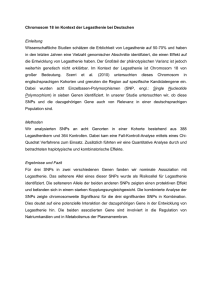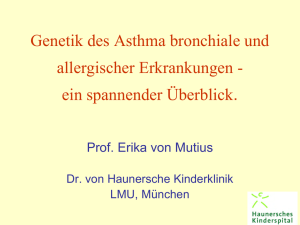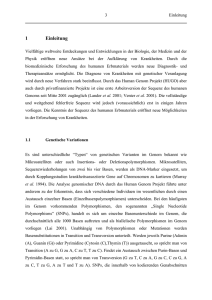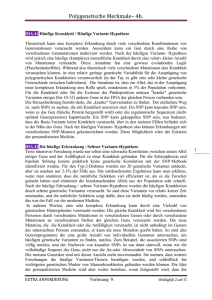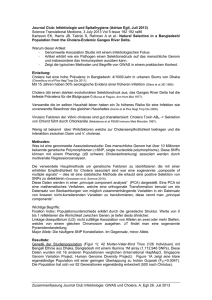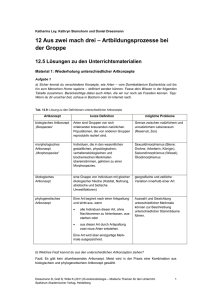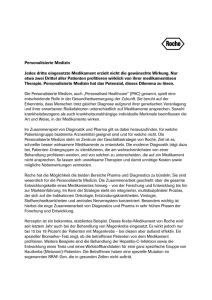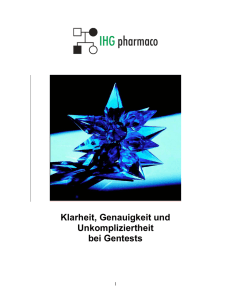Info_Personalisierte..
Werbung
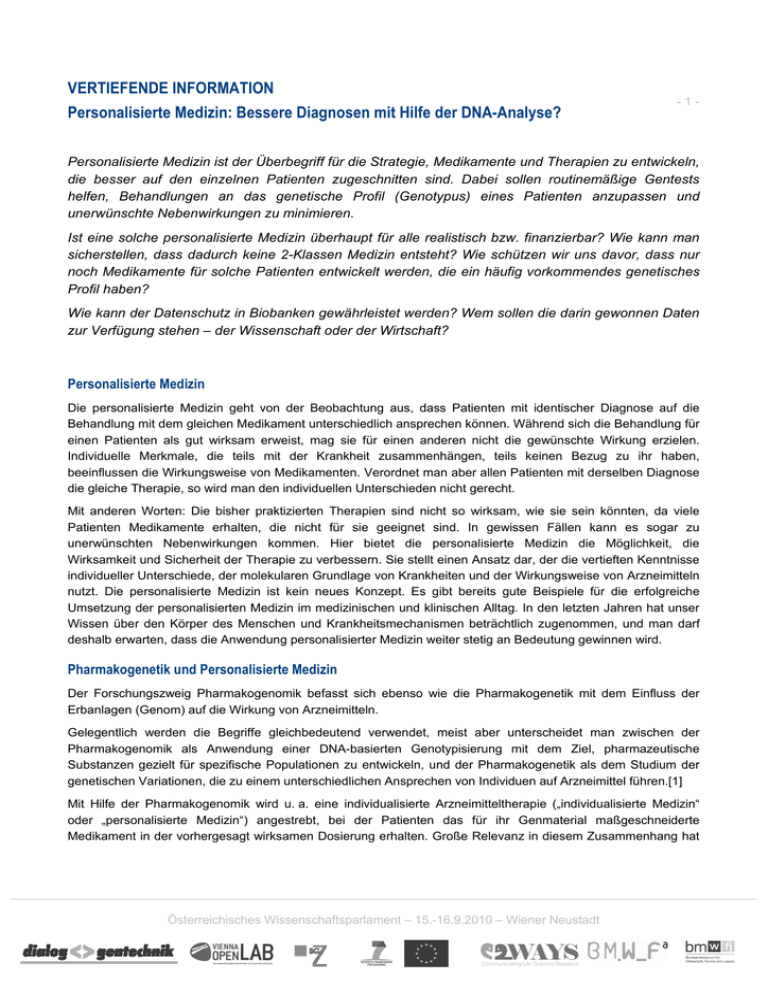
VERTIEFENDE INFORMATION Personalisierte Medizin: Bessere Diagnosen mit Hilfe der DNA-Analyse? -1- Personalisierte Medizin ist der Überbegriff für die Strategie, Medikamente und Therapien zu entwickeln, die besser auf den einzelnen Patienten zugeschnitten sind. Dabei sollen routinemäßige Gentests helfen, Behandlungen an das genetische Profil (Genotypus) eines Patienten anzupassen und unerwünschte Nebenwirkungen zu minimieren. Ist eine solche personalisierte Medizin überhaupt für alle realistisch bzw. finanzierbar? Wie kann man sicherstellen, dass dadurch keine 2-Klassen Medizin entsteht? Wie schützen wir uns davor, dass nur noch Medikamente für solche Patienten entwickelt werden, die ein häufig vorkommendes genetisches Profil haben? Wie kann der Datenschutz in Biobanken gewährleistet werden? Wem sollen die darin gewonnen Daten zur Verfügung stehen – der Wissenschaft oder der Wirtschaft? Personalisierte Medizin Die personalisierte Medizin geht von der Beobachtung aus, dass Patienten mit identischer Diagnose auf die Behandlung mit dem gleichen Medikament unterschiedlich ansprechen können. Während sich die Behandlung für einen Patienten als gut wirksam erweist, mag sie für einen anderen nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Individuelle Merkmale, die teils mit der Krankheit zusammenhängen, teils keinen Bezug zu ihr haben, beeinflussen die Wirkungsweise von Medikamenten. Verordnet man aber allen Patienten mit derselben Diagnose die gleiche Therapie, so wird man den individuellen Unterschieden nicht gerecht. Mit anderen Worten: Die bisher praktizierten Therapien sind nicht so wirksam, wie sie sein könnten, da viele Patienten Medikamente erhalten, die nicht für sie geeignet sind. In gewissen Fällen kann es sogar zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen. Hier bietet die personalisierte Medizin die Möglichkeit, die Wirksamkeit und Sicherheit der Therapie zu verbessern. Sie stellt einen Ansatz dar, der die vertieften Kenntnisse individueller Unterschiede, der molekularen Grundlage von Krankheiten und der Wirkungsweise von Arzneimitteln nutzt. Die personalisierte Medizin ist kein neues Konzept. Es gibt bereits gute Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung der personalisierten Medizin im medizinischen und klinischen Alltag. In den letzten Jahren hat unser Wissen über den Körper des Menschen und Krankheitsmechanismen beträchtlich zugenommen, und man darf deshalb erwarten, dass die Anwendung personalisierter Medizin weiter stetig an Bedeutung gewinnen wird. Pharmakogenetik und Personalisierte Medizin Der Forschungszweig Pharmakogenomik befasst sich ebenso wie die Pharmakogenetik mit dem Einfluss der Erbanlagen (Genom) auf die Wirkung von Arzneimitteln. Gelegentlich werden die Begriffe gleichbedeutend verwendet, meist aber unterscheidet man zwischen der Pharmakogenomik als Anwendung einer DNA-basierten Genotypisierung mit dem Ziel, pharmazeutische Substanzen gezielt für spezifische Populationen zu entwickeln, und der Pharmakogenetik als dem Studium der genetischen Variationen, die zu einem unterschiedlichen Ansprechen von Individuen auf Arzneimittel führen.[1] Mit Hilfe der Pharmakogenomik wird u. a. eine individualisierte Arzneimitteltherapie („individualisierte Medizin“ oder „personalisierte Medizin“) angestrebt, bei der Patienten das für ihr Genmaterial maßgeschneiderte Medikament in der vorhergesagt wirksamen Dosierung erhalten. Große Relevanz in diesem Zusammenhang hat Österreichisches Wissenschaftsparlament – 15.-16.9.2010 – Wiener Neustadt VERTIEFENDE INFORMATION Personalisierte Medizin: Bessere Diagnosen mit Hilfe der DNA-Analyse? -2- der Genotyp des Patienten. Der Abbau von Medikamenten kann beschleunigt, verlangsamt oder verhindert werden: Es kann auch zum Nichtwirken des Medikaments oder, noch schlimmer, zu Nebenwirkungen kommen, die im ärgsten Fall den Tod des Patienten verursachen können. Einer Schätzung nach sterben in Deutschland jährlich etwa 17.000 Menschen wegen solcher Nebenwirkungen. Der Ansatz der Pharmakogenomik birgt aber auch ethische und rechtliche Probleme hinsichtlich des Umgangs mit belastenden genetischen Informationen und mit dem Datenschutz. Wie ist es möglich, dass zwei Menschen mit der gleichen Krankheit unterschiedlich auf die Behandlung mit dem demselben Medikament reagieren? Vergleicht man das Erbgut zweier Menschen, zum Beispiel das Erbgut einer Schülerin und ihres Banknachbarn, so wird man feststellen, dass sich die beiden Genome an etwa 30 bis 60 Millionen Basenpaaren, den «Buchstaben» des Erbguts, unterscheiden (einzige Ausnahme: der Banknachbar ist zugleich der eineiige Zwilling). Das entspricht etwa 1 bis 2 Prozent des gesamten Erbguts. Noch vor fünf Jahren meinten Wissenschafter, dass sich zwei Menschen nur etwa zu 0,1 Prozent genetisch voneinander unterscheiden. Einzelne Unterschiede in der Buchstabenabfolge der DNA-Sequenz bezeichnen Forscher als Single Nucleotide Polymorphism, kurz SNP (sprich «Snips»). Wo die Schülerin zum Beispiel ein Adenosin in ihrem Erbgut trägt, hat ihr Nachbar vielleicht ein Thymin. Diesen Unterschied merkt man in der Regel überhaupt nicht. Er kann aber in einzelnen Fällen grosse Auswirkungen haben, denn falls diese DNA-Sequenz abgelesen wird und ein Protein entsteht, dann könnte dieses Protein bei der Schülerin und beim Banknachbarn unterschiedlich aussehen und auch unterschiedlich wirken. Ist dieses Protein zum Beispiel am Abbau eines Medikaments beteiligt, so könnte das bedeuten, dass die beiden Personen ein bestimmtes Medikament unterschiedlich verarbeiten. Nun stellen Sie sich vor, die Schülerin und ihr Banknachbar würden an der gleichen Krankheit erkranken, zum Beispiel Krebs. Beide würden mit demselben Medikament behandelt, dann müssten doch beide vom Medikament gleich gut profitieren, oder? In der Realität kommt es aber manchmal vor, dass die gleichen Medikamente der einen Person helfen, der anderen aber nicht. Lange wussten die Ärzte nicht, warum das so ist. Heute ist klar: Einerseits liegt es an den oben erwähnten genetischen Unterschieden im Erbgut, den SNPs (siehe Grafik 1). Sie sind aber nur ein Grund für dieses Phänomen. Auch viele andere Faktoren können einen Einfluss haben, zum Beispiel: Umweltfaktoren (z.B.: Erkrankungen, die eine Person bereits durchgemacht hat/ Tabakkonsum/…) oder biologische Faktoren (z.B.: Alter, Geschlecht,…) Österreichisches Wissenschaftsparlament – 15.-16.9.2010 – Wiener Neustadt VERTIEFENDE INFORMATION Personalisierte Medizin: Bessere Diagnosen mit Hilfe der DNA-Analyse? -3- Was genau ist ein SNP (Single Nucleotide Polymorphism)? SNPs und Pharmakogenetik: Wie können SNPs die Medikamentenwirkung beeinflussen? Der andere große Bereich, in dem SNPs für die Medizin eine Rolle spielen, ist die Pharmakogenetik– also der genetisch bedingte Umgang des Körpers mit Arzneimitteln. Hier können Genvarianten auf verschiedenen Wegen in die Wirkung eines Medikaments eingreifen, zum Beispiel: • Absorption. Schon die Aufnahme eines Wirkstoffs in den Körper kann gestört sein, was die Wirkung des entsprechenden Medikaments einschränkt. • Aktivierung. Viele Wirkstoffe müssen vom Körper erst in ihre wirksame Form überführt werden, etwa durch Abtrennen einer molekularen Schutzkappe. Die Funktion der dazu erforderlichen Enzyme kann durch SNPs im zugehörigen Gen begrenzt werden. • Verteilung. Damit ein Arzneimittel richtig wirkt, muss es in ausreichender Konzentration an seinen Zielort gelangen. Viele Proteine sind an dem Transport dorthin beteiligt, und entsprechend können SNPs die Verteilung stark beeinflussen. In zu großer Menge am falschen Ort kann ein Wirkstoff auch unerwünschte Nebenwirkungen auslösen. • Abbau und Ausscheidung. Wie beim Beispiel der P450-Enzymfamilie werden Fremdstoffe im Körper oft umgebaut, um sie ausscheiden zu können. Geschieht das zu schnell, ist die Wirksamkeit des betroffenen Medikaments eingeschränkt; geht der Abbau zu langsam vor sich, bleibt der Wirkstoff zu lange im Körper und die Gefahr unerwünschter Nebenwirkungen steigt; darüber hinaus kann durch den Umbau ein an sich harmloses Molekül gefährliche Eigenschaften gewinnen und zum Beispiel Krebs fördern. Österreichisches Wissenschaftsparlament – 15.-16.9.2010 – Wiener Neustadt VERTIEFENDE INFORMATION Personalisierte Medizin: Bessere Diagnosen mit Hilfe der DNA-Analyse? • -4- Molekulares Ziel. Finden sich im Gen für das Ziel eines Medikaments SNPs, können diese direkt in die Wechselwirkung zwischen Wirkstoff und Target eingreifen. Studien und Zulassung Bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe sind SNPs daher auf allen Ebenen wichtig: von der Erforschung der molekularen Grundlagen einer Krankheit über die Suche nach neuen Targets und ihre Bewertung bis hin zur klinischen Erprobung und Zulassung des neuen Medikaments. Gerade in den letzten beiden Fällen zeigt unser Wissen über die Verteilung und die Wirkung von SNPs schon jetzt deutliche Auswirkungen. So wird zum Beispiel die Tatsache, dass manche Menschen bestimmte Medikamente langsamer abbauen als andere, zum Teil schon heute in der Erprobungsphase neuer Wirkstoffe berücksichtigt. Das wird durch das Wissen über die Verteilungen und Auswirkungen von SNPs vermutlich in Zukunft gezielter berücksichtigt werden. Noch weiter gehen erste Ansätze zur Entwicklung von Medikamenten, die speziell für bestimmte Patientengruppen geeignet sind. Ist von vorneherein bekannt, dass ein Wirkstoff nur Trägern einer bestimmten Genvariante hilft, ist es möglich, das entsprechende Medikament auch an dieser Zielgruppe spezifisch zu testen. Das setzt allerdings voraus, dass es einfache und schnelle Methoden gibt, die Genvariante in den Patienten zu erkennen. Auf ähnliche Weise können auch Unverträglichkeiten und gefährliche Nebenwirkungen vermieden werden: Sind die dafür verantwortlichen SNPs bekannt, kann man die Patienten darauf untersuchen und gegebenenfalls auf andere, für die Betroffenen besser geeignete Medikamente ausweichen bzw. die Dosis entsprechend anpassen. In diesem Fall führt die Forschung an SNPs nicht zu neuen Therapien, sondern zu diagnostischen Möglichkeiten, mit deren Hilfe man bestehende Angebote gezielter und sicherer anwenden kann. Neu entdeckte SNPs können daher durchaus bereits für bestehende Therapien und für Medikamente im Zulassungsverfahren wichtig sein. Vor allem können sie Probleme erklären, die beim Umgang mit einem Wirkstoff oder bei seiner Erprobung aufgetreten sind – seien dies Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten oder Wirksamkeitsschwankungen. Hier bieten die SNPs die Möglichkeit, diese Probleme vorauszusehen und zu vermeiden. Zugleich können sie Wege aufzeigen, mit denen solche Wirkstoffe verbessert werden können. Und falls in einem Targetgen keine relevanten SNPs gefunden werden, ist das immerhin ein gutes Argument für die Zulassung und den Verkauf des entsprechenden Medikaments. Methoden der SNP-Forschung Die vielen in den letzten Jahren (fort-)entwickelten Methoden haben eine systematische SNP-Forschung erst möglich gemacht. Vor allem die Automatisierung und Miniaturisierung erlauben es heute, in einem Schritt Tausende von Experimenten durchzuführen, für die noch vor wenigen Jahrzehnten Großforschungseinrichtungen Jahre gebraucht hätten. Bei der Auswertung der riesigen Datenmengen, die auf diese Weise zusammengetragen werden, hilft heute ein eigener Wissenschaftszweig, die Bioinformatik. Drei Stufen der Forschung kann man unterscheiden: 1. Suche nach SNPs Ein wichtiger Teil der Suche nach SNPs findet heute in silico, das heißt am Computer statt. Die Ergebnisse aus Laborexperimenten werden in Datenbanken gespeichert, welche anschließend am Rechner verglichen und nach SNPs durchsucht werden. Spezielle Computerprogramme wie das Programm „Polyphred“ helfen bei der Suche und sorgen dafür, SNPs von Sequenzierfehlern unterscheiden zu können. Weil einzelne SNPs jedoch sehr selten Österreichisches Wissenschaftsparlament – 15.-16.9.2010 – Wiener Neustadt VERTIEFENDE INFORMATION Personalisierte Medizin: Bessere Diagnosen mit Hilfe der DNA-Analyse? -5- sein können, muss auch weiterhin das Erbgut vieler zusätzlicher Freiwilliger sequenziert werden, um weitere Daten zu erhalten. Die Daten werden anonymisiert. 2. Bewertung von SNPs Auch bei der Bewertung von SNPs helfen Datenbanken und spezielle Programme, um die Variationen mit Genen in Verbindung zu bringen. Für die Suche nach Zusammenhängen zwischen SNPs und Krankheiten bzw. pharmakogenetischen Problemen sind Assoziationsstudien unverzichtbar. Dabei wird untersucht, ob bestimmte SNPs immer bei Menschen mit bestimmten Störungen zu finden sind. Eine weitere wichtige Methode in diesem Zusammenhang sind In-vitro-Assays, mit denen die Eigenschaften von Proteinen studiert werden. Auf diese Weise lässt sich schnell erkennen, ob ein SNP in einem Gen zu einer veränderten Funktion des Genproduktes führt. (SIEHE BIOBANKEN) 3. SNP-Tests für Patienten Das letzte Glied in der Kette von Anwendungen der SNP Forschung sind Tests, die solche Variationen in Patienten aufspüren helfen. Hier werden zurzeit verschiedene Verfahren entwickelt, wobei noch nicht feststeht, welche davon wirtschaftlich und wissenschaftlich sinnvoll sind und sich durchsetzen werden. Mit einem so genannten Line Array können zum Beispiel 60 Varianten auf einer Membran erfasst werden. Weitaus größere Mengen bewältigt da schon ein SNP-Chip: Mehrere Tausend SNPs lassen sich auf einem DNS-Chip unterbringen und gleichzeitig testen (SIEHE GENTESTS). Eine andere Methode untersucht SNP-spezifische Oligonukleotide mit MALDI-TOF. Daneben gibt es eine Fülle anderer weiterer Ansätze, die sich verschiedener Techniken wie der PCR oder der Nanotechnologie bedienen. SNP und Patente Das internationale Patentrecht erlaubt es, dass SNPs patentiert werden. Die pharmazeutische Industrie hat durch die Gründung des SNP Konsortiums vorzeitig versucht, einer Patentierung von SNPs entgegenzuwirken. The SNP Consortium Obwohl also die Forschung an SNPs erst seit relativ kurzer Zeit im großen Maßstab möglich ist, ist inzwischen ein großer Teil dieser Variationen im menschlichen Genom bekannt – und das liegt vornehmlich am so genannten SNP-Konsortium. Unter dem Namen The SNP Consortium (TSC) haben sich 1999 nach dem Vorbild des HumanGenom-Projektes zehn der bedeutendsten pharmazeutischen Unternehmen, der britische Wellcome Trust als weltgrößte Forschungsgesellschaft und fünf führende Forschungseinrichtungen zusammengetan, um eine umfassende SNP-Karte des menschlichen Genoms zu erstellen. Ziel des TSC war es, innerhalb zweier Jahre insgesamt 300 000 SNPs im menschlichen Genom zu identifizieren und mindestens die Hälfte davon auch zu «mappen», also ihre Lage im Genom zumindest annähernd festzustellen. Über 50 Millionen US-Dollar stellten die Partner dem SNPKonsortium dafür anfangs zur Verfügung, wobei die Ergebnisse sofort veröffentlicht werden und der Wissenschaft frei zur Verfügung stehen sollten – ein in dieser Größenordnung bespielloses privates Projekt. Tatsächlich wurden die identifizierten SNPs erst dann veröffentlicht, wenn auch ihre Position im Genom ermittelt war, um Patente darauf von vornherein auszuschließen. Die entstehende Datenbank – eine umfassende SNPKarte des Menschen – steht heute jedermann jederzeit kostenlos und ohne Patentschutz zur Verfügung. Im November 2001 veröffentlichte das SNP-Konsortium die letzten von ihm gesammelten Daten: 1,7 Millionen SNPs Österreichisches Wissenschaftsparlament – 15.-16.9.2010 – Wiener Neustadt VERTIEFENDE INFORMATION Personalisierte Medizin: Bessere Diagnosen mit Hilfe der DNA-Analyse? -6- haben die Forscher insgesamt gefunden, 1,5 Millionen davon gemappt und 1,3 Millionen eine einzelne Position in der (noch vorläufigen) Sequenz des menschlichen Genoms zuweisen können. Biobanken Als Biobank bezeichnet man die Verbindung einer (oder mehrerer) geordneten stofflichen Sammlung(en) von z. B. Körperflüssigkeiten oder Gewebeproben mit den zugeordneten, in Datenbanken verwalteten Daten. Diese Daten werden in Probengewinnungsdaten (Name, Geschlecht, Alter ...) und Analysedaten unterschieden. In Biobanken werden große Mengen von biologischem Material wie beispielsweise DNA-, Blut- oder Gewebeproben zusammen mit Hintergrundinformationen (z. B. Krankengeschichte oder Lebensumstände) der Spender gespeichert. Grundsätzlich unterscheidet man Populations-basierte von Krankheits-spezifischen Biobanken. Die ersteren werden für meist großangelegte Populationsstudien aufgelegt und es werden in der Regel Proben von Gesunden gesammelt. Zweitere sind Biobanken typisch für Krankenhäuser, wo Proben von Erkrankten zur Diagnose, Therapie und Forschung gesammelt werden. Sie erlauben so einen aussagekräftigen Vergleich verschiedener Individuen hinsichtlich ihres genetischen Materials, ihrer unterschiedlichen Krankheiten, ihrer Krankheitsverläufe und beispielsweise auch dem Einfluss von Umweltfaktoren. Auf dieser Basis ermöglichen sie eine krankheitsbezogene Genomforschung, die neue Kenntnisse über die Entstehung und den Verlauf von Krankheiten liefert und zur Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze oder wirkungsvollerer Methoden der Prävention führen kann. Prägendes Merkmal der meisten Biobanken ist dabei, dass sie als Forschungsinfrastrukturen für künftige wechselnde Forschungsvorhaben dienen sollen, deren Forschungszwecke zum Zeitpunkt der Zusammenstellung der Biobank noch weitestgehend unbestimmt sind. Die zur Zeit größte Biobank mit öffentlichem Zugang in Europa liegt in Graz an der Medizinischen Universität [2] mit rund 4,5 Mio Proben. In Österreich hat die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt einen Bericht und Empfehlungen zu Biobanken veröffentlicht. Praxisbeispiele personalisierter Medizin: Onkologie Brustkrebs: Der Nachweis eines Wachstumsfaktors (HER2) bei Brustkrebs mit spezifischen Tests erlaubt es, Patienten zu identifizieren, die voraussichtlich auf eine Therapie mit Herceptin ansprechen – einem Medikament, das gezielt auf diesen Wachstumsfaktor wirkt. Virologie HIV: Hoch spezifische Tests ermöglichen es dem Arzt, den Therapieerfolg während der Behandlung mit einem antiretroviralen Medikament zu überwachen, Resistenzen zu erkennen und die Behandlung entsprechend anzupassen. Österreichisches Wissenschaftsparlament – 15.-16.9.2010 – Wiener Neustadt VERTIEFENDE INFORMATION Personalisierte Medizin: Bessere Diagnosen mit Hilfe der DNA-Analyse? -7- Stoffwechsel Osteoporose: Die Überwachung der Wirkung von antiresorptiven Medikamenten hilft Ärzten dabei, die Behandlung den spezifischen Bedürfnissen der Patienten anzupassen. Metabolisierung von Medikamenten Ein spezieller CYP450 Test analysiert Variationen in zwei Genen, die bei der Verstoffwechselung von vielen häufig verordneten Medikamenten eine wichtige Rolle spielen. Dieser Test ist weltweit das erste kommerzielle pharmakogenomische Produkt zur Vorhersage des individuellen Ansprechens auf Medikamente. Strittige Fragen Um die Vielfalt der Faktoren zu ordnen, die die Wirkung von Arzneimitteln beeinflussen, sind gross angelegte Studien und umfangreiche Datensätze aus genetischem Material erforderlich. Als Quelle für solche genetischen Daten kommen so genannte Biobanken in Frage. An ihnen hat sich eine von zahlreichen Kontroversen rund um die Pharmakogenetik entzündet: Auf welche Weise sollten die in diesen Banken eingelagerten Daten verschlüsselt werden, um ihre missbräuchliche Verwendung zu verhindern und die Persönlichkeitsrechte der Spender zu garantieren, ohne deswegen die Forschung allzu stark einzuschränken? Wem gehören die Blut- und Gewebeproben, die in diesen Banken gesammelt werden? Und wie soll mit Informationen umgegangen werden, die nicht nur Rückschlüsse über therapeutische Dispositionen zulassen, sondern auch über die Veranlagung zu Erbkrankheiten? Pharmakogenetische Medikamente könnten auch die Beziehung zwischen den Kranken und den sie behandelnden Ärztinnen und Ärzten verändern. Ist zu befürchten, dass Ärzte aufgrund pharmakogenetischer Tests die Persönlichkeit ihrer Patienten auf deren genetische Identität reduzieren und soziale oder lebensgeschichtliche Faktoren in der Behandlung nicht mehr berücksichtigen? Besteht die Gefahr, dass Kranke mit ungünstigem genetischem Profil zunehmend von Therapien ausgeschlossen werden? Ist damit zu rechnen, dass sich der Arzneimittelmarkt zunehmend in Medikamente aufsplittert, die auf spezielle Subgruppen in der Bevölkerung zugeschnittensind? Was hätte das für die pharmazeutische Industrie für Folgen? Österreichisches Wissenschaftsparlament – 15.-16.9.2010 – Wiener Neustadt