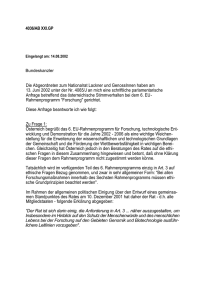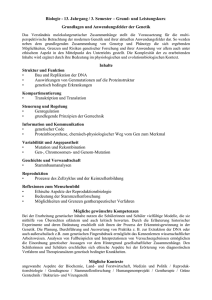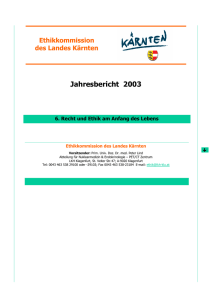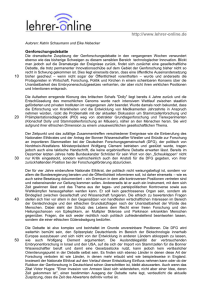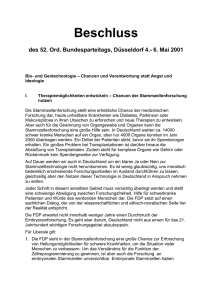Partizipation und Biopolitik: Thesenpapier
Werbung

Partizipation und Biopolitik – Eine Analyse des Referendums zum Schweizer Stammzellenforschungsgesetz THESENPAPIER ZUM REFERAT AM FORUM BIOETHIK IN BERLIN AM 18. MAI 2005 Von Claude Longchamp, Politikwissenschafter und Institutsleiter gfs.bern Bern, den 17. Mai 2005 Copyright1by gfs.bern Stammzellenforschung als politisches Thema Die Wissenschaft betrachtet die Forschung an embryonalen Stammzellen als wichtiges Gebiet. Man erhofft sich durch die Forschung umfassende Erkenntnisse betreffend der Therapie von beispielsweise Parkinson und Multiple Sklerose. Der Stammzellenforschung begegnet man weltweit jedoch mit Bedenken. Die Frage ist gestellt: Reicht die Motivation, Therapien gegen unheilbare Krankheiten zu finden, aus, um aufkommendes Leben zu zerstören? Die weltumspannende Ethikdiskussion über Stammzellenforschung erhielt aus skeptischer Sicht Auftrieb, als in den USA die Forschung an embryonalen Stammzellen zum Wahlkampfthema avancierte. In diesem Prozess hat die Schweiz 2003 einen parlamentarischen Entscheid für ein neues Stammzellenforschungsgesetz auf liberaler Grundlage gefällt. Dieses unterlag 2004 einer Referendumsabstimmung. Das Ergebnis war zugunsten der Vorlage, was die Möglichkeit eröffnet darüber nachzudenken, wie die Bevölkerung in moralisch-ethischen Grenzfragen entscheidet. Für und wider direktdemokratische Entscheidungen Bedenken gegen direktdemokratische Entscheidungen setzen in der Regel bei den unvollständigen Informationen der Bürgerschaft an, denn gehen von einer generellen Überforderung der EntscheiderInnen aus. Sie bemängeln auch, dass die Entscheidungen nicht durch alle getroffen werden, sondern nur durch die Bürger und Bürgerinnen, die sich an Volksentscheidungen beteiligen. Auf der Systemebene wird die Schwächung von politischen Parteien kritisiert, und es wird eine Abwertung von Wahlen beklagt. Die politische Philosophie des politischen Systems der Schweiz stellt dem eine Reihe von Gegenargumenten gegenüber: Das Kollektiv fällt als Ganzes in der Regel weise Entscheidungen, die, weil sie aus Volksabstimmungen hervorgehen, auch breiter akzeptiert werden als umstrittene parlamentarische Entscheidungen. Die Relativierung des Parteienstaates fördert den pluralistischen Diskurs, der von Interessengruppen getragen wird. Diese können sich direkter an die Bürgerschaft wenden. Der Sachdiskurs wird zudem potenziell erweitert und erleichtert, wenn die Parteien kein Interpretationsmonopol mehr haben. Die Schweiz kennt zwei wesentliche Instrumente der direkten Demokratie: die Volksinitiative und das Referendum. Die Volksinitiative beinhaltet die Möglichkeiten, dass Stimmberechtigte einen verbindlichen Rechtsvorschlag einbringen, wobei es ein parlamentarischer Entscheid ist, ob der Vorschlag auf Verfassungs- oder Gesetzesstufe geregelt werden soll. Der Vorschlag ist angenommen, wenn er in einer Volksabstimmung eine Mehrheit hat. Das Referendum wiederum ist eine Nachkontrolle parlamentarischer Entscheidungen, die auf Verfassungs- oder Gesetzesebene erfolgen kann. Für Gesetzesänderungen braucht es nur eine Zustimmung durch die Mehrheit der stimmenden Bürger und Bürgerinnen. Die Politikwissenschaft hebt eine wesentliche Konsequenz der direkten Demokratie hervor: die höhere Responsivität parlamentarischer Entscheidungen gegenüber gesellschaftlichen Strömungen. Massgeblich hierfür sind Vetogruppen, die eine parlamentari2 sche Entscheidung in der Volksentscheidung zu Fall bringen können; sie können mit der Drohung des Referendums Parlamentsentscheidungen stärker beeinflussen als es ihre parlamentarische Macht ausdrückt. Das hat zur Folge, dass Parlamentsentscheidungen stärker als in Regierungs-/Oppositionssystemen gegen Einwände von Vetogruppen abgesichert werden. Auf den Prozess der Gesetzgebung hat dies verschiedene Konsequenzen: • • • Erstens, partizipative Elemente werden schon in der Vorbereitungsphase integriert; zweitens, die parlamentarische Entscheidung wird durch verstärkte Konsenssuche geprägt, und drittens besteht ein erhöhter Erklärungsbedarf von Parlamentsentscheidungen durch Behörden, Parteien und Interessengruppen. Dies wirkt sich vorteilhaft auf den Gesetzgebungsprozess aus. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich Regierung und Parlament in Referendumsabstimmungen durchsetzen. Neuralgische Themen sind vor allem die Aussenpolitik, während in der Innenpolitik politisch eingemittete Projekte, die Bevölkerungsprobleme regeln in der Regel eine Mehrheit finden. Die Entscheidung über das Stammzellenforschungsgesetz in der Schweiz Am 28. November 2004 wurde das neue Gesetz zur Stammzellenforschung mit 66,4 Prozent der Stimmenden angenommen. Der Entscheid war alles andere als ein Zufallsentscheid. Er steht in einer Reihe von fünf Volksabstimmungen zu ähnlichen Themen, die seit 1992 stattgefunden haben und alle im Sinne liberaler Regelungen ausgegangen sind. Die Abstimmung 2004 kam zustande, weil drei Komitees zusammen die nötigen Unterschriften gesammelt hatten. Die drei Komitees stammten aus dem religiös-fundamentalistischen, aus dem wertkonservativen und dem feministischen Lager. Befürwortet wurde das neue Gesetz von allen Regierungsparteien. Das neue Gesetz zur Stammzellenforschung erlaubt die Verwendung überzähliger Embryonen für die Forschung mit therapeutischem Ziel. Verboten bleiben jedoch das therapeutische Klonen, die Erzeugung von Embryonen zu Forschungszwecken und die Kommerzialisierung von Embryonen oder Stammzellen. Man kann es als liberales Forschungsgesetz kennzeichnen, welche den wissenschaftlichen Fortschritt geregelt zulassen will. Die Analyse der Werthaltungen, der Botschaften und des Konfliktmusters Eine erste Analyse der Werte, die zu diesem Ergebnis führten, zeigt, dass nicht nur ein Sach-, sondern auch ein Wertentscheid gefällt worden ist: Unterstützt wurde eine offene, moderne Schweiz, welche marktwirtschaftliche und materialistische Werte bejaht. Die Kritik nährte sich aus gegenteiligen Werthaltungen: der Präferenz für postmaterialis3 tische Werte, für staatswirtschaftliche Kontrolle, für eine traditionelle und nach aussen abgeschlossene Schweiz. Die Kombination der befürwortenden Werte legt nahe, dass es nur geringe regionale Gegensätze gab, was einer Zustimmung förderlich ist. Der parteipolitische Konflikt blieb in diesem Fall augenfällig beschränkt. Die Anhängerschaften der liberalen und linken Parteien votierten klar mehrheitlich für das Stammzellenforschungsgesetz. Die Anhängerschaften der konservativen Parteien waren gespaltener; nur bei der (mehrheitlich katholischen) christlich-demokratische Volkspartei resultiert an der Basis schliesslich eine mehrheitliche Verwerfung des Gesetzes. Bei der (mehrheitlich protestantischen) Schweizerischen Volkspartei wirkte sich dies jedoch nicht gleich stark aus. Wenn sich hier, aber nur hier, ein Elite/Basis-Gegensatz eröffnete, hat dies mit konfessionell belegten Argumenten zu tun. Sie wirkten auf Personen katholischen Glaubens vor allem dann, wenn diese in einem geschlossen konservativen und katholischen Milieu leben. Unter dieser Bedingung blieb die Akzeptanz des neuen Gesetzes gering. Schon bei Katholiken in konfessionell gemischten Milieus bauten sich entsprechende Bedenken jedoch ab, und waren für Protestanten ganz untypisch. Weitere Elite/Basis-Konflikte, etwa auf linker Seite, bleiben dagegen weitgehend aus. Die Ja-Seite konnte sich in ihrer Kommunikation auf verschiedene Botschaften stützen, die verstanden und mehrheitlich akzeptiert wurden: Es sind dies die Hoffnung auf neue Lösungen für unheilbare Krankheiten, der Bejahung des medizinischen Fortschrittes generell und die Angst vor wirtschaftlichen Schäden für den Forschungsplatz Schweiz. Unsicher war die Bevölkerung jedoch, ob die vom Parlament getroffenen rechtlichen Auflagen genügend seien; davon musste die Mehrheit im Abstimmungskampf zuerst überzeugt werden. Gegen die Vorlagen sprachen die erwarteten Kosten für das Gesundheitswesen; erwartet wurde auch, dass ein starker Schutz für überzählige Embryonen entwickelt werde. Hinzu kamen Klagen, das Gesetz öffne dem Klonen Tür und Tor. Im Einzelfall musste jedoch auch hier eine Mehrheit davon überzeugt werden, dass die Annahmen nicht stimmen. Die Nachanalyse der Wirkungen zeigte, dass die Hoffnungen, für unheilbare Krankheiten neue Wege zu finden, am meisten zur Volksentscheidung beitrugen. Zweitens wirkte die Angst über Nachteile für den Forschungsplatz Schweiz. Für die Gegnerschaft wirkte namentlich der Wunsch nach einem absoluten Schutz von Embryonen. Beschränkt wirksam waren die Ängste vor Klonen und Kosten. Die Wirkung der Auflagen, die das Parlament gemacht hatte, blieb in der Volksabstimmung deutlich zurück. Die Meinungsbildung war nicht von Beginn weg eindeutig Pro. Vor dem Abstimmungskampf war nur eine relative Mehrheit für die Zulassung der Stammzellenforschung in der Schweiz. Dank offensiver Kommunikation des befürwortenden Lagers des Themas gelang es jedoch, unschlüssige Menschen von den Pro Argumenten zu überzeugen und Bedenken zu zerstreuen. Wiederum waren es die kommunizierten medizinischen Argumente, die hierfür den Entscheid gaben. Am Abstimmungstag befürwortete eine knappe absolute Mehrheit die Stammzellenforschung in der Schweiz ausdrücklich. Entsprechend nahmen die positiven Stimmabsichten vor allem in der ersten Phase des Abstimmungskampfes zu; 3 Wochen vor der Entscheidung war eine Mehrheit dafür, und die Unschlüssigen verteilten sich schliesslich auf beide Seiten. 4 Die Entscheidung fiel am Schluss sogar verstärkt positiv aus, weil sich nicht alle Stimmberechtigten beteiligten. Die relativ tiefe Stimmbeteiligung begünstigte die Zustimmung. Die Teilnehmenden sahen die persönliche Bedeutung der Entscheidung über dem Mittel für gegeben an. Sie bekundeten in mittlerem Masse Entscheidungsschwierigkeiten. Unter diesen Bedingungen ist Kommunikation vor einer Abstimmung sinnvoll, aber auch nötig. Kurze Bilanz Die systematische Analyse von Volksentscheidungen zeigt, dass Ergebnisse von Volksabstimmungen nicht ein für alle Mal feststehen. Vielmehr sind sie das Produkt aus der Vorlage, dem Konfliktmuster in der meinungsbildenden Elite, der politischen Kultur, dem politischen Klima, den thematischen Prädispositionen und dem Abstimmungskampf. Die persönliche Betroffenheit durch das Thema war bei den Entscheiden mehrheitlich gegeben; die Entscheidungsschwierigkeiten waren jedoch eher überdurchschnittlich. Es war zuerst eine symbolische Entscheidung über Werte, dann eine über die Vorlage. Man kann die These vertreten, dass die Schweizer Stimmberechtigten vor allem wegen den medizinischen Erwartungen für die Stammzellenforschung gestimmt haben. Sie haben diesen Aspekt der Debatte höher bewertet als alle Bedenken gegenüber der Stammzellenforschung. Was der Menschheit einen Nutzen bringen kann, darf erforscht werden. Darin liegt auch die ethische Begründung der politischen Entscheidung. Gestärkt wurde sie durch ökonomische Ängste resp. durch eine positive Grundhaltung zum Forschungsplatz Schweiz. Der zentrale Vorteil, der durch Partizipation erreicht wird, ist die Involvierung der Bevölkerung in Fragen der modernen Wissensgesellschaft. Die Kluft wird dadurch nicht vergrössert, sondern verkleinert. Es ist durchaus möglich, komplexe Sachverhalte verständlich zu kommunizieren. Dies wird erleichtert, wenn diese in Beziehung zu generellen Werthaltungen gesetzt werden. Mehr noch: der partizipative Stil in der vor- und nachparlamentarischen Phase hat die Entscheidung nicht verhindert, sondern befördert. Die Glaubwürdigkeit der Kommunikation ist ebenso gestärkt, wenn ein Teil der Opposition vorweg genommen wird. Die Legitimation der Entscheidung ist höher als in parlamentarischen Demokratien. 5