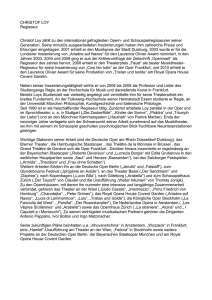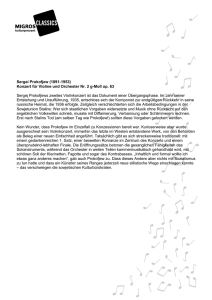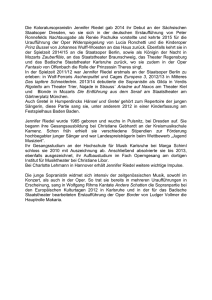PDF-Download - Bayerische Staatsoper
Werbung

Max joseph Max Joseph Bayerische staatsoper bayerische staatsoper 2015–2016 1 #1 Vermessen: Der Mensch D: 6,00 Euro A: 6,20 Euro CH: 8,00 CHF René Pape und Roland Schwab über das Böse – Premiere Mefistofele Evelyn Herlitzius über Dämonen und Freiheit – Premiere Der feurige Engel Donna Leon erforscht Bienen Erleben Sie die neue Kollektion "Glücksgefühle" in Ihrer Wellendorff-Boutique in München, Dienerstraße 18 • Tel. 089 - 21 02 07 90 • www.wellendorff.com neomatik 1st edition: zehn neue NOMOS-Uhren mit einem Automatikwerk der nächsten Generation. Hauchdünn, höchst präzise – jetzt im besten Fachhandel. Und unter nomos-glashuette.com, nomos-store.com EDITORIAL Etwas vermessen: etwas verstehen, beherrschen, urbar machen wollen Sich vermessen: etwas falsch ausmessen, ein falsches Bild gewinnen Tony Oursler, Less-than-perfect, 2014, Courtesy of the Artist and Lisson Gallery Vermessen sein: dem erliegen, was seit der griechischen Antike als Hybris beschrieben wird; das Denken des Menschen, größer zu sein als er ist Max Joseph 1 2015 – 2016 Das Magazin der Bayerischen Staatsoper … und die eigenwillige Tatsache, dass dies im Deutschen durch ein und dasselbe Wort aus­gedrückt wird. Dies wird uns als Thema in der Spielzeit 2015 / 16, die wir mit eben diesem Wort „Vermessen“ überschrieben haben, beschäftigen. Die Stücke unserer Neuproduktionen geben dies vor: Vermessen mag schon das Vorhaben des Komponisten Arrigo Boito gewesen sein, beide Teile von Goethes Faust in einer Oper zu erzählen. Sein Interesse galt ­indes hauptsächlich der Figur des Mephisto als Verkörperung des Bösen. Er, nicht Faust, beherrscht die Oper und fasziniert, weil er eine Seite in uns zeigt, die der Mensch ausklammert und als nicht existent wissen möchte – so formuliert es Bass René Pape, der die Titelpartie in Mefistofele singt, im Gespräch mit Regisseur Roland Schwab. Das Ausklammern von Abgründen lässt sich aktuell auch an der Praxis der großen Social Media-Unternehmen sehen, die allzu verstörende Inhalte entfernen lassen, weil sie vor allem anderen die Profitabilität ihrer Seiten gefährden – abseits jedweder Dis­ kussion um unangemessene, illegale oder fremdenfeindliche Meinungsäußerungen. Ein US-Journalist berichtet in dieser Ausgabe davon, dass dies nicht automatisch ­geschieht, sondern nur, indem eine Armee von Hilfsarbeitern sich diese Inhalte ­ansieht und bewertet. Nicht weniger vermessen das zweite Werk dieser Saison: Im bayerischen Ettal komponiert, thematisiert Sergej Prokofjews Der feurige Engel eine Amour Fou, in der Frau, Mann und Umfeld alle Facetten einer aus den Fugen geratenen Leidenschaft ­heraufbeschwören. Dass die Oper auf einem Roman basiert, in dem der Autor eine ­unerfüllte Liebe verarbeitet, und diese begehrte Frau sich genau zu der Zeit in Paris das Leben nimmt, als Prokofjew dort vergeblich versucht, sein Werk zur Uraufführung zu bringen: vielleicht nicht vermessen, aber mit Sicherheit niemals plan- und vor­aus­ rechenbar. Die Partie der Renata jedenfalls geriet zur Zumutung und ist gerade ­deshalb eine lustvolle Herausforderung für Sopranistin Evelyn Herlitzius, die mit V ­ erve über diese einnehmende Figur spricht. Die Vermessung des Menschen schließlich und die Idee, diesen wie eine ­Ansammlung von Daten zu verstehen und zu analysieren, ist der große Paradigmenwechsel unserer Zeit. Keine Wissenschaft und auch nicht unser Verstand hält mit ihm Schritt. „Wo das Messbare ins Unwägbare umschlägt, ist die Kunst gefordert, dem ­Unmessbaren Ausdruck zu verleihen“, schreibt Anna Mitgutsch in ihrem Essay für diese Ausgabe. Begleiten Sie uns und alle Vermessenheit der Künstler, mit hoffentlich neuen Perspektiven aus dieser MAX JOSEPH-Ausgabe, zu unseren beiden packenden Münchner Erstaufführungen! Nikolaus Bachler, Intendant der Bayerischen Staatsoper Wir, böse? – PREMIERE Bass René Pape und Regisseur Roland Schwab über Arrigo Boitos Mefistofele 44 Prokofjew und Ettal – PREMIERE Sergej Prokofjew komponierte Der feurige Engel in Ettal. Eine Spurensuche von Sophie Becker 49 Südpol – URAUFFÜHRUNG Teil 1 der Bilderreihe zur Uraufführung von Miroslav Srnkas Oper South Pole. Gezeichnet von Viktor Hachmang 60 Wie vermessen sind Sie? Der Psycho-Test gibt Antwort 64 Satanismus oder: Ich mach‘ mir die Welt, wie sie mir gefällt Was Satanismus heutzutage ausmacht. Eine Schilderung von Dagmar Fügmann Drecksarbeit für das Internet Content-Moderatoren prüfen Sex- und Gewaltvideos für Internet-Konzerne. Ein Bericht von Adrian Chen Im Ränkespiel der Macht Das Team des Forschungsprojekts Bayerische Staatsoper 1933 – 1963 präsentiert Fundstücke 78 Die Datenbank der Träume Ein Interview mit Harvard-Professorin Rebecca Lemov über das Datensammeln 84 Voller Vorfreude – PREMIERE Omer Meir Wellber dirigiert Mefistofele, Vladimir Jurowski Der feurige Engel. Die beiden Dirigenten im Porträt 90 Maß genommen Überfällig: die Abmessungen von MAX JOSEPH AGENDA 34 Unterwerfung Hans Neuenfels’ Rede im Rahmen der Unmöglichen Enzyklopädie der Bayerischen Staatsoper 93 Spielplan 102 Die Vermesser Hutmacherin Margarethe Luegmair-Ertl über ihr Handwerk 104 Vorschau Foto Gerhardt Kellermann 22 Inahlt Nur der Mensch zählt Ein Essay über das Vermessen. Von Anna Mitgutsch 70 Spielzeit 2015 – 2016 14 Eine große innere Freiheit – PREMIERE Sopranistin Evelyn Herlitzius über ihr Debüt als Renata in Sergej Prokofjews Der feurige Engel Foto Martina Hemm Ich als Forscher Donna Leon über Bienen Illustration Harriet Lee-Merrion 10 Illustration Viktor Hachmang Das Cover zeigt einen Ausschnitt aus einer Installation des New ­Yorker Medienkünstlers Tony Oursler. Auf sieben fotografierte oder gemalte, raumhohe Gesichter ­projiziert er Augen und Münder und lässt die Werkzeuge biometrischer Vermessung darüber­ flimmern. Er will den Betrachter, wie er sagt, dazu einladen, sich selbst aus anderer Perspektive zu ­sehen, und zwar aus der der Maschinen, die wir vor k ­ urzer Zeit erschaffen haben. Contributors/Impressum 30 Max Joseph 1 Tony Oursler, template / variant / friend / stranger, 2014 8 38 Courtesy of the Artist and Lisson Gallery #1 Vermessen: Der Mensch Editorial Von Nikolaus Bachler Foto Martin Fengel Spielzeit 2015/16 3 Bild Travis K. Schwab Das Magazin der Bayerischen Staatsoper Inahlt Max Joseph 1 Sehen Sie Wasserstoff. In einer Weltpremiere von Linde. Am Anfang stand eine Idee: unsichtbare Gase sichtbar zu machen. Wir haben einen faszinierenden, einzigartigen Ansatz entwickelt. Numerische Grafiken, errechnet aus den spezifischen Stoffeigenschaften der Gase. Mehr unter www.fascinating-gases.com. Wir unterstützen die Bayerische Staatsoper als Spielzeitpartner. Magazin der Bayerischen Staatsoper www.staatsoper.de/maxjoseph Max-Joseph-Platz 2 / 80539 München T 089 – 21 85 10 20 / F 089 – 21 85 10 23 [email protected] www.staatsoper.de Herausgeber Staatsintendant Nikolaus Bachler (V.i.S.d.P.) Redaktionsleitung Maria März Gesamtkoordination Christoph Koch Redaktion Miron Hakenbeck, Rainer Karlitschek, Malte Krasting, Daniel Menne, Julia Schmitt, Heilwig Schwarz-Schütte, Benedikt Stampfli Mitarbeit: Sabine Voß Bildredaktion Yvonne Gebauer Gestaltung Bureau Mirko Borsche Mirko Borsche, Moritz Wiegand, Jean-Pierre Meier, Felix Plachtzik Autoren Sophie Becker, Adrian Chen, Rasmus Cromme, Dominik Frank, Katrin Frühinsfeld, Dagmar Fügmann, Anna Kim, Donna Leon, Christiane Lutz, Anna Mitgutsch, Pascal Morché, Hans Neuenfels, Eva Wlodarek Fotografen & Bildende Künstler Martin Fengel, Viktor Hachmang, Alana Dee Haynes, Martina Hemm, Wilfried Hösl, Gerhardt Kellermann, Harriet Lee-Merrion, Bryan Olson, Tony Oursler, Jon Rafman, James Rieck, Travis K. Schwab, Kurt Simonson Marketing Gabriele Brousek T 089 – 21 85 10 27 / F 089 – 21 85 10 33 [email protected] Anna Kim Seite 78 Bryan Olson Seite 14 Harriet Lee-Merrion Seite 10 Unzählig die offenen Fragen zum alles beherrschenden Thema des Datensammelns. Die Schrifstellerin Anna Kim hat Harvard-Historikerin Rebecca Lemov einige davon gestellt. Anna Kim wurde in Südkorea geboren und lebt heute in Wien. 2012 erschien ihr Roman Anatomie einer Nacht bei Suhrkamp, sie erhielt zahlreiche ­Auszeichnungen wie den European Union Prize for Literature. Derzeit arbeitet sie an einem Roman über den Kalten Krieg in Ostasien. In seinem Studio in ­Charlotte, North Carolina erforscht der Autodidakt Bryan Olson mit seinen Collagen das Universum. Er beginnt jede Arbeit mit der Suche nach alten, modrigen Büchern und leiht sich dort, wie er sagt, eine Art von Nostalgie, die es nur dort zu geben scheint. Seine Collagen bebildern den Essay dieser Ausgabe. Seine Arbeiten erschienen unter anderem in FOUR Magazine oder Wired UK und wurden in Galerien weltweit ausgestellt. Zuerst ihre Illustration des Kusses zwischen Werther und Lotte, dann die ­Darstellung der Regisseurin Christiane Pohle in der letzten Spielzeit und nun die Forschungsobjekte der „Bienenforscherin” Donna Leon: Siehe da, in jeder dieser wunderbaren ­Zeichnungen ist auch ein bisschen Harriet Lee-­Merrion zu sehen. Die britische Künstlerin s­ tudierte Illustration an der Falmouth University in Cornwall und arbeitet heute von Bristol aus für internationale Publikationen. Schlussredaktion Nikolaus Stenitzer Anzeigenleitung Imogen Lenhart T 089 – 21 85 10 06 [email protected] Lithografie MXM Digital Service, München Druck und Herstellung Gotteswinter und Aumaier GmbH, München ISSN 1867-3260 Nachdruck nur nach vorheriger Einwilligung.­ Für die Originalbeiträge und Originalbilder alle Rechte vorbehalten. Urheber, die nicht zu ­erreichen waren, werden zwecks nachträglicher Rechtsabgeltung um Nachricht gebeten. James Rieck Seite 64 Anna Mitgutsch Seite 14 Adrian Chen Seite 32 Selbstdarstellung, Stilisierung und Inszenierung – ­diese Themen beschäftigen den US-amerikanischen Maler James Rieck, der in Los Angeles lebt. Die Ölbilder seiner Serie Annual Report bedienen sich der Bild­ sprache der internationalen Unternehmenswelt. Einige davon begleiten in dieser Ausgabe den Text über modernen Satanismus. Riecks Arbeiten wurden landesweit in den USA gezeigt, in Europa sind sie in der Schweiz und den Nieder­ landen zu sehen. Alle Dimensionen des Vermessens zu ergründen: unmöglich. Anna Mitgutsch zum Kern des Begriffs zu folgen: unwiderstehlich. Die österreichische, mit vielen Preisen aus­ gezeichnete Autorin und Literaturwissenschaftlerin lebt nach langjährigen Aufenthalten in den USA nun in Linz, Österreich. Zuletzt veröffentlichte sie den Essayband Die Welt, die Rätsel bleibt (2013). Im Frühjahr 2016 erscheint der Roman Die Annäherung im Luchterhand Verlag. Im Rahmen der Diskussionen, welche Äußerungen Facebook & Co. von ihren Seiten löschen sollen, ist eine Tatsache wenig ­bekannt: Zigtausende IT-Arbeiter, viele in Asien, filtern ohnehin verstörende Inhalte heraus, um sie von uns fernzuhalten. Der US-Journalist Adrian Chen hat viele dieser Unternehmen besucht und berichtet ­ in dieser Ausgabe davon. Er schreibt u.a. für Wired und The New York Times, in Brooklyn betreibt er den Internet-affinen IRL-Club. Foto Anna Kim: Roland Dreger Contributors Foto Anna Mitgutsch: Peter von Felbert Impressum eine liebeserklärung für die ewigkeit. Promise by kim München, Maximilianstraße 10, T 089.29 12 99 Besiegeln Sie große Gefühle mit einem brillanten Zeichen. Entdecken Sie die Welt der Solitaire-Ringe Promise BY KIM bei Wempe an den besten Adressen Deutschlands und in London, Paris, Madrid, Wien, New York und Peking oder bestellen Sie unter www.wempe.de Ich als Forscher: Donna Leon über Bienen … In der Spielzeit 2015/16 schildern Künstler für MAX JOSEPH, woran sie gerade forschen – was sie zur Zeit vermessen. Vor ein paar Monaten las ich in meiner Bibel, Il Gazzettino, dass einem Bauern in der Nähe von Vicenza über Nacht 300.000 Bienen gestohlen worden seien. Dreihunderttausend – das hört sich nach einer sehr hohen Zahl an, doch all diese Bienen passen in sechs Bienenstöcke. Kurz darauf druckte der Londoner Independent das Foto eines riesigen Lastwagens, der irgendwo in den Vereinigten Staaten umgestürzt war und dabei einen Teil seiner Fracht – eine Million Bienen – verloren hatte. Sechzig Prozent der amerikanischen Honigbienen werden nämlich alljährlich von Florida nach Kalifornien transportiert, wo sie im Central Valley jene Mandelbäume befruchten sollen, die achtzig Prozent der weltweiten Ernte liefern. Und plötzlich war ich umschwärmt von Bienen: Nur eine Woche später sah ich ein Bild von einer chinesischen Birnenplantage, auf der die Blüten von Hand bestäubt werden mussten, weil die Bienen durch die vielen Pestizide vollständig ausgerottet worden waren. In einem anderen Artikel ging es um den sogenannten Völkerkollaps, bei dem vielerorts bis zu achtzig Prozent der Bienen sterben. Den Gnadenstoß aber versetzte mir eine Freundin, die mir ein Glas zartgelben Honigs schenkte: „miele della barena“, der aus der venezianischen Lagune stammt. Natürlich könnte ich jetzt behaupten, der Himmel tat sich auf, die Muse schwebte auf einer Wolke hernieder, richtete ihren Zauberstab auf mich und meinte: „Donna, das ist ein Buch.“ In Wirklichkeit zögerte ich kurz, den Honig in Empfang zu nehmen, während ich bei mir dachte: „Das ist Stoff für ein Buch.“ Schon öfter bot sich mir ein Thema wie von selber an. Und Bienen sind fürwahr ein wichtiges Thema. Seitdem lässt mich „das Bienenbuch“ nicht mehr los. Ein Romanautor sollte seine Fakten stets mit leichter Hand einstreuen; alles muss so selbstverständlich daherkommen, als habe der Autor sich jahrelang mit dem Thema beschäftigt und könne sich beim Schreiben ganz auf sein enzyklopädisches Wissen verlassen. Wobei er aber genau nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen darf. Über die Jahre habe ich mich mit Diamanten und Blutdiamanten, chinesischer Keramik, Kunstraub, Glasbläserei, seltenen Büchern und Strahlenkrankheit befasst, und jedes Mal hat mich wie in meinen Studienzeiten das Thema so sehr gepackt, dass ich monatelang nichts anderes gelesen habe. Meine Freunde wissen die Zeichen mittlerweile zu deuten, und darunter leiden meine Kontakte, denn wer möchte schon in geselliger Runde von den Symptomen der Strahlenvergiftung hören oder sich erklären lassen, wie man mithilfe von Zahnseide alte Manuskripte stiehlt? Mit Bienen beschäftige ich mich erst seit zwei Monaten, aber schon werde ich seltener eingeladen und muss mir Scherze anhören wie den, ich sei beim Einstudieren des Schwänzeltanzes der Bienen beobachtet worden. Manche Leute, freilich nur die, mit denen ich Englisch rede, nennen mich plötzlich „Honey“; andere sprechen vom Stachel meiner Ironie. Noch bin ich nicht der sprichwörtliche Oberlehrer, aber lange kann es nicht mehr dauern. Noch kläre ich meinen Nachbarn im Vaporetto nicht darüber auf, dass Bienen positiv geladen sind, Blüten hingegen negativ, was, sobald eine Biene den Pollen entnimmt, in positive Ladung umschlägt, sodass die nächste (positiv geladene) Biene sofort weiß, bei dieser Blüte ist nichts mehr zu holen, bis neuer Pollen gebildet und die Blüte damit wieder negativ geladen ist. Ähnlich mag es frisch zu einer Religion oder einer politischen Partei Bekehrten ergehen oder jenen, die sich verlieben: Plötzlich hat man nur noch ein einziges Thema, und alle anderen müssten es genauso spannend finden wie man selber, wenn sie einen nur mal ausreden ließen. Auf die Gefahr hin, mich vor den Spezialisten zu blamieren (es gilt da schließlich ein ganzes Universum zu entdecken), möchte ich versuchen begreiflich zu machen, warum mir die Bienen mittlerweile als faszinierende Wunderwesen erscheinen. Allein schon ihre Feinde: Da wäre Varroa destructor – gruselt es einen nicht bereits bei dem Namen? −, eine furchterregend aussehende Milbe, die sich von Bienenlarven ernährt und ganze Stöcke ausrotten kann; Nosema apis, ein Pilz; das Flügeldeformationsvirus, die Sauerbrut und was ­dergleichen mehr ist an Krankheitserregern, die nicht nur die Larven, sondern auch die ausgewachsenen Bienen in ihrem kurzen Leben bedrohen. Vom Menschen ganz zu schweigen: Monokulturen bedeuten einen Cocktail von Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden, von denen viele für Honigbienen schädlich sind. Natürlich behaupten die Hersteller, die Mittel würden gezielt nur Insekten vernichten, die Bienen aber verschonen – gerade so, als breite die Madonna von Medjugorje ihren blauen Mantel schützend über ihnen aus. Doch es gibt auch kritische Stimmen: „Es ist nicht weiter verwunderlich, dass der Bayer-Konzern ein en­ thusiastischer Verfechter der Neonikotinoide ist, wenn man bedenkt, dass es sich bei dem hauseigenen Produkt Imidacloprid um das weltweit am häufigsten eingesetzte Pestizid handelt.“ (Mark L. Winston: Bee Time, Harvard University Press, 2014, S. 68) Bislang haben die Bienen überlebt, trotz aller Bedrohung durch Mensch und Natur. Im Bienenstock herrscht ein Leben von einer Perfektion, zu der die Natur es bringt, wenn man sie sich fünfzig Millionen Jahre lang in Ruhe weiterentwickeln lässt. Man weiß angesichts dieser Perfektion kaum, wo man anfangen soll. Die Bienen sind nach ihrer Funktion in ein strenges Kastensystem eingeteilt. Die Königin schlüpft aus einem befruchteten Ei, das ihre Vorgängerin in einer der sechseckigen Waben im Stock abgelegt und mit Gelée Royale ­gefüttert hat. Wenn ihre Zeit gekommen ist, paart sie sich mit zahlreichen Drohnen, die aus den Eiern ihrer Vorgängerin stammen. Eier, welche jene unbefruchtet ließ, nachdem sie den Größenunterschied ertastet hatte: Drohnenzellen sind einen Millimeter breiter als die anderen. Arbeitsbienen hingegen stammen aus Illustration Harriet Lee-Merrion © Donna Leon & Diogenes Verlag AG, Zürich wirres, goldbraun in der Sonne glänzendes Gewimmel. „Achte auf den blauen Punkt.“ Ich sah genauer hin, suchte alles mit den Augen ab. Und dann hatte ich es, ein stecknadelgroßes, leuchtendes blaues Pünktchen auf dem Hinterkopf, das jene als eine 2015 geborene Königin auswies. Langsam kroch sie über die Waben, machte gelegentlich Halt und senkte ihren Hinterleib in eine Zelle, um jeweils ein weißes Ei etwa von der Größe des Punktes abzulegen, mit dem dieser Satz endet. Neben ihr, über ihr, unter ihr krabbelte ihr Hofstaat, berührte, umarmte, putzte sie und hielt sie womöglich bei Laune, während sie an einem einzigen Tag 2.000 Eier ablegte. Ich hatte nie zuvor ein Erweckungserlebnis gehabt. Und daher dem metaphysischen Wesen, das Aristoteles in seinen Schriften zur Naturgeschichte postuliert, nie viel abgewinnen können – aber der Anblick dieser Königin und das, was ich mir in wenigen Monaten über Bienen angelesen hatte, lässt mich ahnen, der Philosoph wusste, was er meinte, als er mangels eines besseren Ausdrucks seinen Begriff vom „himmlischen Seienden“ prägte. Hier ist Sein, hier ist Leben, das Vollkommenste, was ich jemals gesehen habe. Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz Nach Stationen unter anderem in Rom, ­London, in Iran und in China lebt die US-amerikanische Autorin Donna Leon seit 1981 vor allem in ­Venedig. Dort sind auch die Kriminalromane ­ihrer CommissarioBrunetti-Reihe angesiedelt, die in 35 ­Sprachen übersetzt wurden. 2012 schrieb die Liebhaberin von Händels Opern den ­Barock-Krimi Himmlische Juwelen (The ­Jewels of Paradise) für ein gemeinsames ­Projekt mit der Mezzosopranistin Cecilia Bartoli. Foto Regine Mosimann / © Diogenes Verlag ­efruchteten Eiern, die nicht mit b Gelée Royale, sondern mit normalem Futtersaft aufgezogen werden. Eine Arbeitsbiene ist nach drei Wochen in ihrer Zelle vollentwickelt und versessen darauf, sich in die Arbeit zu stürzen. Sie lebt nur etwa einen Monat, übernimmt in dieser Zeit aber eine Aufgabe nach der andern. Sie beginnt mit dem Saubermachen im Bienenstock, dann kommt sie zum Füttern der Larven, danach hilft sie bei der Nahrungsproduktion, wenn sie den ausgeflogenen Bienen den Nektar im Stock abnimmt. Schließlich wird sie zum Zimmermann und baut die 8-eckigen Waben aus Wachs für den Stock. Sobald sie 2o Tage alt sind, werden Arbeitsbienen wehrpflichtig und müssen den Stock gegen Eindringlinge verteidigen. Und erst, wenn sie einige Tage am Einflugloch gekämpft haben, werden sie selbst den Stock verlassen, um draußen Pollen und Nektar einzusammeln. Und nun sterben die meisten von ihnen, abgearbeitet und mit zerschlissenen Flügelchen, von der Arbeit erschöpft. Ich kam beim Lesen nicht aus dem Staunen heraus: Wie klug das alles geregelt ist! Als sei der Bienenstock ein einziger denkender Organismus, der Informationen aufnimmt, auswertet und dann den Bienen die Aufgaben zuteilt, die jeweils am dringendsten bewältigt werden müssen. Schließlich ließ ich die Bücher Bücher sein und machte mich auf den Weg, um mir das Ganze mit eigenen Augen anzusehen: Ein Freund wollte mir seine Bienenstöcke zeigen. Mit Hut und Schleier geschützt, näherten wir uns, die Bienen aber waren so beschäftigt, dass sie uns gar nicht weiter beachteten. Mein Freund öffnete den Stock und zog einen der Holzrahmen heraus, auf denen die Bienen ihre Waben angelegt hatten. Hunderte, wenn nicht Tausende Bienen krabbelten darauf herum. „Siehst du die Königin?“, fragte er. Ich sah nur Bienen, die auf dem Rahmen übereinander und untereinander durch krochen, doch keine wirkte königlicher als die anderen. Ein Nur der Mensch zählt 14 Vorstellungsankündigung Der Wunsch zu ­vermessen entspringt einem tief menschlichen ­ Be­dürfnis nach Ordnung und ­Sicherheit. Ist dieses ­befriedigt, beschleicht uns die Sehnsucht, aus der vermessenen und dadurch entzauberten Welt auszubrechen. Ein Essay von Anna ­Mitgutsch. 15 Was reizt uns so sehr, die Grenzen zum Undenkbaren zu überschreiten, dass wir es auf alle möglichen Weisen versuchen, in der MaSSlosigkeit, im Exzess, im Versuch, das Bewusstsein auszuschalten? Das Maß kam durch den Menschen in die Welt. Wo es kein Bewusstsein gibt, dort ist die Welt ohne Anfang und ohne Ende. Nur der Mensch braucht Begriffe wie Raum, Zeit, Dimension und Grenzen. Der permanente Zwang zu messen entspringt dem menschlichen Grundbedürfnis, sich in der Welt zu verorten. Raum und Zeit sind an sich unendlich. Nur der Mensch denkt in Maßeinheiten. Es ist die Fähigkeit zu denken, die unser Bedürfnis nach Kategorien und Systemen hervorbringt. Messen ist anthropozentrisch, eine menschliche Eigenschaft. Wo der Mensch an die Grenzen seines Denkens stößt, liegt auch die Grenze des Messens. Wir messen zwar längst im Bereich des Unvorstellbaren, in Nanoteilchen und in Lichtjahren, aber irgendwann beginnen immer das Nichts und die Unendlichkeit, Begriffe, die ein ebenso metaphysisches Schwindelgefühl erzeugen wie der Gedanke an den Tod. Das Messbare wird von allen Seiten, räumlich und zeitlich, vom ­Unermesslichen begrenzt. Der Mensch bringt zwar durch das Bewusstsein seiner Endlichkeit den Tod als existenzielle Erfahrung in die Welt, aber der Tod geht über das Messbare hinaus. Der stets gegenwärtige Hintergrund des Messbaren ist das Nichts, das wir nicht denken können. Das Unermessliche, das Nichts als das Undenkbare umgibt uns vom Anfang und vom Ende her und verlangt nach Begrenzung, um unsere Angst davor in Schach zu halten. Anfang und Ende sind Begriffe, in denen das Maß enthalten ist, davor und dahinter ist das, was sich nach Ludwig Wittgenstein nicht denken lässt und worüber die Sprache der Logik schweigen muss. Die Grenzen des Nichts lassen sich nicht von außen vermessen. Was reizt uns so sehr, die Grenzen zum Undenkbaren zu überschreiten, dass wir es auf alle möglichen Weisen versuchen, in der Maßlosigkeit, im Exzess, im Versuch, das Bewusstsein auszuschalten, in der Selbstauslöschung? Ist es die Befreiung von Raum und Zeit? Ist es die Verlockung des Unvorstellbaren jenseits des Horizonts? Es bleibt viel Unermesslichkeit angesichts der Tatsache, dass alles messbar geworden ist, vom Universum bis zum unvorstellbar kleinsten Teilchen der Materie, von den Funktionen des menschlichen Gehirns bis zur neuronalen Genese unserer Emotionen. Der Mensch kann sich über den eigenen Verstand beugen und ihn vermessen, ein medizinischer Fortschritt, der nicht geringzuschätzen ist, baut er doch Mystifizierungen ab und betrachtet das Gehirn als Organ, dessen Funktionen entgleisen können und dessen Pathologien heilbar sind. Doch nach wie vor reicht alles Wissen um die Funktionsweisen des Gehirns nicht aus, uns vor der kreatürlichen Angst vor dem Tod und dem Unermesslichen, das uns umgibt und existenziell bedroht, zu schützen. Es scheint fast, als wüchsen mit der fortschreitenden Messbarkeit realer Phänomene die menschlichen Ängste vor dem Ausgeliefertsein zu einer permanenten Katastrophenangst an und lieferten reichlichen Stoff für die Weltuntergangsszenarien der Populärkultur. Als die Unendlichkeit noch mit Himmel und Hölle, mit Engeln und Teufeln bevölkert war, wussten die Menschen wenigstens, was sie im besten und im schlimmsten Fall erwartete. Trotzdem konnte die fortschreitende Messbarkeit der Welt bislang das Geheimnis der menschlichen Existenz nicht überzeugend erhellen. Wenn unser Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt ist, beschleicht uns die Sehnsucht, aus der vermessenen und dadurch entzauberten Welt auszubrechen. Die Sehnsucht nach Entgrenzung und nach dem Unbekannten ist der Gegenpol zum Bedürfnis nach Ordnung und Grenzen. So sehr wir uns auch bemühen, alles mit Maßeinheiten zu versehen und auf Messbarkeit zu reduzieren, die wichtigsten Dinge im Leben entziehen sich dem Maßnehmen. Mitten in der Geschäftigkeit des Definierens werden wir mit der Maßlosigkeit und Irrationalität unserer Sehnsüchte und Begierden, unserer Emotionen konfrontiert, von Liebe, Schmerz, Trauer, Glück oder Hass überwältigt. Dann sprechen wir von Unermesslichkeit, wir nennen den Schmerz unsäglich, reden von maßlosen Gefühlen. Leidenschaften können tatsächlich, nicht bloß metaphorisch, jedes Maß übersteigen und alle Grenzen niederreißen. Die Sprache entlarvt die tiefe Angst vor dem Verlust des Maßes, indem sie das Wort mit Negativkonnotationen versieht: Maßlosigkeit, Vermessenheit, Unmaß, Übermaß. Das richtige Maß dagegen, in dem Leben und Sicherheit gedeihen, steht zwischen Übermaß und Mindestmaß; aber das Mittelmaß hat die Tendenz zur Mittelmäßigkeit, denn der Maßstab der Norm ist der größte gemeinsame Nenner. Wer will schon Durchschnitt sein? Wer möchte sich nicht, ein bisschen wenigstens, durch Individualität der Norm entziehen? Dennoch nimmt die Manie, alles zu normieren, vom Abstand zwischen Nase und Augen auf dem Passfoto bis zu den uniformen Leistungsvorgaben im Bildungssystem, manchmal groteske, öfter erschreckende Formen an. Maß und Vermessenheit sind die Pole, zwischen denen das Leben aufgespannt ist. Von Geburt 16 an steht jeder Mensch in seinem Koordinatensystem, das ihn definiert. Er kann ausbrechen, sich selbst neu erschaffen, er kann die Maßstäbe neu definieren, aber das kann ihm schnell als Vermessenheit ausgelegt werden. Wer aus der Norm fällt, lässt sich schwerer kontrollieren, und nicht berechenbar zu sein, macht suspekt und kann zum Verhängnis werden. Hybris oder das, was das Maß als Hybris auslegt, wird seit dem Altertum von Göttern und Menschen bestraft. Je enger die Grenzen des Tolerierten, desto strenger und unduldsamer ihre Überwachung. Die wichtigsten Erfahrungen des Lebens, die uns erschüttern, uns aus der Bahn werfen und vielleicht in unvorhersehbare Bahnen lenken, sind gerade die des Nicht-Messbaren, das sich das Maßnehmen verbietet. Doch auch vor Gefühlen macht der Normierungswahn nicht halt. Wie lange darf „gesunde“ Trauer dauern? Wochen? Zwei Monate? Und wenn die Trauer sich nicht daran hält? Dann ist Therapie angesagt. Die Sprache entlarvt die tiefe Angst vor dem Verlust des MaSSes, indem sie das Wort mit Negativkonnotationen versieht: MaSSlosigkeit, Vermessenheit, UnmaSS, ÜbermaSS. Wo das Messbare ins Unwägbare umschlägt, ist die Kunst gefordert, dem Unmessbaren Ausdruck zu verleihen. Essay Anna Mitgutsch 17 Doch auch vor Gefühlen macht der Normierungswahn nicht halt. Wie lange darf „gesunde“ Trauer dauern? Wochen? Zwei Monate? Und wenn die Trauer sich nicht daran hält? Dann ist Therapie angesagt. „Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide“, sagt Torquato Tasso bei Goethe. Wo das Messbare ins Unwägbare umschlägt, ist die Kunst gefordert, nicht um zu beschreiben oder vorzuschreiben, sondern um das Unsagbare zur Sprache zu bringen, dem Unmessbaren Ausdruck zu verleihen, eine Erfahrung auf solche Weise in Sprache zu übersetzen, als habe sie nur darauf gewartet, formuliert zu werden. Wenn Wittgenstein sagt, „die Welt ist alles, was der Fall ist“, meint er die Kunst nicht mit, ebensowenig die Religion. Auch wenn sie sich mit Vorliebe des Nicht-Messbaren annimmt, ist die Kunst keineswegs frei von Maß und Form. Nicht nur die Musik ist ohne formale Strukturen undenkbar. Die Notwendigkeit von Maß und Form ist allen Kunstsparten als Gestaltungsprinzip eingeschrieben, denn auch das Sprengen der Formen geschieht auf der Grundlage der Form. Auch freie Rhythmen horchen auf den Rhythmus der Sprache. Das Dionysische und das Apollinische waren seit jeher nicht nur Gegensätze, sondern ein unzertrennliches Paar im kreativen Prozess. Kunst ist nicht Mystik, sie ist beschreibbar, sie folgt Kriterien, sie ist sogar kategorisierbar, und sie besteht aus gewissen, mit einiger Begabung erlernbaren handwerklichen Fertigkeiten. „Verachtet mir die Meister nicht, und ehrt mir ihre Kunst“, singt der Meistersinger Hans Sachs bei Richard Wagner. Doch das, was uns in der Kunst ergreift, was uns erschüttert und verwandelt, ist nicht die Form, auch nicht der Inhalt, es ist das Ungreifbare, Unbegreifliche, das sich der Stimmung des Hörers, der Gefühle der Betrachterin, der Leser bemächtigt, sie ganz auf sich einstimmt und ihre Fantasie mitreißt, vielleicht sogar für Augenblicke Zeit- und Raumgefühl aufhebt, sie entrückt, ohne dass sie ­erklären könnten, was in ihnen vorgeht, außer dass sie vielleicht noch nie dem Göttlichen so nah waren. Das Göttliche, die Transzendenz, der wir im Alltag mit Skepsis begegnen, an deren Existenz wir selten glauben, weil sie in den Bereich des Unendlichen verweist und dem Nichts so ähnlich ist: Hier begegnen wir ihr mit glücklicher Gewissheit, ohne es zu wollen, oft ohne es zu wissen. Ohne diesen Anteil am Göttlichen, der tief ins Gestaltlose, ins Sprachlose hineinführt, bleibt das, was sich als Kunst verkauft, eben nur Konsumware, Dienstleistungsgewerbe des Kulturbetriebs. Die Stimmung, die Gefühle, die von Musik erzeugt werden, sind neurologisch nicht messbar, sie gehen über das Vegetative hinaus und bleiben eine ganz und gar individuelle, unteilbare Erfahrung. Das ist die von nichts anderem ersetzbare Funktion der Kunst: dass sie den Kern des Ich berührt, den wir auch in unserer geheimnisentkleideten Zeit noch immer Seele nennen. Der Drang zu messen und zu vermessen, der Zwang, Grenzen zu ziehen und die Einhaltung der Norm zu überwachen, beide haben in den letzten Jahrzehnten bedrückend zugenommen. Wenn die Macht es mit der Angst zu tun bekommt, verringert ihre Paranoia die Maßeinheiten der Freiräume, jeder muss stets und überall überwachbar sein, die Rasterfahndung erfasst jeden, nichts darf der permanenten Kontrolle entgehen, jeder ist verdächtig. Messen, in welcher Form auch immer, ist nicht nur ein menschliches Grundbedürfnis nach Ordnung, sondern immer auch Machtausübung. Die Norm ist ein Instrument der Macht. Im Umgang mit der Kunst hat der Markt weitgehend die Deutungshoheit an sich gebracht. Um sie auszuüben und zu festigen, bedarf es der Charts, der Bestsellerlisten, Bestenlisten, Skalen, auf denen die einzelnen Titel und Namen hinauf- und hinuntergeschoben, entfernt oder an erster Stelle platziert werden. Mag sein, die Macht gehört dem Markt, dem Betrieb, dem es um Quoten, Einschaltquoten und Besucherzahlen, also um Quantität geht. Doch die Kunst ist subversiv, sie findet immer neue Wege, sich zu entziehen, denn in der Kunst geht es allein und ausschließlich um Qualität, die sich um Mengen und Messbarkeiten nicht kümmern kann. Wie sollen Charts und Listen das Unmessbare messen, das sich im Vorgang des Messens in die Gefühlstaubheit zurückzieht? Muss Kunst denn mehrheitsfähig sein? Dürfen die „likes“ von Konsumenten über Qualität entscheiden? Wenn Musik, wenn die Literatur ihre eigentliche Funktion erfüllt, spricht sie zu jedem von uns als Individuum. Collagen Bryan Olson 19 Das Internet hat unser Raum- und Zeitgefühl grundlegend geändert. Die Welt ist nach Marshall McLuhan schon seit geraumer Zeit ein globales Dorf, doch sie wird immer schemenhafter. Selbst extreme Erfahrungen, Katastrophen und fremdes Leiden erreichen uns nur mehr in diesem seltsam körperlosen Raum. Cyberspace ist kein räumlicher Begriff. Auch in den sozialen Medien sind Raum und Zeit zusammen mit der Realität abgeschafft. Wir haben „Freunde“, wir „parshippen“, mobben und kommunizieren ohne physischen Kontakt, unsere soziale Identität deckt sich nicht mehr mit unserer realen Präsenz. Zeit und Raum ziehen sich auf einen Punkt zusammen, den Punkt, an dem wir uns gerade befinden, vernetzt und zugleich anonym und isoliert. Trotzdem bleiben die grundlegenden Fakten des Lebens unverändert. Wir verlieben uns auch in der realen Zeit und an realen Orten, wir leiden unter unseren Verlusten, wir sind dem Zufall ausgeliefert, der uns Glück, Unglück, Krankheit, Erfolg bringt, unvorhersehbar wie das Schicksal es eben verteilt seit eh und je, wir werden krank und sterben, und all das trifft uns ganz real. Anfang und Ende unseres Lebens bleiben ein Geheimnis. Das Leben widersetzt sich der Messbarkeit auf Schritt und Tritt, auch wenn wir verkabelt durch die Landschaft laufen und unsere Mess­ instrumente Pulsfrequenz, Kalorienverbrauch und zurückgelegte Meter messen. Angesichts der Atemlosigkeit, mit der wir versuchen, uns durch unentwegtes Messen dem Zufall zu entziehen, ist es beruhigend zu wissen, dass sich die Kunst stets unserer irrationalen Seite, unserer namenlosen Sehnsüchte, unserer verborgenen Leidenschaften, unserer verheimlichten Ängste und unserer Einsamkeit annehmen wird. Mehr über die Autorin und den Bildkünstler auf S. 8 EXCELLENCE: RENÉ PAPE TRIFFT AUF MORITZ GROSSMANN Wir begrüßen den weltweit gefeierten Bass René Pape als Excellence-Partner unserer Marke. Die hohe Kunst des Gesangs berührt die traditionelle Kunst der Feinuhrmacherei. Das Kaliber seiner Wahl ist die BENU Gangreserve in Weißgold mit dem Grossmann’schen Handaufzug mit Drücker: perfektes Timing inklusive. Erfahren Sie mehr über die Manufaktur: www.grossmann-uhren.com HEIMAT EINER NEUEN ZEIT Collagen von Bryan Olson Seite 14: Youth Observatory, 2011 Seite 17: Hike of a Lifetime, 2011 Seite 18: Activation, 2012 20 Carl Glück UHREN & SCHMUCK Maffeistraße 4 . 80333 München Telefon 089 / 22 62 87 . Telefax 089 / 22 83 112 www.carl-glueck.de . [email protected] Wir, böse? René Pape singt die ­Titelpartie in ­Arrigo ­Boitos Oper Mefistofele, ­Roland Schwab inszeniert. Für MAX J­OSEPH unternahmen sie vorab e ­ inen ­Oster­spaziergang der anderen Art: eine ­Karussellfahrt. Und ­unterhielten sich darüber, wie sie den Mephisto anlegen wollen. 22 Vorstellungsankündigung Rubrikentitel Premiere Mefistofele 23 Roland Schwab René Pape MAX JOSEPH Herr Pape, Herr Schwab, Sie haben sich eben beide in ein Kettenkarussell begeben. Hat ein Opernbesuch nicht auch etwas von einer Karussellfahrt? ROLAND SCHWAB Das Karussell hatte den netten Namen „Wellenflug“, und ein Wellenflug ist ein Opernbesuch gewiss, zumal bei einem Stück wie Mefistofele. Wir haben einen Wechsel zwischen Höhen und Tiefen, zwischen Himmelfahrten und Abgründen, das ist sicher ein Trip, auf den der Zuschauer mitgenommen wird. Gleichzeitig ist das Karussell ein so schöner Ort von Understatement. Mephisto, der Teufel, wenn er in einer Oper schon personifiziert wird, wird nur interessant, wenn er mit Understatement auf der Bühne erarbeitet wird. Wenn er nicht wie der große Angeber oder der große Zampano daherkommt, sondern man sein abgründiges Potenzial durch dezentes Verschweigen umso stärker ahnbar macht. Und das ist eine tolle Herausforderung, es verlangt eine Denkraffinesse, und da müssen wir, René und ich, unsere Köpfe zusammenstecken und unser abgründiges Denken zusammenlegen, dass wir den Teufel nicht an die Karikatur verkaufen oder verschenken, sondern dass er wirklich eine dämonische Qualität hat, die man so nicht unbedingt oft auf der Opernbühne antrifft. MJ Besonders an dieser Oper ist auch, dass die Basspartie die Titelpartie ist. Der Böse, der Antagonist von Faust steht im Zentrum. Geht man an diese Rolle von vornherein anders ­heran? Ist das überhaupt eine menschliche Figur, oder ist das der Teufel, den man ohnehin anders spielen muss? RENÉ PAPE Die Frage ist: Was ist böse? Für mich ist Mephisto einfach ein starker Charakter. Er ist nicht böse für meine Begriffe, sondern er ist einfach nur das, was wir sind, jeden Tag. Er hält uns den Spiegel vor und sagt: Hey, was willst Du von mir? Du bist doch genauso. Und dann sage ich eben: Ich bin Mephisto, also ich, René Pape, ich fühle mich als Mephisto, auch im wirklichen Leben. Diese Einteilung in „wer ist gut, wer ist böse“ – da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Mephisto ist nicht böse. Er ist nur böse, weil wir denken, dass er böse ist. Ich will ihn auch so anlegen … Er soll dieses Nette, Hintertriebene haben, diese Coolness (zieht ein harmloses Gesicht, hinter dem es diabolisch funkelt). Und er ist sich seiner Macht, seiner Stärke sehr bewusst. Er hat die Fäden in der Hand. Alle anderen bewegen sich wie Marionetten. Aber von selbst. Nicht, weil er sie so spielt. RS Aber das ist doch schön, diese Selbstverständlichkeit dabei. RP Eben. Er ist einer von uns. Wir können alle Gott spielen und nett sein, wir können tausend Kinder in die Welt setzen, das ist alles super. Wir können aber auch das andere, aber das andere blenden wir immer aus. Wir sagen: Nein, ich bin nicht so böse, nein, ich steh auf in der Straßenbahn für eine alte Frau. MJ Machen Sie das denn nicht? RP Doch, natürlich. So hab ich’s gelernt. 26 René Pape (r.) und Roland Schwab (l.) bei ihrer nicht nur metaphorischen, sondern wirklichen Karussellfahrt auf der Münchner Auer Dult. „Mephisto hat die Fäden in der Hand. Alle anderen bewegen sich wie Marionetten. Aber von selbst. Nicht, weil er sie so spielt.“ – René Pape „Wo ‚Mephisto‘ draufsteht, sollte man kein humani­ täres Rettungspaket erwarten.“ – Roland Schwab MJ Der Teufel, das Böse kann auf der Bühne schnell etwas Lächerliches bekommen. Kommt man mit den Mitteln des Theaters überhaupt an das ran, was man das eigentlich Böse nennt? RS Das Böse ist immer: Man sieht die Eisbergspitze, und darunter ist unsichtbar der Rest. Und das muss immer ein Geheimnis bleiben, auch und gerade im Theater. Das darf nicht ausformuliert werden. Die Aura eines Diabolos macht man kaputt im Ausformulieren, das Mysterium muss aufgespannt werden. Es ist eine absolut packende Herausforderung. Mir kommt entgegen, die Hölle als unseren Ort zu begreifen: Wir sind alle in der Hölle geparkt, der Himmel ist uns nur als utopische Sehnsucht gegeben. MJ Kann man ausformulieren, was unter dem Eisberg ist? RS Es gibt ja eine ganze Sekundärliteratur, die sich mit dem Bösen beschäftigt, die uns aber keinen Deut weiterbringt. Das Böse entzieht sich uns, es wird nie greifbar. Die Präsentation der Spielzeit 2015/16 an der Bayerischen Staatsoper mit dem Titel „Vermessen“ im März dieses Jahres war überschattet von dem Germanwings-Absturz. An dem Tag hieß es: Absturz, alle ums Leben gekommen, Piloten wie die Passagiere haben uns alle gleich leid getan. Ein paar Tage später hieß es, es gebe eine Ausnahmerolle: einen Co-Piloten, der bewusst Mannschaft und Passagiere in den Tod mitgerissen habe. Dann, Wochen später, die Message: Bereits der Hinflug nach Barcelona habe als Testflug fungiert. Es hatte sich hier etwas ausgeweitet, und man weiß nicht, wo sind die Grenzen? Haben wir alle schon solche Testflüge mitgemacht, Fotografie Martin Fengel möglicherweise Wochen und Monate vorher? Es gibt nur eine Ahnung, was da noch ist. Aber das Vermessen des Bösen ist eine Hybris, es ist nicht möglich. Man vermisst die Eisbergspitze, aber des Mysteriums wird man nicht habhaft. MJ Als die Informationen über den Co-Piloten bekannt wurden, stand seine Person wochenlang im Zentrum der Medien. Ist es grundsätzlich das Böse, das uns besonders fasziniert, das Dunkle, die Abgründe der Menschen? RP Ja. Für mich das Beste, was ich gelernt habe in den 26 Jahren meiner Laufbahn: sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Ich habe gelernt, dass Philipp in Verdis Don Carlo nicht der gute Philipp ist, ich habe gelernt, dass Marke in Tristan und Isolde nicht der gute Marke ist. Und genau das ist es, was sie zu so faszinierenden Figuren macht. Wir sind mitten im Leben. Egal, ob wir über die Straße gehen, ob wir hier ein Bier trinken, ob wir Kunst machen, ob wir Straßenbahn fahren: Ich lebe mit Menschen zusammen, und jeder hat unterschiedliche Meinungen. Aber ich verurteile Menschen nicht wegen ihrer Meinung. Ich verurteile Menschen nicht, weil sie so und so gepolt sind. Ich bin Dresdner, mir ist schon peinlich, was da mit Pegida läuft. Das ist auch schwierig. Aber wie gesagt: „böse“, dieses Wort, gibt es für mich nicht. Ich versuche so zu leben, dass … ich dieses Wort „böse“ möglichst irgendwie wegschiebe. MJ Wenn wir nun annehmen, dass der Begriff des Bösen uns nicht hilft, weil es alltäglich und in uns allen ist, dann muss man trotzdem fragen: Kommen wir ohne Werturteile aus? 27 RS Mit dem Bösen, da gebe ich René recht, klammert man immer etwas aus, was man nicht sein will. Die simple Unterscheidung von Gut und Böse hat uns nie geholfen. Was dagegen hilft ist, die Unterscheidung in sich selbst zu sehen, was für einen Anteil hat man am Bösen? Wir befragen, siehe Germanwings, die Atteste: Welche psychische Krankheit hat der? Beides bringt uns nicht weiter. Dann enden wir irgendwann bei dem Wörtchen „Warum“. Das ist immer das kapitulative letzte Wort, weil wir es meist auf andere beziehen und nie die Sonde in uns selbst setzen. Wir denken, anormal sind die anderen. Aber wir sind nicht solitär. Wir haben alle Anteil an allem. Die Akzeptanz des eigenen Schattens, des eigenen Abgrunds, behaupte ich, ist präventiv, ist Krisenprophylaxe. Zu erkennen, wie viel man Anteil hat. Und diejenigen, die immer verdrängen: Irgendwann schafft sich das Verdrängte sein Recht, bricht sich Bahn. Und da sind viele Menschheitskatastrophen festzumachen in diesem Themenkomplex. MJ Würde das auch beinhalten, dass ich sage: Mein Anteil war schlecht, war böse, war nicht richtig? Oder würde es heißen: Mein Anteil hat diese Ursache und es gibt das Böse nicht? RS Wie man es auch nehmen will – es gibt natürlich eine Skala der seelischen Schwärze, ja. Luzifer, behaupte ich mal, hat sich vom Himmel abgekehrt aus Langeweile. Hier kommt das Spaßprinzip ins Spiel. Das Böse, ob man es jetzt in Anführungszeichen setzt oder nicht, ist ein Lustprinzip. Böse, das ist gleichzeitig Wettkampf und Dilemma, das ist, sich toppen zu müssen. Eine Figur auf der Bühne, die sich permanent souverän fühlt, ist auch nicht interessant. Man muss bei aller Versuchung auch zeigen, wie Mephisto selbst versucht wird, in welche Klemmen er gerät. Aber wo „Mephisto“ draufsteht, sollte man kein humanitäres Rettungspaket erwarten. MJ Es gibt ja ein Wort, das so ganz entscheidend ist für Mephisto – das Wort „nein“. Er ist der Geist, der stets verneint. Boito hat Mephisto eine große Arie komponiert, die sich um dieses Wort dreht. RP Wenn ich da einhaken darf: Wie sind Sie Dramaturg geworden? Durch Ja- oder durch Neinsagen? MJ Gute Frage. Nun, als Dramaturg ist man ohnehin immer der Teufel der Produktion. Man stärkt ja die Produktion, indem man den Finger in die Wunde legt. RP Na also. Neinsagen ist immer gut. MJ Ja, würde ich auch sagen. (lacht) Ich stimme zu. René Pape wurde beim Dresdner Kreuzchor sowie an der Musikhochschule Carl Maria von Weber in Dresden ausgebildet. Seit 1988 ist er im Ensemble der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, wo er auch zum Kammersänger ernannt wurde. Zu seinem Repertoire gehören Partien wie Rocco (Fidelio), Méphistophélès (Faust), König Heinrich (Lohengrin), Banquo (Macbeth), Pogner (Die Meistersinger von Nürnberg), Gurnemanz (Parsifal), Sarastro (Die Zauberflöte), König Marke (Tristan und Isolde) und Philipp II., König von Spanien (Don Carlo) sowie die Titelpartien in Don Giovanni und Boris Godunow. Gastspiele führten ihn u.a. an die Metropolitan ­Opera New York, die Opéra National de Paris, d ­ as Royal Opera House Covent Garden in London, an die Wiener Staatsoper sowie zu den Festspielen von Bayreuth und Salzburg. An der Bayerischen Staatsoper ist er in dieser Spielzeit als Orest ­­­(Elektra) und in der Neuinszenierung als ­Mefistofele zu erleben. Roland Schwab, geboren in Paris, studierte nach einem Studium der Germanistik und Physik Musiktheater-Regie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg unter Götz ­Friedrich. 1994 wurde er Meisterschüler von Ruth Berghaus und schuf seine ersten Inszenierungen, u.a. Frank Alert meets Brecht am Berliner Ensemble. Ab 2002 wirkte er als Oberspielleiter am Meininger Theater, wo er Così fan tutte und Le nozze di Figaro inszenierte. Weitere Opernproduktionen führten ihn u.a. an das Tiroler Landestheater, das Landes­ theater Linz, an die Oper Bonn, die Oper Dortmund sowie an das Staatstheater Braunschweig. Seine wichtigsten Arbeiten schuf er für die Deutsche Oper Berlin: Mozart-Fragmente, Tiefland sowie Don Giovanni. In der Spielzeit 2015/16 inszeniert er an der Bayerischen Staatsoper Boitos Mefistofele und gibt damit sein Hausdebüt. Das Gespräch führten Daniel Menne und Maria März. Mefistofele Oper in vier Akten mit Prolog und Epilog Von Arrigo Boito Premiere am Samstag, 24. Oktober 2015, Nationaltheater STAATSOPER.TV: Live-Stream der Vorstellung auf www.staatsoper.de/tv am Sonntag, 15. November 2015 Weitere Termine im Spielplan ab S. 93 28 talbot runhof boutique munich // theatinerstraße 27 // 80333 münchen // www.talbotrunhof.com Drecksarbeit für das Internet Bild Travis K. Schwab, Reject, 2015 Nicht nur unser Giftmüll, ­sondern auch unser ­Seelenmüll wird in Entwicklungsländer ab­­trans­portiert: Facebook & Co. beschäftigen ­sogenannte ­Content-­Moderatoren rund um den Globus, die Sex- und ­Gewaltvideos sichten und je nach ­Unternehmens­ziel löschen. Im Januar 2014 war ich im Auftrag des Wissenschaftsmagazins Wired auf den Philippinen und sprach dort mit einer jungen Frau, die ich hier Maria nennen will. Maria hatte einen ungewöhnlichen Job. Sie arbeitete für ein Subunternehmen in Manila und leitete dort ein Team von Mitarbeitern, die täglich tausende von Bildern und Videos begutachteten, die in den Cloudspeicher­ ­eines großen amerikanischen Technologieunternehmens hochgeladen wurden. Die Aufgabe ihres Teams bestand darin, Inhalte zu überprüfen und zu löschen, sollten diese die Nutzungsbedingungen des Unternehmens verletzen. Nutzungsbedingungen legen fest, was Nutzer auf den verschiedenen Onlinediensten posten dürfen. Diese Bedingungen sind so unterschiedlich wie die Dienste selbst. Die meisten sozialen Netzwerke verbieten beispielsweise Nacktheit und alle Formen von systematischer Belästigung wie Anfeindungen, erniedrigende Kommentare und Drohungen. Andere wiederum lassen extremere Inhalte zu – die Nutzungsbedingungen einer Pornoseite werden lockerer sein als die eines populären Nachrichtenportals. Es gibt auch Inhalte, die quasi von niemandem ­zugelassen werden, wie zum Beispiel Kinderpornografie oder Material mit falschen Urheberrechtsangaben. Maria und ihr Team sind Teil einer Armee von Content-Moderatoren, die ununterbrochen damit beschäftigt sind, das Netz von Inhalten zu befreien, vor denen die Unternehmen ihre Nutzer schützen wollen. Fast jedes Unternehmen, das im Internet von Nutzern generierte Inhalte bereitstellt – von Webseiten von Lokalzeitungen bis hin zu den größten sozialen Netzwerken –, beschäftigt Content-Moderatoren wie Maria. Ein Experte, mit dem ich für meinen Wired-Artikel sprach, schätzte, dass es mehr als 100.000 solcher Moderatoren weltweit gibt – Tendenz steigend. Facebook beispielsweise bezahlt Menschen dafür, Fotos und Posts zu überprüfen und eventuell zu kennzeichnen. Bei YouTube macht ein Team das Gleiche mit Videos. Webseiten mit Reiseempfehlungen beschäftigen Moderatoren, um die Tipps auf ihren Seiten zu durchforsten und zum Beispiel sicherzustellen, dass sie von realen Personen eingestellt wurden und nicht von einem anderen Unternehmen, das dem Konkurrenten schaden will. Oft sichten Content-Moderatoren nur Inhalte, die von Nutzern gemeldet wurden. Diesen Prozess nennt man „reactive moderation“, also reagierende oder rückwirkende Moderation. Manchmal wird auch der gesamte gepostete Inhalt einer Webseite oder eines sozialen Netzwerks durchsucht. Diesen ­arbeitsintensiven Vorgang bezeichnet man als „active moderation“. Aber auf welche Weise auch immer: Die Arbeit, die die Content-Moderatoren erledigen, um die dunkle Seite der Menschheit zu kontrollieren, ist mittlerweile genauso entscheidend für den kommerziellen Erfolg der sozialen Medien wie die der Softwareentwickler dieser Plattformen. Ohne diese Moderatoren wäre das Internet ein wenig profitables, schmutziges Brachland voller Betrüger und Verbrecher. Die Content-Moderatoren halten den Missbrauch in Schach und melden kriminelle Inhalte den zuständigen Behörden. Sie stellen sicher, dass das Internet mehr einer digitalen Flaniermeile gleicht als einer finsteren virtuellen Seitengasse. Text Adrian Chen Die Arbeit der Content-­­ Mo­deratoren ist mittlerweile genauso ­entscheidend für den kommerziellen Erfolg von sozialen Medien wie die der Software­entwickler. Ohne sie wäre das Internet ein wenig ­profit­ables, schmutziges Brachland. Der globale Charakter des Internets hat auch zur Folge, dass Content-Moderatoren überall auf der Welt tätig sind. Für meine Reportage sprach ich unter anderem mit einem Mann in Marokko, der von zu Hause Fotos für Facebook überpüfte. Ich sprach mit einem jungen College-Absolventen im Silicon Valley, dessen Aufgabe es war, Videos für YouTube zu sichten. Ich habe von Leuten in Kanada, Indien, Guatemala und Mexiko gehört, die diese Arbeit machen. Aber weil Content-Moderation sehr arbeitsaufwendig ist und gleichzeitig wenig soziales Prestige hat, wird sie oft in Entwicklungsländer ausgelagert. Dort lässt sich eine große Zahl von gering qualifizierten Mitarbeitern für wenig Geld engagieren. Die Philippinen sind mittlerweile für viele ­amerikanische Start-Up-Unternehmen einer der beliebtesten Standorte für dieses Geschäft. Als frühere amerikanische Kolonie haben die Philippinen den doppelten Vorteil von geringen Lohnkosten und einer kulturellen Nähe zu den USA. Philippiner können deswegen gut beurteilen, wovon sich das amerikanische Publikum belästigt fühlt. Dies hat jedoch die paradoxe Situation geschaffen, dass junge Philippiner, die in einer sehr konservativen, von katholischen Moralvorstellungen geprägten Gesellschaft aufgewachsen sind, hochgefährdenden Inhalten aus­gesetzt sind, die nicht einmal der abenteuerlustigste amerikanische Internetnutzer je zu sehen bekommt. Dieser Abfluss des globalen Social-­ Media-Mülls in die Entwicklungsländer ähnelt in gewisser Weise der Endlagerung des weltweiten Elektromülls auf den großen Deponien in Nigeria. Und das ist nur eine der Gemeinsamkeiten zwischen der neuen und der alten Informationsindustrie. Ebenso wie die Beschäftigten, die in chinesischen Fabriken unsere Verbraucherelektronik herstellen, hochriskanten Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind, müssen auch Con­tentModeratoren mit hohen Risiken umgehen. Hier sind sie allerdings psychischer statt physischer Art. Die Mitarbeiter in Marias Moderatoren-Team auf den Philippinen waren regelmäßig den schlimmsten nur vorstellbaren Inhalten ausgesetzt: brutalen und gewalttätigen Snuff-Filmen, sexuellem Missbrauch von Kindern und allen möglichen Spielarten von Pornografie. Maria 31 ­ rzählte mir, dass sie nach besonders verstörenden Bildern oder e Videos erst einmal einen Spaziergang macht oder sich einen Kaffee bei Starbucks um die Ecke holt, um sich wieder zu sammeln. Doch für andere sind die Auswirkungen schwerer zu verkraften. Ich sprach mit einer philippinischen Psychologin, die mit Content-Moderatoren arbeitet. Sie erzählte mir von Müttern, die ihre Kinder keinem Babysitter mehr anvertrauen, nachdem sie schreckliche Missbrauchs-Videos ansehen mussten. Sie ha- ein pornografisches Bild oder ein Enthauptungsvideo ausfindig zu machen. Doch das stimmt nicht! In Wirklichkeit sind Computer nur zu den allereinfachsten Moderationen fähig. Keiner von den Leuten aus der Branche, mit denen ich sprach, glaubt, dass es in der näheren Zukunft möglich sein wird, diesen Prozess zu automatisieren. Die Bewertungen der Moderatoren sind so nuanciert, dass nur ein menschliches Wesen sie treffen kann. Nach seinen 2012 durchgesickerten geheimen Richtlinien verbietet beispielsweise Facebook ERHABEN WOHNEN. AUCH ÜBER DEN ZEITGEIST. Es nicht überraschend, dass Firmen die abstoßenden Seiten ihrer Dienstleistungen geheimhalten wollen. Viel überraschender ist es, wie bereitwillig die Öffentlichkeit und die Medien dieser Illusion folgen. 32 die „Darstellung von sexueller Gewalt oder Vergewaltigung in jeder Form“. Um aber bestimmen zu können, ob ein Bild sexuelle Gewalt darstellt oder lediglich eine freundschaftliche Balgerei, erfordert es bereits mehr kulturelles Wissen und Urteilsvermögen, als irgendein Algorithmus je aufbringen könnte. Und auch die Unterscheidung, ob jemand widerwärtige Inhalte teilt, um sie zu befürworten oder zu verurteilen, ist für einen Computer kaum zu treffen. Deswegen werden es letztendlich immer Menschen sein, die in das obszöne, finstere Herz der Menschheit blicken müssen, selbst wenn die Technologie immer leistungsfähiger wird. „Eines der schönsten Kaufobjekte 2015“ Aus dem Amerikanischen von Sabine Voß Mehr über den Autor auf S. 8 Foto Adrian Chen ben Angst, ihren Kindern könnte das Gleiche passieren. Andere berichteten von Problemen mit ihrer Libido, nachdem sie tagelang pornografische Bilder und Filme sichten mussten. Der ehemalige YouTube-Moderator, mit dem ich sprach, hielt kein Jahr durch. Er war zermürbt von Tierquäler-Videos und grausamen Kampffilmen aus dem Nahen Osten. Weil die Branche so jung ist, gibt es nur wenige Studien über die möglichen psychologischen Auswirkungen des Ansehens extremer Gewalt und Pornografie. Doch weil immer mehr Menschen in dieser Branche arbeiten, muss man die Risiken besser einschätzen lernen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten, in denen das Wachstum des kommerziellen Internets auf eine immer größere Zahl von Content-Moderatoren angewiesen ist, ist es sehr erstaunlich, dass dieser Arbeitszweig so wenig bekannt ist. Das ist gerade so, als wüssten Großstädter in unserer realen Welt nicht, dass Müllmänner ihren Abfall beseitigen. Die Unternehmen halten einfach die Illusion aufrecht, dass die Menschen, die sich mit dem Begutachten von Bildern und anderen Inhalten beschäftigen müssen, nicht existieren. Und es ist ja auch nicht überraschend, dass Firmen die abstoßenden Seiten ihrer Dienstleistungen geheimhalten wollen. Viel überraschender ist es, wie ­bereitwillig die Öffentlichkeit und die Medien dieser Illusion ­folgen. Das spiegelt den gesellschaftlich weit verbreiteten Technikoptimismus und den Glauben an die Macht der Technologie wider, positive gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen zu können. Wir wollen glauben, dass die aufregenden neuen Möglichkeiten auf unseren Bildschirmen allein das Produkt irgendeines brillanten und hochbezahlten Entwicklers aus dem Silicon Valley sind und uns unaufhaltsam der Utopie von Vernetzung und Kreativität näher bringen. Es ist dieser Optimismus, der die meisten Menschen glauben lässt, unerträgliche Bilder in den sozialen Medien würden von einem hochentwickelten automatischen System entfernt. Wenn Computer es ermöglichen, unsere innersten Gedanken in Sekundenschnelle Millionen von Menschen gleichzeitig mitzuteilen, dann wird auch die relativ einfache Aufgabe programmierbar sein, TROGERSTRASSE 19, MÜNCHEN Wo Bogenhausen und Haidhausen zusammenkommen, wenige Schritte von der Prinzregentenstraße entfernt, entstehen 26 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen von ca. 77 m bis ca. 218 m. Der Entwurf von Landau + Kindelbacher setzt Maßstäbe: Während das Vordergebäude subtil mit der Jugendstilnachbarschaft harmonisiert, zeichnet sich das Rückgebäude durch radikale Modernität aus. Offen konzipierte Grundrisse und Details wie Naturstein in den Bädern oder transparente Brüstungen vollenden die Ausnahme-Architektur. Die verheerenden Folgen für die Arbeiter sind nicht sichtbar: Content-Moderatoren in einem Büro auf den Philippinen. EnEV 2014 EA-B · HZG BHKW Bj. (EA) 2016 45 kWh/(m²a) Energieeffizienzklasse A Beratung und provisionsfreier Verkauf: 089 415595-15 www. bauwerk . de Bauwerk Capital GmbH & Co . KG , Prinzregentenstraße 22 , 80538 München Foto Wilfried Hösl Unterwerfung Vermessen bedeutet auch, sich etwas untertan zu machen – zu unterwerfen. Für die Unmögliche Enzyklopädie der Bayerischen Staatsoper setzte sich Regisseur Hans Neuenfels mit dem Begriff auseinander. Seine Rede ist hier nochmals nachzulesen und nachzugenießen. Meine Damen und Herren, Unterwerfung, ein Begriff, der sich in zwei extreme Hälften teilt. „Ich unterwerfe“ lässt an Sieger, an Herrscher, mehr noch an Gewalt, Unterdrückung, an Brutalität denken, auf jeden Fall an einen Täter. „Ich unterwerfe mich“ setzt Assoziationen wie Demütigung, Knechtschaft, auch Qual, auch Kriechertum, auch Feigheit frei, hat grundsätzlich etwas mit einer Opferhaltung zu tun. Beides kann sich mit einem verbinden: mit der Lust. Die Lust an der Macht, zu befehlen, die Bereicherung des Ichs durch die Hörigkeit der anderen zu erzwingen, über allem zu scheinen, erhaben, erwählt. Und gleichzeitig gibt es die Lust, getreten zu werden, zu leiden, Objekt zu sein, bestraft zu werden, in der Schuld zu wühlen wie im Schlamm, die Erniedrigung wie ein Tier zu spüren, die Identität, die Würde, die Verantwortung fast völlig ausgelöscht. Aber weit häufiger gibt es die Tränen, das Stammeln, das Verstummen, sich mit Haus und Hof und Kind und Mann und Frau unterwerfen zu müssen. Das ist fast zu jeder Zeit die Faustregel. Die Unterwerfung hat spontan etwas mit Männern zu tun, sich zu unterwerfen etwas mit Frauen. Dieses Klischee, längst als Klischee entlarvt, zeigt nur auf, wie verwirrend Mannes- und Frauentum sich gegenüberstehen. Dazwischen liegen unendlich viele Verbiegungen und Brechungen, Mischformen der Unterwerfung und des Sich-Unterwerfens, die uns kaum noch bewusst werden. Auch die Demokratien können diesen Zustand nicht völlig auflösen, denn die Virulenz der Unterwerfung scheint dem Menschen angeboren zu sein, wobei nur die Lie- 34 Vorstellungsankündigung Hans Neuenfels be oder das Mitleid sie zähmen kann, und wir wissen, wie selten diese Begriffe sich in uns verwirklichen. Wir ersetzen „ich unterwerfe mich“ oft geschickt mit dem weicheren „ich muss mich fügen“, gar mit „ich arrangiere mich“ oder mit der rhetorischen Frage „was soll ich tun?“, mit einem lapidaren „es wird sich schon einrenken“ oder mit dem Schulterzucken „wenn die Umstände so sind, ist es halt so“. Selbstverständlich fühlen wir uns nicht ganz wohl dabei. Deswegen wollen wir lieber Unterwerfer sein. Da gibt es inzwischen kaum mehr einen Unterschied zwischen den Geschlechtern, wenn auch viele Frauen noch einen gewissen historischen Rückstand in der Ausübung ihrer Mittel haben, doch die Zukunft sieht schon trächtig aus. Die eher verborgene Unterwerfung – besonders in der täglichen Banalität – zehrt schleichend an unseren Kräften; während sie in den Diktaturen und der Sexualität deutliche Aufschwünge und Erschöpfungen aufweist, was aber nicht bedeutet, dass die scheinbar alltäglich harmlose Unterwerfung uns minder auslaugt und ermattet. Das eingelebte Leben, wie Robert Musil es nannte, die Anpassung an Normen durch Trends und Informationen ist sicherlich ein Novum in der Geschichte der Unterwerfung, weil die globale Verbreitung keine Grenzen mehr kennt. Sie steht in der sogenannten „Freien Welt“ jetzt über den Reglements der Religion. Die Natur hat uns immer durch ihre Gleichgültigkeit unterworfen. Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Orkane, all ihren Erscheinungen bleibt der Mensch heute noch aus- gesetzt. Man erkennt sie manchmal früher, weiß ihnen effektiver zu begegnen, aber sie geschehen wie seit eh. Zwar ist es ebenfalls allen klar, dass er, der Mensch, einen nicht unbeträchtlichen Anteil an der Verschandelung des Planeten hat, doch letztlich wird die Einsicht durch raffiniert verschachtelte Interessensysteme verschleiert und bis zur Platitude umgemünzt, dass jeder von uns schuldig ist, denn jeder will das Flugzeug besteigen, sein Haus erleuchten, seine Wäsche waschen, und nicht im Bach. Es bleibt ein internationales schlechtes Gewissen und ein duckmäuserisches Schweigen. Die ständig bedrohende Unterwerfung durch die Technik ist neu, weil ihre Erfindungen – vornehmlich das Internet – das Intim-Persönliche derartig vielfältig und tief mit der Außenwelt verknüpfen, dass der Mensch in der letzten Abgeschiedenheit sich im Nabel des Kosmos zu befinden glaubt. Das Berauschende, mit der ganzen Welt verbunden, an allem teilhaftig zu scheinen, ist ein großes Glücksgefühl und lädt das einsame Ich gewaltig auf. Abgesehen von den praktischen Dingen: ich kann mir Schuhe bestellen, sie zuhause anprobieren und wieder kostenfrei zurückschicken; bis zu der Beichte ähnelnden Bekenntnissen ist der Faden der Kommunikation, der ununterbrochenen News und vor allem der Bilder und Filme schier unermesslich gefächert. Inwieweit wir das Internet ­beherrschen oder uns von ihm beherrschen lassen ist letztlich unsere persönliche Entscheidung. Daran gibt es nichts zu rütteln. Inzwischen ist es mehr als eine Weltverbindung geworden, es hat sich zur grundlegenden Geschäfts- und menschlichen Verkehrssprache, ja selbst zur Amtssprache erhoben. Ich muss hier kurz von denen berichten, die es nicht beherrschen, denn ich alter Mann bin ein Beispiel, wie man durch Unfähigkeit und Versäumnis in ein Aus gerät, wenn man der Notwendigkeit einer Zeitströmung von solchem Gewicht nicht den gebührenden Tribut erweist. 35 Da ich über den Gebrauch des Handys nicht hinausgekommen bin, habe ich mich, wenn ich es aus einer unpathetischen Distanz formuliere, beruflich, gesellschaftlich und auch genussmäßig geschädigt. Zwar kann ich es bislang zumeist vertuschen, da meine Frau und meine Assistenten die Kontakte zur Außenwelt: Steuern, Krankenkasse, Miete, Zug- und Flugreisen, die ständigen Hin- und Hers mit den Theatern spielend bewältigen, und ich mühsam und langwierig mit Briefen, Telefonaten und mit dem Fax den Verpflichtungen nachzuhelfen versuche, doch meine Abhängigkeit bleibt gewaltig. An unmittelbare Kommunikation, durch eine E-Mail beispielsweise, oder an eine spontane, emotionale Mitteilung ist gar nicht zu denken, da alles durch die Hände Dritter geht. Ich hatte fast drei Jahrzehnte lang eine Art Sekretärin, eine Frau, der ich all mein mit der Hand Geschriebenes diktierte. Diese wunderbare Frau, die ihr Leben lang im Rollstuhl saß und im letzten Jahr verstarb, war sozusagen mein Nadelöhr zur Welt. Was durch ihren Computer schlüpfte, wurde publiziert. Unsere Sitzungen waren Séancen, von denen ich zutiefst erschöpft, hustend – wir rauchten beide wie um die Wette – und am Ende ich leicht angetrunken nach Hause kam. Ich werde nie mehr eine ähnliche Partnerschaft finden, denn es war der bestimmte Mensch, der da an der Maschine saß, freudig nickte, die Mundwinkel verzog, kurz innehielt, ermunternd mich anblickte. Der Tod dieser Frau isolierte mich zusätzlich. Es ist etwas anderes, wenn ich meine Frau ungekonnt burschikos frage: „Meinst du, du könntest diese Seiten in den Computer tippen?“ Sie hat es, wenn es dringend war, oft genug getan. Doch es vermittelte latent den Eindruck eines unfreiwilligen Ausnahmezustandes, und ich kam mir als Versager, ja als ein Missbrauchender vor. Und wenn meine Frau, da sie über ein seltenes, fein registrierendes Sprachgefühl verfügt, etwas verbesserte, 36 dankte ich ihr nicht genügend, wie ich es bei meiner Sekretärin getan hatte, sondern fühlte mich eher wie von einer Lehrerin gerügt. Nun werden Sie zu Recht fragen: Wieso, lieber Mann, wenn Sie das so unerträglich finden, unternehmen Sie nichts dagegen? Oder wollen Sie ein Opfer sein? Genießen Sie Ihre Rolle als ein täppischer Greis, der von einer neuen Zeit überrollt bejammerungswürdig in der Ecke sitzt und auf die Türklinke starrt, ob ein Kutscher anklopft und Sie in die 1970er oder -80er Jahre zurückfährt?! Wahrhaftig, nein, rufe ich empört, aber abgesehen davon, dass ich 1998, als das Internet immer mehr aufkam – damals war ich siebenundfünfzig Jahre alt –, nicht seine grundlegenden Folgen erkannt habe, hatte ich immer schon Schwierigkeiten mit jeder Form von Apparat. Und noch etwas ganz Zentrales ließ mich mein Versäumnis entschuldigen. Bei meinen schriftlichen Arbeiten gab mir die Handschrift eine spontane, vorläufige Form vor, die, indem ich laut einer anderen vertrauten Person diktierte, in eine Überprüfung geriet und schließlich durch den Druck der Maschine so neutral wurde, dass ich der Korrektur, wie ich fand, fast fremd gegenüberstand. (Übrigens hat diesen Text meine Frau geschrieben.) Doch ich will mich nicht als traurigen Einzelfall stilisieren, sondern als warnendes Beispiel verbleiben, das allerdings jetzt mit 74 Jahren einen Lehrer engagiert hat, der nach den ersten Stunden überblickend gemeint hat: viel werden wir nicht erreichen, Herr Neuenfels, aber das Wenige kann helfen, Sie nicht gänzlich der Welt abhanden kommen zu lassen. Zurück oder besser vorwärts zum allgemeinen Thema! Das einzige Gebiet, das Niemandsland, das keine Unterwerfung je erreicht hat und nie erreichen kann, ist die Kunst. Die Kunst unterwirft und unterwirft sich nie. Ob Leonardo da Vinci sein Abendmahl im Auftrag der Kirche von Mailand malte oder Michelangelo die biblischen Deckenfresken in der Sixtinischen Kapelle des Vatikans – es sind gekaufte Auftragsarbeiten der damals alles unterwerfenden Religion – nichts deutet darauf hin, dass diese Arbeiten eine andere Haltung haben als die Sicht ihrer Schöpfer. Durch die Formgebung, durch die Farben. Ja, es wäre zu fragen, und sicher ist es schon geschehen, ob diese Kunstwerke überhaupt im strengen Sinn als religiös zu bezeichnen wären. Die Haltung der Schöpfer, was ist sie? Die von Beethoven, von Luigi Nono, von Goethe, von James Joyce – es ist immer der Zweifel bis zur Auflehnung, die Verzweiflung bis zum Chaos, die Zähigkeit bis zum Untergang, die Durchsicht bis zum Wahnsinn, die hemmungslose ­B eschwörung des einzig treffenden Bildes, des Tones, des Wortes bis zum Zusammenbruch. Die Kunst hat keine Zeit für Machtspiele und Protz. Sie kommt immer zur Unzeit. Sie ist nie zu berechnen. Aber sie ist keinesfalls zeitlos. Sie hat ihre eigene Zeit. Die Unterwerfung kennt ihre Zeit genau. Rechnet mit ihr. Weil sie Stärke und Schwächen kennt. Die Kunst weiß davon nichts. Das Reiche und Arme, das Gute und Böse, das Dumme und Kluge, alles ist da, weil es ist. Aber es wird verwandelt. Durch die Behauung eines Steins, das Einsetzen einer Fuge, einer K ­ antilene, einer Metapher, eines R ­ elativsatzes, eines Bindestrichs, einer Farbe, einer Kontur. Die Kunst ist ohnehin stärker als die Unter­ werfung, denn sie stellt die Unterwerfung dar. Sie stellt sie aus. Ist M ­ aterial für sie. Wie sie ebenfalls das ­Opfer ausstellt. Aber nie ohne die Liebe, ohne das Mitleid. Selbst im größten Schock sind sie anwesend. Sie bilden mit dem K ­ önnen des Schöpfers eine Trinität. Es ist die einzige Trinität, die so wahrhaftig ist, dass sie keiner Religion b ­ edarf. Sie ist die Krone der Freiheit des Menschen in diesem Diesseits. Regisseur Hans Neuenfels hielt die Rede „Unterwerfung“ am 22. Juli 2015 in der Münchner Heilig-Geist-Kirche, im Rahmen der Unmöglichen Enzy­klopädie 34, einer Kooperation mit der Erzdiözese München und Freising. In der Spielzeit 2015/16 wird er an der Bayerischen Staatsoper die ­Uraufführung von Miroslav Srnkas South Pole inszenieren. MÜNCHEN RESIDENZSTR ASSE 27, AM ODEONSPL ATZ / PRE YSING PASSAGE FOLLOW US ON W W W. PRIME-SHOES .COM Eine groSSe innere Freiheit Die Figur der Renata aus Sergej Prokofjews Der feurige Engel wird oft auf eine sexuell obsessive Frau reduziert – sagt So­pranistin Evelyn ­Herlitzius, die diese aberwitzige Partie in der Neuins­zenierung von Barrie Kosky singt. Ein Interview zum ­Rollendebüt. Rubrikentitel Premiere Der feurige Engel 39 MAX JOSEPH Renata ist für Sie ein Rollendebüt. Wie nähert man sich einer solchen Figur? EVELYN HERLITZIUS Von möglichst vielen Seiten! Ich bin noch mitten in der Forschungsarbeit … Die Handlungsstränge des Feurigen Engels sind komplex, das Personal bunt gemischt. Momentan beschäftigen mich spirituelle Fragen. Was ist ein Engel? Gibt es so etwas, oder nicht? Wie unterscheiden sich Engel in den unterschiedlichen Religionen? Oder Dämonen: In unserer Kultur herrscht eine Polarität von Gut und Böse. Bei den alten Griechen wurden Dämonen aber differenzierter gesehen. Ein Daimonion war eher eine Art Begleiter durchs Leben. Für mich ist es wichtig, eine Haltung zu finden. Vordergründig ist Der feurige Engel ja unglaublich katholisch, mit der Inquisitionsszene am Ende der Oper und der Bezeichnung Renatas als Besessene. Aber ich sage bewusst „vordergründig“. Für mich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dieser Katholizismus nur eine Folie ist, auf der Prokofjew seine Themen abbilden konnte. Die Inquisitionsszene ist natürlich ungeheuer theaterwirksam, und man kann sich vorstellen, wie stark sie Prokofjew als Musiker inspiriert hat. Bei der Entwicklung der Figur hat mir die Beschäftigung mit dem Katholizismus aber nicht wirklich weitergeholfen. Für mich ist Renata per se ein Mensch, der sehr anders ist als seine Umgebung, provokativ anders lebt, dies auch zeigt und davon nicht abweicht. Man könnte sagen, Renata lebt in einer anderen Realität – aber dies wirft gleichzeitig die Frage auf, was Realität überhaupt ist. Ist es mein Garten, in den ich gerade blicke, oder gibt es eine Realität dahinter, die Renata eben wahrnimmt? Fakt ist, dieses Anderssein zerstört Renata, weil ihre Umgebung damit nicht umgehen kann. Diese Umgebung, die vor allem eine männliche ist, will Renata bändigen. MJ Gilt das auch für Ruprecht? EH Ja, und für die heilige Mutter Kirche! MJ Ist Ruprecht von Renata fasziniert, weil sie Eigenschaften hat, die ihm fehlen? EH Ganz am Anfang findet Ruprecht Renata vor allem schnuckelig, er möchte mit ihr schlafen. Das Ziel verfolgt er im Laufe der Oper zwar weiterhin, aber es gibt auch etwas an dieser Kindfrau, das ihn fasziniert. Renata hat eine große innere Freiheit, eine Wildheit, Begeisterungsfähigkeit, Ungebärdigkeit – die Prokofjew grandios in Musik umsetzt. Dazu scheint sie eine Schutzbedürftigkeit auszustrahlen, die Ruprecht antriggert. Und sie hat eine starke erotische Ausstrahlung. Obwohl sie noch jung ist, hat sie zu ihrer Sexualität einen sehr direkten Zugang, sie besitzt die Fähigkeit zur absoluten Hingabe. Das zeigt ihr Verhältnis zu Madiel und dann später zu Heinrich. Fotografie Martina Hemm MJ Ist es wichtig, eine Vorstellung davon zu haben, wer oder was Madiel, der „feurige Engel“, sein könnte? EH Für ein erweitertes Verständnis der Oper finde ich es wichtig. Unsere Kultur ist ja voll von Engeln. Im Hebräischen gibt es zwei Übersetzungen für „Engel“. Die eine lautet sinngemäß „Gestalt gewordenes Wesen im Licht“, die andere „bestimmter Bewusstseinszustand“. Madiel geht wieder, er entzieht sich. Vielleicht kann man „Licht“ mit „Seligkeit“ gleichsetzen. Was Renata passiert, worin sie sich verrennt, ist zutiefst menschlich: sie möchte Seligkeit, Freude, Liebe festhalten. MJ Ist die Erarbeitung einer so intensiven Rolle wie die der Renata nicht auch eine Belastung? EH Nein. Es ist eine Herausforderung, eine große Lust. Ich brauche diese Forschungsarbeit, sonst lerne ich Töne und Text, aber ich weiß nicht, wer ich bin. Wie ich eine Phrase gestalte, zum Beispiel, ist natürlich in der Musik vorgegeben durch Tempo- oder Dynamikangaben, durch die Instrumentation. Das sind Puzzleteile, ich suche aber das Gesamtbild. Dafür lese ich querbeet – über Religion oder das Mittelalter zum Beispiel. Ich befrage Freunde, die sich in Psychologie oder Spiritualität auskennen, schaue mir Bilder, Gemälde an. So entsteht ein innerer Film, zusätzlich zum Diskurs mit dem Regisseur und der gemeinsamen Probenarbeit mit den Kollegen. Für die Renata wollte ich zunächst unter den tausend Baustellen des Werks ein oder zwei Punkte finden, auf die ich mich konzentrieren möchte. Zum einen ist das eben dieser Umgang der Gesellschaft mit ihrem Anderssein, zum anderen ihre offen ausgelebte Sexualität, die Art, mit der sie ihre Bedürfnisse so klar und entschieden formuliert. Der arme Ruprecht muss im Verlauf des Stückes ganz schön einstecken. Ich finde es aber falsch, Renata auf eine sexuell obsessive Frau zu reduzieren, wie es oft geschieht. Was Renata an Madiel so beeindruckt, ist ja gerade die spirituelle Nähe, von der sie möchte, dass sie sich auch auf einer körperlichen Ebene ausdrückt. Man spricht ja auch in der Liebe von „sich erkennen“. MJ So, wie Sie über Renata reden, erscheint sie als durch und durch positive Figur. Hat sie denn überhaupt keine Abgründe? EH Doch. Sie hat eine Tendenz zu – ich möchte nicht sagen: Selbstzerstörung, aber zur Selbstauflösung in ihrer Unbedingtheit. Ich bin mir auch noch nicht schlüssig, wie ich ihr späteres Verhalten Ruprecht gegenüber, ihren scheinbaren Sinneswandel, sehe. Liebt sie ihn wirklich, oder setzt sie bewusst ihre weiblichen Mittel ein? Das werden wir auf den Proben klären. 41 Fotografie Martina Hemm Haare, Make-up Gülsen Tasch MJ Was ist die größte musikalische Herausforderung? EH Das Parlando. Es ist nicht leicht, diesen Text ­adäquat in russischer Sprache zu gestalten. Ich habe die Katerina Ismailowa in Lady M ­ acbeth von Mzensk gesungen, die Partie ist viel großzügiger, arioser, sie hat nur ein Drittel des Textes der Renata. Sicherlich auch die stimmliche Exaltiertheit, die Ausbrüche, die gleich wieder zurück­ genommen werden. Die L ­ agenwechsel fallen mir nicht so schwer, weil ich viel zeitgenössische Musik gesungen habe. Es gibt auch nur wenige, vielleicht zwei oder drei Momente der Ruhe in der Oper. Ich muss mir also meine Kräfte gut einteilen. MJ Gibt es irgendwelche Parallelen zwischen ­Renata und Ihnen? EH Die Frage, was wirklich ist und was nicht – nicht ­unbedingt in religiöser, eher in spiritueller Hinsicht – treibt mich schon lange um. Wie ist die Welt beschaffen, wie erschaffen wir sie uns? Aber zu einem Ergebnis ­gekommen bin ich noch nicht … Der feurige Engel in aller Kürze: Köln, im 16. Jahrhundert: Seit ihrer Kindheit wird ­Renata von Madiel, dem „feurigen Engel“, besucht. ­B eide verbindet eine tiefe Freundschaft. Als junge Frau möchte Renata sich auch körperlich mit ihm v ­ ereinigen, aber Madiel lehnt dies ab und ­ver­schwindet: Renata sei das Leben einer Heiligen bestimmt. Besessen von dem Wunsch, mit Madiel zusammen­leben zu können, meint Renata ihn im Grafen ­Heinrich wiederzuerkennen. Doch auch ­Heinrich ­entzieht sich ihr. Indessen verfällt der ­entwurzelte Amerika-­Heimkehrer Ruprecht Renata und begibt sich mit ihr auf ihre fiebrige Suche nach dem ­verschwundenen Heinrich. Dabei schrecken ­beide nicht vor unlauteren Mitteln zurück, sie ­bedienen sich schwarzer Magie und bedrohen ­Heinrich körperlich; von Renata gedrängt, fordert Ruprecht Heinrich zu e ­ inem Duell, bei dem Ruprecht schwer verwundet wird. Da ihre Be­mühungen keinen Erfolg zeigen, zieht sich Renata in ein Kloster ­zurück. Als ihre An­wesenheit die a ­ nderen Nonnen zu orgiastischen und ekstatischen E ­ xzessen reizt, wird Renata von der ­Inquisition zu Tode verurteilt. Evelyn Herlitzius, geboren in Osnabrück, studierte an der ­Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Nach ersten ­Engagements in Saarbrücken und Karlsruhe debütierte sie 1997 mit der Partie der Leonore (Fidelio) an der Semperoper in ­Dresden. Seither gastierte sie u.a. an den Opernhäusern in Wien, Brüssel, Stuttgart, Berlin, Mailand, Amsterdam und Barcelona ­sowie bei den Festspielen in Salzburg, Bayreuth und Aix-en-­ Provence. Ihr Repertoire umfasst Partien wie Isolde (Tristan und Isolde), Kundry (Parsifal), Elisabeth/Venus (Tannhäuser), Ortrud (Lohengrin), Marie (Wozzeck), Färberin (Die Frau ohne Schatten), Katerina Ismailowa (Lady Macbeth von Mzensk) und die Titel­partien in Turandot, Salome und Jenůfa. Seit 2002 ist sie ­Sächsische Kammersängerin. In der Spielzeit 2015/16 ist sie a ­n der B ­ ayerischen Staatsoper als Elektra und als Renata in Barrie Koskys Neuinszenierung von Der feurige Engel zu erleben. Der feurige Engel Oper in fünf Akten und sieben Bildern Von Sergej Prokofjew Premiere am Sonntag, 29. November 2015, Nationaltheater STAATSOPER.TV: Live-Stream der Vorstellung auf www.staatsoper.de/tv am Samstag, 12. Dezember 2015 Weitere Termine im Spielplan ab S. 93 42 Interview Sophie Becker „Renata ist ein Mensch, der sehr anders ist als seine Umgebung, provokativ anders lebt. Fakt ist, dieses Anderssein zerstört Renata, ­ weil ihre Umgebung damit nicht umgehen kann.“ – Evelyn Herlitzius Prokofjew und Ettal Weder Paris noch Moskau: Sergej Prokofjew komponierte seine Oper Der feurige Engel im oberbayerischen Ettal. Sophie Becker erzählt von der überraschenden Station einer Biografie, die bis heute fesselt und Rätsel aufgibt. 44 Vorstellungsankündigung „Im März übersiedelte ich nach Süddeutschland, in die Nähe des Klosters Ettal an den Ausläufern der Bayerischen Alpen, drei Kilometer von Oberammergau entfernt, das durch seine mittelalterlichen, alle zehn Jahre stattfindenden Passionsspiele berühmt ist, eine malerische und ruhige Gegend, zum Arbeiten geradezu ideal. Ich begann sogleich mit der Komposition des ‚Feurigen Engels‘. Der darin beschriebene Hexensabbat muss irgendwo in dieser Gegend stattgefunden haben.“ So lapidar berichtet Sergej Prokofjew in seiner 1941 erschienenen Autobiografie über eine seiner Lebensstationen, die bis heute Rätsel aufgibt – gerade weil der Komponist den Eindruck erweckt, seine Ortswahl verstünde sich ohne weitere Begründung. Gibt man sich damit aber nicht zufrieden und geht der Frage nach, wieso es den Komponisten nach Bayern verschlug, beginnt eine spannende Spurensuche, die mitten in die politischen Wirren des 20. Jahrhunderts führt und das kleine Dorf mit der Weltpolitik verbindet. Die wenigen bekannten Fakten sind schnell erzählt: Gemeint ist der März des Jahres 1922, die Ankunft des damals 30-jährigen Prokofjew in Ettal. Prokofjew kam nicht allein, er wurde von seiner Mutter Maria und seinem Freund Boris Werin, einem Dichter, begleitet. Der Komponist hatte für sie gemeinsam ein Haus angemietet, die „Villa Christophorus“. Regelmäßiger Gast war Carolina Codina, eine in Madrid geborene Sängerin mit spanischen, französischen und polnischen Vorfahren, die der Komponist 1920 bei einem Aufenthalt in New York kennen- und lieben gelernt hatte. Die beiden heirateten im Oktober 1923 in Ettal. Es war eine Ziviltrauung im eigenen Haus, als Zeugen fungierten Maria Prokofjewa und Boris Werin, größere Feierlichkeiten scheint es nicht gegeben zu haben. Lina war schwanger, der gemeinsame Sohn Svatoslav wurde im Februar 1924 geboren – doch zu diesem Zeitpunkt war das Ehepaar Prokofjew schon weitergezogen: ab Dezember 1923 lebte das Paar in Paris. Prokofjew begeisterte sich in Ettal für die ihn umgebende Natur, genoss die Stille, unternahm weiterhin seine Konzerttourneen als Pianist, hatte aber nach eigenen Angaben keinerlei Kontakt zur deutschen Kunstszene. Auf den Stoff von Der feurige Engel war Prokofjew bereits, anders als seine Ausführungen in der Autobiografie nahe legen, im Dezember 1919 gestoßen, kurz nach Vollendung seiner dritten veröffentlichten Oper Die Liebe zu den drei Orangen. Vorlage war der gleichnamige, 1907/1908 entstandene Roman des symbolistischen Dichters Waleri Brjussow (1873-1924). Ohne Auftraggeber begann Prokofjew­­ noch 1920, während seines New York-Aufenthaltes, mit den ersten Skizzen. Premiere Der feurige Engel Den Großteil des Werkes komponierte der Künstler dann tatsächlich in Ettal. Insgesamt arbeitete er sieben Jahre an dem Werk, allerdings mit großen Unterbrechungen. 1926 erfolgte die Instrumentation, in der darauffolgenden Saison sollte Der feurige Engel an der Städtischen Oper in Berlin-Charlottenburg unter Leitung von Bruno Walter uraufgeführt werden. Die Produktion musste jedoch abgesagt werden, weil das Notenmaterial noch nicht fertig gesetzt war. Die weiteren Pläne für eine Uraufführung zerschlugen sich in den folgenden Jahren. 1928 arbeitete Prokofjew Teile des Werkes zu seiner Dritten Symphonie um. Die Uraufführung von Der feurige Engel hat Prokofjew nicht mehr erlebt, sie erfolgte konzertant 1954 in Paris, szenisch dann ein Jahr später im Teatro La Fenice in ­ ­Venedig, Regisseur war Giorgio Strehler. Trotz aller unbestrittenen Schönheit Ettals muss man Prokofjews Wahl wohl als Notlösung ansehen, geschuldet seiner langjährigen Wanderschaft. Der Komponist hatte seine Heimat 1918 verlassen. Grund dafür waren allerdings nicht so sehr die politischen Ereignisse der Zeit, sondern – zumindest offiziell – der Wunsch, im Ausland Karriere zu machen und die Notwendigkeit einer Luftveränderung angesichts seiner schwachen Gesundheit. Prokofjew reiste, mit einem sowjetischen Pass ausgestattet und mit Zustimmung des Volkskommissariats für Volksbildung, von Petrograd über Wladiwostok, Tokio und San Francisco an die amerikanische Ostküste, wo er Konzerte gab und an seiner Oper Die Liebe zu den drei Orangen nach Gozzi arbeitete. Die ursprünglich für ­Chicago geplante Uraufführung scheiterte nach dem Tod des Intendanten und Dirigenten Cleofonte Campanini. Auf der Suche nach Arbeit und Anerkennung nahm Prokofjew wieder Kontakt zu Serge Diaghilew, dem Impresario der nach Paris emigrierten Ballets Russes auf. Die nächsten beiden Jahre bis zum Umzug nach Ettal pendelte der Komponist zwischen Paris, London und den USA, wo 1921 in Chicago schließlich doch die Uraufführung von Die Liebe zu den drei Orangen stattfand. Ein anstrengendes, unruhiges Leben. Allein: der Durchbruch sollte nicht gelingen. Der Rückzug nach Ettal verfolgte sicherlich das Ziel, Muße zum Komponieren zu finden. Darüber hinaus war das Leben im nach dem Ersten Weltkrieg wirtschaftlich zerrütteten Deutschland ungleich günstiger als in Frankreich – der Dichter Konstantin Balmont berichtet, dass Prokofjew umgerechnet gerade einmal 20 Dollar im Monat zur Verfügung standen. Zur beruflichen Enttäuschung und zum großen Heimweh kam eine Haltung gegenüber den Bolschewiken, die man am ehesten als indifferent bezeichnen könnte. Prokofjew war, soweit wir wissen, kein überzeugter ­ 45 ­ ommunist, aber auch kein klassischer Emigrant, der eine K Rückkehr unter den vorherrschenden politischen Bedingungen kategorisch ausgeschlossen hätte. In Ettal begann er, über Briefe wieder verstärkt Kontakt zu seinen russischen Freunden aufzunehmen. 1925 bekam Wsewolod Meyerhold, Regisseur und Begründer des „Theateroktober“, den Auftrag, mit Prokofjew über Auftragskompositionen für die Sowjetunion zu verhandeln. Eine erste Reise in die alte Heimat unternahm der Komponist 1927 – nicht ohne sich die Wiederausreise sicherheitshalber auf Tag und Stunde genau garantieren zu lassen. Die Tournee erwies sich als sehr erfolgreich, Prokofjew wurde mit großem Jubel empfangen. Zurück in Paris sorgte die Uraufführung seines für Diaghilew komponierten Balletts Pas d’acier („Der stählerne Schritt“) unter den Emigranten für Unruhe und trug dem Komponisten den Vorwurf ein, ein „Apostel des Bolschewismus“ zu sein, der die westliche Denkart ablehnen würde. Eine zweite Reise in die ­Sowjetunion 1929 gestaltete sich schwieriger. Wieder war Pas d’acier Stein des Anstoßes, nur kam diesmal der Protest aus der anderen Richtung: eine „Assoziation proletarischer Musiker“ brachte die am Bolschoi geplante Aufführung zu Fall. Trotzdem, die Weichen waren gestellt, und weitere Reisen folgten. 1933 nahm sich der Komponist eine Wohnung in Moskau, 1936 übersiedelte er mit Lina und den beiden Söhnen endgültig dorthin – zur Zeit brutalster stalinistischer „Säuberungen“, wenige Monate, nachdem ein in der Zeitschrift Prawda veröffentlichter Artikel mit dem unrühmlich bekannt gewordenen Titel Chaos statt Musik die Hetzjagd auf Dmitri Schostakowitsch eröffnet hatte. Es ist bis heute nicht möglich, diesen Schritt ­Prokofjews und seine Konsequenzen für seine Kompositionsweise schlüssig einzuordnen. Bei allen Äußerungen des Komponisten muss reflektiert werden, wem gegenüber er sie in welchem Kontext tätigte. Das gilt insbesondere auch für die Autobiografie, die er 1939/41 – also mitten im Zweiten Weltkrieg – verfasste. Jedenfalls wird klarer, warum ­Prokofjew sich nicht mehr um eine Uraufführung von Der feurige Engel bemühte: Es war offensichtlich, dass das Werk in krassem Widerspruch zur Kulturpolitik der ­Sowjetunion stand. Über die Einschätzung seines Werkes insgesamt scheiden sich die Geister bis heute. Für die einen unterwarf sich der Komponist mit seiner Rückkehr der Doktrin des sozialistischen Realismus. Gleichzeitig jedoch schrieb er erst in seiner sowjetischen Zeit zahlreiche seiner bis heute berühmtesten Kompositionen wie Peter und der Wolf oder die Ballettmusik zu Romeo und Julia und Aschenbrödel; es muss an dieser Stelle offenbleiben, ob man diesen Erfolg mit einer Vereinfachung der Mittel erklären kann, die mit dem sozialistischen Realismus ­konform ging. Andere wiederum vertreten die Ansicht, Prokofjew – zu keiner Zeit ein „internationaler“ Komponist wie sein Landsmann und Rivale Igor Strawinsky – habe erst nach der Rückkehr künstlerisch wirklich zu sich selbst gefunden. Diese Überzeugung wiederum blendet die Tatsache aus, dass der Komponist vor allem am Ende seines Lebens massiv angefeindet wurde. Zwischen diesen beiden Extrempositionen gibt es zahlreiche differenziertere Urteile bis hin zu der These, dass es gar keinen „Bruch“ in Prokofjews Schaffen gegeben habe, sondern Kontinuitäten vorherrschen würden. Wann – ­ wenn überhaupt – hier eine faire Einschätzung gefunden werden kann, ist unabsehbar. Und so halten wir uns auch im Hinblick auf ­Prokofjews­sowjetische Zeit an die überlieferten Fakten, womit sich weitere Kreise schließen: Ende der 1930er Jahre begegnete Prokofjew der in Kiew geborenen Mira Mendelssohn und verliebte sich in die 24 Jahre jüngere Frau. 1941 zog er mit ihr zusammen, hielt aber die Ehe zu Lina noch aufrecht, um sie zu schützen. Als Prokofjew sich dann 1948 aus welchen Gründen auch immer doch zur Heirat mit Mira entschloss, wurde Lina als verdächtige Ausländerin umgehend verhaftet und unter dem Vorwurf der Spionage und des Landesverrates bis 1956 in ein Lager verbannt. Bereits im Februar 1948 wurde Prokofjew und anderen Komponisten in einem Beschluss des Zentralkomitees der KPdSU „Formalismus“ und mangelnde Nähe zum Volk vorgeworfen. Fast alle Werke Prokofjews wurden verboten, er hatte kein Einkommen mehr. Sergej Prokofjew starb am 5. März 1953 – am selben Tag wie Stalin. Mit dem Wissen um die Ereignisse seiner letzten Lebensjahre wirkt die seine Oper Der feurige Engel beschließende Inquisitionsszene noch erschütternder. Als hätte er seinen weiteren Lebensweg in Ettal voraussehen können. Wenn man heute nach Ettal reist, sind die Spuren des Komponisten verschwindend gering. Man erreicht den Ort im Kreis Garmisch-Partenkirchen von München aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln in knapp zwei Stunden. Mit dem Zug geht es bis Oberau, von dort aus nimmt man den Bus. Das Dorf ist mit nur rund 800 Einwohnern kleiner als erwartet. Gegenüber der großartigen Klosteranlage aus dem 14. Jahrhundert finden sich aufgereiht an der Werdenfelser Straße einige Hotels, Gastwirtschaften und wenige Häuser gegenüber. Die junge Verkäuferin in der Bäckerei bejaht meine Frage, ob sie die Villa kennen würde, in der der Komponist Prokofjew seinerzeit gelebt hatte. Ich solle die Straße zurückgehen – es gäbe hier ja nur eine –, an dem Haus befände sich mittlerweile auch eine kleine Prokofjews Rückzug nach Ettal verfolgte sicherlich das Ziel, Muße zum Komponieren zu finden. Darüber hinaus war das Leben im nach dem Ersten Weltkrieg wirtschaftlich zerrütteten Deutschland ungleich günstiger als in Frankreich. Rubrikentitel 47 ­ edenktafel, und sie zeigt mit den Händen den Umriss eiG ner Kachel. Obwohl die Auswahl nicht groß ist, brauche ich eine Weile, bis ich die „Villa Christophorus“ identifiziert habe, denn die einzige schwarz-weiß Fotografie, die mir zur Verfügung steht, ist, wie sich herausstellt, nicht von der Straße her, sondern vom Garten aus aufgenommen worden. Das ganze Grundstück des offensichtlich von mehreren Parteien bewohnten Hauses wirkt liebevoll gepflegt, die Gedenktafel finde ich nicht. Eine ältere Ettaler Dame, von einem Spaziergang zurückgekehrt, bestätigt mir nach kurzem Nachdenken, das Gesuchte gefunden zu haben, verbindet darüber hinaus mit dem Namen des Komponisten aber keine weiteren Assoziationen. Auch in den zahlreichen Souvenirläden gibt es keinen Hinweis auf Prokofjew. In der Buchhandlung des Klosters finden sich mehrere CDs von Jonas Kaufmann, Anna Netrebko und Elisabeth Schwarzkopf, dazu Biografien über Richard Wagner. Meine Frage, ob es irgendein Buch oder eine Aufnahme von Prokofjew im Angebot gäbe, beantwortet der zuständige Pater mit einem barschen „Nein“. Sophie Becker arbeitet als Dramaturgin u.a. für die Festivals SPIELART und DANCE, für die Sächsische Staatsoper Dresden, die Bayreuther Festspiele, die Salzburger Osterfestspiele und De Nederlandse Opera Amsterdam. Der feurige Engel Oper in fünf Akten und sieben Bildern Von Sergej Prokofjew Premiere am Sonntag, 29. November 2015, Nationaltheater STAATSOPER.TV: Live-Stream der Vorstellung auf www.staatsoper.de/tv am Samstag, 12. Dezember 2015 Weitere Termine im Spielplan ab S. 93 48 Fotografie Martina Hemm Der Wettlauf von Roald Amundsen und Robert Scott zum Südpol wurde Geschichte. In der Spielzeit 2015/16 wird die Geschichte zur Oper. Miroslav Srnka komponiert im Auftrag der Bayerischen Staatsoper die Oper South Pole, das Libretto schreibt Tom Holloway. MAX JOSEPH begleitet die Uraufführung durch die Spielzeit – im Rubrikentitel 49 ­ersten Teil damit, wie alles begann … Das kälteste Rennen des Jahrhun­ derts. Die Dauer: mindestens zwei Jahre. Das Ziel: als erster Mensch den Südpol zu erreichen. Der Einsatz: nicht weniger als das Leben. Die Teil­ nehmer: zwei ehrgeizige Entdecker und ihre Mannschaften. Im Herbst 1910 heißt es ablegen. Doch nur ei­ ner der beiden Expeditionsleiter weiß beim Auslaufen seines Schiffes, dass es ein Wettlauf werden wird. Erst als Robert Scott mit seinem fünfeinhalb Dutzend Mann starken britischen Team schon fast die Antarktis er­ reicht hat, eröffnet der norwegische Polarforscher Roald Amundsen sei­ nen 18 Mitfahrern, statt zum Nordpol ebenfalls nach Süden zu fahren – und lässt sein Vorhaben dem Konkurren­ ten per Telegramm mitteilen. Beide Gruppen sind sich bis zuletzt un­ gewiss, wer die besseren Karten hat. Das Ergebnis ist viel deutlicher, als irgendjemand gedacht hätte. Doch der Sieger wird seines mit scheinbar leichter Hand erzielten Triumphs letztlich nicht froh. 50 Vorstellungsankündigung Rubrikentitel „Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau“, heißt es. Kathleen Bruce, die spätere Frau von Robert Scott, hat sich nie damit abgegeben, in der zweiten Reihe zu stehen. Die Bildhauerin pflegt einen extravaganten Lebensstil und schert sich nicht um Konventionen. Die Zahl ihrer Verehrer ist Legion, doch wonach sie eigentlich sucht, ist ein Mann, der dafür taugt, der Vater ihres Sohnes zu werden. Und das ist Scott, der seit der Discovery-Expedition 1901–04 als Südpolfahrer berühmt wurde und dem manche noch Großes zutrauen. Ihm wiederum spuken die vielen großen Männer in ihrem Leben immer im Kopf herum. Wie soll ein schlichter Marineoffizier auch bestehen gegen Persönlichkeiten wie Auguste Rodin (der ihr Lehrer gewesen war und sie als Kollegin achtete), Pablo Picasso (den sie in Paris kennenlernte), J. M. Barrie (den späteren Autor von Peter Pan) oder gar den Dichter und Sexual-Okkultisten Aleister Crowley? Auch mit der Tänzerin Isadora Duncan war Kathleen eng verbunden: allesamt Erscheinungen einer Gesellschaft, in der Scott sich wie ein tumber Tor fühlen muss. Es entspinnt sich sogar während seiner Antarktisreise eine – platonische – Beziehung zwischen Kathleen und dem späteren Friedensnobelpreisträger Fridtjof Nansen, Amundsens Mentor, der sich in sie verliebt. Ausgerechnet! Kathleens Ehrgeiz spornt Scott jedenfalls in seinen Südpol-Ambitionen maßgeblich an: Sie gibt ihm mit auf den Weg, kein Risiko zu vermeiden nur aus Sorge um sie und den kleinen Peter. Der ist gerade ein halbes Jahr alt, als sein Vater die Südpol-Mission antritt. 51 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts liegen die letzten unentdeckten Gegenden der Welt an den Polspitzen der Erde. Die Fragen lauten: Was für eine Landschaft verbirgt sich hinter den Eisbarrieren, die den Blick zum Südpol versperren? Und gibt es am entgegengesetzten Ende der Erdachse vielleicht nicht nur Treibeisschollen, sondern auch Festland, das besiedelt werden könnte? Dahinter steckten handfeste geostrategische, politische, wirtschaftliche Interessen; die wissenschaftliche Forschung dient da eher als Feigenblatt. Das britische Königreich will seine Stellung festigen; und Norwegen als gerade erst unabhängig gewordene Entdeckernation – die königliche Personal­ union mit Schweden ist 1905 aufgelöst worden – will seinen Platz in der Weltpolitik finden. Scott musste seine Expedition zwar privat vorfinanzieren, kann aber auf Rückhalt von akademischen Vereinigungen wie der Royal Geographical Society und von deren einflussreichen Mitgliedern zurückgreifen; der Präsident, Sir Clements Markham, ist der eigentliche Urheber hinter Scotts Expeditionen. Die Konkurrenz ist groß, Sir Ernest Shackleton nur einer von vielen, die liebend gerne auch den Südpol entdecken würden (pikanterweise unterstützt er dann Amundsen bei dessen Presseaktivitäten). Und Amundsen selbst? Der steht zwar besser da, zählt doch Fridtjof Nansen als Doyen der Polforschung zu seinen Unterstützern, gleichwohl ist auch er auf staatliches Geld angewiesen; der Storting (das norwegische Parlament) bewilligt ihm nicht alles, was er fordert, aber doch eine Menge, und König Haakon VII. hilft ebenso. Einiges an Hinterzimmerdiplomatie ist nötig in diesem Gerangel. Hinter den sportlichen Leistungen stecken viele Köpfe, die daheim die Fäden zu ziehen versuchen. 52 Vorstellungsankündigung Rubrikentitel 53 Amundsens Vater Jens war einer von fünf Brüdern, Roald selbst der jüngste von vieren. Doch eine eigene Familie gründet er nie. Von Kindheit auf gilt sein Ehrgeiz der – wie er es nannte – „Eroberung“ von Nord- und Südpol. Das nur der Mutter zuliebe aufgenommene Universitätsstudium bricht er nach deren Tod ab, und fortan ist alles, worin er sich ausbildet – Skifahren, Navigation, Kapitänspatent – auf dieses Ziel ausgerichtet. Nur eine Frau ist beständig gegenwärtig in seinem Leben: Betty Anderson, sein Kindermädchen, die noch dem berühmt gewordenen Abenteurer den unsteten Haushalt führt; nach ihr – nicht etwa nach seiner Mutter oder Freundin oder Frau – benennt er einen Berg auf der Antarktis. Liebschaften pflegt er nichtsdestoweniger, als Zeitvertreib zwischen seinen Expeditionen. Nach erfolgreicher Rückkehr verliert er dann regelmäßig das Interesse an den Amouren, bei denen es sich ausnahmslos um 54 verheiratete Frauen handelt. Seine Vermieterin in Antwerpen, wo Amundsen einen Navigationskurs besuchte, bringt sich um, als das Verhältnis bekannt zu werden droht; Sigrid Castberg, die Gattin eines Obergerichtsanwalts, trennt sich von ihrem Mann für Amundsen, der sie dann sitzen lässt; Kristine Bennett, die junge norwegische Frau eines reichen englischen Geschäftsmanns, wird während Amundsens Vortragstournee nach der Südpolreise seine Herzensdame und bleibt es länger als alle anderen. Als es ernst zu werden droht mit dem Zusammenleben, lässt Amundsen auch sie fallen. Vor seiner letzten Geliebten, Bess Magids, die er mit einem Verlobungsversprechen aus Amerika nach Norwegen gelockt hat, flüchtet er sich in die tödliche Rettungsaktion für seinen Rivalen Umberto Nobile. Vorstellungsankündigung Zwei Schiffe – beide mit bedeutender Vorgeschichte. Die Fram („Vorwärts“): Kein Holzschiff ist weiter nach Norden und weiter nach Süden vorgedrungen. Fridtjof Nansen hatte es sich 1892 bauen lassen für seine legendäre Nordpoldrift. Ein Schiff, das dank seiner ausgeklügelten Konstruktion dem Druck des Packeises standhalten konnte; jahrelang überwintert die Fram im arktischen Frost. Länge über alles: 39 Meter, Breite 11 Meter, 402 Bruttoregistertonnen; für Amundsens Expedition wird sie als erstes Schiff der Welt mit einem Dieselantrieb ausgerüstet. Heute steht sie in Oslo, als Hauptausstellungsstück des Fram Museums. Rubrikentitel Die Terra Nova („Neuland“): knapp zehn Jahre älter und ursprünglich ein Walfangschiff. Mit 57 Metern anderthalbmal so lang, aber knapp einen Meter schmaler als die Fram, verfügt sie mit 764 Bruttoregistertonnen über fast doppelt so viel Laderaum, benötigt allerdings auch viel mehr Besatzung. Immerhin müssen auch Ponys und Motorschlitten untergebracht werden und nicht nur Schlittenhunde wie auf der Fram. Auch die Terra Nova hat einschlägige Erfahrungen im polnahen Einsatz: 1903 hat sie die von Scott geleitete Discovery-Expedition befreien geholfen und zwei Jahre später in der Arktis die Ziegler-Expedition gerettet. Nach Scotts Südpolfahrt wird sie als Robbenfänger eingesetzt und sinkt 1943 bei Grönland, wo sie Nachschub für amerikanische Militärbasen transportiert hat. 55 Auf der Karte sieht es so simpel aus, doch so einfach und direkt geht es natürlich nicht. Kaum auszumalen, welches Risiko die Abenteurer auf sich nehmen, um überhaupt erst an den Ort des Geschehens zu gelangen! Schon ein heftiger Sturm hätte alle Anstrengungen zunichte machen, die gesamten Besatzungen der schwerbeladenen Schiffe zugrundegehen lassen können. Einige Zwischenstopps sind erforderlich: Scott besteigt die Terra Nova erst in Südafrika, verlässt sie wieder in Melbourne und kehrt an Bord zurück in Neuseeland, der letzten zivilisierten Station vor der Antarktis; Amundsen kreuzt ein wenig in den Fjorden zwischen Kristiania (Oslo) und Bergen und steuert dann Funchal auf Madeira an, wo nicht nur die Vorräte ergänzt werden, sondern er auch seine Mannschaft darüber 56 informiert, was sie eigentlich erwartet. Auf den Booten befinden sich: das Material für die Hütten der Basisstationen (in Amundsens Fall praktisch ein Fertighaus), Zelte, Schlitten, meteorologische Instrumente, Proviant für Jahre (überwiegend Konserven von Unternehmen, die sich wie heutige Sponsoren gute Propaganda versprechen), an Transportmitteln bei den Briten drei Motorschlitten, Ponys und einige Hunde, bei den Norwegern von letzteren über 100 – aber an beiden auch Klaviere und Grammofone mit hunderten von Schellackplatten. Man feiert Weihnachten unter Deck mit stimmungsvoller Musik; zuweilen verkleidet sich ein englischer Matrose als Frau und tanzt für seine Kameraden. Es ist eine lange Zeit, die man miteinander verbringt. Vorstellungsankündigung Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist der „elektromagnetische Schreibtelegraf“ von Samuel Morse das Mittel der Wahl, um kurze Nachrichten über weite Entfernungen schnell zu übermitteln; besonders, wenn der genaue Aufenthaltsort des Empfängers nicht bekannt ist. Die nötige Knappheit durch die nur drei verschiedenen Zeichen (kurz, lang, Pause) zwingt zur Beschränkung aufs Wesentliche. Die professionellen Tastfunker entwickeln beim Senden ihre jeweils charakteristische, wiedererkennbare „Handschrift“; besonders souveräne Morser genießen in ihrer Funkstube wohl auch eine zünftige Pfeife. Der Empfänger kann es sich nicht immer so ­gemütlich machen. (Das charakteristische Piepen des Morsegeräts wird übrigens keine ganz unwesentliche Rolle in der Oper von Miroslav Srnka Rubrikentitel spielen. Schließlich ist es quasi der Startschuss zum Wettlauf um die Ehre – mit der, à propos, auch eine Menge Geld verbunden ist; Exklusivnachrichten sind auch damals schon eine lukrative Angelegenheit.) Das Telegramm erreicht Scott in Melbourne. An seiner geplanten Vorgehensweise ändert es nichts – sagt er. Aber sein Inneres bleibt seither in Aufruhr. 57 Johanna Diehl, Ukraine Series, Chernivtsi I, 2013, Courtesy Johanna Diehl und Galerie Wilma Tolksdorf Frankfurt/Berlin Text Malte Krasting סדרה אוקראינית Johanna Diehl ukraine series 28. Oktober 2015 українські верстви – 06. März 2016 Die telegrafierte Botschaft Amundsens ist mit Absicht unklar gehalten: „Beg leave to inform you Fram proceeding Antarcic“ – „Erlaube mir Sie zu informieren Fram Kurs auf Antarktis“. Das eigentliche Vorhaben der „Fram“ wird gar nicht benannt, und aus dem unterzeichneten „Amundsen“ geht nicht einmal hervor, wer eigentlich der Absender ist: Tatsächlich ist es nicht von Roald Amundsen, 58 sondern auf dessen Anweisung von seinem Bruder Leon verschickt worden, und als Scott ungläubig bei Fridtjof Nansen nachfragen lässt, was das denn bitte genau bedeuten solle, bescheidet dieser wider besseres Wissen: „Unbekannt“. Was will Amundsen wirklich? Was wollen beide überhaupt erreichen? Wozu setzen Dutzende Männer ihr Leben aufs Spiel, um im ewigen Eis einen abstrakten Punkt zu erreichen? Vieles lässt sich auch in Kenntnis aller Fakten und Dokumente nur schwer erklären. Aber dem schwer Erklärbaren, dem Unerklärlichen kommt womöglich die Kunst näher. Auch für den Dichter Tom Holloway und den Komponisten Miroslav Srnka heißt es nun: Amundsen und Scott, wir kommen! Vorstellungsankündigung PINAKOTHEK DER MODERNE Bayerische Staatsgemäldesammlungen www.pinakothek.de Rubrikentitel 59 Test: Wie vermessen sind Sie? Ein kleines Spiel mit dem Wort „Vermessen“ sei erlaubt: Es geht nicht nur um Selbstüberschätzung, sondern auch um den individuellen Hang zum Vermessen. Manche würden am liebsten alles vermessen – vom Puls beim Joggen bis zum täglichen Check auf der Waage. Das gibt ihnen das gute Gefühl, die Kontrolle zu haben. Andere wiederum fühlen sich durch ständiges Messen eingeschränkt. Sie sind lieber spontan, verlassen sich eher auf ihre Intuition und ihr Augenmaß. Testen Sie hier exklusiv, wie es in puncto „Vermessenheit“ um Sie steht. Frage 4 Drei Intendanten diskutieren über die Bedeutung einer Oper. Welchem Schwerpunkt stimmen Sie am meisten zu? Eine Aufführung muss das Herz berühren, den Zuschauer zu einem besseren Menschen machen. Bleiben wir realistisch, vergessen wir nicht, dass eine Aufführung auch Handwerk ist. lehnen dankend ab. Denken Sie an einen Menschen, der Ihnen nahesteht und den Sie gut kennen. Finden Sie spontan Vergleiche für diese Person. Was wäre sie als … Duft Blume Frage 1 be r Fa Wie gut hat es mit dem Vergleichen geklappt? Da musst du aber fleißig üben, mein Junge. Es fiel mir schwer. Na, bis dahin fließt noch viel Wasser die Isar hinunter. Bei ein, zwei Begriffen musste ich länger nachdenken. Das Kind hat tatsächlich schon eine Zukunftsvision. Das ging ganz leicht. Das klare, präzise Klangbild und die theatrale Umsetzung entsprachen musikdramaturgisch großartig dem Werk. So ein breites Spektrum! Das war für mich wunderbar abwechslungsreich. Frage 3 Das Leben ist kein Wunschkonzert. Sie sind maßlos enttäuscht, wenn … sich Ihr Ziel als falsch entpuppt. ein Freund Sie hintergeht. viel Arbeit sich nicht auszahlt. 60 Musikins trument Der kleine Sohn einer Freundin verkündet stolz: „Ich werde mal ein berühmter Musiker.“ Sie denken: Die reinste Seelennahrung, ich konnte kaum die Tränen zurückhalten. Von Dr. Eva Wlodarek Frage 9 Während einer Ballettaufführung flüstert die Dame neben Ihnen ihrem Begleiter zu: „So müsste man tanzen können …“ Sie denken: Ach ja, den Traum kann ich gut verstehen. Stimmt, aber dazu hätte man früh anfangen müssen. d Drei Opernfreunde schwärmen über alle Maßen von einer Aufführung. Welche Aussage bringt Sie wohl am ehesten dazu, sich diese anzusehen? fragen: „Kann ich auch eine halbe Portion haben?“ sagen sich: „Wenn schon, denn schon …“, und bestellen. Lie Frage 2 Nach der Oper gehen Sie noch mit Freunden zum Italiener. Die Hauptspeise hat Sie schon gesättigt. Der Kellner kommt: „Heute haben wir ein besonders köstliches hausgemachtes Dessert.“ Sie … Es geht nicht nur um Genuss, die Aufführung sollte eine intellektuelle Herausforderung sein. Frage 5 So wird der Test gemacht: Versetzen Sie sich mit etwas Fantasie in die jeweilige Situation und kreuzen Sie dann an, was am ehesten für Sie zutrifft … Frage 8 Sie hat recht, das Ballett ist fantastisch. Frage 10 Was würde Sie maßlos ärgern? Sie stehen im Lenbachhaus vor einem Bild von Wassily Kandinsky. Hinter Ihnen sagt eine Frau zu ihrem Ehemann: „Gell, Schatz, das kann unser kleiner Tobias auch.“ Frage 6 Sie haben eine Menge Geld ausgegeben, um diesen tollen Sänger zu hören. Er spult sein Repertoire ab und verschwindet nach einer knappen Stunde von der Bühne. Nach dem Konzert bringen Sie der von Ihnen verehrten Pianistin einen Blumenstrauß in die Garderobe, und zwar … Eine Bekannte hat Sie ins Theater eingeladen. Leider hat sie verschwiegen, dass es sich um ein Einpersonenstück mit kompliziertem Monolog handelt. selbstgepflückte Blumen. Damit heben Sie sich von all den gekauften Sträußen ab. ihre Lieblingsblumen – Sie haben herausgefunden, welche das sind. einen dekorativen Strauß. Es kommt auf die Geste an. Frage 11 Im Duett singt der Tenor: „Ich liebe dich, ich liebe dich …“ Welche Antwort der Sopranistin passt am besten? „Ja, du liebst mich, so wie ich dich.“ „Ich glaub’ es nicht, du musst es mir beweisen.“ Frage 7 „O Liebster, ja, ich würde für dich sterben.“ Man mag es vermessen finden, aber Sie wollen einen Bestseller schreiben. Wie gehen Sie vor? Sie recherchieren genau und entwerfen vorab den gesamten Plot. Sie schreiben ein Probekapitel, zeigen es Ihrem Partner oder Freunden und bitten um Kritik. Sie fangen einfach an zu schreiben. Dann entwickeln sich die Figuren schon von selbst. Frage 12 Sie bekommen die Chance, ein Bühnenbild zu gestalten. Welcher Stil liegt Ihnen am meisten? Sinnlich, farbig Minimalistisch, grafisch Klassisch mit modernen Elementen 61 Geben sie sich für jedes … A = 3 Punkte B = 1 Punkt C = 2 Punkte Zählen Sie Ihre Punkte zusammen. Die Auflösung finden Sie unter dem entsprechenden Punktwert: 12 – 20 Punkte: Bloß nicht zu vermessen – Sie vertrauen auf Ihr Gefühl 30 – 36 Punkte: Ziemlich vermessen – Sie behalten die Kontrolle Sie haben ein großes Herz und können sich gut in andere einfühlen. Ihre Sensibilität ist für Sie gewiss nicht immer einfach, weil Sie dadurch leicht von einer Atmosphäre beeinflusst werden. Aber sie hat auch eine großartige Seite: Dank Ihrer Aufnahmefähigkeit ist es Ihnen möglich, Kunst ganz besonders zu genießen. Dabei geben Sie sich mit allen Sinnen hin. Sie können sich begeistern und andere mitreißen. Das Vermessen liegt Ihnen dagegen weniger. Sie müssen nicht unbedingt die Partitur eines Musikstücks oder das Versmaß eines Gedichtes erkunden, um dessen Schönheit wahrzunehmen. Für Sie gilt eher der Spruch des Kleinen Prinzen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut“. Vorsicht vor Vermessenheit: Sie vertrauen mit Fug untd Recht Ihren Gefühlen und Ihrer Intuition. Aber es wäre vermessen, diese zum alleinigen Maßstab Ihrer Wahrnehmung und Ihrer Entscheidungen zu machen. Es kann nämlich durchaus sein, dass Intuition von Wunschdenken beeinflusst wird und dann zu falschen Schlüssen führt. Berücksichtigen Sie deshalb auch alle Fakten. Die sollten immer die Grundlage für Ihr Bauchgefühl sein. O doch, Sie haben durchaus Gefühle. Aber Sie lassen sich ungern von ihnen beherrschen. Große Leidenschaften sind Ihnen eher suspekt, lieber benutzen Sie Ihren klugen Kopf und halten sich an Tatsachen. Planen, organisieren, Wissen erwerben, das ist Ihre Domäne. Ein Faible fürs Vermessen beruht auch auf Ihrem Wunsch nach Perfektion. Sie geben meist hundert Prozent und bringen es einfach nicht über sich, etwas abzuliefern, das nur das Prädikat „gut“ statt „sehr gut“ bekommt. Ihr innerer Zensor misst, vergleicht und zieht seine Schlüsse. Hohe Ansprüche stellen Sie auch an die Kunst. Für Sie ist es ein besonderer Genuss, nicht nur emotional, sondern auch intellektuell bereichert zu werden. Dabei gilt der Spruch: „Je mehr man weiß, desto mehr kann man genießen.“ Vorsicht vor Vermessenheit: Ihre Erfahrung hat Ihnen gewiss bisher gezeigt, dass eine gute Planung Erfolg bringt. Doch das birgt auch die Gefahr, zu glauben, alles sei planbar. Schließlich gibt es den Zufall oder – im großen Rahmen – das Schicksal. Darum ist bei aller notwendigen Voraussicht auch Demut angesagt. Wir haben nun mal nicht über alles die Kontrolle. Das zu ignorieren wäre vermessen. AIDA deluxe: packende Studioaufnahme AIDA Jonas Kaufmann & Anja Harteros 21 – 29 Punkte: Mäßig vermessen – Sie schätzen die Balance 62 Gesamtaufnahme mit Ekaterina Semenchuk Ludovic Tézier · Erwin Schrott Antonio Pappano Eva Wlodarek ist promovierte Psychologin. Seit 1980 entwickelt sie psychologisch fundierte Tests für Printmedien, TV und namhafte Firmen. Sie baute unter anderem das Ressort Psychologie der Zeitschrift Brigitte auf. Testauflösung Illustration Felix Plachtzik Angenommen, das Leben ließe sich als eine Waage darstellen: In der einen Schale liegen die Gefühle, samt Kunstgenuss und Lebensfreude, in der anderen Pflichten und Aufgaben, die Organisation und Überlegung verlangen. Dann könnte man bei Ihnen deutlich sehen, dass beides recht ausgewogen ist. Sie wissen, wann es angebracht ist, Ihr Herz sprechen zu lassen, sind aber auch in der Lage, sachlich zu reagieren, wo es nötig ist. Messbare Informationen interessieren Sie nur, soweit sie Ihre Arbeit betreffen und persönliche Neigungen berühren. Dann recherchieren Sie präzise Zahlen im Internet oder wollen alles über eine bestimmte Epoche wissen. Ansonsten sind Sie eher spontan und lassen sich gerne überraschen. Vorsicht vor Vermessenheit: Speziell für Sie lautet der Rat ein wenig anders, nämlich Vorsicht vor zu wenig Vermessenheit. Sie sind oft so um Harmonie bemüht, dass Sie nur ungern aus der Reihe tanzen oder sich in den Mittelpunkt stellen. Sie fürchten, das könnte man Ihnen als Eitelkeit oder Überschätzung auslegen. Seien Sie in diesem Punkt ruhig etwas mutiger und stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Empfohlen von Rubrikentitel 63 Satanismus oder: Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt So weit vom Klischee, so nah an der Realität: Die ­Religionswissenschaftlerin Dagmar Fügmann schildert, was Satanismus heutzutage ausmacht. 64 Meine erste Begegnung mit einem leibhaftigen Satanisten werde ich nie vergessen. Ich stand an einem November­ abend zu später Stunde an einem Bahnhof, irgendwo in Deutschland. Dort wartete ich auf meine Kontaktperson, die mich zu einer Schwarzen Messe mitnehmen sollte, an der ich im Rahmen meines Forschungsprojekts teilnehmen durfte. Der genaue Veranstaltungsort war ebenso geheim wie die Menge der Personen, die ich dort treffen sollte. Es beschlich mich ein ziemlich mulmiges Gefühl. Während ich wartete, beobachtete ich die Menschen um mich herum und vermutete in jedem schwarz gekleideten oder düster dreinblickenden Passanten meinen Kontaktmann. Bis ein Mann mittleren Alters, gekleidet in ausgewaschene Jeans und einen blauen Strickpullover, Jesuslatschen mit Socken an den Füßen, eine Leberkäsesemmel kauend, mich an­ sprach. Ich gebe zu: Er war so ziemlich die letzte Person auf dem Bahnsteig, hinter der ich einen Satanisten vermu­ tet hätte. Ebenso – im Vergleich zu meinen Erwartungen – unspektakulär verlief das Ritual: Ein abgedunkelter Raum, ein wenig Weihrauch, ein Altar mit Pentagramm, künstli­ chem Totenkopf und Kelch, Rezitation von Texten ver­ schiedener Autoren und am Ende ein gemeinsames Trink­ ritual aus dem mit Wein gefüllten Kelch, an dem man sich beteiligen konnte, nicht musste. Diese erste Begegnung blieb beispielhaft für alle, die folgen sollten. Ich erwartete, auch aufgrund meiner ersten Recherchen und bestimmter Medienberichte, eine Art dunkler Subkultur, die sich durch ihre oder wegen ihrer Anbetung des Satans in menschenverachtenden Weltan­ schauungen und Ritualen ergeht. Von Grab- und Kirchen­ schändungen bis zu blutigen Opferritualen ist im Bild, das sich die meisten von Satanismus machen, alles geboten. Im Satanismus als religionswissenschaftlich erforschbarem Feld findet sich davon allerdings nichts. Das mag daran lie­ gen, dass mit Satanismus eben nicht Teufelsanbetung ge­ meint ist. Bereits Anton LaVey, der Gründer der in den USA seit 1971 als Kirche eingetragenen Church of Satan (CoS), an deren Leitideen sich viele andere satanistische Organisationen orientieren, pocht auf diese Unterschei­ dung. Wohl gibt es unzählige andere – auch gewalttätige – Gruppen, die oft nur für kurze Dauer existieren und mit einer Religion oder Weltanschauung nichts zu tun haben. Jedoch ist keine einzige existierende Gruppe nachgewie­ sen, die ihre Weltanschauung Satanismus nennt und gleich­ zeitig blutige Opfer vollführt. Zeitgenössische satanistische Gruppierungen beten weder Satan noch den Teufel oder Beelzebub an. Sie beten, genau gesagt, gar nichts an. Weshalb Satanismus dann als Religion, und nicht, wie manchmal vorgeschlagen, als Hu­ manismus bezeichnet wird (nicht zu verwechseln mit Hu­ manität), beantwortet der Gründer der CoS in der Satanischen Bibel. Er verweist darauf, dass Humanismus keine Religion, sondern nur ein „way of life“ sei. Satanismus da­ gegen bestehe aus einer Kombination von Zeremonie und Glaubenslehre, die seiner Auffassung nach menschliche Grundbedürfnisse sind. Satan wird in der Church of Satan als bewusste Alternative zu jeglicher Form von Herden­ mentalität, als prädestiniertes Symbol für Nonkonformis­ mus sowie als Symbol für die Instinktnatur des Menschen aufgefasst; die CoS kennt keine Vorstellung von einer per­ sonifizierten Wesenheit Satan. Anderen satanistischen Gruppierungen, wie dem ebenfalls in den USA als Kirche eingetragenen Temple of Set (ToS), gilt die Figur des Satan als Orientierungspunkt für die eigene Entwicklung: Satan selbst, so der ToS, offenbarte sich unter dem Namen Set dem Gründer des ToS, Michael Aquino, und beschrieb sich 65 als die „zeitlose Intelligenz dieses Universums“. Die Figur des Satan wird im Satanismus, ausgehend von der bibli­ schen Darstellung des Widersachers, positiv umgedeutet. Egal, ob er rein symbolisch oder personifiziert gedacht wird: Satan ist derjenige, der sich Gott gleichstellen woll­ te. Er widersagt im satanistischen Vorstellungsuniversum allem, was als mittelmäßig, angepasst, demütig, machtlos oder schwach konzipiert sein könnte. Ebenso unterschiedlich wie die Vorstellung von Sa­ tan ist das Menschenbild der beiden großen satanistischen Kirchen: Bestimmt die Church of Satan den Menschen als ein Tier unter Tieren, als instinkthaftes Tier, definiert der Temple of Set den Menschen als Wesen, das nicht auf die natürliche Seinsordnung reduziert bleibt, sondern darüber hinausgeht. Bei aller Verschiedenheit von Church of Satan, Temple of Set und vielen anderen kleineren Gruppierun­ „Satanists are born, not made“ war einer der meistwie­ derholten Sätze meiner satanistischen Interviewpartner auf die Frage, warum man sich im 21. Jahrhundert dem Satanismus zuwende. Oder ausführlicher: „Satanismus beschreibt meine Persönlichkeitsstruktur. Ich bin Sata­ nist von Geburt. Satanismus ist meine Religion, und es ist ein beschreibendes Wort für meinen Persönlichkeitstyp“. Das Spezielle dieser Form von Weltanschauung wird in der Aussage eines Mitglieds der Church of Satan deutlich: „Für mich ist Satanismus die Religion des Lebens. Alle anderen Religionen sind Religionen des Todes, der Absti­ nenz, des Stumpfsinns. Ich bin Satanist, weil ich Teil je­ ner Vielfalt bin, die sich Leben nennt, und es auch bleiben möchte. Die meisten Massenvergnügungen lassen mich zwar kalt, aber es gibt eine Menge anderer Dinge, an de­ nen ich mich erfreue: Literatur. Kunst. Gute Filme. Le­ Allen Spielarten des Satanismus gemeinsam ist die Vorstellung von der Selbstvergottung des Menschen. Jeder Mensch ist sein eigener Gott oder kann sich dazu entwickeln. gen gibt es dennoch zwei Grundgedanken, bei denen man sich einig ist. Zum einen wird Satan positiv umgedeutet. Er ist weder der Verführer noch der Böse. Er symbolisiert für die Church of Satan unter anderem Sinnenfreude statt Abstinenz, Weisheit statt Selbstbetrug, Verantwortung für Verantwortliche und einiges mehr, wie in den Neun satanischen Aussagen in Anton LaVeys Die satanische Bibel nachgelesen werden kann. Der Temple of Set betont, dass die Verehrung Sets die Verehrung des Individualismus sei. Die zweite Grundannahme, bei der Einigkeit besteht, ist die Vorstellung von der Selbstvergottung des Menschen. Je nach Spielart des Satanismus ist dabei jeder Mensch sein eigener Gott von Geburt an oder kann sich dazu entwi­ ckeln. Kein Gott für andere, dafür aber absoluter Herr­ scher im eigenen privaten Universum. Basierend auf dieser Vorstellung wird nachvollziehbar, weshalb Satanisten von Opferritualen jedweder Couleur wenig halten. Wem soll man opfern, wenn man sein eigener Gott ist? 66 ckeres Essen. Sex. Die Natur. Das Weltall. Nette und in­ teressante Menschen. Diese Welt ist eine Schatztruhe an Freuden und Vergnügungen. Dafür lebe ich. Und das ist für mich Satanismus.“ Satanismus hat trotz der stark hedonistischen Beto­ nung wenig mit einer Anything-goes-Haltung gemein. Der höchste Wert für Satanisten ist individuelle Freiheit. Die schlimmste Sünde, zumindest im Satanismus der Church of Satan, ist Dummheit. Als besonders dumm gilt, die eige­ ne Freiheit durch Handlungen zu gefährden, welche einen mit dem Gesetz (und in der Folge eventuell mit Freiheits­ entzug) konfrontieren könnten. Für ebenso dumm wird es gehalten, nicht Maß halten zu können und sich den eigenen Begierden auszuliefern. Denn auch dies habe nichts mit Freiheit zu tun. Das eigene Leben im Hier und Jetzt in größtmöglicher Freiheit selbstbestimmt zugenießen ist das oberste Ziel. Satanistische Grundideen beziehen sich aus­ schließlich auf das diesseitige Leben. Ob es ein Jenseits Bilder James Rieck gibt und was einen Satanisten dort erwarten könnte, gilt schlicht als spekulative Frage, auf die es keine Antwort ge­ ben kann. Indem man sich auf das Leben im Jetzt konzen­ triert, eröffnen sich im satanistischen Denkuniversum viel­ fältige Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Daseins nach individuellen Vorlieben. Pippi Langstrumpfs Liedzei­ le „Ich mach‘ mir die Welt – widdewidde wie sie mir ge­ fällt“ hätte das Potenzial zur Hymne des Satanismus. Das ideale gesellschaftliche Zusammenleben ist im Satanismus in selbstgewählte, individuell abgegrenzte Le­ benswelten aufgeteilt, die „total environments“. Sie sind kaum realisierbar und gelten den Satanisten daher als Utopie. Sozialdarwinistische Modelle nach dem Motto des „survival of the fittest“ und eine Einteilung der Gesell­ schaft in Schichten bilden die Basis einer solchen Gesell­ schaftsform. Keine Rolle spielt dabei die Abstammung pfuhl leben, sollten nicht auch denen auferlegt werden, die sich für ein asketisches Leben entschieden haben. Auch sollten die Verbote, die ein Mönch einhalten muss, nicht auch für jene gelten, die ihre Leben lieber im Wohnzim­ mer verbringen.“ Gleichheit für alle gibt es im Satanismus nur in einem einzigen Bereich: Alle sollen gleiche Chancen haben, das Bestmögliche aus sich und ihrem Leben zu ma­ chen. Trotz der geschilderten Grundeinstellungen ist Sa­ tanismus nicht frei von Überlegungen zu Liebe und Empa­ thie. Der Satanist lässt diese Regungen idealiter bewusst aber nur denjenigen zukommen, die er als dieser Gefühle wert empfindet. Auch wenn die Realisierung von unterschiedlichen Lebenswelten, in denen man sich völlig von allem Unge­ wollten abgrenzen kann, als utopisch gilt, versuchen viele Satanisten diesem Konzept doch möglichst nahe zu kom­ Mein Kontaktmann war so ziemlich die letzte Person auf dem Bahnsteig, hinter der ich einen Satanisten vermutet hätte. von Individuen. Im Original liest sich das, was mit Strati­ fizierung der Gesellschaft gemeint ist, in LaVeys Essay Pentagonal Revisionism wie folgt: „Es darf keinen Mythos von der Gleichheit aller geben – so etwas führt nur zu Mit­ telmäßigkeit und unterstützt die Schwachen auf Kosten der Starken. Man muss dem Wasser gestatten, sich seinen ­Pegel zu suchen, ohne von den Fürsprechern der Inkom­ petenz gestört zu werden. Keiner sollte vor den Auswir­ kungen seiner eigenen Dummheit bewahrt werden. Der Gedanke der Gleichheit aller Menschen (auch im Sinne von Gleichbehandlung vor dem Gesetz) wird abgelehnt. Es klingen deutlich die Einflüsse des späten Nietzsche an, wenn LaVey schreibt: „Wenn Schichtenbildung gleichbe­ deutend ist mit Ghettobildung, lasst es bleiben. Nennt es Isolierung – oder wie ihr wollt. Doch wir brauchen unter­ schiedliche Gesetze für unterschiedliche Menschen, vo­ rausgesetzt, es gibt unterschiedliche Lebenswelten. Die ­Regeln, die denen auferlegt werden, die in einem Sünden­ Text Dagmar Fügmann men. Deshalb gilt es, das Beste aus dem eigenen Leben zu machen und sich möglichst von allem, was nicht zur „sata­ nistischen Elite“ gehört, abzugrenzen. Dies könnte eine Er­ klärung dafür sein, weshalb sich in satanistischen Kreisen zahlreiche Selbstständige, viele akademisch gebildete Per­ sonen sowie eine große Zahl recht erfolgreicher Kunst­ schaffender finden. Wer sein eigenes privates Universum, sein eigenes total environment, möglichst unabhängig gestalten möchte, braucht Kreativität und die nötige Finanzkraft. In der Selbsteinschätzung als gesellschaftliche Elite und der Ablehnung des Grundgedankens der Gleichheit al­ ler Menschen im Sinne von Rechtsgleichheit liegt sicher auch die schwierigste Seite des zeitgenössischen Satanis­ mus. Zwar sei der Satanismus keine „Weltanschauung, die meint, sie sei die einzig wahre“, wie eine Satanistin mir ge­ genüber betonte. Dennoch halten sich Satanisten für die besseren, in jedem Fall aber für die fähigeren Menschen. 67 LeporeLLo auf B R-KL ASSI K Oder wie es der Herr in Jeans und Jesuslatschen, den ich zu Beginn erwähnt hatte, einmal ausdrückte: „So wie man heute einen Führerschein machen muss, damit man fest­ stellt: der Mann kann Auto fahren, so sollte es zum Bei­ spiel auch einen Wahlführerschein geben, dass man sagen kann: der Mann hat Ahnung, der darf wählen. Also keine Gleichheit der Menschen, sondern Rechtezuteilung nach Fähigkeit.“ Warum die Vorstellungen von blutigen satanisti­ schen Ritualen und Opferhandlungen sich trotzdem hart­ näckig halten, mag unterschiedliche Gründe haben. Zum einen liegt es sicher an der volkstümlichen Verwendung des Begriffs Satanismus für Erscheinungen, die mit dem organisierten Satanismus der Church of Satan und anderer Gruppierungen des Satanismus schlicht nichts zu tun ha­ ben, sondern mit Vorstellungen, die historisch gesehen als Teufelsanbetung oder Ähnliches bezeichnet wurden. Der Begriff des Satanismus selbst tauchte explizit zum ersten Mal bei dem englischen Historiker und Hofdichter Robert Southey (1774–1843) auf, der Lord Byron als „Mitbegründer einer satanischen Dichterschule“ bezeichnet. Des Weiteren gibt und gab es Beschreibungen über blutige Opferrituale, rituelle Vergewaltigungen und andere Untaten in allen Kul­ turen und Epochen der Menschheit: als Zuschreibung an jene, die man ausgrenzen wollte. Der urchristlichen Ge­ meinde wurde ebenso wie Jahrhunderte später unter ande­ rem sogenannten Ketzern und Hexen rituelle Gewalt und ritueller Mord unterstellt. Zum Dritten hängt die öffentli­ che Wahrnehmung von Satanismus als rituellem Gewalt­ system vielleicht auch mit den Zahlen zusammen, die seit Jahren in einschlägiger Literatur herumgeistern. Von tausenden Satanisten alleine in Deutschland ist hier die Rede, die meuchelnd ihren finsteren Gelüsten nach­ gehen. Realistische Zahlen derer, die sich in Deutsch­ land dem Satanismus zurechnen, dürften eher bei maxi­ mal 500 Personen liegen. Ein weiterer Grund für die Vorstellungen von Satanismus als gewalttätigem System könnten die zu trauriger medialer Berühmtheit gelang­ 68 ten „Satansmorde“ sein. Mit Schrecken erinnert man sich vielleicht an den medienwirksamen Prozess gegen das Ehepaar Manuela und Daniel Ruda. Die beiden töte­ ten 2001 einen Bekannten mit 66 Messerstichen, Mache­ tenhieben und Hammerschlägen – im Auftrag Satans, wie sie vor Gericht aussagten. Inzwischen, 14 Jahre nach der Tat und hunderte Therapiestunden später, wollen beide nichts mehr wissen von ihrem selbstdesignten Sa­ tanismus. Satanisten sind sich bewusst, dass sie mindestens auf Unverständnis treffen würden, wäre bekannt, dass sie Satanisten sind. Zumindest in Europa. In den USA gehen Mitglieder satanistischer Gemeinschaften recht offen mit ihrer Zugehörigkeit zu solchen Gruppierungen um. Zur Frage, weshalb die Selbstbezeichnung „Satanismus“ bzw. „Satanist“ dennoch für jemanden sinnvoll ist, obwohl er um die Vorurteile diesem Begriff gegenüber weiß, lasse ich ab­ schließend noch einmal meinen Verbindungsmann vom An­ fang zu Wort kommen: „Die Bezeichnung ist perfekt ge­ wählt, weil sie einerseits alles das beschreibt, wovor sich die einfachen Gemüter ängstigen. Die meisten Menschen ängs­ tigen sich davor, das zu leben, was sie wirklich leben wollen, weil sie dann auch die Verantwortung übernehmen müssten und die Konsequenzen tragen müssten, also lassen sie sich lieber alles vorbeten. Das Wort hat andererseits eine Filter­ funktion. Wer sich davor ängstigt und nicht dahinter schaut, der bleibt auch draußen, und das ist auch zu recht so. Des­ halb ist das Wort für mich perfekt.“ Dagmar Fügmann lehrt und forscht im Studiengang ­Philosophie und Religion an der Julius-­MaximiliansUniversität Würzburg. Ihre Dissertation schrieb sie über zeitgenössischen Satanismus in Deutschland. Mehr über den Bildkünstler auf S. 8 Bilder von James Rieck Seite 64: The Board of Directors, 2006 Seite 66: The Shareholders, 2003 Seite 67: Management, 2008 Seite 68: Committee, 2008 Montag bis Freitag 16.05 – 18.00 Uhr br-klassik.de facebook.com/brklassik Ihr musikalischer Begleiter am Nachmittag Musik, Informationen, Interview Forschungsprojekt Bayerische Staatsoper Folge 9 1933 – 1963 „Nicht reichsdeutsche“ Mitarbeiter 71 Auszug aus einem Schreiben von Kultus­ minister Franz ­Goldenberger an die ­Generaldirektion der Bayerischen ­Staats­theater vom 13. Februar 1932. Die Bayerische Staatsoper beauftragte in der Jubiläumsspielzeit 2013/14 ein Forschungsteam des Instituts für Theaterwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München damit, die Geschichte des Hauses von 1933 bis 1963 zu untersuchen. Auch in dieser Spielzeit berichten die Forscher in MAX JOSEPH kontinuierlich von ihrer Arbeit. Quelle: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, ­Ministerium für Unterricht und Kultus, Nr. 45270 (Julius Patzak). Im Ränkespiel der MAcht Ausgewählte Fund­stücke und ­Archivmaterial des Forschungsprojekts Bayerische Staatsoper geben Aufschluss darüber, wie das NS-Regime hinter den Kulissen des Nationaltheaters wirkte. Der Historiker Karl-Dietrich Bracher charakterisiert in seinem Aufsatz „Stufen totalitärer Gleichschaltung: Die Befestigung der nationalsozialistischen Herrschaft 1933 / 34“ die NS-Diktatur als ein ständiges Gegen- und Neben­ einander von Kompetenzen und Entscheidungs­ befugnissen verschiedener Personen, Gremien und Behörden. Durch „das Ineinandergreifen von zentralistischer Lenkung und Befehlsübermittlung einerseits, von verhüllender und verschleiernder Delegation und Parallelschaltung der Verantwortungen andererseits“ waren Entscheidungen und Anordnungen von permanenten Spannungen begleitet und der Gefahr ausgesetzt, von einer anderen – vermeintlich oder tatsächlich übergeordneten – Stelle in Zweifel gezogen oder angefochten zu werden. Diese konkurrierende Aufteilung von Befugnissen an verschiedene Personen und Stellen begünstigte zum einen die übermächtige Stellung des „Führers“ als letzte Instanz im Kompetenzgerangel und schuf zum anderen einen fruchtbaren Boden für verschleierte Entscheidungswege, persönliche Machtdemonstrationen und skrupellose Intrigen. 70 Auch an der Bayerischen Staatsoper wurden derartige Kompetenzkämpfe ausgetragen. Als öffentliche Einrichtung wurde das Haus zu einer Arena, in der um Einfluss und Geltung, Distanz und Nähe zu den Herrschenden, individuelle Vorteile und persönliche Schicksale gerungen wurde. Dies belegen Ergebnisse aus der Archivarbeit des Forschungsprojekts zur Personalsituation und Spielplangestaltung des Hauses in den 1930er Jahren. Bei der Sichtung der Akten standen folgende Fragen im Fokus: Wie wurden personelle Veränderungen durchgesetzt? Welche Rolle spielten politische Entscheidungsträger außerhalb der Oper bei Besetzungsfragen und Verpflichtungen? Inwiefern waren Beschäftigte des Hauses den rassistischen Repressionen des Regimes ausgesetzt? Wer bestimmte, welche Stücke aus welchen Gründen auf den Spielplan gesetzt wurden? Die ausgewerteten Akten ermöglichen einen Einblick in die institutionellen Wechselbeziehungen von Kunst und Politik. Simon Gröger Franz Goldenberger, 1926 bis 1933 bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, bezieht sich hier auf die Anzahl der Ausländer, die 1932 an der Bayerischen Staatsoper beschäftigt waren: Die aufgeführte Liste vermerkt, dass von 36 angestellten Sängerinnen und Sängern 21 „reichsdeutsch“ waren. Der Anteil ausländischer Sänger lag also bei 42 Prozent; einer von ihnen war der österreichische Tenor Julius Patzak. Goldenberger bewertet diesen Anteil als zu hoch und fordert, Dienstverträge von ausländischen Angestellten nur noch in Ausnahmefällen und unter Vorlage von Begründungsschreiben zu verlängern. Erst ab 1933 sollte hierfür eine behördliche Genehmigung notwendig sein. Der Fall belegt jedoch das nationalistische Klima bereits vor 1933. Auch Österreicher galten vor der Angliederung Österreichs 1938 selbstverständlich als Ausländer und unterlagen entsprechenden Auflagen. Dennoch blieb Julius Patzak nach Goldenbergers Intervention 1932 noch 13 Jahre an der Staatsoper beschäftigt; seine Dienstver- träge wurden stets kommentarlos vom Ministerium verlängert. Ein Grund hierfür lag sicherlich in der festen Etablierung des Sängers in München: Er war beim Publikum als Operntenor äußerst beliebt und engagierte sich zudem bei zahlreichen Wohltätigkeits- und Sonderveranstaltungen. Ab 1933 trat Patzak auch bei NS-Veranstaltungen auf, etwa bei einem Wohltätigkeitskonzert der SA. Das Regime machte sich offenbar den Starkult um den Sänger zunutze und instrumentalisierte die Berühmtheit seiner Person zu propagandistischen Zwecken. Die Einstellung Patzaks zu den NS-nahen Veranstaltungen lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht entnehmen. Jedoch liegt die Vermutung nahe, dass die Bereitschaft zur Mitwirkung an NS-nahen Veranstaltungen die Weiterbeschäftigung des „nicht reichsdeutschen“ Julius Patzak an der Bayerischen Staatsoper erheblich begünstigte. Lena Scheungrab Julius Patzak vor der Bayerischen Staatsoper, ohne Datum (Postkarte). Quelle: Deutsches ­Theatermuseum München, Inv. Nr. II 43285. 72 Erst nicht „reichsdeutsch“, dann nicht „arisch“ 73 Spielplanentscheidungen Abschrift eines Schrei­ bens von Paul Demeter (vermutlich die Eingabe eines Bürgers) an Staatsrat Ernst ­Boepple vom 26.9.1934: Auszug aus dem „Allgemeine[n] Bericht der dramaturgischen Kommission“ zur Märchenoper Schwarzer Peter vom 8. Juni 1936. Quelle: Bayerisches Hauptstaatsarchiv: ­Intendanz Bayerische Staatsoper, Personalakt: 426 (Hildegarde ­Ranczak), Teil I. Quelle: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Intendanz Bayerische Staatsoper, Sachakten, 1192 (Schwarzer Peter). Hildegarde Ranczak als Salome. Quelle: Deutsches Theatermuseum, Archiv Hanns Holdt. ­ ildegarde Ranczak auf H einer Starpostkarte. Quelle: Deutsches Theatermuseum München, Inv. Nr. II 37769, Foto: Anton Sahm. Die Tatsache, dass Hildegarde Ranczak erst durch ihre Heirat mit dem jüdischen Sänger Fritz Schaetzler im Jahr 1931 die deutsche Staatsangehörigkeit erhielt, war der Anlass für mehrere Hetzbriefe gegen die Sopranistin, die zum Zeitpunkt ihrer Heirat lediglich die tschechische Staatsbürgerschaft besaß. Ab 1933 hätte insbesondere das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933, das die Entlassung „nicht arischer“ Personen anwies und das Personal staatlicher Institutionen im weiteren Sinn betraf, nicht zuletzt auch das Ende ihrer Karriere bedeuten können. Auf obiges Schreiben hin wurde die Bayerische Generalintendanz aufgefordert, die „arische“ Abstammung von Schaetz­ler zu überprüfen: Als ehemaliger Offizier im Ersten Weltkrieg war er davon vorerst befreit gewesen. Die Generalintendanz setzte sich in einem Schreiben vom 3.12.1934 verstärkt für Ranczak ein und erklärte, ein mögliches ­Ausscheiden der Sängerin be- deute einen „großen künstlerischen Verlust für die bayerische Staatsoper“ – mit Erfolg: Nicht nur Ranczaks Vertrag an der Münchner Oper, auch der von Fritz Schaetzler an der Staatsoper Stuttgart wurde verlängert. Als 1942 noch immer kein „Ariernachweis“ zu Fritz Schaetzler vorlag, erklärte die Reichskanzlei, dass Schaetzler per ­ Führerbeschluss mit „deutschblütigen Personen gleichzusetzen“ sei. Zu diesem Zeitpunkt war die Ehe bereits ­geschieden und Hildegarde Ranczak mit dem Major der deutschen Luftwaffe Hans Travaglio verheiratet. Der ­Karriere von Ranczak konnten diese Vorgänge nichts anhaben. Zum Kreis ihrer Bewunderer ­gehörte auch Adolf Hitler: Nach der Aida-Premiere 1937, in der Ranczak die Titelrolle sang, ließ er ihr 100 rote Nelken und 1000 Reichsmark zukommen. Franziska Eschenbach Der freischaffende Komponist Norbert Schultze produzierte für das NS-Regime auch Kriegs- und Hetzlieder; sein wohl bekanntestes Stück wurde der Schlager Lili Marleen von 1938. Zur Frage, ob seine bis dato noch nicht aufgeführte Märchenoper Schwarzer Peter an der Bayerischen Staatsoper gespielt werden solle, hatte die Intendanz eine so genannte „Dramaturgische Kommission“ eingesetzt, bestehend aus dem Oberspielleiter Kurt Barré, den Dirigenten Meinhard von Zallinger und Josef Kugler sowie dem Dramaturgen M. H. Fischer. Die Kommission votierte einstimmig ablehnend; in seinem ergänzenden „Dramaturgischen Bericht“ attestierte Fischer dem Werk gar „ … künstlerische[n] Infantilismus, der aus dem Mangel an Gestaltung und Können eine Tugend machen möchte …“ Zudem bemängelte er, dass das Libretto „auf sehr schwachen Füssen“ stehe und konstatierte: „Primitivität des Inhalts gibt keinen Freibrief für Primi- tivität der künstlerischen Form.“ Trotzdem wurde Schwarzer Peter in den Spielplan der Staatsoper 1937/38 aufgenommen. Was letztlich zu dieser Entscheidung führte, lässt sich den in München vorhandenen Akten nicht entnehmen. Zwei Umstände sind dabei jedoch nicht zu übersehen: Die „Vertriebsstelle und Verlag der Deutschen Bühnenschriftsteller und Bühnenkomponisten“, die in der Struktur des NS-Staates quasi amtliche Funktion einnahm, hatte nachdrücklich eine Aufführung in München gefordert. Auch stand der Komponist Schultze als Lieferant von Kriegs- und Hetzliedern und als späteres NSDAP-Mitglied dem Regime nahe. Offen bleibt, ob die Entscheidung zur Aufnahme in den Spielplan auf vorauseilendem Gehorsam beruhte oder auf direkter politischer Einflussnahme. Klaus von Lindeiner 74 Kompetenzgewirr „Eine Anordnung des Führers“ 75 Schreiben des Intendan­ ten der Staatstheater Nürnberg Johannes ­Maurach an den Münch­ ner Generalintendanten der Bayerischen ­Staatstheater Oskar ­Walleck vom 30.7.1936. Auszug eines Schreibens von Generalintendant Oskar Walleck an den bayerischen Innenminister und Münchner Gauleiter Adolf Wagner vom 14.6.1937. Quelle: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, ­Bestand: Intendanz der Bayerischen Staatsoper: Personalakten, Akt Nr. 176 (Georg Hann). Quelle: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Intendanz Bayerische Staatsoper Personalakten 518, Bd. I: Die Einladung von Georg Hann, Bass und prominentes Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper, zur ­Meistersinger-Vorstellung im Rahmen des Reichsparteitages 1936 erfolgte durch die Intendanz der Staatstheater Nürnberg. Die Theaterleitung wandte sich allerdings direkt an Hann, ohne die Bayerische Staatsoper zu verständigen. Nachdem der Münchner Generalintendant Oskar Walleck davon Kenntnis erhielt, rügte er das Vorgehen in einem scharfen Brief: „Es ist unmissverständlich, dass Sie die Leitung der Münchener Staatsoper übergehen wollen, da Sie auch die Anwesenheit auf Proben nach Fühlungnahme mit einem Dirigenten Krauss geregelt sehen wollen. Für Aufklärung Ihrer mir nach bisheriger Stellungnahme unverständlichen Haltung wäre ich Ihnen dankbar.“ Johannes Maurach, Intendant in Nürnberg, betonte in obenstehender Antwort mehrfach den direkten Auftrag Hitlers zu Georg Hanns Verpflichtung – und Walleck mäßigte sofort seinen Ton. Das Zitat belegt einen konkreten Eingriff Adolf Hitlers in den Theaterbetrieb. Während die Bayerische Staatsoper viele Gastspieleinladungen an Hann aus „Betriebsgründen“ abgelehnt hatte, war dies bei parteinahen Veranstaltungen nie der Fall. Hann setzte seine prominente Position offenbar selbstbewusst ein: Als er später um eine Freistellung bat, um vor der Meistersinger-Vorstellung als „Ehrengast des Führers“ an den Festlichkeiten des Parteitags teilnehmen zu können, wurde diesem Antrag ebenfalls stattgegeben. Peter Behýl Dieser Brief des Generalintendanten Oskar Walleck ­bezieht sich auf den Abschluss eines über zehn Jahre laufenden Dienstvertrags mit dem Bühnenbildner Ludwig Sievert im Jahr 1937. Der damalige bayerische Innenminister und Gauleiter von München-Oberbayern war Adolf Wagner, der als Chef der Aufsichtsbehörde die Verträge der Staatsoper zu genehmigen hatte. Walleck war von Wagner so informiert, dass ein 10-Jahres-Vertrag mit Sievert nicht in Frage käme. Nun sollte Walleck aber auf Wunsch von Generalmusikdirektor Clemens Krauss einen solchen unterzeichnen und verfasste daraufhin obiges Schreiben an Wagner. Auffällig sind die angeführten „Krauß-Gelder“, sonst nie erwähnte Finanzmittel, sowie der indirekte Verweis auf die Pläne zum Bau eines neuen Opernhauses („die mit dem Münchner Theaterleben zusammenhängenden Pläne“). Es ist wahrscheinlich, dass sich Wagner als Vorgesetzter von Clemens Krauss und Oskar Walleck widersprüchlich gegenüber beiden zur Verpflichtung Sieverts äußerte – möglicherweise gezielt. Denn im Akt ist auch ein Treffen von Wagner mit Sievert und Krauss, aber ohne Walleck, vor der Vertragsausarbeitung dokumentiert. Obwohl das tatsächliche Verhalten und die Motivation des Gauleiters unklar bleiben, treten die politische Einflussnahme bei personellen Entscheidungsvorgängen an der Staatsoper und das gespannte Verhältnis von Krauss und Walleck deutlich zutage. Simon Gröger 76 Die Personalie Barré SEIT 1954 Aus einem Schreiben von Clemens Freiherr von Franckenstein ­(Generalintendant der Bayerischen Staats­ theater i. R.) an Arthur Bauckner (Operndirek­ tor der Bayerischen ­Staatstheater i. R.) vom 14.8.1941. MAßGEFERTIGTE KLEIDUNG AUS DEUTSCHLAND Quelle: Bayerische Staatsbibliothek (Handschriftensammlung), Nachlass Arthur Bauckner. „Lieber Doctor, eben lese ich, dass dieser Schweinsbarré Intendant in Danzig geworden ist! So was kann einen ärgern. Hätte diesem Hallunken einen langsamen Hungertod gegönnt.“ 1934 fanden im Zuge der ideologischen Gleichschaltung in den Bayerischen Staatstheatern größere personelle Umstrukturierungen statt. Fast jeder Angestellte in leitender Funktion wurde ersetzt. Eine Ausnahme bildete Kurt Borchardt, genannt Barré, der von 1928 bis 1938 Oberspielleiter der Bayerischen Staatsoper war und in den Anfangsjahren intensiv von Generalintendant Franckenstein gefördert wurde. Barré durfte bleiben, obwohl eine Intrige ihn beinahe zu Fall gebracht hätte: Im Februar 1934 druckte der Völkische Beobachter einen Verriss der Faschingsoperette Das verwünschte Schloß. Der gekränkte Librettist Gustav Quedenfeldt verbreitete daraufhin das Gerücht, Barré habe die schlechte Kritik eingefädelt. Wenig später wandte sich der prominente Musikschriftsteller Dr. Willy Krienitz mit einem Schreiben an die Generalintendanz, worin er Barré als „bösen Geist“ bezeichnete und ihn beschuldigte, Teil eines Komplotts gegen die Opernleitung sowie Anhänger der atonalen Musik zu sein. Barré, dem es gelang, sich zu ­ verteidigen und die Unterstellungen zu entlarven, spielte in dieser turbulenten Phase offensichtlich nicht nur eine Opferrolle. Max Reinhard, Direktor des Kulturamts der Stadt München, notierte: „Barré [hat] in der Zeit des Umbau [sic] [...], große Verdienste bei der Neuordnung der Verheltnisse [sic] erwiesen.“ Das erklärt auch die harschen Worte Franckensteins: Barré – früher noch Franckensteins Protegé – hatte unmittelbar nach 1933 sämtliche avantgardistischen Ambitionen aufgegeben und war NSDAP-, bald auch SA-Mitglied geworden. ­Offenbar konnte er sich so seine Position sichern und genoss auch in späteren Streitfällen das Wohlwollen wichtiger Parteifunktionäre. Franckenstein hingegen wurde 1934 trotz seines Vertrages auf Lebenszeit in den dauerhaften Ruhestand versetzt. Erst als 1937 Clemens Krauss Opernintendant wurde und einen neuen ­Oberspielleiter mitbrachte, bröckelte Barrés Stellung. Nach seinem Ausscheiden 1938 setzten sich wichtige NSDAP-Funktionäre für ihn ein und sicherten ihm auch künftig neue Engagements – wie 1941 die Intendanz in Danzig. Philip C. Montasser Die Verfasser der Texte sind Master-Studierende des Instituts für Theaterwissenschaft der LudwigMaximilians-­Universität München. Die Texte ­entstanden in einer Projektübung mit Archivarbeit im Rahmen des ­Forschungsprojektes zur Geschichte der Bayerischen Staatsoper 1933 – 1963 unter der ­Leitung von Rasmus ­Cromme, Dominik Frank und Katrin Frühinsfeld. Scans und ­Reproduktionen ­wurden ermöglicht durch das Praxisbüro des Departments Kunstwissenschaften. München - Maximiliansplatz 17 Mo.-Fr. 10.00 - 18.30 Uhr Sa. 10.00 - 16.00 Uhr Telefon (0 89) 230 76 533 oder nach Terminvereinbarung Die Datenbank Wir vermessen uns mit Apps. Wir geben uns preis mit Likes. ­Gleichzeitig füttern wir damit r­ iesige Datenspeicher. ­Verändern wir uns dadurch? Seit wann s­ ammeln Menschen Daten? Mit ihren Fragen ­wandte sich die Schriftstellerin Anna Kim an die Harvard-­Historikerin Rebecca Lemov. 78 der Träume Ich gestehe: Ich habe ein Problem mit Apps, die mir sagen, wie ich leben soll. Nicht, weil ich mir das nicht sagen lassen will. Sie haben meistens nur eine andere Vorstellung vom Leben. Nehmen wir zum Beispiel die Lese-App. Sie misst meine Lesegeschwindigkeit und sagt mir voraus, wie viele Stunden ich noch mit diesem Buch verbringen werde. Das Lesen wird zu einem Wettlauf. Ich beginne, für das Programm zu lesen statt für mich. Ich verzichte auf das Wiederlesen, das Verweilen bei Absätzen und Sätzen, der Inhalt wird zweitrangig; ein anderes Ziel, ein vollkommen unerwartetes, hat sich zwischen mich und das Buch gedrängt. Für die Lese-App ist nur das Zählen wichtig. Mein Verhalten verändert sich, weil ich weiß, dass ich beobachtet werde. Die App interessiert sich aber nicht nur für meine Lesegeschwindigkeit, sie sammelt auch die Daten vieler anderer Leser. Wir speisen damit einen riesigen Datenpool – nicht nur eine, sondern unendlich viele Datenbanken. Dabei ist die Belohnung, die ich mir von diesem Verhalten erwarten darf, stets eine Verbesserung, beispielsweise ein Boost meiner Belesenheit durch die Lese-App oder ein Zulegen meiner Muskelkraft durch eine Fitness-App. Seit ich nämlich entdeckt habe, dass sich – bereits vorinstalliert – auf meinem Handy ein Schrittzähler befindet, schaue ich ständig nach, wie viele Schritte ich schon gegangen bin. Ich könnte aber nicht sagen, dass ich wegen des Programms mehr Schritte mache. Stattdessen fühle ich mich schuldig, wenn ich viel weniger gemacht habe. Hier denke ich an den Begriff „human resources“, der im­­ ­Englischen die Personalabteilung in Unternehmen bezeichnet und auch hierzulande immer häufiger dafür verwendet wird. Wörtlich übersetzt heißt es jedoch „menschliche Ressourcen“. Wenn man daran denkt, wie wir unseren Alltag, unsere Gewohnheiten, aber auch Gedanken, Pläne und Wünsche durch Apps, Online-Einkäufe oder auf sozialen Medien wie Facebook als Daten zur Verfügung stellen, drängt sich die Frage auf: Werden wir immer mehr zu menschlichen Ressourcen? Ich maile sie der Historikerin Rebecca Lemov, die an der Harvard University Wissenschaftsgeschichte lehrt und sich mit der Geschichte des Sammelns von Big Data beschäftigt. Text und Interview Anna Kim 79 Anna Kim Frau Professor Lemov, werden wir immer mehr zu „human recources“, zu menschlichen Ressourcen? REBECCA LEMOV „Human resources“ bedeutet einerseits tatsächlich „Personal“. Man kann den Begriff aber auch weiter fassen, dann bekommt er eine finstere Bedeutung, nämlich das Beschlagnahmen des Menschen als Material, das der Wirtschaft, dem Militär, der Regierung und anderen mächtigen Regimes zur Hand geht. Auf diese Art werden Menschen zu Ressourcen, die gemanagt, manipuliert und ausgelagert werden können. Dies wird nur intensiver werden mit den Diskontinuitäten, die von der digitalen Welt ausgehen, und wenn sich Big Data, also sehr große Mengen von Datensätzen, mit immer neuen menschlichen Ressourcen verbinden. Was Facebook betrifft, so glaube ich, dass es uns all die Experimente, in die wir bereits verstrickt sind, nur vorführt. Wahrscheinlich beschleunigt es auch diesen Prozess. Nehmen Sie zum Beispiel das Face­book-Experiment von 2013, als Mark Zuckerbergs Firma für eine Studie die Einträge im Nachrichtenstrom von einigen hunderttausend Nutzern filterte und manipulierte. So wollte er herausfinden, wie sich positive und negative Emotionen in Netzwerken ausbreiten. Als dies herauskam, gab es einen großen Aufschrei in der Öffentlichkeit. Ich war erstaunt, dass die Leute überrascht davon waren, dass vertrauliche Daten gesammelt und algorithmisch manipuliert worden waren. Damals wurde nur sichtbar, was schon die ganze Zeit über praktiziert wurde und wird. AK Um das Sammeln von intimen Daten geht es auch in Ihrem neuen Buch Database of Dreams: The Lost Quest to Catalog Humanity. Darin schildern Sie die Geschichte einer Wissenschaftsbewegung in den USA, die zwischen 1947 und 1961 versuchte, eine Datenbank der Träume zu erstellen. Zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs brach ein großes amerikanisches Forschungsteam nach Mikronesien auf, um die Bevölkerung und deren Lebensgewohnheiten zu studieren. Das Team bestand unter anderem aus Ethnologen, Psychologen und Sprachwissenschaftlern. Die Insulaner wurden gebeten, an einer Reihe von Tests mitzuwirken, zum Beispiel an Rorschachtests. So meinten die Forscher an „Die Idee, Daten zu speichern, existierte bereits vor der entsprechenden Technologie.“ – Rebecca Lemov ­ aten zu ­gelangen, die bis dahin nicht in gemessener Form D existierten: an Träume, Lebensgeschichten, Ängste und ­Ge­danken. Auf diese Weise gelangten sie an rund 100.000 Seiten Datenmaterial. RLDie Bewohner wurden nicht nur gebeten, an einer Reihe von Tests mitzuwirken. Die Wissenschaftler haben auch versucht, ohne Umwege zu sammeln. Sie wollten die Daten direkt aus dem Unbewussten pflücken. Dazu haben sie Techniken verwendet, die durch jahrzehntelange Feldforschung methodologisch verbessert und an die jeweilige Situation angepasst wurden. Das Sammeln begann schon im 19. Jahrhundert; zunächst mit konkreten Kulturgegenständen wie zum Beispiel Körben. Im 20. Jahrhundert wandte man sich abstrakteren Dingen zu, wie Mustern oder Ritualen. In den 1930er Jahren nahm man dann Träume und Tagträume ins Visier. Die Wissenschaft damals war an den alltäglichen Gedanken interessiert, die noch niemand vorher sammeln wollte. Gemeinsam mit den ausgewerteten Tests sollten sie das Innenleben des Träumers oder Erzählers vollständig abbilden. AK Aber wie verwandelt man etwas so Abstraktes und Persönliches wie einen Traum in Daten? RLBei den Forschern des letzten Jahrhunderts lief es häufig folgendermaßen ab: Sie baten die Menschen, ihnen ihre Träume zu erzählen, schrieben sie auf und sammelten sie in Papierform. Schließlich publizierten sie sie als sogenannte Microcards. Das war eine Technologie, die in den 1950er Jahren als Konkurrenz zur Mikrofiche-Technologie aufkam, aber nicht weiterentwickelt wurde. Die Microcards sollten auf der ganzen Welt in einem primitiven Microcard-Netzwerk zur Verfügung stehen. Manchmal bezahlten die Wissenschaftler ihre Studienobjekte auch für die Niederschrift ihrer Träume. Manche Anthropologen waren sogar bekannt dafür, jeden Morgen wie der Milchmann eine Runde im Dorf zu drehen. Zu Freuds Zeit und in seiner Nachfolge waren Träume ein wertvolles Gut. Ironischerweise waren es ausschließlich die amerikanischen Indianer, die ihre Träume aufschreiben konnten, da sie gewöhnlich gegen den Wunsch der Familie dazu gezwungen worden waren, englische Sprachkenntnisse zu erwerben und ihre ursprüngliche Lebensweise aufzugeben. Von diesen Träumen sagte man nachher, sie seien Zeugnisse für eine nicht weiße, nicht westliche, ursprüngliche Lebensweise und Denkart. Das Lesen wird zu einem Wettlauf. Ich beginne, für das Programm ­ zu lesen statt für mich. Ich verzichte auf das Wiederlesen, das Verweilen bei Absätzen und Sätzen, der Inhalt wird zweitrangig. 80 AK Etwa zur gleichen Zeit, nämlich ab 1957, führte ein gewisser Dr. Ewen Cameron am Allan Memorial Institute in Kanada Gehirnwäsche-Experimente an mehr als 100 seiner Patienten durch, die glaubten, sie würden von ihrer psychischen Bilder Jon Rafman Krankheit, zumeist Schizophrenie oder Depression, geheilt. Sie hatten keine Ahnung, dass sie an Experimenten teilnahmen, in denen es darum ging, ihr Selbst mittels Elektroschocks und totalem Reizentzug zu zerstören, um es anschließend wieder aufzubauen. In Camerons Vorstellung war der Mensch ein Datenträger, eine Festplatte, die man nach Belieben löschen und wieder beschreiben konnte. Ein Vorgang, der seiner Meinung nach billiger und zeitsparender war als eine Psychotherapie. Er war nicht an den vorhandenen Daten interessiert, sondern an der Reprogrammierung der Hardware. Im Gegensatz dazu erklärten die in Mikronesien tätigen Wissenschaftler, die Testpersonen würden ihr Innerstes preisgeben, ohne es zu bemerken. Instrumentalisiert wurden jedoch Camerons Patienten genauso wie die Mikronesier. Woher kam dieses Interesse daran, den menschlichen Geist gefangen zu nehmen, zu entführen? RLDer Wunsch, menschliche Gehirne zu, wie Sie sagen, entführen – einerseits die Gehirne von verletzlichen, da kranken, andererseits die von verletzlichen, da geopolitisch fernen Menschen – hat seine Wurzeln im modernen und wissenschaftlichen Drang, sich einem Verständnis von Leben auf möglichst objektive Weise zu nähern. Das äußerte sich zum einen in der Bemühung, einen Blick von außen anzunehmen, und zum anderen darin, das Objekt der Wissbegierde zu analysieren und zu erobern, indem es so lange zerlegt und die Einzelteile isoliert wurden, bis man sie verstanden hatte. „Instrumentale Vernunft“ ist das Banner, das modernen wissenschaftlichen Fortschritt leitet. Es impliziert, etwas so gut zu verstehen, dass man es auch verändern kann. Bei beiden Projekten ging es genau darum: zu verstehen, um zu verändern. Cameron war ein Arzt, der für die Heilung von Schizophrenie den Nobelpreis gewinnen wollte. Er wollte, wenn auch auf e ­ iner abstrakteren Ebene, das Leiden der Menschheit reduzieren. Die Anthropologen, Psychologen und Soziologen d ­ agegen verwendeten zum sogenannten Wohl der Menschheit Individuen als Materialien, indem sie die Grundlagen menschlicher Kultur etwa über ihre existierenden Variationen zu verstehen suchten. AK Ein Sammler sammelt ja selten für eine beschränkte Zeit. Wenn es die neue Microcard-Technologie nicht gegeben hätte, also die Möglichkeit, abertausend Seiten auf winzigem Format abzufotografieren und zu speichern, wäre das Projekt einer „Datenbank der Träume“ überhaupt durchführbar gewesen? RLDie „Datenbank der Träume“ wurde für die Ewigkeit angelegt, und das Microcard-Format erschien als eine vielversprechende Plattform, obwohl es sich als eine äußerst vergängliche 81 AK Ich finde die Parallelen zur heutigen Zeit absolut erstaunlich: Wie die Wissenschaftler damals haben wir heute die technischen Möglichkeiten und Mittel, eine ungeheure Menge an sogar intimen Daten zu sammeln und diese so lange zu behalten, wie wir wollen – und diese Möglichkeiten sind immens gestiegen. Amazon etwa sammelt nicht nur Daten zum Kauf- und Leseverhalten seiner Kunden, sondern auch zum Arbeitsverhalten der Angestellten, angeblich, um deren Arbeitsleistung zu steigern. Ich bin sicher, das machen auch noch andere. RLJa, ich fand die Parallelen auch auffällig und vor allem bedeutsam. Es heißt oft, dass solche Entwicklungen von der Ankunft des digitalen Zeitalters abhängig wären. Das Computerzeitalter wird als eine wichtige Schwelle begriffen, im Fall der „Datenbank der Träume“ jedoch war es ein analoges Gerät, das noch dazu nach der Idee des Sammelns entwickelt wurde. Dies zeigt, dass solche Schwellen nicht unbedingt vom technologischen Fortschritt bestimmt werden. auch mutig finde ist, dass er genau beschreibt, wie all diese Verbindungen, die 700 Sensoren und die Unzahl an Plattformen, auf denen er registriert ist, in ihm buchstäblich eine Bewusstseins-Krise ausgelöst haben: Er war von so viel Information umgeben, dass er Panikattacken bekam. Also begann er zu meditieren, um sich selbst und die Grenzen seines Selbst besser einschätzen zu können. Aufschlussreich ist jedoch nicht, dass er eine Krise und Panikattacken bekam und schließlich über buddhistische Meditationen zu sich selbst zurückfand, sondern dass man an ihm sehen kann, dass bereits das Wissen über sich selbst in Form von Daten das Selbst beeinflussen bzw. verändern kann. AK Man kann also mit dem Sammeln von Daten in den Menschen eindringen, ihn erobern? RLKann man das? Das ist eine wirklich wichtige Frage. Ich denke, es hängt davon ab, wie man Erobern definiert. Wenn man an viele kleine Eroberungen denkt, die sich mit der Zeit addieren, dann, glaube ich, ist es sehr wohl möglich, eine Person zu erobern. Durch virtuelle Stupser, Links, Likes, Programme, die die Reaktionen der User messen, speichern und wieder ins System einspeisen, ist es möglich, das „algorithmische Selbst“ für die Entscheidungen und Winkelzüge der Technologie, in die es eingebettet ist, empfänglich zu machen. Ja, eigentlich glaube ich, dass sich bereits eine Art Eroberung vollzogen hat. Mehr über Anna Kim auf S. 8 AK Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass das Sammeln immer mit Überwachen Hand in Hand zu gehen scheint. Inwiefern geht es uns heute noch um den Versuch, den Menschen, also uns zu verstehen? Photo Jens mauritz herausstellte. Ich nenne das in meinem Buch das „Pathos des vergänglichen Formats“, und wir erleben es alle heute, wenn wir alte Disketten oder andere tote Medien benutzen wollen, aber nicht können. Interessant ist allerdings, dass es das Datenbank-Projekt bereits gab, bevor das Microcard-Format als Lösung auftauchte. Die Idee, Daten zu speichern, sodass künftige Forscher diese erneut untersuchen könnten, existierte bereits vor der Technologie, die schließlich zusammengebastelt wurde, um „für die Zukunft“ zu speichern. RLDie Gründe für das Datensammeln sind so verschieden wie die Menschen, die sie sammeln, denke ich. Aber vielleicht kann man sie in zwei große Gruppen einteilen: die, die aus Neugier, und die, die aus Angst sammeln. AK Angst: Das ist ein gutes Stichwort. Angst vor Krankheiten, letztlich Tod? Gesundheits-Apps sollen uns ja Erleichterung und Sicherheit verschaffen, das Gefühl, das Sterben verschieben zu können. Ein extremes Beispiel in der Kategorie „bewusster leben“ ist der Amerikaner Chris Dancy. Er trägt täglich an die 700 Sensoren am Körper, die alles, was er tut, messen und aufzeichnen. Er behauptet, dadurch besser, gesünder und bewusster zu leben. Aber was kann ich eigentlich über mich erfahren, wenn ich mein Leben derart vermesse? RLIch finde sein Konzept der „gemessenen Selbst-Losigkeit“ sehr spannend. Es geht ihm nicht nur darum, der „am meisten vermessene Mensch der Welt“ oder der „Versace des Silicon Valley“ zu sein, wie er bezeichnet wird. Was ich interessant und 82 Rebecca Lemov ist Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der ­Harvard University. In ihrem Buch Database of Dreams: The Lost Quest to Catalog Humanity, das im November 2015 ­erscheint, beschäftigt sie sich mit der Entstehung von Big Data in der experimen­ tellen Forschung vor dem digitalen Z ­ eitalter. Sie war zwei Jahre Gastwissenschaftlerin am Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Die Bilder sind Stills aus Jon Rafmans ­Videoarbeit A Man Digging, 2013. Fine Jewellery – handmade in germany PromenadePlatz 10 80333 münchen 089 . 29 60 72 www.sevigne.de Fü n F h ö Fe – th e ati n erstr a sse 8 8 03 3 3 m ü n ch en 0 89 . 24 2 1 79 1 7 Voller vorFreude „A conductor is like a policeman inside a dream.“ – Omer Meir ­Wellber Omer Meir Wellber Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber ist von Boitos ­Mefistofele fest überzeugt: „Das Werk ist viel, viel stärker als jene bekannteren Faust-Opern von Gounod, Berlioz oder von Busoni. Es ist für mich die komprimierteste Form des Faust-Dramas“, erklärt er temperamentvoll und ergänzt: ­„Boito war ja eine Art Leonardo da Vinci, ein Universalgenie. Er war Architekt, er zeichnete, hat Bücher geschrieben und natürlich die Libretti für mehrere Verdi-Opern verfasst. Aber selbst hat Boito nur zwei Opern komponiert.“ Und Wellbers Erklärung, warum er von Boitos Werk so überzeugt ist, verblüfft: „Boitos Mefistofele ist nicht so perfekt wie jener Faust von Gounod. Und er ist auch nicht so schön wie der Faust von Berlioz.“ Mehr als Perfektion und Schönheit fasziniert den Dirigenten nämlich die unkonventionelle und experimentelle Weise, in der sich der Komponist dem Bösewicht Mephisto nähert. Das sagt nicht nur einiges über Boitos Mefistofele­Partitur, sondern noch viel mehr über Omer Meir Wellber selbst und seinen Anspruch an Kunst und Musik. Der erst 34-jährige Wellber sieht, denkt und lebt über Partiturseiten hinaus. Seine Karriere verlief bisher so schnell, dass sie einem dann doch das strapazierte Wort „atemberaubend“ abnötigt. In Be’er Scheva wird Wellber 1981 geboren. Die viertgrößte Stadt Israels liegt am Rande der Wüste Negev und ist Schmelztiegel vieler Biografien: Beduinen, Araber, Israelis treffen hier aufeinander. Bis heute verbindet ihn durch seine Dirigate bei der New Israeli Opera Tel Aviv und als Musikdirektor bei der Raanana Symphonette viel mit seiner Heimat. Mit fünf Jahren lernt Omer Meir Akkordeon, Klavier und Violine; hier in seiner Heimatstadt besucht er zunächst das Konservatorium, danach wechselt er an die ­Jerusalem Music Academy. Eine strenge rumänischstämmige „Maestra“ lässt am Konservatorium die Studenten ganze Symphonien abschreiben. Was manche als stumpfsinnig 84 empfinden, öffnet Omer Meir Wellber die Werke und eine unglaubliche Fähigkeit zu lernen; noch heute kann er die komplette Waldsteinsonate auswendig niederschreiben. Kein Zweifel, der junge Mann ist vom Lernen besessen. Heute hat Wellber fast 50 Opern im Repertoire. „Ich kann sehr schnell lernen. Inzwischen zwinge ich mich geradezu, Neues langsam zu lernen“, sagt er über sich selbst. Und doch mache das Lernen neuer Symphonien und Opern nur die Hälfte seiner Studien aus. „Mich interessiert vor allem das Drumherum eines Werks. Ich lese zum Beispiel einen Berg von Büchern über Boito. Ich will absolut alles erfahren über den Komponisten, über die Zeit in der er lebte, über die Geschichte und die Umstände, in denen ein Werk entstand.“ Dieses faustische Graben und Suchen und dieses musikalische Talent blieben einem Mann nicht verborgen, der Wellbers Mentor werden sollte: Daniel Barenboim. „Ich habe alle Positionen eines jungen Dirigenten durchlaufen: Assistiert, korrepetiert, ich bin eingesprungen und hatte so bereits mit 21 Jahren eine enorme musikalische Erfahrung.“ Fast selbstverständlich, dass der ehemalige Assistent von Barenboim heute als einer der besten und talentiertesten Dirigenten seiner Generation gilt. Er gastiert regelmäßig an der Semperoper in Dresden, wo er einen beeindruckenden Erfolg mit Richard Strauss‘ ­Daphne feierte und wo er von 2014 bis 2016 einen neuen ­Mozart-Da Ponte-Zyklus dirigiert, unter anderem Cosi fan ­tutte und Don Giovanni in Inszenierungen von Andreas ­Kriegenburg. Er war seit 2011 drei Jahre lang als Nachfolger von Lorin ­Maazel Musikdirektor am Palau de les Arts Reina Sofía in V ­ alencia. Sein Debüt beim Glyndebourne Festival 2014 führte zu einer sofortigen Wiedereinladung beim ­London Philharmonic­­Orchestra. Und auch an der Münchner Oper konnte ihn das Publikum bereits erleben. Ein Erlebnis war das von ihm geleitete Akademiekonzert im Februar 2015. Omer Meir ­Wellber ­dirigierte da die sechste Symphonie von Premieren Mefistofele, Der feurige Engel Foto Tato Baeza Forscherdrang und die Lust am Unbekannten treiben diese beiden Dirigenten an: Omer Meir Wellber leitet in dieser Spielzeit ­Mefistofele von Arrigo Boito und Vladimir Jurowski die Oper Der feurige Engel von Sergej Prokofjew – beides Münchner ­Erstaufführungen. Pascal Morché stellt die beiden Künstler vor. „Perfektion bleibt ein Ziel am Horizont, aber diesen Horizont muss man immer wieder von sich wegschieben. Man darf ihn niemals erreichen.“ – Vladimir Jurowski Vladimir Jurowski ­ chostakowitsch. Die Antwort, warum er gerade dieses, eher S selten ­gespielte Stück aufs Programm setzte, ist knapp und ziemlich typisch für ihn: „Ich habe diese Symphonie gewählt, weil sie eben so selten gespielt wird. Was ich nicht kenne, das ist wie frische Luft für mich.“ In der Erinnerung bleibt von dieser „frischen Luft“ vor allem Wellbers Souveränität am Pult, der berührende langsame Satz dieser Symphonie und ein Dirigent, der in seiner tänzerischen Körpersprache und in der Intensität seiner Gestik stark an jene Leonard ­Bernsteins erinnert. „Ach, oh, ja: Bernstein!“, ein glücklicher, etwas ­sehnsüchtiger Seufzer entfährt denn auch dem schlanken jungen Mann; schließlich nennt er tatsächlich zwei große Dirigenten-Legenden als seine Vorbilder: „Leonard Bernstein und Jewgenij Mrawinskij.“ Emotional überbordend der eine, rational genau der andere – beide Musikerpersönlichkeiten scheinen sich wirklich in Wellbers Dirigaten wiederzufinden. „Bernstein ist unglaublich wichtig für mich und es ist traurig, dass ich ihn nie kennengelernt habe.“ Zufällig entdeckte er aber ein Foto von „Lenny“ bei einem Auftritt in seiner Heimatstadt Be’er Scheva. Eine Trouvaille! Überhaupt ist der Name Bernstein jenes Stichwort, das Wellber sofort dorthin führt, wo Kunst und Musik ihre Aufgabe zu erfüllen haben: in der Gesellschaft. „Es war eine so unglaubliche Menschlichkeit und große Humanität in allem, was er tat. Jedes Video, jede CD beweist das: Es geht bei unserem ­Beruf ja gar nicht nur um Musik. Es geht um viel, viel mehr.“ Und sein Anspruch an Musik sprudelt aus dem jungen D ­ irigenten heraus. „Es geht in der Musik nicht nur um Harmonie, Dynamik, Phrasierungen, Tempi, nicht darum, ob man etwas schnell oder langsam, laut oder leise spielt. Es geht immer nur einzig und allein darum, warum man es tut.“ Was ist dann ein Dirigent? Wellber antwortet dialektisch, esoterisch, poetisch auf Englisch: „A conductor is like a p ­ oliceman inside a dream“. Obwohl ihn bisher erst wenige Auftritte an die Münchner Oper führten, verehrt Omer Meir Wellber das Münchner Opernhaus und sein Orchester sehr. Und dann gerät er plötzlich ins Schwärmen: „Bei einer Serie von Carmen-Vorstellungen, die ich im Nationaltheater leitete, dachte ich plötzlich: Wahnsinn! Die Carlos Kleiber-Atmosphäre, die kann man hier in München richtig fühlen. Man spürt, hier wurde der Tristan uraufgeführt, hier dirigierte Kleiber!“ An diesem Haus wehe ein ganz spezieller Geist: „Dass hier eine Probenbühne ­‚Bruno Walter-Saal‘ heißt, spricht sehr dafür.“ Der junge Dirigent, der von sich sagt „meine Karriere geht schnell voran, ich hingegen langsam“, will zukünftig mehr Symphonik dirigieren und weniger Opern. Gustav Mahlers Achte für Aufführungen im nächsten Jahr lerne er bereits. Im Jahr studiere er nun noch maximal drei Opern neu ein. Ein Glück für Mefistofele, dass es in München auf einen jungen ­Dirigenten trifft, der für Musik wahrhaftig brennt; ein ­Dirigent, der Neues will und wagt. Woher er die Zeit für das Neue nehme? Omer Meir Wellber lacht: „Nun, ich schlafe nicht sehr viel“. Sergej Prokofjews Der feurige Engel und Arrigo Boitos Mefistofele haben durchaus Gemeinsamkeiten. In der Rahmenhandlung und in den Motiven. Beide Opern spielen im Jahrhundert Fausts, der Zeit, in der Aberglaube, kirchliche Dogmen und wissenschaftlicher Erkenntnisdrang den Menschen gleichermaßen prägten. Und auch die Verlockungen zu Grenzüberschreitungen, ins Terrain des Verborgenen, ähneln sich in beiden Stücken: Faust ruft in seiner absoluten Wissensgier Mephisto auf den Plan, so wie Renata die ekstatische Liebesbegegnung mit dem Engel herbeisehnt. Noch überraschender sind allerdings die ähnlichen Ansichten, die man zwischen den beiden Dirigenten dieser zwei Neuproduktionen entdecken kann. Der russische Dirigent Vladimir Jurowski wird zwar in Journalistenpoesie schon mal als „Niccolo Paganini des 21. Jahrhunderts“ bedichtet, er sei von „geradezu dämonischer Aura, mit dunklen Augen und dunkler Mähne“. Nun ja. So verschieden in Figur, Aura und biografischer Prägung, so ähnlich sind die Dirigenten dieser Neuproduktionen in ihren Meinungen und Einstellungen zum heutigen Opernbetrieb. „Ich lerne schnell und lasse mir doch Zeit beim Lernen“, sagt auch Jurowski. Auch er hat „um die 50 Opern im Repertoire“. Auch er nennt Neugierde seine Triebfeder. „Meine Liebe gerade zu Werken, die aus bestimmten Gründen seltener zu hören sind, ist enorm. Ich fühle mich da als ein Anwalt der Musik.“ So gibt es kaum ein Stück von Prokofjew, das Jurowski noch nicht dirigierte: „Ich habe 2005 in Paris Krieg und Frieden dirigiert und mich dafür eingesetzt, dass 2006 in Glyndebourne Die Verlobung im Kloster aufgeführt wurde und Semen Kotko im November 2016 in Amsterdam konzertant aufgeführt wird. Die anderen Opern wie Der Spieler und Maddalena habe ich mir für die nächsten Jahre auch vorgenommen.“ Nur die einzig gängige Oper von Prokofjew, Die Liebe zu den drei Orangen, hat er noch nicht dirigiert und hat es auch fürs Erste nicht vor. Typisch: ­Jurowski ist niemand, der sich mit Altbekanntem anbiedert. Es geht ihm um Herausforderung, und die anzunehmen erwartet er auch vom Publikum: „Ich möchte, dass Menschen, die in ein Konzert oder in eine Opernaufführung gehen, nicht nur entspannen, sondern auch emotional und intellektuell teilnehmen.“ Der ­feurige Engel ist kein Werk zum Entspannen; also ist es ein Werk für Vladimir Jurowski, für diesen Mann, der 1972 in eine bekannte russische Musikerfamilie hineingeboren wurde. Sein Urgroßvater war schon Dirigent, der Großvater war Komponist, sein Vater Michail Jurowski ebenfalls Dirigent. Zum engsten Freundeskreis der Familie gehörten Musikerlegenden wie Schostakowitsch, Ojstrach, Rostropowitsch, Kondraschin, Roschdestwenski und viele andere. Schon in Moskau faszinierte ihn Der feurige Engel. „Das Werk umgab ja wegen seiner sexuellen und mystischen Konnotation immer eine gewisse Aura des Verbotenen“, erinnert er sich heute an die späten 1980er Jahre in der damaligen ­Sowjetunion. Diese Oper jetzt in München endlich zu dirigieren, sei für ihn „ein Glück, eine persönliche Premiere“. Vladimir ­Jurowski versucht, jede Verästelung eines neuen Werks zu ­ergründen. „Gewiss gibt es interessante Parallelen zur Roman- Bildbearbeitung Alana Dee Haynes 87 vorlage des Feurigen Engels. Der Dichter Waleri Brjussow, schrieb ja seinen Roman in einer Art Rachefeldzug als eine ­Parodie auf seine ehemalige Geliebte Nina Petrowskaja. Tatsächlich kam sie später in eine Anstalt mit einer schweren Nervenkrankheit und beging 1928, vereinsamt, verarmt und von ex­ zessivem Morphium- und Alkoholkonsum gezeichnet in Paris Selbstmord, was Prokofjew übrigens mit Sicherheit nicht wusste, als er quasi zeitgleich das Schicksal der Renata komponierte“, erklärt Jurowski. „Der Komponist sah in seiner Hauptfigur eine Person, die über eine Gabe verfügt, Dinge zu sehen und zu hören, die vermeintlich ‚normale’ Menschen nicht wahrnehmen können.“ Dass Prokofjew während der Arbeit an dieser Oper in dem oberbayerischen Klosterort Ettal lebte, unterstütze die tiefenpsychologische Interpretation der Renata. Man merkt: Hier geht jemand einem Werk auf den Grund. Während Vladimir Jurowskis Studium am Musikkolleg des Moskauer Konservatoriums – er ist gerade 18 Jahre alt – fällt der eiserne Vorhang. Die Familie emigriert 1990 nach Deutschland. Vladimir besucht die Musikhochschulen in Dresden und Berlin und beginnt mit 23 Jahren als Kapellmeister an der Komischen Oper in Berlin. „Das war die prägendste Zeit meines Lebens. Dort habe ich alles über meinen Beruf gelernt und verstanden. Diese Zeit nährt mich heute noch.“ Danach ging es schnell, wieder einmal „atemberaubend“ schnell: 1996 Debüt am Royal Opera House Covent Garden mit Nabucco; Jurowski ist da 24 Jahre alt. 1999 debütiert er an der New Yorker MET. Dann ist er 13 Jahre lang Musikdirektor in Glyndebourne. Seit 2007 ist Jurowski nun Chefdirigent des London Philharmonic Orchestra. Die „big five“ Orchester der USA leitet er ebenso wie das ­Concertgebouw Orchestra oder die Berliner und Wiener ­Philharmoniker. In München dirigierte er zwar die Münchner Philharmoniker und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, nicht aber in der Oper. Höchste Zeit also, dass dieser Mann ans Pult der Staatsoper tritt. „Besonders freue ich mich, wieder mit dem Regisseur Barrie Kosky ­zusammenzuarbeiten. Wir sind ein Team und haben an der Komischen Oper gemeinsam Moses und Aron produziert. Eine wunderbare, intensive Arbeit“, erinnert sich Jurowski, „Nur zum Schlafen verließen wir den P ­ robensaal.“ Berlin ist Vladimir Jurowskis Heimat geworden. Hier lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. „Unsere Tochter ist 19 und hat gerade Abitur gemacht.“ Obwohl sie davon träume, Theaterschauspielerin zu werden, habe sie sich erstmal an der Uni beworben, um etwas „Anständiges“ wie englische P ­ hilologie und Geschichte zu studieren. „Unser sechsjähriger Sohn überlegt noch: Feuerwehrmann, Gärtner oder Schlagzeuger.“ So international der dirigierende Vater inzwischen unterwegs ist, so meidet er doch entschieden die sozialen Netzwerke der heutigen Kommunikationswelt. „Eine vampirartige Angelegenheit“ nennt er zum Beispiel Facebook. „Der Lebenssaft wird einem vom Internet schnell abgezapft“. Als Schlüssel zu seinem Erfolg nennt Jurowski „die ständige Unzufriedenheit mit sich selbst“. Er strebe immer die Perfektion an, dabei sehr genau wissend, dass es Perfektion nicht 88 gibt. „Sie bleibt ein Ziel am Horizont, aber diesen Horizont muss man immer wieder von sich wegschieben. Man darf ihn niemals erreichen.“ So sucht Vladimir Jurowski immer Neues, Zeitgenössisches und bezeichnet sich dabei selbst auch als „Geburtshelfer“ neuer oder unbekannter, buchstäblich unerhörter Werke. Es sei für ihn „innerstes Bedürfnis, unbekannte Werke zu entdecken und ihre Schönheit und Aktualität den Menschen zu zeigen.“ Denn schließlich sei „es ja ganz wunderbar, immer wieder zu La traviata, La bohème und Die ­Zauberflöte zurückzukommen. Aber wir Musiker wären doch völlig verarmt, nur Museumsarbeit zu leisten. Oper ist kein ­Museum!“ Vehement zeigt der Dirigent seine Ablehnung über Musik und Oper als kulinarische, gesellschaftliche Ober­ flächenpolitur: „Ich spreche deshalb auch unbedingt immer von Musiktheater und nicht von Oper. Um lebendig zu bleiben, muss sich diese Kunstform immer wieder neu erfinden und ­definieren.“ Wenn jemand so ehrlich für sein Metier einsteht, dann kann man ihm glauben, dass er auch Prokofjews selten gehörte Partitur Der feurige Engel so vorstellt, dass sie uns betrifft. 4 0 J A H R E N U B E RT „In dieser Klasse ist die nuVero die Königin der Kompaktboxen“ Stereoplay 8/15 Pascal Morché lebt als Journalist und Texter in München. Im ­Jubiläumsjahr 2013 veröffentlichte er das Kalender-Buch 50 Jahre ­Nationaltheater München. Omer Meir Wellber, geboren in Israel, studierte an der Musikakademie in Jerusalem. In den vergangenen Jahren debütierte er u.a. beim ­Gewandhausorchester Leipzig, dem Orchestra Sinfonica della RAI ­Turino, dem Israel Philharmonic ­Orchestra, dem Pittsburgh Symphony Orchestra und dem London ­Philharmonic Orchestra, das er u.a. beim Glyndebourne Festival leitete. Außerdem ist er regelmäßiger Gastdirigent an der Semperoper Dresden, am Teatro La Fenice in Venedig und an der Israeli Opera in Tel Aviv. Von 2010 bis 2014 war er Music ­Director am Palau de les Arts Reina Sofia in Valencia. Seit 2009 ist er Musikdirektor des Raanana ­Symphonette Orchestra. An der Bayerischen Staatsoper übernahm er bisher Dirigate bei La traviata, Carmen und beim 4. Akademie­ konzert 2014/15. In der aktuellen Saison leitet Wellber hier die Neuproduktion von Mefistofele. Vladimir Jurowski, geboren in ­Moskau, begann seine musika­lische Ausbildung am Staatlichen Moskauer P.-I.-Tschaikowski-­Konservatorium und setzte sie an den Musikhochschulen in Berlin und Dresden fort. Er war musikalischer Leiter des ­Glyndebourne F ­ estivals. Seit 2007 ist er Chef­dirigent des London­Philharmonic Orchestra. Außerdem ist er Principal Artist des Orchestra of the Age of Enlightenment und Künstlerischer Leiter des Russian State ­Academic Symphony ­Orchestra. Er gastierte bei zahlreichen internationalen Orchestern, u.a. bei den ­Berliner Philharmonikern, den ­Wiener Philharmonikern und beim Koninklijk Concertgebou­workest in Amsterdam. Er dirigierte u.a. an der Metropolitan Opera in New York, am Teatro alla Scala in Mailand und an der Semper­ oper Dresden. In der Saison 2015/16 gibt Jurowski sein Hausdebüt mit dem 2. Akademiekonzert, bevor er die Premiere von Der feurige Engel dirigiert. Mefistofele Oper in vier Akten mit Prolog und Epilog Von Arrigo Boito Der feurige Engel Oper in fünf Akten und sieben Bildern Von Sergej Prokofjew Premiere am Samstag, 24. Oktober 2015, Nationaltheater Premiere am Sonntag, 29. November 2015, Nationaltheater STAATSOPER.TV: Live-Stream der Vorstellung auf www.staatsoper.de/tv am Sonntag, 15. November 2015 STAATSOPER.TV: Live-Stream der Vorstellung auf www.staatsoper.de/tv am Samstag, 12. Dezember 2015 Weitere Termine im Spielplan ab S. 93 nuVero 60 • Wahrhaftiger Klang • vollendete Technik • profiliertes Design • meisterhafte Qualität made in Germany. High-End, aber erschwinglich! Bequem online bestellen: www.nubert.de Stereoplay Highlight 8/15: Klang absolute Spitzenklasse, Preis/Leistung überragend. Hochpräzise und extrem bassstark. 50 cm hoch, 250/180 Watt. Erhältlich in Diamantschwarz, Kristallweiß und Golbraun. 785 Euro/Box (inkl. 19% MwSt, zzgl. Versand) Ehrliche Lautsprecher Made in Germany •Jetzt bestellen und probehören – bei Ihnen zu Hause, mit 30 Tagen Rückgaberecht •Günstig, weil direkt vom Hersteller Nubert electronic GmbH, Goethestr. 69, D-73525 Schwäbisch Gmünd •Bestell-Hotline mit Profi-Beratung Deutschland gebührenfrei 0800-6823780 •Vorführstudios: D-73525 Schwäbisch Gmünd, D-73430 Aalen und D-47249 Duisburg Maß genommen Nach dieser Ausgabe muss es einmal sein: Flugs das Maßband angelegt und MAX JOSEPH vermessen … Seitenzahl Umschlag ....................................................... Seitenzahl Innenteil ......................................................... Seiten gesamt..................................................................... Doppelseite.......................................................................... Gewicht ................................................................................ Seit 1841 4 104 108 420 x 280 mm 422 g BAYERISCHE STAATSOPER Ausgaben insgesamt: glückliche 29 280 mm Anzahl der redaktions­ internen Dispute pro Ausgabe: leidenschaftliche 35 Rücken: 5,1 mm 50,4 cm Diagonale 19,8“ Covervorschläge pro Ausgabe (im Durchschnitt) Longlist: 157,7 Shortlist: 11 Umfang: 140 cm 210 mm Gesamtfläche: (Flächeninhalt x Anzahl Seiten) 1.176 cm2 x 108 = 127.008 cm2 90 Wörter.................................................................................... Zeichen................................................................................. Bilder .................................................................................... Verhältnis Text / Bild ....................................................... Originalbeiträge Text ....................................................... Originalbeiträge Bild ....................................................... Auflage.................................................................................. Reichweite............................................................................ An dieser Ausgabe beteiligte Personen .................... 27.883 186.759 65 Text: 62,5 % / Bild: 37,5 % 100 % 63,2 % 30.000 weltweit 54 Strahlungsenergie des feurigen Engels ................... 500.000 lx (Lux) / 104 In München nur bei Radspieler F. Radspieler & Comp. Nachf. Hackenstraße 7 · 80331 München Telefon 089 / 23 50 98-0 · Fax 089 / 26 42 17 www.radspieler.com PIN. feIert 50 Jahre PIN. Let’S Party 4 art JuBILäumSgaLa PIN.-Party uNd BeNefIzauktIoN SamStag, 21. NovemBer 2015 PINakothek der moderNe müNcheN Spielplan 16.10.15 – 30.01.16 Karten Tageskasse der Bayerischen Staatsoper Marstallplatz 5 80539 München T 089 – 21 85 19 20 [email protected] www.staatsoper.de Sofern nicht anders angegeben, finden alle Veranstaltungen im Nationaltheater statt. Oper Gioachino Rossini Il barbiere di Siviglia Musikalische Leitung Francesco Angelico Inszenierung Ferruccio Soleri Javier Camarena, Renato Girolami, Tara Erraught, Levente Molnár, Kyle Ketelsen, Andrea Borghini, Iris van Wijnen, Dean Power, Johannes Kammler Fr 16.10.15 19:00 Uhr Richard Strauss Ariadne auf Naxos Musikalische Leitung Kirill Petrenko Inszenierung Robert Carsen Johannes Klama, Markus Eiche, Alice Coote, Peter Seiffert, Petr Nekoranec, Kevin Conners, John Carpenter, Christian Rieger, Brenda Rae, Amber Wagner, Elliot Madore, Dean Power, Tareq Nazmi, Eri Nakamura, Matthew Grills, Okka von der Damerau, Anna Virovlansky Information +49 89 189 30 95-0 und www.pin-freunde.de arBeIteN voN: Cory Arcangel, Georg Baselitz, Cosima von Bonin, Daniele Buetti, Borden Capalino, Francesco Clemente, Johanna Diehl, Guyton/Walker, Hubertus Hamm, Charline von Heyl, Andy Hope, Erez Israeli, Wolfgang Laib, Jim Lambie, Zilla Leutenegger, Adam McEwan, Mariko Mori, Ciara Phillips, David Reed, Tomas Saraceno und vielen anderen Sa 17.10.15 20:00 Uhr Di 20.10.15 19:00 Uhr Fr 23.10.15 20:00 Uhr auch im Live-Stream auf www.staatsoper.de/tv sponsored by Arrigo Boito Mefistofele VORBESICHTIGUNG ab 7. November 2015 in der Pinakothek der Moderne Musikalische Leitung Omer Meir Wellber Inszenierung Roland Schwab Cosima von Bonin Smoke, 2008 Acryl, LED, Neon und Stahl 137 x 73 x 60 cm Courtesy Galerie NEU, Berlin Foto: Sigrid Körbler © Cosima von Bonin René Pape, Joseph Calleja, Kristine Opolais, Heike Grötzinger, Andrea Borghini, Karine Babajanyan, Rachael Wilson, Joshua Owen Mills Sa Do So Fr Di So 24.10.15 29.10.15 01.11.15 06.11.15 10.11.15 15.11.15 19:00 Uhr Premiere 19:00 Uhr 18:00 Uhr 19:00 Uhr 19:00 Uhr 19:00 Uhr auch im Live-Stream auf www.staatsoper.de/tv Ausstattungspartner der Bayerischen Staatsoper ArtPrivat | Partner und Versicherer 94 Jules Massenet Sergej Prokofjew Wolfgang Amadeus Mozart Wolfgang Amadeus Mozart Werther Der feurige Engel Die Zauberflöte Don Giovanni Musikalische Leitung Asher Fisch Inszenierung Jürgen Rose Musikalische Leitung Vladimir Jurowski Inszenierung Barrie Kosky Musikalische Leitung Asher Fisch Inszenierung August Everding Musikalische Leitung James Gaffigan Inszenierung Stephan Kimmig Rolando Villazón 25./28.10., Matthew Polenzani 31.10./04.11., Michael Nagy, Christoph Stephinger, Kevin Conners, Tim Kuypers, Angela Brower, Hanna-Elisabeth Müller, Johannes Kammler, Anna Rajah Evgeny Nikitin, Evelyn Herlitzius, Heike Grötzinger, Elena Manistina, Vladimir Galouzine, Kevin Conners, Okka von der Damerau, Igor Tsarkov, Goran Jurić, Ulrich Reß, Tim Kuypers, Matthew Grills, Christian Rieger, Andrea Borghini, Iris van Wijnen, Deniz Uzun Georg Zeppenfeld, Mauro Peter, Markus Eiche, Albina Shagimuratova, Hanna-Elisabeth Müller, Golda Schultz, Angela Brower, Okka von der Damerau, Solisten des Tölzer Knabenchors, Alex Esposito, Leela Subramaniam, Ulrich Reß, Kevin Conners, Christoph Stephinger, Wolfgang Grabow, Ingmar Thilo, Ivan Michal Unger, Markus Baumeister, Walter von Hauff, Johannes Klama Erwin Schrott, Goran Jurić, Marina Rebeka, Dmitry Korchak, Véronique Gens, Alex Esposito, Eri Nakamura, Tareq Nazmi So Do So Mi Sa Mi Fr So Di Sa So Mi Sa Mi 25.10.15 28.10.15 31.10.15 04.11.15 18:00 Uhr 19:00 Uhr 19:30 Uhr 19:00 Uhr 29.11.15 03.12.15 06.12.15 09.12.15 12.12.15 19:00 Uhr 19:30 Uhr 19:00 Uhr 19:00 Uhr 19:00 Uhr Premiere auch im Live-Stream auf www.staatsoper.de/tv 23.12.15 25.12.15 27.12.15 29.12.15 02.01.16 18:00 Uhr 18:00 Uhr 17:00 Uhr 18:30 Uhr 18:00 Uhr Francis Poulenc Dialogues des Carmélites Wolfgang Amadeus Mozart Die Entführung aus dem Serail sponsored by Brenda Rae, Sofia Fomina, Benjamin Bruns, Matthew Grills, Tobias Kehrer, Bernd Schmidt, Selale Gonca Cerit Sa 07.11.15 19:00 Uhr Mi 11.11.15 19:00 Uhr Sa 14.11.15 18:00 Uhr La bohème Richard Wagner Götterdämmerung Musikalische Leitung Kirill Petrenko Inszenierung Andreas Kriegenburg Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte Musikalische Leitung Constantin Trinks Inszenierung Dieter Dorn Golda Schultz, Angela Brower, Michael Nagy, Paolo Fanale, Tara Erraught, Christopher Maltman Lance Ryan, Markus Eiche, Hans-Peter König, Christopher Purves, Petra Lang, Anna Gabler, Michaela Schuster, Eri Nakamura, Angela Brower, Okka von der Damerau, Helena Zubanovich So 13.12.15 16:00 Uhr Mi 16.12.15 16:00 Uhr Sa 19.12.15 16:00 Uhr gefördert durch Fr 20.11.15 19:00 Uhr So 22.11.15 18:00 Uhr Di 24.11.15 19:00 Uhr Musikalische Leitung Asher Fisch Inszenierung Otto Schenk Kristin Lewis, Joyce El-Khoury, Dmytro Popov, Markus Eiche, Andrea Borghini, Goran Jurić, Joshua Owen Mills, Christian Rieger, Peter Lobert, Igor Tsarkov, Johannes Kammler Mi 30.12.15 20:00 Uhr So 03.01.16 18:00 Uhr Di 05.01.16 19:00 Uhr Sa 23.01.16 Do 28.01.16 Sa 30.01.16 Mo 01.02.16 19:00 Uhr 19:00 Uhr 19:00 Uhr 19:00 Uhr Johann Strauß Die Fledermaus Musikalische Leitung Kirill Petrenko 31.12. / 01. / 04. / 06.01., Oksana Lyniv 08.01. Nach einer Inszenierung von Leander Haußmann Do 31.12.15 Fr 01.01.16 Mo 04.01.16 Mi 06.01.16 Fr 08.01.16 Richard Wagner Die Walküre Klaus Florian Vogt, Hans-Peter König, Thomas J. Mayer, Anja Kampe, Petra Lang, Daniela Sindram, Daniela Köhler, Karen Foster, Lise Davidsen, Heike Grötzinger, Helena Zubanovich, Alexandra Petersamer, Okka von der Damerau, Rachael Wilson Laurent Naori, Christiane Karg, Stanislas de Barbeyrac, Sylvie Brunet, Anne Schwanewilms, Susanne Resmark, Anna Christy, Heike Grötzinger, Angela Brower, Alexander Kaimbacher, Ulrich Reß, Tim Kuypers, Andrea Borghini, Igor Tsarkov, Johannes Kammler, Oscar Quezada (23.01. /30.01.), Tobias Neumann (28.01./ 01.02.) Bo Skovhus, Marlis Petersen, Christian Rieger, Daniela Sindram 31.12./01./04./06.01., Michelle Breedt 08.01., Edgaras Montvidas, Michael Nagy, Ulrich Reß, Anna Prohaska, Cornelius Obonya, Eva Patricia Klosowski, Ivan Michal Unger sponsored by Musikalische Leitung Simone Young Inszenierung Andreas Kriegenburg Musikalische Leitung Bertrand de Billy Inszenierung Dmitri Tcherniakov Giacomo Puccini Musikalische Leitung Ivor Bolton Inszenierung Martin Duncan Do 14.01.16 19:00 Uhr So 17.01.16 18:00 Uhr Mi 20.01.16 19:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 19:00 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr Engelbert Humperdinck Hänsel und Gretel Musikalische Leitung Tomáš Hanus Inszenierung Richard Jones Sa 28.11.15 17:00 Uhr Mi 02.12.15 17:00 Uhr Sa 05.12.15 16:00 Uhr Sebastian Holecek, Helena Zubanovich, Angela Brower 14./15./18./21.12., Tara Erraught 22.12., Hanna-Elisabeth Müller 14./15./18./21.12., Eri Nakamura 22.12., Kevin Conners, Deniz Uzun, Leela Subramaniam sponsored by Mo 14.12.15 Di 15.12.15 Fr 18.12.15 Mo 21.12.15 Di 22.12.15 19:00 Uhr 18:00 Uhr 19:00 Uhr 18:00 Uhr 11:00 Uhr Richard Strauss Arabella Musikalische Leitung Constantin Trinks Inszenierung Andreas Dresen Kurt Rydl, Doris Soffel, Anja Harteros, Hanna-Elisabeth Müller, Thomas J. Mayer, Joseph Kaiser, Dean Power, Andrea Borghini, Tareq Nazmi, Erin Morley, Heike Grötzinger, Johannes Kammler, Bastian Beyer, Vedran Lovric, Tjark Bernau Mi 13.01.16 19:00 Uhr Sa 16.01.16 19:00 Uhr Di 19.01.16 19:00 Uhr Mit freundlicher Unterstützung der Mit freundlicher Unterstützung Mit freundlicher Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung der Münchner Opernfestspiele e.V. 95 96 Ballett John Cranko Onegin Musik Peter I. Tschaikowsky Musikalische Leitung Myron Romanul Solisten und Ensemble des Bayerischen Staatsballetts Bayerisches Staatsorchester John Neumeier Die Kameliendame Musik Frédéric Chopin Musikalische Leitung Michael Schmidtsdorff Solisten und Ensemble des Bayerischen Staatsballetts Bayerisches Staatsorchester Mi 14.10.15 So 18.10.15 So 18.10.15 Mo 26.10.15 19:30 Uhr 14:30 Uhr 19:30 Uhr 19:30 Uhr Marius Petipa, Ivan Liška Le Corsaire Musik Adolphe Adam, Léo Delibes Musikalische Leitung Aivo Välja Solisten und Ensemble des Bayerischen Staatsballetts Bayerisches Staatsorchester Fr So So Sa Fr 30.10.15 08.11.15 08.11.15 21.11.15 27.11.15 19:30 Uhr 15:00 Uhr 19:30 Uhr 19:30 Uhr 19:30 Uhr Di Fr Fr Sa 01.12.15 04.12.15 11.12.15 26.12.15 19:30 Uhr 19:30 Uhr 19:30 Uhr 18:00 Uhr Jerome Robbins / Aszure Barton / George Balanchine In the Night / Kreation Aszure Barton / Sinfonie in C Musik Frédéric Chopin, Curtis Macdonald, Georges Bizet Musikalische Leitung Michael Schmidtsdorff Solisten und Ensemble des Bayerischen Staatsballetts Bayerisches Staatsorchester So 20.12.15 Di 22.12.15 Mo 28.12.15 Fr 29.01.16 19:30 Uhr 19:30 Uhr 19:30 Uhr 20:00 Uhr Premiere Marius Petipa, Alexei Ratmansky Paquita Hauptsponsor der Orchesterakademie Musik Edouard-Marie-Ernest Deldevez, Ludwig Minkus Musikalische Leitung Myron Romanul Solisten und Ensemble des Bayerischen Staatsballetts Bayerisches Staatsorchester Matinee der Heinz-Bosl-Stiftung / Junior Company Ensemble des Bayerischen Staatsballetts II / Junior Company Schüler und Studenten der Ballett-Akademie München So 22.11.15 11:00 Uhr So 20.12.15 11:00 Uhr Sa So So So Di 09.01.16 10.01.16 24.01.16 24.01.16 26.01.16 19:30 Uhr 17:00 Uhr 15:00 Uhr 19:30 Uhr 19:30 Uhr Menschen suchen ihre Zukunft in Städten, die heute schon an morgen denken. München wächst schneller als jede andere Stadt in Deutschland: Prognosen zufolge werden im Jahr 2020 über 1,5 Millionen Menschen in der bayrischen Landeshauptstadt leben. Aber in München wächst nicht nur die Zahl der Einwohner. Die Stadt hat ehrgeizige Ziele – für den Wirtschaftsstandort und für die Lebensqualität der Menschen. Neubauten und bei der Modernisierung bestehender Häuser. Und sichere und wirtschaftliche Stromnetze binden mehr Energie aus erneuerbaren Quellen ein und sorgen dafür, dass sie genau dort zur Verfügung steht, wo sie gebraucht wird. So wächst nicht nur die Wirtschaftskraft, sondern auch die Lebensqualität. Modernste Verkehrsleittechnik und ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz halten die Stadt in Bewegung und entlasten dabei die Umwelt. Intelligente Gebäudetechnik spart Energie – bei 97 siemens.com Konzert 1. Kammerkonzert Themenkonzerte Zur Uraufführung von Miroslav Srnkas Oper South Pole Ein Projekt mit Konzerten und Vorträgen in Zusammenarbeit mit der Max-PlanckGesellschaft 1. Themenkonzert Do 14.01.16 19:00 Uhr Thema Meereis im Erdsystem 2. Themenkonzert Sa 16.01.16 19:00 Uhr Thema Traumforschung 3. Themenkonzert Mi 20.01.16 19:00 Uhr Thema Vermessung der Atmosphäre 2. Akademiekonzert 4. Themenkonzert Fr 22.01.16 19:00 Uhr Thema Geschichte der Gefühle Franz Liszt / Paul Hindemith / Sergej Prokofjew 5. Themenkonzert Sa 23.01.16 19:00 Uhr Thema Motoren der Zukunft Alfred Schnittke / Ludwig van Beethoven / Dmitri Schostakowitsch So 18.10.15 11:00 Uhr Allerheiligen Hofkirche Musikalische Leitung Vladimir Jurowski Mo 02.11.15 20:00 Uhr Di 03.11.15 20:00 Uhr Die Veranstaltungsorte der einzelnen Themenkonzerte finden Sie auf www.staatsoper.de/spielplan. 2. Kammerkonzert Franz Schubert / Wolfgang Amadeus Mozart So 15.11.15 11:00 Uhr JETZ Allerheiligen Hofkirche ONL Adventsmusik in St. Michael ZUS OperaBrass – Die Blechbläser der Bayerischen Staatsoper Orgel Frank Höndgen Wolfgang Amadeus Mozart / Krzysztof Penderecki / Benjamin Britten / Sergej Prokofjew Allerheiligen Hofkirche 3. Akademiekonzert Leonard Bernstein / Darius Milhaud / Jacob ter Veldhuis / Peter I. Tschaikowsky Musikalische Leitung Kristjan Järvi Saxophon Branford Marsalis ! Für Dich! Ein Kinderlächeln. Was gibt es Schöneres? Mit Ihrer Hilfe können noch mehr Kinder eine unbeschwerte Kindheit erleben. Ihre Zuwendung an die SOS-Kinderdorf-Stiftung bewirkt mehr Freude. Mehr Glück. Mehr Kindheit. Und das nachhaltig! Mo 11.01.16 20:00 Uhr Di 12.01.16 20:00 Uhr 99 TEN St. Michael 3. Kammerkonzert So 10.01.16 11:00 Uhr INE TIF Weihnachten mit OperaBrass – In Dulci Jubilo Sa 12.12.15 20:00 Uhr T Petra Träg 089 12606-109 [email protected] sos-kinderdorf-stiftung.de Extra Konzert des Opernstudios Premierenmatinee So 25.10.15 20:00 Uhr Cuvilliés-Theater Der feurige Engel So 15.11.15 11:00 Uhr Porträtkonzert des Opernstudios Operndialog Solisten Marzia Marzo, Johannes Kammler Mefistofele So 15.11.15 14:00 Uhr Mo 16.11.15 16:00 Uhr Teil 1 Teil 2 Capriccio-Saal Capriccio-Saal Der feurige Engel Sa 12.12.15 10:00 Uhr So 13.12.15 10:00 Uhr Teil 1 Teil 2 Capriccio-Saal Capriccio-Saal Do 29.10.15 19:30 Uhr Künstlerhaus 1. Kammerkonzert der Orchesterakademie Fr 20.11.15 20:00 Uhr Allerheiligen Hofkirche TV Ariadne auf Naxos Campus Ballett extra Proben zur Premiere In the Night / Kreation Aszure Barton / Sinfonie in C Do 10.12.15 20.00 Uhr Ballett-Probenhaus Hauptsponsor der Orchesterakademie ATTACA-Konzert Ludwig van Beethoven / Jean Sibelius ATTACA – Jugendorchester des Bayerischen Staatsorchesters Musikalische Leitung Allan Bergius Violine Albrecht Menzel Di 24.11.15 19:00 Uhr Prinzregententheater Porträtkonzert des Opernstudios Solisten John Carpenter, Anna Rajah Fr 11.12.15 19.30 Uhr Künstlerhaus 101 erleben Sie ausgewählte 23.10.2015 RichaRd StRauSS – ariadne auf Naxos opern- und Ballettaufführungen 15.11.2015 aRRigo Boito – Mefistofele live und kostenlos 12.12.2015 SeRgej PRokofjeW – der feurige engel auf www.staatsoper.de /tv 19.03.2016 giuSePPe VeRdi – un ballo in maschera 12.06.2016 MaRiuS PetiPa / iVaN Liška – Le corsaire 26.06.2016 fRoMeNtaL haLéVy – La juive 31.07.2016 RichaRd WagNeR – die Meistersinger von Nürnberg 2015 2016 Die Vermesser Für das Gelingen einer Opernaufführung müssen viele, sehr viele Dinge vermessen werden. In der Spielzeit 2015/16 schildern Mitarbeiter der Oper in MAX JOSEPH ihr Handwerk. Foto Wilfried Hösl Foto Gerhardt Kellermann Text Christiane Lutz Folge 1: Hutmacherin Margarethe Luegmair-Ertl Die Währung der Zukunft sind unsere Daten. Unternehmen benutzen und entwickeln komplizierte Algorithmen, mit deren Hilfe sie tief in die Köpfe und Hirne ihrer Kunden blicken wollen, um Entscheidungen und Kaufvorgänge vorauszusehen. Die Vermessung des Kopfes samt Hirn indes ist ein Vorgang, der an der Bayerischen Staatsoper tagtäglich stattfindet. In die Köpfe schauen kann auch Margarethe Luegmaier-Ertl nicht, wohl aber mit einfachsten Mitteln die wichtigsten Größen erfahren. Unzählige Köpfe hat die Hutmacherin in ihren 43 Berufsjahren vermessen. Dickschädel. Kinderköpfe. Runde oder ovale Köpfe. Hoch erhobene Profiköpfe. Zur Seite geneigte Debütantenköpfe. Zum Vermessen legt sie zunächst die Hand auf. Die Finger am Hinterkopf, die Handfläche am Scheitel, so spürt sie sofort, womit sie es zu tun hat. Fast auf den Zentimeter genau kann sie den Umfang erfühlen. Um das genaue Maß zu ermitteln, braucht sie keinen Algorithmus, ihr genügt einfaches Maßband, das sie um die Köpfe schlingt. Dabei kommt meist ein Wert zwischen 58 und 63 Zentimetern raus. Mehr als ein halber Meter Kopf. „Die Köpfe der Leute werden aber immer größer“ sagt sie, „und immer runder.“ In den Regalen von Luegmair-Ertls Werkstatt stehen stumm ihre Holzköpfe, denen sie die Prototypen ihrer Hüte aufsetzt. Sie hat alles da, vom Kinderkopf zum Stiernackenkopf, zwischen 50 und 64 Zentimeter Umfang. Einige Holzköpfe sind dunkel verfärbt und glänzen abgegriffen, 80 Jahre alt sind einige. Luegmair-Ertl arbeitet mit Filz, Leder, falschem Leder, Kunststoffen, je nachdem, was der Kostümbildner sich wünscht. Zur Zeit schlingt sie Dornenkronen aus Draht und Plastik. 105 Stück sind bestellt für die Oper Der feurige Engel. Solche Massenproduktion findet sie natürlich ermüdend. „Die Kostümbildner haben viele Ideen, aber wir müssen die Kunst der Realität anpassen“, sagt sie. Eine Kopfbe- Margarethe Luegmair-Ertl vermisst und behütet ­Köpfe seit 43 Jahren. deckung könne zum Beispiel das Hören oder das Singen auf der Bühne beeinträchtigen. „Das geht natürlich nicht, auch wenn sich der Kostümbildner vielleicht eine Maske wünscht, aus der nur die Augen rausschauen.“ An ganz verrückten Produktionen arbeite sie allerdings nur noch selten. „Die Regisseure sind braver geworden – wenn man sich die Hüte anschaut. David Alden und seine Kostümbildnerin Buki Shiff machen hingegen immer wilde Sachen. Oder die spanische Theatergruppe La Fura dels Baus, die wollten abgefahrene Kopfbedeckungen aus Stahldraht, geschmückt mit Leuchtkörpern und Federn.“ Für Produktionen immerhin, die heute noch zu sehen sind. Für solche Wünsche lötet und schweißt die Hutmacherin auch mal in der Rüstwerkstatt. Kommt ein Sänger dann zur Anprobe, ist das der heikelste Moment ihrer Arbeit. Dann zeigt sich, ob ein Modell sitzt oder nicht. Ob die Vision des Kostümbildners der Realität und den Bedürfnissen des Sängers standhalten kann. Mit dem Kopfweitenmesser, einem verstellbaren Holzring, der in einen Hut hineingeklemmt wird, überprüft sie, wie genau sie gemessen hat. Ein antiquiert wirkender Dampfapparat kann fast alle Materialien nachträglich formen, sogar weiten, wenn ein Hut zu klein ist. Die Hutmacherin weiß längst, welcher Sänger welche Hut-Vorlieben hat und wer am liebsten überhaupt keine Kopfbedeckung aufsetzen möchte. Das Gesicht und der Kopf sind eine intime Körperregion. Bisher hat sie mit Sängern und Kostümbildnern immer eine Lösung gefunden. Manchmal träumt die Hutmacherin davon, eine Revue auszustatten, mit vielen Federn und Pomp. Es fasziniert sie, wie anders ein Mensch aussieht, wenn er einen Hut trägt. Wie er damit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Wie er den Kopf hält, wie er plötzlich ein anderer ist. Diesen Zauber kann allerdings niemand vermessen. 103 Kurt Simonson, Sales Map from the Series Northwood Journals, 2006 MAX JOSEPH 2 Vorschau #2 Vermessen: Der Raum South Pole – Uraufführung Komposition von Miroslav Srnka, Libretto von Tom Holloway Un ballo in maschera – Premiere Giuseppe Verdi Ich als Forscher: Klaus Maria Brandauer MJ 2 2015 – 2016 erscheint am 22.1.2016.

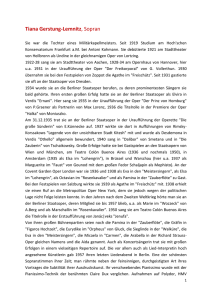


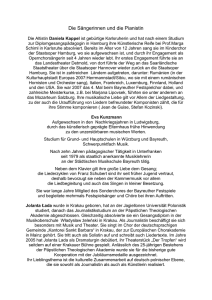
![alpines museum newsletter [januar- februar 2016]](http://s1.studylibde.com/store/data/001004943_1-01612c27e56c494f0cac36031d1926fb-300x300.png)