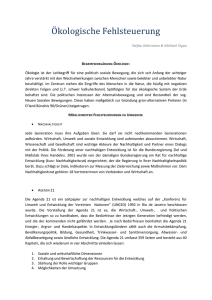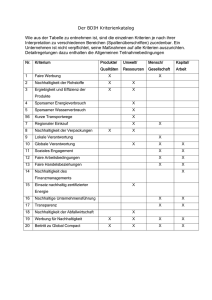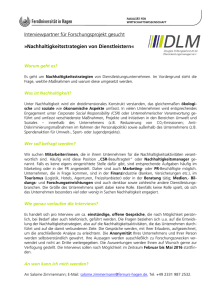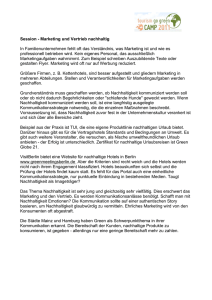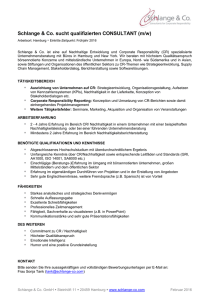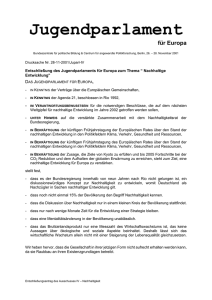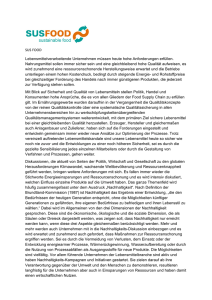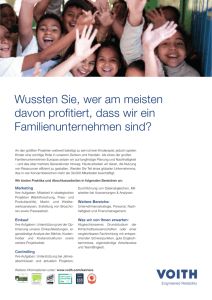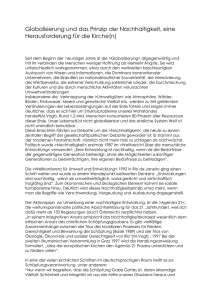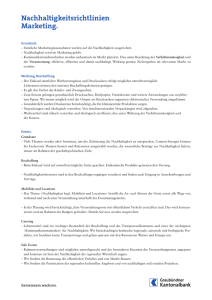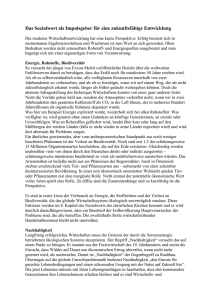Nachhaltigkeit als neues Sozialprinzip - Katholisch
Werbung

Nachhaltigkeit als neues Sozialprinzip (Christliche Sozialethik III: Umwelt- und Entwicklung) von Prof. Dr. Markus Vogt LMU München, SS 2008, Fr 10-12 Uhr Nachhaltigkeit ist ein zentraler Leitbegriff der Politik im 21. Jahrhundert, der davon ausgeht, dass die Ziele der sozialen Gerechtigkeit, der ökologischen Tragfähigkeit und der wirtschaftlichen Effizienz nur erreichbar sind, wenn man in neuer Weise ihre komplexe Wechselwirkung beachtet. Wenn man ihn ernst nimmt, impliziert er ein neues Verständnis von Wohlstand, Lebensqualität und Technikverantwortung. Obwohl Nachhaltigkeit auch in der katholischen Sozialethik eine wachsende Rolle spielt, ist seine konkrete Bedeutung und Zuordnung zu den traditionellen Leitbegriffen bisher nicht hinreichend geklärt. Die Vorlesung fasst aktuelle Forschungen zu theologischen und ethischen Grundlagen der globalen Umweltund Entwicklungspolitik zusammen und diskutiert konkrete Konsequenzen für gesellschaftliche, kirchliche und persönliche Handlungsfelder. Die Vorlesung erhebt nicht den Anspruch die Fülle der in der Gliederung genannten Aspekte vollständig zu entfalten, sondern behält sich vor, je nach Interesse und Aktualität auszuwählen. I. Einführung (1) Einführung zur Fragestellung und Methode der Vorlesung - persönliche Vorbemerkungen und aktuelle Anknüpfungen in Kirche und Forschung - Welche Kompetenzen haben Theologie und Kirche im Nachhaltigkeitsdiskurs? - Perspektiven für ein Forschungsprogramm: Nachhaltigkeit als neues Sozialprinzip (2) Die Umweltkrise im Spiegel des gesellschaftlichen Diskurses - Phasen des ökologischen Diskurses im Spiegel der Literatur Wahrnehmungsprobleme: Blinde Flecken unseres natürlichen „Frühwarnsystems“ Deutungsmodelle: „Grenzen des Wachstums“: Ressourcenverknappung, Bevölkerungsentwicklung und konsumorientierter Lebensstil Die Vergesellschaftung der Umweltschäden (U. Beck; H. Höhn) II. Zusammenhänge von Umwelt, Gerechtigkeit und Frieden (3) Der globale Klimawandel als Brennpunkt neuer Gerechtigkeitskonflikte - Keine Gerechtigkeit ohne Klimaschutz, kein Klimaschutz ohne Gerechtigkeit Fakten und Prognosen zum Klimawandel Gesellschaftliche Folgen des Klimawandels CO2-Gerechtigkeit: Kriterien und Perspektiven für einen neuen global deal (4) Die Gefährdung des Friedens durch Ressourcenkonflikte - Energie und Wasser als Schlüsselkonflikte des 21. Jahrhunderts Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 2 - Hunger contra Überfluss: Ökologische und agrarpolitischen Zusammenhänge Migration und neue Kriege im Kontext von Ressourcenkonflikten Biodiversität und Artensterben: aktuelle Analysen zur UN-Konferenz in Bonn III. Das Leitbild „nachhaltige Entwicklung“ (5) Nachhaltige Entwicklung: Vision für einen neuen Gesellschaftsvertrag oder unverbindlicher „Alleskleber“? - Kleine Begriffsgeschichte zur „nachhaltige Entwicklung" (sustainable development): Von der Forstwirtschaft zum Leitprogramm für globale Zukunftspolitik - Quellentexte zur politischen Ausformulierung (UNCED-Konferenzen in Rio de Janeiro und Johannesburg, Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, BayernAgenda 21, „Zukunftsfähiges Deutschland“ etc.) - Systematischer Zugang: Die Vernetzung der drei Dimensionen Soziale Gerechtigkeit, Ökologische Tragfähigkeit und Ökonomische Effizienz - Zur Rolle ethischer Leitbilder in der offenen Gesellschaft (6) Annäherungen an den ethischen Strategiekern von Nachhaltigkeit - Starke Nachhaltigkeit: Naturkapital als dynamische Basis von Wohlstand Soziale Nachhaltigkeit: Die Entdeckung der Natur als Reichtum der Armen Ökologische Ökonomie: Ein neues Wohlstandsmodell Energie und Arbeit: Eine doppelte Krise als Chance Partizipation: Mittel und Ziel im Suchprozess nachhaltiger Entwicklung (7) Theologische Beiträge zum Nachhaltigkeitsdiskurs - Sustainable Society: Wegbereitung durch den Weltrat der Kirchen Ganzheitliche Entwicklung: Stellungnahmen des katholischen Lehramtes Europäische Versammlungen für Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfungsverantwortung Nachhaltigkeit in Solidarität und Gerechtigkeit: Kirchliche Einmischung in Deutschland Praktizierter Schöpfungsglaube: Bewährungsprobe im kirchlichen Alltag Die Erdcharta: Perspektiven für ein ökologisches Weltethos IV. Begründungsansätze: Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit (8) Schöpfungstheologische Ausgangspunkte - Das Christentum als geistesgeschichtliche Wurzel der Umweltkrise? Biblische Grundlagen: Schöpferische Unterschiede Ethische Leitbegriffe christlicher Schöpfungstheologie Schöpfungstheologie im interreligiösen Diskurs (Tiefen-)Ökologie und Religion Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 3 (9) Naturverständnis und christliche Ethik - Natur als Spiegel des menschlichen Selbstverständnisses Begriffsklärung (etymologisch, metaphysisch, naturwissenschaftlich, gesellschaftstheoretisch, theologisch) Natur und Freiheit: Das Problem des naturalistischen Fehlschlusses Transformation des Naturrechts im Kontext von Anthropologie und Ökologie Ökologie als Gesellschaftskritik (politische Ökologie) (10) Philosophische Begründungstypen der Umweltethik - Fragebogen: “Welcher Ethiktyp sind Sie?“ Begründungstypen ökologischer Ethik: Die Würde des Menschen oder „Vermeidung von „Leid“? „Leben“ und „Rechtsgemeinschaft der Natur“ als Basis? „Ökologische Aufklärung“ der Anthropozentrik Retinität: Vernetzung als Schlüsselprinzip einer ökologischen Sozialethik; naturphilosophische, schöpfungstheologische und gesellschaftstheoretische Begründungen (11) Ressourcenkonflikte und intergenerationelle Gerechtigkeit - Reichweite und Grenzen der Verantwortung in komplexen historischen Prozessen Woran kann man das Postulat „gleiche Lebenschancen für künftige Generationen“ messen? Perspektiven für eine „Ökologie der Zeit“ V. Handlungsfelder für eine nachhaltige Gesellschaft (12) Politische Dimensionen: „Global Marshallplan“ - Institutioneller Wandel: Voraussetzungen für Ressourcengerechtigkeit Leitplanken für eine Ökologische Marktwirtschaft auf Weltebene Die Bedeutung von Mikrokrediten für die Armutsüberwindung „Kyoto-plus“: Politische Ansätze und Barrieren für Klimagerechtigkeit (13) Nachhaltigkeit und Energie - Zur Bedeutung von Energie für Armut, Entwicklung und Wohlstand Analysen zur Reichweite der verschiedenen Energieträger „Solare Weltwirtschaft“: Chancen und Barrieren Wege für eine nachhaltige Energiewirtschaft (14) Mobilität: Unser Umgang mit Raum und Zeit - Kulturkritik und ethische Analysen der Beschleunigungsgesellschaft Daten zum deutschen Mobilitätsverhalten Perspektiven für eine nachhaltige Mobilität Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 4 (15) Konsumverhalten: gesellschaftliche Trends und neue Chancen der Ethik - Daten zum deutschen Konsumverhalten Postmoderne Dematerialisierung der Werte? „Simplify your life“: Bedürfnisethik zwischen Haben und Sein „Politik mit dem Einkaufskorb“: Chance für eine Revolution von unten? (16) Zur Rolle der Ethik im Programm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ - Die UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ (BfnE) Lernschritte und Handlungsfelder der BfnE Schlussfolgerungen für ein Bildungsethik Zur Rolle der Theologie in Forschung und BfnE VI. Resümee (17) Nachhaltigkeit als viertes Sozialprinzip christlicher Ethik? - Religiöse Potentiale für Nachhaltigkeit (die Außenperspektive des Worldwatch Institutes) Vom Leitbild zum Prinzip: Konsequenzen und Anforderungen an Nachhaltigkeit im Kontext der Katholischen Sozialprinzipien (Anknüpfungen und Innovationen) Offene Fragen; Abschlussdiskussion Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 5 I. Einführung zur Fragestellung und Methode der Vorlesung 1. Notwendige Lernprozesse in Kirche und Gesellschaft Die vielschichtigen Phänomene der Umweltkrise prägen das Leben der Menschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Große Wohlstands- und Freiheitschancen stehen einer ebenso großen Hilflosigkeit gegenüber. Die sozialen und ökologischen Nebenwirkungen der wirtschaftlichen und zivilisatorischen Globalisierung führen zur Verelendung ganzer Völker sowie zu einer tief greifenden Veränderung der Lebensbedingungen auf dem Planeten Erde. Die Zukunftsfähigkeit unseres Zivilisationsmodells ist wesentlich abhängig von einer ethisch-politischen Antwort auf die Vernetzung zwischen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen der weltweiten Entwicklung. Christinnen und Christen sind davon überzeugt, dass dem Menschen eine Zukunft zugesagt ist, die Heil und Erlösung bedeutetet, die alle Menschen und die gesamte Schöpfung einschließt1. Diese Zukunft bedeutet Verantwortung für die Mitmenschen, besonders die Ärmsten und gleichermaßen für die ökologischen Lebensräume der kommenden Generationen. Christinnen und Christen sind überzeugt, dass das biblische Menschenbild und der biblische Schöpfungsglauben eine zukunftsfähige Orientierung ausmachen, und dass die Kirche als „Sakrament der Völker“ (LG 1) Zeichen und Werkzeug für die Vereinigung der Menschen mit Gott (= Heil) und für die Einheit der Menschen (= ethisches Fundament einer gelingenden Globalisierung) ist. Eben dieses Heil ist nicht jenseits der Verantwortung für die Welt und menschenwürdige Lebensbedingungen zu finden. Zugleich müssen Christinnen und Christen anerkennen, dass ihr eigener Beitrag zu Fehlentwicklungen und Verantwortungslosigkeit im Umgang mit der Schöpfung erheblich ist, und dass die Antworten der Kirche und der christlichen Ethik auf die ökologischen Herausforderungen nur geringe Orientierungskraft entfalten: - Durch die Kritik am biblischen Herrschaftsauftrag „macht euch die Erde untertan“ (Gen 1, 28) und die ideologisch aufgeladene Konfrontation bio- oder anthropozentrischer Letztbegründung ist christliche Umweltethik zum Großteil in eine unfruchtbare Defensivposition geraten. - Versuche einer systematischen Antwort auf die Umweltproblematik gibt es eher im Rahmen der Individualethik (z.B. auf der Grundlage der Maxime „Ehrfurcht vor dem Leben“) oder eine naturmystisch aufgeladenen Spiritualität; diesen Ansätzen fehlt weitgehend die gesellschaftstheoretische Basis. Es fehlt an Antworten, die über kulturphilosophische Grundsatzreflexionen, individualethische Appelle und Anklagen der politischen und wirtschaftlichen Akteure hinauskommen. - Die theologischen und ethischen Optionen der Schöpfungsverantwortung werden nur unzureichend in einen Zusammenhang gebracht mit den aktuellen Entscheidungs- und Strukturproblemen der Umwelt- und Entwicklungspolitik. Es fehlt ein Schlüssel, um den Schöpfungsglauben in konkrete Regeln für sozialverträgliches 1 Gen 9; Kol 1. Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 6 Wirtschaften zu übersetzen und auf dieser Basis für einen Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie fruchtbar zu machen. - Aufgrund der mangelnden Anwendung der anspruchsvollen schöpfungsethischen Appelle im Bereich kirchlicher Verwaltung ist eine tiefe Glaubwürdigkeitslücke entstanden. Die katholische Kirche ist eher Nachzügler als Impulsgeber im Umweltdiskurs2. Sie hat methodische Probleme, ihren ethischen Einfluss in der sich rapide verändernden pluralen Weltgesellschaft geltend zu machen. Die Umweltfrage ist bisher noch kein systematisches Grundelement christlicher Soziallehre.3 Das Fehlen einer Klärung der sozialethischen Grundlage für die Antwort der Kirchen auf die Umweltfrage in ihren tiefen ökonomischen, entwicklungspolitischen und kulturellen Zusammenhängen wurde exemplarisch deutlich im Entwurf der Diskussionsgrundlage zum Konsultationsprozess: Ökologische Problemfelder tauchten nur vereinzelt und als ein die Kirche nicht näher angehendes Randphänomen auf. Das gleicht einer Verharmlosung der Situation. Zusammenhänge zwischen dem Verständnis von Arbeit, Wirtschaft und Schöpfung/Umwelt werden ignoriert. Deshalb bleiben kirchliche Stellungnahmen zu ökologischen Fragen häufig auf der Ebene moralischer Appelle stehen. An moralischen Appellen aber besteht gerade im Umweltdiskurs kein Mangel, sondern eher eine „Überversorgung“, die die Motivation erdrückt. 2. Nachhaltigkeit: Chance für "politikfähige" Übersetzung der Schöpfungsethik Die qualitativ neue Herausforderung besteht darin, dass die Phänomene der global beschleunigten Entwicklung von Armut und Umweltzerstörung in einem engen inneren Zusammenhang stehen und deshalb gemeinsam analysiert und bewältigt werden müssen. Wirtschaftlicher Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und ökologische Tragfähigkeit stehen heute aufgrund der engen Verflechtung weltweiter Wirkungszusammenhänge so sehr in einer wechselseitigen Abhängigkeit, dass sie nicht einzeln oder gar gegeneinander gesichert werden können. Ohne eine systematische Verknüpfung und weltweite Einbindung bleiben die Konzepte der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltethik nur kurzatmige Symptombehandlungen. Diese Analyse ist nicht neu: Sie liegt dem Leitbild der „Nachhaltigkeit“ zugrunde, auf den sich 1992 bei der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung die Völkergemeinschaft verständigt hat. Nachhaltigkeit wurde dort definiert als ökologisch tragfähige, sozial gerechte und wirtschaftlich effiziente Entwicklung. In der Agenda 21 wurde ein konkreter Fahrplan für diese Vision als Grundlage der Politik im 21. Jahrhundert von den obersten Vertretern von 179 Staaten anerkannt und unterschrieben. Von dem Anspruch der Nachhaltigkeit, als Querschnittsthema alle Reflexions- und Handlungsbereiche zu durchdringen, ist ihre Entfaltung und Rezeption jedoch weit entfernt. Der Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger ist das Leitbild der Nachhaltigkeit schlicht unbekannt. In der Praxis jenseits der verbalen Appelle auf großen Konferenzen hat es sich bestenfalls als Randbereich gesellschaftlicher Verantwortung etabliert. Im Konflikt mit anderen Ansprüchen und Optionen hat es meistens einen nachgeordneten Stellenwert. 2 3 So H. Langendörfer, in: Vogt/Lippert: Bündnispartner für die Schöpfung - Kirche und Umweltverbände im Dialog, Benediktbeuern 1999, 27-33. Korff 1996, 453f. Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 7 Dies zeigt sich deutlich an zahlreichen Entscheidungen im Bereich wirtschaftlicher Grundoptionen, der Verwaltung, der Energieversorgung, der Bauplanung, des Mobilitätsverhaltens und der Entwicklungspolitik4. Der Gedanke der Nachhaltigkeit kann jedoch nicht Nebensache sein, denn damit würde das Konzept einer aufs Ganze angelegten Integration der unterschiedlichen Belange zum Türöffner für Beliebigkeit. Wer Nachhaltigkeit als Nebensache behandelt, lässt den Begriff zur Leerformel werden. Die Herausforderung des Leitbilds nachhaltiger Entwicklung für die Kirche besteht darin, dass es die fundamentale Vernetzung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Globalisierung deutlich macht: Es geht nicht um Einzelprobleme, sondern um die ethischen Grundlagen, Regeln und Ziele gesellschaftlicher Entwicklung. Nachhaltigkeit fordert eine neue Verständigung darüber, was die tragenden Grundwerte des Lebens sind, wie wir weltweite Gerechtigkeit und Überlebensfähigkeit sichern können, aus welchen Quellen die Reformfähigkeit von Politik und Gesellschaft gestärkt werden kann. Damit werden Einzel- und Fach-Fragen gebündelt zu einer grundlegenden ethischen Herausforderung, die auch die Kirchen unmittelbar angeht. Der ganzheitliche Anspruch der Nachhaltigkeit erfordert, ihn entweder in der Mitte des Selbstverständnisses und der eigenen Tradition zu verankern oder ihn abzulehnen. Trotz sehr früher kirchlicher Impulse und Rezeptionen von Nachhaltigkeit sind die Kirchen jedoch noch weit entfernt von einer soliden Verankerung im christlichen Glauben, in den ethischen Grundhaltungen des Alltags, in den politischen Zielen und der praktischen Organisation kirchlicher Institutionen. Frage ist, ob der Ansatz der Nachhaltigkeit ohne Widersprüche mit dem biblischen Schöpfungsglauben und der Tradition christlichen Ethik verbunden werden kann und wie diese ihrerseits zu einer Vertiefung von Nachhaltigkeit beitragen können. Christliche Schöpfungsverantwortung findet nur dann im Leitbild der Nachhaltigkeit ihren zeitgemäßen Ausdruck, wenn sie ihrerseits eine ethische und religiöse Dimension dieses Leitbildes aufdecken und aus den eigenen Quellen heraus interpretieren kann. Welchen Erkenntnisgewinn bringt die schöpfungstheologische Argumentationsfigur, dass (ein) Gott die Welt geschaffen hat, zur Begründung des Umweltschutzes in einer modernen, pluralistischen Gesellschaft? Was kann die theologische Interpretation ökologischer und sozialer Verantwortung im Globalisierungsprozess zur kirchlichen und gesellschaftlichen Verständigung und entsprechend verantwortlichem Handeln beitragen? Nur wenn der christliche Glaube einen originären Beitrag zum Verständnis und zur Umsetzung von Nachhaltigkeit leistet, ist das Leitbild kirchlich rezeptionsfähig und verdient eine Ausarbeitung und Anerkennung im Rahmen der katholischen Sozialethik. 3. Herausforderungen für eine Erweiterung der Sozialprinzipien Die Globalisierung der ökologischen und sozialen Frage lässt sich ethisch nicht hinreichend beantworten mit dem Aufstellen von Einzelnormen, sondern fordert ein Hinterfragen der Grundsätze, nach denen Politik und Wirtschaft organisiert werden. Es geht darum, normative Leitlinien soziale Konflikte sowie die Gestaltung der gesellschaftlichen Strukturen nach allgemeinen Gesichtspunkten transparent zu machen, zu erklären, zu ordnen und zu gestalten. Genau dies ist die Ebene der Sozialprinzipien5. 4 5 Vgl. UNEP 1999; UNEP 2002 (Berichte zu Johannesburg). Sozialprinzipien sind die ethische Grammatik für den Strukturaufbau der Gesellschaftsordnung. Theologisch betrachtet haben sie ihren Ort auf der grundsätzlichen Ebene der Übersetzung biblischer Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 8 Hier ergibt sich jedoch ein Dilemma: Die klassischen Sozialprinzipien Personalität, Solidarität und Subsidiarität, die den systematischen Kern katholischer Sozialethik ausmachen, sind auf den zwischenmenschlichen Bereich bezogen. Sie können daher keine hinreichende Antwort auf ökologische Herausforderungen geben. Auch die Komplexität der Globalisierungsprozesse ist eine qualitativ neue Herausforderung. Auf der Ebene der Sozialprinzipien kommt die Umwelt- und Entwicklungsfrage nicht vor. Der Beginn des 21. Jahrhunderts ist sozialethisch betrachtet eine Umbruchzeit, die dadurch gekennzeichnet ist, „dass Deutungs- und Orientierungsmuster ihre Plausibilität verlieren und Gesellschaften sich herausgefordert sehen, sich neu der Grundlage ihres Selbstverständnisses und damit ihrer Zukunftsfähigkeit zu vergewissern. Dabei kann es durchaus auch zur Ausprägung neuer Prinzipien kommen, mit denen dem Gang der geschichtlichen Entwicklung Rechnung getragen wird.“6 Von ihrer Geschichte her sind die Sozialprinzipien auf eine Erweiterung hin angelegt: Sie sind nicht gleichzeitig entstanden, sondern über Jahrhunderte gewachsen als ethische Antwort auf geschichtlich jeweils neue Herausforderungen. Bei den Prinzipien der Personalität und der Solidarität hat die Kirche ethische Impulse von außen aufgenommen (Personbegriff von Kant als Grundlage der Aufklärung; Solidarität war zunächst ein Klassenkampfbegriff im Sozialismus und den Gewerkschaften). Die zunächst „säkularen“ Begriffe wurden mit der eigenen Tradition verknüpft und so ethisch und theologisch neu ausgedeutet. Von daher liegt es in der konzeptionellen Linie der Sozialprinzipien, dass sie erweitert werden, wenn sich qualitativ neue geschichtliche Herausforderungen stellen und dass dabei auch ethische Begriffe und Reflexionen von außen in die kirchliche Tradition aufgenommen werden können. Daraus ergibt sich die zentrale Fragestellung dieser Vorlesung: Sie sucht die Anschlussfähigkeit, den Stellenwert und die Verbindlichkeit des Prinzips der Nachhaltigkeit im Kontext des christlichen Schöpfungsglaubens und der katholischen Sozialprinzipien zu klären. Die Aufgabe liegt darin, den umfassenden Anspruch und die Verbindlichkeit dieses Leitbildes deutlich zu machen, ohne in die Engführung eines ökologischen Naturalismus zu verfallen, der weder mit dem Schöpfungsglauben noch mit dem ersten und grundlegenden Sozialprinzip der Personalität vereinbar wäre. Ein christlicher Zugang zum Leitbild der Nachhaltigkeit muss deutlich machen, dass diesem nicht als ökologischem Fachbegriff, sondern als ethisch-politischem Programm und als einer kulturellen Aufgabe eine revolutionäre Bedeutung zukommt. Zu dieser erweiterten Interpretation von Nachhaltigkeit versucht diese Vorlesung aus spezifisch schöpfungstheologischer, naturphilosophischer, wirtschaftstheoretischer und politischethischer Perspektive einen Beitrag zu formulieren. Folgende Fragen und Thesen gilt es zu prüfen: - 6 Kann Nachhaltigkeit in seiner Begründung konsistent mit dem Schöpfungsglauben verbunden werden und trägt ihre Zuordnung zu den traditionellen Sozialprinzipien dazu bei, den Stellenwert und Zusammenhang ökologischer und entwicklungspolitischer Fragen auf prinzipieller Ebene sowie im Kontext der Tradition christlicher Ethik zu klären? Imperative in ordnungsethische Kategorien, die der offenen Dynamik moderner Gesellschaft und Wirtschaft Rechnung tragen. Baumgartner/Korff 1999, 225. Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 9 - Kann Nachhaltigkeit als ordnungsethisches Rahmenkonzept dienen, das die Grundoptionen christlicher Schöpfungsverantwortung unter den Bedingungen moderner Gesellschaft zur Geltung bringt und so eine Brücke bietet zu ihrer politisch und wirtschaftsethisch wirksamen Entfaltung? Ist Nachhaltigkeit also eine Art "missing link" zwischen Schöpfungsglauben und gesellschaftlichem Umwelt- und Entwicklungsdiskurs? Findet Schöpfungsverantwortung im Prinzip der Nachhaltigkeit ihren zeitgemäßen Ausdruck? - Besteht eine Strukturparallele zwischen der mangelnden Politikfähigkeit des Schöpfungsglaubens und der geschichtlichen Erfahrung mit der christlichen Interpretation der Caritas, die Jahrhunderte lang nur tugendethisch verstanden und für wesentliche Problemfelder erst in der Verbindung mit dem Personalitäts- und Solidaritätsprinzip politikwirksam wurde? Kann der als sozialethisches Prinzip interpretierte Gedanke der Nachhaltigkeit in ähnlicher Weise wie die anderen Prinzipien als Übersetzung biblischer Imperative in ordnungsethische Kategorien dienen, um ihnen politische Gestaltungskraft zu verleihen und ihre Konsequenzen für (post-)moderne Gesellschaften zu verdeutlichen? - Führt die Verknüpfung der Sozialprinzipien mit dem Nachhaltigkeitsmodell dazu, dass die Reflexion „im Schneckenhaus des Naturrechts“7 verkrustet oder lässt sich im Gegenteil von dem Nachhaltigkeitsdiskurs im Kontext moderner Anthropologie, Ökologie und Quantenphysik die Tradition des Naturrechtes erneuern? Ist die Erweiterung der Sozialprinzipien um Nachhaltigkeit ein notwendiger Schritt, um ihre naturrechtliche Tradition heute verständlich zu machen für aktuelle Problemfelder zu entfalten? - Kann christliche Sozialethik eine Spur zu konsistenten Antworten auf die Vernetzung zwischen den Herausforderungen der Globalisierung finden? Ist Nachhaltigkeit ein Rahmenkonzept, in dem sich heute die Zusammenhänge zwischen ökologischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verantwortung für die Folgen der Globalisierung besser analysieren und bündeln lassen und in dem die christlichen Antworten hierzu ein qualitativ angemessenes aggiornamento und eine verständliche Sprache finden? - Ist Nachhaltigkeit ein Kontext, in dem sich auch für die traditionellen Prinzipien der Personalität, Solidarität und Subsidiarität neue und heute notwendige Interpretationsaspekte zeigen? Wenn diese Fragen positiv beantwortet werden, ergibt sich, dass Nachhaltigkeit als gleichberechtigtes sozialethisches Prinzip in der christlichen Tradition verankert werden muss, wobei dies sowohl als Integration wie auch als Erweiterung zu gestalten wäre. Schöpfungsglaube und Sozialethik: Vertiefte Begründung der Nachhaltigkeit Positiv formuliert sind die Leitthesen, die in dieser Vorlesung untersucht werden sollen, folgende: Zwischen dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung und christlicher Schöpfungsverantwortung besteht ein Ergänzungsverhältnis: Einerseits ist christliche Schöpfungsverantwortung heute auf nachhaltige Entwicklung verwiesen, um gesellschaftliche Wirksamkeit entfalten, andererseits kann die Begründung und 7 Hengsbach 1993, bes. 33-56 (B. Emunds: Das naturrechtliche Schneckenhaus. Kritik der katholischen Soziallehre am Beispiel des Ansatzes von Lothar Roos). Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 10 Umsetzung des Leitbildes vom christlichen Schöpfungsglauben und Menschenbild her wichtige Orientierungshilfen erhalten. Der Glaube kann entscheidende Anstöße geben, um Nachhaltigkeit in ihrer kulturellen und ethischen Dimension zu vertiefen und so den notwendigen Kurswechsel zu einer nachhaltigen Entwicklung auf der Ebene des individuellen und gesellschaftlichen Wertewandels zu unterstützen. Dabei geht es nicht um eine christliche Vereinnahmung des Begriffs, sondern darum, ihn mit christlichen Inhalten zu verknüpfen und dadurch neue Dimensionen des Begriffs auszuleuchten. Auf diese Weise wird er zu einem Interpretationskontext der christlichen Botschaft, der ihre aktuelle Bedeutung für die moderne Gesellschaft vergegenwärtigt. Der Nachhaltigkeitsdiskurs kann und soll als Brücke für die Kommunikation zwischen Kirche und moderner Gesellschaft dienen. 4. Bisherige Beiträge der Kirchen zum Leitbild der Nachhaltigkeit Christinnen und Christen haben bereits einen nicht unerheblichen Beitrag zur Entwicklung des Leitbilds nachhaltiger Entwicklung geleistet: - Der Entwicklungsbegriff aus der Enzyklika Populorum Progressio von 1967 hat – vermittelt durch einige katholische Mitglieder des Club of Rome - die frühen Konzeptionen der UNO zur Verbindung von Umwelt- und Entwicklungsprogrammen, aus denen das Nachhaltigkeitskonzept hervorgegangen ist, beeinflusst8. Das kirchliche Verständnisses von Entwicklungszusammenarbeit und die Zielperspektive eines „integralen Humanismus“9 unter Einbeziehung der ökologischen Komponente10 wird in den Dokumenten von Rio aufgegriffen. - Bereits 1974 hat der Ökumenische Rat der Kirchen eine Stellungnahme für eine „nachhaltige Gesellschaft“ (sustainable society) verabschiedet.11 Der ökumenische konziliare Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung war ein wichtiger Wegbereiter der Nachhaltigkeitsidee12. So gibt es unmittelbare Zusammenhänge zwischen der Trias des konziliaren Prozesses und der Trias von Ökologie, Ökonomie und Sozialem, die die Botschaft von Rio ist. Viele Texte der Versammlungen des konziliaren Prozesses von Stuttgart und Dresden haben Formulierungen der Texte von Rio geprägt13. Führende Persönlichkeiten stehen für die Verbindung beider Prozesse. Bisher fehlt eine systematische wissenschaftliche Untersuchung dieser Zusammenhänge. 8 9 10 11 12 13 Vgl. E. Masini, Ein nachhaltiger Lebensstil als Heusforderung für ein christliches Europa, in Vogt/ Numico 2007: Populprum Progressio Nr. 14-16.19-21.42. Apostolisches Schreiben „Octogesima Advenients [1971], 21. 1975 bis 1983 war die Arbeit des ÖRK auf das Programm “Just, Participatory and Sustainable Society” ausgerichtet (Stückelberger 1997, 195-205), was nicht nur eine sehr frühe Rezeption des Begriffs “sustainable development” bedeutet, sondern zugleich eine wegeweisende Verknüpfung mit demokratischer Partizipation, was sich in der Konzeption der Agenda 21 niedergeschlagen hat. CCEE 1989; Ernst 1990; Rosenberger 2001. Zwar wird „Frieden“ meist nicht unmittelbar benannt als konstitutives Element der Nachhaltigkeit, die Friedensproblematik ist jedoch intensiv in den Dokumenten von Rio reflektiert und einbezogen (z.B. Rio-Deklaration Nr. 24-26). Darüber hinaus besteht ein enges Verhältnis zwischen „Frieden“ und „Entwicklung“. so hat Papst Paul VI formuliert: „Entwicklung ist dein neuer Name für Frieden.“ wobei das Verbindungsglied die Gerechtigkeit als Voraussetzung und Ziel beider ist. Zum Beispiel der heutige UNEP-Direktor Klaus Töpfer oder Lukas Vischer vom World Council of Churches in Genf (weitere Personen mit Belegen dokumentieren, anhand des Vgl. von Rosenberger 2001 und der Agenda 21 sowie der Dokumente von Rio ..) Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 11 - Die integrale Sichtweise der Umweltfragen, die sich mit dem Nachhaltigkeitskonzept durchzusetzen beginnt, entspricht zutiefst dem Ansatz christlicher Schöpfungsverantwortung: Christliche Schöpfungsverantwortung hat nie die Natur für sich alleine, sondern stets die Geschichte des Menschen in und mit ihr im Blick. Für die Wahrnehmung ökologischer Anliegen bedeutet dies, dass sie von vornherein in einem soziokulturellen Zusammenhang gesehen werden. Dies entspricht dem ethischen Ansatz der Rio-Deklaration und der Agenda 21, die Menschenschutz und Naturschutz, Armutsbekämpfung und Umweltvorsorge als Einheit verstehen14. Die Aufgabe, den Begriff Nachhaltigkeit mit der christlichen Soziallehre zu verknüpfen, wird in dem 1997 veröffentlichten Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit klar formuliert15: "Die christliche Soziallehre muss künftig mehr als bisher das Bewusstsein von der Vernetzung der sozialen, ökonomischen und ökologischen Problematik wecken. Sie muss den Gedanken der Bewahrung der Schöpfung mit dem einer Weltgestaltung verbinden, welche der Einbindung aller gesellschaftlichen Prozesse in das - allem menschlichen Tun vorgegebene - umgreifende Netzwerk der Natur Rechnung trägt. Nur so können die Menschen ihrer Verantwortung für die nachfolgenden Generationen gerecht werden. Eben dies will der Leitbegriff einer nachhaltigen, d.h. dauerhaft umweltgerechten Entwicklung zum Ausdruck bringen."16 Dieser Appell wird in der Schrift der Kommission VI der Deutschen Bischofskonferenz „Handeln für die Zukunft der Schöpfung“ aufgenommen, ethisch entfaltet und durch eine Verknüpfung des Leitbilds der Nachhaltigkeit mit christlicher Schöpfungstheologie, Ethik, Pastoral, Bildung, Politik und Infrastruktur konkretisiert17. Insbesondere in entwicklungspolitischen und weltwirtschaftlichen Zusammenhängen ist die theologischethische Reflexion des Leitbilds der Nachhaltigkeit mit heftiger Kritik mancher Verwendungen in Politik und Wirtschaft verbunden18. Der Hintergrund kirchlicher Texte ist wichtig für das Anliegen dieser Vorlesung: Die Aufnahme des Leitbildes der Nachhaltigkeit in den Reigen der Sozialprinzipien ist nicht allein eine akademische Entscheidung, sondern ein Prozess der Entwicklung kirchlicher Meinungsbildung und Praxis. Da die Sozialprinzipien von ihrer Geschichte her nicht nur Gegenstand der Sozialethik sind, sondern in besonderer Weise auch Ausdruck lehramtlicher Stellungnahmen, ist die Aufnahme von Nachhaltigkeit in den Kontext der Sozialprinzipien auch eine Frage der lehramtlichen Entscheidung. Deshalb kann der Anspruch sozialethischer Forschungen dazu nur begrenzt sein, sie kann nicht mehr, als Denkanstöße geben, diese mit vorhandenen Ansätzen verknüpfen, diese zu bündeln und in einen neuen Horizont zu stellen. 5. Der Kontext von Lehramt und Praxis im Anspruch eines Leitbildes Es wäre nicht sinnvoll, das Prinzip der Nachhaltigkeit nur theoretisch aufzugreifen, ohne damit den Anspruch zu verbinden, die kirchliche Praxis entsprechend neu 14 15 16 17 18 Vgl. bes. Rio-Deklaration, Nr. 1; Agenda 21, Nr. 3. Vgl. EKD/DBK 1997, Nr. 122-125.224-232; Kommission VI der DBK 1998; Lochbühler 1997; Münk 1998; Diefenbacher/Döring/Vogt 2001. EKD/DBK 1997, Nr. 125. DBK - Kommission VI 1998. EECCS 1996; ZdK 1998. Einige Texte der Ökologischen Arbeitsgruppe der DBK z.B. „Schöpfungsverantwortung im liberalisierten Strommarkt“, „Nachhaltige Mobilität“ oder „Neuorientierung für eine nachhaltige Landwirtschaft“ konkretisieren den Gedanken der Nachhaltigkeit für zentrale Handlungsfelder. Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 12 auszurichten. Um das Prinzip der Nachhaltigkeit in der Mitte des christlichen Glaubens zu verankern und aus dieser Inspiration heraus einen eigenen Beitrag zu seinem Verständnis und seiner Umsetzung zu leisten, sind deshalb pastorale und praktische Handlungsfelder wesentlich angefragt: Feste, Gebete und Lebensformen können dem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung eine spirituelle Mitte geben19. In der Diskussion um nachhaltige Lebensstile ist christliche Spiritualität gefragt. Christliche Feste wie z.B. das Entedankfest, können dem familiären Engagement wichtige Impulse geben. Die Verbindung mit konkreten pastoralen und bürgerschaftlichen Prozessen gibt der sozialethischen Reflexion Bodenhaftung, Glaubwürdigkeit und spezifisch kirchliche Handlungsfelder, in denen getestet werden kann, wie ernst es der Kirche mit ihren eigenen ethischen Prinzipien ist und in denen der kirchliche Zugang zu den Fragen der Nachhaltigkeit Profil gewinnen kann. Die Pflicht zu einem Engagement für Umwelt und Entwicklung ergibt sich für die Kirche nicht zuletzt aus der Struktur des christlichen Glaubens selbst: Dieser versteht sich nicht als eine bloß abstrakte, sondern als Wahrheit mit praktischer und gemeinschaftsbildender Bedeutung. Er verlangt von der Kirche das Zeugnis durch entschlossenes Handeln. Der Schöpfungsglaube ist eine „Tat-Sache“ in ganz praktischer Hinsicht: Schöpfung meint nicht nur eine Erklärung für den Anfang der Welt, sondern eine lebendige, ethisch relevante Hinordnung der Weltwirklichkeit auf den in ihr gegenwärtigen und verborgenen Gott. Wer von Schöpfung redet, verpflichtet sich damit zu einem verantwortlichen Umgang mit allen Geschöpfen. Es ist unglaubwürdig, die Liebe Gottes zu allen Geschöpfen zu verkünden, ohne damit die Bereitschaft zu verbinden, die Güter der Schöpfung zu schützen, zu pflegen und gerecht zu teilen. Diese Verantwortung kann heute nicht hinreichend individualethisch wahrgenommen werden, sondern braucht eine Übersetzung in politische und wirtschaftliche Strukturen. Eben dafür steht das Konzept der nachhaltigen Entwicklung. 6. Welche Kompetenzen haben Theologie und Kirche im Nachhaltigkeitsdiskurs? Die Weite des Prinzips Nachhaltigkeit kann leicht in eine programmatische Selbstüberforderung führen, die alle Weltprobleme gleichzeitig lösen will und deshalb nichts erreicht. Deshalb ist es wichtig, nicht nur von ethischen Postulaten der Kirche und an die Kirche zu sprechen, sondern auch von den spezifischen Kompetenzen und ihren Grenzen. Gerade angesichts des durch knappe Kassen und einen Mentalitätswandel – auch und besonders in der jüngeren Generation – ausgelösten Rückzugs auf die so genannten „Kernkompetenzen“ ist es wichtig, zu fragen, was Nachhaltigkeit mit diesen Kernkompetenzen von Kirche und Glaube zu tun hat, und wie aus dieser Bestimmung heraus die kirchliche Verantwortung begrenzt und strukturiert werden kann. Deshalb sei skizzenhaft auf einige spezifisch kirchliche Kompetenzen hingewiesen, die die christlichen Kirchen für eine Nachhaltigkeit einbringen können: - 19 Nachhaltigkeit braucht strukturelle Verankerung mit langfristigen Perspektiven. Hierfür kann die Kirche von ihrem Selbstverständnis und ihrer Struktur her als älteste und auf Langfristigkeit (Ewigkeit) ausgerichtete Institution einen wichtigen Dienst leisten. Die ethische Basis der Nachhaltigkeit, nämlich Verantwortung für kommende Generationen, ist eine Frage der Bereitschaft zu langfristigem Denken. Glaube und Kirche sind wesentlich darauf angelegt, den Zeithorizont unserer Vgl. Vogt: Der Zukunft Heimat geben. Die Kirchen im Agenda 21-Prozess. Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 13 Wertmaßstäbe zu erweitern. Nachhaltigkeit ist ein Zeitproblem, und die Ordnung der Zeit ist ein Grundanliegen der der jüdisch-christlichen Tradition. - Nachhaltigkeit erfordert eine Anerkennung des Eigenwertes der Natur. Das christliche Schöpfungsverständnis kann dies auf eine Weise fördern, die nicht auf mystisch-voraufklärerischen Konzepten beruht und deshalb (im Rahmen eines wechselseitigen Lernprozesses) mit moderner Naturwissenschaft und Technik vereinbar ist. Das religiöse Verhältnis zur Natur als Schöpfung, als „Spur Gottes“, als Raum geschenkten Lebens ist ein kraftvolles Gegengewicht zur Reduktion der Naturwahrnehmung als „Warenlager“ für menschliche Konsuminteressen. - Nachhaltigkeit steht und fällt mit der Befähigung zu globaler Solidarität. Diese Forderung wird in der kirchlichen Sozialverkündigung und Praxis konkretisiert (Hilfswerke, Kirche als Weltgemeinschaft und als älteste globale Institution, Entwicklungsarbeit der Orden etc.). Da Solidarität nicht primär ein Erkenntnisproblem ist, sondern vor allem eine Frage der Motivation, kann christliche Verkündigung und kirchliche Praxis hier Vieles beitragen, was philosophische Begründungen und politische Appelle zu globaler Solidarität nicht vermögen. - Nachhaltigkeit braucht eine Überwindung des massenhaften Konsums, der sich vor allem zu Lasten der Natur in den Entwicklungsländern auswirkt. Dies ist vor allem eine Frage der Werte und der Vermittlung eines Selbstbewusstseins, das sich unabhängig von äußerem Besitz und kurzfristigen Erlebniswerten anerkannt weiß. Genau darauf zielen christliche Pastoral und Bildung. Das christliche Menschenbild bietet wichtige Orientierungshilfen für einen nachhaltigen Lebensstil und motiviert zum Dienst der Versöhnung und der Gerechtigkeit. - Nachhaltigkeit ist eine Zukunftsvorsorge, deren motivierende Hoffnung nicht Fortschrittsoptimismus ist, sondern die Vision eines gelungenen Lebens in den Grenzen der Natur. Eine solche Hoffnung findet sich im christlichen Glauben; sie wendet die Erfahrung der eigenen geschöpflichen Grenzen in die Chance, das Leben als Geschenk anzuerkennen, dessen Ursprung und Ziel der Mensch nicht selbst machen und bestimmen kann, und dessen Glück er erfahren kann, wenn er seine Existenz in die Hände Gottes legt und in solidarischer Gemeinschaft lebt. Das asymmetrische Verhältnis zwischen Schöpfungsglauben und Nachhaltigkeit Wenn es gelänge, diese vielfältigen Aspekte zu entfalten, könnte Nachhaltigkeit durch die Verbindung mit christlicher Ethik und durch die Mitwirkung der Kirchen wesentliche Dimensionen gewinnen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass zwischen Schöpfungsglauben und Nachhaltigkeit ein asymmetrisches Verhältnis herrscht: Der Glaube verpflichtet zu Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeit setzt jedoch nicht notwendig den Glauben voraus. Ähnlich wie in der sehr vielschichtigen und widersprüchlichen „Leidensgeschichte“20 des Verhältnisses zwischen Kirche und Menschenrechten wird den Kirchen im Leitbild der Nachhaltigkeit die politische Konsequenz ihres eigenen Glaubens entgegengebracht. Sie müssen sich in einem konfliktreichen Lernprozess des „aggiornamento“ die Substanz des eigenen Glaubens neu aneignen. 20 Maier, H.: Welt ohne Christentum – was wäre anders?, Freiburg 2002. Vogt Nachhaltigkeit [Zsfg 1] 14 Man kann dies jedoch auch positiv sehen: Die Auseinandersetzung mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit bietet die Chance einer Wiederentdeckung des Schöpfungsglaubens. Die Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur ist – neben den Fragen nach Identität und Gerechtigkeit in der postmodernen Welt - eine der zentralen, ungelösten und eben deshalb auch religionsproduktiven Herausforderungen. Als Frage nach den größeren Zusammenhängen, in die unser Leben eingebunden ist und die es tragen, führt die ökologische Krise zu religiösen Fragen. Zukunftsfähigkeit ist immer auch eine religiöse Frage. Die Unglaubwürdigkeit in Sachen Ökologie kostet die Kirchen nicht nur viele tausend Mitglieder im Jahr, besonders in der jüngeren Generation, sondern macht es ihr auch schwer ein konstruktives Verhältnis zu den neuen Formen der Religiösität zu finden, die heute nicht selten im Kontext der Ökologie aufbrechen. Im Bereich der „Tiefenökologie“ gibt es jedoch auch viele ersatzreligiöse Elemente, die sich entweder als ökologische Apokalyptik oder als Idylle einer sinnstiftenden Geborgenheit des Menschen in der Natur äußern.21. Gerade deshalb ist jedoch eine Auseinandersetzung der Kirche mit diesen unterschiedlichen Gruppierungen und Bewegungen unerlässlich. Das Leitbild der Nachhaltigkeit ist dabei für die christliche Kritik ersatzreligiöser Ökologie als „Heilslehre“22 eine wesentliche Chance, weil es seinen Ursprung nicht in einem esoterischen Kontext hat. Inzwischen ist die gesellschaftliche Rezeption des Leitbildes der Nachhaltigkeit jedoch weit über die Bedeutung einer Managementregel hinausgewachsen und bedarf einer grundlegenden ethischen und religiösen Ausdeutung, damit sein fundamentaler Anspruch nicht im Leeren hängt. Die Beteiligung an der interdisziplinären gesellschaftlichen Suche nach Antworten auf die ökologische Herausforderung ist auch für die christliche Ethik ein Lernprozess. Zunächst sind auf der Ebene des Prinzipiellen der Stellenwert und die Adressaten ökologischer und entwicklungspolitischer Imperative angesichts des Pluralismus und der offenen Dynamik moderner Gesellschaft und Wirtschaft zu klären. Verbindliche Konkretisierung können diese nur im Dialog mit den unterschiedlichen Wissenschaften und gesellschaftlichen Akteuren erreichen und einfordern. Dabei ist auch christliche Ethik ein wichtiger Gesprächspartner, allerdings nur dann, wenn sie sich selbst als interdisziplinäre Wissenschaft versteht. Sozialethik hat ihren Ort in besonderer Weise in solchen Lernprozessen; denn sie geht davon aus, dass in der biblischen Ethik als der norma normarum die Imperative für die Gestaltung der Gesellschaft nicht fertig vorgegeben, sondern gestaltungsoffen aufgegeben sind. Sie bedürfen der je neuen Übersetzung, um tatsächlich zur Orientierung zu dienen. Dies ist methodisch bei der folgenden Vorlesung vorausgesetzt. 21 22 Vgl. Maxeiner, D./Miersch, M. (1996): Öko-Optimismus, München, 114-122. Trepl, L. (1991): Ökologie als Heilslehre: Zum Naturbild der Umweltbewegung, in: Politische Ökologie 25, 39-45.