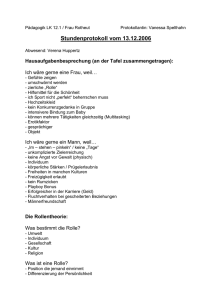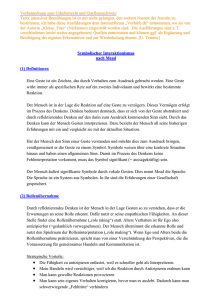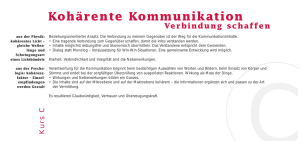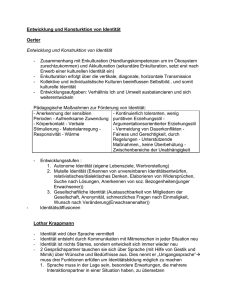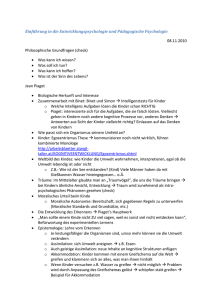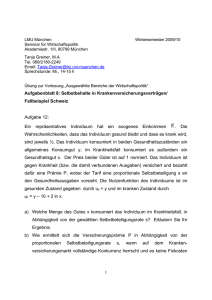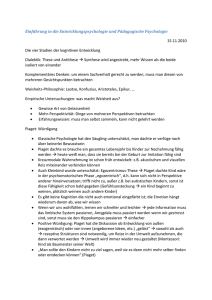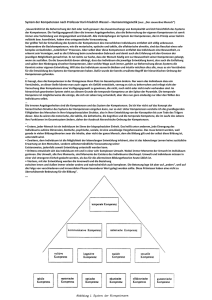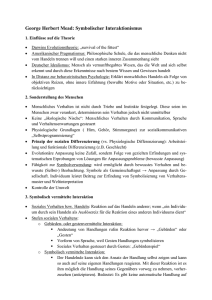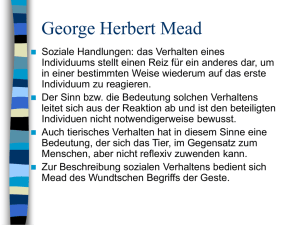Verhalten und Verhaltensauffälligkeit
Werbung

Riccardo Bonfranchi Verhalten und Verhaltensauffälligkeit Eine Literatur-Synopse zur Darstellung und Entwicklung interpersonalen Verhaltens aus heil- und sonderpädagogischer Sicht. 1 1. Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................................ 2 2. Vorwort................................................................................................................................................ 4 3. Einleitung......................................................................................................................................... 5 4. Der Symbolische Interaktionismus (SI)............................................................................................ 6 4.1 Theoretische Grundlagen .............................................................................................................. 6 4.2 Störungen im sozialen Lernen ..................................................................................................... 13 5.Das kognitiv-entwicklungspsychologische Konzept ........................................................................... 16 6. Das Konzept der ‚Rollenübernahme‘................................................................................................. 18 6.1 Theoretische Grundlagen ............................................................................................................ 18 6.2 Rollenübernahme in der Unter- bzw. in der bildungsfernen Schicht.......................................... 21 6.3 Das Konzept der Rollenübernahme aus ontogenetischer Sicht.................................................. 22 7. Das Konzept der ‚sozialen Kognition‘ ................................................................................................ 29 8. Das Konzept der ‚kognitiven Strukturen‘ ...................................................................................... 39 8.1 Das Konzept der 'kognitiven Strukturen' im handlungsleitenden Zusammenhang................ 45 8.2 Gestörte Regulationsebenen im handlungstheoretischen Ansatz.............................................. 47 9. Das Konzept der kognitiven Prozesse auf lerntheoretischer Grundlage....................................... 48 9.1 10. Informationsverarbeitungsstörungen beim kognitiven Lernen ............................................ 52 Therapieformen, die sozial-kognitive Prozesse berücksichtigen .............................................. 55 10.1 ‚RET‘: Die rational-emotive Psychotherapie von ELLIS (1973) .................................................. 55 10. 2 Reineckers Konzept der Selbstkontrolle durch Versprechen und soziale Verträge................. 56 10.3 Meichenbaums Selbstinstruktionstraining................................................................................ 57 10.4 Das Selbstinstruktionstraining bei Kindern von Luria ............................................................... 58 10.5 Das Training der Bewältigungsfertigkeiten ............................................................................... 58 10.6 Die Attributionstheorie ............................................................................................................. 61 10.7 MEWES Konzeptbildungen bei Verhaltensauffälligkeiten......................................................... 62 10.8 Die Handlungsentwürfe von SCHELL zur Konfliktlösung ........................................................... 62 2 10.9 Zusammenfassung..................................................................................................................... 63 11. 3 Literatur..................................................................................................................................... 65 2. Vorwort Dieses Buch beschäftigt sich mit der Entstehung und Darstellung interpersonalen Verhaltens. Dabei geht es darum, neuere Theorien, die Aussagen zu diesem existentiellen Thema machen, darzustellen. ‚Neuere Aussagen‘ wird in unserem Zusammenhang als relativer Begriff gebraucht. Das heisst, dass einige Literatur, vornehmlich aus dem anglo-amerikanischen Raum, bereits 10 – 25 Jahre alt sein kann. Es ist ihr aber, insbesondere in der Schweiz, erst viel später eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil geworden. Dies kann nicht nur allein mit verspätet erschienener Übersetzungen zusammen hängen. Offensichtlich war im deutschsprachigen Europa die Zeit für die Kenntnisnahme dieser sozialkognitivistisch-psychologischen Theorien noch nicht reif. Es geht uns nun nicht darum, diese Theorien zu werten oder sogar gegeneinander auszuspielen. Unser Interesse ist vorerst mal ein rein rezipierendes, um in einem weiteren Schritt die Bedeutung dieser Theorien für die Verhaltensauffälligenpädagogik aufzuzeigen. Deshalb soll auch die praktische Umsetzung dieser Theorien dargestellt werden. Hierzu ist es notwendig die aus diesen Theorien abgeleiteten Therapieformen zur Kenntnis zu nehmen. Auch diese Therapieformen sind in der Schweiz, insbesondere in der Heil- und Sonderpädagogik noch nicht heimisch (geworden) und deshalb vermutlich noch kaum ins Bewusstsein auch einer professionellen Öffentlichkeit gedrungen. Es könnte deshalb ein weiteres Anliegen dieser Arbeit sein, die Verbreitung kognitiver Therapien weiter zu unterstützen. Grundlegendes, erkenntnisleitendes Interesse für die Aufarbeitung der hier dargestellten Theorien zur Entstehung und Entwicklung menschlichen Verhaltens ist unsere Neugier in Bezug auf verhaltensauffälliges Verhalten, mit dem wir uns nun seit vielen Jahren auseinandersetzen. Hier zeigt sich denn auch der Unterschied zur etablierten Literatur, die sich mit dem Phänomen der Verhaltensauffälligkeit beschäftigt. Dieser Unterschied besteht darin, dass wir verhaltensauffälliges Verhalten in Bezug setzen zu den für uns wichtigen Theoriekonstrukten von Piaget und Mead. Es werden also von uns keine Symptomauflistungen (‚Bettnässen, Ladendiebstähle, Schule schwänzen etc.) geliefert. Dies sind für uns lediglich Erscheinungsformen gestörten interpersonalen Verhaltens und um das geht es ausschliesslich in diesem Buch. Wir denken, dass uns dieser Weg tiefer an die Ursachen zeitbezogener Phänomene wie Vandalismus, Aggressivität, Brutalokonsum, um nur einige zu nennen, führen kann. 4 3. Einleitung Wenn wir nun aber ‚Verhaltensauffälligkeit‘ zum Gegenstand unserer Betrachtungen machen wollen, so erscheint es uns unerlässlich, dass wir uns zuerst der Entwicklung und damit einem genaueren Verständnis von Verhalten nähern, um dann bestimmen zu können, worum es sich bei auffälligem Verhalten handelt. Wir bedienen uns dabei einerseits der Theorie des ‚Symbolischen Interaktionismus‘ (SI) und ihrer Verbindungen zu neueren Entwicklungen, sowie andererseits gehen wir auf kognitionspsychologische Aussagen ein. Nun ist es aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei keineswegs um geschlossene Theorien oder Systeme handelt, die man sich einfach aneignen und zu einem bestimmten Zweck in Anwendung bringen kann. Wir verwenden Aussagen sowohl des SI als auch aus dem Bereich der Kognition als hypothetische Konstrukte, die als intervenierende Variablen herangezogen werden. Sowohl die Aussagen zum SI wie aber auch zur Kognitionspsychologie präsentieren sich als höchst komplexe Gebilde von Einzelkonstrukten sowie postulierten Beziehungen zwischen diesen Konstrukten. Einschränkungen müssen in Bezug auf den unterschiedlichen Abstraktionsgrad dieser Konstrukte gemacht werden, die Vergleiche kaum oder nur unter grossem Vorbehalt zulassen. Während einzelne Konstrukte sich beinahe als Zusammenfassungen von Beobachtungssätzen (z. B. Problemlösen) ausnehmen, dürfte es bei anderen Konstrukten (z. B. Flexibilität, Rollenambiguität) schwer fallen, Operationalisierungsniveau zu erreichen, wäre es denn intendiert. Sicher wäre es wünschenswert, wenn die verwendeten Begriffe und Konstrukte exakter definiert, das Beziehungsnetz zwischen den Konstrukten schärfer gefasst, die Bereichsgültigkeit der einzelnen Konstrukte genauer abgesteckt wären. Eine grobmaschige Theorie dieser Art kann deshalb auch nicht durch einzelne empirische Versuche erhärtet werden, sie bedarf einer schrittweisen Erläuterung und Prüfung einer grossen Anzahl von Hypothesen, die aus den einzelnen Konstrukten abgeleitet werden. Gleichwohl können wir, insbesondere wenn es um die Therapie verhaltensauffälligen Verhaltens geht, auf eine Reihe von empirischen Daten und Ergebnissen hinweisen. Unseres Erachtens ergibt nur die Verbindung von SI und Kognitionspsychologie sinnvolle Erklärungen menschlichen Verhaltens. Sie gehören zusammen. Während der SI Verhalten in seinem engen Bezug zur Gesellschaft aufzeigt, ist es das Ziel kognitionspsychologischer Aussagen, Verhalten eher unter individuellem Aspekt zu untersuchen. Obwohl diese Trennung in der hier dargestellten Schärfe idealtypisch zu verstehen ist, sind wir der Meinung, dass zur umfassenden Abklärung von ‚Verhalten‘ beide Bereiche berücksichtigt werden müssen. Wir werden uns zuerst dem SI nach G. H. Mead zuwenden und übersichtsartig seine wichtigsten Aussagen referieren, um dann kognitionspsychologische Arbeiten von J. Piaget zu erörtern. Dabei ergibt sich zwangsweise auch die Berücksichtigung der Konzepte ‚soziale Kognition‘, ‚Rollenübernahme‘, ‚kognitive Strukturiertheit‘ und ‚kognitive Therapie‘. 5 4. Der Symbolische Interaktionismus (SI) 4.1 Theoretische Grundlagen Bevor wir uns näher mit dem interaktionistischen Rollenmodell beschäftigen, dem wir gegenüber dem konventionellen Rollenmodell in Bezug auf Sonder-Pädagogik grössere Bedeutung zumessen, wollen wir erst noch auf den zentralen Begriff der ‚Rolle‘ eingehen. Nach DAHRENDORF (1977/15) bezeichnet der Begriff der Rolle eine zentrale Kategorie der Soziologie. Er wurde von LINTON (1936) in die Soziologie eingeführt. Der Begriff der Rolle wird als begriffliche Einheit des sozialen Zusammenhangs gesehen. Also wird mit Rolle der Inbegriff der normierten Handlung innerhalb eines sozialen Zusammenhangs bezeichnet. Beschreibbar sind diese Handlungen von den normierenden Ansprüchen der anderen her. ‚Rolle‘ bezeichnet also erst einmal kein tatsächliches Verhalten, sondern ein Komplex von Verhaltenserwartungen. Jede Rolle setzt sich demnach aus den Verhaltenserwartungen mehrerer Bezugspersonen oder Bezugsgruppen zusammen. Sie werden ‚Rollensender‘ (POPITZ 1967) genannt. Rollenhandeln vollzieht sich immer zwischen mindestens 2 Partnern. Voraussetzung hierfür ist eine Ebene der Intersubjektivität. Diese Intersubjektivität basiert auf einem Set gemeinsam zu dekodierender Symbole. Diese Symbole wiederum, die im Sozialisationsprozess erworben werden, sind für gut funktionierende Interaktionsprozesse von entscheidender Bedeutung. Möglich wird das, wenn die Interaktionspartner in der Lage sind, sich in die Rolle des anderen hinein zu versetzen. KRAPPMANN (1975/4) spricht in diesem Zusammenhang von Empathie, MEAD (1978/3) von „to take the role oft the other“. 1 Um den Begriff ‚Symbol‘ (Symbolischer) zu klären, beziehen wir uns auf ROSE (1962). Nach ROSE lebt der Mensch nicht nur in einer natürlichen, sondern auch in einer symbolischen Umwelt. ROSE versteht demnach unter einem Symbol einen Reiz, der für den Menschen eine erlernte Bedeutung und einen erlernten Wert besitzt. Symbole erhalten ihr Gültigkeit kraft Übereinstimmung. Dies ergibt erst die bereits erwähnte gemeinsame Ebene der Intersubjektivität. Symbole beziehen sich sowohl auf den verbalen wie auf den nonverbalen Bereich. Durch die Kommunikation von Symbolen kann das Individuum eine Vielzahl von Bedeutungen und Werten und damit auch Verhaltensweisen anderer verstehen und lernen. Betrachten wir nun den Unterschied zwischen dem konventionellen und dem interaktionistischen Rollenmodell. Die Rollentheorie, ursprünglich von SIMMEL und MEAD in den USA (1923) ausgearbeitet, kam nach dem Zweiten Weltkrieg in die BRD (DAHRENDORF: homo sociologicus, 1958). DAHRENDORF (1958) kritisiserte aber schon damals, dass der Mensch in der herkömmlichen Rollentheorie zum Objekt gemacht wird. Das Individuum erscheint von der Umwelt durch die an es gerichteten Verhaltenserwartungen determiniert. Dies erschien DAHRENDORF gefährlich, aber auch inhuman. Da schein ein anderer Versuch weiter zu kommen: der des Symbolischen Interaktionismus, vertreten durch HABERMAS (1974), KRAPPMANN (1975/4), DREITZEL (1972), GOFFMAN (1973), ROSE (1962) 1 Weitere ausführliche Publikationen zu G. H. MEAD sind: MANIS & MELTZER 1967, GRAUMANN 1972, ROSE 1962. Speziell für die Pädagogik: BRUMLIK 1973, NATHANSON 1973, MANIS & MELTZER 1975, JOAS 1973. 6 usw. Insbesondere für den deutschen Sprachraum wurden die Erkenntnisse von HABERMAS und KRAPPMANN bedeutsam. Ihnen geht es bei der Rollenübernahme nicht nur um stabilisierende und konformistische Prozesse, sondern ebenso um die Autonomiechancen und –bestrebungen des Individuums. Das interaktionistische Rollenmodell ist durch die folgenden Punkte gekennzeichnet: 1. Die Rollendefinitionen erlauben subjektive Interpretationen. 2. Orientierung an früheren oder in der betreffenden Situation ebenfalls noch inne gehaltenen Rollen ist möglich. 3. Versuche und Kompromisse mit dem Rollenpartner genügen, um zu kommunizieren. Totale Übereinstimmung ist nicht notwendig. 4. Die Stabilität von Institutionen wird durch individuelle Befriedigung innerhalb eines normgesetzten Spielraums ermöglicht. Es erscheint einsichtig, dass das konventionelle Rollenmodell (PARSONS 1949) zu Recht als zu repressiv verworfen wurde. Es stellt Idealfälle von Rollenbeziehungen dar. Abweichungen von dem Idealfall, die in der Praxis aber die Regel sind, kommen in den Geruch des Abweichenden, Devianten. Auf der anderen Seite, so meinen wir, dass auch das Rollenmodell von HABERMAS (1975/4) idealtypischer Natur ist, wenn er von herrschaftsfreier Interaktion spricht. Es dürfte wohl kaum eine Interaktionssituation geben, die vollkommen herrschaftsfrei abläuft. Aus diesen Einwänden schliessen wir, dass die Unterschiede zwischen dem konventionellen und interaktionellen Rollenmodell in praxi wohl nicht so gross sein dürften, wie HABERMAS und KRAPPMANN annehmen. Es ist also von Fall zu Fall zu untersuchen, ob Rollenverhalten repressiv vorgeschrieben wird und ob dies zu verurteilen ist oder nicht. So ist es im Strassenverkehr sicher nützlicher und lebenserhaltender, wenn Rollenverhalten, z. B. das des Verkehrspolizisten, repressiv vorgeschrieben ist. Würde ein Verkehrspolizist sein Rollenverhalten jedes Mal neu interpretieren, wären wohl Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer nicht mehr sicher. Andererseits muss derselbe Verkehrspolizist an der selben Kreuzung sich sofort flexibel verhalten, wenn sich ein unvorhergesehenes Ereignis, wie z. B. ein Unfall, ereignet. Gleiches gilt z. B. auch für einen Schiedsrichter bei einem Fussballspiel. Aber auch ein sogenannter Sozialisationsagent, wie z. B. ein Lehrer oder ein Sozialpädagoge tun gut daran, wenn ihre Verhaltensweisen bzw. ihre Regeln durchschau- und berechenbar sind und bleiben. Hier kann man also sehr wohl von einem rigiden Rollenverhalten sprechen. Nachdem wir nun die Unterscheidung und ihre Relativierung zwischen konventionellem und interaktionistischem Rollenmodell dargestellt haben, wollen wir näher auf den zentralen Begriff der interaktionistischen Rollentheorie, auf den der ‚Ich-Identität‘ eingehen. Nach MEADS Analyse (1978/3) hat eine gelungene Interaktion zur Voraussetzung, dass die Partner ihre gegenseitigen Erwartungen zu Beginn ihrer Kontaktaufnahme zu erkennen versuchen, diese Erkenntnis dann in die Planung ihres Verhaltens aufnehmen, um so eine gemeinsame Ebene zu schaffen. Dazu kommt es, dass die Partner sich jeweils an die Stelle ihres Gegenüber versetzen, um die Situation aus dessen Blickwinkel betrachten zu können. Diese Fähigkeit wird im Sozialisationsprozess spielerisch erworben über das ‚taking the role of the other‘ und zwar in play und game. MEAD versteht unter play ein regelloses Spiel. Das Kind identifiziert sich, z. B. im Mutter-Vater-, oder Lehrer-Spielen, in einem kognitiven und emotionalen Akt mit den ‚besonderen Anderen‘ seines Milieus und übernimmt deren Rollen. Hierbei ist es 7 aber wichtig zu beachten, dass das Kind nicht die realen Verhaltensweisen eines anderen Subjektes lernt, sondern die normativen Erwartungen, die dieses an es stellt. Unter ‚game‘ versteht MEAD das Regelspiel. Hierbei muss das Kind in der Lage sein, jede durch die Regelvorschrift determinierte Rolle im Organisations-Ganzen einnehmen zu können. Dieses Regelspiel ist, nach MEAD, entscheidend für soziales Leben überhaupt. Der Übergang vom regellosen zum geregelten Spiel beschreibt im Bewusstsein des Kindes eine progressive Loslösung von den normativen Erwartungen ‚besonderer Anderer‘ und damit eine Hinwendung zu den normativen Erwartungen ‚verallgemeinerter Anderer‘, d.h. aber zum gesellschaftlichen Normen- und Regelsystem. Nun bedeutet aber ‚spielerisches-sich-mitdem-Anderen-identifizieren, immer auch ‚sich-selbst-identifizieren‘. Dieser Prozess wird von MEAD als Entwicklung des ‚self‘ bezeichnet. Mit fortschreitender Verallgemeinerung der Identifikation im Sozialisationsverlauf gewinnt dieses Selbstbewusstsein zunehmende Unabhängigkeit von einer bestimmten Interaktionssituation. Dieses ‚self‘ zerfällt bei MEAD in ein ‚I‘ und ein ‚me‘. Der ‚me‘-Anteil spiegelt die Verhaltensweisen und Einstellungen der anderen (MEAD: signifikante Andere) wider. Der ‚I‘-Anteil stellt die spontanen und kreativen Ich-Anteile dar. HABERMAS und KRAPPMANN entwickeln nun ihren Begriff der Ich-Identität als Balance zwischen der Aufrechterhaltung der persönlichen und sozialen Identität. „Wir müssen gleichzeitig unsere soziale Identität wahren und ausdrücken, ohne der Gefahr der ‚Verdinglichung‘ zu erliegen; aber ebenso müssen wir unsere persönliche Identität zugleich wahren und ausdrücken, ohne ‚stigmatisiert‘ zu werden…“ (HABERMAS 1968). Die Stärke der Ich-Identität bemisst sich nun an der Aufrechterhaltung der Balance zwischen persönlicher und sozialer Identität. Entscheidend bemerkbar macht sich diese Fähigkeit in Belastungssituationen. Es sei hier vorweg genommen, dass z. B. Jugendliche, deren Chancen auf dem Arbeits- bzw. Lehrstellenmarkt auf Grund ihrer bildungsfernen Schulkarriere, stark eingeschränkt ist, i.d.R. ein grosses Problem damit haben, auf eine ausbalancierte Ich-Identität zurückgreifen zu können. Das diese Situation einer grossen persönlichen Belastung gleich kommt, erscheint einsichtig. Welchen Weg dieser Jugendliche dann wählt, um trotzdem zu einer für ihn selber befriedigenden Ausbalancierung seiner Ich-Identität zu kommen, erscheint ebenfalls einsichtig. Zur gelungenen Identitätsdarstellung (gelungen bemisst sich hier vor allem auch durch das Urteil der näheren (Familie, Freunde, Arbeitgeber) und weiteren (Medien, Justizsystem) Umgebung) Identitätsdarstellung sind eine Reihe von Fähigkeiten notwendig, über die die Interaktionspartner verfügen müssen: Rollendistanz, Empathie und Ambiguitätstoleranz. Unter Rollendistanz versteht CLAESSENS (1970) die Fähigkeit, einmal übernommene Normen wieder in Frage zu stellen, wenn die Situation es erfordert, d.h. wenn soziale und individuelle Bedürfnisse neu strukturiert werden müssen. Mittels der Fähigkeit der Rollendistanz ist ein Individuum in der Lage, Rollennormen auszuwählen, sie zu negieren und neu zu interpretieren. Ausserdem ist zur gelungenen Identitätsdarstellung Empathie (Einfühlungsvermögen) notwendig. Empathie bezeichnet, nach TURNER (1962) die affektive und kognitive Befähigung zum ‚role taking‘, d.h. mit Empathie wird die Befähigung, sich in die Perspektiven des Anderen hinein versetzen zu können, bezeichnet. Eine gut ausgebildete Empathie ist die Voraussetzung für angemessene Situations- und Bedürfnisinterpretation. Als dritter Faktor soll hier noch die Fähigkeit Rollenambiguitäten ertragen zu können, genannt werden. Damit ist die Befähigung gemeint, widersprüchliche Rollenerwartungen, sowohl Intra- wie auch Interrollenkonflikte und einander widerstrebende Motivationsstrukturen interpretierend nebeneinander zu dulden. Erst Ambiguitätstoleranz ermöglicht eine Einigung mit dem Partner auf eine gemeinsame Situationsinterpretation. 8 Die geschilderten Fähigkeiten zur Aufrichtung und Wahrung der Ich-Identität erwirbt das Individuum im Verlaufe der Sozialisation. DREITZEL (1972) hat in Anlehnung an MEAD (1978/3) und ERIKSON (1966) folgenden Sozialisationsverlauf skizziert: 1. Die vorödipale Phase, die bestimmt ist von den Mechanismen der Projektion und der Introjektion. Diese Vorgänge spielen sich i.d.R. noch innerhalb der Familie ab. 2. Die Kindheitsidentifikation (Internalisierung) spielt sich während und nach der ödipalen Phase ab. 3. Die eigentliche Identitätsbildung vollzieht sich während der Adoleszenz. Um die o.e. Aussagen zu vertiefen, erscheint es uns wichtig und sinnvoll zugleich zu sein, auf die Erörterungen von BERGER/LUCKMANN (1970) einzugehen. Diese gehen zunächst einmal auf den Bereich der primären Sozialisation ein. Damit der Mensch Mitglied in der Gesellschaft werden kann, muss er erst Wirklichkeit internalisieren. Unter den Prozess der Internalisierung fassen BERGER/LUCKMANN das unmittelbare Aufnehmen und Auslegen eines objektiven Vorganges und Ereignisses, das Sinn zum Ausdruck bringt. In dem Erfassen der Welt als einer sinnhaften und gesellschaftlichen Wirklichkeit, liegt zugleich die Funktion der Internalisierung. Die Welt, in der andere schon leben, wird übernommen. Internalisierung vollzieht sich nicht nur in bestimmten Augenblicken, sie vermittelt durch subjektiv übergreifende umfassende Perspektiven die bereits erwähnte Ebene der Intersubjektivität. Nur wer einen bestimmten Grad der Internalisierung von Welt erreicht hat, ist Mitglied dieser Gesellschaft. Der ontogenetische Prozess, der das zustande bringt, ist nach BERGER/LUCKMANN die primäre und sekundäre Sozialisation, die damit als die grundlegende und allseitige Einführung des Individuums in die objektive Welt einer Gesellschaft bezeichnet werden kann. Die primäre Sozialisation ist die erste Phase, durch die der Mensch in seiner Kindheit zum Mitglied der Gesellschaft wird. Sekundäre Sozialisation ist jener Vorgang, der eine bereits sozialisierte Person in neue Ausschnitte der objektiven Welt einer Gesellschaft einweist. In der objektiven Gesellschaftsstruktur trifft der Mensch auf jene ‚signifikanten Anderen‘, denen die Sozialisation anvertraut ist. Diese signifikanten Anderen (auch: Sozialisationsagenten) filtern die Welt des Neugeborenen. Primäre Sozialisation umfasst nicht nur blosses kognitives Lernen. Auch Gefühle werden gelernt. Das Kind identifiziert sich mit den signifikanten Anderen: ohne Identifikation keine Internalisierung von Werten und Normen der (gesetzgebenden!) Gesellschaft. Rollen und Einstellungen werden durch Identifikationen internalisiert. Durch seine Identifikation mit signifikanten Anderen wird das Kind fähig, sich als sich selbst und mit sich selbst zu identifizieren. Das Selbst ist ein reflektiert-reflektierendes Gebilde, das die Einstellungen, die andere ihm gegenüber haben und gehabt haben, spiegelt. Der Mensch wird, was seine signifikanten Anderen in ihn hineingelegt haben. Das ist jedoch kein einseitiger mechanischer Prozess. Er enthält vielmehr eine Dialektik zwischen Identifizierung durch Andere und selbstbestimmenden Anteilen, nämlich der Selbst-Identifikation, d.h. zwischen objektiv zugewiesener und subjektiv angeeigneter Identität. Die primäre Sozialisation bewirkt im Bewusstsein des Kindes eine progressive Loslösung der Rollen und Einstellungen von speziellen Anderen und damit die Hinwendung zu Rollen und Einstellungen überhaupt. Das Abstraktum der Rollen und Einstellungen konkreter signifikanter Anderer ist für die Sozialpsychologie der generalisierte Andere. Das Zustandekommen solcher Abstraktionen im Bewusstsein bedeutet, dass das Kind sich jetzt nicht nur mit konkreten Anderen identifiziert, sondern mit einer Allgemeinheit der Anderen, d.h. mit Gesellschaft überhaupt. Es kommt damit über9 haupt zu Identität. Das erwachende Bewusstsein für den generalisierten Anderen markiert eine entscheidende Phase der Sozialisation. Objektive Wirklichkeit ist internalisiert, dauerhafte subjektive Identität ist gebildet worden. Sobald das Bewusstsein den generalisierten Anderen für sich heraus kristallisiert hat, entsteht eine Symmetrie zwischen objektiver und subjektiver Wirklichkeit, die als ein nie statischer Balanceakt verstanden werden muss. Für die primäre Sozialisation ist typisch, dass das Kind Welt protorealistisch erlebt. Es gibt für das Kind nur die eine Welt, in der es lebt. Die primäre Sozialisation endet damit, dass sich die Vorstellungen des generalisierten Anderen im Bewusstsein der Person angesiedelt haben. Jetzt besitzt der Mensch eine Vorstellung von Selbst und von der Welt bzw. seiner eigenen Stellung in derselben. Sekundäre Sozialisation ist die Internalisierung institutioneller oder in Institutionalisierung gründender Subwelten. Sekundäre Sozialisation ist der Erwerb von rollenspezifischem Wissen. Der Übergang von der primären zur sekundären Sozialisation verläuft nicht immer problemlos und wird häufig mit einem Ritual verbunden. Sekundäre Sozialisation wird der primären Sozialisation quasi übergestülpt. Sekundäre Sozialisation vollzieht sich ohne emotionale Identifikation. Sozialisation im späteren Leben ist aber meistens dann gefühlsbetont, wenn sie versucht, die subjektive Wirklichkeit des Individuums radikal umzumodeln. Die Agenten der sekundären Sozialisation sind aber leichter austauschbar. Damit ist auch subjektive Wirklichkeit austauschbar. Das kann sowohl Vor- wie auch Nachteil sein. Vorteil ist vor allem Dingen dann, wenn es sich, nach einer nicht ganz gelungenen primären Sozialisation z. B. bei verhaltensauffälligen Jugendlichen darum geht, dass staatliche Sozialisationsagenten (Sozialpädagogen) damit beauftragt sind, Nach-Erziehungsprozesse in Gang zu setzen. Ihr Ziel ist es dann, mittels Re-Sozialisierung neue Welten, d.h. neue Wirklichkeiten zu schaffen. Der Begriff der Resozialisierung ist deshalb ungenau oder geradezu falsch, weil es sich ja nicht um ein retrospektives, sondern um ein prospektives Geschehen handelt. Der (verhaltensauffällige) Jugendliche hat die Stufe der sekundären Sozialisation ev. noch gar nicht in Angriff genommen bzw. sicherlich noch nicht abgeschlossen. Wenn wir uns das Beispiel vor Augen führen, dass Jugendliche wahllos andere Menschen zusammen schlagen bzw. auch dann nicht aufhören, auf diese einzuprügeln, wenn diese wehrlos am Boden liegen, so kann unschwer davon ausgegangen werden, dass hier entscheidende Prozesse der Rollendistanz, insbesondere der Empathie und auch der Rollenambiguität noch nicht internalisiert worden sind. Darauf werden wir im späteren Verlauf der Arbeit noch zu sprechen kommen. Nachdem wir nun quasi das Gerippe des SI sowie den Sozialisationsverlauf dargestellt haben, wollen wir auf die gesellschaftlichen Verbindungen und Bezüge des SI eingehen. In seiner ausführlichen Analyse des SI weist BLUMER (1978/4) auf 3 Prämissen hin, die es beim Verständnis des SI zu berücksichtigen gilt: 1. Menschen handeln gegenüber ‚Dingen auf der Grundlage der Bedeutungen, die diese Dinge für sie haben‘. Als Dinge werden in diesem Zusammenhang nicht nur materielle Dinge verstanden, sondern auch Institutionen, Leitideale, Handlungen anderer Menschen sowie Alltagssituationen. Diesen Bedeutungen wird im SI eine zentrale Bedeutung zugemessen. 2. Die Bedeutung dieser Dinge ergibt sich aus der sozialen Interaktion der Menschen untereinander. Der SI betrachtet den ursächlichen Zusammenhang der Bedeutungen Dingen gegenüber weder als Ausfluss der inneren Beschaffenheit eines Dinges noch als Ergebnis einer Vereinigung psychologischer Elemente im Individuum, wie sie etwa Empfindungen, Gefühle, 10 Ideen usw. darstellen. Vielmehr ergibt sich die Art und Weise, in der andere Personen es handhaben. Darauf haben BERGER/LUCKMANN auch hingewiesen. Bedeutungen werden durch die in den zu definierenden Aktivitäten miteinander verbunden. 3. Diese Bedeutungen werden ja nach Interpretationen gehandhabt respektive abgeändert. Interpretationen werden in diesem Zusammenhang als formender Prozess verstanden, in dessen Verlauf Bedeutungen als Mittel für die Steuerung und den Aufbau von Handlungen gebraucht und abgeändert werden (vgl. BLUMER 1978/4). Im Gegensatz zu den später noch ausführlich zu erörternden Kognitionstheorien macht der SI auch Aussagen über den Zusammenhang von Handlung und menschlicher Gesellschaft. Wie bei der 2. Prämisse dargestellt, wird auch von BLUMER Handlung als Ausgangspunkt und Ziel jeden Entwurfs verstanden, der sich mit menschlicher Gesellschaft auseinander setzt. Ähnlich bezieht sich soziale Struktur auch auf Beziehungen, „die aus der Art der Interaktion zwischen verschiedenen Personen abgeleitet sind“ (BLUMER 1978/4, 86). Die Bedeutung der sozialen Interaktion liegt in der Tatsache begründet, dass sie ein Prozess ist, der menschliches Verhalten formt. Die Aktivitäten der Umgebung müssen mit den eigenen in Einklang gebracht werden. In Anlehnung an MEAD unterscheidet BLUMER zwei Ebenen sozialer Interaktion, die er ‚nicht-symbolische-Interaktion‘ und ‚symbolische-Interaktion‘ nennt. Nicht-symbolische-Interaktion, z. B. ein Reflex, findet statt, wenn ein Individuum direkt auf Aktivitäten eines anderen antwortet, ohne diese aber zu interpretieren. Symbolische-Interaktion ist aber gerade durch diese Interpretation gekennzeichnet. Wie wir bereits ausgeführt haben, versteht MEAD unter symbolischer Interaktion a) eine Präsentation von Gesten und b) eine Reaktion auf die Bedeutung solcher Gesten. Individuen organisieren nun ihre Reaktionen auf der Grundlage dessen, was die Gesten ihnen bedeuten (vgl. 1. Prämisse). Damit bringen sie Gesten als Zeichen sowohl für das vor, was sie zu tun beabsichtigen, wie für das, was der Gesten-Empfänger tun soll. Die Geste hat somit eine Funktion für den, der sie setzt, wie für den, der sie empfängt. Werden die Gesten von beiden verstanden, herrscht eine gemeinsame Ebene der Intersubjektivität. Damit nun die Vermittlung von Gesten zum Funktionieren kommen kann, müssen beide in der Lage sein, die Rollen ihres jeweiligen Gegenüber einnehmen zu können. Es sei darauf hingewiesen, dass gegenseitige Rollenübernahme eine grundsätzliche Bedingung von Kommunikation und symbolischer Interaktion ist. Deshalb haben auch viele Forscher in der Nachfolge von G. H. MEAD sich dieses Problemkreises angenommen. Wir schliessen die Darstellung des SI mit folgenden Überlegungen. Menschliche Interaktion erfolgt charakteristischerweise und überwiegend auf der symbolischen Ebene. „Menschliches Zusammenleben ist ein unermesslicher Prozess, in dessen Ablauf anderen in derartigen Definitionen gesagt wird, was sie tun sollen und in dem deren Definitionen wiederum interpretiert werden; durch diesen Prozess gelingt es Menschen, ihre Aktivitäten aufeinander abzustimmen und ihr eigenes individuelles Verhalten zu formen“ (BLUMER 1978/4, 89). Es gehört weiter zu einem Fixpunkt in der Theorie des SI, dass die Umgebung, die für Menschen und Gruppen existieren, aus Objekten zusammengesetzt sind, die wiederum das Produkt des SI sind. Objekte lassen sich nun in drei Kategorien fassen: 11 - Physikalische (Auto, Tisch) - Soziale (Freund, Abgeordneter, Sozialpädagoge) - Abstrakte (Ideen, Normen, Urteile, Haltungen) Die Beschaffenheit eines Objektes besteht aus der Bedeutung, die es für seine Person hat, für die es ein Objekt darstellt. Die Bedeutung determiniert die Art und Weise, wie ein Individuum ein Objekt sieht, wie es in Bezug auf das Objekt zu handeln gedenkt, sowie die Art und Weise, wie es über das Objekt spricht. Die Entstehung von Bedeutungsgehalten von Objekten wird in der Sozialisation durch Interaktion mit Personen erfahren (vgl. BERGER/LUCKMANN), bei denen sich bereits Einstellungen diesen Objekten gegenüber gebildet haben. Dies erklärt auch, warum Angehörige der gleichen Gruppen gleichen Objekten nahezu ähnliche Bedeutungen zumessen. Will man nun das Verhalten von Menschen verstehen oder sogar beeinflussen, ergibt sich die Folgerung, dass man notwendigerweise erst die Welt der Objekte bestimmen muss. Hierbei ist zu beachten, darin liegt aber auch eine Chance, dass alle Objekte einen Bedeutungswandel durchmachen können. Vom Standpunkt des SI aus ist, kurz gesagt, das menschliche Zusammenleben ein Prozess, in dem Objekte geschaffen, bestätigt, umgeformt und verworfen werden. Das Leben und das Handeln von Menschen wandeln sich notwendigerweise in Übereinstimmung mit den Wandlungen, die in ihrer Objektwelt vor sich gehen (vgl. BLUMER 1978/4, 91). Der Mensch kann, nach MEAD, anderen nur etwas anzeigen bzw. deren Anzeigen interpretieren, wenn er ein ‚Selbst‘ besitzt. Das wiederum bedeutet, dass ein Mensch auch Gegenstand seiner eigenen Handlung, also auch ein Objekt (seiner selbst) sein kann. Wie die anderen Objekte, so entwickelt sich auch das Selbst-Objekt aus dem Prozess der sozialen Interaktion, „in dem andere Personen jemandem die eigene Person definieren“ (BLUMER 1978/4, 92). MEAD hat diesen Prozess der Rollenübernahme als einer der ersten beschrieben und festgestellt, dass eine Person sich von ausserhalb ihrer selbst betrachten können muss, um für sich selbst zum Objekt werden zu können. Möglich ist dies nur, indem man sich in andere hinein versetzen lernt und sich von dieser Position aus selbst betrachtet. Daraus folgt, dass Menschen sich so sehen lernen, wie andere sie sehen bzw. definieren. Ein weiterer Beweis für das ‚Selbst‘ ist der Umstand, dass Menschen sich selbst bewerten, d.h. mit sich selbst auch interagieren können. Der SI sieht deshalb den Menschen als soziales Wesen, der nicht nur auf das Spiel von Faktoren im Sinne von S-R-Ketten antwortet, die auf ihn einwirken oder durch ihn wirken. Der Mensch zeigt sich die Dinge so an, weil er Wahrgenommenes zum Objekt macht, ihm eine Bedeutung zumisst und von dieser Bedeutung aus sein Handeln steuert. Deswegen ist sein Verhalten auch keine blosse Reaktion, sondern geht aus seiner Interpretation hervor, die in dem Prozess des Selbst-Anzeigens vorgenommen wurde. Menschen müssen in Situationen zurecht kommen, in denen sie gezwungen sind, zu handeln, indem sie sich der Bedeutung der Handlung anderer versichern und ihren eigenen Handlungspläne im Hinblick auf Interpretationen entwerfen. Die Ansicht, Menschen reagierten nur auf Faktoren, die auf sie einwirken, wird damit von uns zurückgewiesen. Das menschliche Handeln besteht darin, dass Dinge, von Individuen wahrgneommen und je nach dem in Betracht gezogen werden oder nicht, je nach dem welche Bedeutung sie ihnen zumessen. Daraus entwickelt sich eine Handlungslinie, die, mit anderen verbunden, gemeinsames Handeln entstehen lässt. Versuchen wir im folgenden nun, die Aussagen rund um den Ansatz von MEAD vor dem Hintergrund des Nicht-Gelingens zu betrachten. Es geht dabei um das Phänomen der Verhaltensauffälligkeit. 12 4.2 Störungen im sozialen Lernen Im folgenden wird der Versuch unternommen, die in diesem Kapitel gemachten Aussagen bezüglich des Problemkreises ‚Verhaltensauffälligkeit‘ zu vertiefen. Diesem Unterfangen kommt heute (2011) besondere Bedeutung zu, weil die Gesellschaft (Medien) davon ausgeht, dass verhaltensauffälliges Verhalten, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, heute häufiger vorkommt als früher, bzw. die Verhaltensauffälligkeiten eine grössere, gravierendere Dimension angenommen haben. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die im folgenden gemachten Ausführungen sozialpsychologischer Natur sind. D.h., dass wir keinen Rund-um-Blick gewährleisten können, indem hier wichtige soziologische Erkenntnisse (z. B. Migrations-Problematik, Intellektualisierung der Schule, Lehrstellen-Problematik usw.) nicht thematisiert werden. Nach DREITZEL (1972) stellt Verhaltensauffälligkeit die „relative Unfähigkeit zu einem normativ orientierten Verhalten (292) dar. KLOSTERKOETTER (1976) verweist auf zwei Vorteile, die ein so im interaktionistischen Zusammenhang gemachte Definition von Verhaltensauffälligkeit besitzt. 1. Die rollentheoretische Bestimmung von Verhalten unterschlägt gerade die für das Phänomen des abweichenden Verhaltens so wichtige Frage nach der Normenproblematik nicht, sondern macht sie gerade zum Gegenstand der Diskussion. Denn was ein gestörtes Verhalten ist, bemisst sich ja am Massstab ungestörten Verhaltens. Dieser Massstab wiederum bemisst sich an altersentsprechender Funktionstüchtigkeit, die anhand statistischer Ergebnisse gewonnen wird. Die alleinige Berücksichtigung dieses Wertes ist aber höchst problematisch, dessen sind wir uns bewusst. Dieser Wert ist deshalb problematisch, da häufig diesem konstatierten IstZustand der Wert eines Soll-Zustandes zugebilligt wird bzw. vom einen auf das andere geschlossen wird. Verhalten muss aber immer auch von der Eigengesetzlichkeit der jeweiligen Situation, in der es geäussert wird, betrachtet werden. Gerade darauf geht der SI in seiner Darstellung einer durch individuelle und gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigenden Verhaltens-Balance aus, die die analytische Trennung zwischen sozialem und persönlichem System aufhebt. 2. Auch das Sozialisationskonzept des SI muss in diesem Zusammenhang (noch einmal) erwähnt werden. Legt es doch nach, dass Verhalten durch die erfahrene soziale Prägung der Persönlichkeit mitbestimmt wird (vgl. KLOSTERKOETTER 1976, 20). Ohne ausbalancierte IchIdentität ist keine interaktionsadäquate Befolgung von Normen möglich. Gestörtes Rollenverhalten ist demnach die Folge. Störungen im Rollenverhalten drücken sich, weiter der Terminologie des SI folgend, in einer gestörten Fähigkeit zur - Empathie - Rollendistanz und - Rollenambiguität aus. BERGER/LUCKMANN (1970) formulieren in diesem Zusammenhang eine Reihe von möglichen Fehlern, die bei der Identitätsbildung eine Rollen spielen können: 13 Das Individuum bildet keine ‚generalisierten Anderen‘. Es bleibt dem Stadium der ‚signifikanten Anderen‘ verhaftet. - Der Balanceakt von subjektiver und objektiver Wirklichkeit misslingt zu Gunsten eines Pols. - Das Individuum ist nicht in der Lage, subjektive Wirklichkeit zu transformieren, um damit neue Wirklichkeit zu schaffen. Es verfällt der sozialen Isolation (vgl. BERGER/LUCKMANN 1980, 176ff). Gehen wir nun auf den Entstehungszusammenhang gestörten Rollenverhaltens ein. Wächst ein Kind in einer Umgebung auf, in welcher die Stabilität der Rollenbeziehungen an unumschränkte, starre Einhaltung der Regeln gebunden ist, die auch nicht diskutiert werden dürfen/können, so ist es ihm nicht möglich, Rollendistanz einzuüben. Das Kind kann sich dann, was es zur Balance seiner IchIdentität nötig hätte, weder von der sozialen noch von der persönlichen Rolle distanzieren. Hoher Repressionsgrad ist die Ursache hoher Normenrigidität. Das Kind orientiert sein Verhalten an den zu erwartenden Sanktionen. Je nach dem gelingt ihm nicht einmal die Internalisierung von Normen. Das Kind ist nicht in der Lage, normative Verhaltenserwartungen zu hinterfragen, damit eine Abstimmung des eigenen Verhaltens mit den Verhaltenserwartungen der Interaktionspartner zustande kommt. Da sich die Fähigkeit der Empathie wiederum nur auf der Basis einer gelungenen Rollendistanz vollziehen kann, misslingt unter den bereits beschriebenen Sozialisationsbedingungen auch die Entwicklung der Empathie. Da die Eltern selbst kaum empathisches Verhalten zeigen, können sie auch kaum als Modell wirksam werden Da sich Rollenerwartungen nur in den seltensten Fällen völlig decken, ist es unumgänglich, dass ein Individuum im Verlaufe seiner Sozialisation auch lernt, widersprüchliche Verhaltenserwartungen zu akzeptieren. Ambiguitätstoleranz kann aber nur erworben werden, wenn das Kind in einem Lernmilieu aufwächst, das ihm hierzu auch Gelegenheit bietet. OEVERMANN (1971) verweist in diesem Zusammenhang auf die Geschlechtsrollenidentifikation, die sich nur über gelungene Ambiguitätstoleranz entwickeln kann. Nach OEVERMANN (1971) trifft nun das beschriebene Kind am ehesten auf das der Unterschicht bzw. ausländischen Unterschicht (bildungsferne Familien) zu. Das Unterschichtkind lebt in einem Lernmilieu, das durch ein geringes Rollenrepertoire mit entsprechender Norm-Unkenntnis und Kommunikations-Unsicherheit gekennzeichnet ist. Zusammenfassend lässt sich somit für das Unterschichtenkind die folgende – verhängnisvolle – Kette formulieren: 14 - Normenrigides, repressives Lernmilieu mit geringem Rollenrepertoire bedingt: - Normenunkenntnis, reduziertes Rollenrepertoire bedingt: - Mangelnden Erwerb von Rollendistanz, Empathie und Ambiguitätstoleranz bedingt: - Mangelnde Entwicklung einer ausbalancierten Ich-Identität bedingt: - Mangelnde Befähigung zum normativ orientierten Verhalten bedingt: - Interaktionsabhängige Einzelsymptomatik, d.h. individuelle Verhaltensauffälligkeit bedingt: - Interaktionsabhängige Fixierung der Symptomatik als Abweichung bedingt: - Eine Verfestigung des (eingeschränkten) Verhaltensrepertoires (vgl. KLOSTERKOETTER 1976, 26). Ist verhaltensauffälliges Verhalten durch geringe Rollendistanz gekennzeichnet, spricht DREITZEL (1972) von „Distanzierungsstörungen“ (1972, 330). Darunter versteht er: - Die Unfähigkeit zur Elastizität des Rollenverhaltens (Konventionalismus) - Die Unfähigkeit zur Zielorientierung des Rollenverhaltens (Ritualismus) - Die Unfähigkeit zur Wahrnehmung und Artikulation von Bedürfnissen (Konformismus). Resultieren die Störungen im Verhalten eher aus mangelnder Internalisierung und Unkenntnis von Normen, spricht DREITZEL von „Orientierungsstörungen“. Darunter versteht er: - Das Bestreben, Verhaltensverunsicherung zu vertuschen (Originalitätszwang) - Das Bestreben, sich aus der Situation zurückzuziehen (Apathie, Gleichgültigkeit, aber auch ziellose Aggression). Wir denken, dass wir insbesondere mit o.e. Beschreibungen bzw. Ableitungen von Erkenntnissen aus des SI den Bezug zu verhaltensauffälligem Verhalten hinreichend dargestellt haben. Wie bereits einleitend erwähnt, geht es uns nicht darum, die Symptome verhaltensauffälligen Verhaltens aufzulisten. Dies wurde auch an anderer Stelle bereits hinreichend getan. Uns geht es vielmehr darum, verhaltensauffälliges Verhalten mit den zentralen Begriffen des SI (Rollendistanz, Empathie und Ambiguitätstoleranz) in einen engen Zusammenhang zu bringen. Damit soll zum einen der Aspekt auf die entwicklungspsychologische Seite des Phänomens Verhaltensauffälligkeit gerichtet werden und zum anderen soll auch dargestellt werden, dass über diese drei Begrifflichkeiten, die in sich selber hoch komplex sind, eine eventuelle Nach-Reifung, Resozialisierung o. ä. möglich ist. 15 5.Das kognitiv-entwicklungspsychologische Konzept Ähnlich wie bei der Darstellung des SI wollen wir nun die zweite Säule in Form der Darstellung der PIAGET’schen Aussagen errichten. Auch hier beschränken wir uns wiederum auf Erörterungen, die in engem Zusammenhang mit der Erklärung und Entwicklung von Verhalten zu tun haben, insbesondere mit kognitiv-entwicklungspsychologischen Theorien zur Rollenübernahme. PIAGET kommt zweifellos das Vorrecht zu, eine seit Jahren in der Psychologie dominierende Konstruktion bei der Untersuchung der Kognitionen in der Entwicklung des Kindes vorgelegt zu haben.2 PIAGET versucht die besonderen Formen der Wirklichkeitserfassung bei Kindern in Bezug auf frühere und spätere Kognitionen zu erfassen. Dabei geht er von der Annahme aus, dass Erkenntnis konstruiert wird. Weder ist sie ein Kopie der Realität, noch ist sie eine Interpretation derselben. Zur Erzeugung von Erkenntnis reichen perzeptive und sensorische Daten nicht aus, es muss Handlung in Form mentaler Aktivität, welche mit prälogischen und logischen verbundene Funktionen umgreift, dazukommen. Hieraus ergibt sich ein hierarchischer Aufbau der kognitiven Systeme. Nach PIAGET (1972) konstituiert sich die Intelligenz in der handelnden Auseinandersetzung des Kindes mit den Objekten seiner Erfahrungswelt. Denken ist für PIAGET das aktive Handeln, welches zu einem späteren Entwicklungszeitpunkt, wenn die Objektumwelt und die Erfahrungen durch Vorstellungen oder Symbole kognitiv repräsentiert sind, in zunehmend verinnerlichten Operationen möglich ist. Der Säugling erfährt seine Umwelt zunächst ausschliesslich im konkreten Vollzug. Er verfügt über angeborene Handlungsreflexe, die sich während der ersten Lebensmonate im Wechsel von assimilatorischen und akkomodativen Prozessen, darauf wird gleich noch näher einzugehen sein, zu differenzierten Handlungsschemata erweitern. Diese sensumotorischen Schemata bilden die Grundlage der kognitiven Repräsentationen, die aus dem handelnden Vollzug abstrahiert werden. Für das Kleinkind (ca. im 8, 9 Lebensmonat) bedeutet Objektpermanenz die Erkenntnis, dass Objekte auch dann weiter existieren, wenn sie nicht mehr sichtbar sind. Diese neue Erkenntnis bringt es mit sich, dass das Selbst als ein eigenständiges Objekt unter anderen registriert wird. Aber erst ab dem 18. Lebensmonat setzt der Beginn des konzeptuellen Denkens ein, indem Objekte und Erfahrungen kognitiv repräsentiert sind. Diese Repräsentationssysteme entwickeln sich in der Phase des prä-operatorischen Denkens (2 – 5, 6 Lebensjahr) weiter. Denkprozesse werden allmählich unabhängiger vom konkreten Vollzug. Handlungen können in Gedanken ausgeführt, ihre Konsequenzen vorweg genommen werden. Es ist aber offensichtlich von der Struktur der Lernumwelt des Kleinkindes abhängig, ob z. B. visuelle, auditive oder motorische Schemata früher und differenzierter ausgebildet werden. Dabei ist zu beachten, dass bevorzugt Schemata differenziert werden, die von der Umwelt besonders angeregt werden. Dabei zeigt sich eine Differenz von PIAGET zu neueren Forschungen, die dem Säugling Intelligenz nicht mehr nur als manifestes Handeln zusprechen, sondern ihm auch Wahrnehmungsfunktionen zumessen, i. S. sensorischer Diskrimination. Kognitive Strukturen und damit auch die internale Repräsentation von Erfahrungen bilden sich offensichtlich, zumindest teilweise, unabhängig von den sen2 Weitere ausführliche Publikationen zu J. PIAGET sind: FLAVELL 1963, FURTH 1969, ELKIND 1969, GINSBERG & OPPER 1975. 16 sumotorischen Koordinationen durch Wahrnehmung und Beobachtung. Dies erhöht natürlich die Bedeutung von Schauen und hören in Bezug zu motorischen Aktivitäten. Nach PIAGET entstehen in einem zunehmenden Prozess der Differenzierung diskrete Handlungssystem, die intern strukturiert, integriert und in einem hierarchischen System miteinander verbunden sind. Der menschliche Organismus ist auf die Bewältigung und kognitive Durchdringung seiner Umwelt ausgerichtet. Die Motivation zu diesem Handeln ist intrinsisch wie sein endogen zielgerichtetes Handeln. Der Antrieb zu diesem Entwicklungsprozess liegt in dem instabilen Gleichgewicht (Äquilibration) zwischen Assimilation und Akkomodation. Assimilation meint die Tendenz eines Organismus Umweltdaten aufzunehmen, sie entsprechend den bereits realisierten kognitiven Strukturen zu organisieren und damit den eigenen Erfahrungen zugänglich zu machen. Akkomodation ist der komplementäre Prozess kognitiver Anpassung an die Umwelt. Innerhalb eines Problemlösungsprozesses sähe das so aus: Zunächst werden bisherige Lösungsstrategien an ein Problem herangetragen (Assimiliation) und erst im Verlauf der Lösungsversuche konstruktiv an das spezifische Problem angepasst (Akkomodation). Der Organismus ist ständig damit beschäftigt, ein neues Gleichgewicht (Äquilibration) von Assimilation und Akkomodation herzustellen. Dieser Prozess hat kein Ende, eine Veränderung zieht jeweils eine andere nach sich, denn durch die stetige Veränderung der Umwelterkenntnis entsteht sofort wieder ein neues Ungleichgewicht von Assimilation und Akkomodation. Nach PIAGET entfaltet sich der Äquilibrationsprozess im aktiven Handeln, welches sich zunächst auf die konkreten Objekte der Umwelt richtet. Im kVerlauf des Entwicklungsprozesses wird durch Internalisierung dieses Handeln eigentliches Denken, als Ungleichgewicht zwischen assimilatiorischen und akkomodatorischen Prozessen bezeichnet. Der Egozentrismus nun kennzeichnet nach PIAGET eine Haltung des Kindes, die auf der unmittelbaren Besitzergreifung der Welt beruht. Das Kind kann noch nicht zwischen Subjekten und Objekten trennen. Deshalb zählt die eigene Perspektive als die einzig mögliche. Auch der Egozentrismus ist eine sich prozesshaft vollziehende Entwicklung. Denn die Überwindung des Egozentrismus im Handeln führt zu einer neuen Form des Egozentrismus. Im Verlaufe der Entwicklung kommt es demnach von einer Zentrierung der kognitiven Akte beim jüngeren Kind zu einer Dezentrierung, was bedeutet, dass das ältere Kind jeweils mehrere Aspekte einer Wahrnehmung gleichzeitig wahrnehmen kann. Daraus resultiert eine grössere Feldabhängigkeit des jüngeren Kindes, welches sich eher durch dominante Merkmale einer Wahrnehmungssituation beeinflussen lässt als andere Kinder. Erst im Verlaufe der Kindheit kommt es mehr und mehr zur Dezentrierung und damit zur Konzeptualisierung. Der der zunehmenden Tendenz zur Differenzierung, die mit gleichzeitig zunehmender Integration der kognitiven Prozesse einhergeht, kann als Gesetz betrachtet werden. Diese Ausführen stehen zugegebenermassen nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der hier vorgelegten Thematik. Sie stellen aber gewissermassen das Fundament der weiteren Erörterungen dar. Wenden wir uns nun den Folgen der Erkenntnisse von MEAD und PIAGET zu, nämlich dem Konzept der ‚Rollenübernahme‘. 17 6. Das Konzept der ‚Rollenübernahme‘ 6.1 Theoretische Grundlagen WALLER (1978) versteht nach STRYKER (1970) und TURNER (1955/56) unter Rollenübernahme den Prozess der vorstellungsmässigen und/oder gedanklichen Vorwegnahme (von WALLER als Antizipation bezeichnet) zukünftigen Verhaltens anderer. WALLER, der sich darum bemüht operationale Definitionen zu finden, sagt aus: „Rollenübernahme lässt sich definieren als Prozess der Bildung subjektiver Hypothesen und/oder Erwartungen, die sich auf das zukünftige Verhalten einer anderen Person beziehen“ (WALLER 1978, 54). Nach KELLER vermag das Konzept der ‚Rollenübernahme‘ soziale und kognitive Lernvorgänge miteinander zu verknüpfen. Auch KOHLBERG (1974) geht über PIAGET hinaus, wenn er die sozio-kulturelle Entwicklung als eine Umstrukturierung der Beziehung des Selbst zum Anderen und damit der Fähigkeiten zur Rollenübernahme fasst. In diesem Zusammenhang erscheint es angebracht, noch einmal auf MEAD (1978/3) zurückzugreifen, um nun die Ähnlichkeit seines Rollenübernahmemodells mit dem von PIAGET aufzeigen zu können. Nach MEAD imitiert das Kind Verhalten in einem ersten vorbereitenden Stadium mit dem Ziel, sich auf das Verhalten der Bezugspersonen einzustimmen. Aber das Kind imitiert nicht nur, sondern es ist auch nach 5, 6 Lebensmonaten in der Lage, Verhaltensreaktionen auf Seiten der Bezugsperson zu antizipieren und als Reaktion hervorzurufen. Im folgenden Stadium der spielerischen Handlung übernimmt das Kind soziale Rollen. Es bedient sich dabei des Rollenspiels, indem es die verschiedenartigsten Rollen übernimmt, lernt es, auf sich selbst zu reagieren. Erst im dritten Stadium des eigentlichen Spiels lernt das Kind, die Haltungen anderer im Spiel zu übernehmen sowie sich daraus ergebende unterschiedliche Perspektiven aufeinander abzustimmen. Mit der Zeit übernimmt es nicht nur die rolle einzelner Mitglieder der Gruppe, sondern auch die Haltungen, die in einer bestimmten Gruppe vorherrschen. Es übernimmt, wie wir bereits ausgeführt haben, die rollen des generalisierten Anderen. PIAGET (1972) versucht nun seinerseits, mittels der Entwicklung des Regelverständnisses ebenfalls eine Stadienabfolge zu zeichnen. Im ersten Stadium hat das Kind noch kein Regelverständnis und handelt nach individuellen Regeln. Im zweiten Stadium spielen die Kinder allein oder nebeneinander her (egozentrisch). Das Kind unterwirft sich aber bereits fremdbestimmten Regeln. Erst im nächsten, dritten Stadium, wenn Kinder anfangen miteinander zu spielen, gewinnen sie die Einsicht, dass Regeln auf Gegenseitigkeit beruhen und dass Spiele nur gelingen, wenn sich alle an die Regeln halten. Andererseits erfahren Kinder auch auf diesem Niveau, dass Regeln veränderbar sind. Im vierten Stadium kommt es dann wieder zur genauen Einhaltung von Regeln. Die früheste Form der Erfassung des Mitmenschen stellt sich bei kleinen Kindern durch Gefühlszustände dar. Schon relativ früh vermag das Kind grobe Gefühlskategorien wie Freude, Trauer oder Schmerz zu unterscheiden. Daraus schliesst KELLER (1969) auf die projektive Rollenübernahme, „in der das Kind Schlussfolgerungen über das Verhalten eines anderen zieht, die seinen eigenen Bedeutungen entsprechen“ (KELLER 1976, 70). Die eigene Perspektive des Kindes wird zur generalisierten Grundlage der vermeintlichen Erfahrung des anderen. Diese Phase wird durch die positionale Rollenübernahme durchbrochen, in der durch persönliche Stereotypisierung die ehemals groben Kategorien verfeinert werden, weil sie stärker unter situationsspezifischem Hintergrund gesehen werden können. Setzt sich dieser Prozess fest, kommt es zur individuierten Rollenübername, in der subjektive Erwartungen differenziert gesehen und berücksichtigt werden können. SELMAN (1973) legte ebenfalls ein Stufenschema vor, dass die Aussagen von PIAGET mit dem Konzept der Rollenübernahme in Verbindung bringt. Die Alters18 spanne von 4 bis 6 Jahren ist demnach durch die egozentrische Rollenübernahme gekennzeichnet. Das Kind unterscheidet kaum Differenzen in den Standpunkten vom Selbst und von anderen. Um die Gefühle seiner Mitmenschen zu verstehen, überträgt es assoziativ seine eigenen Erfahrungen. Die Handlungen, die es in seiner Umwelt erlebt, werden nicht interpretiert. Daan schliesst sich im Alter von 6 – 8 Jahren die Phase der sozial-informationalen Rollenübernahme an, in der das Kind begreifen lernt, dass seine Umwelt Situationen unterschiedliche wahrnimmt und interpretiert. Jetzt wird ihm der Unterschied von Selbst und Anderen deutlich. Das dritte Stadium der selbstreflexiblen Rollenübernahme im Alter von 8 – 10 Jahren befähigt das Kind Perspektivenwechsel vorzunehmen. Das Kind vermag Motive und Verhalten zu antizipieren und weiss, dass seine Motive und Verhaltensweisen von anderen antizipiert werden. Erst jetzt wird Interaktion im eigentlichen, d.h. reziproken Sinn möglich. Im vierten Stadium der mutuellen Rollenübernahme ist das Kind bzw. der Jugendliche in der Lage, die Situationen, in de sich die jeweiligen Interaktionspartner befinden, vom Standpunkt eines Dritten her zu betrachten. Es kann somit unterschiedliche soziale Situationen aus der Sicht eines Beobachters her gegeneinander abwägen. Fassen wir zusammen, so ist es das Ziel der Rollenübernahme, welche das Individuum befähigt, sich die Übernahme der Perspektiven seiner Umwelt zu ermöglichen. Das wiederum ermöglicht erst soziales Verstehen. Der Rollenübernahmeprozess stellt somit eine kognitive Leistung dar, weil das Individuum Motive, Attribuierungen und Erwartungen in Beziehung zueinander setzen muss. Da die Entwicklung der Rollenübernahme im sozialen Interaktionsprozess verankert ist, stellt sich die Frage nach den sozialen Lernsituationen, in denen sich die sozio-kognitive Entwicklung vollzieht. Nach MEAD stellen dies Imitation und Spiel dar. Darauf wollen bzw. müssen wir im folgenden eingehen. Danach werden wir untersuchen, wie sich die Entwicklung der Rollenübernahme in der Sozialisation vollzieht. Die Tatsache, dass bereits ein Säugling zu weinen beginnt, wenn er einen anderen Säugling weinen hört, stellt für PIAGET bereits einen Akt der Akkomodation dar, indem sich der Organismus, weil er Dinge nachvollziehen will, an die Struktur der Umwelt anpasst. Wie wir bereits ausgeführt haben, ist aber der akkomodatorische Prozess nicht ohne den assimilatorischen denkbar. Natürlich vermag ein Organismus in dieser Altersstufe Umwelt lediglich egozentrisch zu assimilieren. Das verhindert vorerst einmal ein Gleichgewicht, so dass die kognitiven Strukturen bemüht sein müssen, weiter explorativ neue Erfahrungen zu machen. Imitation, PIAGET setzt sie mit Akkomodation gleich, ist nach INHELDER und PIAGET (1973) die Grundbedingung für die Entwicklung symbolischer Funktionen, denn die Nachahmung auf sensumotorischer Ebene ist Bedingung für die Entwicklung und Vorstellung von Symbolen. Erst mit der Symbolbildung kann das Individuum auf konkrete Nachahmung verzichten. Damit sich nun das symbolische System stabilisieren kann, ist wiederum Assimilation notwendig, die erst symbolische Repräsentationen der Umwelt dem Individuum verfügbar macht. Der assimilatorische Prozess geschieht nach PIAGET im Spiel, und dient u.a. dazu, den Egozentrismus zu überwinden. Nach KELLER (1976) stellt Imitation bereits eine frühe Form der Rollenübernahme dar. „Durch Imitation erweitert das Kind sein kognitives und sein Verhaltenssystem, denn indem es einen Verhaltensaspekt imitiert, akkomodiert es die eigenen Strukturen an das Vorbild und gewinnt damit neue Formen des Verhalten“ (KELLER 1976, 78). Nach MEAD (1978/3) imitieren Kinder aber nicht nur offene Verhaltensweisen, sondern auch Einstellungen und Haltungen. Im Spiel nun erweitert das Kind das durch Imitation erworbene Verhaltensrepertoire. Indem das Kind im Spiel eine Rolle einnimmt, spielt es gleichzeitig auch die komplementäre Rolle. Es lernt somit, die Perspektiven des An19 deren zu sehen. Das Kind spielt eine Rolle und assimiliert diese zugleich, indem es sie gemäss den bisher ausgebildeten Strukturen kognitiv verarbeitet. In diesem Sinn stellt kommunikatives Handeln im Spiel die Entwicklung der kognitiven Strukturen dar. Wie wir ausgeführt haben, kommt insbesondere bei jüngeren Kindern der Fähigkeit zur Imitation im Prozess der Rollenübernahme in Bezug auf Erweiterung von Rollenverhalten und Rollenbeziehungen grösste Bedeutung zu. Imitation entspricht dem MEAD’schen ‚taking the role of the others“. Die Notwendigkeit zu diesem Perspektivenwechsel ergibt sich aus dem kognitiven Konflikt des Individuums mit seinen Interaktionspartnern. Die Auslebung dieses Konfliktes, insbesondere in der Gruppe Gleichalteriger (peers), ist nach PIAGET entscheidend für die Lösung aus dem egozentrischen Bezugssystem. Was nun die Bedeutung kommunikativer Prozesse für die Entwicklung der Rollenübernahme bei PIAGET und MEAD anbelangt, so ist bei beiden gemeinsam, dass sie die Entwicklung des Denkens als Folge von abgelaufenen Interaktionsprozessen begreifen. Eine erste Interaktionsbeziehung ist zwangsläufig die zu den Eltern. Die Rolle der Eltern im Sozialisationsprozess muss doppelt gesehen werden. Zum einen müssen die Eltern in der Lage sein, sich auf ihre Kinder einzustellen, um deren Bedürfnisse zu befriedigen. Zum anderen müssen sie innerhalb der Interaktion auch Beschränkungen im normativen und regulierenden Sinn vornehmen. Aus dieser Sicht muss die Bedeutung der Gleichalterigen auf die Entwicklung der Rollenübernahme zugunsten der Eltern relativiert werden. Die gefühlsmässigen Besetzungen im Interaktionsprozess mit den Eltern ( = signifikanten Anderen) sind entscheidend für den Perspektivenwechsel. „In den Beziehungen zu anderen erfährt das Kind, dass ihm die Befriedigung seiner Bedürfnisse durch die Liebe anderer zuteil wird“ (KELLER 1976, 92). Das Kind erfährt im Laufe seiner Entwicklung, dass es zu geben in der Lage ist, und dass es damit auch ganz bestimmte Reaktionen hervorrufen kann. Ziel der Interaktionspartner ist es, eine optimale Balance zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen der Eltern und ihrer Kinder herzustellen. Sozialisation wird in diesem Zusammenhang als wechselseitiger Anpassungsprozess verstanden. Zu Beginn ist diese Reziprozität der Beziehungen von Selbst und Anderen hauptsächlich durch physische Belohnung und Bestrafung geregelt. Erst später kommt es durch die Internalisierung elterlicher Gebote und Verbote und der darauf folgenden Orientierung an universalistischen Normen zu symbolischen Anforderungen. Nach KELLER (1976) lässt sich nun schliessen, dass, wenn in der Eltern-KindInteraktion kein Gleichgewicht hergestellt werden kann, negative Bedingungen für die Genese der Fähigkeit zur Rollenübernahme vorliegen. KELLER (1976) in Übereinstimmung mit HAMLYN (1974), misst der affektiven Beziehung zwischen Eltern und Kind zentrale Bedeutung zu im Hinblick auf die Genese der Rollenübernahmefähigkeit.3 Ohne im Moment weiter auf die mittlerweile zwar nicht widerspruchsfreie aber doch als Allgemeingut zu bezeichnende Literatur näher eingehen zu wollen, muss aber doch in Bezug auf unsere Themenstellung auf die Auswirkungen sozialer Ungleichheit zur Genese von Rollenübernahmefähigkeit eingegangen werden. 4 3 Vgl. zum Problemkreis familiale Interaktionsmuster auch SPITZ 1973, ERIKSON 1966, BERNSTEIN 1972, OEVERMANN 1971. 4 Vgl. hierzu: BRONFENBRENNER 1958, BECKER 1964, EWERT 1966, NEIDHART 1968, MOLLENHAUER 1969, PEARL 1970, DANZIGER 1970, SROUFE 1970, ALLEN 1970, ZIGLER & CHILD 1969, MILLHOFER 1973, KELLER, WEINERT & ZEBERGS 1975. 20 6.2 Rollenübernahme in der Unter- bzw. in der bildungsfernen Schicht Zusammenfassen lässt sich sagen, dass in der Unterschicht die innerfamiliären Interaktionsmuster sich stark an vorgegebene Regeln orientieren (Normenrigidität) und häufiger autoritär gehandhabt werden. Der Sozialisationskontext für Unterschichtkinder wird allgemein als wenig kind-orientiert beschrieben. Hervorgehoben wird allgemein die Sozialisationsschwäche des Vaters, die sich einerseits in der mangelnden Übernahme von Erziehungsaufgaben und andererseits durch die restriktiven Bedingungen der Arbeitssituation, den Mangel an Selbstbestimmung und die Erfahrung relativer Machtlosigkeit darstellt. Was aber gerade die affektive Bindung im Vergleich Unterschicht-Väter zu Mittelschicht-Vätern zu ihren Kindern anbelangt, sind die Ergebnisse längst nicht eindeutig. Unterschiede bestehen aber im Disziplinierungsverhalten. Auch was die Fähigkeit anbelangt, Kindern Lebenssituationen durch kognitive Anregungen zu strukturieren, ergeben sich stabile Unterschiede. So geben Mittelschicht-Mütter ihren Kindern mehr verbale Erklärungen in der Anleitung zu Aufgaben und wissen die Informationsbedürfnisse der Kinder besser zu beantworten. 5 Nach TULKIN & KAGAN (1972) verbringen Unterschicht-Mütter weniger Zeit damit, in spielerischen Interaktionen mit ihren Kinder auf deren Reaktionen (Lächeln, Verbalisierungen) differenziert einzugehen. Nach KELLER (1976) ist demnach anzunehmen, dass Unterschicht-Rollenbeziehungen die Fähigkeit zur Rollenübernahme „einerseits im Kontext von Gehorsamssituationen gelernt werden, andererseits als auf den partikularistischen Kontext der Primärgruppe beschränkte Empathie“ (KELLER 1976, 119). Mehrere Untersuchungen zur allgemeinen (DE VRIES 1970, ROTHENBURG 1970) sowie verbalen (FEFFER 1970, RUBIN 1973, TURNURE 1975) Intelligenz, aber auch sprachfreie Tests (RAVEN 1956) ergaben, dass die Fähigkeit zur Rollenübernahme in teilweise engem Zusammenhang mit Intelligenz stehen. Eine mögliche Erklärung hierfür mag der von PIAGET dargestellte Umstand sein, dass die allgemeine kognitive Entwicklung, in den Untersuchungen psychometrisch ausgewiesen, eng mit dem Konstrukt der bereits erwähnten Dezentrierung verbunden ist. Auch die Kommunikationsfähigkeit korreliert mit der Fähigkeit zur Rollenübernahme hoch (r = .72), wie Untersuchungen von MILLER ET AL. (1970) belegen. In der Untersuchung von FLAVELL ET AL (1968) wurde Kommunikationsfähigkeit sogar als entscheidender Indikator für Rollenübernahme herangezogen. Ob die Fähigkeit zur Rollenübernahme eine wesentliche Bedingung für soziales Handeln in Gruppen darstellt, ist bis jetzt noch kaum untersucht worden. Von PIAGET ausgehend lässt sich hierzu sagen, dass zwischen prosozialem Verhalten und der Fähigkeit zur Rollenübernahme eine Beziehung besteht, dergestalt, dass die Fähigkeit zur Verarbeitung komplexer Interaktionssituationen, wie sie durch Rollenübernahme gegeben ist, dem Kind Interaktionen in der Gruppe erleichtert. Daraus lässt sich schliessen, dass Kinder mit hohen Rollenübernahme-Fähigkeiten mehr Kooperativität zeigen, als Kindern mit niedrigeren Rollenübernahme-Fähigkeiten. RUBIN (1973) fand bei siebenjährigen Jungen positive Korrelationen zwischen der Fähigkeit zum Altruismus und zur Rollenübernahme. Diese Ergebnisse müssen aber insofern eingeschränkt werden, als von der Fähigkeit der Rollenübernahme, die ja ein kognitives Verstehen des anderen darstellt, nicht zwangsweise auch auf eine positive affektive Bindung zu den Anderen geschlossen werden darf. Rollenübernahme stellt zwar die Voraussetzung dar, es sind aber auch aggressive Verhaltensweisen möglich. Besteht Rollenübernahme in der Perspektive eines anderen in einer feindselig definierten Situation, so sind keine prosozialen Verhaltensweisen zu erwarten. Diese 5 Vgl. hierzu besonders: ROBINSON & RACKSTRAW 1967, HOFFMANN 1970, KAMII & RADIN 1967, KLAUS & GRAY 1968. 21 Aussage ist entscheidend, relativiert sie doch das Konzept der Rollenübernahme im Hinblick auf übertriebene Erwartungshaltungen. Unterstützt werden diese Aussagen zusätzlich noch durch Untersuchungsergebnisse von ROTHENBURG (1970), die belegen, dass auch der Faktor ‚soziale Beliebtheit‘ nicht unbedingt, mit der Fähigkeit zur Rollenübernahme positiv korreliert. In Anlehnung an PIAGETS Theorie kann man Rollenübernahme als Überwindung des räumlichen Egozentrismus auffassen. Nach PIAGET stellt die Fixierung an die eigene Perspektive bis zum Alter von 6 – 8 Jahren die egozentrische Wahrnehmung dar. Im Verlaufe der fortschreitenden assimilatorisch-akkomodatorischen Äquilibration der Wahrnehmungsschemata kommt es zur Überwindung des räumlichen Egozentrismus. Untersuchungen von BORKE (1971, 1975) zeigen nun aber auf, dass die angesprochene Dezentrierung auch schon früher auftreten kann. Bedingung hierfür ist aber die affektive Bindung an die Person, deren Perspektive eingenommen werden soll. Hierzu geben auch Experimente über strategisch-rekursives Denken (thining about thinking about thinking) von FLAVELL ET AL. (1968) und MILLER, KELLER & FLAVELL (1970) Klarheit. Rekursives Denken, das zwei Schleifen einbezieht, kann von ca. zwölfjährigen Kindern noch nicht nachvollzogen werden. Diese Denkeprozesse sind erst in der Adoleszenz, also im Stadium des formal-logischen Denkens, möglich. Rekursives Denken ist ausserdem noch stark intelligenzabhängig (vgl. DE VRIES 1970). 6.3 Das Konzept der Rollenübernahme aus ontogenetischer Sicht „Erfahrungsgrundlage für die Ausbildung von Verhaltenserwartungen sind überdauernde und damit erkennbare Verhaltensregelmässigkeiten, die in alltäglichen sozialen Interaktionen beobachtbar sind“ (WALLER 1978, 84). Das Erkennen und Erfahren von Verhaltensregelmässigkeiten ermöglicht die subjektive Rekonstruktion und Konstruktion von Regeln interpersonalen Verhaltens. Dieser Prozess umfasst einerseits die Organisation partikularer antizipatorischer Schemata zu übergeordneten, auf Klassen von Interaktionssituationen bezogenen Regeln interpersonalen Verhalten (= Regelbildung) und andererseits die Bildung naiver Hypothesen über die kausale Determination von Regelbeziehungen (= Regelverständnis). Beeinflusst wird dieser zweigleisige Prozess durch die Parameter: 1. Den Grad der Konkretheit vs Abstraktheit erworbener antizipatorischer Schemata, 2. Durch den Komplexitätsgrad konstruktiv gebildeter übergeordneter Regeln und 3. Durch das Ausmass, indem die kausale Determination von Regelbedingungen externalen vs internalen Kausaldeterminationen zugeschrieben werden. Wie bereits bei PIAGET, erwähnt auch WALLER, dass der Abstraktionsgrad erworbener antizipatorischer Schemata mit fortschreitendem Alter als Funktion der im Verlaufe der Ontogenese zunehmenden Strukturhöhe informationsaufnehmender und –verarbeitender Prozesse steigt. Nach BRUNER (1971) sind die ontogenetisch am frühesten (bis ca. 1,5 Jahre) erworbenen antizipatorischen Schemata in sensumotorische Handlungsschemata eingebettet, die im Verlaufe der Koordinierung eigenen Verhaltens mit dem Verhalten der signifikanten Anderen ausgebildet werden. Sensu-motorische Handlungsschemata weisen einen hohen Grad an Konkretheit auf und sind deshalb nicht durch höhere kognitive Operationen transformierbar. Mit der Fähigkeit zur ikonischen Enkodierung und Repräsentation von Erfahrungsinhalten (ca. 1,5 – 2 Jahre) können Regelbeziehungen losgelöst vom aktuellen Handlungsvollzug erfasst werden. Sie weisen aber immer noch ein hohes Mass an Konkretheit auf und sind dementsprechend auch nur in beschränktem Masse durch höhere kognitive Operationen transformierbar. „Im weiteren Verlauf der Ontogenese werden antizipatorische Schemata durch symbolische Enkodierung und Repräsentation interaktionistischer Kontingen22 zen ausgebildet“ (WALLER 1978, 86). Die auf dieser Stufe erworbenen Schemata sind bereits vom anschaulich/konkreten Kontext partikularer Interaktionssituationen losgelöst und können deshalb durch höhere kognitive Operationen wie Generalisierung, Klassifikation und Konzeptualisierung transformiert und umstrukturiert werden. Im weiteren Verlauf der Ontogenese werden zunehmend komplexere Regeln interpersonalen Verhaltens gebildet. Während der frühen Kindheit ordnet das kind Regelbeziehungen vorwiegend externalen Kausaldeterminanten zu. Dazu gehören: - Phänomenal hervorstechende Person- und Status-Attribute - Offene soziale Sanktionen - Anschaulich unterscheidbare Attribute des Interaktionskontextes. Die auf der Basis von external vermittelten Regeln erlernten interpersonalen Verhaltensweisen und Verhaltenserwartungen werden als ‚normorientiert‘ bezeichnet. Erst im Verlaufe der Kindheit lernt das Kind zu verstehen, dass interpersonales Verhalten auch durch internale Kausaldeterminanten, wie: - Motive, Intentionen, Handlungsziele - Psychologische Wirkung von Verhaltensäusserungen - Sozial-psychologisches Verhältnis zwischen Akteuren bestimmt wird. Die auf der Basis von internal vermittelten Regeln erlernten interpersonalen Verhaltensweisen und Verhaltenserwartungen werden ‚personorientiert‘ bezeichnet. Interaktionsrelevante Verhaltensschemata bildet das Kind bereits im ersten Lebensjahr aus. Entscheidend hierbei ist die Mutter-Kind-Dyade, die bereits zu einem frühen Zeitpunkt eine klar erkennbare und zeitlich stabile Organisation (Regelstruktur) darstellt. Gleichzeitig findet auch ein gegenseitig aufeinander abgestimmter Wechsel der Rolle des aktiven vs passiven Interaktionspartners statt. Hier findet man bereits konstituierende Elemente von Interaktion wie z. B. Kenntnis des Bedeutungsgehalts von sogenannten stop- und go-Signalen. D.h. Wissen, dass eigenes Verhalten in kontingenter und damit vorhersagbarer Weise durch darauf bezogenes Verhalten eines Gegenüber beantwortet wird. Dies bedeutet, dass bereits ein Kleinkind zu einfachen, rudimentären antizipatorischen Leistungen fähig ist. Verlässt man nun die Inte3raktion der Mutter-Kind-Dyade und wendet sich Untersuchungen (MUELLER & LUCAS 1975) zu, die Interaktionssequenzen zwischen Kleinkindern untersuchten (6 – 15 Monate), so lassen sich in dere frühen Kind-Kind-Interaktion die folgenden 3 Stufen unterscheiden: 1. Objektzentrierte Kontakte In dieser Phase ergibt sich der Kontakt mit anderen Kindern durch gemeinsame Spielobjekte. Bezeichnend ist, dass das Spielverhalten nicht egozentrisch ist und sich Kontakte eher zufällig ergeben. Die Aufmerksamkeit des Kindes ist hauptsächlich auf das Spielobjekt gerichtet. Blickkontakte unter den Kindern werden demnach nicht aufrecht erhalten. Erst ab ca. 13 Lebensmonaten beginnen die Kinder ihre Mitspieler zu imitieren und ihr Spielverhalten zu gliedern im Sinne aufeinanderfolgender alternierender Aktionen. 23 2. Einfache und komplexe Kontingenzen sozialer Austausch-Akte Das Spielverhalten auf dieser Entwicklungsstufe (14 – ca. 16 Lebensmonate) ist soziozentrisch. Nicht nur ausschliesslich das Spielobjekt steht im Mittelpunkt, sondern auch die Mitspieler und deren Aktionen. Dabei geht es nicht nur alleine um mögliche Imitationsmuster, sondern um Koordinierung des eigenen mit dem Verhalten des Mitspielers. Die Kinder beziehen sich gegenseitig in ihr Geschehen mit ein. Um dies zu erreichen, setzen die Kinder Blickkontakte, Lächeln, vokale Appelle und andere non- und präverbale kommunikative Gesten ein. Die ersten Aktions-Reaktions-Muster entstehen. Diesen ist aber ‚nur‘ quasi-sozialer Wert zuzumessen, da diese Muster lediglich unilateral gesteuert werden. 3. Komplementäre Austausch-Akte In dieser Phase (ab dem ca. 16. Lebensmonat) verläuft die soziale Beeinflussung nicht mehr nur ein-, sondern auch wechselseitig. Die Aktions-Reaktions-Muster weisen eine reziproke Struktur auf und bilden somit echte soziale Handlungseinheiten. Dies bedeutet, dass zur Aufrechterhaltung sozialer Interaktionen, dass sich das Kind gleichzeitig mit der Ausführung einer Verhaltensweise kognitiv die darauf bezogene komplementäre Reaktion des Mitspielers vorstellt und in seine Handlungsmuster miteinbezieht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „die interaktionale Kompetenz des Kindes erst im Verlauf der ersten Hälfte des zweiten Lebensjahres, gemessen an Befunden zur frühen Mutter-KindInteraktion also relativ spät, erwacht“ (WALLER 1978, 95). Die Ausbildung der Verhaltensschemata geschieht (vgl. Stufe2) auch mittels Beobachtungslernen. Wir wollen im folgenden näher darauf eingehen. Nach BANDURA (1971) besteht die spezifische Funktion des Beobachtungslernens in der Konditionierung und Informationsverarbeitung intern vermittelter Repräsentation von Beobachtungsdaten. Die Beobachtung des Verhaltens von Modellpersonen führt zur Ausbildung dieses Verhaltens. Dies braucht, wie wir auch noch anderer Stelle dieser Arbeit umfassender ausführen wollen (vgl. MAHONEY 1977), nicht direkt und offen geschehen, sondern kann auch verdeckt ablaufen. Verdeckt ablaufende Aktualisierungen intern repräsentierter Verhaltensschemata entspricht nun dem Prozess der Verhaltensantizipation, sprich: Verhaltenserwartung. Voraussetzung einer verdeckten Aktualisierung antizipatorischer Verhaltensschemata „ist ihre Repräsentation im Medium eines zumindest ikonischen Kodes“ (WALLER 1978, 99). Deshalb kann der Erwerb antizipatorischer Verhaltensschemata erst dann erwartet werden, wenn das Kind in der Lage ist, Interaktionsverläufe ikonisch zu enkodieren und zu repräsentieren. Nach PIAGET (1972) ist dies frühestens gegen Ende der sensumotorischen Phase der kognitiven Entwicklung zu erwarten. In Anlehnung an PIAGET ist deshalb davon auszugehen, dass die durch akkomodative Verhaltenskoordinierung vermittelte Ausbildung sensu-motorischer Aktions-Reaktions-Schemata eine Vorbedingung für den Erwerb von realtitätsgetreuen, antizipatorischen Verhaltens-Schemata sind. Eine Funktion des Beobachtungslernens besteht in der Ausbildung neuer Verhaltenserwartungen, respektive Verhaltensmuster. Dies in der Praxis nachzuweisen ist aber besonders schwierig, bedeutet es doch, dass man sämtliche Komponenten bisher ausgebildeter Verhaltensschemata unter Kontrolle bekommen müsste. Eine zweite Funktion, nämlich die Umstrukturierung bereits ausgebildeter Verhaltenserwartungen, ist leichter aufzuzeigen. Diese weitere Funktion des Beobachtungslernens besteht in der Stabilisierung bereits ausgebildeter Verhaltenserwartungen. In der Praxis zeigt sich eine derartige Stabilisierung in einer verstärkten Aktualisie24 rung bestehender Verhaltensschemata nach der Beobachtungsphase. Eine Hemmung des Beobachtungslernens findet dann statt, wenn das beobachtete interpersonale Verhalten nicht mit bereits ausgebildeten Verhaltensschemata übereinstimmt. Die Bekräftigung des eigenen Verhaltens bzw. der eigenen Verhaltenserwartungen werden nicht bestätigt. WALLER stellt fest, dass die Ausbildung von Verhaltenserwartungen nur als progressiver Lernprozess zu verstehen ist. An dessen Beginn steht der Erwerb von Verhaltensschemata, die rudimentär repräsentiert sind. Durch wiederholte Beobachtung derselben Interaktionsabläufe werden diese Muster in einer ersten Stabilisierungsphase zu Verhaltensschemata transformiert und sind als solche in Form von Verhaltenserwartungen aktualisierbar. Erst jetzt ist es dem Individuum möglich, durch Vergleich zwischen beobachtetem und erwartetem Verhalten (feed-back-Schleife) den Prozess der Ausbildung von Verhaltenserwartungen anzugehen. Herrscht Übereinstimmung zwischen erwartetem und beobachtetem Verhalten werden die jeweils aktualisierten Verhaltensschemata bestätigt und damit stabilisiert. Die Wiederauftretenswahrscheinlichkeit erhöht sich. Eine Kongruenz von erwartetem und beobachtetem Verhalten stellt aber die Ausnahme dar. Feste Grenzen aufzuzeigen ist nicht möglich, trotzdem muss an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass, wenn sich die Schere zwischen erwartetem und beobachtetem Verhalten häufig (zu) weit öffnet, man vorhersagen kann, dass sich die Aktualisierungswahrscheinlichkeit des jeweiligen Verhaltensschemata verringert und schliesslich gegen Null geht. Es kommt zur Bildung neuer Verhaltensschemata. Bevor wir uns weiter mit dem Modellernen beschäftigen, wollen wir uns eingehend mit der Beeinflussung bei der Ausbildung von Verhaltenserwartungen durch die direkte Erfahrungsbildung im aktiven Interaktionsvollzug beschäftigen. Auf das Modellernen übertragen heisst das, dass die Beobachtung des eigenen Verhaltens und damit der eigenen Person zum Gegenstand der Betrachtung gemacht wird. Dies zu beobachten, um davon Schlüsse ableiten zu können, ist aber sehr schwierig, so dass man sich darauf beschränken sollte, lediglich Funktionen zu untersuchen, die die direkte Erfahrungsbildung im aktiven Interaktionsvollzug im Hinblick auf die Ausbildung von Verhaltenserwartungen darstellen. Ein weiterer Grund, von der Selbstbeobachtung abzugehen, ist die einleuchtende Feststellung, dass bei einem Kleinkind Selbstbeobachtung als Erfahrungsbildungsprozess für Verhaltenserwartungen auf Grund mangelnder Entwicklung auszuschliessen ist. Lernprozesse in der frühen Periode der Mutter-Kind-Dyade verlaufen nicht stellvertretend, sondern unter aktiver Beteiligung des lernenden Subjektes nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Für WALLER (1978) stellt sich sogar die Frage, ob es sinnvoll ist, weiter vermittelnde Lernprozesse zu untersuchen, oder ob man sinnvollerweise vollständig auf instrumentelle Lernprozesse im aktiven Interaktionsvollzug eingehen sollte? So ist ein Kleinkind nur in der Lage, Erwartungshaltungen auszubilden, wenn es die reale Erfahrung gemacht hat, dass seine Mutter mit einem Mindestmass an Regelhaftigkeit und Verlässlichkeit agiert und reagiert. Durch blosse Beobachtung wäre es nicht in der Lage, ein basales Gefühl der eigenen sozialen Sicherheit und Kompetenz zu erwerben. „Insofern ist der direkte Interaktionsvollzug innerhalb der Mutter-Kind-Dyade bei der Ausbildung von Verhaltenserwartungen im Vergleich zu bloss beobachtbaren interaktionalen Kontingenzen sowohl in genetischer als auch in funktionaler Hinsicht als primordiale Quelle der Erfahrungsbildung zu betrachten (WALLER 1978, 111). Ein zweiter Faktor, der zu Gunsten der aktiven Teilnahme am Interaktionsgeschehen spricht, hängt mit der Funktion der Ich-Beteiligung zusammen. Geht man nämlich von der Annahme aus, dass die Ich-Beteiligung im aktiven Vollzug am Interaktionsgeschehen grösser ist, als bei blosser Beobachtung, so lässt sich weiter folgern: Verhaltenserwartungen werden umso wirksamer gelernt, je höher die Ich-Beteiligung am Interaktionsgeschehen ist. Bei einer Wertung des zuvor gesagren kommen wir zu der Auffassung, dass neben dem Erlernen auf stellvertre25 tender Basis, auf das infolge der breiteren Möglichkeit zur Erfahrungsbildung und der ökonomischen Durchführung nicht verzichtet werden soll, auch direkte, an die eigene Person gebundene Interaktionserfahrungen zu berücksichtigen sind. Obwohl WALLER (1978) zu dem gleichen Schluss gelangt wie wir, verfolgt er in seiner Abhandlung nur noch die Ausbildung von Verhaltenserwartungen auf der Basis des Beobachtungslernens, da er ‚nur‘ in diese Richtung weiter gearbeitet hat. Kehren wir zu den Erklärungen über den ontogenetischen Verlauf der Ausbildung von Verhaltenserwartungen zurück. Diese sind eng mit der Bildung eines Regelbewusstseins verbunden. Damit die Regelkenntnisse aber nicht nur auf partikulare interpersonale Verhaltensmuster beschränkt werden müssen, muss es im Laufe der individuellen Entwicklung zu universalistischen, auf interpersonales Verhalten im allgemeinen anwendbaren Regelstrukturen kommen. D.-h. langfristig gesehen verläuft der Prozess der Ausbildung von Verhaltenserwartungen somit von einer rigiden und situationsadäquaten Schematisierung in Richtung auf eine der Vielfalt interpersonaler Verhaltensmuster angemessenen situationsspezifischen Differenzierung und Flexibilität. Detailliert ausgedrückt bedeutet dies, dass bei 4 – 5jährigen Kindern, Rollenschemata noch nicht die Tragweite von Rollenkonzepten haben, weil es sich in dieser Altersstufe noch um vorbegrifflich-anschauliche Gruppierungen „antipatorischer Verhaltensschemata, die nach Äquivalenzrelationen zwischen konkret-anschaulichen personalen cues partikularer interaktionaler Kontingenzen gebildet werden“ (WALLER 1978, 176/177). Im weiteren Verlauf der in der Ontogenese zunehmenden Differenzierung und Stabilisierung kommt vermutlich der Sprachentwicklung eine wichtige Bedeutung zu. Auch in diesem Bereich verläuft die ontogenetische Entwicklung vom konkreten zum abstrakten: frühe sprachliche Bezeichnungen (Eigen- und Begriffsnamen von Personen der engeren sozialen Umwelt) werden abstrahiert und auf übergeordnete Kategorien bezogen. Es findet eine Generalisierung der Bedeutungsinhalte von Begriffen statt, die immer kontextunabhängiger werden. Erst in dieser Phase der mittleren Kindheit ist ein Kind in der Lage, die soziale Verbindlichkeit von Regeln interpersonalen Verhaltens zu erkennen. Diese Phase geht mit der von KOHLBERG (1974) und PIAGET (1972) beschriebenen Entwicklung moralischer Regeln und Normen parallel. Aufgrund der Bildung von konzeptualisierten, kontextunabhängigen Verhaltenserwartungen wird die individuelle Speicherkapazität eines Kindes entlastet: Ein lernökonomischer Effekt. Ausserdem ist es dem Kind in Verbindung mit der nun bereits erwähnten sprachlichen Entwicklung möglich, Verhaltensschemata zu aktualisieren, was ihm in der Phase der konkreten Ausprägung elementarer Verhaltenserwartungen noch nicht möglich gewesen wäre. Diese für die Sozialisation eines Kindes bedeutsamen Aussagen messen natürlich auch dem Erzieherverhalten entscheidende Bedeutung zu. Wir kommen deshalb an dieser Stelle auf diese wichtige Thematik zurück: „Je grösser die Bereitschaft der Eltern oder von sonstigen Sozialisationsagenten, interaktionale Kontingenzen in der kommunikativen Interaktion mit dem Kind symbolisch zu vermitteln, desto mehr wird die Bildung sozial relevanter Erwartungskonzepte stimuliert und ihre soziale Validierung erleichtert“ (WALLER 1978, 181). Die semantische Struktur des Kindes wird somit erweitert. Die Erwartungskonzepte eines Kindes werden weiter organisiert und miteinander koordiniert. Nach HARTLEY et al. (1948) und STRAUSS (1952) ist ein Kind erst im Alter von 8 – 11 Jahren dazu in der Lage, einer Person mehrere Rollen gleichzeitig zuzuordnen. Vorher vermag es zwar mehrere Rollen an einer Person wahrzunehmen, doch identifiziert das jüngere Kind die Person mit der ihr zugeschriebenen Rolle. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass multiple Rollenzugehörigkeit Voraussetzung für die Entwicklung des Verständnisses interpersonaler Beziehungen ist. Während die Konzeptualisierung von an Rollen geknüpften Verhaltenserwartungen frühestens im Stadium der konkret-operativen Intelli26 genz möglich ist, ist das Erkennen multipler Rollenzugehörigkeiten erst später in der Phase der formal-operativen Intelligenz möglich. Erst in diesem Stadium ist das Kind/der Jugendliche in der Lage, kognitive Strukturen beliebig und flexibel miteinander zu kombinieren. Mit der reversiblen Organisation und Koordinierung von Erwartungskonzepten im Rahmen eines Systems von Regeln interpersonalen Verhaltens ist das heranwachsende Individuum aus entwicklungspsychologischer Sicht dazu fähig, in Bezug auf alle – tatsächlichen oder hypothetischen – interpersonalen Situationen reziprok aufeinander abgestimmte Verhaltenserwartungen zu generieren. Bezieht man das Konzept der Rollenübernahme auf die Schule, so kommt der Fähigkeit, die Rolle des Lehrers als ‚signifikanten Anderen‘ zu antizipieren und zu wissen was ‚er‘ von ihnen verlangt, in Bezug auf die notwendige Anpassung zur Herstellung der intersubjektiven Ebene besondere Bedeutung zu. Geht man weiter von der in der Sozialisationstheorie anerkannten These aus, dass man Erwartungen besser entsprechen kann, je ähnlicher sie den bisher gemachten Erfahrungen entsprechen, so fällt es nicht schwer, zu verstehen, dass Kinder aus der Unterschicht in der Schule Schwierigkeiten haben, sich nach der Rollenübernahme des Lehrers und damit der Schule anzupassen, da diese, wie einige Untersuchungen (WEINERT 1972, FEND 1974, FOLFF 1974) nahelegen, überwiegend mittelschichtorientiert ist. Dem entspricht denn auch in der Praxis die Distanz, die Unterschicht-Eltern und Kinder der Institution Schule entgegenbringen. Interessant ist es in diesem Zusammenhang näher auf die Untersuchung von KELLER (1976) einzugehen. KELLER untersuchte 67 Kinder im Alter von 12,5 – 15 Jahren in Bezug auf ihre Rollenübernahmefähigkeit und eventuell sich daraus ableitende Vorhersagemöglichkeiten auf ihren zukünftigen Schulerfolg. Die ausgewählten Kinder besuchten eine Gesamtschule und gehörten zu je einem Drittel der unteren Unterschicht, der oberen Unterschicht sowie der Mittelschicht an. Die Aufgabe des den Kindern vorgelegten Tests bestand zunächst darin, anhand von Bildern des „Shneid-Man-Map-Test“ (eine Art thematischer Apperzeptionstest) Szenen zusammen zu stellen, in denen drei Personen interagieren. Zu dieser Szene erzählen die Probanden eine Geschichte, in der alle drei Personen vorkommen. In späteren Untersuchungen wurden den Probanden Bilder vorgelegt, auf denen drei Personen in einer Interaktionssituation dargestellt waren. Anschliessend wurden die Probanden in einem zweiten Schritt aufgefordert, die Geschichte nacheinander aus der Perspektive aller drei Personen zu erzählen. Das Testmaterial für die Ausgangsgeschichte ist prinzipiell beliebig zu variieren und dient nur als Basis für die Rollenübernahme. KELLER (1976) formulierte eine Reihe von Untersuchungsergebnissen. Sie stellt fest, dass das Schulsystem für das Kind schwieriger zu bewältigende Rollenübernahme-Situationen darstellt als die Familiensituation. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass im Gegensatz zur Meinung PIAGETs (1972) die Gruppe der Gleichalterigen durch die Leistungsorientierung der Schule bei den Kindern auch Misserfolgsängste auslösen kann, die die Rollenübernahmefähigkeit hemmen. Auch dürfte die Generierung von Rollenübernahme in der Familie eher gelingen, weil Rollenübernahme und Empathie eher in der Familie als in der Schule gefordert und gefördert werden. Die Untersuchungsergebnisse von KELLER (1976) sprechen für die Annahme, dass „sozio-affektive Dimensionen elterlichen Erziehungsverhaltens relevante sozialisatorische Bedingungen der Genese von Rollenübernahme-Fähigkeit sind“ (KELLER 1976, 271). Hier ist aber auch darauf hinzuweisen (vgl. CHANDLER 1972), dass nicht nur Kinder in emotional warmen Klima eine Rollenübernahme-Fähigkeit entwickeln, sondern auch Kinder, die in ihrer Familiensituation extrem punitiven Sozialisationsbedingungen ausgesetzt sind. Die Untersu27 chung von KELLER spezifiziert dieses Phänomen allein auf Kinder aus der oberen Unterschicht. Dieses Untersuchungsergebnis wirft die Frage auf, ob eventuell unterschiedliche Stile der Rollenübernahme angenommen werden müssen, so wie WEINSTEIN (1969) und WALLER (1973) in Anlehnung an BERNSTEIN von positions- und person-orientierten Formen der Rollenübernahme sprechen. Diese Unterscheidung in Bezug auf flexiblere Fähigkeiten zur Rollenübernahme ist aber vorsichtig aufzufassen, da sie eher theoretisch zu formulieren denn empirisch zu belegen ist. Trotzdem soll festgehalten werden, dass in unterschiedlichen Kontexten erworbene Fähigkeiten zur Rollenübernahme auch eher den dem Kontext näher liegenden Situationen aktualisiert werden. D.h., dass Kinder, die die Fähigkeit zur Rollenübernahme in positionalen Familiensystemen, die eher auf Konformitätsdruck ausgerichtet sind, erworben haben, eher in solchen Situationen über effektive Rollenübernahme-Fähigkeiten verfügen, in denen Kinder sich normativen Erwartungen ausgesetzt sehen. Hingegen können Kinder, die die Fähigkeit zur Rollenübernahme eher in person-orientierten Interaktionskontexten erworben haben, eher in der Lage sind, die Perspektive eines anderen flexibel zu verstehen, respektive zu antizipieren. Für KELLER steht fest, dass in der Fragestellung ‚Rollenübernahme und Schulerfolg‘ die Fähigkeit der Rollenübernahme sich noch deutlicher als die Intelligenz und die soziale Schicht als ein äusserst bedeutsamer Prädikator für Schulerfolg erweist. Was nun die Entwicklung und Funktion kognitiver und affektiver Bereiche, auf deren Bedeutsamkeit wir bereits mehrmals hingewiesen haben, angeht, so postuliert KOHLBERG (1974) ihre Parallelität. Die beiden Bereiche können nicht voneinander geschieden werden. Sie stellen lediglich verschiedene Perspektiven und Kontexte für die Definitionen struktureller Veränderungen dar. Da nach SCHACHTER (1964) physiologische Muster der Erregung relativ gleichförmig verlaufen (bei durchaus unterschiedlichem Intensionsgrad), kann die Variabilität der Emotionen nur mit der Variabilität kognitiver Faktoren (Freude, Ärger, Liebe etc.) zu erklären sein. SCHACHTER’s Theorie besagt, dass ein Individuum allgemeine Muster physiologischer Erregung nach den Charakteristiken der jeweiligen Situation und den früher gemachten Erfahrungen interpretiert. Physiologische Erregung genügt demnach allein nicht, um Emotionen zu erfahren, es müssen kognitive Verarbeitungsprozesse hinzukommen. Gelingt es nicht, emotionale Erregung kognitiv zu interpretieren, bleibt sie diffus und unbestimmt. OERTER (1975) leitet hiervon ab, dass Menschen, die eher emotional diffus reagieren, weniger in der Lage sind, ihre Erregungen zu steuern. Andererseits fördern positive Emotionen kognitive Prozesse, die diese Emotionen wiederum unterstützen. Die Verbindung von Kognitionen und Emotionen ist bei internalisierten Normen, die OERTER „Werte“ oder „Wertkonzepte“ nennt, besonders eng. Wertstrukturen bestimmen die Sichtweise eines Menschen gegenüber seiner Umwelt, welche Ziele er in ihr verfolgt und nach welchen Strategien er vorzugehen in der Lage ist. Änderungen im kognitiven Anteil von Wertstrukturen verändern gleichzeitig auch immer die emotionalen Anteile. Der Theorie von SCHACHTER kommt in Bezug auf die persönliche Einstellung von Lehrern besondere Bedeutung zu. Ein Beispiel aus dem Umgang mit einem „schlechten“ Schüler vermag dies zu verdeutlichen. Stört ein Schüler oft und vermag inhaltlich wenig zum Unterricht beitragen, mag der Lehrer dieses Verhalten respektive seinen Ärger als reine Destruktion etikettieren. Ist der Lehrer aber in der Lage, das gleiche störende Verhalten nicht als auf den Unterricht allein bezogenes Verhalten zu interpretieren, sondern als Ausdruck z. B. gestörter Familienverhältnisse, i. S. einer mangelhaft ausgebildeten IchIdentität umzuinterpretieren, wird er eher in der Lage sein, dem Schüler in einer für ihn adäquateren Form zu begegnen und damit dem Schüler zu helfen. 28 Wir wollen nun den theoretischen Komplex, der sich mit dem Konzept der Rollenübernahme, fussend auf PIAGET und MEAD, beschäftigt, verlassen, um uns dem Konzept der ‚Sozialen Kognition‘ zuzuwenden. Dabei werden wir aber doch immer wieder auf Aussagen von PIAGET zurückgreifen müssen. Theorien, die dich mit Kognitionen befassen, kommen auch beim heutigen Erkenntnisstand nicht darum herum, PIAGET zu berücksichtigen. 7. Das Konzept der ‚sozialen Kognition‘ In diesem Abschnitt sollen die wesentlichen Positionen dargestellt werden, die unter dem Oberbegriff ‚soziale Kognitionen‘ vermittelt werden. Dabei ist zu bemerken, dass es auch hier bisher wenige Schritte in Richtung auf eine einheitliche Theorie gegeben hat. Die unterschiedlichsten Forschungsansätze stehen nebeneinander. So muss z. B. die Arbeit von FLAVELL ET AL. (1975) als Erweiterung des Egozentrismuskonzeptes von PIAGET angesehen werden. FLAVELL ET AL. versuchten, experimentel eindeutige Unterscheidungen zwischen egozentrischer und nicht egozentrischer Kommunikation bei Kindern herauszuarbeiten. Um den Rahmen des Konzepts ‚soziale Kognition‘ abzustecken, greifen wir auf von CROISSIER ET AL. (1979) herausgearbeitete Unterscheidungsmerkmale zurück: - Die räumlich perzeptive Übernahme des Standpunktes des Anderen - Das instrumentell-kognitive Verstehen dessen, was eine andere Person denkt, häufig als ‚role-taking‘ oder als strategische Rollenübernahme bezeichnet - Die sozial-kognitive Rollenübernahme als Einnehmen spezieller sozialer Perspektiven von bekannten oder typischen Anderen (z. B. Eltern) und - Die affektive Komponente im Verstehen des Anderen, auch Empathie genannt (vgl. CROISSIER ET AL. 1979, 22). In diesem Zusammenhang müssen zwei weitere Modelle genannt werden. Das eine ist das Modell von SELMAN (1976; auch: SELMAN/BYRNE 1977). Es beschäftigt sich speziell mit dem Wechsel in den Fertigkeiten des Kindes und Jugendlichen, Rollen zu übernehmen, und ist als Stufenmodell konzipiert. Generell kann zusammengefasst werden: SELMAN nimmt an, dass das Kind vor 6 Jahren egozentrisch ist, in dem Sinn, dass es keine Unterscheidung macht zwischen seiner Sicht einer Situation und möglichen anderen Sichten. Es mag wissen, dass der Andere eine andere Perspektive hat, ist aber nicht fähig, diese zu spezifizieren, oder nimmt zumindest Ähnlichkeit zwischen seinen Gedanken und den Gedanken des Anderen an. In der mittleren Kindheit (6 – 10 Jahre) erlangt das Kind zwei wichtige Repräsentationen. Erstens ist es fähig, die Absichten, Gefühle und Gedanken des Anderen angemessen zu erschliessen. Zweitens wird es fähig, zu verstehen, dass es selbst und seine eigenen Gedanken 29 Objekt der Gedanken des Anderen sein können. Mit 10 – 11 Jahren erreicht das Kind eine neue Stufe der Fähigkeit, Rollen zu übernehmen, indem es versteht, dass man gleichzeitig seine eigene Perspektive sehen und die eines anderen Individuums übernehmen kann („mutual role taking“). Mit 12 Jahren etwa dehnt sich die Fähigkeit des Jugendlichen dazu über die Zwei-Personen-Situation auf soziale Systeme aus („generalized other“). Dieses Stufenmodell basiert weitgehend auf den Antworten von Kindern zu kurzen Geschichten, die moralische oder soziale Entscheidungssituationen beinhalten. Ein weiteres Stufenmodell stammt von FLAVELL (1968, 1975). Er hat ein Modell der interpersonalen Inferenz entwickelt, das auf einem Informationsprozess-Ansatz beruht. Er benennt vier Ereignisse als Existenz, Bedürfnis, Inferenz und Anwendung (Flussmodell). Zunächst muss sich das Individuum bewusst sein, dass es oder eine andere Person überhaupt verdeckte psychologische Ereignisse haben kann. Zum Zweiten muss das Kind erkennen, dass die gegenwärtige Situation eine Schlussfolgerung erfordert (Bedürfnis) über die psychologischen Erfahrungen eines Anderen. Dieser Ausdruck der ‚Schlussfolgerungen‘ bezieht sich auf die Diskrimination von Anzeichen, ihre Integration, Wahrscheinlichkeitsdenken u. ä.. Schliesslich ist die Anwendung definiert als irgendein folgendes Verhalten des Kindes als Konsequenz seiner Schlussfolgerungen, z. B. indem es seine Spielstrategien oder seine Botschaft dem Gegner oder dem Zuhörer, über den es eine Schlussfolgerung gezogen hat, anpasst. Bei SHANTZ (1975) bezieht sich der Begriff ‚soziale Kognition‘ auf die intuitive oder logische Repräsentation von Anderen bei Kindern, d.h. auf die Fragen, wie sie Andere charakterisieren und wie sie Schlüsse ziehen über ihre verdeckten inneren psychologischen Erfahrungen. Die Erforschung und weitere Erörterung der Entwicklung der sozialen Kognition ist wichtig in zweierlei Hinsicht. Zunächst bringt sie ein eher komplexes Bild der kognitiven Entwicklung des Kindes, indem sie zeigt, welche Typen von Konzepten und Prozessen in beiden, den sozialen und den nichtsozialen, Bereichen in bestimmten Altersperioden von Bedeutung sind. Zum anderen ist das Studium wichtig, weil die Art, wie Kinder Andere konzeptualisieren, wahrscheinlich einen wichtigen Einfluss hat auf ihr soziales Verhalten gegenüber diesen Anderen. Es ist wichtig im Gedächtnis zu behalten, dass das Bild von der sozial-kognitiven Entwicklung der Kinder sowohl kognitive als auch linguistische Fertigkeiten widerspiegelt. Nur wenig Forschung bezieht sich auf non-verbale Reaktionen. Dort wählt das Kind z. B. einen Gesichtsausdruck aus, um zu zeigen, was jemand anderes in einer bestimmten Situation empfindet. Oder es wählt eine Wahrnehmungsperspektive auf einer Fotographie aus, um zu zeigen, wie die Sicht eines Anderen von einer bestimmten Position her ist. Dabei können die motorischen und affektiven Verhaltensmöglichkeiten des Kindes benutzt werden, z. B. in einigen Spielsituationen, um die Repräsentationen des anderen Individuums von daher zu erschliessen. In den verschiedenen empirischen Studien werden ganz unterschiedliche Informationen über den Anderen gegeben. Das Material variiert von verbalen Geschichten über Fotographien bis zu Tonbandaufnahmen oder Filmstreifen. In diesen Umgebungen spielt das Kind die Rolle eines Beobachters. In anderen Studien dagegen wird ein aktuelles Individuum benutzt, das das Kind beurteilen soll, wobei das Kind oft Teilnehmer ist. Z. B. spielt das Kind ein Spiel mit einer anderen Person, wobei sich zeigt, wie weit es fähig ist, die Gedanken des Anderen und dessen Spielstrategien zu erschliessen; oder es kommuniziert eine Botschaft an ein anderes Individuum. Bei der Unterschiedlichkeit der vorgegebenen Stimuli zur anderen Person und zur Situation muss man sich fragen, auf welche Elemente das Kind seine Aufmerksamkeit beim Urteilsprozess richtet. Eines der allgemeingültigen Ergebnisse ist, dass Kinder vor dem Alter von sieben Jahren ihre Aufmerksamkeit auf deutlich sichtbare, oberflächliche Anzeichen von Leuten und Situationen richten. Z. B. benutzen sie oft äussere Erscheinung und 30 Besitz als Beschreibunsdimension. Das korrespondiert mit den Ergebnissen von PIAGET zur Beachtung von Oberflächenmerkmalen bei materiellen Objekten. Mit 7 oder 8 Jahren zeigen sie einen tiefgreifenden Wandel in der Art, wie sie andere Leute beschreiben. Zunehmend benutzen sie Begriffe wie Gewohnheit, Eigenschaften, Glaubenssätze, Werte u. ä. Also eher abstrakte Beschreibungen, die auf Regularitäten in Verhalten über Zeit und Situation hin beruhen. Auch dieser Wechsel hat ein Korrelat bei der Aufmerksamkeitsausrichtung im Problemlösen in nicht-sozialen Situationen. SHANTZ (1975) löst nun den Komplex ‚soziale Kognition‘ in folgende Alltagskategorien auf: 1. Was sieht der Andere? 2. Was denkt der Andere? 3. Was weiss der Andere über einen gemeinsamen Kommunikationsgegenstand? 4. Was fühlt der Andere? 5. Was will der Andere? 6. Was ist der Andere für eine Person? 7. Was für eine Situation ist dies? 1. Was sieht der Andere? Eine verdeckte psychologische Erfahrung einer anderen Person ist dessen optische Perspektive von Objekten im Raum, eine Erfahrung, die man gewöhnlich mit einem Anderen nie gleichzeitig teilt. Diese Schlussfolgerung ist die am wenigsten soziale aller im Folgenden vorgestellten Typen. Das einzige, was das Kind dabei berücksichtigen muss, ist die räumliche Position des Anderen, während es bei den folgenden Schlussfolgerungen verschiedene Aspekte der Situation integrieren muss, um Gefühle, Gedanken oder subjektive Erfahrungen herauszufinden. Die klassische Studie in diesem Bereich stammt von PIAGET/INHELDER (1956). Eine Landschaft mit drei unterschiedlichen Bergen wird den Kindern vorgestellt. Sie werden befragt, welche Perspektive ein Anderer von verschiedenen Positionen in der Landschaft hat. An dieser Aufgabe hat PIAGET sein Egozentrismuskonzept verdeutlicht. Dabei hat er eine dreistufige Entwicklung in der Fähigkeit, sich die Position eines Anderen, postuliert. Ist es tatsächlich so, dass Kinder vor dem 6. Lebensjahr, wie PIAGET es behauptet, egozentrisch sind und keine Vorstellung von der positionsgebundenen Perspektive eines Anderen haben? Dieses Bild der Entwicklung entsteht, wenn man nur die Standard-Landschaftsausgabe benutzt. FLAVELL (1974) hat eine Reihe von Studien zusammengefasst, bei denen einfachere Vorgaben gegeben und weniger verbale Fertigkeiten zur Beantwortung erforderlich waren. Seine Analyse dreht sich um zwei Faktoren: A) Identifikation dessen, was ein Anderer sieht und – komplexer – wie er es sieht (Perspektive durch das Kind und B) Die Art seiner Antwort, d.h. sensomotorisch oder repräsentational. 31 Diese Analyse gehört in den Teil, den FLAVELL „existence“ nennt. Das Null-Niveau bedeutet, dass das Kind die Objekte beschreibt, die es in seiner Umgebung erwartet und sie so beschreibt, wie sie ihm erscheinen. Eine Untersuchung von MASANGKAY ET AL. (1974) mit 2 bis 5jährigen Kindern ist ein Beispiel dafür. Eine Karte mit verschiedenen Bildern auf jeder Seite wird dem Kind gezeigt und die Fragen werden gestellt: Was siehst du? Und was sehe ich? Das Kind auf dem Null-Niveau wird die zweite Frage nicht beantworten können, es sei denn es wird gefragt: Welches Bild ist auf meiner Seite der Karte? Das Kind kann sich Objekte vorstellen, aber nicht die Perspektive des Anderen, aus der dieser die Objekte sieht. Die Leistungen auf dem Niveau 1 gründen sich auf der Fähigkeit, sich vorzustellen, was der Andere sieht, und nicht auf die Fähigkeit, seine Perspektive einzunehmen. Ein Kind auf dieser Stufe könnte dann die Was-sehe-ich-Frage beantworten. Diese Grundstufe der Rollenübernahme ist in der Untersuchung bei allen Dreijährigen und der Hälfte der Zweijährigen festgestellt worden. Das Kind auf diesem Niveau stellt sich vor, wie der Andere Dinge sieht. Dafür ist die DreiBerge-Aufgabe beispielhaft. Wenn eine einfache Aufgabe, bestehend aus einem einzigen, bedeutungsvollen Objekt mit leicht benennbaren Seiten, benutzt wird, haben Vorschul- und Kindergartenkinder einige richtige Schlussfolgerungen dazu gezeigt. Wenn eine Gruppe von Objekten benutzt wird, schafft das Kind die Aufgabe in der Regel nicht vor dem 7. Lebensjahr. Welche Anzeichen gibt es für die Prozesse, die bei der Lösung des Raumproblems mitspielen? Drei Ansätze haben versucht, darin Klarheit zu schaffen: - Analyse der Fehlertypen - Analyse der Wahrnehmungsbedingungen der Aufgabe und - Analyse der Rolle von Bewegungen im Raum. Den ersten Ansatz haben COIE ET AL. (1973) bei fünf bis elfjährigen Kindern benutzt. Sie fanden Ergebnisse, die mit FLAVELLS Modell übereinstimmten. Die häufigsten Fehler finden statt einmal bei der Diskrimination, welche Objekte gesehen werden, dann, wie sie gesehen werden, zum Schluss, ob sie rechts oder links gesehen werden. Beim zweiten Ansatz wird der Eindruck des Standpunktes des Kindes auf seine Fähigkeit, die Perspektive des Anderen zu erschliessen, untersucht. BRODZINSKY ET AL. (1972) (In: CROISSIER 1979) untersuchten Kinder von 6, 8 und 10 Jahren. Sie fanden, dass bei Aufgaben mit mehreren Objekten es nur für 8jährige Kinder eine Erleichterung war, wenn ihr eigener Gesichtspunkt verdeckt wurde. Es scheint, dass Verdeckung im allgemeinen kaum direkte Wirkung hat. Beim dritten Ansatz sind die Fragen: versteht das Kind, was der andere sieht, a) indem es in seiner Vorstellung das Feld zu seiner Position hin dreht und das so entstehende Bild abliest oder b) indem es sich in seiner Vorstellung zur Position des Anderen hinbewegt und dann das Bild abliest oder c) indem es systematisch Dimensionen wie Nah-fern- und Rechts-links-Beziehungen variiert, um schliesslich die Perspektive herauszufinden. Die Effektivität der Kinder, die sich bewegen, zeigt sich in einer Untersuchung von SHANTZ ET AL. (1975). Wird eine solche aktuelle Bewegung aber nicht zugelassen, wie in der Standardaufgabe, dann scheint es nicht so zu sein, dass das Kind sich in der Vorstellung zur Position des Anderen hin begibt; das scheint dem Kind sehr schwer zu fallen. Stattdessen scheint es so, als ob das Kind das Bild des Anderen zu seiner eigenen Position hindreht. 32 2. Was denkt der Andere? Diese Fragestellung zielt auf ein zentrales Problem innerhalb des Konzepts der Rollenübernahme bzw. sozialen Kognition, nämlich, wie ein Kind die inneren Zustände, die Gedanken, die Wünsche und Absichten einer anderen Person erfasst. In Untersuchungen wurden den Kindern folgende Aufgaben gestellt: - In einem Ratespiel, bei dem in einer Hand ein Geldstück versteckt wird, muss das Kind entweder raten oder selbst das Geldstück verstecken - Auf Bildern mit Sprechblasen sollen die Kinder beschreiben, was die Personen auf den Bildern tun und was sie denken - Die Kinder werden aufgefordert, eine Geschichte, die sie zunächst neutral, d.h. aus ihrer Sicht erzählt haben, anschliessend aus der Sicht eines anderen Kindes zu erzählen. Weitere Untersuchungsbeispiele hierzu liefern: SELMAN & BYRNE 1977; KURDEK 1975; LECKIE 1975; FEFFER 1959; KELLER 1976. In der Spanne von 4 – 6 Jahren sind Kinder in der Lage, z. B. beim Ratespielen eine Vorhersage des Verhaltens ihrer Partner zu geben. Mit System raten sie allerdings erst ab 7 Jahren. Erst in der mittleren Kindheit etabliert sich die Fähigkeit, zu erkennen, dass andere Personen das eigene Denken zum Gegenstand ihres Denkens machen können. Auch hier muss wieder erwähnt werden, dass die Aussagekraft in Bezug auf Rollenübernahmefähigkeit immer mit den jeweilig zur Anwendung gebrachten Untersuchungsverfahren zusammenhängt. Jüngere Kinder erleben nämlich nicht mehr Frustrationserlebnisse als ältere, wenn es um die Fähigkeit der Rollenübernahme geht: sie setzen sich eben einfacheren Aufgaben aus. So spielt es eine Rolle, ob das Kind in einer gewohnten Umgebung, z. B. zu Hause, den Informationsstand seiner Mutter vorhersagen soll. In dieser Anlage sind bereits vierjährige Kinder in der Lage, richtige Antworten zu geben. 3. Was weiss der Andere über einen gemeinsamen Kommunikationsgegenstand? Untersuchungsaufgaben zum Abklären dieser Fragestellung waren dergestalt angelegt, dass ein Kind einem Zuhörer mit verbundenen Augen ein Würfelspiel erklären soll. Bei dieser Aufgabenstellung wurde noch keine Trennung von Rollenübernahmefähigkeit und kommunikativen Fähigkeiten vorgenommen, wie das z. B. bei der folgenden Aufgabe der Fall ist, wo Sprecher und Hörer durch eine Wand getrennt werden. Der Sprecher muss nun dem Hörer bestimmte Objekte beschreiben, die dieser dann auswählen und anordnen muss. Die Untersuchungsergebnisse zu dieser Fragestellung sind leider sehr uneinheitlich und lassen kaum entwicklungspsychologische Schlüsse zu (vgl. GLUCKSBERG u.a. 1975, MARATSOS 1973, MENIG-PETERSON 1975, HOY 1975). 33 4. Was fühlt der Andere? Diese Fragestellung wird häufig mit dem Begriff ‚Empathie‘ umschrieben, der auf die Kontroverse um die Beziehung zwischen affektiven und kognitiven Anteilen (oder beidem gleichzeitig) innerhalb des Empathiekonzeptes verweist. Die Untersuchung von BORKE (1971) konnte aber den Beweis erbringen, dass bereits 3jährige Kinder in der Lage sind, emotionale Reaktionen anderer Personen zu unterscheiden und situationsangemessen zu beurteilen. Besonders letzteres verweist auf eigene emotionale Erfahrung, die in Beziehung zur dargestellten Situation gebracht werden muss. Geht man nun von der Annahme aus, dass diese Kinder nicht nur in der Lage waren, Gefühle anderer zu erkennen (eine eindeutig kognitive Leistung), sondern auch zu teilen (eine emotionale Leistung), so gerät man mit PIAGET’s Egozentrismuskonzept in Konflikt. Diese Kontroverse (vgl. auch die gegenteilige Positionen von KELLER, 1976 und WALLER, 1978) haben auch CROISSIER ET AL. (1979) in Anlehnung an IANNOTTI (1975) aufgegriffen. IANNOTTI unterscheidet, ob ein Individuum a) mit dem gemeinsamen kulturellen Wissen auskommt, um eine Situation zu beurteilen, oder ob es b) seine eigene Perspektive unterdrücken muss, um den Standpunkt des Anderen einnehmen zu können. Geht man nun von der emotionalen Entsprechung aus, so kann diese entweder als emotionale Übereinstimmung © oder als ein dezentrisches Situationsverständnis aus der Sicht des Anderen (d) verstanden werden. JANNOTTI’s Untersuchungen konnten zeigen, dass bereits sechsjährige Kinder gute Leistungen in a) und c) aufwiesen. Sie konnten also das Gefühl einer Person nach Fotos richtig auswählen, wenn diese situationsangemessen war. Unseres Erachtens vermag auch IANNOTTI den Streit nicht exakt klären. Fest steht, dass Empathie umso früher einsetzt, je grösser die Ähnlichkeit zwischen Beurteiler und Beurteiltem und je vertrauter die Situation ist. Ungeklärt ist aber weiter, durch welche Vermittlungsprozesse das Kind Empathiefähigkeit erlangt. In einigen Studien wird dem Kind eine kurze Geschichte mit einer Situation, begleitet von einem Bild, vorgegeben, z. B. Geburtstagsparty, Zerbrechen eines Spielzeugs. Das Kind wird gefragt: Was fühlt das Kind in der Geschichte? Eine richtige Antwort wird von BORKE (1971) als Empathie, von FESHBACH/FESHBACH (1963) als soziales Verständnis bezeichnet. Oder das Kind wird gefragt: Was empfindest du? Die Antwort hierauf wird dann von FESHBACH als Empathie bezeichnet. Wir wollen zunächst auf die Befunde zur Empathie i. S. von Verstehen des Gefühls des Anderen eingehen. Die meisten Daten basieren auf BORKE’s „Interpersonal Perzeption Test“ (1971). Der Test umfasst 23 Geschichten mit Bild und erfordert nur eine non-verbale Antwort. Verschiedene Studien haben gefunden, dass ein Kind mit 4 Jahren auf einem bestimmten Wahrscheinlichkeitsniveau korrekt Situationen identifizieren kann, die typisch sind für Emotionen wie Freude, Trauer, Angst und Ärger. Dabei gibt es kulturspezifische Unterschiede. Wenn ein Kind identifizieren kann, was ein anderes in einer bestimmten Situation fühlt, ist das eine Funktion von Rollenübernahme-Fähigkeiten? Wahrscheinlich nicht: die korrekte Emotion wird das Kind eher identifizieren aufgrund seiner eigenen Erfahrungen mit dieser Situation oder der Erinnerung an das Verhalten anderer in einer solchen Situation, die es beobachtet hat (Projektion oder Identifikation). Eine Reihe von Untersuchungen weisen nach, dass Vorschulkinder dann Emotionen identifizieren, wenn ihnen die betreffenden Situationen vertraut ist und/oder die andere Person dem Kind selbst ähnlich ist. Die Identifikation der Emotion scheint eher eine Selbstbeschreibung zu sein. I.d.R. können Vorschulkinder angenehme und unangenehme Emotionen in Fotos identifizieren und aus drei Fotos eines auswählen, das Ärger, Freude oder Ekel zeigt. Wenn sie aber eine spezifische verbale Benennung dafür geben sollten, sind ihre Antworten weniger akkurat. 34 5. Was will der Andere? In der entwicklungspsychologischen Forschung wurde versucht, diese Fragestellung im Vergleich von unbeabsichtigten und beabsichtigten Handlungen sowie in der Konsequenzbeurteilung von beabsichtigten Handlungen zu untersuchen. Bekannt geworden sind hierzu die Befragungsmethoden von PIAGET (1973) zum moralischen Urteil. PIAGET’s Ergebnis zeigte, dass bei der Einschätzung von moralischen Dilemmata Kinder bis zu 8 Jahren einer Handlung nur von deren Ergebnis abhängig machen, während ältere Kinder die Absichtlichkeit des Verhaltens beurteilen. Hierbei handelt es sich um Schlussfolgerungen darüber, was der andere bewusst oder unbewusst zu tun versucht. Die Fähigkeit zur Unterscheidung beabsichtigter und unbeabsichtigter Ereignisse und die Fähigkeit zur Unterscheidung von Typen solcher Aktionen unterliegen der Entwicklung. In einer Untersuchung von KING (1971) in der die Verantwortlichkeit für Konsequenzen und die Konsequenzen selbst klarer variiert wurden als bei PIAGET, zeigte sich ein signifikantes Ansteigen der Urteilsbegründungen durch die Absicht vom Vorschulalter (4 Jahre) bis zum Alter (6 Jahre), wobei die Fünfjährigen eher die Absicht in Rechnung stellen. Ob negative Konsequenzen entstanden waren oder nicht, hatte bei einer Altersgruppe keinen bedeutsamen Effekt auf die Korrektheit des Erschliessens der Absicht. ARMSBY (1971) (in: CROISSIER ET AL. 1979) findet ebenfalls, dass die Mehrheit der Sechsjährigen die Absicht als Basis benutzen, um über die Frechheit des Handelns des Handelnden zu entscheiden. Welche Urteile geben Kinder, wenn ihnen Geschichten gegeben werden, bei denen alle Aktionen beabsichtigt sind und die Absichten und Konsequenzen entweder gut oder schlecht sind? COSTANZO ET AL. (1973) benutzte so eine Aufgabe für Jungen von 6, 8 und 10 Jahren. Kindergarten-Jungen änderten die Beurteilung nicht nach guter oder schlechter Absicht, wenn die Konsequenzen schlecht waren. Wenn sie aber gut waren, sahen sogar die Kindergartenkinder das Kind mit schlechten Absichten als schlechter an das das, welches mit guten Absichten handelte. Die Art der Konsequenz war für ältere Kinder weniger relevant. Das bedeutet, dass Kinder von sechs Jahren durchaus gute und schlechte Absichten unterscheiden, wenn die Konsequenzen positiv sind, anscheinend aber nicht, wenn sie negativ sind. Bei solchen Untersuchungen scheint auch das Medium (Geschichte oder Bildwidergabe) von Bedeutung zu sein. Andere Untersuchungen von SHANTZ (1975) belegen aber auch, dass der Kontext der Fragestellung nie unberücksichtigt bleiben darf, denn je extremer die Konsequenzen einer Handlung (z. B. Körperverletzung) desto mehr tritt die Unterscheidung von Absicht und Ergebnis in den Hintergrund, zugunsten der Variable ‚Ergebnis‘. 6. Was ist der Andere für eine Person? Nach DUBIN & DUBIN (1965) entwickelt sich die soziale Wahrnehmung in der Reihenfolge: Selbst – Rollen der Eltern – andere Autoritätsperson, wobei in der Wahrnehmung des Selbst bereits zwischen den drei und fünf Jahren geschlechtsrollenspezifische Unterschiede wahrgenommen und bewertet werden. Ähnlich verhält es sich mit der Diskriminationsfähigkeit der Rollen der Eltern. Erst mit sieben- achtjährigen Kindern konnten LIVESLEY & BRAMLEA (1973) die Unterscheidung von lediglich äusserer Beschreibung und psychischen Merkmalen feststellen. 35 7. Was ist das für eine Situation? FLAPA (1968) bot 6, 9 und 12 Jahre alten Kindern Filmszenen an, in denen kurz Alltagskonflikte von Kindern dargestellt waren. Sie liess deren Handlung nacherzählen und stellte danach gezielte Fragen nach den Gefühlen, die auf unterschiedlichen Abstraktionsstufen geordnet werden konnten: - Bericht und Beschreibung des Geschehens (6 – 9 Jahre) - Erklärung des Geschehens - Schlussfolgerung und Interpretation (9 – 12 Jahre). Zu dieser Untersuchung muss kritisch angemerkt werden, dass insbesondere die Abhängigkeit von sprachlichen und intellektuellen Fähigkeiten nicht exakt klar werden lässt, was die Kinder von den Situationen wirklich erfasst haben? Zur Diskussion steht nun die Generalisierbarkeit verschiedener Typen von sozialer Kognition. PIAGET selbst hat zwar eine den verschiedenen Verhaltensformen zugrunde liegende kognitive Orientierung, den Egozentrismus, postuliert, niemals ist aber einer Gruppe von Kindern eine Vielzahl von Aufgaben gegeben worden, so dass eine Korrelation zwischen den verschiedenen Massen hätte errechnet werden können. RUBIN (1973) untersuchte diese Frage, indem er 80 Kinder vom Kindergartenalter bis zum 6. Schuljahr mit einer Batterie von Tests zur Fertigkeit der Rollenübernahme testete. Drei dieser Tests (räumliches, kommunikatives Rollenübernehmen und rekursives Denken) korrelieren untereinander mit .65 bis .73. Auch VAN LIESHOUT ET AL. (1973) kommen zu dem Ergebnis, dass verschiedene Aspekte der Fähigkeit zur Rollenübernahme auf ein zugrundeliegendes Konstrukt zurückgeführt werden können, wobei die Korrelation aber nur zwischen .20 und .48 liegen. Die Studien zeigen, dass bestenfalls ein mittlerer Zusammenhang besteht. Ein weiterer häufig vorgenommener Ansatz ist der Versuch, die Beziehung zwischen Intelligenz und Rollenübernahme-Fertigkeiten zu untersuchen. I.d.R. sind die Korrelationen niedrig, im Rahmen von .20 bis .40. Selbst wenn die sozial-kognitiven Fertigkeiten in stärkerem Ausmass mit Intelligenz verbunden wären, würde diese Beziehung nicht viel weiterhelfen in der Klärung, welche Prozesse an der sozialen Kognition beteiligt sind. Einige spezifische kognitive Fertigkeiten sind mit der Fertigkeit zur Rollenübernahme in Verbindung gebracht worden. So findet RUBIN (1973), dass die Leistung bei Konservations-Experimenten hoch mit der Fähigkeit zur Rollenübernahme korreliert, tatsächlich genauso hoch, wie die verschiedenen Masse untereinander zusammen hängen. Allerdings berichtete HOLLOS (1975) über nur geringe Zusammenhänge zwischen Rollenübernahme und logischen Operationen dieser Art bei norwegischen Kindern von 6 bis 9 Jahren. Es ist nicht klar, welche logischen Fertigkeiten an den sozial-kognitiven Fertigkeiten beteiligt sind. Hier fehlt es noch an Forschung. Was nun den Zusammenhang von Peer-Interaktionen und sozialen Kognitionen anbelangt, fasst HARTUP (1970) zusammen: Es gibt keinen Zweifel, dass Änderungen in den Peer-Interaktionen in der Kinderzeit eng verbunden sind mit den sensomotorischen Kapazitäten, den kognitiven Fertigkeiten und der Entwicklung der Impulskontrolle. Rollenübernahme scheint eine Voraussetzung für viele soziale Verhaltensweisen zu sein, wie z. B. die Kooperation und altruistische Interaktion. In einer Reihe von Arbeiten ist behauptet worden, dass Kooperation, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Grosszügigkeit von der Fähigkeit des Kindes abhängen, die Rollen des Anderen zu übernehmen. Zum zwei36 ten ist vorgeschlagen worden, dass bestimmte antisoziale Verhaltensweisen wie Peer-Aggressionen durch die Übernahme der Rolle des Opfers gehemmt werden könnten (FESHBACH & FESHBACH 1969). Neben diesen pro- und antisozialen Verhaltensweisen sind noch Konformität und Popularität in Zusammenhang zur Rollenübernahme gebracht worden. Die Beziehung zwischen Rollenübernahme und Sozialverhalten kommt direkt aus der Theorie von PIAGET, wobei es sich um eine bidirektionale Beziehung handelt. Einmal nimmt der Egozentrismus ab, als Resultat der Interaktion mit Peers, die anderen Wünsche, Bedürfnisse und Gedanken haben. So ist Peer-Konflikt eine notwendige Bedingung dafür, dass sich die Fähigkeit zur Rollenübernahme entwickelt. Andererseits ist die Fähigkeit zur Rollenübernahme wiederum Voraussetzung für reziprokes Sozialverhalten wie Kooperation, Diskussion und Planung. In Korrelationsstudien findet RUBIN (1973) bei 7 Jahre alten Kindern mittlere Zusammenhänge zwischen der Fähigkeit zur Rollenübernahme und Massen für Altruismus und Grosszügigkeit. Jene nehmen mit dem Alter zu. Von CERESNY (1971) ist die Beziehung zwischen Rollenübernahme und kooperatives Verhalten untersucht worden. Er konnte keinen Zusammenhang finden. FESHBACH & FESHBACH (1969) finden, dass hohe Empathie zusammenhängt mit mehr Aggressionen bei 4 bis 5jährigen Jungen und für Mädchen beiden Alters unbedeutend ist. CHANDLER (1973) findet, dass chronisch delinquente Jugendliche von 11 bis 13 Jahren bedeutsame Defizite in der Fähigkeit zur Rollenübernahme haben im Vergleich zu nicht-delinquenten Jugendlichen. Einige Studien haben versucht, die Fähigkeit zur Rollenübernahme zu trainieren, um die Effekte auf das Sozialverhalten zu beobachten. STAUB (1975) untergliederte Kindergartenkinder in vier Trainingsbedingungen: Rollenspiel im Helfen und Sich-Helfen-Lassen; Induktionstraining, das sich auf das Aufzeigen von Konsequenzen des Verhaltens richtet; kombiniertes Rollenspiel und Induktionstraining; Kontrollgruppe. Er fand, dass bei Mädchen, die nur Rollenspiel trainierten, am häufigsten eine Steigerung der Hilfsbereitschaft auftrat, während für Jungen die Kombination Rollenspiel und Induktion am effektivsten war. Das Teilen-Können bei Mädchen wurde von keiner Bedingung beeinflusst, war aber Jungen in der Rollenspiel- und in der Induktionsgruppe signifikant erhöht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rollenspiel den konsistenten Effekt bei der Erhöhung der Hilfsbereitschaft von Mädchen und beim Teilen-Können bei Jungen hat. Die Effekte des Rollenspiels auf antisoziales Verhalten untersuchte CHANDLER (1973). Nach einem 10 Wochen dauerndem Training mit delinquenten Jugendlichen (Placebo- und Kontrollgruppe) wurde Rollenübernahme getestet, und nach 18 Monaten die Polizeimeldungen verglichen. Zum ersten Zeitpunkt zeigten die trainierten Gruppen signifikante Zunahmen in der Fähigkeit zur Rollenübernahme. Sie verübten anschliessend etwas halb so viele Verbrechen wie die Kontrollgruppen. In einigen Studien sind Fertigkeiten zur Rollenübernahme selbst Gegenstand gewesen. VAN LIESHOUT ET AL. (1973) liessen Kinder die Gefühle von anderen in Geschichten und Puppenspielen diskutieren, machten Rollenspiele, forderten und ermunterten sie zu hilfreichem Verhalten. Die derart trainierten Kinder zeigten mehr Fähigkeit zur Rollenübernahme als eine Kontrollgruppe von 3- bis 4jährigen Kindern. Dieses Ergebnis fand sich bei 5jährigen nicht mehr. Es mag sich dabei auch um trainingsspezifische Wirkungen gehandelt haben, da Trainings- und Testaufgaben ähnlich waren. Drei Studien haben versucht, die Fähigkeit des Kindes, die Rolle des Zuhörers in Kommunikation zu übernehmen, zu verbessern. Kinder kommunizierten über Zeichnungen und diskutierten die angemessenen Aussagen vom Standpunkt der Zuhörer. Zwei Studien zeigten geringe Änderungen, eine jedoch bedeutsame und generalisierte Effekte. Diese Reihe von Studien zeigt, welche Faktoren aus37 reichend sind, um eine Entwicklung der Rollenübernahme zu beschleunigen, nicht aber, welche Mindesterfahrungen dazu nötig sind. Elterlicher Erziehungsstil ist von mehreren Autoren mit moralischer Entwicklung in Verbindung gebracht worden. HOFFMANN (1977) vermutet, dass elterliche Induktion und die Fähigkeit zur Rollenübernahme miteinander verbunden sind. HOLLOS (1973) überprüfte Rollenübernahme und logische Fertigkeiten in drei verschiedenen Umgebungen im ländlichen Norwegen: Bauernhof, Gemeinde, Stadt. Die Leistungen von 7- bis 9jährigen Kindern zeigten zwei Faktoren: logische Operationen, die eng mit dem Alter verbunden waren, und Rollenübernahme, mit der nur die Umgebung zusammenhängt. Die Kinder auf dem Bauernhof hatten weniger Fähigkeiten zur Rollenübernahme als Kinder aus dem Dorf oder der Stadt. Das spricht für die Annahme, dass ein Mindestmass an alltäglicher verbaler Interaktion für die Rollenübernahmefähigkeit Voraussetzung ist. In eine ähnliche Richtung zeigt die Untersuchung von RUBIN ET AL. (1973). Sie finden weniger Rollenübernahme bei nachgeborenen Kindern, mehr bei erstgeborenen und bei Einzelkindern, was gegen einen direkten Effekt der Geschwisterposition spricht. Weiter spricht vieles dafür, dass für die Rollenübernahme die Gelegenheit, verschiedene Rollen zu übernehmen, wichtig ist, oder die Gelegenheit, von ihren Eltern verdeckte Vorgänge bei andern benannt zu erhalten. Der Zusammenhang zur linguistischen Umgebung müsste aber noch weiter untersucht werden. Die im folgenden aufgeführten Autoren, insbesondere SEILER mit seinem Konzept der ‚kognitiven Struktur‘, berücksichtigen in ihren Ausführungen zwar auch kognitive Prozesse auf der Basis von PIAGET, aber sie entwickeln sie weiter zum Konzept der genetischen Kognitionstheorie, der genetischen Strukturiertheit, dies unter Berücksichtigung von handlungstheoretischen Überlegungen. 38 8. Das Konzept der ‚kognitiven Strukturen‘ SEILER (1973) versteht unter kognitiven Strukturen „alternative Kategorisierungs-, Problemlösungsund Verhaltensprogramme, über die der Organismus in gewissen Grenzen und je nach Situation beliebig verfügen kann“ (SEILER 1973, 9/10). Die Verwendung des Begriffs ‚Programm‘ verweist stark auf die Nähe zu PIAGET’s Schemata sowie auf die Pläne von MILLER, GALANTER und PRIBRAM (1973). Diese Programme, Schemata oder Pläne verweisen auf eine gewisse Einheit des verbalen und äusseren Verhaltens über eine bestimmte Zeit, über einzelne Objekte, Handlungen, Situationen und Individuen. Aus dieser angenommenen Einheit ergibt sich die Folgerung, dass sich bei einer Reihe von Individuen in ähnlich gelagerten Situationen, bei Vorliegen ähnlicher Objekte ähnliche Verhaltenssysteme erkennen lassen. Diese Einheit ist demnach eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren sozialer Interaktion. Die Entstehen kognitiver Strukturen kann als eine Verinnerlichung senso-motorischer Handlungssysteme verstanden werden, die durch eine zunehmende Verselbständigung und Ökonomisierung des Lernprozesses gekennzeichnet sind. Dieser auch als Integrations- oder Differenzierungprozess beschriebene Vorgang wird durch das Gefälle zwischen den zu verarbeitenden Gegenständen, Situationen einerseits und den dem Individuum zur Zeit zur Verfügung stehenden Schemata, Pläne, Programme andererseits in Gang gehalten. „…das Individuum entwickelt zur Lösung der in der sozialen Interaktion sich stellenden Probleme besser geeignete Systeme (SEILER 1973, 12). Kognitive Strukturen sind nur begrenzt aufnahmefähig und müssen deshalb die anfallenden Informationen sowohl selektieren als auch in eine gewisse Ordnung bringen. Für SEILER ist die Prämisse grundlegend, „dass kognitive Strukturen sowohl Handeln wie Wahrnehmen als insbesondere auch Urteilen und Denken eines Individuums bestimmen: sie steuern seine Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung, sie bringen selegierend und klassifizierend Ordnung in das Reizangebot und sind Fundament und Kontrollinstanz für motivationale und affektive Impulse“ (ders., 27). Kognitive Strukturen stellen demnach ein Sammelbegriff dar. Unter kognitiver Struktur kann man deshalb folgendes verstehen: - Komplexe Wahrnehmungsvorgänge - Problemlösungen auf der Handlungsebene - Vorstellen, Begriffe und gedankliche Operationen - Hypothesen, Strategien des gedanklichen Problemlösens - Begriffsbildung etc. Was ist diesen Konstrukten nun gemeinsam? „In einem ersten Umschreibungsversuch könnten kognitive Strukturen generell als alternative Kategorisierung-, Problemlösungs- und von innen gesteuerte Verhaltensprogramme bezeichnet werden, über die der Organismus in gewissen Grenzen und je nach Situation beliebig verfügen kann“ (SEILER 1979, 27). Die Problemlösungsmuster sind weder genetisch angelegt, noch unveränderlich. Sie sind vielmehr das Ergebnis der vergangenen Tätigkeits- und Entwicklungsgeschichte des Individuums. Allgemein ausgedrückt lässt sich sagen, dass kognitive Strukturen das Mittel darstellen, mit dem ein Organismus eine Umwelt bewältigt. Kognitive Strukturen weisen darauf hin, dass der Organismus nicht auf eine von seinen Handlungsmustern unabhängige und als solche objektiv gegebene Reizsituation reagiert, sondern nur durch seine von ihm herge39 stellten Konstruktionen der Auseinandersetzung und Anpassung an physische und soziale Gegebenheiten der Umwelt. Die senso-motorischen Verhaltensschemata, mit denen sich kleine Kinder mit ihrer Umwelt auseinandersetzen, entstehen durch Veränderung und Erweiterung angelegter, reflektorischer Reaktionsmuster und ihre gegenseitige Verbindung zu integrierten Systemen. Diese sensomotorischen Schemata, mit denen das Individuum bestimmte Gegenstände und Situationen abbildet, werden im Laufe der Zeit ökonomisiert und verinnerlicht. Aufgrund dieser Prozesse entstehen kognitive Strukturen, die Menschen durch Vorstellungen, Begriffe, Gedanken, Überlegungen und Willensakte aktivieren können. Damit wird klar, dass menschliches Handeln und Erkennen durch Programme vollzogen wird, die das Individuum selber entwickelt und gespeichert hat. SEILER definiert nun den Begriff ‚kognitive Struktur‘ exakter als relativ überdauernde, in sich geschlossene und interferenzresistente Tätigkeits- oder Reaktionsmuster eines Organismus, die seiner erkennenden Umweltbewältigung dienen und die selber durch Differenzierung und Integration schon vorhandener Strukturen entwickelt wurden und von ihm je nach Bedarf aktiviert werden können. Für SEILER ist die wichtigste und grundlegendste Eigenschaft kognitiver Strukturen ihre Erkenntnisfunktion. Dies trifft auch auf einfachste Verhaltensschemata senso-motorischer Art zu, denn jede Struktur weist ihren eigenen Erkenntnisgehalt auf. In jedem Begriff und in jeder Vorstellung sind verinnerlichte Wahrnehmungs- und Handlungsschemata zu einem mehr oder weniger durchstrukturierten Komplex zusammengefasst. Deshalb sind auch in jeder Struktur all die Erfahrungen verdichtet, die das Individuum mit ähnlichen Gegenständen und in ähnlichen Situationen bereits gemacht hat. Diese Erfahrungswerte werden in neue Situationen integriert. Das bedeutet, dass nur die Eigenschaften und Beziehungen der Dinge erkannt werden können, für die bereits entsprechende Strukturen zur Verfügung stehen und durch einen ad hoc vollzogenen Differenzierungs- und Integrationsprozess bereit gestellt werden können. In Bezug auf das Nachahmen kommt SEILER zu dem Schluss, dass ein Kind nur das nachahmen kann, was es bereits in Grundzügen beherrscht. Nachahmung in diesem Sinn ist kein Lernprozess, sondern Situation, in der gelernt wird. Darauf wird noch zurückzukommen sein. Mit der Erkenntnisfunktion kognitiver Strukturen eng gekoppelt ist die Bedeutungsfunktion. Je nachdem, welche Ebene zum Gegenstand der Analyse gemacht wird, sind kognitive Strukturen unterschiedliche Bedeutungsrelationen zuzuschreiben. Der Begriff ‚kognitiv‘ impliziert, dass ein Individuum die Wirklichkeit erkennt, indem es sie in seinen senso-motorischen Handlungsschemata und in seinen neuralen Strukturen ausschnittweise rekonstruiert und abbildet und damit den Ergebnissen Bedeutung verleiht, sie seinen Handlungszielen unterordnet und damit erfahrene Dinge zueinander in Beziehung setzt. All das stellt bewusste Vorgänge dar, aber nicht nur allein. SEILER bezeichnet kognitive Strukturen erst als bewusst, wenn sie in ihrem Vollzug selber wieder von anderen neben- oder übergeordneten Strukturen erfasst und abgebildet werden. Bewusstsein setzt in diesem Sinn immer eine Verdoppelung voraus. Keine Erkenntnisstruktur kann für sich allein stehen. Jede von diesen ist eingeordnet in den komplexen Vollzug einer Vielzahl solcher Strukturen oder Tätigkeiten des Subjekts im Umgang mit den Dingen, Situationen und Personen der Umwelt. Der Begriff der Struktur ist dem des Systems gleichzusetzen. Wie das System besitzt auch die Struktur die Eigenschaft der Geschlossenheit, wobei der Grad der Geschlossenheit, der einem System oder einer Struktur zukommt, formal gesehen, von den Beziehungen zwischen den Elementen und dynamisch betrachtet, von den Gesetzen, die das Zusammenspiel der Elemente untereinander regeln, abhängt. Genetisch gesehen, ist der Systemcharakter kognitiver Strukturen sowohl das Ergebnis der Ökonomisierung und Schema40 tisierung situationsbezogener Informationsverarbeitungsprozesse als auch ihrer gleichzeitigen Verfestigung. Die Menge der Elemente und die Menge der Relationen zwischen diesen Elementen bezeichnet SEILER als den Inhalt einer Struktur. Kognitive Strukturen sind dynamische Vorgänge: Handlungen, Wahrnehmungen, Tätigkeiten, Vorstellungen, Klassifikationen, Denkoperationen werden darunter gefasst. Die Begriffe von Handlung und Operation bringen den prozesshaften Charakter von Schemata bzw. Strukturen zum Ausdruck. Nach SEILER hat man kognitive Strukturen auch als komplexe Kontrollsysteme zu verstehen, bei denen zahlreiche einzelne sensorische und/oder motorische Akte ineinander greifen und sich gegenseitig beeinflussen und steuern. Kognitive Struktur bedeutet keineswegs ein bloss rationales Gebilde, sie ist gleichzeitig und immer ein dynamisches das Handeln des menschlichen Subjektes bestimmendes und dieses Handeln affektiv oder emotional qualifizierendes Gebilde. Motivation stellt somit nur einen anderen Aspekt der das Handeln und Erkennen strukturierenden Einheiten dar. Jeder kognitiven Struktur ist demnach auch eine bestimmte emotionale Qualität eigen. Diese hängt von der je spezifischen Situation ab, und färbt auf das Wahrgenommene und das Tun ab (Kontiguität). Mit der Annahme kognitiver Strukturen ist ebenso eine vielfache Generalitätsbehauptung verbunden. Man nimmt an, dass sich eine bestimmte Wahrnehmung, Handlung, ein Verhalten in derselben oder in einer ähnlichen Weise zu verschiedenen Zeitpunkten wiederholen kann, dass derselbe Aspekt bei einer Vielzahl von Gegenständen durch die betreffende Struktur herausgehoben wird und dass schliesslich, die der Struktur entsprechende Handlung oder Operation in verschiedenen Situationen in derselben Weise vollzogen werden kann. Insbesondere wo es sich um innere Strukturen, Vorstellungen, Begriffe, Regeln und Operationssysteme handelt, ist man, um Generalisationsprozesse zu erfassen, immer auf bruchstückhaft erfolgende Mitteilungen innerer Erfahrungen und die Interpretation damit zusammenfallender Handlungen eines Individuums angewiesen. HARVEY, SCHRODER & HUNT, 1961, nach: SEILER 1973) unterteilen den Strukturiertheitsgrad kognitiver Systeme in 4 Stufen: 1. Stufe: niedrige Strukturiertheit Ist gekennzeichnet durch: 41 - Geringe Differenziertheit - Geringe Diskriminiertheit - Fast vollständiges Fehlen einer Integration der vorhandenen Begriffe, Vorstellungen, Einstellungen und Bedürfnisse - Begriffe, Einstellungen und Motive werden absolut und isoliert verwendet, ohne Bezug zueinander - Tendenz zur Übergeneralisierung - Neigung zu stereotypen Urteilen - Bevorzugung von abgekapselten, nicht zueinander in Bezug gesetzten und daher oft widersprüchlichen Aussagen mit einem Absolutheitsanspruch - Fehlen von begrifflichen Abgrenzungen und Unterscheidungen - Unfähigkeit, Situationen in verschiedene Art und Weise zu interpretieren - Neigung zum Dichotomisieren, Kategorisieren - Verhalten und Urteile werden oft in äusseren Bedingungen verankert (Aussensteuerung) Die Interpretation von SEILER (1973), dass im Denkenden und Urteilenden selber kaum ein Konflikt auftritt, möchten wir bezweifeln. Erlebt das Individuum doch auch die Reaktionen seiner Umwelt, die auf seine niedrig strukturierte Persönlichkeit reagiert. Nur, welche Schlüsse es daraus zieht, das ist der Unterschied und damit auch das Problem. 2. Stufe: zunehmende Strukturiertheit - auf der ersten Phase der Auflockerung der rigiden Strukturen sind die Urteilskategorien noch sehr extrem und dualistisch, aber sie werden miteinander in Beziehung gesetzt - Konflikte tun sich auf - Konflikte führen zu vorwiegend oppositionellen und negativistischen Haltungen - das Individuum schwankt zwischen Polen - es folgt eine Abkehr von aussengeleiteten Positionen - weil das Individuum fähig ist, alternative Positionen zu erzeugen, bevorzugt es sie auch. 3. Stufe: weiter zunehmende Strukturiertheit - die Anzahl der Alternativen vermehrt sich - die Alternativen verlieren ihren extremen und deterministischen Charakter, sie beginnen sich gegenseitig zu ergänzen - subtilere Unterscheidungen werden möglich, die miteinander verglichen und gegeneinander abgewogen werden - wenn sich ein Individuum für eine Situation entscheidet, bleibt es dennoch offen für andere. 4. Stufe: hoher Grad der Strukturiertheit - 42 das Individuum besitzt ein reich bestücktes Arsenal von fein abgestuften Urteilsdimensionen, die zu einem durchstrukturierten Netz verknüpft sind - das Individuum verfügt über eine Menge von Regeln, die angeben unter welchen Bedingun gen diese oder jene Dimension aktualisiert wird - das Individuum handelt von innen heraus, aber nicht von einer Gegenposition aus, sondern weil sein Urteil auf dem aktiven Vergleich einer grossen zahl selbst erarbeiteter Kategorien beruht - vor ein Problem gestellt, probiert es systematisch alle Mittel und Wege aus, die ihm zur Ver fügung stehen, oder die es neu auszuarbeiten vermag - wichtigste Quelle der Belohnung ist nicht die äussere Belohnung, sondern die mit dem inne ren Spiel seiner kognitiven Möglichkeit verbundene Befriedigung - das Individuum wirkt sachorientiert - es besitzt hohe Ambiguitätstoleranz - es besitzt hohe Rollendistanz. Die Bereichsspezifität kognitiver Strukturen weist auf die unterschiedliche Entwicklung des Strukturiertheitsgrades innerhalb einer Person hin. So ist es möglich, dass ein Individuum in rein wissenschaftlichen Fragen hochdifferenziert und integriert sein kann, in sozialen Situationen aber nur über sehr wenige und unkoordinierte Strukturen verfügt. Der Strukturiertheitsgrad, den ein Individuum aufweist, kann weiter nicht als für immer feststehende Grösse verstanden werden. Auch er ist einer grossen Zahl von situativen Faktoren unterworfen. So kann sich z. B. eine hochstrukturierte Person in einer komplexen Situation, die normalerweise kaum Schwierigkeiten bereitet, unter extremen, äusseren Druck, zu groben "Vereinfachungen" hinreissen lassen. HARVEY, HUNT & SCHRODER (1961, in: SEILER 1973) unterscheiden drei Arten von situativen Faktoren, die sich auf das aktuelle Niveau der Informationsverarbeitung auswirken: - Menge und Komplexität der anfallenden Information - der belohnende und/oder bedrohende Charakter der anfallenden Information - konkrete, von der Umwelt ausgehende Anforderungen. Alle diese Faktoren können sich sowohl hemmend wie aber auch steigernd auf den Strukturiertheitsgrad auswirken. Es besteht eine kurvenförmige (= umgekehrte U-Kurve) Beziehung zwischen Strukturiertheitsgrad und den situativen Faktoren. Nun muss aber nicht immer ein hochstrukturiertes begriffliches System am effektivsten sein. Dies hängt viel mehr von der Art der erwarteten Effektivität und dem Charakter der gestellten Aufgabe ab. So ist in relativ einfachen Aufgaben, die über lange Zeit konstant durchgehalten werden müssen und keine überraschenden Momente bringen, eine im betreffenden Anforderungsbereich weniger hochstrukturierte Person im Vorteil, da sie schneller handelt und rascher entscheidet. Handelt es sich aber um eine Aufgabe mit komplexen Charakter, ist es wahrscheinlicht, dass hochstrukturierte Personen besser abschneiden, weil sie kreativer sind, mehr Informationen verarbeiten, mehr Gegebenheiten (gleichzeitig) berücksichtigen können, mehr Perspektiven erzeugen etc. Wie bereits angedeutet, setzen die Autoren Kreativität mit hoher Strukturiertheit des kognitiven Systems gleich. Was nun bei der Be43 reichsspezifität der kognitiven Struktur gesagt wurde, wollen die Autoren demnach auch auf Kreativität übertragen wissen. Eine weitere Folgerung besteht in der Annahme, dass keine direkte Relation zwischen Strukturiertheitsgrad und IQ besteht. Weiter vertreten die Autoren die Ansicht, dass ein Individuum, das mit Sozialisationstechniken konfrontiert wurde, die formale Regeln und äussere Verhaltensmässstäbe überbewerteten und dem Kind kaum Spielräume für persönliche Entscheidungen liessen, ihm dadurch die Möglichkeit verbauten, Alternativen auszuprobieren bzw. differenzierte und integrierte kognitive Strukturen aus- bzw. aufzubauen. Die Autoren bewerten ein Erzieherverhalten höher, das zwar inhaltliche Aspekte und die Vermittlung begrifflicher Kategorien nicht vernachlässigt aber doch stark Neugierverhalten fördert, das Kind anleitet, viele Wahrnehmungen zu machen, um zahlreiche Aspekte einer Situation zu erfassen. Fassen wir das Konzept der 'kognitiven Strukturen' zusammen: 1. Der Bildungsprozess kognitiver Strukturen ist nie abgeschlossen. Je mehr Begriffe entwickelt werden, umso mehr neue sind möglich, denn umso mehr Problemsituationen kann sich ein Individuum schaffen. 2. Das Subjekt schafft die Erkenntnismittel nicht aus sich selbst heraus, sondern in der tätigen Auseinandersetzung mit der Umwelt. 3. Der Aufbau kognitiver Strukturen kann gleichzeitig als ein Konflikt- oder Problemlösungsprozess aufgefasst werden. Strukturinterne Wahrnehmungsprozesse melden quasi in einer Feedback-Schleife Annäherungen an Zielvorstellungen in Verbindung mit starken emotionalen Begleiterscheinungen. 4. Erkenntnisfortschritte und Lernen sind nur in dem Masse möglich, wie das Individuum schon über entsprechende Verhaltensmöglichkeiten oder begriffliche Kategorien verfügt, die mit den gesteckten Lern- oder Erkenntniszielen vereinbar sind. 5. Obwohl Nachahmung nur in dem Bereich möglich ist, in dem das Individuum bereits Grundlagen erworben hat, kommt ihr doch in der kognitiven Entwicklung besondere Bedeutung zu. Dies hängt damit zusammen, dass sich kognitive Entwicklung nur in sozialen Austauschprozessen vollziehen und das Individuum übergeordnete Steuerungsstrategien zur systematischen Imitation von Modellverhalten entwickeln kann. 6. Der Differenzierungs- und Integrationsprozess zeigt sich als Generalisierungsprozess sensomotorischer Verhaltensweisen und begrifflicher Strukturen sowie im Transfer und in der Anwendung gelernter Verhaltensweisen und Begriffe auf neue Situationen. 7. Entscheidend ist, dass Individuen über die Möglichkeit verfügen, im Laufe der fortschreitenden Entwicklung übergeordnete Struktursysteme, auch: Strategien, herauszubilden, mit denen es wiederum den Aufbau neuer Strukturen mehr oder weniger zu steuern vermag. Wie bereits erwähnt, muss ein Individuum in der Lage sein, kognitive Strukturen zu verdoppeln, d.h. sie durch andere bei- oder übergeordnete begriffliche Struktursysteme abzubilden, und das umso mehr, je mehr begriffliche Strukturen es entwickelt hat. Das Subjekt muss sich selbst wahrnehmen, und 44 indem es lernt, gewisse allgemeine, sich stets wiederholende Charakteristika dieses Prozesses herauszuheben, lernt es zu lernen! Auf diese Weise wird es möglich, dass höhere Formen menschlichen Lernens, Begriffsbildungen und Problemlösungen wenigstens teilweise einen bewussten Vorgang darstellen. 8. Das Individuum vermag auch, bestimmte sich wiederholende grundlegende gesetzmässige Beziehungen zu erfassen, die es als Soll- oder Kontrollbedingungen auf zu bildende Struktursysteme übertragen kann. Doch ist daraus kein System einer strengen Logik des Denkens abzuleiten. 8.1 Das Konzept der 'kognitiven Strukturen' im handlungsleitenden Zusammenhang Da die Frage, ob kognitive Einschätzungen von Situationen und Handlungen entscheidend sowohl für die Auswahl von Verhaltensstrategien wie für emotionale Reaktionen sind, geht es darum, abzuklären, ob Kognitionen auch an der aktuellen Ausführung bzw. an der Erweiterung des Handlungsrepertoires beteiligt sind? Hier lässt sich auf BANDURA (1969) verweisen, in dessen Theorie des Modelllernens kognitive Repräsentationen des Gelernten das entsprechende Verhalten in einer späteren Situation steuern. Untersuchungen zum mentalen Training im Sport (DAEUMLING u.a. 1973) sind beim Anlernen sensomotorischer Arbeitsaufgaben (ROHNERT, RUTENFRANZ & ULICH 1971) sowie die Untersuchungen von MEICHENBAUM (1975) sind weitere deutliche Beweise für die Rolle von Kognitionen in der Steuerung des Handelns. In diesem Zusammenhang soll auch erwähnt werden, dass unter Angst irrelevante Kognitionen produziert werden, die sich ebenfalls auf den Handlungsverlauf auswirken (vgl. HAMILTON 1975; SARASON 1975). Die angeführten Untersuchungen werfen die Frage auf, unter welchen Umständen Kognitionen handlungsregulierend wirken? Um diese Frage zu klären, schlagen SEMMER & FRESE (1979) vor, näher auf den Bereich des sensumotorischen Lernens einzugehen, dessen Grundlegung bereits von MILLER, GALANTER & Pribram (1960/1973) geleistet wurde. Das zentrale Thema dieser handlungsorientierten Verhaltenswissenschaftler „ist die hierarchisch-sequentielle Regulierung von Handlungen durch innere Abbilder auf der Basis von selbstgenerierten oder von aussen vorgegebenen Zielen“ (SEMMER & FRESE, in: HOFFMANN 1979, 125). Diese Abbilder haben umfassenden Charakter; sie schliessen die relevanten Umweltbedingungen, den Konsequenzen ein. Damit ist ein enger Zusammenhang zwischen der Qualität dieser Abbilder und der Qualität des Handelns gegeben. Die inneren Abbilder enthalten, da sie Handlungen zu steuern vermögen, diese Handlungen in antizipatorischer Art und Weise. In einem Feedback-Prozess muss das innere Modell laufend mit den Handlungsweisen verglichen werden, und umgekehrt (vgl. auch Test-OperateTest-Exit bei MILLER, GALANTER & Pribram, 1970). Dieser Feedback-Prozess ist nun in der Handlungstheorie von entscheidender Bedeutung: efferenter Impuls, reafferentes Feedback und erneuter efferenter Korrekturimpuls müssen dabei zeitlich nahtlos ineinander verschleifen, um eine flüssige Handlung zu gewährleisten. HACKER (1973) spricht in diesem Zusammenhang von „Vergleichs-Veränderungs-Rückkopplungs-Einheit“ (VVR). Nach HACKER sind diese VVR-Einheiten hierarchisch miteinander verschachtelt, wobei die höheren Kontroll- und Überwachungsfunktionen haben, resp. Diese auch in Gang setzen können. VOLPERT (1973) bezeichnet eine Einheit höherer Ordnung als Handlungs-Superzeichen. Unter einem Globalzeichen versteht VOLPERT (1973) 45 hingegen den Vorgang, dass eine allgemein Kognition nicht mit einer Handlung verbunden wird. Ziel einer Therapie ist es demnach nach handlungstheoretischen Überlegungen, dass Globalzeichen durch Superzeichen ersetzt werden. Gehen wir noch einmal auf die verschiedenen Regulationsebenen ein. HACKER (1973) unterscheidet drei Ebenen: 1. Sensumotorische Regulationsebene Als unterste Ebene der kognitiven Regulation ist sie für gleichbleibende, stereotype Bewegungsfolgen verantwortlich, die hochautomatisiert und ohne Beteiligung des Bewusstseins ablaufen. 2. Perzeptiv-begriffliche Regulationsebene Diese Ebene steuert allgemein Handlungsmuster, die in ihrer Struktur relativ gleichbleibend sind und je nach Situation flexibel eingesetzt werden können. 3. Intellektuelle Regulationsebene Diese Ebene umfasst die komplexe Analyse von Situationen. Die Analyse unerwarteter, unbekannter Störungen wird von dieser Ebene gesteuert. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, muss hier angesiedelt werden. Diese drei Stufen nach HACKER (1973), die sich mehr auf die inneren Abbildungen beziehen, müssen noch durch Erläuterungen, die das Handeln thematisieren, ergänzt werden. Für VOLPERT (1974) ist sinnvolles Handeln von einer sachlichen und zeitlichen Effizienz her zu begreifen. VOLPERT erklärt realistisches Handeln an zwei Negativ-Beispielen: Pläne sind unrealistisch, wenn sie fehlentwickelt, isoliert sind. Solche Pläne enthalten Teile, die vom Individuum nicht zu realisieren sind, resp. In ihrer Zeitvorstellung unrealistisch sind. Unterentwickelte Pläne dagegen kommen überhaupt nicht zur Entfaltung, sie ermöglichen lediglich, zielloses, wirres Umhersuchen. Nach VOLPERT zeichnet sich effizientes Handeln nicht nur durch Realitätsbezogenheit, sondern auch durch ein Festhalten am Ziel (Stabilität) bei gleichzeitig flexiblem Austausch (Flexibilität) von Unterprogrammen aus, wenn Handlungssituationen es erfordern. Als Fehlentwicklung würde es VOLPERT ansehen, wenn Rückmeldungen nicht verarbeitet werden. Rigides Handeln ist die Folge. Das Gegenteil ist aber genauso denkbar, indem die kleinste Störung ausreicht, um den einmal eingeschlagenen Handlungsfluss aus dem Gleichgewicht zu bringen und damit zu unterbrechen. Effizientes Handeln muss demnach auch organisiert sein. Dadurch kommt eine Ökonomie zustande, die es erlaubt, dass höhere Regulationsebenen mittels Delegation an untere für voraus planende Aufgaben frei werden. Fehlentwicklungen von Planungsvorgängen sähen so aus, dass Zwischenstadien einer Handlung nicht genügend antizipiert werden, so dass in voreiliger Zielorientierung Handlungsvarianten gewählt werden, die nicht mit eventuell effizienteren Handlungsstrategien verglichen worden sind. Auch hier wäre wiederum eine Fehlentwicklung denkbar, in der höhere Ebenen Kleinigkeiten zu viel Aufmerksamkeit schenken statt sie routinemässig zu behandeln, so dass das Individuum keinen Überblick mehr hat. 46 8.2 Gestörte Regulationsebenen im handlungstheoretischen Ansatz Auf den jeweiligen Regulationsebenen können nun bestimmte Störungen auftreten: 1. Inadäquate Regulationsgrundlage Eine inadäquate Regulationsgrundlage besteht darin, dass die äusseren und inneren Bedingungen einer Situation falsch eingeschätzt werden, oder dass falsche, d.h. unrealistische Ziele eingesetzt werden. 2. Fehlende Regulationsgrundlage Hier kommt zusätzlich zu 1. Hinzu, dass wirrres und ungerichtetes Verhalten auftaucht, wenn Situationsbedingungen nicht eingeschätzt werden, bzw. keine strategischen Ziele gefunden werden. 3. Inadäquates Aktionsprogramm „Das Aktionsprogramm ist der hierarchisch strukturierte Plan zur Ausführung von Handlungen auf ein bestimmtes Ziel hin“ (SEMMER & FRESE, in: HOFFMANN 1979, 140). Inadäquat ist ein Aktionsprogramm dann, wenn aus dem Ziel und dem sonstigen Informationshintergrund eine falsche Regulationsgrundlage abgeleitet wird. Allgemeine Kognitionen und damit Einsichten können zwar vorhanden sein, diese werden aber in falschen strategischen oder taktischen Plänen umgesetzt. Auch Handlungsrigidität ist ein inadäquates Aktionsprogramm (vgl. LUCHINS & LUCHINS 1959). Als Gründe für rigides Verhalten von Handlungsstrategien und Taktiken können angeführt werden, dass eine alternative Handlungsstrategie fehlt und deshalb an der einzig bestehenden starr und unflexibel festgehalten wird: - Dass bestimmte Strategien unter Angst- und Stressbedingungen sich rigidisieren und fixieren - Dass sich bestimmte Handlungen so nach der senosmotorischen Ebene verlagert haben, dass sie nur noch schwer gestoppt und nicht mehr auf höhere Ebenen transformiert werden können. 4. Defizitäre Beherrschung des Aktionsprogrammes Fehlende oder mangelnde Beherrschung eines Aktionsprogrammes zeichnet sich dadurch aus, dass sich Kognitionen nicht mit konkretem Verhalten verbinden. Hier muss durch entsprechende Übung eine handlungsrelevante Kognition auf einer unteren Regulationsebene angesprochen bzw. aufgebaut werden. Im folgenden werden wir Untersuchungen berücksichtigen, die sich auch mit kognitiven Prozessen befassen, diese aber von einer ganz anderen Basis als der bisherigen, von PIAGET ausgehenden ableiten, nämlich von den Lerntheorien. 47 9. Das Konzept der kognitiven Prozesse auf lerntheoretischer Grundlage Die kognitive Verhaltensmodifikation hat die begriffliche und empirische Analyse von privaten Ereignissen zum Inhalt. Menschliches Leben setzt sich überwiegend aus privaten Reaktionen auf die jeweilige private Umwelt zusammen: dies können Monologe, Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Träumereien usw. sein (vgl. MAHONEY 1977, 12). Auf Grund der kaum zu bestreitenden häufigen Vorkommnisse privater Reaktionen erscheint es nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine moralische Aufgabe zu sein, kontrollierte wissenschaftliche Ergebnisse zum angesprochenen Bereich vorzulegen. Diese Forderung erscheint auf den ersten Blick kaum der Rede wert zu sein. Es scheint jedoch, dass sich die Verhaltensforscher mit dem o. a. Bereich privater Erlebnisse immer sehr schwer getan haben respektive ihn ignoriert haben (vgl. hierzu den Terminus ‚black box‘). „Die offene Verbannung privater Ereignisse in ein „positivistisches Fegefeuer“ durch WATSON (1924) und SKINNER (1953) hatte instrumentellen Stellenwert für die Entwicklung von kontrollierten Verhaltensanalysen solcher Phänomene. Ausdrücke wie ‚mental‘ und ‚nicht-beobachtbar‘ wurden in Verbindung gebracht mit Begriffen wie ‚unbestimmt‘, ‚unwissenschaftlich‘. In den letzten zwanzig Jahren haben sich auch innerhalb der verhaltenstheoretisch ausgerichteten Forschung Gegenstimmen zur klassischen Verhaltenstherapie gemeldet und ihr Interesse an verdeckten, d.h. nicht beobachtbaren bzw. nicht beobachteten Phänomenen angemeldet. Verdeckte Phänomene sind ihrer Meinung nach wissenschaftlich legitim, und ihre Untersuchung im klinischen und für uns im (heil- bzw. sozial-)pädagogischen Bereich unerlässlich. Geht man der Untersuchung privater Ereignisse aus dem Weg, so trennt man sie von anderen beobachtbaren Verhaltensweisen und unterstützt damit gleichzeitig eine Trennung von körperlichen und geistigen Aktivitäten, was auch nie im Sinne der klassischen Behavioristen gewesen ist. Die Hauteigenschaft des radikalen Behaviorismus WATSON’scher Prägung war natürlich metaphysisch: die Existenz der Seele wurde geleugnet. Auf das direkte Ablehnen der Seele und seelischer Prozesse stösst man bei heutigen Behavioristen selten. Trotzdem bleibt eine starke Abneigung gegen mentalistische Begriffe zurück. Abneigung betrifft alle Prozesse, die zwischen Reiz und Reaktion zu vermitteln versuchen. Folgende Vorwürfe werden vorgebracht: - mentalistische, also vermittelnde Begriffe und Konstrukte sind unwissenschaftlich, - sie sind nicht beobachtbar, - operationale Definitionen sind oft nicht gewährleistet. D.h. der methodologisch operierende Behaviorist muss spezifizieren können, welche Daten Bedeutung für den Wahrheitswert seiner Hypothesen haben usw. Für MAHONEY (1977) entsprechen mehrere der oben genannten Kriterien methodologischen Konventionen. Seine Aussagen erinnern stark an die von uns bereits im ersten Kapitel getroffenen Ausführungen. Kehren wir zu MAHONEYs Unterscheidung von vermittelnden und nicht-vermittelnden Modellen zurück. Unter einer vermittelnden Variable versteht MAHONEY einen erschlossenen (unbeobachte48 ten) Faktor, welcher den Stimulus-Input mit dem Reaktions-Output in Beziehung b ringt. MAHONEY unterscheidet zwischen nicht beobachteten und nicht beobachtbaren Vermittlungen. Erstere bezeichnet er als hypothetische Konstrukte und verweist auf neuro-chemische Prozesse im Inneren eines Organismus. Anders als das hypothetische Konstrukt, das einer strukturellen Funktion dient, ist eine intervenierende Variable nicht beobachtbar. Ihre Rolle im Vermittlungsprozess ist eine begriffliche bzw. beschreibende. Deshalb fällt es vielen Behavioristen schwer, Vermittlungsmodelle zu akzeptieren, weil sie ansonsten mit dem „Gebot“ des Behaviorismus: „Du sollst keine Schlussfolgerungen ziehen“ kollidieren. Die Begriffe ‚Schlussfolgerungen‘ und ‚nicht beobachtet‘ wurden in ihrer Nebenbedeutung zu technischen Obszönitäten (vgl. MAHONEY 1977, 35). Nach MAHONEY sind nun aber Schlussfolgerungen nicht nur gerechtfertigt, sondern für die Verhaltenswissenschaft grundlegend. Für MAHONEY stellt sich die Problemstellung nicht, ob Schlussfolgerungen gerechtfertigt sind, sondern vielmehr, wann und welche Schlussfolgerungen zum Verständnis von Verhalten beitragen können. Die grundlegende Funktion erschlossener, d.h. vermittelnder Variablen ist ihr verbindender Charakter. MAHONEY weist auf, dass die meisten Schlussfolgerungen durch nur vier grundlegende empirische Ereignisse zustande kommen: 1. zwei identische Reize erzeugen verschiedene Reaktionen Reiz A Reaktion A Reiz A Reaktion B 2. zwei verschiedene Reize erzeugen identische Reaktionen Reiz A Reaktion A Reiz B Reaktion A 3. kein beobachteter Reiz Reaktion A 4. Reiz A keine beobachtete Reaktion. Interessant ist nun, dass die vier Beispiele bei einer einzigen Person vorkommen können (intraindividuelle Schlussfolgerungen). Die Beispiele 1 – 4 machen deutlich, wann es unerlässlich ist, Schlussfolgerungen zu ziehen. Offen bleibt jetzt noch die Frage, welche Schlussfolgerungen gerechtfertigt sind? Nach MAHONEY ist das einzige Kriterium für eine gerechtfertigte empirische Schlussfolgerung pragmatischer Natur. „Eine Schlussfolgerung ist dann, und nur dann gerechtfertigt, wenn sie die Vorhersagegenauigkeit oder die konzeptuelle Weite vergrössert“ (MAHONEY 1977, 45). Vorhersagbarkeit ist demnach zweifellos das strengste Kriterium, expost-facto-Erklärungen können ebenfalls ein bestimmtes Mass an Angemessenheit zugebilligt werden. „Wenn ein theoretisches Modell ein bestimmtes Phänomen weder vorhersagen noch erklären kann, ist es inadäquat“ (MAHONEY 1977, 46). Wie bereits erwähnt, sind Abweichungen von 1 – 4 von einfachen Input-Output-Regelmässigkeiten an der Tagesordnung und fordern deshalb zu empirisch überprüften Schlussfolgerungen heraus. Nach dem Vermittlungsmodell ist ein Teil dieser Verhaltensvariabilität den Reaktionsprozessen innerhalb des Organismus zuzuschreiben. Darauf wollen wir im folgenden näher eingehen. 49 Mit der Negativ-Hypothese: Nicht-vermittelnde Modelle sind inadäquat, wollen wir 1. auf die vermittelte Reiztransformation eingehen. Ein in der Wahrnehmungstheorie lange bekanntes Phänomen ist, dass der Organismus nicht auf einen bestimmten ‚echten‘ äusseren Reiz reagiert, sondern auf einen ‚wahrgenommenen‘ Reiz: Wir denken nicht, wir denken, dass wir denken! Deshalb kann es auch Beispiele geben, bei denen ein Organismus unterschiedlich auf zwei identische Reize reagiert. Es käme nun für den Verhaltenswissenschaftler darauf an, zu erfahren, wie ein Reiz wahrgenommen wird. Dadurch wäre es ihm möglich, die Genauigkeit seiner Verhaltensvorhersagen zu erhöhen. Äussere Reize werden oft durch kognitive, symbolische Prozesse modifiziert, anders gesagt: Menschen reagieren auf ihre Wahrnehmung oder Interpretation eines Hinweisreizes und nicht auf den Hinweis selbst. Ein zweites Gebiet stellt die semantische Konditionierung und Generalisation dar. Vor allem von russischen Forschern (PAVLOV 1955; PLATONOV 1959; RAZRAN 1965) wurde schon sehr früh verkannt, dass, wenn bei respondentem Konditionieren Wörter als zu konditionierende Reize verwendet werden, einige Vermittlungsprozesse mit ins Spiel kommen. Wenn in Trainingsdurchgängen auf das Wort ‚Hase‘ immer ein schmerzhafter Elektroschock folgt, wird es zu einem konditionierten Reiz für autonome Erregung werden. Wenn danach während der Testdurchgänge kein Schock dargeboten wird, werden menschliche Versuchspersonen auf den Reiz ‚Kaninchen‘ grössere autonome Erregung zeigen als auf das Wort ‚Haare‘. D.h., dass der semantischen Bedeutung ein grösserer Wert zukommt, als der phonetischen Ähnlichkeit. Zu erklären ist dieser Umstand nur durch ein Vermittlungsmodell. Beim dritten Bereich muss auf die ‚Symbolische Selbstreizung‘ eingegangen werden. Dieses dritte Beispiel, in dem nicht-vermittelnde Modelle nicht weiter kommen, ergibt sich aus den seit langem bekannten Nachweisen, dass verbale und vorgestellte Reize beim menschlichen Verhalten eine sehr bedeutende Rolle spielen. PLATONOV (1959) berichtet, dass Versuchspersonen beträchtliche physiologische Reaktionen auf die mit Schmerz assoziierten Wörter (z. B. Verletzung) zeigten. Verstärkt wird dieses Phänomen noch durch die Tatsache, dass der Mensch ein sich selbst stimulierendes Wesen ist (innere Monologe, Selbstgespräche, Denken etc.). Die Frage ist nun, ob auch selbsterzeugte, verdeckte Reize Reaktionen auslösen, die denen externer Reizung vergleichbar sind? Nun ist bekannt (SHAW 1940; BANDURA 1969; MCGUIGEN & SCHOONOVER 1973), dass wenn Versuchspersonen verschiedene Reize ‚herbeidenken‘, messbare physiologische Effekte beobachtet werden können. Ein viertes Gebiet auf dem das nicht-vermittelnde Modell sich als unzulänglich erwiesen hat, ist das Feld der Bewusstheit. Besonders im Zusammenhang mit Lernprozessen hat man das Phänomen Bewusstheit untersucht. Die Nachweise scheinen zusammenfassend zu zeigen, dass Lernen ohne Bewusstheit stattfinden kann, wenn auch mit langsamer Geschwindigkeit, dass aber die symbolische Vorstellung der Reaktions-Verstärkungs-Kontingenzen die angemessene Reagibilität beträchtlich beschleunigen kann (vgl. BANDURA 1969). Aus diesen Beispielen ist klar geworden, dass die Angemessenheit des nicht-vermittelnden Modells in Frage gestellt werden muss. Ein einfaches Input-Output-Schema vermag die komplexen Phänomene wie Reiz-Transformation, semantische Konditionierung und Generalisierung, symbolische Selbstreizung, Bewusstheit, aber auch des stellvertretenden Lernens, nicht zu erfassen. Es besteht kein Zweifel, dass ein Paradigmenwechsel weg vom nicht-vermittelnden hin zum vermittelnden Modell unablässig ist. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Der Forscher muss sich permanent mit der Frage auseinan50 dersetzen, wie er unterscheiden kann, welches Modell oder welche Modelle angemessen sind. Etwas spezifischer ausgedrückt: 1. Welche Daten liefern den vermittelnden Variabeln Bestätigung? 2. Wie angemessen ist das Modell als theoretisches System hinsichtlich der formalen wissenschaftlichen Kriterien für Theoriebildung: a) die symbolische Struktur, b) die Terminologie, c) Voraussetzungen oder Vorannahmen, d) interne Konsistenz, e) Beziehungsregeln, f) Ableitungen und Vorhersagecharakter. In dem von MAHONEY beschriebenen zweiten Vermittlungsmodell geht es um die Informationsverarbeitung, d.h. um Aufnahme, Speicherung und Anwendung von Information. Hierbei geht MAHONEY von der Prämisse aus, dass der Organismus nicht auf eine reale Welt reagiert, sondern auf seine eigene vermittelte Wiedergabe davon. Diese Vermittlung unterliegt Prozessen wie Reizselektion, verzerrung und –umformung. Von dieser Basis ausgehend formuliert MAHONEY 4 umfassende Kriterien der Informationsverarbeitung. 1. Aufmerksamkeit, die sich mit selektiver Orientierung auf spezifische Stimuli hin und deren Assimilation beschäftigt. Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass der Organismus nur einen kleinen Teil der auf ihn einstürmenden Reize assimiliert und selektiert. Aufmerksamkeitsprozesse ermöglichen es dem Organismus einen weiten Bereich an Aktivitäten auszuführen, ohne bewusst auf sie zu achten. Subjektive Berichte lassen vermuten, dass diese prä-attentiven Mechanismen der selektiven Aufmerksamkeit nur bei einfachen, routinemässig zu erledigen Aufgaben vorkommen. Aber Veränderungen der Routine scheinen gerichtete Aufmerksamkeit wieder zu stimulieren. Früher Gelerntes und der Reizkontext beeinflussen die Wahrnehmung ebenfalls stark. 2. Kodierung, was symbolische Verschlüsselung des Reizes nach verschiedenen Faktoren (physikalische Merkmale, Semantik usw. ) bedeutet. Die Informationsverarbeitung wird durch mehrere Faktoren beeinflusst. Bei der Kurzzeitspeicherung scheint die Dauer, die Wiederholung und die zeitliche Position der Konfrontation mit dem Reiz positiv mit der späteren Erinnerung zu korrelieren. Ausserdem transformieren Menschen Stimulierung oft in einen inneren Code, um die Erinnerung daran zu erleichtern und ökonomisch zu machen. Menschen haben aber eine beschränkte Verarbeitungskapazität und können nur mit einer bestimmten Informationsmenge gleichzeitig umgehen. Dies zwingt sie, Informationen zu Einheiten zusammenzufassen. 3. Speicherung, was das Behalten codierter Informationen bedeutet. MAHONEY verweist auf 4 mögliche Erklärungen, die das Behalten von Informationen durch Vergessen tangieren: 51 - Zerfallshypothese: Gedächtnisspuren werden langsam schwächer - Interferenzhypothese: neue, andere Erfahrungen interferieren mit den alten, die mit der Zeit auf der Strecke bleiben - Gerichtetes Vergessen: werden bestimmte Reize nicht mehr gebraucht, so wird die Wahrscheinlichkeit der späteren Erinnerung an sie deutlich reduziert - Motiviertes Vergessen: Erinnerungen, die mit sehr schmerzlichen Erfahrungen verbunden sind, können weniger zugänglich werden. 4. Reproduktionen, was die folgende Anwendung der gespeicherten Informationen zur Verhaltenssteuerung einschliesst Die entscheidenden Fragen bei der Reproduktion von Erinnerung scheinen sich um Such-, Auswahl- und Reaktionserzeugungsprozesse zu zentrieren. Dabei gehen Menschen sowohl von vorstellungsmässigen als auch von verbalen Hinweisreizen aus. Die meisten Reproduktionen scheinen assoziativ oder instrumentell zu sein. Das Modell der Informationsverarbeitung versteht den Menschen als aktiven Vermittler der Stimulierung. Die Informationsverarbeitung beim Menschen ist auf drei strukturelle Elemente angewiesen: - Sensorischer Speicher - Kurzzeitgedächtnis - Langzeitgedächtnis. Die gegenwärtigen Kenntnisse über die Beständigkeit des Gedächtnisses, seine physiologischen Grundlagen und das Wesen des Vergessens sind aber noch unzureichend. 9.1 Informationsverarbeitungsstörungen beim kognitiven Lernen Im folgenden wollen wir auf gestörte Vermittlung von Informationen beim kognitiven Lernen eingehen. Vier Schwerpunkte der Varianz im Verhalten sollen angegangen werden. 1. Faktoren der Aufmerksamkeit Wie wir bereits ausgeführt haben, richten Menschen ihre Aufmerksamkeit selektiv nach Kriterien, die für ihre Anpassung angeborene oder erworbene Bedeutung haben. So berichten MISCHEL, EBBESEN & ZEISS (1972) von Experimenten, in denen Kindern durch kognitives Training beigebracht wurde, Aufmerksamkeitsfaktoren von erwünschten Gegenständen abzulenken, um kurzfristig gesuchte Befriedigung aufschieben zu lernen. Verhalten kann also auch durch den differentiellen Fokus der Aufmerksamkeit merklich beeinflusst werden (vgl. auch ROSENTHAL 1966). So zeigen Personen ein grösseres Vermeidungsverhalten, wenn dieselbe Aufgabe zum Beispiel als Furchteinschätzung und nicht als Kommunikationsforschung dargestellt wurde (vgl. auch Placebo-Effekte: FRANK 1962, GOLDSTEIN 1962, SHAPIRO 1971). Auch hier spielen kognitiv-symbolische Prozesse eine grosse Rolle, denn wenn Verfahren Erwartungen auslösen, werden mittels ihrer Einflüsse perzeptuelle und vermittelnde Prozesse wirksam. Von der adaptiven Seite her gesehen, scheint die selektive Informationsverarbeitung die Fähigkeit einer Person zu erleichtern, z. B. schmerzhafte Situationen zu ertragen, Versuchungen zu widerstehen und therapeutische Veränderungen zu optimieren. Fehlangepasste 52 Aufmerksamkeitsprozesse können nun aber auch zu fehlangepassten Verhaltensmustern führen. Dazu gehört: a) Die selektive Unaufmerksamkeit Sie bedeutet das Übersehen verhaltensrelevanter Hinweisreize. Dies kann sich so darstellen, dass die Hinweisreize sehr wohl angemessen sind, aber nicht beachtet werden. b) Fehlwahrnehmung Eine andere Möglichkeit der Fehlwahrnehmung sieht so aus, dass zwar die Hinweisreize beachtet werden, aber sie werden mit ungenauen Bezeichnungen belegt. c) Fehlangepasstes Fokussieren Fehlangepasstes Fokussieren tritt dann auf, wenn Menschen Hinweisreizen folgen, die für sie eigentlich unwichtig oder sogar schädlich sind. Fehlangepasstes Fokussieren tritt oft in Verbindung mit selektiver Unaufmerksamkeit auf. MAHONEY meint, dass Impulsivität darauf hindeuten könnte, dass impulsive und hyperaktive Kinder vielleicht auf ablenkende Stimuli achten (vgl. MAHONEY 1977, 177; auch: MEWE 1978). d) Fehlangepasste Selbsterregung Die fehlangepasste Selbsterregung umfasst das Erzeugen privater Hinweisreize, die ebenfalls für das Verhalten irrelevant oder schädlich sind. Im Gegensatz zum fehlangepassten Fokussieren werden jetzt die fehlangepassten Hinweisreize ‚intern‘ statt ‚extern‘ erlebt. Angst vor Dunkelheit veranschaulicht dieses Phänomen deutlich. Wenn eine äussere Stimulierung tatsächlich fehlt, erfahren viele Personen aufgrund selbsterzeugter Hinweisreize eine starke und schmerzhafte autonome Belastung. 2. Beziehungsprozesse Die Möglichkeit für Funktionsstörungen in der Vermittlung hören nicht auf, nachdem ein Hinweisreiz beachtet und decodiert worden ist. Eine erste Störung überschneidet sich mit einigen unter 1. Besprochenen Decodierungsprozessen. Im spezifischen Fall kann ein beachteter Stimulus ungenau übersetzt werden und zwar so, dass ein Klassifikationsirrtum adaptives Verhalten verhindert. So ist beispielsweise ‚Dichotomes Denken‘ ein gestörter Prozess bei der menschlichen Vermittlung. Hier werden Situationen, Ereignisse nach einem Alles-oder-Nichts-Prinzip kategorisiert. Das graduelle Kontinuum, das die Situation vielleicht angemessener beleuchten würde, wird nicht erkannt bzw. nicht anerkannt. Auch überstarke Vergleichsprozesse und ständiges Bewerten eigener Leistungen sind oft schädliche Komponenten im Vermittlungsprozess (vgl. auch Depressivität: BECK 1970; Testangst: ALLEN 1970). Eine dritte Form von beeinträchtigter Vermittlung sind Gedächtnisstörungen, die zu fehlangepassten Verhaltensmustern beitragen können. Gedächtnisstörungen sind ein unnagemessenes Speichern von 53 - Stimulus- und Kontextinformationen - Reaktionselementen - Merkmalen von Konsequenzen. Gedächtnisstützen, Übungsanweisungen und ein bedeutungsvoller begrifflicher Zusammenhang, erleichtern vielen Menschen die Fähigkeit, sich Informationen anzueignen und zu merken. Eine weitere Art von Vermittlungsstörungen stellen Schlussfolgerungs-Irrtümer dar. MAHONEY verweist in diesem Zusammenhang auf das induktive Denken, dass aus isolierten Ereignissen generalisierte Schlüsse gezogen werden. Hier ist die Gefahr sehr gross, dass Schlussfolgerungen gezogen werden, die von der persönlichen Information nur unzureichend abgedeckt werden. Gestörte Schlussfolgerungen können zudem noch durch falsche Analogie-Schlüsse mit beeinflusst werden. Erwähnt werden soll auch die mögliche Fehlerquelle beim Schlussfolgern, die durch die fehlerhafte Antizipation von Konsequenzen entsteht. Da Menschen vermittelnde Organismen sind, scheint sich einer ihrer primären, symbolischen Prozesse auf persönliche Vorhersagen zu konzentrieren. Die Antizipation von Konsequenzen geschieht auf der Grundlage der Auswertung von vorherigen Erfahrungen, von stellvertretendem Lernen, von gegenwärtigen Impulsen und einer Reihe von privater, individuellen Schlussfolgerungen. 3. Merkmale des Reaktionsrepertoires Angemessene Aufmerksamkeits- und Beziehungsprozesse allein sind noch eine Garantie für adaptives Verhalten. Wenn das Reaktionsrepertoire Mängel aufweist, wird auch das Verhalten ungenügend sein. Unzulängliches Verhalten kann auch entstehen, wenn Menschen nicht die Fähigkeit besitzen, angemessene Wahlmöglichkeiten im Problemlösen bereitzustellen. Ein systematisches Training in Problemlösefähigkeiten kann eine Verbesserung im Reaktionsrepertoire bewirken (vgl. SPIVACK & SHURE 1974). Nachdem nun auch die die informationsverarbeitenden Prozesse sowie ihre Störungsmöglichkeiten dargestellt wurden, ist damit die Basis gegeben, um nun, im folgenden Kapitel, noch intensiver auf mögliche Verhaltensauffälligkeiten sowie ihre Therapiemöglichkeiten einzugehen. 54 10. Therapieformen, die sozial-kognitive Prozesse berücksichtigen Im folgenden wollen wir nun auf mögliche Therapieformen eingehen, die die kognitive Therapie hervorgebracht hat. Es handelt sich hierbei weitestgehend um Therapieformen, die sich der Methode der kognitiven Umstrukturierung sowie der Selbstinstruktion bedienen. 10.1 ‚RET‘: Die rational-emotive Psychotherapie von ELLIS (1973) Nach ELLIS entstehen psychische Probleme aus Fehlwahrnehmungen und falschen Kognitionen über das, was Menschen wahrnehmen. Die rational-emotive Therapie basiert demnach auf der Anname, dass emotionale Reaktionen durch bewusste und unbewusste Bewertungen, Interpretationen und Philosophien entstehen. BECK (1970), der versucht, das theoretische Fundament der 'RET' zu untermauern, weist auf 4 übliche Verzerrungen der Denkmuster hin: 1. Willkürliches Kausaldenken Es werden Schlussfolgerungen gezogen, obwohl Beweise fehlen oder sogar den Schlussfolgerungen widersprechen. 2. Übertriebene Verallgemeinerungen Tritt dann auf, wenn ein einziges eine allgemeine Regel im Denken zur Folge hat. 3. Magnifizieren/Katastrophieren Die Bedeutung eines Ereignisses wird stark überbewertet. 4. Kognitive Defizite Sie bestimmen sich durch Vernachlässigung eines wichtigen Aspektes in einer Lebenssituation. Wichtige Erfahrungen können deshalb nicht erfahren und in einen Gesamtzusammenhang integriert werden. LAZARUS (1971) hat diesen Katalog noch um zwei Punkte erweitert. 5. Dichotomisierendes Denken Ein Mensch zieht jeweils nur zwei mögliche Bewertungen eines Ereignisses in Betracht (schwarzweiss, gut-schlecht, richtig-falsch etc.) 6. Übertriebene Sozialisation Kennzeichnet sich durch das Versagen, die Willkürlichkeit sozialer Sitten und Normen zu erkennen und in Frage zu stellen. 55 Die Hauptaufgabe des Therapeuten besteht nun darin, dem Klienten seine unlogischen Denkstrukturen aufzuzeigen und ihm dabei zu helfen, neue Wege zu überlegen und diesselben auch einzuschlagen. Einige Variablen, die ELLIS besonders berücksichtigt haben möchte, bringen ihn in besondere Nähe zur klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie. Auch nach ELLIS sollte ein Therapeut vorsichtig vorgehen, den Klienten unterstützen, Wärme zeigen, dem Klienten Gelegenheit geben, seine Gefühle zu zeigen. ELLIS verwendet hierzu das Rollenspiel. Nach ELLIS muss der Therapeut selber über Techniken bzw. Strategien verfügen, um logische Regeln im menschlichen Denken und Zusammenleben aufzeigen zu können. Er sollte gerade und unkompliziert denken und sein Leben mit wissenschaftlichen Methoden zu bewältigen versuchen. Dadurch wird der Therapeut in die Lage versetzt, irrationales Denken auf Seiten des Klienten aufzudecken. Für REINECKER (1978), auf den wir noch gesondert eingehen werden, bedeutet es eine grosse Schwäche der 'RET', dass nur der Therapeut den Schlüssel für richtig oder falsch besitzt, als ob nur er einen privilegierten Zugang zur Realität besässe. Die Auffassung ELLIS widerspricht der heute in der Sozialpsychologie üblicherweise vertretene Position, dass es zwischen pathologischen und normalen Verhaltensweisen keine scharfe Trennungslinie gibt. ELLIS System ist von einem gefährlichen Subjektivismus durchsetzt, weil man nicht davon ausgehen kann, dass nur ein Therapeut über die Weltsicht verfügt, die richtig ist. Nach MAHONEY (1977) sind die experimentellen Befunde zur 'RET' dürftig. Häufig kommen bei den wenigen experimentellen Befunden noch methodische Ungenauigkeiten und viele Faktoren, die nicht exakt kontrolliert werden konnten, hinzu. Trotzdem muss darauf hingewiesen werden, dass sich insbesondere die 'RET' im klinischen Bereich einer gewissen Beliebtheit erfreut, was für die 'RET' sprechen würde. Der andere Punkt, in dem ELLIS angriffswürdig ist, sind ELLIS philosophische Grundannahmen. Ob sich alle menschlichen Gefühlszustände auf logische Weise auflösen und damit lösen lassen, scheint fraglich. Ob es wünschenswert wäre, ist eine weitere offene Frage. 10. 2 Reineckers Konzept der Selbstkontrolle durch Versprechen und soziale Verträge REINECKER (1978) integriert zu Beginn die in der Verhaltenstherapie getroffenen Abmachungen oder Verträge zwischen Klienten und Therapeuten in sein Konzept der Selbstkontrolle. Ziel dieser Verträge ist es, bestimmte Kontingenzen eines Verhaltens präzisieren zu können, die dadurch eher verhaltenssteuernd wirken. Was ist nun das genuin spezifische eines Vertrages in der Verhaltenstherapie? Voraussetzung ist, dass der Klient sein eigenes Verhalten nicht mit gewissen Verhaltensprinzipien in Einklang bringen kann. Das Individuum stellt Abweichungen zu seinem Selbst-Image fest. Die Bereitschaft, Verträge zu schliessen, ist unter folgenden Bedingungen besonders hoch: 1. In Anlehnung an PREMACK (1971) können Umgebungsreize mit z. B. aversivem Charakter die eigene Bereitschaft erhöhen, einen Vertrag zu schliessen. 2. Wenn die Bereitschaft besteht, ein Verhalten auszubilden, das aber im Gegensatz zu einem anderen geäusserten Verhalten steht, so erhöht dies ebenfalls die Bereitschaft, einen Vertrag abzuschliessen. Ein Vertrag erfüllt nach REINECKER (1978) zwei Funktionen: 1. Er legt die gegenseitigen Verpflichtungen fest. 56 2. Der Vertrag dient als externe Kontrolle i. S. eines Feedbacks. Auch bei Verträgen liegt die positive Wirkung mehr in der kognitiven Repräsentanz von extern erwarteter Verstärkung, als in der realen Verstärkung selbst. Ein weiterer Vorteil der Verhaltensverträge liegt in ihrer Präzisierung von Problemverhalten resp. in der Darstellung kleinster Schritte, die es zu erreichen gilt, was stark angstmindernd wirkt. REINECKER (1978) bemerkt, dass allein das Wissen um die Möglichkeit eigener Kontrolle das Ertragen aversiver Situationen leichter macht. Personen, die diese Möglichkeit nicht haben, reagieren mit 'geplanter Hilflosigkeit' (sinnloses, neurotisches, depressives Verhalten). Gelernte Hilflosigkeit (SELIGMAN 1972) geht von der Annahme aus, dass es ein Individuum durch traumahafte Erlebnisse verlernt hat, auf eigene Reaktionen auch eigene Wirkungen zu sehen. Erlernte Hilflosigkeit stellt eine kognitive Verzerrung bezüglich der eigenen Konsequenzen dar. Das Individuum nimmt an, dass die Konsquenzen, die auf sein Verhalten folg(t)en, zufällig sind. Gelernte Hilflosigkeit verschlechtert die Leistung beim Problemlösen. 10.3 Meichenbaums Selbstinstruktionstraining MEICHENBAUM (1977) stellt seine Methoden der Selbstinstruktion auf den Denkstil des Patienten als einen sehr wichtigen Zugang zur Verhaltensänderung ab. Eine wichtige Komponente dabei ist die Wahrnehmung des Klienten bzw. sein Wahrnehmungsstil. Jemand mit Redeangst glaubt, wenn die Leute den Saal verlassen, an mangelnde Redefähigkeiten, während ein Mensch mit Selbstbewusstsein denkt: die Leute im Saal sind unzivilisiert. Dabei ist wichtig zu sehen, dass die verschiedenen Wahrnehmungen von verschiedenen Selbstbewertungen ausgehen. Die Selbstinstruktion ist dazu angelegt, sowohl die kognitiven als auch die Verhaltensanteile der jeweiligen Problematik zu modifizieren. Durch die Selbstinstruktionstherapie soll der Klient sich seiner Gedanken bewusst werden und dazu geleitet werden, inkompatible Selbstinstruktionen und inkompatibles Verhalten hervorzubringen; eine Methode, die in der Sozialpsychologie als die beste festgestellt wurde, um Einstellungen zu ändern. MEICHENBAUM unterteilt den Therapieprozess in drei Teile. 1. Phase der begrifflichen Strukturierung des Problems Hier wird von seiten des Therapeuten verstehend in die besondere Natur des Problems eingedrungen und erste Planungen des Behandlungsanfangs vorgenommen. Der Klient wird auf die therapeutische Intervention und deren Begründung vorbereitet, einzeln oder in Gruppen. Dabei scheint die Gruppentherapie wegen der Gruppendynamik vorteilhafter zu sein. Als erstes erfolgt eine Situationsanalyse des vorgestellten Problems durch Interviews. Dabei ermittelt der Therapeut den Denkstil, den er ja nach Lage dem Klienten bewusst macht oder nur auf das Problem bezieht. Die Klienten bekommen Hausaufgaben, bei denen sie quasi mit einem 'dritten Ohr' sich selbst zuhören, um ihre eigenen Instruktionen zu erfahren. 2. Phase Die begriffliche Struktur des Problems wird erforscht, ausprobiert und konsolidiert. Die Klienten beginnen zu begreifen, dass ihre Ängste und Befürchtungen nicht Eigenschaften äusserer Ereignisse sind, sondern dass es vielmehr ihre eigenen Gedanken sind, die die Angst auslösen. Die Klienten lernen die Selbstinstruktion erst laut, dann allmählich verdeckt. Es werden folgende Dinge geübt: 57 - die Realität der jeweiligen Situation abzuschätzen - negative, selbstbehindernde, angsterzeugende Vorstellungstätigkeit wird kontrolliert - die erlebte Angst anerkennen, benützen und möglicherweise mit einem neuen Etikett versehen - sich zur Durchführung psychisch 'aufraffen', motivieren - mit der intensiven Furcht fertig werden - sich selbst verstärken, wenn es gelungen ist. 3. Phase: Selbstinstruktionstraining Dabei hilft der Therapeut dem Patienten bei der Modifikation seiner Selbsturteile und der Hervorbringung besserer Verhaltensweisen. Hier schlägt MEICHENBAUM Verfahren vor, wie z. B. die 'RET' von ELLIS oder die Systematische Desensibilisierung (WOLPE 1969), bei der aber MEICHENBAUM ein Element hinzufügt: Die Klienten sollen sich auch in zu bewältigenden Situationen vorstellen. Weiterhin verweist MEICHENBAUM auf das Modelllernen, wiederum vor allem mit bewältigenden Modellen. Diese Vorgehensweise von MEICHENBAUM beruht auf einer Untersuchung von KAZDIN (1973), der feststellte, dass das bewältigende Modell wirksamer ist als das 'Meistermodell'. Schliesslich arbeitet MEICHENBAUM in der dritten Phase noch mit der Technik des Gedankenstopps und der verdeckten Selbstbehauptung. Wobei die Selbstbehauptung einmal den Gedankenstopp verstärkt, zum anderen auch so etwas wie eine Gedankensäuberung bewirkt, weil sie zu den Selbstbeschuldigungen inkompatibel ist. 10.4 Das Selbstinstruktionstraining bei Kindern von Luria Bei der Behandlung von hyperaktiven Kindern hat LURIA (1961) ein Dreistufenprogramm vorgeschlagen, mittels dessen das Auftreten und das Hemmen willkürlich gesteuerten motorischen Verhaltens unter verbale Kontrolle gebracht werden soll. Auf der ersten Stufe leitet und kontrolliert das Sprechen anderer, meist Erwachsener, das Verhalten der Kinder. Die zweite Stufe ist dadurch charakterisiert, dass das Kind durch lautes Sprechen sein Vorhaben steuert. Schliesslich übernimmt verdecktes oder inneres Sprechen des Kindes die Führungsrolle. Das Zu-sich-selbst-Sprechen des Kindes ist in gewisser Weise schwierig. Hierzu wird vorgeschlagen, dass der Therapeut mit dem Kind spielt und jede seiner Handlung verbalisiert. Dadurch lernt das Kind langsam seine Handlungen selbst zu verbalisieren. 10.5 Das Training der Bewältigungsfertigkeiten Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, wird die Fähigkeit eines Menschen, sich an belastende und nicht-belastende Situationen anzupassen, durch sein Reaktionsrepertoire mit beeinflusst. Dazu gehört u.a. die Fertigkeit des Problemlösens. D'ZURILLA & GOLDFRIED (1971) definieren Problemlösen als einen Verhaltensprozess von offener und kognitiver Art, der a) eine Vielzahl potentiell wirksamer Reaktionsalternativen für die Bewältigung der Problemsituationen zur Verfügung stellt und b) die 58 Wahrscheinlichkeit vergrössert, die wirksamste Reaktion aus diesen verschiedenen Alternativen auszuwählen. D'ZURILLA & GOLDFRIED (1971, 108, in: MAHONEY 1977, 230) nehmen an, dass die zur Verfügung stehenden Daten bei einem anstehenden Problemlösungsprozess auf 5 grundlegende Elemente zurückzuführen sind: 1. Das Erzeugen einer Orientierung Orientierung ist die erste Voraussetzung für das Erkennen einer Problemsituation. Diese Erkenntnis bedeutet in der Praxis, dass die Konfliktsituation noch einige Zeit ertragen werden muss, weil in diesem Stadium noch keine Lösung vorhanden ist. Erst mit anfänglichen Erfolgen kann das Individuum lernen, dass eine abwartende Haltung resp. das Ertragen von kurzfristigen aversiven Situationen langfristig grösseren Erfolg bringt. Eine Milderung ist möglich, indem das Individuum die Problemsituation in Gedanken bereits vorher kognitiv durcharbeitet. 2. Definition des Problems Wenn die aversive Situation mit dem Klienten durchgesprochen wird, kann diese auch analysiert und gegebenenfalls nach Dringlichkeiten formuliert werden. Eine präzise Darstellung der Problemkreise ist allerdings notwendig i. S. einer effizienten Lösungsstrategie. Genauso verhält es sich mit der präzisen Beschreibung des Zielverhaltens. 3. Erzeugen von alternativen Lösungen Diese Prozessphase ist einerseits durch kreativ-imaginative und andererseits durch erinnerungs- und Gedächtnisprozesse gekennzeichnet. Es ist ohne weiteres möglich, dass alte Lösungen erfolgreich auf neue Situationen übertragen werden. Oft wird man aber nicht umhin kommen, neue Lösungen zu finden. Dann sind besonders Methoden z. B. das brain-storming angesprochen. 4. Vorläufiges Auswählen einer Lösung Hier soll aus den vorher gefundenen Lösungen die beste herausgefiltert werden. Dabei müssen die Erwartungen des Klienten und die Konsequenzen der einzelnen Verhaltensstrategien gegeneinander abgewogen werden. Es ist sinnvoll, zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Konsequenzen zu unterscheiden, weil zwar kurzfristige Effekte momentan grosse Wirkungen haben, für die Therapie aber langfristige Effekte sinnvoller, d.h. nachhaltiger sind. 5. Verifikation Wenn eine Entscheidung in Verhalten umgesetzt worden ist, sollten die erwarteten mit den tatsächlich eingetroffenen Konsequenzen verglichen werden. Je nach dem sind dann wieder neue Alternativen zu suchen, bzw. Entscheidungen für andere Alternativen zu fällen. Auch nach KÖNIG (1979) stellt die Problemlösefähigkeit in kognitiv orientierten Ansätzen einen zunehmend wichtigen Indikator für erfolgreiche Therapie dar. Die Bedeutung der Problemlösefähigkeit liegt im Handlung erzeugenden, regulierenden Bereich. Dabei kommt es darauf an, dass ein Individuum durch Informationsgewinnung und -verarbeitung, durch die Fähigkeit zu selbständigem Wissenserwerb befähigt wird, sich auf neuartige Situationen einzustellen sowie bereits Gelerntes auf neue Gegebenheiten zu transformieren. Effizientes Problemlösen zeichnet sich dadurch aus, dass ein 59 Individuum in der Lage ist, Verfahren, die es sich im Kontext spezifischer Probleme angeeignet hat, über diese Zusammenhänge hinaus zu verallgemeinern, um somit umfassende Strategien des Lösens von Problemen zu entwickeln. Diese Fähigkeiten werden dann zum Gegenstand von Therapiezielen, wenn bei einem Individuum wissens- und/oder handlungsmässige Defizite, Ängste oder Konflikte ein Individuum unfähig machen, persönliche Probleme zu erkennen, zu bearbeiten und zu lösen. Im folgenden sollen die Voraussetzungen, Bedingungen, Verfahren und Formen der Informationsverarbeitung beim Problemlösen näher erläutert werden. Dabei lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit zu dem bereits erläuterten Modell von D'ZURILLA & GOLDFRIED nicht vermeiden. Problem und seine Klassifizierung Nach DÖRNER (1974) ist ein Problem durch den unerwünschten Anfangszustand, den erwünschten Endzustand und die Barriere, die diese Transformation verhindert, gekennzeichnet. Um ein Problem zu lösen, muss diese Barriere überwunden werden. Dabei spielen die bereits gemachten Lernerfahrungen eine wichtige Rolle. Es lassen sich verschiedene Problemtypen unterscheiden. Kein Problem kann aber unabhängig von einer spezifischen Situation gesehen werden. Deshalb müssen auch allgemeine Eigenschaften von Situationen bzw. Sachverhalten erwähnt werden. a) Sachverhalten können einen unterschiedlichen Komplexitätsgrad besitzen. Der Komplexitätsgrad hängt von der Vielfalt von Verknüpfungen und Beziehungen der Struktur eines Sachverhalts ab. Diese Struktur muss erst analysiert werden und je nach Fall eine Komplexitätsreduktion vorgenommen werden. b) Dabei ist zu beachten, dass die Veränderung einzelner Merkmale eines Sachverhaltes die Veränderung einiger anderer Merkmale nach sich zieht, die auch analysiert werden müssen. c) Es ist möglich, dass sich nicht alle Merkmale eines Sachverhaltes erkennen lassen. Hier ist es nur möglich, von beobachteten Merkmalen auf latente zu schliessen. Handlungen ziehen Effekte nach sich. Auch darüber muss sich ein Individuum im klaren sein. Z. B. muss die Wirklichkeit von Handlungen mitbedacht werden. Verschiedene Handlungen können nur in unterschiedlichem Masse wieder rückgängig gemacht werden. Handlungen können an unterschiedliche Voraussetzungen geknüpft sein und tragen ein gewisses Risiko in sich, dass sie scheitern. Handlungen können aber auch zu aufwendig im Hinblick auf ihren Nutzen sein, so dass sich die Frage stellt, inwieweit sie noch sinnvoll sind. Kognitive Strukturen und kognitive Operationen Der kognitive Apparat stellt für das Problemlösen die notwendige geistige Kapazität zur Verfügung. Er ist u.a. mit der Fähigkeit ausgestattet, Heurismen zu bilden. Unter Heurismen versteht DÖRNER (1974) Pläne für die Konstruktion von Handlungen, mit Hilfe derer in produktiver Weise ein gegebener in einen neuen Zustand transformiert werden kann. Die Qualität der heuristischen Struktur ist entscheidend für den Problemlösungsprozess. Wie wir bereits erwähnt haben, gliedert sich der Problemlöseprozess in 4 grundlegende Operationen: - Zustandsexplikation (Test) 60 - Veränderungsoperation (Operation) - Prüfoperation (Test) - Zielexplikation (Operation, Ende). Diese Gliederung stimmt weitgehend mit der von MILLER, GALANTER & PRIBRAM (1960) formulierten TOTE-Einheit überein, die wir bereits erwähnt haben. 10.6 Die Attributionstheorie Attributionen sind eine weitere Komponente im kanon der Problemlösefertigkeiten. Die Prämisse, die der Attributionstheorie zugrunde liegt, besagt, dass eine wahrgenommene Kausalität das Verhalten beeinflussen kann (vgl. MAHONEY 1977, 244). Die Theorie der Kausalattribution berücksichtigt ausserdem, dass die Art menschlicher Attributionen durch frühe Erfahrungen sowie durch Umfang und Art der gegenwärtig verfügbaren Information mitbeeinflusst wird. Die grundlegende Annahme dieses Konstruktes beschäftigt sich damit, ob sich eine Person eher als aktiven Urheber (interne Kontrolle) oder eher als passiven Empfänger (externe Kontrolle) von Umwelteinflüssen ansieht. Die Unterscheidung in internale und externale Typen hat nun weitreichende folgen für die Praxis, dergestalt, dass z. B. eine internal gesteuerte Person mehr Initiative und Verantwortung zu übernehmen bereit ist. Internal gesteuerte Personen beschaffen und bewerten Informationen oft wirkungsvoller und stehen meist in engerem Kontakt mit der sie umgebenden Umwelt. „Kinder, die ihre Schulleistungen eher persönlichen als zufälligen Ursachen zuschreiben, scheinen als Schüler aktiver und erfolgreicher zu sein“ (MAHONEY 1977, 246). Lernprozesse werden also durch den Glauben an externe Ursachen auf entscheidende Weise beeinträchtigt. Höchst problematisch ist der Aspekt, dass Schüler zurecht annehmen, dass sie von externalen Einflüssen abhängig sind. Diese Population in unserer Gesellschaft hat oft sehr berechtigte Gründe, sich selber als machtlos gegenüber ihren jeweiligen Lebenssituationen zu sehen. Diese Umstände verstärken ihre passive Mutlosigkeit. SCHACHTER & SINGER (1962) berichten über die Rolle der Etikettierung bei emotionaler Erregung. Die Art des Etikettierens beeinflusst das nachfolgende Verhalten. Da wir auf SCHACHTER & SINGER bereits Bezug genommen haben, mag diese kurze Erläuterung im Zusammenhang mit der Attributionstheorie genügen. Die Selbstwahrnehmungstheorie ihrerseits geht davon aus, dass Personen lernen, ihre eigenen Einstellungen und Gefühle zu kennen, indem sie von Beobachtungen ihres eigenen offenen Verhaltens und/oder aus den Bedingungen, unter denen dieses Verhaltens vorkommt, Schlussfolgerungen ziehen. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Ist ein Schüler intrinsisch motiviert, eine Aufgabe zu bearbeiten und sie zu lösen, erhält dabei laufend extrinsische, materielle Verstärkung, so kann diese Überbewertung der belohnten Aktivitäten den Schüler zu der Selbstwahrnehmung verleiten, dass sein Verhalten eher extrinsisch als intrinsisch motiviert war. Der Schüler gelangt auf gleiche Weise wie andere zu seinen eigenen privaten Vorgängen, indem er das Verhalten und seine Hinweisreize aus der Umwelt beobachtet. JAEGGI (1979) bringt das Dezentrierungsphänomen mit Ergebnissen der Attributionsforschung in Zusammenhang. Die Verbindung sieht sie dergestalt, dass sie auf eine erfolgreiche Dezentrierung 61 verweist, die eine Aufspaltung der Person in einen Handelnden und einen Beobachter vorsieht, da es ansonsten nicht möglich wäre, dass ein Individuum sich selbst so sehen lernt, wie andere es sehen und dass es sich selbst so sehen lernt, als sähe es in sich selbst ein anderes Individuum. Bekanntlich befasst sich ja die Attributionsforschung damit, zu untersuchen, welche Ursachen bestimmten Verhaltensweisen von einem Menschen zugeschrieben werden. Dazu gehört natürlich auch, zu untersuchen, wie eigenes Verhalten beurteilt wird. Dies ergibt die Überschneidung mit dem Dezentrierungsphänomen. JAEGGI verweist auf Untersuchungen von JONES & NISBETT (1971), die in der Beurteilung von Verhaltensweisen dem Beobachter als Ursache von Verhaltensweisen stabile Persönlichkeitsbezüge, dem Akteur hingegen spezifische situationale Umstände nachweisen. Gelingt es einem Individuum beide Positionen durchzuspielen, kann es zu einer differenzierteren Beurteilung fremden und eigenen Verhaltens kommen. 10.7 MEWES Konzeptbildungen bei Verhaltensauffälligkeiten Nach MEWE (1978) bedeuten Verhaltensstörungen Einschränkungen des Handelns. Er weist darauf hin, dass sowohl aggressiv, wie aber gehemmt verhaltensauffällige Kinder ein geringeres Verhaltensrepertoire aufweisen, denn nicht verhaltensauffällige Kinder. „Die Verhaltensgestörten zeigen somit keine qualitativ anderen, sondern nur weniger verschiedene und zeitlich anders verteilte Handlungsweisen als die Normalen“ (MEWE 1978, 190). Die potentiellen Verhaltenseinheiten sind sowohl bei Verhaltensauffälligen wie bei Nicht-Verhaltensauffälligen gleich, nur in den realisierten Verhaltenseinheiten unterscheiden sie sich. MEWE geht davon aus, dass bei der kognitiven Verarbeitung einer Problemsituation bei Verhaltensauffälligen die einzelnen potentiellen Verhaltenseinheiten nicht alle die gleiche Chance haben, ausgewählt zu werden. Verhaltensauffälliges Verhalten besitzt häufiger die Wahrscheinlichkeit aufzutreten. Es ist durch höhere Ungleichverteilung auch leichter vorhersagbar. Aus diesem Modell leitet MEWE nun ab, dass Verhaltensauffällige weniger als NichtVerhaltensauffällige in der Lage sind, Verhaltensweisen zu aktualisieren, die ausserhalb eingefahrener Normen liegen. Deshalb wenden sich Verhaltensauffällige eher verstärkt ihrer Umgebung zu. Das hat zur Folge, dass eigene Erfahrungen ungenügend ausgewertet werden. Verhaltensauffällige müssen deshalb besonders in zwei Bereichen besonders gefördert werden: - Im Bereich der Selbstsicherheit und - Im Bereich des Interesses am eigenen Gedächtnis (vgl. MEWE 1978, 192). 10.8 Die Handlungsentwürfe von SCHELL zur Konfliktlösung SCHELL (1978) versucht ‚Verhaltensauffälligkeit‘ und ‚Konfliktlösung‘ in Zusammenhang zu bringen. Nach SCHELL sind Konflikte dadurch gekennzeichnet, dass Aktivitäten nicht mitinander zu vereinbaren sind. Diese Unvereinbarkeit ergibt das Vorhandensein mehrerer Verhaltenstendenzen, die gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig beeinflussen. Nach SCHELL ist es nun nicht richtig, Konflikte allein negativ zu bewerten, denn Spannungszustände vermögen Lernprozesse in Gang zu setzen sowie Sozialerfahrungen zu initiieren. Kompromisse bzw. Konfliktbewältigung lassen sich nur in und mit Konflikten bewältigen. Die Fragestellung, wonach Konflikte zu vermeiden sind, ist deshalb sicher zu verwerfen. Die Fragestellung muss vielmehr lauten: „Wie können in einer Konfliktsituation konkurrie62 rende Prozesse zugunsten von kooperativen Lösungsstrategien verändert oder vermieden werden“ (SCHELL 1978, 200). Die Erklärung von Konflikten darf aber nicht nur in der Erfassung aktueller Situationen stecken bleiben, sondern muss z. B. auch die Sozialisationsbedingungen, die Schulorganisation sowie Wertorientierungen, die in einer Gesellschaft (evtl. in einer Subgruppe) vorherrschen, berücksichtigen. MINSEL (in: SCHELL 1978) legt ein Schema vor, in dem er die unmittelbaren Konfliktkonsequenzen darstellt. Dabei lassen sich eine Reihe von Verhaltensweisen finden, die auch für die Kennzeichnung von Verhaltensauffälligkeit Gültigkeit haben: Psychischer Bereich Konfliktauswirkung Kognition rigides Denken, verminderte Interessenbreite, geringer Ideenreichtum, verminderter Sprachwortschatz Emotionalität starke Erregung, Verunsicherung, Stimmungsschwankungen, verminderte Motivation Sensorik/Physiologie starke Wahrnehmungsselektivität, erhöhte psychgalvanische Reaktion, Übersensibilität (vgl. MINSEL, in: SCHELL 1978, 204). Eine Teufelskreis ergibt sich durch den Umstand, dass z. B. Desorientierung, hoher Erregungsgrad usw. zu Fehlinterpretationen von Situationen und damit zu neuen Konflikten führen. Die Realisierung dieser Ziele in einem Programm zur Konfliktbewältigung impliziert: - Das Bereitstellen von Handlungsentwürfen zur Beilegung aktueller Konflikte für die beteiligten Parteien und mögliche, nicht direkt betroffene Schlichter (Regelung des Konfliktverlaufs) - Handlungsentwürfe für die Aufarbeitung von Gegensätzlichkeiten, die Konflikte ausgelöst haben (Konfliktverarbeitung) - Langfristig wirksame Sozialisationspraktiken, die zu einer Desensibilisierung im subjektiven Ertragen von Dissonanzen führen und Individuuen dazu befähigen mit Konflikten progressiv umzugehen. 10.9 Zusammenfassung Zusammenfassend formulieren wir: Verhaltensauffälligkeit stellt sich uns in dem beschriebenen Zusammenhang dergestalt dar, dass ein Individuum situative Anforderungen nicht oder nicht mehr oder nur partiell in Handlungspläne zu transformieren in der Lage ist. Es kommt zu einer kognitiven Desorganisation, die das Individuum zumeist als Angst erlebt, die seine Handlungsfähigkeit noch weiter einschränkt. Angstvermeidungsprozesse, Fluchtverhalten lassen das Individuum Reize verzerrt wahrnehmen, inadäquate Sichtwei63 sen aufrecht erhalten, weil damit kurzfristig Angst abgebaut werden kann. In der Folge verzichtet das Individuum auf konfliktlösungsbezogene Aktivitäten und flüchtet sich einerseits in ein planloses und andererseits stereotypes Verhalten. Jedes Individuum muss die Erfahrung machen, dass es in der Lage ist, wiederholt die Lösung persönlich bedeutsamer Probleme zu meistern, soll es zu einer offenen Haltung gegenüber der Umwelt kommen. Diese Offenheit ist es dann wieder, die dem Individuum neue Erfahrungen verschafft, es Umweltreize ungehindert und unverfälscht aufnehmen lassen. Damit wird es fähig, Unstimmigkeiten sensibel wahrzunehmen und situationsadäquat zu agieren bzw. reagieren. 64 11. Literatur Allen, V.L.: Personality correlats of pverty. In : Allen, V. L. (Hrsg.) : Psychological factors in poverty. Chicago 1970, 242 – 286 Bandura, A.: Social learning theory. Morristwon 1971 Beck, A.T.: Cognitive therapy: Nature and relation to behavior therapy. In: Behavior therapy 1, 1970, 184 – 200 Becker, W.C.: Consequences of different kind of parentel idiscipline. In: Hoffmann, M.L. & Hoffmann, W.W. (Hrsg.) 54, Review of child development research. New York 1964 Berger, P.L./Luckmann, T.L.: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt/M. 1970 Bernstein, B.: Studien zur sprachlichen Sozialisation. Düsseldorf 1972 Blumer, H.: Der methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus. In: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hrsg.): Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit. Bd. 1, Reinbek bei Hamburg 1978 Borke, H.: Interpersonal perception of young children: egocentrism or empathy. In: Development Psychology 5, 1971, 263 – 269 Ders.: Piaget’s mountains revisited. Changes in the egocentric landscape. In : Developmental Psychology 2, 1975, 240 – 343 Bronfenbrenner, U. : Socialization and social class through time and space. In : Maccoby, E.E., Newcomb, T. M. & Hartley, E. L. (Hrsg.): Readings in social psychology. New York 1958 Brumlik, M.: Der symbolische Interaktionismus und seine pädagogische Bedeutung. Frankfurt/M. 1973 Bruner, J.: Studien zur kognitiven Entwicklung. Stuttgart 1971 Chandler, M. J.: Egocentrism in normal and pathological development. In: Monks, F.H., Hartrup, W.W. & De Wit, J. (Hrsg.): Determinants of behavioral development. New York 1972, 569 – 575 Ders.: Egocentrism and antisozial behaviorf: the assessment and training of social perspective skills. In: Developmental Psychology, 8, 1973, 326 – 332 Claessens, D.: Rolle und Macht. München 1970 Coie, J.D. et al.: Sex difference in the intellectual structure of social interaction skills. In : Developmental Psychology, 8, 1973, 261 – 267 Costanzo, P.P. et al. : A reexamination of the effects of intent and consequences in children’s moral judgment. In : Child Development 44, 1973, 154 – 161 Croissier/Hess/Koesting-Gloger : Soziale Kognition im Vorschulalter. Weinheim/Basel 1979 65 Dahrendorf, R.: Homo Sociologicus. Köln/Opladen 1977/15 Däumling, u.a.: Beiträge zum mentalen Training. Frankfurt/M. 1973 Danziger, K.: Readings in child socialization. Oxford 1970 De Vries, R.f: The development of role-taking as reflected in the behavior of bright average and retarted children in a social guessing game. In : Child Development 41, 1970, 760 – 770 Doerner, D. : Die kognitive Organisation beim Problemlösen. Bern 1974 Dreitzel, H.P.: Die gesellschaftlichen Leiden und das Leiden an der Gesellschaft. Stuttgart 1972 Dubin, R. & Dubin, E. R.: Children’s social perceptions, a review of research. In : Child Development 36, 1965, 319 – 337 Elkind, D. : Two approachs of intellgence. Piaget’s psychometric. In : Harvard Educational Review 39, 1969, 319 – 337 Ellis, A. : Die rational-emotive Therapie. München 1973 Erikson, E.H. : Identität und Lebenszyklus. Frankfurt/M. 1966 Ewert, O.M.: Erziehungsstile in ihrer Abhängigkeit von sozio-kulturellen Normen. In: Herrmann, Th. (Hrsg.): Psychologie der Erziehungsstile. Göttingen 1966, 61 - 76 Feffer, M.H.: The cognitive implications of role-taking behavior. In: Journal of Personality 27, 1959, 152 – 168 Ders.: A developmental analysis of interpersonal behavior. In: Psychological Review 77, 1970, 197 – 214 Fend, H.: Gesellschaftliche Bedingungen schulischer Sozialisation. Weinheim 1974 Feshbach, ND. & Feshbach, H.S.: The relationship between empathy and aggression in two age groups. In: Developmental Psychology 1, 1963, 102 – 107 Flavell, J. u.a.: Rollenübernahme und Kommunikation bei Kindern. Weinheim/Basel 1975 Ders.: The developmental psychology of Jean Piaget. Princeton 1963 Flavell, J.D. & Botkin, P.T. : The development of role-taking and communication skills in children. New York 1968 Frank, C.: Die Auswirkungen rhythmischer Elemente auf vegetative Funktionen. In: Harrer, (Hrsg.): Grundlagen der Musiktherapie und Musikpsychologie. Stuttgart 1975, 79 – 90 Frenkel-Brunswik, E.: Intolerance of Ambiguity as an Emotional and Perceptional Personality Variabel. In : Journal of Personality 18, 1945/50, 108 – 143 Furth, H.G. : Piaget and knowledge. Englewood Cliffs 1969 66 Ders. : Piaget für Lehrer. Düsseldorf 1973 Glucksberg, S. u.a.: The development of referential communication skills. In : Horowitz, F.D. : Review of child development research. Vol.4, Chicago 1975, 305 – 345 Goffman, E.: Interaktion: Spass am Spiel – Rollendistanz. München 1973 Goldstein, A.P.: Therapist-patient in Psychotherapy. New York 1962 Graumann, C.F.: Interaktion und Kommunikation. In: Graumann, C.F. (Hrsg.): Handbuch der Psychologie. Bd. 7. Sozialpsychologie, 2. Halbband. Göttingen 1972, 1109 – 1262 Guisberg, H/Opper, S.: Piagets Theorie der geistigen Entwicklung. Stuttgart 1975 Habermas, J.: Erkenntnis und Interesse. Frankfurt/M. 1968 Ders.: Zur Logik der Sozialwissenschaften. Frankfurt/M. 1977/4 Hacker, W.: Allgemeine Arbeits- und Ingenieurpsychologie. Berlin (DDR) 1973 Hamilton, V.: Socialization anxiety and information processing: a capacity model of anxiety-induced performance. In : Sarason et al. (Hrsg.) : Stress and anxiety. Vol. II. New York 1975 Hamlyn, D.W. : Person perception and our understanding of others. In : Mischel, Th. (Hrsg.) : a.a.O., 1 – 36 Hartley, E.L. & Krugman, C.: Note on children’s social role perception. In : Journal of Psychology, 26, 1948, 399 – 405 Hartup, W.W. : Peer interaction and social organication. In : Mussen, P.H (Hrsg.) : Carmichael’s manual of child psychology. Vol.II, New York 1970, 361 455 Hoffman, M.L.: Moral development. In: Mussen, P.H. (Hrsg.): Carmichael’s manual of child psychology. Vol. II, New York 1970, 261 – 360 Ders.: Personality and social development. Annual Review of Psychology, 28, 1977, 295 – 321 Hoffmann, N. : Grundlagen kognitiver Therapie. Bern 1979 Hollos, M.: Logical operations and role-taking abilities in two cultures: Norway and Hungary. In: Child Development, 46, 1975, 638 – 649 Homme, L.E.: Perspectives in psychology. Control of coverants, the operants of the mind. In: Psychological Record 15, 1965, 501 – 511 Hoy, E.E..: Measurement of egocentrism in children’s communikations. In: Developmental Psychology 11, 1975, 392ff. Jannotti, R.I.: The many faces of empathy. An alysis oft he definition and evaluation of empathy in children. Paper presented at the Meeting oft he Society for Research. In: Child Development, Denver 1975 67 Inhelder, B. & Piaget, J.: Die Entwicklung der elementaren logischen Strukturen. Düsseldorf f1973 Jaeggi, E.: Kognitive Verhaltenstherapie. Weinheim/Basel 1979 Joas, H.: Die gegenwärtige Lage der soziologischen Rollentheorie. Frankfurt/M. , 1973 Kamii, C.K. & Radin, N.: Class differences in the socialization practices of negro mothers. Journal of Marriage and the Family, 29, 1967, 302 – 310 Kazdin, A.E.: Role of instructions and reinforcement in behavior changes in token reinforcement programs. In: Journal of Educational Psychology, 64, 1973, 63 – 71 Keller, M.: Kognitive Entwicklung und soziale Kompetenz. Stuttgart 1976 Keller, M. & Weinert, F.E. & Zebergs, D.: Kognitive Sozialisation. In: Neidhart, F. (Hrsg.): Frühkindliche Sozialisation. Stuttgart 1975, 7 – 75 King, M.: The development of some intention concepts in young children. In: Child Development, 42, 1971, 1145 – 1152 Klas, R.A. & Gray, S.: the early training projects for disadvantged children. A report after five years. Monographs of the Society for Research in Child development, 33, (4), Ser. N. 120, 1968 Kohlberg, L.D.: Zur kognitiven Entwicklung des Kindes. Frankfurt/M. 1974 Krappmann, L.: Soziologische Dimension der Identität. Stuttgart 1975/4 König, F.: Problemlösen und kogntive Therapie. In: Hoffmann, N., a.a.O. Kurdek, L.A.: Perceptual, cognitive and affective perspective-taking and empathy in kindergarten through third-grad children. Paper presented at the Meeing oft he Society for Research. In: Child Development, Denver 1975 Lazarus, A.a.: Behavior therapiy and beyond. New York 1971 Leckie, G.: Ontwikkeling van sociale cognitie. Diss., Nijmegen 1975 Linton, R. : The study of man. New York 1936 Livesley, W.J. & Bromley, D.B.: Person perception in childhood and adolescence. London 1973 Luria, A.R. : the role of speech in the regulation of normal and abnormal behavior. New York 1961 Mahoney, M.: Kognitive Verhaltenstherapie. München 1977 Manis, J.G. & Meltzer, B.N. (Hrsg.): Symbolic interaction. Boston 1967 Maratsos, M.P.: Nonegocentric communication abilities in preschool children. In : Child Development, 41, 1973, 697 – 709 68 Masangkay, Z.S. et al. : The early development of inferences about the visual percepts of others. In : Child Development, 45, 1974, 357 – 366 McGuignan, F.J. & Schoonover, R.A. (Hrsg.) : The psychophysiology of thinking. New York 1973 Mead, G.H. : Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt/M. 1978/3 Meichenbaum, D.: Self-instructional methods. In: Kanfer, F.H. & Goldstein, A.P.: Helping people change. New York 1975 Ders.: Cognitive Behavior Modification. New York 1977 Menig-Peterson, C.L.: The modification of communicative behavior in preschool-aged children as a function of the listener’s perspective. In : Child development 46, 1975, 1015 – 1018 Mewe, F. : Konzeptbildungen bei Verhaltensgestörten. In: Fachbereich Sonderpädagogik der PH Reutlingen (Hrsg.): Handlungsorientierte Sonderpädagogik. Rheinstetten 1978 Miller, Galanter & Pribram: Strategien des Handelns. Stuttgart 1973 Miller, P.H./Vessel, F.S. & Flavell, J.H.: Thinking about people thinking about… A study of cognitive development. In : Child development 41, 1970, 613 – 623 Millhofer, P. : Familie und Klasse. Frankfurt/M. 1973 Mischel, Th.: Understanding other person. Oxford 1974 Mischel, W./Ebbesen, E. & Zeiss, A.: Cognitive and attentional mechanismus in delay of gratification. In: Journal of Personality and Social Psychology. 1972, 21, 204 – 218 Mollenhauer, K.: Sozialisation und Schulerfolg. In: Roth, H. (Hrsg.): Begabung und Lernen. Stuttgart 1969, 269 – 296 Müller, E. & Lucas, T.: Peer interaction among toddlers. In : Lewis, M., Rosenblum, L.A. (Hrsg.) : Friendship and peer relations. New York 1975 Natanson, M.: The soical Dynamics of George Herbert Mead. Washington 1956 (Deutsch 1973) Neidhart, F.: Schichtspezfische Elterneinflüsse im Sozialisationsprozess. In: Wurzbacher, G. (Hrsg.): Die Familie als Sozialisationsfaktor. Stuttgart 1968, 174 – 200 Oerter, R.: Moderne Entwicklungspsychologie. Donauwörth 1975 Ders.: Kognitive Sozialisation und subjektive Struktur. München 1977 Oevermann, U.: Sprache und soziale Herkunft. Frankfurt/M. 1971 Parsons, T.: The structure of xocial action. Glencoe. III, 1949 Pavolv, I.P. : Selected works. Moskau 1955 69 Pearl, A.: the poverty of psychology – an indictment. In: Allen, V. (Hrsg.): Psychological factors in poverty. Chicago 1970, 348 – 364 Piaget, J.: Sprechen und Denken des Kindes. Düsseldorf 1972 Ders.: Urteil und Denkprozess des Kindes. Düsseldorf 1972b Ders.: Das moralische Urteil beim Kinde. Frankfurt/M. 1973 Platonov, K.J.: The word as a physiological and therapeutic factor. Moskau 1959 Popitz, H.: Der Begriff der sozialen Rolle. Reihe: Recht und Staat, 331/332, Tübingen 1967 Premack, D.: Catching up with common sense or two sides of a generalization : Reinforcement and punishment. In : Glaser, R. (Hrsg.) : The nature of reinforcement. New York 1971 Ragran, G.A.: Russian physiolpgists, psychology and american experimental psychology. In: Psychological bulletin, 63, 19645, 42 – 64 Raven, J.C.: Standard Progressive Matrices. London 1956 Reinecker, H. : Selbstkontrolle. Salzburg 1978 Robinson, W.R. & Rackstraw, S.J. : Variations in mother’s answers to children’s questions as afunction of social class, verbal intelligence testscores and sex. Sociology 1, 197, 259 – 276 Rohmert, W., u.a. : Das Anlernen sensomotorischer Fertigkeiten. Frankfurt/M. 1971 Rolff, H.G.: Sozialisation und Auslese durch die Schule. Heidelberg 1974 Rose, A.M.: A systematic summary of symbolic interaction theory. In: Rose, A.M. (Hrsg.): Human behavior and social processes. London 1962 Rosenthal, R. : Experiment effects in behavioral research. New York 1966 Rothenberg, B.: Children’s social sensitivity and the relationship to interpersonal competence, interpersonal comfort and intellectual level. In : Development psychology 2, 1970, 335 – 350 Rubin, K.H. : Egocentrism in childhood, an unitary construct ? In: Child Development 44, 1973, 102 – 110 Sarason et al.: Stress and Anxiety. NewYork 1975 Schachter, S. : The interaction of cognitive and physiological determinants of emotional state. In : Berkowitz, L. (Hrsg.): Advances in experiemntal social psychology. New York 1964, 49 – 80 Schachter, S. & Singer, J.E.: Cognitive, social and physiological determinants of emotional state. In: Psychological Review 69, 1962, 379 – 399 Schell, H.: Handlungsentwürfe zur Konfliktlösung. In: Fachbereich Sonderpädagogik der PH Reutlingen (Hrsg.): Handlungsorientierte Sonderpädagogik. Rheinstetten 1978 70 Seiler, B. (Hrsg.): Kognitive Strukturiertheit. Stuttgart 1973 Ders.: Genetische Kognitionstherapie, Persönlichkeit und Therapie. In: Hoffmann, N.: Grundlagen kognitiver Therapie. Bern 1979 Seligman, M.E.P.: Learned helplessness. Annual Review of Medicine 23, 1972, 407 – 412 Selman, R.: a structural anaysis oft he ability to take anothers perspective: stage in the development of role-taking abilities. Philadelphia 1973 Ders.: Social-cognitive understanding. In: Lickonta, T. (Hrsg.): Moral development and behavior. New York 1976 Selman, R. & Byrne, D.F.: Stufen der Rollenübernahme in der mittleren Kindheit – eine entwicklungspsychologische Analyse. In: Dobert, R. u.a.: Die Entwicklung des Ichs. Köln 1977, 109 – 114 Semmer, N. & Frese, M.: Handlungstheoretische Implikationen für kognitive Therapie. In: Hoffmann, N.: Grundlagen kognitiver Therapie. Bern 1979 Shantz, C.U.: The generality and correlates of egocentrism in childhood. Denver 1975 Shaw, W.A.: The relation of muscular action potentials to imaginal weight lifting. Archives of Psychology. Nr. 247, 1940 Skinner, B.F.: Science and human behavior. New York 1953 Spivack, G. & Shure, M.M.: Social adjustment of young children: a cognitive approach to solving reallife problems. San Francisco 1974 Spitz, R.A.: Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen. Stuttgart 1973 Sroufe, L.A.: A methodological and philosophical critique of intervention oriented research. Developmental Psychology 2, 1970, 140 – 145 Staub, E. : The development of prosocial behavior. New York 1975 Strauss, A.L. : The development and transformation of monetary meanings in the child. In : American Sociological Review 17, 1952, 275 – 286 Stryker, S.H. : Die Theorie des Symbolischen Interaktionismus. In: Lüscher, G. & Lupri, E. (Hrsg.): Soziologie der Familie. Sonderheft 14 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 1970, 49 – 67 Tulkien, R.R. & Kazan, J.: Mother-child interaction in the first year of life. Child Development 43, 1972, 31 – 42 Turner, R.H.: Role taking, role standpoint and reference-group behavior. In: American journal of Sociology 1955, 61, 316 – 328 Ders. : Role taking : process versus conformity. In : Rose, A.M. (Hrsg.): a.a.O., 20 – 40 71 Turnure, C.: Cognitive development and role-taking ability in boys and girls from 7 – 12. In: Developmental Psychology 11, 1975, 202 – 209 Van Lieshout et al.: Beinvloeding van social gedrag in de school. Pädagogische Studien 50, 12973, 437 - 449 Volpert, W.: Sensumotorisches Lernen. Frankfurt/M. 1973 Ders.: Handlungsanalyse. Köln 1974 Waller, M.: Kooperatives Verhalten im Verständnis von Kindern als symbolischer Austauschprozess: Stärke und Bedingungen der Norm des symmetrischen Austausches in den Verhaltenserwartungen 4 – 9jähriger Kinder. In: Zeitschrift für Sozialpsychologie 1973, 4, 51 – 61 Ders.: Soziales Lernen und Interaktionsprozess. Stuttgart 1978 Watson, J.B.: Behaviorismus. Chicago 1924 Weinert, F.E.: Schule und Beruf als institutionelle Sozialisationsbedingungen. In: Graumann, C.F. (Hrsg.): Handbuch der Psychologie. Band 7: Sozialpsychologie. 2. Halbband. Göttingen 1972, 825 – 885 Weinstein, E.A.: The devolopment of interpersonal competence. In: Goslin, D.A.: Handbook of socialisation theory and research. Chicago 1969 Wolpe, J.: the pracice of behavior therapy. New York 1969 (Deutsch: 1972) Zigler, E.F. & Child, J. L.: Socialization. In: Lindsey, G. & Aronson, E. (Hrsg.): The handbook of social psychology. Vol.3, Reading (Mass.) 1969, 450 - 489 72 73