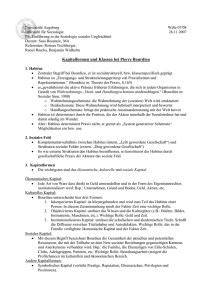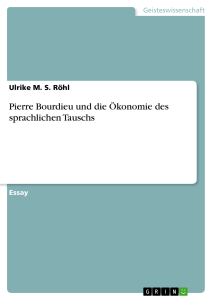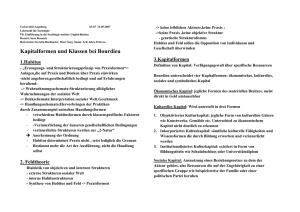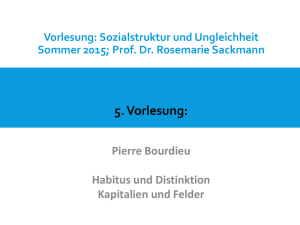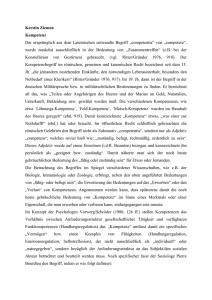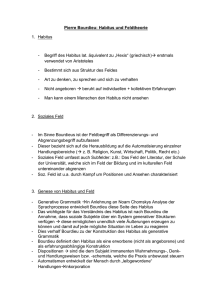Kapital und Klassen als Position in sozialem Raum und Feldern
Werbung
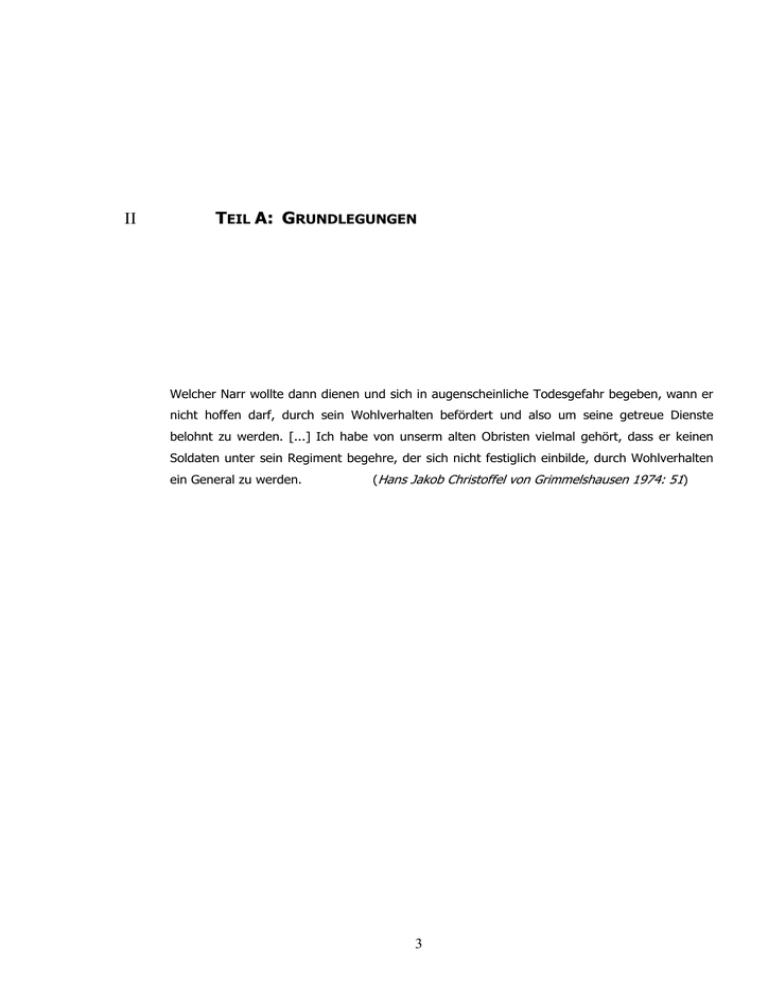
II TEIL A: GRUNDLEGUNGEN Welcher Narr wollte dann dienen und sich in augenscheinliche Todesgefahr begeben, wann er nicht hoffen darf, durch sein Wohlverhalten befördert und also um seine getreue Dienste belohnt zu werden. [...] Ich habe von unserm alten Obristen vielmal gehört, dass er keinen Soldaten unter sein Regiment begehre, der sich nicht festiglich einbilde, durch Wohlverhalten ein General zu werden. (Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen 1974: 51) 3 II. 1 BOURDIEUS MATERIALISTISCHE ANTHROPOLOGIE SOZIALER HERRSCHAFT II. 1.1 KAPITAL UND KLASSEN Als zwei der wesentlichen Gründerväter einer empirischen und theoretischen Wissenschaft vom Sozialen, wissen sich der ‚konservative’ Kantianer Emile Durkheim und der ‚revolutionäre’ Hegelianer Karl Marx ein einem wesentlichen Punkt einig: „Uns dünkt die Idee fruchtbar“, so Durkheim „wonach das soziale Leben nicht durch die Auffassung, der an ihm Teilnehmenden erklärt werden kann, sondern durch tieferliegende Gründe, die sich dem Bewusstsein entziehen“ (zit. nach Bourdieu 1992: 136 f). So plausibel die Sicht auch sein mag1, hat eine nahezu diametral entgegen gesetzte Perspektive diese sozialwissenschaftliche Form der ‚Kränkung’ ‚nicht Herr im eigenen Hause zu sein’ (vgl. Freud 1916) entschieden zurückgewiesen. Die „lebenden, handelnden und denkenden menschlichen Wesen“ schreibt etwa Alfred Schütz (1971: 68) „haben die Welt, in der sie die Wirklichkeit ihres täglichen Lebens erfahren, in Folge von Konstruktionen des Alltagsverstandes bereits vorher ausgesucht und interpretiert. Diese ihre eigenen gedanklichen Gegenstände bestimmen ihr Verhalten indem sie es motivieren“. Es gibt inzwischen einige, elaborierte Ansätze diese beiden Denkweisen, den ‚Strukturalismus’ und den ‚Konstruktivismus’ zusammenzubringen2, um Aufklärung über das Verhältnis von makrosozialen Strukturen und dem mikrosozialen Handeln der Subjekte zu schaffen. Neben dem Strukturierungstheorie von Anthony Giddens (vgl. 1984), gehört der Ansatz des Soziologen Pierre Bourdieu zu den am meisten beachteten Entwürfen um diese Zusammenhänge in den Blick zu nehmen: „Hätte ich meine Arbeit in zwei Worten zu charakterisieren“ schreibt Bourdieu (1992: 135) „würde ich von strukturalistischem Konstruktivismus oder von konstruktivistischem Strukturalismus sprechen [...]. Mit dem Wort ‚Strukturalismus‘ oder ‚strukturalistisch‘ will ich sagen, dass es in der sozialen Welt selbst [...] objektive Strukturen gibt, die vom Bewusstsein und Willen der Handelnden unabhängig und in der Lage sind, deren Praktiken und Vorstellungen zu leiten und zu begrenzen. Mit dem Wort ‚Konstruktivismus‘ ist gemeint, dass es eine soziale Genese gibt einerseits der Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, die für das konstitutiv sind, was ich Habitus nenne, andererseits der sozialen Strukturen und da nicht zuletzt jener Phänomene, die ich als Felder und als Gruppen bezeichne, insbesondere die herkömmlicherweise so genannten sozialen Klassen.“ Allerdings wäre es stark verkürzt das Oeuvre Bourdieus lediglich als einen weiteren Entwurf im sozialwissenschaftlichen wie -philosophischen Dauerstreit um das Verhältnis von Handlung und Struktur zu verstehen, obschon sich dieser - man werfe nur einen Blick auf die Positionen von Augustinus und Martin Luther zur Frage des freien und des unfreien Willens – nicht zuletzt als eine sekularisierte Form einer der zentralsten Dispute okzidentaler Denk- und Kulturgeschichte darstellt. Das zentrale Thema der Arbeiten Bourdieus ist die Frage nach den Mechanismen der (Re-) Produktion gesellschaftlicher Strukturen im praktischen Handeln sozialer Akteure. Sein gesamtes Werk lässt sich als eine „materialistische Anthropologie des spezifischen Beitrags interpretieren, den die verschiedenen Man denke etwa an die klassischen, gerade nicht durch den bloßen bewussten Willen der Akteure – schon gar nicht den der Proletarier, Frauen und Migranten – getragenen, gesellschaftlichen Strukturgrößen ‚class’, ‚gender’, ‚race’. 2 Zur Aktualität dieser Frage im Bereich sozialer Probleme siehe die Beiträge in Groenemeyer 2001b. 1 4 Formen der symbolischen Gewalt zur Reproduktion und Transformation der Herrschaftsstrukturen leisten” (Bourdieu/Wacquant 1996: 34). Ausgangspunkt des zu einer „allgemeine[n] Theorie der Ökonomie von Handlungen […] verallgemeinerten Materialismus“ Bourdieus (zit. bei Schmeiser 1985: 173) ist ein – von Max Weber kaum weniger als von Marx beeindrucktes - Konzept von Klasse, in dem eine ökonomische Fokussierung traditioneller Klassenkonzepte um die Dimensionen kultureller Ressourcen und sozialer Beziehungen erweitert wird. Alle drei Dimensionen stellen dabei ‚relativ autonome‘, d.h. nicht restlos aufeinander rückführbare, sondern logisch unabhängige Ressourcen dar (vgl. Kreckel 1992: 65). Auf dieser Basis ist es möglich, den primär auf vertikale Macht- und Ungleichheitsdimension verweisenden, und damit für die Analyse modernder, ausdifferenzierter Gesellschaften nicht mehr hinreichenden, traditionellen Klassenbegriff um horizontale Ebenen zu erweitern, ohne die vertikale Dimension analytisch aufzugeben. Epistemologisch wird dabei eine substantialistische Analyse- und Denkweise abgelehnt, ohne eine Analysen auf die Betrachtung einer ‚subjektivistischen’ Unmittelbarkeit bzw. die Unmittelbarkeit des ‚social acts’, zu reduzieren (vgl. Fröhlich 1994: 33). Die Relativierung einer Privilegierung von Substanzen – Stuart Hall (1989: 11 ff) zu Folge eine entscheidende Fehlinterpretation des Marxschen Materialismus - erfolgt in Bourdieus Oeuvre zu Gunsten einer strikten Betonung von Relationen. Einem ‚praxeologischen’ Erkenntnismodus, wie ihn Bourdieu vorschlägt, liegt der Gedanke zu Grunde, dass die Logik einer Praxis in der Erfahrung ihres Vollzugs auf Seiten der handelnden Akteure einen ‚praktischen Sinn’ induziert, der ihren Handlungsvollzügen wiederum selbst zu Grunde liegt. Dadurch werden die Strukturen der individuellen wie interindividuellen Praxis strukturiert und tendenziell auch reproduziert. In diesem Erkenntnismodus werden jene - für traditionelle Klassentheorien keinesfalls atypischen - totalisierenden Vorstellungen abgelehnt, die versuchen ‚Gesellschaft’ auf ein singuläres Funktionsprinzip zurückzuführen. An die Stelle einer solchen Vorstellungen tritt ein Konzept von sozialer Welt als multidimensionalem sozialen Raum, in dem theoretisch gehaltvolle und empirisch rekonstruierbare Hauptfaktoren sozialer Differenzierung (vgl. Bourdieu 1997b), ebenso rekonstruiert werden können wie die für die Konstitution sozialer Praktiken wesentliche Dimension einer ungleichen Verteilung materieller wie symbolischer Ressourcen. Die theoriearchitiektonische Konsequenz eines solchen Erkenntnismodus besteht in der Konstruktion eines vergleichsweise abstrakten Raummodells, in dem das Verhältnis von theoretisch - gemäß ihrer relationalen Stellung zueinander - konstruierten Klassen, zu den empirischen Praxisweisen - und ‚Kämpfen’ - gesellschaftlicher Klassen und Gruppen thematisiert wird. Auf dieser Basis wird eine ‚allgemeine’ - d.h. nicht nur fiskalische sondern auch kulturelle, soziale und symbolische – ‚Ökonomie’ elaboriert und der Entwurf einer analytischen Soziologie symbolischer Kämpfe um die (‚legitme’) Repräsentation der sozialen Welt vorgestellt. Auf einer ersten Analyseebene dieses Modells wird der soziale Raum, als ein Raum ‚objektiver’ sozialer Positionen entworfen, der ein Ensemble sozialer Kräfteverhältnisse im Sinne einer ‚Sozialtopologie’ skizziert. Einzelne oder Gruppen von Akteuren werden dabei durch ihre relative Stellung innerhalb eines solchen Raums definiert, d.h. „durch Nähe, Nachbarschaft oder Ferne sowie durch ihre relative Position, oben oder unten oder auch zwischen bzw. in der Mitte usw.” (Bourdieu 1992: 138, vgl. 5 Bourdieu 1985). Solche ‚Klassen auf dem Papier’ bezeichnen zunächst kaum mehr als eine Art soziales ‚Ranking’, in dem Positionsinhaber zusammengefasst werden, die sich in der Topologie des sozialen Raums nahe stehen (vgl. Bourdieu 1985a). Die so konstruierten ‚Klassen’ stehen in einer gewissen Analogie zu den ‚Klassen an sich’ im Sinne von Hegel und Marx. Als ‚objektive‘ Klassen sind sie nicht identisch mit einer politisch für gemeinsame Ziele mobilisierbaren und gegen eine andere Klasse ‚kämpfenden’ ‚Klasse für sich’ (vgl. Bourdieu 1998: 24 vgl. Marx/Engels 1989, Weber 1980: 177ff, 514ff). ‚Objektive’ Klassen, wie sie Bourdieu konstruiert, sind keine durch ein gemeinsamen ‚Willen und Bewusstsein’ geprägte soziale Gruppen, sondern eher durch ein ‚Klassenunbewusstsein’ gekennzeichnet. Zunächst sind sie in der Regel, wie es Marx (1973: 198) formuliert hat, „unfähig, ihr Klasseninteresse im eigenen Namen [...] geltend zu machen“. ‚Klasse‘ ist bei Bourdieu also ein primär analytischer, kein politischer Begriff. ‚Objektive’ Differenzen zwischen Gruppen als ‚Klassendifferenzen’, stellen nur eine Potentialität dar, die vermittelt über das, was Bourdieu als ‚symbolisches Kapital’ bezeichnet, erst in inhaltlich ‚sinnvolle‘ und handlungsrelevant wirksame Differenzierungen und Klassifizierungen transformiert werden (können). „Eine theoretische Klasse oder eine ‚Klasse auf dem Papier’ kann als eine wahrscheinliche reale Klasse angesehen werden, deren Bildungselemente auf der Basis ihrer Ähnlichkeiten (hinsichtlich des Interesses und der Dispositionen3) zusammengebracht und mobilisiert werden können (aber aktuell nicht mobilisiert worden sind)”. (Bourdieu 1997b: 113) Klassen auf der Basis ihrer Stellungen im Raum ‚herauszupräparieren’, bedeutet aber dennoch mehr, als ein beliebiges Ensemble von Akteuren analytisch abzubilden, das eine wie auch immer vergleichbare soziale Position einnimmt. Eine zentrale These Bourdieus lautet, dass diese sozialen Akteure - als Klassensubjekte - ähnlichen äußerlichen Bedingungen und Konditionierungen unterworfen sind, sowie, bezogen auf eine subjektive, verinnerlichte Dimensionen dieser Unterworfenheit, der Tendenz nach ähnliche Dispositionen, Präferenz- und Praxisschemata sowie vergleichbare Interessen herausbilden (vgl. Bourdieu 1985, 1997b). Klassen bei Bourdieu sind demnach durch Wahrnehmungs- und Gewohnheitsgemeinsamkeiten zwischen subjektiver Praxis und objektiver Lage rekonstruierbare Gruppierungen (vgl. Köhler 2001: 106), die weder (nur) als Konstrukte einer ‚objektiven’ topologischen Position noch durch spezifische, ihnen immanente, raum-zeitlich invariante Merkmale definiert werden können, sondern erst „durch die Struktur der Beziehungen zwischen allen relevanten Merkmalen, die jeder derselben wie den Wirkungen, welche sie auf die Praxisformen ausübt, ihren spezifischen Wert verleiht” (Bourdieu 1982: 182). Ein solcher Klassenbegriff synthetisiert also einen Begriff der Klassenstellung, als relationale Bestimmung im positionalen Gefüge mit dem Moment der Klassenlage als ‚objektive’ Merkmalskombination. Auf dieser Basis entwirft Bourdieu ein Modell sozialer Realität als eine Gesamtheit aller ‚unsichtbaren Beziehungen’, die einen relationalen sozialen Raum bezeichnen, der sich erst durch die einander Der Begriff ‚Disposition‘ ist dabei nicht als quasi-natürliche charakterliche Eigenschaft einer ‚Person’ im Sinne einer Veranlagung zu verstehen, sondern im Sinne einer über den aktualen Moment der Erfahrung hinausreichende Inkorporierung von Haltungen gegenüber äußeren Praxisbedingungen die im Vollzug der hierin eingebetteten Praxis produziert und reproduziert werden. (Für Hinweise auf epistemologische und analytische Probleme im Gebrauch des Dispositionsbegriffs danke ich Prof. Norbert Meder) 3 6 äußerlichen, durch ihren je relativen Abstand zueinander definierten sozialen Positionen konstituiert (vgl. Bourdieu 1997b: 106). Dies impliziert die soziale Welt topologisch als ‚Raum von Beziehungen’ (vgl. Bourdieu 1985: 13) zu betrachten, der weniger auf das Vorhandensein von Interaktionen oder intersubjektiv ‚wichtigen’ Beziehungen hin ausgerichtet ist, sondern auf „objektive Relationen die ‚unabhängig vom Bewusstsein und Willen der Individuen’ bestehen” (Bourdieu 1996: 127). Der so gefasste ‚soziale Raum’ ist eine konstruierte, abstrakte Darstellung, die „einen Überblick bietet, einen Standpunkt oberhalb der Standpunkte, von denen die Akteure in ihrem Alltagsverhalten […] ihren Blick auf die soziale Welt richten.” (Bourdieu 1982: 277). Diese Darstellung gleicht drei übereinandergelegten (transparenten) ‚Landkarten’, die aus einer übergeordneten, abstrakten Perspektive einen „umfassenden Blick bieten auf die Welt sozialer Klassen, die nach den Gesichtspunkten der (objektiven) Lebensbedingungen, der (symbolischen) Lebensstile und der (inkorporierten) Habitusformen (re-) konstruiert wurde” (Schwingel 1993: 28). ‚Gesellschaft’ wird im Sinne eines solchen sozialen Raums nicht als eine organische Einheit oder ein singuläres Regelsystem verstanden, sondern als eine Gesamtschau, eine synchroner Schnitt durch eine Vielzahl relativ autonomer ‚sozialer Felder’, die die Gesellschaft differenzieren. Der Verzicht auf einen einheitlichen Gesellschaftsbegriff, der die Organisationsprinzipen einer gesamten gesellschaftlichen Organisation analytisch zu fassen in der Lage wäre, kann als eine zentrale Schwäche dieses Ansatzes betrachtet werden, sofern er nicht nur zur Analyse der Dynamiken innerhalb einer gesellschaftlichen Formation, sondern zur Analyse und Interpretation des Wandels ‚der Gesellschaft’ herangezogen werden soll. Für die Rekonstruktion der Dynamiken innerhalb eines gesellschaftlichen sozialen Raums weist der Begriff des Feldbes, definiert als „ein Netz oder eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positionen“ (Bourdieu/Wacquant 1996: 127) jedoch analytische Vorteile auf: „[I]n advanced societies, people do not face an undifferentiated social space. The various spheres of life, art, science, religion, the economy, politics and so on, tend to form distinct microcosms endowed with their own rules, regularities and forms of authority – what Bourdieu calls fields. A field is, in the first instance, a structure of space positions, a force field that imposes its specific determinations upon all those who enter it”4 (Wacquant 1998: 221) Der Begriff des sozialen Raums dient bei Bourdieu als eine Art Synonym für eine in ihrer Formation nicht näher bestimmte ‚Gesellschaft’ und bietet einen abstrakten Überblick über die soziale Welt. Sein analytischer Schwerpunkt liegt aber nicht auf diesem Raum als Gesamtheit, sondern auf den differenziellen Regelmäßigkeitssystemen innerhalb dieses Raums: den sozialen Feldern, verstanden als „kleine, relativ autonome soziale Welt[en] innerhalb der großen sozialen Welt“ (Bourdieu 2001: 41). Während das theoriearchitektonisch weniger zentrale, heuristische Modell des sozialen Raums bei Bourdieu vor allem dazu dient, eine Momentaufnahme eines synchronen Zustand in seiner Gesamtheit zum Ausdruck bringt, liegt der Schwerpunkt für Analyse eines Feldes auf einer diachronen Perspektive, d.h. der Dynamik der relationalen Entwicklung je wirksamer Kräfteverhältnisse. Dabei finden sich viele der Eigenschaften, Beziehungen und Prozesse im sozialen Raum zwar Prinzip auch in den einzelnen „An autonomous field is characterised by a high level of specificity: it possesses its own history; a particular configuration of agents operate within it and struggle for a distinctive stake; it induces its own habitus and upholds a distinctive set of beliefs. 4 7 sozialen Feldern, nur bestehen sie hier in einer je besonderen, teilweise ungleichzeitigen Form. Das Feld als ein relativ autonomer sozialer Mirkokosmos „ist zwar wie der Makrokosmos sozialen Gesetzen unterworfen, aber es sind nicht die selben […, o]bwohl er sich nie ganz den Zwängen des Makrokosmos entziehen kann“ (Bourdieu 1998: 18). Der Beschreibung eines Feld als einem spezifischen Handlungskontext kommt in den Analysen Bourdieus eine quasi-differenzierungstheoretische Funktion zu, die - analog zu dem Begriff des ‚Frame’ bei Goffman, ‚Systemen’ bei Luhmann oder der ‚Sinnprovinzen’ bei Schütz - die je gültigen Klassifikationskriterien im ‚Kampf’ um die Geltendmachung sozial konstruierter Wirklichkeit und Sinn bezeichnet. Ein soziales Feld bildet einen „potentiell offenen Spiel-Raum mit dynamischen Grenzen, die ein im Feld umkämpftes Interessenobjekt darstellen” (Bourdieu/Wacquant 1996: 135) und bezeichnet in so fern ein relativ autonomes Kampffeld im Sinne einer gesellschaftlichen Arena permanenter Auseinandersetzung zwischen unterschiedlich positionierten, agonalen Akteuren, die entsprechend der spezifischen Einsätze, die in diesen Arenen erforderlich sind, um ‚Gewinne’, d.h. um soziale Vorteile, Ressourcen, Positionen innerhalb einer allgemeinen Ökonomie von Handlungspraxen ebenso ringen, wie um materielle oder symbolische Anerkennung und d.h. im Kontext einer relationalen Perspektive auf die soziale Welt5 nicht anderes als um Macht. Die Beschreibung eines sozialen Feldes als relativ autonom besitzt zwar z.B. Gemeinsamkeiten zu dem von Luhmann verwendeten Begriff der ‚Selbstreferenz’, ist aber ein weniger ‚starker’ Begriff der analytischen Begrenzung. Sie verweist primär eine Konfiguration objektiver Relationen zwischen sozialen Positionen, die von spezifischen Verteilungsstrukturen und ‚Kraftlinien’ - unter anderem im Sinne besonderer Formen und Kombinationsformen von (mimetischen) Denkweisen, institutionalisierter Regelungen und Regulation, sowie praktischer Erfolgsbedingen - durchzogen ist und in sofern eine eigene, von anderen Feldern unterscheidbare Regelmäßigkeitsstruktur besitzt. Vor allem aber sind Felder sensu Bourdieu nicht durch ihre bloße innere Dynamik, gemeinsame Funktionen, interne Kohäsion und Selbstregulierung in abstrakt-theoretisch formulierbaren, funktionalen Grenzen eines Systems beschreibbar. Im Gegensatz zur tendenziell ‚subjektfreien’ Funktionalität sozialer Prozesse und Strukturen, die im Systembegriff Luhmanns angelegt sind, konkretisiert sich ein soziales Feld im Sinne Bourdieus erst im habituell vermittelten Zusammenwirken dieser Strukturen mit der Praxis handelnder ‚Subjekte’ - genauer ‚subjektivierter’6 sozialer Akteure. Ein Feld beschreibt in so fern keine ‚bloßen’ Sinnverhältnisse, bzw. Sinnzusammenhänge im Sinne Webers, sondern einen Raum materieller wie symbolischer Kräfteverhältnis, „die allen in das Feld eintretenden gegenüber sich als Zwang auferlegen und weder auf die individuellen Intentionen der Einzelakteure noch auf deren direkte Interaktionen zurückführbar sind“ (Bourdieu et al. 1981: 181) sowie „von Such an autonomous field is highly differentiated and marked by sharp boundaries, beyond which the field ceases to have any impact on practice” (Peillon 1998: 215). 5 Obwohl auch Axel Honneth (1992) von ‚Kämpfen um Anerkennung’ spricht, unterscheidet sich der, in philosophischer Hinsicht eher durch Kant beeindruckte, ‚symbolische Materialismus’ Bourdieus (auch) in diesem Punkt von dem hegelianischen Ansatz Honneths. 6 Der Ausdruck ‚Subjektivierung’ geht auf die Arbeiten Michel Foucaults zurück, beschreibt aber auch durchaus treffend die Form und Genese der ‚Subjektstellung’ die Bourdieu sozialen Akteuren zuspricht (vgl. Bourdieu 2001, im Überblick Bublitz 2001) 8 Kämpfen um die Veränderung dieser Verhältnisse und folglich ein[en] Ort permanenten Wandels” (Bourdieu/Wacquant 1996: 135). ‚Kohärenz’, im Sinne einer Ausrichtung auf eine einheitliche Funktion, kann aus dieser Perspektive nicht als Produkt einer immanenten Eigenentwicklung der Struktur verstanden werden. Sie erscheint nur im synchronen Schnitt einer Momentaufnahme als analytisch fixierbarer Zustand, der ein Zwischenergebnis vorgängiger und aktueller Auseinandersetzungen bzw. Kämpfe darstellt. Von ‚Kämpfen’ ist bezogen auf die Feldkonstitutionsprozess doppelter Hinsicht zu sprechen: den ‚materiellen’ hinsichtlich der Ziele und Vereilungen der Mittel in einem Feld und den ‚symbolischen’ hinsichtlich der Legitimation und Wertigkeit der Mittel und Einsätze. Wenn aber in jedem der sozialen (Kräfte-)Felder ständige Kämpfe um die Positionen in diesen Feld stattfindet, ist die Verortung in diesen Feldern, und damit verbunden die ‚Produktion’ eines sozialen Feldes selbst, als dynamischer Vorgang zu betrachten. Dabei bestimmt das, was Bourdieu als ‚Kapital’ bezeichnet, den Zugang zu den feldspezifischen Profiten wie die Stellung des Akteurs in den je einzelnen sozialen Felder und damit mittelbar auch im sozialen Raum. „Kapital […] stellt Verfügungsmacht im Rahmen eines Feldes dar, und zwar Verfügungsmacht über das in der Vergangenheit erarbeitete Produkt, wie zugleich über die Mechanismen zur Produktion einer bestimmten Kategorie von Gütern, und damit über eine bestimmte Menge an Einkommen und Gewinnen. Gleich Trümpfe in einem Kartenspiel, determiniert eine bestimmte Kapitalsorte die Gewinnchancen in einem entsprechenden Feld (faktisch korrespondiert jedem Feld oder Teilfeld die Kapitalsorte, die in ihm als Machtmittel und Einsatz im Spiel ist)” (Bourdieu 1985: 10). Die Wertigkeit dieser Kapitalen bzw. Machtmittel ist feldspezifisch, d.h. ihre Wirksamkeit und Wertigkeit ist an die an die materiellen und symbolischen Verteilungsstrukturen in einem sozialen Feld gebunden: Es ist „eine soziale Energie, die Bestand und Wirkung nur in dem Feld hat, in dem sie sich produziert und reproduziert“ (Bourdieu 1982: 194). Daher stellt einem sozialen Feld auch nur jene, per se beliebige Eigenschaft oder Ressource ein Kapital dar, die in der ‚Ökonomie’, d.h. der Rationalität der Praxis eines spezifischen Feldes auch tatsächlich wirksam. Es ist nicht also das das materielle oder immaterielle Substrat eines möglichen ‚Kapitals‘, sondern „die spezifische Logik des Feldes […die] diejenigen Merkmale [bestimmt], vermittels deren sich die Beziehungen zwischen Klasse und Praxis herstellen” (Bourdieu 1982: 193 f). Bourdieu verwendet damit einen weit gefassten Kapitalbegriff, der wegen einer Überbetonung der Ebene der Zirkulation, einer mangelnden Rückführung auf gesellschaftliche Arbeit, der verallgemeinernden Zusammenführung von Basis und Überbau der Ignoranz des Zusammenhangs von Akkumulation und Mehrwertproduktion und damit der Aufgabe einer Fassung von Kapital als gesellschaftliches Verhältnis, das in letzter Instanz auf Ausbeutung von Arbeitskraft beruht kritisiert worden (vgl. Krais 1983, Herkommer 1996, Diettrich 1999, Fine 2001, Bischoff et al. 2002). So sinnträchtig diese Kritik an der Kapitalkonzeption Bourdieus aus einer im weitesten Sinne ‚marxistischen’ Perspektive auf sein mag, ist es genau diese Konzeption von Kapital, als einem Prinzip der inneren Regelmäßigkeiten der sozialen Welt – und nicht nur ihrer Reduktion auf die Warenökonomie -, die es epistemologisch ermöglicht, eine Dichotomie von reflexiven und präreflexiven ‚Subjektivismen’ und ‚Objektivismen’ zugunsten einer machtproduktions- und machtreproduktionsanalytischen ‚Ökonomie der Praxis’ zu überwinden und dabei auch die Frage von 9 Produktions- und Distributionsverhältnisse, - die im Alltag keinesfalls nur als ‚monetäre’ bzw. materielle erscheinen - in ihren besonderen Formen in den Strukturen von Lebensstil und Lebenswelt analysierbar zu machen. Auch wenn Bourdieu selbst die Begriffe ‚Ressource’ und ‚Kapital’ mit unter als Synonyme verwendet geht sein Kapitalbegriff über ein einfaches ‚Ressourcenmodell’ hinaus. ‚Kapital’ wird explizit als akkumulierte Arbeit thematisiert, die sich um eine ausgebeutete, bzw. privat und exklusiv angeeignete, verdinglichte oder lebendige Arbeit von anderen handeln kann7, aber vor allem durch ihre Eigenschaft definiert ist, „ebenso Profite produzieren wie sich selbst reproduzieren oder auch wachsen” (Bourdieu 1997: 49f) zu können. Kapitale ‚nutzen’ sich also durch ihren Einsatz nicht einfach nur ‚ab’, sondern können ‚investiert’ und durch ihren Gebrauch akkumuliert werden. Neben der Einführung von weiteren Kapitalarten über das ‚ökonomische Kapital’ hinaus, besteht die von Bourdieu unternommene Erweiterung des Kapitalbegriffs vor allem darin, dass Kapital als akkumulierte Arbeit nicht nur in einer materiell-äußerlichen Form eines ‚Gutes’, sondern auch in ‚inkorporierter’, d.h. in einer von Akteuren verinnerlichten, sowie gegebenenfalls auch in einer institutionalisierten Form existieren kann Bourdieu 1986). Dabei ist die private Aneignung von Kapital als sozialer Energie „in Form von verdinglichter oder lebendiger Arbeit möglich. Als vis insista ist Kapital eine Kraft, die den objektiven und subjektiven Strukturen innewohnt; gleichzeitig ist das Kapital – als lex insista – auch grundlegendes Prinzip der inneren Regelmäßigkeiten der sozialen Welt” (Bourdieu 1997: 49f). Ein solcher Kapitalbegriff beruht also nicht, wie es etwa ein der Begriff von Kapitalgütern nahe legen würde, auf einer Fassung von Kapital als einem spezifischen (ökonomischen) Faktor, sondern bezeichnet eine Wirkung gesellschaftlicher Beziehungsstrukturen, deren allgemeine Formulierung das darin angelegte Machtkonzept als Prozess der Akkumulation und Verfügung über gesellschaftliches Arbeitsvermögen darstellt (vgl. Raphael 1987). Das ‚Kapital’ in der ‚Ökonomie der Praxis’ wird demnach nicht analog zu den Konzepten neoklassischer Wirtschaftswissenschaften verstanden8, sondern bezeichnet als Machtmittel in erster Linie die praxisökonomische Fähigkeit, Kontrolle über die eigene und die Zukunft anderer ausüben zu können9 (vgl. Postone et al. 1993: 4). Der Verweiß auf symbolische, sozio-moralische und sozio-kulturelle Momente des Kapitalbegriffs, bietet die Möglichkeit über die ökonomische Sphäre hinaus, Momente askriptiver Dimensionen sozialer Ungleichheit - wie beispielsweise ethnische Stratifizierungen - zu reflektieren, und in ihren Interdependenzen in einen sozialstrukturell fundierten Kontext im Sinne einer materialistischklassentheoretischen Perspektive einzubinden. Damit wird eine systematische Beachtung der Tatsache möglich, dass ökonomische Klassenunterschiede „nicht mehr die einzigen sozialen Unterschiede sind, die das Funktionieren der Gesellschaft“ bestimmen, sondern „die lebensweltliche Handlungswirklichkeit „Capital”, so Bourdieu (1986: 241), „is accumulated labour (in its materialised form or its ,incorporated’, embodied form) which, when appropriated on a private, i.e., exclusive, basis by agents or groups of agents, enables them to appropriate social energy in the form of reified or living labour”. 8 Der „wirtschaftswissenschaftliche Kapitalbegriff“, so die Kritik Bourdieus, „reduziert die Gesamtheit der gesellschaftlichen Austauschverhältnisse auf den bloßen Warenaustausch, der objektiv und subjektiv auf Profitmaximierung ausgerichtet und vom (ökonomischen) Eigennutz geleitet ist. Damit erklärt die Wirtschaftstheorie implizit alle anderen Formen sozialen Austausches zu nicht-ökonomischen, uneigennützigen Beziehungen“ (Bourdieu 1997: 50 f). In diesem Sinne büßt auch die Kritik, dass, gemäß des Konzepts Bourdieus, alles ‚ökonomisch’ und jeder und jede ein ‚Kapitalist’ sei (vgl. Bischoff et al. 2002) an Überzeugungskraft ein. 9 Dies kann je nach Feld und Praxisform potentiell auf jenen Akteur zutreffen (dazu auch Hagan 1989) 7 10 geprägt ist von einem‚ komplexen Mischungsverhältnis klassenspezifischer, milieuspezifischer und [… personalisierter] Erscheinungsformen der Ungleichheit“ (Berger/Vester 1998: 14). Da sich die Arten und Mengen an Kapital bzw. Machtmitteln nicht als unabhängige, invariante Substanzen, sondern erst in den Logiken und ‚Ökonomien’ innerhalb der Regelmäßigkeiten der Praxis relativ autonomer Felder konstituieren, sind sie im Gegensatz zu den Kapitalkonzepten positivistischmaterialistischen Klassentheorien, weder vorab bestimmbar noch begrenzbar. Diese ‚ontologische Unbestimmbarkeit’ ihres Wertes auf einer verallgemeinernd abstrakten Ebene hängt damit zusammen, dass insbesondere bei ‚immateriellen’ Kapitalformen, Produktion und Wertschöpfung bzw. Wertzumessung unmittelbar in der spezifischen Praxis der Felder zusammenfallen und sich auch nur in dieser Praxis realisieren lassen. Dennoch beschreibt Bourdieu drei ‚Grundsorten’ praxiswirksamer Machtmittel: das ökonomische, das kulturelle und das soziale Kapital. Allen Kapitalsorten ist gemein, dass sie dazu beitragen die Positionierung ihrer Träger im sozialen Raum insgesamt, ebenso wie in spezifischen sozialen Feldern – in Relation zu anderen sozialen Akteuren - zu sichern oder zu verbessern10. Das ökonomische Kapital: Aufgrund einer „tendenziellen Dominanz des ökonomischen Feldes” (Bourdieu 1985:11) kann das ökonomische Kapital als primäres Kapital verstanden werden und damit als grundlegender Faktor der Klassenmatrix. Als den anderen Kapitalen - theoriearchitektonisch und empirisch - notwendig zugrunde liegend, wird das ökonomische Kapital in so fern verstanden, wie die materielle Reproduktion eine notwendige Vorraussetzung der kulturellen und sozialen Produktion und Reproduktion ist. Auch wenn das ökonomische Kapital in dieser Hinsicht eine Art ‚letzte Instanz’ (vgl. Engels 1967: 462) darstellt, bedeutet dies nicht, dass es die kulturellen, sozialen und symbolischen Praxisformen restlos determiniert. Um in wesentlichen Feldern Machtpositionen abzusichern, reicht das ökonomische Kapital alleine in aller Regel nicht aus; es muss mit den anderen Kapitalformen einhergehen. Auch in Bezug auf das ökonomische Kapital unterscheidet sich die Begriffsverwendung Bourdieus vom Marx’schen Kapitalbegriff. Es bezieht sich nicht nur auf den Besitz von Produktionsmitteln, sondern auf alle Formen des materiellen Reichtums (Vermögen, Einkommensquellen und -titel etc.) bzw. all jene Mittel, die „unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar [sind] und eignet besonders zur Institutionalisierung in Form des Eigentumsrechts” (Bourdieu 1997: 52). Dederichs et al. (2000: 12) verweisen darüber hinaus auf Existenz feldspezifischer Figurationen, die es erlauben, von einer einverleibten Form ökonomischen Kapitals zu sprechen: „Eine Inkorporierung ökonomischen Kapitals ist als Rationalitätsdisposition bei Disponenten [in wirtschaftlichen Unternehmen] auffindbar, deren habituelle Ziele mit den effizienzund gewinnsteigernden Unternehmenszielen korrespondieren“. 10 Mit Blick auf ökonomisches Kapital liegt dies auf der Hand. Die Relevanz von kulturellem und sozialem Kapital paraphrasieren Vijayendra Rao and Michael Walton (2002: 10) wie folgt: „In socially differentiated societies, social and cultural capital can work together in reproducing inequality, by preserving differential access to networks, by perpetuating symbolic violence that maintains the status quo, and by creating a pattern of habitus that generates constraining preferences, limiting the hopes and aspirations of the poor and perpetuating adverse ,terms of recognition’ from dominant groups”. 11 Wesentlich ist ferner, dass sowohl das soziale als auch das kulturelle Kapital unter bestimmten Voraussetzungen in ökonomisches transformiert werden können und sich ihre jeweiligen Zugangschancen und Akkumulationen bis zu einem gewissen Grad wechselseitig bedingen. Hierauf rekurrieren auch Dederichs et al. (2000: 12), wenn sie das ökonomischen Kapital in seiner inkorporierten Form, auf eine Haltung beziehen, „die bereits das Produkt der inkorporierten Konvertierung und gegenseitigen Beeinflussung von kulturellem, ökonomischem und symbolischem Kapital [ist], die sich als Disposition für bestimmte Aufgaben und Wissen über bestimmte Lösungen zeitlich stabil verinnerlicht hat. Das kulturelle Kapital: Kulturelles Kapital, das um seine ‚volle Universalität’ auszudrücken eigentlich Informationskapital heißen müsste (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996: 151), kann a) in „inkorporiertem Zustand, in Form von dauerhaften Dispositionen des Organismus” (Bourdieu 1997: 53) vorkommen. Dieser Aggregationszustand von kulturellem Kapital lässt in gewisser Weise als Synonym des Begriffs ‚Bildung’11 verstehen. Dabei ist es grundsätzlich körpergebunden. Es ist Teil des Habitus und damit Bestandteil der Akteurs selbst. Deshalb kann es – im Gegensatz zum ökonomischen Kapital - nicht unmittelbar weitergegeben werden, sondern setzt einen „Verinnerlichungsprozess voraus der in dem Maße wie e[s] Unterrichtsund Lernzeit erfordert Zeit kostet” (Bourdieu 1997: 55), die vom ‚Investor’ persönlich aufgebracht werden muss. Klassisch werttheoretisch betrachtet lässt sich damit die Dauer des Bildungserwerbs als Maßstab für ‚inkorporiertes’ Kulturkapital angelegen, wobei jedoch andere inkorporierte Praxisformen insbesondere „die Primärerziehung in der Familie [d.h das ‚sozial geerbte’ capital culturel hérité ] in Rechnung gestellt werden [müssen], und zwar je nach Abstand zu den Erfordernissen des schulischen Marktes entweder als positiver oder als negativer Wert, als gewonnene Zeit oder Vorsprung, oder als negativer Faktor, als doppelt verlorene Zeit, weil zur Korrektur der negativen Folgen nochmals Zeit eingesetzt werden muss (Bourdieu 1997: 56). b) in einem „objektiviertem Zustand, in Form von kulturellen Gütern […] Spuren hinterlassen oder sich verwirklicht haben” (Bourdieu 1997: 59). In diesem ‚objektivierten’ Zustand (etwa dem Besitz von Büchern, Kunstwerken oder Internetzugang) ist das Kulturkapital vermittelt über seine materiellen Träger materiell übertragbar und setzt ökonomisches Kapital zu seiner Aneignung voraus. Aber auch das objektivierte Kulturkapital kann, wenn es als kulturelles Kapital und nicht nur als Träger einer ökonomischen Wertanlage angeeignet werden soll, nur vor dem Hintergrund seiner Beziehung zum inkorporierten – nicht übertragbaren Kulturkapital bestimmt werden. c) schließlich kann sich das inkorporierte Kulturkapital in einer institutionalisierten Form - als Titel - verobjektiviert haben. Diese Institutionalisierung bezeichnet ein Verfahren, dass den ‚Mangel’ In seinen Originaltexten verwendet Bourdieu in diesem Kontext häufig den deutschen Begriff ,Bildung’. Beachtenswert ist darüber hinaus die Korrespondenz der Fassung von ‚Bildung’ als Kapital bei Bourdieu zu den Ausführungen von Georg Simmel (1989), der in seiner ‚Philosophie des Geldes’ dessen Einsatz in ganz ähnlicher Form als distinktives Machtmittel beschreibt. 11 12 der personalisierten Körpergebundenheit inkorporierten Kulturkapitals ausgleichen kann: Sobald es durch schulische, akademische etc. Titel sanktioniert worden ist, hat es sich in einen dauerhaften, rechtlich garantierten, konventionellen Wert gewandelt, der formell unabhängig von der Person ihres Trägers existiert und sich selbst vom Umfang seines aktual tatsächlich ‚inkorporierten’ kulturellen Kapitals entkoppelt hat (vgl. Bourdieu 1997). Der ‚Wert’ des institutionalisierten Kulturkapitals hängt von der Anerkennung und Exklusivität des Titels ab, der als offizielle Kompetenz von der Beweislast des Autodidakten - der ‚nur’ über inkorporierte und objektivierte Formen kulturellen Kapitals verfügt - entlastet ist. Insofern sind Titel vor allem auch das Ergebnis symbolischer Auseinandersetzungen um soziale Taxionomien und Qualifikationsgrenzen, mit denen Ranordnungen festgeschrieben gesellschaftliche Räume strukturiert und soziale Positionierungen gesichert werden (vgl. Bourdieu et al. 1981) Das soziale Kapital: „Das Soziale Kapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen.” (Bourdieu 1997: 63) Soziales Kapital bei Bourdieu bezeichnet demnach, wie Alejandro Portes (1998: 3) paraphrasiert, ein „aggregate of resources linked to a network of durable relationships“, die sich auf Freundschaften, Bekanntschaften und Arbeitskollegen ebenso wie auf Verwandtschaften und Mitgliedschaft in Vereinen, Parteien, Klubs etc. beziehen können. Die Mitgliedschaft in diesen Gruppen „provides each of its members with the backing of the collectivity-owned capital” (Bourdieu 1986: 248 f). Soziales Kapital ist hier also nicht auf die Beziehung selbst, sondern die Fähigkeit Ressourcen wie etwa Zeit, Information, Geld und andere ‚natürliche’ und symbolische Ressourcen durch die Mitgliedschaft in sozialen Netzwerken und Gruppen zu sichern und zu erweitern. Mit Neil Webster (1998) formuliert, beinhalten also soziale Beziehungen „which cannot be used for material purposes”, auch kein soziales Kapital Als ein durch praxisökonomische Investitionen in Netzwerke generiertes Machtmittel erfährt soziales Kapital seine Bedeutung durch die Dimensionen von Schutz, Bindung, Unterstützung und Hilfe sowie durch die erhöhten Möglichkeiten soziale Kontrolle auszuüben (vgl. Karstedt 1996: 57). Der Umfang des sozialen Kapitals eines sozialen Akteurs hängt dabei sowohl davon ab, ob und in welchem Umfang er die Beziehungen der Gruppe tatsächlich für sich mobilisieren kann12, als auch grundlegend davon, wie hoch der Umfang des Sozialkapitals ist über das die Gruppe, zu der er gehört, insgesamt verfügt (vgl. Bourdieu 1997). Während das kulturelle Kapital ein nahezu idealtypisches Beispiel für ein ‚inkorporierbares Kapital’ (‚embodied capital’) ist, stellt soziales Kapital ein relational eingebettetes aber individuell verwertbares Kapital (‚embedded capital’) dar (vgl. Lin et al. 2001): „although the source of social capital is the relationships among a group of individuals, the capital itself is an individual asset“ (Grootaert 2001: 17). In diesem Sinne ist soziales Kapital zwar ein intersubjektiv einbedundenes, aber kein kollektives bzw. öffentliches Gut (so etwa Putnam 1995, 2000), das jenseits von Fragen der Zugehörigkeit zu einer 13 Gruppe und der Position innerhalb dieser Gruppe materiell existent ist und von Gruppen im engeren Sinn ‚besessen’ werden kann. „Soziales Kapital“ ist wie es Bourdieu (1986) formuliert ein „attribute of an individual in a social context. One can acquire social capital through purposeful actions and can transform social capital into conventional economic gains. The ability to do so, however, depends on the nature of the social obligations, connections, and networks available to you” (zit. nach Soebl 2002: 139) Soziales Kapital verweist demnach auf Austauschbeziehungen, in denen materielle und symbolische Aspekte untrennbar miteinander verknüpft sind (vgl. Bourdieu 1997: 64, Bourdieu et al. 1991). Sozialkapitalbeziehungen existieren erst auf der Grundlage von ökonomischen und symbolischen Tauschbeziehungen, zu deren Reproduktion sie selbst wiederum deshalb beitragen, weil prinzipiell alle Formen des (ökonomischen, kulturellen, politischen oder sozialen) Güterverkehrs und Austausches notwendigerweise in soziale Beziehungen eingebettet sind13 (vgl. Granovetter 1985). In sofern ist soziales Kapital auf theoretischer Ebene zwar eine eigenständige Kapitalform, kann aber als ein Machtmittel empirisch nur im Verbund mit anderen Kapitalen existieren14. Soziales Kapital fungiert dabei als eine Art ‚Multiplikator’ für die Realisierung ökonomischen und kulturellen Kapitals. Diese Austauschbeziehungen, genauer das Netz von Austauschbeziehungen die soziales Kapital generieren, sind deshalb als eigenständiges Kapital zu bezeichnen, weil sie Produkte „individueller oder kollektiver Investitionsstrategien [sind], die bewusst oder unbewusst auf die Schaffung von (dauerhaften) Sozialbeziehungen gerichtet sind […] die Zugang zu materiellen oder symbolischen Profiten verschaffen. Dabei werden Zufallsbeziehungen, z.B. in der Nachbarschaft, bei der Arbeit oder sogar unter Verwandten, in besonders ausgewählte und notwendige Beziehungen umgewandelt, die dauerhafte Verpflichtungen nach sich ziehen. Diese Verpflichtungen können auf subjektiven Gefühlen [Anerkennung, Respekt, Freundschaft usw.] oder institutionalisierten Garantien [Rechtsansprüchen] beruhen“15 (Bourdieu 1997: 65, vgl. Bourdieu et al. 1991, Bourdieu/Wacquant 1996). In diesem Sinne kommt es in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zu Konzentrationen von Sozialkapital, wobei es bezogen auf den sozialen Akteur die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ist, die sein Verfügen über dieses Machtmittel ermöglicht. Durch die multiplikatorische Wirkung des sozialen Kapitals in Bezug auf die Fähigkeit zur Steigerung der Potenz und der praxisökonomischen Profite der anderen Kapitalsorten trägt es sozialstrukturell zur Perpetuierung sozialer Ungleichheit und klassenförmiger Herrschaft bei. Dies gilt auch mit Blick auf die ‚Profite’ die sich durch Sozialkapitalinvestitionen erzielen lassen. Im Sinne einer ‚second order resource’ (Boissevain 1974) verweist soziales Kapital auf die Möglichkeit über Beziehungen zu anderen Akteuren Zugang zu deren Ressourcen zu erhalten. „Wenn andere aber ebenso so wenig besitzen, steigert sich nur die eigene Machtlosigkeit […]. Je einheitlicher [daher] die Netzwerke schwächerer Gruppen In dieser Hinsicht lässt sich soziales Kapital auch als das Machtmittel ‚Solidarität’ beschrieben. Zumindest in bestimmten Feldern lässt sich soziales Kapital in so fern auch als eine der „nicht-ökonomische[n] Voraussetzungen ökonomischer Institutionen“ (Mahnkopf 1994: 70) verstehen. 14 Die hieraus folgende Komplementrarität von sozialem Kapital und anderen sozialen ‚Ressourcen’ ist für die Bundesrepublik in Studien auf der Basis des sozio-oekonomischen Panel empirisch belegt worden. Alle „Investitionen in soziales Kapital [setzten] bereits verfügbare Ressourcen […] voraus, wie auch umgekehrt die meisten Studien belegen, dass soziales Kapital [… deren Erträge] erhöht” (Brömme/Strasser 2001: 12). In den Analysen Bourdieus, ebenso wie jenen von James S. Coleman (vgl. 1988, 1991: 389 ff), ist insbesondere der Zusammenhang von sozialem und kulturellem Kapital (bzw. ‚Humankapital’ bei Coleman) hervorgehoben worden. (Zur Abgrenzung von und kritischen Würdigung der ‚HumankapitalSchule’ um Gary S. Becker vgl. Bourdieu 1997: 54 f) 12 13 14 ausfallen und je größer ihr Abstand zu starken Milieus desto geringer sind ihre sozialen Chancen“ (Neckel 2003a: 11). Im Gegensatz zu klassischen Strukturtheorien geht es in Bourdieus Konzeption nicht nur um die Frage des Zugangs und des Erwerbs von Kapitalen als Machtmittel, sondern vor allem auch um die Möglichkeit ihren Wert vor Verfall zu schützen oder zu steigern sowie um die Möglichkeiten es in andere Machtmittel zu transformieren (vgl. Karstedt 1996: 57). Dies gilt zwar im Kern auch für andere Machtmittel wie etwa das kulturelle Kapital, aber die praxisökonomische Notwendigkeit individueller und kollektiver Schutzmechanismen ist im Falle sozialen Kapitals besonders virulent. Um das flüchtige Medium soziales Kapital zu reproduzieren, und dauerhafte Bande zu schaffen, ist eine ständige Pflege der Bekanntschaften erforderlich, die moralisch stabile Verpflichtungen schafft, und den potentiellen materiellen Nutzen weitgehend verschleiert. Dies macht neben ‚Takt und Fingerspitzengefühl’ eine zeitaufwendige, bisweilen im durchaus pekuniären Sinne teure „Beziehungsarbeit in Form von ständigen Austauschakten erforderlich, durch die sich die gegenseitige Anerkennung immer wieder neu bestätigt [… :] Gegenseitiges Kennen und Anerkennen ist zugleich Voraussetzung und Ergebnis dieses Austausches” (Bourdieu 1997: 67, 66). Wenn soziales Kapital durch das (symbolische) Kriterium der wechselseitigen Anerkennung definiert ist, impliziert dies zu jedoch einen per se risikobehafteten Charakter dieses einbetteten Machtmittels. Zentrale Risiken der Investitionen in soziales Kapitals, die mit der Verschleierung ihres praxisökonomischen Nutzens wachsen, stellen sich in Form von Beziehungs-, Status- und Freundschaftsfallen dar, und manifestieren sich in Form von ‚Undankbarkeit’ - und dem hiermit verbundenen Schwundrisiko der Investitionen -, ‚asymmetrischer Reziprozität’ - wenn die Vorleistungen permanent den Ertrag übersteigen - und ‚Unzumutbarkeit’ - wenn in einer Beziehung ‚zuviel verlangt‘ wird (vgl. Müller 1992: 270 ff). Weitere Kapitalarten: Als weitere Arten von Kapital benennt Bourdieu Unterarten der genannten Kapitalsorten beispielsweise das ‚politische Kapital’ (vgl. Bourdieu 1998, 2001b), als eine Unterart des soziales Kapitals - aber auch Kapitalsorten, die nicht eindeutig unter die drei genannten Grundformen zu subsumieren sind. Hierzu zählt etwa das ‚literarische’ bzw. ‚linguistische Kapital’ oder das ‚physische’ bzw. Körperkapital16 (Stärke, Schönheit, Gesundheit aber auch die Hautfarbe, dazu Gorely et al. 2003), das zwar biologische Momente aufweißt, aber dennoch durch Arbeit (Körperpflege, ‚Bodystyling’ etc.) akkumulierbar, und vor allem selbst an kulturelle Standards gebunden ist. ‚Körperkapital’ lässt sich in so fern als eine biosoziale Kategorie verstehen. Dabei sind es „bestimmte Institutionen, die einen zum Verwandten […], zum Adligen, zum Erben, zum Ältesten usw. stempeln, [und damit] eine symbolische Wirklichkeit schaffen, die den Zauber des Geweihten in sich tragen” (Bourdieu 1997: 65) 16 Auf die Bedeutung von Körperkapital hat vor allem auch Bryan S. Turner systematisch aufmerksam gemacht: „A system of controlling the mind appears to shift to the outside of the body, which becomes the symbol of worth and prestige in contemporary societies. Briefly, to look good is to be good“ (Turner 1987: 226) 15 15 Insgesamt sind, abhängig von den praktischen Rationalitäten der diversen sozialen Felder und Subfelder unbeschränkt viele Kapitalarten und -unterarten denkbar. Nahezu jede Eigenschaft oder Fähigkeit kann ein Kapital darstellen, nur eben nicht überall. Symbolisches Kapital als spezifische Form der Kapitalen: Insbesondere die deutsche Rezeption hat sich mit der Bestimmung des symbolischen Kapitals schwer getan. Dies mag dem Umstand geschuldet sein, dass in der dialektischen und relationalen Argumentationsweise Bourdieus die materielle und die symbolische Ebene auf das Engste miteinander verknüpft sind und dabei prinzipiell alle Kapitalarten auch als Formen des symbolischen Kapitals existieren. Bourdieu (1998: 108) definiert symbolisches Kapital als „eine beliebige Eigenschaft (eine beliebige Kapitalsorte, physisches, ökonomisches kulturelles, soziales Kapital), wenn sie von sozialen Akteuren wahrgenommen wird, deren Wahrnehmungskategorien so beschaffen sind, dass sie zu erkennen (wahrzunehmen) und anzuerkennen, ihr Wert beizulegen, imstande sind”. Symbolisches Kapital kennzeichnet somit die institutionalisierte und nicht institutionalisierte Anerkennung der Machtmittel durch soziale Gruppen (vgl. Bourdieu 1990: 51). Es ist also nicht als eine weitere, eigenständige Kapitalsorte zu verstehen, sondern als die symbolische Form, der Wertmaßstab, dem alle Arten von Kapital unterworfen sind, sobald sie als Machtmittel in einem spezifischen Feld wirken. Anders formuliert, können Kapitale eine handlungspraktische Wirksamkeit nur durch ihre Anerkennung als ein ‚wertvolles’ Gut erzielen. Diese symbolische Form im Sinne der Wertbestimmung einer bestimmten Kapitalsorte und damit verbunden auch ihre Konvertierbarkeit, ergibt sich erst aus ihrer Einbettung in eine feldspezifische Figuration. Dabei ist symbolisches Kapital die „Form […], die eine dieser Kapitalsorten annimmt, wenn sie über Wahrnehmungskategorien wahrgenommen wird, die seine spezifische Logik anerkennen bzw. […] die Willkür verkennen, der sich sein Besitz verdankt” (Bourdieu 1996: 151); oder wie es Michel Peillon (1998: 216, 219) formuliert: „symbolic capital […] comes very close to the notion of legitimacy“, die deshalb als ein Machtmittel fungiert, weil „social agents with a specific type of capital must ensure the recognition of its value“. Daher tendiert jede „Art Kapital […] (in unterschiedlichem Grade) dazu, als symbolisches Kapital zu funktionieren (so dass man vielleicht genauer von symbolischen Effekten des Kapitals sprechen sollte), wenn es explizite oder praktische Anerkennung erlangt: die Anerkennung des Habitus, dessen Strukturen den Strukturen des Raums entsprechen, in denen er sich hervorbrachte. Mit anderen Worten: Das symbolische Kapital […] ist nicht eine besondere Art Kapital, sondern das was aus jeder Art Kapital wird, das als Kapital, das heißt als (aktuelle oder potentielle) Kraft, Macht oder Fähigkeit zur Ausbeutung verkannt, also als legitim anerkannt wird. Genauer gesagt: Das Kapital existiert und agiert als symbolisches Kapital“ (Bourdieu 2001c: 311). Die symbolische Form der Kapitalen ist jene Form, die ‚Distinktionsgewinne’ in der sozialen Auseinandersetzung um symbolische Herrschaft in den sozialen Federn abwirft (vgl. Bourdieu 1990) und bezeichnet in sofern ein wesentliches Machtmittel im Kampf „um die Durchsetzung einer jeweiligen Definition der legitimen Einsätze und Waffen im Rahmen sozialer Auseinandersetzungen, oder, wenn man will, um die Basis von legitimer Herrschaft – nämlich Wirtschafts-, Bildungsoder Sozialkapital, alle drei sozialen Machinstanzen, deren spezifische Effizienz noch gesteigert werden kann durch die des Symbolischen, d.h. durch die Autorität, deren Verbindlichkeit aus kollektiver Anerkennung und kollektiver Mandatsträgerschaft hervorgeht” (Bourdieu/Wacquant 1996: 151). Erst das symbolische Kapital definiert welche Formen und welcher Gebrauch von Kapital die legitime Basis für die sozialen Positionen einem gegebenen sozialen Raum darstellt. Das bedeutet aber, dass 16 die anderen Kapitalsorten erst durch den Prozess einer ‚Übersetzung’ durch symbolisches Kapital bedeutungsvoll und sozial effektiv werden. Die Frage der Distribution von Ressourcen und Machtmitteln und die der praxisökonomischen Anerkennung, Verkennung und Verschleierung (vgl. Fraser/Honneth 2003), steht demnach aus der von Bourdieu vorgelegten Perspektive in einem Verweisungsverhältnis, das sich weder in die noch in die andere Richtung aufzulösen ist. Entsprechend können die Modi der Anerkennung – inklusive der von Axel Honneth (1992) bemühten Ebenen der ‚Liebe’, des ‚Rechts’ und der ‚Solidarität’ - nicht als ent-materialisierte Formen sozialer Praxis verstanden werden. Zugleich ist es aber auch nicht die materielle Substanz der Kapitalen selbst, sondern ihre Transformation in symbolisches Kapital bzw. die Verwandlung „physiologische[r] Ereignisse in symbolische“ (Bourdieu 1979: 199), d.h. die Erzeugung unterschiedlicher Praktiken und Entitäten durch symbolische Kategorisierungen, welche den Kern gesellschaftlicher Machtrelationen darstellt: „Influencing the categories and distinctions through which the world is perceived becomes a major way in changing (or conserving) the social world. It is by seeing things in the legitimate way that the implicit can be made explicit and potential groups transformed into actual groups” (Siisiäinen 2000: 14). Die verschiedenen – relativ autonomen - Kapitale sind unter gewissen Voraussetzungen, bis zu einem gewissen Grad gegenseitig konvertierbar17. Dabei ist die Nutzung der Möglichkeit ihrer Konvertierung eine mögliche Strategie der Reproduktion, die es durch Umwandlungen der organischen Struktur des Kapitalgesamtumfangs erlauben kann, je nach der Beschaffenheit der besetzbaren sozialen Felder höhere Wertigkeiten des vorhandenen Kapitals zu erzielen, die Akkumulation neuen Kapitals zu erleichtern und für die Zukunft zu erhalten. Die Transformation von Machtmittel vollzieht sich jedoch nicht ‚automatisch’, sondern verlangt eine unterschiedlich aufwendige ‚Transformationsarbeit‘, die Zeit verlangt und bei der auch ‚Schwund‘, d.h. Verluste auftreten können. In Anlehnung an die Marxsche Werttheorie wird dabei Arbeitszeit im weitesten Sinne, als die am wenigsten ungenaue Wertgrundlage betrachtet auf der sich Kapitalanhäufungen und Transformationen vollziehen. Bezogen auf die Konvertierbarkeit bedeutet dies, dass Gewinne auf einem Gebiet mit (zumindest Zeit-)Kosten auf einem anderen Gebiet bezahlt werden. Die Kapitalen dienen als Machtmittel sowohl im Kampf um die Stellung in der Sozialtopologie des sozialen Raums insgesamt, als auch um die Positionen in den einzelnen sozialen Feldern. Ihre Wertigkeit ist hierbei in so fern feldspezifisch, dass die Verwertungschancen der einzelnen Kapitalen von Feld zu Feld variieren, weil „jedes Feld über seine eigene interne Logik und Hierarchie verfügt” (Bourdieu 1985: 11) und damit zugleich die ‚Tauschrate’ definiert „at which one kind of capital is converted into another (Bourdieu 1993: 34)”. Dies bedeutet aber, dass „at the very least, the extent and ease of convertibility must be quite different in different contexts“ (Calhoun 1993: 68). Dies gilt auch für die drei Grundkapitalarten ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital: „Es gibt mit anderen Worten, Karten, die in allen Feldern stechen und einen Effekt haben – das sind die KapitalGrundsorten -, doch ist ihr relativer Wert als Trumpf je nach Feld und sogar je nach den verschiedenen Zuständen Ein treffendes Beispiel hierfür ist das private Bildungssystem, das den Akteuren mit relativ wenig kulturellem und viel ökonomischen Kapital, für den Fall, dass ihr Nachwuchs im öffentlichen Bildungssystem (nicht zuletzt wegen mangelnder Redundanz des erworbenen Habitus zu den Praktiken der Schule) scheitert eine zweite Chance gibt. Nichts desto trotz kann auch hier der Bildungsabschluss nicht einfach ‚erkauft’, sondern muss erarbeitet werden. 17 17 ein und des selben Feldes ein anderer. Wobei es sich versteht, dass ganz grundsätzlich der Wert einer Kapitalsorte – zum Beispiel die Kenntnisse in Griechisch oder Integralrechnung – davon abhängt, dass überhaupt ein Spiel, ein Feld, existiert, in dem dieser Trumpf sticht.” (Bourdieu 1996: 128) Mit Blick auf die sozial-räumliche Genese von Klassen lässt sich demnach zunächst von zwei Dimensionen eines sozialen Raums sprechen. Dabei verteilen sich „die Akteure auf der ersten Raumdimension je nach Gesamtumfang an Kapital, über das die verfügen; auf der zweiten Dimension je nach Zusammensetzung dieses Kapitals, das heißt je nach dem spezifischen Gewicht der einzelnen Kapitalsorten, bezogen auf das Gesamtvolumen” (Bourdieu 1985: 11). Die Analyse der Gesamthöhe des Kapitals, verweißt auf die relative Wertigkeit der Kapitalen. In einer Spielmetaphorik formuliert geht es um die Frage, wie viel ‚Spieljetons’ kulturelles Kapital, ein ‚Spieljeton’ ökonomisches Kapital wert sei. Diese Frage variiert nicht nur feldspezifisch, sondern auch innerhalb eines Feldes bleibt der Tauschwert, vor dem Hintergrund einer diachronen verlaufenden Entwicklungsdynamik der Kräfteverhältnisse in den sozialen Feldern über die Zeit nicht konstant. Um diese Überlegung zu verdeutlichen: Ein ‚Jeton’ ökonomisches Kapital kann als Machtmittel in einem Feld beispielsweise zwei ‚Jetons’ kulturelles Kapital wert sein. Ein ‚Jeton’ ökonomisches Kapital hat dann also den gleichen Gesamtumfang im Sinne der absoluten Kapitalhöhe, wie zwei ‚Jetons’ kulturelles Kapital. In einem anderen Feld kann dieses Verhältnis durchaus umgekehrt sein. Darüber hinaus kann sich dieses Tausch- bzw. Kräfteverhältnis der Wertigkeit der Kapitalen im Verlauf der Auseinandersetzungen in den sozialen Feldern verschieben; das Tauschverhältnis wäre dann z.B. 1:1 oder 3:1 usw. und entsprechend hierzu verschieben sich auch die Positionen – und mittelbar auch die möglichen ‚Spielzüge’ - der Akteure mit unterschiedlichen Zusammensetzungen ihrer Jetons. In den ‚Kämpfen’ in den Feldern – als soziale Auseinandersetzungen, im Sinne von ‚Konkurrenzkämpfen’ - geht es in der Regel nicht nur um die Erhöhung der Kapitalen selbst, sondern eben auch um dieses Kräfteverhältnis. D.h. die einzelnen Akteure versuchen die Logik und Strukturen der Felder so zu ändern, dass sich die Wertigkeit ihrer Machtmittel erhöht, bzw. dass sich die organische Zusammensetzung ihrer Kapitalen als möglichst optimal erweißt18 (so lässt sich etwa auch die Rede Bourdieus von ‚ökonomischen Interesse’ an Kultur seitens der Kulturschaffenden verstehen19). In diesem Sinne ergibt sich die absolute Größe bzw. der ‚Gesamtumfang’ des Kapitals in der synchronen Perspektive des sozialen Raums aus dem Ensemble der für den Tauschwert maßgeblichen Kapitalhöhen in den Feldern. Die Bestimmung der Gesamthöhe des Kapitals – bezogen auf seine sozialstrukturelle Wertigkeit – basiert daher zugleich auf der sozial-historischen Hierarchie der sozialen Felder, wobei in marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften das ökonomische Feld eine relative Dominanz besitzt. Die vor dem Hintergrund der jeweiligen Verfügungsgewalt über ‚Kapital‘ bestimmbaren Klassen im sozialen Raum sind nun sowohl anhand ihrer vertikalen (hierauf verweist das So betrachtet könnte man „Reformen” als Neudefinition der Wertigkeiten der Einsätze im Spiel betrachten. Diese Reformen sorgen natürlich hierbei dafür, dass das Spiel selbst weiter gespielt wird. „Revolutionen” wären in dieser Hinsicht von „Reformen” zu unterscheiden, weil hierbei nicht die Wertigkeit der Einsätze im Mittelpunkt steht, sondern das Spiel selbst. Bei „Revolutionen” geht es – im Gegensatz zu „Reformen” - mit anderen Worten darum, den Spieltisch umzuwerfen. 18 18 Gesamtvolumen), als auch – als ‚Fraktionen‘ einer Klasse - anhand ihrer horizontalen (hierauf verweist die Kapitalstruktur) Positionen, zu bestimmen. Diese Fassung der Kapitale als Machtmittel erlaubt es erst von ‚Klassen’ zu sprechen: Als bloße substanzhafte Ressourcen gefasst, würden sie nur deskriptive Kriterien für eine vertikale Position in einer sozial geschichteten Gesellschaft liefern. Ein Verweis auf die Bedeutung der Kapitale für die soziale Schichtung ist nicht ‚falsch‘, aber sie verstellt den Blick auf die damit verbundenen Macht- und (Klassen-)Herrschaftsdimensionen und suggeriert implizit, die Frage sozialer Ungleichheit wäre mit der Kompensation jener Ressourcen gelöst, die notwendig erscheinen um ‚mitzuspielen‘. So ist es auch eine solche verkürzte Sichtweise, die bei der Forderung nach ‚sozialer Integration‘ in aller Regel die Analyse der symbolischen Herrschafts- und Kontrolldimensionen ausklammert, die bereits in der (politischen) Konstitution des je dominanten Referenzsystems in das ‚integriert‘ werden soll und mithin auch die subjektivierende Konstitution des zu Integrierenden ausklammert. Nochmals in einer Spielmetaphorik formuliert: In Bourdieus Modell bestimmen die Gesamtmenge der Jetons und die Struktur des Jetonstapels eines Akteurs (oder einer Gruppe von Akteuren) neben seiner Position und seiner ‚relativen Stärke’ im Spiel’ auch die „Spielstrategien, also das was man sein ‚Spiel‘ nennt, die mehr oder weniger riskanten, mehr oder weniger vorsichtigen, mehr oder weniger konservativen oder subversiven Züge, die er ausführt” (Bourdieu 1996: 128 ). Eine dritte, temporale, Ebene stellt die ‚soziale Laufbahn’ dar. Durch den Verweis auf die soziale Laufbahn ist es möglich dem Umstand gerecht zu werden, dass sich soziale Positionen im Lebenslauf verändern (können), oder Merkmale der substanzhaft ‚selben’ Position relational anders gewichtet werden. Die soziale Laufbahn bezeichnet die „Entwicklung des Umfangs und der Struktur seines [des Akteurs oder einer ganzen Klasse von Akteuren] Kapitals in der Zeit, dass heißt von seinem sozialen Lebenslauf und von den Dispositionen (Habitus), die sich in der dauerhaften Beziehung zu einer bestimmten objektiven Chancenstruktur herausgebildet haben.” (Bourdieu 1996: 129) Durch die Analyse der sozialen Laufbahn „lassen sich stellungsspezifische Eigenschaften unter synchroner Betrachtung von Eigenschaften unterscheiden, die sich aus der Genese der Stellung ergeben: Tatsächlich können zwei unter synchronem Gesichtspunkt offensichtlich identische Positionen sich als zutiefst verschieden voneinander erweisen, bezieht man sie auf den einzig realen Kontext, d.h. die historische Entstehung der sozialen Struktur in ihrer Gesamtheit und mit ihr zugleich der entsprechenden Stellung” (Bourdieu 1970: 48f). Umgekehrt kann diese laufbahnspezifische Sicht zugleich systematisch die Möglichkeit reflektieren, unterschiedliche (Klassen von) Akteuren „auch wenn sie momentan über den gleichen Umfang und die gleiche Struktur an Kapital verfügen, nach ihrem Startkapital und danach unterschieden werden können, ob sie sich auf einer eher absteigenden oder eher aufsteigenden sozialen Laufbahn befinden20.” (Schwingel 1993: 38f). Ähnlich lässt sich auch für die Sozialpädagogik von einem ‚ökonomischen Interesse’ an (der Identifikation) von Lebensführungsproblemen sprechen, oder der kriminalpräventiven Akteure an Delinquenz, Prä-Delinquenz, Risikofaktoren etc. 20 Die soziale Laufbahn oder ‚Karriere‘ eines Akteurs, kann nicht nur retrospektiv, als erfolgte, sondern auch prospektiv, als ‚potentielle soziale Laufbahn’ (Bourdieu 1982: 196) eines Akteurs oder einer ganzen Gruppe analysiert werden. 19 19 Untrennbar mit den analytisch zu fassenden Positionen im sozialen Raum sind jene Ebenen verbunden, die Bourdieu ‚Habitus’ und ‚Lebensstil’21 nennt. So erklärt Bourdieu den wesentlichen Gehalt seines Schemas in groben Zügen in einem Interview wie folgt: „Stellen Sie sich eine Art Achsenkreuz vor – die vertikale Achse hat ein ‚oben’ und ein ‚unten’ die horizontale einen intellektuellen und einen ökonomischen Pol. Dieses Feld sozialer Dispositionen drückt sich nun in der Art der Lebensstile aus. Das Ganze lässt sich so veranschaulichen, dass Sie auf ein unteres Blatt (mit den sozialen Positionen) ein Transparentpapier legen, auf dem bestimmte, Präferenzen, Praktiken usw. eingetragen sind.22” (Bourdieu 1997: 37) Mit Richter (1994: 173f) lassen sich dabei drei verschiedene Ebenen von (Lebens-)Stilmerkmalen unterscheiden: die im wesentlichen okkasionellem ‚nicht symbolhafte‘ Ebene attributiver - d.h. oberflächlicher, rasch wechselnder, wenig bestimmender – Stilmerkmale, die symbolhafte Ebene der ‚Stilisierung des Lebens‘ (Max Weber), im Sinne bewusst gewählter distinktiver Stilmerkmale und die ebenfalls symbolische Ebene subtiler, distinktiver Stilmerkmale als habituelle – und daher scheinbar ‚natürliche‘ Unterschiede. Im Rahmen der bourdieuschen Überlegungen zum Lebensstil geht es vor allem um jene nicht voluntaristischen, subtil distinktiven Stilmerkmale auf der symbolischen Ebene. Der Begriff des ‚Lebensstils’ als ein durch die Dimensionen Raum und Zeit strukturiertes Muster der Lebensführung (vgl. Müller 1992: 376), zielt auf die Praktiken und Objekte, die symbolischen Merkmale der Lebensführung, die Max Weber mit seinem Begriff des Standes zu fassen sucht, und gegen den Begriff der ‚Klasse’ setzt. Bourdieu (1987: 254) zu Folge sind aber auch „,Statusgruppen’, die auf ‚Lebensstil’ und ‚Stilisierung des Lebens’ beruhen […] nicht, wie Max Weber meinte, etwas anderes als Klassen, sondern herrschende Klassen, die verneint oder, wenn man so will, sublimiert und damit legitimiert werden”23. Dass sich der Raum der Lebensstile entsprechend als die ‚repräsentierte soziale Welt’ verstehen lässt (vgl. Bourdieu 1982: 278) mündet in die zentrale These, „dass zwischen dem Raum der sozialen Positionen und dem der Lebensstile, Lebensweisen und Geschmacksrichtungen eine Korrespondenz besteht, […und sich] zwangsläufig jede Veränderung im Bereich der sozialen Positionen auf die eine oder andere Weise innerhalb des Bereichs von Geschmack und Lebensstil [niederschlägt]” (Bourdieu 1997: 34; vgl. Bourdieu 1982) In diesem Sinne findet spannt sich die soziale Wirklichkeit zwischen zwei nur analytisch trennbaren ‚Räumen’, dem Raum der sozialen Positionen und dem durch (symbolische) Praktiken konstituierten Raum der Lebensstile auf, die zugleich als das „Sein“ und das „wahrgenommene Sein“ beschrieben werden (Vgl. Bourdieu 1982: 754). Die Vermittlung zwischen diesen Räumen, bzw. dieser beiden Seiten des Raums geschieht über den Habitus. Dieser bewirkt, dass In der Perspektive Bourdieus leisten ‚Lebensstile’ einen entscheidenden Beitrag zur Reproduktion von Klassengesellschaften. Die Implikationen dieses Lebensstilbegriffs sind in so fern grundlegend zu unterscheiden von den ‚Lebensstilen’ wie sie etwa Hradil (1987) vertritt. Hradil zu Folge lösen Milieus und Lebensstile gesellschaftliche Klassenstrukturierungen ab (dazu Bischoff et al. 2002). 22 Aus der Homologie von sozialem Raum und Lebensstilen, ist jedoch keine mechanische Homologie von sozialem Raum und politischen oder anderen (kognitiv) bewussten Einstellung und Haltungen abzuleiten oder zu unterstellen. 23 Vielleicht noch treffender führt Bourdieu diese Abgrenzung zu Weber in einer früheren Arbeit aus: „everything seems to indicate that Weber opposes class and status group as two types of real unities which would come together more or less frequently according to the type of society [… however,] to give Weberian analyses all of their force and impact, it is necessary to see them instead as nominal unities […] which are always the result of a choice to accent the economic aspect or the symbolic aspect - aspects which always coexist in the same reality” (Bourdieu 1966: 212 ff, nach Weiniger 2002: 122) 21 20 „die Gesamtheit der Praxisformen eines Akteurs (oder einer Gruppe von aus ähnlichen Soziallagen hervorgegangenen Akteuren) als Produkt der Anwendung identischer (oder wechselseitig austauschbarer) Schemata zugleich systematischen Charakter tragen und systematisch unterschieden sind von den konstitutiven Praxisformen eines anderen Lebensstils” (Bourdieu 1982: 278). Der Habitus beschreibt eine inkorporierte Instanz und Repräsentation des Sozialen, durch die ein sozialer Akteur die Makro-Strukturen – und damit sind die Institutionen, Diskurse, Felder und ‚Ideologien’ gemeint - denen er unterliegt in seine Situationsdefinition wie in die Mirkostrukturen seines Handelns ‚übersetzt‘ und damit den Zusammenhang zwischen Klasse und gesellschaftlicher Praxis über einen spezifischen ‚sozialen Sinn’, (‚sense practique’) vermittelt. Erst in dieser Relation wird auch der Klassenbegriff verständlich: Klassen sind nicht nur explikativ klassifizierbare Gruppen, sondern „Ensembles von Akteuren mit ähnlichen Stellungen [d.h. topologische Positionen im sozialen Raum], die, da ähnlichen Konditionen und ähnlichen Konditionierungen unterworfen, aller Voraussicht nach ähnliche Dispositionen und Interessen aufweisen, folglich auch ähnliche Praktiken und politisch-ideologische Positionen“ (Bourdieu 1985: 12). Deshalb lässt sich die Stellung von Klassen oder Klassenakteuren nicht durch a-historisch bestimmbare Wesensmerkmale, sondern immer nur in ihrer relativen Stellung gegenüber anderen Klassen, Akteuren und klassenspezifischen, distinktiven Lebensstilen betrachten. Die Distinktion, die einen Lebensstil positiv oder negativ von denen anderer Gruppen abhebt, resultiert aus deren differentiellen Beziehung und ist in so fern nicht abhängig von einem bewussten Streben nach Distinktion (vgl. Schwingel 1995: 113). Vielmehr wird ein wesentlicher Zusammenhang von zwischen der Interiorität und Exteriorität sozialer Handlungsbedingungen (vgl. Bourdieu 1976), d.h. zwischen objektiven Lebensbedingungen und personal verinnerlichten Einstellungen und Verhaltensweisen unterstellt, die den objektiven Verhältnissen angepasst sind, ohne das dies subjektiv beabsichtigt wäre (vgl. Bourdieu 1987). Um diesen Niederschlag äußeren Zwänge, auf die ‚von innen’ strukturierten Handlungen und Vorstellungen der Akteure geht es im Habituskonzept, das zugleich eine verzeitlichte Dimension in den Prozess der ‚Subjektivierung’ (Foucault) einführt. II. 1.2 HABITUS UND STRATEGIE Der Habituskonzept Bourdieus ist vielleicht am Besten als Gegenkonzept zu den funktionalistischen Vorstellung eines ‚Rollenhandelns’ (kritisch: Haug 1994) zu verstehen, nach der die sozialen Akteure ‚Rollen spielen’ um den gesellschaftlichen Funktionsanforderungen gerecht werden (vgl. Krais/Gebauer 2003, Hillebrandt 2001). Der Begriff der Habitus findet bereits weit vor Bourdieu - unter anderem in den Philosophie von Aristoteles, der Scholastik von Thomas von Aquin, der Soziologie von Max Weber und Emile Durkheim oder der Anthropologie von Marcel Mauss - an mehr oder weniger zentraler Stelle Anwendung, um den konstitutiven Charakter von Mentalitäten, ‚Dispositionen’ bzw. kulturellsymbolischen Praktiken sowie deren Einverleibung seitens der Akteure, als konstituierendes Elemente der Organisation sozialer Welt zu beschreiben. Bei Bourdieu ist Konzept des ‚Habitus’, im Sinne einer ‚generativen Grammatik’ von Handlungsmustern als intermediäre Dimension einer nicht diametralen Gegenüberstellung, sondern dialektischen Verknüpfung von Handlung und Struktur gefasst, um die 21 „wissenschaftlich absurde Gegenüberstellung [...] von Individuum und Gesellschaft“ (Bourdieu 1985b: 160) systematisch zu überwinden: „Die für einen spezifischen Typus von Umgebung konstitutiven Strukturen, die empirisch unter der Form von mit einer sozial strukturierten Umgebung verbundenen Regelmäßigkeiten erfasst werden können, erzeugen Habitusformen d.h. Systeme dauerhafter Dispositionen, strukturierte Strukturen, die geeignet sind als strukturierende Strukturen zu wirken, mit anderen Worten: als Erzeugungs- und Strukturierungsprinzipien von Praxisformen und Repräsentationen, die objektiv ‚geregelt’ und ‚regelmäßig’ sein können, ohne im geringsten das Resultat einer gehorsamen Erfüllung von Regeln zu sein; die objektiv ihrem Zweck angepasst sein können, ohne das bewusste Anvisieren der Ziele und Zwecke und die explizite Beherrschung der zu ihrem Erreichen notwendigen Operationen vorauszusetzen, und die, dies alles gesetzt, kollektiv abgestimmt sein können, ohne das Werk der planenden Tätigkeit eines ‚Dirigenten’ zu sein.” (Bourdieu 1976: 164f) Die Rede vom Habitus als sowohl ‚strukturierte’ als auch und zugleich ‚strukturierende Struktur’, verweist auf die Eigenschaft und Fähigkeit sozialer Akteure in einer permanenten Interaktion mit ihrer sozialer (Um-)Welt – die sie selbst durch ihre Praxis (mit)konstituieren - diese Welt beständig in einer nicht lediglich passiv rezipierenden, sondern aktiv gestaltenden Weise in sich aufzunehmen: „Objekte der Erkenntnis [werden aktiv] konstruiert und nicht passiv registriert” (Bourdieu 1987: 98). Epistemologisch kann der Habitus als Kernstück einer sozialwissenschaftlichen Praxistheorie der bedingten Freiheit individueller sozialer Akteure verstanden werden. Als die Gesamtheit der durch soziale Erfahrungen erworbenen und bis in den Körper (Hexis) eingeschriebenen Dispositionen konzipiert, ermöglicht es das Habituskonzept zu beschreiben, wie ein kapitaltheoretisch gefasstes ‚Haben’ in Verbindung mit dem gesellschaftlichen ‚Sein’ der Akteure steht. Der Habitus erzeugt jene Dispositionen, die mit den ‚objektiven’ Bedingungen der gesellschaftlichen Positionen vereinbar, bzw. ‚vorangepasst’ – und in so fern ‚vernünftig’ - sind und die gleichzeitig nicht homologe Praktiken unwahrscheinlich machen, ohne damit völlig deckungsgleiche Praxisformen zu erzwingen oder gar bestimmte Praxisinhalte zu determinieren (vgl. Bourdieu 1987). Vielmehr dient der Habitus, indem er soziale Akteure an ihre Herkunft und ihren Lebenslauf rückverweist, als kreatives Organisationsprinzip nicht vollständig determinierbarer Handlungspotentiale, die wie es Judith Butler (1999: 114) treffend beschreibt, jene „embodied rituals of everydayness“ umfassen „by which a given culture produces and sustains belief in its own ‚obviousness’“. Damit lässt sich das merkwürdige Phänomen erklären, dass wir, wie John Searle (1997: 153) in seiner ‚Ontologie sozialer Tatsachen’ mit explizitem Bezug zu Bourdieus Habitus Konzept ausführt „in vielen Situationen einfach [wissen] was zu tun ist, wir wissen einfach, wie wir mit Situationen umzugehen haben“. Dies sei, obwohl sich dieses Phänomen wie eine Regel vollziehe, weder eine bewusste noch eine unbewusste Anwendung von Regeln: „Vielmehr entwickeln wir Fähigkeiten, die auf die besondere institutionelle Struktur reagieren“. Der Begriff des Habitus wird daher der Tatsache gerecht, „that social agents are neither particles of matter determined by external causes, nor little monads guided solely by internal reasons, executing a sort of perfectly rational internal program of action” (Bourdieu/Wacquant 1992: 136): Mit dem Habitusbegriff ist ein erkenntnistheoretisches Instrument vorgeschlagen, mit dem unbefriedigende Dualismen wie Geist und Materie, Basis und Überbau, Individuum und Gesellschaft überwunden und stattdessen die verinnerlichten Dimensionen der ‚Ökonomie des Praxis’ analysiert werden können, die nicht nur eine den Akteuren äußerliche Rationalität beschreibt, sondern ein Regelmäßigkeitssystem, das „gleichzeitig in den Institutionen, in den Mechanismen und in den 22 Dispositionen, im Kopf der Leute ist“ (Bourdieu 1997a: 80). Dabei generiert vor allem die Höhe und organische Zusammensetzung der je akkumulierten, inkorporierten und institutionalisiert zugänglichen Machtmittel - die zugleich die soziale Positionierung als auch den Raum der Handlungsmöglichkeiten der Akteure bestimmen – im Sinne eines „die Wirkung der anderen Faktoren strukturierende[n] Faktor[s] […eine] strukturierende Wirkung, die sie auf die grundlegenden Dispositionen der Habitus, oder, wenn man das vorzieht, auf die Systeme der Vorlieben ausübt” (Bourdieu/de Saint Martin 1998: 145). Dies geschieht weil erfahrene Verhältnisse, angepasste Praxisformen erzeugen, welche als „Strukturen des Habitus, […] wiederum zur Grundlage aller späteren Erfahrungen werden. Als Produkt der Geschichte produziert der Habitus individuelle und kollektive Praktiken also Geschichte, nach den von der Geschichte erzeugten Schemata; er gewährleistet die aktive Präsenz früherer Erfahrungen, die sich in jedem Organismus in Gestalt von Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungsschemata niederschlagen und die Übereinstimmung und Konstantheit der Praktiken im Zeitverlauf viel sicherer als alle formalen Regeln und Normen zu gewährleisten suchen.” (Bourdieu 1987: 101) Der Habitus lässt sich damit als eine inkorporierte Instanz beschreiben, mit der ein sozialer Akteur die gesellschaftlichen Makrostrukturen, denen er unterworfen ist in seine eigenen Situationsdefinitionen ebenso ‚übersetzt’ wie in die Mirkostrukturen seiner Handlungspraxis. Der Habitus bezeichnet also keine inhaltlichen ontisch-substanzhaften Charakteristika einer ‚Person’, sondern ein soziogenetisches aber individuell inkorporiertes, komplexes ‚Syndrom’ (vgl. Vester et al 2001: 162 ff) im Sinne einer umfassenden Kombination prinzipieller, körperlicher, praktischer, mentaler und moralischer Haltungs-, Deutungs-, Wahrnehmungs-, Klassifikations-, Einstellungs-, Wert- und Vorstellungsmuster. Dabei sind die Akteure nicht durch soziale Strukturen ‚determiniert’, sondern sie setzen die ‚inkorporierten Prinzipien’ ihres soziogenetisch angeeigneten ‚generativen Habitus’ ein. Dies geschieht nicht auf eine mechanische, äußeren Gesetzen gehorchende Weise, sondern ‚ihrem Spiel’ in der Ökonomie feldspezifischer Praxis entsprechend und in so fern ‚strategisch’ (vgl. Bourdieu 1992, 1997). Der Habitus verweist in so fern nicht auf eine mechanische Determination, sondern auf die in der Regel nicht reflektierte Einsicht eines praxisökonomischen ‚Erkenntniseffekts’ (vgl. Bourdieu 1990). Ebenso wie die sozialen Strukturen und Felder denen der Habitus entspringt, nicht ‚statisch’, sondern mehr oder weniger dynamisch sind – ohne dass diese Dynamik zu einer völligen Umkehrung ihrer Grundstrukturen führen würde – ist der Habitus als Mittler zwischen Feld und Praxis kein fixiertes, ein für alle mal feststehendes Attribut, sondern unterliegt (zumindest) den Dynamiken der „permanenten Auseinandersetzungen um die Normen des ‚richtigen Lebens’, die als ‚normale’ Lebensweisen in den sozialen Milieus zirkulieren“ (Bublitz 2001: 4). Der Habitus ist also offensichtlich ein Prinzip, das weder „monolithisch ([…ist d.h. es gibt] gespalten[e], zerrissen[e] Habitus […] die in ihren Spannungen und Widersprüchen die Spur widerspruchsvoller Bedingungen ihrer Herausbildung aufweisen) [noch] unabänderlich (in welchem Ausmaß er auch immer verstärkt oder gehemmt worden sein mag) [noch] schicksalhaft (wobei der Vergangenheit die Macht zufiele, alle künftigen Handlungen zu determinieren) und ausschließlich (der bewussten Absicht unter keinen Umständen den geringsten Raum lassend) agiert [. … Das] Ausmaß in dem der Habitus systematisch (oder gespalten, widersprüchlich) und konstant (oder auch fließend und schwankend) ist, [hängt ebenso wie …] die Wahrscheinlichkeit eine ‚rationale’ Handlung ausführen zu können […] von den sozialen Bedingungen der Produktion von Dispositionen [ab] und von den – organischen und kritischen – sozialen Bedingungen ihrer Umsetzungen in Handlungen“ (Bourdieu 2001c: 83). Die Frage von ‚Handlungsfähigkeit’ (‚agency’), verstanden als regulierte Handlungsfreiheit ist in sofern also nicht zuvorderst im Habitus als solchem zu suchen, sondern in den generativen Dynamiken von Habitus und Feld, die erst durch die Praxis – und das heißt auch durch praktisches Handeln – 23 hervorgebracht werden ( vgl. Schirato/Webb 2003)24. Dies verweist auf ein Modell sozialer Handlungsfähigkeit gesellschaftlicher Akteure, das nicht auf eine abstrakte ‚Wesenseigenschaft’ auf sich selbst beruhender ‚Subjekte’ zurückzuführen ist, sondern vollständig in einer historischen und sozialen Materialität begründet liegt (vgl. McNay 2000). Als ein in der geschichtlichen Vergesellschaftung der Subjekte erworbenes Ensemble von inkorporierten Präferenzstrukturen (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996) ist der Habitus, nicht anders als die äußeren Strukturen, denen der soziale Akteur unterworfen ist, selbst nichts anderes als ein Produkt sozialer Praxis, das nur durch die Praxis selbst aufrecht erhalten werden können25: „das Subjekt [verinnerlicht] die Gesellschaft, die ihrerseits durch die Handlungen der Subjekte immer wieder von neuem erzeugt wird“ (Gebauer 2000: 428). Trotz einer kaum übersehbaren Nähe zu Marx bezüglich der damit behaupteten gesellschaftlichen Selbstproduktion des Menschen, entspricht der durch die ‚klassenförmige’ Praxis der Akteure (individuell) angeeignete ‚Klassenhabitus’ nicht dem was mit Marx als ‚Klassenbewusstsein’ bezeichnet werden kann. Es verweist vor allem darauf, dass eine ähnliche Positionierung in der sozialen Welt, ähnliche Praxisformen begünstigen – die jedoch in der Regel kein bewusstes kollektives Handeln darstellen -, die von einer ähnlichen Haltung gegenüber der sozialen Welt begleitet werden – die jedoch nicht als bewusste ‚Klassensolidarität’ zu verstehen sind. Analytisch lassen sich drei Aspekte des Habitus als intermediäre Instanz zwischen Struktur und Praxis differenzieren: a) Der sensuale Aspekt praktischer Erkenntnis und Strukturierung sozialer Welt in Form von ‚Wahrnehmungsschemata’. b) Die ‚alltagstheoretischen’ Deutungsmuster und Kategorien, sowie die ethischen und ästhetischen Bewertungsmaßstäbe sozialer und kultureller Objekte und Praktiken. Kurz der ‚Ethos’ und ‚Geschmack’, in Form von ‚Denkschemata’. c) Die ‚Handlungsschemata’ der Erzeugung und Reproduktion individueller oder kollektiver Praktiken (vgl. Schwingel 1995, Vester et al. 2001). Der Akteur bei Bourdieu ist also kein freischwebendes, prä-soziales ‚Subjekt’, das voluntaristisch nach seinem selbst gewählten, beliebigen Lebensentwurf handelt, sondern ein vergesellschaftetes, nach strukturell eingeschriebenen Regelmäßigkeiten ‚subjektiviertes’ ‚Subjekt’, das in keiner Weise – d.h. auch nicht in irgendwelchen bestimmbaren Teilen, wie die Rede von Individuum und Gesellschaft „For Bourdieu”, so führen Schirato und Webb (2003: 540) aus, „there is no such thing as pure agency; but […] agency can be identified, not as subjective or individual action, but within a logic derived both from cultural fields and from the aporia, or lag, that always characterizes the relationship between the objective structures of fields and their practices. In other words, subjects are able to negotiate the rules, regulations, influences and imperatives that inform all cultural practice, and delimit thought and action, precisely because fields dispose them to do so”. 25 Insofern kann der Habitusbegriff auch als eine mögliche Antwort auf die Frage, wie sozial Ordnung möglich sei, als die Grundfrage tendenziell aller Sozialwissenschaften betrachtet werden. Ferner ist - bei aller Strittigkeit über das Maß an ‚Determinismus’ das Bourdieu unterstellt - nichts weniger plausibel als der Vorwurf, sein Modell sei ‚statisch’. Die Strukturen, die Bourdieu beschreibt, sind an einen Feldbegriff gekoppelt, der als eine Arena permanenter Kämpfe beschrieben wird – nichts könnte weniger statisch und undynamisch sein. 24 24 suggeriert – jenseits der sozialen (kulturellen, ökonomischen, politischen, diskursiven etc.) Ordnung steht, sondern selbst ein produktiver Teil dieser Ordnung ist26. Der Vorwurf an die Arbeiten Bourdieus, das Subjekt hinaus zu eskamotieren, kann insofern nicht überzeugen. ‚Subjektivität’ wird von Bourdieu nur insofern bestritten, wie sie als eine ontologische oder ontologisierbare Kategorie, als apriori existentes „reines Subjekt, ein transzendentales Subjekt mit universellen Kategorien” (Bourdieu 2001: 169) gefasst wird und nicht als kontingentes ‚Produkt’ von ‚Subjektivierung’ und symbolischer Repräsentation, die an die sozialen Strukturen ihrer Genese und aktualen Performanz gebunden sind, ohne dass die eine auf die andere zu reduzieren wäre. In den Worten von Judit Butler (1993: 41): „Kein Subjekt ist sein eigener Ausgangspunkt“. Die Traditionslinien von Karl Marx und Max Weber verknüpfend ist das Argument Bourdieus, dass eine Reproduktion sozialer Strukturen durch ein ‚Subjekt’ nie in einem schlichten ‚Eins-Zu-Eins-Verhältnis’ als passive reflexhafte Antwort auf konditionierende Stimuli erfolgt, sondern in Form einer extensiven, ‚interpretativen’ und kreativen Reproduktion. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Rede von ‚objektiven’ Strukturen vor allem auf soziale Felder verweist, die durch die Praxis der Akteure in der Ökonomie dieser Felder aufrecht erhalten werden und als solche einen stets umkämpften „Ort permanenten Wandels” darstellen (Bourdieu/Wacquant 1996: 135). Die Reproduktion von Praxisweisen in sozialen Feldern ist demnach nur in Relation zur dynamischen Re-Produktion von Praxisfeldern durch die Praxis der Akteure zu verstehen: ‚objektive’ Strukturen wirken habitusformierend, während der Habitus als strukturierte Struktur über eine Generierung von Praxis zur Entwicklung veränderter Strukturen beiträgt. Diese komplexe und dynamische Form einer ‚gesellschaftlichen Prägung’, im Sinne einer praktischen Inkorporation der äußeren der Existenz- und Praxisbedingungen im Habitus - „[which] is adapted to the infinite number of possible situations [… and thus] goes hand in glove with vagueness and indeterminacy“ (Bourdieu 1990b: 9, 77) -, ist kein Produkt eines ‚Masterplans’, sondern vollzieht sich mittels einer ‚stillen Pädagogik’. Dabei liegt die „List der pädagogischen Vernunft […] grade darin, dass sie das Wesentliche unter dem äußeren Schein abnötigt, nur Unwesentliches wie z.B. Beachtung der Formen und Formen der Achtung zu erheischen” (Bourdieu 1987: 128). Der Habitus hat als praxisgenerierendes Dispositiv die Gesamtheit der konkreten Praxis der Akteure – und nicht einzelne Variablen (z.B. Kognition oder Moral) – als Ausgangspunkt, und inkorporiert hierbei auch die sozialen Strukturen, die diese Praxisformen wahrscheinlich machen. Er ist damit zugleich Produkt des Ensembles seiner jeweiligen Existenzbedingungen und hat mithin systemischen Charakter und ist systematisch von den Praxisformen anderer Lebensstile zu unterscheiden. Einem ‚Klassenunbewusstsein‘ näher als einem Klassenbewusstsein, ist der Habitus als „einverleibte, zur Natur gewordene und damit als solche vergessene Geschichte” Erzeugungsprinzip von Praktiken und Klassifikationen. Hierbei erzeugt der Habitus zwar Regelmäßigkeiten, die auf die Anforderungen des Erzeugungsfeldes abgestimmt sind, ist er „wirkende Präsenz der gesamten Vergangenheit die ihn erzeugt hat” (Bourdieu 1987: 105), und wird auch zugleich als „praktische Metapher” (Bourdieu 1982: Diese Sichtweise zeigt deutliche Analogien zu Marxens sechster These über Feuerbach auf, wonach der Mensch kein dem Individuum inne liegendes Abstraktum sei, sondern das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, die wiederum nichts 26 25 281) in Form von Analogien auf andere Felder, „relativ unabhängig von den äußeren Determiniertheiten der unmittelbaren Gegenwart” (Bourdieu 1987: 105) übertragen, aber er übt aber keine – und schon gar keine diskursiv zugänglichen – Regeln aus (dazu auch Weber 1991). Der Habitus hat demnach zwar eine tendenziell zirkuläre Struktur impliziert aber keinen sozialen Determinismus, sondern kennzeichnet die verinnerlichte, über-situative Dimension der Bedingungen und Vorbedingungen, die die Freiheit des Akteurs rahmen. In so fern kann das Konzept des Habitus als der Versuch betrachtet werden, das Problem der Beziehung konditionierender Strukturen und der Handlungspraxis und Entscheidungsfreiheit des Akteurs, dialektisch zu lösen (dazu: Parker 2001). Die Zirkularität der Dispositionen ist dem Umstand geschuldet, dass er zum einen mit und in der Praxis erzeugt wird, und zum anderen hierzu homologe oder redundante Praxisformen präferiert, und somit „die Regelmäßigkeiten zu reproduzieren trachtet, die in den Bedingungen enthalten sind, unter denen […] seine Erzeugungsgrundlage erzeugt wurde” (Bourdieu 1987: 104). Eine strukturelle Homologie zwischen sozialen und mentalen Strukturen, besteht insofern nicht in einem kausalistischen Sinne, sondern in einem genetischen Zusammenhang, in dem die mentalen Strukturen als eine Objektivität zweiter Ordnung – dem Habitus - die inkorporierte Version der sozialen Strukturen aus denen sie erwachsen sind – der Objektivität erster Ordnung – darstellen (Wacquant 1996: 32). Das bedeutet zugleich, dass die sozialen Strukturen weder ihre strukturierende Wirkung völlig kontingent oder (nur) kommunikativ vermittelt entfalten, noch dass sie selbst kontingent und kommunikativ produziert werden, sondern dass beides über vermittelt über den Habitus der Akteure durch ihre individuelle und kollektive Praxis organisiert wird. In diesem Sinne erlaubt, das Habituskonzept, wie es Loïc Wacquant (1995) formuliert, „to show that domination arises in and through that particular relation of im-mediate and infraconscious ,fit’ between structure and agent that obtains whenever individuals construct the social world through principles of vision that, having emerged from that world, are patterned after its objective divisions. Thus […Bourdieu] can affirm at one and the same time, and without contradiction, that social agents are fully determined and fully determinative”. In der aktiven Konstruktion von Gesellschaft nach diesen Klassifikationsschemata des Habitus, werden die Strukturen aus denen die habituellen Schemata hervorgegangen sind, „tendenziell als natürliche und notwendige Gegebenheiten […dargestellt], statt als historisch kontingente Produkte der bestehenden Machtverhältnisse” (Wacquant 1996: 33). „Kurz, als Erzeugnis einer bestimmten Klasse objektiver Regelmäßigkeiten sucht der Habitus die ‚vernünftigen’ Verhaltensweisen des ‚Alltagsverstands’ zu erzeugen, und nur diese, die in den Grenzen dieser Regelmäßigkeiten alle Aussicht auf Belohnung haben, weil sie objektiv der Logik angepasst sind, die für ein bestimmtes Feld typisch ist, dessen Zukunft sie objektiv vorwegnehmen. Zugleich trachtet der Habitus ‚ohne Gewalt List oder Streit’ alle ‚Dummheiten’ (‚so etwas tut man nicht’), also alle Verhaltensweisen auszuschließen, die gemaßregelt werden müssen, weil sie mit den objektiven Bedingungen unvereinbar sind.” (Bourdieu 1987: 104) Diese Erkenntnisschemata sind somit zugleich Erkenntnisinstrumente und ‚Ideologien’. Damit stellt der rekursive und strukturelle Zusammenhang von sozialen und kognitiven Strukturen einen der solidesten Garanten sozialer Herrschaft dar. ‚Absolute’ Herrschaft wäre erreicht, wenn die Dialektik von subjektiven Erwartungen und objektiven Strukturen zum Stillstand käme: „Die objektive Homogenisierung der Habitusformen der Gruppe oder Klasse, die sich aus der Homogenität der Existenzbedingungen ergibt, sorgt nämlich dafür, dass die Praktiken ohne jede strategische Brechung und bewusste als ihr wechselseitiges Verhalten seien. 26 Bezugnahme auf eine Norm objektiv aufeinander abgestimmt und ohne jede direkte Interaktion und damit erst recht ohne ausdrückliche Abstimmung einander angepasst werden können – weil die Form der Interaktion selbst den objektiven Strukturen geschuldet ist, welche die Dispositionen der interagierenden Handelnden erzeugt haben und ihnen dazu noch über diese Dispositionen ihren jeweiligen Platz in der Interaktion und anderswo zuweisen” (Bourdieu 1987: 109). Den (Ideal)Fall einer „Körper gewordenen sozialen Ordnung” (Bourdieu 1982: 740), als die vollkommene Übereinstimmung der objektiven Ordnung mit den subjektiven Organisationsprinzipien, bzw. die Deckungsgleichheit der gesellschaftlich gegebenen Ordnung mit den individuellen Vorstellungen von der gesellschaftlichen Ordnung, und damit der unbewussten Zustimmung zu dieser Ordnung nennt Bourdieu Doxa. Dieser ‚Doxa’ ist tendenziell nicht nur die Autonomie und Handlungsfähigkeit der Subjekte unterworfen, sondern auch ihre Rationalität. Es ist, wie es Max Miller (1989: 215) formuliert, „der praktische Sinn, der dazu führt, dass die Verzauberung der gesellschaftlichen Verhältnisse ihrer Rationalisierung und kritischen Hinterfragung immer einen Schritt voraus ist“. Auch jenseits ‚doxischer’ Formen ist das ‚Individuelle’, das ‚Subjektive’ selbst „sozial, kollektiv. Der Habitus ist sozialisierte Subjektivität, historisch Transzendentales, dessen Wahrnehmungs- und Wertungskategorien [die Präferenzsysteme] Produkt der Kollektiv- und Individualgeschichte sind27” (Bourdieu 1998b: 197). Damit ist der Habitus als ‚sozialisierte Subjektivität’ (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996: 159) beschrieben aber kein strukturalistischer Determinismus unterstellt zumal dieser Zusammenhang bei Bourdieu immer im Sinne einer „Kausalität des Wahrscheinlichen“ (Bourdieu et al. 1981: 173) nicht im deterministischen Sinne eines durch „Gewißheit und Notwendigkeit“ (Bourdieu 1993: 40) gekennzeichneten Kausalverhältnisses verstanden wird. Das Habituskonzept ist ein System von Grenzen, das auf die ‚Notwendigkeiten’ der konkreten sozialen Praxis, und die ‚Zwänge’ der – einverleibten – sozialen Strukturen verweist, d.h. der Habitus verweist auf eine theoretisch unbeschränkte Anzahl möglicher Handlungsoptionen eines Akteurs, während deren absoluter Handlungs- und Anwendungsbereich durch das Feld und die Position der Akteure in diesem Feld beschränkt bleibt. Soziale Akteure sind zwar gerade in modernen Gesellschaften mehr oder weniger ‚autonome’ Individuen, die jedoch in ihrer Verwiesenheit auf die soziale Umwelt Grenzen unterworfen sind, die außerhalb ihrer ‚subjektiven’ und unmittelbaren Kontrolle und Verfügbarkeit liegen. Für einzelne soziale Akteure wirken diese Grenzen bzw. ‚Constraints’ in doppelter Weise: „einmal durch die materiellen Schranken, die sie seinem Handeln auferlegt, und sodann durch die Schranken, die sie sie seinem Denken setz[en] - und damit wiederum seinem Handeln“ ( Bourdieu 1982: 378). Die ‚praktische Vernunft’ eines sozialen Akteurs ist in dieser Hinsicht ‚bounded‘.28 Was im Habitus aufgenommen und einverleibt werden kann, ist endlich und in dieser Endlichkeit nicht zufällig, sondern durch den aktualen Habitus vorstrukturiert. In den Habitus kann so die These Bourdieus nur dauerhaft inkorporiert werden wofür es eine Art habituelle ‚Ankoppelungsstelle’ gibt. Die relative Die Idee, dass die Individuierung des Einzelnen mit seiner Vergesellschaftung untrennbar verbunden ist, findet sich - in Anlehnung an George Herbert Mead – auch bei Jürgen Habermas (1988). 28 Ein treffendes Beispiel ist das in jüngeren Untersuchungen erneut nachgewiesene Phänomen, dass klassendifferenzierende Bildungschancen, neben einer Reihe sozialstruktureller und institutionslogischer Gründe, auch „mit klassenspezifischen Unterschieden in der Kosten-Nutzen-Abwägung für höhere Bildung und darauf basierenden Bildungsentscheidungen“ der Eltern zusammenhängen (Becker 2000: 450). 27 27 Stabilität des Habitus ist die Folge davon, dass die bestehende Strukturierung des Habitus ausschließt, „dass er alles verarbeitet was in der Welt ist“ (Krais/Gebauer 2002: 64). Diese Bedingtheit und Begrenzung der Denk-, Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Handlungsschemata sozialer Akteure unterliegt – neben der schlichten Tatsache, dass soziale Akteure gerade in modernen Gesellschaften gar nicht über alle Informationen und alles Wissen verfügen können das über die Gegenstandsbereiche ihrer Praxis vorliegt - auch in einer sozial strukturierten Begrenzung. Außerhalb dieser Grenzen sind für den Akteur „bestimmte Dinge einfach undenkbar, unmöglich […]. Aber innerhalb dieser Grenzen ist er durchaus erfinderisch, sind seine Reaktionen keineswegs immer schon im Voraus bekannt” (Bourdieu 1997: 33). Dies bedeutet nun offensichtlich nicht, dass die sozialen Akteure zu bloßen Trägern der Struktur degradiert werden (vgl. Bourdieu 1992: 34) und die aktiven und schöpferischen Dimensionen der Praxis der Akteure geleugnet werden (vgl. Bourdieu 1992: 28). Sofern man in Anlehnung an Kant davon ausgehen kann, dass Erfahrungsgegenstände nur mittels Interpretationsleistungen hergestellt werden können, die auf ein ‚Beurteilungsvermögen’, einen ‚sensus communis’, verweisen (vgl. Kant 1974 a § 40), wird dieser durch das Konzept des Habitus empirisch-sozialwissenschaftlich fundiert und als ein praktischer ‚sozialer Sinn’ reformuliert29. Im (Produktions-)Verhältnis von sozialem Raum und ‚vergesellschaftetem Subjekt’ stellt der Habitus vor allem die ‚synthetische Intuition’ (vgl. Bourdieu 1973) her, „die das Subjekt in den Stand setzt, sich [– ohne das dies auf bewusste Entscheidungen zurückzuführen wäre -] in der Gesellschaft zu orientieren“ (Gebauer 2000: 439). Zugleich ermöglicht der Habitus das, was in Anschluss an Micha Brumlik, einen Bestandteil eines nur durch Lernen, Interaktion und Sozialisation verstehbaren Begriffs der ‚Personalität’ bezeichnet. Es ist der Habitus, der Individuen in die Lage versetzt, „sich selbst als in Raum und Zeit kontinuierliche und abgrenzbare Wesen wahrzunehmen“ (Brumlik 1992: 235, vgl. Rorty 1976): er setzt dem „Opportunismus einer Art mens momentanea“ die Fähigkeit entgegen „in der Begegnung mit der Welt ein Gefühl innerer Geschlossenheit zu bewahren“ (Bourdieu 2001c: 207). Die äußeren, sozialen Strukturen und Begrenzungen werden nur dann und in so weit im engeren Sinne ‚reproduziert’, wie der Habitus unter gesellschaftlichen Bedingungen zur Anwendung kommt, die mit denen seiner Entstehung vollständig oder zumindest weitgehend identisch sind; sie werden dann ‚transformiert’, wenn – und dies ist in modernen, ausdifferenzierten Gesellschaften keine Ausnahmeerscheinung – diese beiden Bedingungen verschieden sind (vgl. Bourdieu 1987, Krais/Gebauer 2002, Schwingel 1995). Vergegenwärtigt man sich darüber hinaus die generativen Fähigkeiten jener Dispositionen, die den Habitus formieren, so ist dieser nicht in Form einer einfachen Widerspiegelung der biographischen Erfahrungen, sondern als eine „Analogie zur generativen Grammatik von Chomsky […zu verstehen] - In einem gewissen Sinne kann man davon sprechen, dass Bourdieu Kant vom philosophischen Kopf auf sozialwissenschaftliche Füße stellt und dabei vor allem die Vorstellung des handelnden Subjekts aus seiner Konzeption einer Philosophie des Geistes entreißt. 29 28 mit dem gewichtigen Unterschied freilich, dass es sich um durch Erfahrung erworbene, folglich […] variable Dispositionen handelt30” (Bourdieu 1992: 28). Die zentrale Pointe dieser Analogie besteht darin, dass Chomskys kompetenter Sprecher mit einem begrenzten und expressis verbis nicht bewussten Repertoire an grammatikalischen Regeln tendenziell unendendlich viele grammatikalisch korrekte Sätze bilden kann. Ebenso wie es erst die Grammatik erlaubt sinnvoll zu sprechen und gleichzeitig einschränkt, was gesagt werden kann und wie es gesagt werden kann, ohne zu determinieren, was in einer konkreten Situation geäußert wird, kann auch der Habitus als eine Art ‚Handlungsgrammatik’ verstanden werden, die es erlaubt „aus dem Vorhandenen” zu schöpfen (Bourdieu 1997: 33) und „wie mit jeder Erfinderkunst unendlich viele und (wie die jeweiligen Situationen) relativ unvorhersehbare Praktiken von dennoch begrenzter Verschiedenartigkeit” zu erzeugen (Bourdieu 1987: 104). Sofern man sich jedoch vor Augen hält, dass Chomskys ‚Universalgrammatik’ als ein System Regeln erzeugender Regeln gedacht wird, führt diese Analogie allerdings in die Irre: Durch den Habitus inkorporiert das handelnde ‚Subjekt’ „nicht die in der Gesellschaft vorgefundenen Regeln“ (Gebauer 2000: 445). Als Inkorporation der Positionierung des Akteurs in der sozialen Welt besitzt der Habitus „eine eigene Struktur, die keine Eigenschaften mit den sozialen Regeln gemeinsam haben muss“ (Gebauer 2000: 445). In diesem Sinne steht dem Habitusbegriff in keiner Weise entgegen, dass es - vor allem in modernen Gesellschaften - flexible und in ihrer je einzelnen Besonderheit unaufhebbar partikulare Lebensentwürfe gibt, die sich als ‚Patchworkidentitäten’ oder ‚Bastelbiographien’ beschreiben lassen (vgl. Ferchhoff 1999, Hitzler/Honer 1994) - nur finden sich auch diese eben nicht in einer völlig voluntaristischen bzw. struktur- und ressourcenunabhängigen Form31 (vgl. Geißler 2002, Vester et al. 2001). Mit dem Begriff des Habitus wird darauf bestanden, dass, wie Emile Durkheim (1994) in ‚Die elementaren Formen des religiösen Lebens’ ausführt, „unser sozialer Anteil“ das „wesentliche Element unserer Persönlichkeit“ ist. Dieser ‚soziale Anteil’ ist jedoch nicht einfach eine gegebene, den Akteuren äußerliche Substanz, sondern das Produkt ihrer gesellschaftlicher Praxis. Der Zusammenhang von strukturierender und strukturierter, praxisgenerierender Praxis des Spiels32 und dem Habitus als vermittelnder Ebene, kann gewissermaßen als Übertragung und Fortführung einer Diese Erworbenheit eines subjektiven, aber nicht individuellen Systems verinnerlichter Strukturen sorgt dafür, das der spezifische Habitus eines einzelnen Akteurs niemals vollständig deckungsgleich mit dem eines anderen Akteurs ist. Zugleich kann jedoch von einem Klassenhabitus gesprochen werden, der den typischen Habitus der Mitglieder eines Klassenmilieus von denen eines anderen unterscheidet. Dies ist deshalb möglich, weil kollektive und individuelle Erfahrungen eben weder deckungsgleich noch unabhängig voneinander sind. So kann auf der Ebene einzelner Akteure zwar „ausgeschlossen werden, dass alle Mitglieder ein und derselben Klasse (oder selbst nur zwei von ihnen) dieselben Erfahrungen – und zumal in gleicher zeitlicher Ordnung – gemacht haben; ebenso sicher ist aber auch, dass jedes Mitglied derselben Klasse sich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als jedes Mitglied einer anderen Klasse in seiner Eigenschaft als Akteur oder Zeuge mit den für die Mitglieder dieser Klasse häufigen Situationen konfrontiert sieht“ (Bourdieu 1979: 187). 31 In einem gewissen Sinne lässt sich davon sprechen, dass die Tendenz von der Zeitdiagnose entgrenzter und flexibilisierter Strukturen auf entsprechend veränderte Denk- und Wahrnehmungsmuster aller sozialen Akteure zu schließen im Kern auf eine lediglich formveränderte vulgärmaterialistische Ableitung verweist. Demgegenüber scheint Eigensinnigkeit, ja selbst Widerständigkeit und ‚Subkulturalität’ von Lebensentwürfen, insbesondere der von Jugendlichen angemessener in der Form erfassbar zu sein, wie etwa die Forscher der Birmingham School um John Clarke und Stuart Hall Wandlungsprozesse in der Alltagskultur rekonstruierten: dadurch, dass ‚widerständige’ Jugendkulturen die Klassenkulturen ihrer Herkunft (bzw. ihrer Eltern) nicht einfach auflösen, sondern vor allem ‚abwandeln’ (vgl. Clarke et al. 1979). 32 Diese Vorstellung lässt sich am Beispiel eines guten Tennisspielers erklären, der das Spiel gerade deshalb beherrscht weil der dort steht wo der Ball gerade hinkommt: „nichts ist zugleich freier und zwanghafter als das Handeln des guten Spielers. 30 29 zentralen Idee der Sprachphilosophie Wittgensteins auf die feldspezifische Regelmäßigkeit der Praxis betrachtet werden. Der Erklärungswert von Wittgensteins ‚Sprachspiels’ besteht nämlich darin, dass „es erlaubt, einerseits nach den Regeln in sprachlichen Kontexten [bei Bourdieu: Regelmäßigkeiten der Felder] zu suchen, und daß er es erlaubt, andererseits das sprachliche Handeln [die Praxis im Feld] als einen Wettstreit im Sinne des Spielens aufzufassen, der das Spiel dynamisch weitertreibt, neue Spielzüge generieren läßt – bis hin zur Veränderung der Regeln und des Spiels selbst” (Meder 1987: 11). Die beiden Ebenen sind unüberwindbar miteinander verwoben, aber analytisch bestimmbar, und faktisch jeweils wirksam. In der bildhaften Beschreibung Wittgensteins: Ich „unterscheide zwischen der Bewegung des Wassers im Flußbett und der Verschiebung dieses; obwohl es eine scharfe Trennung der beiden nicht gibt” (Wittgenstein 1970: §97 zit. nach Meder 1987: 11). Als konditionierte und bedingte Freiheit – die Bewegung des Wasser im Flussbett in Wittgensteins Bild - besitzt der Habitus somit relative Autonomie (Bourdieu 1997: 103). Jedoch legen hierbei die ungleich verteilten Chancen, über die verschiedenen Kapitalsorten zu verfügen den jeweiligen Raum für Variationen und selbst Innovationen fest (vgl. Schwingel 1995: 64). Daher fungiert der Habitus „als unendliche, aber dennoch strikt begrenzte Fähigkeit zur Erzeugung“, individueller und gesellschaftlicher Praxis und a la longe auch von Individualität und Gesellschaftlichkeit. Solange man jedoch „den üblichen Alternativen von Determination und Freiheit, Konditioniertheit und Kreativität, Bewusstem und Unbewusstem oder Individuum und Gesellschaft verhaftet bleibt […ist der Habitus] nur schwer zu denken. Da der Habitus eine unbegrenzte Fähigkeit ist, in völliger (kontrollierter) Freiheit Hervorbringungen – Gedanken, Wahrnehmungen, Äußerungen, Handlungen - zu erzeugen, die stets in den historischen und sozialen Grenzen seiner eigenen Erzeugung liegen, steht die konditionierte und bedingte Freiheit, die er bietet, der unvorhergesehenen Neuschöpfung ebenso fern wie der simplen mechanischen Reproduktion ursprünglicher Konditionierungen.” (Bourdieu 1987: 103) Die jeweilige Klassenlage determiniert somit nicht eine einzig mögliche Habitusform, sondern lässt, „einen reflexiv interpretierbaren Spielraum […] Es ist aber auch nicht jede Habitusform denkbar, d.h. die Klassengebundenheit kann auch durch individuelle Interpretation und Ausgestaltung nicht überwunden werden” (Dangschat 1998: 61). In diesem Sinne unterscheiden sich die Habitus der je einzelnen Akteure auch innerhalb ein und der selben Kultur und Klasse - in einem ähnlichen Maße wie sich auch die Individualgeschichten sozialer Akteure unterscheiden – und bleiben doch vergleichsweise ‚geregelte’ Abweichungen und Variationen eines kollektiven Habitus (vgl. Steinrücke 1988). Obwohl der Habitus in diesem weit verstandenen Sinne prägend ist, wird kaum eine Interpretation dem Ansatz Bourdieus weniger gerecht als die, die einen mechanisch-kausalistischen Zusammenhang von Habitus und konkreten, unsuspendierbar individuellen Handlungen unterstellt: „Nehmen Sie alle Eindrücke, die ein Mensch empfangen hat“ so erläutert Bourdieu (1985a: 336), „Sie werden daraus keine einzige künftige Handlung deduzieren können, selbst wenn es Ihnen gelingt, zu antizipieren, in welche Richtung sich seine kreative Fähigkeit bewegen wird” . Eine prä-determinierende Wirkung des Habitus, im Sinne einer Begrenzung der Kontingenz menschlichen Handelns, bezieht sich also nicht primär auf die Praxisinhalte als solche, sondern auf den begrenzten Spielraum der Praxisformen in denen es eine individuelle Wahl von Handlungen und Handlungsstrategien gibt. Diese Wahl ist jedoch nicht absolut, sondern relativ kontingent, in so fern Gleichsam natürlich steht er genau dort, wo der Ball hinkommt, so als führt ihn der Ball - dabei führt er den Ball“ (nach Fröhlich 1992: 42) 30 sie stets eine Wahl innerhalb eines bestimmten, nicht nur durch feldspezifisch situative Variablen, sondern auch durch das Verfügen über Kapital begrenzten Möglichkeitsspielraums darstellt, der gleichsam über die konkrete Praxissituation hinaus präreflexiv in individuellen und kollektiven Dispositionen – dem Habitus – inkorperiert und mithin historisch oder auf Seiten des einzelnen Akteurs ‚biographisch’ wird33. Differenziert man zwischen Inhalt und Struktur, so bestimmt der Habitus als ‚Modus Operandi‘ also eher Struktur, die Art und Weise des gesellschaftlichen Praxisvollzugs und weniger die konkreten Inhalte dieser Praxis selbst (vgl. Bourdieu 1982: 281). In dem mit dem Habituskonzept auf die durch die Praxis erfolgende Einverleibung der immanenten Notwendigkeiten und Rationalitäten „eines Ensembles von mehr oder weniger konkordanten Feldern” verwiesen wird, wird vor allem die ebenso a-historische wie sozialwissenschaftlich unterkomplexe Figur eines ‚situational man’ (vgl. Lofland 1967) zurückgewiesen und stattdessen darauf aufmerksam gemacht, dass die soziale Wirklichkeit in doppelter Weise existiert: „in den Sachen und in den Köpfen, in den Feldern und im Habitus, innerhalb und außerhalb der Akteure” (Bourdieu/Wacquant 1996: 161). Als Produkt der Geschichte stellt der Habitus eines Akteurs ein offenes – und zumindest phasen- oder teilweise auch von den Akteuren kontrollierbares (vgl. Bourdieu 1987: 407) - Dispositionssystem dar. Er beschreibt ein System von Virtualitäten und Potentialitäten, das erst im Verhältnis zu einer bestimmten Situation manifest wird, und somit als ‚reiner’ oder ‚freischwebender’ Habitus nicht existiert, sondern ständig mit neuen Erfahrungen konfrontiert und damit unentwegt von ihnen beeinflusst wird. Es sind mithin Praxisformen mit einem Habitus verbunden, „die sich weder aus den punktuell als Summe der Stimuli, die jene Praxisformen hervorgerufen zu haben scheinen, definierten objektiven Bedingungen, noch aus den Bedingungen unmittelbar deduzieren lassen, die das dauerhafte Prinzip ihrer Produktion geschaffen haben; aus dem folgt, daß jene Praxisformen nur derart erklärt werden können, daß die objektive Struktur, die die sozialen Bedingungen der Produktion des Habitus der sie erzeugt hat, definiert, in Beziehung gesetzt wird zu den Anwendungsbedingungen dieses Habitus” (Bourdieu 1976: 170f). Wenn ausdifferenzierte, bzw. ‚pluralisierte‘ Klassengesellschaften immer mehr individuelle Mobilität erfordern, kommt es entsprechend häufiger zu Kontakt mit Feldern deren Logik und Erfordernisse andere sind, als die früheren (Re-)Produktionsbedingungen der Erzeugungsgrundlagen aus denen der aktuale Habitus je hervorgegangen ist. Der Habitus neigt jedoch dazu, sich vor solchen Krisen und der damit verbundenen kritischen Hinterfragung der ‚Doxa’ zu schützen „indem er sich ein Milieu schafft, an das er so weit wie möglich vorangepasst ist, also eine relativ konstante Welt von Situationen, die geeignet sind, seine Dispositionen dadurch zu verstärken, dass sie seinen Erzeugnissen den aufnahmebereitesten Markt bietet” (Bourdieu 1987: 114). Hiermit verbunden ist eine Tendenz zu einer quasi-natürlichen Auffassung der Selbstverständlichkeit der sozialen Welt in der alltäglichen Praxis sozialer Akteure, basierend auf dem „Schein der Unmittelbarkeit, mit der sich der Sinn dieser Welt erschließt” (Bourdieu 1987: 52). Wenn Bourdieu in Anlehnung an Leibnitz schreibt, dass sich Akteure in drei Viertel ihrer Handlungen ‚wie Automaten’ bewegen (vgl. Bourdieu 1987), so beschreibt er damit 33 Zur ‚biographischen Illusion’ siehe Bourdieu 1990a 31 die sozialen Akteure nicht per se als ‚Dreiviertelautomaten’34, sondern verweist - in einer etwas unglücklichen Metapher - auf die etwaigen Proportionsverhältnisse von bewussten und ‚prä-reflexiven’ Elementen in sozialen Praxen. ‚Wie’ - und nicht etwa ‚als’ – ‚Automaten’ bewegen sich Akteure vor allem in empirisch voraussetzungsvollen Ausnahmesituation, „wenn die auf die Welt applizierten Schemata Produkte eben der Welt sind, auf die sie appliziert werden, das heißt in [Handlungssituation] der Alltagserfahrung [koinzidieren]: der vertrauten Welt“ (Bourdieu 2001c: 188 f). Allerdings kommt es grade in ausdifferenzierten Gesellschaften immer wieder zu ‚Krisen’ in denen Habitus und Feld auseinander treten und die habituellen Erwartungen systematisch enttäuscht werden. Somit ist die Vorstellung von „quasi-zirkulären Verhältnisse[n] quasi-vollkommener Reproduktion [… nur ein] ‚Sonderfall des Möglichen’ [, … der] nur dann uneingeschränkt gilt, wenn der Habitus unter Bedingungen zur Anwendung gelangt, die identisch oder homothetisch mit denen seiner Erzeugung sind“ (Bourdieu 1987: 117). Ist dies nicht der Fall, kommt es unvermeidlich zu Modulierungen des Habitus, oder sofern die Strukturen nicht „auf die unbewusste Zuarbeit“ der Dispositionen der Akteure treffen, zu einer Konstellation, die „der befreienden Kraft der Bewusstwerdung Raum lässt“ (Bourdieu 1998b: 44) und eine Ersetzung habitualisierter Praxisformen durch reflektierende Abwägung zulässt. Diese reflektierende Abwägung induziert nicht nur zu ‚Anpassungen’, sondern auch zu zunächst absichtsvoll herbeigeführten Veränderungen, d.h. nicht nur eine inhaltliche Varianz sondern auch Veränderung und Weiterentwicklung von Handlungs-, Präferenz- und Wahrnehmungsstrukturen bzw. eine Distanzierung von den eigenen Dispositionen ist durch eine bewusste und absichtsvolle Auseinandersetzung mit dem Habitus – im Sinne organisierter (Selbst-)Bildung – möglich35. Damit sind die sind die Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien, die die Basis der sozialen (Selbst-) Bedingtheit der Akteure darstellen, zwar in ihrem Ursprung primär auf die kulturellen, sozialen und ökonomischen Bedingungen ihrer Entstehung verwiesen, aber diese Bedingungen determinieren die Praxisformen d.h. die Entsprechungen von Habitus und Strukturen, der einzelnen Akteure weder direkt noch ‚irreversibel’. Obwohl die Ausführungen Bourdieus zu Beharrungskraft und Wirkungsweise des Habitus nicht immer einheitlich und durch sein Werk hindurch auch nicht immer kompatibel sind, gibt es Hinweise darauf, dass Bourdieu die Frage der sozialen Determinierung der Akteure defensiver fasst und der Möglichkeit einer (Selbst-)Subjektivierung der Akteure eine Potenz zuspricht, die mit Perspektive der jüngeren kritischen Bildungstheorie (vgl. etwa Krüger/Sünker 1999) durchaus vereinbar ist. Bourdieu lässt keinen Zweifel daran, dass der Habitus eines sozialen Akteurs als ‚konvertierbar’ bzw. dass er „kongruent und lernfähig (docile), dass heißt offen für die Möglichkeit der Restrukturierung ist“ (Bourdieu 1997c: 120, zit. nach Krais/Gebauer 2002: 61f). Explizit lehnt Bourdieu (2001c) den ‚Fatalismus’ ab, der „als Soziologismus daherkommen [kann], der die soziologischen Gesetzmäßigkeiten zu quasi naturgegebenen, ehernen Gesetzen erhebt, wie als essentialistischer, auf den Glauben an eine unveränderliche Menschennatur gegründeter Pessimismus“. 35 Bourdieu ist in dieser Hinsicht in seinen Ausführungen widersprüchlich. Während die dominante Interpretation darin besteht, das ja durchaus wesentliche Moment der Reproduktion und Perpetuierung sozialer Strukturen durch die habituell prä-strukturierte Praxis sehr stark – und mitunter zu stark - zu betonen, lässt sich die von Bourdieu immer wieder nahe gelegte Möglichkeit und Notwendigkeit zu Reflektion auch als Möglichkeit zunehmender Offenlegung und Bewusstmachung sozialer Mechanismen, d.h. als ein Prozess der Aufklärung verstehen. In einem solchen Aufklärungsprozess bestimmt 34 32 Da der Habitus darüber hinaus nicht ‚monolithisch’ ist (vgl. Bourdieu 2001c: 83) und entsprechend Konstellationen konkurrierender Wahrnehmung- Handlungs- und Sinnschemata innerhalb eines Wahrnehmungs- und Sinnhorizontes möglich sind, lässt sich davon sprechen, dass kreative Praxisformen nicht weniger möglich sind als vergleichsweise lineare Handlungsroutinen. Ein starrer, ‚verschlossener’ nicht-anpassungsfähiger Habitus ist – zumal in modernen Gesellschaften – sowohl empirisch (vgl. Vester et al. 2001) als auch mit Blick auf das analytische Konzept selbst nicht die Regel sondern eine Ausnahme: „In Abhängigkeit von neuen Erfahrungen ändern die Habitus sich unaufhörlich. Die Dispositionen sind einer Art ständigen Revision unterworfen, die aber niemals radikal ist, das sie sich auf der Grundlage von Voraussetzungen vollzieht, die im früheren Zustand verankert sind. Sie zeichnen sich durch eine Verbindung von Beharren und Wechsel aus, die je nach Individuum und der ihm eigenen Flexibilität oder Rigidität schwankt“ (Bourdieu 2001c: 207). Mehr noch verweißt das Konzept des Habitus als eine qua Praxis strukturierte und generativ strukturierende, personal inkorporierte Struktur darauf, dass die sozialen Akteure ihrer Umwelt nie passiv unterworfen sind. Zwar ist „die ‚Situation’ […] gewissermaßen die permissive Bedingung für die Erfüllung des Habitus“ (Bourdieu 1993: 129), zugleich bedingen aber die Akteure selbst „aktiv die Situation, die sie bedingt. Man kann sogar sagen, dass die sozialen Akteure nur in dem Maße determiniert sind, in dem sie sich selber determinieren [… Dabei ist] die erste Neigung des Habitus […] schwer zu kontrollieren, aber die reflexive Analyse, die uns lehrt, dass wir selber der Situation einen Teil der Macht geben, die sie über uns hat, ermöglicht es uns, an der Veränderung unserer Wahrnehmung der Situation und damit unsere Reaktionen zu bearbeiten. Sie versetzt uns in die Lage, bestimmte Bedingtheiten, die durch das Verhältnis der unmittelbaren Übereinstimmung von Position und Disposition zum Tragen kommen, bis zu einem gewissen Punkt zu überwinden“ (Bourdieu/Wacquant 1996: 170) Auch auf der eher präreflexiven Ebene diskursiver Praktiken und sozio-symbolischer Auseinandersetzungen und Klassifikationskämpfe bezeichnet der Habitus, als eine Diffundierungen, Uneinheitlichkeiten und Streuungen zu relativ homogenen komplexen Regelmäßigkeiten der aktualisierbarer Praktiken vereinigende Instanz, eine Art Amalgamierung „durchaus polyvalente[r], heterogene[r] Strategien […], die, je nach strukturellem Kontext, homöostatisch-bewahrenden oder dynamisch-flexiblen Charakter annehmen [können]“ (Bublitz 2002: 6). Der soziale Akteur ist – wenngleich der Habitus einen inkorporierten Bestandteil seiner selbst ist – jedoch nicht auf den Habitus zu reduzieren. Bourdieu (1976: 207) verwehrt sich explizit dagegen „aus dem Habitus das exklusive Prinzip einer jeden Praxis zu machen, wenngleich es keine Praxis gibt, der kein Habitus zugrunde liegt“. Vielmehr wirkt der Habitus um so selbstverständlicher und damit effizienter, je weniger sich der einzelne soziale Akteur mit ihm auseinandersetzt und je homologer oder redundanter er sich zu den praktischen Anforderungen verhält. Der Habitus fungiert also vor allem als ein „sehr ökonomisches Aktionsprinzip, das eine enorme Ersparnis an Rechenaufwand […] und an der beim Handeln besonders knappen Ressource Zeit sichert. Er entspricht demnach besonders den gewöhnlichen Umständen der Existenz, die bald dringlichkeitshalber, bald mangels notwendiger Kenntnisse kaum Raum geben für eine bewusste und kalkulierte Evaluierung der Profitchancen” (Bourdieu et al. 1998: 200). Bourdieu auch die kritische, gesellschaftliche Rolle des sozialwissenschaftlichen Forschers: „If the sociologist has a role to play, it’s more to give weapons than to give lessons” (zit. nach Schubert 1999: 97). 33 Diese Effektivität bezieht sich nicht nur auf ‚Profite‘ in monetärer Hinsicht. Der Begriff der Profite ist vielmehr an die spezifische ‚Ökonomie‘ des jeweiligen Feldes gebunden. In diesem Zusammenhang spricht Bourdieu von einer allgemeinen Theorie der Ökonomie, die er letztlich nicht als Substanz, sondern allgemein als Beziehung zwischen sozialen Akteuren versteht. Bourdieu (1987: 80) zu Folge vollzieht sich die Praxis sozialer Akteure innerhalb eines „System[s] von Institutionen und Dispositionen in welchen es eine Logik gibt“. Diese Logik kennzeichnet das, was Bourdieu als ‚Ökonomie des Feldes’ bezeichnet, „die gleichzeitig in den Institutionen, in den Mechanismen und in den Dispositionen, im Kopf der Leute ist […, und die] bewirkt, dass es Sanktionen gibt, die nicht zufallsbedingt sind” (Bourdieu 1987: 80). ‚Ökonomie’ ist somit nichts anderes, als das für eine rationale Praxis konstitutive Verhältnis, dass zwischen einem Habitus und einem Feld ausgelöst wird. Vermittelt über den Habitus wird dabei Seitens des Akteurs eine präreflexive Bevorzugung jener Praxisformen impliziert, die am besten geeignet erscheinen, „die in der Logik eines Feldes enthaltenen Ziele mit dem geringsten Aufwand zu erreichen [. Daher] kann diese Ökonomie in Bezug auf alle möglichen Funktionen definiert werden.” (Bourdieu 1987: 167). In diesem Sinne ist eine durch die je spezifischen Rationalitäten und Regelmäßigkeitssystemen eines sozialen Feldes bestimmte allgemeine Ökonomie der Praxis „durch die einem Feld eigenen Einsätze – das jeweilige Kapital – und die Ziele – ‚die Maximierung spezifischer Profite’ – [definiert.] welche mittels Strategien verfolgt werden, die durch den praktischen Sinn vermittelt und dadurch an die Struktur des Feldes (mehr oder weniger) angepasst sind.” (Schwingel 1993: 90f) Was Marx den ‚stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse’ nennt, gilt also auch außerhalb der pekuniären Ökonomie: „Man kann nicht irgend etwas machen, wenn man bei der Akkumulation oder dem Wachstum seines Kapitals erfolgreich sein will” (Schwingel 1993: 81). Wenn es demnach also teilweise explizite vor allem aber unausgesprochene ‚Spielregeln’ gibt, die sozialen Felder konstituieren und definieren, so stellen sie einerseits einen Zwangscharakter dar – auf den man sich einlassen muss, wenn man ‚mitspielen’ will -, andererseits sind es grade sie, die die Möglichkeitsbedingungen der jeweiligen Felder erzeugen. In diesem Zusammenhang ist der Strategiebegriff Bourdieus, als ‚objektiver Sinn ohne subjektive Absicht’ zu verstehen. Epistemologisch ist ein solcher praxisökonomischer Strategiebegriff an eine Unterscheidung zwischen der ‚Logik der Theorie’ und der ‚Logik der Praxis’ gekoppelt, die in erster Line darin begründet ist, dass letztere durch Zeitlichkeit, Irreversibilität und Dringlichkeit gekennzeichnet ist (vgl. Bourdieu 1987: 148 ff). Um in der Logik einer feldspezifischen Praxis bestehen zu können, bedarf es eines ‚praktischen Sinns’ bzw. „das was man auch ein ‚spielerisches Gespür’ nennen könnte: der gekonnte praktische Umgang mit der immanenten Logik des Spiels, die praktische Beherrschung der ihm innewohnenden Notwendigkeit. […D]ieser ‚Sinn‘ wird durch Spielerfahrung erworben und funktioniert jenseits des Bewusstseins und des diskursiven Denkens” (Bourdieu 1992: 81). Der Strategiebegriff wird in dieser Hinsicht in einer bewussten – und teilweise auch polemisch überspitzen - Abgrenzung zum autonomen, rational kalkulierenden Subjekt der ‚Rational-Choice’ Ansätze (vgl. Hill 2002) konzipiert, die dazu tendieren, soziale Regelmäßigkeiten auf bloßes Aggregat individueller Handlungen zu reduzieren. Er richtet sich stattdessen vor allem auf eine dem Handeln ‚prä-reflexiv’ und auf sprachlicher Ebene nicht artikuliert - oder gar nicht artikulierbar – zu Grunde 34 liegende ‚praktische Vernünftigkeit’ (vgl. Bourdieu 1998); „auf das Prinzip der Verstehbarkeit […] auf die Rationalität, die soziale Praktiken aufgrund ihrer ‚objektiven‘ Zielgerichtetheit, d.h. ihrer Ausrichtung auf zentrale gesellschaftliche ‚Einsätze‘ eigentümlich ist” (Raphael 1987: 155). Strategien sind also dem Kräftespiel der Kampffelder ‚objektiv‘ angepasste Handlungen, die als solche nicht subjektiv intendiert sein müssen. Das was Bourdieu als Hysteresis-Effekt des dispositionalen Gefüges des Habitus bezeichnet – d.h. Trägheit, von einer Gewohnheit abzugehen -, lässt sich in diesem Kontext vor allem auch als die Beibehaltung eines Habitus im ‚falschen‘ Feld verstehen. In dieser Hinsicht manifestiert sich der Hysteresis-Effekt als eine praktische ‚Fehlstrategie‘, die in der Regel mit negativen, im skizzierten Sinne ökonomischen, Auswirkungen verbunden ist. II 1. 3. KÄMPFE UND SYMBOLISCHE MACHT In Bourdieus analytischem Modell stellen Felder im sozialen Raum Kraft- und vor allem Kampffelder dar, in „denen um die Wahrung oder Veränderung der Kräfteverhältnisse gerungen wird” (Bourdieu 1985: 74). Dabei geht es nicht nur um die Distribution materieller Ressourcen, sondern vor allem um Fragen symbolischer Herrschaft. Der praxisökonomischen Analyse symbolischer Gewalt liegt die Einsicht zu Grunde, dass Herrschaft um so effektiver funktioniert, je eher sie es schafft ihre kulturelle Willkürlichkeit als Notwendigkeit oder Natürlichkeit darzustellen und damit es zu vermeiden, dass ihre Existenz als Herrschaft überhaupt ans Tageslicht kommt. Im ‚günstigsten Falle’ geschieht dies nicht nur gegenüber den ‚Beherrschten’ sondern auch gegenüber den ‚Herrschenden’ selbst. Sofern man davon ausgehen kann, dass zumindest in demokratisch verfassten Gesellschaften ein bloßer Zynismus langfristig keine Basis für stabile Herrschaft darzustellen in der Lage ist (vgl. Foucault 1976, Hauck 1993) und viel weniger noch in der Lage sein, kann die Beherrschten dazu zu bewegen, Herrschaft zu erdulden, ja zu rechtfertigen (vgl. Steinrücke 1988: 92) bzw. „ihre eifrige Unterwerfung und aktive Beteiligung an einem System von Ausbeutung und Unterdrückung zu erlangen deren erste Opfer sie sind“ (Bourdieu 1997c: 213), so ist gerade die Lautlosigkeit von Herrschaft bzw. ihre Anerkennung und Verkennung, ihr stabilster Garant36 (vgl. Bourdieu 1990 dazu auch: Foucault 1976, Mathisen 1985). „Von allen Formen der ‚unterschwelligen Beeinflussung’“ so Wacquant und Bourdieu (1996: 205) in offensichtlicher Anlehnung an Foucault, „ist die unerbittlichste die, die einfach von der Ordnung der Dinge ausgeübt wird“. Ordnungen funktionieren demnach umso besser, je weniger die Willkürlichkeit ihrer Grundlagen sichtbar ist: „Anders gesagt: die Herrschenden haben ein Interesse am Konsensus, an der grundsätzlichen Übereinstimmung über den Sinn der sozialen Welt auf der Grundlage einer Übereinstimmung über die Prinzipien der sozialen Gliederung“ (Bourdieu 1990: 108). Auf die Freiwilligkeit der Aufrechterhaltung gegebener Verhältnisse verweist Bourdieu mit dem Begriff der ‚Doxa‘, bzw. der ‚paradoxen Unterwerfung‘, als die „Unterwerfung unter eine sanfte, nicht spürbare, selbst für die Opfer nicht sichtbare Gewalt” (Bourdieu 1998d: 1). Die Verwendung des 35 Begriffs ‚Doxa‘ verweist dabei weniger auf Marxens ‚falsches Bewusstsein‘, als auf Gouldners (1976: 224) Rede von ‚Paleo-Symbolismus‘, als restringierte Kommunikationsfähigkeit auf der Basis von unhinterfragten weil unhinterfragbaren Glaubenssätzen. ‚Doxische‘ Gewalt ist also einer Form der Herrschaft, die „sich hauptsächlich auf rein symbolischem Weg vollzieht, mittels Kommunikation und Kenntnis, oder besser: mittels Verkennung, Anerkennung und letztlich mittels Gefühl” (Bourdieu 1998d: 1). Doxa, als die Inkorporierung sozialer – d.h. machtförmig erzeugter – Ordnungen, verweist auf das merkwürdige Phänomen, dass „die real existierende Ordnung der Welt mit ihren Einbahnstraßen und Durchfahrtsverboten (im buchstäblichen wie übertragenen Sinne) und mit ihren Pflichten und Strafen im großen und ganzen respektiert wird: dass es nicht viel häufiger zu Übertretungen und Auflehnungen kommt, nicht viel häufiger Verbrechen und ‚Verrücktheiten’ begangen werden […]. Noch verblüffender ist jedoch, dass die etablierte Ordnung mit ihren Herrschaftsverhältnissen (den Rechten und Sonderrechten, Vorrechten und Ungerechtigkeiten) sich abgesehen von ein paar historischen Zwischenfällen so reibungslos hat perpetuieren können; und nicht minder verblüfft, dass selbst die unerträglichsten Lebensumstände so oft als annehmbar oder gar naturgegeben erscheinen” (Bourdieu 1998d:1). Wenn die soziale Ordnung bzw. symbolische Herrschaft mittels ihrer praktischen Inkorporierung aber selbst zu einem ein Teil des Habitus der sozialen Akteure wird, stellen sie nicht nur Beschränkungen und Unterdrückungen, sondern – wie der Habitus - ein generatives und generierendes Prinzip sozialer Praxis dar. In diesem Sinne können die Begriffe Doxa und symbolische Herrschaft als eine sozialstrukturell fundierte Entsprechungen eines ‚produktiven’ Machtbegriffs verstanden werden, wie ihn etwa Michel Foucault vorschlägt: „Wenn sie [die Macht] nur repressiv wäre wenn sie niemals etwas anderes tun würde als nein sagen“, fragt Foucault, „ja glauben sie dann wirklich, dass man ihr gehorchen würde? Der Grund dafür, dass Macht herrscht, dass man sie akzeptiert, liegt ganz einfach darin, dass sie nicht nur als neinsagende Gewalt auf uns lastet, sondern in Wirklichkeit unseren Körper durchdringt, Dinge produziert, Lust verursacht, Wissen hervorbringt, Diskurse produziert; man muss sie als produktives Netz auffassen, das den ganzen sozialen Körper überzieht” (Foucault 1978: 35). Bei aller Divergenz der theoretischen Architektur und Erkenntnispraxen von Bourdieu und Foucault ist ihnen eine Fassung von Macht als ein konstitutives Element in allen gesellschaftlichen (Praxis)Verhältnissen gemeinsam37 (vgl. Bublitz 1997, Papilloud 2003). Wie bei Foucaults mikrophysikalischem Machtkonzept, sind auch bei Bourdieu alle sozialen, ökonomischen, kulturellen etc. Praxisformen von ‚Macht’ durchzogen, wobei jedoch das analytische Interesse an Machtformen und -prozessen bei Bourdieu vor allem auch auf die Ebene sozio-kultureller, materieller und symbolischer Konkurrenz - und Klassenkämpfe ausgedehnt wird. In diesen sozialen Kämpfen sozialer Akteure geht es um ‚objektive‘, d.h. nicht unbedingt subjektiv intendierte, Ziele bzw. Gewinne an sozialen Vorteilen. Damit verbunden verweisen diese Kämpfe innerhalb einer Ordnung (‚Konkurrenzkämpfe’) a la longe in ihrer Gesamtheit immer auch auf Kämpfe um die Anordnungen sozialer Kräfteverhältnisse, d.h. um eine Konservierung oder eine Subversion bestehender materieller wie symbolischer Ordnungen. Analytisch bietet es sich jedoch an, zunächst zwischen den de facto eng „Nur unter der Bedingung, dass sie einen wichtigen Teil ihrer selbst verschleiert“, so schreibt auch Foucault (1976: 107), „ist Macht erträglich. Ihr Durchsetzungserfolg entspricht ihrem Vermögen, ihre Mechanismen zu verbergen. Würde die Macht akzeptiert, wenn sie gänzlich zynisch wäre?“ 37 Im Vergleich zur mikrophysikalischen Fassung von Macht bei Foucault, lassen sich die Machtkämpfe bei Bourdieu jedoch eher (sozial-)strukturell einordnen. 36 36 verknüpften materiellen und symbolischen Ebenen zu unterscheiden, da auf beiden Ebenen andere Ziele verfolgt werden: Auf der materiellen Ebene geht es um die durch Knappheit bedingte Konkurrenz bei der unmittelbaren Akkumulation von Kapital. Materielle Konkurrenz wird dabei weniger mit einem individuellen Profitstreben einzelne Akteure in Verbindung gebracht, sondern in den Strukturen sozialer Ungleichheit und den Logiken der Felder selbst angesiedelt. Auf der symbolischen Ebene geht es um die Legitimierung dieser Akkumulationsergebnisse, d.h. zum einen um die Aneignung symbolisch positiv wahrgenommener und bewerteter Merkmale, zum anderen um den Kampf um die Macht zur Legitimation38 und Delegitimation bestimmter Praxisformen und Praxisverhältnisse. Dieser Kampf lässt sich als „genuin symbolischen Konkurrenzkampf” verstehen (Schwingel 1993: 88). Materielle und symbolische Konkurrenzkämpfe kennzeichnen alltägliche Auseinandersetzungen in der feldspezifischen Ökonomie der Praxis. Konkurrenzkämpfe sind auf feldspezifische Interessen zurückzuführen, die in so fern objektiver Natur sind, dass sie relativ unabhängig vom Wissen und der Intention der handelnden Akteure bestehen, die diese wahrnehmen und zugleich reproduzieren, sobald sie sich in der Logik der Felder bewegen: „Das für ein ‚Spiel’ kennzeichnende spezifische Interesse wird identisch mit der ‚Besetzung’ (affektives Engagement und materielle Investition) des ‚Spiels’ , mit der illusio als stillschweigender Anerkennung der ‚Spieleinsätze’. Jedes Feld erheischt und schafft eine besondere Form von Interesse (diese fundamentale ‚Besetzung’, die jedes Feld dem als Gebühr abverlangt, der eintreten will, das heißt die Anerkennung der Geltung des ‚Spiels’ und der ‚Spieleinsätze’, ist allen Beteiligten gemeinsam, was bedeutet, dass sie auch im Falle von Dissens durch Konsens – nicht Vertrag – verbunden sind). Dieses mit der Teilnahme am Spiel implizierte besondere Interesse spezifiziert sich jetzt noch je nach Stellung innerhalb des ‚Spiels’” (Bourdieu 1989: 399). Insofern besteht eine enge Verbindung von symbolischen und materiellen Interessen, und damit von symbolischen und materieller Konkurrenz. Der Verweisungszusammenhang von materiellen und symbolischen Dimensionen darf jedoch nicht im Sinne eines Basis und Überbau Verhältnisses in dem Sinne verstanden werden, dass die symbolischen Auseinandersetzungen um die Klassifikations- und Ordnungssysteme – ihrerseits „eine vergessene Dimension der Klassenkämpfe” (Bourdieu 1982: 755) – auf die Logiken der Kämpfe um knappe materielle Ressourcen reduzierbar wären39. Die relativ autonome, symbolische Ebene wird nicht nur von den objektiven Gegebenheiten beeinflusst, sondern hat selbst starken ‚realen’ Einfluss auf die materiellen Kräfteverhältnisse. Der symbolischen Ebene der Gesellschaft entspricht auf der Ebene der sozialen Akteure die durch den Habitus - als dem „Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis und Klassifikationssystem (prinzipium divisionis) dieser Formen” (Bourdieu 1982: 277) – konstituierte, sich repräsentierende soziale Welt40. Anders formuliert ermöglicht die relative Autonomie des Symbolismus 38In diesem Sinne stellt bereits Max Weber (1980: 151) fest, dass „bei Herrschenden und Beherrschten [...] die Herrschaft durch [...] Gründe ihrer ‚Legitimität‘ innerlich gestützt zu werden [pflegt]“. 39 In der impliziten Anthropologie Bourdieus findet sich vielmehr eine Korrespondenz zu Cassirers ‚homo symbolicus‘, insofern Bourdieu auf der Ebene der Erkenntnissoziologie eine Eigenlogik des Symbolismus unterstellt, die sich auch in seiner Unterscheidung der objektiven Strukturebene und der Ebene der Lebensstile in seinem Raum-Modell widerspiegelt. 40 Gegenstand einer umfassenden sozialwissenschaftlichen Analyse müssen daher sowohl objektiv-materielle als auch subjektiv-symbolische Realitätsebenen sein: „Weil Individuen oder Gruppen objektiv nicht nur durch ihr Sein definiert sind, sondern auch durch das, was sie angeblich sind, also durch ihr wahrgenommenes Sein, das zwar eng von ihrem Sein 37 das, was Bourdieu ‚symbolische Macht‘ oder ‚symbolische Gewalt‘ nennt: die Fähigkeit „Bedeutungen durchzusetzen und sie als legitim durchzusetzen, indem sie die Kräfteverhältnisse verschleiert, die ihrer Kraft zugrunde liegen” (Bourdieu 1973: 229). Im Kotau der Kämpfe sozialer Akteure um die Bedeutungen und Bewertungen oder kurz symbolischen Kräfteverhältnisse der sozialen Welt kämpfen die Akteure auch um ihre symbolische Selbstrepräsentation: „the discursive constitution of the subject [is] inextricable from the social constitution of the subject“ (Butler 1999: 120). In dem untrennbar mit den Auseinandersetzungen um die Positionen im sozialen Raum verknüpften Kampf um die Durchsetzung der legitimen Vorstellung der sozialen Welt, bemisst sich „die Macht der Akteure ganz direkt nach ihrem symbolischen Kapital, also nach der Anerkennung, die sie von einer sozialen Gruppe bekommen: Die Autorität […] ist ein percipi, ein Gekannt- und Anerkanntwerden, das ein percipere durchsetzen kann, oder richtiger gesagt, sich selbst etwas, das offiziell, das heißt vor den Augen und im Namen aller, den Konsens über den Sinn der sozialen Welt erzwingen kann, auf dem der common sense41 beruht” (Bourdieu 1990: 72). abhängig ist, doch nie völlig darauf zurückgeführt werden kann, muss die Sozialwissenschaft die beiden Arten von Eigenschaften berücksichtigen, die objektiv mit jenen Seinsarten verknüpft sind: einerseits die materiellen, die sich, wie schon der Leib, wie Beliebiges aus der physischen Welt zählen und messen lassen, und andererseits die symbolischen Eigenschaften, die nichts anderes als in ihren Wechselbeziehungen, d.h. als Unterscheidungsmerkmale aufgefasste materielle Eigenschaften sind” (Bourdieu 1987: 246). Es existiert demnach eine relative Autonomie von ‚objektiven‘ Bedingungen - inklusive des Verfügens über Kapital - und deren symbolischen Eigenschaften. Diese ist in der Nicht-Identität von materieller Logik als einer Logik von Differenzen und differentiellen Abständen und symbolischer Logiken begründet, durch die diese relationalen Differenzen zu signifikanten Unterscheidungen werden (vgl. Bourdieu 1985: 21). Diese Differenz ermöglicht für die Akteure auf der symbolischen Ebene, in klassenspezifisch differenzierter Weise, Freiheitsmomente gegenüber der objektiven Soziallage: „Das bedeutet, dass Moral und Ästhetik einer bestimmten Klasse, da jeweils einer besonderen Klasse von Existenzbedingungen angepasst, die sich durch eine bestimmte Nähe oder Ferne zur Zwangsphäre der ökonomischen Notwendigkeiten auszeichnen, entsprechend ihrem Banalitäts- oder Distinktionsgrad auf die der anderen Klassen bezogen, ihre Optionen daher automatisch mit einer klar bestimmten Position assoziiert und mit einem kennzeichnenden Wert versehen sind, und zwar unabhängig von jedweder Distinktionsabsicht, von jedwedem Streben nach Differenz” (Bourdieu 1982: 382). Die Freiheitsmomente der symbolischen Ebene sind klassenspezifisch, je nach der Abstand zu objektiven, materiellen Zwängen unterschiedlich stark ausgeprägt. Deshalb spielt sich das „Spiel der symbolischen Unterscheidungen […] innerhalb des engen Raumes ab, dessen Grenzen die ökonomischen Zwänge diktieren, und bleibt, von daher gesehen, ein Spiel der Privilegierten privilegierter Gesellschaften, die es sich leisten können, sich die wahren Gegensätze, nämlich die von Herrschaft, unter Gegensätzen der Manier zu verschleiern” (Bourdieu 1974: 73). Auch wenn damit die ‚herrschenden Klassen’ selbst den eigentlichen Schauplatz symbolischer Kämpfe – als Konkurrenzkämpfe zwischen den Akteuren und ‚Faktionen’ dieser Klassen - darstellen (vgl. Bourdieu 1982: 395) bedeutet dies nicht, dass sich die praktische Relevanz symbolischer Kräfteverhältnisse auf diese Gruppen beschränkt. Vielmehr kann davon gesprochen werden, dass nicht nur die Chancen zur Durchsetzung symbolischer Gewalt, sondern bereits die Möglichkeiten an den Kämpfen um die symbolische Hegemonie überhaupt teilzunehmen, klassenspezifisch ungleich verteilt sind. Dies ist deshalb der Fall, weil die für genuin symbolische Strategien so wesentliche Autonomie gegenüber den materiellen Bedingungen in den unteren Klassen am geringsten ausgeprägt ist: der Lebensstil und der Geschmack der unteren Klassen, wird unter den Eindruck des Zwangs der materiellen Verhältnisse der Tendenz nach vor allem vom Diktat der ‚Notwendigkeit‘ oktroyiert. Sie gestattet in so fern vergleichsweise wenig Raum für abstrakte Ästhetisierungen und ‚Stilisierungen des Lebens’ (Weber). Der Lebensstil, bzw. die Stilisierung des Lebens der herrschenden Klasse hat als legitimer Geschmack tendenziell Vorbildcharakter für die übrigen Klassen. Während insbesondere das aufstiegsorientierte Kleinbürgertum versucht der herrschenden Klasse nachzueifern, zeichnet sich der Geschmack der herrschenden Klassen durch einen ‚Sinn für Distinktion‘ aus (vgl. Bourdieu 1982: 405 ff). Entgegengesetzt wirkt der Habitus der unteren Klassen, als Negativschablone, von der sich die übrigen Klassen absetzen (dazu auch Vester et al. 2001). Die nach außen zunächst unsichtbaren Positionen im Raum objektiver Unterschiede des primären (materiellen) Kapitals finden demnach ihren entsprechenden Ausdruck durch sichtbare Unterschiede und Distinktionssymbole in einem symbolischen Raum. Während daher „die objektiv stärksten Differenzierungsprinzipien, wie ökonomisches und kulturelles Kapital, deutliche Unterschiede zwischen den an Extrempunkten angesiedelten Agenten bewirken, ist ihr Effekt in den mittleren Zonen des sozialen Raums offensichtlich geringer. Die Unbestimmtheit und Verschwommenheit der Beziehungen zwischen Praktiken und Positionen und der Spielraum für Strategien, die diese Beziehungen verdecken wollen, sind hier am größten.” (Bourdieu 1997b: 121) 41 Common Sense im Sinns Bourdieus impliziert alle drei etymologischen Bedeutungen der griechischen Begriffe auf denen er basiert: dem koinos nous als der gemeinsamen Denkform, der koine aisthesis als dem gemeinsamen Wahrnehmungssinn, und und der koine ennoia als gemeinsam geteilte Überzeugungen und Vorstellungen. Darüber lehnt sich Bourdieu offensichtlich an Immanuel Kants Rede vom ‚senus communis’ an. 38 Dieser Common Sense ist keine anthropologische und keine überhistorische Konstante, sondern das Zwischenergebnis kulturspezifischer Dynamiken. Im Sinne der Macht zur Durchsetzung legitimer Bedeutung ist die Möglichkeit zur Produktion von Common Sense insbesondere in ausdifferenzierten Gesellschaften - auch innerhalb ‚einer Kultur’ - an spezifische, ungleich verteilte ökonomische und soziale Bedingungen geknüpft ist. Dabei gestattet es die Durchsetzung commonsensualer Bedeutungen und Bewertungen ihren Träger sowohl „einen Gewinn an Distinktion” gegenüber jenen zu sichern, deren Praxisformen und -präferenzen weiter von diesem Common Sense entfernt sind, als auch „einen Gewinn an Legitimität, den Gewinn überhaupt, der darin besteht, sich so, wie man ist, im Recht, im Rahmen der Norm zu fühlen” (Bourdieu 1982: 359). Gewinne, die sich aus einer Nähe des eigenen Habitus und Lebensstils diesem Common Sense ergeben zeigen sich also nicht alleine auf der Ebene der objektiv-materiellen Stärke, sondern auch auf der Ebene des Sinns und der Erkenntnis, nämlich darin, bloße Unterschiede in qualitative Differenzen zu ‚verwandeln’. Anders formuliert liegt, der Wert des Machtmittels zur Erzeugung von Common Sense, dem symbolischen Kapital - nicht in einem unveräußerlichen Merkmal einer Eigenschaft selbst42, sondern in der Schaffung eines distinktiven, relationalen Grenzwerts, d.h. dem Gewinn, der durch positive oder negative Hervorhebung gewährleistet werden kann. Als symbolischen Unterscheidungsstrategien fungieren dabei die „beiden grundlegenden Operationen der sozialen Logik, nämlich Vereinigung und Trennung […] die symbolische Geltung der Gruppe gesteigert oder vermindert werden kann […] Das Eigentümliche der Logik des Symbolismus liegt darin, dass sie winzig kleine [… und] willkürlichen Unterschiede, wie sie in der statistischen Verteilung von Eigenschaften verzeichnet sind, zu Zeichen (selbstverständlicher) Unterscheidung [… und] zu absoluten Unterschieden zwischen alles oder nichts aufbauscht“ (Bourdieu 1987: 249 ff). Wenn symbolisches Kapital die anerkannte und legitime Form der anderen Kapitalen darstellt, so ist es jenes Machtmittel, das es ermöglicht die sozio-historische Bedingtheit und damit Veränderbarkeit der ‚objektiven’ Kräfteverhältnisse, die sich aus dem Volumen und der Struktur der primären Kapitalen konstituieren, zu verschleiern, um somit die kulturelle Willkür als inkontigente, quasi-natürliche Eigenschaft zu verklären und die selbstverständliche Anerkennung einer letztlich beliebigen Macht durchzusetzen. Die symbolische Gewalt ist somit „die sanfte und verschleierte Form, welche die Gewalt dort annimmt, wo nackte Gewalt unmöglich ist” und zeigt sich am zuverlässigsten, wenn es zur Entfaltung ihrer Wirkungen „keiner Worte, sondern nur der Duldung und des stillschweigenden Einvernehmens bedarf” (Bourdieu 1987: 244). Die Legitimierung der bestehenden sozialen Ordnung, die als „praktische Anerkennung der Legitimität […] in bestimmten Handlungen oder Enthaltungen vorliegt”, stellt dabei in der Regel „keinen auf explizitem Nachdenken beruhenden Akt der freiwilligen Zustimmung dar” (Bourdieu 1989: 402), sondern vollzieht sich durch die Praxis selbst „über einen Akt des Er- und Verkennens […], der noch vor den Kontrollen von Bewusstsein und Willen stattfindet, im Dunklen der Schemata des Habitus” (Bourdieu 1996: 209). In dieser Hinsicht gilt für das Konzept relationaler symbolischer Macht bei Bourdieu das selbe, was Deleuze (1995: 43) zum mikrophysikalischen Konzept der Macht bei Foucault, ausführt: Macht hat „kein Wesen, sie ist operativ. Sie ist kein Attribut sondern ein Verhältnis” (vgl. auch Elias 1970). 42 39 In sofern ist sich Bourdieu mit Michel Foucault (1987) und Norbert Elias (1970) darin einig, dass Macht, obgleich ein Verhältnis, das in Strukturen geronnen, durch Praxisverhältnisse strukturiert und zugleich durch die Akteure habituell inkorporiert ist, nur in actu existieren kann. Als Konstitutionsprinzip eines Netzes von Möglichkeiten in dem soziale Akteure, innerhalb von gegebener Grenzen – die sich über die Zeit hinweg verengen oder erweitern können - Entscheidungen treffen und Ziele verfolgen (vgl. Lukes 1977: 29), beruht symbolische Macht weniger auf Unterdrückung und ‚aktiver’ Unterwerfung, sondern vielmehr auf der impliziten Anerkennung der Legitimität einer Ordnung durch ‚praktische Zustimmung’43. Sie ist keine bloße Einschränkung einer – gegebenen oder gar essentiellen – Autonomie von Akteuren, sondern eher „ein[e] komplexe strategische Situation in einer Gesellschaft“ (Foucault 1977: 114) um spezifische Formen von Praktiken und ‚Identitäten’ hervorzubringen oder unwahrscheinlich zu machen, zu stützen, zu legitimieren oder abzuwerten. Es ist die Verknüpfung von Macht als symbolischer Gewalt - mit Castells (2000: 39) „das Vermögen eines gegebenen symbolischen Kodes, einen anderen Kode aus dem individuellen Denken dessen zu lösen, über den Macht ausgeübt wird” - mit den strukturierenden Dispositionen des Habitus, die dafür Sorge trägt, dass die Eigenlogik der symbolischen Herrschaft „den Gegensatz von Zwangsausübung und Zustimmung, äußerem Zwang und innerem Trieb aufhebt”44 (Bourdieu 1996: 209). 43 Symbolische Macht basiert, wie es Schwingel (1993: 108) formuliert im Kern auf „der habituellen Übernahme der äußeren Bedingungen des Daseins und in der Anerkennung dieser Bedingungen als selbstverständliche […]. Die faktische Wirkung symbolischer Macht setzt also eine Form von objektiver ‚Komplizenschaft‘ mit der bestehenden Ordnung voraus, die genau dann gegeben ist, wenn die jeweilige Ordnung (des Feldes oder der Klassen) mittels homologer Strukturen (freilich in Form inkorporierter kognitiver Strukturen) wahrgenommen wird”. 44 So erzeugt z.B. das Bildungssystem die faktische Anerkennung seiner Selektions- und Legitimationsfunktionen weniger durch mechanische Selektionen oder durch gezielt erzeugte Ideologien, sondern durch ein klassenspezifisch differenziertes Homologie- bzw. Redundanzverhältnis zwischen den Praktiken der Schule und den in Familien erworbenen Kenntnissen und Dispositionen, die aufgrund formaler Neutralität und Gleichheit der Leistungskriterien, auch von denen die – scheinbar selbstverschuldet – scheitern als gerecht und legitim empfunden werden (vgl. Bourdieu 1970: 104). Die Wirkung dessen, was Bourdieu symbolische Macht nennt vollzieht sich hier in Form staatlicher Definitionsmacht als offizielle bzw. juristische Benennung, Nomination oder Ausgrenzung. Durch Bürokratisierung, staatlichen Schutz, Kodifizierung und Delegierung, wird aus dem diffusen, ‚lediglich‘ auf Anerkennung basierenden symbolischen Kapital, juristisches bzw. legales Kapital, eine objektivierte, institutionalisierte Form dieses Kapitals (vgl. Bourdieu 1998) – oder wie es Habermas (1981) nennt das ‚Medium’ ‚Macht’ im staatlich-systemischen Bereich. Um dieses legale Kapital durchzusetzen, und eine entsprechend geordnete soziale Welt zu erzeugen, braucht der Staat jedoch „nicht unbedingt Anordnungen zu geben und physischen Zwang auszuüben, […] nämlich so lange nicht, wie er in der Lage ist, inkorporierte kognitive Strukturen zu erzeugen, die auf die objektiven Strukturen abgestimmt sind, und auf diese Weise für […] die doxische Unterwerfung unter die bestehende Ordnung [zu sorgen …] (Bourdieu 1998: 120). Denn die „sozial bedingten Klassifikationsschemata, nach denen wir die Gesellschaft aktiv konstruieren, stellen die Strukturen, aus denen sie hervorgegangen sind, tendenziell als natürliche und notwendige Gegebenheiten dar statt als historisch kontingente Produkte der bestehenden Machtverhältnisse zwischen den sozialen Gruppen” (Bourdieu/Wacquant 1996: 33). Dabei können offizielle Benennungen und Regeln - da sie „von einem Mandatsträger des Staates, Inhaber des Monopols über die legitime symbolische Gewalt, vollzogen [werden] - auf die ganze Stärke des Kollektivs, des Konsens, des common sense aufbauen” (Bourdieu 1985: 23f). Common Sense bei Bourdieu ist in dieser Hinsicht verwandt mit Gramscis Konzept der ‚hegemonialen Herrschaft‘ als „implizierte Form der Organisation von Zustimmung und Legitimation als Verinnerlichung von Macht ohne Rückgriff auf Gewalt und Zwang” (Groenemeyer 1999: 59). Die Herrschaftsfunktion besteht in Gramscis Hegemoniekonzept kaum anders als in Bourdieus ‚Common Sense’ darin, dass ihn möglichst alle Akteure – auch und besonders die subalternen - in ihren alltagspraktischen Handlungen legitim akzeptieren und in Form eines ‚aktiven Konsenses’ selbst aktiv tragen (vgl. Demirovic 1992), „womit die führende Klasse ihre Herrschaft nicht nur Rechtfertigt und aufrecht erhält, sondern es ihr auch gelingt, den aktiven Konsens der Regierten zu erlangen (Gramsci 1991 ff: 1725 f). Common Sense bei Bourdieu basiert auf einer Harmonisierung in Konkurrenz stehender Deutungsmuster zur Klassifikation der sozialen Welt, durch die sie „sozialen Funktionen unterworfen und mehr oder weniger offen auf die Erfüllung spezifischer Gruppeninteressen hin ausgerichtet” (Bourdieu 1982: 744) werden und damit faktisch keine ‚neutralen‘ Medien der Erkenntnis sondern Mittel der Macht darstellen, die Herrschaftsverhältnisse durch die Erzeugung 40 Mit Blick auf die sozialen Akteure und sozialen Klassen haben diese symbolischen Kämpfe haben eher den Charakter von ‚Konkurrenzkämpfen’ zwischen Einzelnen und (Status-)Gruppen als von ‚Klassenkämpfen’ im weitesten marxistischen Sinne, d.h. von sozialen Auseinandersetzungen, die Resultat der politischen Mobilisierung einer Klasse und die gezielt auf die Veränderung der sozialen (Herrschafts-)Ordnung gerichtet sind. Nichtsdestoweniger spricht Bourdieu auch hinsichtlich der Konkurrenzkämpfe, die eine „Art Wettlauf zwischen den Klassen [beschreiben], der die Anerkennung ein und derselben Ziele beinhaltet” von einer latenten bzw. „sanftere[n], fortwährende[n] Form des Klassenkampfes” (Bourdieu 1975: 182). Während ‚Klassenkämpfe’ als gesellschaftliche Kämpfe zwischen politisch mobilisierten sozialstrukturell ähnlich positionierten Gruppen um die Perpetuierung oder den Umsturz einer sozialen Ordnung beschrieben werden können, zeichnen sich Konkurrenzkämpfe eher durch die prinzipielle Anerkennung der in den sozialen Arenen wirksamen ‚Einsätze’ und ‚Spielregeln’ durch die beteiligten Akteure aus: „Konkurrenzkämpfe wollen nämlich durchaus nicht nur die Klassenteilung abschaffen oder ihre Grundlage reformieren, sondern nur die eigene Lage verändern, was eine stillschweigende Anerkennung der Klassenordnung voraussetzt, sie sind auch dadurch, dass sie die Nächsten, Nachbarn, Gleiche spalten, die vollkommenste Antithese und wirksamste Verneinung des Kampfes gegen eine andere (herrschende) Klasse, in dem die Klasse erst zu einer solchen wird.” (Bourdieu 1987: 252) Während ‚Klassenkämpfe’ demnach darauf gerichtet sind soziale Strukturen aufzubrechen, zielen symbolische Konkurrenzkämpfe nicht auf Umwälzungen der sozialen Ordnung, sondern vor allem auf Verschiebungen der Verteilungsstruktur, während die Grundmuster der Ordnungen erhalten bleiben (vgl. Bourdieu 1987:) „Kurzum: nicht differente Soziallagen verewigt der Konkurrenzkampf, sondern die Differenz der Soziallagen45” (Bourdieu 1982: 272) Der Logik des Konkurrenzkampfes, als spezifischer, symbolisch verneinter Form des Klassenkampfes, „sitzen die Angehörigen der beherrschten Klasse dann auf, wenn sie die von den Herrschenden vorgegebenen Einsätze akzeptieren. Als integrativer und infolge des anfänglichen handicap als reproduktiver Kampf erweist sich dieser nicht zuletzt deshalb, weil die, die bei dieser Art Verfolgungsrennen an den Start gehen – als vorweg geschlagene, wie die unveränderten Abstände bezeugen -, implizit durch ihre Teilnahme am Rennen die Legitimität der Ziele der von ihnen Verfolgten anerkennen.” (Bourdieu 1987: 273) II. 2 DEVIANZTHEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN IM ANSCHLUSS AN BOURDIEU II. 2.1 ABWEICHUNG UND COMMON SENSE ‚richtiger‘ Formen der Perspektiven und Erkenntnisse sichern. Dies gilt insbesondere für wissenschaftliche und juristische Macht deren „spezifische Effizienz freilich grade auf dem Schein ihrer Neutralität beruht: Gemäß der Logik und in der Sprache relativ autonomer Felder erzeugt, verbinden sie reale Abhängigkeiten von den Klassifikationsschemata des dominanten Habitus und vermittels dieser von den Sozialstrukturen aus denen sie hervorgehen mit dem Schein von Unabhängigkeit, kraft dessen sie zu Legitimation eines bestimmten Kampfes zwischen Klassifikationssystemen und des Klassenkampfes beitragen” (Bourdieu 1982: 744). 45 Zwischen der Behauptung einer Permanenz der Kämpfe und der Reproduktion der sozialen Ordnung durch strukturierte Praxis besteht also kein Widerspruch, solange es in den Kämpfen um die relative Erhöhung des Tauschwerts der jeweils am Spieltisch eingebrachten Jetons geht und nicht darum, die Regeln zu ändern, geschweige denn den Spieltisch umzuwerfen. Hierbei sind es in erster Line, Vertreter der oberen Klassenmilieus, die „- indem sie die Einsätze, über die sie verfügen (Geld, Macht, Wissen, Einfluss, Prestige), auch den anderen Klassen als erstrebenswerte Ziele aufnötigen können – ihre herrschenden Positionen auf eine implizite, d.h. unauffällige (und zudem auch ihnen selbst oft unbewusste) Art und Weise zu legitimieren und zu perpetuieren vermögen” (Schwingel 1993: 143). 41 Bourdieu selbst hat sich nur selten zu Fragen der ‚Devianz‘ bzw. der Mechanismen der Normsetzung und Normanwendung herrschaftstheoretische (dazu: Bourdieu Synthetisierung von 1986a) Mikro- geäußert46. und Dabei Makroebene bietet ein gerade die Analyse- und Interpretationsraster zur Klärung der Regelmäßigkeiten der Konstitution von Abweichung sowie deren Kontrolle an. Auf der Basis der Begriffs-Trinität Kapital-Habitus-Praxis kann eine sozialtheoretische Fundierung des Grundgedankens der radikalen Kriminologie vorgenommen werden, dass eine Analyse vertikaler und horizontaler Strukturierungen einer Gesellschaftsformation für ein Verständnis und eine interpretative Klärung gesellschaftlich vorherrschender Kontrollformen unabdingbar sei (vgl. Albrecht 1999: 122). Kennzeichnend für Bourdieus Ansatz ist der Versuch, die Verkürzung auf die Unmittelbarkeit der Handlungen im Subjektivismus ebenso wie eine Verselbstständigung und Hypostasierung der Verhältnisse durch einen sozialphysikalischen Objektivismus zu Gunsten einer Analyse der dialektischen Beziehungen zwischen objektiven Strukturen und strukturierenden Dispositionen aufzulösen. Eine solche theoretische Interpretationsfolie ermöglicht es, die ‚gesellschaftliche Produktion‘ und ‚Distribution‘ des negativen symbolischen Gutes ‚Abweichung‘ bzw. ‚Kriminalität‘, auf der Grundlage ihrer ‚Produktionsverhältnisse‘ zu analysieren. Sofern sich die Analyse von Non-Konformität dabei auf ,Kriminalität’ bezieht, fokussiert sie im Kern ein legalistisches durch strafrechtliche Reaktionen fassbares Konzept. Spricht man von Kriminalität, so spricht man immer zugleich von einer - in der Regel staatlich verfassten - rechtlich regulierten sozialen Ordnung. In diesem Sinne stellt Kriminalität – auch dann, wenn es bestimmte Handlungen gibt, die nahezu in jeder konkret historischen Gesellschaftsformation nicht akzeptiert und bestraft werden47 – keine handlungsimmanente, überhistorische ‚Naturtatsache’ dar. Kriminalität, so eine treffende Definition von Larry Siegel (1995: 20) „is a violation of societal rules as interpreted and expressed by a legal code created by people holding social and political power”. Kriminalität ist also kein selbst-verständliches, einheitliches Konzept zur Beschreibung eines phänomenologischen Vorgangs, sondern eine Relation zwischen einer Handlung und dem je gegebenen Strafgesetz. Das Strafgesetz selbst stellt - wie es auch das Gesetzlichkeitsprinzip ‚nullum crimen sine lege’ nahe legt - in so fern das entscheidende Kriterium zur Unterscheidung von kriminellen und nicht kriminellen Handlungen dar (vgl. Sack 1988). Das Strafrecht reduziert sich dabei nicht darauf, empirische ‚Wirklichkeiten’ zu reflektieren, sondern schafft diese auch selbst, während es seinerseits, wie Blaise Pascal (1970: 60) über das Gesetz ausführt, „ganz in sich selbst beschlossen [ist]. Es ist das Gesetz und nichts weiter“. Das bedeutet aber nicht, dass das Strafrecht keine gesellschaftliche Relevanz, bzw. keine Funktionen hätte48. Je nach gesellschaftlicher Formation, in der es etabliert (worden) ist und je nach Art der Ähnliches auch gilt für eine systematische Analyse der Wohlfahrt (vgl. Peillon 1998). Das Töten von Mitgliedern der gleichen gesellschaftlichen Gruppe, jenseits bestimmter lizenzierter Vorgehensweisen in bestimmten Ausnahmesituationen ist ein Beispiel dafür. 48 Die Beschreibung der ‚Funktionen’ des Strafrechts bedeuten nicht zwangsläufig, dass diese auch ‚funktionieren’ (vgl. Scheerer/Hulsman 1983) 46 47 42 Handlungspraxis, die es fokussiert49, ist das Strafrecht in unterschiedlichem – z.T. widersprüchlichem Maße als ein normatives bzw. symbolisches Mittel der Reaktionen auf ein definiertes Unrecht, eine Schädigung bzw. eine Schuld (,Retribution’) und/oder als ein instrumentelles, technologisches Mittel zur gesellschaftlichen Regulation konzipiert (vgl. Lacey 2002). Das Konzept der Kriminalität beinhaltet dabei mindestens drei zentrale Elemente: Die – ,schädliche’ bzw. gesellschaftlich als relevant betrachteten Interessen zuwiderlaufende – Handlung, ein in Recht50 ,geronnener’ gesellschaftlicher ‚Common Sense’51 und eine ,offizielle’ gesellschaftliche Reaktion gegenüber dieser Handlung, auf Basis dieses Konsens (vgl. Henry 2001). Das heißt, Kriminalität bezeichnet eine Handlungsweise, die strafrechtlich sanktioniert wird bzw. nach geltendem Recht sanktioniert werden kann. Das legalistische ‚Konzept der Kriminalität’ konstituiert sich also idealerweise52 aus der ‚offiziellen’, justiziellen Anwendung einer präskriptiven Verhaltensnorm auf bestimmbare praktische Akte und zwar dann, wenn es gelingt festzustellen, dass durch diesen Akt ein vorab definiertes Rechtsgut (die Rechte eines konkreten oder abstrakten Opfers) absichtsvoll verletzt wurde. Der Tatsache, dass das Konzept der Kriminalität sich erst vor dem Hintergrund eines sich historisch wandelnden und im Einzelnen kontinuierlich umstrittenen53 Rechts konstituiert, steht auf Seiten der handelnden Akteure - auch dann, wenn es sich bei dem nur seiner unbegrenzten freien Entscheidung und seinem freien Willen unterworfenen ‚Kriminellen’ und eine ‚legal Fiktion’ handelt (vgl. Hutton 1999) - nicht entgegen, dass auch der als Täter identifizierbare Akteur typischerweise um die - in diesem Sinne ‚zugeschriebene’ - ,Qualität’ seiner Handlung weiß. Der ‚Kriminelle’ ist in aller Regel weder in dem Maße von der prävalenten gesellschaftlichen Ordnung und Praxis abgekoppelt, noch in dem Maße kognitiv und affektiv retardiert, dass ihm diese nicht zugänglich wäre54. In aller Regel begehen Akteure kriminalisierbare Handlungen demnach zwar nicht unbedingt ‚rational kalkulierend’, aber zumindest in so fern ‚intentional’, dass davon auszugehen ist, dass sie wissen, dass ihr Handeln diese spezifische ,Qualität’ besitzt und aufgrund dieser Qualität (möglicherweise) mit negativen Sanktionen verbunden ist (vgl. Braithwaite 1989, Brumlik 1998, Lea/Young 1984, dazu allgemein: Nunner-Winkler 1996). Zur Erweiterung der Funktion und Reichweite dessen was in den letzten 2000 Jahren in verschiedenen Epochen und Territorien als ‚Strafrecht’ betrachtet werden konnte sie die Ausführungen von Nicola Lacey (2002). 50 Fuchs et al. (1994: 544) definieren ‚Recht’ als „Verhaltensregeln, die explizit formuliert, von einer (meist staatlichen) Instanz gesetzt und von (meist staatlichen) Sanktionsinstanzen mit (insbesondere physischen) Zwangsmitteln garantiert werden“. Diese Definition lässt sich deutlich abgrenzen von der ‚Moral’ als „ ideale Fundierung eines Systems von Werten und Normen“ (Fuchs et al. 1994: 450) und von den ‚Sitten’, die wie es Max Weber (1980: 236) unübertroffen formuliert hat, ‚eingesessene’ Verhaltenregelmäßigkeiten bezeichnen: „[U]rsprünglichen Motive der Entstehung von Verschiedenheiten der Lebensgewohnheiten werden vergessen und die Kontraste bestehen als ‚Konventionen’ weiter“. 51 Der Verweis auf diesen Common Sense schließt, wie in den Ausführungen zur symbolischen Macht bei Bourdieu ausführlich behandelt worden ist, keinesfalls eine herrschafts- und konflikttheoretische Betrachtung aus. Er hat nichts mit einem herrschaftstheoretisch naiven, ‚harmonistischen’ Bild einer Gesellschaft nach den Prämissen eines Konsensmodells zu tun. Es finden zwar permanent gesellschaftliche Kämpfe um Wirklichkeit und Wahrheit statt (Bourdieu, Foucault), diese erzielen ‚Ergebnisse’, die zwar umstritten bleiben, nichtsdestoweniger ‚Gültigkeit’ besitzen. Anders formuliert: Kämpfe um ‚Hegemonie’ schließen ‚Hegemonie’ nicht aus. 52 Neuere Entwicklungen in Richtung eines so genannten ,Risikostrafrecht’ (vgl. Frehsee 1997, Prittwitz 1997) weichen allerdings deutlich von diesem ‚Ideal’ deutlich ab. 53 Das Parlament ist in westlichen Demokratien die Legislative, d.h. die rechtssetzende Gewalt. Ganz offensichtlich ist dies eine Arena des politischen Streits. 49 43 Tatsächlich ist zumindest umstritten, ob eine Handlung überhaupt als ‚kriminell’ bezeichnet werden kann, wenn dieses Wissen fehlt, stellt es doch die Basis für die Unterstellung von Schuld und Verantwortung dar (vgl. Lacey 2002). Über dieses bloße Wissen hinaus kann davon ausgegangen werden, dass die Akteure in aller Regel auch die Beurteilung der Unrechtsqualität ihres Normbruchs zumindest im Prinzip - teilen (vgl. Matza 1969, Agnew 1994, Young 1999). Zwar gibt es – je nach Delikt in unterschiedlichem Maße55 - Täter, die diese Einschätzung der ,Qualität’ ihrer Handlung normativ nicht teilen (vgl. Katz 1989), diese nehmen aber, bei den meisten Delikten durchaus korrespondierend zu der ,offiziellen’ Schwere der Tat ab56. Allerdings sind die ,Schwere moralischer Schuld’ und die ‚Schwere der Kriminalität’ in dem Sinne unterschiedliche Dinge, dass ihr tendenzieller Zusammenhang ein einseitiger ist. Er besteht nur aus einer Perspektive, deren Basis ein Rechtsbruch darstellt. Von der ,moralischen Schuld’ aus betrachtet, können sie völlig unabhängig voneinander sein. Anders formuliert: eine Handlung mag so ‚unmoralisch’ sein wie sie möchte, solange sie gegen kein Gesetz verstößt ist sie nicht ‚kriminell’57. Über diesen engen Sinn von Kriminalität hinaus hat die Soziologie abweichenden Verhaltens (v.a. der etikettierungstheoretische Ansatz) aufgezeigt, dass auch das in einem allgemeineren Sinne sozial problematisierte Handeln sozialer Akteure nicht in einer a-historischen und de-konextuierbaren Dinglichkeit verhandelt werden kann, sondern seine Qualität vor allem als Ergebnis einer kontextbezogenen, historisch kontingenten, gesellschaftlichen Konstitution und Zuschreibungen auf der Basis dieser Konstitution erfährt: ‚Soziale Probleme‘ lassen sich vornehmlich auf der Basis kollektiv durchgesetzter Definitionen bestimmen58 (vgl. Groenemeyer 2001: 1702 f). Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt des Interesses, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen welche Handlungsweisen welcher Gruppen von Akteuren als ‚problematisch‘, abweichend bzw. ‚kriminell‘ identifiziert werden. Bezogen auf die Frage der Kriminalität lässt sich in Anlehnung an Collin Sumners Ansatz der ‚social censures’ (vgl. Sumner 1990, 1994) argumentieren, dass die Regeln selbst, und nicht erst deren systematischer Bruch, ‚Kriminalität’ konstituieren, und dass sie dabei die konkret historischen, Dieses Moment ist wesentlich dafür, dass in nahezu jedem Kriminaljustizsystem Menschen unterhalb eines gewissen Alters von dem justiziellen Prozess der ‚Zuschreibung’ von Kriminalität ausgenommen sind. 55 In Bezug auf Delikte ist dies beispielsweise bei oder ‚Drogenkonsum’ häufiger der Fall als bei einem ‚Raubüberfall’ oder, in der Unterscheidung des Common Law, bei jenen Delikten, die als ‚mala prohibita’ betrachtet werden häufiger, als bei den ‚mala in se’. 56 Ein sehr bekanntes Beispiel einer Ausnahme ist - der von Herbert Marcuse (1971) treffend analysierte – Fall des Lieutenant William, L. Calley. Calley war der verantwortliche und „aktiv“ teilnehmende Offizier des Massakers von My Lai (Vietnam) in dem am 16. März 1968 über 500 unbewaffnete Einwohner eines vietnamesischen Dorfes ermordet wurden. Über Calley wird berichtet er hätte vor Gericht nichts abgestritten aber mit Unverständnis auf die Anklage (Mord) reagiert. In seiner drei Jahre später veröffentlichten Biographie (Calley/Sack 1971) bezieht er sich wie folgt auf ein Kleinkind, das er eigenhängig zu einer Grube gebracht und erschossen hat, wie folgt: „And babies. On babies, everyone’s really hung up. ‘But babies! The little innocent babies!’ Of course, we’ve been in Vietnam for ten years now. If we’re in Vietnam another ten, if your son is killed by those babies you’ll cry at me, ‘Why didn’t you kill those babies that day?’” 57 Man kann beispielsweise der Ansicht sein, dass die moralische Qualität ‚nicht-kriminellen’ Verhaltensweise wie etwa dem Freund oder die Freundin ,auszunutzen’ zu ,hintergehen’ etc. erheblich größer ist, als bei dem ,kriminellen’ Verhalten sich einen Schokoriegel jenseits des Cash-Ware Nexus anzueignen oder auf dem Fensterbrett Hanfpflanzen wachsen zu lassen. 58 Dies gilt freilich nicht nur für ‚soziale Probleme’ sondern für alle ‚sozialen Tatsachen’: „Soziale Tatsachen werden […] nicht aus rohen Tatsachen erzeugt, sondern aus institutionalisierten Zusammenhängen der gesellschaftlichen Praxis. Oder auf eine knappe Formel gebracht: Soziale Tatsachen entstehen aus sozialen Tatsachen“ (Gebauer 2000: 437). 54 44 gesellschaftlichen Verhältnissen reflektieren, in die soziale (Un)Werturteile in Form von ‚sozialen Zensuren’ eingebettet sind. Konkrete, performativ sichtbare Phänomene werden erst durch solche ‚sozialen Zensuren’ zu ‚sozialen Tatsachen’. Die soziale Zensur selbst wiederum ist ein historisches Produkt eines normativen Diskurses. Folgt man Bourdieu, ist der „Sinn von Diskursen durch die ‚Ökonomie der Praxis’ und die in den jeweiligen sozialen Räumen geltenden Klassifikations- und Wahrnehmungslogiken bestimmt” (Bublitz 1998: 88). In dieser Hinsicht korrespondieren ‚soziale Zensuren’ je mit dem Stand der gesellschaftlichen Produktion des Common Sense, als legitime Kategorien der Wahrnehmung der Welt. Diese symbolische Produktion ist als Klassifikationskampf zu verstehen: „Es finden permanente Auseinandersetzungen um die Erlangung und Aufrechterhaltung sozialer Positionen und damit auch um Vorstellungen, Klassifikationen und entsprechende Wahrheiten statt. Diese zeichnen sich als – als normal deklarierte – (Lebens-) Gewohnheiten und Anstandsregeln sozialer Milieus aus” (Bublitz 1998: 85). Die in diesen Kämpfen wirkenden ‚Klassifikationsformen‘ sind das Produkt der Inkorporierung der Strukturen jener Gruppen, denen die sozialen Akteure je angehören (vgl. Bourdieu 1998: 116). In modernen gesellschaftlich verfassten Gemeinschaften besitzt jedoch der Staat in wesentlichen Bereichen ein ,legitimes’ Monopol auf die Ausübung symbolischer Macht und Gewalt. Seine monopolisierte symbolische Macht kann er in dem Maße ausüben, wie es ihm gelingt, durch eine ‚juristische’ bzw. ‚legale’ Form des symbolischen Kapitals ,offizielle Identitäten’ zu entwerfen und diesen dadurch Gültigkeit zu verschaffen, dass er sie „dem symbolischen Kampf aller gegen alle [entzieht], indem er die von allen gebilligte Perspektive durchsetzt“. Dies geschieht dann, wenn durch eine „Legalisierung des symbolischen Kapitals eine bestimmte Perspektive absoluten universellen Wert [… gewinnt. Sie ist] damit jener Relativität entzogen, die per definitionem jedem Standpunkt als einer bestimmten Sicht von einem partikularen Punkt des Raums aus immanent ist” (Bourdieu 1992a: 150 f). Insofern Bourdieu (1998: 99, vgl. 1991: 485) ‚den Staat’ als „ein (noch zu bestimmendes) X“ skizziert, „das mit Erfolg das Monopol auf den legitimen Gebrauch der physischen und symbolischen Gewalt über ein bestimmtes Territorium und über die Gesamtheit der auf diesem Territorium lebenden Bevölkerung für sich beansprucht“ erweitert er den Rekurs auf die Monopolisierung der ‚physischen Gewalt’ - die von so unterschiedlichen Sozialtheoretikern wie Max Weber (1980), Norbert Elias (1978) und Charles Tilly (1975) - als ein wesentliches Moment der Entwicklung moderner Staatlichkeit beschrieben worden ist, um die Dimension der Monopolisierung der ‚symbolischen Gewalt’. Dabei liegt die Pointe der ‚Legalisierung symbolischen Kapitals darin, dass „aus einem diffusen, einzig auf der kollektiven Anerkennung beruhenden symbolischen Kapital […] ein objektivierte symbolisches Kapital [wird], das staatlich kodifiziert, delegiert, geschützt – bürokratisiert – ist“ (Bourdieu 1998a: 113) Bezogen auf diese, nicht neutrale aber ent-relativierte und den situativen Strategien je einzelner sozialer Akteure entzogene Macht des Staates, im Dienst eines ‚verallgemeinerten Interesses’ (vgl. Bourdieu 1994: 17) den Standpunkt über den Klassen einnehmen zu können - und damit in einem gewissen Sinne „die Konsekration zu erteilen, heilige soziale Trennungen und Hierarchien zu produzieren” (Bourdieu 1996: 209) „kann man annehmen, dass in differenzierten Gesellschaften der Staat in der Lage ist, im Rahmen seiner territorialen Zuständigkeit universell gleiche oder ähnliche Erkenntnis- und Bewertungsstrukturen durchzusetzen und für ihre 45 Verinnerlichung zu sorgen, und dass er aufgrund dessen die Grundlage eines ‚logischen Konformismus’ und eines ‚moralischen Konformismus’ ist […] einer stillschweigenden präreflexiven, unmittelbaren Übereinkunft über den Sinn der Welt, der der Ursprung für die Erfahrung der Welt als einer ‚Welt des common sense’ ist” (Bourdieu 1998: 116). Damit wird eine Perspektive auf den Staat vorgeschlagen, die deutliche Korrespondenzen zu jener, mit dem Namen Nicos Poulantzas (vgl. 1978, 2002) verbunden Variante der französischen, marxistischen Staatstheorie hat, die den Staat nicht als Institutionalisierung einer von der Gesellschaft getrennten, eigenständig handelndem Macht interpretiert, sondern als materielle Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse – d.h. von Machtverhältnissen zwischen gesellschaftlichen Gruppen – interpretiert: Wie Nilio Kauppi (2003: 7) zu den staatstheoretischen Elementen der politischen Soziologie Bourdieus ausführt, lässt sich der Staat als eine Art „grand social organizer [verstehen] that ,constantly exercises a formative action of durable dispositions’ of dauerhabitus to use Webers term. It imposes fundamental principles of classification on everybody - sex, age, competence, and so on. Its influence is everywhere. In the family, it controls the rites of institution; in the schooling system, it creates divisions between the chosen and the rejected, durable, often definitive symbolic divisions that are universally recognized and that often have determining effects on the future of individuals. The individuals submission to the state order is the result of the harmony between cognitive structures and the objective structures of the world to which they apply”. In diesem Sinne besteht der Kern staatlicher Herrschaftspraxis in der „stabilisierten Verfügung über die gesellschaftlichen Schemata der Wahrnehmung. Die Macht des Staates basiert auf der Herrschaft über die Wirklichkeit“ (Kreissl 1990: 13 f). Auf Seiten der Akteure wiederum manifestiert sich diese symbolische Herrschaftsform - wie alle Formen symbolischer Gewalt - auf Basis dessen, was Bourdieu als ‚illusio’ bezeichnet: der Anerkennung bzw. dem (prä-reflexiven) Sich-Einlassen auf und vor allem dem Glauben an das ‚Spiel’, durch den die Akteure von dem Spiel ‚erfasst’ werden und dieses Sinn und Daseinsberechtigung erhält (Bourdieu 1999b, 2001c, Bourdieu/Wacquant 1996). Die Illusio im Sinne des Vertrauens und des „Glaube[ns] an die Institution und an ihre Wirklichkeit, Bedeutung und ihren Wert ist ein starker Motor des gesellschaftlichen Handelns59“ (Gebauer 2000: 432) und bildet – sofern sie nicht über manifesten physischen Zwang operiert – den Mittelpunkt staatlicher Macht. Die Durchsetzung und Aufrechterhaltung des legalen Common Sense durch den Staat verweist aus dieser Perspektive eher auf „dramaturgische und symbolische Prozesse“ als auf jene „hartgekochten Kalkulationen von Interessen, die von rationalistischen, akteurszentrierten Ansätzen unterstellt werden“ (Meyer et al. 1997: 8). Die von Bourdieu vorgeschlagene Perspektive auf den Staat ist zwar im Kern plausibel, jedoch besteht eine Tendenz, die ‚aktive’ Rolle des Staates in Bezug auf die Genese der Monopolisierung und „Legalisierung des symbolischen Kapitals“ (Bourdieu 1992a: 150) - bzw. des ,legalen Kapitals’ - zu überschätzen. In diesem Sinne fällt Bourdieu in seinen orginär staatstheoretischen Überlegungen hinter seinen eigenen Ansatz zurück. Zunächst lässt sich nichts dagegen einwenden, ,legales Kapital’ als das zentrale Machtmittel ‚legaler Herrschaft’ im Sinne Max Webers (vgl. 1980) zu verstehen. Allerdings lässt sich – die Monopolhaftigkeit der Durchsetzung jener legalen Form des symbolischen Ein „unbefangene[r] Glauben an die Güte und Gerechtigkeit von Autoritäten“ (Adelson 1977: 282) spricht dabei allerdings nicht gerade für ein ‚reifes Urteil’. Entwicklungspsychologisch findet es sich vor allem bei Kindern und jungen Adoleszenten (vgl. Adeslson 1977). 59 46 Kapitals unbestritten – argumentieren, dass seine Etablierung als geteilter Common Sense durch den Staat als Monopolisten, nur eine unter mehreren Möglichkeiten darstellt. Das „Monopol des Allgemeinen“ so führt Bourdieu (1998a : 123) selbst gegen ‚Usurpationslehren’ aus, wird nur „um den Preis einer (zumindest scheinbaren) Unterwerfung [des Staates] unter das Allgemeine und einer allgemeineren Anerkennung der universalistischen Darstellung der Herrschaft [erworben], in der diese als legitim und nicht interessegeleitet präsentiert wird“. Demnach besteht eine zweite - und vermutlich dominante - Möglichkeit der Etablierung eines auf legalem Kapital basierenden, ‚objektivierten Common Sense’ darin, dass ein bereits gegebener, gesellschaftlich geteilter Common Sense (Traditionen, Gewohnheiten etc.) – gegebenenfalls in modifizierter Form - in Recht übertragen werden (vgl. Bourdieu 2001c). Dieser Common Sense wird durch staatliche Macht, bzw. das symbolische Kapital der offiziellen Anerkennung zusätzlich gestärkt (dazu auch Coleman 1991). In diesem Sinne rekonstruiert Levi Martin (2002: 894) in seiner Untersuchung über die Strukturierung von Konsensen den allgemeinen Zusammenhang zwischen Macht, Autorität und einer Festigung von Konsens darin, dass „the clarity or fixedness of power relations [...will] increase consensus”. Der Erfolg dieser Fixierung zeigt sich u.a. daran, dass wie Honneth (2001: Wertepluralismus 1326 […] f) ausführt, „in demokratischen ein gewisser Konsens über die Gesellschaften in der ist […] Rechtordnung bei allem enthaltenen Gerechtigkeitsprinzipen gegeben“ ist. Mit Bourdieu lässt sich nun - in Analogie zu Foucaults (1991) Konzept der ‚governementalité’60 - davon sprechen, dass die Wirkung der symbolischen Macht des Staates, bzw. des legalen Kapitals, darin begründet liegt, dass sie nicht nur außerhalb der seiner Herrschaftssphäre unterworfenen Akteure liegt, sondern auch ‚in’ ihnen: „Wenn der Staat in der Lage ist symbolische Gewalt auszuüben, dann deshalb, weil er sich zugleich in der Objektivität verkörpert […] und in der ‚Subjektivität’, oder wenn man will in den Köpfen, nämlich in Form von mentalen Strukturen, von Wahrnehmungs- und Denkschemata“ (Bourdieu 1998: 99). Eine dritte Möglichkeit besteht schließlich darin, dass nicht ‚der Staat’ ,von sich aus’ diese legalen Formen des Common Sense etabliert, sondern dass umgekehrt nicht-staatliche Akteure – Howard S. Becker spricht von ‚moral entrepreneurs’ - diese legalen Formen gegenüber dem Staat erstreiten. Allgemeiner formuliert, lässt sich die bloße Existenz des modernen Staates auch aus den institutionellen Erwartungen und Interessen, die auf verschiedenen Ebenen und aus unterschiedlichsten Perspektiven an ihn gerichtet werden erklären, während der Staat selbst permanent bemüht ist Anerkennung zu finden und seine Verpflichtung auf den für diese Anerkennung notwendigen Wertekanon zu demonstrieren (vgl. McNeely 1995, Meyer et al. 1997). Alle drei Varianten, nämlich dass - der legale Common Sense aktiv ,vom Staat’ (,top-down’) etabliert wird, dass - der Common Sense vorhanden ist und (‚horizontal’) vom Staat ‚legalisiert’ wird und dass 60 Dies wird insbesondere deutlich in der englischen Fassung von ‚Praktische Vernunft’ wenn Bourdieu (1998c: 52) hinsichtlich der Wirkweise staatlicher Machtausübung etwa von „Minds of State’ spricht. 47 - die Etablierung eines ‚legalen’ Common Sense (‚bottom up’) gegenüber dem Staat erstritten wird (vgl. Becker 1981, Scheerer 1986), können nebeneinander existieren. Wenn ein legaler Common Sense jedoch erst etabliert ist, besitzt der Staat durch diese ,Legalisierung’ aber das Monopol auf Ausübung dieser Form der symbolischen Gewalt. Dies bedeutet aber, dass sich die alleinige Monopolstellung des Staates zwar idealtypisch auf beiden, faktisch aber eher auf einer bewahrenden, synchronen Zustandsebene, als auf einer diachronen Entwicklungsebene findet. Während es zwar möglich ist, dass der Staat neue Normen als verbindlichen Imperativ – langfristig durchsetzt, ist es zumindest dann schwierig - und der ‚Erfolg’ einer solchen Durchsetzung zweifelhaft wenn er diesen ‚neuen’ ‚legalen Common Sense’ gegen einen ‚alten’ Common Sense etablieren möchte. Eine ‚top-down’ Etablierung eines ‚legalen’ Common Sense verspricht vor allem dann wenig Erfolg, wenn dies auf Seiten der gesellschaftlichen Akteure eine „Umstellung des Lebensstils und Verzichtsleistungen erfordert“ (Karstedt 1999: 95) - insbesondere wenn diese nicht akzeptiert wird. Eine solche Form der Etablierung eines ‚legalen’ Common Sense ist umso einfacher, je kleiner, je ‚einfluss-’ bzw. ‚machtloser’ und je weiter die Gruppe, auf die jene legale Form symbolischer Macht Seitens des Staates zielt, in ihrem Habitus und Lebensstil von einem gegebenen gesellschaftlichen Common Sense entfernt ist. Während beispielsweise eine allgemeine (ordnungs- oder strafrechtliche) Alkoholprohibition oder ein Verbot anderer beliebter Gewohnheiten – dem Kaffeetrinken etwa schwierig ist (vgl. Karstedt 1999, Groenemeyer 1999b), ist eine allgemeine Prohibition des ‚Drogen’Konsums (vgl. Reuband 1999) oder ein punktuelles Verbot von Alkoholkonsum – beispielsweise im öffentlichen Raum der Innenstädte, in dem es vor allem auf ‚Randgruppen’ zielt (vgl. Simon 2000), – offensichtlich einfacher zu gestalten. Dem widerspricht nicht, dass die Erzeugung von Übereinkunft im Sinne einer Durchsetzung eines ‚offiziellen’ Common Sense im Ergebnis als eine Form ‚politischer Disziplinierung’ – d.h. eine „einstellungs- und verhaltensmäßige Subordination unter jene politischen Maxime […], die in der betreffenden Gruppe oder Gesellschaft als maßgebend angesehen wird” (Mathiesen 1985: 32) verstanden werden kann, die darauf zielt, die (individuellen) Habitus der Akteure mit dem Common Sense in Einklang zu bringen. Der Common Sense entfaltet seine Wirkung dadurch, dass er nicht (primär) auf äußerem Zwang basiert, sondern von den Akteuren akzeptiert, im Habitus inkorporiert und qua Praxis reproduziert wird, d.h. es geht um einen (normativen) Konsens der unabhängig von der gesellschaftlichen Positionierung von (möglichst) allen Akteuren und Klassen geteilt wird (vgl. Hess 1986: 25). Die entscheidende Macht-Dimension liegt daher in der symbolische Macht der Durchsetzung von ‚angemessenen’ Prinzipien der Konstruktion gesellschaftlicher Realität (vgl. Bourdieu 1976: 327). Dabei wirkt der Staat im gewissen Sinne als „geometrische[r] Ort aller Perspektiven” (Bourdieu 1992a: 151). Das politische System, schreibt Zolo, „performs a function of symbolic protection far beyond its specific role as an apparatus of the selective regulation of social risk […]. It is most of all on the symbolic level that the institutions of authority, with all their show, ritual, prescriptions and even codes of manners and etiquette, satisfy a latent need for social protection and spread a gratifying sensation of order and security” (Zolo 1990: 43). 48 Dem steht nicht entgegen, dass es vor allem auch jenseits des Staates – der, wie es Poulantzas (1978: 119) formuliert, auch selbst nicht als ‚Subjekt’ oder als ‚Sache’ verstanden werden kann, sondern nur „als ein Verhältnis, genauer als die materielle Verdichtung des Klassenverhältnisses zwischen Klassen und Klassenfraktionen“ - auf der Ebene der zivilen Gesellschaft immer symbolische Kämpfe gesellschaftlicher Machtgruppen darum gibt, ihre Sicht gesellschaftlicher Trennungen des Wahren und Falschen, Guten und Bösen etc. verbindlich durchzusetzen. Die zentrale Pointe einer solchen ‚hegemonietheoretischen’ Fassung61 gegenüber (radikal)konstruktivistischen Annahmen (vgl. Schetsche 1996) ist es, dass die Produktion des Common Sense nicht alleine Ergebnis einer subjektiven Sinngebung und eines reflexiv bewussten Interesses ist, und daher auch nicht alleine durch die Analyse der Interaktionsdynamik im konkreten Fall zu dechiffrieren ist, sondern gleichsam mit den spezifischen Strukturen und Praktiken der relativ autonomen Felder im sozialen Raum korrespondiert, aus denen ihre Bedeutung entspringt. Es gibt eine dialektische Verknüpfung zwischen gesellschaftlicher Regulation - inklusive einer Common Sense Produktion62 -, intra- wie interfeldspezischer Stellung und Anordnung sowie deren Inkorporierungen bzw. mentalen Repräsentationen. Die Wirkung der symbolischen Legitimitätshierarchie wird dabei nicht zuletzt auf Basis der Zuschreibung von ‚Legitimität‘ durch legitimierte Institutionen (zumindest) verstärkt - und zum Teil auch erst hervorgebracht63 -, die ihre symbolische Gewalt weniger durch Zwang und Unterdrückung, sondern eher dadurch entfaltet, dass sie über die Wahrnehmung der in den Blick genommenen Praktiken und Objekte entscheidet. Diese symbolische Klassifikation der ‚äußeren’ Wirklichkeit verlängert sich als symbolische Repräsentation dadurch zu einer ‚inneren’ Wirklichkeit, dass sich im Zuge einer klassenspezifischen Genese des Habitus kollektiver ‚Subjekte’, in der Praxis generierte und generative Dispositionsstrukturen entwickeln, die der Tendenz nach zur eigenen Praxisform redundante Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsstrukturen hervorbringen. Diese Betrachtungsweise kann nun dazu beitragen, die Frage der gesellschaftlichen Distribution des ‚negativen Guts’ ‚Kriminalität’ aufzuhellen. Jenseits der Tatsache, dass spezifische (straf-)rechtliche Normen spezifische Zielgruppen fokussieren (z.B. das JGG oder das Ausländerrecht), sind Gesetze im Rahmen der territorialen Zuständigkeit des Staates zunächst für alle Mitglieder einer Gesellschaft verbindlich, unabhängig davon welchen Klassenmilieus sie angehören und welche Habitusformen sie ausbilden. An die relational im sozialen Raum positionierten (Klassen-)’Subjekte’ wendet sich das Recht dabei individualisierend, als eine einzelne Person unter formal Gleichen (vgl. Hall et al. 1978: 208). Gleichzeitig sind Gesetze aber auch als politisch kodifizierte Normen - und mithin Ausdruck geronnener Macht (vgl. Sack 1979) und Unter ‚Hegemonie’ wird hier im wesentlichen ein Effekt ‚materieller’ und ,symbolischer’ Kräfteverhältnisse verstanden, der eine nur eine bestimmte Varianz der Artikulation von Altnernativen zulässt, bzw. Alternativen entsprechend dieser Kräftekonstellation modifizierend und u.U. instrumentalisierend ‚einverleibt’. 62 Michel Foucault (2000) hat insbesondere in seinem Aufsatz über die Gouvernementalität darauf hingewiesen, dass Regierung, in dem weiten Sinn einer Lenkung, Anleitung und Führung von ‚Subjekten’ und ‚Dingen’, vor allem über die Erzeugung einer Haltung oder ‚Mentalität’ – in Anlehnung an Bourdieu könnte man auch von Habitus sprechen – bedarf. 63 Diese Hervorbringung zeigt sich historisch beispielsweise in der Demokratisierung der Bundesrepublik durch die westlichen Alliierten . 61 49 Instrumente zur Regelung gesellschaftlicher Handlungsstrukturen (vgl. Frehsee et al 1993: 9) sowohl Produkt von Auseinandersetzungen, als auch Ausdruck einer grundsätzlich interessegebundenen, aber symbolisch als legitim und allgemein durchgesetzten Sicht der Welt. Dieses ‚Interesse’ kann dabei durchaus ein weit geteiltes Interesse sein. Bestimmte Formen des Geschlechtsverkehrs gegen die Zustimmung der anderen Person (‚erzwungener Beischlaf’) 64 beispielsweise als Vergewaltigung zu definieren und unter Strafe zu stellen , hatte historisch nicht zuletzt den Interessen ,des Patriarchats’ gedient, zumal bis Ehepartner bis vor kurzem (Juli 1997) aus dieser Definition ausgenommen waren. Gleichzeitig dient die Tatsache, dass durch dieses Verbot zugleich auch die Würde, Unversehrtheit, sexuelle Selbstbestimmung etc. geschützt wird, ganz offensichtlich auch den Interessen von Frauen als der patriarchal ‚beherrschten Gruppe’. Ebenso offensichtlich dient auch das Verbot von ‚Diebstahl’ – bei der gleichzeitigen Legalität, den Äquivalententausch durch die Möglichkeit einer Mehrwertaneignung zu modifizieren – der ,Bourgeoisie’, ohne dass damit unterstellt werden kann, dass das ‚Proletariat’ ein Interesse daran hätte, ‚bestohlen’ zu werden. Recht legalisiert in diesem Sinne einen Common Sense und produziert ein kollektives symbolisches Gut (z.B. den Schutz von Eigentum) und ist gleichzeitig ein Machtmittel, das identifizierbaren Interessen dient. Der Prozess der Rechtssetzung verläuft interessenförmig. Während die Kapitale sozialer Akteure nur durch ihre symbolische Form Wert realisieren können, kann Recht - das Strafrecht im Besonderen65 - als eine von der direkten Beziehung zu ‚substanziellen’ Kapitalsorten abgekoppelte Form symbolischen Kapitals betrachtet werden. Als ein symbolisches Kapital besteht seine zentrale Funktion und Wirkung vor allem darin, Common Sense zu erzeugen und zu reflektieren. Recht stellt dabei eine besondere, institutionell ‚geronnene’ Form symbolischen Kapitals dar. Als ‚juristisches’ oder ‚legales Kapital’ wird symbolisches Kapital staatlich monopolisiert und über die sozialen Felder und über alle Akteure in diesen sozialen Feldern hinweg verallgemeinert. Auf der Basis von legalem Kapital wird damit nicht nur die ‚legitime physische Gewaltsamkeit’ (vgl. Weber 1980: 29), sondern auch bestimmte Teile der symbolischen Gewaltsamkeit aus den sozialen bzw. feldspezifischen ‚Kämpfen’ ausgenommen, vom Staat monopolisiert und zugleich für alle Felder und alle Akteure gleichermaßen verbindlich gemacht. II. 2.2 MORALISCHES KAPITAL UND DAS KONZEPT DER DEVIANZ Legales Kapital kann als eine ‚geronnene Form’ staatlich monopolisierter symbolischer Macht betrachtet werden, die zugleich auf der Ebene der einzelnen Akteure in Form zugeteilter Rechte verwirklicht wird. In modernen Gesellschaften stellt es ein ‚kollektives’ und - im Rahmen (national)staatlicher Zuständigkeit - ‚universalistisches’ Gut dar: „Exklusionen aus dem Rechtssystem sind in der modernen Gesellschaft nicht vorgesehen“ (Scherr 2001: 85). Dem steht jedoch nicht Zu der Schwierigkeit der justiziellen ‚Konstruktion’ von ‚Vergewaltigung’ vgl. Peters (2002). Die Ausführungen beziehen sich im Folgenden vornehmlich auf das Strafrecht und müssen für Rechtsformen, z.B. das Zivilrecht, nicht unbedingt im gleichen Maße Gültigkeit besitzen. 64 65 50 entgegen, dass dieses Gut partikularen Gruppen in unterschiedlicher Weise dient, und von einzelnen Gruppen und Akteuren individuell ‚verwertet’ wird, d.h. partikulare ‚Nutzung’ ermöglicht. Zunächst ist legales Kapital – z.B. im Gegensatz zu ökonomischem Kapital - kein Kapital, das einzelne Akteure im engeren Sinne ‚besitzen’ können. Natürlich kann man davon sprechen, dass eine Person X ‚Rechte hat’. Von diesen kann X zwar als einzelner individueller Akteur Gebrauch machen, d.h. X kann sie individuell ‚verwerten’, aber er ‚besitzt’ diese Rechte nicht alleine, sondern - idealtypisch66 - nur in dem Maße, wie sie auch für alle anderen Akteure in dem territorialen Geltungsbereich gelten, in dem X diese Rechte ‚hat’. In diesem Sinne ist legales Kapital ein gleich verteiltes Gut, von dem niemand ausgeschlossen werden kann. Zumal dieses Gut zumindest in demokratischen Gesellschaften üblicherweise selbst durch einen formal demokratischen Prozess legitimiert ist, können Urteile auf der Basis von legalem Kapital ‚im Namen des Volkes’ gesprochen werden. Durch legales Kapital wird ein praktischer Common Sense ‚offiziell’. Gleichzeitig werden binäre symbolische Klassifikationen und Bewertungen wie ‚gut’ versus ‚böse’, ‚schön’ versus ‚hässlich’, ‚heilig’ versus ‚sündig’ usw., die in einzelnen Feldern wesentliche symbolische Unterscheidungen darstellen können, durch die Binarität ‚legal’ versus ‚illegal’ substituiert. Die symbolische Macht der Gesetze als legales Kapital besteht darin, dass alle Handlungen, die nicht nach a priori definierten Kriterien als illegal subsummiert werden (können)67 - unabhängig davon wie ‚sündig’ und ‚böse’ sie im einzelnen sein mögen - ‚offiziell legitimiert’ sind. So sind z.B. die ‚sieben Todsünden’68, nämlich Trägheit, Stolz, Zorn, Völlerei, Neid, Wollust und Habgier in der Regel nicht bzw. nicht unmittelbar durch legales Kapital entlizenziert69, schon gar nicht in ihrer Form als ‚schlechter Charakterzug’. In Bezug auf die ,offizielle’ Entlizenzierung bestimmter Handlungen auf der Basis legalen Kapitals hat das ‚Konzept der Kriminalität’ einen - auch durch den Hinweis auf seinen sozial konstruierten Charakter (dazu: Best 2003) - nicht suspendierbaren ‚Realitätsgehalt’. ‚Kriminalität’ lässt sich – ungeachtet der sozialen Selektivität der Institutionen des Strafrechts bzw. der ‚formellen’ sozialen Kontrolle – als die ‚objektive Wirklichkeit’ einer Unterbietung der symbolischen ‚Demarkationslinien’ einer gegeben sozialen Ordnung beschreiben, die auf der Basis von legalen Kapital allgemeinverbindlich durchgesetzt sind. Auch als einzelner Akteur existiert der Kriminelle - ebenso wie der unterscheidbare Es gibt selbstverständlich status- und berufsbezogene ‚Sonderrechte’ sowie bestimmte Gruppen die in Bezug auf das Strafrecht (zunächst) ‚Immunität’ besitzen. 67 Illegalität bezeichnet einen Status der auf der Basis ‚angemessener Beweise’ und nicht nur auf der Basis eines Verdachts formal festzulegen ist. 68‚Wollust’ in bestimmten Formen der (sexuellen) ‚Unzucht’ und bestimmten Formen der ‚Habsucht’ z.B. in Form von ‚Wucher’ stellen eine gewisse Ausnahme, dar ohne das gesagt werden könne es sei im juristischen Sinne verboten ‚ Wollüstig’ oder ‚Habsüchtig’ zu sein. Insbesondere das Verbot der ‚Habsucht’ wäre in kapitalistischen Gesellschaftsformationen reichlich absurd. Man denke etwa an Milton Friedmans Diktum nach dem es „wenig Entwicklungstendenzen [gäbe], die so gründlich das Fundament unserer freien Gesellschaft untergraben können, wie die Annahme einer anderen sozialen Verantwortung durch Unternehmer, als die, für die Aktionäre ihrer Gesellschaften so viel Gewinn wie möglich zu erwirtschaften“ (Friedman 1971: 176) 69 Ähnliches gilt für die 10 Gebote. Nicht stehlen (5) und nicht morden (4) zu dürfen, ist im allgemeinen verhältnismäßig unstrittig. Aber das Strafrecht verhält sich in modernen Gesellschaften - zumindest in formal Hinsicht – verhältnismäßig neutral gegenüber den Haltungen der sozialen Akteure in Bezug auf Gott (1-3), es gesteht im Großen und Ganzen durchaus zu, die Unwahrheit zu sprechen (6), die EhepartnerIn einer/eines anderen zu begehren (7/10), den eigen Eltern abschätzig 66 51 Nichtkriminelle - als empirisches, nach bestimmten Regeln und Kategorien identifiziertes Individuum ebenso ‚real‘, wie die soziale Ordnung als ein Arrangement von Bezügen und Verhältnissen, die auf der Basis dieser Kategorien konstituiert und aufrecht erhalten wird (vgl. Hess/Scheerer 1997). ‚Kriminalität‘ ist dann aber nicht einfach eine ‚Fiktion‘70 (vgl. Hulsman 1996), sondern eine ‚epistemologische Objektivität‘ (vgl. Kreissl 2000). Als ein Sammelbegriff für die Praxisformen, die den symbolisch dominanten und gleichzeitig verallgemeinerten Interessen zuwiderlaufen, ist Kriminalität als Status einer individuellen Handlung nicht weniger ‚objektiv’, wie diese durch einen ‚offiziellen’ Common Sense geschützten Interessen selbst. Falls von sozialen Machtverhältnissen sinnvoll gesprochen werden kann und wenn es zutrifft, dass diese in Form von Rechtsverhältnissen reguliert werden, muss aus auf der Basis der vorgeschlagenen Perspektive – entgegen einem ‚vulgär-konstruktivistischen’ (vgl. Best 1995) wie zuschreibungstheoretischen Kontingenzmodells – davon ausgegangen werden, dass die so definierte ‚Kriminalität‘, zwar nicht als ‚natürliche Art‘ (vgl. Hacking 1999: 165 f), aber nach der ‚objektiven’ Durchsetzung von Interessen, als deren Gegenstück, „objektiv im Sinne einer institutionellen oder Kulturtatsache” (Hess/Scheerer 1997: 40) existiert. In diesem Sinne ist es gerade dann, wenn ‚legales Kapital’ als ‚geronnene’‚ symbolische Macht verhandelt wird möglich, in einem wissenschaftlich angemessenen Sinne, Aussagen über Kriminalität als ‚Tatsache’ zu treffen, so lange sie nicht als gegenüber zu stehen (8) und was man von seiner Mitwelt hält (9) bleibt in strafrechtlicher Hinsicht weitgehend ebenfalls eine Privatangelegenheit. 70 Im wesentlichen geht dies auf eine Bestimmung von Howard S. Becker zurück: „Deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an offender“. Damit ist im wesentlichen gesagt, dass die Handlungen die als ‚kriminell’ betrachtet werden, unterschiedlich und wandelbar sind (vgl. Durkheim 1976) (Dies gilt übrigens nicht nur für ‚Verhalten’ sondern beispielsweise auch für Armut, wobei man –zum Glück – bisher kaum auf die Idee gekommen ist, den ‚ontologischen’ Gehalt von Armut in einer Weise zu bestreiten, dass man sie zu einer ‚Fiktion’ erklärt und die Unterstützungsleistungen einstellt) . Weil der Vollzug ein und der selben Verhaltensabläufe nun zu einer bestimmten Zeit und unter bestimmten (gesellschaftlichen) Bedingungen ‚kriminell’ ist und zu einer anderen Zeit und unter anderen (gesellschaftlichen) Bedingungen eben nicht kriminell ist, ist das entscheidende Differenzkriterium nicht der Akt, sondern die Norm und deren Anwendung auf einen Akt. Aus einer soziologischen Perspektive ist dies nicht nur wenig aufregend, sondern in epistemologischer Hinsicht gewissermaßen eine ‚Banalisierung’ von Durkheim, Weber und Marx (vgl. etwa Marxens Ausführungen über den Holzdiebstahl). Problematisch ist diese Perspektive aber, wenn unter gegeben Bedingungen, in einer gegebenen Zeit nicht einem ‚Verhalten’, sondern einem ‚sozialen Handeln’, als einem Verhalten, das „der oder die Handelnden mit einem subjektiven Sinn verbinden [… und das] seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist“ (Weber 1980: 1), der ‚reale’ oder ‚ontologische’ Gehalt abgesprochen wird. Wird ‚Kriminalität’ als Verhalten verstanden – was es insbesondere in seiner juristischen Konzeption ja gerade nicht ist (und - sieht man etwa von Lombrosos Konzeption von Abweichung als ontogenetischem Atavismus ab - in anderen Konzeptionen üblicherweise auch nicht) – kann man diesen qualitativen Gehalt kaum bestreiten. Bestreitet man ihn für ‚Kriminalität’ als Handlung, hat man ‚Kriminalität’ u.U. ‚de-konstruiert’, dies aber um den Preis, dass man die Akteure als in ‚sozialer’ Hinsicht ‚paralysierte Deppen’ rekonstruiert. Die gilt insbesondere dann, wenn das Argument lautet, dass weil ‚Kriminalität’ es ‚in Wirklichkeit’ nicht gibt – wobei in diesem Argument die ‚wirkliche Wirklichkeit’ als Gegenstück ‚fiktionalen Wirklichkeit’ auf wundersame Weise wieder auftaucht – es auch keinen ‚Kriminellen’ gibt. Nimmt man diesen Zweifel am ‚ontologischen Realitätsgehalt’ des Rechtsbruchs ernst, kann konsequenterweise auch der Realitätsgehalt der Rechtsdurchsetzung, die, als dessen Kehrseite, ja wie auch immer auf den Rechtsbruch bezogen ist, bestritten werden. Allerdings sind Debatten über die reale Existenz von Polizisten, Staatsanwälte, Richter etc. eher dürftig. Überzeugender als die Rede von der fehlenden (‚ontologischen’) Qualität von Kriminalität, oder ihre Darstellung als Fikton oder Mythos, sind die Ausführungen von John Muncie (2000) zum ‚Kriminalitätsproblem’ die die Konstitutionselemente hervorheben, ohne den ‚Konstruktionscharakter’ zu qualifizieren: „Crime cannot be identified by simply focusing on known offenders. These are but one particular element of the ‚problem of crime’ and only capable of identification following a series of social constructions involving the power to formulate particular criminal laws, police targeting, court room discretion, media representations and so on. […Important is to focus on the processes and conditions of] how certain harmful acts/events come to be defined and recognised as ‚crime’ whilst others do not“. 52 unabhängige Größe jenseits der symbolischen Ordnung verhandelt wird, die sie konstituiert. ‚Kriminalität’ und die Durchsetzung einer juristisch regulierten sozialen Ordnung lassen sich insofern zwar je in ihren prozessualen Dynamiken bestimmen – d.h. es lässt sich beschreiben, was der als ‚Täter’ dechiffrierte soziale Akteur ‚macht’ und was ‚die Kontrollinstanzen machen’ - aber analytisch nicht sinnvoll voneinander trennen. In Bezug auf das Konzept der Kriminalität rückt damit weniger die Frage seines ‚Realitätsgehalts’ in das Zentrum der Analyse, sondern vielmehr die Frage, welche (inhaltlichen) Schemata und Prinzipien der Klassifikation in den monopolisierten Kanon legalen Kapitals aufgenommen werden - und was ‚offiziell’ eine Frage persönlicher Haltung, Präferenz oder Meinung bleibt - sowie die Frage, wo die vergleichsweise trennscharfen- symbolischen Demarkationslinen legalen Kapitals im einzelnen gezogen werden. Diese Aspekte sind sozial, politisch und kulturell umstritten, bzw., in Anlehnung an Gramsci (1955), eine Frage kultureller Hegemonie71. Trotz ihres verallgemeinerten Anspruchs können Prinzipien und Demarkationslinien des auf legalem Kapital basierenden ‚offiziellen Common Sense’ zu den empirisch je klassenspezifischen Wahrnehmungs- und Beurteilungskategorien der in den vertikalen und horizontalen Ebenen des sozialen Raums unterschiedlich positionierten sozialen Akteure in Verbindung gesetzt werden. Diese dispositionalen Schemata resultieren ihrerseits wesentlich aus der Inkorporierung der objektiven Strukturen und Kräfteverhältnissen des sozialen Raums „weil die Strukturprinzipien der Weltsicht in den objektiven Strukturen der sozialen Welt wurzeln und die Kräfteverhältnisse auch im Bewusstsein der Akteure […] in Form von Kategorien zur Wahrnehmung dieser Verhältnisse [stecken]” (Bourdieu 1985: 17 f, vgl. Vester et al. 2001). Solche Wahrnehmungskategorien sind in den Habitus eingeschrieben und daher zunächst ebenso differenziell wie die Positionen im sozialen Raum, deren Produkt sie sind. Mehr noch, sind sie auch auf der Symbolebene differenzierend: Es sind „unterschiedliche Klassifikationsschemata, unterschiedliche Klassifikationsprinzipien, Wahrnehmungsund Gliederungsprinzipien, Geschmacksrichtungen. Mit ihrer Hilfe werden Unterschiede zwischen gut und schlecht, gut und böse, distinguiert und vulgär etc. gemacht” (Bourdieu 1998a: 21). Auf Basis der Annahme einer unauflösbaren Dialektik von ‚Interiorität’ und ‚Exteriorität’ ‚sozialer Verhältnisse’ und deren Beurteilungen (vgl. Bourdieu 1976), lässt sich argumentieren, dass die sozialen Positionen und inkorporierten Dispositionen der klassifizierten wie der klassifizierenden Akteure, einen strukturellen Hintergrund für die praktische Durchsetzung sozialer Wahrnehmungskategorien und Gliederungsprinzipien bilden. Diese stellen insofern die ‚materielle’ Basis für die unterschiedlichen performativen Praktiken, Meinungen, Äußerungen etc. dar. Vor allem sind sie aber auch die Basis für Der Herrschafts-, ebenso wie der Hegemoniebegriff wird hier analytisch, nicht normativ verwendet. Das heißt es geht nicht um ein ‚falsches Bewusstsein’ erzeugt von ideologischen Staatsapparaten und schon gar nicht darum einem Verstoß gegen hegemoniale Standards als ,heroische Tat’, Widerstand gegen Unterdrückung und so weiter zu glorifizieren. Um bei dem Beispiel Vergewaltigung zu bleiben: Bestimmte Handlungen als Vergewaltigung zu bestimmen und damit zugleich unter Androhung von Sanktion zu untersagen, ist ein herrschaftsförmig als symbolisch hegemonial durchgesetzter Standard und die Durchführung genannter Handlungen durchbricht diese hegemonialen Standards, was den Akteur – ungeachtet der Frage der Gerechtigkeit und Legitimität der sozialen Ordnung die durch die hegemonialen Standards perpetuiert wird - aber kaum als Träger eines ‚richtigen Bewusstseins’ erscheinen lässt. 71 53 die symbolische Transformation von relationalen Abständen in attributive substanzielle Unterscheidungsmerkmale. Die Wirksamkeit des universalistischen, gleichverteilten Kollektivguts ‚legales Kapital’ liegt nun bezogen auf die gesellschaftlichen Machtverhältnisse gerade darin, „dass es unter dem Prinzip der Gleichheit, bewahren hilft, was in der kapitalistischen Gesellschaft bereits ungleich ist” (Bähr 2001: 99). Das Strafrecht setzt in diesem Sinne weniger etwas völlig Neues durch, sondern stellt eher etwas Vorhandenes dar. Es entfaltet seine Wirkung über die Intervention seiner Institutionen nicht zuletzt dadurch, dass es - als ‚positive Generalprävention’ - Zustimmung organisiert und die „Dynamik der Interessen in bestimmte Bahnen“ lenkt (Schluchter 1979). Anders formuliert: der Staat verteidigt nicht die Interessen einer – etwa der ‚herrschenden’ – Klasse, sondern vor allem den gegebenen oder prima faci gesellschaftlich durchgesetzten Common Sense; er schützt und sanktioniert die bestehenden Institutionen, gesellschaftlichen Beziehungen und Regeln (vgl. Offe 1972). Der wesentliche (Herrschafts-)Effekt legalen Kapitals besteht darin, dass ein generalisierter ‚klassenloser’ Konsens erzeugt wird, der einen für alle Mitglieder einer Gesellschaft gleichermaßen verbindlichen - und auch von ‚subdominanten’ Gruppen häufiger akzeptierten als abgelehnten (vgl. Young 1994, Brumlik 1999, Bourdieu 1987, 1998 Bourdieu/Wacquant 1996) - Standard für jedes Gesellschaftsmitglied darstellt. Eine zentrale Frage bleibt dabei jedoch die, nach dem realen sozialen ‚Abstand’ der Positionen und praktischen Dispositionen der Akteure von diesem Standard. Die formal ‚klassenlose Gleichheit’ des offiziellen Common Sense auf der Basis legalen Kapitals kann nur aufrecht erhalten werden, wenn von diesen realen Abständen abstrahiert wird (vgl. von Hirsch 1996). Gleichzeitig entspricht es aber der Logik des Strafrechts, unter diesem Prinzip der Gleichheit die realen Dispositionen eines isolierten Einzelnen zu reflektieren. Auf dieser Basis wird mit der formalen Etikettierung eines Handels als kriminell ein normatives Substrat dieser Handlung gerade dadurch geschaffen, dass es aus seinen sozialen Zusammenhängen herausgelöst ist. Auf der Basis einer Dechiffrierung einer konkreten individualisierbaren Handlung eines Einzelnen als Tat schreibt das Recht insofern durch „das Konzept ‚Kriminalität’ im Namen der Gleichheit, allgemeinem Interesse und geteilten Werten dem Klassensubjekt mit seiner ganzen Last der Perpetuierung der [...] sozialen Ordnung als individuelles Merkmal zu und bringt darüber hinaus die Zivilgesellschaft in ‚Passung’ mit den Erfordernissen […dieser] Ordnung” (Bähr 2001: 99). Wenn die formale Gleichheit und Allgemeinheit legaler symbolischer Regulation aber auf Ungleichheit und Diversität des zu Regulierenden trifft, lässt sich auf der Ebene der Normsetzung annehmen, dass jene Gruppen deren Klassen- und/oder Individualhabitus zu der symbolisch qua legalem Kapital als legitim und allgemein durchgesetzten Sicht der Welt in dem dichtesten Homologieverhältnis stehen, die mithin zugleich innerhalb des Rahmens der gültigen Gesetze, in der Relation von Habitus und positionaler Kompetenz (als legitime Befugnis) breitere konforme und zugleich – bezogen auf die feldspezifische Ökonomie der Praxis - ‚profitable’ Handlungsmöglichkeiten in dieser Konformität besitzen, praxislogisch mit eben diesen Normen und den Strategien ihrer Durchsetzung – zumindest als eine statistisch aggregierte Population - weniger leicht in Konflikt geraten. 54 Weil legales Kapital als ein kollektives Gut, das weder ungleich verteilt ist noch von einem Akteur ‚besessen’ wird, einen verallgemeinerten und allgemein verbindlichen Standard sichert, sichert es vor allem die praktischen Profite der genannten Gruppen weil ‚ihren’ Praktiken und damit verbunden ihren Kapitalen eher als den Praxisweisen und Kapitalen anderer Gruppen der ‚Mehrwert’ des symbolischen Kapitals offizieller Legitimität ‚hinzugefügt’ wird. Nicht weil diese Akteure per se besonders Rechtsgehorsam wären – was empirisch insgesamt recht zweifelhaft ist -, sondern weil ihre Spielzüge in der Ökonomie der Praxis in der relativ geringsten Opposition zum ‚offiziellen’ - d.h. durch legales Kapital gesicherten - Common Sense stehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den ‚Besitz’ des negativen symbolischen Individualgutes ‚Kriminalität’ gelangen, am vergleichsweise geringsten. Wird die Analyse der Verteilung dieses negativen Individualgutes in das vorgeschlagene hegemonietheoretische Modell symbolischer Gewalt eingebettet, kann Kriminalisierung, d.h. der Prozesse der Normanwendung, verstanden als Realisierungen sozialer Phänomene qua Benennung (‚symbolische Macht’), als ein Unterfall einer strukturellen ‚Disziplinierung’ betrachtet werden (vgl. Mathiesen 1985), die auf eine Aufrechterhaltung oder ‚Wiederherstellung’ der Gültigkeit des ‚offiziellen’ Common Sense zielt. Wenn dieser Common Sense aber eine symbolische Form ungleicher ‚materieller’ Verhältnisse und sozialer Relationen ist, verläuft auch dieser Prozess entsprechend selektiv. Diese Selektivität wirkt sich logischerweise zuungunsten jener Akteure aus, deren (symbolische) Form ihres eingebrachten Kapitals nicht als legitim anerkannt wird. Vor allem wirkt dieser Prozess aber zuungunsten der Akteure, deren Habitus in dem geringsten Homologieverhältnis zu der ‚legitimen Kultur’, bzw. zu dem Common Sense und den praxislogischen Bedingungen und Erfordernissen sowohl ‚ihres’ sozialen Feldes im einzelnen, als auch der ihnen zugedachten Position in der Sozialtopologie im allgemeinen stehen. Unterstellt man die Wirksamkeit der trinären Bezogenheit von Feld(position), Habitus und Praxis auch in diesem Fall, lässt sich argumentieren, dass es in der Regel diese Gruppen und Akteure sind, die die Träger jener Dispositionen darstellen, die einer Reproduktion und Aktualisierung der feldspezifischen Strukturen - und damit zugleich den ‚objektiven Interessen’ der Trägern und Repräsentanten der legitimen Kultur dieser Felder - am wenigsten zuwiderlaufen. Anders formuliert: Da das Recht qua legalem Kapital den Common Sense schützt, dient es im Namen der Gleichheit vor allen jenen Akteuren, Gruppen und Klassen, die praxisökonomisch am meisten von diesem Common Sense profitieren. In einem gewissen Sinne gelingt es demnach spezifische Interessen in rechtlich geschützte, universalistische ‚Kollektivgüter’ zu transformieren und von einem öffentlichen Organ durchsetzen zu lassen, dessen symbolische Macht gerade darin besteht, sich als neutral und über partikularen Interessen stehend darstellen zu können: Wie es Anatole France unübertroffen formuliert hatte, verbietet es die Erhabenheit des Gesetzes dem Millionär wie dem Obdachlosen unter Brücken zu schlafen, auf der Strassen zu betteln und Brot zu stehlen. Die offenkundige ‚Ungerechtigkeit’ ist jedoch keine Ungerechtigkeit bzw. Ungleichheit des (Straf)Rechts, sondern der zugrunde liegenden Bedingungen der Möglichkeit seiner Realisierung – und diese gilt nicht nur am ‚unteren’ Ende. So lässt sich argumentieren, dass beispielsweise mit Blick auf ‚Wirtschaftskriminalität’ auch am ‚oberen’ Ende ein Ungleichgewicht besteht: hier verbietet das Gesetz 55 dem Millionär wie dem Obdachlosen gleichermaßen Steuern zu hinterziehen. Selbstverständlich ist dieses Argument alleine deshalb nicht strukturanalog, weil man kaum behaupten kann, dem Millionär bliebe keine andere Wahl, als Steuern zu hinterziehen und das Strafrecht ‚bestrafe’ vor allem seine soziale Stellung als Millionär (vgl. aber Sutherland72 1968 [1940]). Allerdings verweist diese Perspektive darauf, dass sich aus der ‚Gleichheit’ des ‚legalen Kapitals’ heraus, verschiedene Formen einer strukturell ungleicher Distribution des negativen Gutes ‚Kriminalität’ entwickeln können. Nimmt man diesen Gedanken ernst, kann zunächst im Anschluss an Vincenzo Ruggiero (2001) davon gesprochen werden, dass eine niedrige feldspezifischen Positionen, ein mangelnder Zugang zu Feldern und eine mangelnde Verfügung über Ressourcen, bzw. Kapitale auf der Seite der Akteure per se nicht, zumindest nicht alleine, als die Ursache von Kriminalität - als Verstoß gegen den zu legalem Kapital geronnenen gesellschaftlich Common Sense - verstanden werden kann. Die Verteilung und das Muster von Ressourcen (Kapitalen), Feldzugängen und -positionen, sowie die Verteilung der möglichen oder wahrscheinlichen ‚Spielzüge’ der Akteure in einem Feld (bzw. im gesamten sozialen Raum) steht eher im Zusammenhang mit verschiedenen Formen von ‚Kriminalität’. Die soziale Distribution des ‚negativen’ symbolischen Gutes ‚Kriminalität’ hängt demnach von der Dichte der Regulation durch das Machtmittel legales Kapital im jeweiligen Feld ab. Sie steht mit dem Maß im Zusammenhang, in dem die Gültigkeit dieses ‚Common Sense’ je (formal) eingeklagt und durchgesetzt wird - dazu gehört auch die vor allem von ‚rational choice’ Theoretikern behandelte Frage, wie aufwendig und mit welchen materiellen, sozialen und symbolischen ‚Kosten’ eine solche Einklagung und Durchsetzung verbunden ist (vgl. Coleman 1990, Lüdemann 2000). Schließlich hängt sie vor allem von dem feld-, feldpositionsund akteursspezifischen Maß sowie von der Art und Weise ab, in dem die Einhaltung dieses Common Sense sichtbar ist und sichtbar gemacht, d.h. kontrolliert wird73 (dazu vor allem die Arbeiten von Donald Black 1970, 1976, 1980, 1984, Black et al. 2002). So ist es empirisch unzweifelhaft, „dass bei wirtschaftlich benachteiligten Jugendlichen […] Verhalten sichtbarer ist weil sie mehr Zeit an öffentlichen Orten verbringen74 […]. Dies bedeutet aber, dass selbst wenn [… abweichendes Verhalten] bei benachteiligten Jugendlichen in keiner Weise ausgeprägter ist als bei anderen, sie durch bloße Anwesenheit in der Öffentlichkeit mehr auffallen“ (Forster/Hagan 2002: 698). Zu der Art und Weise der Kontrolle gehört auch die Frage, welchen Gegenstand die Form des legalen Kapitals fokussiert, das als Mittel der symbolischen Regulation eines Feldes bemüht wird. So ist etwa das ‚Feld der Ökonomie’ in einem wesentlich stärkerem Maße durch administrative Regulationen, öffentliches und Zivilrecht usw. als durch das Strafrecht reguliert. Dies gilt für andere Felder nicht unbedingt im selben Maße und dies schlägt sich zugleich auf die Akteure in den Feldern nieder. Unabhängig davon, dass es gute Gründe dafür gibt, bestimmte Verhaltenweisen für alle Akteure unter Sutherland (1968) zufolge stehen die ‚Spielregeln’ in der Wirtschaft „in Konflikt mit den gesetzlichen Regeln. Ein Geschäftsmann, der dem Gesetz gehorchen will, wird von seinen Konkurrenten dazu gebracht zu ihren Methoden zu greifen“. 73 Bereits 1882 betont der Kriminalanthropologe Léonce Manouvrier (1986: 213, nach Sack 2002: 34), dass auch „die wohlerzogenen, ehrbaren Leute […] Gewalt auszuüben wüssten und vermöchten, ohne damit bei der Polizei Anstoß zu erregen“. 74 Offensichtlich finden sich beispielsweise auf den Straßen der Innenstädte andere Verhaltensvariationen und Praxismuster und damit auch andere Formen des Bruchs des legalkapitalbasieren Common Sense - als den Staatskanzleien, Arztpraktiken oder Universitäten. Damit verbunden wird die Distribution des negativen Gutes ‚Kriminalität’ schon alleine dann zuungunsten bestimmter Gruppen von Akteuren - namentlich jungen Männern aus den unteren Klassen – verändert, wenn die Kontrolldichten nicht in letztgenannten Arealen, sondern im öffentlichen Raum verstärkt werden. 72 56 Strafe zu stellen, und ohne diese Berechtigung per se zu relativieren, ist es aus dieser Perspektive plausibel anzunehmen, dass „the operation of the criminal justice system is not neutral [… because] most of the resources are focused on the crimes of the disadvantaged“ (Hutton 1999: 580). In diesem Sinne wirkt es faktisch als ‚homogenisierender Filter’ (Hudson 1996: 112) zuungunsten der unteren Klassen: „[It] is directed predominantly at the kinds of wrongdoing that are most common among the poor: ‚the law is designed primarily for the non-affluent; the affluent are kept in line, for the most part, by tort law’ (Posner 1985: 1204f)“ (Hudson 1996: 12, vgl. Frehsee 1991, Fulcher/Scott 2003, Wilson et al. 1986). Darüber hinaus hat vor allem Peter Manning (1994) in Rekurs auf Bourdieus symbolisches Kapital nachgezeichnet, dass diese Selektionsrationalitäten nicht nur in Bezug auf den formellen Strafprozess wirksam sind. Eine klassenspezifische Filterung geschieht vor allem auch durch die, dem Strafprozess vorgelagerten Kontrollinstanzen – allen voran der Polizei –, die die gegebenen formal ‚gleichen’, ‚egalitären’ und ‚objektiven’ Gesetze in einer Weise durchsetzen, die das symbolische Kapital der mittleren und oberen Klassen schützt, während die unteren und subdominanten Klassen – vor allem relational zu den oberen – in ihrem politischen, legalen und sozialen Status degradiert werden. Die Gleichheit des legalen Kapitals manifestiert sich demnach de facto keinesfalls gegenüber allen Akteuren in gleicher Weise. So leben z.B., wie Funk (1995: 255) ausführt, „der deutsche Besitzbürger und der Sozialhifeempfänger, der arbeitslose Jugendliche und die hier geborene Türkin […etc. faktisch] in ganz unterschiedlichen Rechtssphären und folglich auch divergierenden Kontrollrealitäten. Ausmaß und Intensität staatlicher Überwachung bemessen sich nach dem Status der Objekte sozialer Kontrolle.“ Mit Blick auf die Feld-, aber auch auf die ‚physikalischen’ ‚Ortseffekte’ der Kontrolle, sowie mit Blick auf die unterschiedlichen Positionen der Akteure im ‚sozialen Raum’, verbunden mit einer unterschiedlichen Ausstattung an ‚materiellen’ und ‚symbolischen’ Machtmitteln, kann demnach auch in kontrolltheoretischer Hinsicht von mindestens zwei weiteren ‚strukturellen’ - d.h. sich (auch) ohne bewussten ‚Masterplan’ der formellen Kontrollinstanzen vollziehenden - Momenten der Ungleichheit gesprochen werden: Zum einen verweist diese Konstellation auf der Ebene der äußeren Constraints, denen soziale Akteure in differenzieller Weise unterworfen sind darauf, dass einige Akteure eher in der Lage sind zu kontrollieren, während andere vor allem kontrolliert werden (dazu umfassend: Scanlon 1997). Die Annahme „that ,rules’ are applied equally to persons occupying completely different positions of power is [therefore] a neglect of the fact that people occupy these positions, and that, strictly sociologically speaking, the true object of inquiry consists of positions, not people” (Schinkel 2002: 127 f). Zweitens führen die je nach Positionierung im sozialen Raum und Feldern unterschiedlichen Ökonomien und Logiken der Praxis zu habituellen Inkorporierung auf der Ebene der Akteure selbst (vgl. Bourdieu 1987). Das bedeutet, dass die unterschiedlich positionierten Akteure andere Formen und Kapazitäten in Bezug auf praktische Hermeneutik der Dechiffrierung des Inhalts und der Bedeutung der ‚gleichen Regeln’ besitzen bzw. praxislogisch bevorzugen (vgl. Schinkel 2002: 128, Manning 1994). Diese ‚hermeneutische Kapazität’ ist dann aber nicht einfach eine ‚natürliche’ Gabe. Sie ist in den unterschiedlichen sozialen Straten unterschiedlicher Felder ungleich verteilt. Auch die Frage welche Form und praxishermeneutische ‚Regel’ sich als verbindlich durchsetzt - in Anschluss 57 an Foucault lässt sich von ‚Wahrheitspolitik’ sprechen - stellt sich in so fern als eine Frage symbolischer Herrschaft dar. Solange ein Konzept der Kriminalität reflektiert wird, ist es der Staat, der quasi die Rolle eines exekutiven symbolischen Machtmonopolisten inne hat: Der Staat hat das Monopol auf die Durchsetzung der Imperative legalen Kapitals. Dies bedeutet nun allerdings in keiner Weise, dass es ohne den ‚legitimen’ Monopolisten ‚Staat’ ein Machtvakuum gäbe. „In der Tat“, so fiel bereits Emile Durkheim (1977: 111 f) auf, „drängt das soziale Leben überall, wo es dauerhaft existiert, dazu, eine bestimmte Form anzunehmen und sich zu organisieren, und das Recht ist nichts anderes als eben diese Organisation insoweit, als sie beständiger und präziser ist [...]. Allerdings könnte man einwenden, dass sich die sozialen Beziehungen auch fixieren können, ohne deswegen eine Rechtsform anzunehmen [...]. Trotzdem bleiben sie damit nicht unbestimmt, unterliegen aber, statt durch das Recht geregelt zu sein, nur mehr der Sitte. Das Recht spiegelt also nur einen Teil des sozialen Lebens wieder“. Auch die legalisierte Form symbolische Herrschaft selbst, so lässt sich präzisieren, ist weniger orginäres Produkt staatlicher Erzwingungsformen, als vielmehr Produkt der praktischen Ökonomie in spezifisch strukturierten, sozialen Sinnzusammenhängen. Die Monopolstellung entsteht durch die Überführung und Verallgemeinerung einer ansonsten partikularen und feldspezifischen symbolischen Herrschaft in legale Herrschaft bzw. mit Blick auf die eingesetzte Form symbolischen Kapitals durch die Überführung von Moral und Sitte in Recht. Verweist das Konzept der ‚Kriminalität’ auf diese formalisierten Aneignungen durch den Staat, so bezeichnet es vor allem eine Wirklichkeit, die das Ergebnis dieses offiziellen Prozesses darstellt und die nur aufgrund der Legalität als einer verallgemeinerten symbolischen Legitimität existiert, mit der sie im Rahmen einer auf legalem Kapital basierenden Reaktion konstituiert wird75. Wenn jedoch der Staat, je nach Ausmaß und Reichweite seines Regulationsmonopolanspruchs, zwar regulierend (d.h. kontrollierend, lenkend, stützend, kompensierend, etc.) in die objektiven gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse eingreift, aber insbesondere in liberalen kapitalistischen Gesellschaftsformationen kaum als der primäre Erzeuger dieser Kräfteverhältnisse betrachtet werden kann, greift es zu kurz, die gesellschaftlichen Machtprozesse in der Produktion von Abweichung auf die offiziellen Reaktionen zu reduzieren. Vielmehr scheint es notwendig, die Analyse nicht auf die Prozesse der justiziellen Bestimmung von verbrecherischem Handeln zu beschränken, sondern sie von dem auf juristischem Kapital basierenden Konzept der Kriminalität, auf das Konzept der ‚Devianz’ zu erweitern. Der Unterschied zwischen beiden Konzepten besteht darin, dass es im ersten Falle - wie ausgeführt die formalen und verallgemeinerten Regeln sind die ‚Kriminalität’ konstituieren, während es beim Konzept der Devianz die feldspezifisch partikularistischen praktischen Regelmäßigkeiten sind, die ‚Devianz’ konstituieren. Folgt man Colin Sumner (2001: 89), so beschreibt der Begriff ‚Devianz’ ein Aggregat aus „social behaviours, practices, acts, demeanours, attitudes, beliefs, styles or statues which are culturally believed to deviate […from given] norms, ethics, standards and expectations“. Devianz bezieht sich Bezogen auf die Frage, wann eine Normabweichung als Kriminalität verhandelt werden kann, ist die Forderung Fritz Sacks (1986: 44) nach einer Veränderung der „Kriminologie zu einer Soziologie des Strafrechts“ demnach durchaus sinnträchtig. 75 58 demnach auf die Differenz einer bestimmten Lebensäußerung von korrespondierenden Anforderungen an sozial, kulturell, ökonomisch und symbolisch artikulierte Dimensionen der Lebensführung. Zur Bestimmung des Konzepts der Devianz auf einer überindividuell vermittelbaren und daher performativ- sichtbaren Ebene ist darüber hinaus ein Rückgriff auf die Definition des amerikanischen Theoretikers Charles Tittle gewinnbringend (kritisch: Savelsberg 1999). Devianz bezeichnet nach Tittle (1995: 124) „jedes Verhalten das die Majorität einer gegeben Gruppe als nicht annehmbar betrachtet, oder das typischerweise eine kollektive Antwort negativen Typs hervorruft”. Eine solche Fassung von Devianz beinhaltet eine deutliche Erweiterung gegenüber dem Konzept der Kriminalität. Sie umfasst all jene Handlungsweisen, die nicht nur bezogen auf einen verallgemeinert verfassten Idealtyp gesellschaftlich organisierter sozialen Beziehungen - dem (Straf-)Recht - als nicht annehmbar bzw. bedrohlich gefasst wird, sondern beinhaltet auch jene Handlungsweisen, die in einer aus einer ganzen Palette möglicher - ebenso beliebigen, wie spezifisch empirisch vorfindbaren Konfiguration sozialer Relationen situiert sind, und dabei nur und ausschließlich in diesem Kontext als unangemessen, bedrohlich oder unakzeptabel wahrgenommen werden – was nicht heißt, dass sie dies auch faktisch sind (vgl. Lianos/Douglas 2000: 104). In dieser Hinsicht bezieht sich das Konzept der Devianz nicht (nur) auf die Illegalität einer Handlung, sondern auf einen Habitus und eine Form der Lebensführung, d.h. auf Dispositionen, die in ihrem Bezug auf bestimmte soziale und politische Positionen und Positionszuordnungen, in einem spezifischen sozialen Feld ‚unterhalb‘ praxislogisch dominanter, symbolischer Standards liegen. Im Gegensatz zum Konzept der ‚Kriminalität’ wird Devianz in einer solchen Fassung nicht erst durch bestimmte Reaktionen definiert, sondern als ein Attribut eines Verhaltens gefasst. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die so konstituierte ‚Eigenschaft’ dieses Verhaltens per se eine substanzhafte Kategorie darstellen würde. Es bekommt diese Eigenschaft dann, wenn es in eine bestimmte Logik der Praxis eingebunden ist. Das Problem dieser Definition ist die Rede von der ‚Majorität’ einer gegebenen Gruppe, sofern sie nicht ‚qualitativ’ – etwa als ‚moral majority’ (dazu: Rodger 1992) - sondern ‚quantitativ’ gefasst wird. Wesentlich ist nicht der Bezug auf nominale Mehrheiten selbst (vgl. Savelsberg 1999: 333), sondern die zugrunde liegenden machtförmigen Prozesse, deren Ergebnis ein symbolisch hegemonialer und von den sozialen Akteuren inkorporierter ‚Common Sense’ darstellt. Sofern die Konstitution von Kriminalität und Devianz ebenso wie die Prozesse der Kriminalisierung in einem ‚hegemonietheoretischen’ Modell symbolischer Gewalt betrachtet werden, ist es sinnvoll auch traditionelle ‚ätiologische’ Erklärungsansätze von Kriminalität heranzuziehen. Diese Ansätze können sowohl dazu beitragen, die Bedingungen zu erhellen, in deren Rahmen Devianzkonstitutionen und Zuschreibungen wirksam werden, als auch dazu, die ‚typischen‘ Zielgruppen dieser Konstitutionen und Zuschreibungen zu beschreiben. Ironischerweise lassen sich diese Bedingungen im Rekurs auf das - insbesondere im konservativ ‚neorealistischen’ kriminologischen und kriminalpolitischen Diskurs populär gewordene - individualisierende Devianzmodell ‚mangelnder Selbstkontrolle‘ von Michael Gottfredson und Trevis Hirschi (1990) verdeutlichen. Dieses Modell ist nicht zuletzt darum interessant, weil Gottfredson und Hirschi durch die 59 Rekonstruktion des Kriminellen, als Akteur mit wenig Selbstkontrolle und mangelnder Fähigkeit, die Befriedigung unmittelbarer Bedürfnisse aufzuschieben (‚deferred gratification’ vgl. auch Wilson 1975), implizit eine Art Idealtypus des ‚Verbrechermenschen’ der - im Sinne klassischer Kriminalitätstheorien scheinbar anti-ätiologischen – ‚rational choice Theorien’ skizzieren76. Selbstkontrolle wird dabei als die Fähigkeit gefasst, im Rahmen einer angemessenen Kosten-Nutzenkalkulation auf eine augenblicksorientierte, aufwandslose und unmittelbare Befriedigung eigener Bedürfnisse zu verzichten, wenn diese auf Dauer überwiegend negative Ergebnisse produziert. Im Zentrum dieser Überlegungen steht zumindest implizit eine Erklärung von Abweichung auf der Basis einer Dichotomie zwischen asketischer Ethik und Hedonismus als ethische Grundmotivation einer individuellen und rational kalkulierten Lebensführung (vgl. Lamnek 1994). Erhellend ist die Beschreibung jener Lebensweise, die nach Gottfredson und Hirschi von hoher Selbstkontrolle zeugt, also devianzimmunisierend wirkt: Während sie bezogen auf die Entwicklung der Fähigkeiten zu einer ‚angemessenen’ Form der Lebensführung in einer gewissen Weise korrespondierend zum Habituskonzept bei Bourdieu argumentieren, dass diese „appear early and remain stable over much of the life course” (Gottfredson/Hirschi 1990: 108), steht ihre inhaltliche Beschreibung gänzlich in der Tradition der protestantischen Ethik des Kapitalismus (vgl. Nelken 1994: 249), die, wie Max Weber (vgl. 1934) ausführt, eine ‚konsequente Methode der Lebensführung’ und ‚systematische Selbstkontrolle’ erfordere. Melossi (2000: 168) bezeichnet das, was Gottfredson und Hirschi als ‚hohe Selbstkontrolle’ beschreiben, zurecht als eine lange Aufzählung des „usual middleclass, work ethic, American way of doing things”. Sieht man von der Konkretisierung der ‚selbstkontrollierten’ Lebensführung in ‚amerikanischen Verhältnissen’ ab, entsprechen die Beschreibungen jener kriminalitäts- bzw. devianz-immunisierenden Lebensweise, nicht nur bezogen auf ihr frühes Auftauchen und ihre Stabilität im Lebenslauf, sondern auch inhaltlich bis in das Vokabular hinein, jenen Habitus, die nach Bourdieu (1982, Bourdieu et al. 1981) kennzeichnend für das (‚aufstiegsorientierte’) Kleinbürgertum sind77 (für die Bundesrepublik: Vester et al. 2001). Charakteristisch für hohe ‚Selbstkontrolle’ und den kleinbürgerlichen Habitus sind die Bereitschaft zum Verzicht, asketische Sittenstrenge, Konformismus und Investitionen in sichere Werte, langfristige aufwandsintensive Planungen, Pretentiosität und Disziplin, die Tendenz „to be cautious, cognitive, and verbal” (Gottfredson/Hirschi 1990: 90), die Orientierung an stabilen Erfolg versprechenden Beziehungen, (Bildungs-)Eifer, Pflichtbewusstsein, wenig Impulsivität, wenig „charm and generosity”, etc. (Gottfredson/Hirschi 1990: 90, vgl. Bourdieu 1982, Bourdieu et al. 1981). Kurz, La Bruyères Diktum: „Le présent est pour le riches, l´avenir pour les vertueux et les habiletés” (zitiert nach Bourdieu et al. 1981: 186), kann als eine Art handlungspraktisches Leitmotiv für die Akteure betrachtet Bourdieu bezieht sich in den feinen Unterschieden explizit auf diese, scheinbar rein persönliche, aber offensichtlich und keinesfalls zufällig in den unteren Klassenmilieus sehr viel seltenere Fähigkeit. In der englischen Übersetzung heißt es hierzu etwa: „the propensity to subordinate present desires to future desires depends on the extent to which this sacrifice is ,reasonable’ that is, on the likelihood of obtaining future satisfactions superior to those sacrificed” (Bourdieu 1984a: 413). 77 Nun ist die Orientierung am Kleinbürgertum seitens kriminalsoziologischer Rational-Choice-Theoretiker nichts Neues. So bezeichnete bereits Marx (vgl. MEW 23) Jeremy Bentham als ‚Genie in der bürgerlichen Dummheit’, der den ‚englischen Spießbürger’ zum Maßstab für alle Rationalität hypostasiere. 76 60 werden, denen Michael Gottfredson und Travis Hirschi ‚hohe Selbstkontrolle’ bescheinigen und die Bourdieu wie Vester et al. als Träger eines ‚kleinbürgerlichen’ Habitus identifizieren. (Devianz-)Theoretisch entscheidender als das bloße Aufzeigen phänomenologischer Parallelen ist jedoch die besondere sozialstrukturelle Stellung des - ‚aufstiegsorientierten’ - Kleinbürgertums. Diesem entsprechen in der Bundesrepublik, die oberen Straten jener ‚mittleren’ 60 Prozent der Gesellschaft, deren Ethos bzw. Lebensmoral, wie Michael Vester und seine Mitarbeiter (vgl. Vester 1993, 2002, Vester et al. 2001) in umfassenden Untersuchungen empirisch nachzeichnen, stark am ‚Erreichten’ und an den Vorbildern der oberen Klassenmilieus ausgerichtet ist. Bourdieu skizziert sie als Vertreter jener Klassenmilieus, die die größten Anstrengungen und Entbehrungen auf sich nehmen, um der legitimen Kultur - der Kultur der herrschenden Klasse als Vorbildmodell für alle anderen Klassen - nachzueifern, und sich zugleich von den unteren Klassen zu distinguieren, d.h. über jenen ‚Habitus des Strebens’ verfügen, den Vester et al. (2001) vor allem in den mittleren Klassenmilieus der Bundesrepublik ausmachen. Hierbei entsprechen sie zugleich jener Gruppe, die einer bewussten ‚Stilisierung des Lebens’ im Sinne Webers und den Annahmen der kognitivistischen wie ‚rational choice‘- Theorien am nächsten kommen. Gegenüber den kleinbürgerlichen, aufstiegsorientierten Gruppen grenzen sich die oberen Klassenmilieus (‚Bourgeoisie’) im Rahmen des Symbolismus der Lebensstile der Tendenz nach ab. Dabei formulieren sie – aus einer diachronen Perspektive betrachtet – die legitime Kultur und mithin den hegemonialen Konsens in mittelbarer Hinsicht neu. Folgt man den Studien von Michael Vester (Vester et al. 2001: 504 f, vgl. Vester 2002) rekrutieren sich diese oberen Klassenmilieus aus „mehr als 20 % der Bevölkerung, die ihrem Habitus nach beanspruchen, wirtschaftlich, sozial, kulturell oder politisch tonangebend zu sein“. In synchroner Perspektive kann bezogen auf den Status quo der legitimen Kultur jedoch das (aufstiegsorientierte) Kleinbürgertum als die Gruppe betrachtet werden, die diese im nicht nur Sinne eines lebenspraktischen ‚trickle-down-effects’ adaptiert (vgl. Vester et al. 2001), sondern bei der sich deren handlungsleitende Wirkung, im Sinne einer normativ-ästhetischen Orientierungsgröße, auch am umfassendsten zeigt. Bestimmt die kulturelle Praxis der herrschenden Klassen die Genese des Common Sense, wird dieser – in synchroner Perspektive - faktisch in erster Linie von den ‚kleinbürgerlichen’ Klassenmilieus stabilisiert und perpetuiert. Diese Lesart steht jedoch vor einem theoretischen Problem. Ist der Lebensstil als mittelbare Exteriorität des gesellschaftlichen Seins zu verstehen, so muss dieser - gemäß dem Postulat eines dialektischen Verweisungszusammenhangs von Position und Disposition – um sich dauerhaft zu stabilisieren durch die allokativen Mittel in den sozialen Auseinandersetzungen, d.h. durch verfügbare ‚Kapitale’, ‚abgedeckt’ sein. In diesem Sinne herrscht beim ‚Kleinbürgertum’ zunächst ein objektiver Mangel an ‚tatsächlicher’ Kapitalausstattung. Dieser Mangel lässt sich jedoch auf der Ebene des Symbolismus kompensieren: Im Vergleich zu den über ‚wirkliche Machtmittel’ verfügenden herrschenden Klassen „(relativ) arm an ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital [...können die Mitglieder der aufsteigenden mittleren Klassenmilieus] ihre Ansprüche lediglich dann rechtfertigen (und sich Möglichkeiten zu ihrer Befriedigung verschaffen), wenn sie mit Opfern, Entbehrungen, Verzicht, kurzum: mit Tugenden bezahlt. […Aufsteigende 61 Kleinbürger sind] vor allem dadurch definiert, dass ihre soziale Lage durch objektive Chancen bestimmt ist, die sie nicht hätten, wenn sie sie nicht für sich beanspruchten und nicht grade dadurch ihre Ressourcen an ökonomischem und kulturellem Kapital um moralische Ressourcen erweiterten“ (Bourdieu et al. 1981: 188, 184). Es ist Bourdieu zu Folge also möglich, nicht nur die benannten Kapitalen einzusetzen, sondern auch durch ‚Moral’ zu bezahlen. Mehr noch verweisen die ‚moralischen’ Machtmitteln auf das „Lieblingsgebiet“ und eine der wichtigsten ‚Waffen’ und Sanktionsmittel des Kleinbürgertums: Die Kleinbürger, so Bourdieu (1982: 554), „machen aus ihrer Notwendigkeit eine Tugend und erheben ihre partikulare Moral […] zur universell gültigen. Denn sie haben nicht nur, wie jedermann, eine ihrem Interesse entsprechende Moral, sie haben Interesse an der Moral: Als Kläger gegen alle Privilegien geben sie alleine dem moralisch Gesonnenen ein Recht auf diese Privilegien“ (vgl. auch Verba et al. 1995). Diese (inkorporierte) Form der Moral ist empirisch rekonstruierbar. Vester et al. (2001: 94, vgl. Schilling 2003, Vester 2002) sprechen von einem „Ethos von Hierarchie und Pflicht“ bei den eher traditionellen Fraktionen bzw. einem „Ethos von Eigenverantwortung und […] Leistung“ bei den modernen Fraktionen eines Klassenmilieus der ‚respektablen Mitte’, deren Mitglieder über ‚strebende’ oder ‚arrivierte’ Habitus verfügen (vgl. Vester et al. 2001: 48ff). Diese Klassenmilieus grenzen sich nun „von den Unterprivilegierten seit je dadurch ab, dass sie ihr Leben auf beständige Arbeit und Lebensführung gründen“ (Vester et al. 2001: 94), die sie durch eine Leistungs- und Pflichtethik verinnerlicht haben (vgl. Vester et al. 2001: 503f). Die nach unten gerichtete Grenze der ‚Respektabilität’ konstituiert eine Form der ‚Statussicherheit’ durch eine symbolische Kommunikation, dass die Ansprüche und eingenommen Stellungen „durch Leistung und Loyalität ‚verdient’“ sind, während diese zu versäumen „den unteren Milieus als Charaktermangel vorgehalten“ wird (Vester et al. 2001: 27 f). Vor allem im Kontext einer zeitgenössischen und keineswegs zufälligen Konjunktur traditioneller Werte (vgl. Hradil 2002, 2002a), wird diese Abgrenzung dadurch vorangetrieben, dass „über dem Sockel von etwa 10 % Einkommensarmut […] eine Zone der Prekarität entstanden ist, die weitere 25- 30 % der Bevölkerung betrifft“ (Vester 2002: 102). Die Existenz dieser ‚Zone der Prekarität’ (vgl. auch Bourdieu 1998a, Castel 2000, Ehrenreich 1992, Hübinger 1996) induziert eine Forcierung der Statusunsicherheit der Mitglieder dieser Milieus, die eine entscheidende Quelle rigider sozialer und vor allem symbolischer Abgrenzungsprozesse darstellt (vgl. auch Brand 1990, Gusfield 1963, Karstedt 1999, Sennett 1998). In einer Verbindung von Ergebnissen von Autoritarismusstudien und Untersuchungen zu den Habitus der Klassenmilieus rekonstruiert Dravenau (2002) als ein zentrales Dilemmata des durch vergleichsweise rigide und ‚asketische’ Moralvorstellungen (vgl. Bourdieu 1982, Bourdieu et al. 1981) sowie durch eine Gleichzeitigkeit von Statusängsten und Statusambitionen (vgl. Vester et al. 2001) gekennzeichneten ‚Prätentionshabitus’ (vgl. Bourdieu 1982) kleinbürgerlicher Klassenmilieus, die „Ergebenheit gegenüber der legitimen Kultur, bzw. dem, was er dafür hält“, während es ihm selbst nicht gelingt dieser zu genügen: „Seine ehrgeizige Anspannung, die ihn zur Erlangung, die ihm zur Erlangung gesellschaftlicher Anerkennung allerlei Entbehrungen auferlegt, wird zur Quelle eines Rigorismus, einer restriktiven und repressiven Moral, welche sich durchaus aggressiv richten kann einerseits gegen das laxe Sich-gehen-lassen der [… unter Klassenmilieus], wie andererseits gegen die Libertinage der Künstler und intellektuellen, treten doch beide Gruppen die nur unter großen Mühen sich selbst auferlegte Disziplin mit Füßen. Da Disziplin und Moral das Einzige ist, was er zum Zwecke 62 gesellschaftlichen Aufstiegs in die Wagschale zu werfen hat – gehen ihm doch die Startvorteile größeren kulturellen und oder ökonomischen Kapitals ab -, ist seine Weltsicht durch Moralismus geprägt“ (Dravenau 2002: 464). In diesem Sinne erfolgt nicht nur das Streben nach der legitimen Kultur der Lebensführung, sondern auch ihr Gegenstück, die Markierung einer ‚Grenze der Respektabilität’, als untere symbolische Scheidelinie (vgl. Vester et al. 2001: 503f), durch den Gebrauch einer besonderen Variante des symbolischen Kapitals: dem moralischen Kapital78. Diese ‚Kapitalsorte’ moralisches Kapital ist mit Blick auf gesellschaftliche bzw. feldspezifische Dynamiken und Kämpfe schon alleine deshalb relevant, weil sich „die sozialen Gruppen und Individuen hauptsächlich auf der Grundlage ‚moralischer’ Empfindungen […] verbinden und teilen“ (Vester et al. 2001: 167), oder, wie es Durkheim (1977) formuliert, sich die Gruppen durch einen ‚gemeinsamen Korpus moralischer Regeln’ auszeichnen, aus denen sich auch auf individueller Ebene ein ‚moralischer Habitus’ generiert (vgl. auch: Geiger 1932). Während symbolisches Kapital in der Regel die ‚verwertbare’ Form ,materieller Kapitalen’ darstellt, wird hier unter ‚moralischem Kapital’ – analog zum legalen Kapital - eine ‚geronnene’, von anderen Kapitalen zunächst abgekoppelte Form des symbolischen Kapitals verstanden, nämlich die feldspezifisch dominante Form der Wahrnehmung und Beurteilung sozialer Phänomene, bzw. Prozesse. Im Gegensatz zu ‚legalem’ Kapital ist das ‚moralische’ Kapital jedoch nicht ‚offiziell’ geworden. Es wird in der Regel weder schriftlich fixiert noch expliziert. Es wird von keiner identifizierbaren Exekutivinstanz monopolisiert, sondern bleibt Gegenstand feldspezifischer ‚symbolischer Kämpfe’ und vor allem wird es nicht ‚universalisiert’, sondern bleibt auch in der Reichweite seiner Gültigkeit feldspezifisch und damit partikularistisch79. So wird sich das ‚moralische Kapital’ im ‚Gay-Village’ von Manchester oder Amsterdam von dem ,moralischen Kapital’ in den Gemeinschaften baptistischer ‚Born-Again-Christians’80 deutlich unterscheiden (dazu: Hirst 2000). Auf feldspezifische Unterschiede in der Verteilung ‚moralischen Kapitals’ macht – unabhängig von der Validität der Aussage in dieser Form – im gewissen Sinne auch der AWO Bundesverband (2000: X) aufmerksam, wenn er davon spricht dass Kinder und Jugendliche in ‚sozialen Brennpunkten’ „weit entfernt sind von den Zentren der (Mittelschicht-)Normalität, an deren Normen sie gemessen werden“ Die ‚Erfindung’ ‚moralischen Kapitals’ im Sinne eines sozialwissenschaftlichen Begriffs, kann wohl Elisabeth Lissenberg (1990) für sich reklamieren. Im Gegensatz zu Lissenbergs Begriff ‚moralischen Kapitals’, bezieht sich der hier vorgeschlagene Terminus aber weniger auf die ‚moralischen Ressourcen’ einer Gesellschaft und ihre Einsozialisierung durch den Einzelnen. Moralisches Kapital im Sinne Lissenbergs repräsentiert vor allem ‚moralische Ressourcen’ als Elemente des gesellschaftlichen Zusammenhalts, des Vertrauens, der Handlungssicherheit sowie von Versuche einer (‚gerechten’) Lösung von Konflikten. Für zahlreiche Anregung und kontroverse Diskussionen zur Fassung und zum Erklärungswert ‚moralischen Kapitals’ danke ich Prof. Susanne Karstedt. 79 Dies bedeutet jedoch nicht, dass das ‚moralische Kapital’ in einem Feld, in einem anderen nicht ebenso gültig sein kann, allerdings kann es sich genauso gut auch unterscheiden. 80 Nach einer Umfrage der Associated Baptist Press vom Juli 2001 halten zwei Prozent der Born-Again-Christians Homosexualität für einen ‚akzeptablen Lebensstil’, während 95% diesen ‚Lebensstil’ strikt ablehnen. 78 63 Während Moral bzw. ‚moralischen Ressourcen’ einer Gesellschaft den Charakter eines ‚Kollektivguts’ annehmen und – etwa hinsichtlich der Inklusivität und der ‚universalistischen’ Ausrichtung ihrer Prinzipien, dem Maß und der Reichweite wechselseitigen Vertrauens usw. - ein Element der ‚Qualität’ des sozialen Zusammenlebens in einer Gesellschaft darstellen kann (vgl. Habermas 1983, Inglehart et al. 1998, Inglehart 1999, kritisch: Bourdieu 2001c), wird mit dem hier vorgeschlagene Begriff ‚moralisches Kapital’ eine andere Perspektive entwickelt. Unter ‚moralischem Kapital’ wird eine spezifische (Unter)Form symbolischen Kapitals verstanden, die als ein Machtmittel in der Erzeugung eines primär normativ verbindlichen feldspezifischem Common Sense dient. Dabei geht es weniger im die Frage ob moralisches Kapital gleichbedeutend mit den Implikationen eines elaborierten ‚Moralbegriffs’ im Sinne einer philosophisch begründeten Ethik ist. Moralisches Kapital wird vielmehr als eine praxisökonomisch Ressource verstanden, die sich – in dem Sinne das Moral, wie es Durkheim (1984: 85) in bester kantianischer Tradition formuliert, „nicht einfach ein System von Gewohnheiten […, sondern] ein System von Befehlen“ beschreibt – in dem Maße verwerten lässt, wie sie wie ‚Moral’ wirkt. Angewendet auf eine klassenmilieutheoretische Perspektive verweist ‚moralisches Kapital’ nicht auf eine ‚universalistische Moral’ oder das ‚moralische Band’ einer Gesellschaft, sondern auf ein Kapital das in symbolischen Distinktions- und Reproduktionskämpfen eingesetzt wird81 (vgl. Sayer 2001). Es fördert, wie Hartmut Esser (1996: 68) den Begriff moralisches Kapital verwendet, „moralische Verpflichtung, Hochwertung und Vertrauen [seiner Träger] nach innen [bei gleichzeitiger] abwertende[r] Distanz, sogar bewusste ‚Amoralität‘ und Misstrauen nach außen“ und materialisiert sich entsprechend als „Ressourc[e], die für die Akteure im Alltag essentiell wichtig“ ist, um symbolische Grenzziehung zu „objektivieren“. Dabei ist moralisches Kapital - vergleichbar mit sozialem Kapital - eine Form des Kapitals, die von einem einzelnen Akteur als einzelnem zunächst nicht ‚besessen’ werden kann. Dennoch wird es hier nicht in einer Fassung als Kollektivgut vorgeschlagen, sondern als etablierte, symbolische Form, die in inter-individuelle Beziehungen ‚eingebettet’ ist, aber von einzelnen Akteuren realisiert wird, im Falle von bestimmten Akteuren in einer stärkeren Strukturhomologie zu ihrer präferierten Praxis steht und sich damit zugleich praxisökonomisch ‚gewinnbringender’ realisieren lässt. Ein Kapital ist moralisches Kapital in so fern, wie es eine eigenständige Ressource darstellt, wenn Handlungsweisen und entscheidungen, Lebensstile usw., die den Interessen eines Akteurs zuwiderlaufen, zugleich auf einer symbolischen Ebene normativ delegitimiert sind. Vor dem Hintergrund des engen Verweisungszusammenhangs von Feld, Kapital, Habitus und Lebensstil bzw. Lebensführungsstrategie (vgl. Bourdieu 1982, 1985, 1987, 1997), sorgt moralisches Kapital mittelbar auch dafür, dass, wie es Peillon (1998: 218) formuliert, „the possession of any kind of capital is justified not only in the eyes of So verweist etwa Andrew Sayer (2001) auf „Beverley Skeggs’ work on young working class women and their struggle for respectability [that] shows their often painful awareness of being judged more severely than middle class women […]. The search for respectability is a game which is rigged so that they will usually lose. As is also evident from the personal narratives in the transcripts in Bourdieu et al’s The Weight of the World, resentment about this stigmatisation is often stronger than resentment about lack of material wealth. Thus, moral stigma is frequently attached to those who are worst off in class terms, and correspondingly, a moral privilege is attached to high class”. 81 64 those who benefit most from its distribution, but also in the eyes of those who are most deprived of it”. Wenn es in dem Feld, in dem sich ein Akteur bewegt - von allen anderen Sanktionen abgesehen beispielsweise als ‚moralisch’ unakzeptabel gilt – z.B. als Faulheit, Egoismus, Verantwortungslosigkeit etc. – , schlecht bezahlte Arbeiten zu schlechten Konditionen abzulehnen, profitiert ein ‚Anbieter’ solcher Arbeiten davon offensichtlich mehr als dann, wenn die schlechte Bezahlung und die schlechten Arbeitsbedingungen selbst als Ausdruck seiner ‚Habgier’ oder als ‚Ausbeutung’ thematisiert werden. Das selbe gilt – mit umgekehrten Effekten – auch für den Akteur, der solche Arbeiten akzeptiert oder ablehnt. Es liegt auf der Hand, dass solche ‚symbolischen’ Fragen des moralischen Kapitals über kurz oder lang ‚materielle’ und handlungspraktisch wirksame Effekte zeigen. Mit dem Terminus ‚moralisches Kapital’ wird also die Qualität dieses ‚Kapitals’ bzw. dieser Ressource als ‚Moral’ in den Blick genommen, sondern seine Qualität als ein in individuellen Praxisökonomien realisierbares ‚tatsächliches’ Kapital, d.h. als ein mögliches Machtmittel sozialer Akteure in den Kämpfen der Ökonomie der Praxis. Während sich ‚Moral’ in einem engeren theoretischen Sinne, dadurch auszeichnet, dass sie nicht kalkulierend gebraucht wird, bzw. sich ihre Geltung nicht am eigenen Interesse ausrichtet (vgl. Brumlik 2001), liegt die analytische Pointe des Begriffs moralisches Kapital - als praxisökonomisches ‚verwertbares’ Kapital darin - dass es gerade deshalb - und nur dann ein effektives Machtmittel darstellt, wenn der Eindruck von ‚Moral’ in diesem engen Sinn aufrecht erhalten werden kann (vgl. Bourdieu et al. 1981, Bourdieu 1987, 1998, 2001c). Hierin liegt eine der Grundfunktionen dessen, was Bourdieu als symbolische Macht oder symbolisches Kapital beschreibt. Macht, so auch Alvin Gouldner (1970) in seinen Ausführungen zur ‚Coming Crises of Western Sociology’ „is among other things [the] ability to enforce one’s moral claims. The powerful can thus conventionalise their moral defaults” (Herv. H.Z.). Die Relevanz von nicht-staatlich monopolisierten, symbolischen Wahrnehmungs- und Klassifikationsformen für die Regulation und Kontrolle von Verhaltensweisen und Praxisformen ist eine alte Einsicht. So ist es der ‚Erfinder’ des Terminus ‚soziale Kontrolle’, Edward A. Ross (1901), der mit eben diesem Konzept den Standpunkt vertritt, dass es vor allem die ‚belief systems’ und nicht die spezifischen staatlichen Gesetze seien, die die Handlungen von Individuen (internal) leiten, und die auch dazu dienen, ihr Verhalten – external - zu kontrollieren. In diesem Kontext lässt sich moralisches Kapital - als die Ressource, um nicht nur in ‚richtiger’ Weise in den common-sensualen ‚belief systems’ teilzunehmen, sondern vor allem auch um auf sie Einfluss zu nehmen - deshalb als ein Machtmittel fassen, weil es den Blick auf die Vorteile richtet, wenn ein feldspezifischer normativer Common Sense in einem engen Homologieverhältnis zu verfügbaren und präferierten Praxisformen steht. Der systematische Unterschied zwischen den praxislogischen, ‚moralkapitalistischen’ Regelmäßigkeitsund den legalkapitalbasierten Regelsystemen liegt, mit Immanuel Kant gesprochen, darin, dass erstgenannte „nicht für alle vernünftige Wesen in gleicher Art gültig sein“ (Kant 1974: A 40) müssen, zumal insbesondere in modernen demokratischen Gesellschaften von einer allgemeinen „Übereinstimmung über die Ideen eines ‚guten’ oder intakten Zusammenlebens“ (Honneth 2001: 1327) nicht ausgegangen werden kann: 65 „Worin nämlich jeder seine Glückseligkeit zu setzen habe, kommt auf jedes sein besonderes Gefühl der Lust und Unlust an, und selbst in einem und demselben Subjekt auf die Verschiedenheit der Bedürfnisse, nach den Abänderungen dieses Gefühls, und ein subjektiv notwendiges Gesetz [... ist daher] objektiv ein gar sehr zufälliges praktisches Gesetz, das in verschiedenen Subjekten [und Gruppen von ‚Subjekten’] sehr verschieden sein kann und muss“ (Kant 1974: A 46f.) Unterstützung und eine Ergänzung erfährt das Argument Immanuel Kants durch die empirische Moralforschung. Folgt man dem Philosophen Ernst Tugendhat (1993), zeigt sich ein Verstoß gegen eine gültige moralische bzw. auch gegen eine auf moralischem Kapital basierte Norm - im Gegensatz beispielsweise zum Bruch von Klugheitsregeln - vor allem dadurch, dass dieser bestimmte Emotionen hervorbringt: Empörung oder Zorn auf der einen, Scham und Schuld auf der anderen Seite. Sofern davon auszugehen ist, dass dieses Argument im Kern richtig ist82 (dazu: Günther 1999), besteht aus empirischer Sicht das Problem darin, dass „die Emotionen, die ‚wir’ angesichts von Verfehlungen empfinden, zwischen Personen und in Abhängigkeit von Kontextbedingungen [variieren]. Einige von uns antworten mit heftiger Empörung auf Unrecht - andere reagieren mit Gleichgültigkeit“ (NunnerWinkler/Edelstein 1993: 11). Dies wäre dann aber nicht zuletzt dadurch begründet, dass das, was als Unrecht wahrgenommen wird ebenso variiert wie die Frage, wie dieses Unrecht gewichtet wird und vor allem damit, dass „Moral […] etwas [ist], dass gemacht werden muss (wenngleich nicht willkürlich), nicht etwas, das man vorfindet“ (Tugendhat 1993: 43, vgl. Mackie 1981). Auf einen der Faktoren, der diese Konstitution reflektiert – und nur auf diesen einen –, rekurriert der Begriff des ‚moralischen Kapitals’, nämlich auf die „Nützlichkeit, mit anderen stillschweigende Vereinbarungen einzugehen, ein System von Regeln zu befolgen, wenn die anderen es gleichfalls tun“ (Tugendhat 1993: 43). Im Gegensatz zum legalem Kapital verweist das so verstandene moralische Kapital auf die notwendigen Machtmittel zur Strukturierung eines, eher auf ein bestimmtes Feld, als auf den ganzen sozialen Raum bezogenen, normativen bzw. ‚moralischen’ Bereichs der Ökonomie der Praxis. Diese Machtmittel dienen sowohl dazu den normativen Gehalt der am eigenen Interesse orientierten Dispositionen innerhalb des eigenen Aktionsfeldes zu verallgemeinern, wie sie auch umgekehrt die symbolische Legitimation dafür eröffnen, den verallgemeinerten - ‚legalkapitalistischen’ - Normbefehl gemäß einer Bewertung nach feldspezifischer wie situativer ‚Angemessenheit’ zu modulieren (vgl. Karstedt 1999a: 100 ff). Moralisches Kapital wirkt demnach nicht als kollektive Ressource - wie etwa bei Fragen des ‚moralischen Zustands’ oder der ‚moralischen Qualität’ einer Gesellschaft - sondern als das, was Hirsch (1977) ein ‚positional good’ nennt. Wenn die eigene praxislogische ‚Strategie’ durch moralisches Kapital legitimiert werden kann - bzw. andere Strategien korrespondierend delegitmiert werden können -, dann erfährt moralisches Kapital seinen Wert nicht in erster Linie dadurch, dass ein Akteur überhaupt darüber verfügt, sondern vor allem durch das Ausmaß in dem er über ‚mehr’ moralisches Kapital verfügt als andere Akteure. Je stärker sich das Verfügen über ‚moralisches’ Kapital - nämliches gilt ceteris paribus auch für soziales Kapital - zwischen den Akteuren angleicht, desto geringer wird sein Wert als Kapital (vergleichsweise unabhängig davon auf welchem Niveau sich diese Angleichung Siehe zur Diskussion vor allem das ‚special issue’ zur Beziehung von Emotionen, Kriminalität, Kontrolle und Bestrafung der Zeitschrift ‚Theoretical Criminology’ (3/2002) 82 66 vollzieht). Als ein solches ‚positional good’ ist moralisches Kapital ein Machtmittel, das eine Art symbolische Regulation praktischer ‚Strategien’ erlaubt, in dem es die Erfolg versprechenden ‚Spielzüge’ des je eigenen ‚Spiels’ legitimiert, als ‚angemessen’ durchsetzt und damit die praktische ‚Verwertbarkeit’ sicherstellt. Gleichzeitig ist es ein Machtmittel um andere ‚Spielzüge’ zu delegitimieren und ihre Ergebnisse als ‚unrechtmäßige Vorteile’ darzustellen. D.h. ‚moralisches Kapital’ ist ein Machtmittel um das eigene Spiel durchzusetzen und die ‚Spielzüge’, die der eigenen praktischen Strategie zuwiderlaufen sowohl einzuschränken, als auch die Profite, die sich aus diesem Spielzügen ergeben, zu entwerten bzw. auf die symbolische Ebene der Feldstrukturen so einzuwirken, dass sie schlicht ‚wertlos’ sind. Aber selbst wenn moralisches Kapital in diesem Sinn als Machtmittel betrachtet werden kann, steht dem nicht entgegen, dass eine kulturell variable Mindestausstattung an inkorporiertem ‚moralischem Kapital’ als Voraussetzung für konformes Handeln innerhalb gegebener juristischer wie sozio-kultureller Verkehrsformen erforderlich ist (vgl. Lissenberg 1995). Die ‚Mindestausstattung’ entspräche etwa dem ‚moralischen Wissen’ bei Nunner-Winkler (vgl. 1993) sowie einer zumindest rudimentären Fähigkeit zum ‚taking the role of the other’ und mithin einer qua Sozialisation inkorporierten Fähigkeit zu einer, wie auch immer kulturell, historisch und herrschaftsförmig gesetzten, Unterscheidung von ‚gut’ und ‚böse’ sowie einem bestimmten Maß an normativer Selbstkontrolle (vgl. Lissenberg 1995) um in der Lage zu sein, diese Unterscheidung handlungspraktisch umsetzen zu können. Von möglichen, im medizinischen Sinne pathologischen, ‚Extremfällen’ abgesehen, ist diese ‚Mindestausstattung’, die zugleich eine Basis für eine Herausbildung von Identität und relativer Autonomie sozialer Akteure sowie einer (subjektiven) Sinnhaftigkeit des Handelns darstellt, auch bei ‚Straftätern’ vorhanden83 (vgl. Sutter et al. 1998, Sykes/Matza 1957, Weyers 2002): Abweichung ist kein Ausdruck eines ‚moralischen Kretinismus’ und ‚konformes Handeln’ ist unabhängig von der sozialtopologischen Position und den inkorporierten Dispositionen der einzelnen Akteur prinzipiell möglich. Äußere und verinnerlichte ‚materielle’ und ‚symbolische’ gesellschaftliche Strukturen und Kräfteverhältnisse üben zwar erhebliche Zwänge (Constraints) aus, aber der einzelne Akteur ist diesen Zwängen keinesfalls einfach als bewusstlos formbarer ‚Reaktionsdepp’ ausgeliefert (vgl. von Trotha 1977). Der notwendigen Mindestausstattung an ‚moralischem Kapital’ – zumindest all jener Akteure, denen nicht der Status von ‚Eremiten’ oder ‚Desperados’ im Sinne Robert K. Mertons (1951) zugeschrieben werden kann84 - steht nicht entgegen, dass ‚moralisches Kapital keinen bloßen Bewertungsmaßstab von Praktiken darstellt, sondern ein Kapital im Sinne eines ‚Trumpfs’ in der symbolischen Ökonomie 83 Neuere Forschungen im bundesrepublikanischen Jugendstrafvollzug kommen zu dem Ergebnis, dass der überwiegend auf ‚konventionellen’ moralischem Argumentationsniveau im Sinne Lawrence Kohlbergs argumentieren (WAS-Mittelwert 310), was etwa dem Argumentationsniveau entspricht, dass die Klassenlage der Probanden erwarten lässt (vgl. Weyers 2002). Die verbreitete Annahme eines ‚lack of moral sense’ (Winnicott 1965) von Delinquenten ist demnach empirisch nicht aufrecht zu erhalten. Erstaunlicherweise lässt gerade das konventionelle Argumentationsniveau eine Konformitätsorientierung vermuten. Es sei wie Jennings, Kilkenny und Kohlberg in den 1980er Jahren argumentieren „an important condition for resisting delinquent behaviour when personal need or situational forces provide strong incentives for delinquent action“ (Jennings et al. 1983: 316). Dieses moralische Argumentationsniveau im Sinne der kognitiven Psychologie korrespondiert zugleich mit Bourdieus soziologischer Beobachtung einer ‚Konformitätsorientierung’ in den unteren Klassenmilieus. 84 Dies entspreche etwa dem Extrem jenes ‚Anpassungstypen’, den Merton (1951: 142) als ‚sozialen Rückzug’ bezeichnet, und von dem er behauptet, er sei am wenigsten verbreitet und würde eine Entität bezeichnen, die zwar zur Bevölkerung aber nicht zur im engeren Sinne zur Gesellschaft gehören. 67 der Felder. Das Verfügen über moralisches Kapital verweist – um es nochmals zu betonen - weniger auf die ‚Moralität’ des Einzelnen, sondern auf ein Machtmittel, das, als Variante symbolischen Kapitals, die normative Legitimität eigener Praxisformen darzustellen und zu sichern in der Lage ist und als Machtmittel zur Einwirkung auf den Common Sense in den sozialen Feldern, die Profitchancen der anderen, in diesen Felder eingesetzten, Kapitalarten erhöht. Kulturell willkürliche Ordnungsvorstellungen, Handlungsmaxime, Werthaltungen und Werthierarchien etc. können durch ihre Ausstattung mit moralischem Kapital in ihrer praxisökonomischen Redundanz zu spezifischen Praxisformen ‚verschleiert’ werden. ‚Verschleierung’ meint hier, dass feldspezifische Partikularinteressen als moralisch gültige, natürliche und nichthinterfragbare Wahrheiten durchgesetzt werden. Da die relativ autonomen – d.h. zugleich relativ interdependenten - sozialen Felder im Sinne Bourdieus keine geschlossenen ‚autopoietische Systeme’ (Maturana/Varela 1984, Luhmann 1987) darstellen, steht dem nicht entgegen, dass die ‚Gültigkeit’ des ‚moralischen Kapitals’ in einem sozialen Feld in der Regel als strukturhomologe, praktische Metapher zu einem gewissen Grad auf andere Felder übertragbar ist. Jedoch verweist ‚moralisches Kapital’ als ‚Kapital’ auf die Notwendigkeit einer praxislogischen Passung zu dem Feld, in dem es als Machtmittel wirkt. Somit wirkt ‚moralisches Kapital’ weniger im Sinne einer ‚universellen’ Moral auf der Makroebene, als vielmehr wie eine „situations- und kontextadäquate[…] (Kontroll-)Moral auf der Mikro- und Mesoebene” (Lindenberg/Schmidt-Semisch 1995: 8). D.h. moralisches Kapital bezieht sich weniger auf eine einheitliche Moral oder Ethikform für das gesamte gesellschaftliche System, als auf die Ökonomie der Praxis in den einzelnen relativ autonomen sozialen Feldern. Dort fungiert es als lebensweltlicher, auf einem Alltagsbewusstsein basierter Sanktionsmechanismus (Rauschenbach 1999: 132 f). Der Idealfall ‚moral-kapitalistischer’ sozialer Kontrolle ist dabei die Schaffung feldspezifischer (Praxis)Strukturen, die gewährleisten, dass gerade jene Handlungsstrategien, die auf feldspezifisch wirksamem, ‚moralischen Kapital’ basieren - und möglichst nur diese - in einer legitimen Weise Aussicht auf Erfolg, bzw. Profit haben dürfen. In diesem Sinne ist moralisches Kapital für all jene, die in das dazu passende Feld eintraten, nicht nur praxislogisch verbindlich, sondern für die, die über ein möglichst hohes Maß an feldspezifisch ‚passendem’ moralischen Kapital verfügen auch praxisökonomisch ‚profitabel’. Wenn der Inhalt und die Art und Weise ‚meiner’ Praxis, dem Inhalt und der Art und Weise jener Praxisformen entspricht, die einen in normativer Hinsicht imperativen Charakter für alle anderen Akteure haben, stellt dies ohne Zweifel einen ‚praxisökonomischen’ Vorteil gegenüber all jenen Akteuren dar, für die dies nicht im gleichen Maße gilt85. Es gibt in diesem Sinne seitens der Träger ‚moralischen Kapitals’ ein ökonomisches Interesse an der Durchsetzung und Verbindlichkeit einer der eigenen Handlungslogik entsprechenden ‚Moral’, deren Gültigkeitsanspruch sich vor allem auf das Feld ihrer Genese bezieht. Dieses ‚strategische’ Interesse, indem ‚Moral’ zu einem ‚Kapital’ wird, zeigt sich beispielsweise daran, dass das Kleinbürgertum „obgleich es gewöhnlich viel strenger auf die Einhaltung von Sitte und Anstand achtet als die anderen Klassen (insbesondere bei allem was die Erziehung der Kinder, ihre Leistungen, ihren Umgang […] usw. angeht) […sich] – Etwas überspitzt könnte man sagen, dass - auch wenn es hier nicht um moralisches, sondern um legales Kapital geht beispielsweise die Rechtssetzungsprozesse in Silvio Berlusconis Italien augenscheinlich im Verdacht stehen, Herrn Berlusconi genau solche ‚praxisökonomischen’ Vorteile zu verschaffen. 85 68 ohne dass darin ein Widerspruch gesehen wird – in bestimmten Fällen sehr viel weniger sittenstreng zeig[t], als es der herrschenden Moral entspricht, weniger streng auch als die am stärksten auf diese Moral bedachte Fraktion der herrschenden Klasse, nämlich immer dann, wenn die verurteilten Praxen […] dem Aufstieg dienen.” (Bourdieu et al. 1981: 185, vgl. auch Vester et al. 2001) Dieses Interesse schlägt sich deutlich im ‚politischen Feld’ nieder. Wie Sidney Verba et al. (1995) in ihrer Studie über ‚Voice and Equality’ zeigen, besteht für sozial, kulturell und ökonomisch Privilegierte nicht nur eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit politisch gehört zu werden und ihre Sicht der Welt einzubringen und durchzusetzen (vgl. auch Bourdieu 2001b), sondern auch ihre politischen Thematiken unterscheiden sich deutlich von denen der unteren Klassen. Falls sie sich überhaupt politisch artikulieren, fokussieren beispielsweise (US amerikanische) Wohlfahrtsrezipienten vier mal häufiger als der Durchschnitt basale materiellere Bedürfnisse wie Fragen von Wohnen, Gesundheit und materielle Absicherungen86 (vgl. auch Matheson/Wearing 1999). Die Themen der eher Bevorteilten kreisen fast ebenso eindeutig um zwei Aspekte. Zum einen um ökonomische Fragen, zum anderen und dies ist die moralkapitaltheoretische Pointe - um sozio-moralische Angelegenheiten, wie beispielsweise Abtreibung, Pornographie und ‚anständige Lebensführung’ etc (Verba et al. 1995). Zugleich werden auf der Basis des ‚moralischen Kapitals’ die materiell und symbolisch ‚Unterprivilegierten’ „durch eine unsichtbare Grenzlinie von der respektablen Mitte getrennt, die gemeinhin als Linie der Respektabilität bezeichnet wird“ (Vester et al. 2001: 245). Diese Formen des ‚moralkapitalbasierten’, habituellen ‚Ethos’ sind empirisch vor allem für die ‚aufstiegsorientierten Milieus’ des ‚modernen Mainstreams’ sowie die Klassenmilieus des ‚traditionellen Mainstreams’ charakteristisch (vgl. Köhler 2001, Vester et al. 2001), d.h. jenen ‚respektablen’ Gruppen, die an ihrem ‚unteren’ Ende den ‚Unrespektablen’ sozialtopologisch am nächsten stehen. Folgt man den Ausführungen Bourdieus, dient der Lebensstil der unteren Klassen, vor allem für das Kleinbürgertum als ‚Negativfolie’, auf die man sich nur bezieht, um sich symbolisch davon abzusetzen (vgl. Bourdieu 1982, Krais/Gebauer 2002, Vester et al. 2001, Weiß et al. 2001). Die symbolische Grenzziehung über ‚moralisches Kapital’ ist dabei in ihren praxislogischen Auswirkungen oft nicht weniger rigide, als eine Grenzziehung durch ‚legales Kapital’. Mehr noch sind diese moralkapitalbasierten Grenzziehungen von Respektabilität und Unrespektabilität häufig selbst die gesellschaftliche Basis für die Etablierung strafjustizieller Grenzziehungen. Es ist empirisch weitgehend unstrittig, dass es „weniger die herrschenden Klassen, bzw. ökonomisch und politisch einflussreiche Eliten sind, die ihre Positionen bedroht sehen und sie mittels des Strafrechts erhalten oder restaurieren wollen, als dass vielmehr der politische Druck seitens der Mittelschichten […] zur Eskalation von strafrechtlichen Kontrollen führen kann” (Karstedt 1996: 48, vgl. Hagan 1993, Waldmann 1979) Während – zumindest in ‚entwickelten’ Gesellschaften - wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Führungsgruppen ihre Macht- und Ressourcenkämpfe in der Regel - schon „außerhalb des Politikfeldes Strafrecht austragen“ (Waldmann 1979: 112), sind es insbesondere die normativen Abgrenzungen der unteren und absteigenden Mittelklassen, die vor dem Hintergrund von Gefühlen der ökonomischen In einer internationalen Vergleichstudie in Australien, West-Deutschland, Norwegen und den Vereinigten Staaten, zeigen die Daten von Matheson und Wearing (1999: 145) deutlich auf, dass „the unemployed across the four countries are having the strongest opinions of all labour force categories on state intervention on employment, basic incomes and a progressive tax: fundamentally strongly supportive of increased public spending on welfare and greater levels of state intervention to secure incomes and jobs”. 86 69 Unsicherheit und Identitätskrisen, als Teil des Versuchs, den Anschluss und die Zugehörigkeit an den respektablen Teil der Gesellschaft nicht zu verlieren, auf der Ebene des Symbolismus die eigene moralische Selbstbeschränkung vorantreiben und den Anspruch auf symbolische Legitimität der eigenen Praxis durch die moralische Degradierung der unteren und untersten Klassen zusätzlich verdeutlichen (vgl. Young 2001: 200f). So führt Svend Ranulf bereits 1938 aus, dass „[d]ie unvoreingenommen erscheinenden Bemühungen, Strafe auszusprechen […] bezeichnende Charakteristika der unteren Mittelschicht [seien], das heißt einer sozialen Schicht, die unter Bedingungen lebt, die ihre Mitgliedern in außergewöhnlich hohem Maße zu Einschränkungen zwingt und sie so einer hohen Frustration natürlicher Bedürfnisse aussetzt” (Ranulf 1964: 198, Young 2001: 201) Auch die Untersuchungen von Sigfried Lamnek (2000) über ‚soziale Devianz’ können als eine implizite Bestätigung der These einer geringeren ‚moralischen’ Delegitimierung von Praktiken betrachtet werden, die mit ‚objektiven’ Interessen des kleinbürgerlichen Klassenmilieus in Verbindung stehen. So werden Fragen von ‚Steuerhinterziehung’ und ‚Schwarzarbeit’ - eine Form der Devianz, die in den eingebrachten Leistungen ihren Ausgang findet - in der Regel als weit weniger verwerflich betrachtet als ‚Sozialhilfebetrug’ - eine Form von Devianz, die in eingeforderten Rechten von eher subdominanten Gruppen ihren Ausgang findet. Moralisches Kapital ist also nicht nur ein Machtmittel zur Normsetzung und Normdurchsetzung, sondern auch ein Instrument der ‚lebensweltlichen’ Legitimierung der je eigenen Handlungsweise und damit zugleich der Abwehr bzw. Neutralisierung von Kriminalisierungsversuchen (zumindest insofern sie mit einer moralischen Degradierung verbunden wären). In diesem Kontext kann auch davon ausgegangen werden, dass es soziale Ungleichheit auf einer materiellen und symbolischen Ebene ist, die die Eliten vor Kriminalisierung schützt, nämlich vor allem dadurch, dass ihre positional exklusiven Stellungen die „Voraussetzungen für die Delegitimierung von Normen, neutralisierende Legitimationsstrategien oder die Dehnung von Werten [darstellen, die…] keineswegs nur typisch für eine ‚Subkultur der Armut’ (vgl. Miller 1971) sind: Eliten können sich eben in jeder Hinsicht mehr erlauben als der Rest der Gesellschaft“ (Karstedt 2001f: 127). In diesem Sinne hat ‚moralisches Kapital’ zwei Funktionen: Zum einen ist es ein legitimatorisches, symbolisches Machtmittel der eigenen feldspezifischen Strategien. Zugleich ist es durch den Gebrauch ‚moralischen Kapitals’ möglich, die in ‚pluralisierten’ Klassengesellschaften per se erweiterten Zugänge in verschiedenen gesellschaftlichen Felder und in diversen (sub)kulturellen Verortungen, insbesondere gegenüber subhegemonialen Gruppen, an praxislogisch implizite, gleichwohl aber durchaus rigide ‚Konformitätskontrollen’ zu koppeln, die sich nicht nur an Fragen der Legalität, sondern vor allem auch nach den dominanten, kontextual und sektoral symbolisch durchgesetzten, partikularen Standards innerhalb dieser Felder und Gruppen bemessen. Unterteilt man die Organisation des Zusammenhalts gesellschaftlicher Formationen idealtypisch in eher (rechts)staatlich-legalistische und eher zivilgesellschaftlich-kommunitaristisch basierte Formen, so besitzt ‚moralisches Kapital’ in der zweiten Variante eine ungleich bedeutsamere Stellung. Dies führt dazu, dass sich – wie im Verlauf dieser Arbeit noch eingehend verdeutlicht wird - gerade in fortgeschritten liberalen Gesellschaften „die Definition abweichenden Verhaltens zusehends von klaren strafrechtlichen Normen ab[koppeln und …] sich stärker an eher diffusen Vorstellungen von sozialer Normalität” (Kreissl 1997: 536) orientieren. Denn ‚moralisches Kapital’ bezieht sich nur mittelbar auf 70 die, dem Begriff nach allgemeinverbindlich gefasst Frage der Legalität, aber unmittelbar auf die kontextuale, sektorale und feldspezifisch partikulare Frage der Legitimität einer Praxisform. Unmittelbarer als in Prozessen formaler Kriminalisierung, ist moralisches Kapital bei Prozessen praktischer Delegitimierungen wirksam und ‚vernünftig’: nämlich für das aufstiegsorientierte Kleinbürgertum in seiner Orientierung nach ‚oben’ und – vor allem vor dem Hintergrund einer weitreichenden Prekarisierung (vgl. Bourdieu 1998a) sozialer Positionen - für das im Abstieg begriffene Kleinbürgertum in seiner Abgrenzung und seinem symbolischen Statuserhalt nach unten. Während es auch im Kontext einer formalen Kriminalisierung, vermittelt über die „macht- und interessengestützte Politik kollektiver Akteure, ihre politischen Ressourcen und institutionalisierten Handlungsmöglichkeiten” (Groenemeyer 1999: 66,) ungleiche Möglichkeiten der Einflussnahme auf die staatlichen Zentren der Macht gibt, hat die in modernen Rechtsstaaten einigermaßen formaldemokratisch legitimierte Monopolisierung symbolischer Macht und der mit der staatlichen Enteignung von Konflikten (vgl. Christie 1977) verbundene Vorrang des Rechts vor der Moral, bei aller Interessen- und Machtabhängigkeit des (Straf)Rechts im einzelnen, für die subdominanten Gruppen nicht nur eine ‚unterdrückende’, sondern auch eine nicht zu unterschätzende schützende Funktion. Legales Kapital ist zwar – in Bezug auf seine Exekutierung - ein staatlich monopolisiertes Machtmittel, aber zugleich ein kollektives Gut, das sich auf der Seite der Akteure in Form von verbürgten Rechten realisiert. Es sind entsprechend auch weniger die ‚alltäglichen’ Prozesse informeller Sozialkontrolle, die ohne den ,moralischen Überschuss’ bzw. die ,moralische Degradierung’ auskommen, die für das Strafrecht (tatsächlich oder vermeintlich) kennzeichnend sind (Cremer-Schäfer/Stehr 1993, kritisch: Karstedt 1995), sondern umgekehrt sorgt das monopolisierte und universalisierte ‚legale Kapital’ rechtsstaatlicher Demokratien - unabhängig von seiner ‚absichtsvollen Zufügung von Leid’ (vgl. Christie 1986) und seiner Feststellung von ‚Schuld’, (die ohne Zweifel ein ethischer Makel ist vgl. von Hirsch 1996) - für eine relative ‚Entmoralisierung’ des (prozessualen) Umgangs mit Non-Konformität (vgl. bereits Nietzsche 1999 [1887]). Für diesen ,Mangel’ z.B. an gemeinschaftsfördernden Ritualen und an Erzeugung von Scham und Reue – einem Kerngehalt der Reaktion auf Verstöße gegen moralische Imperative (Tugendhat 1993) - auf Seiten des Täters, ist das Strafrecht schließlich auch kritisiert worden (vgl. Braithwaite 1989). Die Rationalisierung, Systematisierung, Prozeduralisierung und Professionalisierung des Umgangs mit Abweichung auf der Basis von legalem Kapital, sorgt zumindest im Vergleich zum spontanen, nicht formal geregelten, ‚lebensweltlichen’ Umgang mit Non-Konformität, ‚Un-Moralität’, Schädigung und Handlungsweisen, die den eigenen Interessen widersprechen, für eine relative Ent-Emotionalisierung. Eine Zurückdrängung der Emotion durch Recht ist eine der zentralen Beobachtungen Max Webers (vgl. 1980). Wenn Recht überhaupt Moral reflektiert, so kann diese, aufgrund der Konstitutions- und Geltungsbedingen des Rechts87, logisch nur als eine ‚kontraktualistische Moral’ verstanden und wirksam werden. Im Hinblick auf eine solche ‚kontraktualistische Moral’ lässt sich argumentieren, dass 87 D.h. nicht zwangsläufig aufgrund des Charakters dieser Moral selbst. 71 der Raum der ‚Moralisierungen’ systematisch zugedacht wird verhältnismäßig gering ist. Der Philosoph Ernst Tugendhat spricht davon, dass eine „Verpflichtung innerhalb dieses Systems [… kontraktualistischer Moral] nur durch äußere Sanktionen aufrechterhalten [wird. E]ntsprechend beruht es nicht auf einer Bewertung […,die mit den] Wörter[n] ‚gut’ und ‚schlecht’ [… vorgenommen wird], und es gibt keinen Raum für Empörung (oder Scham)“ (Tugendhat 1993: 44). Dieses Argument ist freilich eher systematisch als empirisch stichhaltig. So kann davon ausgegangen werden, dass Emotionen auch in den formalisierten Prozessen eine beachtliche Rolle zukommt (vgl. Karstedt 2002) und vor allem zeitgenössisch international von einer deutlichen – wenngleich widersprüchlichen - Tendenz zu einer ,re-emotionalization of law’ gesprochen werden kann (vgl. Laster/O’Malley 1996). Gleichwohl ist die relative Ent-Moralisierung in der Beurteilung von Abweichung durch das legale Kapital des (Straf-)Rechts nicht zuletzt dem Moment der ‚Ent-Emotionaliserung’ geschuldet. Wie Susanne Karstedt (2002:306) argumentiert, sind Emotionen, bzw. genauer ‚moral sentiments’, „neither constitutive nor a motivation for moral action, but are attached to a moral principle and judgement (see Nunner-Winkler, 1998). This is essentially the position of Durkheim, that strong moral sentiments indicate strong moral norms, and reinforce these norms following their violation.” Tatsächlich sind es vor allem die Arbeiten Emile Durkheims, auf deren Basis sich argumentieren lässt, dass das Maß, in dem in dem in dem Abweichung vor allem moralkapitalbasierte Gruppennormen reflektiert, die Varianz und Bandbreite tolerierter Handlungen sowie die Reaktion auf die Unterbietung symbolischer Standards eng zusammenhängen. So fragwürdig die von Durkheim (1977) vertretene These von einer tendenziellen Ablösung eines repressiven und moralisch expressiven (Straf)Rechts segmentärer Gesellschaften durch ein primär resititutives (Straf)Recht in arbeitsteilig ausdifferenzieren Gesellschaften im einzelnen auch empirisch sein mag, in einem zentralen Punkt weist sie bestechend scharf in die richtige Richtung: Wenn es – wie in Durkheims Rede von segmentären Gesellschaften – darum geht Ordnungsbildung und Integration über einen ‚segmentären’ Common Sense im Sinne gemeinsam geteilter Werte, Glaubensvorstellungen, Perspektiven, Beurteilungsschemata etc. zu erzeugen, dann tendiert die Reaktion auf Non-Konformität, d.h. auf die Abweichung von diesem Common Sense, dazu, die moralischen Grenzen der Gemeinschaft expressiv zu symbolisieren (vgl. Groenemeyer 2001). Diese Voraussetzung ist in modernen Gesellschaften im Falle einer Unterbietung feldspezifischer Normen, die auf moralischem Kapital basieren, der Tendenz nach deutlicher gegeben, als im Falle einer Unterbietung von Normen, die auf legalem Kapital basieren und über verschiedene Felder und Akteure hinweg auf die gesamte, ausdifferenzierte Gesellschaft hinweg universalisiert werden. Es lässt sich demnach argumentieren, dass eine Aufwertung ‚moralischen Kapitals’ gegenüber dem ‚legalen Kapital’ der Tendenz nach zu einer schärferen Reaktion auf Abweichung führt. Die Stärkung einer ‚dezentralisierten’ ‚Gemeinschaftsorientierungen’ von Institutionen und ein stärkerer Gebrauch des Strafrechts stellen demnach keinesfalls einen Widerspruch dar – im Gegenteil. Darüber hinaus begrenzt eine institutionalisierte Verallgemeinerung durch legales Kapital zugleich das Maß, in dem sich die Definition abweichenden Verhaltens und sozialer Probleme direkt an diffusen, willkürlichen, partikularen, (klassen-)interessegebundenen, sektoral hegemonialen Vorstellungen des Guten, Richtigen, Angemessenen und Normalen orientierten kann. 72 Dabei ist anzunehmen, dass keinesfalls alle, wohl aber die Mehrheit der Handlungen, die durch legales Kapital entlizenziert sind, in der Mehrheit der Felder auch durch moralisches Kapital delegitimiert sind. Andererseits ist anzunehmen, dass insgesamt wesentlich mehr Praxisweisen zumindest in einzelnen Feldern durch moralisches Kapital delegitimiert sind als durch legales Kapital ent-lizenziert bzw. verboten sind. Je stärker sich ‚Kontrolle’ an feldspezifischem ‚moralischem Kapital’ ausrichtet, so lässt sich dann argumentieren, desto mehr – im Prinzip nicht verbotene – Handlungen geraten in den Fokus sozialer Kontrolle, während zumindest ein Teil der im legalen Sinne untersagten Handlungen aus dem Kontrollfokus rückt. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass sich nicht nur das Strafrecht, sondern vor allem auch ein praxislogisch wirksames und moralkapitalbasiertes Konzept der Devianz in Form habitusbezogener Delegitimierungen in erster Line gegen relational subdominante und marginalisierte Gruppen richtet. Wenn ‚moralisches Kapital’ ein feldspezifisches Machtmittel ist, das zur Legitimation der eigenen ‚Spielzüge’ zur Verbesserung der eigenen positionalen Stellung und zur Abgrenzung nach ‚unten’ im Sinne einer Delegitimierung subdominanter Praxisformen verwendet wird, so erscheint es auf dieser Basis möglich, die ‚Armutsthese’ der klassischen, ‚ätiologischen’ Ansätze in der Kriminologie – d.h. die These eines ein mehr oder weniger direkten Zusammenhangs von Armut bzw. Marginalität und Abweichung (kritisch: Lindenberg/Kunstreich 1997) – zu reinterpretieren. Empirische Befunde sprechen zwar dafür, dass es einen Zusammenhang Armut und Abweichung gibt. Nur ist dieser deliktspezifisch (vgl. Kelly 2000) und dabei keinesfalls immer nur positiv - wie etwa im Falle bestimmter Gewaltdelikte (vgl. Baily 1984, Braithwaite 1979, Blau/Blau 1982, Messner 1989, Pfeiffer/Ohlemacher 1995, Krivo/Peterson 1996, zusammenfassend: Crutchfield/Wadsworth 2002) -, sondern - wie etwa im Falle bestimmter Eigentumsdelikte - auch durchaus negativ (vgl. Karstedt 1996, Hagan 1988, Felson 1998, Ruggiero 2001). Was sich demgegenüber jedoch eindeutig feststellen lässt ist ein deutlicher und positiver Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Heterogenisierung und einem „Zuwachs der per PKS [Polizeiliche Kriminalstatistik] gemessenen Kriminalität“ (Ohlemacher 2000: 222) insgesamt. So besteht eine zentrale Erkenntnis, die aus der Korrelation aggregierter sozialer und ökonomischer Faktoren und Abweichung gewonnen werden kann, darin, dass Gesellschaften, die sich durch die höchsten Ausmaße sozialer Ungleichheit - ‚relative Deprivation’ – auszeichnen88, ceteris paribus der Tendenz nach auch durch die höchsten ‚offiziellen’ – d.h. registrierten – Gesamtraten von Kriminalität und Abweichung gekennzeichnet sind (vgl. UN World Crime Report 1999, European Crime Prevention Sourcebook 2001, Currie 1997, Downes/Rock 1998, Hope 2001, Lea/Young 1996). Vor dem Hintergrund dieser sich scheinbar widersprechender Daten ist die Annahme plausibl, dass „the significance of inequality as a determinant of crime […] may be due to unobserved factors affecting simultaneously inequality and crime rather than to some causal relationship between these two variables” (Bourguignon 1998: 2). Dabei lässt sich der Widerspruch eines insgesamt sehr mäßigen und eher deliktspezifischen und qualitativen statt unspezifischem und quantitativen, kausalen Zusammenhangs zwischen der Schichtzugehörigkeit, Armut, Arbeitslosigkeit und der ‚Kriminalität’ der 88 Es sind also weniger die Gesellschaften mit einem niedrigen Pro-Kopf Einkommen, Bildungsstand etc. (vgl. UN 1999) 73 Akteure (vgl. Hagan 1993, Albrecht/Howe 1992, Land et al. 1995, Kleck/Chiricos 2002, Schumann et al. 2003) und dem relativ deutlichen Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und der Gesamtkriminalitätsrate dann aufhellen, wenn eine Analyse nicht nur auf unterschiedliche Lebenslagen, Schichtungen und topologische Statusordnungen zielt, sondern vor allem die damit verknüpften, je feldspezifischen Machtbeziehungen und symbolischen Kräfteverhältnisse – inklusive der Kontrollstrukturen und der Möglichkeit der ‚Abwehr’- und modifikativer Beeinflussung der Reaktionen auf die Unterbietung legal- wie moralkapitalbasierter Verhaltensimperative - systematisch beachtet werden (vgl. Hagan 1988, Karstedt 1996, Ruggiero 2001, Schumann 2002). Der Zusammenhänge von Armut bzw. Subdominanz und (der Reaktion auf )Abweichung erscheint dann weniger widersprüchlich, wenn in Betracht gezogenen wird, dass die Problematisierung von und Reaktion auf Abweichung nicht zuletzt das Maß fokussiert, in dem eine praxislogische Inkorporierung eines spezifischen Habitus – und die Form seiner handlungspraktischen Realisierung – sowie die Ausstattung mit ‚symbolischen Ressourcen’ mit den Regelmäßigkeiten, symbolischen Gültigkeitsansprüchen und den Modi der Durchsetzung dieser Geltungsansprüche in einer (feld-) spezifischen Praxis korrespondiert. Während demnach die Unterstellung eines geradlinigen Zusammenhangs von Schicht und Devianz der Tendenz nach eher irreführend als erhellend ist, kann, wie Susanne Karstedt (1996), in ihrem Versuch um eine ‚kritische Ätiologie’ der Abweichung in Anlehnung an die ‚control-power-theory’ Hagans (vgl. 1988) ausführt, von einem wesentlich stärkeren Zusammenhang zwischen der Varianz von Devianzraten und dem eigenen Status teils klassenförmig, teils idiosynkratisch bestimmter ‚sozialen Milieus’ ausgegangen werden. Die Binnenstruktur der materiellen und symbolischen Lebenslagen und ‚sozio-moralischen’ ‚Klassenmilieus’ (vgl. Vester et al. 2001) sind dabei wesentliche Momente für die Herausbildung eines, der sozio-ökonomischen Lage bzw. der Klasse entsprechenden feld- und klassen- bzw. klassenmilieuspezifischen ‚Kontrollhabitus’, der maßgeblich ist für das Ausmaß, die Art und die ‚Effektivität’, in dem Abweichungen – der Akteure unterschiedlicher Gruppen - gemäß der praktisch-symbolischen Logiken der Felder bearbeitet bzw. an formelle Instanzen überstellt werden. Der ‚Kontrollhabitus’ bezeichnet demnach die „Praxis der Normdurchsetzung unter je spezifischen Macht- und Herrschaftsbeziehungen. Der Erfahrungszusammenhang innerhalb eines sozialen Milieus produziert dann eben auch […die in diesem Falle feld]spezifischen Kontrollstile. Entsprechend variiert der Kontrollhabitus nicht alleine mit der hierarchischen gesellschaftlichen Gliederung sondern ebenso mit horizontaler Differenzierung […]. Auf diese Weise ergeben sich Unterschiede in den Kriminalitätsbelastungen der verschiedenen Minoritäten“ (Karstedt 1996: 63) Diese Unterschiede sind entsprechend ein Merkmal und Produkt der den strukturellen sozialen Positionierungen entspringenden (feld)spezifischen Machtrelationen und - diese reflektierend - der Herstellung symbolisch stabilisierter, sozialer Regelmäßigkeiten und Regulationsversuche innerhalb feldspezifischer Kräfteverhältnisse. II. 3 DELEGITIMIERTE DISPOSITIONEN, ‚DAS SOZIALE’ UND DIE JUGENDHILFE Während das ‚Konzept der Kriminalität’ für die Problembearbeitungsrationalität der Jugendhilfe durchaus Relevanz besitzt, kann davon ausgegangen werden, dass das ‚Konzept der Devianz’ und die damit einhergehende Frage einer Delegitimation von Habitus für die Interventionslogiken der 74 Jugendhilfe - als eine nicht primär in Relation zum Strafrecht verfasste Institution - eine ungleich gewichtigere handlungspraktische Bedeutung besitzt. Im weitesten Sinne stellen ‚deviante’ Akteure aus der Perspektive Sozialer Arbeit einen möglichen Fall jener ‚Schattenseiten’ gesellschaftlich einflussreicher Ordnungsentwürfe dar (vgl. Baumann 1995, Mollenhauer 1994), mit dem sich auch die Jugendhilfe als eine mögliche Antwort auf „Problem[e] der Lebensführung in modernen Gesellschaften“ (Scherr 2002: 35) und mit Blick auf die Gefahr des ‚Misslingens’ einer Sozialisation in einer gesellschaftlich oder persönlich befriedigenden Form befasst89 (vgl. Giesecke 1991). Das Vorgehen der Jugendhilfe erfolgt dabei in einer Weise, die sich „nach Aufgaben der materiellen Lebenshilfen, der sozialen Erziehung und Bildung im Allgemeinen und nach einer kompensatorischen Erziehung, Beratung und sozialen Therapie in besonderen Mängel- und Notlagen zusammenfassen [lässt]” (Dewe/Otto 1996: 15). Die Jugendhilfe selbst erscheint also als ein Moment der öffentlichen Gestaltung von Lebensformen (vgl. Otto/Karsten 1996: 10), die als eine spezifische Form der „Führung von Menschen“ (vgl. Lemke et al 2000: 10) mittels einer generativen Koordinierung von Selbst- und Fremdführungsweisen - „conduct of conduct“ (Foucault 1980: 119) - im Entwicklungsprozess vergesellschafteter Subjekte verstanden werden kann. Jugendhilfe ist in so fern als eine (mögliche) Form dessen, was Michel Foucault als ‚Regierung’ thematisiert (dazu: Kessl 2003, Kessl/Otto 2003, Kessl/Ziegler 2003, Ziegler 2003). Wenn Foucault (1993a: 203) von Regierung - als einer Technologie der Macht spricht - hat er vor allem den „contact point” im Blick „where the individuals are driven by others is tied to the way they conduct themselves”. Ein solcher Begriff der Regierung bezieht sich daher nicht nur auf „political structures or to the management of states; rather, it designate[s] the way in which the conduct of individuals or of groups might be directed - the government of children, of souls, of communities, of families, of the sick. It cover[s] not only the legitimately constituted forms of political or economic subjection but also modes of action, more or less considered and calculated, that […are] destined to act upon the possibilities of action of other people. To govern in this sense, is to structure the possible field of action of others” (Foucault zit. nach Simon 2002: 7f) Dieser Regierungsbegriff reduziert sich demnach nicht auf Fragen institutionalisierter Herrschaftsformen moderner Staatlichkeit, sondern bezieht sich auf „die unterschiedlichsten Formen der Führung von Menschen“ (Lemke/Krasmann/Bröckling 2000: 10) und Einflussnahmen auf die Selbststeuerung der Akteure, die von staatlichen Zwangs- über ideologische ‚Apparate’ (vgl. Althusser 1977) bis hin zu den ‚Selbsttechnologien’ (vgl. Lemke 2002) reichen und demnach die „Gesamtheit der Institutionen und Praktiken [… und] von Prozeduren, Techniken, [und] Methoden, […] von der Verwaltung bis zur Erziehung […umschließt,] mittels deren man die Menschen lenkt […und] welche die Lenkung der Menschen untereinander gewährleisten“ (Foucault 1996b: 119). Mit einem Verständnis von Jugendhilfe als ‚Regierung’ ist eine Regierungsform in der Blick genommen, die gerade nicht auf ‚totale’ Kontrolle und Unterwerfung zielt, sondern, mit Bourdieu gesprochen, auf positionale, dispositionale und symbolische Strukturierung des Möglichkeitsraums ‚regierter’ Akteure. Dabei entspricht es der spezifischen ‚Regierungsrationalität’ der Jugendhilfe sich gemäß eines - eher die feldspezifischen ‚Ökonomien der Praxis’ reflektierenden, als für den gesamten sozialen Raum In den Worten Hermann Nohls (1963: 11) geht es um „soziale, sittliche und geistige Not“, d.h. positionale wie dispositionale Aspekte der Lebensführung. 89 75 verbindlich definierten - symbolischen Kriteriums des ‚Gelingens’, auf eine die Logiken der Privatheit (‚the civil’) und der Öffentlichkeit (‚the civic’) verknüpfenden Form der Lebensführung der nachwachsenden Generation zu richten. Als Referenzgröße für ein Ge- oder Misslingen dient demnach nicht ein als gültig typisierter gesellschaftlicher bzw. in ‚legales Kapital’ geronnener, sondern auch der je feldspezifisch wirksame, durch die Praxis der Akteure selbst konstituierte ‚Common Sense’. In der Regierungsrationalität der Jugendhilfe, eine gesellschaftlich normalisierende Antwort auf Defizite und Probleme einer kulturell vermittelten Lebensführungspraxis junger Menschen zu geben (vgl. Gildemeister 1995, Scherr 2002), stellen symbolisch ‚delegitimierte’ Akteure, die jene gültigen Referenzgrößen ‚unterboten’ haben, in doppelter Hinsicht typische Adressaten dar: Als organisierte Hilfe (vgl. Bommes/Scherr 2000: 13) reagiert die Jugendhilfe auf diese Akteure - und in aller Regel durchaus auch in deren Interesse -, sofern sie je nach ‚professionalisierungstauglicher’ Begründung und Definition (vgl. Peters 1995), bezüglich ihrer gesellschaftlichen Position und ihrer (mangelnden) Kapazitäten, in dieser Position ‚vernünftige’ Handlungspraxen und Daseinseinsweisen zu entwickeln90, als ‚hilfsbedürftige’ bzw. ‚wahrscheinlich hilfsbedürftige’ Individuen darstellen. Jugendhilfe reagiert auf diese ‚Hilfsbedürftigkeit’91 durch den Versuch der „Sicherung, [… und] Rekonstruktion“ einer solchen Form gesellschaftlich figurierter „Subjektivität dort, wo sie durch Eigenschaften des nichtgenetischen Erbes gefährdet und beschädigt wurde” (Winkler 1988: 121). In einer professionsadäquaten Deutung erscheint die ‚Hilfebedürftigkeit’ von Akteuren der nachwachsenden Generation mithin als der Bedarf an Vermittlung oder Ermöglichung legitimer Formen sozialer Teilhabe und einer gleichzeitigen Hervorbringung einer dadurch ungefährdeten Form der ‚Identität’. Dies geschieht mittels des Versuchs einer Generierung von Habitus, d.h. als gezielte Beeinflussung der gesellschaftlich vermittelten ‚Subjektwerdung’ der individuellen Akteure, die als ‚Selbsttechnologien’ des Subjekts (vgl. Foucault 1993) ihrerseits um die mehr oder weniger permanente Auseinandersetzung hinsichtlich der zahlreichen Aspekte des ‚richtigen’, ‚guten’, ‚erstrebenswerten’ oder ‚gelingenden’ Lebens, als ‚normale’ Lebensweisen und Regelmäßigkeiten der sozialen Milieus und der gegebenen gesellschaftlichen Formation zirkulieren. Es ist dieser Fokus der jugendhilfetypischen ‚Regierungsrationalität’, der die Jugendhilfe als eine Instanz sozialer Kontrolle kennzeichnet, die nicht nur auf eine Unterdrückung von ‚Devianz’ zielt, sondern vor allem auf die Ermöglichung stabiler Lebensformen (vgl. Fraser 2003, Janowitz 1976, Schluchter 1979, Japp 1985). Das von der Jugendhilfe im Rekurs auf Fragen der Unterstützung einer ‚gelingenden’ ‚Subjektwerdung’ zu bearbeitende Problem der Einschränkungen sozialer Teilhabemöglichkeiten - im Sinne struktureller Benachteiligungen in sowie im Sinne einer Verwährung des Zugangs zu praxislogisch relevanten sozialen Feldern - lässt sich mit einem Mangel ihrer Adressaten an feldspezifisch wirksamen - bzw. einem Verfügen oder gar Überschuss an ‚falschen’ - materiellem, sozialen, kulturellen und symbolischen Kapitalen in Verbindung bringen. Diese Mängellagen werden als soziale, bzw. als sozial induzierte, personale Problemlagen von Sozialpolitik und sozialer Arbeit bearbeitet, sofern sie mit dem Und das heißt zugleich bezüglich ihrer gesellschaftlich und feldspezifisch realisierten Teilnahme- und faktischen Teilhabemöglichkeiten. 91 Zum Problem der Bestimmung von ‚Hilfsbedürftigkeit’ siehe Brumlik (1984), Brumlik und Keckeisen (1976) 90 76 besonderen ‚Feld des Sozialen’ (bzw. dem ‚field of welfare’ vgl. Peillon 1998) in Verbindung gebracht werden. Dieses durch besondere Institutionen, Logiken, Regelmäßigkeiten und symbolische Gültigkeiten gekennzeichnete ‚Feld des Sozialen’ ist eng verbunden, wenngleich nicht identisch mit jenem figurativen Raum den Jacques Donzelot (1980) und Gilles Deleuze (1980) als ‚das Soziale’ bezeichnen. Während ‚das Soziale’ auf die besonderen ‚Regierungsweisen’ einer bestimmten historischen gesellschaftlichen Formation verweist, findet sich das ‚Feld des Sozialen’ als ein Feld „within th[is] broad field of social formation, but it also constitutes a differentiated domain of activity. The differentiation of the welfare field is manifested by the configuration of agents which operate within it, the resources which are mobilised, and by the stakes around which struggles develop” (Peillon 1998: 225). Das ,Feld des Sozialen’ lässt sich demnach als ein relativ autonomes, von anderen Feldern wie etwa dem der ‚Kriminalitätskontrolle’ unterscheidbares Kampffeld betrachten, das auf die dynamischen Logiken der Wohlfahrtspraktiken – und die Habitus der Handlungsträger dieser Praktiken - innerhalb jenes besonderen Raumes verweist, den ‚das Soziale’ beschreibt. Die Existenz ‚des Sozialen’ ist insofern eine übergreifende makrosoziale Bedingung für das mikrosoziale ‚Feld des Sozialen’. Dabei ist ‚das Soziale‘ selbst nicht als eine zeitlose Existenzform zu verstehen, die auf die Tatsache menschlicher Sozialität verweist92. Vielmehr bezeichnet und generiert die strukturierte und strukturierende Logik des Soziale eine bestimmte Form um in einer spezifischen, historischen Figuration einer modernen, nachmetaphysischen, regulatorisch bzw. politisch ‚geschaffenen’ Ordnung menschlichen Zusammenlebens, die „innerhalb eines eingegrenzten geographischen und zeitlichen […Raums] die Bedingungen, [generiert] unter denen die intellektuellen, politischen und moralischen Instanzen und Institutionen der Menschen an bestimmten Orten und in spezifischen Zusammenhängen über ihre gemeinsame Erfahrung nach[denken] und auf sie Einfluss” zu nehmen (Rose 2000: 75). ‚Das Soziale’ lässt sich in so fern als eine „politische Positivität“ (Ewald 1987: 6) und spezifische Organisationsform von Gesellschaft (Donzelot 1994) verstehen, die auf die Möglichkeit einer besonderen, voraussetzungsvollen Rationalität des Regierens über den gesellschaftlichen Raum verweist. Auf seiner operativen Wissensebene ist ‚das Soziale’ eine Form des Regierens – eine spezifische Elaborierung jenes Arrangements von Technologien und Denkweisen, die Foucault als ‚Bio-Politik’ bezeichnet hat (dazu: Hewitt 1983) -, die eng mit dem Aufstieg der Sozialwissenschaften verknüpft ist (vgl. Evers/Notwotny 1987, Ewald 1993, Wagner 1990). Vor allem mit der Entwicklung der Sozialstatistik, die einen Einblick in den „objective, scientific knowledge, part of a world [eröffnet] in which both the social and the natural may be measured, calculated and therefore predicted” (Kampshall 2003: 7), werden die speziellen Wissensbestände Es ist nicht zumindest nicht ausschließlich das ,Soziale’ im Sinne der Doppelbedeutung von dem ,Gesellschaftlichen’ und dem ‚menschlichen Interaktionsprozess’ gemeint, das, wie etwa bei Max Weber oder Emile Durkheim, auf eine ‚objektive’ Existenzform verweist die von dem ‚Individuellen’, dem ‚Natürlichen’ oder dem ‚Physikalischen’ abgrenzbar ist und damit zugleich auch das Feld der Soziologie als Wissenschaft beschreibt (vgl. Weber 1980, Durkheim 1976). 92 77 bereit gestellt, die es ermöglichen eine gesellschaftsregulatorische ‚Politik der großen Zahl’ in einer rationalisierten systematisierten Form zu etablieren (vgl. Desrosières 1993, T. Porter 1995). Mit der ‚Geburt’ dieser neuen Wissensbestände ist eine notwenige Voraussetzung beschrieben, die die ‚Entzauberung’ des prä-modernen Rekurses auf das rein Zufällige, Schicksalhafte oder göttlich Gewollte ebenso ermöglicht, wie eine Relativierung und Erweiterung des frühmodernen Bezugs auf den freien Willen, durch den die Akteure zunächst als rein individuelle, nur ihrer Rationalität unterworfene Handlungsträger in Erscheinung treten und durch den das Schicksalhafte in individuelle Schuldzurechnung und Verantwortung moduliert wird. Die frühmoderne, aufklärerische Welterklärung trägt zwar dazu bei, das „liberale Credo […des] freien Wettbewerb[s] an die Stelle von Gottesurteil und Gottesgnaden“ zu setzen (Muschg 1977: 153), und bleibt auch in der Folge ein inhärent zentraler Bestandteil einer bürgerlich-kapitalistischen Ordnung (vgl. Sünker 2003), aber sie steht zugleich vor dem Problem der Erklärung und damit der systematischen Bearbeitbarmachung regelmäßig wiederkehrender ‚problematischer’ sozialer Phänomene (dazu Quetelet 1921 [1869]) in einer zunehmend arbeitsteiligen und d.h. immer stärker in überindividuelle Verweisungszusammenhänge einander unbekannter Akteure überführten, modernen Welt immer weniger tauglich zu sein. Kurz, die moderne Welt steht vor dem permanenten Problem jener Frage, die den Raison D'Être der Sozialwissenschaften darstellt: ‚Wie ist soziale Ordnung möglich?’ Mit dem Aufstieg der Sozialwissenschaften, tritt dem liberalen Erklärungsmuster eine gezielte und systematisierte Generierung von Wissensbeständen an die Seite, die auch jenseits des Bezugs auf die konkreten, einzelnen, je direkt handlungsverantwortlichen Akteure die Muster und Frequenzen jener Phänomene sichtbar machen kann „that happen regularly enough and often enough in a whole population of people to be broadly predictable, and so insurable” (Kampshall 2003: 7). Basierend auf diesen Wissensbeständen, die sich als eine Grundlage für eine systematische Gestaltbarkeit der Welt und Verfügbarmachung der Zukunft einer widersprüchlichen und fragilen sozialen Ordnung erweisen (vgl. Evers/Nowotny 1987), stellt ‚das Soziale’ eine strukturierte und strukturierende politische Denk- und Handlungsstrategie dar. In diesem Sinne ist das Soziale von Beginn an mehr als nur eine Semantik des politischen Systems, sondern verweist auch auf die Etablierung eines „dichte[n] Gewebe[s] von einander überschneidenden Regelkreisen und Apparaturen zu denen sich Institutionen der sozialen Kontrolle“ zusammenschließen (Fraser 2003: 245) und ein Bündel von Regierungstechniken generieren, um eine spezifische Form von ‚Subjekten’ hervorzubringen93. Dabei lässt sich in so fern von einer ‚neuen’, im genannten Sinne ‚sozialen’ Form der Subjektivität sprechen, wie – was bereits die Arbeiten von Max Weber verdeutlichen - jede Form der „Subjektwerdung des Menschen, also jede Erzeugung von Typen sozialer Individualität […] ei[n] unverrückbare[s] Stück materiellen Zwangs [erfordert], weil es stets wenn nicht der handfesten Disziplinierung, so doch der physischen Präsenz verräumlichter Gewalt bedarf, um ein menschliches Wesen in das entsprechende Netzwerk sozialer Regeln einzuüben“ (Honneth 2003: 24). Mit Peillon (1998: 218) lässt sich davon sprechen, dass „welfare recipients are shaped as individuals through the welfare state”. 93 78 Unter Berufung auf ‚das Soziale‘ geht es nun um genau dies: um einen rationalisierten Versuch, vermittelt durch eine besondere Form koordinierter Strategien, Technologien, Teleologien und ‚Ethiken’ der Bearbeitung von Problemen der gesellschaftlichen Kohäsion, Stabilität und ‚Solidarität’, die auf ‚soziale’ Formen der Gerechtigkeit, Sicherheit, Rechte usw. rekurrieren, den Bestand einer sozialen Ordnung zu sichern, die sich aus dem Ökonomischen alleine heraus nicht aufrecht erhalten kann und die ihrerseits eine ermöglichende Bedingung für eine umfassende, keinesfalls vorraussetzungslose Marktintegration in einer arbeitsteiligen Ökonomie repräsentiert. In einem gewissen Sinne wird damit zugleich der Versuch unternommen dem Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital eine quasisynthetisierende Antwort entgegen zu stellen, die diesen Konflikt in einem gewissen Sinne ‚entpolitisiert’ und die Möglichkeit einer sozialistisch-revolutionären Lösung zugunsten einer ‚solidarische’ Perspektive des Schutzes von beiden zurückdrängt (vgl. Ewald 1991, Defert 1991, Procacci 1994). Mit Blick auf die Struktur der Gesellschaft moduliert das Soziale die Frage von ‚Klassen’ in Fragen ‚sozialer Schichtung’ und die ‚soziale Frage’ in Fragen ‚sozialer Probleme’94. In diesem Sinne bezeichnet das Soziale vor allem eine „kollektive Existenz […] die Menschen in einem sozialen ‚Großraum‘ und seiner Ordnung zusammen[bringt]“ (Karstedt 2003: 3). Dabei tritt an die Stelle der individuellen Zurechnung und der individuellen Schuld, die noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts zentrale Elemente der ‚guten’ gesellschaftlichen Ordnung darstellen (vgl. Groenemeyer 2001, Lemke 1997) zunehmend eine Vorstellung von ‚gesellschaftlicher’ Verantwortung und von Ansprüchen, die gegenüber der ‚Gesamtgesellschaft’ geltend gemacht werden können: „Es erfolgt eine Umstellung des Regulationsmodus vom Prinzip der individuellen Verantwortung zu dem des sozialen Risikos“ (Lemke 1997: 212). Mit dem Sozialen kommt auch der Politik und den politischen, bzw. öffentlichen Sicherheitsversprechen (vgl. Kaufmann 1973) eine neue umfassende Bedeutung zu: den gesellschaftlichen Raum zu gestalten (vgl. Karstedt 2003), wobei in wachsendem Maße spezielle, neu entwickelte Institutionen damit betraut werden, „ausgehend von hinreichend umfassenden und universalistischen Werten di[e] Handlungssteuerung [der sozialen Akteure] sicher[zu]stellen, damit die Individuen sich auf autonome Weise in der Vielfalt von Situationen und Beziehungen orientieren können“ (Dubet 2003: 79). Soziogenetisch lässt sich die Etablierung des Herrschaftsraum ‚des Sozialen’ damit als eine kollektivierende Fortführung eines fundamentalen Veränderungsprozesses der politischen Führung verstehen, der seinen Anfang in dem beginnenden Zerfall der ständisch-feudalistischen Ordnung und den mit der frühen Industrialisierung verbundenen Rationalisierungsprozessen findet. Die ab dem 18. Jahrhundert einsetzenden Rationalisierungen zielen mittels eines systematischen, zunächst jedoch noch vornehmlich auf die einzelnen Individuen ausgerichteten Prozesses der ‚Verfleißigung’ der Herrschaftsunterworfenen auf die Durchsetzung eines ‚industrialisierten Bewusstseins’ (vgl. Dreßen 1982), um über die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen hinweg, möglichst alle Akteure systematisch in eine sich entwickelnde kapitalistische Ökonomie einzubinden Zur Bearbeitung dieser ‚sozialen Probleme’ – nicht aber zur Frage von Lohnarbeit und Kapital - stellt auch Soziale Arbeit eine mögliche Antwort dar. In diesem Kontext wird auch eine systematisierte Form der Jugendfürsorge dadurch ermöglicht, dass ‚Verwahrlosungserscheinungen’ der (sub-)proletarischen Jugend von einem Problem der politischen Ökonomie zu einem Problem der Erziehung werden (vgl. Ferchhoff/Peters 1979). 94 79 (dazu auch: Müller/Otto 1980, Lenhardt/Offe 1979). Wolfgang Dreßen verortet den hegemonialen pädagogischen - aber auch juristischen - Diskurs von Mitte des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts im Kontext einer sukzessiven Zurückweisung einer auf verhältnismäßig dauerhaft etabliertem und direktem Zwang operierenden ‚schwarzen Pädagogik’95. An deren Stelle tritt die Erprobung pädagogischer Konzepte, die zunehmend Fragen der Selbstregulation und ‚Selbstregierung’ der Akteure thematisieren. Die repräsentieren jedoch nicht nur den aufklärerischen Geist der ‚Mündigkeit’, sondern bilden eine unerlässliche Vorraussetzung für eine systematische Erzeugung und Ordnung der immer stärker arbeitsteiligen Entität ‚Gesellschaft’, zur Lösung des permanenten Problems ‚organischer Solidarität’ (Durkheim 1977) bzw. sozialer Koproduktion und Integration der Akteure in wirtschaftliche Produktions- und politische Herrschaftssysteme. In diesem Sinne hat jene Form des Kapitalismus, die sich, „am Ende des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt“ so Foucault (1994b: 209), „als ihr erstes Objekt, den Körper, als Produktionsmittel und Arbeitskraft sozialisiert“. Die ‚pädagogische Maschine’ (Dreßen 1982) des frühen Liberalismus, vor der Geburt des Sozialen (vgl. Donzelot 1991), sucht die ihr unterworfenen Akteure insbesondere mittels der Etablierung von Anstalten - wie sich mit Blick auf die Einrichtung von ‚Zucht-’ und ‚Arbeitshäusern’ aber auch Johan Bernhard Basedows ‚Industrieschulen’ dokumentiert lässt (vgl. Marzahn/Ritz 1984, Sachße/Tennstedt 1980) – zunächst zu ‚Vereinzeln’, und ihren Eigenwillen zu brechen. Dies beschreibt jedoch keinen Prozess despotischer Unterdrückung, sondern einen Versuch der ‚Erzwingung’ einer bestimmten Form der Handlungsfähigkeit, die nur als ein produktives Mittel erscheint um den geordneten Menschen als einen ‚freien’ zu re-etablieren (vgl. Dresen 1982, Foucault 1994). Die Fabrikation ‚gelehriger’ und ‚nützlicher’ Subjekte – im Sinne einer ‚politischen Anatomie des menschlichen Körpers’ (Foucault 1976) - kennzeichnet einen Disziplinarmodus der Herrschaft, der eine wesentliche Grundlage für Etablierung (industrie-)kapitalistischer Produktionsverhältnisse markiert, in dem er zugleich auf die systematische Steigerung der verfügbaren Kräfte des Individual- wie Gesellschaftskörpers zielt und auf ihre Schwächung zum Zwecke einer neuen, von der Feudalherrschaft systematisch unterscheidbaren Form der politischen Unterwerfung (vgl. Foucault 1994). Demgegenüber ist die ‚Entdeckung‘ des Sozialen als eine Sphäre der (administrativ) rationalisierten und systematisierten kollektiven Risikobearbeitung (vgl. Donzelot 1991) - im Gegensatz zu dieser ‚subjektivierenden’ Rationalität einer ‚Verfleißigung’, zu ‚prä-sozialen’ Techniken der Behandlung von Armut etwa in Form der frühbürgerlichen Philanthropie, zur karitativen Barmherzigkeit und Armenfürsorge (vgl. Marzahn/Ritz 1984, Sachße/Tennstedt 1980) aber auch zu der Gewährleistung der ‚guten Ordnung und Sittlichkeit’ sowie des ‚gemeinen Wohls’ durch die (früh)neuzeitliche und absolutistische ‚Policey‘ (vgl. Dinges/Sack 2000, Lüdke 1992, Preuß 1990) - im Kontext der Entwicklung politischer und ökonomischer Bürgerrechte im Kapitalismus (vgl. Ganßmann 2000, Lewis 1998, Marshall 1992) und der Bearbeitung der ‚Sozialen Frage‘ nach der ‚Take-off‘ Phase der Industrialisierung, auf das letzte Drittel des 19. Jahrhundert zu datieren, und seit dem - wenn auch in 95 Michel Foucault (1999) verortet diesen Wandel der ‚Machttechnologie’ bereits im 17. Jahrhundert. 80 sehr unterschiedlicher Intensität und Reichweite (vgl. Esping-Anderson 1990) - den politischen Regimes bürgerlicher Gesellschaften eingeschrieben (vgl. Offe 1984). Die Institutionalisierung des Sozialen - in Form einer Sozial-Staatlichkeit – lässt sich als ein historisch junger Aspekt eines bis zu seinem Zenit im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts immer umfassender werdenden Sicherheitsversprechens verstehen96 (Kaufmann 1973): „In the wake of the ‚discovery of the social’ (Donzelot […1980]), werden in den bürgerlich-kapitalistischen Regimes „the principal objects of rule and the ways of engaging with them […] in terms of a collective social entity [konsituiert] with emergent proprieties that could not be reduced to the individual constituents – or could not be tackled adequately at the level of individuals. Social services, social insurance, social security, and social wage were variously constituted by governments to deal with social problems, social forces, social injustices, and social pathologies through various forms of social intervention, social work, social science, and social engineering. The social appeared as a unified and unifying […] space of rule” (O´Malley 1999: 94). Dieser Herrschaftsraum des Sozialen entwickelt sich zu der vorwiegend innerhalb der territorialen Grenzen einer nationalen Gesellschaft konzentrierten (vgl. Fraser 2003), charakteristischen Organisationsform moderner, industriekapitalistischer Gesellschaften. Für die Organisation dieser Gesellschaftsformationen bzw. für die Hervorbringung einer stabilen, inklusiven und zugleich genügend dynamischen Ordnung der Zusammenhänge von Produktion und Reproduktion, hat dieser verbundene und verbindende (vgl. O’Malley 1999) gesellschaftliche Großraum den entscheidenden Vorteil, dass „die Bereiche der Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, der Sozialarbeit, des Strafrechts, der öffentlichen Gesundheitswesens, der Haft- und Jugendstrafanstalten, der Psychotherapie, der Eheberatung und der Erziehung gegeneinander durchlässig [werden. …: Sie können] sich [alle] aus dem gleichen Vorrat an Rationalisierungspraktiken bedien[en], während sie gleichzeitig ihre je eigenen Varianten einer allgemeinen Grammatik der Governementalität entwickel[n]“ (Fraser 2003: 245). Zugleich war es de facto von Beginn an möglich den für die Akteure handlungsermöglichenden und koordinierenden Raum des Sozialen hierarchisch zu strukturierten und systematisch mit ‚produktiven’, strategisch eingesetzten Techniken formeller bzw. institutionalisierter ‚sozialer’ Kontrolle zu durchziehen, die auf eine ‚Nützlichmachung’ der individuellen wie kollektiven Akteure dieses Raums zielen. Deren Reichweite und Effizienz geht weit über die sichtbaren und zwangsbasierten Elemente des klassisch-liberalen Strafrechts hinaus (vgl. Pavlich 2001, Fraser 2003), dessen Bedeutung zunehmend auf die einer ‚ultima ratio’ Lösung reduziert werden kann (vgl. Sack 1998). Ein wesentliches Charakteristikum der politischen Rationalität des Sozialen ist es dabei, dass eine administrativ erzeugte, kollektive Form der Solidarität über die Betonung individueller Verantwortung gestellt (vgl. Donzelot 1994: 117) wird. Auch wenn dies nie bedeutet hatte die Verantwortlichkeiten des Einzelnen völlig zu ignorieren, sondern die Formierung des Sozialen von Beginn an im Gegenteil mit dem Versuch einhergeht, kooperative und produktive ‚Subjekte’ zu erzeugen, die nicht nur äußerer Autorität, sondern vor allem auch innerer Selbstregulierung unterworfen sind (vgl. Fraser 2003, Zaretsky 1976), so beinhaltet diese Verantwortungsverschiebung eine De-Privatisierung von Risiken. Das Soziale repräsentiert in dieser Hinsicht eine Rationalität, die darauf gerichtet ist, die unterschiedlichen Risiken vor dem Hintergrund ungleicher gesellschaftstopologischer Verortungen und Einbettungen in strukturellen Zusammenhängen in einer mehr oder weniger universalistisch 96 Im Kotau dieses umfassenden Sicherheitsversprechens erweitert der nationalstaatliche Gewaltmonopolist seine machtbasierten Infrastrukturen der Durchsetzung einer Ordnung um geldbasierte (vgl. Scherr 1999: 49). 81 ausgerichteten ‚Sozialbürgerschaft‘ auszugleichen (vgl. Ewald 1993). Anders formuliert: es ist eine institutionalisierte Technologie sozialer Ver- und kollektiver, wechselseitiger Absicherung, die Individuen weniger als eigenverantwortliche Bearbeiter individueller Unsicherheiten, sondern als Teil eines sozialen Kollektivs in den Blick nimmt (vgl. Defert 1991), das Risiken durch eine „constitution of mutualities“ (Ewald 1991: 203) sozialisiert97. Auf der Basis einer solchen ‚Befreiung’ der einzelnen sozialen Akteure von der Last rein individuell zu tragender Lebensrisiken und ihrer Zusammenfassung zu größeren, und idealtypisch letztlich einer großen risikoteilenden Gemeinschaft (vgl. Ullrich 1999) wird dabei der Versuch unternommen, eine ganze Palette von positionalen Problemlagen - allen voran Armut - aber auch dispositionale Probleme sozialer Akteure dadurch zu regulieren, einzudämmen oder zu normalisieren, dass sie von individuellen Schicksalsschlägen oder individuell zu verantwortenden Verfehlungen in ‚soziale Probleme’ transformiert werden, deren Ursachen innerhalb der gesellschaftlichen Organisation zu suchen sind (vgl. Schmidt-Semisch 2002, Groenemeyer 2001). Soziale Arbeit lässt sich nun als ein Teil dieses Versuchs verstehen. Ihre Existenz selbst erscheint somit als unauflösbar verknüpft mit den strukturierten Regelmäßigkeiten des politisch konstituierten Feldes des Sozialen und den politischen Rationalitäten, die die Bearbeitung des Sozialen regulieren und formieren. In diesem Sinne lässt sich die spezifische ‚Regierungspraxis’ der Sozialen Arbeit als Teil jenes größeren Konglomerats von ‚Taktiken des Regierens’ - das ‚das Soziale’ bezeichnet - präzisieren und als ein Element einer Form der Führung, Anleitung, Hervorbringung, Formung, Gestaltung, Normierung, Erzwingung etc. (vgl. O’Malley 2001a) formulieren, die systematisch von den Regierungspraktiken des ‚klassischen Liberalismus’ unterscheidbar ist (vgl. Rose 1996a, O’Malley 2001a). Entgegen der Regierungspraxis des ‚klassischen Liberalismus’ verweist die des Sozialen vor allem darauf, dass die Teilhabe der Bürger an der politisch verfassten Gemeinschaft „zunehmend von ihrer […je ] individuellen ökonomischen Tüchtigkeit abgekoppelt“ wird (Brumlik 2000b: 189). Auch die Soziale Arbeit - als ein Teil dieser Regierungspraxis – reflektiert insofern einen „wesentliche[n] Ausdruck des modernen Staates, der sich über gesetzliche Bindungen die Allzuständigkeit für die Geschicke zunächst seiner Untertanen, dann seiner Bürger erworben hat” (Brumlik 2000b: 189) . Sozialpolitik und Soziale Arbeit, - als Institutionen im spezifischen ‚Feld des Sozialen’ -, stellen demnach wesentliche institutionalisierte Garanten dafür dar, das frühliberale Modell gesellschaftlicher Integration und Ordnung, als einer ‚Kultur der Markvergesellschaftung’ vereinzelter Akteure, um das Moment einer wohlfahrtspolitischen Gesellschaftsintegration im Sinne einer abstrakten ‚administrativen Solidarität’ zu erweitern, die sich von privater Barmherzigkeit, moralisch-affektiver Verbundenheit ebenso wie von der Ummittelbarkeit intersubjektiver Reziprozitätserwartungen entkoppelt (vgl. Groenemeyer 2001, Ewald 1993, Schmidt-Semisch 2002). Die politische Bearbeitung ‚des Sozialen’ erfolgt ‚im Feld des Sozialen’ im wesentlichen durch vier analytisch unterscheidbare Interventionsformen: rechtliche, ökonomische, ökologische und In so fern lässt sich der Tendenz nach davon sprechen, dass die als das Soziale artikulierten Formen des „risk government view risk as being located in society as a whole, with the danger falling in a probabilistic fashion across the whole population, 97 82 pädagogische Intervention. Rechtliche Interventionsformen zielen auf den rechtlichen Status, ökonomische auf die Einkommensverhältnisse, ökologische auf die materielle wie soziale Umwelt und pädagogische auf die Handlungsfähigkeit von Personen(mehrheiten) (vgl. Kaufmann 1982, 1999, Kaufmann/Rosewitz 1983, siehe auch: Luhmann 1981, Parsons 1978). Im Sinne einer Dynamisierung des, dieser Perspektive - in einer heuristisch fruchtbaren, aber analytisch zu statisch und geschlossen Weise - zu Grunde gelegten, strukturfunktionalistischen ‚AGIL’Modells von Talcott Parsons, lassen sich die in diesen Interventionen je hauptsächlich wirksamen Machtmittel den von Bourdieu elaborierten Kapitalarten zurechnen: das ökonomisches Kapital erscheint als das Machtmittel der ‚ökonomischen Interventionsform’, das soziale Kapital korrespondiert im wesentlichen der ‚ökologischen’ und das kulturelle Kapital im Kern der ‚pädagogischen Interventionsform’ während legales Kapital - als ‚geronnene’, formal institutionalisierte Form des symbolischen Kapitals - den ‚rechtlichen Interventionsformen’ zu Grunde liegt. Die (administrative) Sozialpolitik und die Soziale Arbeit lassen sich aus dieser Perspektive als institutionelle Elemente und Träger der Interventionsformen eines sozialen Staats verstehen, um in Rekurs auf unterschiedliche Machtmittel und in unterschiedlicher Reichweite verschiedene Facetten sozialer Sicherheit zu gewährleisten. Soziale Sicherheit bezeichnet dabei das Kernelement der Praxisrationalitäten im Feld des Sozialen, die auf die Verhütung des Auftretens bestimmter, als soziale Risiken dechiffrierter, Phänomene gerichtet sind und darüber hinaus versprechen im Falle des Eintritts der mit diesen Risiken verbundenen Schäden, kompensierend tätig zu werden (vgl. Schulte 1998). Die Gewährleistung sozialer Sicherheit durch die administrative Solidarität des sozialen Staates beinhaltet Infrastrukturmaßnahmen, Sach-, Geld- und Dienstleistungen, die auf die Sicherung der Reproduktion gegenüber den in der Organisation des Sozialen eingeschriebenen ‚Standardrisiken’ wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter etc., die Sicherung gegenüber ‚sozialen Problemen‘ wie Armut und Abweichung, sowie die Sicherung der Sozialisation der Individuen als aktuale wie künftige Bürger sowie und vor allem als Träger der Ware Arbeitskraft gerichtet sind. Das entscheidende Spezifikum Sozialer Arbeit, als sozialstaatlich zu erbringende Dienstleistung und besonderer Teil der Sozialpolitik – so ist das SGB VIII keinesfalls ein zufälliger, sondern ein (rechts-) systematischer, in spezifischer Weise auf die nachwachsende Generation bezogener Teil des Sozialgesetzbuchs98 (vgl. Richter 2000) - lässt sich nun gegenüber den anderen Aspekten und Formen institutioneller und politischer Strukturierung des Feldes des Sozialen folgendermaßen beschreiben: Sozialpolitik fokussiert in erster Linie gesellschaftliche und politische Positionen sozialer Akteure in der staatlich gefassten, sozietalen ‚Gemeinschaft‘, im Sinne einer regulativen Reproduktion sozialer Verkehrsformen und rundet - in ihrer helfenden Dimension - die Spitzen sozialer, positionaler Ungleichheit kompensatorisch ab. Die rechtsförmig erbrachten, gesellschaftlich re-distributiven Regulationsleistungs- und Sicherungsversprechen der Sozialpolitik sind hierbei bezogen auf den einzelnen Akteur per se dispositionsneutral. Sie beziehen sich auf verallgemeinerbare Risiken, die vornehmlich durch Institutionen der Sozialversicherung in standardisierbarer Form bearbeitet werden individual characteristics being largely irrelevant” (Henman 2002: 3). 83 können, nämlich durch den Einsatz bzw. die kompensatorische Zurverfügungstellung von institutionalisierbaren und personenunabhängig übertrag- und damit distributierbaren (Macht-)Mitteln namentlich dem ökonomischen und dem legalen Kapital - zur relationalen (Re-)Positionierung im Sozialen. Innerhalb der Nation als territorial begrenztem Regierungsraum erfolgt dies mehr oder weniger ‚generalistisch’99, d.h. nicht nur mit vergleichsweise geringem Bezug auf die Dispositionen individueller Akteure, sondern auch weitgehend ohne Bezug auf spezifische sozial-ökologische Aspekte der ‚räumlichen’100 Verortung einzelner Akteure. Diese beiden nicht-universalisierbaren Bezüge werden von den Sozialen Diensten aufgegriffen, deren Machtmittel - in Bezug auf ihre Wertigkeit und Verwertbarkeit ebenso wie auf ihre Wirksamkeit - in einem wesentlich stärkeren Maße feldspezifisch gebunden sind, als dies bei den primären Machtmitteln der Sozialpolitik der Fall ist. Diese weniger universellen Machtmittel der Sozialen Arbeit – namentlich das kulturelle und das soziale Kapital – sind auch innerhalb eines nationalen Regierungsraums nicht nur stärker feldspezifisch gebunden als das legale und ökonomische Kapital, sondern sie stellen auch in einem engeren, territorialen Sinn in einem höheren Maße ein ‚ortspezifisches Kapital’ dar (vgl. DaVanzo 1981), d.h. ein Kapital dessen Nutzen sich erhöhen, verringern oder sogar völlig verloren gehen kann, wenn der Akteur, der es gebraucht, den Ort bzw. seine ‚sozialräumliche Verortung’ wechselt. In den Regierungsweisen des Sozialen - insbesondere in ihrer keynesianisch-sozialstaatlichen Form demnach wird ein spezifisches Verweisungsverhältnis zwischen den differenten Interventionslogiken der Sozialarbeit und Sozialpolitik hergestellt (vgl. Böhnisch 1982, Müller/Otto 1980), in dem Soziale Arbeit darauf zielt, die inkorporierten, dispositionalen Aspekte der Individuen - als ‚Subjekte’ - mit den ‚sozialpolitischen’ Regulierungen ihrer sozialen und politischen Positionen im gesellschaftlichen Gefüge in ein stabilisierendes Passungsverhältnis zu bringen (dazu Berger/Offe 1980, Offe 1987, Olk 1986, Otto 1973, Schaarschuch 1998). Dabei kommt der Sozialen Arbeit die Aufgabe zu, auf Seiten der Akteure, innerhalb der sozialpolitisch gesetzten und geforderten ‚Normalität’ – bzw. mit Max Weber gesprochen, des gesetzten und geforderten ‚Rationalismus der ethisch-methodischen Lebensführung’ , handlungsfähige, ,normale Subjekte’ und stabile Identitäten zu generieren. In diesem Sinne dienen personenbezogene soziale Dienstleistungen nicht zur Abdeckung von Lebensrisiken, die in einer verallgemeinerbaren Form sozialversicherungsrechtlich geregelt sind (vgl. Wohlfahrt 2000, Luhmann 1981), sondern von Lebensrisiken, die sich in den komplexen, konkreten und je besonderen Konstellationen der praxislogischen Lebenszusammenhänge ihrer Adressaten niederschlagen (vgl. Scherr 2002). Wie es Wendt (2001: 100) formuliert: „Soweit Sozialleistungen auf ein Konto überwiesen werden, mischt sich die Sozialarbeit nicht ein”. Wobei indes strittig ist, ob alle Aspekte des SGB VIII – z.B. § 45 und insbesondere auch § 43 - als materielle Teil des Sozialrechts verstanden werden können. 99 Es lässt sich kaum bezweifeln, dass auch die ‚allgemeine’ Sozialpolitik, beispielsweise in Bezug auf Fragen von ‚Gender’ und ‚Race’ aber auch bezüglich Behinderungen (bzw. ‚capabilities’) faktisch deutliche Differenzierungen enthält (für diese Hinweise danke ich Prof. John Clarke). 100 ‚Räumlich’ wird hier im Sinne von ‚Space’ und nicht von ‚Place’ verstanden (dazu: Kessl/Otto 2002) 98 84 Wenn die Dimension der Hilfe durch Soziale Arbeit in dieser Perspektive als eine ‚Zweitsicherung‘ erscheint (Scherr 2000: 75, vgl. Böhnisch 1982, Bommes/Scherr 2000), die jene Hilfen ergänzt, die auf der Basis rechtlich definierter Ansprüche qua Distribution festgelegter Leistungen durch die sozialen Sicherungssysteme nach Maßgabe einer vergesellschafteten Versicherungsrationalität (,socialized actuarialism’) als „erzwungene Solidarität von Risikoungleichen“ (Schmidt-Semisch 2000: 52, vgl. O’Malley 1992, Ewald 1991) erbracht werden, reagiert sie in erster Line auf die als mittelbar und unmittelbar unterstellten, negativen handlungs- und ‚identitäts-’ bzw. lebenspraktischen Folgen und Folgerisiken ihrer Adressaten, die mit politischen und gesellschaftlichen Positionen in Verbindung gebracht, jedoch nicht in Form standardisier- und versicherbarer Leistungen bearbeitet werden bzw. werden können. Dies ist kann z.B. der Fall sein, weil „Sozialpolitik auf Motive und Handlungsbereitschaften einer Vielzahl individueller Adressaten angewiesen […ist] deren Diversität in Rechnung stellen […muss und d]ie generalisierten Medien Recht und Geld […] diese Motive nicht hinreichend ansprechen und hervorbringen“ kann (Leisering 2001: 1218, vgl. Luhmann 2000). Die Hilfe der Jugendhilfe bezieht sich demnach auf jene Risiken und Krisen der nachwachsenden Generation in der gesellschaftlichem Praxis im Feld des Sozialen, zu deren, als gesellschaftlich angemessen erachteten, Form der Bewältigung, weder die gesellschaftlich garantierte und (sozial)politisch zugeteilte Menge an ökonomischem und juristischem Kapital, noch die Menge oder Art der aktual individuell inkorporierten Ressourcen und Machtmittel – als individuelle ‚Kompetenz’ und ‚Lebensführungsfähigkeit’ – alleine ausreichend erscheinen. In diesem Sinne reagiert die Jugendhilfe in der Dialektik von Position und Dispositionen nicht alleine auf ein Unterschreiten festgeschriebener Größen und Grenzwerte auf der Ebene von Positionen im Feld des Sozialen, sondern auf eine dispositionssensible Weise auf die - unterstellten oder artikulierten - „je konkreten Bedürfnisse” (Blanke/Sachsse 1987: 260), die mit Blick auf die gesellschaftlichen Akteure der nachwachsenden Generation, als individuelle oder kollektive Subjekte festgestellt werden101. Diese Bedürfnisse drücken sich – etwa im Sinne von als riskant oder defizitär erachteten Sozialisations- und Lebensbedingungen, ebenso wie im Sinne von erfahrenen Diskriminierungen und Missachtungen – als eine zumindest potentielle, identitäre Entfernung von einem Funktionszustand aus, der als ‚vernünftig’ erachtet wird (vgl. Brumlik 1992) oder als Gefährdung oder Beschädigung von Selbstbewusstsein, Selbstachtung sowie selbstbestimmter Handlungsfähigkeit (vgl. Scherr 2000, 2002). Dabei ist es die primäre Aufgabe der Jugendhilfe, die als sozialpolitisch relevant erachteten, dispositionalen Problemlagen sozialer Akteure der nachwachsenden Generation, bezogen auf eine Vermittlung von Teilhabe, Vermeidung von Nicht-Teilhabe oder Verwaltung der Nicht-Teilnehmer innerhalb der geltenden, praktischen wie formalen Regeln und Regelmäßigkeiten des Sozialen zu bearbeiten, d.h. als Phänomene, die in einer Hierauf weist im Kern auch Nohl in seiner Auseinandersetzung mit Verhältnis von Sozialpädagogik und Wohlfahrtspflege hin. So konstatiert er, dass die „sachliche Hilfe, […] die primäre, die Mittelsorge […] den Faktor des Charakters vergisst, der doch mindestens die Hälfte des Schicksals ist […]. Und so tritt die Sozialpädagogik als die andere Seite der Wohlfahrtsarbeit hervor, ohne die sie ihr letztes Ziel wie ihre entscheidenden Mittel verfehlte, die persönliche Stützung und den Wiederaufbau des Menschen selbst und seiner geistigen Umwelt“ (Nohl 1965: 18). 101 85 spezifischen Form der gesellschaftlichen Organisation entstehen und die im Rekurs auf diese Organisation zu bearbeiten sind102. In Bezug auf die Positionierung ihrer Adressaten im ‚Sozialen‘ geht es der Jugendhilfe nicht um eine direkte und ummittelbare, individuelle Kompensation eines Mangels an ‚materiellen’ Kapitalen, sondern vielmehr um die (ressourcenförmige) Erzeugung, wie den (machtförmigen) Einsatz inkorporierbarer – in der Regel nicht materieller – Kapitalsorten, insbesondere des sozialen103 und kulturellen Kapitals. Diese beiden Kapitalarten können durch die Adressaten in einem gewissen Sinne ‚inkorporiert’ werden und sind - in ihrer nicht institutionalisierten Form – somit personengebunden bzw. intersubjektiv einbebettet, und dies bedeutet zugleich habitusformierend oder, ‚pädagogischer’ formuliert, in sozialer wie individueller Hinsicht ‚identitätsbildend’. Dies stellt ein spezifisches Charakteristikum und damit verbunden auch die Basis für eine Eigenlogik und eine relative Autonomie personenbezogener sozialer Dienste von einer verallgemeinerten sozialpolitischen Risikoabsicherung dar. Allerdings bleiben die dispositionssensiblen Interventionen dabei nicht nur auf der ‚materiellen’ Ebene (nämlich als deren substanzielle Ergänzung) an die positionskompensierenden Sicherungsleistungen staatlicher Sozialpolitik gebunden – d.h. an das legale Kapital, im Sinne rechtlicher Vorgaben, und an ökonomisches Kapital, im Sinne der Quantität der ihr (zum Zwecke der Transformation) sozialpolitisch zur Verfügung gestellten, sozialstaatlichen Redistributionsleistungen ökonomischer Art104 -, sondern auch in symbolischer Hinsicht. Obgleich selbst nicht bzw. nur schwierig standardisierbar, zielen ihre Interventionen darauf, spezifische - zu den Positionen ‚passende’ - Identitäten hervorzubringen. Auf der Ebene der Interventionsformen zielt die Praxis der Erbringung sozial- und kulturkapitalbasierter, personenbezogener sozialer Dienstleistung auf die kombinierte Wirkung ökologischer und pädagogischer Interventionen. D.h. auf „die Verbesserung von Umweltsegmenten im Sinne größerer Nutzungschancen durch sozial schwache Gruppen” (Kaufmann 1999: 937) - wobei im Rahmen der Jugendhilfe der Familie eine besondere Rolle zukommt105 (vgl. Donzelot 1980, Jordan 2003, Karsten/Otto 1995) - und auf die „Entwicklung [personenbezogener] sozialer Kompetenzen und von ‚Humanvermögen’” im Feld des Sozialen (Kaufmann 1999: 938). Wie auch Bill Jordan (2003: 9) auf die spezifische Mischung sozial- und kulturkapitalbasierter Interventionen Sozialer Arbeit aufmerksam macht, fokussieren andere Humandienstleistungen vor allem In dem Maße wie diese Figurationen mit der ‚Identität’ der Adressaten der Jugendhilfe verknüpft werden und eben diese wiederum den zentralen Ansatzpunkt der Interventionen der Jugendhilfe darstellt, treten die Individuen, an die sich die Jugendhilfe als Adressaten wendet, auch dann, wenn sie als Handlungsträger identifiziert werden, denen ein Subjektstatus zugeschrieben wird, nicht als unabhängig von konstituierenden gesellschaftlichen Vorgaben existierende ‚Subjekte’ in Erscheinung (vgl. Hasse/Krücken 1999), sondern zugleich als eine ‚Konstruktion’, bzw. als ein, wie es Meyer et al. (1994: 21) formulieren, „Mythos, der aus rationalisierten Theorien ökonomischen, politischen und kulturellen Handelns entsteht“. 103 Soziale Arbeit, so führt etwa Bill Jordan (2003: 9) mit Blick auf die Bedeutung des Machtmittels ‚soziales Kapital’ in der Sozialen Arbeit aus,„gives priority to the bonds and conflicts between people, and to how moral ties and dilemmas, and the co-operative and competitive aspects of groups and communities, both constrain and enable individuals. It is anchored in collective life, and addresses service users as interdependent and interactive within social units“. 104 Selbst bei der ‚Aktivierung von Ehrenamtlichen’, spielt deren ökonomisches Kapital faktisch eine entscheidende Rolle (vgl. Ignatieff 1991; empirisch: Brömme/Strasser 2000). 105 Dies gilt nicht nur mit blick auf das familienzentrierte KJHG in der Bundesrepublik: „Families“ so Bill Jordan (2003: 9) „have always been the main social units upon which social work interventions focused“. 102 86 „on aspects of human development – improving competence, knowledge and skills through education and training, curing or alleviating disease, or improving psychological functioning – which are more specific, and which add to human capital [… while] social work [pays special attention] to the bonds and conflicts between people, and to how moral ties and dilemmas, and the co-operative and competitive aspects of groups and communities, both constrain and enable individuals. […Thus social work] addresses service users as interdependent and interactive within social units”. In diesem Sinne ist es gerade die Kopplung von sozialem und kulturellem Kapital, die es etwa Michael Winkler (1995: 175) ermöglicht, von Sozialer Arbeit als einer ‚Infrastruktur’ zu sprechen „welche die Fähigkeit zur Selbstprozessualisierung schafft, in der sich die Individuen an die Gesellschaft koppeln“. Für die Jugendhilfe106, ist der zu bearbeitende Ausschnitt des Feldes des Sozialen spezifisch an die Frage der sozio-historisch dominanten Definition des ‚Wohls’ der nichterwachsenen Population der Gesellschaft gebunden: der Intervention wenn dies ‚nicht gewährleistet‘ ist (vgl. § 27 SGB VIII), ebenso wie seiner strukturellen Ermöglichung sowie der Gestaltung seiner Bedingungskontexte, und damit nicht nur Abwehr einer ‚manifesten’ Gefährdung dieses ‚Wohls’, sondern auch seiner Optimierung (vgl. Münder/Schone 1999: 439) gemäß soziokulturell hegemonialer Standards. In diesem Sinne ist das SGB VIII und die hieran orientierte Kinder- und Jugendhilfe eine Form der Konkretisierung des allgemeinen, verfassungsrechtlichen Sozialstaatsgebots - als kodifizierte Form des Sozialen – hinsichtlich der je besonderen Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen (vgl. Richter 2000: 116). Die gesellschaftlich institutionalisierte Sorge um das ‚Wohl’ der nachwachsenden Generation legitimiert dabei das Zurverfügungstellen von Ressourcen ebenso wie den Einsatz von Machtmitteln durch die Soziale Arbeit in Form der Jugendhilfe. Interventionen auf der Basis von sozialem und kulturellem Kapital zur Gewährleistung des Wohls der nichterwachsenen Population stellen in diesem Sinne zugleich den Versuch der Erzeugung spezifischer Formen der Identität und die Beeinflussung bzw. Führung der Lebensführung der nachwachsenden Generation dar. Eine solche Ausrichtung ist für die Jugendhilfe und ihre Vorläufer konstitutiv, seit im Kontext der Entdeckung des Sozialen Ende des 19. Jahrhunderts ein spezifischer Bereich einer umfassenderen Erziehungswirklichkeit entsteht, der als ein System gesellschaftlicher Eingliederungshilfen in Folge der industriellen Entwicklung notwendig erscheint107 (vgl. Mollenhauer 1993: 13, Jordan 1983). Dabei entwickelt sich aus einer zunächst an in erster Linie ökonomischen, bzw. materiellen Hilfe orientierten Fürsorge sukzessive eine ‚soziale Pädagogik‘ (vgl. Münchmeier 1981), die sich auf weitere Bereiche der Erziehung und Sozialisation entsprechend der industriekapitalistischen Veränderungen der gesellschaftlichen Organisation richtet (vgl. Ferchhoff/Dewe 1979). Eine solche Orientierung findet insbesondere auch in der Konstitution der Jugendhilfe als personenbezogene soziale Dienstleistung ihren anschaulichen Ausdruck. In dieser semantischen Thematisierung der Jugendhilfe verdeutlicht insbesondere das sogenannte ‚uno-actu‘ Prinzip (vgl. vgl. Diese agiert im wesentlichen ‚eigenständig’ bzw. nach ‚eigenem Ermessen’ in Fällen und Konstellationen ‚unterhalb’ § 1666 BGB und in einer exekutiven Form ‚oberhalb’ eines von ihr - bzw. dem Jugendamt - eingeleiteten, aber juristisch (durch ein Familiengericht) festgestellten Falls gemäß § 1666 BGB. 107 „In simple societies”, so kann Jordan (1981: 1) daher zurecht behaupten „there are no social workers. Orphans, widows, handicapped people and the elderly are looked after within the extended family or tribe. Unconventional behaviour is either 106 87 Herder-Dornreich/Klötz 1972) eine Weise in die Lebenswirklichkeiten von Adressaten einzugreifen, die deren Ko-Präsenz voraussetzt. Offensichtlich entspricht es dem Handlungsmodus der Jugendhilfe nicht, Problemlagen des Sozialen auf einer, von den Dispositionen eines konkreten, sozialen Akteurs abstrahierten Ebene gesellschaftlicher Position zu bearbeiten. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, das solche strukturellen ‚sozialen Probleme’ ausgeklammert werden. Sie werden vielmehr in einer Weise ‚moduliert’, dass sie als Probleme in einer durch ökonomische, politische, soziale, kulturelle und anthropologische Wirklichkeitsannahmen figurierten, ‚positional-dispositionalen Matrix’ (vgl. Abbildung 1) symbolisch entsprechend ‚repräsentierter’ bzw. ‚subjektivierter’ Individuen bearbeitbar werden, die aber als leibhaftige empirische Akteure – deren Praxis der sichtbare Hinweis auf Probleme ihrer ,positional-dispositionalen Matrix’ ist - in den Prozess sozialpädagogischer Leistungserbringung involviert sind. Positionen ,subdominant’, unterhalb (relationaler) ‚sozialer Standards’ Dispositionen/ Habitus ‚inadäquat’ unterhalb (hegemonialer) ,kultureller Standards’ Praxisweisen ‚symbolisch delegitimiert’/ ‚kriminalisiert’ (Abbildung 1: Die ‚positional-dispositionale Matrix’) Die Fokussierung der Dispositionen verweist zwar darauf, dass Soziale Arbeit auf der Ebene der - diese als interventionsrelevant identifizierten Dispositionen strukturierenden und teilweise auch beständig neu verursachen - Positionen, alleine deshalb kaum einen eigenständigen und unmittelbaren Beitrag zur Bewältigung von Problemlagen leisten kann, weil ihr die Zugriffsmöglichkeiten auf die gesellschaftlichen Strukturen fehlen (vgl. Olk/Otto 1987: XVII), dies bedeutet allerdings nicht, die in den Blick genommenen sozialen Lebensführungsprobleme isoliert am Individuum festzumachen108 (vgl. Jordan 2003). Sie stellt sich in erster Line als eine Sensibilität gegenüber den Dispositionen sozial verorteter Akteure dar, die mit ihren gesellschaftlichen und politischen Positionen im Feld des Sozialen in Verbindung gebracht wird. In so fern verweißt die Dispositionssensibilität der Jugendhilfe auf Interventionsrationalitäten, durch die spezifische, regulative Vermittlungsleistungen im Verhältnis von vergesellschaftetem Subjekt und der sozialen, kulturellen und politischen Organisation der sozialen Formation erbracht werden. tolerated, venerated or punished by retributive methods. The notion of having specialists in planning the care of dependants, or in changing the non-conformist behaviour of other people is largely the creation of modern industrialised societies”. 88 Während sich psychologisch orientierte Humandienstleistungen idealtypischerweise auf die Dispositionen, dispositionalen Problemlagen eines individualisierbaren Einzelnen beziehen (vgl. Jordan 2003), und auf Positionen in per se beliebigen sozialen Feldern und Sinnzusammenhängen nur in sofern rekurrieren, wie sie für eine Bearbeitung der Dispositionen bzw. ‚Technologien des Selbst‘ (vgl. Foucault 1993) von Bedeutung erscheinen109, und während sich die sozialpolitischen Interventionen außerhalb der sozialen Dienste - indem sie Ressourcen zur Bearbeitung von Problemlagen zur Verfügung stellen, die mit vergleichsweise unmittelbar aus legalem und ökonomischem Kapital konvertierbaren Mitteln bewältigt werden können - primär auf die relationalen Positionen der Akteure im Feld des Sozialen beziehen, die idealtypisch von einzelnen Individuen abstrahierbar sind, unterscheidet sich die Soziale Arbeit von beiden: Das Spezifikum der dispositionssensiblen Interventionen der Sozialen Arbeit besteht darin, die als Adressaten identifizierten sozialen Akteure zugleich als einzelne leibhaftige und biographische Individuen und als sozial, politisch und symbolisch figurierte Träger von Positionen im Feld des Sozialen zu adressieren. In der Bearbeitung von Dispositionen teilt die Soziale Arbeit, in Bezug auf deren Verbindung mit gesellschaftlichen Positionen, mit der Sozialpolitik - in einer Art strategischer Allianz - das generelle Ziel einer regulativen Herstellung eines inkludierenden, sozialen Ausgleichs sowie sozialer Kohäsion. In so fern sind die Interventionen Sozialer Arbeit, alleine mit Blick auf ihre anvisierte sozialregulative Wirkung nicht in einem ausschließlich individuellen Sinne dispositionsorientiert. Sie zeichnen sich vielmehr durch eine Dispositionssensibilität aus, für die es konstitutiv ist, zugleich positionsbezogen zu bleiben. Jugendhilfe vollzieht demnach in actu zwar eine dispositional bezogene Handlungsstrategie im Sinne einer „Angleichung der Erziehungs- und Entwicklungsbedingungen durch den Ausgleich eines strukturell oder individuell vorhandenen Defizits und die Befriedigung eines hieraus resultierenden Bedarfs an Förderung im Sinne von Betreuung, Bildung, Erziehung und Therapie” (Wiesner et al. 2000, SGB VIII § 1 Rdnr. 29 ff), dabei bleibt aber der sozialrechtliche ‚Grundtatbestand’ der Jugendhilfe nämlich „ein individuelles oder strukturelles Defizit an familialen Erziehungs- und Bildungsleistungen”, das auf einen „objektiven Bedarf” an „Unterstützung und Ergänzung der Erziehung”, zur Förderung der Entwicklung des Jugendlichen und „zur gesellschaftlichen Integration” (Wiesner et al. 2000, SGB VIII § 1 Rdnr. 29 ff) verweist - positional gefasst. Trotz der positionalen Fassung des ‚Grundtatbestandes’ richtet sich die Jugendhilfe interventionssystematisch jedoch primär „auf die Bedarfssituation […] begrenzt auf die Bedürftigkeit, also die Unfähigkeit zur Bedarfsbefriedigung durch zumutbare Selbsthilfe oder die Fremdhilfe anderweitig verpflichteter […und] nicht auf die Ursache der Entstehung der Bedarfssituation” (Wiesner et al. 2000, SGB VIII § 1 Rdnr. 29ff) Eine Bearbeitung ‚delegitimierter‘ Dispositionen, bzw. von Dispositionen, die in der Praxis sozialpolitisch relevanter Felder auf Risiken verweisen, die die materiellen und symbolischen Strukturen und Logiken Die Rede von ‚dispositionssensiblen’ Interventionen wird bewusst gegenüber dem Begriff einer ‚dispositionsorientierten’ Intervention vorgezogen, um den irreführenden Eindruck zu vermeiden, die Interventionen Sozialer Arbeit wären alleine als Prozesse des ‚people-changing’ (vgl. Markert 2000, Olk 1986) hinreichend beschrieben (dazu kritisch: Jordan 2003). 109 So hebt etwa Hermann Wegener (1968: 369) hervor, dass es kennzeichnend für die Sozialpädagogik sei, dass „der Erzieher das notwendige Prinzip des Individualisierens nicht einseitig als ausschließlich individuelle Therapie auffasst, sondern als Hinführung zur Gemeinschaft und Gesellschaft“. 108 89 der Felder und eine mit diesen Logiken und Strukturen in Einklang zu bringende Konstitution des ‚Selbst’ der direkten Adressaten der Interventionen und Leistungen betreffen, stellt demnach den zentralen Handlungsmodus Sozialer Arbeit im Feld des Sozialen dar . Die Bearbeitung sozialer Lebenszusammenhänge im Sinne einer „gesellschaftlich verantwortete[n] und institutionell verfestigte[n] Praxis der Lebenslaufregulierung” (Brumlik 2000c: 186) durch soziale Dienste, auf der Basis der Machtmittel kulturelles und soziales Kapital, bleibt zugleich an die gesellschaftlich dominanten oder zumindest akzeptabel scheinenden Symbolformen dieser Kapitale gebunden. Das ‚doppelte Mandat’, genauer die operativen Elemente der Bildung, Sorge und Kontrolle (vgl. Banks 1994: 1) der Jugendhilfe reflektieren demnach das Verhältnis von (Sozial- und Kultur-) Kapitalakkumulationshilfe, Kapitalzugangsermöglichung und der (feldspezifisch) hegemonialen symbolischen Form dieser Kapitalen. Auf eine in actu mit ihrer Leistungserbringung erfolgende, praxislogische Verteidigung der feld- oder insgesamt gesellschaftsstrukturgebundenen Symbolform der Kapitale und damit verbunden auch ihre praktisch wie analytisch nicht hintergehbare, konstitutive Form und Funktion ‚sozialer Kontrolle’, muss sich Jugendhilfe schon alleine dann einlassen, wenn sie sicherstellen möchte, dass die von ihr gebotenen, ermöglichten, aktivierten etc. Kapitale für die Akteure, denen sie zugute kommen sollen, auch einen ‚Wert’ haben. Insofern - und nicht etwa weil sie per se ein Ausdruck eines ‚machthungrigen Leviathan’ oder ähnliches wäre - ist Soziale Arbeit immer eine Instanz sozialer Kontrolle. ‚Soziale Kontrolle’ und zwar nicht nur im Sinne allgemeiner gesellschaftlicher Regulation und Konstitutionselement individueller und sozialer Reproduktion, sondern im Sinne einer dispositionsbezogenen Form der Kontrolle und „people-changing-function“ (Olk 1986: 240), ist demnach gerade für eine gebrauchswertbezogene Erbringung personenbezogener sozialer Dienstleistungen, systematisch betrachtet zunächst keine ‚unerwünschte Nebenwirkung’, sondern immanent notwendig. Dies hängt damit zusammen, dass die Kapitale, auf die sich die Interventionen Sozialer Arbeit stützen, ihren praktischen ‚Wert’ – als praxisökonomisch verwertbaren gesellschaftlichen Wert – erst durch ihre Symbolform realisieren können. Diese Symbolform liegt ‚geronnen‘ als legales Kapital vor, oder ist eingebettet eine prävalente feldspezifische Struktur und Logik der Praxis. In diesem Sinne kann Micha Brumlik (2000b: 186) gefolgt werden, wenn er Soziale Arbeit als eine Form der Regelung eines spezifischen Grundproblems beschreibt, nämlich dem „des zeitlich gestreckten Bedarfsausgleich im Fall der Unterversorgung mit jenen Ressourcen, die üblicherweise dem Nachstreben legitimer gesellschaftlicher Ziele dienlich sind. Diese Unterversorgung erscheint sozial [positional] als Armut oder Deprivierung, personal [dispositional] als Defizit oder Devianz”. Unabhängig davon, ob die ‚Unterversorgung’ als ‚soziale’ oder ‚personale’ erscheint, bleibt im Falle einer Intervention der Jugendhilfe die professionsadäquate Form der Kopplung von Position und Disposition bestehen. In ihrem professionstypischen Bezug auf die positional-dispositionalen Matrix der Akteure verdichtet sich dieses, als Ausdruck eines ‚doppelten Mandats’ fassbare Spannungsverhältnis von öffentlicher Nachfrage und der Nachfrage des Nutzers an die Jugendhilfe idealtypisch darin, eine ‚subjektiv‘ befriedigende Sozialisation und Entwicklung im Rahmen einer ‚objektiv‘ gültigen gesellschaftlichen ‚Normalität’, als der ‚Common Sense’, die Regeln und Regelmäßigkeiten des ‚Spiels’, im Feld des Sozialen, zu gewährleisten. 90 Verbunden mit ihren Macht- und Interventionsmitteln im Feld des Sozialen erfolgt die Bearbeitung delegitimierter Dispositionen durch die Jugendhilfe dabei prinzipiell und ausschließlich ‚präventiv’. Sowohl ‚pro-aktive’ als auch ‚re-aktive’ Eingriffe der Jugendhilfe sind durch den Bezug auf Fragen der Entwicklung junger Menschen, bzw. der nachwachsenden Generation immer zugleich auf die Zukunft bezogen. Auch der Rückgriff auf soziales und kulturelles Kapital, als inkorporierbare Ressourcen und Machtmittel in Bezug auf die Lebensführung folgt diesem Entwicklungsbezug, und ist der Logik nach auf die Zukunft bezogen110. In all ihren Interventionen geht darum, dass potentielle oder aktuelle, positionale wie dispositionale Probleme und Konflikte im Zeitverlauf vermieden werden können, sich nicht ver- sondern entschärfen bzw. auflösen, von den betroffenen Akteuren besser bewältigt oder von ‚der Gesellschaft’ – bzw. bezogen auf die Interessen und aus der Perspektive der Umwelt der betroffenen Akteure – befriedigender gemanaged und reguliert werden können111. Über diese ‚präventive’ Rationalität der Interventionen der Jugendhilfe hinaus, lässt sich, wie im nächsten Kapital gezeigt wird, argumentieren, dass die Jugendhilfe selbst ein ‚Produkt’ einer spezifischen, historisch voraussetzungsvoll entwickelten Präventionslogik ist. Eindringlicher noch hebt Klaus Mollenhauer (1959: 124) diesen Aspekt hervor, wenn er konstatiert, dass „die Abwertung sozialer Gegenwart und die Ideen zur sozialen Erneuerung […] für das Vorhandensein wie für die Theorie der Sozialpädagogik konstitutiv zu sein [scheinen]“. 111 Im Rahmen einer konsequent gedachten professionellen Orientierung und Praxisausrichtung an einer pro-aktiven Präventionslogik kann jedoch der jugendhilfetypische Zusammenhang von Position und Disposition im Bezug auf den Delegitimierungsgrad eine wesentliche Veränderung erfahren: Der Dispositionsbezug bleibt bestehen, bezieht sich jedoch auf Dispositionen, die in ihrer inzidenten Form im Bezug auf das Feld noch nicht in einer Weise delegitimiert sind, dass sie gegenwärtig der ‚besonderen’ dispositionale Erweiterung der ‚allgemeinen’ positionalen Intervention bedürfen. Eine solche dispositionale ‚Hilfe’ ohne diesen Bedarf ist ebenso ‚präventiv’ orientiert wie paternalistisch. Dieser Bedarf wird in einer ersten Präventionsvariante durch eine entsprechende Problematisierung bzw. Delegitimierung von Dispositionen durch den Bezug auf eine Potentialität, nämlich ein Risiko, dass mit diesen Dispositionenen verbunden wird und diese damit problematisch macht, selbst erzeugt. In einer zweiten Variante wird dieses Risiko nicht im Kontext der aktualen Dispositionen vermutet, sondern aus der feldspezifischen Position mehr oder weniger kausal hergeleitet. Armut oder der Status ‚Ausländer’, so zum Beispiel eine gängige Form dieser Variante, berge das Risiko der Abweichung der durch entsprechende prophylaktische Maßnahmen ‚zuvor zu kommen’ sei. Aufgrund der professionsadäquaten Dispositionssensibilität wendet sich jedoch auch diese Form der pro-aktiven Intervention letztlich – und mit ähnlichen Effekten - auf nach den je gültigen Interventionskriterien aktual eigentlich nicht ‚interventionsbedürftig’ erscheinende Dispositionen der Akteure. Eine konsequent präventive Orientierung beinhaltet mithin entweder die aktive Delegitimierung bzw. Problematisierung vorhandener Dispositionen sui generis in Hinblick auf feldspezifisch relationale Positionen, oder die aktive Delegitimierung bzw. Problematisierung präinzidenzialer Dispositionen aus einer statistischen Kopplung an die Position. 110 91 II. 4 DIE ‚GEBURT’ DER PRÄVENTIONSORIENTIERUNG UND DIE PRÄVENTIVEN DIMENSIONEN DER JUGENDHILFE II. 4.1 BEGRIFFSBESTIMMUNG : WAS IST PRÄVENTION? Bezeichnet der Begriff der Intervention ein Eingreifen in einen Geschehensablauf, so verbindet der Begriff der Prävention diesen Eingriff mit dem Ziel des Zuvorkommens oder Vorbeugens. Bezieht man den Begriff Prävention auf abweichendes Handeln wird demnach ein Eingriff impliziert, der darauf gerichtet ist, dem Phänomen oder Prozess zuvorzukommen, dass ein Handeln abweichend wird111. In einer analytischen Definition kann Prävention nicht mehr als bedeuten, als die Vorverlagerung eines Eingriffs, mit dem Ziel das Eintreten eines antizipierten, als unerwünscht betrachteten Zustands oder Vorgangs zu verhindern, und somit einen anderen Zustand zu erhalten. Wesentlich sind also die Dimensionen der Antizipation, der Vorverlagerung und der Zielgerichtetheit von Steuerungsversuchen einer künftigen Entwicklung als Merkmale des Präventionsbegriffs. Während ausgehend von einem spezifischen, inzidenten Phänomen spezifische Entstehungszusammenhänge retrospektiv einer in kausalanalytischen Form rekonstruiert werden können, ist eine solche Form der Fallspezifität gegenüber einem zu prävenierenden Phänomen unmöglich. Da sich Prävention als eine Intervention darstellt, die sich auf vorgängige Indikatoren eines Phänomens, mit dem Ziel einer Verhinderung der Inzidenz dieses Phänomens bezieht, müssen dessen Entstehungszusammenhänge prospektiv bestimmt werden. Eine solche Bestimmung ist nur auf der Basis einer, notwendigerweise auf Aggregationen basierten, Berechnung statistischer Wahrscheinlichkeiten möglich. Ausschließlich auf einer wahrscheinlichkeitsprognostischen Basis gegenüber einer statistisch aggregierten Entität kann die einer präventiven Logik immanente Behauptung aufrechterhalten werden, dass Ursachen, Auslöser oder begünstigende Umstände eines für den einzelnen Fall ja noch nicht eingetretenen und im Falle ‚gelungener’ Prävention auch in Zukunft nicht eintretenden und daher für diesen spezifischen Fall auch nicht rekonstruktiv in seinen Entstehungszusammenhängen bestimmbaren - Phänomens bekannt seien. Alleine dieses Wissen ermöglicht Interventionen, die dann als Prävention bezeichnet werden können, wenn sie auf prävalente Indikatoren gerichtet sind, die die statistische Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Phänomens bestimmen, und dabei das Ziel verfolgen, diese Eintrittswahrscheinlichkeit zu beeinflussen. Prävention ist demnach keine Deskription eines beobachtbaren Eingriffs, sondern die als Kontingenzregulation beschreibbare Zieldimension einer gegenwärtigen Intervention gegenüber einem Phänomen, das zum Zeitpunkt der Intervention den Charakter eines ‚Risikos’ besitzt, d.h. eines zukünftigen Schadens, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder Ausmaß an gegenwärtige Dabei ist es - entgegen vor allem in der Sozialpädagogik oft kolportierten Auffassungen - für eine taxionomische Bestimmung von Prävention völlig sekundär, ob der antizipierte Umstand auf den sich die ‚präventiven’ Interventionen richten auf die künftige Wiederholung eines bereits aufgetretenen oder eines befürchteten ‚neuen’ Phänomens beziehen. Maßnahmen, die etwa einen Jugendlichen von einem Ladendiebstahl abhalten sollen, sind auch dann ‚präventiv’, wenn in der Lebensgeschichte dieses Jugendlichen eine entsprechende Handlung bereits rekonstruiert kann. 111 92 Handlungsentscheidungen gekoppelt ist (vgl. Bröckling 2003, Luhman 1991). In diesem Sinne setzt jede Form der Prävention immer zwei zentrale strategische Operationen voraus: „Predicing an outcome and being able to intervene in (that is, alter) a predicted outcome“ (Walklate 2002: 60) Die Beeinflussung der Kontingenz dieser Vorhersage kann sich darauf richten, einen möglichen Zukunftsentwurf möglicht auszuschließen oder aber die Entwicklung eines bestimmten Zukunftsentwurfs zu befördern, der sich sowohl von der Gegenwart als auch von dem möglichst auszuschließenden Zukunftsszenario unterscheidet. In diesem Sinne hat Prävention in Bezug auf den Versuch der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des Nicht-Eintritts einer unerwünschten Zukunft einen ‚konservativen’ Charakter und im engeren Sinne des Wortes logisch repressiven Charakter (vgl. Schülein 1983: 17), der jedoch begrifflich widerspruchsfrei um das Moment einer proaktiven Gestaltung erweitert sein kann, dessen präventive Qualität darin besteht, dass in dem Maße wie sich dieser Impuls im Zeitverlauf realisiert, die gegenwärtige Kontingenz alternativer, unerwünschter Zukunftsentwürfe reduziert. Richtet sich Prävention auf durch menschliches Verhalten induzierte gesellschaftliche Phänomene bzw. Phänomene, die sich auf ‚das Soziale’ beziehen, kann davon gesprochen werden, dass sich präventive Eingriffe innerhalb eines Kontinuums vollziehen, das auf ein Verhältnis von Individuum und Gesellschaft – bzw. ‚the civil’ und ‚the civic’ (vgl. Silverman 1997) - verweist: Prävention kann sich auf die Wahrscheinlichkeit von Schädigung beziehen, die einem Individuum aus den vorherrschenden Machbeziehungen und Lebens-, Handlungs- und Verkehrsformen gesellschaftlicher Praxisfelder widerfahren. Prävention kann in diesem Fall als eine ‚subversive’ Strategie der Bearbeitung sozialer Bedingungen zugunsten der Individuen verstanden werden, deren Interessen gegebene gesellschaftliche Ordnungen und Regelmäßigkeitssysteme zuwiderlaufen. Eine solche Subversion wäre jedoch ihrerseits ein bevorzugtes Objekt jener Präventionsstrategien, die darauf gerichtet sind, die Kontingenz einer Schädigung der gesellschaftlichen Ordnung zu reduzieren. In ihrer hegemonialen Form bezieht sich Prävention auf die Risiken, die bestimmte Phänomene, Entwicklungen, Einzelne oder Gruppen für das Ziel einer Aufrechterhaltung und Erreichung der ‚SollWerte’ (vgl. Nogala 2000) einer bestehende normativen und/oder funktionalen Ordnungs- und Bedingungsmatrix darstellen. Folgt man Siegfried Lamnek (vgl. 1994: 216) ist Prävention in diesem Kontext eine ‚Subkategorie’ sozialer Kontrolle, deren Spezifikum darin bestehe, dass sie antizipatorisch vor der Inzidenz bestimmter Praxisweisen einsetze. In Bezug auf diese Definition ist jedoch fraglich, ob eine antizipatorische Dimension nicht ein Charakteristikum jeder Form sozialer Kontrolle ist, bzw. ob eine lediglich nachgängige Ahndung bestimmter Handlungsweisen, die nicht zugleich auf das Ziel verweisen, Unerwünschtes zu verhindern (vgl. Scheerer 2000) und/oder Erwünschtes zu erzeugen (vgl. Peters 2000), d.h. eine Korrespondenz zwischen einem Ist- und einem Soll-Wert herzustellen (vgl. Nogala 2000), überhaupt unter den Begriff ‚soziale Kontrolle’ subsummiert werden können. Sofern soziale Kontrolle nicht als ein Phänomen gefasst wird, dessen Funktion eine ausschließlich retributive ist (dazu: Sumner 2001), sind ‚Prävention’ und ‚soziale Kontrolle’ synonyme Begriffe. Historisch geht der Begriff Prävention einem sozialwissenschaftlichen Begriff sozialer Kontrolle (dazu Ross 1901) voraus. Die Verwendung des Begriffs ‚soziale Kontrolle’ selbst findet ihre Wurzelen in 93 Auguste Comtes Ausführungen zur ‚Voraussicht‘ (prèvision) und - davon beeindruckt – in der von Ward geprägte Formel der ‚prediction in order to control’ (vgl. Dewe & Ferchhoff 1991: 503). Soziale Kontrolle und Prävention beziehen sich demnach beide auf die Fähigkeit, gewünschte Lebensperspektiven und -prinzipien zu regulieren. Prävention lässt sich in so fern als eine Intervention sozialer Kontrolle betrachten, die sich als Strategie der vorausschauender, d.h. - auf einer teleologischen Ebene - zukunftsgerichteter, Kontingenzbearbeitung darstellt. Diese Kontingenzbearbeitung kann verschiedene Formen annehmen: sie kann darauf abzielen, bestimmte Phänomene völlig auszumerzen, darauf ihre Formen und Ausmaße zu verändern, sie kanalisierend in Kontexte zu leiten, in denen sie weniger störend oder einfacher zu ‚managen‘ scheinen etc. - Je nach gesellschaftlichem Feld, nach Operationalisierungen der in diesem Feld eingelagerten Interessen und nach den Verweisungszusammenhängen zwischen Kontrollsubjekten und Kontrollobjekten kann die eine oder andere Strategie vorherrschend sein. Unabhängig davon bleibt für alle Präventionsstrategie eine Referenz auf verbindliche Normen und Standards konstitutiv. Diese können als sektorale Hegemonien in ‚alltäglichen’ Normalitätserwartungen wirksam sein, eingeschrieben in der strukturierten Logik der Praxis einzelner sozialer Felder. Sie können auch – und/oder zugleich - in Form legalen Kapitals, als gesetzte Standards der bevorzugten oder zumindest akzeptierten Verkehrsformen über einzelne soziale Felder und intersubjektive Sinnzusammenhänge hinweg, verallgemeinernd für eine gesamte gesellschaftliche Formation Gültigkeit besitzen und durch formale Institutionen aufrecht erhalten werden. In jedem Falle trifft eine partikulare, sozietal verallgemeinerte oder administrativ repräsentierte Gemeinschaft durch die Typisierung eines Zustands als präventionswürdig eine Entscheidung darüber, welche mit dieser Typisierung in Verbindung gebrachten Lebensäußerungen sie nicht (mehr) zu dulden bereit ist. Eine solche Entscheidung impliziert wie es Zygmunt Baumann formuliert eine ‚Zumutung’ mit zweifachem Effekt: nämlich eine Ordnung und eine Norm (vgl. Baumann 1997: 115). Erst durch einen solchen Bezug können ‚normale’ bzw. ‚akzeptable’ Handlungsweisen in Abgrenzung zu ‚abweichenden’ und ‚unerwünschten’ symbolisch markiert werden. Damit ist jedoch zugleich auch umgekehrt impliziert, dass Bemühungen zur Aufrechterhaltung der je gegebenen Formen dieser Markierung notwendigerweise Abweichung - als ihren Konterpart – konstituieren (vgl. Sack 1993). Die Etablierung solcher Markierung – und in so fern auch die Konstitution von Abweichung – ist nicht auf einen empirischen Durchschnitt bezogen, sondern verweist auf ‚symbolische Macht’ (vgl. Bourdieu 1985, 1987). Mit Rekurs auf die ihnen zu Grunde liegenden (symbolischen) Machtprozesse und Machtverhältnisse, können verschiedenen Formen dieser Markierungen danach unterschieden werden, ob sie ‚lediglich‘ handlungsstrukturierend in die Strukturen einer feldspezifischen Praxis durch die Praxis eingeschrieben, oder in einer zu legalem Kapital ‚geronnenen’ Form kodifiziert sind. Im ersten Fall werden sie nach der Maßgabe der je hegemonialen Praxisform wirksam. In einer institutionalisierten Fassung werden sie ihrer feldspezifischen Diachronität entrissen und wirken (formal neutral) über die dominanten Praxisformen einzelner Felder und über je aktuelle gesellschaftliche Konkurrenz- und Klassenkämpfe hinweg. Konflikte werden damit ihres intrinsischen 94 Maßstab - der hegemonialen und auf symbolischer Ebene ‚moralkapitalistisch’ als legitim bewerteten Praxis – enteignet und dem verallgemeinerten Maßstab des legalen Kapitals jenseits einer ‚Praxis der Praxis‘ (vgl. Bourdieu 1987) zugeführt. Diese Differenz entspricht der Differenz von formeller und informeller Kontrolle112, die in sofern mehr als nur unterschiedliche Mittel der Aufrechterhaltung derselben ‚Markierungen’ darstellen. Das Verhältnis von formeller und informeller Kontrolle und die Frage welche Bedeutung welcher Kontrollform in den einzelnen Präventionsstrategien zugestanden wird, ist demnach äußert bedeutungsvoll für die Setzung der symbolischen Demarkationslinien akzeptabler Lebensäußerungen und damit verbunden der gesellschaftlichen Produktion Ordnung und Abweichung. Alleine aufgrund der Feldspezifität hegemonialer Praxisformen ist davon auszugehen, dass „formelle und informelle Kontrolle keine inhaltliche Gleichsinnigkeit aufweisen, sondern eher durch Divergenzen und Diskrepanzen gekennzeichnet sind“ (vgl. Sack 1997: 23). Soweit die empirische Logik der Praxis eines einzelnen soziales Feld nicht deckungsgleich ist mit der institutionellen Repräsentation des gesamten sozialen Raum, kann es alleine deshalb keinen Gleichklang zwischen informeller und formeller Kontrolle geben, weil erstgenannte auf die Diachronität je feldspezifisch hegemonialer symbolischer Macht verweist, während sich die formelle Kontrolle auf deren Synchronisierung zu einem gesellschaftlich verallgemeinerten und verbindlichen Aggregat als ‚legales Kapital’ bezieht. Dies bedeutet, dass etwa Verschiebungen in den Präventionsstrategien zu Gunsten einer Stärkung der informellen Dimension von Prävention auch als Verschiebung der Parameter der Erzeugung von ‚Norm(alität)‘ und ‚Ordnung(en)‘ verhandelt zu verhandeln sind, die zumindest die Relativierung einer verallgemeinernden Legalitätsorientierung zugunsten einer Orientierung an je ‚sektoralen Hegemonien‘ impliziert und vice versa. II. 4. 2 Der Begriff ‚PRÄVENTIVE‘ UND ‚NICHT-PRÄVENTIVE‘ DIMENSIONEN MIT ABWEICHUNG BEFASSTER INSTITUTIONEN ‚Prävention’ erscheint als eine geeignete Formel für einen rationalen und vorausschauenden Umgang für alles, was mit Gefahren, Schädigungen Unsicherheit, Problemen, Konflikt oder kurz mit allem in Verbindung gebracht werden kann, was sich als nicht erwünscht darstellen lässt. In diesem Sinne ist ein Rekurs auf Prävention insbesondere zur (Selbst-)Beschreibung der Interventionen jener Institutionen geeignet, die sich mit den ‚Schattenseiten des gesellschaftlichen Normalitätsentwurfs’ (vgl. Mollenhauer 1994) auseinandersetzen. Das SGB VIII, als die rechtliche Rahmung der Kinder- und Jugendhilfe zeichne sich, so die nahezu einhellige Meinung seiner Kommentatoren, vor allem dadurch aus, dass es ein modernes Im Rahmen der Auseinandersetzungen mit dem den zeitgenössischen Präventionsstrategien wird sich zeigen, dass letztgenannter (wieder) verstärkt Bedeutung zugemessen wird. Würde dieser Bedeutungsgewinn nur eine Verschiebung der Mittel der Aufrechterhaltung derselben ‚Markierung’ darstellen, könnte man ihn durchaus lediglich als quantitativen Zuwachs der Kontrolldichte bzw. Unterstützung der formalen Kontrollinstanzen verhandeln oder, im Falle einer sukzessiven Ersetzung formeller Kontrolle in einigen Bereichen, als deren ökonomisch und organisatorisch günstigeres Äquivalent (vgl. Cohen 1979, Scull 1980). 112 95 Leistungsgesetz mit präventivem Charakter sei113. Im Achten Jugendbericht (1990: 84 ff) wird Prävention von lediglich nachgehenden Hilfen unterschieden und unter den Strukturmaxime einer lebensweltorientierten Jugendhilfe nimmt Prävention den prominenten ersten Rang ein (vgl. Thiersch 1992). Auch hinsichtlicht der Prozesse einer so genannten ‚Normalisierung der Sozialarbeit’ zu einem „Standardangebot für Normalbiographien“ (Merten & Olk 1999: 976) und der Fortentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe zu einer modernen, personenbezogenen sozialen Dienstleitung wird eine ‚präventive Orientierung’ als wesentlicher Indikator angeführt (vgl. 9. Kinder- und Jugendbericht, Merten & Olk 1999). Allerdings ist die ‚Entdeckung’ der Prävention kaum auf die letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts zu datieren. Explizit wird der präventive Charakter der Sozialpädagogik von Gertrud Bäumer (1929: 221), als ein „gemeinsames Werk der Heilung oder Vorbeugung“ beschreiben und auch im Sinne handlungspraktischer Orientierungen bringen z.B. die Jugendfürsorgeleitbilder im Wilhelminischen Reich, systematische Rekurse auf die Notwendigkeit präventiver Gesichtspunkte in der Jugendhilfe explizit zur Geltung (vgl. Niemeyer 2000: 442). Weniger systematisch, aber an durchaus zentralen Stellen finden sich Konzepte, denen aus moderner Perspektive zumindest eine ‚präventive’ Intention bescheinigt werden kann bereits bei den ersten ‚Fürsorgetheoretikern’ der frühen Neuzeit (vgl. etwa Juan Luis Vives 1526). Kurz, der ‚Ruf nach Prophylaxe’ ist kein neues Phänomen in der Jugendhilfe, sondern stellt von Beginn an ein zentrales Konstitutionselement der Sozialen Arbeit und ihrer Vorgänger dar (vgl. Blanke & Sachße 1987: 260). In der Tat erscheint eine präventive Orientierung selbstredend sinnvoll und einleuchtend. In normativer Hinsicht ist Prävention ‚gut’ weil soziale Probleme ‚schlecht’ sind (vgl. Walklate 2002: 60). Für Prävention zu sein, hat einen appellativen Charakter, der in etwa dem Bekenntnis gegen Sünde zu sein entspricht (vgl. Gilling 1999: 2) und die eigene Positionierung auf der ‚richtigen’ Seite zum Ausdruck bringt. Strategisch impliziert Prävention, es sei besser etwaige Problemlagen von vorn herein zu verhindern, als sie später, wenn sie eine ‚Zuspitzung’ und ‚Verhärtung’ erfahren haben, - mit ‚großem Aufwand - kurieren zu müssen. Daher reiche es, wenn man „Probleme lösen, Verhältnisse verbessern und Kinder und Jugendliche fördern und Unterstützen will […] nicht, immer nur als Feuerwehr gefordert zu sein, wenn […] das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Gefordert sind Strategien und Ansätze, die früher ansetzen, zu einem Zeitpunkt also, ‚bevor es zu spät ist’“ (Lüders 1999). In diesem Kontext finden sich Bestimmungsversuche – und Abgrenzungsversuche zum Begriff der Intervention - die Prävention als ‚rechtzeitige Intervention’ (vgl. Böllert 1996: 440) oder gar als „richtige Reaktion zum richtigen Zeitpunkt“ (Gabriel 2001: 18) fassen – und damit zugleich eine ‚gute’ und angemessene von einer offensichtlich ‚schlechten’ Jugendhilfe zu unterscheiden. Eine solche Definition, im Sinne nur ex post im Verhältnis zur Zielerreichung bestimmbaren Qualität einer Intervention, hat einen stark appellativen Charakter, der es sehr erstrebenswert macht möglichst alle Maßnahmen als präventiv zu beschreiben, über analytische Überzeugungskraft verfügt er jedoch Damit ist vor allem auch gemeint, dass es im Vergleich zum ‚Jugendwohlfahrtsgesetz’ den Charakter eines ‚repressiven Eingriffsrechts’ verloren hätte 113 96 kaum114: ‚Nicht- präventiv’ würde gemäß dieser Definition entweder bedeuten insgesamt falsch oder zum falschen Zeitpunkt einzusetzen oder beides. Jedenfalls wird damit ein Vorgehen, das wie auch immer, nicht richtig ist. Auch auf einer politischen Ebene besteht über die Notwenigkeit von ‚Prävention’ ein breiter Konsens. Auch hier können im einzelnen allerlei durchaus widersprüchliche Maßnahmen gleichzeitig mit dem Etikett ‚präventiv‘ versehen werden. In interventionslegitimatorischer Hinsicht ist der Präventionsbegriff für die Jugendhilfe nahezu unverzichtbar. Er ermöglicht ihr etwa logisch und praktisch widerspruchsfrei, neben ihren ‚freiwilligen Leistungen’ und der Erfüllung der Rechtsansprüche ihrer Adressaten auch ihre ‚echt hoheitlichen’ Ordnungstätigkeiten (vgl. Münder 2001: 1010) als Prävention zu verhandeln und vor dem Hintergrund des, ja nicht ‚eingriffs-’ sondern ‚präventionsorientierten’ SGB VIII, eine „Gegenüberstellung von Sozialanspruch und Sozialdisziplinierung [zu vermeiden], indem es [… sie beide] in den Dienst präventiver Sozialplanung stellt“ (vgl. Richter 2001: 1027). Da es der strukturellen Logik der Interventionen der Jugendhilfe entspricht präventiv zu sein, ist eine solche Umbenennung von Eingriffen in Prävention zwar analytisch nicht sonderlich hilfreich, aber auch nicht falsch. Nicht nur in der Jugendhilfe, sondern auch im kriminalpolitischen Diskurs hat sich der Rekurs auf ‚Kriminalprävention‘ jenseits einer strafjustiziellen Ahndung zur dominierenden Zielorientierung entwickelt (vgl. Walter 1999: 25 ff). Allerdings ist ‚Prävention’ auch hier ein zwar keinesfalls voraussetzungsloses und zur Rekonstruktionen der kriminalpolitischen Straf- und Kontrollrationalitäten im analytischen Sinne korrektes Etikett, aber es wird als kategorial ‚falscher’ Gegenbegriff zur ‚Intervention’ bzw. ‚Repression’ verwendet und bleibt darüber hinaus weitgehend inhaltsfreie: Legt man ein traditionelles kriminologisches Verständnis zu Grunde, nach dem Prävention all jene Maßnahmen bezeichnet, die auf eine kalkulierende Erzeugung von Konformität zielen beachtet darüber hinaus, dass die Personen, die in den direkten ‚Genuss‘ entsprechender Maßnahmen kommen, nicht einmal identisch sein müssen, mit denen, auf die die Prävention zielt115, ist der Kritik von Lowman et al. (1987: 4) insgesamt zu zustimmen, dass der Präventionsbegriff wie ein „Dietrich [wirke] der so viele Türen öffnet, dass seine analytische Kraft abhanden kommt“. Ebenso wie im Falle ‚sozialer Kontrolle’ ist ein unbestimmter Rekurs auf ‚Prävention’ ein, wie es Stan Cohen (1985) formuliert, ‚Mickey Mouse Konzept‘, das von der frühkindlichen Sozialisation bis zur Todesstrafe reicht. Alle Interventionen, die sich deshalb auf Sacherhalte, Personen, Konstellationen oder Situationen richten sind, weil sich diese als riskant beschrieben lassen, können zutreffend als Prävention beschrieben werden. Auf einer analytischen Ebene ergeben sich beispielsweise bei der Orientierung am Begriff der ‚Rechtzeitigkeit‘ u.a. Fragen hinsichtlich seiner Operationalisierung, seiner Abgrenzung, der ‚Um-Zu-Variablen’ auf die er sich beziehen soll usw. sowie die grundsätzliche Skepsis, ob ‚Rechtzeitigkeit’ – die Kontingenz menschlichen Handelns gesetzt - überhaupt eine prospektive Kategorie darstellen kann, oder nicht vielmehr selbst eine retrospektive Interpretation des Geschehenen darstellt. 115 So will etwa der amerikanische Ökonom Isaac Ehrlich (1975) in einer ökonometrischen Analyse des Abschreckungseffekts der Todesstrafen errechnet haben, dass pro zusätzlicher Hinrichtung bis zu acht Tötungsdelikte verhindert werden könnten. Pointiert formuliert Edwin M. Schur (1974) dass die eigentliche Funktion der Strafe nicht darin bestünde Abweichende selbst zu „zu ändern oder potentielle Abweichende abzuschrecken, sondern darin den sozialen Zusammenhalt zu fördern oder zu verstärken“. 114 97 Zwar Wandeln sich die jeweiligen Normen und Maßnahmen tendenziell mit ihrer Zielsetzung, jedoch liegt grade in Bezug auf abweichendes Handeln die Unterscheidung präventiv/nicht präventiv in nicht in der Norm oder der Maßnahme selbst, sondern in ihrer Legitimation begründet. D.h. es ist nicht notwendig, eine Norm oder Maßnahme als solche, sondern nur ihre symbolische Besetzung zu ändern, um sie von einer ‚nicht-präventiven‘ in eine ‚präventive‘ zu ‚verwandeln‘. Wenn etwa Rössner et al. (2002: 6f) beispeilsweise argumentieren, Repression und Prävention seien „zwei divergierende Ansätze“ und von „Argumente[n] für und wider Prävention und Repression“ sprechen (vgl. auch Body-Gendrot 2000), so mag dies als ein, wie auch immer begründetes, Votum intendiert sein, mit punitiven, strafrechtlichen - in aller Regel aber nichtsdestoweniger ‚präventiven’ Maßnahmen zugunsten prä-justizieller Interventionen möglichst sparsam umzugehen, analytisch ist eine solche Unterscheidung indes nicht haltbar116. Ob eine Intervention präventiv ist oder nicht, hängt nicht von der Maßnahme selbst, sondern von ihrer Zwecksetzung ab. Sperrt man, um ein Beispiel zu geben, einen des Normbruchs überführten Menschen ein, ist daraus alleine zunächst zu nicht erkennen, ob diese Intervention präventiv ist oder nicht. Sperrt man ihn – z.B. für drei Jahre117 - mit der Begründung ein, dass er verbrochen habe, und die Strafe daher verdiene, ist diese Intervention nicht präventiv. Sperrt man den gleichen Menschen für den Rest seines Lebens ein, weil er ein gefährlicher Verbrecher sei, den es unschädlich zu machen gilt, ist diese Intervention – u. U. ausschließlich - präventiv. Dem weder entgegen, dass beide Maßnahmen Interventionen sind, noch dass beide Intervention inhaltlich in so fern gleich gerichtet sind, dass sie Freiheit entziehen, noch dass die präventive Variante ungleich repressiver ist als die nicht-präventive und schließlich auch nicht, dass beide Interventionen ex post nach einem inzidenten Normbruch einsetzen. Um die Frage des präventiven und nicht-präventiven Umgangs mit Abweichlern, jenseits der analytisch völlig unbrauchbaren Gegensatzpaare ‚Repression und Prävention’ oder ‚Prävention und Intervention’ zu erhellen, bietet sich ein historischer Blick in den Strafdiskurs an. Mit Blick auf philosophische Auseinandersetzungen mit dem Thema Strafe lässt sich davon sprechen, dass eine Begründung ‚repressiver’ bzw. ‚punitiver’ Intervention durch ‚präventive’ Zwecken ein sehr altes Argument ist. Argumentative Figuren dieser Art finden sich etwa in Senecas ‚De ira‘ (‚Über den Zorn’) - nach dem vernünftigerweise nicht gestraft werden sollte weil gefehlt wurde, sondern damit nicht gefehlt werde - ebenso wieder, wie in Platons Ausführungen zur die Lehrbarkeit der Tugend im ‚Protagoras’. In einem systematisch-techologischen Sinne ist die Bindung der Bestrafung eines Individuums an gesellschaftliche Zwecke jedoch ein sehr voraussetzungsvolles Produkt einer Wissensformation und Subjektrepräsentation, die vor allem im 19. und 20. Jahrhunderts dominant wird. Wenn Franz von List mehr als zwei Jahrtausende nach Platon mit seiner These provoziert, Strafe sei „Prävention durch Phillipe Robert (2003: 116) beklagt ananlytisch zu Recht, dass, „the term prevention is even commonly used to designate any non-punitive solution susceptible of reducing the frequency of criminal behavior, despite the fact that logically, it obviously includes deterrence through punishment“. 117 Von Hirsch (1996: 321) - ein Vertreter von nicht-präventiven 'just desert' Strafen - empfiehlt dass die Strafe für meisten Delikte - dabei hat er Straftaten wie Tötungsdelikte und bewaffnete Überfälle im Blick - unter drei Jahren bleiben sollen. 116 98 Repression; oder wie wir ebenso gut sagen können: Repression durch Prävention“ (Liszt 1905: 176), so argumentiert er auf Basis einer Form der Strafe, einem Kanon von Wissen und einer Rationalität staatlicher Herrschaftsausübung, die nur sehr bedingt an Platon anschließt. Jenseits philosophischer Traditionslinien ist der Unterschied vielleicht noch gravierender. Die zumindest im außer- und nach-römischen Mitteleuropa keinesfalls ‚schon immer’, sondern erst ab etwa dem 12. Jahrhundert auftauchenden formellen Strafen (vgl. Achter 1951, Brockmann 1988) sind zunächst ‚nicht-präventiv‘. Neben der, ebenfalls ‚außerpräventiven’, ‚germanischen’ Traditionen eines Schädigungsausgleichs für begangenes Unrecht (vgl. Foucault 2002) – ein ‚Kompensationsprinzip’ das sich neben dem Moment der Übelvergeltung (talionsche Strafe) auch in der Hethitischen Rechtssammlung (1500 v.Chr.), dem griechischen und dem römischen Recht findet (vgl. Messmer 2001) - wird Strafe ihrer Logik nach als absolute Strafen vollzogen. Sie stellt eine ‚zweckgelöste Majestät‘ (vgl. Maurach 1971) bzw. einen Selbstzweck dar, der sich an einer vollzogenen, abgeschlossenen Tat orientiert, sich bereits durch den bloßen Vollzug erfüllt und nicht auf Effekte außerhalb der Strafe selbst zielt. Die Begründung dieser Strafformen erfolgt im wesentlichen normativ-metaphysisch118, aufgrund sittlicher und prinzipieller Notwendigkeit (vgl. Neumann & Schroth 1980: 11f), nicht aber aufgrund einer ‚Angemessenheit’ in Bezug auf die soziale und persönliche Situation des Delinquenten oder einer gesellschaftlichen Nützlichkeit bzw. ‚sozialen‘ Aufgaben der Strafe. Obgleich die ‚absoluten’ Strafen mit dem frühen Liberalismus an Bedeutung verlieren, folgt im Prinzip auch noch Immanuel Kant dieser Perspektive, wenn er fordert einen Täter kategorisch zu sanktionieren, ‚weil er verbrochen hat’ (vgl. Kant 1956). Das Kant’sche Argument für die ‚absolute Strafe’ ist vom einem aufklärerischen, gegen Willkür und Despotie gerichteten Impetus beseelt, der gänzlich anti-präventiv ist: der Täter soll nur für die Tat bestraft werden, die er tatsächlich und schuldhaft vollzogen hat. Absolute Strafen können sich im Wesentlichen auf drei Rechtfertigungsmuster beziehen. Neben der von Kant und Hegel bemühten Gerechtigkeitstheorie bestehen diese im Sühne- und Reuegedanken (vgl. Neumann & Schroth 1980). Der Sühnegedanke impliziert das Moment der Rache und Vergeltung, aber auch die – ebenso wenig präventiven – Vorstellungen von Versöhnung und Ausgleich. Eng damit verbunden ist der Reuegedanke, demgemäß die Strafe zugleich die Reue des Delinquenten symbolisiert, der seine Strafe ‚annimmt’. Dieses ‚Annahmen’ ist eher symbolisch als empirisch zu verstehen und findet sich etwa in der von Foucault beschriebenen Vierteilung des ‚Königsmörders’ Damiens, die damit beginnt, dass dieser „vor dem Haupttor der Kirche von Paris öffentliche Abbitte“ tun und „seine rechte Hand […dabei] das Messer halten [soll], mit dem er den Vatermord begangen hatte, und mit Schwefelfeuer gebrannt werden“ (Foucault 1994: 9, vgl. Karasek 1994). Sämtliche Begründungen absoluter Strafen sind nicht zukunftsbezogen, sondern darauf gerichtet einen in der Vergangenheit beschädigten Gleichgewichtszustand wieder herzustellen. Nach der Gerechtigkeitstheorie wird durch die Strafe - als die Negation der Negation (vgl. Hegel 1970) – der Bruch des Gesellschaftsvertrags ausgeglichen oder eine gleichsam ‚naturrechtliche‘ Gerechtigkeit Ein häufig im engeren Sinne religiöser Einfluss ist dabei unübersehbar und hat sich, trotz weitgehend säkularisiertem Strafrecht bis heute zumindest in Diktionen wie Bußgeld, Sühne, Schuld, Reue, Gnade oder Verkehrssünder erhalten. 118 99 reetabliert, in dem das durch die Tat entstandene metaphysische Ungleichgewicht wiederhergestellt wird. Auch im Sinne der Sühnetheorie sorgt die Strafe für die Versöhnung des Delinquenten mit der Natur, der Gemeinschaft oder dem Souverän, an denen sich der Delinquent durch seine Tat versündigt habe. Insbesondere die öffentlichen und blutigen Körperstrafen, Martern und Hinrichtungen sind darauf gerichtet, sichtbar zu demonstrieren, dass die Macht des Souveräns auch mit die der Übertretung seiner Gebote durch seine Unterworfenen ungebrochen ist (vgl. LudwigMayerhofer 2000: 330, Foucault 1994) – ein Moment der Strafe, das sich in sublimierter Form bis heute erhalten hat (vgl. Hess & Stehr 1987, Steinert 1997). Insbesondere im frühen Liberalismus und der Aufklärung dominiert eine – vor allem mit den Namen Cesare Beccaria (1738-1794) und Jeremy Bentham (1748-1832) verbundene – rechtsformalistische Position den Strafdiskurs. Obgleich diese Position bemessen an den Prämissen des präventiv begründeten ‚Strafmodernismus’ (vgl. Garland 1985) in wesentlichen Bereichen als ‚anti- präventionistisch’ bezeichnet werden kann, setzt sich ein bis heute erhaltenes Moment der Prävention mit dieser Perspektive durch: das Moment der Abschreckung. Über dieses Abschreckungsmoment hinaus ist die frühliberale Position jedoch insofern nicht präventiv, wie sie darauf besteht, dass sich eine Differenzierung der Kategorien des Kriminellen sowie der Grund und das Maß der Strafe einzig aus den begangenen Delikten und dem normativen Erfordernis ihrer Vergeltung - als einem tatbezogenen Schuldausgleich - herleitet (vgl. Albrecht 1999: 48f). Mit Bezug auf die Täter interessierten aus dieser frühliberalen Perspektive weder ihre Persönlichkeitsmerkmale, noch die Bedingungen ihrer Genese, noch die Frage unter welchen Bedingungen sich die Persönlichkeit und ihre Handlungsformen prospektiv in die eine oder andere Richtung entwickeln werden119. Im Gegensatz zur modernen Präventionslogik sind die Täter in dieser Rationalität keine ‚Risikosubjekte’. Sie interessieren, pointiert formuliert, nicht einmal als leibhaftige, „individuelle Subjekte, sondern nur als abstrakte Rechtssubjekte, die nicht durch Interventionen von außen verändert werden sollen“ (Groenemeyer 2001: 120). Aus der frühliberalen Perspektive unterscheiden sie sich von konformen Akteuren ausschließlich darin, dass sie die Regeln des Gesellschaftsvertrag gebrochen haben (vgl. Kunz 1998), weshalb – vor dem Hintergrund des von den Liberalen gesetzten, prinzipiellen Freiheitsrechts der Akteure, von staatlichen Interventionen verschont zu bleiben – der formalistisch formulierte Zweck der Strafe auch nur darin liegen darf, den vergangenen, abgeschlossenen Verstoß gegen das Recht zu sanktionieren. Basierend auf dem, aus dem römischen Recht übernommenen, ‚nulla poena sine lege’ Grundsatz repräsentiert ein solcher Formalismus das klassisch liberalen Strafecht weniger das Moment der bloßen Rache, Diese Ausführungen haben für die klassisch-liberale Position viel stärkere Geltung als für die ‚pönale Wirklichkeit’ dieser historischen Epoche selbst . Es sei darauf verwiesen, dass es im 18. und 19. Jahrhundert sowohl auf das Strafrecht als auch auf den Strafvollzug starke Einflüsse gab, die dieser liberalen Position eine deutlich soziale Position entgegensetzten. Der Bezug auf die soziale Positionierung, und die Forderung der 'Sünde' und der Kriminalität etc. durch soziale Reformen und die Besserung des Einzelnen zu begegnen findet sich sehr deutlich bei einigen Einflussreichen reformerischen Kräften und vor allem in der (philanthropischen wie der politisch-aufklärfrischen) Literatur seit der Zeit um die französische Revolution. Die Position ‚child saver’ Mitte des 19. Jahrhunderst, den kriminellen Jugendlichen nicht durch Strafe, sondern durch die disziplinierende Kraft der Arbeit und konsequent religiöse Erziehung kann keinesfalls einfach als eine subdominante Position 119 100 sondern stellt zugleich eine Garantie der Freiheitssicherung - formal gleich zu behandelnder Bürger120 gegen die Ansprüche und Willkür des Staates dar (vgl. Albrecht 1994). Der Ausgangspunkt des klassischen Strafrechtssystems ist die Repräsentation der Akteure als ‚homo penalis’ (vgl. Lemke 1997, Pasquino 1991), der als rational entscheidendes freies Individuum verstanden wird (Groenemeyer 2001: 120) und dieses auch bleiben soll. Während all diese Momente von einer präventiven Rationalität weit entfernt sind, ermöglicht eine solche – im wesentlichen auf einer utilitaristischen Philosophie gespeiste - Repräsentation des Rechtsbrechers durch das Moment der Abschreckung durch Strafe, die erste, grundlegendste und am stärksten durchgängige Form der Prävention im Kriminalitätsdiskurs. Diese Präventionsform basiert auf der Annahme, dass - wie William Seagle (1951: 357) in seiner ‚Weltgeschichte des Rechts’ ausführt „Menschen vernünftige, denkende Wesen seien, die sich bei ihrem Verhalten nach den Erwartungen von Lust und Unlust lenken lassen. Aus diesem Grunde werde, so nahm man an, ein Mensch von kriminellen Handlungen abstehen, wenn die dafür angedrohte Strafe ausreiche, um die Hoffnung auf einen möglichen Vorteil oder materiellen Gewinn aufzuwiegen“. Dieser präventive Aspekt wird von Beccaria wie Bentham explizit erwünscht und in dem Sinne systematisch ausgearbeitet, dass die Strafhöhe genau so gestaltet sein soll, dass sie gezielt den ‚Nutzen’ einer Tat nivelliert. Diese Präventionsdimension ist jedoch in so fern eher ‚passiv’, wie sie der Strafdrohung - und damit vor allem der Existenz und Gewissheit einer Strafe - immanent sein soll, „von einer intentionalen positiven Beeinflussung im Sinne einer Spezialprävention [(s.u.) kann aber] keine Rede sein“ (Cornel 2003: 35). Die strafende Intervention gegenüber den einzelnen Rechtsbrechern selbst bleibt in sofern keine zielgerichtete Form einer ‚aktiven’ Kontingenzbearbeitung, wie sie nach wie vor im wesentlichen auf die Schuld des Täters bezogen ist und weder mit einem systematischen, sozialregulatorischen Anspruch – da es nach dieser Auffassung eben keine (‚gesellschaftlichen’) Ursachen für die Tat außerhalb der freien Willensentscheidung des einzelnen Subjekts gibt - noch differenziert nach ‚Risikosubjekten’, sondern proportional zur vollzogenen Tat erfolgt: „Kriminalprävention war also vor […] den zwei letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts noch nicht die bestimmende Legitimation der Ausschließung bzw. des Einschlusses“ (Cornel 2003: 35). Allerdings wird bereits von einem entscheidenden Denker der Strafklassizismus des 18. Jahrhunderts, Jeremy Bentham, mit dem Modell des Panoptikums – bei Bentham ein Turm im Gefängnis, der so positioniert ist, dass ein Wächter möglichst in alle Zellen blicken und die Insassen überwachen kann, ohne von ihnen selbst gesehen zu werden - die Idee einer Form der Prävention entwickelt, die in ihrer Grundidee zentral für die Präventionsformen moderner Gesellschaften und die ihnen zu Grunde liegenden Machtverhältnisse wird. Weniger das Panoptikum selbst, als vielmehr das, was Foucault (2002: 748f) als ‚Panoptismus’ nennt repräsentiert drei Aspekte, die für den modernen Präventionsmus von zentraler Bedeutung sind: Überwachung, Kontrolle und Besserung. Diese Form der präventiven Rationalität, repräsentiert den Übergang zu einen ‚Strafmodernismus’ (vgl. Garland betrachtet werden. Dies gilt analog auch für die ‚gefallen’ Frauen und in einem abgeschwächten, nichtsdestoweniger feststellbaren Maße auch für männliche Erwachsene. 120 Im Deutschen Reich freilich noch Untertanen 101 1985), der dem liberalen ‚Strafklassizismus’ entgegensteht. Die ‚klassische’ Straftheorie, obgleich mit ersten ‚präventiven Dimensionen’ versehen, „knüpft die Strafe und die Möglichkeit einer Bestrafung an mehrere Voraussetzungen: Es muss ein explizites Gesetz geben; es muss ein expliziter Verstoß gegen dieses Gesetz vorliegen; und die Strafe muss die Funktion haben, das Unrecht das der Gesellschaft durch den Gesetzesverstoß zugefügt worden ist, wieder gutzumachen und [- hierin liegt die, wenngleich noch systematisch nachgeordnete, präventive Idee -] eine Wiederholung nach Möglichkeit zu verhindern. Diese legalistische […] Theorie ist das genaue Gegenteil des Panoptismus. Im Panoptismus erfolgt die Überwachung des einzelnen nicht auf der Ebene des Tuns, sondern des Seins; nicht auf der Ebene der tatsächlichen sondern der möglichen Taten. Dadurch tendiert die Überwachung zu einer immer stärkeren Individualisierung des Täters und achtet immer weniger auf die rechtliche Bedeutung, die strafrechtliche Qualifizierung der Tat“ (Foucault 2002: 749, Herv. H.Z.). Trotz dieser Idee dominiert die klassische Straftheorie in Deutschland noch im (ab 1871 etablierten) Strafrecht des Kaiserreichs. Auch wenn die Form der Strafbegründung dort mit ‚instrumentellen’, (general-)präventiven Einschüben verbunden ist - die im wesentlichen an die Annahme geknüpft sind, dass die Androhung von Vergeltung die Rechtstreue der Bevölkerung stärke – bleibt der den ‚absoluten’, nicht-präventiven Straflegitimationen geschuldete Gedanke der Tat-Schuld-Vergeltung zentral (vgl. Naucke 1999: 337). Dieser Gedanke verliert - wie in Deutschland vor allem das Jugendgerichtsgesetz von 1923 dokumentiert – im Verlauf des 20. Jahrhundert zunehmend an Dominanz und wird durch viel eher ‚technologisch’ als normativ begründete Strafen bzw. ‚Maßnahmen’ verdrängt, die sich aus den Überlegungen so genannter relativer Straftheorien speisen121, die eine Denklogik formulieren, die in ihren Grunddimensionen eine deutliche Verwandtschaft mit dem ‚Panoptismus’ Benthams - oder vielleicht besser Foucaults - aufweisen und für sich beanspruchen auf ‚empirischen’ Wissenskategorien und weniger auf ‚normativen’ Straftheorien zu beruhen. Die für die relativen Straftheorien konstitutive soziale Zweckgebundenheit der Strafe, kennzeichnet diese als ein ‚präventives’, d.h. funktional auf die Reduzierung der Kontingenz individueller Abweichung gerichtetes Instrument. „Die moderne […] Strafrechtsschule und einen auf Zweckrationalität schauende Kriminalpolitik interessierten sich nun auch für die Ursachen von Delinquenz, wollten nicht mehr nur Vergeltung, sondern Prävention“ (Cornel 2003: 35). Die intellektuelle Basis für diesen fundamentalen Wandel besteht im wesentlichen in einer Veränderung der Repräsentation des Kriminellen (vgl. Melossi 2000) und damit verbunden auch in den Technologien des Umgangs mit ihm, die vor allem im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts einsetzen. Wesentlich ist, dass sich der Rechtsbrecher nicht mehr nur durch seine Tat konstituiert, sondern einen bestimmten, intrinsisch von konformen Akteuren unterscheidbaren Typus darstellt: aus dem ‚homo penalis’ wird ein anhand intrinsische Merkmale kategorisierbarer ‚homo criminalis’ (vgl. Beirne 1993, Pasquino 1991) bzw. ‚uomo delinquente (Lombroso 1876), der „vor dem Verbrechen und letzten Endes sogar unabhängig vom Verbrechen“ identifizierbar ist (Foucault 1994: 324). Die Geburt des ‚homo criminalis’ ermöglicht Formen der Prävention, die sich systematisch vom bloßen utilitaristischen Abschreckungsgedanken abgrenzen lässt: das Prinzip der Normalisierung überwiegt 121 Im Gegensatz zum Jugendgerichtsgesetz, können sich im Erwachsenenstrafrecht zentrale Momente solcher absoluten Theorien, bzw. Rechtfertigungen von Strafe vor allem bis in die frühen sechziger Jahre halten, bis sie im Rahmen der Strafrechtsreform 1969 und 1975 weitgehend von so genannten relativen Straftheorien verdrängt wurden 102 zunehmend die Sanktionierung. Diese Präventionsformen beginnen sich ab Ende des 19. Jahrhunderts sukzessive durchzusetzen und werden ab Mitte des 20. Jahrhunderts in einer Weise dominant wird die sich, alleine sprachlich daran ablesen lässt, dass etwa in den USA seit den 1950 Jahren nicht mehr von Gefängnissen sondern von ‚correctional institutions’ die Rede ist und sich die ‚American Prison Association’ in ‚American Correctional Association’ (1954) umbenennt (vgl. Rotman 1995). Nachdem vor allem Cesare Lombroso (1862, 1876) naturwissenschaftliche Methoden und Instrumentarien elaboriert hat, um den ‚Verbrechermenschen’ - als einen biologisch festgelegten Atavismus - zu identifizieren und zu bestimmen (dazu: Garland 2002, Melossi 2000), ist es nur wenig später Enrico Ferri - Lombrosos wichtigster Schüler und soziologisch argumentierender Vertreter der italienischen ‚scuola positiva’ –, der insofern zu einem Vordenker der ‚strafmodernistischen’ Präventivlogik wird, wie er in der Strafe einen von der Logik Tat-Schuld-Vergeltung nahezu völlig abgekoppelten und auch vom Gedanken der Abschreckung unhängigen, funktionalen Teil der ‚Sozialhygiene’ erblickt: Ihre „einfache und dumme repressive Funktion soll in eine klinische transformiert werden, durch die die Gesellschaft von der Krankheit des Verbrechens genau so wie von anderen physischen und mentalen Krankheiten geheilt wird“ (Ferri 1895: 286 [zuerst: 1882]). Das revolutionäre Moment und der epochale Bruch dieses Arguments besteht in der Repräsentation des Verbrechers als einem pathologischen Subjekt dem weniger mit Drohung, sondern mit einem Vollzug einer ‚Strafe’, als einer gezielten, ‚passenden’ Maßnahme begegnet werden soll, die selbst einen funktionalen, ‚technologischen’ Zweck besitzt. Dieser Zweck richtet sich nicht an den vollzogenen Taten aus, sondern an der spezifischen Konstitution des Verbrechers selbst. In Deutschland ist die Entwicklung der ‚relativen’, zweckgebundenen Strafe ist vor allem mit den Namen von Liszt verbunden122, der ebenfalls Ende des 19. Jahrhunderts in seinem ‚Marburger Programm‘ – vor allem mit Blick auf Nicht-Erwachsene - fordert Strafen in erster Line auf „[d]ie Besserung der besserungsfähigen und besserungsbedürftigen“ (Liszt 1905: 166) Jugendlichen ausrichten, die es entsprechend zu identifizieren gilt. Diese Aufgabe soll dem Staat zukommen, da nur ihm die „Selektion des sozial untauglichen Individuums“ anvertraut werden könne (Liszt 1905: 163). Das oft zitierte Argument, dass es bei den Straftaten bestimmter Jugendlicher besser sei ‚nichts’ zu tun wird in diesem Sinne mit der Forderung nach Aussonderung und härtesten Strafen für ‚Gewohnheitsverbrecher‘123: „Sicherheitshaft für Gewohnheitsverbrecher, Arbeitshaus mit militärischer Strenge ohne Federlesen und so billig wie möglich, wenn auch die Kerle zugrunde gehen, Prügelstrafe unerlässlich. Der Gewohnheitsverbrecher […] muss unschädlich gemacht werden, und zwar auf seine Kosten, nicht auf die unseren“ (Liszt 1880, nach Plewig 1995: 227). Das wesentliche Moment dieser neuen Repräsentation des Kriminellen und des ‚präventiven’ Umgangs mit ihnen besteht nicht darin mehr oder weniger repressiv zu sein, sondern die Maßnahmen eher an Und in einem gewissen Sinne auch mit Anselm Feuerbach der jedoch den – in Kern schon von Bentham benannten Strafzweck im Abschreckungscharakter von Strafen betont. 123 Diese Sichtweise war keinesfalls ein ‚humanisierender’ oder gar ‚sozialdemokratischer’ Erfolg. Sie lässt sich eher als eine Form des Regierens beschreiben, die Foucault als ‚Biomacht’ analysiert. Das NS Regime hatte kein Problem die Liszt’sche Sichtweise – genauer das Präventionsmodell der ‚Défense Sociale’ – zu adaptieren. Folgt man dem Reichsrechtsführer Frank in seinen Ausführen zur ‚Nationalsozialistischen Strafrechtspolitik’ (1938) ist der „Zweck der Strafe“ im 122 103 den Besonderheiten des Risikosubjekts selbst als an seinen konkreten Taten auszurichten und damit ‚gesellschaftlich’ nützliche Effekte zu erzeugen. An dem ‚materiellen’ Phänomen, dass die Delinquenten eingesperrt und gezüchtigt werden sollten, änderten die relativen bzw. ‚präventiven’ Strafbegründungen wenig. Was sich verändert ist vor allem die im Liberalismus entscheidende Frage ‚Was hast du getan?’ In der neuen Rationalität „[w]ird im Falle der Verhaftung eines Delinquenten sein Fall komplett durchleuchtet, zurück bis zu jenem Zeitpunkt als er das Licht der Welt erblickt. Die entscheidenden Fragen sind dabei: Wer bist du? Wie bist du? Warum bist du? Was bist du?“124 (Garland 1985: 121). „Sein Familienleben, seine schulischen Leistungen, seine Vorlieben, sein Wohnumfeld, seine Freunde, all das“ - so verdeutlicht Reinhard Kreissl (2000: 29) am fiktiven Beispiel eines „Jugendliche[n], der in seinem Alltag möglicherweise einmal 30 Minuten seiner Zeit darauf verwendet hat ein Auto auszubrechen“ - „wird unter dem Gesichtspunkt analysiert, dass es in irgendeinem Sinne kausal für eine Handlung verantwortlich ist, die für den Betroffenen selbst möglicherweise vollkommen nebensächlich ist“. Die Perspektive verschiebt sich also von der Kriminalität zum Kriminellen selbst als der zentralen Kategorie von Kontrolle und Strafe. Dieser Wechsel des Paradigmas und Objektbezugs lässt sich in einem gewissen Sinne als die ‚lombrosianische’125 Basis der Durchsetzung eines zumindest die ersten drei Viertel des 20. Jahrhunderts dominierenden ‚Strafmodernismus’ (vgl. Garland 1985) im Feld der Kriminalitätskontrolle beschreiben. Die strafmodernistischen Strategien basieren auf einer ‚neuen Kategorie des Wissens’ (vgl. Pasquino 1991), die es erlaubt, den Rechtbrecher von andern Individuen nicht mehr nur dadurch zu unterscheiden, dass sich dieser für einen Normbruch entschieden hat, sondern er wird zu einer, logisch unabhängig von seinen Taten, unterscheidbaren Kategorie eines Akteur, dessen Handlungen lediglich ein sichtbarer Ausdruck vorgängiger innerer und äußerer Determinierungen sind. Erst auf dieser Wissensbasis, bzw. auf der Basis der ‚Verwissenschaftlichung’ und empirischen Erforschbarkeit der Fragen von Kriminalität und Strafe, lässt sich von der Möglichkeit einer umfassenden ‚präventiven Wende’ im Feld der Kontrolle und Strafrechts sprechen. Die gesamte Idee der Prävention, so François Ewald (1998: 11 ff), ist an die „Utopie einer Wissenschaft gebunden, die Risiken zusehends in den Griff bekommen soll, […sie] ist eine Haltung, die sich prinzipiell auf das Vertrauen in die Wissenschaft und ihre Gutachten stützt“. Aber auch umgekehrt ist – wie David Matza (1974) ausführt – die Kriminologie selbst eine Wissenschaft, deren erster und primärer Daseinsgrund weniger das Verstehen, als vielmehr der Versuch der ‚Ausmerzung’ ihres Gegenstands war (bzw. ist). Nationalsozialismus „die Vernichtung des absolut besserungsunfähigen, gemeinen, meist rückfälligen Verbrechers, die Besserung des noch besserungsfähigen, die Erziehung des noch erziehbaren Rechtsbrechers“. 124 Symptomatisch dafür ist eine - von Sack (2002) berichtete – Kommission von sieben Kriminalanthropologen (unter ihnen Cesare Lombroso), die auf ihrem zweiten Kongress der Kriminalanthropologie in Paris 1889 ins Leben gerufen wurde um auf ‚wissenschaftliche’ Weise in einer vergleichenden Untersuchung die Frage zu klären ob soziale oder biologisch-genetische Gründe ‚den Kriminellen’ erzeugen. Die Aufgabe dieser Kommission lautete bezeichnenderweise wie folgt: „Zu vergleichen sind eine Anzahl von mindestens hundert lebenden Kriminellen, davon je ein Drittel Mörder, Gewalttäter und Dieben, mit einer ebenso großen Zahl von hindert ehrbaren Menschen [‚honnêtes gents’], deren Vorleben und das ihrer Familien genauestens bekannt ist“ 104 Auf dieser Basis werden Rechtfertigungen von Strafe auf der Basis einer Fassung von Kriminalität als Produkt des freien Willens eines autonomen, rationalen Akteurs zurückgewiesen (vgl. Lemke 1997). Genau genommen wird sogar ‚der Kriminelle’ als autonome Person ‚vernichtet’. In den Worten von Jean-Paul Sartre (1952: 545): „Par la connaissance scientifique, la société prend d’elle même une conscience réflexive: elle se voit, elle se décrit, elle voit dans le voleur un de ses innombrables produits; elle l’explique par des facteurs généraux. Quand elle a fini son travail, il ne reste plus rien de lui“. Die früh-liberale ‚klassische’ Straftheorie seien, so resümiert Pasquale Pasquino (1991) die Argumente des ‚neuen’ Projekts, nicht nur praktisch falsch gewesen, wie die immer höhere Verbrechensraten signalisierenden - ebenfalls neuen Instrumente - der ‚Moralstatistik’ verdeutlichen (vgl. Quetelet 1869), sondern auch theoretisch, weil der ‚homo criminalis’ keinesfalls wie jede andere normale ehrenwerte Person auch denke. Genau genommen ‚denkt’ der ‚Verbrechermensch’ überhaupt nicht: er tut nur das was er ist. Diese ‚strafmodernistische’ Perspektive (vgl. Garland 1985) setzte sich nicht nur in Europa, sondern etwa zeitgleich auch in den USA durch (vgl. Morris & Rothman 1995). Exemplarisch hierfür sind die Ausführungen von Arthur Mac Donald seinem Werk ‚Criminology’ von 1893. „Whatever the remedy [to crime]“, so führt Mac Donald (1893: 272), in deutlicher Nähe zu Lombroso aus, notwendig sei immer „a thorough investigation of the criminal himself, both psychologically and physically, so that the underlying and constant cause of crime can be traced out“ (Herv. H.Z.). Allerdings, so fährt er an gleicher Stelle fort, würde ein großer Teil der Kriminalität aus den soziale Bedingungen erwachsen „and hence is amenable to reformation, by changing this conditions“. Dabei ist es an dieser Stelle zunächst weniger wichtig, ob der Verbrecher als ein ‚unschuldiges’ Opfer eines evolutionären biologischen Atavismus (vgl. Lombroso & Ferro 1996 [1895]), individueller, psychischer Pathologien oder der sozialen (vgl. Lacassagne126 1885 nach Sack 2002) und ökonomischen Bedingungen (vgl. Bonger 1996 [1916]) rekonstruiert wird. Wesentlich ist, dass sich determinierenden Bedingungen im Sinne einer statistischen Regelmäßigkeit von Kriminalitätserscheinungen (vgl. Quetelet 1842) und in Form einer Regelmäßigkeit in der Entstehung klassifizierbarer und individuell erforschbarer verbrecherischer Individuen erfassen lassen (vgl. Bertillon 1889, Ferri 1895, Liszt 1905). Erst diese Repräsentation des Kriminellen ist es, die den Einzug der Psychiatrie und ihren Techniken der Prognose und Heilung (vgl. Foucault 1994, Althoff & Leppelt 1995) und – nicht zuletzt, da sich zur gleichen Zeit auch die Konzeption des Kindes und Jugendlichen als eine spezielle Kategorie unter den Kriminellen durchsetzt, auf die mit einer speziellen Form des Strafrechts zu reagieren sei (vgl. Cornel 2003, Garland 1985, Newburn 2002) - der (Jugend)Fürsorge und ihren Techniken der Besserung und Erziehung in das Strafrecht ermöglicht und notwenig erscheinen lässt. Der auf dem ‚Psy-Wissen’ (vgl. Donzelot 1980) medizinischer, sozial- und humanwissenschaftlicher Disziplinen basierende ‚Macht-Wissenkomplex’ des ‚Strafmodernismus’ richtet sich weniger auf die In Anlehnung an den italienischen Physiker und Psychiater Cesare Lombroso (1835-1909) Fritz Sack (2002: 30) zitiert den Anthropologen Alexandre Lacassagne (1885) mit dem Satz: „Les sociétés ont les criminelles, qu elles méritenet“ – „Jede Gesellschaft hat die Verbrecher die sie verdient“. 125 126 105 Rache am Kriminellen, noch in erster Linie auf die Eindämmung der Kriminalität per se, als vielmehr vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts - auf die ‚Reformierung’ des Krimiellen (vgl. Cornel 2003) und - mit dem Aufstieg der fordistischen Phase des Kapitalismus - zunehmend auch auf seine soziale ‚Reintegration’ (vgl. Cohen 1979, Taylor 1999). Zugleich werden Kriminalität und Strafe tendenziell von ‚moralischen’ zu ‚klinischen’ Angelegenheiten modifiziert: Die Entwicklung moderner Institutionen, „particularly the prison, was aimed at displacing popular emotions from the centre of punishment by extending the control of state based professionals“ (Simon 1998: 464). Kriminalität und die gesellschaftliche Reaktion auf diese ist fortan nicht mehr nur eine Sache des Strafrechts, sondern wird zu einer differenzierten, professionalisierten und rationalisierten Frage der ‚richtigen’ Technik und zu Angelegenheit des Expertenwissens verschiedener Disziplinen. Foucault spricht von einer weit ausdifferenzierten Bandbreiten unterschiedlicher „Normalitätsrichter“, die überall anzutreffen sind in einer sich entwickelten „Gesellschaft des Richter-Professors, des RichterArztes, der Richter-Pädagogen, des Richter-Sozialarbeiters“ (Foucault 1994: 392), die nicht nur eine Vielzahl von „Techniken und Institutionen [bereitstellen] die der Messung, Kontrolle und Besserung der Anomalen dienen“, sondern auch eine neue „Grenzziehung zwischen dem Normalen und dem Anormalen“ (Foucault 1994: 256) ermöglichen. Bezogen auf Kinder und Jugendliche setzt sich dabei eine Undefinition von Abweichung durch die einen alternativen Umgang mit Abweichlern rational erscheinen lässt die zu einem zentralen Charakteristikum für die Reaktionen der Jugendhilfe und des gesamten Strafkomplexes wird: „das Verhalten soll nicht [nur] einfach geahndet, sondern aus den personalen Problemstrukturen der Kinder und Jugendlichen erklärt und damit der pädagogischen Verhaltensbeeinflussung zugänglich gemacht werden“ (Böhnisch 1982: 22). Vor allem gegenüber Jugendlichen erfolgen strafjustizielle Entscheidungen auf dem Höhepunkt dieser ‚neuen’ Rationalität „stets ‚in Würdigung der Gesamtpersönlichkeit des Angeklagten’, d.h. die aktuell zu verhandelnden abweichenden Ereignisse werden immer auch in den Kontext der biographischen Geschichte des Angeklagten gestellt. Der Richter entwirft [… dabei] ein retrospektiv gerichtetes Bild der je besonderen Individualität und Entwicklungsgeschichte des ‚Missetäters’ und sucht aus dieser interpretativ rekonstruierten Lebensgeschichte historisch-genetische Gründe für sein abweichendes Verhalten zu identifizieren. Gestützt auf dieses durch retrospektive Interpretation gewonnene Bild der bisherigen Lebensgeschichte gibt der Richter zugleich ein prospektiv gerichtetes Urteil über die ‚vorhersehbare’ zukünftige Entwicklung des betroffenen Angeklagten. Er verlängert die biographische Entwicklung und entwickelt eine entsprechende Verhaltensprognose. Erst wenn [dies] dem Richter gelingt […] gewinnt er seine Handlungsfähigkeit gegenüber dem konkreten Fall und vermag weitergehende rechtliche Maßnahmen zu ergreifen“ (Brusten & Herriger 1980: 670f). Diese Rekonstruktion der Vergangenheit, aus der sich eine begründete Prognose über eine wahrscheinliche Zukunft herleiten lässt - auf deren Bearbeitung die auf dieser Wissensgrundlage beruhenden Interventionen zielen - ist die wissenstheoretische Grundfigur der Präventionsidee und bezogen auf die Vergangenheit und Zukunft von Kindern und Jugendlichen auch die der modernen Kinder- und Jugendhilfe. Pointiert formuliert lässt sich insofern behaupten, dass ‚Prävention’ in einem analytischen Sinne keine Strukturmaxime oder ähnliches der Jugendhilfe ist, sondern dass die ‚Geburt’ der modernen 106 Jugendhilfe selbst in epistemologischer Hinsicht erst durch die Präventionsidee ermöglicht wird127, die wiederum selbst an die wesentlich grundlegendere, moderne Vorstellung der Bearbeitbarkeit und Beeinflussbarkeit der Kontingenz der Zukunft, d.h. insbesondere einer (sozial)technologischen Beherrschbarkeit von (sozialen) Risiken gebunden ist128 (vgl. Evers & Nowotny 1987). Auf einer administrativen Ebene setzt sich eine Reinterpretation der Zwecke staatlicher Strafe als Prävention und Mittel zur Gestaltung des Gemeinwohls im Kontext der Entwicklung des modernen Verwaltungsstaates und seinem erhöhten Interventions- und Steuerungsbedarf durch: Als gesellschaftliche und säkularisierte Aufgabe des Staates, so die neue Sichtweise, komme der Strafe „nur eine soziale, keine sittliche, keine moralische und keine religiöse Aufgabe“ (Baumann 1984: 34) mehr zu. Damit flexibilisiert sie ihren zunächst unbedingten, zumindest formal a-politischen Charakter des Rechtsgut- und Freiheitsschutzes - auf dessen Basis sie in der Aufklärung und im frühen Liberalismus gegründet worden ist - und gibt ihn mit der zunehmenden Legitimation als ‚sozial nützliches’ Präventionsinstrument sukzessive auf (vgl. Albrecht 1994, Naucke 1990): Unabhängig von der Ausformulierung der Zweckorientierung des Strafrechts im einzelnen, kann davon gesprochen werden, dass alles, was über ein ausschließlich tatschuldorientiertes Strafrecht hinausgeht eine Seite „der selben Münze [ist]: die Institutionalisierung präventiver Steuerungskapazität der politisch-administrativen und rechtlichen Einrichtungen“ (von Trotha 1992: 189). Mit der ‚präventiven Wende’ wird das Strafrecht demnach von einem Mittel der Vergeltung zu einem steuernden und sozial gestaltenden Instrument (vgl. Scheerer 1996: 80). Die strafrechtliche Rationalität verschiebt sich von einem liberalen Modell des ‚due process’ zu einem sozialtechnologischen ‚crime control model’ (vgl. Packer 1969), das in seiner präventiven Orientierung auf Veränderung gerichtete Interventionen verweist, die zwar eine Reaktion auf gezeitigte Abweichungen darstellt, aber sich mit Bezug auf die Kontrolle und Regulation des Risikos, d.h. der kalkulierbaren Wahrscheinlichkeit künftiger Abweichungen begründet und rechtfertigt (vgl. Groenemeyer 2001, Hudson 2001). Der staatliche Anspruch auf eine Demonstration von ‚Souveränität’ durch Strafe ist damit zwar nicht verschwunden, gerät aber zumindest zwischenzeitlich gegenüber seinem Gestaltungs- und Regulationsanspruch in den Hintergrund (vgl. Garland 2001), d.h. gegenüber genau jener präventiven Logik des Interventionsstaats, die die Geburtsstunde der Soziale Arbeit als einem institutionalisierten Bestandteil der Regulation des Sozialen markiert. In modernen Demokratien ist eine solche präventive Orientierung der Strafe durch das Rechtsstaatsprinzip an die ‚nicht-präventiven‘ Grundsätze von Fairness und Verhältnismäßigkeit gebunden, und damit der Tendenz nach gebrochen129, da sie induzieren, dass Versuche der Nahezu wörtlich formuliert wird dies wenn das SGB VIII §1 Abs3 die Jugendhilfe dazu verpflichtet „junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung [zu] fördern“ namentlich zu einer „eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (SGB VIII §1 Abs1). Diese Aufgabe mag zwar als ‚Bildungsauftrag’ interpretiert werden (vgl. Scherr 2002), verweist jedoch auf eine präventives Anliegen, das sich substanziell nur wenig von dem – legitmatorischen – Präventionsauftrag des Jugendstrafrechts unterscheidet, nachdem „der Verurteilte dazu erzogen werden [soll], künftig einen rechtsschaffenden und verantwortungsbewussten Lebenswandel zu führen“ (§ 91 JGG). 128 Dies gilt auch für Lombroso, der sich für Prävention durch gezielte Eugenik einsetzte. 129 Beispielsweise wäre es zwar nicht verhältnismäßig aber ‚präventiv‘ durchaus legitimierbar, alltägliche Bagatellen hart zu sanktionieren, den ‚wohlintegrierten“ und ‚konformen‘ Kriegsverbrecher in Friedenszeiten gewähren zu lassen. 127 107 Verwirklichung von ‚Gerechtigkeit‘ (vgl. Höffe 2001) - und mithin auch die (‚absoluten‘) Dimensionen von Schuldausgleich, Sühne und Vergeltung für begangenes Unrecht (vgl. BverfGE 45, 253f) - in so genannten ‚Vereinigungstheorien’ in die Legitimation der Strafen einfließen. Dieser Einschub ‚absoluter’ Ideen stellt sich aber mehr oder weniger nur als Korrektiv zu den ‚relativen’ Theorien dar, die primäre Legitimation der Strafe ist ihre Präventivfunktion, bzw. wie es in einer Entscheidung des Bundesgerichtshof von 1970 heißt, eine Beschaffenheit durch die, „sie sich zugleich als notwendiges Mittel der präventiven Schutzaufgabe des Strafrechts erweißt“: Strafe „darf nur präventiv ausgerichtet sein“ (Ostendorf 1996: 32). Auf einer legitimatorischen Ebene ist Strafe ist damit von einer normativ-philosophischen, bzw. ‚metaphysisch’ (Neumann & Schroth 1980) begründeten Reaktion auf eine vergangene Tat zu einem erfahrungswissenschaftlichen Einwänden unterworfenen Mittel zum Zweck der Kontingenzreduzierung kriminalisierter Gefährdungen geworden. Obwohl staatliches Strafen demnach eine Reihe von Zielen haben kann - und immer noch hat - ist ihr hauptsächliches Anliegen nach der ‚präventiven Wende’ des Strafmodernismus ein instrumentelles: die Raten von abweichendem Verhalten zu reduzieren oder einzudämmen. In diesem Sinne kann sie als eine Möglichkeit unter anderen betrachtet werden, die entwickelt worden, um als eine legal bewährte Methode, die Aufgabe der Kontrolle von Kriminalität und Abweichung zu erleichtern (vgl. Garland 1990: 18). Eine andere, mögliche Variante unter der Vielzahl von Strategien im Umgang mit abweichendem Verhalten von Kindern und Jugendlichen sind die jugendhilferechtlichen Angebote und Maßnahmen selbst (vgl. Walter 1993: 192). Vor dem Hintergrund der ‚präventionsnotwenigen’ Geburt des ‚speziellen Wissens’ über den ‚homo criminalis’ (vgl. Pasquino 1991) und deren Modifikation auf die, auch im strafrechtlichen Sinne erfolgende, ‚Erfindung’ des Jugendlichen (vgl. Newburn 2002) ist es nicht verwunderlich, dass die Beschäftigung mit Kriminalität bzw. Devianz von Beginn an keinesfalls nur ein Randbereich der Jugendhilfe und ihrer Vorläufer ist. In einer sozialhistorischen Untersuchung hat etwa de Swaan (1993) aufgezeigt, dass weniger der Humanismus oder gesellschaftliche Fürsorge und Mitleid mit armen und marginalisierten Gruppen das zentrale Movens bei der Entstehung des ‚sorgenden Staates‘ im Sinne einer modernen Sozialpolitik war, sondern bürgerliche Schutzinteressen vor den ‚classes dangereux‘ und den gefährlichen Nebenfolgen von Armut und Ausgrenzung, im Sinne von Seuchen und Krankheiten, sowie eben auch der Kriminalität, seitens jener durch ‚Immoralität‘ und ‚Demoralisierung‘ gekennzeichneten Arbeiterklasse130 (vgl. Engels 1962: 355). „Die Geburtsurkunde der modernen Jugendfürsorgeerziehung“ attestiert etwa Detlev Peukert (1986: 68) in einem vergleichbaren Kontext, „wurde von der Strafrechtspflege ausgestellt“. Die Etablierung der Sozialpädagogik folgt nicht zuletzt dem, der skizzierten Präventionslogik folgenden Phänomen, dass ‚Verwahrlosung‘ - als ein funktionales Äquivalent für Kriminalität im Kindes- und Jugendalter - in 130 Beschwörungen der - in der Regel auf Individuen disaggegierten - ‚classes dangereux‘ haben sich bis heute erhalten. Sie legitimieren konservative ‚law-and-oder‘ Vorstellungen (vgl. Murray 1990, Bennett et al. 1996, Wilson & Herrnstein 1985) ebenso, wie sie die ‚gesamtgesellschaftliche‘ Dringlichkeit sozialreformerischer Ambitionen oder die präventive Nützlichkeit bzw. Förderungswürdigkeit - disziplinärer, professioneller und ehrenamtlicher Tätigkeiten in allen Bereich der Sozialisation, Erziehung und Bildung verdeutlichen (vgl. Baethge et al. 1998). 108 der bürgerlichen Gesellschaft in ein - von der politischen Ökonomie entkoppeltes - Problem der Erziehung umdefiniert wird (vgl. Ferchhoff & Peters 1979: 5f), während sich eine Pädagogisierung sozialer Kontrolle strukturierend auf jenen Raum auswirkt, der die Entstehungs- und Ausbreitungsbedingungen für die Institution Sozialarbeit bereitstellt (vgl. Münchmeier 1981). Selbst wenn bestritten werden kann, dass die Jugendhilfe eine Institution sei, die sich alleine aus der Existenz des Kriminalitätsproblems im engeren Sinne entwickelt, sondern dass das Moment der sozialen Regulation der Daseinsvorsorge von Beginn an einen mindestens ebenso wichtigen Bestandteil ihrer Rationalität ausmacht, ist kaum zu bestreiten, dass das umfassende, sozialtechnologisch ausgerichtete, präventive Denken erstens beide Aspekte umspannt und in einen eng korrespondierenden Zusammenhang bringt, und zweitens einer politischen Rationalität und der Konstitution eines Feldes - genauer dem ‚space of rule’ ‚des Sozialen’ – den Weg eröffnet, auf den die Jugendhilfe unentrinnbar verwiesen ist. In diesem Sinne eröffnet der soziale Präventionismus die Bedingung der Möglichkeit für die Entstehung der Jugendhilfe in einem modernen Sinne: Prävention, als die Bearbeitung der Kontingenz von Risiken im Feld des Sozialen (dazu auch: Rauschenbach 1992), ist der Raison d'Être der Jugendhilfe. II. 4.3 ZUR KLASSIFIKATION PRÄVENTIVER STRATEGIEN Wenn es demnach möglich ist, alle Maßnahmen der Jugendhilfe auch aus der Perspektive der Prävention zu betrachten, so kann eine Analyse der Prävention der Jugendhilfe sinnvollerweise nur die Analyse und Interpretation der je vorherrschenden Strategien dieser Prävention sein, d.h. die Frage des Wie und des Weshalb und nicht des Ob. Hierfür sollen im nächsten Abschnitt die basalen Klassifikationsmöglichkeiten der Prävention diskutiert werden. Die Strategien der Prävention werden dabei unter anderem hinsichtlich ihrer ihres Objektbezugs, ihrer Funktion, ihres Zeitpunktes und ihres Theoriebezugs einer Taxionomie der Prävention geordnet. II. 4.3.1 BEREICHS- UND ZIELGRUPPENBEZOGENE KLASSIFIKATION DER PRÄVENTION Eine wesentliche Differenzierung der Präventionskonzepte zielt auf die Frage, in welchen Bereichen irgendetwas oder irgendjemand, abgeschreckt, vorgebeugt, verhindert, vermieden, reduziert, reformiert, integriert, kontrolliert, diszipliniert, beschützt, gesichert, unterstützt, (um)gelenkt, substituiert, verbessert oder aber in Ruhe gelassen werden soll. Grundlegend ist dabei die Unterscheidung, ob als Objekt der Prävention ein Akt bzw. die Tat selbst oder ein Akteur bzw. der Täter fokussiert wird. Beziehen sich die Präventionsbemühungen auf den Akt selbst, ist es möglich – aber nicht notwendig -, dass sie in einem konservierenden Sinne lediglich auf die bloße Verhinderung einer zukünftigen ‚Tat’ abzielen, d.h. auf die Erhaltung Status quo. Eine Orientierung am Akteur hingegen, z.B. durch pädagogische Einflussnahmen, verweist immer auf den Versuch, den potenziellen Urheber einer unerwünschten Handlung selbst zu ändern, d.h. nicht nur etwas Gegebenes zu erhalten, sondern eine 109 Alternative zu erreichen. Die am Akteur orientierten Maßnahmen gehen also im Sinne einer aktualen Veränderung über eine bloße zukunftsbezogene Verhinderung hinaus. Der zu verändernde aktuelle Zustand des potentiellen Täters, wird dabei als Ursache für das zu verhindernden Phänomen betrachtet. D.h. nach der präventiven Logik ist das zu Verändernde selbst nicht das ‚Problem’, sondern Indikator kontingenten Entwicklung deren mehr oder weniger wahrscheinlicher Endpunkt das ‚Problem’ darstellt. In dieser Hinsicht besteht „kein essentieller, sondern lediglich ein analytischer Unterschied zwischen Prävention und Intervention [. Allgemein …] lässt sich dann sagen, dass mit Bezug auf ein mehrstufiges kausalanalytisches Handlungsmodell die ‚Logik der Prävention‘ darauf gerichtet ist, den Ort des Eingreifens möglichst weit nach vorne zu legen“ (Kaufmann 1999: 924f). Dabei ist es jedoch nicht der Zustand des Bestehenden selbst, sondern eine hypothetische, wahrscheinlichkeitskalkulatorisch ‚berechnete’ Zukunft, die die Begründung und Legitimation für eine soziale Intervention (vgl. Otto 1991a) in das je Gegebene liefert. Bezogen auf das Gegebene ist der ‚präventive’ Eingriff aber nicht präventiv, sondern reaktiv. Er reagiert auf vergangene und gegenwärtige Phänomene und Geschehensabläufe. In diesem Sinne eignet sich der Begriff „Intervention […] besser als Prävention als Grundbegriff sozialwissenschaftlicher Analysen sozialpolitischer, medizinischer, psychologischer, sozialpädagogischer oder sozialarbeiterischer Maßnahmen, weil er die Perspektive des Beobachters von Handlungen impliziert und die Ambivalenz allen Eingreifens zu thematisieren gestattet“ (Kaufmann 1999: 925). Verlässt man die Position eines Beobachters der bloßen Vorgänge und bezieht die Ebene der diskursiven Interventionslegitimation mit ein, kann ‚Prävention’ innerhalb des Überbegriffs der Intervention analytisch nichtsdestoweniger dadurch spezifiziert werden, dass Intervention einen Eingriff in einen Geschehensablauf bezeichnet, während Prävention dessen Begründung und Zielrichtung formuliert. Wenn Interventionen ganz allgemein Reaktionen gegenüber Phänomenen darstellen, liefert Prävention eine spezifische Begründung für diese Reaktion, indem sie auf dem ‚riskanten’ - d.h. nicht zwangsläufig aktual ‚problematischen’ - Charakter dieses Phänomens aufmerksam macht. Zugleich beschreibt sie die Zielrichtung dieser Intervention, in dem sie auf die Intention einer - wie auch immer gearteten – Kontingenzbearbeitung im Sinne einer Einschränkung, Reduzierung, Kanalisierung oder Vermeidung einer unerwünschten Zukunft verweist. Klassifiziert man diese ‚präventiven’ Interventionen objektbezogenen, lassen sich, in fließenden Übergängen, personale, soziale, situative und ‚definitionsbezogene’ Präventionskonzepte unterscheiden, die sich, bezogen auf Kriminalprävention, in unterschiedlicher Intensität und Reichweite auf den ‚kriminellen’ Akt, seine situative Kontextuierung und die Beschaffenheit bzw. das Verhalten des Gegenstands bzw. des Opfers dieses Aktes richten oder auf den ‚kriminellen’ Akteur, seine Motive, ‚sozialen Bezüge‘ (vgl. Göppinger 1983) und die inneren und äußeren Bedingungen, denen er unterworfen ist. Während eine personale bzw. ‚dispositionale’ (vgl. Farrington 2002) Form der Kriminalprävention die einzelnen Akteure als empirische Individuen fokussiert und dabei die Annahme der Vorhersagbarkeit zukünftiger Abweichung aus den charakterisierbaren ‚Persönlichkeitsstrukturen’ impliziert, bezieht sich eine ‚soziale’ Kriminalprävention auf die Formen bzw. die Verkehrsbeziehungen des gesellschaftlichen 110 Lebens, und unterstellt dabei „die Prognostizierbarkeit der Auftretenswahrscheinlichkeit abweichenden Verhaltens in gegeben Milieus“ (Brumlik 2000c: 194). Personale (Kriminal)Prävention, richtetet sich auf die sozial, aber auch ‚bio-physikalisch’ inkorporierten oder genetisch prädisponierten, jedenfalls individualisierbaren Dispositionen und Vulnerabilitätsmuster (vgl. Resch 1996, Moffitt 1990) eines einzelnen Akteurs, im Sinne einer Eindämmung, ‚erzieherischen’ Veränderung und/oder Kompensation jener Risikofaktoren bzw. einer Stärkung jener protektiven Faktoren, die das Auftreten von normabweichendem, psychopathologischen oder ‚Risikoverhaltenweisen’ wahrscheinlicher – bzw. unwahrscheinlicher - machen (vgl. Reese & Silbereisen, Raithel 2002, Montada 1995, Farrington 2002). Während sich eine personale Form der Prävention auf die individualistisch gefassten dispositionalen Aspekte der positional-dispositionalen Matrix der Akteure bezieht, basiert eine soziale, bzw. ‚strukturelle’ Prävention im Kern auf der Annahme, dass Abweichungen Gründe haben, die außerhalb der Person des Abweichlers selbst liegen, etwa in der Organisation der Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Positionierung der Akteure und daraus erwachsenden Zwängen (strains) und/oder in den Interaktionsstrukturen zwischen dem Akteur und ‚dem Sozialen’ (vgl. Young 2001, Currie 1998). Obwohl diese Form der Prävention häufig von ‚fortschrittlichen’ Kräften eingefordert wird, die darauf verweisen, dass Sozialreformen, sozialer Ausgleich, soziale Sicherung, ein Abbau von Machtasymmetrien etc. inter alias auch eine Möglichkeit darstellen, um Abweichungen zu verhindern, ist, wie etwa Elliot Currie (1991) aufzeigt, ein Verweis auf die präventive Kapazität des Sozialen keinesfalls per se mit ‚liberalen’ oder sozialreformerischen Zielsetzungen verbunden. Es ist ein klassisch konservativer Standpunkt, dass ‚die Gesellschaft’ selbst das entscheidende Problem sei, wenn beispielsweise ihre zentralen Institutionen ebenso wie die zivilgesellschaftlichen Akteure zu wenig zur Durchsetzung von Werten, Moral, Konformität, Disziplin und der Kontrolle von Kriminalität beitragen (vgl. Melossi 2000). Mit Blick auf ihren dispositionssensiblen Positionsbezug lässt sich – unabhängig von ihrer Positionierung auf einer ‚progressiven’ oder ‚konservativen’ Seite – davon sprechen, dass eine teils spannungsreiche, vermittelnde Position, die sich auf einem Kontinuum zwischen den unterschiedlichen personalen bzw. dispositionalen und sozialen Ansätzen bewegt, im Kern die interventionsrationalitäts- und professionsadäquate Präventionsstrategie der Jugendhilfe darstellt. Weitgehend unberücksichtigt bleiben gesellschaftliche oder persönliche Dimensionen und Ursachenkomplexe in den tatorientierten, situationsbezogenen Strategien der Prävention. Diese zielen auf die Bearbeitung und Gestaltung der (sozial)räumlichen Gegebenheiten, die Gelegenheiten zur Abweichung induzieren, um diese zu erschweren, bzw. zu verhindern. Während der potentielle Täter in der Regel als ein im sozialen, psychologischen, biologischen und moralischen Sinne ‚ganz normaler’ – in der Regel rational kalkulierender – Akteur verstanden wird (vgl. Felson 1998, Clarke 1997, von Hirsch et al. 2001), beziehen sich die Interventionen auf eine - häufig technische - Gestaltung der Arrangements und räumlichen Settings, die auf die unmittelbaren Handlungsvollzüge der Akteure wirken (vgl. Ekblom 2001, Brantingham & 111 Brantingham 1995). Den professionellen Interventionsrationalitäten der Jugendhilfe kommt in diesen Präventionslogiken keine eigenständige ‚präventive’ Bedeutung zu. Die hier als ‚definitionsorientiert‘ beschriebene Form der Kriminalprävention bezeichnet weniger eine institutionalisierte, handlungspraktische Strategie, als eine akademische oder sozial- und kriminalpolitische Form der Wissenserzeugung und Präventionsperspektive, die zugleich auf weltanschauliche Selbstverständnisse und gesellschafts- und berufspolitisch wirksame Interessen verweist. Die praktische Relevanz einer ‚definitonsorientierten Prävention’ ergibt sich nur mittelbar, aus ihrer symbolischen Wirksamkeit als Machtmittel in der Strukturierung des Feldes der Kriminalitätskontrolle und im Sinne Generierung habitueller bzw. ‚doxischer’ Schemata auf Seiten der Akteure sozialer Kontrolle. ‚Definitionsorientierte’ Prävention ist Teil der Dynamik gesellschaftlicher Regulationen. Da gerade die Wahrnehmungen von Risiken in einem erheblichen Ausmaß sozialen Definitionsprozessen unterworfen sind (vgl. Beck 1986: 30), bezieht sich diese Form der Prävention auf die sozialen Risikoregulationen, durch die auf das differenzielle Kalkül von Gefahren Einfluss genommen wird (vgl. Ewald 1991). Dabei entspricht es der Logik der Prävention, ‚Gefahren’ dadurch bearbeit- und regulierbar zu machen, dass sie diese in ‚Risiken’ transformiert (vgl. Japp 1992), d.h. in jenes auf die „Gestaltbarkeit von Gesellschaft“ (Evers & Nowotny 1987) verweisende ‚moderne’ Konzept, das das ersetzt „was man sich früher als Fortuna dachte“ (Giddens 1990: 30). Prävention als die Form der Risikoregulation - ist eng entsprechend verbunden mit dem, was Bourdieu ‚symbolische Macht’ nennt, nämlich die Macht zu benennen und damit zu klassifizieren131. Klassifikation, so ist sich Bourdieu mit Zygmunt Baumann (1995: 14) einig, bedeutet nämlich vor allem „der Welt eine Struktur zu geben, ihre Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen; einige Ereignisse wahrscheinlicher zu machen als andere; sich zu verhalten als wären die Ereignisse nicht zufällig, oder die Zufälligkeit von Ereignissen einzuschränken oder zu eliminieren“. Insbesondere Mary Douglas hat darauf aufmerksam gemacht, dass der den präventiven Zielen und Gegenstandsbestimmungen logisch zu Grunde gelegte Begriff des ‚Risikos’ keine Essenz – wie es noch bei Beck (1986) anklingt -, sondern eine Denkform bezeichnet, oder, wie François Ewald in seiner Zurückweisung einer Vorstellung vom ‚Risiko per se’ zusammenfasst: „as Kant might have put it, the category of risk is a category of the understanding; it cannot be given in sensibility or intuition”. Die Rede vom Risiko beinhaltet also nicht nur den Rekurs auf die bloße Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, „but also the probable magnitude of its outcome, and everything depends on the value that is set on the outcome“ Douglas (1992: 31). Zur Bestimmung dieses ‚Outcome’ ist es notwenig, den Modus zu bestimmen „in which the identification of particular sources of threat and danger (and by extension whom we blame for them) refracts a given community's disposition towards order and authority […] The presentment of risk, therefore, is inherently political: it galvanizes action and prompts discourse“ (Sparks 1997: 425). In einem gewissen Sinn kann der Interpretation von François Dosse (1997: 372) zugestimmt werden dass Bourdieu „den Klassenkampf neu [fasst] als Kampf um die Klassifizierung“ 131 112 Die Bestimmung der Wahrnehmungsmodi von Risiken ist demnach ein Teil dessen, was mit Bourdieu als symbolische Macht beschreiben lässt. Risiken sind selbst nicht vorab bestimmt, sondern werden, als soziale Risiken, innerhalb eines positional-dispositionalen Kontextes durch die Dimensionen von Wahrscheinlichkeit, Regelmäßigkeit und Berechnung konstituiert. Dabei ist eine Gefahr oder ein Risiko nicht nur die Konstitution eines kausalen Zusammenhangs von gegenwärtig bestehender Lage und einem zukünftigen (bedrohlichen) Ereignis, sondern ein „Urteil über einen derartigen Zusammenhang“ (Preuß 1994: 527, Herv. H.Z.). Die präventive Qualität einer, quer zu allen anderen Formen der Prävention liegenden, ‚definitionsorientierten Prävention’ besteht dabei in einem symbolischen Kampf um hegemoniale Klassifikationsschemata, weil die Existenz eines Gegenstandes als zu prävenierendes Risiko weniger auf eine objektive Qualität, als auf die Erzeugung einer sozialen Wahrnehmung verweist (vgl. Douglas & Wildavsky 1982). Die Entwicklungen von bestimmten ‚Risiken’ als soziale Phänomene ist demnach in einem Prozess der symbolischen Produktion von ‚Anerkennung und Verkennung’ (vgl. Bourdieu 1982, 1987, 1998) eingelagert und kann dadurch ‚verhindert’ werden, dass ihre gesellschaftliche Er- und Anerkennung abgewehrt wird. Diese diskursive Form der ‚Prävention’ verweist auf die Konstitution der zu prävenierenden Sachverhalte und der angemessenen Strategien, die davon abhängen, welche ‚objektiven‘ Interessen (vgl. Bourdieu 1987) die Risiken und ihre Bewältigungsversuche berühren. Im Rahmen einer bereichs- und zielgruppenbezogenen Klassifizierung der Präventionsstrategien ist ferner eine von Sandra Walklate (1996) getroffene Unterscheidung hilfreich, die auf die – sehr stark auf die Wirkungen einer ‚definitionsorientierten Prävention’ verweisende - sozialstrukturell selektive Fokussierungen von Präventionsstrategien aufmerksam macht. Walklate unterscheidet zwischen ‚crimes of the street‘ als den ‚sichtbaren‘ Delikten im öffentlichen Raum, die vor allem bei marginalisierten Gruppen vermutet werden, ‚crimes of the suit‘ als den Verbrechen der Eliten und ‚crimes behind closed doors‘ als den Delikte, die sich im geschützten, privaten, beziehungsweise intimen Raum, wie beispielsweise der Familie, ereignen. Diese Differenzierung kann um die risikoträchtigen, aber kaum dramatisierten beziehungsweise kriminalisierten Routinen und Aktivitäten der ‚Wohlanständigen’ oder um die ‚Abweichung der Angepassten‘ (vgl. Frehsee 1991) einerseits und um die ‚Verbrechen’ des Staates und seiner Institutionen (zum Problem: Huggins 1998, 2000, Jäger 1989) andererseits erweitert werden. Eine solche Unterscheidung ist in sofern analytisch hilfreich, wie die unterschiedlichen ‚Arten’ von Abweichung (vgl. Peters 1995), von Mitgliedern unterschiedlicher Klassen, aber auch von unterschiedlichen Alters- (vgl. Sessar 1997) und Geschlechtergruppen (vgl. Heidensohn 2002) in unterschiedlicher Form und Häufigkeit und in verschiedenen sozialen Praxisfeldern verübt werden: ebenso wie alle anderen Praxisformen (vgl. Bourdieu 1985, 1987, Bourdieu & Wacquant 1996) sind auch alle Abweichungsformen im weitesten Sinne klassenspezifisch (vgl. Quinney 1977). Empirisch betrachtet richtet sich Kriminalprävention jedoch überproportional häufig auf bestimmte Delikte vergleichsweise machtloser Gruppen und auf bestimmte, in der Regel subdominante Akteure, die vornehmlich im öffentlichen Raum situiert sind (vgl. Walklate 1996): Offensichtlich werden ‚Risiken’ sozialstrukturell hoch selektiv konstruiert. 113 II. 4.3.2 DIFFERENZIERUNG VON PRÄVENTION NACH FUNKTIONEN Nicht nur die präventiven Funktionen des Strafrechts (vgl. Hübner 1997), sondern auch die Präventionsbemühungen sub- und prä-justizieller Instanzen – der Jugendhilfe inklusive - lassen sich funktionsspezifisch in Strategien der negativen und positiven Spezial- und Generalprävention sowie Strategien der ‚Unschädlichmachung’ einordnen. Die Präventionsstrategien basieren hierbei auf negativ sanktionierenden Kontrolltechniken, die abweichendes Handeln neutralisieren sollen und bedingungsverändernden Strategien, die auf Änderungen von Personen, soziale Lagen und Situationen zielen (vgl. Peters 1995: 137ff): - Negative Spezialprävention richtet sich auf den (potentiellen) Täter selbst. Sie soll den Einzelnen durch das verbüßen, oder die Androhung von Strafe - einem absichtsvollen Zufügung von Leid (vgl. Christie 1986) - abschrecken, und ihn dazu bewegen, sich (in Zukunft) konform zu verhalten um Strafe zu vermeiden (Zimring & Hawkins 1973). - Auch negative Generalprävention oder Abschreckungsgeneralprävention ist „auf die der Sanktionsdrohung und einer gegebenen Sanktionspraxis eigene Abschreckung potentieller Normbrecher bezogen“ (Albrecht 1993: 157). Jedoch dient die Sanktionierung eines Straftäters nicht dazu, nur ihn, sondern in erster Linie auch alle anderen, potentielle Folgetäter von ihrem Vorhaben abzubringen (vgl. Kunz 1998, Lamnek 1994: 226). Die Akteure an denen punitive Maßnahmen vollzogen wird, sind demnach nicht mit denen identisch, auf die sich die präventive Wirkung beziehen soll. Paradigmatisch für Strategien negativer Generalprävention sind symbolisch expressive und andere sichtbar gemachte Formen der Überwachung, Drohung und Bestrafung (bis hin zu Chain-Gangs und post-modernen Varianten des Prangers vgl. Etzioni 1997a). - Positive Spezialprävention ist die präventive Leitidee des so genannten ‚Erziehungsgedankens’ im Jugendstrafrecht und die Basis des ‚rehabilitativen Ideals’ (vgl. Allen 1981) der Behandlungsansätze des ‚Straf-Wohlfahrtskomplexes’ insgesamt. Sie zielt auf die ‚Verbesserung‘ der sozialen Kompetenzen und moralischen Haltungen, bzw. der Erziehung, Therapie, Resozialisierung und normativen Umorientierung des einzelnen Täters. - Positive General- oder Integrationsprävention zielt auf die ‚Einübung von Rechtreue‘ und eines allgemeinen Rechtsbewusstseins (vgl. Müller-Tuckfeld 1996), sowie verallgemeinerten Formen einer - kontrafaktischen - Stabilisierung von Verhaltenserwartungen (vgl. Luhmann 1983) und damit auf die Legitimation des Rechts und die Stärkung des Rechtgüterschutzes (vgl. Lamnek 1994). Allgemein formuliert besteht die Aufgabe dieser Form der Prävention in der „Erhaltung der Norm als Orientierungsmuster für sozialen Kontakt“ (Jakobs 1991: 11). Positive Generalprävention bezeichnet den Versuch, durch Drohung und Vollzug von Strafen die Geltung von Strafrechtsnormen zu verdeutlichen (vgl. von Trotha 1987) um den ‚materiellen’ Effekt zu erreichen, dass sich die (scheinbar) ‚konforme’ Mehrheit auch weiterhin konform verhält. Obwohl die Integrationsprävention, im Sinne einer Präventionsform, die überwiegend 114 auf symbolische Wirkungen zielt, als die am schwierigsten einer systematischen, empirischen Prüfung zu unterziehende Präventionsform gilt – und als Straflegitimation in der zeitgenössischen strafjustiziellen Landschaft eine deutliche Aufwertung erfährt (vgl. MüllerTuckfeld 1996, Schünemann et al. 1998) –, lässt sich alleine aus logischen Gründen davon sprechen, dass diese ‚Integrationsprävention’ nur solange funktionieren kann, wie Normbrüche als Ausnahme definiert sind. Popitz (1968) spricht von einer ‚Präventivwirkung des Nichtwissens’, auf Basis der Einsicht, dass eine integrative Wirkung präventiver Bemühungen weder auf einem Minimum, noch auf einem Maximum, sondern auf einem (selektiven) Optimum an Verhaltenstransparenz basiertt. Hält man sich den empirischen Verbreitungsgrad von Normbrüchen vor Augen, kann die so begründete Form der Strafe demnach „ihre soziale Wirksamkeit nur bewahren, solange die Mehrheit nicht bekommt, was sie verdient.“ (Popitz 1968: 20) Die Modi von Spezial- und Generalprävention ergänzen sich zwar teilweise gegenseitig, stehen aber zugleich auch in einem Spannungsverhältnis. Der Einsatz spezialpräventiver Maßnahmen wird reguliert, beziehungsweise endet dort, „wo die Beschädigung des Vertrauens der Allgemeinheit in die Wirksamkeit der Strafrechtspflege sowie des allgemeinen Rechtsbewusstseins befürchtet wird“ (Albrecht 1993: 157). Die Bedeutung des Strafrecht bei den Funktionen ‚negativer‘ Prävention – die im Modus der Abschreckung funktionieren - liegt auf der Hand. Nachdem die ‚negative’ Prävention, durch den Einzug des Wohlfahrtsstaates in das Strafrecht, vor allem ab den 1960er Jahren zumindest rhetorisch in Misskredit geraten war, gewinnt sie auf der Basis der Annahme neo-klassischer und ökonomischen Ansätze wieder an praktischer und ideologischer Bedeutung (vgl. Cornel 1985, Tzannetakis 2001), „dass die Häufigkeit des Auftretens krimineller Handlungen von der Wahrscheinlichkeit und der Schwere staatlicher Strafe sowie der Schnelligkeit, mit der Strafe eintritt, abhängt“ (Albrecht 1993: 157). Aber auch das Wegsperren selbst kann, im Sinne einer ‚(selective) Incapacitation’ (vgl. Zimring & Hawkins 1995), über eine mögliche Abschreckungswirkungen hinaus, eine empirisch durchaus effektive Präventivfunktionen beinhalten (vgl. MacKenzie 1997): Wegsperren kann als Prävention durch ‚Unschädlichmachung’ verstanden werden. Unschädlichmachung ist eine fünfte, logisch eigenständige, mögliche präventive Funktion von Interventionen, die in zeitgenössischen ‚Risikogesellschaften’ (wieder) deutlich an Gewicht gewinnen. Dabei geht es darum, missliebige, riskante oder störende Elemente aus einzelnen Sektoren oder aus ‚der Gesellschaft’ insgesamt zu entfernen, um zugleich ihr Risikopotential zu beseitigen oder zu kanalisieren: Wer strikt überwacht wird, so lässt sich argumentieren, begeht weniger, wer Knast sitzt begeht, während dieser Zeit, zumindest in Freiheit, keine Straftaten und wer hingerichtet wird, überhaupt keine mehr. Es ist nicht nur im internationalen Vergleich sehr variabel, sondern es lässt sich auch auf der je nationalen Ebene eines Rechtsraums nicht mit Bestimmtheit sagen, für welche Akteure diese ‚Unfähigmachung’ als angemessene Präventionsstrategie betrachtet wird (vgl. Garland 2001a, Wacquant 2001). Claude Faugeron (1995) unterscheidet drei kategoriale Gruppen, für die ‚Unfähig’- bzw. Unschädlichmachung durch (punitiven) 115 Ausschluss, mit unterschiedlichen Begründungen, Anwendung findet: die ‚Gefährlichen’, um ‚die Gesellschaft’ bzw. potentielle Opfer zu schützen, die ‚Anderen’, zur Exklusion der als unerwünscht Klassifizierten und eine Gruppe, die in so fern als die der ‚Störer’ bezeichnet werden kann, wie ihre ‚Unfähigmachung’ aus Autoritätsgründen geschieht, wenn die Staatsmacht, bzw. ihr reibungsloses Funktionieren in Frage gestellt wird. ‚Unfähigmachungen’ als präventive Strategien müssen nicht immer punitiven Charakter haben. Eher ‚aussperrende’ als ‚einsperrende’ Formen der (sektoralen) Unschädlichmachung sind beispielsweise Platzverweise zur ‚Gefahrenabwehr’, selektive Einreiseverbote für ‚Hooligans‘ bei internationalen Fußballtournieren, Abschiebungen von ‚kriminellen Ausländern‘, nächtliche Ausgangssperren für Jugendliche aber auch Eingangskontrollen etwa durch Türsteher vor Lokalen und Clubs oder den Sicherheitsdienst einer Universität. ‚Unschädlichmachung‘ als analytische Einheit bemisst sich nicht an der Intensität oder einem repressiven Gehalt der Maßnahmen. Werden längere Öffnungszeiten für Jugendhäuser gefordert, damit sich Jugendliche nicht auf der Straße aufhalten und dadurch ‚Jugendauffälligkeiten‘ in öffentlichen Räumen zurückgehen (vgl. IM Baden-Württemberg 1997b: 117), so zielt diese Forderung argumentationslogisch nicht auf die präventive Leistung der Jugendarbeit selbst, sondern auf die Wirkung des Fernhaltens aus anderen, spezifischen sozialen Feldern - in diesem Falle in der geographischen Dimension der Innenstädte. Analytisch liegt der funktionale, kriminalpräventive Gehalt aller Formen des Verwahrens – ob in Jugendhäusern, geschlossenen Heimen oder Segelschiffen auf dem offenen Meer –, jenseits aller anderen Absichten, auch in der Funktion einer temporalen und/oder sektoralen Unschädlichmachung. Die Jugendhilfe, als ein Teilsystem, das sowohl „mit der vorsorglichen Vermeidung und kurativen Beseitigung von Normverletzungen beziehungsweise mit der Gewährleistung durchschnittlich erwartbarer Identitätsstrukturen“, als auch auf einen verallgemeinerten Schutz von Normalitätsvorstellungen (Olk 1995: 23) zielt, kann mit unterschiedlichem Schwergewicht für sich reklamieren, auf allen fünf Ebenen zu wirken. Kriminalprävention durch die Jugendhilfe kann hierbei sowohl innerhalb des Strafrechts greifen, als auch als eine Alternative zu diesem. So beinhaltet das verfassungsmäßig im Strafrecht verankerte Verhältnismäßigkeitsgebot, dass sich strafrechtliche Maßnahmen als „erforderlich und geeignet erweisen [müssen]. Erforderlich sind Strafrecht und Strafe aber nur dann wenn nicht andere, weniger einschneidende Mittel und Verfahren zur Verfügung stehen, die mindestens dasselbe Ausmaß von Prävention gewährleisten“ (Albrecht 1995: 19). Wenn auch nicht unbedingt politisch, so gilt das Strafrecht zumindest in rechtlicher Hinsicht als ‚ultima ratio’, die den jugendhilferechtlich begründeten, vergleichsweise weniger einschneidend und eingriffsintensiven Maßnahmen132 nach gelagert sein sollen. Dabei liegt der Schwerpunkt der Jugendhilfe nicht auf der ‚negativen’, sondern auf der ‚positiven’ Spezial- und Generalprävention. So arbeitet die Jugendhilfe – auch völlig ohne Bezug zum Strafrecht- im Modus einer ‚positiven’ spezialpräventiven Perspektive, wenn sie versucht, „den individuellen Fall an die generalisierte Diese Einschätzung hat zumindest dann Gültigkeit, wenn sie auf Überlegungen bezogen ist, ob man einem konkreten Handeln x mit strafrechtlichen Sanktionen oder jugendhilferechtlichen Angeboten begegnet. 132 116 Bezugsnorm anzupassen, also potentiell abweichende Adressatengruppen durch entsprechende Angebote und Unterstützungsleistungen in die Lage zu versetzen, geltenden Normen selbstständig zu folgen“ (Olk 1995: 23), und auch innerhalb des Jugendstrafrecht soll die Jugendhilfe - vor allem im Kontext des so genannten ‚Erziehungsgedankens’ - zur positiven Spezialprävention beitragen. Wenn soziale Inklusion eine funktionale Aufgabe der Jugendhilfe darstellt, ist der Modus ‚positiver’ Generalprävention, bzw. Integrationsprävention ebenfalls ein zentraler sozialpolitischer Bezugspunkt (kriminal-)präventiver Sozialer Arbeit. Dieser Aspekt realisiert sich handlungspraktisch insbesondere dann in einer pointierten Form, wenn nicht ein einzelner sozialer Akteur, sondern - wie zum Beispiel im Falle der ‚sozialräumlichen Orientierungen’ – ein Kollektiv von Akteuren das Objekt der Interventionen der Jugendhilfe bildet. Analytisch lassen sich aber alle integrativen Bemühungen der Jugendhilfe bzw. Sozialer Arbeit im allgemeinen, makrosozial auch als Beitrag zur Erhaltung des ‚sozialen Friedens’, als ‚kollektives Gut’ und damit als positive Generalprävention betrachten. Dies gilt insbesondere, wenn sie sozial- und jugendpolitisch agiert und reagiert, um die Bedingungen aus denen Devianz erwachst könnte zu ändern, und damit gleichzeitig zu einer stabilen, nicht-inkrimierten Form der Bedürfnisbefriedigung (vgl. Viehmann 1995: 11) innerhalb der praxisökonomisch je hegemonialen Strukturen einer Gesellschaft beiträgt. Damit sorgt sie zum einen für Integrationsmöglichkeiten in die gesellschaftliche ‚Normalität’ bestehender Gesellschaftsstrukturen bzw. für die Integration in die Logik der einzelnen sozialen Felder und trägt dabei gleichzeitig zur Reproduktion dieser Normalität und Normalitätsvorstellungen bzw. der Stabilisierung der bestehenden, feldspezifischen Ordnung bei. Als eine interventionslogisch primär auf die ‚positiven’ Formen der Prävention gerichtete Institution, ist die Beziehung der Jugendhilfe zur ‚negativen’ General- und Spezialprävention durchaus spannungsreich und teilweise widersprüchlich. Zunächst impliziert die Intervention der Jugendhilfe das genaue Gegenteil ‚negativer’ Präventionsformen. Sie wird, wie Müller und Sünker (1995: 304) ausführen, unter anderem gerade deshalb eingesetzt, weil sie „den Vorteil, [… bietet, dass sie] offen ist auch für die ex-post-Zuordnung neuer Maßnahmen, die – würden sie als Strafe deklariert – in der Bevölkerung eine geringere Akzeptanz hätten“. Andererseits unterscheiden sich – besonders plastisch verdeutlicht im Kontext geschlossener Heime -, die „Einrichtungen des Sozialstaates […] gelegentlich, was den Kontaktverlust zur Außenwelt und die psychischen Wirkungen auf die Insassen angeht, kaum von denen des strafenden Rechtsstaats“ (Stolleis 1980: 141, im Überblick: Chassé 1999). Wesentlich bedeutsamer als ihre ‚reale’ Wirkung, ist für die Zuordnung zu einem Präventionsmodus jedoch die zu Grunde gelegte Rationalität und Art der Begründung einer Intervention. Wenn im Kontext der zeitgenössisch revitalisierten Idee der Wichtigkeit des ‚Grenzen setzten’ und der ‚schnellen und spürbaren Normverdeutlichung’ (vgl. DJI 2001) im „pädagogischen Feld […] Erziehung und Strafe uno actu zusammenfallen“ (Böhnisch 1999: 188) sollen, ist damit – unabhängig von einem noch näher zu analysierenden, durch diese Positionen zum Ausdruck gebrachten Erstarken neokonservativer Prämissen in der Jugendhilfe – auf die analytische Möglichkeit verwiesen, Interventionen der Jugendhilfe auch als Momente der negativen Spezialprävention zu fassen. In einem empirischen Sinne werden die Interventionen der Jugendhilfe von ihren Adressaten auch 117 durchaus als ‚abschreckende’ Strafe erlebt: Das ‚Abschreckungspotential’ von Jugendhilfemaßnahmen, braucht den Vergleich zu anderen formellen Sanktionsandrohungen nicht zu scheuen. Folgt man einer Untersuchung von Karstedt (1999: 20) zu Schwereeinschätzungen erlebter Sanktionen, so wurden Maßnahmen des Jugendamtes von 57,1 % und Schadenswiedergutmachung unter Aufsicht eines Sozialarbeiters zu 60,0 % der Befragten als „sehr schlimm oder ziemlich schlimm“ eingestuft, während dies im Falle einer Verhängung einer Geldstrafe und eines Absitzens der Strafe an einigen Wochenenden oder Wochentagen in einer Jugendarrestzelle für je 0,0 % der Befragten (!!) der Fall war. Die negativen spezialpräventiven Momente der Jugendhilfe lassen sich auch generalpräventiv verallgemeinern: „Unter generalpräventiver Perspektive bedeutet der Schutz einer Norm […] vor allem das Bestreben durch einen geeigneten Umgang mit devianten Personengruppen (z.B. in Form von Bestrafung oder Ausgrenzung) die Gültigkeit der Norm zu bestätigen und die übrigen Mitglieder der Gemeinschaft abschreckungswirksam davon abzuhalten, die Norm zu brechen“ (Olk 1995: 23). Eine Unterscheidung von ‚positiver’ und ‚negativer’ Spezial- und Generalprävention ist insofern eher in Bezug auf die Argumentations- und Legstationsrationalität als in einem essentiellen maßnahmeimmanenten Sinne möglich. Nicht nur in der Jugendhilfe kann ein und dieselbe Maßnahme verschieden begründet werden. So erfordert etwa der strafrechtliche Versuch von Stabilisierung des Rechtsbewusstseins (‚positive Generalprävention‘), die Demonstration der Gültigkeit der Norm d.h. eine Anwendung der Normen auf einzelne Straftäter, die auf dieser Ebene ebenso gut als ‚negative Spezialprävention’ betrachtet werden könnte. Für die Attribute ‚positiv’, ,negativ’, ‚general’ oder ‚spezial’ ist offensichtlich weder die Frage, wie schwerwiegend die ‚präventiven’ Maßnahmen ‚subjektiv’ empfunden werden, noch die Frage, wie hoch oder rigide die intendierte oder ‚objektive’ Eingriffsintensität ist, ein Unterscheidungskriterium. So ist häufig gerade nicht der Verweiß auf die positive Spezialprävention, der die Eingriffsintensität einer Maßnahme begrenzt, sondern es sind die Grundsätze von Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit, die allzu ‚präventive’ Überlegungen in die Schranken weisen (empirisch: Dünkel 1990). Es ist empirisch durchaus vertretbar, von einem Schutz des Täters vor dem Erziehungsgedanken (vgl. Albrecht 2000) - und vor der Zudringlichkeit und der Intensität der Vorschläge von Jugend- und Jugendgerichtshilfe (vgl. Heinz & Hügel 1986, Drewniak et al. 1997) - durch das Strafrecht zu sprechen. II. 4.3.3 KLASSIFIKATION DER PRÄVENTION NACH DEM ZEITPUNKT DER INTERVENTION Aus der Medizin ist die auf Georges Caplan (1964) zurückgehende Differenzierung hinsichtlich des Zeitpunktes der Maßnahmen in Form von primärer (Fokus auf die Gesamtpopulation), sekundärer (frühestmögliche Diagnose) und tertiären Prävention (Rehabilitation) entnommen (vgl. Pschyrembel 1993: 1238). Auf das Feld des Sozialen und der Kriminalitätskontrolle übertragen ist das bemerkenswerte dieser Klassifizierung zunächst eine Begriffsstrategie Interventionsform als Prävention gekennzeichnet wird (vgl. Kaufmann 1999: 925). 118 durch die jede Zugleich ist in einer Übertragung auf das Feld des Sozialen der implizierte Zeit(punkt)bezug der Intervention eher irreführend, weil oft alle drei Formen der Prävention faktisch parallel stattfinden (vgl. Pease 1997). Der ‚sekundären’ und ‚tertiären’ Form der Prävention ist dabei eine mittelbar oder unmittelbar personalisierende Strategie immanent, während ‚primäre Prävention’ auch weitergefasste, vom Einzelnen abstrahierende, sozialpolitische bzw. gesellschaftsstrukturelle Momente impliziert. Bezogen auf das Feld der Kriminalitätskontrolle lassen sich die einzelnen Dimensionen wie folgt charakterisieren: Primäre Prävention bezeichnet Maßnahmen, die durch eine Bearbeitung gesellschaftlicher Verhältnisse und Bedingungen (vgl. BMJFFG 1990: 85), bzw. durch eine Beeinflussung ‚tieferliegender Ursachen‘ die Entstehung von Abweichungen verhindern sollen. Primäre Prävention setzt insofern logisch unabhängig von dem Vorliegen manifester ‚Risikofaktoren’ ein. Im Sinne einer Beeinflussung der sozialen oder räumlich-situationalen Bedingungsmatrix „without reference to criminals or potential criminals“ (Pease 1994: 660) reflektiert sie somit generelle Fragen sozial- und ordnungspolitischer Regulation (vgl. Brantingham & Faust 1976, Crawford 1998, Gilling 1997). Primäre Prävention lässt sich als eine vom einzelnen Akteur bzw. vom einem identifizierten Träger von Risiken abstrahierende, grundlegende Regulation fassen, die normierend auf strukturelle soziale Konflikte mit dem Ziel einer spezifischen Form gesellschaftlicher Reproduktion wirken soll (vgl. Peters & Kunstreich 1990, Böllert 1992). Als ‚primäre Prävention’ und gesellschaftliche Regulation das Lohnarbeit-Kapital-Verhältnis in verallgemeinerter Form präsentiert sich demnach vor allem die Sozialpolitik und das ‚primäre’ System sozialer Sicherung. Demgegenüber kann Soziale Arbeit dadurch charakterisiert werden, dass sie sich, im Sinne einer institutionalisierten, ‚vergesellschaftete Sozialisationsarbeit’, auf die einzelnen gesellschaftlichen Akteuren – als individuelle oder kollektive ‚Subjekte’ - richtet (vgl. Kessl et al. 2002). Nicht nur mit Rekurs auf die Inkorporierungsnotwenigkeit der Machtmittel soziales und kulturelles Kapital, auf denen die Interventionen der Jugendhilfe basieren, sondern insbesondere auch im Kontext einer dienstleistungstheoretischen Begründung der Jugendhilfe, wird auf diesen Personenbezug aufmerksam gemacht, wenn explizit auf ein ‚uno-actu-Prinzip’ (vgl. Herder-Dornreich & Klötz 1972) der Leistungserbringung rekurriert wird, die ‚an’ einer Person erbracht werden muss (vgl. Blanke & Sachße 1987), und in so fern auf die Notwenigkeit einer empirischen Anwesenheit dieser Person verweist. In diesem Sinne ist es fraglich, ob primäre Prävention in einem analytisch engen Sinne überhaupt ein systematischer Bestandteil des Aufgaben- bzw. den Möglichkeitsbereichs der Jugendhilfe sein kann. Zwar betreibt Jugendhilfe auch allgemeine Formen der Aufklärung, sie mag entsprechende allgemeine ‚Bildungsprozesse’ auslösen, die sich mit Blick auf das präventive Moment auch als eine mögliche Form ‚primärer Prävention’ beschreiben lassen könnten, auch nimmt Jugendhilfe – etwa als Teil ‚lokaler Sozialpolitik’ (vgl. Olk & Otto 1989) – durchaus sozialpolitisch Einfluss und gestaltet - etwa mit Blick auf die Sozial- bzw. die Jugendhilfeplanung – insbesondere kommunale Sozialpolitik auch selbst mit, dennoch vollziehen sich ihre professionellen Leistungserbringungen, als eine Instanz der Erbringung personenbezogener sozialer Dienstleistungen – unabhängig von einer ‚ökologischen 119 Wende’ in der Sozialen Arbeit (vgl. Blanke & Sachße 1989) - mit einem dispositionssensiblen Blick auf die Akteure und damit analytisch auf der Ebene ‚sekundärer Prävention’. Hierauf verweist auch der 10. Kinder- und Jugendbericht, der davon spricht, dass primäre Prävention für die Jugendhilfe „nur eine programmatisch-strategische Zielvorstellung anzeigen [könne]. Primäre Prävention ist […] eher ein politisch-legitimatorischer Begriff, der die ‚Philosophie’ des KJHG formuliert und nicht eine konkrete Handlungsanleitung für die Praxis“ (BMFSFJ 1998: 178). Überraschenderweise hat es sich mit Bezug auf ‚kriminalpräventive’ Aufgaben der Jugendhilfe in der einschlägigen bundesdeutschen Literatur durchgesetzt, unter anderem die Bearbeitung von ‚sozialen Mängellagen’ und ‚Defiziten in der Sozialisation’ (vgl. Koetzsche 1995: 441) bzw. von ‚Armut und psycho-sozialen Belastungen’ (vgl. Lüders 1999) der ‚primären Kriminalprävention’ zuzuordnen. Diese Einordnung ‚primärer’ Kriminalprävention kann analytisch nicht überzeugen: Wenn diese Interventionen als zur Verhinderung bzw. Verringerung von Straftaten geeignete Maßnahmen dargestellt werden, dann liegt dieser Strategie die Annahme zugrunde, dass solche (Entwicklungs-) Belastungen - gleich ob materieller, kultureller oder psychischer Natur –, Ursachen oder Auslöser für Abweichungen bzw. ein Abweichungsrisiko darstellen (vgl. Plewig 1990: 23). In diesem Falle wären die diesen Belastungen ausgesetzten individuellen oder kollektiven Akteure als ‚gefährdet‘ identifiziert. Die (pädagogischen) Interventionen, die auf diese Gefährdung reagieren sind demnach Reaktionen auf Risikofaktoren und d.h., analytisch betrachtet, keine Maßnahmen der ‚primären’ sondern Maßnahmen der ‚sekundären‘ Kriminalprävention. Um pädagogische Interventionen als primäre Prävention im analytischen Sinne zu verstehen, müssten sich diese Maßnahmen ausschließlich auf die Regulation dieser Umstände beziehen, ohne - als „Reaktionen auf die unerwünschten Nebenfolgen sozialer Problemlagen“ (Scherr 2000: 75) - eine Verknüpfung zu den hiervon Betroffenen als Risikogruppe bzw. potentiell ‚Deviante‘ herzustellen. Ein solcher ‚dispositionsunsensibler’ Versuch der strukturellen Beeinflussung der Prävalenz von Abweichung - ohne Bezug auf die Inzidenzrate – mag als theoretisches Modell möglicherweise denkbar sein, steht in jedoch einem Spannungsverhältnis zu den praktischen und professionsstrukturellen Handlungslogiken der Sozialen Arbeit. In zeitpunktbezogener Hinsicht stellt also die so genannte ‚sekundäre Prävention‘ analytisch wie praktisch die (kriminal-)präventive Haupt-, oder radikaler formuliert, die strukturell einzige Interventionsform der Jugendhilfe dar. Folgt man Pease (1997: 965) ist diese Präventionsform nicht nur die Form der Prävention der Institutionen Sozialer Arbeit, sondern diese ist auch umgekehrt deren hauptsächlicher Träger: „youth work assume ledership in secondary prevention“. „Secondary prevention seeks to change people, typically those at high risk of embarking upon a criminal career, before they do so“ (Pease 1997: 965). Sie bezieht sich auf ‚identifizierte‘, potentiell gefährdete oder gefährliche d.h. riskante Akteure. Von sekundärer Prävention ist dann die Rede, wenn auf der Basis von Gefährdungsmerkmalen - als Rückfall hinter die gültigen ‚Kulturideale‘ (vgl. Cremer-Schäfer & Steinert 1998: 63) - oder „im Anschluss an abweichendes Verhalten Maßnahmen ergriffen werden, um künftig ein solches zu verhindern“ (Lamnek 1994: 227). Auch opferbezogene Maßnahmen, die auf eine Veränderung des (Risiko-)Verhaltens potentieller Opfer zielen, um diese vor Straftaten zu schützen fallen unter den Modus sekundärer Prävention. 120 In der Logik sekundärer Prävention werden also aktuale, auf die ‚Behandlung’ bereits eingetretener unerwünschte Entwicklungen oder Ereignisse zielende Intervention zugleich als zukunftsbezogene Prävention begründet. Insbesondere auf der Ebene ‚sekundärer Prävention’ wird demnach deutlich, dass Unterschied von ‚Prävention’ und ‚Intervention’ kein substanzieller, sondern ein symbolischer ist: ein Unterschied der sich ausschließlich auf der Ebene der Begründung und Legitimation zeigt. Mit Blick auf die bundesdeutsche akademische Debatte drängt sich in diesem Kontext auch hinsichtlich der Zuordnung der Interventionen sozialer Kontrolle zur ‚primären‘, ‚sekundären’ und ‚tertiären‘ Prävention der Verdacht auf, dass es selbst bei den Systematisierungsversuch dieses ideologisch sehr stark besetzten Themas weniger um analytische Konsistenz und Plausibilität, als um eine Hierarchie des - fachlich oder sozialpolitisch – Wünschenswerten geht. Maßnahmen die auf eher eine ‚edle‘ sozialpolitische bzw. sozial ausgleichende Dimension verweisen werden als ‚primäre‘ Prävention verhandelt, während offensichtlich sicherheitsfixierte Maßnahmen nahezu ausschließlich der ‚sekundären‘ (und ‚tertiären’) Prävention zugeordnet werden133 Dies gilt nicht nur hinsichtlich einer ‚Beseitigung von Sozialisationsdefiziten’ als ‚primäre Prävention’ sondern auch in Bezug die Zuordnung einer auf (räumliche) Situationen rekurrierende „Veränderung der Tatgelegenheitsstrukturen, Verringerung von Zielobjekten, Erhöhung des Schwellenwerts erforderlicher Täterenergie“ (Koetzsche 1995: 442) als ‚sekundäre‘ Kriminalprävention. Diese Präventionsform hat zwar weniger einen ‚sozialen’, als einen ‚sicherheitsmateriellen’ Charakter, aber dies kann keine analytische Rechtfertigung sein, sie der ‚sekundären’ Prävention zu zuordnen. Vielmehr lässt sich davon sprechen, dass sie darauf ausgerichtet ist, das (territoriale) Setting, in dem das soziale Leben stattfindet, in einem intentionalen und zielgerichteten Sinne, aber ohne direkte – bzw. immanente - Referenz auf die Gefährdungsmerkmale Einzelner zu regulieren. Räumliche, bauliche und technische Beeinflussungen des sozialen Verhaltens ebenso wie Manipulationen und Kanalisierungen des sozialen Setting und der sozialen Verkehrsströme, sind d analytisch keine ‚sekundäre’ Prävention, sondern können vielmehr als eine auf die Gesamtpopulation bezogene Strategie der ‚environmental defence’ und in diesem Sinne als ein Idealtyp ‚primärer’ Prävention angeführt werden (vgl. Lab 1997, Pease 1997, 2002). Analytisch sich demgegenüber auf Abschreckung einzelner zielende Maßnahmen ebenso zur sekundären Prävention zu rechnen, wie Bemühungen „durch beratende, behandelnde und betreuende Angebote“ (Böllert 1992: 161), oder allgemeiner „durch aktive Stützung normangepassten Verhaltens“ (Trenczek & Pfeiffer 1996: 14), d.h. durch Veranlassung zu einem „rechtschaffenden bis disziplinierten Lebenswandel“, als der „individuellen Bringschuld für ‚Integration’“ (Cremer-Schäfer/Steinert 1998: 64), eine Verfestigung von Abweichung bzw. das Umschlagen von einem Risiko – einer potentiellen Inzidenz - in eine virulente Inzidenz zu verhindern. Das Ziel der Jugendhilfe kann dabei, in Anlehnung an Lothar Böhnisch (1982), als das einer ‚sekundären Normalisierung’ und als Versuch der Schaffung Dabei mag es durchaus sein, dass spezifisch deutsche Einordnung, der Tendenz geschuldet ist ‚zuerst‘ auf sozialpolitische Maßnahmen zurückzugreifen – oder diese zumindest rhetorisch hervorzuheben - bzw. , skeptischer formuliert, zunächst sozialpolitische Maßnahmen auf ihren möglichen kriminalpräventiven Gehalt hin abzuklopfen. Diese Einordnung ist dann jedoch vor allem als eine (legitimatorische) Erklärung des ‚guten Willens‘ dienlich als von analytischer Überzeugungskraft. 133 121 einer (Re)Integrationsperspektive für potentiell, partiell oder temporär Ausgegrenzte verstanden werden. Allerdings ist Strategien einer ‚sekundären’ und ‚tertiären’ Prävention, insbesondere vor dem Hintergrund ihres personalen Bezugs, ein zentrales Problem immanent, nämlich das, der Verhältnismäßigkeit ihrer Interventionen. So ist in der auf ‚Gefährdungsmerkmale’ zielenden sekundären Prävention nicht anders als der ‚tertiären’ Prävention eine Form der Subjektorientierung angelegt, in der die ‚Klientenkarriere’ in den Mittelpunkt gestellt wird134 (vgl. Otto 1983: 219). Richten sich die Präventionsbemühungen in dem jugendhilfetypischen Bezug auf die positional-dispositionale Matrix primär auf dispositionale bzw. individualbiographische Aspekte, d.h. zielen sie also auf eine „Persönlichkeitsveränderung des Täters […], so kann diese ‚Maßnahme‘ nicht mehr vorab begrenzt werden. Das Maß bestimmt sich vielmehr am Grad des spezifischen Persönlichkeitsdefizits in einem kontinuierlichen Prozess interventionsbegleitender Erfolgsmessungen anhand […] fixierter Normalitätsstandards.“ (Albrecht 1999: 23) Eine solche Ausrichtung der Interventionen ist den Eingriffsrationalitäten der Jugendhilfe zwar nicht per se immanent, jedoch ist eine Tendenz zu einem primär auf die Dispositionen der Akteure zielenden Zugriff insbesondere dann stark, wenn es um die Bearbeitung von Risiken abweichenden Verhaltens geht. In dieser Hinsicht erscheint auch eine analytisch trennscharfe Unterscheidung zwischen den je personenbezogenen Formen der ‚sekundären’ und ‚tertiären’ Prävention schwierig. Erscheinen die ‚Problemgruppen‘ und ‚Risikopopulationen‘ als Adressaten einer ‚sekundären’ Prävention als „besserungsbedürftig, erziehungsbedürftig, verwahrungsbedürftig“ (Cremer-Schäfer & Steinert 1996: 441), so markiert dies bereits einen fließenden Übergang zur ‚tertiären’ Prävention. Technologisch interpretiert ist das Ziel der tertiären Prävention die Vermeidung von Rückfälligkeit durch ‚sachgerechte’ Sanktion bzw. Behandlung in einem allgemeinen Sinne. Zwar können auch die abschreckenden Funktionen negativer Spezialprävention ebenso wie die der Unschädlichmachung als Mittel tertiärer Prävention betrachtet werden, jedoch legitimiert sich - insbesondere in Bezug auf die Maßnahmen der Jugendhilfe - auch die ‚tertiäre’ Prävention in häufig als eine Form der Intervention, der das Prinzip der Inklusion zu Gunde liegt. Als ‚tertiäre’ Prävention in diesem ‚inkludierenden’ Sinne lassen Maßnahmen zur Besserung, Nacherziehung und Resozialisierung im Anschluss an abweichendes Handeln verstehen, mit denen rehabilitative bzw. reintegrative Zielsetzungen und normative Umorientierungen (vgl. Lamnek 1994: 227) des – überführten - ‚Täters’ erreicht werden sollen. Um die reaktiven Maßnahmen der ‚tertiären Prävention‘ als ‚Prävention‘ beschreiben zu können, bedarf es einer Repräsentation der formell Kriminalisierten als eine besondere ‚Risikopopulation‘ erneuter zukünftiger Straffälligkeit. Die Begründungen der Interventionen der Jugendhilfe als ‚tertiäre’ Prävention sind mithin von denen der ‚sekundären’ Prävention analytisch kaum zu unterscheiden. Für 134 Stellt ein ‚fürsorgerisches Motivvokabular’ der sekundären Prävention mittelbar oder unmittelbar die ‚abweichenden‘ Eigenschaften einer Person als implizite Ursachentheorie der Auffälligkeit heraus (vgl. Cremer-Schäfer & Steinert 1996: 441) bleiben sozialpädagogische Maßnahmen - unberührt von ihrer unterstellten ‚Generalisierung’ (Schefold 1992: 231) im Sinne einer „alters- und adressatenentgrenzten Sozialen Arbeit“ (Rauschenbach 1992: 53) - als personalisierende sekundäre Prävention tendenziell auf einer Ebene „auf der unterschiedliche soziale Konflikte in institutionelle Regelungen interpretiert, technologisiert und damit entpolitisiert werden [können]“ (Böllert 1992: 161). 122 die Jugendhilfe besteht der Unterschied zur sekundären Kriminalprävention als Interventionslegitimation darin, dass die Risiken ihrer Adressaten durch das symbolische Kapital hierfür legitimierter Instanzen ‚offiziell’ festgestellt wird. Demgegenüber ist das Ziel – und oft auch die Methode – der Intervention letztlich dasselbe: Ein als wahrscheinlich unterstelltes (Wieder)Auftreten von Gefahren oder Gefährdungen soll verhindert oder ‚gemanaged’ werden. Die Logik des ‚präventiven’ Handlungsmodus der Jugendhilfe lässt sich in so fern als die der ‚sekundären’ Prävention beschreiben, d.h. der Reaktion auf ‚Risiken’. Eine Abgrenzung der ‚sekundären’ zur ‚tertiären’ Prävention innerhalb der Jugendhilfe verweist in Bezug auf ‚allgemeine’ soziale Risiken falls überhaupt auf eine – kaum in empirisch fixierbaren Demarkationslinien festzulegende – Veränderung im Grad der Wahrscheinlichkeit einer ‚Gefährdung‘ oder ‚Gefährlichkeit‘ der Adressaten, in Bezug auf das ‚besondere’ Risiko der Kriminalität ist eine lediglich eine Frage symbolischen ‚Validierung’ dieses negativen Guts durch ‚legales Kapital’. II. 4.3.4 DEVIANZTHEORETISCHE KLASSIFIKATION Als eine abschließende Möglichkeit der taxionomischen Klassifikation erscheint es sinnvoll, die Präventionsstrategien nach ihrem impliziten oder expliziten theoretischen Bezug und damit zumindest mittelbar verbunden, auch ihres Gesellschaftsbilds zu differenzieren (zum Zusammenhang: Gronemeyer 2001, Melossi 2000). Obgleich zur Kategorisierung auch andere Unterscheidungen der Theoriebezüge möglich sind (vgl. Albrecht 2002, Groenemeyer 1999, Lamnek 1996), lässt sich die Varianz durch eine idealtypisierende Differenzierung in positivistisch-individualisierende, positivistisch-sozialstrukturelle, individualisierendkonstruktivistische und hegemonietheoretische bzw. ideologiekritische Ansätze abdecken. Die Mehrheit der neueren Ansätze stellen Modifikationen, ‚Übersetzungen’ und vor allem Kombinationen und Integrationen – im Sinne diverser Versuche einer ‚conceptual integration’, ‚positional integration’ oder ‚theoretical syntheses’ (vgl. Eifler 2002: 56 ff) – dieser grundsätzlichen Analysemuster dar. Positivistisch-individualisierenden Theorien zufolge ist das Risiko, die Abweichung oder gar die Abartig- oder Bösartigkeit (vgl. Bennett et al. 1996) eine „dem Subjekt innewohnende Eigenschaft“ (Castel 1983: 53). Die hierauf basierenden Ansätze unterstellen eine Verschiedenheit konformer und abweichender Individuen und die Möglichkeit Risikosubjekte von nicht riskanten anhand intrinsischer Merkmale der (defizitären) Persönlichkeit des Einzelnen zu unterschieden. Die Erklärungen, warum die Dispositionen eines Individuums ‚so sind’ reichen von (sozio)biologischen Erklärungsansätzen (vgl. Kretschmer 1921, Wilson & Herrnstein 1985), über medizinisch-psychiatrische und psychologische Erklärungen (vgl. Eysenek 1996), Anlage/Umwelt-Modelle (vgl. Göppinger 1983), Lern- und ‚Entwicklungstheorien (vgl. Akers 1973) bis hin zu, im weitesten Sinne soziologisch argumentierenden, multi-faktoriellen Ansätze (vgl. Glueck & Glueck 1950). Die positivistisch-individualisierenden Theorien lassen sich auch als Theorien des ‚defekten Individuums’ beschreiben, wobei teils eher der ‚defekte Organismus’, teils eher die ‚defekte Sozialisation’ als genetischer Determinant dieses ‚Subjekts’ gefasst wird. Gemeinsam ist ihnen eine Naturalisierung oder zumindest Statisierung des Sozialen. Gleich ob 123 sie im engeren Sinne biologisch-genetisch argumentieren, auf eine negative ‚individuelle Lerngeschichte’ oder eine ‚missglückte Gewissensbildung’ (Lamnek 1994: 212) verweisen oder eine Psychopathologisierung des Einzelnen in eine Betrachtung des ‚Täters in seinen sozialen Bezügen’ (vgl. Göppinger 1983) einbetten, stellen diese Theorietraditionen die deutlichsten Grundlagen jenes ‚Lombrosian Project’ (vgl. Hughes 1998, Garland 2002) dar, in dem der ‚Strafmodernismus’ des 19. und 20. Jahrhunderts seine Wurzeln findet. Durchaus im engeren Sinne der, mit dem Namen Cesare Lombroso verbundenen, positivistischen Tradition verpflichtet, sind diese Ansätze auf der Suche nach dem, wie auch immer bedingten ‚uomo delinquente’ (Lombroso 1876), d.h. sie richten den Blick auf „die Inkompetenz […] des Individuums, sich angemessen zu verhalten“ (Albrecht 1999: 36). Eine Analyse, Dynamisierung oder dar Kritik des (normativen) Maßstabs einer solchen Angemessenheit ist in dieser Tradition entweder zweitrangig oder bleibt völlig aus. Der Logik nach wird seine Gültigkeit naturalisiert bzw. essentialistisch gesetzt. Allgemeiner: Individualisierend-positivistische Ansätze abstrahieren von gesellschaftlichen Normen und den dahinter liegenden (Herrschafts-)Prozessen und (Macht-)Strukturen zu Gunsten einer paradigmatischen Beschränkung auf die Täterseite mit dem Ziel einer „Reduktion unerwünschter Verhaltensweisen“ (Lamnek 1994: 212) und einer Erprobung von Maßnahmen, durch die das einzelne riskante Individuum, „bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der bestehenden Strukturen“ (Lamnek 1994: 212), ‚abgeschreckt’ ‚gebessert’ bzw. ‚(um)erzogen’ oder ‚unschädlich’ gemacht wird. In diesem Sinne dienen sie einer aktiven Reproduktion des gesellschaftlichen Status quo. In kriminologischer Hinsicht wird das Programm positivistischindividualisierende inzwischen häufig als Teil des ‚rechter Realismus’ (‚right realism’) verhandelt (vgl. Walklate 1998) Auf die Jugendhilfe bezogen, geht es dann beispielsweise um Interventionsstrategien auf der Basis von Mechanismen der ‚positiven’ und ‚negativen Verstärkung’, um Formen der Wert- und Normverdeutlichung zur Motivation oder Handlungsaktualisierung konformen Handelns, um die Stärkung external und internal kontrollierender, konformer sozialer Bindungen, um das ‚ab-’ oder ‚antrainieren’ von Verhaltensweisen, um die Etablierung ‚positiver Leitbilder’ etc. (vgl. Janssen 1997). Positivistisch-sozialstrukturelle Ansätze gehen ebenfalls grundsätzlich davon aus, das Konformität und Abweichung unterscheidbare Klassen von Handeln, bzw. Akteuren bilden, „die grade durch die ihnen eigentümliche Form der Abweichung, durch dem Verhalten inhärente Merkmale schlüssig unterschieden und bestimmbar sind“ (Keckeisen 1974: 25) Allerdings teilen diese Ansätze die Annahme der ursächlicher Bedingtheit von Abweichung in einer personalisierten Verhaltenspathologie des individuell Abweichenden nicht (vgl. Haferkamp 1972), sondern ziehen divergente Norm-, Wertund Handlungsmuster induzierende, gesellschaftliche Strukturen in eine Kriminalitätserklärung ein. In einem gewissen Sinne repräsentieren sie die ‚soziologische Dimension’ des ‚Lombrosian project’ dar. Positivistisch-sozialstrukturelle Ansätze basieren im Wesentlichen auf Theorien einer ‚defekten Sozialstruktur’. An die Stelle minderwertiger, pathologischer, missgeleiteter oder fehlsozialisierter Individuen treten dabei soziale Pathologien, die einen sozialen Druck (‚strain’) auf bestimmte Lebenslagen ausüben, und entsprechend Risiken evozieren (vgl. Merton 1968, Agnew 1992). Während dieser Theoriestrang auf eine inverse, sozialpolitisch zu bearbeitende Beziehung von individualisierbaren Gefährdungen und Gefahren und der sozioökonomischen Gesellschaftsstruktur 124 verweist, bleiben die je bestehenden und den Kriminalisierungen zu Grunde liegenden Normensysteme, als gültige gesellschaftliche Organisationsprinzipien, die weitgehend unhinterfragte Referenz135: Ein Pathologisierungskonzept bleibt in einer vermittelten Weise bestehen. Auf der Basis anomietheoretischer (vgl. Merton 1968, Bohle 1975) und, in deren Gefolge, subkultur- und kulturkonflikttheoretischer Annahmen (vgl. Böhnisch 1999, Cohen 1955, Cloward 1968, Miller 1968) sowie Ansätzen zur ‚sozialen Desintegration’ (vgl. Heitmeyer 1999) und ‚Desorganisation’ (vgl. Bursik 1999) wird es aber von der Ebene der Individuen auf die der sozialen Systemen und Strukturen gehoben, die ihrerseits jedoch auf den Einzelnen ‚abstrahlen’ (vgl. Sack 1993: 278). Präventive Ansätze auf der Basis dieser Überlegungen zielen im Kern darauf, die Normen ebenso wie die Lebensbedingungen der identifizierten Gruppen zu modifizieren und Abweichung dadurch zu reduzieren, dass eine Anpassung an die bestehenden gesellschaftlichen Erfordernisse und Normalitätsvorstellungen strukturell ermöglicht bzw. erleichtert wird. Eine Fokussierung gesellschaftlicher Verhältnisse, die über Fragen von distributiver Ungleichheit hinausgeht und zugleich (symbolische) Macht- und Herrschaftsverhältnisse, Definitionsprozesse oder die Handlungsmaximen der Instanzen sozialer Kontrolle selbst in den Blick nimmt bleibt für diese Ansätze als Präventionsstrategie systematisch zweitrangig, wenn nicht ausgeschlossen. Auf der Basis positivistisch-sozialstruktureller Erklärungsmodelle lassen sich nichtsdestoweniger gesellschaftliche Reformen, insbesondere hinsichtlich der Kompensation sozialer Ungleichheit, einfordern – wobei das Ungleichheitsmodell üblicherweise das der Schichtung und nicht der Klasse ist. Demgegenüber werden jedoch gesellschaftliche Machtverhältnisse, die Gültigkeit der (Mittelklasse-) Normen und die Aktivitäten der Instanzen, die diese Aufrechterhalten, wenn überhaupt, funktional, aber nicht systematisch und in einem generellen Sinne in Frage gestellt. Sie konstituieren auch in diesen Modellen die Zielvorgaben der Prävention: „Zur Disposition stehen also nur sozio-kulturelle Orientierungsmuster gesellschaftlicher Gruppen. Die Erreichung von Konsens ist nur möglich über Anpassung der Unterschichts- oder Subkulturnormen an die Standards der herrschenden Mittelschicht. Methodisch und operational heißt Prävention aus dieser theoretischen Sicht Sozialarbeit“ (Albrecht 1999: 41) Für die Jugendhilfe sind die auf diesen Ansätzen basierenden Präventionskonzepte - zumal dann wenn sie ‚abstrahlungstheoretisch’ gefasst werden - zentral. Dies gilt nicht nur auf der Ebene professioneller Deutungsmuster (vgl. Thiem-Schräder 1989), sondern vor allem, weil diese Ansätze handlungslogisch relativ reibungslos mit einer professionstauglichen Perspektive auf die positional-dispositionale Matrix zu vereinbaren sind. Es kann ein Bezug auf ‚den Abweichler’ als Person und damit auch die sine qua non Kategorie ‚pädagogischer Interventionen’ bestehen bleiben, während - analog zur positional dispositionalen Kopplung - die Ursachen über den Abweichler (individuelle Pathologie) hinaus reichen und auf die gesellschaftliche Organisation verweisen. Nahezu idealtypisch für diese ‚abstrahlungstheoretische’ Perspektive ist die von Lothar Böhnisch (1999) vorgestellte ‚pädagogischsoziologische Einführung’ in das Problem abweichenden Verhaltens, in dem er die Frage der ‚System-‚ 135 Hier zeigt sich die generelle Affinität des gesamten Theoriestrangs zum Strukturfunktionalismus 125 und vor allem der - den sozialkapitalbasierten Interventionen sozialer Arbeit wesentlich weitreichender zugänglichen - ‚Sozialintegration’ mit der Frage ‚antisozialer Tendenzen’ des Subjekts verkoppelt. Eine auf sozialstrukturell-positivistische Ansätze rekurrierende Form der Prävention verbindet die Aufforderung an die Jugendhilfe ihren Adressaten kompensatorisch Chancen zu eröffnen, um „Zugang zu den legitimen Mitteln ‚gesellschaftlichen Erfolgs’ zu bekommen“ (Peters 1997: 49), mit dem methodischen Weg, dies über eine ‚reaktive Bedingungsveränderung’ zu erreichen (vgl. Lamnek 1994: 214, Peters 1995). Diese ‚reaktive Bedingungsveränderung’ als präventive Hauptstrategie der Jugendhilfe ist besonders geeignet, um durch Beeinflussungen und Veränderungen der Bedingungen Modifikationen im Verhalten ihrer – re-personalisierten - Adressaten zu induzieren, und diese in die Lage zu versetzen, ihre Autonomie innerhalb der gegebenen - und durch die Interventionen selbst reproduzierten - (symbolischen) Bedingungsmatrix (wieder)herzustellen und zu sichern. D.h. die Adressaten werden Normvorstellungen dazu zu befähigt, lösen, und „sich von von selber den bislang Konformität prägenden (im Sinne gruppenspezifischen des dominierenden Normensystems) anzustreben“ (Lamnek 1994: 214). In modifizierter Form bleibt demnach auch bei den sozialstrukturell-positivistischen Ansätzen ein personalisierbarer Behandlungsanspruch insofern bestehen, wie auf dieser Basis unterstellt werden kann, dass die Bedingungsebenen von Devianz zwar „in der devianten Person (und ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld) lägen, von dieser jedoch nicht zu verantworten seien“ (Peters 1995: 166). Die hierzu passenden Interventionen auf der Ebene individueller Akteure verweisen auf eine Kopplung der Machtmittel kulturelles und soziales Kapital, und damit auf die Interventionsmittel Sozialer Arbeit. Individualisierend-konstruktivistische Ansätze verstehen Risiken, Gefahren oder Gefährdungen als Produkte von Aushandlungsprozessen. Was in den positivistischen Ansätzen – im Sinne eines ‚right’ oder ‚left Realism’ - als substanzhafte und feststellbare Eigenschaft betracht wird, erscheint hier als ein kontingentes Ergebnis von Konstruktionen, Interpretationen und Sinnzuschreibungen der betroffenen Akteure und vor allem auch der Instanzen sozialer Kontrolle selbst. Die zugeschriebenen Eigenschaften und Status können, als Ergebnis eines interaktiven Prozesses, von den ‚betroffenen’ ‚Kontrollobjekten’ inkorporiert und im Sinne einer ‚abweichenden Karriere’ (vgl. Quensel 1970) ‚verwirklicht’ werden. Individualisierend- konstruktivistische Ansätze sind in dieser Hinsicht vor allem als interaktionistische Modelle ‚krimineller Sozialisation’ zu verstehen (vgl. Lemert 1975, Quensel 1970), die ihren Fokus nicht nur auf die ‚Sozialisationsobjekte’, sondern vor allem auch – in durchaus ‚kritischer’ Absicht - auf die ‚Sozialisationsagenten’ richten. Im Sinne einer mikrosozialen Variante des so genannten ‚labeling approach’ (zur kritischen Würdigung: Ferchhoff & Peters 1981) folgt auf einen, analytisch zu vernachlässigenden, Akt ‚primärer Devianz’ ein selektiv wirklichkeitskonstituierender Prozess, welcher ‚sekundäre Devianz’ (vgl. Lemert 1975) dadurch erst hervorbringt, dass in seinem Verlauf die Kategorie ‚abweichend’ zugeschrieben, und das einzelne Individuum von dem definitionsmächtigen, gesellschaftlichen Umfeld als Delinquent stigmatisiert wird. Erst wenn dieses Stigma, so die vom symbolischen Interaktionismus beeindruckte Annahme, in Form einer Übernahme des Status ‚Abweichler’ - als dominantes Fremdbild - in das eigene Selbstbild aufgenommen worden ist, komme es, im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, zu einer Veränderung der 126 personalen Identität und die ‚Kriminalisierten’ weisen schließlich ‚tatsächlich’ „die einschlägigen Merkmale von Kriminellen auf“ (Lamnek 1994: 215; Becker 1981, kritisch: Albrecht 1993). Der wesentliche Unterschied zu den positivistischen Ansätzen ist der systematische Bezug auf die Handlungsmaxime und Definitionsprozesse der Kontrollinstanzen insbesondere auf den Ebenen der Normanwendung und Bedeutungszuschreibung, bzw. der Ebene sozialer Interaktion. Für die individualisierend-konstruktivistischen Ansätze bestehen die Prämissen der Prävention sowohl in der Vermeidung potentiell kriminalisierbarer Handlungen, d.h. „Verhaltensweisen […], die mit hoher Wahrscheinlichkeit als kriminell oder anormal etikettiert werden“ (Lamnek 1994: 215), als auch in der Vermeidung oder Verringerung kriminalisierender Etikettierungen, bzw. stigmatisierender Reaktionen durch die definitionsmächtigen Instanzen selbst. In diesem Sinne bleiben auch individualisierendkonstruktivistischen Ansätze - bzw. ‚gemäßigten’ Labeling-Ansätze (vgl. Schneider 1987) - einem vergleichsweise konservativen (vgl. Ferchhoff & Peters 1981, Ziegler 1999) „hilfswissenschaftlich-kriminologischen Präventionsziel verpflichtet. […] Zur Disposition stehen Einstellungen, Alltagstheorien und individuelle Verhaltensstrategien aller Beteiligten, sowie praktische Routineabläufe polizeilichen [sozialpädagogischen] und strafjustiziellen Handeln“ (Albrecht 1999: 44). Für progressive Formen der Jugendhilfe sind die präventiven Implikationen diese Erklärungsmodells in so fern relevant, wie sie auf die Notwenigkeit der Überprüfung eigener Routinen und Erprobung von Maßnahmen verweisen, die potentiell abweichende Karrieren möglichst nicht nach ‚unten’, sondern nach ‚oben’ lenken (vgl. Brumlik & Holtappels 1993: 101). Um Kriminalisierungen und Zuschreibungen zu verhindern wäre, diesen Ansätzen zu Folge, vor allem eine Reorganisation der Interaktion und Kommunikation im System sozialer Kontrolle notwendig, durch die Subsumtionslogiken vermieden (Mollenhauer & Uhlendorff 1992), die Perspektiven der Betroffenen selbst gestärkt und systematisch einbezogen werden (vgl. Schnurr 2001) und auch abweichendes Handeln „soweit irgend möglich toleriert und konstruktiv behandelt oder [zumindest] nicht isolierend unterdrückt wird“ (Busch 1995: 683). Prävention entspricht nach den Vorstellungen einiger Vertreter dieser Ansätze weniger einer ‚Verhinderung’ oder ‚Unterdrückung’ von Normabweichungen, sondern ist eher als eine Form der „Arbeit an Situationen von Unsicherheit“ (Cremer-Schäfer 2000: 22) zu verstehen, die darauf zielt „für die als gefährlich erachteten Gruppen […] Ressourcen zur besseren Bewältigung ihrer Lebenssituation [zu] bieten und Konflikte [zu] zivilisieren“ (Cremer-Schäfer 2000: 22). Andererseits ist die Verbreitung und häufig verkürzte Rezeption des Etikettierungsansatzes in der Sozialen Arbeit (dazu: Brumlik 1989, Sack 1997) aus einer eher ‚radikalen’ Sicht (vgl. Autorenkollektiv 1971) nicht unkritisch zu betrachten. Prävention auf der Basis individualisierend-konstruktivistischer Ansätze impliziert zunächst einmal ‚weniger’ an personalisierenden Interventionen in die individuellen Lebensläufe der Kriminalisierten (Peters 1997: 59). Nichtsdestoweniger lässt sich davon sprechen, dass sich diese Perspektive auch als Instrument für durchaus traditionelle präventive Logiken, im skizzierten ‚positivistischen’ Sinne, wirkungsvoll und vor allem berufspolitisch ausgesprochen nützlich gestalten kann. Nicht obwohl, sondern weil die Instanzen sozialer Kontrolle stigmatisieren, ist es sinnvoll, schon so weit wie möglich im Vorfeld anzusetzen, um schädliche Folgewirkungen dieser 127 Instanzen und schädliche die Kriminalisierungsprozesse möglichst zu verhindern136. Das Risiko verschiebt sich von der ‚Kriminalität’ zu einem dynamisierten Prozess der Kriminalisierung und legitimiert damit noch mehr Interventionen, die noch früher einsetzen und - im Gegensatz zu den sozialstrukturell argumentierenden ätiologischen Ansätzen – nicht einmal auf eine Verbesserung der sozialen Stellung der Adressaten selbst gerichtet sein müssen, sondern eher auf eine Reduzierung des ‚allgegenwärtigen’ - und in seinem Beginn beliebig weit nach vorne zu verlagernden - Risikos eines psycho-dynamischen Prozesses einer Übernahme einer Abweichlerrolle. Während Prävention auf der Basis einer individualisierd-konstruktivistischen Perspektive demnach eine Liberalisierung und Demokratisierung der Interventionsformen und die Zurückhaltung bei ordnungspolitischen Interventionsanlässen implizieren kann, ist es de facto gerade auch auf der Basis dieser kritisch-aufgeklärten Ansätze gelungen „sozialtechnologische Maßnahmen mit dem Ziel der Prävention zu verbinden und dadurch zu legitimieren. […] Insofern gilt: ‚Die Kriminalprävention im Kindergarten ist die Folge der Aufklärung über die gesellschaftliche Produktion von Kriminalität’“ (Scherr 1997:256, vgl. Lindenberg & Schmidt-Semisch 1996: 296) Im Kontext dieser Logik haben sich – falls überhaupt - nicht nur die stationären Maßnahmen reduziert, sondern vor allem die ambulanten, möglichst ‚ent-formalisierten’ und lebensweltlichen Maßnahmen erweitert. Die Interventionen begründen sich dabei nicht (nur) auf der Basis wie auch immer begründeter ‚Risikofaktoren’, die man bei dem Adressaten A finden kann und bei B nicht, sondern durch einen Rekurs auf die Notwendigkeit eines ‚Empowerns’ und ‚Stark Machens’, das für A und B gleichermaßen wichtig sei - je um das Risiko von Stigmatisierung und Kriminalisierung zu verhindern, denn schließlich „gibt [es] kein risikofreies Verhalten“ (Luhmann 1991: 37). Die ursprüngliche Kritik des Stigmabegriffs - abweichendes Verhalten sei ein Verhalten, das erfolgreich so bezeichnet werde (vgl. Becker 1981) - in kann auf diese Weise in neue Kategorien überführet werden, die sich in Stellenpläne und Mittelzuweisungen umsetzten lassen. Gesellschaftstheoretisch orientierte Labeling Ansätze gehen ebenso wie die individualisierenden Labeling Modelle von einer „gesellschaftlichen Produktion abweichenden Verhaltens“ (Ferchhoff & Peters 1981) aus, sehen aber den ‚Grund’ für die Kriminalisierung alleine in der herrschaftlich konstituierten Normsetzungen und Normdurchsetzungen definitionsmächtiger Instanzen. Hierbei fokussieren sie nicht nur die Prozesse der Kriminalisierung als gesellschaftliches Produkt, sondern auch die zu Grunde liegenden ‚Produktionsverhältnisse’ (vgl. Ziegler 1999). Etikettierungen werden weniger als interaktive Aushandlungsprozesse, sondern als selektive Zuweisung eines ‚negativen Guts’ (Sack 1972) verstanden, dessen, sich zu den positiven sozialen Güter antiproportional verhaltende, Verteilungsmechanismen durch vorherrschende Machtasymmetrien und gesellschaftsstrukturelle Interessen bestimmt sind und Kontroll- und Disziplinierungsbedürfnisse reflektieren, die auf eine (ideologische) Aufrechterhaltung von organisatorischen und strukturellen Herrschaftsverhältnissen in einer bestimmten Politik- und Staatsform gerichtet sind (vgl. u.a. Sack 1972, Smaus 1986, 1998, Ferchhoff & Peters 1981). 136 Für Hinweise danke ich Prof. Michael Lindenberg 128 ‚Prävention’ beinhaltet in dieser Hinsicht vor allem die Distanz zu den „normativ fixierten Präventionszielen“ des Strafrechts (Albrecht 1999: 46). Nicht eine wie auch immer organisierte Bekämpfung von Kriminalität, sondern die Verhinderung eines Prozesses der Kriminalisierung der problematischen Situationen subdominanter Klassen und Gruppen im Kapitalismus steht im Vordergrund eines solchen ‚Präventionskonzeptes’ (vgl. Hulsman 1996: 300, Chambliss 1996). Prävention wandelt sich damit letztlich zur Gesellschaftspolitik mit dem Ziel einer Veränderung der kapitalistischen Klassengesellschaft und der Rolle des Staates (vgl. Albrecht 1999: 46). Dabei geht es nicht nur um den selektiven und herrschaftlichen Charakter der Rechtssetzung und -durchsetzung, sondern, auf Basis der Überlegung, dass selbst eine Gleichbehandlung auf der Basis ungleicher Vorraussetzungen nicht zu Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit im Ergebnis führen kann (vgl. Hall 1996), um eine Veränderung der produktiven und reproduktiven gesellschaftlichen Struktur. Mit der konkreten Praxis der Jugendhilfe scheinen die in der Regel auf die Organisation kapitalistischer Gesellschaften bezogenen, gesellschaftstheoretisch fundierten Labeling Ansätze wenig kompatibel. Dennoch können diese Überlegungen nicht nur als eine „Sensitivisierung und Sensibilisierung gegenüber Herrschaftsmechanismen“ (Peters 1997: 59) verstanden werden, sondern auch als Aufforderung, sich in (lokale) Politikverhältnisse einzumischen, um die Interessen der Subdominanten zu artikulieren, um die Kontexte, die Kriminalisierungsprozessen dienlich sind, möglichst wirkungsvoll zu verändern und Hegemonieverhältnisse zu verschieben (vgl. Ziegler 1999: 136). Kurz: ‚Kriminalprävention’ meint hier den utopisch-heroischen Versuch „Einengungen, strukturelle Gewalt, Macht- und Herrschaftsausübung von Gruppen zu Gunsten einer sozialqualifizierenden Demokratie“ (Busch 1995: 683) zu reduzieren und sich, wie beispielsweise die Redaktion Widersprüche (1984: 121) im Anschluss an eine ‚radikale Soziale Arbeit’ vorschlägt, in Form einer ‚Politik des Sozialen’ in und gegen den sozialen Staat zu positionieren und sich, je nach Anlass, zugleich um dessen Verteidigung, Kritik und Überwindung zu Bemühen. II. 4.4 DIE NOTWENDIGKEIT EINER GESELLSCHAFTLICHEN FUNDIERUNG DER JUGENDHILFE Die Multidimensionalität und Widersprüchlichkeit des Präventionsbegriffs verweist darauf, dass weder die Feststellung die Jugendhilfe agiere präventiv, noch der ‚Wille zum präventiven Handeln’ per se eine gehaltvolle Basis für eine Analyse darstellen kann. Wenn ‚Prävention’ aber sowohl eine fachliche Grundausrichtung, als auch den durch die Konstitution ‚des Sozialen’ bestimmten Daseinszweck der Jugendhilfe - in ihren ‚helfenden’ wie ‚kontrollierenden’ Dimensionen - darstellt, so verweist die Frage der ‚Prävention’ in der Jugendhilfe notwenig auf die Frage der Teleologien, sowie Denk- und Handlungsrationalitäten der Jugendhilfe in einem allgemeinen Sinne und damit auch der Figuration ihres gesellschaftlichen Feldes: dem Sozialen. Eine solche Bestimmung kann nicht nur auf einer abstrakten Ebene erfolgen, in der über die allgemeinen und überzeitlichen strukturellen Beziehung zwischen ‚der Jugendhilfe’ und ‚der Gesellschaft’ verhandelt wird, sondern soll auf der Grundlage einer spezifischen Situierung der Jugendhilfe vor dem Hintergrund eines konkret 129 historischen Entwicklungsstandes einer gesellschaftlichen Formation geschehen. Die Jugendhilfe, ihre ‚präventiven’ Bemühungen und die ihnen zu Grunde liegenden ‚Subjektrepräsentationen’ verändern sich parallel zu Entwicklungen der gesellschaftlichen Formation in die sie eingebettet sind. Dies gilt schon alleine, weil die Institutionen Sozialer Arbeit auf der Basis ihrer historischen und historisch gewachsenen Verflechtung mit dem staatlichen Sozialleistungssystem (vgl. Bauer 2000: 10) auf eine spezifische gesellschaftliche Verfasstheit zielen. So fern die Leistungen der ‚vergesellschafteten Sozialisationsarbeit’ Jugendhilfe (vgl. Kessl et al. 2002) als gesellschaftliche Tätigkeiten zu verstehen sind, die nicht nur bezogen auf jene gesellschaftliche Konstitution der Bereiche, die sie unmittelbar fokussieren, sondern auch in Bezug auf ihre eigenen Konzepte und Methoden im Zusammenhang mit dem Stand der gesellschaftlichen Entwicklung stehen, ist ‚Gesellschaftstheorie’ ein zentraler Bereich jeder theoretischen Annäherung an die Soziale Arbeit (vgl. Thiersch & Rauschenbach 1987). Um gehaltvolle, über partikulare Deskriptionen hinausgehende Aussagen über Jugendhilfe leisten zu können ist es darum zunächst notwendig, ihre Aufgaben, Funktions- und Statusbestimmungen vor dem Hintergrund der jüngeren Entwicklungen kapitalistischer Klassengesellschaften westlicher Provenienz zu analysieren. Eine solche Analyse muss auf der theoretischen Ebene insofern über die Argumentationslinien Bourdieus hinausgehen, wie dieser in seinen Analysen des Verhältnisses von Praxis, Habitus und Feld kaum systematische Ausführungen über die Organisation und Entwicklung (kapitalistischer) Gesellschaftsformationen Sinne anbietet. Genau diese wirken jedoch mittelbar und unmittelbar auf die konkret historische Formierung des Sozialen – als dem Bezugsfeld der Jugendhilfe – ein, und kennzeichnen gerade in ihrer zeitgenössischen Form eine „grundlegende Neuordnung der Beziehung zwischen den Nationalstaaten einerseits und zwischen Individuum und Gesellschaft andererseits“ (Gerlach 2000: 125f). 130