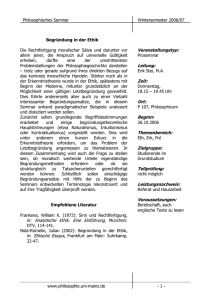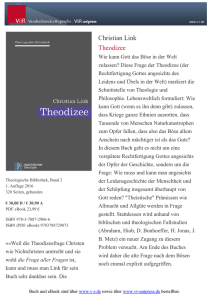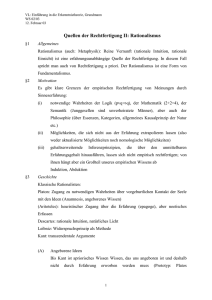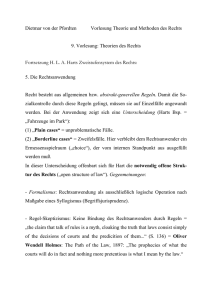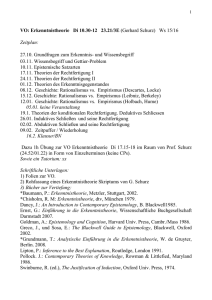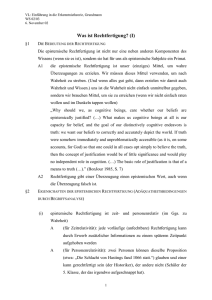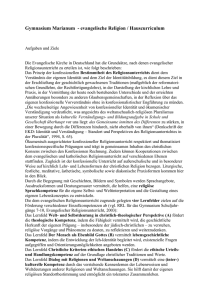5. Vorlesung: Naturrecht versus Rechtspositivismus
Werbung

Dietmar von der Pfordten Vorlesung: Einführung in die Rechts- und Sozialphilosophie SS 2004 5. Vorlesung: Naturrecht versus Rechtspositivismus Neben den in der letzten Vorlesung genannten notwendigen Merkmalen des Rechts wie Repräsentation und Formalität (Setzung), ist ein weiteres Merkmal stark umstritten: seine Gerechtigkeit bzw. sein ethischer Gehalt. An dieser Stelle steht also wieder die Frage nach der Alternative Naturrecht bzw. Nichtpositivismus versus Rechtspositivismus zur Diskussion, die bereits in der 2. Vorlesung kurz erläutert wurde. Die wesentlichen, damals noch groben Unterscheidungen seien hier wiederholt: Rechtspositivismus: enthält zwei Thesen: (1) Nur positives Recht ist Recht. Daraus folgt: Es gibt kein Naturrecht. (2) Positives Recht ist Recht auch ohne Gerechtigkeit. Nichtpositivismus: (1) Starke Naturrechtsversion: Es gibt ein nichtpositives Recht, das Naturrecht. (2) Schwache Nichtnaturrechtsversion: Positives Recht bedarf als Recht der Gerechtigkeit. Was bedeutet nun aber die jeweilige zweite These, daß „Positives Rechts“ „Recht ohne Gerechtigkeit“ ist oder daß das „Recht als Recht der Gerechtigkeit“ bedarf? Man kann die zwei gemäßigten, nichtnaturrechtlichen Alternativen des Rechtspositivismus und des Nichtpositivismus in vier Teilversionen präzisieren:1 Dazu bieten sich die sog. die Modalkategorien unmöglich, möglich, wirklich und notwendig an. Nimmt man diese vier Modalkategorien zu Hilfe, dann lassen sich vier Grundpositionen zum Verhältnis zwischen rechtsethischer Rechtfertigung und Recht unterscheiden. Worauf lassen sich die Modalkategorien in unserem Zusammenhang beziehen? Die Antwort lautet: auf die rechtsethischen Rechtfertigungen. Die rechtsethischen Rechtfertigungen können also unmöglich, möglich, wirklich oder notwendig sein. Rechtsethische Rechtfertigungen müssen sicherlich ein normatives Element enthalten, sonst können sie ihre Aufgabe einer Rechtfertigung und Kritik des positiven Rechts nicht erfüllen. Darüber hinauswerden sie sich aber auch auf Tatsachen in der Welt als Basis beziehen. Verbindet man die Modalkategorien mit der Faktizität und der Normativität als zwei möglichen Elementen rechtsethischer Rechtfertigung, so erhält man folgenden Kategorisierungsvorschlag: 1 Vgl. zum Folgenden: Dietmar von der Pfordten, Rechtsethik, München 2001, S. 99ff.; ders., Rechtsethik, in: Julian Nida-Rümelin, Angewandte Ethik, Stuttgart 1996, S. 200-289. 2 Eine rechtsethische Rechtfertigung des Rechts kann angesehen werden als: - faktisch und/oder normativ unmöglich (rechtsethischer Nihilismus), - zwar faktisch und normativ möglich, aber zu eliminieren bzw. zu minimieren und damit nicht wirklich (rechtsethischer Reduktionismus), - faktisch und normativ möglich und wirklich und damit rechtsethisch wirkungsvoll, aber nicht notwendig in einem begrifflichen oder ontischen Sinne (rechtsethischer Normativismus) und - faktisch und normativ möglich, wirklich sowie als begrifflich und/oder ontisch notwendiger Teil des Rechts (rechtsethischer Essentialismus). Die ersten beiden Positionen lehnen eine rechtsethische Rechtfertigung des Rechts ab, die letzten beiden gestehen sie zu. Die rechtsethisch zentrale Grenze liegt also zwischen rechtsethischem Reduktionismus und rechtsethischem Normativismus. Die Radbruchsche Formel kann sich dabei sowohl auf den rechtsethischen Essentialismus als auch den rechtsethischen Normativismus stützen. Im ersten Fall entbehrt kraß ungerechtes Recht per se der Rechtsnatur. Im zweiten Fall fordert die Ethik eine Aufnahme der Radbruchschen Formel in das Verfassungsrecht. In der Bundesrepublik wird man davon ausgehen können, daß die Radbruchsche Formel als Verfasungsgewohnheitsrecht- bzw. Richterrecht gilt. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, verpflichtet die Formel als ethische Norm, kraß ungerechtem Recht die Gefolgschaft zu verweigern. Bevor die einzelnen Kategorien und die ihnen zuzuordnenden Positionen näher erläutert werden, sei auf das bei dieser Erläuterung zugrunde gelegte Abfolgeprinzip hingewiesen: Die Abfolge orientiert sich am zunehmenden normativen Einfluß der rechtsethischen Rechtfertigung auf das positive Recht. Von der Verneinung der Möglichkeit einer rechtsethischen Rechtfertigung über das Zugeständnis ihrer Möglichkeit, aber Ablehnung ihrer Wirklichkeit und ihrer Bejahung bis hin zum Postulat ihrer begrifflichen bzw. ontischen Notwendigkeit reicht das Spektrum der Abfolge. Jede dieser verschiedenen Möglichkeiten, das formale Verhältnis zwischen rechtsethischer Rechtfertigung und Recht zu konstruieren, hat zu allen Zeiten Anhänger gehabt. Wollte man allerdings das Schwergewicht der historischen Anhängerschaft widerspiegeln, dann müßte man die Darstellungsabfolge umkehren. Wie in der Philosophie insgesamt und der Ethik insbesondere läßt sich in grosso modo eine mehr oder minder kontinuierliche Zurücknahme starker bzw. inhaltsreicher Rechtfertigungsannahmen konstatieren. Oder anders ausgedrückt: Die rechtsethisch-essentialistische Annahme einer notwendigen begrifflichen bzw. ontischen Verbindung von positivem Recht und überpositiver Rechtsethik ist im Prozeß der zunehmenden Rationalisierung und Säkularisierung in immer stärkerem Maße skeptischen Zweifeln begegnet – wenn man von kurzzeitigen retardierenden Entwicklungen wie etwa der Naturrechtsrenaissance in Deutschland kurz nach dem 2. Weltkrieg absieht. 3 Bevor nun die einzelnen möglichen Alternativen der Konstruktion des formalen Verhältnisses von rechtsethischer Rechtfertigung und Recht diskutiert werden, sei noch auf folgende Unterschiede im Status einer Rechtsnorm hingewiesen: Man muß die Frage nach dem Verhältnis von rechtsethischer Rechtfertigung und Recht klar von der Frage des Bestehens, der Frage der Geltung und der Frage der Befolgung von Rechtsnormen unterscheiden. Es gibt also vier Stufen: Eine Rechtsnorm kann erstens rechtsethisch gefordert sein, aber mangels Beschluß und Erlaß nicht als positives Recht bestehen. Sie kann zweitens als Sprechakt des positiven Rechts tatsächlich bestehen, aber juridisch nicht gelten, etwa weil sie fehlerhaft erlassen wurde oder erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten soll. Sie kann drittens als positives Recht tatsächlich bestehen und juridisch gelten und somit juridisch Befolgung fordern, aber ihre Befolgung mag viertens aus rechtsethischen Gründen verwehrt sein. Die Nichtidentität von rechtsethischer Etablierungsforderung, tatsächlichem Bestehen als Sprechakt, juridischer Geltung und rechtsethischer Befolgungsbeurteilung einer Rechtsnorm schließt es aber nicht aus, jeweils Voraussetzungsrelationen zwischen diesen verschiedenen Statusformen einer Rechtsnorm anzunehmen. So wird etwa das tatsächliche Bestehen einer Norm notwendige Voraussetzung ihrer juridischen Geltung sein, die juridische Geltung einer Norm notwendige Voraussetzung ihrer juridischen Befolgungspflicht, die juridische Befolgungspflicht notwendige Voraussetzung ihrer rechtsethischen Rechtfertigungsbedürftigkeit. I. Rechtsethischer Nihilismus Die allgemeine Kritik an jedwedem Begründungsversuch normativer Ethik durch nihilistische, skeptische oder pragmatische Positionen in der Philosophie richtet sich eo ipso auch gegen alle Begründungsversuche einer Rechtsethik. Daneben gibt es spezifische Theorien, die eine außerjuridische normative Rechtfertigung oder Kritik des Rechts für unmöglich erklären. Schon einigen antiken Sophisten kann man – bei großzügiger Interpretation – eine derartige Position zuschreiben, etwa wenn sie allein das „Recht des Stärkeren bzw. Tüchtigeren“ gelten lassen (zum Beispiel Kallikles).2 Wenn nur Stärke oder Macht zählen soll, kann das Recht nur der Macht dienen, und jede rechtsethische Rechtfertigung ist ausgeschlossen. Von den neueren rechtsethisch-nihilistischen Positionen seien zwei erwähnt:3 1. Der Skandinavische Rechtsrealismus: Der Skandinavische Rechtsrealismus wurde um 1900 in Uppsala von A. Hägerström begründet. Weitere Hauptvertreter 2 Vgl. Platon, Gorgias, 483d. 3 Weitere Positionen wären der Amerikanische Rechtsrealismus und der soziologische Positivismus. Zu ersterem vgl. Oliver W. Holmes, The Path of the Law, 1897; zu letzterem: Walter Ott, Der Rechtspositivismus, Berlin 1976. 4 waren A. V. Lundstedt, K. Olivecrona und A. Ross. Hauptziel des Skandinavischen Rechtsrealismus war der Kampf gegen jede Metaphysik. Die Stoßrichtung des Skandinavischen Rechtsrealismus war also dem antimetaphysischen Kampf durch G. E. Moore und B. Russell in England vergleichbar. Alle Metaphysik soll nach A. Hägerström zerstört werden. Grundlage jeglicher Erkenntnis kann ausschließlich die äußere und innere Erfahrung in Raum und Zeit sein. Sprachliche Aussagen sind nur sinnvoll und wahrheitsfähig, wenn sie eine derartige äußere und innere Erfahrung in Raum und Zeit beschreiben. Wertungen und Imperative sind dagegen lediglich als Gefühlsäußerungen und beeinflussende Handlungen zu interpretieren, die nicht wie beschreibende Aussagen Wahrheitsfähigkeit beanspruchen können. Schon aus sprachlogischen Gründen müssen demnach ein objektives Sollen und objektive Werte als unwissenschaftlich abgelehnt werden. Das Recht ist nach Auffassung des Skandinavischen Rechtsrealismus als sprachlichpsychische Realität anzusehen, die vom Menschen ausgeht. Der einzige Zweck des Rechts besteht in der faktischen Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Die Normativität des Rechts bildet keinen gegenüber der Wirklichkeit (dem Sein) abgeschlossenen eigenen Sinnbereich des Sollens, wie dies von Vertretern des normlogischen Neukantianismus (zum Beispiel Kelsen, vgl. unten) angenommen wird, sondern manifestiert sich ausschließlich in der tatsächlichen psychischen Wirksamkeit des Rechts. Auch die Geltung des Rechts wird auf seine tatsächliche äußere und innere psychische Wirksamkeit reduziert. Die Moral ist wie das Recht als tatsächliches soziales und psychisches Phänomen zu beschreiben. Zwischen Moral und Recht bestehen kausale Wechselwirkungen. Jede über derartige kausale Wechselwirkungen hinausgehende rechtsethische Rechtfertigung des Rechts wird aber kategorisch ausgeschlossen. Beschreibende Sätze können per se nicht rechtsethisch rechtfertigen und nichtbeschreibende Sätze sind nicht wahrheitsfähig, also aus jeder wissenschaftlichen Untersuchung zu verbannen. Rechtsnormen können von der Wissenschaft somit nur beschrieben werden. Da ethische Sätze über das Recht nicht wahrheitsfähig sind, erweist sich jeder Versuch der Konstruktion einer ethischen Rechtfertigung des Rechts als sinnlose Metaphysik. Das Ergebnis des Skandinavischen Rechtsrealismus ist dasselbe wie das Ergebnis des logischen Positivismus in der allgemeinen Ethik: der Ausschluß jeglicher Möglichkeit einer normativ-ethischen Rechtfertigung des Rechts und die Restriktion wissenschaftlicher Untersuchungen auf die Analyse von Sprache und Argumentation und empirische Beschreibung. Folgende Einwände lassen sich gegen diese Thesen erheben: Die scharfe Grenzziehung zwischen wahrheitsfähigen deskriptiven und nichtwahrheitsfähigen normativen Äußerungen wird nur durch eine strikt dualistische Sprachkonzeption ermöglicht. Im Rahmen dieser strikt dualistischen Sprachkonzeption wird jedoch das pragmatische Bedeutungselement der Sprache außer acht gelassen, welches das semantische Bedeutungselement notwendig überwölbt. Aber selbst wenn man die dualistische Grenzziehung zwischen deskriptiven und nichtdeskriptiven Äußerungen auch unter Berücksichtigung des pragmatischen Bedeutungselements akzeptiert, ist damit nicht bewiesen oder nur begründet, daß 5 nichtdeskriptive Äußerungen notwendig irrational und nicht zur ethischen Rechtfertigung des Rechts brauchbar sind. Die deontische Logik hat gezeigt, daß auch zwischen nichtdeskriptiven Äußerungen logische Ableitungsbeziehungen aufgebaut werden können. Dies spricht für das Gegenteil. Im Alltagsverständnis der Sprache wird im übrigen sehr klar zwischen bloßen Gefühlsäußerungen und praktischen Rechtfertigungen unterschieden. Wir werfen Opponenten in Moraldiskussionen häufig vor, daß sie für ihre Position keine guten Gründe anführen können. Der Skandinavische Rechtsrealismus, behaupten Anhänger derartiger praktischer Rechtfertigungen, befände sich in einem permanenten kollektiven Irrtum, ohne diesen Irrtum erklären zu können. Überdies läßt sich die Reduktion des Wissenschaftsbegriffs auf die theoretischdeskriptive Wahrheitsfindung und die weitere Reduktion der Wahrheitsfindung auf ein korrespondenztheoretisch-empiristisches Modell nicht halten. Das empiristische Wissenschaftsparadigma hat sich in verschiedener Hinsicht als problematisch erwiese. Die berechtigte Kritik an stark metaphysischen rechtsethischen Einzelpositionen beweist im übrigen nicht die Unmöglichkeit jeder rechtsethischen Rechtfertigung des Rechts. Man kann diese Einsicht grundsätzlicher fassen: Ähnlich wie ein Naturgesetz nicht durch einzelne Vorkommnisse per Induktion bewiesen werden kann, läßt sich – in Anwendung des Humeschen Prinzips – die These der generellen Unmöglichkeit rechtsethischer Rechtfertigungen nicht durch die Widerlegung einzelner metaphysischer Rechtfertigungsversuche beweisen – wie beim Sport die Tatsache, daß ein Athlet eine Höhe oder Weite nicht erreicht, nicht beweist, daß kein Athlet zur Erreichung dieser Leistung in der Lage ist. Bemerkenswert ist schließlich, daß praktisch jeder der Skandinavischen Rechtsrealisten seinerseits kryptoethische Ansätze – etwa unter der Bezeichnung „Rechtspolitik“ – entwickelt hat, die als Rudimente einer rechtsethischen Position anzusehen sind. Man kann zusammenfassen: Dem Skandinavischen Rechtsrealismus ist es als einer spezifischen Version des rechtsethischen Nihilismus nicht gelungen, die prinzipielle Unmöglichkeit rechtsethischer Rechtfertigungen zu zeigen oder auch nur plausibel zu machen. Dieses negative Ergebnis impliziert allerdings natürlich nicht das viel weitergehende positive Ergebnis, daß eine tragfähige materiale rechtsethische Rechtfertigung konstruiert werden kann. Widerlegt sind nur die spezifischen Annahmen des Skandinavischen Rechtsrealismus, es bestünden prinzipielle ethikexterne Hinderungsgründe sprachlicher, wahrheitstheoretischer oder erkenntnistheoretischer Art für eine rechtsethische Rechtfertigung des Rechts. 2. Die autopoietische Systemtheorie: Eine der größten Herausforderungen für eine normative Rechtsethik – ja für die allgemeine Ethik und die Philosophie überhaupt – stellt gegenwärtig die autopoietische Systemtheorie dar. Sie wird in Deutschland vor allem von Niklas Luhmann vertreten. Vgl. zu Details: D. v. d Pfordten, Rechtsethik, S. 119ff. 6 II. Rechtsethischer Reduktionismus Während der rechtsethische Nihilismus nur Fakten kennt und eine normative Rechtfertigung des Rechts für unmöglich hält, sieht der rechtsethische Reduktionismus eine normative Rechtfertigung des Rechts als möglich an. Allerdings kann oder soll diese normative Rechtfertigung des Rechts keine rechtsethische Rechtfertigung sein. Das heißt: Alle normativen Relationen zum Recht werden derart restringiert, daß jede gehaltvolle rechtsethische Rechtfertigung ausgeschlossen bleibt oder zumindest minimiert werden soll. Dieser Ausschluß jeder rechtsethischen Rechtfertigung kann auf zwei grundsätzlich verschiedenen Wegen geschehen: indem jede Form normativer Rechtfertigung des Rechts ausschließlich als rechtsintern für möglich erklärt und damit auf das Rechtssystem beschränkt wird oder indem rechtsexterne Instanzen, wie Politik oder Ökonomie, die Rechtfertigung des Rechts in toto übernehmen, so daß für eine ethische Rechtfertigung des Rechts kein Platz mehr bleibt. Paradigmatisch für die erste Alternative steht die „Reine Rechtslehre“ von Hans Kelsen (2. Aufl 1960). Paradigmatisch für die zweite Alternative in ihrer ersten Variante ist der politische Dezisionismus Carl Schmitts. Als paradigmatisch für die zweite Alternative in ihrer zweiten Variante kann die sogenannte „Ökonomische Analyse des Rechts“ angesehen werden. Vgl. dazu: von der Pfordten, Rechtsethik, S. 141ff. Hans Kelsen hält anders als die Vertreter eines rechtsethischen Nihilismus die normative Rechtfertigung von Moral- und Rechtsnormen nicht für unmöglich. Er schränkt eine objektive und damit wissenschaftlich erfaßbare Rechtfertigung von Normen allerdings auf die Rechtfertigung durch andere positive Normen desselben Normensystems ein. Positive Moralnormen können demnach nur durch andere positive Moralnormen, positive Rechtsnormen nur durch andere positive Rechtsnormen gerechtfertigt werden. Dieser rechtsethische Reduktionismus speist sich zum einen aus Kelsens allgemeiner Norm- und Geltungstheorie, zum anderen aus einzelnen Thesen zum Verhältnis von Rechtssystem und außerrechtlichen rechtsethischen Rechtfertigungen. Kelsens Norm- und Geltungstheorie nimmt ihren Ausgangspunkt bei der Frage, wie neben kausalgesetzlich bestimmten Tatsachen auch nicht kausalgesetzlich bestimmte moralische und rechtliche Normen bestehen können. Kelsen konstatiert zunächst, daß einzelne Willensakte von Personen einen subjektiven Sinn intendieren. Dieser subjektive Sinn kann auch ein normativer Sinn sein. Er genügt aber nicht, um den Willensakten der Personen einen „objektiven“, juridischen Sinn zu verleihen. Das Entstehen eines objektiven juridischen Sinns und damit einer objektiven Rechtsnorm bedarf – so Kelsens zentrale These – in jedem Fall einer anderen höherrangigen Rechtsnorm, die dem subjektiven Willensakt als bloß faktischer und kausalgesetzlich bestimmter Tatsache objektive Normativität und damit objektive Geltung verleiht. Nur durch eine derartige objektive Sinndeutung seitens einer höherrangigen Rechtsnorm können pure Fakten nach 7 Kelsen zu einer objektiv geltenden Rechtsnorm werden. Die höherrangige Norm fungiert als Deutungsschema der kausalgesetzlich bestimmten Fakten. Recht wird also dadurch konstituiert, daß eine andere Rechtsnorm einem empirisch wahrnehmbaren und kausalgesetzlich bestimmten Willensakt (Sein) einen objektiven normativen Sinn (Sollen) gibt. Eine Kritik an Kelsens rechtsethischem Reduktionismus muß an der zentralen These eines objektiven, rechtsinternen „Sollens“ ansetzen. Dieses rechtsinterne „Sollen“ wird von Kelsen als entscheidendes Systembildungs- und Objektivierungselement4 des Rechts aus verschiedenen Teilfunktionen zusammengesetzt und in hohem Maße metaphysisch aufgeladen. Aber das interne „objektive“ Sollen kann jeder einzelnen Rechtsnorm keine höhere Objektivität verleihen. Gegenüber Kelsens rechtsethischem Reduktionismus, der keine wirklich gehaltvolle Rechtfertigung erlaubt und in die zweifelhaften Postulate der notwendigen Hierarchizität und der Grundnorm mündet, verdient folgendes Modell den Vorzug: Neben der rechtsinternen Legitimation durch andere Rechtsnormen (sog. Legalität) findet jede einzelne Rechtsnorm ein gewisses Maß an rechtsexterner rechtsethischer Legitimität, wenn sie zu einer interessengerechten und gut begründbaren Konfliktregelung führt. Jedes einzelne Gesetz, jede Verordnung, jedes Urteil und jeder Verwaltungsakt inkorporieren somit ein Stück externer, rechtsethischer Legitimität (oder Kritik) in die Rechtsordnung. Mit dem Anschluß einer Rechtsnorm an eine andere Rechtsnorm kann neben der rechtsinternen hierarchischen Rechtfertigung von oben nach unten auch diese rechtsexterne rechtsethische Legitimität – zumindest teilweise – übertragen werden, wobei die Übertragung bei einem inhaltlichen Anschluß naturgemäß größer ist als bei einem bloß formalen. Die Übertragung rechtsethischer Legitimität von einer Rechtsnorm auf eine andere ist aber anders als bei der rechtsinternen Rechtfertigung nicht ausschließlich ein quasideduktiver Vorgang von oben nach unten, sondern die Rechtfertigung enthält auch quasiinduktive Elemente, das heißt die rechtsethische Legitimität eines gut begründeten Gesetzes wird nicht nur auf die einzelnen auf ihm basierenden Urteile transferiert, sondern die gut begründeten Einzelfallurteile vermitteln umgekehrt auch dem Gesetz ein gewisses Maß an ethischer Legitimität. Das bedeutet: Weder der Gesichtspunkt der rechtsinternen noch der der rechtsexternen Rechtfertigung macht die Konstruktion einer über die Verfassung hinausgehenden Grundnorm nötig. Die rechtsinterne rechtliche Legalität kann bei den obersten Rechtsnormen der Verfassung stehen bleiben. Die rechtsexterne rechtsethische Rechtfertigung ist nicht auf einen einzigen obersten Hierarchiepunkt konzentriert, sondern dringt über jede einzelne Entscheidung in das gesamte Rechtssystem ein und verteilt sich dort. Will man eine Metapher wählen, so balanciert das Rechtssystem legitimatorisch nicht auf der einzigen Nadelspitze der Grundnorm, sondern steht wie ein Tausendfüßler auf 4 Im postumen Spätwerk, der „Allgemeinen Theorie der Normen“ von 1979, ist die Dominanz des objektiven Sollens als Systemelement deutlich zurückgenommen. 8 allen seinen Füßen, nämlich seinen einzelnen Normen, die rechtsethisch legitim sind. III. Rechtsethischer Normativismus Die Grundthese des rechtsethischen Normativismus lautet: Eine rechtsethische Rechtfertigung des Rechts ist faktisch und normativ möglich und wirklich sowie rechtsethisch wirkungsvoll. Recht und Ethik sind danach normativ verbunden. Rechtsethische Prinzipien sind – dies ist eine Forderung der Ethik, nicht des Rechts – vom Recht zu berücksichtigen. Das Recht muß sich, um gerecht zu sein, zumindest teilweise und in seinen grundlegenden Regelungen auf rechtsethische Rechtfertigungen stützen oder darf ihnen zumindest nicht widersprechen. Die normativ-ethische Verbindung von Recht und Ethik geht aber nicht soweit, die Wertungen und Normen der Rechtsethik als begrifflich oder ontisch notwendigen Teil des Rechts anzusehen wie der im nächsten Abschnitt noch zu erörternde rechtsethische Essentialismus. Die Rechtsethik bleibt beim rechtsethischen Normativismus also rechtsextern und wird nicht wie beim rechtsethischen Essentialismus zum rechtsinternen Teil des Rechts. Der rechtsethische Normativismus wurde von unterschiedlichen Theorierichtungen vertreten: Eine sehr schwache Version kann man bei Thomas Hobbes lokalisieren: Für Hobbes bedarf die fiktionale Etablierung des Staates der hypothetischen Legitimation durch den einzelnen. Ist der Staat aber etabliert und seine institutionelle Grundstruktur festgelegt, so gilt: Kein positives Gesetz ist von einem internen Standpunkt aus als ungerecht anzusehen. Bei Kant ist der rechtsethische Normativismus dagegen stärker entfaltet als bei Hobbes. Das Recht muß bei jeder Rechtsetzung der Frage „was recht sei“ unterworfen werden. Trotzdem ist für Kant das Recht als positives Recht nicht schon ontisch oder begrifflich mit der rechtsethischen Rechtfertigung verbunden. Auch ungerechtes Recht ist Recht. Ein weiterer berühmter Vertreter ist H. L. A. Hart mit seinm rechtstheoretischen Hauptwerk „The Concept of Law“ (1961). Auch Gustav Radbruch wird man vor 1945 dieser Theorielinie zurechnen können. Man kann über die inhaltlichen Details der hier skizzierten Theorien von H. L. A. Hart und Gustav Radbruch streiten. Aber der rechtsethische Normativismus als formale Grundposition beider Theoretiker verdient Zustimmung. Das positive Recht bedarf aufgrund seiner freiheitsbeschränkenden Wirkung einer rechtsethischen Rechtfertigung, soll es gerechtes Recht sein. Diese rechtsethische Rechtfertigung kann das positive Recht nicht allein aus sich selbst heraus erzeugen oder aus anderen – selbst ethisch legitimationsbedürftigen – Gesellschaftsbereichen, wie der Politik oder der Ökonomie, schöpfen. Der rechtsethische Normativismus sieht Ethik und Recht als normativ verbunden an. Rechtsnormen sind rechtsethisch rechtfertigungsbedürftig. Die Parlamentarier im Deutschen Bundestag sind danach zum Beispiel aufgefordert, sich bei ihren Entscheidungen von rechtsethischen Erwägungen leiten zu lassen. Sie sollen etwa eine gerechte Verteilung von Steuern und sonstigen Lasten regeln. Wer aus ethischen Gründen zu der Überzeugung gelangt ist, daß das Einkommen in einer bestimmten 9 Art und Weise zu besteuern ist, muß auch die Ansicht vertreten, daß das Recht diese Besteuerung ermöglichen sollte. Jede ethische Theorie – gleich welchen Inhalts – wird vom Recht fordern, daß es ihre Wertungen und Normen berücksichtigt und durchsetzt. Verweigert das Recht diese Berücksichtigung und Durchsetzung, so fehlt ihm die rechtsethische Rechtfertigung. Die Rechtsbefolgung wird dann problematisch. Die Notwendigkeit, rechtsethische Wertungen und Normen bei der Rechtsetzung und Rechtsanwendung zu berücksichtigen und zu verwirklichen, führt allerdings nicht – dies muß betont werden – zu einer „Ethisierung“ des Rechts. Dafür gibt es fünf Gründe: (1) Viele ethische Wertungen und Normen – etwa das Verbot der Lüge – lassen sich nicht sinnvoll mit Hilfe des Rechts verwirklichen. (2) Das Recht findet nicht selten eigene Regelungsformen zur Verwirklichung ethischer Wertungen und Normen, zum Beispiel die Grundrechte. (3) Demokratische Erfordernisse verbieten die allein auf Gerechtigkeit zielende Ethisierung von Entscheidungen des Rechts. (4) Das Recht darf Einzelentscheidungen gegenüber unmittelbaren rechtsethischen Einflüssen abschotten, um z. B. die Gleichbehandlung als hohes rechtsethisches Gesamtprinzip sicherzustellen. (5) Manche Rechtsnormen dienen pragmatischen und technischen Erfordernissen, so daß ihr ethischer Gehalt allenfalls minimal ist. Insgesamt wird man also davon ausgehen müssen, daß ein weiter Bereich des Rechts nicht oder nicht direkt durch rechtsethische Wertungen und Normen beinflußt werden sollte. Die Beurteilung, wo die Grenze dieses Bereichs verläuft, muß allerdings rechtsethischen Standards unterworfen bleiben und darf nicht einer Rechtstechnokratie überlassen werden. Zur Beurteilung der ethischen Beurteilungsbedürftigkeit des Rechts hat die Rechtsethik das letzte Wort. IV. Rechtsethischer Essentialismus Der rechtsethische Essentialismus verteidigt die These, daß zwischen Ethik und Recht eine ontisch oder begrifflich-analytisch notwendige Identität, Teilidentität oder zumindest Verbindung besteht – insofern lassen sich stärkere und schwächere Versionen des rechtsethischen Essentialismus unterscheiden. Normen, denen eine solche notwendige ethische Komponente oder Verbindung fehlt, sind kein Recht. Dies gilt etwa für Normen von Verbrecherregimen wie dem nationalsozialistischen in Deutschland oder dem stalinistischen in der UdSSR. Beide Regime haben in ihren Normen grundlegende rechtsethische Forderungen mißachtet. Historischer Hintergrund des rechtsethischen Essentialismus ist die Vorstellung von einer ontischen Verbindung aller Teile der Welt und damit auch von Ethik und Recht. Gegenwärtiger Hintergrund des rechtsethischen Essentialismus ist das Bedürfnis, extrem ungerechte Normen von Verbrecherregimen nicht nur rechtsethisch und damit rechtsextern zu verurteilen und ihre Befolgung rechtsethisch und damit rechtsextern auszuschließen – wie es auch auf der Basis des rechtsethi- 10 schen Normativismus möglich ist –, sondern derartigen extrem ungerechten Normen auch vom rechtsinternen und rechtlichen Standpunkt aus jede Rechtsnatur abzusprechen und sie zum Nicht-Recht zu erklären, so daß sich die Frage der Geltung und der Rechtsbefolgung auch vom rechtsinternen und rechtlichen Standpunkt aus nicht stellt. Praktisch bedeutsam ist die These des rechtsethischen Essentialismus nur für die Beurteilung von Unrechtsstaaten, denn Rechtsstaaten haben rechtsethische Maßstäbe wie die Menschenrechte in ihre Verfassungen integriert, so daß ungerechtes Recht auch ohne Bezug auf rechtsexterne rechtsethische Maßstäbe bereits rechtsintern aus rechtlichen Gründen für ungültig erklärt werden kann. Verschiedene Theoretiker haben den rechtsethischen Essentialismus derart gefaßt, daß begrifflich-analytisch im Rechtsbegriff ein notwendiger Zusammenhang von Recht und Ethik enthalten sein soll (sogenannte analytische Verbindungsthese). Die analytische Verbindungsthese ist vor dem Hintergrund der Sprachkritik des späten Wittgenstein (1953) schon in abstracto schweren Bedenken ausgesetzt. Man muß fragen, ob es überhaupt so etwas wie eine notwendige Begriffsbildung bzw. Sprachverwendung gibt. Für die Sprachverwendung kann dies nicht in einem analytischen Sinne gelten. Sie kann allenfalls im Sinne einer sprachpragmatischen Regel einen bestimmten Wortgebrauch als normativ notwendig auszeichnen. Damit verbleibt allenfalls die Möglichkeit einer analytisch notwendigen Begriffsbildung. Zum Nachweis der analytischen Verbindungsthese werden verschiedene Wege beschritten: (1) Ronald Dworkin hat geltend gemacht, daß Rechtsordnungen – anders als Hart in seinem zweistufigen Regelmodell annimmt – neben Regeln auch Prinzipien enthalten. Eine Regel ist als „Alles-oder-Nichts-Gebot“5 verpflichtend, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, nicht verpflichtend, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen nicht gegeben sind. Prinzipien geraten dagegen miteinander in Konflikt und ihr relatives Gewicht entscheidet. Prinzipien werden im Gegensatz zu Regeln in ihrer Durchsetzungskraft durch andere Prinzipien limitiert. Bei jeder Anwendung muß demnach eine Abwägung und Gewichtung der relevanten Prinzipien erfolgen. Dworkin konzediert allerdings, daß Regeln und Prinzipien manchmal fast dieselbe Rolle spielen. Aus der Feststellung, daß das Recht aus Regeln und Prinzipien besteht, leitet Dworkin zwei Rechtfertigungen für die These des rechtsethischen Essentialismus ab, eine strukturtheoretische und eine geltungstheoretische. Das strukturtheoretische Argument besagt, daß Prinzipien kraft ihrer Struktur den engeren normativistischen Rechtsbegriff sprengen, weil sie die approximative Realisierung eines ethischen Ideals zur Rechtspflicht erheben. Das geltungstheoretische Argument besagt, daß die faktische und normativ gebotene Heranziehung solcher Prinzipien die strikte Grenzziehung zwischen rechtlichen 5 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge 1977, S. 24. 11 Regeln und moralischen Prinzipien durch eine sekundäre Erkenntnisregel unmöglich macht. Harts sekundäre Erkenntnisregel kann als gesellschaftliche Regel zwar Primärregeln als gültiges oder ungültiges Recht auszeichnen, nicht aber Prinzipien. Zur Beurteilung des strukturtheoretischen Arguments ist festzustellen: Dworkin behauptet zwar, daß seine Thesen nicht nur für das amerikanische bzw. angelsächsische Rechtssystem gelten, aber er bezieht sich selbst überwiegend auf dieses. Im angelsächsischen Recht gibt es weite Bereiche ohne systematische Kodifikation oder Gesetzgebung, die nur durch richterliches Fallrecht geregelt werden. Hat man aber nur einzelne Fälle als Entscheidungsrichtlinie, so liegt es nahe, zwischen ihnen durch die Bildung von Prinzipien zeitliche und räumliche Kohärenz herzustellen. Man kann dies als Vorstufe einer abstrakt-generellen gesetzlichen Regelung auffassen. Aus der Tatsache, daß die spezielle Rechtsform des richterlichen Fallrechts eine solche Hilfe zur Kohärenzbildung benötigt, darf aber nicht geschlossen werden, dies gelte für alle Typen des Rechts, etwa auch für Rechtsordnungen, in denen Kodifikationen, Parlamentsgesetze und geschriebene Verfassungen eine zentrale Rolle spielen. Damit kann das strukturtheoretische Argument zumindest für Rechtsordnungen wie die deutsche nicht überzeugen. Im übrigen müßte erst einmal erwiesen werden, daß die Prinzipienbildung auf Wertungen beruht, die nicht bloße Rechtswertungen des positiven Rechts sind. Die Tatsache, daß die Wertungen von Einzelentscheidungen zu einer allgemeinen Regel geformt werden, garantiert ja nicht, daß diese Regel in irgendeiner Weise als rechtsethische und damit überpositive zu qualifizieren ist. Die Mitglieder einer Räuberbande können ihre zufällige tägliche Einzelentscheidung, einen Überfall zu verüben, zum Prinzip erheben. Dieses Prinzip mag mit einem anderen Prinzip der Bande kollidieren, etwa einmal in der Woche ein Fest zu feiern, also nicht als Alles-oder-Nichts-Regel anwendbar sein. Dies alles beweist aber nicht, daß entsprechende Prinzipien rechtsethische und nicht rechtliche oder bloß technische Prinzipien sind. Aus einem Strukturunterschied von Normen kann man nicht auf die ethische Rechtfertigungskraft eines Normtyps schließen. Zum geltungstheoretischen Argument ist zu sagen: Wenn klare Verfassungs- und Organisationsnormen die Erzeugung und Geltung von Gesetzen regeln, so ist für einen zentralen Rechtsbereich die Unterscheidung zwischen rechtlichen Normen und außerrechtlichen Rechtfertigungen eindeutig – wenn man von einer sprachlich bedingten unvermeidlichen Unschärfe absieht. Auch richterrechtliche Regeln können diesen zwei Bereichen zugeordnet werden. Sie bleiben im Normbereich des Rechts, wenn sie sich im Rahmen des möglichen Wortlauts und der Rechtswertungen des positiven Rechts halten. Überdies haben Rechtsordnungen wie die der Bundesrepublik einen Großteil der ethischen Prinzipien in ihre Verfassung inkorporiert und damit zu positivem Recht erhoben.6 Die Rechtsprechung kann auf Rechtswertungen der Verfassung 6 Vgl. BVerfGE 34, S. 269ff. (287). 12 zurückgreifen. Dabei handelt es sich aber um rechtsimmanente rechtliche Wertungen und nicht um das positive Recht übersteigende ethische Wertungen. Aber selbst wenn man annimmt, daß die Rechtsprechung in zweifelhaften Fällen faktisch auch auf außerrechtliche Wertungen zurückgreift, ist der rechtsethische Essentialismus noch nicht bewiesen. Das tatsächliche Überschreiten der Grenzen des positiven Rechts durch einzelne Rechtsanwender beweist keine begrifflichanalytische Verbindung von Recht und Ethik. Man kann das Prinzipienargument auch noch auf einer basaleren normlogischen Ebene anzweifeln. Jede Präskription bzw. jede Norm enthält sowohl in ihrem deskriptiven Voraussetzungsteil als auch in ihrem normativen Gebotsteil ein striktes und ein graduell-relatives Element. Nur im Rahmen des tatsächlichen Sprachgebrauchs kann eines dieser Elemente im Einzelfall als unsinnig oder kontraproduktiv ausgeschlossen werden. Man denke sich folgendes Beispiel: Wenn ich einen Freund bitte, unter der Voraussetzung, daß es noch vier Eier gibt, vier Eier beim Händler zu besorgen (striktes deskriptives und normatives Element), so impliziert dies normalerweise, daß er auch ein, zwei oder drei Eier kaufen soll, wenn nur noch ein, zwei oder drei Eier vorhanden sind (graduell-relatives deskriptives und normatives Element). Die letzten beiden graduell-relativen Elemente meiner Bitte äußere ich nur dann nicht, wenn ich zu erkennen gebe, daß ich ausnahmsweise genau vier Eier brauche und mit zweien nichts anfangen kann, etwa weil ich für uns beide ein Omelett zubereiten will. Im Regelfall („Vier Eier oder weniger!“) enthält dieses Gebot also im Voraussetzungsteil und im Rechtsfolgeteil eine strikte sowie eine graduelle Deskription und Präskription. Im Ausnahmefall („Nur genau vier Eier!“) ist die graduelle Deskription und Präskription im Voraussetzungs- und im Rechtsfolgeteil aufgehoben. Es gibt nun auch Normen, die nicht erst durch eine zusätzliche Sprachhandlung eingeschränkt werden müssen, sondern schon inhaltlich strikt, also nach dem Allesoder-Nichts-Prinzip, gefaßt sind. Die Bitte an meinen Freund, unter der Voraussetzung, daß der Händler offen hat, einzukaufen, wäre ein solches Gebot. Ein Händler kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur offen haben oder nicht offen haben. Eine graduelle Abstufung ist nicht möglich. Die zweifelhafte Annahme Dworkins und mancher Anhänger der Regeln-/Prinzipienunterscheidung besteht nun darin zu glauben, der soeben erläuterte abstrakte sprachfunktionale bzw. normlogische Sachverhalt führe zu unterschiedlichen Normtypen und diese seien mit Rechts- und. Moralnormen bzw. ethischen Rechtfertigungen zu identifizieren. Dagegen muß man einwenden: Es kann selbstverständlich auch Moral- oder Ethiknormen geben, die strikt gebieten, wie dies Kant etwa für das Verbot der Lüge annahm. Und es kann Rechtsnormen geben, die graduelle Abstufungen zulassen, etwa einzelne Verfassungsnormen. Der Zusammenhang zwischen den beiden Normcharakterisierungen strikt/graduell und Recht/Moral bzw. Ethik ist also ein kontingenter, kein analytischer und notwendiger. Zuzugeben ist nur eine gewisse statistische Häufung: Rechtsnormen werden häufiger strikt gebieten, weil sie stärker ins Detail gehen und weil jeder Rechtsetzer 13 im Zweifel wahrscheinlich die präzisere Formulierung wählen wird. Ist dies nicht möglich, wird er eher die strikte Formulierung bevorzugen, die auch die Gradualisierung enthält, als sich von vornherein auf die Gradualisierung zu beschränken. Moralische Normen und ethische Rechtfertigungen sind dagegen abstrakter. Zwischen ihnen wird es häufiger zu Kollisionen kommen, die eine Gradualisierung notwendig machen. Aus dieser statistischen Häufung kann aber nicht auf eine begrifflich-analytische Verbindung beider Merkmale und damit auch nicht auf eine begrifflich-analytische Verbindung von Recht und Ethik geschlossen werden. (2) Robert Alexy hat weiterhin geltend gemacht, daß das Recht einen „Anspruch auf Richtigkeit“ erhebe, was vom Standpunkt des Beobachters für das Rechtssystem als Ganzes und vom Standpunkt des Teilnehmers sowohl für das Rechtssystem als Ganzes als auch für einzelne Normen die analytische Verbindungsthese beweisen soll.7 Er führt das Beispiel einer Banditenbande an, die andere Menschen ausbeutet: „Auf lange Sicht erweist sich die prädatorische Ordnung nicht als zweckmäßig. Die Banditen bemühen sich daher um eine Legitimation. Sie entwickeln sich zu Herrschern und damit die prädatorische zu einer Herrscherordnung. An der Ausbeutung der Beherrschten halten sie fest. Die Akte der Ausbeutung erfolgen aber im Wege einer regelgeleiteten Praxis. Es wird jedermann gegenüber behauptet, daß diese Praxis richtig sei, weil sie einem höheren Zweck, etwa dem der Entwicklung des Volkes diene. ... Der entscheidende Punkt ist vielmehr, daß in der Praxis des Herrschersystems ein Anspruch auf Richtigkeit verankert und gegenüber jedermann erhoben wird. Der Anspruch auf Richtigkeit ist ein notwendiges Element des Begriffs des Rechts.“ Gegenüber dieser These ist zunächst zu fragen, was unter einem „Anspruch auf Richtigkeit“ zu verstehen ist. Dabei begegnet schon die Wortverbindung Zweifeln. Ein Anspruch wird immer gegenüber einem anderen erhoben; und zwar mit dem Ziel, diesen anderen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen. Man erhebt einen Anspruch auf Zustimmung, Befolgung, Anerkennung, Respekt etc. „Richtigkeit“ ist demgegenüber kein mögliches Verhalten eines angesprochenen anderen Menschen oder einer Gemeinschaft von Menschen. „Richtigkeit“ ist die Substantivierung einer janusköpfigen Verbindung aus Wertung und Beschreibung. Wir beurteilen Normen oder Handlungen als „richtig“. Damit kann unter „Anspruch auf Richtigkeit“ „Bewertung als richtig durch den Urheber“ oder weitergehend „Bewertung als richtig durch den Urheber, verbunden mit dem Anspruch gegenüber dem Adressaten auf Zustimmung zur Bewertung als richtig“ verstanden werden. Auf das Banditenbeispiel übertragen, kann dies bedeuten, daß die Banditen gegenüber den Beherrschten eine „Behauptung der Richtigkeit“ erheben wollen und es ihnen gleichgültig ist, ob die Hörer diese Behauptung nur registrieren, 7 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg 1992, S. 61ff. 14 oder es kann bedeuten, daß die Banditen wollen, daß die Hörer dieser Behauptung zustimmen. Da die Qualifizierung als „richtig“ eine positive Bewertung darstellt, kann man die Frage so formulieren: Verbinden die Banditen mit ihren Regeln notwendig eine positive Bewertung ihrer Regeln als richtig (erste Teilfrage), und wenn ja, wollen sie, daß die Unterworfenen ihrerseits diese positive Bewertung übernehmen (zweite Teilfrage)? Wie sich aus den obigen Überlegungen ergibt, ist die erste Teilfrage aus sprachlogischen Gründen mit „ja“ zu beantworten, wenn man annimmt, daß die Banditen ihre Normen autonom, d. h. ohne Zwang durch andere, erlassen. Wer einen anderen zu einem Verhalten verpflichtet, wertet damit gleichzeitig – wenn er selbst nicht unter Zwang handelt – die Realisation dieses Verhaltens und die normative Anforderung gegenüber dem anderen positiv.8 Die positive Antwort auf die erste Teilfrage trägt aber für die Annahme eines „Anspruchs auf Richtigkeit“ nichts ein, denn jeder Befehl, jedes Gebot, ja sogar jedes tatsächliche Verhalten, das andere betrifft, enthält implizit eine derartige positive Bewertung des Befehls, Gebots oder tatsächlichen Verhaltens durch den Sprecher oder Akteur. Dies gilt auch schon, bevor sich die Banditenbande um „Legitimation bemüht“. Die sprachfunktionale Tatsache einer Wertungsimplikation ist für das Recht nicht spezifisch und bedeutet nicht, daß die implizierte Wertung in irgendeiner zufälligen oder gar notwendigen Verbindung zu außerrechtlichen Wertungen steht. Die Banditen können etwa gewohnheitsmäßig oder rein dezisionistisch Vorschriften erlassen, ohne daß damit die durch die Vorschriften implizierte Bewertung irgendein außerhalb der Vorschriften liegendes ethisches Pendant hätte. Auf die zweite Teilfrage, ob neben der Bewertung auch der Anspruch gegenüber den Unterworfenen erhoben wird, daß diese die Bewertung übernehmen, kann man antworten: Dies geschieht nicht notwendig, aber regelmäßig. Denn nur wenn ein Angesprochener ebenfalls eine positive Bewertung entwickelt, wird er auch ohne Zwang zur Ausführung der vom Sprecher erwarteten Handlung bereit sein. Es liegt also im Interesse des Sprechers, daß auch der Angesprochene das erwartete Verhalten positiv wertet. Die zweite Teilfrage ist aber dann häufig negativ zu beantworten, wenn dem Sprecher Sanktionen bzw. Zwangsmittel zur Verfügung stehen. Kann er den Hörer zum geforderten Verhaltens zwingen, so muß er sich nicht darum bemühen, bei diesem eine zustimmende Bewertung zu erzeugen. Man könnte somit bei der Räuberbande nur dann von einem durchgängigen – wenn auch nicht notwendigen – Bemühen um positive Bewertung aller Maßnahmen durch die Unterworfenen ausgehen, wenn die Bande den Charakter als Zwangsordnung aufgeben würde. Dies nimmt aber weder Alexy in seinem Beispiel an, noch kann es für entwickelte Rechtsordnungen demokratischer Staaten der westlichen Welt postuliert werden, die ihre Rechtsregeln zumindest partiell mit Zwang durchsetzen. 8 Vgl. Dietmar v. d. Pfordten, Deskription, Evaluation, Präskription, Berlin 1993, S. 248. 15 Man könnte nun entgegnen: Es kommt nicht auf eine positive Bewertung durch die Unterworfenen in Einzelfällen an, sondern auf eine positive Bewertung der regelgeleiteten Praxis als Ganzes. Es kann nicht geleugnet werden, daß sich Rechtsetzer häufig um eine derartige generelle positive Bewertung bemühen. Es kann auch nicht geleugnet werden, daß sich die Banditen empirisch-faktisch „um eine Legitimation“ bemühen. Sie tun faktisch genau das, was mit dem Beispiel als begrifflich notwendig apostrophiert wurde: Sie verbinden ihre Normenordnung mit ethischen Rechtfertigungen. Aber das beweist nicht die begrifflich-analytische Verbindungsthese. Denn die Banditen können auch auf eine derartige Verbindung verzichten oder sie nur in beschränktem Maße anstreben – etwa wenn eine Revolution droht – oder nur gegenüber einzelnen Personen, etwa gegenüber den Clanführern der Unterworfenen. Ab welcher Intensität eine solche zusätzliche normative Legitimität dann die Zwangsordnung als Rechtsordnung qualifizieren soll, ist kaum festzulegen. Jedenfalls kann ein solches kontingentes und graduelles Verhalten nicht die These einer begrifflich-analytisch notwendigen Verbindung von Recht und Ethik rechtfertigen. Die These des rechtsethischen Essentialismus ist damit nicht erwiesen. Wer das „Bemühen um Legitimation gegenüber den Beherrschten“ als notwendiges Rechtskriterium postuliert, hat des weiteren zu bedenken, daß damit nicht nur Mörderregimen und Räuberbanden der Rechtsstatus abgesprochen wird, sondern auch einer größeren Anzahl von Normenordnungen, die bisher als Rechtsordnungen – wenn auch vielleicht als ungerechte Rechtsordnungen – angesehen wurden: allen Herrscherordnungen, die sich auf ein legitimatorisches Prinzip berufen, ohne dafür von den Rechtsunterworfenen eine Zustimmung in Anspruch zu nehmen. Dies gilt etwa für die christlichen Könige und Kaiser des Abendlandes mit ihrer Rückführung der Herrschermacht auf göttliche Einsetzung sowie für die alliierten Besatzungsmächte in Deutschland nach 1945. Aus pragmatischen Gründen haben natürlich auch diese Herrscher zum Teil gegenüber den Beherrschten auf ihre rechtsethische Legitimation verwiesen, zum Teil aber auch nicht. Aus diesem tatsächlichen Verhalten, das pragmatisch sinnvoll und rechtsethisch geboten ist, kann aber nicht auf seine begrifflich-analytische Notwendigkeit geschlossen werden. Im übrigen bedeutet das Erheben eines „Anspruchs auf Richtigkeit“ ja noch nicht, daß hier Richtigkeit – und damit eine notwendige Verbindung von Ethik und Recht – tatsächlich anzunehmen ist. Für die Teilnehmerperspektive versucht Alexy, die begrifflich-analytische Verbindungsthese des rechtsethischen Essentialismus zu erhärten, indem er Äußerungen anführt, die gegen den immer schon performativ erhobenen „Anspruch auf Richtigkeit“ verstoßen, zum Beispiel eine Verfassungsnorm „X ist eine souveräne, föderale, ungerechte Republik“, „Der Angeklagte wird, was falsch ist, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.“ Gegen diese Vorgehensweise kann man schon methodische Einwände erheben: So wie ein Naturgesetz nicht durch einzelne positive Experimente als im strengen Sinne bewiesen angesehen werden kann, weil die Induktion kein logisch gültiger Schluß ist, so kann man kaum 16 durch einzelne Äußerungsbeispiele, in denen performative Widersprüche auftreten, beweisen, daß ein „Anspruch auf Richtigkeit“ begrifflich notwendig, das heißt immer und überall erhoben wird. Die Beispiele können allenfalls den Status einer Plausibilisierung unserer kontingenten Sprachkonventionen für sich in Anspruch nehmen. Aber selbst unter diesem Vorbehalt sind sie kaum überzeugend: Zum ersten Beispiel: Die Verfassungsnorm ist aufgrund ihrer illokutionären Einbettung – das heißt ihrer Verwendung im Rahmen einer Verfassung – als präskriptiver Sprechakt zu interpretieren, der als solcher – wie sich oben ergab – immer auch eine positive Eigenbewertung enthält. Eine derartige positive Eigenbewertung ist nicht spezifisch für das Recht, sondern begleitet alle autonomen Präskriptionen. Es ist auch fehlerhaft zu sagen: „Geh’ zum Einkaufen, obwohl ich es für ungerecht halte, dich zum Einkaufen zu schicken!“ Die sprachliche Inkorporation einer Bewertung kann deshalb einer analytischen Verbindung von Rechtsethik und Recht nicht gleichgesetzt werden. Zum zweiten Beispiel: Wichtig ist zunächst, daß in diesem Beispiel nur ein performativer Widerspruch entsteht, wenn man Alexys Deutung als „Der Angeklagte wird, was eine falsche Interpretation des geltenden Rechts ist, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt“ übernimmt. Versteht man das Beispiel dagegen als „Der Angeklagte wird, obwohl ich es persönlich für falsch halte, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt“, so ergibt sich kein performativer Widerspruch. Der Richter kann demnach ein geltendes Gesetz ohne weiteres anwenden, obwohl er selbst eine andere Fallösung vorziehen würde, etwa weil er eine lebenslange Freiheitsstrafe für inhuman hält. Aber selbst wenn man Alexys Deutung des Beispiels übernehmen würde, könnte nie ausgeschlossen werden, daß der performative Widerspruch in der Äußerung aus einem Widerspruch zwischen innerjuridischen Rechtswertungen erwächst. Daß der Verweis auf außerjuridische rechtsethische Wertungen notwendig ist, kann deshalb durch einen derartigen performativen Widerspruch nicht dargetan werden.