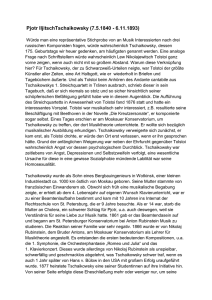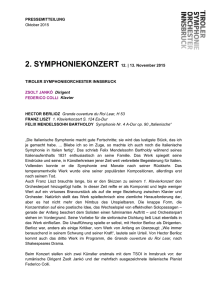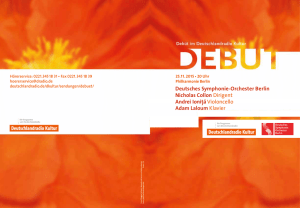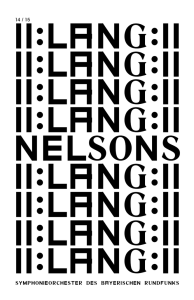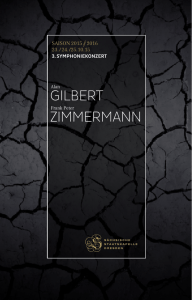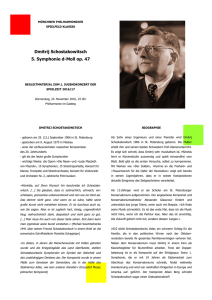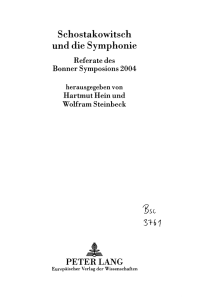Paavo Järvi - Münchner Philharmoniker
Werbung

Paavo Järvi Joshua Bell Samstag, 18. April 2015, 13:30 Uhr Sonntag, 19. April 2015, 11 Uhr Montag, 20. April 2015, 20 Uhr Dienstag, 21. April 2015, 20 Uhr Calla unser Diamantring des Jahres 2015 Ein Schmuckstück mit Seele – höchste Handwerkskunst gepaart mit viel Liebe zum Detail lassen in der Diamantenmanufaktur SCHAFFRATH ein einzigartiges Schmuckstück entstehen. Ein Ring zum Verlieben – so unbeschwert wie die Liebe selbst. Weitere Informationen unter: w w w. s c h a f f r a t h 1 9 2 3 . c o m . Carl Nielsen Ouver türe zur komischen Oper „Maskarade“ P j o t r I l j i t s c h Ts c h a i k o w s k y Konzer t für Violine und Orchester D-Dur op. 35 1. Allegro moderato – Moderato assai – Allegro giusto 2. Canzonetta: Andante 3. Finale: Allegro vivacissimo Igor Strawinsky „Scherzo fantastique“ für großes Orchester op. 3 Dmitrij Schostakowitsch Symphonie Nr. 1 f-Moll op. 10 1. Allegretto – Allegro non troppo | 2. Allegro 3. Lento – Largo | 4. Allegro molto Paavo Järvi, Dirigent Joshua Bell, Violine Eine Aufzeichnung der Konzer tserie durch den Bayerischen Rundfunk wird am Mit t woch, dem 27. Mai 2015, ab 20.03 Uhr auf BR-KL ASSIK gesendet. Samstag, 18. April 2015, 13:30 Uhr | 5. Öf fentliche Generalprobe Sonntag, 19. April 2015, 11:00 Uhr | 7. Abonnementkonzer t m Montag, 20. April 2015, 20:00 Uhr | 4. Abonnementkonzer t k5 Dienstag, 21. April 2015, 20:00 Uhr | 5. Abonnementkonzer t e5 Spielzeit 2014/2015 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant 2 Carl Nielsen: „Maskarade“ Witzig, humorvoll, frech Nicole Restle Carl Nielsen Textvorlage der Oper (1865–1931) Nachdem sich Carl Nielsen entschieden hatte, die Komödie „Maskarade“ von Ludvig Holberg (1684–1754), dem großen norwegisch-dänischen Dichter des 18. Jahrhunderts, zu vertonen, suchte er einen Librettisten, der dem sehr speziellen Humor der Vorlage gerecht werden konnte. Er fand ihn in dem dänischen Literaturhistoriker Vilhelm Andersen (1864–1953), der das Libretto 1904 innerhalb von nur einem Monat in enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten verfasste. Ouvertüre zur komischen Oper „Maskarade“ Entstehung Die Ouvertüre zu der 1904 begonnenen komischen Oper „Maskarade“ schrieb Carl Nielsen zwischen dem 25. September und 3. November 1906: Zu diesem Zeitpunkt waren die Proben für die Uraufführung der Oper allerdings bereits im vollen Gange ! Im November 1907 erhielt die Ouvertüre für ihre konzertante Erstaufführung in Schweden einen neuen Schluss. Uraufführung Lebensdaten des Komponisten Geboren am 9. Juni 1865 in Sortelung (südlich von Odense auf der Insel Fünen / Dänemark); gestorben am 3. Oktober 1931 in Kopenhagen. Am 11. November 1906 in Kopenhagen im Rahmen der Welturaufführung der Oper „Maskarade“ im Königlichen Opernhaus (Orchester des Königlichen Opernhauses Kopenhagen unter Leitung von Carl Nielsen). Die Konzertfassung der Ouvertüre wurde am 26. November 1907 bei einem Symphoniekonzert in Stockholm zum ersten Mal gespielt. 3 Carl Nielsen in seiner eigenen Grimassen-Maskerade (um 1885) 4 Carl Nielsen: „Maskarade“ Von den großen Komponisten des Nordens, zu denen auch der Däne Carl Nielsen gehört, erwartet man in erster Linie eine Musik, die die Schönheiten der weiten Landschaften widerspiegelt oder alten Sagenstoffen eine klang­ liche Gestalt gibt. Nichts davon findet sich in Nielsens komischer Oper „Maskarade“, die am 11. November 1906 im Königlichen Theater Kopenhagen unter Leitung des Komponisten uraufgeführt wurde und rasch zur Nationaloper avancierte. Sie verhandelt mit Leichtigkeit, Humor, Ironie und Esprit ein Thema, das über das Nationale hinausweisend allgemeingültig scheint: Spießbürgertum gegen freiheitliches Gedankengut, gesellschaftliche Zwänge versus persön­ liches Glück. Sowohl das Sujet der Oper als auch die Musik erinnern an die großen Komödien des Musiktheaters: Mozarts „Le nozze di Figaro“ und „Così fan tutte“, Rossinis „Il barbiere di Siviglia“ oder Verdis „Falstaff“. Wider das Philistertum Im Mittelpunkt der Handlung stehen Leander und Leonore, zwei junge Leute aus dem wohlhabenden Kopenhagener Bürgertum. Die beiden verlieben sich auf einem Maskenball ineinander und wollen heiraten – sehr zum Unwillen der Eltern, die eigentlich für ihre jeweiligen Sprösslinge bereits einen Partner bestimmt haben und die Wahl ihrer Kinder kategorisch ablehnen. Zum guten Schluss löst sich jedoch alles in Wohl­ gefallen auf: Es stellt sich nämlich heraus, dass Leander und Leonore genau diejenigen sind, die auch die Eltern zusammenbringen wollten. Die Vorlage zu Nielsens Oper lieferte die gleichnamige Komödie des norwegisch-dänischen Dichters Ludvig Holberg, der im 18. Jahrhundert als Schriftsteller, Wissenschaftler und Universitätsprofessor in Kopenhagen wirkte. Sein Schaffen fiel in eine Zeit, in der der kunstsinnige König Frederik IV. das erste Theater Dänemarks gründete und die beiden Impresari des neuen Hauses händeringend einen Autor für dänischsprachige Stücke suchten. Sie baten den Dichter, einige Komödien zu schreiben, darunter „Maskarade“ aus dem Jahr 1724. Holbergs Komödien sind von den Idealen der Aufklärung geprägt und orientieren sich an der italienischen Commedia dell’arte sowie an den Werken des Franzosen Molière, die sich damals dank reisender Theatertruppen auch in Dänemark großer Beliebtheit erfreuten. Von der Bibel in den Karneval Gerade der spezielle Humor, den Holberg in seinen Stücken entwickelte, sprach Carl Nielsen an, und ihm kam bereits 1890, im Alter von 25 Jahren, die Idee, aus einer der Komödien eine Oper zu machen. Es gingen jedoch noch Jahre ins Land, ehe der Komponist seinen Plan in die Tat umsetzte. Erst nachdem er sein Talent für das Musiktheater mit einem ernsten Stoff, der biblischen Geschichte von Saul und David, bewiesen hatte, wagte er sich an das leichtere Genre. Zunächst liebäugelte er mit einer anderen Komödie des dänischen Dichters, ehe er sich schließlich für „Maskarade“ entschied, die schon allein durch ihren äußeren Rahmen – die Handlung spielt in der Karnevalszeit mit ihren vielen Kostümbällen und Tanz­ veranstaltungen – reichlich Gelegenheit für bühnenwirksame Szenen mit Tanzeinlagen bot. Zudem war Nielsen das Milieu der Tanzsäle aus seiner Zeit als Geiger im Orchester des „Tivo- Carl Nielsen: „Maskarade“ li“, des berühmten Kopenhagener Vergnügungsparks, bestens vertraut. Schwerer Anfang für ein leichtes Genre Der Komponist hielt Ausschau nach einem Librettisten, der dem besonderen Holberg’schen Humor gerecht werden konnte. Er fand ihn in dem Literaturhistoriker Vilhelm Andersen, auf den er bei einer Studentenaufführung im Folke­ teatret aufmerksam geworden war und den er für sein Vorhaben begeistern konnte. Nachdem die beiden im Karneval 1904 bei einem Maskenball „Feldstudien“ betrieben hatten, machte sich Andersen an die Arbeit und entwarf das Textbuch innerhalb eines Monats. Allerdings dauerte es eine Weile, ehe Nielsen mit der Vertonung begann; den leichten Ton für das Werk zu finden, fiel ihm zunächst schwer. Er verglich die Anfangsphase des Komponierens mit einem Schiff, das sich mühsam seinen Weg durch ein vereistes Meer sucht, ehe es dann im eisfreien Gewässer volle Fahrt aufnehmen kann. „Ich hatte schreckliche Schwierigkeiten, bis ich in die Thematik und den Tonfall hineingekommen bin. Das war ganz neu für mich. Es ist wirklich seltsam und es sollte mir noch mehr zu denken geben, seitdem es so leicht und flüssig vorwärts geht.“ Renaissance des Klassizismus Nielsen fand in „Maskarade“ zu einer neuen Klassizität: eine liedhafte Melodik, ein sich in seiner Durchsichtigkeit an Mozart und Haydn orientierender Orchestersatz, aber dennoch mit modernem Anspruch. Diese Haltung kenn- 5 zeichnet auch die Ouvertüre, die der Komponist als letztes, kurz vor der Uraufführung, vollendete. Ihr Beginn mit der agilen, etwas nervös erscheinenden Anfangsfanfare wirkt wie ein sich hebender Vorhang, der dem Publikum Zugang zu dem erwartungsfrohen Geschehen einer bevorstehenden Ballnacht verheißt: die festliche Aufgeregtheit, das sich fröhliche Begrüßen und Zusammenfinden der Gäste, ihre blasierten, eifrigen Unterhaltungen klingen ebenso an, wie Walzer- und andere Tanzthemen. Der Mittelteil mit seinen fugierten Themeneinsätzen vermittelt die gravitätische Gespreiztheit der Honoratioren. Subtil greifen die einzelnen Instrumentalstimmen ineinander, werfen sich kurze Motive zu, treten in ein dialogisierendes Wechselspiel, hinzu kommen die vorantreibenden Sechzehntelfiguren der Streicher und Holzbläser – all das zusammen macht das Schwungvolle, Mitreißende dieser Musik aus. Auch wenn Andersens Adaption der Holberg’schen Komödie von der Kritik nicht ungeteilten Zuspruch erhielt, Nielsens furiose Musik überzeugte, und „Maskarade“ fand einen festen Platz im Repertoire des Königlichen Theaters in Kopenhagen. Auch in Kollegenkreisen erntete der Komponist Anerkennung: „Was für ein amüsantes und witziges Werk Du geschaffen hast ! [...] Diese feine, humorvolle Art und diese kluge Ökonomie der technischen Mittel !“, schrieb Edvard Grieg enthusiastisch nach dem Besuch einer Aufführung an Nielsen. Die Konzertfassung der Ouvertüre wurde eines der meistgespielten Werke des dänischen Komponisten. 6 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur „Gezaust, gerissen und gebläut...“ Nicole Restle Pjotr Iljitsch Tschaikowsky Entstehung (1840–1893) Pjotr Iljitsch Tschaikowsky schrieb sein (einziges) Violinkonzert vom 17. März bis 11. April 1878 im Kurort Clarens am Genfer See (Schweiz). Die Erstveröffentlichung erschien unter dem Drucktitel „Concert für Violine mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte op. 35“; gleichwohl wird das Konzert heute fast ausnahmslos in der Orchesterfassung aufgeführt. Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35 1. A llegro moderato – Moderato assai – Allegro giusto 2. Canzonetta: Andante 3. Finale: Allegro vivacissimo Widmung Im Erstdruck noch „Herrn L. Auer gewidmet“; nach Ablehnung des Violinkonzerts durch den ungarischen Virtuosen Leopold Auer (1845– 1930), der von 1868 bis 1917 die Geigenklasse am St. Petersburger Konservatorium leitete, übertrug Tschaikowsky die Dedikation auf den russischen Geiger Adolph Davidowitsch Brod­ skij (1851–1929) und schenkte ihm eine Photographie mit der Aufschrift „Dem Erneuerer des Konzerts, das für unmöglich gehalten wurde, vom dankbaren Komponisten“. Lebensdaten des Komponisten Geboren am 25. April (7. Mai) 1840 in Wotkinsk (Wjatka / Ural); gestorben am 25. Oktober (6. November) 1893 in St. Petersburg. Uraufführung Am 4. Dezember 1881 in Wien im Großen („Goldenen“) Musikvereinssaal (Wiener Philharmoniker unter Leitung von Hans Richter; Solist: Adolph Brodskij). 7 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky mit seinem ehemaligen Schüler Josif Kotek (um 1877) 8 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur Im Schaffensrausch „Zum ersten Male in meinem Leben fühlte ich mich gezwungen, ein neues Werk zu beginnen, ohne das vorhergehende abgeschlossen zu haben. Bisher hielt ich mich fest an die Regel, niemals eine neue Arbeit anzufangen, solange die alte nicht beendet war. Aber diesmal geschah es, dass ich die Lust in mir nicht bezwingen konnte...“, schrieb Pjotr Iljitsch Tschaikow­ sky am 19. März 1878 aus dem schweizerischen Kurort Clarens am Genfer See an seine Gönnerin Nadeshda von Meck. Die Komposition, die ihn in ihren Bann gezogen hatte und ihn darüber eine andere, nämlich die der Klaviersonate G-Dur op. 37, erst einmal vergessen ließ, war das Violinkonzert D-Dur op. 35. Tschaikowsky brauchte von den ersten Skizzen bis zur kompletten Instrumentierung nur einen knappen Monat – und das, obwohl er den zweiten Satz gleich doppelt schrieb. Denn den ursprünglichen Mittelsatz, den er später unter dem Titel „Méditation“ für Violine und Klavier veröffentlichte, ersetzte er zum Schluss durch die knappere und prägnantere „Canzonetta“. Ein schneller, fast möchte man sagen, rauschhafter Schaffensprozess, der signalisierte, dass Tschaikowsky das gesundheitliche und seelische Tief überwunden hatte, in das er durch seine Heirat mit seiner ehemaligen Schülerin Antonina Miljukowa geraten war. Die im Juli 1877 geschlossene Ehe, die sich für Tschaikowsky als fürchterlicher Irrtum herausstellte und ihn in eine schwere Nervenkrise stürzte, wurde bereits nach drei Monaten wieder geschieden. Anschließend ermöglichte ihm Nadeshda von Meck eine längere Auslands- reise, auf der er sich von den Anspannungen erholen und wieder neue Kraft zum Komponieren sammeln sollte. Er trat sie in Begleitung seines Bruders Modest und dessen Schülers Nikolaj Konradi im Oktober 1877 an. Édouard Lalo als Vorbild Tatsächlich mobilisierte diese Reise Tschaikowskys schöpferische Energien. Er fühlte sich nun in der Lage, seine 4. Symphonie und seine Oper „Eugen Onegin“ zu vollenden – zwei Werke, die er 1877 begonnen hatte und deren Fertigstellung durch die seelische Krise unterbrochen worden war. Danach ging er zur „Entspannung“ an die Klaviersonate G-Dur. Doch die Arbeit wollte nicht so recht von der Hand gehen. Da kam überraschend der Geiger Josif Kotek zu Besuch, der am Moskauer Konservatorium bei Tschaikowsky Tonsatz studiert hatte und seither mit dem Komponisten befreundet war. In seinem Gepäck befanden sich einige musikalische Neuheiten, die er gemeinsam mit Tschaikowsky durchspielte. Vor allem Édouard Lalos „Symphonie espagnole“ für Violine und Orchester gefiel dem Komponisten besonders gut. Wie aus einem Brief an seine Mäzenin hervorgeht, bewunderte Tschaikowsky die Frische und Leichtigkeit sowie die reizvollen Rhythmen und die vortrefflich harmonisierten Melodien des Werks. Er fühlte sich davon so angeregt, dass er beschloss, auch ein Stück für Violine und Orchester zu schreiben. Es sollte sich wie Lalos Komposition durch musikalische Eleganz und zündende Themen auszeichnen. Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur Melodische Raffinessen Tschaikowsky war selbst ein genialer Schöpfer anrührender Themen, der sich beim Komponieren in erster Linie von der melodischen Inspiration leiten ließ. Allerdings stand für ihn hinter jeder Melodie bereits ein bestimmtes harmonisches Konzept. „Eine Melodie kann einem nicht anders in den Sinn kommen als zusammen mit ihrer Harmonie ! Überhaupt sind diese beiden Elemente der Musik – samt dem Rhythmus – untrennbar; jeder melodische Gedanke setzt also einen bestimmten harmonischen Zusammenhang voraus...“, heißt es 1878 in einem Brief an Nadeshda von Meck. Von dieser Konzeption sind auch die Themen des Violinkonzerts geprägt. Die ihnen eigene Spannung erzeugt Tschaikow­ sky durch das raffinierte Spiel mit Tonika- und Dominant-Klängen, sowie durch ausgeprägtes Changieren zwischen Dur und Moll. So wendet sich das Hauptthema des ersten Satzes kurz nach h-Moll, der „Paralleltonart“ von D-Dur – der h-Moll-Klang ist von Anfang an allgegenwärtig. Ein weiteres Merkmal ist, dass Tschaikowsky die Tonika-Akkorde nicht in ihrer Grundstellung, sondern bevorzugt in ihrer Umkehrung benutzt. Dadurch erhält die Musik eine besondere Leichtigkeit und Schwerelosigkeit. Die Violine gibt den Ton an Der Kopfsatz des Violinkonzerts ist formal zwar als Sonatenhauptsatz konzipiert, doch ist er weit davon entfernt, „klassisch“ zu sein. Denn nach einer kurzen Orchestereinleitung, in der die Streicher den Anfang des Hauptthemas andeu- 9 ten, wird die Exposition allein von der Geige bestritten. Das Soloinstrument beginnt mit einem improvisatorisch anmutenden Passagenspiel, in dem es auf den Anfang der Einleitung Bezug nimmt, und stellt daraufhin das Hauptthema vor. Dieses zeichnet sich durch synkopische Rhythmik und eine immer größer werdende melodische Gestik aus. Ein kurzes, prägnantes, mehrmals repetierendes Motiv gebietet dem musikalischen Aufschwung des Solisten Einhalt und leitet zur Themenwiederholung über. Im folgenden wird dieses Motiv Bestandteil des zweiten musikalischen Gedankens, der ebenso wie der erste in der Grundtonart D-Dur steht, aber wegen seiner Kürze eher episodenhaft wirkt. Virtuose Läufe und Passagen leiten auf das dritte Thema hin, das in der Dominanttonart A-Dur steht. Dieses dritte Thema nimmt in der Exposition den meisten Raum ein. Genau wie die beiden vorausgehenden wird es von der Solovioline vorgetragen – zunächst pianissimo von den Streichern begleitet, später kommt bei der Wiederholung eine Gegenfigur in der Klarinette hinzu. Der drängende Impetus der Melodie verführt die Violine zu einer musikalischen Fortspinnung, zu der das Orchester den Anfang des dritten Themas zitiert und die in einen höchst virtuosen Überleitungsteil mündet. Anders als man es vom Eröffnungssatz eines Konzerts gewohnt ist, findet in der Exposition kein thematischer Austausch zwischen Solo­ instrument und Orchester statt. Stets bleibt die Solovioline der dominante Part. Erst in der Durchführung wird das Orchester zum Träger des musikalischen Geschehens. Gemessen an „klassischen“ Vorbildern entspricht aber auch 10 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur dieser Teil nicht den üblichen Erwartungen, denn die traditionelle Auseinandersetzung mit dem Themenmaterial der Exposition findet nicht statt. Vielmehr lässt Tschaikowsky das Hauptthema in zwei verschiedenen musikalischen „Stimmungen“ vortragen: einerseits pathetisch und würdevoll vom Orchester, andererseits tändelnd und spielerisch ausgeziert von der Vio­line. Der Durchführung folgt die von Tschaikowsky ausgeschriebene Solokadenz, in der die thematische Arbeit sozusagen „nachgeholt“ wird, ehe der Satz mit der Reprise und einer überaus virtuosen Schlusscoda zu Ende geht. Lyrische Elegie im Mittelsatz Der zweite Satz mit der Bezeichnung „Canzonetta“ hat einen liedhaften Charakter. Von einem Bläserchoral eröffnet, greift Tschaikowsky mit dem ersten Akkord den D-Dur-Schluss des Kopfsatzes auf, der sich allmählich als Dominante zur neuen Grundtonart g-Moll entpuppt. Wie im ersten Satz so ist auch hier die Solovioline der fast ausschließliche Träger des melodischen Gedankens. Durch seine innige Schlichtheit besticht das Hauptthema. Das Gerüst der Melodie wird vom Ton d gebildet, den Tschaikowsky mehrmals wiederholt und als Achsenton im Wechsel zwischen Dominant- und Tonikaklängen benutzt. Formaler Mittelpunkt des Satzes ist das lyrische Nebenthema in Es-Dur, das vom Hauptthema und dessen Wiederholung eingerahmt wird, bei der als musikalische Steigerung Klarinetten- und Flötenfiguren die Solostimme umspielen. Am Ende erklingt nochmals der Bläser­ choral, der im pianissimo eine Sekundfigur ent- stehen lässt – die motivische Keimzelle des folgenden Schlusssatzes –, um mit ihr direkt ins Finale überzuleiten. Tänzerischer Ausklang im Finale Der letzte Satz zeichnet sich durch derbe, volkstümliche Melodien aus und steht in starkem Kontrast zu dem elegischen Duktus des Mittelsatzes. Der Zuhörer fühlt sich in ein russisches Dorffest versetzt. Tschaikowsky bestreitet das Finale mit zwei Themen, einem lebhaft springenden, dessen Kopfmotiv sich in den einleitenden Orchestertakten aus der erwähnten Überleitungsfigur des Andante entwickelt, und einem eher behäbig auftretenden, dessen folkloristische Wirkung die bordunartigen Quinten in den Violoncelli unterstreichen. Letzteres wird zunächst von der Geige vorgestellt und geht dann in das Orchester über, während das Soloinstrument die Melodie mit virtuosen Läufen und Doppelgriff-Figuren umspielt. Den musikalischen Ruhepunkt in diesem fulminanten Finale bildet ein mit „Molto meno mosso“ überschriebener Moll-Teil, der sich an das zweite Thema anschließt und mit ihm melodisch verwandt ist. Die sich aus dem Wechsel der beiden Themen ergebende formale Struktur des Satzes wird durch die Harmonik noch plastischer gemacht: Das erste Thema erklingt ausschließlich in der Grundtonart D-Dur, das zweite weicht zuerst in die Tonart der Ober-, später der Unterquinte aus. Obwohl alle drei Sätze in ihrem Charakter sehr unterschiedlich sind, eint sie ein übergeordnetes musikalisches Element: Der Auftritt der Solovioline wird stets von einer durch die Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur Dominante bestimmten Orchestereinleitung vorbereitet, so dass kein Satz in seiner Grundtonart beginnt. Dedikationen und kein Ende Da Tschaikowsky mit der Spieltechnik der Geige wenig vertraut war, holte er sich bei der Ausgestaltung des mit technischen Schwierigkeiten gespickten Soloparts Rat bei Josif Kotek. Der Komponist hätte aus diesem Grund das Werk auch gerne dem befreundeten Geiger zugeeignet. Doch er fürchtete, dass die geplante Dedikation die Gerüchte hinsichtlich seiner homoerotischen Neigungen schüren würde, und widmete sein Opus 35 stattdessen dem am Konservatorium von St. Petersburg lehrenden ungarischen Violinvirtuosen Leopold Auer. Dieser aber lehnte es als unspielbar ab, worauf Tschaikowsky tief enttäuscht die Widmung zurückzog. Nach Auers vernichtendem Urteil wagte sich zunächst niemand an das Konzert heran. Schließlich stellte der junge russische Geiger Adolph Brodskij, Schüler von Joseph Hellmesberger, das Stück am 4. Dezember 1881 bei seinem ersten Auftritt in Wien im Rahmen der Philharmonischen Konzerte unter Leitung von Hans Richter erstmals der Öffentlichkeit vor. Niederschmetternde Kritiken Die Uraufführung muss sehr turbulent gewesen sein. Es gab stürmischen Beifall und heftige Ablehnung. Die Presse reagierte fast durchweg negativ, allen voran der Wiener Kritikerpapst Eduard Hanslick, der seinem Unmut freien Lauf 11 ließ: „Da wird nicht mehr Violine gespielt, sondern Violine gezaust, gerissen, gebläut...“ In Anlehnung an einen Ausspruch des Zürcher Ästhetikers Friedrich Theodor Vischer bezeichnete er Tschaikowskys Konzert als Musik, „die man förmlich stinken hört“. Heute hingegen gehört das Werk neben dem Violinkonzert von Johannes Brahms, das übrigens im selben Jahr wie das Tschaikowskys entstand, und dem von Ludwig van Beethoven, das für beide Pate gestanden hatte, zu den bedeutendsten Beiträgen dieser Gattung im 19. Jahrhundert. 12 Igor Strawinsky: „Scherzo fantastique“ Wie alles anfing Susanne Stähr Igor Strawinsky Lebensdaten des Komponisten (1882–1971) Geboren am 5. (17.) Juni 1882 in Oranienbaum (seit 1948: Lomonossow) bei St. Petersburg; gestorben am 6. April 1971 in New York. „Scherzo fantastique“ für großes Orchester op. 3 Con moto – Moderato assai – Più mosso – Tempo I Entstehung Strawinsky komponierte das „Scherzo fantastique“ während seiner Studienzeit bei Nikolaj Rimskij-Korsakow; die Partitur entstand zwischen Juni 1907 und März 1908 in Ustilug (Wol­ hynien / Ukraine), wo Strawinsky 1907 ein Landhaus bezogen hatte. Widmung Dem Moskauer Pianisten und Dirigenten Alexander Siloti (1863–1945), der Schüler von Liszt, Tschaikowsky und Nikolaj Rubinstein war und auch als Klavierlehrer seines Cousins Sergej Rachmaninow bekannt wurde. Uraufführung Am 25. Januar (6. Februar) 1909 in St. Petersburg im Saal der St. Petersburger Adelsversammlung (Orchester des Kaiserlich-Russischen Mariinsky-Theaters unter Leitung von Alexander Siloti); im selben Konzert stand auch die Uraufführung von Strawinskys „Feu d’artifice“ op. 4 auf dem Programm. 13 Igor Strawinsky in Ustilug (um 1909) 14 Igor Strawinsky: „Scherzo fantastique“ Die Entdeckung eines Genies „Er hat mich niemals gelobt“ Der 6. Februar 1909 sollte das Leben des damals 26-jährigen Igor Strawinsky schlagartig verändern. Bis dahin war er in der Musikwelt nahezu unbekannt: Er hatte nicht mit jugend­ lichen Geniestreichen für frühe Aufmerksamkeit gesorgt, und es gab auch keine spektakulären oder skandalumwitterten Auftritte, die ihn in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt hätten. Nein, Strawinsky erlernte sein kompositorisches Handwerk gewissermaßen im stillen Kämmerlein, im Privatunterricht bei Nikolaj Rimskij-Korsakow, den er neben seinem Jurastudium 1902 begonnen hatte. Nur einmal war bislang ein Werk von ihm zur öffentlichen Aufführung gelangt, die Gesangssuite „Faune et Bergère“ für Mezzosopran und Orchester nach einem Text von Alexander Puschkin. Was hatte Diaghilew, dessen untrügliches Gespür für künstlerische Genialität legendär war, so sehr für diese „Gesellenstücke“ des jungen Strawinsky eingenommen und namentlich für das „Scherzo fantastique“ ? Vergleicht man das Scherzo, das zwischen Juni 1907 und März 1908 entstand, mit den drei nur wenig später komponierten russischen Balletten, wirkt es naturgemäß wesentlich konventioneller – Welten trennen die filigran gearbeitete Textur, die unwirklich schillernde Klangsprache, die noch ganz den Geist des Fin-de-Siècle atmet, von der brachialen Radikalität, der „Barbarenmusik“ des „Sacre du Printemps“. Andererseits stellt das frühe Scherzo Strawinskys einzigartiges Gespür für instrumentale Farben und Effekte schon unter Beweis: Vierfach besetzte Bläser, geteilte Streicher, drei Harfen und Celesta sieht die Partitur vor, wobei die unterschiedlichen Klangvaleurs subtil und charakteristisch herausgearbeitet sind. Rimskij-Korsakow, der am 21. Juni 1908, drei Monate nach Fertigstellung des Scherzo, verstarb, hatte das Autograph noch selbst durchsehen können, seinem Schüler gegenüber allerdings mit Anerkennung gegeizt: „Er hat mich niemals gelobt“, erinnerte sich Strawinsky später, „doch nach seinem Tod erzählten mir einige seiner Freunde, dass er sich sehr lobend über die Partitur des Scherzo geäußert habe.“ An jenem schicksalhaften 6. Februar aber wurden gleich zwei Orchesterwerke Strawinskys aus der Taufe gehoben, und dies auch noch in der vielbeachteten St. Petersburger Konzertreihe des Dirigenten und Pianisten Alexander Siloti: das „Scherzo fantastique“ op. 3 und das „Feu d’Artifice“ op. 4. Im Publikum saß Sergej Diaghilew, der berühmte Impresario und Gründer der Ballets Russes: Er zeigte sich von den beiden Partituren so beeindruckt, dass er Strawinsky sogleich um die Orchestrierung zweier Stücke von Chopin bat, die in das Ballett „Les Sylphides“ Eingang fanden. Nur wenig später erteilte Diaghilew dann den Auftrag zu Strawinskys erster großer Ballettmusik, zum „Feuer­ vogel“: Eine der produktivsten Künstlerfreundschaften des 20. Jahrhunderts nahm ihren Anfang – und sollte Musikgeschichte schreiben. Gewiss enthält das Werk auch Reminiszenzen an die funkelnde Klangwelt Rimskij-Korsakows, sie erschöpfen sich indes nie im Epigonalen. Strawinsky habe, so formulierte es der russische Musikhistoriker Mikhail Druskin, „die vom Igor Strawinsky: „Scherzo fantastique“ Lehrmeister ausgehenden Strahlen nicht nur reflektiert, sondern auf eigene, originelle Weise gebrochen“. Fünfzig Jahre nach Vollendung des „Scherzo fantastique“ hat es Strawinsky übrigens selbst nochmal als Dirigent zur Wieder­ gabe gebracht – und er zeigte sich angenehm berührt von seinem Frühwerk: „Das Orchester ‚klingt‘, die Musik ist licht auf eine Art, wie sie in Kompositionen jener Epoche selten zu finden ist“, erklärte er. „Natürlich erkenne ich heute, dass ich einiges aus Rimskijs ‚Hummelflug‘ übernommen habe, aber das Scherzo zollt Mendelssohn und auch Tschaikowsky höheren Tribut als Rimskij-Korsakow.“ Die Liste der „Vorbilder“, die hier anklingen, könnte man freilich noch fortsetzen: Lässt sich nicht hie und da Debussy erahnen ? Und scheint, hinter der chromatischen Stimmführung des langsamen Mittelteils, nicht auch noch Wagner auf ? Reges Treiben im Bienenkorb Igor Strawinsky betrachtete sein „Scherzo fantastique“ als „rein symphonische Musik“. Ein Programm habe er bei der Komposition keineswegs im Sinn gehabt, bekannte er gegenüber seinem Mitarbeiter Robert Craft. Gleichwohl wurde das Stück – ohne Zustimmung des Komponisten – für ein Ballett herangezogen, das auf dem Drama „Das Leben der Bienen“ von Maurice Maeterlinck basierte und 1917 in der Choreographie von Leo Staats an der Opéra de Paris herauskam. Strawinsky trug diesen „Missbrauch“ mit Humor: „Bienen haben mich immer fasziniert“, spottete er, „doch habe ich weder versucht, sie in meinem Werk zu beschwören, noch haben mich die Bienen in irgendeiner Weise beeinflusst, außer dass ich meine tägliche 15 Honig-Diät – dem römischen Arzt Galen zum Trotz – beibehalte.“ Maeterlinck dagegen gab sich erzürnt, er bezichtigte den verblüfften Strawinsky gar des Betrugs. Der Verleger des Komponisten wiederum beurteilte die Angelegenheit ganz praktisch, er gewahrte die Chance, das Werk besser vermarkten zu können – und verfasste kurzerhand als Vorbemerkung eine detaillierte Programmbeschreibung. „Der erste Teil gibt ein Bild des regen Treibens im Bienenkorb“, heißt es darin; „der Mittelteil schildert den Sonnenaufgang und den Hochzeitsflug der Königin, den Liebeskampf mit dem auserwählten Gemahl und dessen Tod. Im dritten Teil herrscht wieder das friedlich-emsige Treiben im Bienenkorb.“ „Some bad literature about bees“, nannte Strawinsky das Elaborat, aber dieser sarkastische Kommentar hat nicht verhindert, dass sein „Scherzo fantastique“ noch heute in den Verlagsverzeichnissen mit dem Untertitel „Der Bienenflug“ annonciert wird. Ironie der Musikgeschichte. 16 Dmitrij Schostakowitsch: 1. Symphonie f-Moll Ein Komponist wird entdeckt Marcus Imbsweiler Dmitrij Schostakowitsch Lebensdaten des Komponisten (1906–1975) Geboren am 25. (12.) September 1906 in St. Petersburg; gestorben am 9. August 1975 in Moskau. Symphonie Nr. 1 f-Moll op. 10 1. Allegretto – Allegro non troppo 2. Allegro 3. Lento – Largo 4. Allegro molto Entstehung Erste Pläne zum 2. Satz stammen aus dem Jahr 1923 – da war Schostakowitsch noch keine 17 Jahre alt. Die eigentliche Komposition fällt in den Zeitraum von Oktober 1924 bis Mai 1925, ist also die Arbeit eines 18-Jährigen. Im Dezember 1925 reichte Schostakowitsch die Symphonie bei der Prüfungskommission des Leningrader Konservatoriums ein, Anfang 1926 spielte er dem Direktorium die Klavierfassung vor. Uraufführung Am 12. Mai 1926 in Leningrad im Großen Saal der Leningrader Philharmonie (Leningrader Philharmoniker unter Leitung von Nikolaj Malko). Schostakowitschs Symphonie wurde auf Empfehlung zahlreicher Konservatoriumsdozenten, vor allem aber auf Fürsprache seines Lehrers Alexander Glasunow aufgeführt; auf dem Programm standen gleich drei Werke sowjetischer Nachwuchskomponisten, von denen Schostakowitschs Symphonie den mit Abstand größten Erfolg hatte. 17 Dmitrij Schostakowitsch als 17-jähriger Student (1923) 18 Dmitrij Schostakowitsch: 1. Symphonie f-Moll Bis zum Alter von neun Jahren deutete kaum etwas auf eine mögliche Hochbegabung Dmitrij Schostakowitschs hin. Mit dem Beginn des Klavierunterrichts aber wurden, wenn auch verspätet, die Weichen für eine WunderkindKarriere gestellt. Improvisationen und erste Kompositionsversuche verrieten ein enormes kreatives Potenzial, das dem 13-Jährigen die Aufnahme am Konservatorium seiner Heimatstadt St. Petersburg ermöglichte. Einen veritablen Triumph feierte er 1926, keine 20 Jahre alt, mit der Uraufführung seiner f-Moll-Symphonie. Das Werk machte den Namen Schostakowitsch schlagartig im ganzen Land bekannt – und in den Folgejahren auch in Europa und den USA. Schwierige Lebenssituation Was diese kurze Übersicht allerdings verschweigt, das sind die prekären, zum Teil existenzbedrohenden Umstände, unter denen Schostakowitsch zum Komponisten reifte. So dürften seine zahlreichen Erkrankungen im Jugendalter wie Anämie und Tuberkulose auf die katastrophale Versorgungslage in den Jahren nach dem kommunistischen Umsturz zurückzuführen sein. Und als 1922 Dmitrijs Vater starb, war die Familie Schostakowitsch auf Unterstützung durch Verwandte angewiesen. Auch musikalisch ging es keineswegs kontinuierlich bergauf. Nach Abschluss des Klavierexamens 1923 wurde Schostakowitsch die Weiter­f ührung seiner Studien am Konservatorium verwehrt. Zwei Jahre lang schlug er sich als Pianist in Stummfilm-Kinos durch, was wiederum zu Lasten seiner Kompositionstätigkeit ging. In dieser Zeit war der 18-jährige Schostakowitsch nur einer von vielen hochtalentierten russischen Nachwuchsmusikern, lückenhaft ausgebildet und zumindest kurzfristig ohne Perspektive. Die Weitsicht des Alexander Glasunow Die 1. Symphonie änderte in dieser Hinsicht nicht alles, aber vieles. Erste Pläne, nämlich der Entwurf des als Scherzo konzipierten 2. Satzes, stammen aus jenem Jahr 1923, als Schostakowitsch vom Konservatorium flog, an Tuberkulose erkrankte und sich zum ersten Mal verliebte. Zwischen Herbst 1924 und Frühjahr 1925 wurde der Einzelsatz zum symphonischen Zyklus erweitert. Während drei der vier Sätze dem jungen Komponisten recht leicht von der Hand gingen, bereitete ihm das Finale Schwierigkeiten. Zudem forderte die Arbeit als Kinopianist immer wieder ihren Tribut. Mit dem fertigen Werk bewarb sich Schostakowitsch erneut am Konservatorium, wo ihm nach wie vor einige Dozenten gewogen waren, allen voran Alexander Glasunow, der Direktor. Glasunow, damals 60 Jahre alt, galt als wichtigster russischer Komponist der Generation nach Tschaikowsky, ein schwerfälliger, bisweilen exzentrischer, aber zutiefst humaner Alkoholiker mit genialen Zügen. Schon einige Jahre zuvor hatte er Schostakowitsch ein Stipendium erkämpft, mit dem legendären Stoßseufzer: „Die Zukunft gehört nicht mir, sondern diesem Jungen.“ Auch für die Symphonie setzte er sich ein und empfahl sie der Prüfungskommission Dmitrij Schostakowitsch: 1. Symphonie f-Moll 19 Leningrader Philharmonie, Uraufführungsort der Symphonie Nr. 1 des Konservatoriums als Diplomarbeit. Nicht ohne jedoch einige Änderungen zu verlangen – die Schostakowitsch bei der Drucklegung des Werks wieder rückgängig machte. „Ein neues Kapitel in der Geschichte der Symphonie“ Auch die Professoren des Konservatoriums ließen sich durch Schostakowitschs Partitur überzeugen und empfahlen eine Aufführung der Symphonie. Niemand Geringerer als die Leningrader Philharmoniker unter ihrem Chefdirigenten Nikolaj Malko hoben das neue Werk im Mai 1926 aus der Taufe. Mit durchschlagendem Er- folg: Das Publikum war begeistert und verlangte die Wiederholung des Scherzos. Auch wenn sich die Presse eher zurückhaltend äußerte, wurden sogleich namhafte Musiker im In- und Ausland auf Schostakowitschs symphonischen Erstling aufmerksam. Bruno Walter etwa, der sich die Symphonie vom Komponisten persönlich am Klavier vorspielen ließ und sie daraufhin in Berlin aufs Programm setzte; später die Dirigenten Leopold Stokowski und Arturo Toscanini. Auch Komponisten wie Darius Milhaud und Alban Berg äußer­t en sich positiv über das Stück. Und: Schostakowitsch wurde noch im selben Jahr wieder zum Studium zugelassen, das er 1929 abschloss. 20 Dmitrij Schostakowitsch: 1. Symphonie f-Moll Quasi über Nacht und mit einem Paukenschlag war es dem jungen Mann also gelungen, sich auf der Bühne der sowjetischen Musikszene zurückzumelden. Zwar sollten materielle Schwierigkeiten ihn und seine Familie noch eine ganze Weile begleiten, ganz zu schweigen von den politischen Repressalien späterer Jahre; in der Folge aber zeigten Kompositionsaufträge von staatlicher oder privater Seite, dass er sich als Symphoniker einen Namen gemacht hatte. Um es in den geradezu prophetischen Worten des Uraufführungsdirigenten Malko zu sagen: „Mir scheint, ich habe ein neues Kapitel in der Geschichte der Symphonie eröffnet und einen neuen großen Komponisten entdeckt.“ Frühe Originalität Worin bestand (und besteht) aber nun die Qualität von Schostakowitschs erster Symphonie ? Zu den wichtigsten Aspekten gehört sicherlich die Tatsache, dass sich die f-Moll-Symphonie in eine klassische Tradition stellt, ohne auch nur ansatzweise altbacken zu klingen. Umgekehrt gesagt: Bei aller Modernität und Frische unterwirft sie sich doch den Bedingungen, die an herkömmliche Symphonien gestellt wurden. Mit ihr trat Schostakowitsch den Beweis an, dass er sowohl sein Handwerk verstand, als auch neue Wege zu gehen bereit war. Seine Originalität, so die über Jahrzehnte einhellige Meinung, lugt aus jedem Takt. Und das ist von Beginn an wörtlich zu nehmen. Denn gegen alle Konventionen eröffnet eine Solotrompete das Stück, der sich ein Fagott beigesellt. Einzelne Holzbläser treten hinzu, die Strei- cher assistieren pizzicato, bis ein dumpfer Blechbläserakkord diese erste Episode beendet. Handstreichartig bricht der 18-jährige Komponist mit Hörgewohnheiten, die auf satten Streicherund Bläsersound zielen, und bietet stattdessen ein in Individuen zersplittertes Ensemble. Auffällig auch die Nähe zu Militärmusik und Blas­ orchester, die sich in der Einleitung durch die Instrumentierung (Blechbläser, Schlagzeug) und im Hauptteil des 1. Satzes zusätzlich thematisch äußert (marschartiges Klarinettenthema). Strategisches Denken So überraschend anders all dies klingt, bedient es sich doch streng symphonischer Strategien. Das betrifft zum einen die Gliederung des Satzes, die auf dem alten Modell von Einleitung plus dreiteiligem Hauptabschnitt beruht. Dem Klarinettenthema folgt als Kontrast ein lyrischer Walzer (Flöte); in der Durchführung werden beide verarbeitet. Schostakowitschs ureigene Handschrift zeigt sich an der Art und Weise, wie er in diesem Hauptteil auch auf Motive der Einleitung zurückgreift. Er streut sie nicht bloß als Erinnerungspartikel in das Allegro ein, sondern nutzt sie konsequent zur Binnengliederung: als Überleitung zwischen Marsch und Walzer, als Rahmen für die Durchführung und sogar zum Ausklang des Satzes. Dadurch und durch die Tatsache, dass in der Reprise der Walzer dem Marsch vorausgeht, erhält dieser erste Symphoniesatz eine beispielhaft symmetrische Struktur. Zum zweiten aber stellt sich Schostakowitsch auch bei der Ausformung seiner Themen ganz Dmitrij Schostakowitsch: 1. Symphonie f-Moll bewusst in eine bewährte Tradition. Mögen seine musikalischen Ideen noch so spontan und unverbraucht klingen: Sie sind das Ergebnis planvollen Kalküls. Die Klarinettenmelodie etwa, mit der das Allegro einsetzt, greift nicht nur den punktierten Rhythmus der Einleitung, sondern auch deren Tonmaterial auf (zweiter Takt der Fagottbegleitung). Mit weitreichenden Folgen: Wenn im langsamen Satz eine sehnsüchtige Oboenmelodie erklingt, haben eben diese Töne ihren nächsten wichtigen Auftritt. Ihre Intervallfolge bleibt erhalten, nur die Rhythmisierung ändert sich. Ein Walzer ändert sein Gesicht Fast noch frappierender ist dieses Verfahren in der Durchführung des 1. Satzes, wenn Schosta­ kowitsch Marsch und Walzer übereinander schichtet. Vom Walzer ist freilich nur die nackte Tonfolge übrig geblieben, während sich der Rhythmus des Themas, Phrasierung, Spielart – kurz: die gesamte Ausdrucksweise – geändert hat. Der schwebend-elegante Tanz ist zum schrillen Gestampfe mutiert – eine Thementransformation, wie sie Schostakowitsch von Liszt und Saint-Saëns gelernt haben könnte. Auch die übrigen Sätze sparen nicht mit motivischen Vor- und Rückverweisen. So scheint noch das Hauptthema des Finale, wieder in der Klarinette, aus Elementen der Einleitung zum 1. Satz gebildet. Und auf dem Höhepunkt des Scherzos gelingt es Schostakowitsch, die beiden völlig konträren Ausdruckswelten von Hauptteil und Trio – überschäumende Energie und Klagegesang – zusammenzuzwingen. 21 Konzert für Orchester Solche handwerkliche Souveränität eines 18-Jährigen verblüfft bis heute. Sie wäre aller­ dings unvollständig ohne die Lust am klanglichformalen Experiment, die Schostakowitschs „Erste“ bis in die letzten Takte zelebriert. Wer hätte zum Beispiel erwartet, dass sich das Klavier einen ganzen Satz lang gedulden muss, um im Scherzo dann eine spektakuläre Hauptrolle zu übernehmen ? Wer hätte im Finale mit Soli von Glockenspiel und Pauke gerechnet ? Überhaupt gibt es in diesem Stück kaum ein Orchester­ mitglied, das nicht irgendwann ins Rampenlicht träte: auch die Tuba, auch die dritte Trompete und sogar mehrere (!) Solobratschen. Komponisten wie Paul Hindemith, Béla Bartók oder Witold Lutosławski wählten später für eine der­ artige Konzeption einen einprägsamen Begriff: „Konzert für Orchester“. 22 Die Künstler Paavo Järvi Dirigent Seit 2004 ist Paavo Järvi Künstlerischer Leiter der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Dort stellt er, nachdem in den letzten Spielzeiten der Fokus auf Beethoven- und Schumann-Werken lag, nun Brahms in den Mittelpunkt der aktuellen Saison. Für die Einspielungen von Beet­h ovens Symphonien mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen erhielt Paavo Järvi 2010 den ECHO-Klassik als Dirigent des Jahres. Mit dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt, dessen Ehrendirigent er ist, widmete er sich zuletzt den MahlerSymphonien. Paavo Järvi studierte Schlagzeug und Dirigieren in seiner Heimatstadt Tallinn / Estland, bevor er 1980 in die USA emigrierte. Dort setzte er seine Studien u. a. am Los Angeles Philharmonic Institute bei Leonard Bernstein fort. Seit der Saison 2010/11 ist Paavo Järvi Music Director des Orchestre de Paris, mit dem er vor kurzem die neue Heimstatt des Orchesters, die Philharmonie de Paris, einweihen konnte. Ab der Saison 2015/16 übernimmt er außerdem das Amt des Chefdirigenten beim NHK Symphony Orchestra. Außerdem dirigiert Paavo Järvi weltweit eine Vielzahl namhafter Orchester, darunter die Berliner und die Wiener Philharmoniker, die New Yorker Philharmoniker, die Staatskapelle Dresden, das Israel Philharmonic Orchestra, das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam und das Philharmonia Orchestra London, mit dem er einen Nielsen-Symphonien-Zyklus begonnen hat. Als Gastdirigent steht Paavo Järvi auch regelmäßig am Pult der Münchner Philharmoniker. Seit Beginn seiner Karriere setzt sich Paavo Järvi für die Werke estnischer Komponisten wie Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, Lep Sumera und Eduard Tubin ein. Er ist Künstlerischer Berater des Estonian National Symphony Orchestra sowie des Pärnu Festival und fördert im Rahmen der Järvi Akademie junge Nachwuchsdirigenten. Die Künstler 23 Joshua Bell Violine dem Philadelphia Orchestra unter Riccardo Muti. Seitdem gastierte Joshua Bell bei allen führenden Orchestern weltweit und arbeitete mit Dirigenten wie Vladimir Ashkenazy, Herbert Blom­ stedt, Riccardo Chailly, Christoph von Dohnanyi, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, John Eliot Gardiner, James Levine, Sir Roger Norrington, Seji Ozawa, Leonard Slatkin, Franz Welser-Möst und David Zinman zusammen. Die aktuelle Saison begann er mit Solokonzerten bei den New Yorker Philharmonikern und tourte zusammen mit dem Pianisten Alessio Bax durch die USA und Europa. Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr war die Europa-Tournee zusammen mit der Academy of St. Martin in the Fields. Der amerikanische Geiger Joshua Bell gilt als einer der bedeutendsten Geiger seiner Generation und ist gleichermaßen als Solist, Kammermusiker und Orchesterleiter erfolgreich. Erst kürzlich trat er sein neues Amt als Music Director der Academy of St. Martin in the Fields an. Geboren in Bloomington / Indiana, erhielt er mit vier Jahren seinen ersten Geigenunterricht. Ab seinem zwölften Lebensjahr studierte er bei Joseph Gingold, der sein prägender Lehrer und Mentor wurde. Mit nur 14 Jahren gab er sein viel beachtetes Debüt in der Carnegie Hall mit Mit zahlreichen Preisen wurde Joshua Bell ausgezeichnet, darunter der renommierte Avery Fisher Prize sowie der Grammy-Award für seine Einspielung des Violinkonzerts von Nicholas Maw. Die Aufnahme in die Hollywood Bowl Hall of Fame festigte seinen Ruf als einer der bekanntesten amerikanischen Musiker; zudem wurde er von der Zeitschrift Musical America zum „Ins­tru­m entalist of the Year 2010“ ernannt. Joshua Bell spielt auf der 1713 gefertigten „Gibson ex Huberman“-Stradivarius. e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph 24 Auftakt „Ewig jung“ Die Kolumne von Elke Heidenreich Eine Fülle wunderbarer Konzerte können Sie in den nächsten Wochen bei den Münchner Philharmonikern hören, wohlbekannte alte und herausfordernde neue Musik, und es ist für mich immer wieder ein schönes Wunder, dass die Konzertsäle, wo auch immer, fast voll werden mit Zuhörern. Da spielen Menschen für andere Menschen Musik, die man doch auch zuhause auf CD oder im Radio hören könnte – aber nein, man macht sich auf in den Konzertsaal, zahlt sogar Eintritt, nur, um zusammen zuzuhören. Das klingt altmodisch und ist es auch – schon etwa seit dem 17. Jahrhundert gibt es diese Art Konzerte. Früher fanden sie in Kirchen oder an Fürstenhöfen statt, und dann kam um die Mitte des 17. Jahrhunderts in England ein Mr. Bannister auf die Idee, Konzerte in Tavernen, in Kneipen spielen zu lassen, gegen einen kleinen Eintritt. Das wurde ein großer Erfolg, auch Mozart hat noch in Tavernen gespielt, als er London besuchte. Und so, kann man sagen, kam die Musik endgültig unters Volk. Bis heute können wir wählen zwischen einem Jazzoder Rockkonzert, einem Konzert von Helene Fischer oder den Wiener Sängerknaben, zwischen klassischem Konzert mit Bekanntem oder Konzerten, die neue Musik anbieten. Oft wird das Neue mit dem Alten gemischt, damit es eine Chance hat, auch gehört zu werden, und ich habe schon Konzerte erlebt, wo man sich nach Beethoven vor dem „Neutöner“ fürchtete und dann nach dem Neuem eigentlich nichts Altes mehr hören wollte. Wir kennen so viele Stücke, aber im Konzertsaal live klingen sie plötzlich wieder anders, je nach Dirigent schon sowieso. Ich frage mich oft – und ja nicht nur ich – ob das Konzert eine aussterbende, eine altmodische Gattung ist. Aber dann sehe ich in Köln, wo ich lebe, über tausend Menschen donnerstags zu den kostenlosen Mittagskonzerten in die Philharmonie strömen – oft ungeübte Zuhörer, die einfach mal eben vom Bahnhof oder Dom nebenan für eine halbe Stunde reinschneien. Und München bietet in Kooperation mit Kulturraum Konzerte für sozial schwache Menschen an, die Philharmoniker gehen unter der Überschrift „Spielfeld Klassik“ gezielt auf junge Hörer in Schulen, der Uni oder sogar Kindergärten zu, spielen in Clubs und Off-Locations, jungen und alten Menschen wird der Besuch von Generalproben ermöglicht, und all diese Angebote werden dankbar angenommen. Also: von wegen, das klassische Konzert ist ein Anachronismus! Sein Ende wurde schon oft heraufbeschworen – als die Mäzene an den Fürstenhöfen wegfielen, als Radio und Schallplatte aufkamen, aber die Begegnung Künstler-Publikum hat überdauert. Die Zahl der in Deutschland jährlich gespielten Konzerte geht in die Tausende, die der Besucher liegt bei rund vier Millionen, nach den letzten Zahlen, die ich kenne. Sie gehören dazu. Eine gute Entscheidung! Ph Orchesterakademie Wir haben drei neue Akademisten: Johannes Treutlein (Kontrabass) wird ab März Mitglied unserer Orchesterakademie sein, Philipp Lang (Trompete) und Vicente Climent Calatayud (Posaune) ab April. Folgende Orchesterakademie-Stipendien sind noch ausgeschrieben: Flöte (Probespieltermin: 11.06.15), Oboe (Probespieltermin: 01.07.15), Klarinette (Probespieltermin: 20.04.15) und Fagott (Probespiel termin: 07.05.15). Bewerbungen bitte an: [email protected]. Leitbild Auch wir haben nun ein Leitbild, das in den letzten Monaten von einem Gremium aus Orchestermusikern und Kollegen der Direktion erarbeitet wurde. Verabschiedet wurde dieses Leitbild feier- 25 lich mit einem Neujahrs-Umtrunk nach einem Konzert. Einzusehen ist unser Leitbild auf www.mphil.de Herzlichen Glückwunsch Die Münchner Philharmoniker gratulieren ihrem ehemaligen Solo-Bratschisten Sigfried Meinecke zum 99. Geburtstag! Fußball Wetterbedingt wurden die Trainingseinheiten unserer Fußballmannschaft auf Eis gelegt. Aber auch bei uns wird die Winterpause zu harten Verhandlungen genützt: die Termine für die nächsten Trainingsstunden mit Konstantin Sellheim stehen! Sollte der Frühling noch so sonnig werden – die Fußballmannschaft der Staatsoper kann sich schon mal warm anziehen. MPhil vor Ort Egal ob Club oder Hofbräuhaus, wir sind dabei! Im Januar gab es ein weiteres Konzert in der MPhil vor Ort-Reihe mit Holleschek+Schlick, dieses Mal im Postpalast an der Hackerbrücke. Erst Beethovens 6. Symphonie und „The Light“ von Philip Glass, anschließend Fest mit Disc- und Video-Jockeys und einem Überraschungs-Auftritt um 1 Uhr. „Ehrensache“ ist wieder das Konzert der Blas musik der Münchner Philharmoniker im Hofbräuhaus. Beginn ist am 29.3. um 11 Uhr, Karten gibt’s bei MünchenTicket. e Herzlich Willkommen Quirin Willert (Wecheselposaune) und unser ehemaliger Akademist Thomas Hille (Kontrabass) treten ab März ihren Dienst bei uns an. Wir freuen uns und wünschen alles Gute für das Probejahr! Auch unsere ehemalige Akademistin Yushan Li (Viola) kehrt zurück. Direkt nach ihrem bestandenen Probespiel ging sie in ein halbes Jahr in Babypause, im April beginnt sie ihr Probejahr. Ihr Ehemann Valentin Eichler, ebenfalls Bratschist bei uns, geht dafür in Elternzeit. ch is on m er ar ätt ilh Bl Philharmonische Notizen e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph 26 Wir gratulieren... ...Mia Aselmeyer und Jano Lisboa zum bestandenen Probejahr Mia Aselmeyer wurde 1989 in Bonn geboren, wo sie auch aufwuchs. Ihren ersten Hornunterricht erhielt sie im Alter von neun Jahren bei Rohan Richards, Hornist des Beethoven Orchesters Bonn. Während eines einjährigen High-School-Aufenthalts in Michigan, USA, feierte sie mit mehreren Ensembles verschiedene Wettbewerbserfolge. Vor dem Abitur war sie Jungstudentin bei Paul van Zelm an der Kölner Musikhochschule und wechselte dann an die Hochschule für Musik und Theater Hamburg, wo sie bei Ab Koster ihr Hauptfachstudium absolvierte. Währenddessen war sie Mitglied der Jungen Deutschen Philharmonie, des Orchesters des Schleswig-Holstein-Musik-Festivals sowie zahlreichen Kammermusikensembles. Von 2011 bis 2013 war sie Mitglied der Giuseppe-Sinopoli-Akademie der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Außerdem war sie Stipendiatin des Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now. Ihre Orchestertätigkeiten führten Mia Aselmeyer an bedeutende Konzerthäuser Europas, Amerikas und Asiens. Für die Saison 2013/14 erhielt sie einen Zeitvertrag bei den Münchner Philharmonikern, seit Beginn der Saison 2014/15 ist sie festes Mitglied der Horn-Gruppe. Ph ch is on m er ar ätt ilh Bl 27 Geboren in Viana de Castelo in Portugal, bekam Jano Lisboa im Alter von 13 Jahren Viola-Unterricht. Er setzte seine Ausbildung bei Kim Kashkashian am New England Conservatory in Boston fort und schloss sein Studium in den USA mit dem Master of Music ab. Außerdem studierte er Streichquartett bei Rainer Schmidt (Hagen Quartett) an der Reina Sofia Music School in Madrid. Regelmäßig tritt Jano Lisboa bei Solo – und Kammermusikkonzerten in Europa, USA, Brasilien und Afrika auf. Jano Lisboa arbeitete mit Tigran Mansurian an dessen Violakonzert „…and then I was in time again“, führte Fernando Lopes-Graças „Viola Concertino“ mit dem Orquestra do Norte und das Viola-Konzert von Alexandre Delgado mit dem Gulbenkian Orchestra in Lissabon auf. Er ist Gewinner des „Prémio Jovens Músicos“ (Lissabon), des „NEC Mozart Concerto Competition“ (2006, Boston, USA) und des „Watson Forbes International Viola Competitions“ (2009, Schottland). Darüber hinaus wurde Jano Lisboa mit der Bürgerverdienstmedaille seiner Heimatstadt ausgezeichnet. Jano Lisboa war Mitglied des Münchener Kammerorchesters und Künstlerischer Leiter des Kammermusik-Festivals Viana in Portugal. Seit September 2013 ist er der Solobratschist der Münchner Philharmoniker. Er spielt eine Bratsche von Ettore Siega von 1932 mit einem Bogen von Benoît Rolland. e Wir gratulieren... e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph 28 Symposium in Buchenried Das Musiksymposium am Starnberger See Simone Siwek Von 3.–6. Januar 2015 trafen sich zum zweiten Mal Neugierige, Musikinteressierte und Profis am Starnberger See in Buchenried, einem Haus der Münchner Volkshochschule. Im Januar 2014 startete die Reihe mit dem Titel „Musik ist Kommunikation“, das diesjährige Thema lautete „Musik ist Idee“. Haus Buchenried bietet nach dem Umbau attraktive Seminarräume, aber auch Übernachtungsmöglichkeiten – beides in großartiger Lage. So entstand die Idee, in Kooperation zwischen der Münchner Volkshochschule, dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München und den Münchner Philharmonikern ein Projekt für diesen Ort zu entwickeln. Das Musiksymposium bietet eine besonders persönliche und ambitionierte Beschäftigung mit Aspekten des Musizierens in einem Kreis zwischen 30 und 40 Teilnehmern – für die Menschen, die sie rezipieren ebenso wie für diejenigen, die sie zu ihrem Beruf gemacht haben. Idee und Konzept zum Musiksymposium stammen von Gunter Pretzel, Bratschist der Münchner Philharmoniker: Drei Tage im allerersten Beginn des Jahres, noch außerhalb jeder Zeit, fern jeden Alltags; drei Tage voller Klang, Ideen, Bildern und Begegnungen; eine Auszeit im Innersten der Musik: dies sind die Symposien in Buchenried am Starnberger See. In diesem Jahr war es der Intuition gewidmet und damit der Frage nach dem Entstehen von Musik im Moment ihres Erklingens. Denn nicht jede erklingende Notenfolge ist zugleich auch schon Musik. Musik kann entstehen – oder auch nicht. Was ge- schieht im Entstehen von Musik? Wie erarbeitet sich der Musiker das Werk, wie geht er auf die Bühne, was muss er tun, dass Musik entstehen, dass Musik sich ereignen kann? Dabei ist die Frage nach dem Entstehen von Musik im Moment ihres Erklingens das Leitmotiv, das alle diese Symposien verbindet. Sie ist wahrlich nicht einfach zu beantworten, wenn es denn überhaupt möglich ist. Aber wenn die Dozenten und Interpreten bereit sind, in aller Offenheit sich mitzuteilen, dann führt diese Fragestellung zu einer Nähe von sich Mitteilenden und Hörenden, die sonst kaum zu erreichen ist. Gunter Pretzel und Prof. Peter Gülke Das Wort ist hier nur eines von vielen Formen der Mitteilung: kommentierte Proben, in denen der Musiker sein Denken dem Publikum eröffnet, Klangspaziergänge, die zu eigenem kreativen Hören anstiften, Performances, in denen das Thema wie ein Ph ch is on m er ar ätt ilh Bl 29 künstlerisches Motiv aufscheint und Anleitungen zu konzentriertem Hören umschreiben das Gemeinte vielfältig und facettenreich. Ein Begriff wie der der Intuition, der sich ja jedem sprachlichen Zugriff entzieht, bleibt so gewärtig, ohne sein Geheimnis und damit seine Faszinationskraft zu verlieren. Mit einer offen gebliebenen Frage bleibt auch die Wahrnehmung geöffnet. So wird sie mitgenommen in alle weiteren Begegnungen mit Musik, auf die der Hörer sich in dem dann folgenden Jahr einlässt. Er wird feststellen, wie sich sein Hören sensibilisiert hat und er wird noch intensiver bereit sein, sich auf das Mit-Teilen des Künstlers einzulassen. Die Programme von SPIELFELD KLASSIK wollen Neugierigen die Möglichkeit geben, der Musik zu begegnen und gemeinsam Entdeckungen zu machen. Daher wurde die Idee von Gunter Pretzel gerne in die Tat umgesetzt. Er gestaltet die Tage jeweils gemeinsam mit Marianne Müller-Brandeck (MVHS), Heike Lies (Kulturreferat München) und Simone Siwek (Münchner Philharmoniker). Neben den Inhalten und allem Organisatorischen liegt der Fokus auch darauf, interessante Dozenten und Mitwirkende zu gewinnen. Allen voran Ernst von Siemens Musikpreisträger, Dirigent und Musikwissenschaftler Prof. Peter Gülke, der das Symposium seit seiner Premiere im Januar 2014 mit Vorträgen und Gesprächen prägt. Auch für die Fortsetzung im Januar 2016 hat er seine Teilnahme wieder bestätigt. Weitere Mitwirkende sind Daniel Ott und Manos Tsangaris (Leitung der Münchner Biennale ab 2016), Prof. Denis Rouger (Professur für Chorlei- HAUSCHKA während der Probe mit Florentine Lenz und Traudel Reich tung an der Musikhochschule Stuttgart), Dr. Thomas Girst (BMW Group, Kulturengagement), Komponist und Pianist HAUSCHKA, Komponist und Jazztrompeter Matthias Schriefl. Musikerinnen und Musiker der Münchner Philharmoniker sind in Ensembles beteiligt und gehen musikalische Experimente ein, wenn sie z.B. auf den Jazztrompeter Matthias Schriefl oder Pianist HAUSCHKA treffen. Beide komponierten eigens für diesen Anlass und arbeiteten mit den Ensembles vor Ort. Die Planungen für 3.–6.1.2016 sind in vollem Gange. Weitere Infos erhalten Sie unter spielfeld-klassik.de e Symposium in Buchenried e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph 30 Orchestergeschichte Ein Konzert zwischen Königreich und Republik Gabriele E. Meyer Am 7. November 1918 kam es im Zusammenhang einer Friedenskundgebung auf der Theresienwiese zu einem Massenaufstand, der noch am selben Abend die Herrschaft der Wittelsbacher beenden sollte. An jenem Abend dieses „Schicksalsmoments“, so Bruno Walter in seinen Erinnerungen, fand auch ein Konzert der Münchner Philharmoniker (damals noch unter dem Namen Konzertvereinsorchester musizierend) statt. Hans Pfitzner, der gegen Ende des Ersten Weltkrieges Hals über Kopf seine Straßburger Stellung als Opernchef, Orchesterleiter und Konservatoriumsdirektor aufgeben musste und zunächst notdürftig in der Residenzstadt München untergekommen war, hatte die Leitung übernommen. Auf dem Programm standen Haydns B-DurSymphonie von 1782, Schumanns 4. Symphonie und Webers „Oberon“-Ouvertüre, sodann die „Nachtigallen“-Arie aus Händels Oratorium „L’Allegro, il Pensieroso ed il Moderato“. Zu hören waren außerdem Klavierlieder von Brahms und vom Komponisten selbst, wobei Pfitzner auch als Liedbegleiter auftrat, eine damals noch gängige Praxis in Orchesterkonzerten. Angesichts der sich überschlagenden Schreckensnachrichten schon tagsüber machten sich verständlicherweise nur unerschrockene Konzertbesucher auf den Weg in die Tonhalle, unter ihnen auch die Musikrezensenten von der „Münchner Post“ und den „Münchner Neuesten Nachrichten“. Zu Beginn des Konzerts lebte man noch im Königreich Bayern, am Ende hatte Kurt Eisner bereits die Republik ausgerufen und den Freistaat Bayern proklamiert. Von den ohnehin nicht zahlreichen Zuhörern scheint angesichts der bis in den Saal vernehmbaren Schießereien nur eine Handvoll bis zum letzten Programmpunkt ausgeharrt zu haben. Erst sehr viel später, am 20. bzw. 26. November, erschienen die beiden Besprechungen. Der just zu der Zeit als Kritiker der „MP“ tätige Musikwissenschaftler Alfred Einstein sprach „von Kunsterlebnissen höchster Art, wie sie nur ein geniales Musikertum vermitteln kann“. Diesen Eindruck bestätigten fast acht Tage später auch die „MNN“. „Pfitzner hat es vermocht“, ließ R. W. die Leser wissen, „mit der Symphonie in B-dur von Haydn, der Oberon-Ouvertüre von Weber und ganz besonders mit der hinreißend schwungvoll gestalteten Symphonie in d-moll von Schumann das Publikum zu begeistern. Man erlebte es einmal wieder, was es bedeutet, wenn eine schöpferische künstlerische Persönlichkeit von der Bedeutung Pfitzners zum Dirigentenstab greift.“ Insbesondere die trotz aller straffen und strengen Rhythmik elastisch federnde Agogik, die feine Dynamisierung und die ungewohnt rascheren Allegrotempi hatten es dem Rezensenten angetan. Solistin des Abends war die Dresdner Sopranistin Gertrud Meinel, die, neben der „Nachtigallen“-Arie, noch einige Lieder „von Pfitzner hervorragend schön am Klavier begleitet“ sehr „empfindungsfähig“ vortrug. Pfitzner musste eigentlich zufrieden sein. Der hypersensible Komponist aber stand, nicht zum ersten Mal in seinem Leben, unter dem Eindruck, „daß nur ihm eine solche revolutionäre Unannehmlichkeit“ (Bruno Walter), wie er sie an jenem 7. November erlebt hatte, passieren könne. Ph ch is on m er ar ätt ilh Bl 31 Komponist und Pianist HAUSCHKA Volker Bertelmann Als mich Heike Lies vom Münchner Kulturreferat zum ersten Mal anschrieb, ob ich nicht Lust hätte, bei einem Symposium in Buchenried mit Musikern der Münchner Philharmoniker zu arbeiten, da fiel diese Anfrage genau in eine Zeit, in der mein Interesse für die Zusammenarbeit mit klassischen Musikern in ein neues Stadium kam. Ich hatte gerade ein Angebot beim MDR Symphonieorchester in Leipzig (Anm: als Artist in Residence) angenommen und war somit schon auf der Suche, wie ich Klang im skulpturalen Sinne in eine Komposition einbringen und wie deren Umsetzung aussehen kann. Ich sagte zu und war sehr schnell mit Gunter Pretzel und Simone Siwek im Gespräch über inhaltliche Fragen bezüglich experimenteller Musik und über die Besetzung. Eine der maßgeblichen Fragen, die mich umtreibt, ist: wie bekomme ich den Sound aus meinen präparierten Klavierstücken in ein Ensemble oder Orchester transportiert? Denn viele der Sounds, die sich in meinen Kompositionen entwickeln, entstehen erst vor Ort und auch in Abhängigkeit von Instrument und Raum. Ich habe mich für verschiedene Stufen der Arbeit in den nächsten Jahren entschieden, in denen ich den Klang des Orchesters mit fertig notierten Kompositionen für mich auslote und gleichzeitig freie Improvisationen als Inspirationsquelle, aber auch als Zulassen des Zufallsereignisses in meine Musik und Arbeit mit klassischen Musikern einbaue. Bei meiner Zusammenarbeit mit Hilary Hahn ist es zum Beispiel ein wunderbares Gefühl für uns beide, aus unserem Fundus an musikalisch erlerntem Wissen zu schöpfen und es gezielt abzurufen, ohne Themen aus unserer gemeinsamen CD (Anm: „Silfra“ Hilary Hahn & Hauschka, 2012) zu vergessen. Mit all den Gedanken traf ich mich nun zur Improvisation mit acht Musikerinnen und Musikern der Münchner Philharmoniker und versuchte herauszufinden, wie die Psychologie in unserer Gruppe funktioniert. Wie erlangt man Zugang zu dem Repertoire, das man in sich trägt, welches aber oft mit Ängsten und Zweifeln besetzt ist? Oft ist das Wissen in vielen Jahren abtrainiert worden und muss wieder reaktiviert werden. Wir spielten etwa eineinhalb Stunden und ich hatte große Freude, denn es waren allesamt Menschen, die Lust auf Neues hatten, die Lust hatten, Unsicherheiten zu überwinden – und es waren alles wundervolle Musiker! Es ging hier nicht – wie gerne angenommen wird – darum, irgend etwas zu revolutionieren oder die übliche Art Musik zu machen in Frage zu stellen. Sondern um einen Teil, der auch zum Musikmachen dazugehört, nämlich mit Kraft nach dem eigenen Ausdruck zu suchen und vielleicht etwas zu formen, das unserer gemeinsamen Vorstellung von Musik entspricht. Viele Pläne gibt‘s und ich hoffe, die Zusammenarbeit geht weiter. e Das letzte Wort hat... 32 Vorschau So. 26.04.2015, 11:00 Uhr 6. KaKo Mo. 27.04.2015, 19:00 Uhr 3. JuKo „Britische Ansichten“ Bruno Hartl Konzert für Schlagwerk und Orchester op. 23 Joseph Haydn Klaviertrio D-Dur Hob. XV:24 Graham Waterhouse „Bells of Beyond“ Modest Mussorgskij „Bilder einer Ausstellung“ (Instrumentierung: Maurice Ravel) Frank Bridge „Miniatures“ Eivind Gullberg Jensen, Dirigent Martin Grubinger, Percussion George Onslow Klaviertrio C-Dur op. 3 Nr. 2 Graphik: dm druckmedien gmbh, München Druck: Color Offset GmbH, Geretsrieder Str. 10, 81379 München Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt. Mikhail Glinka Ouvertüre zu „Ruslan und Ljudmila“ Bruno Hartl Konzert für Schlagwerk und Orchester op. 23 Modest Mussorgskij „Bilder einer Ausstellung“ (Instrumentierung: Maurice Ravel) Eivind Gullberg Jensen, Dirigent Martin Grubinger, Percussion Verdandi-Trio: IIona Cudek, Violine Elke Funk-Hoever, Violoncello Mirjam von Kirschten, Klavier Impressum Herausgeber Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4, 81667 München Lektorat: Christine Möller Corporate Design: Di. 28.04.2015, 20:00 Uhr SoKo Mi. 29.04.2015, 20:00 Uhr 6. Abo a Textnachweise Nicole Restle, Susanne Stähr, Marcus Imbsweiler, Elke Heidenreich, Monika Laxgang, Simone Siwek, Gunter Pretzel und Volker Bertelmann schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Lexikalische Angaben und Kurzkommentare: Stephan Kohler. Künstlerbiographien: Christine Möller. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. Bildnachweise Abbildung zu Carl Nielsen: Emilie Demant Hatt, Foraarsbølger – Eindringer om Carl Nielsen, Kopenhagen 2002. Abbildung zu Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Constantin Floros, Peter Tschaikowsky, Reinbek bei Hamburg 2006. Abbildung zu Igor Strawinsky: Theodore Stravinsky, Catherine & Igor Stravinsky – a family album, London 1973. Abbildungen zu Dmitrij Schostakowitsch: Krzysztof Meyer, Dmitri Schostakowitsch – Sein Leben, sein Werk, seine Zeit, Bergisch-Gladbach 1995. Künstlerphotographien: Ixi Chen (Järvi/ Titel), Julia Bayer (Järvi/Bio), Lisa Marie Mazzucco (Bell), Leonie von Kleist (Heidenreich), Andrea Huber (Buchenried), Ralf Dombrowski (Buchenried), Mareike Foecking (HAUSCHK A), privat (Aselmeyer, Lisboa) HAUPTSPONSOR UNTERSTÜTZT KLASSIK AM O D EO N S PLATZ 15 JAHRE CARMINA BURANA ´ SKI DIRIGENT KRZYSZTOF URBAN MÜNCHNER PHILHARMONIKER SONNTAG, 12. JULI 2015, 20.00 UHR DANIEL A FALLY, SOPR AN – BEN JA MIN BRUNS, TENOR JOCHEN KUPFER, BARITON PHILHAR MONISCHER CHOR MÜNCHEN KINDERCHOR DES STA ATSTHEATERS A M GÄRTNERPL ATZ EDVARD GRIEG PEER GYNT- SUITE NR. 1 OP.46 PJOTR IL JITSCH TSCHAIKOWSKY FANTASIE- OUVERTÜRE „ROMEO UND JULIA“ CARL ORFF CAR MINA BUR ANA KARTEN: MÜNCHEN TICKET TEL. 089 / 54 81 8181 UND BEKANNTE VVK-STELLEN WWW.KLASSIK-AM-ODEONSPLATZ.DE DANK AN: MERCEDES-BENZ MÜNCHEN, BAYERNLB, GAHRENS + BATTERMANN, ORGATECH, STRÖER DEUTSCHE STÄDTE MEDIEN 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant