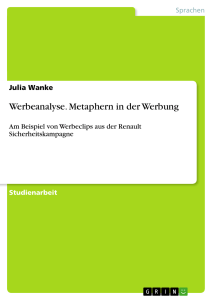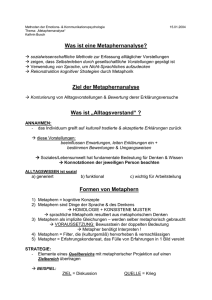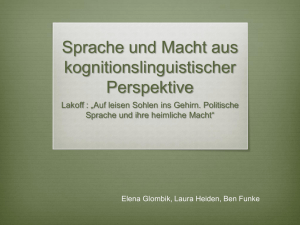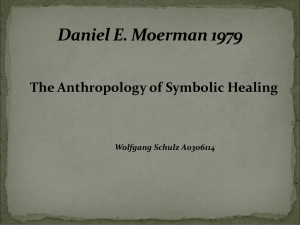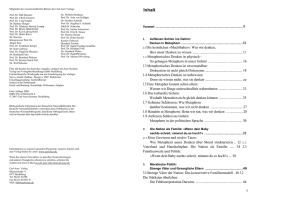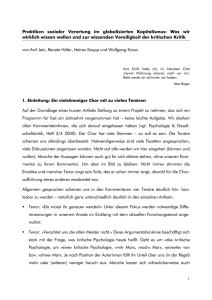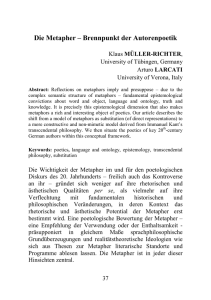Dialogthemen
Werbung

1 GESCHICHTE UND GEGENWART LEHREN UND LERNEN „Mit Metaphern über Musik reden“ Zwei Dialogthemen von Jürgen Oberschmidt, Pädagogische Hochschule Weingarten Zu „Beziehungsweise. Begegnungen beim Schreiben über Musik“ Ein Essay von Joachim Reiber Dialogbeitrag 1 Mut zur Vermutung! Wie metaphorisches Sprechen die fachbegrifflichen Grenzen überschreiten hilft Herzlichen Dank dem Arbeitskreis für Schulmusik Sachsen (AfS) und dem Verband deutscher Schulmusiker Sachsen (VdS) <www.vds-afs.de> für die freundliche Zurverfügungstellung des Beitrages, erschienen als Oberschmidt, Jürgen: Mut zur Vermutung! Wie metaphorisches Sprechen die fachbegrifflichen Grenzen überschreiten hilft. In: Ortwin Nimczik und Jürgen Terhag (Hrsg.): musikunterricht 1. Bildung – Musik – Kultur. Zukunft gemeinsam gestalten. Kassel u. Mainz 2013: AfS/VDSEigenverlag, S. 104-109. Reden ist Silber, Musizieren ist Gold? Das Dilemma der musikalischen Analyse im Unterricht Robert Schumann bringt das Dilemma der musikalischen Analyse auf den Punkt und spricht dabei sicherlich so manchem Lehrenden und Lernenden aus dem Herzen: Alles Reden über Musik kann die sinnlichen Empfindungen nicht erschöpfend in Worte fassen; für den Philosophen Peter Sloterdijk gleicht das im Unterricht verordnete Reden gar einem „Attentat auf das Grundrecht der Musik, ausschließlich mit ihren Mitteln für sich zu sprechen“ (Sloterdijk 2007, S. 29). Dies ist auch das Dilemma der musikalischen Analyse im Unterricht. 2 Nun hat sich gerade Robert Schumann glücklicherweise nicht an sein eigenes Schweigegebot gehalten, sich selbst in einer äußerst fantasievollen Sprache bewegt und als Rezensent in der von ihm begründeten Neuen Zeitschrift für Musik gezeigt, dass man über Musik nicht schweigen kann, sondern geradezu reden muss. Dies gilt auch für jenen Aufsatz über Chopins Klavierkonzerte, in dem er das Reden über Musik gänzlich abschaffen wollte. Von Schumann erfahren wir, dass As-Dur die „Mondscheintonart“ sei, ihm begegnen beim Hören „lauter springende Champagnerstöpsel“, „duftende Schnapsgläschen“ (zit. nach Sponheuer 2004, S. 95) – und nicht zuletzt „sähe man die weißen Alpenriesen die Augen zudrücken“ (zit. nach Rummenhöller 1980, S. 17). Schumann nähert sich der Musik aus der Perspektive allegorischer Figuren: Er schlüpft in die Gestalt des feurig kämpfenden Florestan, des schwärmerischen, aber stillen Eusebius oder bedient sich des maßvollen Blicks eines weisen Meister Raro. Musik erscheint ihm hier nicht als ein messbares objektives Gegenüber, sondern sie wird aus den verschiedenen Blickwinkeln seiner Davidsbündler in den Blick genommen. Im Musikunterricht beschränken sich Vermittlungsbemühungen häufig darauf, Musik aus einer Perspektive zu betrachten und ihr in guter Tradition einer „old german musicology“ ein Sagen abzupressen. Ziel dieser schematisierten Denk- und Verstehensprozesse ist es, eine uniformierte terminologische Sprache einzuüben, die oft reichhaltige, fantasievolle Schülersprache mit der begrifflichen Brille zu lesen und all jenes, was nicht in dieses grobe Raster der Begriffe passt, auszublenden. Hierzu wird im Unterricht ein immer gleiches Menü aufgetischt: Beschreibe, wie die Musik auf dich wirkt! – Wo beginnt das zweite Thema? Jeder Schüler versteht hier sehr schnell, was ihm als lockende Vorspeise und was als Hauptgericht serviert werden soll. Sinnliche Überwältigungen, wie sie sich etwa in der reichen, metaphorischen Sprache Robert Schumanns äußern, finden im Unterricht allenfalls auf diesem unverbindlichen Tummelplatz vorgeordneter subjektiver Sinnzuschreibungen ihren Platz. Dieses wenig appetitanregende Entree, bei dem das begriffliche Besteck der musikalischen Analyse schon am Tellerrand lauert, führt dazu, dass persönliche Begegnungen mit einer Musik ausbleiben und musikalische Struktur ohne dieses unverbindlich anmutende „Labern“ durch formalisierte, aber oberflächliche Beschreibungen des Notentextes aus der Distanz durch Kimme und Korn erlegt wird. Ausgewählt werden hierzu Werke, die sich möglichst bequem begrifflich vermessen und so vermitteln lassen. Um Komponisten mit affektivem Appeal – wie Tschaikowsky, Rachmaninoff oder Mahler – wird ein verlegener Bogen gemacht, obwohl gerade ihre Musik die Schülerinnen und Schüler besonders ansprechen würde. Diese verordneten Analysen, in denen Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Zugang und ihre eigene Sprache nicht wiederfinden können, haben Lehrende und Lernende müde gemacht: Wir 3 möchten Musik kennenlernen – aber nicht so viel darüber reden! Und nicht zuletzt aus diesem Grund hat sich längst das Musikmachen vor die Worte gestellt (vgl. Oberschmidt 2011b). Ziel des vorliegenden Beitrags ist es nun, die verschiedenen Sprachebenen im Unterricht miteinander zu verknüpfen, Verbindlichkeiten in den unvermittelten Assoziationen und unverbindlich anmutenden Äußerungen der Schülerinnen und Schüler aufzuzeigen, ihnen die Flügel ihrer Fantasie loszubinden und ein Zutrauen in die eigenen Gewissheiten zu schenken. Die Musikwissenschaft hat uns diesen Weg längst vorgezeichnet: „Man gewähre dem Herzen Zutritt in den unterkühlten modernen Analytikerraum“ (De la Motte 1986, S. 104), verlangt Diether de la Motte mit Blick auf sein trockenes Geschäft und vielleicht lohnt sich auch ein kurzer Blick in analytische Texte, die sich in dieser eingeforderten Welt der Empfindungen bewegen. Helmut Lachenmann etwa betritt mit seiner Analyse zu Weberns Orchesterstücken op. 10 diesen musikalischen Kosmos, in dem die bisher geltenden Kategorisierungen weitgehend außer Kraft gesetzt sind. Diese Reise führt ihn zu einem Text, der subjektiv anmutende Assoziationen ausdrücklich zulässt und dabei nahezu poetisch anmutet: „Dabei ist das Ganze nichts anderes als eine Serenade im Mondschein des FlageolettKlangs, mit herübergewehten Tönen von dort, wo die schönen Trompeten blasen und die todkündende Posaune, Instrument des Jüngsten Gerichts, antwortet, bis die Militärtrommel zum Zapfenstreich ruft, die Idylle aufstört und sich der Liebhaber, die Mandoline unterm Arm weiterzirpend, davonmacht, während die Angebetete ihm mit einer Geigenfigur nachwinkt“ (Lachenmann 2004, S. 123). Metaphern sind mehr als ornamentales Stilmittel und sprachliche Ersatzformen Unbestreitbar ist sicherlich, dass Sprache eine Vermittlungsfunktion zwischen der Welt der Objekte und den Denkwelten der einzelnen Subjekte erfüllt und dass hier fachliche Begriffsmuster als kognitive Ordnungsschemata unabdingbar sind. Im Unterricht sind wir geneigt, eine fachbegriffliche Orientierung als höchst entwickelte Repräsentationsform anzusehen, zumal diese ja in den Wissenschaften umfassend praktiziert wird, um die Welt nach festen Maßstäben zu vermessen (vgl. Oberschmidt 2013). Metaphern haben hingegen ein geringeres Prestige: Vage und dehnbar wie ein Gummiband scheinen sie der begrifflichen Welt lediglich vorgeordnet. Und doch besitzen Metaphern besondere kognitive Qualitäten, so dass es sich lohnt, diesem schillernden Phänomen nachzugehen. Das griechische Wort „Metapher“ bedeutet so viel wie „Übertragung“, das beschreibt bereits Aristoteles. In dem von ihm beschriebenen Beispiel überträgt die Metapher „Die Sonne lacht“ die menschliche Eigenschaft des Lachens in den neuen Zusammenhang „Himmelskörper“. Metaphern 4 sind falsche Aussagen – schließlich kann die Sonne nicht wirklich lachen – und doch verstehen wir eine Metapher, wenn es uns gelingt, Merkmale eines Gegenstandes (des Bildspenders) auf einen anderen (den Bildempfänger) zu beziehen. Dichtern, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen müssen, räumt man diesen Gebrauch von Metaphern ein. Philosophen und Wissenschaftler – darunter fallen auch jene, die sich mit den schönen Künsten beschäftigen – dürfen den ursprünglichen Sinn nicht verfremden oder vernebeln, sie müssen sich begrifflich klar ausdrücken, ihnen sind derartige Ausschweifungen und Abweichungen von der Norm nicht gestattet. Das Ersetzen des eigentlich Gemeinten durch einen entliehenen Ausdruck lässt sich nach der auf Aristoteles zurückgehenden Substitutions- oder Vergleichstheorie der Metapher auch rückgängig machen, wenn wir eine übertragene, uneigentliche Bedeutung durch eine wörtliche, eigentliche ersetzen. Hintergrund für diese Bestimmung der Metapher liefert die antike Sprachauffassung, nach der Gegenstände mit bestimmten Begriffen etikettiert werden. Metaphern gelten dabei oft als zweitbeste Lösungen, die als spekulative Hypothesen den begrifflichen Objektivierungen vorgeordnet sind. Als sprachliche Ersatzform stopfen sie lexikalische Lücken, weil sich die Sprache der Begriffe noch nicht hinreichend in den Wortschatz der Schülerinnen und Schüler eingenistet hat oder erst mühsam aus dem verschütteten Wissen hervorgeholt werden muss. Ein Staccato klingt „getupft“ oder „abgerissen“, eine Melodie ist „heiter“ oder „streitlustig“, Klänge scheinen „grell“, „düster“, „spitz“ oder „stumpf“. Ähnlich wie in den Naturwissenschaften, wenn der interzelluläre Informationstransport als „Gentaxi“ bezeichnet wird, akzeptieren wir die didaktisch-vermittelnde Funktion der Metaphern im Gefälle einer unterrichtlichen Experten-LaienKommunikation: Als „Dekor mit didaktischen Endzwecken“ (Nieraad 1977, S. 10) dienen Metaphern als ein “didaktisch-methodisches Mäntelchen” (Voß 2005, S. 9), das je nach unterrichtlicher Wetterlage an- oder abgelegt werden kann. Friedrich Nietzsche, der in seiner Abhandlung Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne Begriffe als „bewegliches Heer von Metaphern“ (Nietzsche 1988a, S. 881) entlarvt hat, bringt diese explikative Wirkung mit den Worten Christian Fürchtegott Gellerts auf den Punkt: Wir gebrauchen ein Bild, um „dem, der nicht viel Verstand besitzt, die Wahrheit durch ein Bild zu sagen“ (zit. bei Nietzsche 1988b, S. 92). Wie eine Trägerrakete, die Zulieferdienste ausführt, sucht man auch die Metapher als überflüssig abzustoßen, wenn das Unterrichtsgespräch eine gewisse Flughöhe erreicht hat. Doch wie lässt sich nun unsere Metapher „Die Sonne lacht“ ins Wörtliche zurückholen? Die Sonne „scheint“, sie „strahlt“ oder „leuchtet“? Auf der Suche nach Entsprechungen haben wir ein ganzes System von Dingen bzw. von Eigenschaften vor Augen, wenn wir uns eine „lachende Sonne“ vorstellen. Gleiches gilt für eine „streitlustige Melodie“ oder ein „kämpferisches Thema“. Heute geht man daher auch von einem 5 dynamischen Verständnis der Bedeutungsentstehung aus, bei der durch eine Metapher verschiedene semantische Felder verknüpft und durch eine Ansammlung von Assoziationen miteinander vermischt werden. Der amerikanische Philosoph Max Black erklärt dies anhand der Metapher „Der Mensch ist ein Wolf“ (Black 1983, S. 70); auf ihn geht die Interaktionstheorie der Metapher zurück: Eigenschaften, die dem Wolf zugesprochen werden, verbinden sich mit denen des Menschen und betrachten ihn als ein „wölfisches Wesen“. Gleichzeitig erhält der Wolf dadurch menschliche Züge. Metaphern sind ein Wahrnehmungsangebot, das die Aufmerksamkeit auf einen besonderen Aspekt konzentrieren und uns in den Bann der Sache hineinführen kann. Black vergleicht den Bildspender mit einem Filter, der bestimmte Eigenschaften hervorhebt, andere hingegen ausblendet. Diese gedankenleitende Wirkung hebt das Wilde, Raubtierhafte, Habgierige am Menschen hervor, während zivilisiertere Züge in den Hintergrund treten. Durch dieses Hervorheben der kognitiven Funktion wird auch das kreative Potenzial, der spezifische Mehrwert metaphorischer Sprache hervorgehoben und deutlich, warum sich diese nicht ohne Verlust durch wörtliche Ausdrücke ersetzen lassen kann: „Die Metapher ist durch nichts zu ersetzen und ersetzt nichts“ (Ingendahl 1971, S. 305). Die Kognitive Metapherntheorie Auch im Rahmen ihres Deutschunterrichts begegnen Schülerinnen und Schüler einer Metapher vornehmlich als sprachliches Mittel zur Bereicherung einer dichterischen, poetischen Sprache im Reservat der rhetorischen Figuren (Katthage 2004). Allenfalls „tote“ oder „erloschene“ und zum Begriff „erstarrte“ Metaphern vom Stuhlbein bis zur Nervensäge laufen ihnen im begrenzten Rahmen der üblich elementaren Sprachreflexionen über den Weg. Unbeachtet bleibt auch hier ein „Paradigmenwechsel in der Metaphernforschung“ (Kohl 2007, S. 119), der sich durch die Kognitive Metapherntheorie (Lakoff u. Johnson 2004) längst vollzogen hat: Für die amerikanischen Linguisten und Sprachphilosophen George Lakoff und Mark Johnson ist die Metapher primär eine Erscheinung des Denkens, eine „anthropologische Universalie“ (Kohl 2007, S. 119) zur Erfahrungsbewältigung, die alle Lebensbereiche durchdringt. Es sind metaphorische Konzepte, die all unsere Wahrnehmung und unser Handeln im Hintergrund lenken. Bereichsmetaphern wie „Theorien sind Gebäude“, „das Leben ist eine Reise“ oder „Zeit ist Geld“ strukturieren unser Denken und Handeln, was in einzelnen Lexemmetaphern wie „Zeit sparen“, „Zeit gewinnen‘, „Zeit investieren“ oder „Zeit stehlen“ einen sprachlichen Niederschlag findet. 6 Auch die verschiedenen Strategien der musikalischen Analyse folgen diesem begrenzten Setting von metaphorischen Konzepten, die sich tief in die wissenschaftliche Terminologie eingesenkt haben: Wir konzeptionalisieren Musik als „Sprache“, „Architektur“, „Energie“ oder als „Handlungsgeschehen“. Dementsprechend formen diese metaphorischen Konzepte unsere Begriffe, wenn wir von Vorderund Nachsatz, Klangrede, einer Phrase oder gar von musikalischer Prosa und musikalischen Gedanken sprechen. Oft bieten Schülerinnen und Schüler uns in ihren Äußerungen Schattierungen dieser bereits etablierten Strategien an. Musik hat einen Tonfall, unterschiedliche Sprechweisen, sie klingt murmelnd, abweisend, flüsternd, insistierend, sprudelnd, nachdenklich. In ihren Begegnungen entwickeln die Lernenden häufig auch ein externes Handlungsgeschehen, das stets Spuren ihrer persönlichen Erfahrungsmuster trägt. Es sind narrative Erzählungen, in denen sich ihr eigenes Erleben eines Dramas in Tönen widerspiegelt. Oft müssen sie sich jedoch in die noch fremden Konzepte eingewöhnen: Wenn wir etwa selbstredend von hohen und tiefen Klängen sprechen, ordnen wir verschiedene Frequenzen in einem „virtuellen Raum“ (de la Motte-Haber 1990, S. 44) an, der keineswegs naturgegeben ist. Eine aufsteigende Tonleiter erklingt auf dem Klavier von links nach rechts, auf dem Cello von oben (tief) nach unten (hoch). Kinder, die sich (noch) nicht unserer kognitiven Routinen bedienen, sprechen auch von hellen oder scharfen Klängen. Manchmal bedienen sich Schüler gänzlich anderer Strategien: Dann wird Musik zu „Materie“ (bröckelnd, hart, weich) oder „Organismus“ (stoßweise, heftig, regelmäßig oder keuchend atmend, sie besitzt eine entsprechende Körperhaltung, lässt sich einkleiden, hat Gangarten). Mühevoll wird nun die vom Lehrer gewünscht zielführende und gleichsam reduzierte fachbegriffliche Perspektive herausgelesen, die womöglich vom Schüler ursprünglich gar nicht mitgedacht worden ist und das eigentlich innovative Potenzial seines Denkens unberücksichtigt lässt. Daher soll nun ein Zugang entwickelt werden, der es dem Lehrenden erlaubt, sich von den eigenen, etablierten Konzepten zu lösen, um die Entdeckungen der Lernenden für kreative und individuelle Verstehensprozesse anzunehmen. Musikalische Analyse als Metaphernreflexion in drei Stufen der Annäherung Jede Metaphernkommunikation birgt einen Entdeckungsvorgang, der unübersichtliche Phänomene geistig zu konzeptualisieren vermag. Es sind einmalige und individuelle Zugänge, die ein integratives Denken formt, das nicht nur etwas benennen, sondern auch strukturieren und interpretieren will. Der Untersuchungsgegenstand wird also durch diese Brille bzw. diesen Filter gesehen und abgetastet. Dabei ist die Metapher nur ein Werkzeug des Erkennens, kein vermuteter musikalischer Gehalt, keine zementierte Deutung oder verbindliche Sinnzuschreibung. Dieses Potenzial einer Metapher, das Unbekannte einer Musik mit den Begriffen und Merkmalen des Bekannten vor Augen zu stellen, macht sie zu einem Denkmittel des eigenen Erkundens und Forschens. Leider stehen 7 Metaphern nicht im Wörterbuch, es gibt auch keine Leitfäden oder Handbücher für das Bilden von Metaphern. Es sind Sprachschöpfungen des Augenblicks, Geistesblitze, die sich zufällig aufdrängen: Metaphern kommen – oder eben auch nicht. All dies verspricht zunächst keine guten Aussichten für die Planung von Lernprozessen. Und doch gibt es Möglichkeiten, eine unterrichtliche Atmosphäre und methodisch-didaktische Rahmung zu schaffen, die verdeutlicht, dass Metaphern nicht nur als Sprache zweiter Wahl geduldet werden, sondern ausdrücklich erwünscht sind. Hierzu erfolgt die Auseinandersetzung mit dem objektiven musikalischen Gegenstand und den subjektiven Hör- und Denkwelten der Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines dreistufigen Prozesses: Eine initiale und spontane Metapher wird gebildet, anschließend sprachlich verdichtet und erst dann auf den zugrunde liegenden Gegenstand angebunden (Oberschmidt 2011a, S. 109ff). Die sprachliche Verdichtung ist dabei die wichtigste Phase: All das, was sich zunächst im ahnungsvoll Nebulösen bewegt, muss hier zum Vorschein gebracht werden. Dieses ist die wichtigste Phase, die im Unterricht allzu oft übergangen wird. Es geht hier nicht darum zu ergründen, was unter einer „kämpferischen“ oder „streitlustigen“ Melodie verstanden wird. Dies würde den Blick vorschnell auf musikalische Momente und begriffliche Normen beschränken. Vielmehr gilt es zu ergründen, was mit Kampf oder Streitlust assoziiert wird. Erst in einer solchen Ausdifferenzierung – etwa in Form einer Mindmap – tritt zutage, was sich hinter der initialen Metapher an verborgenem Wissen verbirgt. Dieses feinmaschige Netz an sprachlichen Schattierungen liefert dann das Material für erste Ausblicke auf kompositorische Details, die in der Ausdifferenzierung bereits mitschwingen, aber bisher noch verschwommenen in den Bildern verborgen liegen. Erst auf diese Weise wird die Fülle der Eigenschaften, die gesamte Reichweite, aber auch die Begrenztheit eines metaphorischen Konzepts sichtbar und zugleich verhindert, dass eine innovative Metapher vorschnell auf einen Begriff determiniert wird und so das schöpferische Potenzial, all die Weisheiten, die stillschweigend von ihren Urhebern mitgedacht wurden, verloren gehen. In einer dritten Phase sollte nun das geschaffene Modell an die gehörte Musik angebunden werden. Dies geschieht mit Hilfe des begrifflichen Wissens und gegebenenfalls auch mit dem stützenden Notentext. Ob hier bereits auf ein systematisches analytisches Konzept und die erworbene und verlässlich etablierte Begrifflichkeit zurückgegriffen werden kann oder ob all dieses im Rahmen des Unterrichts erst erarbeitet und eingeführt wird, hängt selbstredend von dem jeweiligen unterrichtlichen Settings und den Vorerfahrungen der Lernenden ab. Wichtig erscheint jedoch, dass die angewandten Begriffe kein totes Wissen bergen, sondern unmittelbar an das eigene Erleben, das sich in jedem metaphorischen Konzept spiegelt, anknüpfen: Begriffe werden gebraucht, um sich über 8 die individuellen Wahrnehmungsmuster zu verständigen und auszutauschen. Die angestrebte musikalische Analyse geschieht hier quasi en passant, in einem Unterricht, der sich jenen Fragen stellt, die durch konventionelle Zugänge eher abgewiesen werden: „Wer oder was oder wie bist du, du fremdes Gebilde? Deine Sprache ist neu, wie kann ich sie verstehen? Deine Erscheinung ist rätselhaft, wie erkläre ich sie mir? Du hast auf mich eine seltsame Wirkung, liegt das an dir oder an mir?“ (Schmidt-Banse 2005, S. 493). Die Vagheit metaphorischer Redeformen Doch wie gestaltet sich nun ein Unterricht, in dem sich dreißig Schüler mit ihren beliebig anmutenden Metaphern auf eigene Wege machen, um ihr ästhetisches Erlebnis in Worte zu kleiden? Wie kann hier eine notwendige – auch von Schülerinnen und Schülern zu Recht eingeforderte – Verbindlichkeit erzielt werden, die sich vom leidigen, unverbindlichen Labern abgrenzt? Zunächst einmal wird es immer gemeinsame Schnittpunkte zwischen den individuellen metaphorischen Konzepten geben, die den Verdacht widerlegen, dass assoziatives Hören beliebig sei. Auch ein fremdes Bild ist manchmal dazu angetan, das eigene Hören zu sensibilisieren und Zutrauen in die eigenen Bilder zu finden. Es sind gerade diese unterschiedlichen Blickwinkel, die eine Musik aus den jeweiligen Perspektiven ausleuchtet und eine konstruktivistische Beschau jenseits festgeschriebener Bedeutungen erst ermöglicht. Schülerinnen und Schüler werden so zu jungen Davidsbündlern, die einer Musik als Florestan, Eusebius oder Meister Raro begegnen und aus ihren individuellen Blickwinkeln ausleuchten. Dabei wird sich zeigen, dass gerade jüngere Schülerinnen und Schüler es vermögen, sich mit grenzenloser Fantasie und mit Metaphern, die oft genau ins Schwarze treffen, der gehörten Musik zu nähern und mit diesem unverstellten Blick ihren älteren Mitschülern meist weit voraus sind. Der Lernzuwachs, der sich dann durch jahrelange Vermittlungsbemühungen einstellt, besteht vor allem in der Fähigkeit, die unvermuteten Metaphernfunde in das sich zunehmend ausdifferenzierende Wissenssystem zu integrieren und an den musikalischen Gegenstand anzubinden. Auch in schriftlichen Arbeiten und Klausuren können kurze Texte, die etwa von jüngeren Schülerinnen und Schülern im Vorfeld erstellt worden sind, bearbeitet werden. Wer dies probiert, wird feststellen, mit welcher Hingabe diese Texte ausgewertet werden: Hier entstehen keine Beschreibungen im luftleeren Raum, in denen Strukturmomente, die in einer Partitur abgelesen werden, lediglich aufgezählt werden. Der auszuwertende Text, die fremde Metapher, erweist sich hier als ein roter Faden, der durch die eigene Analyse leitet, Assoziationen infrage stellt oder begrifflich abdichtet, ein entworfenes Handlungsgeschehen an die musikalische Struktur anbindet, 9 eigene Bilder entstehen lässt: „Die Wahrheit ist eben kein Kristall, den man in eine Tasche stecken kann, sondern eine unendliche Flüssigkeit, in die man hineinfällt“ (Musil 1978, S. 533f). Verwendete Literatur: BLACK, Max: Die Metapher. In: Haverkamp, Anselm (Hg.): Theorie der Metapher. Darmstadt 1983, S. 55-79 DE LA MOTTE, Diether: Analysen musikalischer Analysen. In: Schmidt, Hans-Christian (Hg.): Neue Musik und ihre Vermittlung. Mainz 1986, S. 102-104. DE LA MOTTE-HABER, Helga: Musik und bildende Kunst. Von der Tonmalerei zur Klangskulptur. Laaber 1990 INGENDAHL, Werner: Der metaphorische Prozess. Methodologie zu seiner Erforschung und Systematisierung. Düsseldorf 1971 KATTHAGE, Gerd: Didaktik der Metapher. Perspektiven für den Deutschunterricht. Baltmannsweiler 2004 KOHL, Katrin: Metapher. Stuttgart 2007 LACHENMANN, Helmut: Musik als existentielle Erfahrung. Schriften 1966-1995. 2. Auflage. Wiesbaden 2004 LAKOFF, George und Johnson, Mark: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. 4. Auflage. Heidelberg 2004 MUSIL, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften, Gesammelte Werke, Band 2, Reinbek 1978 NIERAAD, Jürgen: Bildgesegnet und bildverflucht. Forschungen zur sprachlichen Metaphorik. Darmstadt 1977 NIETZSCHE, Friedrich: Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne. Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden. Hg. von G. Colli und M. Montinari, Bd. 1., München 1988 (a), S. 873-890 NIETZSCHE, Friedrich: Die Geburt der Tragödie. Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden. Hg. von G. Colli und M. Montinari, Bd.1, München 1988 (b), S. 9-156 OBERSCHMIDT, Jürgen: Mit Metaphern Wissen schaffen. Erkenntnispotentiale metaphorischen Sprachgebrauchs im Umgang mit Musik, Augsburg 2011a OBERSCHMIDT, Jürgen: Über Musik reden. Einblick in die einschlägige fachdidaktische Diskussion. In: Johannes Kirschenmann, Christoph Richter, Kaspar H. Spinner (Hg.): Reden über Kunst. Projekte und Ergebnisse aus der fachdidaktischen Forschung zu Musik, Kunst, Literatur. München 2011 (b), S. 391-411 OBERSCHMIDT, Jürgen: Aufstieg und Fall des begriffsgeschichtlichen Paradigmas. Zur Sprache der musikalischen Analyse zwischen Metapher und Begriff. In: Bernd Enders, Jürgen Oberschmidt, Gerhard Schmitt (Hg.): Die Metapher als Medium des Musikverstehens. Osnabrück 2013, S. 309-331 RUMMENHÖLLER, Peter: Der Dichter spricht. Robert Schumann als Musikschriftsteller. Kassel 1980 SCHMIDT-BANSE, Hans Christian: Röntgenbild, Steckbrief, Portrait … oder was? Über das Elend musikalischer Analysen in der Schule. In: Bullerjahn, Claudia, Gembris, Heiner und Lehmann, Andreas C. (Hg.): Musik: gehört, gesehen und erlebt. Festschrift Klaus-Ernst Behne zum 65. Geburtstag. Hannover 2005, S. 489-512 SCHUMANN, Robert: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker. Repr. d. Ausg. Leipzig 1854. Wiesbaden 1985 SLOTERDIJK, Peter: Der ästhetische Imperativ. Schriften zur Kunst. Hg. und mit einem Nachwort versehen von Peter Weibel. Hamburg 2007 SPONHEUER, Bernd: Sprechen über Musik – Robert Schumann. In: Blumröder, Christoph v. und Steinbeck, Wolfgang (Hg.): Musik und Verstehen. Laaber 2004, S. 95-112 VOSS, Reinhard: Die neue Lust auf Unterricht und das Wissen, sich auf eine ungemütliche Sache einzulassen. In: Voß, Reinhard, Hrsg. Unterricht aus konstruktivistischer Sicht. Die Welten in den Köpfen der Kinder. Weinheim, Basel 2005, S. 813 10 Dialogbeitrag 2 Metaphern sind „Brotverwandlungen des Geistes“ – Gastrosophische Überlegungen aus musikpädagogischer Perspektive Herzlichen Dank dem Musikverlag epOs-Music, einer Einrichtung der Forschungsstelle Musik- und Medientechnologie (fmt) an der Universität Osnabrück <www.epos.uos.de/music>, für die freundliche Zurverfügungstellung des Beitrages, erschienen als Oberschmidt, Jürgen: Metaphern sind „Brotverwandlungen des Geistes“ – Gastrosophische Überlegungen aus musikpädagogischer Perspektive. In: Bernd Enders, Jürgen Oberschmidt, Gerhard Schmitt (Hrsg.): Die Metapher als Medium des Musikverstehens. Osnabrück 2013: epOs, S. 203-225, vgl dazu <http://www.epos.uni- osnabrueck.de/music/templates/buch.php?id=100> Dichter sind bildende Künstler ›Der Morgen erwacht‹. Es giebt keinen Morgen; wie kann er schlafen? Es ist ja nichts, als die Stunde, wenn die Sonne aufgeht. Verflucht! Die Sonne geht ja nicht auf; auch das ist ja schon Unsinn und Poesie. O dürft’ ich nur einmal über die Sprache her, und sie so recht säubern und ausfegen! O verdammt! Ausfegen! Man kann in dieser lügenden Welt es nicht lassen, Unsinn zu sprechen! (Tieck 1852, S. 84) Dichter sind bildende Künstler, die mit den zahllosen Farb- und Formnuancen ihrer Sprache die Phantasie und Assoziationen ihrer Leser anregen, um Einzigartiges und Außergewöhnliches zu sagen. Dabei nutzen sie allerlei Zierrat, um die Sinne anzuregen: „Viel lügen die Dichter“ (Aristoteles/Bonitz 1995, 983, a3) – und es ließe sich hinzufügen, Dichter lügen, und sie wissen, dass sie lügen. Dieser Vorwurf gehört einerseits seit der Antike zum „Standartrepertoire der epistemologischen Kunstfeindschaft“ (Hammermeister 2007, S. 90). Andererseits sind die Dichter, die wissentlich lügend durch den Tag wandern, dem Wissenschaftler einen Schritt voraus: Wenn sie sich dem Unbegreiflichen nähern, dies zu begreifen suchen und danach streben, dieses mit ihrer reichen Metaphorik in Worte zu fassen. Ludwig Tieck hat in ironischer Weise dargestellt, wie nun solch ein bildender Künstler resignativdichtend und lügend durch den Tag wandelt – und dies gerade dann, wenn er verzweifelt versucht, die Wahrheit zu sagen, wenn er danach strebt, sich von seiner dichterischen Sprache zu lösen, 11 uneigentliche Wörter durch eigentliche zu ersetzen, um in einer metaphernlosen Sprache die Wirklichkeit zu benennen und ihr die Wahrheit abzuringen. Ludwig Tieck hat feststellen müssen, dass es diese Eigentlichkeit nicht gibt: „Nein, diese Eigentlichkeit ist ein Phantom“ (Weinrich 1976, S. 324). In seiner Vorschule der Ästhetik hat sich Jean Paul ebenso aufgemacht, hinter die etablierten Begriffe zu schauen, auch für ihn ist die Sprache „ein Wörterbuch erblasseter Metaphern“ (Jean Paul 1990 [1804], S. 184) – und dies trifft selbstredend auch für jedes Wörterbuch der musikalischen Begriffe zu: Jeder Versuch, die flutende Luft begrifflich zu fassen, ist ein metaphorischer, in jedem etablierten Begriff schwingen metaphorische Konzepte mit, die sich an den jeweiligen, stets wechselnden ästhetischen Normen orientieren und Musik als Sprache, als Energie, als feste Materie oder als organisches Wesen metaphorisch konzeptualisieren. Doch wenn in der Sprache alles irgendwie metaphorisch ist, alternativ alle Begriffe metaphorischen Ursprungs oder sämtlichen Metaphern Begriffsqualitäten zugesprochen werden (Willer 2005, S. 89), weitet dies den Metaphernbegriff in die Beliebigkeit aus, so dass er letztlich seine „pragmatische Differenzierungskraft gegenüber nicht-metaphorischen Sprachformen verliert und so grau wird wie alle Katzen in der Nacht“. Wilhelm Köller fügt hier weiter an, dass wir in dieser bedenklichen Situation „das Phänomen Metapher letztlich nicht begrifflich, sondern nur metaphorisch objektivieren können“ (Köller 2004, S. 592). Das Wort übertragen (epiphora), das Aristoteles, Ahnherr aller Metapherntheorie, benutzt, bezeichnet einen kognitiven Vorgang, nicht den physischen Vorgang des Hinübertragens. So ist nur eines gewiss: Eine Metapher ist eine Metapher. Die Metapher überträgt – den Bazillus der Phantasie auf die reine, sterile Vernunft (Nach Ulrich Erckenbrecht, Divertimenti. Wortspiele, Sprachspiele, Gedankenspiele, Göttingen 1999, S. 98) Wissenschaft – und auch jene Wissenschaft, die sich mit den schönen Künsten beschäftigt – verfolgt die Strategie, wahrheitsfähige Behauptungen aufzustellen und sich im Bereich der sterilen Vernunft zu bewegen. Betrachtet man das Reden über Musik, das den Anspruch dieser Wissenschaftlichkeit einlösen möchte, geht es in besonderer Weise darum, die Tondichtung vor dem Bazillus der Phantasie zu schützen und von allzu zudringlichen semantischen Konnotationen zu befreien. Auch in den Gefilden der Musiktheorie genießt die Metapher keinen guten Ruf; hier dürften sicher auch Erfahrungen mit einer allzu subjektiv-konkreten musikalischen Hermeneutik eine Rolle spielen. Suggestiv statt argumentativ erscheinen etwa Arnold Scherings Beethoven-Deutungen (vgl. Schering 1973 [1934]), allzu schwer wiegt auch das Gepäck erzähl-vermittelnder Geschichten in 12 populärwissenschaftlichen Konzertführern, mit jeglichem Verzicht auf eine hinreichende Reflexivität der hier angebotenen Bilder (Wolf 2002, S. 25). Es ging auch in der Wissenschaft lange Zeit darum, das Denken und Reden von diesen Verunreinigungen zu befreien, die Sprache „auszufegen“, „tönend bewegte Formen“ (Hanslick 1989 [1854], S. 59) mit logischem Kalkül zu vermessen und von allen poetischen Trübungen rein zu halten. Sprachbilder in Bildungskontexten Dürfen sich nun Schüler den Schönheiten einer dichterischen Sprache bedienen oder müssen sie ihr Reden zwischen schöngeistiger Sprache und rationaler Wahrheit trennen? Behelfen sie sich der dichterisch-metaphorischen Sprache als einer Sprache des Ersatzes, weil sie die eine metaphernfreie Formelsprache (noch) nicht kennen? Was bliebe ihnen in einer von Metaphern ausgefegten Sprache an ärmlichen Begrifflichkeiten übrig? Wie orientieren sich nun Schüler in diesem Geflecht von lexikalisierten und kreativen Metaphern, zwischen etablierter und innovativer Metaphorik? Wie unterscheiden sie zwischen toten, verblassten Metaphern, die bereits zu Begriffen erstarrt sind, und ihren eigenen Wort- bzw. Begriffsschöpfungen, die dann in tote Metaphern übersetzt werden möchten? Wie finden sich Schüler ohne Notenkenntnisse zurecht, wenn ein Lehrer selbstredend akustische Phänomene im Raum anordnet, von hohen und tiefen Tönen spricht, die in den Ohren der Schüler zugleich auch spitz, scharf, hell, leicht bzw. dumpf, dunkel und schwer sein können? Auf dem Klavier gibt es kein oben und unten, hier gilt es für Schüler tastend zu erspüren, ob sie diese nun rechts oder eher links auf dem Klavier suchen müssen. Was dem Laien als ungewöhnlich und metaphorisch erscheint, ist dem Fachmann (Der Bergmann bedient sich zur Kohleförderung mit großer Selbstverständlichkeit eines „Hundes“, während große Teile der Sprachgemeinschaft gewohnt sind [oder sein sollten], diesen ausschließlich an der Leine zu führen. Hierzu: Nieraad 1977, S. 2) als fixierter Terminus längst geläufig: „Wissenschaftliche Metaphern sind janusköpfig. Aus der Innensicht eines Faches besitzen sie den Status von Fachbegriffen (Termini). […] Wissenschaftliche Termini bleiben aber – auch wenn sie zu Fachbegriffen geworden sind – in ihrem Kern an ihre Modellfunktion gebunden, die ursprünglich durch eine metaphorische Übertragung zustande kam. Die begriffliche ‚Abdichtung‘ wissenschaftlicher Begriffe gegen ihre Implikationen aus der Alltagssprache bereitet dem Lernenden oft Schwierigkeiten“ (Caviola 2003, S. 21). 13 Auch Schüler sind bildende Künstler, sie bedienen sich ihrer zur Verfügung stehenden Werkstoffe, und manchmal gelingt es auch ihnen, Beachtliches und Eindrückliches in Worte zu fassen. Felix Mendelssohn Bartholdy hat dies in einem Brief an seinen Vater zur Sprache gebracht: „Ich kann es oft gar nicht begreifen, wie es möglich ist, über Musik ein so genaues Urteil zu haben, ohne technisch musikalisch zu sein“ (zit. nach: Geck 2009, S. 192). Es gibt also eine Musikalität, die sich jenseits dieser handwerklichen Musikalität befindet. Sie beruht auf ein intuitives Wissen, das abseits der erlernten Begriffe, aber auch fern von erworbenen oder zu erwerbenden musikpraktischen Fähigkeiten zu Hause ist. In einer Lesart des 21. Jahrhunderts ließen sich Mendelssohns Einlassungen mit Stefan Koelsch international und kürzer formulieren: „Nonmusicians are Musical“ (Koelsch 2000, S. 520-541). Was Mendelssohn intuitiv gespürt und der Neurowissenschaftler Stefan Koelsch mit dem ihm zur Verfügung stehenden Instrumentarium gründlich erforscht hat, ist bisher noch zu wenig in das musikpädagogische Bewusstsein geraten (vgl. Jorgensen 2011; Oberschmidt 2011). Eine allen Menschen gegebene, universelle Musikalität ist hier letztlich in Aussicht gestellt, die dann ohne ein Vorwissen mit Metaphern zum Vorschein gebracht werden kann. Dies sind Versprechungen, die eher an Verheißungen eines Werbeprospektes erinnern, die angesprochenen zentralen Probleme des Redens über Musik nicht lösen, aber hier vielleicht zu neuen Orientierungen führen können. „Culture depends on cookery“ – Die Kultur hängt von der Kochkunst ab (Nach Oscar Wilde, Vera, or The Nihilists, Stilwell 2006, S. 34 [2. Akt, Fürst Paul]) Nimmt man den Grundsatz Lakoffs und Johnsons ernst, dass Sprache und Denken metaphorisch organisiert ist, scheint ein metaphorischer Ausblick auf das Phänomen Metapher auf diese Weise zulässig. Dieses Argumentieren in Metaphern geschieht nun in Anlehnung an eine Metametapher aus Jean Pauls Vorschule der Ästhetik, hier gelesen als eine Vorschule der kognitiven Metapherntheorie. Jean Paul bildet hier sozusagen eine Vorhut, eine Avantgarde, da für ihn die Metapher nicht nur ein Redeschmuck oder eine besonders geistreiche Erfindung darstellt, sondern „natürliche Sprachphänomene“ kennzeichnet und er gerade ihre „integrative Wirkung auf das menschliche Denken“ rühmt (Köller 2004, S. 630f). Letztlich ist der zentrale Gedanke der kognitiven Metapherntheorie bereits für Jean Paul verbindlich: „Unbekannte Gegenstände der Wirklichkeit werden durch den Erfahrungshorizont integriert und zu etwas Eigenem gemacht, indem sie benannt werden. Um aber etwas Fremdes benennen zu können, werden Bezeichnungen bekannter Dinge kombiniert und auf das Unbekannte übertragen“ (Allert 1987, S. 5). 14 Jean Paul verortet die Metapher in einer Vorschule der Ästhetik, weit ist also noch der Weg, bis die Metapher von diesem speziellen Aspekt der Sprache, nämlich dem des dichterischen, poetischen Sprechens oder einem Spezialproblem der Philosophie bei Hans Blumenberg (der sein Interesse von der Philosophie noch hauptsächlich auf die Dichtung gelenkt hat, vgl. dazu: Hörisch 2010, S. 231) zu einer „anthropologischen Universalie“ (Kohl 2007, S. 119) heranwächst. Bei Jean Paul ist die Metapher noch ein Sprachphänomen mit Resonanzen im Denken, während Lakoff und Johnson (Lakoff, Johnson 2004) den kognitiven Aspekt der Metapher zum primären erklären und zeigen, dass Metaphern auch die gewöhnlichsten sprachlichen Verwendungen durchdringen und nun ihren Fokus auf alltagssprachliche Phänomene legen. Und doch geziemt es sich, von hier aus auch einen Ausblick auf die Sprache der Wissenschaft zu wagen: „Er [Jean Paul] sieht die Metapher als anfängliche Struktur der Sprache, die der begrifflichen vorausgehe. Damit wird die Dichtkunst mit ihren Metaphern als eine ursprüngliche Ausdrucksform des Menschen aufgewertet. Die Poesie wird zur Grundlage jeder, auch der wissenschaftlichen Sprache“ (Allert 1987, S. 4). Die eigentliche Heimat des Denkens siedelt also auch Jean Paul nicht im Reich stabiler Begriffe, sondern in beweglichen, neugestalteten bildlichen Vorstellungen an. Metaphern sind für Jean Paul „Brotverwandlungen des Geistes“ (Jean Paul 1990 [1804], S. 184). Dieser Metapher soll nun in den folgenden Überlegungen nachgegangen werden. Um ihre Reichweite und den kognitiven Mehrwert zu erspüren, gilt es nun, den Konnotationen im bildspendenden Bereich „Brot/Brotverwandlung“ nachzugehen und zu zeigen, wie „weitreichend und umfassend das tägliche Essen die menschliche Welt erzeugt.“ (Lemke 2007) Insofern versteht sich dieser Beitrag als gastrosophische Überlegung aus musikpädagogischer Perspektive: „Kochen und Essen bilden eine Grundkonstante menschlicher Erfahrung“ und dienen in der reichhaltigen Sammlung philosophischer Metaphern „zur Veranschaulichung geistiger Operationen“ (Von der Lühe 2007, S. 340). Anmerkung: Der Begriff „Gastrosophie“ geht u. a. auf die gleichnamige Schrift von Eugen van Vaerst (1852) zurück, in der der Autor versucht, die Weltbezüge des Essens zu reflektieren, um daran das Philosophische hervortreten zu lassen. Einen Ansatz, den Harald Lemke in seiner Ethik des Essens aufgreift und weiter verfolgt. Zur weiteren frankophilen Vorgeschichte vgl. Kurt Röttgers, Kritik der kulinarischen Vernunft. Ein Menü der Sinne nach Kant, Bielefeld 2009, S. 38ff. 15 Tischgesellschaften im Unterricht: Lernen ist Nahrungsaufnahme (Aneignung) und Zubereitung (Konstruktion) von Wissen Möchte man sich umfänglich mit der Funktion von Metaphern in gastrosophisch-pädagogischen Situationen beschäftigen, gilt es zunächst, die Pfade von Jean Paul zu verlassen und nicht die selbstgesteuerte Zubereitung, sondern das konsumierende Einverleiben der Speisen zu untersuchen. Die in Aussicht gestellten Betrachtungen über das Lernen mit Metaphern folgen also zunächst der verbreiteten Alltagsauffassung von Lernen als Aneignung von Wissen. Ist Lernen konzeptionalisiert als „Nahrungsaufnahme“ und „Verdauung“, kommt der Metapher hier vornehmlich eine vermittelnde Instanz oder veranschaulichende Funktion zu. Die fertig angerichtete Speise bedient sich didaktischer Metaphern, die erklären, weil es den Schülern (noch) an Begriffen fehlt. Sprachbilder sind hier vorläufig, sie gelten so lange, bis sie begrifflich entschlüsselt, verdaut, die lexikalischen Lücken geschlossen und Nährstoffe begrifflich fixiert werden. Ein zweiter Zugang betrachtet das Bilden von Metaphern als Zubereitung einer Speise, als einen schöpferischen Prozess, der Wissen schafft und die Begriffe überschreitet. Hier ist die Metapher nicht mehr ein Geländer, an dem sich das Verstehen festhalten kann, sondern sprachlicher Reflex einer inneren Vorstellung: In diesem kreativen Akt gründet sich in der Metapher ein Wissen, das sich nicht mehr begrifflich einholen lässt. Das Konzept „Lernen ist Nahrungszubereitung“ läuft dem Prinzip der Nahrungsaufnahme in gewisser Weise zuwider. Die Metapher ist hier mehr als ein Saft zur Verdauung, ein „didaktisch rhetorisches Mäntelchen“ (Voß 2005, S. 9), das an- oder abgelegt werden kann. Sie birgt vielmehr ein Sinnpotential, das die ursprünglichen Intentionen der Erzeuger weit übersteigen: „Die Metaphern bergen den wahren Reichtum des armen Wesens, das der Mensch von Natur aus ist“ (Konersmann 2007, S. 8). Von Lichtenberg wird dies aphoristisch auf den Punkt gebracht: „Die Metapher ist viel klüger als ihr Verfasser“ (Lichtenberg 1968, F. 369). 1. Lernen ist Nahrungsaufnahme (Lernen als Aneignung von Wissen) In der Speisemetaphorik, die in der Philosophie schon früh belegt ist, wird der Intellekt als Leib aufgefasst, der nach Speise verlangt. Wir sprechen von „Wissensdurst“, „Erkenntnishunger“, manch einer hat gar die „Weisheit mit Löffeln gegessen“. Über das Kosten im Munde führt der Weg zum Schlucken, den Verdauungsprozessen in Magen und Darm: „Alles geistige Genießen kann daher mit 16 Essen ausgedrückt werden“ (Von der Lühe 2007, S. 341), hält bereits Novalis fest. Äußerlich Gegebenes wird aufgenommen, um es in einem inneren Erkenntnisprozess zu Eigen zu machen. Als eine solche Parallelisierung von Essen und Erkennen, und Ernähren und Wissen, lässt sich auch das Einverleiben von Wissen im Rahmen pädagogischer Speise- und Verdauungsprozesse fassen. Im Unterricht wird dann die Kost mit Metaphern mundgerecht serviert, um besser aufgenommen und verdaut werden zu können. Wie jede Fachsprache, ist auch die Sprache der Pädagogik auf metaphorische Konzepte angewiesen, um Lernprozesse und Erziehungsziele in Worte zu fassen: „Die Sprache der Pädagogik basiert auf einem begrenzten Set epochenunspezifischer metaphorischer Konzepte“ (Guski 2007, S. 473), stellt Alexandra Guski fest; sie verfolgt diese historisch konstanten metaphorischen Konzepte von schulischem Lernen in pädagogischen Texten. Diese zeigen sich etwa der Konzeptionalisierung „Lernen ist Wachsen“, die den Lehrer als „Gärtner“ betrachtet, der seine „Sprösslinge“ wachsen lässt, diese aber auch „gießen“ und seine „Pflanzen“ gegebenenfalls auch „beschneiden“ muss. Die Speisemetaphorik gehört hier ebenfalls zu einem etablierten Feld: Bereits Johann Amos Comenius empfiehlt im Sinne einer möglichst widerstandslosen Stoffweitergabe, die „Schulspeise“ möglichst „süß anzutun“ (Guski 2007, S. 259). Diese Metapher suggeriert, dass mit kindgerechten Speisen die Unterrichtsinhalte leichter aufzunehmen und schmackhafter seien. Betrachtet man nun die Literatur zur Bedeutung der Metapher in der Pädagogik etwas genauer, so scheinen auch hier die Metaphern als Lockspeise: Sie sind dienlich, um als ein temporäres Medikament die Verdauung zu unterstützen, eingesetzt als Geschmacksverstärker und Appetitanreger, die immer dann ihren Dienst erfüllen, wenn es sich im Unterricht um schwere Kost handelt. Metaphern kommen dort ins Spiel, wo unsere begrifflichen Kompetenzen versagen: Im Bereich des Mangels, des Geahnten aber Noch-nicht-Verfügbaren. Das Weltwissen der Schüler wird so angebunden an das, über das man noch nichts weiß. Ernährungskundliche Kenntnisse der etwas kritischeren Art besaß hier jedoch Johann Gottfried Herder, der betonte, dass „gründliche Wißenschaft, zumal im Anfange und in der Jugend, […] mit Schweiß, mit Uebung gewürzt werden“ (Herder 1877–1913, Bd. XXX, S. 47) müsse und auf die Gefahr überzuckerter Süßspeisen hinwies. Eine derartige Aufbereitung des Lernstoffs bezeichnete er als bloße Lockspeise für den, der „sich an diesen überzuckerten Wißenschaften, oder vielmehr an solchem falschen Zucker, womit seine Wißenschaft überzogen war, sattgenascht hat, [hingegen] nachher nie die Anfangs bittre, aber nachher gesunde und stärkende Wurzel zu kauen mehr Lust hat.“ (Herder 1877–1913, Bd. XXX, S. 55f) Und Friedrich Wilhelm Niethammer spottete 120 Jahre später in ähnlicher Weise über die „Albernheit, das Alphabet in Zucker zu backen“ (Niethammer 1968, S. 325). 17 Betrachte ich metaphorisches Sprechen als eine solch süße Lockspeise, die dann in die stärkende, begriffliche Wurzel überführt werden muss, folge ich einer Substitutionstheorie der Metapher, vollziehe einen Etikettentausch bei der Benennung von musikalischen Sachverhalten. Ganz gleich, ob eine Metapher nun aus dichterisch ornamentalen Gründen oder aus veranschaulichend pädagogischen Gründen den Platz eines Begriffes zunächst eingenommen hat. Diese Substitutionsprozesse haben auch im Musikunterricht ihren Platz und natürlich gibt es auch immer wieder jene Momente, die diese sinnvoll erscheinen lassen. Und auch im Rahmen dieser Substitutionstheorie kann der Metapher ein gewisser kognitiver Innovationsschub nicht abgesprochen werden. Auch das Verdauen von Nahrung ist wie das Bilden und Verstehen von Metaphern ein aktiver Prozess! Gerade wenn es im Verlauf des Unterrichts darum geht, das Reden vom metaphorischen Zuckerguss zu befreien, um sich dann mit der bitteren aber stärkenden Wurzel allein zu beschäftigen. Auch hier wird zumindest das analogisierende Denken angeregt, auf assoziative Ähnlichkeiten aufmerksam gemacht. Im Unterricht wird hier jedoch der musikalische Gegenstand häufig in einem mehrgängigen Menü mit einer festgelegten Speisefolge serviert: Aufgabe 1: Beschreibe, wie die Musik auf dich wirkt! Aufgabe 2: Wo beginnt das zweite Thema? Für jeden Schüler wird dann schnell klar, was hier als süße Vorspeise und was als eigentliches Hauptgericht aufgetischt wird. Sein ursprünglicher, sinnlicher Zugang ist abgeschnitten, wenn für das analytische Studium erst das Besteck gewechselt werden muss. 2. Lernen ist Nahrungszubereitung (Lernen als Konstruktion von Wissen) Die Metapherntheoretiker haben jedoch erkannt, dass auch ein süßer Zuckerguss die geschmackliche Konsistenz des Gegenstandes färbt und verändert. Dieser Einsicht sucht die auf Max Black zurückgehende Interaktionstheorie (Black 1996, S. 55-79) der Metapher Rechnung zu tragen. Es gibt hier keine geordnete Speisefolge, sondern semantische Felder, die sich durch eine Wechselwirkung gegenseitig beeinflussen und miteinander vermischt werden. Wir erleben das bereits bei einfachen Beispielen: Ein „getupfter“ Ton wird eben nicht einfach begrifflich staccato gespielt, in diesem Tupfen steckt mehr als in der fachbegrifflichen Spielanleitung aufgehen kann. Eine springende, hüpfende, huschende Melodie lässt sich nicht in Fachbegriffliches einkleiden, ohne dass Wesentliches der 18 ursprünglichen Assoziation verloren geht. Werner Ingendahl hebt dies in Opposition zur substitutionstheoretischen Sichtweise hervor: „Die Metapher ist durch nichts zu ersetzen und ersetzt nichts“ (Ingendahl 1971, S. 305). Für Jean Paul sind die Begriffe „willkürliche, nichts malende Schnupftuchsknoten der Besinnung“ die „nicht einmal fünf Punkte von einem Objekte“ (Jean Paul 1959, Bd. 3, S. 1025) seien. Angesprochen wird hier, dass sich in jeder Metapher ein analoges Vorstellungsbild konstituiert, mit all seinen feinen Schattierungen und fließenden Übergängen, ein Bild, das sich nicht in das endliche Kategoriensystem der Begriffe fassen lässt. Durch jede metaphorische Interaktion entsteht also ein süß-saurer Geschmack: Der literarische Gourmet mag diesen Gout schätzen, für den Musikwissenschaftler hat dies einen für ihn unangenehmen Bei- oder Nachgeschmack. „Brotverwandlungen des Geistes“ Pädagogik beschäftigt sich damit, das Lernen steuern und lenken zu wollen. Wege werden vorgezeichnet oder geebnet, das Verstehen soll angebahnt und sorgsam vorbereitet werden. Dabei ist die pädagogische Rezepteküche vielfältig, einschließlich eines konstruktivistisch mundenden Unterrichts, in dem die Speisen nicht vom Lehrer, sondern von den Schülern selbst zubereitet werden. Friedrich Nietzsche liefert hierfür das passende Bild: „Wer aber mit essen will, muss auch mit Hand anlegen, auch die Könige. Bei Zarathustra nämlich darf auch ein König Koch sein“ (Nietzsche 1993, Bd. 4, S. 354). Dies führt zurück zur Signal gebenden Metapher der „Brotverwandlung“ (Jean Paul 1990 [1804], S. 184). Kein Verdauungsprozess wird hier beschrieben, sondern die Zubereitung einer Speise, ein Prozess des Gebärens. Was wir bereits ästhetisch erfahren und damit uns einverleibt haben, wird nun in Brot verwandelt: Eine Verwandlung inmitten des Unterrichts. Es sind verheißungsvolle, paradiesische Aussichten, diesen „Sprung des Denkens“ (Sailer-Wlasits bezieht sich auf Heideggers ›Satz vom Grund‹, auch wenn Heidegger hier nicht von der Metapher sondern von den verschiedenen Modi des Satzes ‚nihil est sine ratione‘ spricht: „Der Sprung bringt das Denken ohne Brüche, d. h. ohne die Stetigkeit eines Fortschreitens in einen anderen Bereich und in eine andere Weise des Sagens“. Zit. nach: Sailer-Wlasits 2003, S. 161) – wie Heidegger es formuliert hat – durch die Metapher einfach geschehen zu lassen. Ein Glöckchen erklingt, die Verwandlung geschieht – und 19 eine wie aus dem Nichts geborene Metapher verwandelt Geist in sprachliche Materie. Nur bleibt bei Jean Paul leider unausgesprochen, wie dies zu geschehen hat. Für diese Verheißung lohnt es sich jedoch, der Verwandlung im ursprünglichen, religiösen Kontext etwas näher auf den Grund zu gehen: Brot ist eine materielle Verkörperung nicht nur des Leibes, des Leibes Christi, sondern gleichzeitig die des Geistes, einer Religion, einer Lehre. Brot ist nicht nur ein reales Backwerk, sondern steht für das Ganze, für Leben und Wirken. Das Mahl gewährt hier Zugang zum Göttlichen, zum Höchsten und Guten. Dies alles versucht Jean Paul in seiner Metapher der „Brotverwandlung“ zu fassen. Die Metapher hat in diesem Kontext nicht den Status einer süßen Vorspeise oder eines pädagogischen Vermittlungsmanövers, dieses Brot umfasst das Ganze, es ist mehr als ein Appetitanreger, es ist ein Brot, das sättigt, das am Leben erhält und das ein wohliges Erfülltsein verspricht. Wesentlich ist hier, dass zwischen Resultat und Vorgang nicht getrennt werden muss, dies drückt der religiöse Begriff der Verwandlung aus: „In dieser Situation sind Weltbezug, poetische Aufbauleistung und Reflexion verbunden“ (Kaiser 1995, S. 213). Die entscheidende Leistung einer Metapher besteht für Jean Paul darin, „das Ich in seiner Welt zu konstituieren. Die Metapher ist Seelen- oder Phantasietätigkeit (als Übertragen, Beseelen oder Verkörpern), das sprachliche Produkt dieser Tätigkeit (im weitesten Sinn: der Roman) und das anthropologische Produkt (das wiedergeborene poetische Ich).“ (Kaiser 1995, S. 212) Die poetische Erkenntnis findet, was sie erfindet, legt offen, was sie selbst produziert: „In diesem Erkennen: der Erkenntnis der Phantasie, wird das Auge zur Lichtquelle und nimmt wahr, was es selbst erst sichtbar macht“ (Kaiser 1995, S. 213). Eine gottgleiche Potenz liegt also in der menschlichen Fähigkeit zur Metaphernbildung. Diesen göttlichen Status, den sich die Metapher in ihrer zweitausendjährigen Geschichte mühsam erkämpft hat, gründet sich auf Kant, der zwischen göttlicher und menschlicher Anschauung unterscheidet: „Die göttliche Anschauung erzeugt die Gegenstände in ihrer Existenz, die menschliche Anschauung hingegen setzt die Existenz der Gegenstände als gegeben voraus.“ (Briefliche Mitteilung an Marcus Herz vom 21. Feb. 1772, hier zit. nach Mohr 1998, S. 127) In einem konstruktivistischen Gegenstandsverständnis, das davon ausgeht, dass die Wirklichkeit durch Anschauung selbst geschaffen wird, gibt es also die Einschränkungen nicht mehr, die für den Sterblichen kennzeichnend sind. 20 Das metaphorische Konzept der „Brotverwandlung“ ist also ein weitreichendes – umso ernüchternder erfolgt nun die Einschränkung, dass auch Metaphern nicht das Ganze in den Blick nehmen, sondern sich – wie jede konstruktivistische Gegenstandserfahrung – nur perspektivisch einem Gegenstand nähern können. Es sind Brotverwandlungen des Geistes, also jenes wird verwandelt, das sich das irdische Wesen mit seinen begrenzten Mitteln zuvor einverleibt hat. „Bilder, die uns gefangen halten, wird es immer geben, denn nie werden wir der Sprache oder den Metaphern entrinnen: Nie wird es uns gelingen, Gott oder das anseiende Wesen der Wirklichkeit von Angesicht zu Angesicht zu erblicken“ (Rorty 2000, S. 13). Und doch lassen uns Metaphern ein wenig von jenem göttlichen Funken spüren: „Die Metapher ist die größte Macht, die der Mensch besitzt. Sie grenzt an Zauberei und ist wie ein Schöpfungsgerät, das Gott im Inneren seiner Geschöpfe vergaß, wie der zerstreute Chirurg ein Instrument im Leib des Operierten liegen lässt.“ (Y Gasset, zit. nach Friedrich 1956, S. 207) Bilder produktiv werden lassen: Rachmaninoff, Klavierkonzert Nr. 3 op. 30 Diesem göttlichen Funkenflug gilt es nun mit Blick auf Unterricht nachzugehen, nicht immer funktioniert hier diese Brotverwandlung. Es sind intuitive, einmalige, individuelle Verstehensvollzüge: Prozesse, die einem Verlangen entgegenstehen, das Lernen steuern und lenken zu wollen. „Manchmal trifft, was wir sagen, ins Schwarze, manchmal geht es daneben. Wir knüpfen Kontaktfäden und verstricken uns dabei, und wenn wir auf andere zugehen, kommt es zu Berührungen – oder nicht. Und manchmal funkt es dabei“ (Lakoff, Johnson 2004, S. 7). Zunächst gilt es jedoch, den geneigten Leser einzuladen, bei seiner Begegnung mit dem ersten Satz aus Rachmaninoffs dritten Klavierkonzert eigene Kontaktfäden zu knüpfen und innere Bilder zuzulassen, lesend (vgl. etwa dazu: <http://cantorionnoten.de/music/1451/Piano-Concerto-No.-3Full-Score/downloaded>) oder hörend (vgl etwa dazu: URL: <http://www.youtube.com/watch?v=lusMu2LGIUM>) angeregt werden kann. Dieses „subjektive Erleben von Musik“ (Oberhoff 2007, S. 37), das vom klanglichen Musikerlebnis ausgeht, ist auch Ausgangspunkt für einen Zugang Bernd Oberhoffs, der als Musikpsychoanalytiker seine ureigene Perspektive zu diesem Konzertbeginn vorstellt: „Es tauchten Vorstellungen und Empfindungen auf, die einer frühkindlichen Erlebniswelt angehören könnten. Diese Eindrücke waren sicher nicht ganz unbeeinflusst davon, dass ich mich zu dieser Zeit intensiv mit der Säuglingsforschung auseinander setzte“ (Oberhoff 2007, S. 43). Ereignisse der frühkindlichen MutterKind-Matrix konzeptionalisieren seinen Blick, er teilt den Konzertsatz in 16 Episoden ein, 21 „frühkindliche innere Erlebnisse“ und „keine objektivierbare Hörgestalten“ , lediglich Anregungen, um das Entstehen eigener Bilder zu befördern: „Hören Sie also mit gleichschwebender Aufmerksamkeit und achten Sie auf ihre inneren Resonanzgefühle oder Phantasien“ (Oberhoff 2007, S. 49). Episode 1 Das Orchester beginnt wahrhaft mütterlich mit einer weichen wiegenden Streicherbewegung, die den harmonischen Hintergrund bildet, aus dem heraus sich die schlichte und kindliche Melodie des Klaviers entwickelt. Eine angenehme Harmonie des Miteinanders entfaltet sich vor dem Hörer, die eine ausgesprochen beruhigende Wirkung ausübt. Vor allem das Orchester scheint sensibel zu erspüren, wie es sich harmonisch, klanglich und rhythmisch zu verhalten hat, um optimal den Bedürfnissen eines Säuglings nach einem sicheren und vertrauensvollen Gehaltensein zu entsprechen. Nicht das einzelne ‚Ich‘, sondern das ‚Wir‘, also die Erfahrung des Zusammenseins und der harmonischen interaktiven Passung zwischen Säugling und Mutter (synchroner sozialer Modus) stehen in dieser Episode im Vordergrund. Episode 2 Säuglinge lieben die Wiederholung: Ein bestimmtes Spiel muss immer und immer wieder gespielt werden, es kann nicht oft genug sein. Aber noch aufregender ist es, wenn ein Spiel vom Spielpartner jedes Mal leicht variiert wird: Sei es etwas schneller, oder etwas langsamer, lauter oder leiser etc. Es ist ein großes Glück für den Säugling, wenn er Eltern hat, die bei der Abwandlung von Spielsequenzen viel Phantasie besitzen und natürlich auch die entsprechende Ausdauer aufbringen. Das erleben wir in Episode 2. Das musikalische Spiel aus Episode 1 wird wiederholt jedoch in einer Variation: Das Tempo ist beschleunigt, der beiderseitige Pulsschlag und die Erregungskurve erhöht sich, es kommt zu einem lustvollen Aufschaukeln der Gefühle. Im weiteren Verlauf der Analyse wird das Konzept der Mutter-Kind-Matrix weiter ausgebreitet, dabei werden auch kleinste Ausdrucksnuancen auf dieses metaphorische Eigenkonzept bezogen: 22 Und allem Anschein nach ist die Mutter in dieser Funktion nicht ‚genügend gut‘ gewesen und die Musik in den Episoden 9–12 drückt das Misslingen eines Containments durch die Mutter aus (Oberhoff 2007, S. 55). Diese Ängste sind in der Musik der Episode 11 hörbar ausgedrückt. Ich denke dabei besonders an die fahlen schneidenden Klänge bei den Geigen, die sehr außergewöhnlich sind, aber gleichzeitig eine eindrückliche Versinnbildlichung von kindlichen Ängsten vor dem Zusammenbrechen und dem Zerfall des Selbst darstelle. (Oberhoff 2007, S. 56). Der gesamte Konzertsatz wird auf diese Weise dechiffriert und die Ergebnisse biographisch belegt. Zitiert wird hierzu ein Ausschnitt aus der Biographie Maria Biesolds: Rachmaninoffs willensstarke, übermächtige Mutter war nicht unproblematisch für die seelische Entwicklung des kleinen Sergej und wirkte oft bedrückend auf ihn. […] Prägend für seine spätere Zerrissenheit ist unter Umständen eine Art der Bestrafung, die seine Mutter ihm für Ungehorsam angedeihen ließ: Der kleine Sergej muß unter dem Klavier sitzen! Die erste Bekanntschaft mit dem Instrument ist eine bedrohliche (Oberhoff 2007, S. 53). Statt die Metapher als lokales, temporäres Ereignis (Ricœur spricht ausdrücklich von einer Bedeutung, die nur in diesem augenblicklichen Kontext existiert. Vgl. Ricœur 1996, S. 361ff) im Text zu betrachten, entstehen hier scheinbar objektivierbare Sinnzuschreibungen, die allzu zudringlich werden, weil die Metapher hier ihren beweglichen Status als Metapher verliert. Dichter lügen – und sie wissen, dass sie lügen. Die Perspektive von Bernd Oberhoff ist nachvollziehbar, sinnig, schlüssig. Er versucht eine psychoanalytische Deutung und trägt dabei diesen ihm eigenen Verstehenskontext an das Werk heran. Ein Zugang, der aber genau dann problematisch wird, wenn er zu einer totalitären Deutung der Musik führt, wenn Dichter vergessen, dass sie lügen und die Metapher vergisst, eine Metapher zu sein. Hat Oberhoff nicht genügend Vorkehrungen getroffen, sein Reden über Musik in dem vagen Raum seines eigenen, konstruktivistischen Konzeptes zu belassen? Oder trifft uns, die wir belastet und gezeichnet sind vom schweren Gepäck einer Analyse in der Tradition des Bezeichnens und 23 Benennens, gar eine Teilschuld? Weil wir uns nicht lösen können von den eingespielten Routinen und durch neue Vorstellungen allzu leicht in Turbulenzen geraten? Dem Text von Oberhoff sei nun der Klausurtext einer Schülerin der 11. Klasse an die Seite gestellt. Ein Text von Kim, die es bereits aus anderen Unterrichtszusammenhängen gewohnt ist, in Bildern zu denken und mit Bildern zu sprechen, um auf diese Weise ihren eigenen Verstehenskontext und ihre eigenen Konzepte in ihr Hören einzubringen: Mit dem ersten Teil verbinde ich einen abendlichen Strandspaziergang. Es ist ein warmer, ruhiger Sommerabend und ich bin allein am Strand. Während ich langsam barfuß durch den Sand laufe, geht am Horizont die Sonne unter. Ihr schummriges Licht spiegelt sich auf der Wasseroberfläche und ich höre das gleichmäßige Rauschen der Wellen. Nun ändert sich die Szenerie. Unterhalb der Wasseroberfläche schwimmt ein Fischschwarm. Viele kleine Fische „wuseln“ durcheinander. Im Vergleich zur Ruhe des Ozeans bewegen sie sich sehr schnell, beinah hektisch. Jeder einzelne Fisch sucht sich seinen Weg inmitten der anderen. Ich muss an Meer und Wellen denken, da die ersten Takte abwechselnd aus zwei Tönen bestehen (Takt 1-3). Wie ein Auf und Ab der Wellen wechseln sie. Die Geigen und die Bratsche verwenden eine ähnliche Melodie. Auch hier ein Auf und Ab an Tönen (Takt 1-9). Das Klavier spielt zudem sehr ruhig und gebunden, dies bewirkt eine sehr gemütliche, stille Atmosphäre, was mich an einen einsamen Abend bei Sonnenuntergang denken lässt. Ab Takt 27 verstummt das Wellenmotiv. Das Klavier beginnt nun sehr hektisch und schnell zu spielen. Diese Hektik finde ich in einem Fischschwarm wieder. Wie die Melodie des Solisten aus vielen einzelnen Noten besteht, besteht ein Schwarm aus vielen kleinen Fischen. Die Melodie weitet sich über sehr hohe und sehr tiefe Töne aus. Sie steigt und sinkt stetig, wie ein Fisch, der innerhalb seines Schwarms seinen Weg durch das Getümmel sucht. Die beiden Teile des Stücks weisen viele Ähnlichkeiten auf, 24 obwohl ein sehr starker Wechsel stattfindet. Dies sehe ich in meiner Vorstellung ebenfalls. Einmal spielt sich jedoch alles oberhalb, einmal unterhalb der Wasseroberfläche ab. Für die Schülerin ist nicht die schlichte Gestaltung der einstimmigen Melodie zu Beginn signalgebend. Sie trägt noch kein virtuoses Klavierkonzert von Schumann oder Tschaikowsky im Gepäck ihrer ästhetischen Erfahrungen, der Rachmaninoffs schüchternen Konzertbeginn als etwas Besonderes erscheinen ließe. Für Kim ist die virtuose Entfaltung der späteren Begleitung das Faszinierende, der Eckstein ihrer initialen Metapher. An dieser unbändigen Bewegung, bei gleichzeitig gespürter Ordnung, entzündet sich die Metapher „Fischschwarm“ (Vgl. dazu: Sergej Rachmaninoff, Klavierkonzert Nr. 3 op. 30, T. 27–38). Dieser Schülertext zeigt auch, wie ein intuitiv geformtes, in die Welt gesendetes Bild in einem metaphorischen Prozess (in Anlehnung an Jain 2002, hierzu Oberschmidt 2010, S. 131-154) reflexiv an den musikalischen Gegenstand angebunden werden kann: Die initiale Metapher „Fischschwarm“ bietet hier lediglich einen Anstoß, der in eine Suchbewegung übergeht und sich zunächst in einem zweiten Schritt zu einem Bedeutungsnetz verdichtet. Bevor nämlich die Metapher auf den Gegenstand bezogen werden kann und der Interaktionsprozess zwischen Bildspender und Empfänger in Gang gesetzt wird, soll daher die Metapher selbst ausgeleuchtet werden, um Übergriffsmöglichkeiten, Kontaktfäden bereitzustellen. Eine vorschnelle Übertragung würde womöglich das Potential der Metapher, das zu bergende Wissen, nicht zum Vorschein bringen. In unserem Fall gilt es also zunächst, die Eigenschaften des Fischschwarms näher zu beschreiben: Viele kleine Fische ‚wuseln‘ durcheinander bewegen […] sich sehr schnell, beinah hektisch. Jeder einzelne Fisch sucht sich seinen Weg inmitten der anderen. Erst dann werden Bildspender und Bildempfänger in Beziehung gesetzt, wird versucht, die reiche Metaphorik an transparente Begriffe anzubinden: Das Klavier beginnt nun sehr hektisch und schnell zu spielen. Diese Hektik finde ich in einem Fischschwarm wieder. Wie die Melodie des Solisten aus vielen einzelnen Noten besteht, besteht ein Schwarm aus vielen kleinen Fischen. Die Melodie weitet sich über sehr hohe und sehr tiefe Töne aus. Sie 25 steigt und sinkt stetig, wie ein Fisch, der innerhalb seines Schwarms seinen Weg durch das Getümmel sucht. Angestrebt ist also ein Interpretieren der Metapher, das sich in drei Schritten vollzieht: Eine initiale Metapher wird gebildet (1), verdichtet (2) und reflexiv an den zugrunde liegenden Gegenstand angebunden (3). Es ist also kein Übersetzungsvorgang, kein Substitutionsprozess, der die vorläufige Metapher durch einen endgültigen Begriff ersetzt, sondern sie bleibt als ursprünglicher sprachlicher Reflex bestehen und umstellt weiterhin den musikalischen Gegenstand. Auch, wenn wir es hier mit einem abgeschlossenen, schriftlich hinterlegten Text zu tun haben, lässt sich skizzieren, wie jene metaphorische Beschreibung in anderen, mündlich-beweglichen Kontexten weiter verfolgt werden könnte: 1. Wie reagieren Einzeltöne in Erfüllung ihrer Aufgaben in diesem akkordischen System des Fischschwarms aufeinander? 2. Wie zeigt sich Schwarmintelligenz, werden Harmonie- und Richtungswechsel von den benachbarten Fischen aufgegriffen? 3. Wie werden die einzelnen Fische vom Musiker oder auch vom Hörer isoliert bzw. in ihrer fließenden Gesamtheit wahrgenommen und erfasst? 4. Wie zeigt sich Virtuosität im Instrumentalkonzert? Wie äußert sie sich im Geschehen, das sich oberhalb oder unterhalb der Wasseroberfläche abspielt? Auf diese Weise entsteht ein unabschließbarer Prozess, mit Übergängen in neue Kontexte, geeignet, um mit all seinen Ein- und Ausblicken das Potential einer Metapher, das vorgreifende Wissen der Schüler freizulegen. Zu viele Köche verderben den Brei? Das Wiegen eines Säuglings, ein Fischschwarm, der bei einem Strandspaziergang beobachtet wird, zwei unterschiedliche Konzepte, sich dem Klavierkonzert von Rachmaninoff zu nähern. Was aber nun, wenn im Unterricht dreißig Schüler mit ihren Bildern Netze auf den Gegenstand werfen? Die dabei entstehenden Bilder sind verschieden und doch haben sie eine gemeinsame Mitte, kreisen sie um die Thematik: Kindheit, Melancholie, Einsamkeit, Rückblick. „Die Metaphern aller Völker (diese Sprachmenschwerdung der Natur) gleichen sich, und keines nennt den Irrtum Licht und die Wahrheit Finsternis“ (Jean Paul 1990 [1804], S. 182). 26 Das Einwohnen in die Bilder der Mitschüler umstellt den Konzertsatz mit wechselnden und sich ergänzenden Konzeptionalisierungen: „Durch die Verwendung alternativer Metaphern im gleichen Bezugsfeld wird die dominante Metaphorik wieder in den ‚Als ob‘-Status zurückversetzt und – sofern die neue Metaphorik bessere Erklärungsleistungen liefert – in ihrem Geltungsbereich eingeschränkt“ (Debatin 1996, S. 99). Ist ein Bild in die Welt gesetzt, lässt es sich zwar nicht mehr auf eine Theoriesprache reduzieren, doch offenbaren gerade die im metaphorischen Prozess reflexiv angebundenen Begriffe jene Kreuzungspunkte, die den individuellen Blick zu einen gemeinsam erworbenen Besitz werden lassen: „Metaphern haben deshalb das vorletzte Wort in einer unbegreifbaren, aber deutbaren Welt, die kein letztes Wort kennt“ (Hörisch 2010, S. 228f). Fertiggerichte im Unterricht Auch für Schüler gilt das Wahrheitsgebot, im täglichen Leben wie im Reden über Musik. Der Musikunterricht hält ihnen hierfür ein reichhaltiges außermusikalisches Imaginationsangebot bereit. Es ist der Duft von diesem frisch gebackenen Brot, der dem musikalischen Genuss flüchtig vorauseilt, ihn allenfalls dabei begleitet und sich allzu häufig vor den zu erfahrenen Gegenstand stellt. Auch dieses Brot, das sich nicht aus dem eigenen Geist gründet, ist unverzichtbarer Bestandteil des vollen Geschmackserlebnisses und weckt sicher auch beim Leser verborgen geglaubte Kindheitserinnerungen: Hier ist die Speisung fertig vom Lehrer angerichtet und es sind immer die gleichen Fertiggerichte, die für den Unterricht zubereitet werden: Futter für das Volk – eine Brotverwandlung des Geistes findet dabei nicht statt. So durften bereits in der Grundschule ganze Schülergenerationen Symphonische Dichtungen von der Quelle bis zur Mündung verfolgen und sich auf eine orchestrale Wolfsjagd begeben. Schüler sind aufgewachsen mit diesen fremden, von außen herangetragenen Bildern in einem Unterricht der eindeutigen Konnotationen, wenn es darum geht, die angebotenen Pfade äußerer Eindrücke in der Musik zu verfolgen. Manchmal tragen sie die Spuren dieser verlässlich geglaubten Bilder als einen bereits voller Stolz erworbenen inneren Besitz auch an ihnen fremde Musik heran, der sie nach dem Hören dann konstatieren lässt: „Das Fagott ist immer der Großvater.“ Schüler sind auch in anderen Fächern in dieser Landschaft des Benennens aufgewachsen und auf der Suche nach solch objektivierbaren Sinnzuschreibungen. Sie dürfen sich zwar zeitweise wie ein Dichter bewegen: Eigene Assoziationen ausfalten, angebotene Fäden aufnehmen, weiterspinnen. Doch vornehmlich werden im Unterricht Imaginationsangebote an die Schüler herangetragen, die eine bestimmte Antwort erfordern, der Musik ein Sagen abpressen. Wolfgang Rihm wendet sich gegen diese „eindimensionale[n] Bilder“, die die Musik enteignen: „Musik wird enteignet. Wem gehört sie? 27 Zuletzt eigentlich dem Hörer. Dieser enteignet also sich selbst, wenn er die Musik mit Bildern flutet“ (Rihm 2002, S. 178). Musik wird enteignet, wenn es eben diese vorgeformten Fremdbilder der Fertiggerichte sind, die eine Musik fluten – Musik kann aber zu eigen werden, wenn Schüler ihren eigenen Bildern nachspüren und sie dabei gleichzeitig in ihrer Begrenztheit – in der Begrenztheit des perspektivischen Sehens überhaupt – erfahren dürfen. Reden über Musik: Unser täglich Brot gib uns heute? Robert Schumann sagt, dass Bach sein „täglich Brot“ sei, „an dem er sich erlabe“ (Schumann 1885, S. 279), dass er selbst „täglich vor Bach beichte, sich reinige und stärke“ (Schumann 1886, S. 151). Das tägliche Brot ist Metapher für das Leben schlechthin: Es bildet die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der körperlichen Existenz und wird damit Symbol für alles, was das Leben der Menschen ausmacht. Auch in der Brotbitte des christlichen „Vater unser“ ist dieser doppelte Aspekt mit enthalten. „Sein Brot verdienen“, heißt der säkularisierte und heute griffige Ausdruck dafür. Doch wird Musik nicht auch brotlos verstanden? Vollzieht sich Verstehen auch sprachlos, als „begriffslose Mitteilung“ (Eggebrecht 1995, S. 23) einer begriffslosen Kunst? Haben wir es nicht gerade Hans Heinrich Eggebrechts Zugang zu verdanken, dass dieses ästhetische Verstehen aus dem Schonraum bloßer Wahrnehmung in den Status des Verstehens gehoben wurde und so einen hohen Rang einnimmt? Müssen wir das, was sich in unserem Inneren konstituiert überhaupt noch in Brot verwandeln? Nicht nur Schüler erleben Musik, ohne dass jenes, was sich in ihrem Geist konstituiert, diesen Transformationsprozess durchschreiten müsste. Das gilt im Übrigen auch für die, die sich als ausübende Musiker professionell der brotlosen Kunst widmen und eine regelrechte Allergie gegen die begrifflichen Zudringlichkeiten der harten Letterseele musikalischer Analysen entwickelt haben. Das gilt für sprachlose Interpreten, aber auch für Komponisten, die sich über Musik ausschwiegen. Etwa für Arvo Pärt, dem Worte über Musik zu zudringlich erscheinen (Arvo Pärt in einer brieflichen Mitteilung an Wolfgang Gratzer: „Ich muß in mir Raum frei lassen für Musik, und wenn dieser mit Worten besetzt wird, bleibt mir kein Bedürfnis, mich mit Musik auszudrücken – und umgekehrt: wenn ich ein Musikwerk geschrieben habe, bleibt nichts mehr mit Worten übrig zu sagen.“ Vgl. Gratzer 2003, S. 335) oder Felix Mendelssohn Bartholdy, für den Musik stets ohne Worte auftritt und der – im Gegensatz zu Robert Schumann – „niemals ein Wort über Musik drucken ließ“ (Überliefert in: Dahlhaus 1988, S. 141). 28 Es scheint also genügend Anlass zu geben, sich derart fundamentalistisch auf den Unsagbarkeitstopos zu berufen und Musik in dieser Schweigezone zu belassen: Sich im Geheimnis zu wähnen, ohne zu fragen, in welchem, ist ein fauler Trick, von dem die Musik viel zu leiden gehabt hat und der, die bequeme Selbstverständlichkeit des Besitzens bestätigend, ihrer Neutralisierung viel Vorschub geleistet hat. Wer die Theoriefeindlichkeit sogenannter Praktiker kennengelernt hat, die in der Musik mehr als bei anderen Künsten sich mit einem abschottenden Professionalismus verbindet, kann ein Lied davon singen (Gülke 2001, S. 4). Dem Gerede über Musik wird im Musikunterricht längst das Musikmachen nicht nur an die Seite gestellt. Und dies gerade in Situationen der Aneignung und Vermittlung, in denen es um mehr gehen sollte, als einen mitgebrachten Besitz bequem zu bestätigen. Nachgedacht werden muss daher darüber, ob das Reden überhaupt noch täglich Brot des Musikunterrichts sein will – auch Robert Schumann schöpft sein täglich Brot nicht aus der Analyse einer Bachfuge, sondern aus dem eigenen Spiel, also aus seiner sinnlichen Begegnung mit Bach. Drei Äußerungen aus „Perspektiven zu einem brauchbaren Musikunterricht“ von Volker Schütz sollen zeigen, wie die Musikpädagogik – bei aller eingestandenen Notwendigkeit der sprachlichen Reflexion – mehr und mehr dazu übergeht, der Musik wortlos zu begegnen: Es gilt, Abschied zu nehmen von der unbefragten didaktischen Maxime, dass das Reden über Musik Wesentliches zur Erfahrung von Musik beitragen könne. Das Reden über Musik als wesentlichste Vermittlungsform eines (gymnasialen und gymnasial-orientierten) Musikunterrichts hat seine Wurzeln in der Methodik der historischen Musikwissenschaft (Schütz 1996, S. 3). Andererseits werden sich bei den musikbezogenen Interaktionsprozessen gewiss Fragen nach bestimmten handwerklichen Voraussetzungen stellen. […] Die Formen der Vermittlung wären zu diskutieren. Vielleicht bieten sich eingeschobene Phasen an, in denen man in kompakter Form und mit effektivsten Lernmethoden Wissensbestände aufbaut. Wichtig dabei ist, sich darüber im klaren zu sein, dass das so gespeicherte Wissen, nämlich vorrangig Wissen über musikalische Parameter, Formen, Kompositionsverfahren, geschichtliche Daten usw., nicht unabdingbare Voraussetzung für ästhetisch-musikalische Erfahrungen ist, sondern zunächst mal der besseren intersubjektiven Verständigung im Musikunterricht dienen soll (Schütz 1996, S. 5). 29 Die Stoßrichtung erscheint klar. Das Musikmachen soll vom Reden darüber separiert werden und manchmal bleibt dieses Reden auch gänzlich aus. Brot wird hier allenfalls als Beilage serviert, das Reden über Musik wird hier reduziert auf das, was dem unmittelbaren Musizieren dienlich ist, auf das Entwickeln einer sprachlichen Kompetenz, die eine Kommunikation in Probensituationen ermöglicht: Was die Möglichkeiten wissenschaftlicher Durchdringung angeht, ist etwa in der Literaturwissenschaft ein wesentlich genaueres Methodenbewusstsein zu erfahren. Es mag damit zu tun haben, dass Musik so sehr ans ‚Machen‘ gebunden ist, dass auch das Denken und Verstehen von Musik stärker ans ‚Handwerkliche‘ gebunden ist als in anderen Künsten. […] Die Schwierigkeit stellt sich allerdings dann ein, wenn vor lauter Handwerkswissen der Blick auf das spezifische ‚Mehr‘ der Emergenz verstellt wird (Noltze 2010, S. 256f). Die Gründe für eine derartig allergische Reaktion liegen auf der Hand: Praktisches Musizieren prallt gegen eine störende, theoretisierende Begrifflichkeit, die aus dem Weg geräumt werden möchte. Doch welche Potentiale gehen hier verloren, wenn Musik ohne Einsprüche der Worte austrocknet, wenn nicht ins Bewusstsein gehoben wird, was an ihr berührt oder vielleicht auch einmal im Wege steht? Natürlich ließe sich in diesem Zusammenhang auch einwenden, dass sich das „täglich Brot“ nicht ausschließlich wortsprachlich konstituieren muss. Jean Paul bezieht sich in seiner Vorschule der Ästhetik auf das Reservat der Dichtkunst, Lakoff und Johnson haben diese Brotverwandlungen in der Alltagssprache gesucht und gefunden. Brotverwandlungen des Geistes können sich auch in einem anderen Medium abspielen: Eine nonverbale Metaphorik über Musik zeigt sich in Bewegungsstudien, im Tanz oder in einer bildnerischen Gestaltung zur Musik. Es bedarf nicht einmal der Transposition in ein anderes Medium. Musik kann metaphorisch auch auf sich selbst Bezug nehmen, etwa als unmittelbarer parakompositorischer oder improvisatorischer Reflex auf eine musikalische Primärerfahrung. Musikalische Formung selbst lässt sich als ein metaphorischer Prozess beschreiben (Thorau, S. 109–124). Kunst ist eine Möglichkeit, die Welt – und auch andere Musik – metaphorisch in den Blick zu nehmen: „Vielleicht liegt der Wert der Musik darin: eine gute Metapher zu sein“ (Barthes 1990, S. 285). 30 Zum Abschluss: „Ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt“ (Joh. 4, 31) Zunächst scheint hier ein Lehrer seine geheimen Metiergeheimnisse zu rühmen. Sie sind Ausdruck einer Distanz, die den Wissenden im Musikunterricht vielleicht in besonderem Maße von seinen Schülern trennt. Dies ist allzu häufig auch im alltäglichen Geschehen spürbar, wenn ein Lehrer in wichtigtuerischer Weise diese in einer distanzierenden Sprache zur Schau stellt und so letztlich die kulinarischen Offenbarungen doch für sich behält: Der Schüler staunt dann über den vermuteten, ihm unzulänglichen begrifflichen Code, der nötig erscheint, um ein Werk zu entschlüsseln. Die zu verkündigende Botschaft soll jedoch allen zugänglich gemacht werden, schmecken und angenommen werden: „Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben“ (Joh 6,33). Metaphern sind mehr als nur Futter fürs Volk, weil die sprachliche Kost der Begriffe schwer verdaulich ist. Es sind vielmehr Worte, die durch ihre reflexive Anbindung glaubwürdig erscheinen: Sie bieten hier einen Schlüssel für eine Speise, die sich jenseits dieser Begriffe verortet, nähern sich der geheimnisvollen Speise des Unsagbaren, ohne dies anzurühren, auszusprechen und ermöglichen einen Ausblick auf das, was ohnehin nur vermutet werden kann. Und welchen Rat darf man nun den Unterrichtenden mit auf den Weg geben? Es geht nicht mehr primär darum, den Gegenstand nach seinen Vermittlungsqualitäten zu befragen oder im Vorfeld des Unterrichtes Horizonte für ein gemeinsames Lernen auszumachen. Die Schüler selbst sind es, die ihre Speise zubereiten: „Wer aber essen will, muss auch mit Hand anlegen“ (Nietzsche 1993, Bd. 4, S. 354). Derart konstruktivistische Zugänge fallen im Musikunterricht besonders schwer. Hier wird der Lehrende nicht nur mit einer allgemeinen Pädagogik und einer Fachdidaktik konfrontiert. Sein Unterrichten ist von viel tiefer liegenden Spuren geprägt. Von dem, wie er selbst Musiklernen in seinem Instrumentalunterricht als ausübender Musiker „im Sinne von ‚wer handelt, denkt nicht‘“ (Gülke 2001, S. 5) erfahren hat. Als Instrumentalist oder Sänger im Chor hat er sich führen und lenken lassen (müssen), um dann später als praktizierender Ensembleleiter das Lernen ebenso anzuleiten. Demokratische, selbstbestimmte Prinzipien sucht man hier vergebens. Vielleicht fällt es deshalb Musiklehrern besonders schwer, hier loszulassen und den Schülern ihre eigenen Wege beschreiten zu lassen. 31 Die große Kunst des Unterrichtens liegt nun darin, flexibel auf das schöpferische Potential der Lernenden und ihrer Metaphern zu reagieren. Allzu häufig schauen wir als Lehrer an dem verborgenen Wissen unserer Schüler vorbei und versäumen es, uns auf die Speise der Schüler einzulassen, um auf diese Weise die Klugheit, die in einer Metapher wurzelt, zum Vorschein zu bringen. Eine reichhaltige Sprache wird häufig reduziert auf das, was an begrifflicher Substanz vom Lehrer herausgelesen wird. Für den, der nur einen Hammer kennt, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Ein anspruchsvolles Unterfangen, das gerade beim Lehrer eine umfangreiche Ausrüstung und ein breit angelegtes Wissen erfordert, wenn Sprache nicht als konventionelles Bezeichnungsinstrument genutzt wird, sondern als Werkzeug erst zugerichtet werden soll, wenn Unterricht nicht bei der intuitiven, initialen Metapher stehen bleiben möchte: „Metaphern repräsentieren die Erfahrung, dass man in bestimmten Situationen nicht durch eine Tür kommt, wenn man die konventionalisierte Sprache starr wie einen Stock quer vor sich her trägt, sondern nur dann, wenn man diesen Stock auch mal zu drehen weiß“ (Köller 2004, S. 609). Die lebensweltlichen Bezüge müssen in diesem Unterricht nicht gesucht werden, sie kommen einem in den Metaphern der Schülerinnen und Schüler entgegen, wenn es gelingt, offene Unterrichtssituationen zu gestalten, in denen sprachliche Bilder nicht nur zugelassen, sondern ausdrücklich erwünscht sind. Dann verschmelzen – ganz im Sinne Jean Pauls – Geist und Materie, Ich und Welt, im Sinne einer weitgreifenden Synästhesie, die den „materielle[n] Geschmack und […] geistige[n] Geruch“ (Jean Paul 1990 [1804], S. 183) in der Metapher verbunden weiß. Hierzu bedarf es eines Unterrichts, in dem den Lernenden die Ernsthaftigkeit ihrer Bilder deutlich wird und sie sich nicht lediglich an die Kinderstube ihrer ästhetischen Bildung erinnert fühlen. Womöglich ist dieses Potential nicht an einem einzigen Beispiel erkennbar, einer reflektierten und vielleicht schriftlich gefilterten Metapher einer gereiften Schülerin in der klinischen Klausursituation. Vielleicht verdeutlichen dies eher Metaphern, die in spontanen, mündlichen Beiträgen geboren werden, in denen das Erleben der gehörten Musik mitschwingt. Hier sind es oft sehr eindrückliche Begegnungen, gerade dann, wenn man die Lebenskontexte der Schülerinnen und Schüler genauer kennt und diesen mitgebrachten Erfahrungen nun in ihren individuellen Zugängen, in ihrem ganz persönlichen Reden über Musik, nachspürt und auf diese Weise in der Metapher Spuren und Strukturen ihrer Lebenswelt erkennen darf. 32 Verwendete Literatur: ALLERT, Beate: Die Metapher und ihre Krise. Zur Dynamik der „Bilderschrift“ Jean Pauls. Frankfurt a. M. 1987 ARISTOTELES [Solon zugeschrieben]. Metaphysik. Nach der Übers. von Herman Bonitz. Hamburg 1995 BARTHES Roland: Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn. Frankfurt a. M. 1990 2 BLACK, Max: Die Metapher. In: Theorie der Metapher. Hrsg. von Anselm Haverkamp, Darmstadt 1996 , S. 55-79 CAVIOLA, Hugo: In Bildern sprechen. Wie Metaphern unser Denken leiten. Materialien zur fächerübergreifenden Sprachreflexion. Bern 2003 DAHLHAUS, Carl: „Lieder ohne Worte“. In: Ders., Klassische und romantische Musikästhetik. Laaber 1988 DEBATIN, Bernhard: Die Modellfunktion der Metapher und das Problem der „Metaphernkontrolle“. In: Eine Rose ist eine Rose … Zur Rolle und Funktion von Metaphern in Wissenschaft und Therapie. Hrsg. von Hans Julius Schneider, München 1996, S. 30–47 EGGEBRECHT, Hans Heinrich: Musik verstehen. München 1995 ERCKENBRECHT, Ulrich: Divertimenti. Wortspiele, Sprachspiele, Gedankenspiele, Göttingen 1999 FRIEDRICH, Hugo: Die Struktur der modernen Lyrik. Hamburg 1956 GECK, Martin: Wenn der Buckelwal in die Oper geht. 33 Wunder über die Wunder klassischer Musik. München 2009 GRATZER, Wolfgang: Komponistenkommentare. Beiträge zu einer Geschichte der Eigeninterpretation. Wien 2003 GÜLKE, Peter: Über Musik schreiben. In: Ders., Die Sprache der Musik. Essays über Musik von Bach bis Holliger. Kassel u. a. 2001, S. 4-7 GUSKI, Alexandra: Metaphern der Pädagogik. Metaphorische Konzepte von Schule, schulischem Lernen und Lehren in pädagogischen Texten von Comenius bis zur Gegenwart. Frankfurt a. M. 2007 HAMMERMEISTER, Kai: Kleine Systematik der Kunstfeindschaft. Zur Geschichte und Theorie der Ästhetik. Darmstadt 2007, S. 90. HANSLICK, Eduard: Vom Musikalisch-Schönen, Wiesbaden 1989 [1854] HERDER, Johann Gottfried: Sämtliche Werke. Hrsg. v. Bernhard Suphan, Bd. XXX, Berlin 1877–1913 HÖRISCH, Jochen: Theorie-Apotheke. Eine Handreichung zu den humanwissenschaftlichen Theorien der letzten fünfzig Jahre, einschließlich ihrer Risiken und Nebenwirkungen. Frankfurt a. M. 2010 INGENDAHL, Werner: Der metaphorische Prozeß. Methodologie zur Erforschung der Metaphorik. Düsseldorf 1971 JAIN, Anil K.: Medien der Anschauung. Theorie und Praxis der Metapher. München 2002. JEAN PAUL: Vorschule der Ästhetik. Hamburg 1990 [1804] JEAN PAUL: Sämtliche Werke in 10 Bänden. Hrsg. und kommentiert von Norbert Miller, München 1959ff JORGENSEN, Estelle R.: Pictures of Music Education. Bloomington and Indianapolis 2011 KAISER, Herbert: Jean Paul lesen, Versuch über seine poetische Anthropologie des Ich. Würzburg 1995 KOELSCH, Stefan, u. a.: Brain Indices of Music Processing. „Nonmusicians“ are musical. Journal of Cognitive Neuroscience, (3) 2000, S. 520–541 KOHL, Katrin: Metapher: Stuttgart 2007 KÖLLER, Wilhelm: Perspektivität und Sprache. Zur Struktur von Objektivierungsformen in Bildern, im Denken und in der Sprache. Berlin und New York 2004 4 LAKOFF, George, JOHNSON, Mark: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. Heidelberg 2004 LEMKE, Harald: Ethik des Essens. Eine Einführung in die Gastrosophie. Berlin 2007 LICHTENBERG, Georg Christoph: Sudelbücher. Hrsg. von Wolfgang Promies, Bd. 1, München 1968 MOHR, Georg: Transzendentale Ästhetik. In: Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von Georg Mohr und Marcus Willaschek, Berlin 1998, S. 107–130 NIERAAD, Jürgen: Bildgesegnet und bildverflucht. Forschungen zur sprachlichen Metaphorik. Darmstadt 1977 33 NIETHAMMER, Friedrich Immanuel: Streit des Philanthropinismus und Humanismus in der Theorie des ErziehungsUnterrichts unserer Zeit [1808]. In: Ders.: Philanthropinismus – Humanismus. Texte zur Schulreform. Bearb. von W. Hillebrecht, Weinheim 1968, S. 79–359 NIETZSCHE, Friedrich: Also sprach Zarathustra. In: Ders.: Kritische Studienausgabe in 15 Bänden: Hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 4, München 1993 3 NOLTZE, Holger: Die Leichtigkeitslüge. Hamburg 2010 OBERHOFF, Bernd: Rachmaninoffs Klavierkonzert Nr. 3, 1. Satz: Eine Erinnerung an das Unerinnerbare. In: Das Unbewusste in der Musik, hrsg. von Bernd Oberhoff, Gießen 2007, S. 37–58 OBERSCHMIDT, Jürgen: Metaphorischer Sprachgebrauch im Unterricht. Überlegungen zur Evaluierung der Schülersprache. In: Evaluationsforschung in der Musikpädagogik, hrsg. von Niels Knolle, Essen 2010, S. 131–154 OBERSCHMIDT, Jürgen: Mit Metaphern Wissen schaffen. Erkenntnispotentiale metaphorischen Sprachgebrauchs im Umgang mit Musik. Augsburg 2011 OBERSCHMIDT, Jürgen: „Ein bewegliches Heer von Metaphern“ – Betrachtungen zum metaphorischen Sprechen im Musikunterricht im Anschluss an Nietzsches erkenntnistheoretischer Skepsis. In: Reden über Kunst. Projekte und Ergebnisse aus der fachdidaktischen Forschung zu Musik, Kunst, Literatur. Hrsg. von Johannes Kirschenmann, Christoph Richter und Kaspar H. Spinner, München 2011, S. 491–506 RICŒUR Paul. Die Metapher und das Hauptproblem der Hermeneutik. In Theorie der Metapher, hrsg. von Anselm 2 Haverkamp, Darmstadt 1996 , S. 356–375 RIHM, Wolfgang: Offene Enden. Denkbewegungen um und durch Musik. München 2002 RÖTTGERS, Kurt: Kritik der kulinarischen Vernunft. Ein Menü der Sinne nach Kant. Bielefeld 2009 SAILER-WLASITS, Paul: Die Rückseite der Sprache. Philosophie der Metapher. Wien 2003 SCHERING, Arnold: Beethoven in neuer Deutung, Leipzig 1934 SCHERING, Arnold: Beethoven und die Dichtung, Berlin 1936, Nachdruck Hildesheim 1973 SCHUETZ, Volker: Welchen Musikunterricht brauchen wir?. Teil 1: Einige Voraussetzungen. In: AfS-Magazin 1/1996, S. 3-8 SCHUETZ, Volker: Welchen Musikunterricht brauchen wir?. Teil 2: Perspektiven eines brauchbaren Musikunterrichts. In: AfS-Magazin, 2/1997, S. 3–10 SCHUMANN, Robert: Jugendbriefe. Hrsg. von Clara Schumann, Leipzig 1885 SCHUMANN, Robert: Briefe. Neue Folge. Hrsg. von G. Jansen, Leipzig 1886 THORAU, Christian: Metapher und Variation. Zur referenztheoretischen Grundlegung musikalischer Metaphorizität. Zeitschrift für Semiotik, 25 (1–2), S. 109–124 TIECK, Ludwig: Die Gemälde. Schriften. Berlin 1852, Bd. 17 VON DER LÜHE, Astrid: Art. „schmecken“. In: Wörterbuch der philosophischen Metaphern. Hrsg. von Ralf Konersmann, Darmstadt 2007, S. 340–355 VOß, Reinhard: Die neue Lust auf Unterricht und das Wissen, sich auf eine „Ungemütliche“ Sache einzulassen. In: Unterricht 2 aus konstruktivistischer Sicht. Die Welten in den Köpfen der Kinder. Hrsg. von Reinhard Voß, Weinheim 2005 , S. 8–13 WEINREICH, Harald: Sprache in Texten. Stuttgart 1976 WILDE, Oscar: Vera, or The Nihilists. Stilwell 2006 WILLER, Stefan: Art. Metapher/metaphorisch. In: Ästhetische Grundbegriffe. Hrsg. von Karlheinz Barck et al., Stuttgart 2005, Bd. 7 WOLF Werner: Das Problem der Narrativität in Literatur, Bildender Kunst und Musik. Ein Beitrag zu einer intermedialen Erzähltheorie. In: Erzähltheorie transgenerisch, intermedial, interdisziplinär, hrsg. von Vera Nünning u. Ansgar Nünning, Trier 2002, S. 23-104 34 ZIMMERMANN, Ruben: Bildersprache verstehen. Zur Hermeneutik der Metapher und anderer bildlicher Sprachformen. München 2000