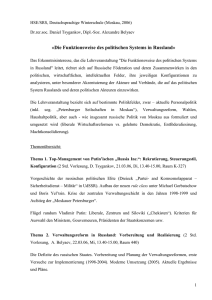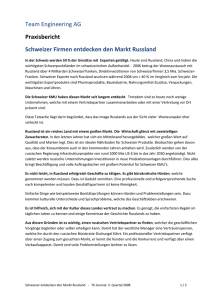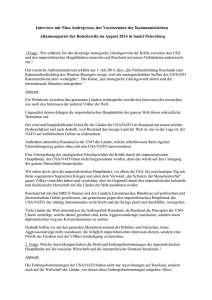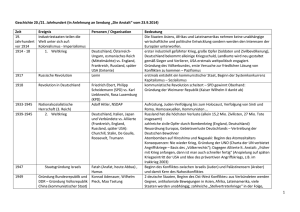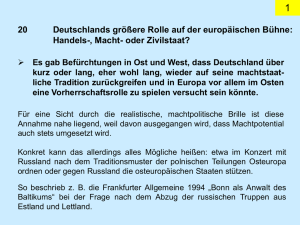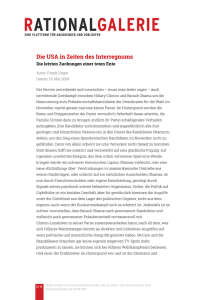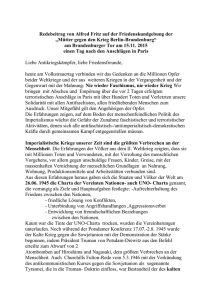Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen 31 - Hanns
Werbung

Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen 31 Stephan G. Bierling/ Reinhard C. Meier-Walser (Hrsg.) Die Clinton-Präsidentschaft – ein Rückblick Hanns Seidel Stiftung Akademie für Politik und Zeitgeschehen Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen 31 Stephan G. Bierling Reinhard C. Meier-Walser (Hrsg.) Die Clinton-Präsidentschaft – ein Rückblick ISBN 3 - 88795 - 239 - 1 © 2001 Hanns-Seidel-Stiftung e.V., München Akademie für Politik und Zeitgeschehen Verantwortlich: Dr. Reinhard C. Meier-Walser (Chefredakteur) Redaktion: Wolfgang D. Eltrich M.A. (Redaktionsleiter) Barbara Fürbeth M.A. (stv. Redaktionsleiterin) Verena Hausner (Redakteurin) Christa Frankenhauser (Redaktionsassistentin) Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Redaktion reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Inhaltsverzeichnis Reinhard C. Meier-Walser Einführung......................................................................................................................... 5 Howard Rosen Aktuelle Wirtschaftstrends in den Vereinigten Staaten..................................................... 9 Stephan G. Bierling Das Ende des langen Booms? Die amerikanische Wirtschaft unter Bill Clinton und George W. Bush................................................................................... 27 Edwina S. Campbell Die Präsidentschaft Clintons im Rückblick: die transatlantischen Beziehungen............ 35 Beate Neuss Die transatlantischen Beziehungen in der Ära Clinton................................................... 43 Lothar Rühl Die Russlandpolitik der Clinton-Administration............................................................. 51 Hannes Adomeit Russisch-amerikanische Beziehungen: von "strategic partnership" zu "strategic patience".......................................................................................................... 77 Gary C. Jacobson Bill Clinton und die Wahlen des Jahres 2000 ................................................................. 93 Peter Lösche "Europäisierung" amerikanischer Wahlen?................................................................... 119 Autorenverzeichnis ........................................................................................................ 127 5 Reinhard C. Meier-Walser Einführung Nachdem er sich im Rennen um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika erfolgreich gegen Amtsinhaber George H.W. Bush durchgesetzt hatte, begann Bill Clinton seine Amtszeit im Frühjahr 1993 mit einem weit reichenden und ambitionierten Programm: Das Gesundheitssystem sollte umfassend reformiert, die Wirtschaft angekurbelt und die amerikanische Außenpolitik in Richtung Förderung von Demokratie und Marktwirtschaft akze ntuiert werden. Rückblickend betrachtet fällt eine Bilanz der Leistungen der Clinton-Administration ambivalent aus: Auf der einen Seite stehen unbestreitbare Erfolge im US-amerikanischen Wir tschaftsleben sowie hohe Popularitätsraten des Präsidenten, die Clinton ein beeindruckendes Ergebnis bei seiner Wiederwahl im Jahre 1996 bescherten. Auf der anderen Seite finden sich Rückschläge in der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik, diverse gescheiterte Reformprojekte im Inneren, der Verlust der Mehrheit der Demokraten in beiden Häusern des US-Kongresses sowie der Schaden, den die Lewinsky-Affäre dem Präsidentenamt zufügte. Die Bilanz der Leistungen der Clinton-Administration stand auch im Mittelpunkt eines außenpolitischen, deutsch-amerikanischen Symposiums, das von der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Stephan Bierling von der Universität Regensburg durchgeführt wurde, und aus dem die Beiträge dieser Publikation hervorgegangen sind. In den Beiträgen von Howard Rosen und Stephan Bierling zeigt sich sowohl die Dynamik und Nachhaltigkeit des US-amerikanischen Wirtschaftsbooms in den 1990er-Jahren als auch die diesbezügliche wechselseitige Beeinflussung volkswirtschaftlicher Veränderungen und politischer Weichenstellungen. Rosen, dessen Untersuchungszeitraum mit dem Ende der Amtszeit Clinton endet, stellt die beeindruckenden Daten der längsten wirtschaftlichen Expansionsperiode in der Geschichte der Vereinigten Staaten mit einem jährlichen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,5 Prozent erläuternd dar und bilanziert: "Die Volkswirtschaft der USA genießt momentan ein solides Wachstum, eine Inflationsrate auf stabil niedrigem Niveau und geringe Arbeitslosigkeit." Aus anderer Perspektive beleuchtet Stephan Bierling die wirtschaftliche Entwicklung, indem er seine Analyse des langen Booms der 90er-Jahre mit der Situation der US-amerikanischen Wirtschaft während der ersten Amtsmonate von Clintons Nachfolger George W. Bush kontrastiert. Bierling rechnet vor, dass der Budgetüberschuss für das am 30. September 2001 zu Ende gegangene Fiskaljahr 2000/2001, der ursprünglich auf fast 300 Milliarden Dollar veranschlagt war, sowohl wegen der seit Monaten lahmenden Konjunktur als auch infolge der Steuerrückerstattung der Bush-Administration und schließlich auf Grund des 40-MilliardenDollar-Sonderausgaben-Paketes nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington auf 121 Milliarden Dollar geschrumpft ist. Obwohl der US-Haushalt 2001 zum ersten Mal seit vier Jahren wieder rote Zahlen schreiben wird, hält Bierling es dessen ungeachtet für wahrscheinlich, dass die US-Wirtschaft schon bald wieder auf einen Wachstumskurs einschwenken werde. "Auch nach den Terroranschlägen bleibt das ökonomische Fundament der Vereinigten Staaten solide." 6 Mit der Entwicklung der transatlantischen Beziehungen in der Ära Clinton befassen sich die Beiträge von Edwina S. Campbell und Beate Neuss. Die amerikanische Sicherheitsexpertin legt ihrer Analyse einen systemischen Ansatz zu Grunde und konzentriert sich auf Grund der starken verhaltenssteuernden Kräfte des internationalen politischen Systems in der Folge des Endes des Ost-West-Konfliktes vor allem auf die exogenen Beeinflussungsfaktoren der US-amerikanischen Außenpolitik gegenüber den europäischen Partnern. Jeder 1992 ins Amt gewählte amerikanische Präsident hätte mit der "Definition der neuen Rolle der Vereinigten Staaten in der Welt zu kämpfen gehabt". Die Haltung der Clinton-Administration gegenüber Europa sei, so Campbell, vor dem Hintergrund einer in Washington verbreiteten negativen Meinung über die politische und militärische Leistung der Europäischen Union zu interpretieren. Während der ersten Amtszeit Bill Clintons hätte die amerikanische Regierung vor dem Hintergrund der neuen weltpolitischen Situation eher dazu tendiert, ihre weltweiten Engagements zu reduzieren und die Europäer zu verpflichten, die Krisen in ihrem "Hinterhof" selbst zu bewältigen. Allmählich sei jedoch (nicht zuletzt im Verlauf der Bosnien-Krise) die Befürchtung gewachsen, dass auf Grund der sicherheitspolitischen Defizite der EU ein politisch-militärisches Vakuum in Europa drohe, wenn die USA nicht die Führungsrolle übernehmen würden. Dies hätte letztlich zu der Erkenntnis in Washington geführt, dass die USA die einzige und "unentbehrliche" Supermacht zu bleiben hätten – ein Umstand, der sich 1999 darin manifestierte, dass "die USA den Luftkrieg gegen Belgrad fast im Alleingang führten". Auch Beate Neuss sieht in den Veränderungen der internationalen Politik zu Beginn der 90erJahre weichenstellende Beeinflussungsfaktoren der transatlantischen Beziehungen in der Ära Clinton. "Die veränderte machtpolitische Situation und die Suche nach neuen Kooperationsformen führte auf beiden Seiten des Atlantiks zu Zielkonflikten und Widersprüchlichkeiten, die ihrerseits wiederum Anlass zu transatlantischen Friktionen gaben." Insofern sind nicht nur die bereits von Edwina Campbell angesprochenen Ambivalenzen im sicherheitspolitischen Gefüge der Atlantischen Allianz (etwa die argwöhnische Haltung der USA gegenüber den verteidigungspolitischen Anstrengungen der EU), sondern auch die von Beate Neuss explizit erwähnten transatlantischen Zankäpfel mit wirtschafts- bzw. handelspolitischem Hintergrund (z.B. "Bananenstreit", "Hormonstreit" etc.) auf die epochale Zäsur der Weltpolitik zurückzuführen. Beiden Seiten des Atlantiks wurde während der Amtszeit Bill Clintons "zunehmend bewusst, dass nach dem Ende der Bedrohung durch die Sowjetunion amerikanische und europäische Interessen nicht mehr selbstverständlich identisch sind". Lothar Rühl und Hannes Adomeit untersuchen das Beziehungsgefüge US-amerikanischrussischer Beziehungen in der Ära Clinton. In der Analyse Rühls spiegelt sich die Problematik der Einbeziehung Russlands in die strategischen Neuorientierungen der westlichen Allianz. Hatte die grundlegende Maxime der NATO während des Kalten Krieges darin bestanden, die Sowjetunion und den Warschauer Pakt von einem Angriff gegen den Westen abzuhalten, stellte sich nach dem Ende der OstWest-Konfrontation die Aufgabe der Schaffung einer gesamteuropäisch-atlantischen Sicherheitsarchitektur, wobei auch Russland unter noch zu klärenden Modalitäten angebunden werden sollte. Rühl untersucht neben den Fragen der Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nonproliferation deshalb vor allem die während der 90er-Jahre die amerikanisch-russischen Beziehungen überschattenden Problembereiche der NATO-Osterweiterung und der Balkan-Politik der NATO. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die Clinton-Administration angesichts der gewaltigen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen für die USA die "nahezu nicht handhabbaren Probleme des Umgangs mit Russland gut behandelt und so weit wie möglich unter Kontrolle gehalten" hat. Vor dem Hintergrund der sich dynamisch verändernden und kaum kalkulierbaren internationalen Situation, aber auch angesichts der "chaotischen inneren Lage Russlands mit den eklatanten Defiziten an Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, 7 Ordnung, Verlässlichkeit und Effizienz der Regierung unter der Präsidentschaft Jelzins, aber auch unter der Führung Putins im letzten Clinton Jahr konnte kein externer Partner Moskaus ein besseres Ergebnis erzielen". Hannes Adomeit, dessen Ausführungen als ergänzende Kommentierung der Analyse der russisch-amerikanischen Beziehungen Lothar Rühls zu verstehen sind, zeigt in seiner Betrachtung der innerrussischen Auseinandersetzungen um den außenpolitischen Kurs Moskaus, dass bereits vor dem Amtsantritt Präsident Clintons sich die russisch-amerikanischen Beziehungen von einer "strategischen Partnerschaft" entfernt und stattdessen zu einem "MischungsVerhältnis aus kooperativen und konfrontativen Elementen" hin entwickelt hätten. Wenngleich er im Zusammenhang mit dem Scheitern einer echten Partnerschaft zwischen Moskau und Washington im weiteren Verlauf der 90er-Jahre die USA nicht völlig freispricht, so macht er dafür doch vor allem den in den außen- und sicherheitspolitischen Eliten Moskaus entstandenen "patriotischen Konsens" dafür verantwortlich. "Im Wesentlichen", so Adomeit, liegen die "Gründe für die Verschlechterung der russisch-amerikanischen Beziehungen unter den Präsidenten Clinton und Jelzin in der inneren Entwicklung Russlands." Mit Blick auf die auch im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 2000 gestellte Frage, ob die Clinton-Administration durch eine falsche Russland-Politik mitverantwortlich dafür sei, dass Russlands Reformprozesse (Demokratie, Marktwirtschaft, Zivilgesellschaft etc.) weit langsamer als im Westen erhofft vorangekommen sind, warnt Adomeit vor einseitigen Schuldzuweisungen. Es sei keineswegs sicher, dass höhere amerikanische Wirtschafts- und Finanzhilfen die innere Entwicklung in Russland wesentlich verändert hätten. "Denn wenn es der politischen Klasse am Willen und der Fähigkeit fehlt, Reformmaßnahmen energisch durchzusetzen und der rechtsstaatliche Rahmen für Inlands- und Auslandsinvestitionen nicht vorhanden ist", dann sei es wahrscheinlicher, dass die Gelder "nicht für dringend notwendige Entwicklungsprojekte im eigenen Land genutzt", sondern "auf Bankkonten im Ausland" landen wü rden. Im Mittelpunkt der Beiträge von Gary C. Jacobson und Peter Lösche stehen die amerikanischen Präsidentschaftswahlen vom 7. November 2000, die erst nach fünfwöchigem Tauziehen um die Stimmenauszählung in Florida zu einem endgültigen Ergebnis führten. Zur Überraschung vieler Beobachter auch diesseits des Atlantiks unterlag bei dieser Entscheidung der demokratische Bewerber und amtierende US-Vizepräsident Al Gore Jr., trotz Amtsbonus und hohem Bekanntheitsgrad und ungeachtet gewaltiger US-amerikanischer Haushaltsüberschüsse, hoher Wachstumsraten und geringer Arbeitslosigkeit, dem republikanischen Kandidaten George W. Bush. In seiner Analyse des Wahlergebnisses und seiner Hintergründe kommt Gary C. Jacobson zu dem Ergebnis, dass verschiedene Merkmale der Wahlentscheidung eine Fortsetzung von Trends der Ära Clinton darstellten und insofern "Bill Clintons Handschrift erkennen" ließen. "Auch wenn Clinton nicht immer die treibende Kraft hinter diesen Entwicklungen war, agierte er doch als eine Art Katalysator, und löste Veränderungen aus, die bereits seit längerem anstanden." Ungeachtet dessen weist Jacobson in Bezug auf die Frage, ob Clintons Verhalten oder Gores Ungeschick in stärkerem Ausmaß für den Wahlausgang zu Ungunsten der Demokraten verantwortlich waren, darauf hin, dass Gores Wahlkampf zwar von den Skandalen Clintons nicht unbeeinflusst geblieben, Gore letzten Endes jedoch selbst schuld gewesen sei . "Gores Versagen, sein bestes Zugpferd – die durch die Regierung Clinton stark verbesserte Volkswirtschaft – effektiv einzusetzen, war mehr als alles andere für seine Wahlniederlage ausschlaggebend." Dies, so Jacobson, erkläre auch, warum alle Prognosemodelle, "die auf Wirtschaftswachstum und die Popularität des Präsidenten zur Vorhersage des Wahlausgangs setzten, mit ihren Ankündigungen eines bequemen Gore-Sieges falsch lagen". 8 Die Untersuchung von Peter Lösche, der der Analyse Jacobsons prinzipiell zustimmt, konzentriert sich auf die Frage, ob die amerikanischen Präsidentschaftswahlen vom November 2000 Veränderungen in den Tiefenstrukturen amerikanischer Politik bedeuten, die auch im Hinblick auf künftige Wahlkämpfe und -entscheidungen in Europa von Bedeutung sind. Konkret geht Lösche der Frage nach, ob die in Europa gängigen Stereotype amerikanischer Wahlen (zunehmende Personalisierung der Wahlkämpfe; wachsende Volatilität der Wählerschaft) mit der Realität übereinstimme. Das Ergebnis der Betrachtung ist erstaunlich, zumal es die diesseits des Atlantiks verbreiteten Vorstellungen amerikanischer Wahlen ad absurdum führt: "Politische Inhalte haben im Wahlkampf und bei der Wahlentscheidung eine ganz zentrale, auf jeden Fall größere Rolle als die Persönlichkeit des Kandidaten gespielt." Auch die weichenstellende Volatilität der Wählerschaft kann Lösche nicht bestätigen: "Wahlverhalten ist selbst in den Vereinigten Staaten von Kontinuität und Stabilität bestimmt." So kommt der Autor schlussfolgernd zu der originellen Empfehlung, angesichts der offensichtlichen Fehldiagnose einer "Amerikanisierung" Europas eher nach einer "Europäisierung" der Vereinigten Staaten zu fragen. 9 Howard Rosen Aktuelle Wirtschaftstrends in den Vereinigten Staaten 1. Die längste wirtschaftliche Expansionsperiode in der Geschichte der Vereinigten Staaten Die Volkswirtschaft der USA genießt momentan ein solides Wachstum, eine Inflationsrate auf stabil niedrigem Niveau und geringe Arbeitslosigkeit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wächst ununterbrochen seit 110 Monaten und macht damit die gegenwärtige Expansionsperiode zur längsten je da gewesenen. Zwischen 1992 und 1999 lag das inflationsbereinigte Wachstum des BIP ungefähr bei 3,5 Prozent jährlich. (oben: reales BIP-Wachstum; links: Prozent) Quelle: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Nachdem er mehr als 20 Jahre lang immer wieder zurückgegangen war und stagniert hatte, steigt der reale Durchschnittswochenlohn seit 1993 wieder. Während der vergangenen sechs Jahre sind die inflationsbereinigten durchschnittlichen Wochenlöhne um über 6 Prozent gestiegen. Trotz dieses Wachstums liegt der reale Durchschnittswochenlohn jedoch erst wieder in etwa auf dem Niveau von 1986 und noch immer um 14 Prozent unter dem Höchststand von 1973. Das heißt, es konnte zwar die Stagnation der realen Durchschnittslöhne aufgehoben werden, doch um den seit Mitte der 1970er-Jahre erfolgten Rückgang wieder wett zu machen, bedarf es sehr viel mehr. Angenommen, die Löhne steigen weiterhin so schnell wie während der vergangenen sechs Jahre, wird es weitere 14 Jahre dauern, bis sie wieder ihr Niveau von 1973 erreichen. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote auf den Monat gerechnet lag 1999 bei 4,2 Prozent – dem tiefsten Stand seit 30 Jahren. Im Zeitraum zwischen 1992 und 1999 wurden in der Wirtschaft über 20 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Der Löwenanteil der neuen Arbeitsplätze entstand im Dienstleistungsbereich (18 Millionen); im Bausektor konnten 1,8 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Auch im Bereich der verarbeitenden Industrie entstanden seit 1992 fast 330.000 Arbeitsplätze, trotz merklicher Einbußen während der beiden vergangenen Jahre auf Grund des Verlustes von Exportmärkten und dem starken Anstieg der Importe infolge der Finanzkrise in Asien. 10 (oben: Arbeitslosenquoten; links: Prozent; Beschriftung der Kurven v.o.n.u.: Schwarze, Hispano-Amerikaner, gesamt) Quelle: Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. Auf Grund der Knappheit des Angebots an Arbeit Suchenden verbesserten sich nach ja Arbeitsplatz. Die Arbeitslosenquote unter den Schwarzen lag 1999 bei 8 Prozent, gefallen von einem Höchststand von mehr als 14 Prozent im Jahre 1992. Auch die Arbeitslosigkeit unter den Hispano-Amerikanern ging von ungefähr 11,5 Prozent 1992 auf etwa 6,5 Prozent 1999 zurück. Es handelt sich dabei um die niedrigsten Arbeitslosenquoten unter den Angehörigen von Minderheiten seit die Regierung im Jahre 1973 begann, diese Daten aufzuzeichnen. (oben: durchschnittlicher Wochenlohn, inflationsbereinigt; links: in Dollar zum Wert von 1982) Quelle: Department of Labor (BLS). Diese Leistung zeigt sich auch in anderen Bereichen bzw. Daten des Arbeitsmarktes. Die Anzahl entmutigter Arbeitsloser – also jener, die sich nicht mehr aktiv um einen Arbeitsplatz bemühen, da sie nicht erwarten, einen zu finden – fiel von 7 Millionen im Jahre 1994 auf 4,3 Millionen im Januar 2000. Der Anteil solcher entmutigter Arbeitsloser an der Gruppe nicht 11 erwerbstätiger Personen ging von 10 Prozent im Jahre 1994 auf 6 Prozent im Januar 2000 zurück. Trotz der geringen Arbeitslosigkeit konnte die Inflation während des gesamten Zeitraumes der wirtschaftlichen Expansion im Zaum gehalten werden. 1999 war die Kerninflation – der Preisanstieg bzw. die Veränderung der Preise für Waren und Güter mit Ausnahme von Nahrungsmitteln und Energie – auf dem niedrigsten Stand seit 1965 angelangt. Obwohl die Energiepreise vor kurzem wieder angezogen haben, weist nichts darauf hin, dass während des Jahres 1999 und dem Frühjahr 2000 die Preise auf Grund der starken Wirtschaftsleistung allgemein angestiegen wären. Von Dezember 1999 bis Februar 2000 verzeichneten die Energiepreise einen Anstieg von aufs Jahr gerechnet 3,4 Prozent, während die Kerninflation während desselben Zeitraums nur 1,8 Prozent jährlich betrug. Über das gesamte Jahr 1999 blieb die Inflation gering, bei unter 3 Prozent, während die Konsumausgaben um 5,5 Prozent anwuc hsen. Bis heute gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass die niedrige Arbeitslosenquote, der kürzliche Anstieg der Löhne und Gehälter sowie das Wachstum der Konsumausgaben die Inflationsrate nach oben getrieben hätten. (oben: Veränderung der Verbraucherpreise; links: Veränderung in Prozent) Quelle: Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. Core rate of inflation, calculated year to year. In den vergangenen Jahren stiegen die Löhne und Gehälter schneller als die Preise für Waren und Dienstleistungen, was eine echte Verbesserung des Lebensstandard darstellt. Zusätzlich verbesserte sich durch die neuesten technologischen Fortschritte auch die Qualität der meisten Produkte. Beispielsweise kostete ein Fernsehgerät mit einem ca. 50cm-Bildschirm 1973 439 USD. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer musste etwa 2,5 Wochen arbeiten, um sich so einen Fernseher kaufen zu können. Heute kostet ein qualitativ deutlich hochwertigeres Fernsehgerät derselben Größe nur noch 270 USD und ein durchschnittlicher Arbeitnehmer kann diese Geldsumme in knapp zwei Tagen verdienen. Der Preis von Fernsehgeräten ist also gefallen, während sich deren Qualität verbessert hat, und der Anstieg der Löhne und Gehälter machte Fernsehgeräte obendrein noch erschwinglicher. Auch Nahrungsmittel und andere grundlegende Verbrauchsgüter sind vergleichsweise günstiger geworden. Beispielsweise zahlte eine in San Jose, Kalifornien, lebende, vierköpfige 12 Familie im Jahre 1983 für einen Korb ausgewählter Waren 100,83 USD. 1 Dieser Betrag lag leicht über einem durchschnittlichen Tagesverdienst. Im Vergleich dazu kostete derselbe Warenkorb 1997 124,12 USD, doch da die Löhne und Gehälter schneller gestiegen waren als die Preise, entsprach dieser Betrag ungefähr dem Verdienst eines guten halben Tages. Am stärksten wuchs die Kaufkraft der Konsumenten während der 1990er-Jahre. Der gege nwärtige Aufwärtstrend verbesserte die Aussichten aller Erwerbstätigen auf einen Arbeitsplatz und hielt den langsamen Verfall des Lebensstandards der Mittelklasse auf, der sich während der 1970er- und 1980er-Jahre eingestellt hatte. Die wahrscheinlich bedeutendste wirtschaftliche Entwicklung der 1990er-Jahre war der Ausgleich des bundesstaatlichen Haushaltsdefizits. Eine Kombination aus Haushaltsdisziplin und robustem Wirtschaftswachstum führte dazu, dass nach 40 Jahren ständigen Defizits in zwei aufeinander folgenden Jahren sogar ein Haushaltsüberschuss erwirtschaftet werden konnte. Der 1998 erzielte Überschuss diente als Beweis dafür, dass es durch die in den vorangega ngenen sechs Jahren verfolgte politische Linie erfolgreich gelang, die aus den "Reagonomics" – der Wirtschaftspolitik Reagans – entstandenen Haushaltslöcher zu stopfen. Zu Beginn der 1980er-Jahre sorgten massive Steuererleichterungen für Unternehmen und die wohlhabenden Amerikaner zusammen mit einem Anstieg der Verteidigungsausgaben für enorme Haushaltsdefizite, die das gesamte Jahrzehnt und bis in die 1990er-Jahre hinein anhielten. Das Haushaltsdefizit erreichte 1983 mit einer Höhe von 6 Prozent der gesamten nationalen Wirtschaftsleistung seinen höchsten Stand seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Vom Ende der 1980er-Jahre bis ins Jahr 1992 kämpfte die Wirtschaft außerdem nicht nur mit der Last der Defizite, sondern auch mit einer allgemeinen Flaute. Die Führungskraft des Präsidenten und die Bemühungen der Demokratischen Partei um das 1993 verabschiedete Haushaltsgesetz – Omnibus Budget Reconciliation Act –, das von keinem Republikaner unterstützt wurde, führten zusammen mit einem gesunden Wirtschaftswachstum während der 1990erJahre zu einem Rückgang und schließlich 1998 zu einem völligen Ausgleich des Haushaltsdefizits. Federal Budget Deficits/Surpluses 200 Surplus Billions of Dollars 100 0 Deficit -100 -200 -300 -400 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 Quelle: Office of Managment and Budget. 1 In diesem Warenkorb befinden sich 4 Laibe Brot (einer pro Woche), 4 Pfund Bratenfleisch, 4 Pfund Huhn, 4 Dutzend Eier (ein Dutzend pro Woche), 16 Pfund Äpfel (4 Pfund pro Woche), 1 Pfund Kaffee und 24 Gallonen (knapp 91 Liter) Benzin (12 Gallonen für jeweils zwei Wochen). 13 Seit 1981 haben die Amerikaner über 2 Billionen USD an Zinsen gezahlt, die sich für die zwischen 1981 und 1992 zusätzlich gemachten Schulden angehäuft hatten. Umgerechnet bedeutet dies, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in den vergangenen 19 Jahren ungefähr 500 USD jährlich dafür berappen musste. Die Ansammlung des Haushaltsdefizits während der 1980er-Jahre erlegte den Amerikanern eine schwere Last auf, nicht zuletzt, da ihre Löhne und Gehälter zu dieser Zeit stagnierten. Die in der Zukunft zu meisternde Herausforderung heißt die zu Beginn der 1980er-Jahre begangenen Fehler nicht zu wiederholen, sondern weiterhin Haushaltsdisziplin zu üben und die Investitionstätigkeit und das wirtschaftliche Wachstum voranzutreiben. Was treibt die Expansion voran? Der wichtigste Faktor, der zum in den letzten Jahren erfolgten Anstieg der Löhne und Gehä lter beitrug, sind höhere Produktivitätswachstumsraten. Ein steigendes Produktivitätswachstum ermöglicht gleichzeitig ein Wachstum der Löhne und Gehälter und anhaltend niedrige Arbeitslosigkeit sowie geringe oder sogar keine Inflation. Um den Arbeitnehmern den größten Nutzen zu bringen, sollte das Produktivitätswachstum natürlich auf einem wirklichen Anstieg der Produktion und des Verdiensts beruhen, nicht auf der Entlassung von Mitarbeitern durch die Firmen. Die Herausforderung besteht daher darin, gleichzeitig hohe Produktivitätssteigerungsraten und niedrige Arbeitslosenquoten zu erzielen. Dies ist momentan in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten der Fall. Zwischen 1973 und 1995 lag das durchschnittliche Produktivitätswachstum bei mageren 1,4 Prozent pro Jahr. Gleichzeitig fielen die realen Durchschnittswochenlöhne um 1 Prozent jährlich. Im Gegensatz dazu hat sich seit 1995 die durchschnittliche jährliche Produktivitätssteigerung verdoppelt, die Arbeitslosenquote ist gesunken und die inflationsbereinigten Durchschnittslöhne und -gehälter sind um über 1,5 Prozent jährlich gestiegen. (oben: Produktivität; links kann so stehen bleiben; Beschriftung links oben: 1,4 Prozent durchschnittliches Wachstum 1973-1995; Beschriftung rechts unten: 2,9 Prozent durchschnittliches Wachstum 1995-1999) Quelle: Department of Commerce (Bureau of Economic Analysis) and Department of Labor (BLS). 14 Dieser bemerkenswerte Anstieg der Produktivität wirft mehrere Fragen auf. Vor allem: Stehen wir vor einer langfristigen Veränderung der Produktivitätssteigerungsraten oder ha ndelt es sich bei dieser Erscheinung nur um eine Eintagsfliege? Welcher Anteil an der Verbesserung der Produktivität ist neuen technologischen Fortschritten zuzuschreiben? Zu welchem Grad ist die vorliegende Verbesserung auf wirtschaftszyklische Faktoren zurückzuführen? In seinem aktuellen Jahresbericht an den Präsidenten hebt der Rat der Wirtschaftsberater (Council of Economic Advisors) die Tatsache hervor, dass die gegenwärtigen Produktivitätswachstumsraten für eine bereits so lange andauernde wirtschaftliche Expansion ziemlich uncharakteristisch hoch sind. Historisch neigt die Produktivität während eines konjunkturellen Rückgangs zu starkem Wachstum, da die Unternehmen Beschäftigte entlassen und Kosten einsparen, bleibt während der Anfangsphase wirtschaftlicher Erholung auf hohem Niveau und geht dann zurück. Die anhaltend hohe Produktivitätssteigerung zu einem so späten Zeitpunkt des wirtschaftlichen Aufschwungs weist darauf hin, dass die Verbesserung der vergangenen Jahre keinesfalls auf zyklische Gegebenheiten zurückzuführen ist. Auf dem High-Tech-Gipfel des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses (Joint Economic Committee) bekundeten Alan Greenspan, der Präsident der US-Notenbank, die Vorstandsvorsitzenden von IBM, Intel und Microsoft, der Präsident des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Vorsitze nde der Gewerkschaft der in der amerikanischen Telekommunikationsindustrie Beschäftigten (Communications Workers of America) allesamt, dass die kürzlich erzielten Neuerungen im Technologiebereich einen Beitrag zu diesem Anstieg der Produktivität geleistet haben. Diese Experten waren sich ebenfalls einig, dass wir erst am Beginn dieses technologischen Fortschritts stehen und daher auf viele Jahre hinaus mit weiteren Verbesserungen zu rechnen ist. Der aktuelle Anstieg der Produktivität folgte auf eine noch nie da gewesene Investitionswelle in neue Technologien, vor allem in Computer und Informationstechnologie. Zwischen 1981 und 1993 fielen die durch die Unternehmen getätigten Kapitalinvestitionen von 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf unter 10 Prozent. Zum letzten Mal war diese Investitionsrate 1964 auf einem derart niedrigen Stand gewesen. Der Rückgang an Investitionen während der gesamten 1980er-Jahre und zu Beginn der 1990er-Jahre erklärt, warum die Produktivitätssteigerung während dieses Zeitraums so gering ausfiel. Zwischen 1993 und 1999 stiegen die Kapitalinvestitionen von Unternehmen von unter 10 Prozent wieder auf fast 14 Prozent des BIP an. Zwischen 1991 und 1998 stiegen die Gesamtinvestitionen mehr als drei Mal so schnell wie das BIP und mehr als zwei Mal so schnell wie während der 1980er-Jahre. Ein so enormes Wachstum der Investitionen hat es innerhalb eines so knappen Zeitraumes noch nicht gegeben, und es treibt den gegenwärtigen Wirtschaftsaufschwung voran. Neben dem bemerkenswerten Anstieg der Investitionen in den Produktionsbereich hat sich auch die Verteilung der Bereiche, in die investiert wird, verändert. Im Jahre 1960 machten Investitionen in das Anlagevermögen – wie beispielsweise in den Bau von Fabrikgebäuden – noch 60 Prozent aller Kapitalinvestitionen der Unternehmen aus, während die Investitionen in das Umlaufvermögen – wie beispielsweise Maschinen, Geräte und Computersoftware – die restlichen 40 Prozent einnahmen. Das rapide Wachstum der Investitionen in das Umlaufvermögen – in erster Linie in Software – der vergangenen 40 Jahre kehrte dieses Verhältnis um. Seit 1993 stiegen die Investitionen in Informationsverarbeitungsgeräte und die entspreche nden Softwareprodukte durchschnittlich um 19 Prozent pro Jahr. 1999 machten Investitionen in Gerätschaften und Software bereits 80 Prozent aller Kapitalinvestitionen von Unternehmen aus, während die Investitionen in das Anlagevermögen auf einen Anteil von 20 Prozent zurückgegangen waren. 15 Der Ausbau der Produktionskapazitäten – oder auch der Angebotsseite – der Volkswirtschaft hängt stark von einer Erhöhung der Qualität und der Quantität von Investitionen ab. Der erfolgte Anstieg der Investitionen lässt sich auf die Bemühungen zurückführen, die Präsident Clinton und die Demokraten im Kongress während der vergangenen Jahre zur Senkung des Haushaltsdefizits unternahmen. Dadurch wurde Kapital freigesetzt, das der Wirtschaft zu Investitionen in die Steigerung der Produktivität zur Verfügung stand. Der Wirtschaftsaufschwung der 1990er-Jahre wurde in erster Linie durch steigende Investitionen angetrieben, nicht durch verstärkte Ausgaben der öffentlichen Hand, wie dies in den 1980er-Jahren der Fall gewesen war. In der Tat sind die Ausgaben der Bundesregierung am BIP gemessen während des gegenwärtigen Aufschwungs zurückgegangen. Sie betragen momentan weniger als 18 Prozent des BIP, was einem Tiefststand seit 1967 entspricht. (oben: Investitionen; links: Prozent BIP; Beschriftung Fläche oben: Geräte und Software; Beschriftung Fläche unten: Anlagevermögen) Quelle: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Durch die Reduzierung des Haushaltsdefizits konnten auch in der Geldpolitik die Zügel etwas gelockert und die Zinsen gesenkt werden. Dies trug zu einem günstigen Investitionsklima bei, vor allem im Bereich der Informationstechnologie (IT) und dazu gehöriger Geräte und Software. Die Entwicklung in der IT-Branche war auf einem Stand, auf dem massive Kapitalzuflüsse absorbiert werden konnten. So führte die Zunahme der Investitionen in diesen Bereich zu großen technologischen Fortschritten, die ihrerseits einen großen Beitrag zur Steigerung der Produktivität leisteten. Folglich stiegen auch die Löhne und Gehälter nach 20 Jahren Rückgang und Stagnation wieder an, ohne der Inflation Vorschub zu leisten. Diese Kette von Ereignissen während der 1990er-Jahre stellt eine wahre Expansion der Angebotsseite der Volkswirtschaft dar. Der gegenwärtige Wirtschaftsaufschwung bietet in vielerlei Hinsicht Grund zur Freude. Heute arbeiten mehr Menschen, und das zu höheren Löhnen als während der vergangenen 20 Jahre. Die niedrige Inflationsrate und das große Produktivitätswachstum haben zu einer wirklichen Verbesserung des Lebensstandards für die meisten Amerikaner geführt. Dennoch gelangt noch nicht jeder in den Genuss dieses neuen Wohlstands. In der Tat hat sich an der wirtschaftlichen Situation einiger Bevölkerungsgruppen noch nicht viel verändert. 16 2. Wachsende Einkommensunterschiede Obwohl es einige Zeit gedauert hat, beginnt nun das durchschnittliche Bruttoeinkommen der Amerikaner aller Einkommensgruppen – nicht nur der Reichen – zu wachsen. Leider lässt sich dies über die Nettoeinkommen nicht sagen, da sich die Einkommensunterschiede zwischen den Wohlhabenden und der restlichen Bevölkerung weiterhin vergrößern. 2.1 Das Bruttoeinkommen von Familien Während der vergangenen 20 Jahre wuchs das inflationsbereinigte Durchschnittseinkommen der 20 Prozent wohlhabendsten Familien (des oberen Fünftels), während sich das inflationsbereinigte Durchschnittseinkommen der 20 Prozent ärmsten Familien (des unteren Fünftels) kaum bewegte. Die realen Durchschnittslöhne des untersten Fünftels begannen 1993 zu steigen und hatten 1998 wieder ihren Stand von 1978 erreicht. Real Average Income by Quintile $140 $127,529 Real Average Income (in Thousand $) $120 $108,671 $100 $91,211 $80 $60 $40 $20 $9,223 $8,973 $8,962 $0 1980 1990 1998 Year Quelle: US Census Bureau, Income Statistics Branch, from Detailed Historical Income and Poverty Tables, Table H-3, revised May 24, 199. Es ist ermutigend, zu sehen, dass auf Grund der gegenwärtigen wirtschaftlichen Expansion nunmehr auch die Einkommen dieses ärmsten Fünftels zu steigen begonnen haben. Trotzdem haben diese Menschen aus dem neuen Wohlstand noch nicht gleichgroßen Nutzen wie die anderen Einkommensgruppen ziehen können. Im Jahre 1980 lag das durchschnittliche Einkommen der 20 Prozent reichsten Familien zehn Mal über dem der ärmsten 20 Prozent. Im Jahr 1998 verdienten die reichsten Familien 14-mal so viel wie die ärmsten. Der Hauptgrund für diese immer weiter auseinanderklaffende Schere ist das unglaubliche Wachstum des Durchschnittseinkommens der Reichen. Obwohl die durchschnittlichen Einkommen beider Bevölkerungsteile seit 1993 gestiegen sind, wuchsen die Einkommen der wohlhabendsten Familien viel schneller. Um es in anderen Worten zu sagen gab es zwar für jedes der beiden Fünftel Verbesserungen der Einkommenslage, doch die Kluft geht trotzdem immer weiter auseinander. 17 Income Ratio of Wealthiest to Poorest Families 1980 to 1998 16 Ratio 14 12 10 8 1980 1985 1990 1995 Years Quelle: US Census Bureau, Income and Statistics Branch, from Detailed Historical Income and Poverty Tables, Table H-3, revised May 23, 1999. 2.2 Das Netto-Haushaltseinkommen Eine kürzlich durchgeführte Studie auf der Grundlage von Daten des Haushaltsausschusses des Kongress (Congressional Budget Office, CBO) analysiert die Entwicklung der Nettoeinkommen. 2 Nach Abzug von Steuern und Verrechnung von Vergünstigungen (Earned Income Tax Credit) verbuchten die 20 Prozent reichsten Haushalte in den Vereinigten Staaten von 1977 bis 1999 einen Anstieg ihrer Durchschnittseinkommen um 43 Prozent, während die 20 Prozent ärmsten Haushalte einen Rückgang ihrer durchschnittlichen Einkommen um 9 Prozent hinnehmen mussten. Die Einkommenszuwächse der vergangenen Jahre sind zwar sehr positiv, aber dennoch zu gering, um ein weiteres Auseinanderdriften der Einkommensniveaus verhindern zu können. Die Studie berichtet außerdem über Folgendes: − Die Einkommenszuwächse des einen Prozent der allerreichsten Familien zwischen 1977 und 1999 entsprechen dem Gesamteinkommen der 20 Prozent der Ärmsten im Jahr 1999. − Die Gruppe der reichsten Amerikaner – die mit einem Prozent der Bevölkerung 2,7 Millionen Menschen ausmacht – bezog Nettoeinkommen in derselben Höhe wie die Einkommen der 38 Prozent ärmsten Amerikaner – oder 100 Millionen Menschen – zusammen. − Im Jahre 1977 bezog die 1-Prozent-Gruppe der reichsten Amerikaner etwas über 7 Prozent des Gesamt-Nettoeinkommens der ganzen Nation. Bis 1999 hatte sich diese Zahl fast verdoppelt und die 1-Prozent-Gruppe der reichsten Amerikaner erhielt fast 13 Prozent des landesweiten Gesamt-Nettoeinkommens. − Im Durchschnitt ist die prozentuale Steuerbelastung der 1 Prozent reichsten Haushalte im Jahr 1999 im Vergleich zu 1977 gesunken. So sparte jeder dieser Haushalte im Schnitt 40.000 USD ein. 2 "The Widening Income Gulf", The Center on Budget and Policy Priorities, Washington, DC 1999. Die Daten des CBO beginnen mit 1977 und enden mit Vorhersagen für 1999. 18 Die Grundlagen für diese Auseinanderentwicklung wurden in den 1980er-Jahren geschaffen. Die stärksten Einkommenszuwächse verzeichnete das reichste Fünftel der Bevölkerung mit 33 Prozent zwischen 1977 und 1989. Zwischen 1989 und 1999 stiegen dessen Einkommen nur noch um 7 Prozent an. Ein Vergleich zwischen den Zuwächsen bei den Einkommen vor Steuer mit den Zuwächsen bei den Einkommen nach Steuer in Bezug auf die reichsten Amerikaner zeigt die perversen Folgen der bundesweiten Steuerpolitik der vergangenen 20 Jahre auf. Was die 1-ProzentGruppe der allerreichsten Haushalte angeht, so stieg zwischen 1977 und 1999 deren durchschnittliches Nettoeinkommen noch um 20 Prozentpunkte mehr als deren durchschnittliches Bruttoeinkommen. Über denselben Zeitraum sank jedoch das durchschnittliche Nettoeinkommen des ärmsten Fünftels der Haushalte. Im Gegensatz zum üblicherweise verfolgten Ziel nimmt also das US-Steuersystem von den Armen und gibt es den Reichen. Changes in the Income Gap* by State from 1988-90 to 1996-98 Income Gap Improved (shrank) (3) No Significant Change (13) Income Gap Worsened (increased) (34) * Defined as the difference between the average income of the poorest and richest 20 percent of families. Quelle: "Pulling Apart," Center on Budget and Policy Priorities. Einkommensbezogene Daten aus den Bundesstaaten bestätigen, dass die Verbreiterung der Kluft zwischen den Einkommen die gesamten Vereinigten Staaten betrifft. Eine kürzlich angefertigte Studie zeigt, dass sich in fast allen Bundesstaaten seit den 1970er-Jahren eine Einkommenskluft aufgetan hat. 3 Dabei fällt vor allem auf: − Während des vergangenen Jahrzehnts verbreiterte sich der Abstand zwischen den 20 Prozent der reichsten und den 20 Prozent der ärmsten Amerikaner in 34 Bundesstaaten. Eine Annäherung konnte nur in drei Bundesstaaten beobachtet werden – Alaska, Louisiana und Tennessee. − Das reale Einkommen der 20 Prozent ärmsten Familien fiel zwischen Ende der 1970erJahre und Ende der 1990er-Jahre in 18 Bundesstaaten. In sechs der betroffenen Bundes- 3 Pulling Apart: A State by State Analysis of Income Trends, in: Center on Budget and Policy Priorities and the Economic Policy Institute, Washington, DC 2000. 19 staaten erreichte dieser Rückgang ein Ausmaß von über 2.000 USD pro Familie (USD zum Wert von 1997). − Gegen Ende der 1990er-Jahre verfügten die 20 Prozent der wohlhabendsten Familien in allen Bundesstaaten über einen größeren Anteil an den Gesamteinkommen im jeweiligen Bundesstaat als dies gegen Ende der 1970er-Jahre der Fall gewesen war. Währenddessen ging in 47 Bundesstaaten der Anteil der 20 Prozent ärmsten Familien an den Gesamteinkommen bis zum Ende der 1990er-Jahre zurück. Change in Average Income of the Poorest Families Increased 12 States 18 States Declined 20 States No Significant Change Quelle: "Pulling Apart", Center on Budget and Policy Priorities. − In 24 Bundesstaaten betrug das Einkommen der 20 Prozent reichsten Familien mehr als das 9,5-Fache des Einkommens der 20 Prozent ärmsten Familien. Ende der 1970er-Jahre gab es keinen einzigen Bundesstaat mit einem derart hohen Faktor "zwischen oben und unten". − Vom Ende der 1970er-Jahre bis zum Ende der 1990er-Jahre wuchs auch in 45 der 50 Bundesstaaten der Abstand zwischen dem Durchschnittseinkommen von Familien der Mittelklasse und den 20 Prozent reichsten Familien. Zwischen 1991 und 1993 – den Jahren des "Bush-Aufschwunges" – sank das reale Durchschnittseinkommen der Familien in vier der fünf Einkommensgruppen. Im Gegensatz dazu stieg zwischen 1993 und 1996 – den Jahren des "Clinton-Aufschwunges" – das reale durchschnittliche Einkommen aller Familien, egal welcher Einkommensgruppe sie angehörten. 4 Die Weitung der Kluft lässt sich anhand des starken Wachstums der hohen Einkommen und der Schwächung des Sicherheitsnetzes für die Bezieher niedrigerer Einkommen erklären. Obwohl sich die Unterschiede zunehmend vergrößerten, fehlte es immer mehr an den Mechanismen, die ursprünglich Menschen mit geringem Einkommen helfen sollten. Dies machte sich vor allem bemerkbar, da der reale Wert des Mindesteinkommens zurückging und im Zuge der Reform des Wohlfahrtswesens Hilfsangebote gekürzt wurden. 4 Klein, Bruce: The 1990s Economic Expansion: Who Gained the Most, Bericht für die Vertreter der Demokratischen Partei im Gemeinsamen Wirtschaftsausschuss (Joint Economic Committee), Washington, DC 1998. 20 3. Schwächen Der gegenwärtig herrschende Wohlstand ist nicht frei von potenziellen Komplikationen. Die Wirtschaft steht vor einer Reihe externer und interner Faktoren, die sie in der Zukunft für eine Rezession oder Inflation verwundbar machen könnten. Der folgende Abschnitt spricht einige dieser Knackpunkte an. 3.1 Der Aktienmarkt Die Finanzmärkte der Vereinigten Staaten verzeichneten während der vergangenen 20 Jahre einen bemerkenswerten Boom. Dazu kommt, dass auf dem Privatkundenmarkt nun andere Arten von Aktien zur Kapitalanlage gefragt sind. Der Dow Jones Industrial Index stieg zwischen 1980 und 1989 um 334 Prozent, zwischen 1989 und 1999 um 418 Prozent. Der NASDAQ-Index kletterte zwischen 1980 und 1989 um ein Dreifaches seines ursprünglichen Stands, zwischen 1989 und 1999 sogar um ein Neunfaches nach oben. Ein so lange anhaltendes Wachstum hat es auf beiden Märkten noch nicht gegeben. Darüber hinaus ziehen die Anleger auch mittlerweile den traditionellen Unternehmen, die an der New Yorker Börse gelistet sind, die im NASDAQ geführten, jungen Technologieunternehmen vor. Gleichzeitig mit dem steilen Anstieg der Aktienpreise wurden jedoch auch zunehmend Wertpapiere auf Kredit gekauft. Die Verschuldung der Investoren durch den Kauf von Wertpapieren wuchs 1999 um 60 Prozent – oder in Zahlen ausgedrückt auf fast 90 Milliarden USD an. Zwischen September 1999 und Februar 2000 allein stieg die Summe auf Kredit erworbener Wertpapiere sprunghaft um jeweils 20 Milliarden USD pro Monat an. Bis vor kurzem stand das Wachstum der Verschuldung noch in einem proportionalen Verhältnis zur Kapitalisierung des Marktes, doch nun ist dies nicht mehr der Fall. Die Verschuldung ist weit höher als die Gewinne auf dem Aktienmarkt – ein Zeichen, dass verstärkt spekuliert wird. Hoch verschuldete Investoren sind durch eine Baisse auf dem Aktenmarkt verwundbarer, da sie durch Aufforderungen zu Nachschusszahlungen bedingt möglicherweise gezwungen sind, Teile ihrer Portefeuilles abzustoßen. Dies könnte seinerseits einen weiteren Verfall der Aktienkurse auslösen und somit eine Abwärtsspirale anstoßen. Die Notenbank hat auf diese Anzeichen für übermäßige Spekulation noch nicht reagiert, könnte jedoch überdenken, die Einschusssätze zu erhöhen, um einem weiteren Anwachsen des Kreditkaufs von Wertpapieren vorzubeugen. (oben: Zunahme des Kreditkaufs von Wertpapieren; links: Millia rden USD) Quelle: Federal Reserve Board. 21 3.2 Die Ölpreise Während der vergangenen Monate sind die Ölpreise steil angestiegen. Dies ist auf ein weltweites Aufleben der Wirtschaft und eine Senkung der Fördermengen durch die Mitglieder der Organisation der Erdöl exportierenden Staaten (OPEC) im Jahre 1999 zurückzuführen. Während des vergangenen Jahres haben sich die Ölpreise fast verdreifacht, was Anlass zu Inflationsängsten in der gesamten Volkswirtschaft gibt. Vor allem im nordöstlichen Teil der Vereinigten Staaten sind die Heizkostenrechnungen ins Astronomische gestiegen und die durchschnittlichen Benzinpreise haben sich im ganzen Land im Verlauf des letzten Jahres um 40 Prozent erhöht. (oben: Ölpreise; links: USD pro Barrel (West Texas)) Quelle: Bureau of Labor Statistics. Der gegenwärtige Ölpreis ist zwar hoch, aber trotzdem deutlich unter dem Preis von 38 USD pro Barrel im Jahr 1980. Die Ölvorkommen sind allerdings bereits ziemlich erschöpft. Mit dem Rückgang der Erdölreserven wurde die Weltwirtschaft zunehmend anfälliger für Schwankungen in der Ölversorgung, wie beispielsweise den Erdöl-Exportstop im Irak. Dazu kommt, dass für das Jahr 2000 mit einer gesteigerten Nachfrage nach Erdöl gerechnet wird, da man von einem erneuten Wachstum der Weltwirtschaft ausgeht. Es wird daher schwierig für die OPEC, die Gratwanderung zwischen dem Erhalt der Ölvorkommen und der nötigen Versorgung der Weltwirtschaft zu meistern. Die Internationale Energiebehörde schätzt, dass die OPEC die Fördermengen um fast 10 Prozent erhöhen müsste, um mit der weltweiten Nachfrage Schritt zu halten. Glücklicherweise ist die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten nicht mehr in so starkem Maße vom Erdöl abhängig wie während der Ölkrisen der 1970er-Jahre. Die Ausgaben für Öl machten 1998 3 Prozent des BSP aus, was einen starken Rückgang gegenüber dem Jahr 1980 mit noch 9 Prozent darstellt. Dennoch kann sich das Erdöl nach wie vor als ein merklicher Bremsklotz auf die industrialisierten Volkswirtschaften auswirken. Die Organisation für wir tschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schätzt, dass jeder Anstieg des Ölpreises um 10 USD pro Barrel zu einem Anstieg der Inflation um einen halben Prozentpunkt sowie zu einem Verlust an Wirtschaftswachstum um einen Viertelprozentpunkt führt. Obwohl eine Rückkehr zur Stagflation der 1970er-Jahre unwahrscheinlich ist, besitzt jede unvorhersehbare Versorgungsschwankung das Potenzial, die Inflation in die Höhe zu treiben und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung abzubremsen. Unterm Strich sind daher niedrige 22 und stabile Ölpreise für die langfristigen Aussichten der amerikanischen Volkswirtschaft am besten. 3.3 Wirtschaftszyklische Faktoren Seit langem ist bekannt, dass Volkswirtschaften einem Wirtschaftszyklus folgen, der auf der Gewinnträchtigkeit von Unternehmen fußt. Sehen Unternehmen die wirtschaftliche Zukunft mit Zuversicht, neigen sie eher zu Investitionen. Infolgedessen wächst die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit sinkt, und die Löhne steigen, was jedoch wiederum die Gewinne der Unterne hmen schmälert. Diese "Gewinnschmälerung" zwingt die Firmen, ihre Investitionen zurückzuschrauben, da sie für die Zukunft niedrigere Gewinne erwarten. Ein Rückgang der Investitionen bremst das Wirtschaftswachstum und beschneidet die Kapitalmenge, die für die Entwicklung neuer Technologien zur Verfügung steht. Damit beginnt die Wirtschaft zu stagnieren. Während des vergangenen Jahrhunderts folgte die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten diesem Zyklus ziemlich eng. Neuerdings kommt man jedoch verstärkt zu der Auffassung, dass Veränderungen in der Struktur der amerikanischen Volkswirtschaft diese weniger anfällig für die Kräfte des traditionellen Wirtschaftszyklus gemacht haben. Beispielsweise ermöglichen neue technologische Errungenschaften es den Unternehmen, eine "Just-in-time"Produktion zu verfolgen, wodurch sie es vermeiden können, umfassende Lagerbestände aufbauen zu müssen, was bis dato durch den Wirtschaftszyklus bedingt geschah. Nach neun Jahren der Expansion weist die Wirtschaft der Vereinigten Staaten obendrein auch nicht viele der Trends auf, die möglicherweise auf eine anstehende Abkühlung der Konjunktur hinweisen. Anstatt zu stagnieren, wie dies bei anderen bereits länger andauernden Aufschwungphasen der Fall war, sind die Produktivitätssteigerungsraten während der vergangenen Jahre nochmals stark gestiegen. Die Inflation ist gefallen anstatt zu steigen, was auf Grund der niedrigen Arbeitslosenquote eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Diese Trends weisen also nicht auf eine bevorstehende Rezession hin, bedeuten jedoch auch nicht notwendigerweise, dass der traditionelle Wirtschaftszyklus ausgedient hätte. Technologische Fortschritte, speziell im Bereich der Informationstechnologie, stehen im Brennpunkt der gegenwärtigen wirtschaftlichen Expansion. Die Revolution in der Informationstechnologie wurde bereits mit der Entdeckung der Elektrizität vor über 100 Jahren verglichen. Unklar bleibt, wie lange der gegenwärtige Technologie-Investitionsboom anhält. Beim Fall der Elektrizität begann die auf die ursprüngliche folgende, zweite Investitionswelle bald abzuflachen und bremste die wirtschaftliche Entwicklung. Noch ist nicht abzusehen, ob die Investitionen in die Informationstechnologie ebenfalls diesen Weg einschlagen werden, oder ob sich eine ganz andere Entwicklung ergibt. Auch die Geldpolitik spielt eine wichtige Rolle in der Richtungsgebung einer Volkswirtschaft. In der Vergangenheit löste ein Rückgang der Arbeitslosigkeit einen Anstieg der Löhne und Gehälter und damit Inflationsängste aus. Um diesen Befürchtungen entgegenzutreten, erhöhte die US-Notenbank typischerweise die Zinssätze, um die in Umlauf befindliche Geldmenge zu beschränken. Obwohl eine restriktive Geldpolitik die Inflation im Zaum halten kann, kann sie ebenfalls die Wirtschaft in eine Rezession führen. Sobald dies der Fall ist, lockert die Notenbank ihre Geldpolitik, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. 23 Die anhaltende wirtschaftliche Expansion der vergangenen neun Jahre war für Präsident Alan Greenspan und seine Kollegen an der Notenbank eine Herausforderung. Im Gegensatz zu vorangegangenen Aufschwungphasen liegen keine Anzeichen dafür vor, dass die Löhne und Gehälter infolge der historisch niedrigen Arbeitslosenquote gestiegen sind. Dies veranlasste Herrn Greenspan, der, stets wachsam, auch eine im Verborgenen lauernde Inflation wittert, mehrfach dazu, die Zinssätze als vorbeugende Maßnahme zu erhöhen, um auch jegliche Gefahr einer inflationären Entwicklung aus dem Weg zu räumen. Doch diese vorbeugenden Maßnahmen an und für sich können bereits die wirtschaftliche Entwicklung bremsen, selbst wenn kein Anlass für einen Anstieg der Inflation gegeben ist. Es gibt viele Gründe, aus denen sich die Konjunktur abkühlen kann und es gibt keine Sicherheiten, dass die gegenwärtige Hochphase gegen einige der internen Dynamiken gefeit ist, die sich in der Vergangenheit bei ähnlichen Expansionen ergeben haben. Es ist wohl stark übertrieben, über ein Ende des traditionellen Wirtschaftszyklus zu spekulieren. Die wirkliche Gefahr für die weitere Entwicklung mag vielmehr in der übereifrigen Umsetzung der Geldpolitik liegen. 3.4 Das internationale wirtschaftliche Umfeld An die Stärke der US-Wirtschaft während der vergangenen Jahre konnten die anderen Industriestaaten nicht herankommen. Mit über 4 Prozent betrug das Wachstum der Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten fast das Dreifache der durchschnittlichen Wachstumsraten in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und dem Vereinigten Königreich. Das Wirtschaftswachstum Kanadas lag etwas unter 4 Prozent. Japan, dessen Wirtschaft einst als beispielhaft betrachtet wurde, konnte 1999 lediglich ein Wachstum von 1,5 Prozent verzeichnen, da es sich noch immer von der Finanzkrise der Jahre 1997-1998 im ostasiatischen Raum erholte. Der Vergleich von Wachstumsraten hat nicht nur etwas mit einem Wettbewerb um die wirtschaftliche Vorherrschaft zu tun. Die US-Wirtschaft öffnet sich immer stärker der Weltwirtschaft. Daher erlangen die Wachstumsraten in anderen Ländern eine immer größere Bedeutung für unsere eigene Volkswirtschaft. Exporte und Importe nehmen zusammen gegenwärtig etwa ein Viertel der Wirtschaft der USA ein und sind Schlüsselfaktoren für das wirtschaftliche Wachstum in unserem Land. Stellt sich in anderen Staaten ein stärkeres wirtschaftliches Wachstum ein, neigen sie dazu, mehr von den USA zu importieren. Dies gibt den USExporteuren die Möglichkeit, ihre Verkäufe auf diesen Märkten in die Höhe zu treiben. Die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten ist jedoch schneller gewachsen als die Volkswirtschaften unserer Haupthandelspartner, wodurch die Importe unseres Landes aus dem Ausland stärker angestiegen sind als unsere Exporte auf Märkte im Ausland. Diese Situation trug zum Wachstum des Handelsbilanzdefizits der USA bei. Die Finanzkrise im ostasiatischen Raum machte den Aussichten der US-Exportwirtschaft einen Strich durch die Rechnung und setzte Unternehmen im Inland, die mit den Importpreisen konkurrieren müssen, zusätzlich unter Druck. Im Jahre 1996 – vor dem Ausbruch der Krise – machten der Außenhandel mit Japan, Korea, Singapur und Taiwan zusammen ein Fünftel aller Exporte und Importe der USA aus. Infolge der Finanzkrise – die die Entwicklung der betroffenen Volkswirtschaften stark abbremste und zu einer Abwertung der betroffenen Währungen führte – stagnierten die Exporte der Vereinigten Staaten in diese vier Länder, während die Importe steil anstiegen. Zwischen 1996 und 1999 fielen die Exporte von den USA in die vier genannten Länder um 4 Prozent und die Importe der USA aus diesen Ländern stiegen um 17 Prozent an. 24 Unterschiedliche wirtschaftliche Wachstumsraten und die Finanzkrise Ostasiens sind jedoch nur zwei Beispiele dafür, welchen Einfluss Entwicklungen in der Weltwirtschaft auf die Stärke der Wirtschaft der Vereinigten Staaten haben. Es wird erwartet, dass sich die Volkswirtschaften Europas und Ostasiens in den kommenden Jahren erholen, wodurch sich die Märkte für Waren und Dienstleistungen aus den USA wieder vergrößern werden. Doch in dem Maß, wie diese großen Volkswirtschaften wachsen, könnten auch deren Exporte in die Vereinigten Staaten ansteigen. Das heißt, die Bedingungen in der Weltwirtschaft mögen sich verbessern, doch wenn die Importe der Vereinigten Staaten weiterhin stärker wachsen als die Exporte, wird sich das Handelsbilanzdefizit noch mehr ausweiten. Idealerweise sollte die Weltwirtschaft in einem gesunden, aber stetigen Ausmaß wachsen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten unbedingt starke wirtschaftliche Schwankungen, wie beispielsweise der oben erwähnte Anstieg der Ölpreise, vermieden oder zumindest versucht werden, deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft so rasch wie möglich weitgehend einzuschränken. Obwohl sich alle Staaten im Prinzip in dieser Zielsetzung einig sind, stellt es sich als schwierig heraus, Worten auch Taten folgen zu lassen. 3.5 Das Zahlungsbilanzdefizit Im Jahre 1999 wuchs das Zahlungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten – welches das allgemeinste Maß für den Handel der USA mit Waren und Dienstleistungen darstellt – im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent an und erreichte 339 Milliarden USD oder fast 4 Prozent des BIP. Die boomende Wirtschaft, der starke Dollar und die schwächelnden Volkswirtschaften in Übersee trugen zu einem steilen Anstieg der Importe, aber nur zu einem mageren Wachstum der Exporte bei. Diese Entwicklungen setzen vor allem die verarbeitende Industrie in den Vereinigten Staaten unter Druck. Folglich sind die Beschäftigtenzahlen in der verarbeitenden Industrie seit 1997 um fast 500.000 zurückgegangen, auch wenn die Produktionszahlen stabil blieben. (oben: Zahlungsbilanzdefizit gemessen am BIP; links: Prozent) Quelle: Bureau of Economic Analysis. Die Zahlungsbilanz spiegelt die Kluft zwischen dem im Inland angesparten Kapital und den getätigten Investitionen wider. In den vergangenen Jahren gingen in den Vereinigten Staaten 25 die Investitionen in die Höhe, während die Spareinlagen sich kaum nach oben bewegten. Trotz des Ausgleichs des bundesstaatlichen Haushaltsdefizits haben sich die nationalen Rücklagen – die in den Vereinigten Staaten traditionell eher gering sind – kaum erhöht, vor allem da die privaten Spareinlagen der Bevölkerung weiterhin zurückgingen. Die Vereinigten Staaten müssen diesen Mangel an angespartem Kapital durch Anleihen aus dem Ausland wettmachen. Während des vergangenen Jahrzehnts haben ausländische Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen Hunderte von Milliarden Dollar in US-Wertpapieren angelegt und damit diese Lücke ausgefüllt. Während der 1980er-Jahre, als die Löcher im Staatshaushalt immer größer wurden, entwickelten sich die Vereinigten Staaten vom weltgrößten Gläubiger zum weltgrößten Schuldner. Eine derartige Abhängigkeit von Kapital aus dem Ausland macht die Finanzmärkte der USA verwundbar für alle Änderungen in den Präferenzen der ausländischen Investoren. Sollten die Investoren im Ausland sich entscheiden, keine in Dollars gehandelten Vermögenswerte mehr zu kaufen, könnte der Wert des US-Dollars deutlich sinken, wodurch die Importe der Vereinigten Staaten teurer würden, die Inflation nach oben getrieben und wahrscheinlich die heimische Wirtschaft unter Druck geraten würde. Langfristig macht daher das große Zahlungsbilanzdefizit die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten anfälliger für Einflüsse aus dem Ausland. Kurzfristig gesehen gibt das Defizit Auskunft über eine wirklich schwierige wirtschaftliche Lage für die Arbeiter in den USA und deren Familien. Ein starkes Wachstum der Importe in Verbindung mit einem schleppenden Wachstum der Exporte hat dazu beigetragen, dass oft gut bezahlte Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie abgebaut und die Menschen in Arbeitsplätze in der Dienstleistungsbranche abgedrängt wurden, die eventuell schlechtere Bezahlung und oft keinerlei Sozialleistungen durch den Arbeitgeber bieten. Obwohl die Aufwärtsentwicklung der Wirtschaft es den Arbeitssuchenden erleichtert, neue Arbeitsplätze zu finden, ist trotzdem ein Anpassungsprozess vonnöten, der den einzelnen Betroffenen und deren Familien eine schwere Belastung auferlegt. Manchmal sind Arbeitssuchende gezwungen, permanente Einkommenseinbußen hinzunehmen, um einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Mit diesen beruflichen Veränderungen gehen oft auch andere Zwänge, wie der eines Umzugs, einer Umschulung, eines Verlusts der Krankenversicherung oder der Rentenversicherung einher. Es besteht ein Bedarf an politischen Maßnahmen, um diesen Arbeitnehmern – die ohne eigenes Verschulden in eine äußerst missliche wirtschaftliche Lage geraten sind – die Last des Anpassungsprozesses etwas zu erleichtern. 4. Schluss Die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten ist in einer so guten Verfassung wie seit Jahren nicht mehr. Trotzdem bekommen einige Amerikaner kein Stück von diesem Kuchen ab. Es gibt noch viel zu tun, um den Lebensstandard aller Amerikaner zu verbessern, nicht nur den einer Handvoll Glücklicher. Trotz einer Steigerung in allen Einkommensschichten tut sich zwischen den Reichen und den Armen eine immer weitere Kluft auf. Der Versuch, diese Entwicklung aufzuhalten oder sogar rückgängig zu machen, bringt nicht notwendigerweise mit sich, dass die Reichen nun ein Stück ihres Wohlstands abtreten müssen. Es ist auch möglich, einen größeren Teil der aktuellen wirtschaftlichen Gewinne auf jene Menschen umzuverteilen, deren Einkommen bislang nicht so stark angestiegen sind. 26 Die Vereinigten Staaten genießen eine Zeit noch nicht da gewesenen wirtschaftlichen Wohlstands. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie noch nie und es gibt keinerlei Anzeichen für ein Wiederansteigen der Inflationsrate. Das hört sich wunderbar an, ist jedoch leider nur die eine Seite der Entwicklung. Millionen von Menschen in unserer Gesellschaft haben von diesem wirtschaftlichen Wohlstand noch nichts abbekommen und für die meisten kam die Verbesserung ihrer Lage nach einer Zeit anhaltender wirtschaftlicher Stagnation. Die Herausforderung für unsere Nation besteht daher darin, sicherzustellen, dass dieser wirtschaftliche Wohlstand anhält und gleichzeitig zu versuchen, die Gewinne und Vorzüge gleichmäßiger mit allen Amerikanern zu teilen. 27 Stephan G. Bierling Das Ende des langen Booms? Die amerikanische Wirtschaft unter Bill Clinton und George W. Bush 1. Von Abstiegsängsten zum langen Boom Amerikas Zeitalter ist zu Ende. Die USA haben sich mit ihren weltpolitischen Ambitionen übernommen und befinden sich im ökonomischen Niedergang. Europa und Japan kauern in den Startlöchern, um die Vereinigten Staaten als Weltwirtschaftsmacht Nummer 1 zu beerben. Der amerikanische Traum ist ausgeträumt. So oder ähnlich kommentierten Journalisten, Politikwissenschaftler und Ökonomen die Lage und die Perspektiven der amerikanischen Wirtschaft vor gut zehn Jahren. 1 Gründe für solche Unkenrufe gab es zuhauf: 1990 rutschten die USA in eine Rezession, die Neuverschuldung stieg auf 220 Mrd. Dollar, die Inflation lag bei mehr als fünf Prozent, der Dollar fiel gegenüber der D-Mark auf ein historisches Tief, der Dow Jones dümpelte unter der 3.000er Marke. Im Jahr 2000 wollte freilich niemand mehr etwas wissen von den Horrorszenarien der späten Achtziger- und frühen Neunzigerjahre. Amerika boomte. Amerika boomte wie zu keinem anderen Zeitpunkt in seiner Geschichte. Die Unkenrufer von einst mussten sich vorhalten lassen, Dynamik und Potenzial der US-Wirtschaft völlig falsch eingeschätzt zu haben. Obwohl sich die Konjunktur im Jahr 2001 deutlich abkühlte, war nicht der Abschwung erstaunlich, sondern die Tatsache, dass er so lange auf sich warten ließ. Im Sommer gab es erste Anzeichen, dass die Talsohle durchschritten war. Die Terrorattacken vom 11. September 2001 auf das World Trade Center und das Pentagon haben aber wichtige Bereiche der amerikanischen Ökonomie – vor allem die Luftfahrt-, die Freizeit- und die To urismusindustrie – schwer geschädigt und das Verbrauchervertrauen stark sinken lassen. Auch wenn es sich dabei um vorübergehende Phänomene handeln dürfte, wird sich trotz Zinssenkungen und Stimulusprogrammen ein Abgleiten der US-Wirtschaft in eine Rezession2 nicht verhindern lassen. Dieser Aufsatz stellt zunächst die langfristigen makroökonomischen Entwicklungen in den USA in den letzten zehn Jahren dar, analysiert dann die polit-ökonomischen Ursachen für den "langen Boom" und widmet sich im dritten Teil den Fragen, welche Wirtschaftspolitik der neue Präsident George W. Bush verfolgt und welche Folgen die Attentate vom 11. September 2001 für die Erholung der US-Ökonomie haben. 2. Die Bilanz der Clinton-Jahre Fast alle makroökonomischen Kennziffern belegen den beispiellosen Aufschwung unter der Präsidentschaft Bill Clintons. Bei seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt wuchs die US-Wirtschaft im 119. Monat ohne Unterbrechung und übertraf damit die alte Rekordmarke 1 Den größten Bekanntheitsgrad in der Schule der "Declinists" erreichte Paul Kennedy mit seinem Buch: The Rise and Fall of Great Powers, New York 1987. 2 "Rezession" wird in den USA als zwei aufeinander folgende Quartale mit negativem Wachstum definiert. 28 aus den Sechzigerjahren bei weitem. 3 Sieht man von dem kurzen Wachstumseinbruch 1990/91 ab, dann befanden sich die USA in einem unter Ronald Reagan 1983 einsetzenden Expansionskurs. 4 Dieses Wachstum war in den letzten Jahren nicht nur sehr stabil auf hohem Niveau, sondern auch deutlich höher als in der Bundesrepublik Deutschland (siehe hierzu die Graphik auf S. 33). Die Preise waren stabil wie seit einer Generation nicht mehr, hohe Produktivitätszuwächse fingen den Lohndruck ab. Dazu schwammen die USA im Geld. Noch nie kauften die Amerikaner mehr Autos als 1999 (16,8 Mio.), noch nie lebten mehr in den eigenen vier Wänden (67%). Die Zahl der Haushalte, die mehr als eine Million Dollar schwer sind, hat sich von 1983 bis 2000 auf fünf Millionen verdoppelt. Die Arbeitslosenquote fiel mit 4,0 Prozent im Jahr 2000 auf den niedrigsten Stand seit dreißig Jahren. Der Boom füllte auch die Staatskasse. Als erstem Präsidenten in der amerikanischen Geschichte ist es Bill Clinton gelungen, in jedem seiner acht Amtsjahre bessere Haushaltszahlen vorzulegen als im vorhergehenden. Ein Defizit von 290 Mrd. Dollar im Jahr 1992 hat sich acht Jahre später in einen Überschuss von 236 Milliarden Dollar im Jahr 2000 verwandelt. Gemessen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt bedeutet dies eine Verbesserung von -4 Prozent auf +2 Prozent. Ermöglicht haben die Sanierung der Staatsfinanzen vor allem drei in ihrem Umfang etwa gleich wichtige Faktoren: – – – die Ausgabensenkungen (vor allem im Verteidigungsbereich) und Steuererhöhungen durch George Bush 1990 und Bill Clinton 1993, die Zinssenkungen des Federal Reserve Board unter Alan Greenspan, die die Zinslasten für die Staatsschulden reduzierten, 5 und die Steuermehreinnahmen auf Grund der guten Konjunktur und des Booms an der Wall Street. Am Ende der Clinton-Administration ging man davon aus, dass der Bund bis zum Jahr 2013 alle öffentlich gehaltenen Verbindlichkeiten zurückzahlen und zum ersten Mal seit 1835 schuldenfrei sein würde (siehe hierzu die Graphik auf S. 34). Von allen beeindruckenden Zahlen des amerikanischen Wirtschaftsbooms sind die zur Entwicklung des Arbeitsmarktes die beeindruckendsten: Die Erwerbslosenquote fiel von 7,5 Prozent bei Clintons Wahl 1992 auf 4,0 Prozent im Jahr 2000, das niedrigste Niveau seit einer Generation. In den letzten acht Jahren sind netto 25 Millionen neue Jobs entstanden. Arbeitslose, Schulabgänger, wieder in den Arbeitsmarkt einsteigende Frauen und die vielen Immigranten haben eine Anstellung gefunden. Die Erwerbslosenquote von Schwarzen und Latinos ist auf historisch tiefem Niveau. Überall suchen Unternehmen und Geschäfte händeringend nach Arbeitswilligen. Wer ein College-Diplom oder einen Highschool-Abschluss hat, kann meist unter zahlreichen Jobangeboten auswählen. Universitäten gehen die Studenten für ihre Doktor-Programme in Natur- und Ingenieurwissenschaften aus, weil HightechFirmen College-Absolventen mit Einstiegsgehältern von 60.000 Dollar locken. Selbst 3 Das monatliche Wachstum der US-Wirtschaft wird festgestellt durch den Purchasing Managers' Index. Liegt er über 42,7, dann wächst die Gesamtwirtschaft. Im Januar 2001 lag er zum ersten Mal seit 1991 wieder unter diesem Wert. Vgl. Ip, Greg: Manufacturing Index Rises for a Second Month, in: Wall Street Journal (WSJ), 3.4.2001, S.A2. 4 Zur Wirtschaftspolitik der Reagan-Administration siehe meinen Aufsatz: Das Vermächtnis der Reaganomics, in: Andersen, Uwe u.a. (Hrsg.): Politik und Wirtschaft am Ende des 20. Jahrhunderts, Opladen 1995, S.119-134. 5 Zur Rolle von Notenbankchef Alan Greenspan in der Wirtschaftspolitik der letzten acht Jahre siehe vor allem Woodward, Bob: Maestro, New York 2000. 29 McDonald's muss deutlich mehr als den Mindestlohn von 5 Dollar 15 bieten, um Mitarbeiter zu finden. Zwar hat der Abschwung Ende des Jahres 2000 zu wohlpublizierten Massenentlassungen einiger Großbetriebe im produzierenden Gewerbe und im Hightech-Sektor geführt, aber noch immer nimmt die Zahl der Arbeitsplätze netto zu. Nur zwei Bereiche der amerikanischen Wirtschaft entwickelten sich negativ in den letzten Jahren: die Sparrate der Bürger und die Handelsbilanz. 6 Legten die Privathaushalte Anfang der Neunzigerjahre noch acht Prozent ihres Einkommens auf die hohe Kante, fiel die Zahl im Jahr 2000 auf Null. 53 Prozent der Amerikaner gaben in einer Umfrage an, meistens oder immer von einem Wochenlohn zum nächsten zu leben. Bei Haushalten mit weniger als 20.000 Dollar Jahreseinkommen lag der Wert sogar bei 79 Prozent. Die finanziellen Rücklagen, also Spareinlagen plus Aktien plus Altersvorsorge minus Schulden, lagen im Jahr 1998 im Durchschnitt bei 9.850 Dollar, bei den unteren Einkommensgruppen bei weniger als 1.000 Dollar. 7 Der Anteil der Schulden eines Privathaushalts an seinem Jahreseinkommen stieg von 63 Prozent 1979 auf 90 Prozent 1999. Allerdings kompensieren die höheren Investitionen der Unternehmen und die Überschüsse der öffentlichen Haushalte den erlahmenden Sparwillen der Bürger. Auch gilt es zu berücksichtigen, dass Aktienbesitz und Wohneigentum nicht in die Berechnung der Sparrate eingehen. Da jeder zweite Amerikaner direkt oder indirekt über Rentenversicherungsfonds am Wall Street-Boom teilnahm und zwei von drei Amerikanern in den eigenen vier Wänden leben, deren Wert in den Neunzigerjahren stark gestiegen ist, haben sich die Rücklagen der meisten US-Bürger sogar erhöht. Eine scharfe Rezession oder ein Absturz des Aktienmarktes könnten diese Gewinne aber wieder stark schmälern. Gerade die beiden unteren Einkommensdrittel haben in den Boomjahren kaum Rücklagen gebildet, um eine längere Durststrecke überbrücken zu können. Angesichts von Vollbeschäftigung und langjähriger Börsenhausse plündern viele Amerikaner aber ihre Sparkonten und pumpen sich Geld, um DVD-Player und Digitalkameras aus Japan, Spielzeug und Textilien aus China oder Luxuskarossen aus Deutschland zu kaufen. Dieser Konsumrausch kurbelt zwar das Wachstum an, kann aber mit der heimischen Produktionskapazität nicht mehr befriedigt werden. Die Folge ist, dass das amerikanische Defizit im Warenaustausch 2000 auf 370 Milliarden Dollar und damit auf mehr als vier Prozent des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts schoss. Nur eine deutliche Abkühlung der Binne nwirtschaft und höhere Wachstumsraten bei den wichtigsten Handelspartnern sowie ein fallender Dollar könnten das Defizit reduzieren. Wegen der Dauerrezession in Japan und der nicht recht in Gang kommenden Konjunktur in Europa und Lateinamerika wird ein solcher Prozess aber viele Jahre dauern. 3. Die Ursachen des langen Booms Zwei Ursachen hatte die längste Boomphase in der Geschichte der Vereinigten Staaten vor allem: 6 Vgl. Stevenson, Richard: Troubles Bubble Beneath Prosperity's Surface, in: International Herald Tribune (IHT), 19.12.2000. Für eine detaillierte Darstellung des Sparverhaltens zwischen 1995 und 1998 siehe Recent Changes in U.S. Familiy Finances: Results from the 1998 Survey of Consumer Finances, in: Federal Reserve Bulletin, January 2000, S.1-29. 7 Vgl. Campaign Aims to Build Savings, in: Los Angeles Times, 21.2.2001, S.C5. 30 – Erstens ist das amerikanische Wirtschaftsmodell der USA besser als das kontinentaleuropäische oder das japanische geeignet, die Vorteile einzustreichen, die sich aus dem rapiden technologischen Wandel und der Globalisierung ergeben. Die hohe Flexibilität, die niedrige Regulierungsdichte, die rasche Verfügbarkeit von Risikokapital erlaubt es USFirmen, rasch auf Veränderungen zu reagieren und neue Märkte zu erschließen. Dazu tolerieren Amerikaner Fehlschläge und bewundern Unternehmer, am meisten jene, die sich von einem Misserfolg nicht unterkriegen lassen und einen neuen Anlauf nehmen. Wer mit 35 im Silicon Valley nicht zwei Mal nahe an der Pleite stand, gilt nicht als erfahrener Businessman. Hat er eine gute Idee, ist ihm weiteres Risikokapital sicher. In Deutschland ist ein Start-Up-Unternehmen meist auf einen Bankkredit angewiesen, der mit jedem Fehlschlag schwieriger zu erhalten ist. Der Ökonom Joseph Schumpeter, der die "schöpferische Zerstörung" und den kreativen Unternehmer als wichtigste Triebkräfte des Kapitalismus identifizierte, hätte seine Freude am amerikanischen Wirtschaftsmodell. Es demonstriert gerade in einer Zeit seine Stärken, wo das größte Wachstum in Sparten stattfindet, in denen Kreativität, Innovationskraft und rasches Handeln gefragt sind: in der Telekommunikation, der Computer-Hard- und -Software, dem Internet-Geschäft, der Biotechnologie, der Medienindustrie, der Medizintechnik. In allen diesen Bereichen liegen die USA heute an der Weltspitze. In keinem Land nehmen diese Zukunftstechnologien einen größeren Anteil an der Gesamtwirtschaft ein als in den Vereinigten Staaten. – Zweitens haben amerikanische Politiker schon in den späten Siebzigerjahren begonnen, eine marktfreundliche Politik zu verfolgen. Staatliche Regulierungen etwa in der Telekommunikation, im Luft- und Schienenverkehr wurden zehn bis fünfzehn Jahre früher abgebaut als in Kontinentaleuropa. Reagan vereinfachte das Steuersystem und reduzierte die Sätze. Bush sr., Clinton und der seit 1994 von den Republikanern kontrollierte Kongress haben mit schmerzlichen Maßnahmen den Haushalt saniert. Trotz aller protektionistischen Forderungen des Kongresses hielten die Amerikaner ihr Land offener für Importe als die Europäer. Trug der Außenhandel 1970 nur ein Zehntel zum Bruttoinlandsprodukt bei, ist es heute fast ein Drittel. Auch subventionierte die US-Regierung in Schwierigkeiten geratene Branchen nur in geringem Maße. All dies hat den Anpassungsdruck für die Unternehmen erhöht und sie schlank und rank gemacht. Der Umstrukturierungsprozess, den die USA in den Achtziger- und Neunzigerjahre durchliefen, war mit vielen individuellen Härten und sozialen Kosten verbunden. So hat die amerikanische Wirtschaft seit 1980 zwar 70 Millionen neue Jobs geschaffen. Gleichzeitig gingen aber auch 35 Millionen Arbeitsplätze verloren. Selbst wenn die amerikanische Job-Maschine also auf Hochtouren läuft, verschwindet für zwei neue Arbeitsplätze ein alter. Auch sind die Löhne in den USA in den letzten 25 Jahren nur sehr langsam gestiegen. Wuchs das Einkommen einer durchschnittlichen Familie von 1947 bis 1973 noch real um mehr als drei Prozent im Jahr, so stagnierte es danach fast zwei Jahrzehnte. Dabei schnitten die oberen Einkommensgruppen besser ab als die unteren, weil sie mit ihren Fähigkeiten vom rapiden technologischen Wandel profitieren konnten. Damit nahm die Ungleichheit zu. Ökonomisch war beides nicht ohne Vorteil, weil der geringe Lohndruck amerikanische Waren wettbewerbsfähiger machte und die wachsende Lohndifferenzierung es erlaubte, auch schlechtausgebildete Arbeiter zu beschäftigen. Sozial waren diese Entwicklungen aber problematisch, weil sie ein Drittel der Bevölkerung vom Wohlstandsgewinn ausschlossen. Politisch schließlich lieferten Lohnstagnation und wachsende Ungleichheit Populisten wie Richard Gephardt, Ross Perot oder Pat Buchanan 1988, 1992 und 1996 die Munition für ihre protektionistischen und xenophoben Wahlkampfparolen. Das Tal der Tränen scheint aber durchschritten: Seit 1993 steigen nicht nur die Durchschnittseinkommen wieder schneller, sondern es geht auch die Ungleichheit bei der Einkommensverteilung zurück. Der amerikanische Traum, der ja den 31 Kindern ein besseres Leben als den Eltern und Aufstiegschancen über Klassen- und Rassenschranken hinweg versprach, ist heute lebendiger denn je. Bemerkenswert ist, dass die US-Bürger die positive Wirtschaftsentwicklung der ClintonJahre vor allem dem normalen Konjunkturzyklus (26%) zuschreiben. Der Ex-Präsident wird nur von 23 Prozent als Hauptverantwortlicher genannt, knapp vor Notenbankchef Alan Greenspan (17%). 8 Diese Zahlen belegen, dass es Clinton weniger gut als zum Beispiel Ronald Reagan gelungen ist, den ökonomischen Aufschwung als Folge seiner Politik darzustellen. Seinem designierten Nachfolger Al Gore fiel es deshalb auch so schwer, den wirtschaftlichen Erfolg der Clinton-Jahre als Motor für seinen eigenen Wahlkampf zu nutzen. 4. Die Wirtschaftspolitik der Bush-Administration George W. Bush gewann die Wahlen im November 2000 weniger als dass sie der amtierende Vizepräsident Al Gore verlor. Wer es als amtierender Vizepräsident allerdings nicht schafft, den längsten Wirtschaftsaufschwung in der US-Geschichte als Sprungbrett ins Oval Office zu nutzen und nicht einmal seinen Heimatstaat gewinnt, hat den Sieg auch nicht verdient. Letztlich bleibt Bush jedoch, wie der Economist titelte, ein "zufälliger Präsident". Diese Zufälligkeit drückt sich auch darin aus, dass Bush mit seinen zentralen Botschaften im Wahlkampf wenig Begeisterung auslöste. So forderte er, das marode öffentliche Schulsystem und die in absehbarer Zeit in die roten Zahlen rutschende Rentenversicherung durch mehr Eigenverantwortung zu sanieren. Das war mutig, ja schon fast riskant. Die Amerikaner reagierten nämlich skeptisch, denn die gern beschworenen Tugenden des Individualismus und des selbstständigen Anpackens von Problemen sind oft genau dies: gern beschworen. Wenn es um die staatliche Rente geht oder die mit öffentlichen Geldern finanzierten Schulen, dann hält es auch Joe Sixpack lieber mit Adenauers Wahlkampfmotto von 1957: "Keine Experimente". Selbst Bushs Versprechen, die von seinem Vater 1990 und Bill Clinton 1993 erhö hten Steuern zu reduzieren, straften die Wähler mit Indifferenz. Der Grund: Leid Tragende der Steuererhöhungen waren die Spitzenverdiener, deren Satz von 28 auf 40 Prozent stieg. Die unteren und mittleren Einkommensgruppen blieben verschont. Eine Familie, die weniger als 45.000 Dollar im Jahr verdient, zahlt wegen der Freibeträge und Abschreibungen schon heute meist mehr an Sozialabgaben als an Steuern, konnte also von der angepeilten generellen Senkung kaum etwas erwarten. Damit fehlte der Nährboden für eine breite Steuerrebellion, wie sie Reagan 1980 ins Weiße Haus gespült hatte. Obwohl die reichsten 10 Prozent der Privathaushalte zwei Drittel der Einkommenssteuern bezahlen, genossen niedrigere Steuern für sie keine Priorität. Sie waren in den "roaring nineties" die Hauptprofiteure der Hausse an der Wall Street gewesen, hatten mit ihren Unternehmen oder als "Dot-Commers" ein Vermögen verdient und dachten in ihren neuen Porsches und Jachten mehr an ihre üppigen Aktiengewinne als an das Finanzamt. Bushs Begründung, es sei nur gerecht, das prognostizierte riesige Haushaltsplus den Steuerzahlern zurückzugeben, verfing deshalb nur bei wenigen Wählern. Um seine Steuererleichterungen von 1,6 Billionen Dollar durch den Kongress zu bekommen, kann sich Bush also nicht auf einen klaren Wählerauftrag berufen. Allerdings kam ihm zu Hilfe, dass dem Rekord-Boom nach zehn Jahren die Puste ausging. Das erlaubte dem Präsidenten, Steuersenkungen nicht mehr nur als Gebot der Fairness, sondern auch als Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft anzupreisen. Notenbank-Chef Alan Greenspan, eigentlich 8 Vgl. Calmes, Jackie: Public Buys Tax-Cut Plan Sold By Bush, in: WSJ, 8.3.2001, S.A9/A10. 32 kein Freund fiskalpolitischer Experimente, und viele Demokraten fanden nun überraschend schnell Gefallen an Bushs Vorschlägen. 9 Den Sinneswandel erleichterten ihnen im März 2001 wieder einmal nach oben geschraubte Schätzungen des Haushaltsbüros des Kongresses, die für die nächsten zehn Jahre einen Überschuss von 5,6 Billionen Dollar vorhersagten. Zwar sollten die 2,3 Billionen Dollar aus den Überschüssen der Rentenversicherung tabu bleiben. Der Rest, so die Bush-Finanzexperten, reichte aber aus, die Staatsschulden abzubauen und die Steuererleichterungen zu finanzieren. In der Tat gelang es Bush, seine republikanischen Parteifreunde im Kongress bei der Stange zu halten und einige Demokraten für seine Pläne zu gewinnen. Im Juni 2001 konnte er die größte Steuererleichterung seit zwanzig Jahren durch seine Unterschrift in Kraft setzen. Zwar werden die Steuern in den nächsten zehn Jahren nur um 1,3 Bio. Dollar und nicht die von Bush angestrebten 1,6 Bio. Dollar gesenkt, wobei fast alle Familien im Spätsommer 2001 eine einmalige Steuerrückzahlung von 600 Dollar erhielten. Kaum ein Beobachter hätte einen solchen Schritt noch wenige Monate zuvor für möglich gehalten. Dies darf Bush durchaus als großen persönlichen Erfolg verbuchen. Allerdings ve rdüsterte der Verlust der republikanischen Mehrheit im Senat im Juni 2001 die Aussichten für weitere wirtschafts- und sozialpolitische Initiativen des Präsidenten. Als Bush Anfang September von seinem Arbeitsurlaub in Texas zurück nach Washington kam, musste er sich auf Vorwürfe der Demokraten gefasst machen, mit seinen Steuersenkungen den Haushaltsüberschuss verplempert zu haben. Der 11. September 2001 hat nicht nur die Außen- und Innen-, sondern auch die Wirtschaftspolitik der USA grundlegend verändert. Die ohnehin schwache Konjunktur dürfte durch die Folgen der Terrorattacken auf das Ausgabeverhalten der Konsumenten in die Rezession geschlittert sein. Die für den Winter 2001/2002 erwartete Erholung wird nun wohl erst im zweiten Quartal 2002 eintreten. Der Präsident steuert der Konjunkturflaute mit einem Ausgabenprogramm in Höhe von 50-75 Milliarden Dollar entgegen, was die Süddeutsche Zeitung schon vom "Keynesianer Bush" sprechen ließ. 10 Außerdem bewilligte das Parlament einhellig Sonderausgaben von 40 Milliarden Dollar für die Rettungs- und Bergungsaktionen sowie den Wiederaufbau New Yorks, beschloss ein Hilfepaket für die Luftfahrtindustrie und zusätzliche Gelder für das Pentagon. Bush, der angetreten war, den Staatsanteil an der Wirtschaft zurückzuschrauben, initiiert damit das steilste Haushaltswachstum seit Jahrzehnten. Der Budgetüberschuss für das Fiskaljahr 2000/01, das am 30. September endete, sollte einmal fast 300 Milliarden Dollar betragen. Als Folge der lahmenden Konjunktur, Bushs Steuerrückerstattung und der Sonderausgaben nach den Terroranschlägen betrug es nur noch 121 Milliarden Dollar. Nach vier Jahren im Plus wird der US-Haushalt in diesem Jahr wieder rote Zahlen schreiben. 11 Besondere Zeiten erfordern allerdings auch besondere Maßnahmen. Dank der bisher neun Zinssenkungen der Notenbank in diesem Jahr, der Steuererleichterungen und der expansiven Fiskalpolitik wird die US-Wirtschaft schon bald wieder auf einen Wachstumskurs einschwenken. Auch nach den Terroranschlägen bleibt das ökonomische Fundament der Vereinigten Staaten solide. 9 Vgl. McKinnon, John/Ip, Greg: Greenspan Softens Backing for Tax Cuts, in: WSJ, 5.3.2001, S.A2. 10 Vgl. Maier-Mannhart, Helmut: Der Keynesianer Bush, in: Süddeutsche Zeitung, 6./7.10.2001. 11 Vgl. Stevenson, Richard: U.S. Returning to Deficits As Costs of Attack Mount; in: IHT, 2.10.2001, S.9. 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 33 Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr in Prozent Graphik 1: Wirtschaftswachstum in den USA und in Deutschland im Vergleich 8 6 4 2 0 -2 -4 Quelle: OECD USA Bundesrepublik Deutschland 34 6 4 2 34 0 19 46 19 48 19 50 19 52 19 54 19 56 19 58 19 60 19 62 19 64 19 66 19 68 19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 * 20 04 * Prozent Graphik 2: Haushaltsüberschuss/-defizit des Bundes in Prozent des BIP -2 -4 -6 Carter -8 Quelle: Office of Management and Budget Reagan Bush, s. Clinton Bush, j. 35 Edwina S. Campbell Die Präsidentschaft Clintons im Rückblick: die transatlantischen Beziehungen Dieser Beitrag untersucht das Konzept, das die Regierung Clinton in den transatlantischen Beziehungen angesichts des Endes des Kalten Krieges und anderer, direkt nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes aktueller Themen, verfolgte. Um es in anderen Worten auszudrücken, bin ich der Ansicht, dass die amerikanische Politik gegenüber Europa in den Jahren ab 1993 weniger mit der Persönlichkeit oder politischen Ausrichtung des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu tun hatte, als vielmehr mit der allgemeinen Situation in den 1990er-Jahren als "Nachkriegsjahrzehnt". Jeder 1992 ins Amt gewählte Präsident hätte mit der Definition der neuen Rolle der Vereinigten Staaten in der Welt zu kämpfen gehabt. Schließlich bestand zum ersten Mal seit der Präsidentschaft Franklin D. Roosevelts keine Notwendigkeit mehr, die Bedrohung durch die Sowjetunion "einzudämmen". In diesem Zusammenhang war der prägende Zeitraum für die amerikanische Politik der Dezember 1991, nicht der November 1989. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion einerseits und den einige Wochen zuvor durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Maastricht getroffenen Entscheidungen andererseits veränderte sich die strategische Situation für die Vereinigten Staaten vollkommen. Die Entschlossenheit der EU, durch die EWU eine gemeinsame europäische Währung einzuführen und eine gemeinsame europäische Außenund Sicherheitspolitik (GASP) zu begründen, sowie die ehemaligen jugoslawischen Republiken Slowenien und Kroatien als unabhängige Staaten diplomatisch anzuerkennen, hatte weit reichende Auswirkungen auf die USA. Weder in Moskau, als die Sowjetunion auseinander brach, noch in Maastricht bei den Verhandlungen der EU-Staaten hatte Washington ein Mitspracherecht an den Verhandlungstischen, doch die Konsequenzen, der dort getroffenen Entscheidungen für die Vereinigten Staaten waren enorm. Die Regierung Bush schien die volle Bandbreite und Bedeutung der Veränderungen, die sich nach November 1989 vollzogen, nie ganz erfassen zu können. In den zwei Jahren von der Öffnung der Berliner Mauer bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion war ihre Arbeit zwar von der Annahme geprägt, dass er Kalte Krieg in Europa vorbei war, doch sie erkannte nicht, dass sich auch die globale strategische Situation radikal veränderte und bald nicht mehr wieder zu erkennen sein würde. Stattdessen ging die Regierung Bush davon aus, dass die Natur der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen wie auch in den 40 Jahren zuvor weiterhin die grundlegende Frage in der amerikanischen Außenpolitik bleiben würde. Präsident Bush erwartete, dass die UdSSR und Gorbatschows Präsidentschaft noch weit in die Zukunft hinein Bestand haben würden. Seine Regierung konzentrierte ihre Bemühungen infolgedessen auf den Abschluss von Übereinkünften mit Moskau, vor allem in den Bereichen der strategischen und konventionellen Rüstungskontrolle. Der Krieg im Persischen Golf 1990 bis 1991 war daher im Hinblick auf die Erwartungen Präsident Bushs und seiner hochrangigen Ratgeber besonders irreführend. Die zur Bildung und zum Einsatz der Koalition, die Kuwait aus der irakischen Besatzung befreite, nötige kooperative Haltung der Sowjetunion innerhalb der UN und hinter den Kulissen führte zu übertriebenen Hoffnungen seitens der Amerikaner auf eine "neue Weltordnung", die sich auf Einigkeit im Weltsicherheitsrat gründen sollte. Diese Erwartungen hingen – wie auch die Aussichten auf weit reichende Abrüstungsvereinbarungen – vom Überleben der Sowjetunion als der "anderen" Supermacht ab. An einen Zusammenbruch wurde nicht gedacht. Als genau dies jedoch 36 geschah, traf der Kollaps der UdSSR die Regierung Bush unvorbereitet, da man nie Alternativen zum Paradigmensatz des Kalten Krieges überdacht hatte: Konfrontation mit Moskau war möglich, Zusammenarbeit mit Moskau war möglich, doch die Möglichkeit, dass es die Sowjetunion vielleicht einmal nicht mehr geben könnte, war in der amerikanischen Außenpolitik bis dahin undenkbar gewesen. Bei ihrem Amtsantritt ein Jahr darauf erbte die Regierung Clinton die amerikanische Außenpolitik zu einem Zeitpunkt, als neue Themenbereiche um Aufmerksamkeit heischten, doch – wiederum zum ersten Mal seit Franklin D. Roosevelt keine "klare und gegenwärtige Bedrohung" der Sicherheit der Vereinigten Staaten vorlag. Clinton und Roosevelt wurden beide, obwohl ihre Wahl sechzig Jahre auseinanderliegt, in der Hoffnung ins Amt gewählt, dass sie effektive Lösungen "für die Wirtschaft, was sonst wohl" finden würden, was ihren republikanischen Vorgängern nicht gelungen war. Doch die Entscheidung, die die amerikanischen Wähler 1992 gegen George Bush trafen, ist auch auf das vorherrschende – wenn auch nicht durchdachte – Gefühl der Bevölkerung zurückzuführen, dass er nicht der geeignete Präsident für die Welt nach dem Kalten Krieg sei. Die Amerikaner schätzten Bush sehr für die Rolle, die er während des Kalten Krieges gespielt hatte (und zum damaligen Zeitpunkt auch für seine Rolle in der Führung der Koalition gegen den Irak im Golfkrieg von 1990 bis 1991), doch wie die britische Öffentlichkeit, die Winston Churchill 1945 abgewählt hatte, waren sie nicht sicher, dass der Mann, der den (Kalten) Krieg gewonnen hatte, auch der richtige Präsident für Friedenszeiten war. Bill Clinton trat sein Amt mit großen Erwartungen an – seinen eigenen und denen des amerikanischen Volkes. Die meisten dieser Erwartungen richteten sich in der Tat auf die Leistung der amerikanischen Volkswirtschaft, doch es stand auch eine lange Liste außenpolitischer Themen auf der Tagesordnung. Im Hinblick auf Europa befanden sich unter diesen Themen: der Umgang mit der neu so benannten Europäischen Union (EU); die Zukunft der NATO und der Rolle Amerikas darin; die Aussichten für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), mit ihren vielen neuen Mitgliedern, den Nachfolgestaaten der Sowjetunion; die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten; wirtschaftliche und politische Reformen der ehemaligen Warschauer-PaktStaaten, darunter Russland; und vor allem der Krieg in Bosnien und dessen Auswirkungen auf die gesamte Balkanregion. All diese Themen waren zwar auf der transatlantischen Tagesordnung Washingtons, doch diese Tagesordnung selbst stand nicht mehr wie noch zu Zeiten des Kalten Kriegs an erster Stelle auf der Gesamttagesordnung der amerikanischen Außenpolitik. Die erste große Veränderung im Bereich der Außenpolitik von der Regierung Bush hin zur Regierung Clinton bestand in der Tat darin, dass die politisch-militärische Rolle der Vereinigten Staaten in Europa auf der Prioritätenliste nach unten rutschte. Anfänglich schien dies zu bedeuten, dass sich ein positiver Meinungsumschwung in der Haltung Amerikas gegenüber Frankreichs Bemühungen, unabhängige europäische Verteidigungskapazitäten zu schaffen, ergeben würde. Diesen Bemühungen hatte vorher die Regierung Bush entgegen den eigenen Interessen der Vereinigten Staaten voreilig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Versuch der Regierung Clinton, Washingtons Beziehungen zu Paris auf eine neue Grundlage zu stellen, scheiterte jedoch vor dem Ende Clintons erster Amtszeit schließlich an der Frage der Neuorganisation und Erweiterung der NATO. Die Bemühungen um konstruktivere Beziehungen zwischen den USA und Frankreich erreichten 1995 während des ersten Amtsjahres von Präsident Chirac ihren Höhepunkt, doch später kehrte man wieder zu den regelmäßigen Schlagabtäuschen zurück, was sich – leider – in beiden Hauptstädten als Norm eingebürgert hat. 37 Die größere Gelassenheit, die die Regierung Clinton anfänglich im Vergleich zu ihrer republikanischen Vorgängerin gegenüber einer politischen (GASP), wirtschaftlichen (EWU) und schließlich auch verteidigungspolitischen (ESDI) Neuorganisation der Europäischen Union in den Tag legte, zeigte auch recht bald ihre Schattenseiten. Im Gegensatz zu den Hoffnungen, denen damals Präsidentschaftskandidat Clinton während der Wahlkampagne von 1992 Auftrieb gegeben hatte, zeigte er bald eine genauso geringe Bereitschaft, amerikanische Truppen für die friedensschaffenden Missionen im ehemaligen Jugoslawien zu entsenden, wie sein Amtsvorgänger. Der durch ihn eingesetzte Außenminister, Warren Christopher, legte innerhalb von nur wenigen Wochen nach seinem Amtsantritt ein einzigartiges Unvermögen an den Tag, die Verhandlungen für Amerika innerhalb der NATO auf eine solche Weise zu führen, dass man eventuell einen bündnisweiten Konsens über die Balkanpolitik hätte erzielen können. Darüber hinaus kamen der Präsident und sein erster Verteidigungsminister, Les Aspin, nicht gegen die Person an, die sich am entschiedensten gegen einen Einsatz von USStreitkräften auf dem Balkan wandte, den Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff und somit obersten Befehlshaber der US-Streitkräfte, Colin Powell. Dass die Situation im ehemaligen Jugoslawien relativ weit unten auf der Liste außenpolitischer Prioritäten der Regierung stand, lag jedoch nicht ausschließlich an mangelndem Verhandlungsgeschick und Bürokratie oder an persönlichen Differenzen zwischen den Beteiligten. Während der ersten Amtszeit Clintons trafen zwei Überzeugungen zusammen, die beide mehr als deutlich gegen einen Einsatz von US-Streitkräften auf dem Balkan sprachen. Erstens führten innenpolitische und wirtschaftliche Prioritäten sowie die eigenen Neigungen des Präsidenten zur Überzeugung, dass die amerikanische Diplomatie in drei Bereichen gefragt war – worunter sich allerdings das ehemalige Jugoslawien nicht befand. Diese Bereiche waren die beiden amerikanischen Kontinente, um die Nordamerikanische Freihandelszone (NAFTA) zu schaffen und später auch zu erweitern; Irland, um der Republik Irland, dem Vereinigten Königreich und der Bevölkerung Nordirlands dabei zu helfen, zu einem anhaltenden Friedensprozess zu gelangen; und, was bekannter ist, der Nahe Osten, mit dem Ziel, eine Versöhnung zwischen Israel, den Palästinensern und den arabischen Staaten zu erreichen. Die zweite Überzeugung war, dass nun keine Bedrohung seitens Moskaus mehr herrschte und in Anbetracht von 40 Jahren Frieden und Wohlstand in Westeuropa die diplomatischen und militärischen Ressourcen der Vereinigten Staaten anderweitig besser eingesetzt werden konnten und die Europäer Krisen in ihrem eigenen Hinterhof selbst bewältigen sollten. Nordirland wurde in diesem Zusammenhang überhaupt nicht als "europäisches" Thema angesehen, sondern als ein Problem zwischen Großbritannien und Irland, an dem die Vereinigten Staaten ein historisches Interesse hatten. Diese Überzeugung wurde oft mit der Weigerung, amerikanische Streitkräfte für friedensschaffende und friedenserhaltende Missionen zu entsenden, für die damals General Powell stand, durcheinander gebracht. Obwohl beide eine Zeit lang dasselbe Ergebnis im Hinblick auf die Politik der Vereinigten Staaten gegenüber dem ehemaligen Jugoslawien herbeiführten, sind beide keineswegs miteinander gleichzusetzen. Im Gegensatz zur Regierung davor bildete sich während der Präsidentschaft Clintons sehr bald eine deutliche Neigung dazu heraus, die Vereinigten Staaten aus den militärischen Verpflichtungen zurückzuziehen, die während des Kalten Krieges gegenüber Westeuropa eingegangen worden waren. Aus dieser Neigung sprach eine Frage, die seit 1940 kein amerikanischer Präsident hatte beantworten müssen: Welche politisch-militärische Rolle sollten die Vereinigten Staaten in einer Welt einnehmen, in der ihr eigenes Überleben nicht mehr existenziell bedroht war? Seit das nationalsozialistische Deutschland Frankreich besiegt und die britischen Streitkräfte sich aus Dünkirchen zurückgezogen hatten, hatte sich jeder Präsident von Roosevelt bis Bush mit 38 einem außenpolitischen Programm um die Präsidentschaft beworben, auf dem Vorschläge, der Bedrohung des amerikanischen Volkes zu begegnen, ganz oben standen. Die Quelle dieser Bedrohung verlagerte sich gegen Ende der 1940er-Jahre von Berlin und Tokio nach Moskau; die Natur des Problems blieb jedoch dieselbe. Nach 50 Jahren, in denen man der amerikanischen Öffentlichkeit die weltweiten diplomatischen und militärischen Verpflichtungen als die notwendige Antwort auf eine existenzielle Bedrohung erklärt hatte, waren weder die demokratische noch die republikanische politische Führung auf die Herausforderung vorbereitet, einen neuen innenpolitischen Konsens zur amerikanischen Außenpolitik ohne eine solche Bedrohung zu schaffen. Sie waren sogar oft weniger als die amerikanische Öffentlichkeit in der Lage oder bereit, zuzugeben, dass ein neuer Konsens nötig war. Dies gilt leider besonders für die letzten 18 Monate der Regierung Bush. Man sprach von einer "neuen Weltordnung" und – noch schlimmer – von einem "Status quo plus", konnte damit jedoch nicht vertuschen, dass man keine neuen Konzepte hatte, welche Rolle die amerikanische Außenpolitik nach dem Ende des Kalten Krieges spielen sollte. Man konzentrierte sich darauf, die NATO als Institution beizubehalten, obwohl man nicht wusste, welche Rolle sie zukünftig einnehmen sollte. "Entweder wir gehen über unser Bündnisgebiet hinaus, oder wir können einpacken", sagte Generalsekretär Manfred Wörner damals; doch was sollte die NATO tun, und wo? So kam es auch zu Washingtons heftigen Reaktionen auf alle europäischen Initiativen, die den Status quo der Allianz in Frage zu stellen schienen. Eine Zeit lang konnte man wegen Saddam Hussein wieder von einer Bedrohung durch feindliche Mächte sprechen, und dies rettete die politischen Entscheidungsträger und Kräfte in den USA davor, sich zu sehr über die Welt nach dem Ende des Kalten Kriegs Gedanken zu machen. Die Verschnaufpause währte jedoch nur kurz. So ineffektiv und schlecht durchplant sie auch war, stellte die amerikanische Außenpolitik während Präsident Clintons erster Amtszeit einen Versuch dar, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Die Neigung zur Annahme, dass die wohlhabenden Staaten Westeuropas in der Lage sein sollten, mit dem Krisenmanagement auf ihrem eigenen Kontinent fertig zu werden, war überdies auch nicht unvernünftig. Doch bis zur zweiten Amtszeit Clintons war die Außenpolitik wieder zu den bekannten Strukturen der Regierung Bush zurückgekehrt. Die transatlantische Tagesordnung stand wieder an der Spitze der Gesamttagesordnung Amerikas, die NATO wurde als das Hauptvehikel amerikanischen Einflusses innerhalb Europas und auf Europa bekräftigt, und in Washington misstraute man den Plänen der EU für die GASP und die ESDI zutiefst. Dabei standen jedoch weder die Regierung der Vereinigten Staaten noch die amerikanische Privatwirtschaft der EWU jemals so misstrauisch gegenüber, wie dies viele europäische Leitartikler zu glauben scheinen. Was war passiert? Drei Hauptfaktoren veranlassten den Präsidenten und seine Ratgeber, von ihrer anfänglichen Neigung, die militärischen Verpflichtungen der USA gegenüber Europa radikal zu verändern und daher die Natur, wenn nicht sogar die Existenz der NATO in Frage zu stellen, abzurücken. Diese Faktoren waren: der Widerwille der Bundesrepublik Deutschland, eine offene politisch-militärische Führungsrolle innerhalb Europas einzunehmen; die Erkenntnis der Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts, in erster Linie Polens, Ungarns und der Tschechischen Republik, dass sich ihr Beitritt zur Europäischen Union wohl um einige Zeit hinauszögern würde; und die Verschlimmerung des Krieges in Bosnien. Die Bündelung dieser drei Faktoren bewirkte in den zwölf Monaten von Mitte 1994 bis Mitte 1995 eine Verschiebung der amerikanischen Politik. Da diese Verschiebung weg von einer radikalen Restrukturierung der transatlantischen Beziehungen und hin zu einem "Status quo plus" verlief, erregte sie fast keine Aufmerksamkeit. So verließ Präsident Clinton wie Präsident Bush vor acht Jahren sein 39 Amt, ohne eine neue Antwort auf die Frage gefunden zu haben, welche politisch-militärische Rolle Amerika in der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges spielen sollte. Die Entwicklung der drei Faktoren im Verlauf der ersten Amtszeit Präsident Clintons zu untersuchen, würde hier zu weit führen. Sie haben jedoch eines gemein, worauf hingewiesen werden sollte. Ihnen allen liegt eine negative Meinung über die politische und militärische Leistung der Europäischen Union zu Grunde. Während zweier Amtszeiten im Weißen Haus haben der Präsident und seine Ratgeber stets die wirtschaftliche Seite der EU, als Handelspartner und als Konkurrent, respektiert. Doch bis zum Ende seines zweiten Amtsjahres hatte Bill Clinton die Annahme der Regierung Bush, dass es ohne die Führung Amerikas ein politisch-militärisches Vakuum in Europa gäbe, übernommen. Von 1991 bis 1992 hatte das außenpolitische Team bestehend aus Bush, Baker und Scowcroft nur negative Schlüsse aus dieser Annahme gezogen. Man genoss ein gewisses Ausmaß an Schadenfreude über Europas fehlgeschlagene Versuche des Krisenmanagements auf dem Balkan und torpedierte gleichzeitig über die Briten und die Deutschen alle Versuche Frankreichs, eine größere politisch-militärische Kohärenz unter den europäischen Staaten zu schaffen. Die Regierung Clinton zog 1994/95 zweierlei politische Schlüsse aus derselben Annahme, nämlich die Notwendigkeit der NATO-Erweiterung und die Notwendigkeit eines militärischen Eingreifens der Vereinigten Staaten, um den Krieg in Bosnien zu beenden. Hätte es einen europäischen – das heißt einen französisch-deutschen – Konsens über die Erweiterung der EU und über den Umgang mit dem ehemaligen Jugoslawien gegeben, hätten die USA wahrscheinlich keine der beiden genannten Politiken verfolgt. So jedoch wurde derselbe amerikanische Politiker zur treibenden Kraft hinter beiden Politiken, erst als Botschafter der USA in Bonn, dann als stellvertretender Außenminister für Europa: Richard Holbrooke. Holbrooke kehrte, nachdem ihn während seiner Zeit in Bonn der deutsche Verteidigungsminister Volker Rühe davon überzeugt hatte, dass eine formale Erweiterung der NATO, und nicht nur eine "Partnerschaft für den Frieden" mit den Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts nötig war, 1994 nach Washington zurück. Bevor die Debatte, ob eine Erweiterung wirklich im Interesse der Vereinigten Staaten lag, richtig beginnen konnte, war es ihm bereits gelungen, sie zu beenden und die Aufmerksamkeit auf die Diskussion zu lenken, wie und wann die Erweiterung durchgeführt werden sollte. Ein Jahr später erlangte Holbrookes Verhandlungstaktik in Dayton Berühmtheit, doch die NATO-Episode war lehrreicher. Die Regierung Clinton erlaubte es ihm, seine entschlossene, ja sogar unilaterale Unterstützung auszuüben, ohne dass ihm seitens des Präsidenten oder des Außenministers Beschränkungen auferlegt worden wären. Holbrookes Unterstützung der NATO-Erweiterung gleicht in vielerlei Hinsicht spiegelbildlich Colin Powells unilateraler Behinderung unter anderem eines Einsatzes auf dem Balkan, bei der auch ihn weder das Weiße Haus noch der Verteidigungsminister in seine Schranken verwiesen hatte. Der Grund, aus dem der Präsident schließlich die Erweiterung der NATO und die militärische Intervention in Bosnien zu Teilen der amerikanischen Außenpolitik machte, worüber nur er entscheiden konnte, war, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten keine brauc hbaren Alternativen anboten. Der sicherste Indikator für die politisch-militärische Bankrotterklärung der EU war der bis 1994 vollzogene Wandel Vaclav Havels vom Gegner zum Befürworter der NATO-Mitgliedschaft der Tschechischen Republik. Wie die meisten osteuropäischen Dissidenten, die in den Jahren 1989 und 1990 politische Macht erlangt hatten, war Havel ursprünglich für eine Mitgliedschaft seines Landes in der Europäischen Gemeinschaft 40 gewesen, nicht aber für seine Mitgliedschaft in einem militärischen Bündnis. 1994 war es in Prag (und Warschau und Budapest und anderorts) klar geworden, dass eine Mitgliedschaft in der NATO wahrscheinlich auf absehbare Zeit die einzige angebotene formale Verbindung zum "Westen" sein würde. Frankreich hatte eine Reform der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik der EU vereitelt, und Deutschland war es, indem es die Vereinigten Staaten in der erweiterten NATO involviert hielt, gelungen, sich vor der Übernahme einer offenen politischmilitärische Führungsrolle innerhalb Europas zu drücken. Die Kosten dafür waren jedoch hoch. Im Gegensatz zu allen Äußerungen der 1980er-Jahre stellte sich heraus, dass das "gemeinsame Europäische Haus" zwar für Österreich, Schweden und Finnland offen stand, aber nicht für die Osteuropäer. Durch den Kosovo-Konflikt im Jahre 1999 wurden Europa und die Vereinigten Staaten mit der Nase auf die Kosten der Abdankung der EU als politische Führungsmacht und der darauf folgenden Rückkehr der USA zu einer Politik des "Status quo plus" während des gesamten Jahrzehnts gestoßen. Eigenartigerweise schienen beide Seiten, von dem, was sie sahen überrascht und gar nicht angetan zu sein. Tatsächlich hat die politisch-militärische Dominanz der Vereinigten Staaten während der Krise und des Krieges jedoch nichts Überraschendes an sich. Sie war nicht mehr als die logische Folge der Entwicklung der transatlantischen Beziehungen während der 1990er-Jahre. Die Regierung Clinton hatte das Jahrzehnt mit einer offenen Frage begonnen. Zu Beginn eines neuen Jahrtausends hat sie nun ihr Amt verlassen und diese Frage ist noch immer ungelöst. Die politisch-militärische Rolle der Vereinigten Staaten in der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges ist in allen ihren globalen Ausprägungen unausgegoren und sowohl für die Amerikaner als auch für ihre Verbündeten unbefriedigend. Im Hinblick auf Europa lässt sich aber zumindest erkennen, warum die Vereinigten Staaten keine neue Definition ihrer Rolle innerhalb der transatlantischen Beziehungen getroffen haben: ihre wichtigsten europäischen Verbündeten waren daran – zumindest bis 1999 – gar nicht interessiert. Aus vielerlei eigenen Gründen, die von Land zu Land und in einzelnen Abschnitten des Jahrzehnts unterschiedlich waren, erwarteten die Europäer weiterhin von den Vereinigten Staaten, ihr ultimativer Sicherheitsgarant zu bleiben, auch weil die meisten europäischen Staaten ihre eigenen Verteidigungsbudgets kürzten und Kapazitäten abbauten. Bonn und London argumentierten lautstark, ausdauernd und am Ende erfolgreich, dass die NATO und die militärische Präsenz der Vereinigten Staaten in Europa auch trotz der Tatsache, dass die Sowjetunion nicht mehr existiert, von grundlegender Bedeutung seien. Angesichts des Krieges auf dem Balkan, der Verweigerung ihrer EU-Mitgliedschaft und der Tatsache, dass die Versuche Brüssels, Belgrad auf diplomatischem Wege zur Räson zu bringen, fehlschlugen, stimmten die Osteuropäer dem bei. Am Ende stimmten auch die Amerikaner zu. Folglich sollte es niemanden überraschen, dass während des letzten Amtsjahres der Regierung Clinton in den transatlantischen Beziehungen eine Begriffswahl vorherrschte, die an die frühen 1980er-Jahre erinnerte: "Schurkenstaaten" anstatt "feindlicher Mächte"; "NMD" anstatt "SDI"; Lücken in und Initiativen für "Verteidigungskapazitäten". Während der 1990er-Jahre vermieden es die Europäer selbst, durch die Betonung der Rolle Amerikas, ihre eigene politisch-militärische Aufgabe in der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges zu überdenken. Das Ergebnis war vorhersehbar: In Washington machte sich spätestens 1998 ein Bewusstsein breit, die "unentbehrliche", einzige Supermacht (der Begriff "Hypermacht" gefällt den Amerikanern nicht) zu sein, was sich 1999 darin manifestierte, dass die USA den Luftkrieg gegen Belgrad fast im Alleingang führten. 41 Wohin dieses Bewusstsein die Vereinigten Staaten in den kommenden Jahren führen wird, wird eine andere Regierung zu entscheiden haben, nicht mehr die Clintons. Was man über das erste Jahrzehnt nach dem Kalten Krieg jedoch sagen kann, ist, dass es in einem Vergleich mit dem ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl auf europäischer wie auch auf amerikanischer Seite schlechter abschneidet. Von 1989 bis 1999 setzten weder die Europäer noch die Amerikaner die Vorstellungskraft und Kreativität ein, mit der sie die von 1945 bis 1955 aktuelle Themen angingen. Während des vergangenen Jahres dämmert nun – teilweise wohl auf Grund der Enttäuschung und Frustration, die der Kosovo-Konflikt auf beiden Seiten des Atlantik auslöste – zunehmend die Erkenntnis, dass der "Status quo plus" ausgedient hat. Wie er ersetzt werden wird, bleibt die zentrale Herausforderung für das europäischamerikanische Verhältnis. 42 43 Beate Neuss Die transatlantischen Beziehungen in der Ära Clinton 1. Grundlegende Veränderungen im transatlantischen Beziehungsgeflecht Bei aller Kontinuität in den transatlantischen Beziehungen über das Ende des Ost-WestKonflikts hinaus – die Vereinigten Staaten bleiben Europas wichtigster Partner – haben sich grundlegende Koordinaten des Verhältnisses geändert. Das Streben nach einer neuen Definition alter Kooperationsmuster und neuer Aufgaben prägte das Jahrzehnt nach dem Ost-WestKonflikt. Ich stimme Edwina Campbell zu: Die Neunzigerjahre waren – auf beiden Seiten des Atlantiks – Jahre der Lösung aus den Denkmustern einer über Jahrzehnte vertrauten internationalen Ordnung und eine Zeit der Suche nach einer neuen Weltordnung, nach neuen Strategien und Konzepten. Diese Suche ist auch nach der Ära Clinton nicht abgeschlossen: Welche Politik die USA gegenüber Russland und China betreiben werden, wie die Beziehungen Deutschlands bzw. der Europäischen Union zu Russland nach der EU-Osterweiterung und der zweiten NATO-Erweiterung aussehen werden, ist noch ebenso undefiniert, wie die konkrete Umsetzung und der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) und ihr "interlocking" mit der NATO. Nach 1945/46 waren die Herausforderungen des Kalten Krieg vergleichsweise eindeutig. Entsprechend schnell fanden die atlantischen Partner innerhalb von wenigen Jahren klare Antworten. Die Neujustierung des internationalen Systems hängt heute nicht nur von der Anpassung an veränderte Machtfaktoren und bleibende Aufgaben ab, sondern auch von der Berücksichtigung gänzlich neuer internationaler Herausforderungen. Es sind heute weit mehr Bälle im Spiel, die in eine Ordnung und in eine kohärente Strategie eingebracht werden müssen, als in den Jahren nach 1945. Die Epochenzäsur mag jenseits des Atlantiks mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Dezember 1991 verbunden werden. Aber auch dort verstand die Bush-Administration sehr wohl, dass sich mit den Ereignissen des Winters 1989/90 das Mächtegleichgewicht drastisch verschoben hatte und es nun galt, Moskau durch Einbindung und durch politische und ökonomische Anreize auf eine pro-westliche Schiene zu bringen bzw. dort zu stabilisieren. 1 Fraglos gilt der November 1989 nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa als die Zäsur zum Kalten Krieg. Ihr Symbol ist der Fall der Berliner Mauer. 2 Freilich, es gab genug Westeuropäer, Deutsche zumal, die, um den Status quo erträglich zu finden oder weil er bequem erschien, ihn zu einem wünschenswerten Stabilitätsfaktor in Europa stilisiert hatten und sich eine fundamentale Änderung durch eine deutsche Einheit nicht vorstellen konnten. Kluge westeuropäische Beobachter, wie übrigens auch der amerikanische Botschafter in Bonn, Vernon Walters, sahen jedoch bereits in der Flucht von Tausenden DDR-Bürgern im Sommer 1 Vgl. Zelikow, Philip/Rice, Condoleezza: Sternstunde der Diplomatie. Die deutsche Einheit und das Ende der Spaltung Europas, Berlin 1997, S.185ff. 2 Im März 1989 war die Frage, ob und wie das Problem der deutschen Einheit angegangen werden sollte, zwar noch umstritten. Vgl. ebd., S.55ff. Klar war aber bereits am 30.5.1989, dass der Präsident eine grundlegende Änderung der europäischen Strukturen anstrebte. Vgl. seine Rede am 30.5.1989 in Mainz, in: Partner für Frieden und Freiheit. Der Brüsseler NATO-Gipfel, hg. vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bonn 1989, S.95-108. 44 1989 die Vorboten der Deutschen Einheit und hatten am 9. November 1989 wenig Zweifel, dass die Tage eines eigenständigen ostdeutschen Staates gezählt waren. 3 Die Zäsur war nicht der Zerfall der Sowjetunion, sondern die Öffnung der Berliner Mauer. Denn er veränderte grundlegend die Machtverteilung in Europa und die transatlantischen Beziehungen: Innerhalb einer Nacht verdeutlichte er, dass Moskau die Herrschaft über sein Reich verloren hatte. Wenn die bankrotte DDR, die westliche Klammer der Zwinge, die das sowjetische Kolonialreich zusammenhielt, schwand, weil sie ihre Bürger nicht durch Demokratie und Wohlstand halten konnte, wie sollte das stets rebellische Polen, das in der marktwirtschaftlichen Reform und inneren Lockerung fortgeschrittene Ungarn, aber auch die Tschechoslowakei und die anderen Staaten an Moskaus Seite gehalten werden? Konnte sich die Sowjetunion ohne ihr östliches Vorfeld stabilisieren? Wohl kaum. Wirtschaftlich nicht weniger erschöpft als ihre Satelliten, zu ausgeblutet, um noch ein bedrohliches Militärpotenzial zu entwickeln und bereits mit Zerfallserscheinungen in den südlichen Regionen konfrontiert, war es nur noch die Frage, wie sich der Abschied von der "Supermachtposition" und die Entkolonialisierung vollziehen würden. Wenn Moskau als Bedrohungsfaktor endgültig wegfiel, musste sich auch die Rolle Washingtons in Europa ändern. Genauso wenig wie Harry Truman nach dem Weltkrieg hatte George Bush nach dem Kalten Krieg ein Konzept für die Zeit. In der restlichen Amtsperiode tat er das einzig Vernünftige, um den künftigen Strukturen der Ost-West-Beziehungen eine entwicklungsfähige Basis zu geben: Er nutzte das Vertrauensverhältnis mit Moskau, um amerikanische Interessen umzusetzen. Gerade weil der geschwächte Gorbatschow als gleichwertiger Partner behandelt wurde, konnte in den 2 plus 4-Verhandlungen die NATO-Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands ohne Verstimmung oder Bruch mit Moskau erreicht werden. Aus gleichen Gründen konnten die START-Verhandlungen abgeschlossen und später die Ukraine und Weißrussland bewogen werden, ihr atomares Potenzial an Russland zu übertragen – aus amerikanischer (und europäischer) Sicht ein großer Vorteil, da eine bessere Kontrolle des unklaren Materials Gewähr leistet zu sein scheint. Auch unter Jelzin war die russische Politik bis Mitte 1993 partnerschaftlich orientiert. Russland agierte "aufgeklärt" nach westlichem Verhaltensmuster und strebte nach Eingliederung in das internationale System, in dem es Washington als seinen strategischen Partner ansah. Erst Mitte 1993 begann Jelzin der Außenpolitik ein betont nationales Gepräge zu geben. Die Außenpolitik nahm, wie auch die Wirtschaftspolitik, sprunghafte Züge an. Auf Grund der personellen Konstellation in Moskau war dies wohl nicht zu verhindern. 4 Der Maastrichter Vertrag mit der Europäischen Währungsunion als bedeutendstem Vertragsbestandteil ist ein weiterer einschneidender Faktor für das transatlantische Verhältnis. Er wurde praktisch zeitgleich mit dem Zusammenbruch der UdSSR paraphiert. Ratifiziert wurde der Vertrag aber erst 1993 nach großen Mühen. Ob die Währungsunion umgesetzt werden würde, war bis 1997 nicht mit Sicherheit abzusehen. Somit ist die Schaffung des Euro 1998 das markante Datum. Bis dahin hätte die Währungsunion das Schicksal des Binnenmarktes erleiden können, der in den Verträgen von 1958 vorgesehen war und doch erst 1993 realisiert wurde. Richtig ist aber, dass die grundlegende Entscheidung der EU, sich eine gemeinsame Währung zu geben, eine Zäsur für das transatlantische Verhältnis darstellt: Der Euro wird die internationale Währungspolitik verändern und langfristig Europa auf diesem Gebiet von den USA unabhängiger machen. Washington wird, mit dem Euro als konkurrierender Reservewährung 3 Walters, Vernon: Die Vereinigung war voraussehbar, Berlin 1994. 4 Vgl. hierzu die Beiträge von Lothar Rühl und Hannes Adomeit. 45 zum Dollar, seine eigene Finanz- und Währungspolitik nicht mehr ausschließlich auf die innenpolitischen Bedürfnisse ausrichten können. 5 2. Folgen für die Außen- und Sicherheitspolitik Die veränderte machtpolitische Situation und die Suche nach neuen Kooperationsformen führte auf beiden Seiten des Atlantiks zu Zielkonflikten und Widersprüchlichkeiten, die ihrerseits wiederum Anlass zu transatlantischen Friktionen gaben. Es lässt sich unschwer prognostizieren, dass diese Zielkonflikte auch im 21. Jahrhundert ein Problem der transatlantischen Beziehungen bleiben werden. Die Notwendigkeit amerikanischer Präsenz in Europa und die multilaterale Einbindung der amerikanischen Vormacht in ein Bündnis formal Gleichberechtigter ist begründungsbedürftig geworden. Beiden Seiten des Atlantiks wurde zudem in der Ära Clinton zunehmend bewusst, dass nach dem Ende der Bedrohung durch die Sowjetunion amerikanische und europäische Interessen nicht mehr selbstverständlich identisch sind. Die Europäer haben mit Blick auf die Politik gegenüber den "rogue-states" alias "states of concern", gegenüber Russland oder China oft eine andere Auffassung. Selbst wenn sie den amerikanischen Maßnahmen zustimmen, so sehen sie diese Politik oft nicht als in ihrem nationalen Int eresse an. Während der Clinton-Präsidentschaft wuchs in den Vereinigten Staaten das Bewusstsein, als alleinige Supermacht den Kampfplatz des Kalten Kriegs verlassen zu haben. Der Aufschwung der amerikanischen Wirtschaft in den Neunzigerjahren und die unübersehbare wissenschaftlich-technologische Führung des Landes sowohl in der Entwicklung ziviler wie militärischer Güter stärkte Washingtons Selbstbewusstsein. Gleichzeitig verlor die Administration, mehr noch der Kongress, das im Kalten Krieg dominante Interesse an Europa, da von ihm keine Sicherheitsbedrohung mehr ausging. Kongressabgeordnete kommen seither kaum noch auf den alten Kontinent, das Wissen auf dem Kapitol über die Bedingungen europäischer Politik nimmt rapide ab – eine bedeutsame Veränderung für den politischen Willensbildungsprozess in Anbetracht des Einflusses von Mitgliedern des Kongresses in außen- und handelspolitischen Fragen. "Rogue-states", Krisen in anderen Erdteilen, die Beziehungen mit China und Wirtschaftsfragen absorbierten die Aufmerksamkeit der Volksvertreter, sofern sie sich mit außenpolitischen Themen beschäftigten. In Europa befremdete das ungebrochene Machtbewusstsein Washingtons, das Außenminister Warren Christopher folgendermaßen artikulierte: "We are the only superpower in the world. We have the responsibility to act unilaterally where that's appropriate, and to lead multilaterally where that's appropriate. We will protect our vital interests, if we have to, unilaterally". 6 Die Wahrnehmung eines zunehmenden Unilateralismus der amerikanischen Politik – sei es in Hinblick auf die Vereinten Nationen, bei der Schaffung eines Internationalen Strafgerichtshofes, in handelspolitischen Fragen und nicht zuletzt in der Umweltpolitik – und die Erfahrung, letztlich nach wie vor von Washingtons Entscheidungen abhängig zu sein, beförderte den europäischen Selbstbehauptungswillen. Die Europäer sahen die im Kalten Krieg gesuchte Führungsrolle der USA und die bereitwillige Unterordnung unter die Hegemonialmacht seit 1989/90 nicht mehr als selbstverständlich an. 7 Die Mitglieder der Europäischen Union – einige, wie Frankreich mehr, andere, wie Großbritannien weniger – streben seither im außen- und 5 Bergsten, C. Fred: America and Europe: Clash of the Titans?, in: Foreign Affairs March/April 1999, S.20-34. 6 Christopher, Warren: zit. nach U.S. Policy Information and Texts, 3.6.1993, S.19. 7 Bierling, Stephan: Amerika führt – Europa folgt?, in : Internationale Politik, 2/1998, S.9-18. 46 sicherheitspolitischen Bereich nach unabhängiger europäischer Handlungsfähigkeit, die die EU als eigenständigen Faktor in der internationalen Politik etablieren soll. Insbesondere Frankreich artikulierte das Unbehagen an der amerikanischen Übermacht. Es strebt nach Ebenbürtigkeit der Europäer und trifft sich mit potenziellen Gegnern und Rivalen Amerikas – wie z.B. China und Russland – in seiner Forderung nach einer multipolaren Welt. 8 Dem amerikanischen Außenminister ist es 1995/96 nicht gelungen, die Annäherung Chiracs an die NATO produktiv umzusetzen. Die mangelnde Bereitschaft, Frankreich als Belohnung für die Heimkehr in den Schoß der NATO das Oberkommando Südosteuropa zu übertragen, und Dissonanzen über die von Holbrooke geleiteten Balkan-Verhandlungen und über die Kandidaten für die NATO-Osterweiterung führten schnell zu einem Ende der überraschenden Romanze zwischen Frankreich und der NATO. In einem sich immer tiefer integrierenden Europa, in dem Deutschland zugleich engster Partner Frankreichs und – neben Großbritannien – engster Partner der Vereinigten Staaten ist, birgt der Dauerkonflikt zwischen Paris und Washington Belastungen für das Verhältnis der EU zu den USA, denn Frankreich ist zweifellos die treibende Kraft hinter der gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik. Gleichzeitig sind die Europäer sich bewusst, dass die USA auch nach dem Ende des OstWest-Konflikts als "europäische Macht" unersetzlich sind. Die Vereinigten Staaten balancieren das innereuropäische Mächtegleichgewicht aus, weil sie das deutsche wie das russische Gewicht gleichermaßen neutralisieren. In den Balkankonflikten war zudem die sicherheitspolitische Abhängigkeit vom militärischen und politischen Potenzials Washingtons mit Händen zu greifen. Gerade dies befördert jedoch das Missbehagen gegenüber einer als zunehmend unilateral handelnden "Hyperpower". Europa verfügt nach dem Ende der großen innereuropäischen Sicherheitsbedrohung und dem Ende der globalen Konfrontation mit seinem Bevölkerungspotenzial, seinem Bruttosozialprodukt und seinem technologischen Know-how über ausreichend Kapazitäten, mit der es sich in die Lage versetzen könnte, seine sicherheitspolitischen Interessen selbstständig und unabhä ngig von den USA zu verfolgen. Diese Wahrnehmung steht jedoch in eklatantem Kontrast zur tatsächlichen Handlungsfähigkeit der EU und zu ihren höchst halbherzigen Versuchen, diese herzustellen. Washington reagierte in den Neunzigerjahren ambivalent auf diese europäischen Bestrebungen. Die Clinton-Administration forderte einen größeren materiellen und finanziellen Einsatz der Europäer für die Bewältigung der Probleme auf ihrem eigenen Kontinent, denn die Diskrepanz zwischen dem europäischen Potenzial und dem Anspruch auf Eigenständigkeit eine rseits und der mangelnden Bereitschaft, entsprechend zu handeln andererseits, ist aus der Sicht Washingtons zu groß. Das Bedürfnis der USA, in Anbetracht ihrer weltweiten Herausforderungen, die Sorge für Ordnung auf dem europäischen Hinterhof den Europäern zu überlassen, ist verständlich. Es entspricht im Übrigen den Intentionen der Vereinigten Staaten seit 1945, die Europäer in die Lage zu versetzen, auf eigenen Füßen zu stehen, um sich selbst der Bürde zu entledigen, für Europas Sicherheit zu sorgen. Jedoch können sich die Vereinigten Staaten offenbar nur ein Europa vorstellen, das als ihr Juniorpartner agiert. Bestrebungen nach größerer Eigenständigkeit werden phasenweise begrüßt, immer wieder aber auch mit großem Misstrauen als beginnende Abkoppelung betrachtet. So war Washington in der Clinton-Ära darauf bedacht, seinen Einfluss in europäischen Angelegenheiten mit Hilfe der NATO zu erhalten und die NATO selbst – als bemerkenswert dauerhaftes und einzig schlagkräftiges Bündnis – auch zur Entlastung ihrer globalen Sicherheitspolitik einzusetzen. 8 Rühl, Lothar: Frankreich und die "Hyper-Macht Amerika", in: Neue Zürcher Zeitung, 3.11.1999, S.6. 47 Aus Washingtoner Sicht hat sich die Rolle der Allianz seit dem Fall der Berliner Mauer fundamental geändert. Zuvor sollte sie Westeuropa vor einem Angriff schützen, heute soll sie jenseits des Bündnisgebietes für Ordnung und Frieden sorgen. So weit tragen die Europäer die Auffassung mit, dies haben sie im Kosovo-Konflikt gezeigt. Sie akzeptierten aber nicht, dass die Clinton-Administration darüber hinaus bestrebt war, die NATO als Baustein der globalen amerikanischen Sicherheitspolitik zu definieren. Washington war in seiner Haltung gegenüber europäischen Zielen nicht konsistent; die EUMitglieder ihrerseits vertreten keine homogene Auffassung. George Bush hatte Anfang der Neunzigerjahre die Entwicklung einer eigenen europäischen Sicherheitspolitik abgelehnt und wurde darin von den Briten unterstützt. Bill Clinton stand bei Amtsantritt dem Unterfangen positiv gegenüber, nur um in seiner zweiten Amtszeit während der Verhandlungen um die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) mit Nachdruck eine amerikanische Mitsprache zu fordern, bzw. an ihrer Stelle die Einbeziehung der europäischen NATOStaaten, die nicht in der EU sind, darunter der Türkei. Das Bestreben der ClintonAdministration, die Organisation der ESVP nicht deckungsgleich mit der EU-Mitgliedschaft, sondern mit der NATO-Mitgliedschaft zu machen, entkleidet sie eines ihrer (politischen) Zwecke: Einen größeren Zusammenhalt der EU und das Entstehen einer gemeinsamen Identität zu fördern – also in letzter Konsequenz die Entstehung einer Macht, die mit den USA nicht nur ökonomisch, sondern – langfristig – auch politisch und militärisch rivalisieren könnte. Die gleiche Wirkung ging im Übrigen von Washingtons massivem Drängen auf die Aufnahme der Türkei in die EU aus, ganz zu schweigen von Clintons Vorschlag, die Tür der EU offen für Russland zu halten9 . Beides entspricht Amerikas strategischen Interessen, ist aber nicht kompatibel mit der europäischen Konzeption. Als problematisch für das gute Einvernehmen in der Außen- und Sicherheitspolitik erwies sich auch die unterschiedliche Rolle der Europäer auf dem Balkan und im Nahen Osten. In beiden Regionen trägt die EU den weit überwiegenden Teil der finanziellen und technischen Kosten für die Friedensicherung und den Aufbau von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. In Bosnien und im Kosovo stellt die EU zudem das meiste Personal. Washington verlangt zwar nach "burden-sharing", anerkennt aus europäischer Sicht aber nicht adäquat den Beitrag europäischer "soft-power" zur Konfliktlösung. Im Nahen Osten gar wünschte die ClintonAdministration ausdrücklich, dass sich die Europäer aus dem Friedensprozess heraushalten. Diese Arbeitsteilung ist nicht für alle EU-Mitglieder nachzuvollziehen, insbesondere dann nicht, wenn sich ihre Konzepten und Strategien deutlich von den USA unterscheiden. Das Streben der EU-Mitglieder nach der "Europäisierung Europas" – ohne ihren Postulaten nach Handlungsfähigkeit energisch Taten folgen zu lassen – und das Bestreben der USA, die Sicherheitspolitik der EU mitzugestalten, führte zu transatlantischen Reibungen, die nicht mehr durch die Bedrohung durch einen gemeinsamen Feind eingedämmt wurden. 3. Wirtschaftspolitik: Verflechtung – Kooperation – Dissonanzen Weit mehr als in der Sicherheitspolitik wird dies in wirtschaftlichen Fragen deutlich. Allerdings: So unabdingbar die partnerschaftlichen Beziehungen für Frieden und Sicherheit auf der nördlichen Halbkugel sind, so unabdingbar sind sie für den Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks. Das rasche Wachstum der transpazifischen Handelsströme verdeckt leicht, welche 9 Während der Verleihung des Karlspreises im Jahr 2000. Dale, Reginald: Clinton's 'Preposterous' Suggestion, in: International Herald Tribune, 9.6.2000, S.6. 48 Bedeutung die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und der EU für beide Wirtschaftsregionen und darüber hinaus für die Weltwirtschaft haben. Sie sind für einander jeweils die größten Handelspartner. Auch der größte Anteil ihrer Direktinvestitionen wird beim transatlantischen Partner getätigt. Gemeinsam haben USA und EU einen Anteil von 37% am Weltgüterhandel und sogar 45% am Welthandel mit Dienstleistungen. Obwohl sich die EU in den Neunzigerjahren durch neue Mitglieder vergrößert hat und die USA mit der NAFTA ihren regionalen Handel intensivierte, ist der Austausch über den Atlantik hinweg weiter gewachsen. Fusionen von wirtschaftlichen Giganten wie Daimler und Chrysler, Telekom und Voicestream machen die Verflechtung augenscheinlich. Mit der Zäsur 1989/90 war den atlantischen Partnern bewusst geworden, dass das traditionelle Bindemittel ihrer Beziehungen – die gemeinsame Abwehr der Bedrohung durch die Sowjetunion – diese Beziehungen nicht mehr sichern konnte. Vereinbarungen im politischwirtschaftlichen Bereich sollten für Ersatz sorgen. Die Transatlantische Deklaration von 1990 – noch unter Bush – wurde durch die Neue Transatlantische Agenda ergänzt und verstärkt durch den Gemeinsamen EU-US Aktionsplan (beides 1995) und die Transatlantic Economic Partnership (1998). Trotz der zahlreich geschaffenen Konsultations- und Dialogrunden im Rahmen dieser Vereinbarungen, sind das Missvergnügen aneinander und die Friktionen über Fragen eher geringerer Bedeutung auf dem Feld der Handelspolitik aber besonders groß. Der Konflikt über Bananen, der Hormon-Streit, Auseinandersetzungen über genmanipulierte Nahrungsmittel sowie Bestrebungen des Kongresses, durch Gesetzgebung mit extraterritorialer Wirkung die EU zur Übernahme amerikanischer Sanktionspolitik zu zwingen, führten zu Störungen des transatlantischen Verhältnisses, die zwar bisher noch nicht zu einem dauerha ften Zerwürfnis, aber doch zu einem bedenklichen Zustand dauerhafter Gereiztheit geführt haben. Der Clinton-Regierung ist es nicht gelungen, die Situation zu entschärfen: Im Bananenstreit, der besonders absurd ist, weil die USA keine Bananen produzieren, wartete die Administration nicht den endgültigen Schiedsspruch der WTO ab, sondern verhängte unilateral unverhältnismäßig hohe Strafzölle gegen ausgewählte europäische Produkte. Europäer hingegen klagten über das amerikanische System der Exportförderung (Foreign Sales Corporation), das mit den Regeln der WTO nicht in Einklang zu bringen ist. Die Explosivität der Probleme mit hormonbehandeltem Rindfleisch und genmanipulierten Lebensmitteln ergibt sich aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründen; auch hier agierte die amerikanische Regierung wenig verständnisvoll, weil sie diese Fragen nur als Handelshemmnisse wahrnahm. Obwohl die Handelsstreitigkeiten nur 2% des gesamten transatlantischen Handelsvolumens ausmachen, neigte die Clinton-Administration dazu, "Megafon statt Telefon" zu nutzen und noch im Verhandlungsprozess durch Verschärfung der Sanktionen ihre hegemoniale Macht einzusetzen. 10 Für die Europäer waren die Bestrebungen des Kongresses, mit dem Helms-Burton- und D'Amato/Kennedy-Act den Europäern ihre Sanktionspolitik aufzuzwingen, Ausweis unilateralen Vorgehens. Es gelang jedoch, diese Politik des Kongresses in den EU-USA Dialogforen zu entschärfen. Die Führungskraft Clintons reichte nicht immer aus, um das Störpotenzial des protektionistisch eingestellten Kongresses einzudämmen. So drängte die EU über Jahre vergeblich, über eine neue Welthandelsrunde weitere Handelsliberalisierung in Gang zu setzen. Clinton ließ sich schließlich auf die Millenniumsrunde der WTO ein. Sie scheiterte nicht nur an den zahlreich erschienen Globalisierungsgegnern, sondern zuvorderst auch an ihrer schlechten Vorbereitung durch die amerikanische Administration. 10 Vgl. Bananen: FSC, Hormonfleisch und kein Ende, in: Neue Zürcher Zeitung, 20.5.2000. 49 Man muss nicht so pessimistisch sein wie Fred Bergsten, der gerade über Kontroversen in Handels- und Wirtschaftsfragen eine Krise in den transatlantischen Beziehungen heraufziehen sieht, 11 aber es fehlte Clinton an Führungskraft, um den Kongress auf der Linie seiner früher traditionell überparteilichen Handelspolitik zu halten. Die bereits entstandene Gereiztheit könnte umso problematischer werden, als sich die amerikanische Konjunktur abkühlt. In Hinblick auf das sehr hohe Außenhandelsdefizit dürfte sich auf dem Kapitol die Neigung zum Protektionismus vergrößern, was einen unglücklichen Auftakt zu einer neuen Welthandelsrunde darstellen würde. Vor allem aber hätten die beiden Handelsriesen in Anbetracht der neuen Probleme im Zusammenhang mit einer sich beschleunigenden Globalisierung übergeordnete Probleme von größerer Brisanz als ausgerechnet Bananen und Hormon-Rinder zu lösen. 4. Die Umweltpolitik – Feld auch künftiger Auseinandersetzungen Zweifellos gehört die Frage, wie und mit welchen Methoden die globale Erwärmung eingedämmt werden kann, zu den transatlantischen Reizthemen. Obwohl Clintons Vizepräsident der Umweltproblematik große Aufmerksamkeit widmete, fanden sich die USA im KlimaProtokoll von Kyoto (1997) nur zu Kompromissen bereit, die eine Umsetzung von vornherein als problematisch, wenn nicht unwahrscheinlich erscheinen ließen. Nicht die Überzeugung Clintons oder Gores waren für dieses Ergebnis relevant, sondern wiederum die Unfähigkeit des Präsidenten, den Kongress von notwendigen politischen Schritten zu überzeugen. Die Bedingungen des Senats für die Ratifizierung – erstens müssten sich wichtige Entwicklungsländer ebenfalls zu einer Emissionsreduktion verpflichten, zweitens müsse die Administration nachweisen, dass durch die Umsetzung der Wirtschaft keine zusätzlichen Kosten entstünden und das weitere Ansteigen der Emissionen weit über die Werte des Stichjahres 1990 hinaus – reduzierten die Chancen des Protokolls, unabhängig davon, ob Al Gore oder George W. Bush nächster amerikanischer Präsident werden würde. Gerade in der Umweltpolitik sind die amerikanischen und die europäischen Regierungen weit auseinander, da auch hier unterschiedliche Wertvorstellungen eine große Rolle in den nationalen Entscheidungsprozessen spielen. In den USA ist eine Zustimmung zu kostenintensiven umweltpolitischen Maßnahmen auf Bundesebene nicht abzusehen – die aktiven Minderheiten ändern daran nichts. Gleichwohl sind die Vereinigten Staaten mit rund 25 Prozent am Weltausstoß von CO2 größter Verursacher des Klimagases. Hier liegt der Keim für künftige Auseinandersetzungen, bei denen sich die EU in Koalitionen gegen ihren engsten Verbündeten wieder finden könnte, so lange wie sich die Interessenslage der Bevölkerung und die ökologische Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Industrie nicht ändert. Allerdings sitzen auch die Europäer im Glashaus: Ob sie ihre Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll werden erfüllen können, scheint noch fraglich. 5. Die Clinton-Ära: Nur der Anfang eines Auseinanderdriftens der Kontine nte? Die Koordinaten des Beziehungssystems waren bis 1989/90 beherrscht von der Frage, wie die westliche Wertegemeinschaft in Europa der ideologischen, politischen und militärischen Herausforderung durch die Sowjetunion erfolgreich begegnen könne. Verglichen mit dieser existenziellen Frage sind die neuen Themen in der transatlantischen Gemeinschaft zumeist von geringerer Bedeutung. Gerade deshalb drohen sie das Beziehungsgeflecht wund zu reiben, wenn sie nicht eingehegt und in institutionalisierter Kooperation bearbeitet werden. Zugleich müssen aber beide Seiten ihr Bild voneinander überprüfen. 11 Bergsten, C. Fred: America and Europe: Clash of Titans?, in: Foreign Affairs March/April 1999, S.22. 50 Die Clinton-Administration tat sich schwer zu akzeptieren, dass ihr "Empire by invitation" im Europa der Nachkriegszeit in der Epoche nach dem Kalten Krieg in eine neue Form einer partnerschaftlichen Kooperation gegossen werden muss. Je mehr Amerika als alleinige Hegemonialmacht in Erscheinung tritt, desto mehr muss es sich Disziplin im Umgang mit seinen Partnern auferlegen. Die EU-Mitglieder sind über das Stadium eines ökonomischen Zusammenschlusses hinausgewachsen, sie sind aber keine dem amerikanischen Bundesstaat vergleichbare Handlungseinheit und werden es vermutlich nie sein. Dennoch muss Washington die Unabhängigkeit und die eigene europäische Identität respektieren. Die EU sollte sich jedoch bewusst sein, dass ihre Postulate nach einer eigenständigen Sicherheits- und Verteidigungspolitik noch nicht mit der Realität übereinstimmen, während die USA sich damit abfinden müssen, dass sie nicht in innere Verhältnisse der EU – wie in der Frage der Osterweiterung – hineinregieren können. Nicht zuletzt müssen sich die Europäer hüten, auf die technologische und militärische Überlegenheit der USA mit Loslösungstendenzen oder gar AntiAmerikanismus zu reagieren; beides war und ist in Ansätzen zu spüren. Transatlantische Konflikte hat es immer wieder gegeben, und die Debatte der Experten ist unentschieden, ob die gegenseitige Übellaunigkeit in den Clinton-Jahren das Maß in früheren handels- oder sicherheitspolitischen Konflikten überschritten hat. Richtig ist aber, dass erstmalig in der Clinton-Ära die Existenz der Westeuropäer in Frieden und Freiheit nicht mehr von den USA garantiert werden musste, während die USA nicht mehr zu befürchten hatten, dass das wichtige europäische Potenzial einer kommunistischen Sowjetunion anheim fallen könnte. Das ändert das Beziehungsgeflecht grundlegend, denn es entfällt ein disziplinierendes Korrektiv; die Auffassungsunterschiede werden deutlicher artikuliert. Die lange Liste transatlantischer Irritationen könnte zu einer "schleichenden Entfremdung" (Klaus Kinkel) führen, obwohl die beiden transatlantischen Giganten – bei allen Unterschieden im Detail – die gleichen Werte teilen und die wichtigsten Partner in allen globalen Fragen sind. Offen bleiben muss derzeit die Frage, wie weit die Person des Präsidenten entscheidend für die Gestaltung der Beziehungen ist, bzw. inwieweit ein nach innen gekehrter Kongress die transatlantische Politik beeinflusst. Die Klimapolitik des neuen Präsidenten George W. Bush signalisiert z.B. eher weitere Dissonanzen – aber war die Umsetzung des Kyoto-Protokolls nicht bereits unter Clinton wenig wahrscheinlich geworden, woran ein Präsident Gore kaum etwas hätte ändern können? Umso mehr gilt es, die Dialog- und Kooperationschancen, die die transatlantischen Foren bieten, zu einem sensiblen Umgang miteinander zu nutzen. Es bleibt als Konstante, dass Europa ohne eine europäische Rolle der USA auf absehbare Zukunft nicht denkbar ist. Die Entwicklung einer europäischen Identität in feindseliger Abgrenzung von Amerika könnte allzu kostspielig werden. 51 Lothar Rühl Die Russlandpolitik der Clinton-Administration 1. Washington und Moskau Die Zukunft Russlands wird aller Voraussicht nach eines der Hauptthemen, wenn nicht sogar die Hauptsorge der amerikanischen Außenpolitik der kommenden Jahre bleiben. Deshalb sind die Entwicklung der amerikanisch-russischen Beziehungen während der ClintonPräsidentschaft 1993-2001 und ihr heutiger Stand von besonderer Bedeutung für die weitere Behandlung Russlands durch die USA und deren Verbündete. Darüber hinaus sind sie aber auch wichtig für das Verhältnis der beiden so verschiedenen Mächte weltweit im strategischen Dreieck Nordamerika-Russland-China mit den Auswirkungen, die diese, derzeit nicht festgelegte, also in den nächsten Jahren veränderliche Mächtekonstellation auf Asien, den Pazifik und Europa haben wird. Diese Bedeutung wird weniger vom Wechsel zwischen der Bush (sen.)-Administration und der Clinton-Administration bewirkt − als von der inneren Entwicklung Russlands, − von den Ereignissen im Osten Europas und im ehemals russischen Mittelasien, − insgesamt von der fundamental veränderten Sicherheitslage auf dem eurasischen Kontinent nach dem Rückzug der sowjetrussischen Militärmacht aus dem Zentrum Europas 1992-94 und dem Beginn der NATO-Erweiterung gegen den vergeblichen politischen Widerstand Moskaus 1994-99 und schließlich − von dem Ausgreifen der NATO auf den Balkan im jugoslawischen Zerfallskonflikt. Jenseits der krisenträchtigen jüngsten Vergangenheit seit dem Ende der Sowjetmacht und der noch immer chaotischen Gegenwart des postsowjetischen Russlands zeigt sich bisher keine klare Aussicht auf die Umwandlung in einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Gerade darauf aber hatten sich vor zehn Jahren die Hoffnungen im Westen gerichtet, auch in den USA. Russland ist ein weites Land mit einer Bevölkerung von etwa 146 Millionen Menschen zur Jahrhundertwende (1989 zählte die russische Sowjetrepublik RSFSR noch 149 Millionen Einwohner), davon rund 80 Prozent ethnische Russen und mehr als 80 Prozent der Gesamtbevölkerung im Westen des Urals. Etwa 80-90 Prozent der geschätzten wesentlichen Rohstoffreserven befinden sich im Osten. Es besteht eine fundamentale geopolitisch-demografische Unausgewogenheit zwischen dem europäischen und dem asiatischen Gebietsteil. Die russische Bevölkerung in Sibirien nimmt ab, Russland hat noch immer keine fest gefügte Ordnung, aber eine ungeschützte äußere Grenze durch Zentralasien ohne russisch kontrollierte Vorfelder wie in der Sowjetunion. Während der Jelzin-Ära (1992-99), die in den USA von 1993 an für den Zeitraum von acht Jahren mit der Präsidentschaft Clintons zusammenfiel, lag die ungewisse Zukunft Russlands in seiner neuen strategischen Situation im Mittelpunkt des internationalen Horizonts der USA, denen der russische Ferne Osten über dem Nordpazifik an der Küste Alaskas näher ist als der russische Westen über Europa und dem Atlantik. Der Hohe Norden Russlands mit der Halbinsel Kola bildet die weitere Nachbarschaft Nordamerikas über den Polarkreis. Dort liegt der geostrategische Gegenpol für Fernwaffen nuklearer Bestückung und für ein Ausgreifen der damaligen sowjetrussischen Seemacht auf den Nordatlantik mit der Seeverbindung zwischen Nordamerika und Westeuropa, vor allem mit nuklear angetriebenen U-Booten großer Reichweite, aber auch landgestützten MarineLangstreckenflugzeugen und großen Überwasserkampfschiffen von den Basen um Mur- 52 mansk. Für die Flotte war ein Flugzeugträger-Programm eingeleitet, dessen erster Bau der Träger "Admiral Kusnetsov" inzwischen zum Verkauf angeboten wurde. Am Nordmeer waren noch Anfang der 1990er-Jahre mehr als drei Viertel der seegestützten nuklearstrategischen Fernraketen der USSR für Seestationen in der vom Land her gut abgedeckten Barents-See disloziert. Diese geografische Grundstruktur des interkontinentalen Ost-West-Verhältnisses, die den Abfall der westlichen Randländer der untergegangenen Sowjetunion von Russland überdauerte, weil der Hohe Norden mit seinen Militärstützpunkten, Flottenhäfen, Rohstofflagern und unterseeischen Energiequellen im Komplex Kola-Barents-See auch nach 1991 ungeschmälert in russischem Besitz blieb, ließ Russland den Verlust der Ostseeherrschaft vom Baltikum aus und damit der Operationsfreiheit der Baltischen Flotte in Krisen und Konflikten globalstrategisch verwinden. Dies galt aber nur, solange die Nordmeerflotte und deren U-BootKapazitäten einsatzfähig erhalten blieben. Der Verlust des Baltikums, Weißrusslands und der Ukraine im Westen wie Transkaukasiens im Südwesten kostete Russland nach zweieinhalb Jahrhunderten die Ostseeherrschaft und die Schwarzmeerherrschaft. Seine Grenzen waren 1991 auf die von Muskowiens Ende des 16. Jahrhunderts nach den Niederlagen des Zaren Iwans IV. Groznij ("Iwans des Schrecklichen") in seinen Kriegen gegen die Krimtataren und gegen Litauen-Polen zurückgefallen. Alle nachfolgenden Gewinne unter dem Zaren Aleksei Mihailowic im 17. Jahrhundert und unter Peter dem Grossen und Katharina der Grossen im 18. Jahrhundert waren verloren gegangen. Es blieb nur das aus Stalins territorialer Erbschaft am Ende des Zweiten Weltkrieges stammende nordostpreußische Gebiet "Kaliningrad" um das alte Königsberg als Exklave und vorgelagerte Militärbasis zwischen Litauen und Polen, aber ohne Landverbindung zu Russland. Insgesamt war die russische Westgrenze im Norden um etwa 600 km, im Süden um bis zu 1300 km zurückgefallen. Damit war nicht nur das frühere westliche Vorfeld der Sowjetunion und des Zarenreichs in Polen und Litauen verloren, sondern auch das traditionelle westliche Stationierungsgebiet der russischen Armeen in Weißrussland und in der Ukraine mit der gesamten militärischen Infrastruktur als Aufmarschgebiet sowohl für die vorgelagerte Landesverteidigung und Luftabwehr als auch für eine Offensivstrategie in Europa. Zum ersten Mal seit der Mitte des 17. Jahrhunderts besitzt Russland keinen von Moskau beherrschten freien Raum für seine Vorwärtsverteidigung in Europa mehr. Der zur liberalen Dumafraktion zählende frühere Sowjetbotschafter Wladimir Lukin, einer der führenden Außenpolitiker des russischen Parlaments, kennzeichnete in den frühen 1990er-Jahren in internationalen Seminaren die strategischen Nachteile dieses Gebietsverlustes am Beispiel Smolensk mit der Feststellung, dass Smolensk die erste größere Truppengarnison in Westrussland sei, knapp 300 km von Moskau entfernt. Jede amerikanische Russlandpolitik war deshalb einem schwer kalkulierbaren Potenzial russischer Zielsetzungen und Reaktionen auf westliche Initiativen exponiert, wie etwa die seit 1993 auf der Agenda der nordatlantischen Allianz stehende Osterweiterung der NATO oder Sicherheitsgarantien für die drei baltischen Länder. Für die Bestimmung der "nationalen Interessen" Russlands in Moskau musste auf westlicher Seite vorsichtshalber angenommen werden, dass künftige russische Staatsführungen sich nicht einfach mit der neuen Lage Russlands am östlichen Rand Europas abfinden würden, selbst wenn in den ersten Jahren pro-westliche Kräfte in Moskau auf Kooperation setzten und die "nationalpatriotischen" Parteien mit den "neo-imperialen" Tendenzen sich noch zurückhielten. Jelzin und Kosyrew formulierten die russischen Ziele offensiv revisionistisch. Dies zeigen die Botschaft des Präsidenten der Russischen Föderation an das russische Parlament am 24. Februar 1994 oder die Artikel des Außenministers in westlichen politischen Zeitschriften, insbesondere 1994 und 1995 in "Foreign Affairs", mit der Forderung auf Anerkennung Russlands als eine natürliche Großmacht auch im Zustand der Schwäche, mit einer Berufung zur Weltmachtstellung als Pendant 53 zu den USA. Gestützt wird dies auf die strategische Nuklearwaffenmacht und die Ressourcen wie auf die physische Stärke und geopolitische Kontinentalmachtstellung Russlands in Europa und Asien. Dabei spielte in der Moskauer Diskussion die von Jelzin und Kosyrew, aber auch von den russischen Militärs wie General Gratschew immer wieder vorgebrachte Forderung nach Anerkennung der "besonderen Interessen und Verantwortung" Russlands im "ehemals sowjetischen Raum" durch die internationale Gemeinschaft und die VN als Voraussetzung für gemeinsame Sicherheit, dazu das noch vage Gebilde der "Gemeinschaft Unabhängiger Staaten" mit vertraglichen Bindungen an Russland für gemeinsame Verteidigung, Grenzsicherheit und Rüstung, eine irritierende Rolle. Hinzu kam die Kosyrew-Doktrin vom "Nahen Ausland", also der unmittelbaren Nachbarschaft Russlands, bestehend aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in Osteuropa und Mittelasien. Obwohl Jelzin die Grenzen mit den westlichen Randländern anerkannte (die der Ukraine erst nach längerem Zögern und mit einem Vorbehalt hinsichtlich der Krim), blieb das Fragezeichen hinter der russischen Außenpolitik während des Jahrzehnts nach 1991 bestehen und beschäftigte die Clinton-Administration als ein zwar kontrollierbares, nicht jedoch lösbares Problem. Kompliziert und erschwert wurde dieses Problem einerseits von den blutigen Unruhen im russischen Nordkaukasus, die 1994 in den ersten Tschetschenienkrieg übergingen, andererseits von der Politik der NATO-Osterweiterung ab Herbst 1993 und von der westlichen Ba lkanpolitik mit dem Bosnischen Krieg, gleichfalls ab 1993, in den die NATO dann schließlich im Herbst 1995 mit bewaffneter Gewalt eingriff, um einen allgemeinen Waffenstillstand zu erzwingen und so eine Grundlage für einen Verhandlungsfrieden zu schaffen. Diesen setzten die USA de facto mit dem Gewicht ihrer Macht in Dayton/Ohio Ende 1995 durch. Der Friedensvertrag wurde mit Rücksicht auf Russland und die europäischen Verbündeten, vor allem Frankreich, danach in Paris endgültig redigiert und unterzeichnet. Von Ende 1995 an bis zum Ende der Clinton-Präsidentschaft blieben die USA im ehemaligen Jugoslawien, zunächst in Bosnien und Mazedonien, ab 1999 auch im Kosovo, militärisch präsent. Mit ihrem Engagement banden sie auch die russischen Kontingente in die internationalen Schutztruppen Ifor/Sfor in Bosnien ein, Kfor im Kosovo. Beide Interventionen mussten anfangs gegen die russische Opposition und russische Störmanöver erfolgen. Diese fanden z.B. im Februar 1994 sowie gut anderthalb Jahre vor dem Eingreifen alliierter Bodentruppen vor Sarajewo und im Juni 1999 nach dem Ende des Unternehmens "Allied Force" mit der Besetzung des Flugfeldes bei Pristina durch einseitig und vertragswidrig aus Bosnien abgezogene russische Truppen, die der alliierten Vorhut der Kfor zuvorkamen, statt. Doch es gelang der westlichen Diplomatie unter amerikanischer Leitung, gestützt auf den Einfluss der USA und auf die Abschrekkungskraft, die von der US-Militärpräsenz auf dem Krisenschauplatz ausging, Moskaus Gegenzüge zu neutralisieren und Russland einzubinden. Dabei wurde Russland jedes Mal eine begünstigte Sonderbehandlung zuteil, die auf das russische Prestigebedürfnis als Großmacht und ebenbürtiger Partner der USA außerhalb der NATO Rücksicht nahm. Insgesamt waren die Politik und Diplomatie der Clinton-Administration dabei erfolgreich und der atlantischen Allianz und der europäischen Sicherheit nützlich. Auch für die sich nach 1993 allmählich im Zuge der Umsetzung des Maastrichter Unionsvertrags und des Abkommens zwischen der NATO und der WEU über europäische militärische Operationen zur Krisenbeherrschung he rausbildenden Selbstständigkeit der EU-Partner außerhalb des Bündnisses mit Vorbehalten war es hilfreich. Die Stabilität der postsowjetischen Verfassung mit einer "Russischen Föderation", die Jelzin zwischen 1991 und 1993 zu organisieren begann, samt der Frage nach der Ende 1991 formal gegründeten "Gemeinschaft Unabhängiger Staaten" um Russland auf dem ehemaligen Gebiet der untergegangenen Sowjetunion (mit Verträgen über eine gemeinsame Verteidigung durch gemeinsame Streitkräfte) war für die USA das Hauptproblem der eigenen und der internationalen Sicherheit. Die Gründe dafür waren: das nukleare Waffenpotenzial, die chemischen 54 Kampfmittelvorräte und der desorganisierte Zustand der russischen Streitkräfte, mit deren noch überdimensional konventionellen Waffeninventar im europäischen Russland. Dieses Stabilitätsproblem hatte und hat unverändert sechs wesentliche Aspekte: − Die territoriale Stabilität in den, Ende 1991 nach der Unabhängigkeit der übrigen Sowjetrepubliken von Russland gezogenen Grenzen (mit der Halbinsel Krim als Teil der Ukraine); − die innere Einheit und Ordnung der "Russischen Föderation" mit den autonomen Nationalitätenrepubliken im "russischen" Nordkaukasus und im Innern Russlands; − die effektive zentrale politische Kontrolle über die ehemals sowjetischen Streitkräfte, deren Bewaffnung, insbesondere deren Vorräte an nuklearen, chemischen und toxischen ("biologischen") Massenvernichtungsmitteln, das industrielle Rüstungspotenzial samt den waffentechnischen Kapazitäten und den Forschern, Ingenieuren und Technikern aller Qualifikationen, summa zunächst noch etwa 25-30.000 nuklearer Sprengladungen in und für Waffen und nach der damaligen amerikanischen Annahme noch bis zu 3.000 Tonnen chemischer Kampfmittel; − die physische und technische Sicherheit dieses explosiven nuklearen und chemischen Potenzials sowie der toxischen Massenvernichtungsmittel für "biologische Kriegsfü hrung", samt eines weiträumigen Umweltschutzes, der einer Wiederholung von früheren Katastrophen in der UdSSR vorbeugen könnte;1 − die wirtschaftliche Stabilität Russlands, die offensichtlich schwer erschüttert war und die internationale Zahlungsfähigkeit Moskaus als erste Schuldneradresse der Weltwirtschaft mit bis zu 135 Milliarden Dollar Auslandsschulden 1993 in Frage stellte, von deren Festigung alles Übrige abhing und − die "demokratische Transformation" Russlands, also der Aufbau eines freiheitlichdemokratischen Rechtsstaates mit einer föderativen Ordnung bei regionaler Autonomie und die Ausbildung einer auf Privateigentum und Unternehmerinitiative gründenden Marktwirtschaft anstatt der alten sowjetischen Staatswirtschaft mit ihren Monopolen. 1 Vgl. über die damaligen amerikanischen Besorgnisse insbes. Miller, Steven E., Harvard University Center for Science and International Affairs: Western diplomacy and the Soviet nuclear legacy, in: Survival, IISS London, vol.34, nr.3 Autumn 1992, p.3-27. 55 2. Die anfänglichen amerikanischen Erwartungen Die USA, Europa, Japan und insgesamt alle Teilhaber am internationalen Wirtschaftssystem mit eigenen demokratischen Staatsordnungen hatten im Umbruch Russlands dominierende Sicherheits- und Handelsinteressen an einem friedlichen, aber auch zügigen und gründlichen Wandel Russlands. Dies galt für die Bush-I-Administration 1991-93 wie ab Februar 1993 die Clinton-Administration. Clinton hatte sich bis dahin kaum je mit Außenpolitik und internationalen Wirtschaftsproblemen, geschweige denn mit Strategie, Rüstungskontrolle, nuklearen Waffen oder mit Bündnissen beschäftigt. Für den neuen amerikanischen Präsidenten stellte Russland noch vor China und dem Mittleren Osten das am schwersten zu behandelnde internationale Stabilitätsproblem dar. Russland war für ihn der längerfristig größte Unsicherheitsfaktor mit explosivem Risikopotenzial. Die Risiken lagen damals vor allem im Inneren Rus slands und an dessen neuen Grenzen. Der Anfang Dezember 1994 von Jelzin eröffnete Tschetschenienkrieg war das eindringlichste Beispiel. Die "Russische Föderation" mit ihren 89 diversen "Subjekten" oder Trägern der föderativen Einheit unterschiedlichster Größe, Bevölkerung, Besiedlungsdichte, wirtschaftlicher und strategischer Bedeutung ist auch zehn Jahre nach der überstürzten Auflösung der Sowjetunion in der Krise von 1991 noch kein Staat, sondern ein politisches Hybrid zwischen dem untergegangenen Imperium und einem russischen Nationalstaat mit rund 80 zumeist kleinen Minderheiten, von denen die Tataren als größte mit 3,5 Prozent der Bevölkerung etwa zur Hälfte in der Region Moskau leben. National ist das postsowjetische Russland also im großen Kern homogen und die Nationalitätenproblematik der ehemaligen Sowjetunion ist in der "Russischen Föderation" Jelzins von 1993 so weit abgeschwächt, dass sie außerhalb des Nordkaukasus für Moskau beherrschbar erscheint. Dies gilt nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den ihre Unabhängigkeit fordernden Tataren seither auch für die autonome Teilrepublik Tatarstan an der Wolga. Insgesamt war die werdende "Russische Föderation" mit ihren inzwischen 13 "autonomen" Teilrepubliken als eigenständige Territorialeinheiten in den 1990er-Jahren aber latent von zentrifugalen Partikularismen bis hin zu Sezessionstendenzen gefährdet. Wiederum ist der Fall Tschetschenien nicht singulär, sondern exemplarisch, denn die nationale Rebellion gegen die russische Vorherrschaft und die Forderung nach Unabhängigkeit von Russland waren von Anfang an sowohl gegen den Bestand des "russischen Nordkaukasus" in der "Russischen Föderation" als auch gegen die kulturelle Verbindung zum europäischen Russland gerichtet. Die islamische Religion spielt dabei zwar eine ambivalente Rolle, doch der islamistische Antrieb war schon in den ersten Unruhen 1988-91 während der Endkrise der Sowjetunion ebenso deutlich wie die Verbindungen nach Afghanistan und die Unterstützung aus islamischen Ländern, insbesondere aus Pakistan. Insofern behandelte die erste Militärdoktrin für die Russische Föderation vom November 1993 in ihrem Teil über die Bedrohungen durch internationalen Terrorismus und religiös-kulturelle Konflikte eine reale Gefährdung der Föderation. Diese Aussagen wurden dann in der zweiten Militärdoktrin im Jahre 2000 wieder aufgenommen, was der Lage im Nordkaukasus entsprach. Die ClintonAdministration war praktisch vom ersten bis zum letzten Jahr gegenüber Russland mit diesem lodernden Krisenherd im Nordkaukasus und dessen Ausstrahlungen auf das ganze Kaukasien konfrontiert. Die Ratlosigkeit Clintons angesichts dieser Situation im Umgang mit Russland wurde am deutlichsten, als er während eines Besuchs im Moskauer Kreml im russischen Staatsfernsehen die Meinung vertrat, Jelzin bliebe nichts anderes übrig als die bewaffnete Gewalt, um die Einheit der Russischen Föderation gegen einen Sezessionsversuch zu behaupten. Dafür zog er noch den überaus gewagten Vergleich mit dem amerikanischen Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert und der Politik Präsident Lincolns zur Verteidigung der Union gegen die Sezession der Südstaaten. Dieser Auftritt bezeichnete zugleich den Höhepunkt der 56 amerikanischen Konfusion über Russland in der sich schon abzeichnenden politischen Beziehungskrise wegen der sich ankündigenden Osterweiterung der NATO, die im selben Jahre 1994 in ersten Konturen als Perspektive sichtbar wurde. Die massive russische Gewaltanwendung gegen die Tschetschenen zur Behauptung der Kontrolle über den Nordkaukasus war aber auch ein erster gewaltsamer Ausdruck des während der gesamten Jelzin-Ära andauernden Strebens nach Wiederangliederung verlorener Gebiete und nach einer russischen Schutzherrschaft über angrenzende Länder in Kaukasien und Mittelasien, aber auch im Nordwesten im Baltikum und im Südwesten gegenüber der Ukraine. Die russische Außenpolitik wurde von Ende 1991 an mit Abschwächungen, Verlagerungen der Schwerpunkte und zeitweiligen Pausen von dem anhaltenden Versuch bestimmt, so viel von dem 1991 verlorenen Gebiet und Einfluss wie möglich zurückzugewinnen. Diese Politik trug zahlreiche Widersprüche zwischen den verschiedenen Moskauer Interessen in sich, die noch immer nicht aufgelöst wurden. Es handelt sich dabei um ökonomisch-finanzielle, bezüglich einer Begrenzung kostspieliger Verpflichtungen gegenüber früheren Reichsteilen wie Weißrussland und der nationalen Zielsetzung einer Wiedervereinigung in der "Russischen Föderation" mit dem ersten Etappenziel, solche neu unabhängig gewordenen ehemaligen Sowjetrepubliken vor den russischen Grenzen wenigstens in gesicherte Abhängigkeit von Russland zu bringen. Außerdem gingen die latenten Spannungen zwischen Moskau und Kiew über die gemeinsame Grenze noch weiter, vor allem die Krim-Halbinsel mit den Kriegshäfen der Schwarzmeerflotte und über deren Aufteilung. Zwischen Moskau und den beiden nordöstlichen Baltenstaaten Estland und Lettland ging es um den Status der russischen Minderheiten und den Grenzverlauf, zwischen Moskau und Georgien um russische Pressionen und die russische Unterstützung der Sezession in der Küstenprovinz Abschasien am Schwarzen Meer. Schließlich kam es auch zwischen Moskau und Moldawien über dessen Unabhängigkeit von Rumänien und über die von General Lebed abgespaltene Grenzprovinz "Transnestrien" – ursprünglich als besonderes Verwaltungsgebiet eine Stalinsche Nachkriegsschöpfung – zu Unstimmigkeiten. Im Verhältnis zur Ukraine war (und bleibt) deren Abhängigkeit von Energie aus Russland in der Größenordnung von 80 bis 90 Prozent des Energiebedarfs zu bezahlbaren Preisen und annehmbaren Lieferbedingungen ein kritischer ökonomischer Faktor, auch für die Konsolidierung der politischen Unabhängigkeit der Ukraine von Moskau. Im Verhältnis zu Georgien spielten die Planungen aller Beteiligten für die Wege der Ausfuhr des kaspischen Erdgases und Erdöls nach Westen eine zwar auch zur Jahrhundertwende noch hypothetische, aber zunehmend politische Rolle. Diese sahen den Weg entweder über den russischen Nordkaukasus mit Tschetschenien nach Georgien oder direkt über russisches Gebiet und von dort nach Südosteuropa oder über See entweder von Georgien durch das Schwarze Meer, also die türkischen Meerengen, oder vom Kaspischen Meer über Aserbeidschan und die Türkei in die Ägäis zum Mittelmeer, schließlich unter Umgehung der westwärtigen Routen für Pipelines direkt durch das Kaspische Meer nach Süden über den Iran zum Persischen Golf, vor. Damit verbanden sich in der amerikanischen Interessenslage gegenüber Mittelasien wie Russland die inneren und auswärtigen Probleme dieser Länder mit den Beziehungen der USA zu Russland, zur verbündeten Türkei, Russlands historischer Rivalin im Kaukasus und Schwarzen Meer, zum noch immer ideologisch feindlichen Iran der schiitischen Revolution, einem zögernden, aber an russischer Nukleartechnologie interessierten potenziellen Partner Moskaus gegenüber Amerika, und zu den kaukasischen wie den zentralasiatischen Ländern, vor allem dem großen und rohstoffreichen Kasachstan, zu einem eng verschlungenen Knoten. So blieb ein flackernder osteuropäischer Unruheherd an den Grenzen Russlands bestehen. Dieser wurde vor allem von russischer Agitation und russischen Ansprüchen auf ein persona- 57 les Protektorat in Krisenzeiten über die 1991/93 auf etwa 24 bis 25 Millionen geschätzten "Auslandsrussen" in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken genährt. Dies waren z.B. russische Drohungen wie die des damaligen russischen Verteidigungsministers General Pawel Gratschew für den Fall von Übergriffen auf russische Minderheiten jenseits der Grenzen Russlands mit militärischem Eingreifen und der von Jelzins 1993-94 öffentlich und durch diplomatische Noten erhobene Anspruch auf Anerkennung eines russischen Rechts, in Krisen und Konflikten auf dem Gebiet der vormaligen Sowjetunion ordnend mit "friedenserhaltenden und friedensschaffenden Maßnahmen" einzugreifen. 2 Die Krise Georgiens mit der Rebellion abchasischer Nationalisten gegen Tiflis, die von Moskau unterstützt wurde und in eine de facto-Sezession der Küstenprovinz Abchasien unter russischer Deckung mündete und die Georgien zwang, Russland die Benutzung von Häfen und Flugplätzen für russische Truppen zuzugestehen, demonstrierte allen Nachbarn Russlands das reale Ausmaß solcher Gefahren im Zuge der Moskauer "Reintegrationspolitik" und Konsolidierung der Sicherheit der Russischen Föderation auf den abgetrennten Vorfeldern. Tatsächlich war bis etwa 1995-96 der Übergang zwischen Konsolidierung und Expansion im gesamten Kaukasusgebiet und im Westen Russlands gegenüber der Ukraine, Weißrussland und den baltischen Staaten fließend. Jelzins Politik blieb ambivalent zwischen einer Kooperation mit dem Westen und Arrangements mit den unabhängig gewordenen Randstaaten einerseits, russischem Expansionsstreben "neoimperialen" Ansatzes andererseits. Diese oszillierende, in Osteuropa überwiegend als bedrohlich angesehene Moskauer Politik gab in Warschau, Prag und Budapest 1992-93 den entscheidenden Anstoß zur Aufgabe der "Visegràd"-Politik für einen eigenen ostmitteleuropä ischen Sicherheitsraum in Neutralität zwischen Russland und der NATO zu Gunsten des Strebens nach Aufnahme in die westliche Allianz. Es gab dafür in den drei Ländern noch andere Gründe und eine allgemeine psychologische Grundeinstellung für eine vollkommene Hinwendung zum Westen, eine Motivation, die auch in Kiew und in der ruthenisch-polnischen Westukraine trotz der erklärten Neutralität spürbar war. Doch die zunehmende Besorgnis über ein mögliches Wiedererstehen des alten russischen Imperialismus, der ja nur wenige Jahre zurück lag, gab den Ausschlag. Ähnlich verlief die Meinungsbildung in den drei baltischen Ländern, die fürchteten, den Anschluss an den Westen zu verlieren und sich in einem bündnislosen aber von Russland beherrschten baltischen Raum, auf einem Vorfeld Moskauer Machtpolitik, dazu mit starken und unruhigen russischen Minderheiten in den eigenen Grenzen, wieder zu finden. Anfangs drängten Estland und Lettland in die NATO wie in die EU, später auch Litauen. In Südosteuropa entstand, von Rumänien ausgehend, eine weitere Te ndenz nach Westen und der Aufnahme in die NATO und die EU, die bald auf Bulgarien und Slowenien übergriff. Damit zeichnete sich eine Entwicklung ab, die Russland von Europa bündnispolitisch trennen würde, wenn die NATO alle diese Kandidaten im Westen Russlands künftig aufnähme. Diese Perspektive eröffnete sich vom Januar 1994 an mit der Brüsseler Erklärung des Nordatlantikrates über "die Friedenspartnerschaft" mit außenstehenden Staaten, denn die dabei verkündeten Leitsätze der Allianz schlossen die Möglichkeit eines Beitritts solcher "Friedenspartner" in das Bündnis ein. 3. Die Osterweiterung der NATO und die NATO-Intervention auf dem Balkan als Komplikationen Zu jener Zeit, Anfang 1994, dauerte der Bosnische Krieg mit massivem Blutvergießen, großen Zerstörungen und landesweiten Vertreibungen der jeweils als feindlich angesehenen Bevölkerungsteile schon zwei Jahre an, ohne dass entweder die UN oder die KSZE noch die EU mit ihrer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nach dem Maastrichter Vertrag oder die 2 Vgl. Jelzins Februar-Botschaft 1994 an das Russische Parlament. 58 NATO wirksam eingegriffen hätten, um den Krieg zu beenden. Das Zögern der atlantischen Verbündeten vor einer militärischen Intervention angesichts − der anhaltenden Unfähigkeit der UNO, den Konflikt zu beenden und den UNOSchutztruppen, Schutz zu bieten, − dem Unvermögen der KSZE (später OSZE), aus eigener Kraft Sicherheit zu stiften, − der Moskauer Blockadepolitik in beiden Organisationen zur Abschirmung der serbischen Aggressionen und der damit verbundenen politischen Lähmung der internationalen Instanzen kollektiver Sicherheit in diesem akuten Konflikt und schließlich − der Passivität der EU, deren Maastrichter Unionsvertrag mit der Klausel über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich "friedenserhaltender und friedenscha ffender Maßnahmen" auch mit militärischen Mitteln der WEU (nach dem "PetersbergBeschlussdokument" von 1992) im Jahre 1993 in Kraft getreten war, überzeugten die Regierungen in den Ländern Ost- und Mitteleuropas davon, dass es in Europa keine reale Sicherheit vor Aggression und Bedrohung außerhalb der NATO mehr geben werde und dass deshalb nur die NATO-Mitgliedschaft ihrer eben wiedergewonnenen Unabhä ngigkeit die äußere Stabilität im Krisenfall verschaffen könne. 3 Als Folge des zur Schau getragenen westlichen Interesses an der gesicherten Unabhängigkeit der Ukraine und Georgiens von Russland – Präsident Clinton hatte die Unabhängigkeit der Ukraine als lebensfähiges Land 1994 bei seinem Besuch in Kiew öffentlich zu einem "vitalen Sicherheitsinteresse der USA" erklärt – breitete sich die Überzeugung, dass nur die NATO Schutz geben könnte, über den Osten Europas bis nach Kiew und Tifliz aus, obwohl die Orientierung dieser beiden Länder noch offen blieb. Es konnten auch weder in der Ukraine noch in Georgien die notwendigen Voraussetzungen eines Beitritts zur NATO geschaffen werden und es bestand keine Chance, dass Moskau diesen dulden würde. Damit war für die USA als Schutz- und Führungsmacht der Nordatlantischen Allianz eine politische Konfrontation mit Russland auf der ganzen Linie quer durch Europa vorprogrammiert, wenn Washington die Politik der NATO-Erweiterung nach Osten zügig vorantreiben würde. In der letzten Konsequenz müsste eine prinzipiengesteuerte NATO-Erweiterung mit offenem Ende die Bündnisgrenze von Land zu Land weiter nach Osten in Richtung auf die Westgrenzen Russlands vorschieben und so den sicherheitspolitischen Zustand Europas immer weiter hin zu einer Gegenüberstellung Russlands und der Atlantischen Allianz verändern. Dem erklärten Stabilitätsziel für eine "gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur" würde somit keine feste, klar umrissene und dauerhafte Grundlage in der geopolitischen Landschaft Europas, auf der diese Architektur gemeinsam mit Russland errichtet werden könnte, eingeräumt. Im Zuge dieser integrativen Expansion der NATO würde die europäische Sicherheit auch von Beitritt zu Beitritt immer mehr auf die NATO konzentriert und zwischen der NATO und Russland tendenziell bilateralisiert, dazu in der politisch-militärischen NATO-Bündnisstruktur auch hierarchisiert. Dies zeigte sich schon 1994/95 in den exklusiven Konsultationen und Entscheidungen der "Internationalen Kontaktgruppe" über Bosnien im Kreise der damals vier NATO-Partner USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland – später trat Italien hinzu – und Russland als äußeren Sicherheitspartner. Die Folge könnte nur die Einschränkung der "multilateralen Sicherheit" in der OSZE sein, in der immer mehr Russland und die größer werdende NATO-Gruppe den Kern bilden würden. Die NATO als Bündnis für "kollektive Verteidigung" mit gemeinsamen Militärstrukturen, alliierten Streitkräften und gemeinsamen Befehl und politischen wie militärischen Krisenplanungen mit Krisenkonsultationen in den Bündnisorganen hat eine umfassende Zuständigkeit für alle relevanten Sicherheitsfragen, 3 Vgl. Rühl, Lothar: Deutschland als Europäische Macht, Bonn 1996, S.234ff. 59 auch über die militärischen hinaus, herausgebildet und praktiziert. Deshalb müsste die "Multilateralität", die als eine Voraussetzung auch für "kollektive Sicherheit" in der KSZE angelegt ist, einem sich ausbreitenden "Bilateralismus" der europäischen Sicherheit NATO/Russland allmählich im Zuge der NATO-Erweiterung weichen. Dies würde durch die Vergrößerung des NATO-Bündnisgebietes als Vertragsgebiet für Verpflichtungen der Mitglieder zu gemeinsamer Verteidigung auch auf der sicherheitspolitischen Landkarte Europas deutlich markiert. 4 Es war darum zu erwarten, dass Russland, unter welcher Führung auch immer, sich mit einer fortdauernden, immer weiter reichenden Strukturveränderung der europäischen Sicherheit durch die Ausbreitung des nordatlantischen Bündnisses auf dem Kont inent nicht einfach abfinden würde, selbst wenn es noch für längere Zeit unfähig sein würde, diese zu blockieren. Das Verhältnis zu Russland würde schon aus diesem in der NATOPolitik vorgegebenen Grund und ganz unabhängig von den konkreten politischen Absichten der Verbündeten gegenüber Moskau abermals einen konfrontativ-kooperativen Charakter annehmen, also die alte Ambivalenz der Ost-West-Beziehungen in der Spätzeit des Kalten Krieges in einer Neuauflage wieder zum Vorschein bringen: Eine janusköpfige russische Politik gegenüber einer janusköpfigen westlichen Politik, eine Ambivalenz, die ohnehin andere Gründe in der russischen Geografie und Mentalität und damit im historisch-geopolitischen Fond des außenpolitischen Denkens in Russland hat und seit vier Jahrhunderten gegenüber Europa, dem Russland aber zugehört und an dem es teilhaben will, wirkt. Dies wurde schon im Oktober 1993 deutlich in Kosyrews Warnung vor einem Rückfall des Westens in eine Politik "des 'cordon sanitaire' zur Isolierung Russlands" und der Empfehlung an Frankreich, eine neue "entente cordiale franco-russe" mit Russland zu schließen. 5 Gut ein Jahr später, im Dezember 1994, warnte Jelzin auf dem KSZE-Treffen der Staats- und Regierungschefs in Budapest, wo die Umwandlung der KSZE in die OSZE beschlossen und das "Budapester Dokument" verabschiedet wurde, vor einem Rückfall in den Kalten Krieg mit dem Wort, es drohe "ein Kalter Friede" zwischen Russland und den NATO-Staaten. Diese Aussichten und die europäische Entwicklung komplizierten das Verhältnis der USA und Westeuropas zu Russland in dessen chaotischer innerer Umwandlung, in der das beha rrende Moment der alten Sowjetstrukturen mit den Moskauer Machthierarchien noch bei weitem überwog. In der Außenpolitik machte sich dieser Beharrungswiderstand gegen ein "neues Denken", wie Gorbatschow es vor Jelzin gefordert hatte, am stärksten bemerkbar, obwohl Jelzin Kooperation anbot und Russland auf den Westen für finanzielle Unterstützung angewiesen war. Im Februar 1993 forderte Jelzin eine "besondere Partnerschaft" Russlands mit den USA und der NATO für eine gemeinsame Garantie der Sicherheit der früheren Paktverbündeten der UdSSR in Europa statt deren Aufnahme in die NATO. Dies wies auf das geopolitische Territorialdenken und auf die Strategie in Moskau hin, im Osten Europas wieder ein Sicherheitsglacis gegenüber dem Westen und über eine Partnerschaft mit der NATO einen mitbestimmenden Einfluss auf eine Sicherheitsordnung Europas, die alle westlichen Nachbarn Russlands bündnislos lassen würde, zu gewinnen. Diese erkennbare Zielsetzung erweckte große Besorgnisse auch in der Ukraine. 1994 bei seinem Besuch in Kiew erklärte Clinton die fortdauernde Unabhängigkeit, territoriale Integrität und wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Ukraine zu einem "vitalen Sicherheitsinteresse der USA", um Moskau vor Übergriffen zu warnen. 4 Vgl. dazu Rühl, Lothar: Kollektive Sicherheit und Allianzen, in: Karl Kaiser/Hans-Peter Schwarz (Hrsg.), Weltpolitik im neuen Jahrhundert, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band 364, Bonn 2000, S.519ff. 5 Vgl. Kosyrews Namensartikel in le Monde, Paris, 21.Oktober 1993. 60 "Neo-imperiale" Politik wurde gerade in den USA Jelzins Russland damals zugeschrieben. Die "Reintegration des ehemals sowjetischen Raumes" durch Moskau nach Jelzins erklärter Absicht und Kosyrews Konzeption, wie der erste russische Außenminister sie 1993-94, vor allem in einem Artikel in "Foreign Affairs" mit dem Titel "The lagging partnership" im Sommer 1994 kritisch gegenüber den USA darlegte, war jedoch nach dem historischgeopolitischen Verständnis der in Moskau vorherrschenden Denkweise weder "imperialistisch" noch "neo-imperial", sondern die natürliche Konsequenz aus der Kontinentalmachtstellung Russlands. Kosyrew und nach ihm Primakow als Außenminister wiesen den Vorwurf des Imperialismus stets zurück, reklamierten aber für Russland den immer währenden Rang einer Großmacht mit einer manifesten Berufung zum Weltmachtrang. Kosyrew schrieb Russland in seinem "Foreign Affairs"-Artikel von 1994 die "Bestimmung eine Großmacht zu sein", also ein Gegenstück zu Amerikas "manifester Bestimmung" als "unersetzliche Nation" für die Freiheit, und "inhärente Merkmale einer Großmacht, Technologie, Ressourcen, Waffen" zu. Er folgerte daraus einen legitimen Anspruch Russlands auf die Anerkennung einer Weltstellung, deren Dimension über den gesamten eurasischen Kontinent hinweg Russland habe und damit auch "Status und Bedeutung einer Weltmacht". Diese Groß- und WeltmachtQualität gebe Russland das Recht, zu einer robusten, ja "sogar aggressiven Politik der Vertretung nationaler Interessen". Diese fasste er im Sinne Jelzins in die Formel von der "besonderen Rolle und Verantwortung Russlands in der ehemaligen Sowjetunion", so als existiere deren Gebiet auch nach ihrer Auflösung noch immer als eine von Moskau treuhänderisch zu bewahrende geopolitische Einheit. Jelzin hatte 1993 von einer "Sphäre besonderer Interessen und Verantwortung" der Russischen Föderation "im ehemals sowjetischen Raum" gesprochen. Beide Formulierungen schlossen weder die drei baltischen noch die drei transkaukasischen Staaten explizit aus, berührten somit also die europäische Ordnung und Sicherheit unmittelbar auf europäischem Boden jenseits der internationalen Grenzen Russlands. An die Adresse Washingtons wiederholte Kosyrew 1994 Jelzins Appell von 1993, eine "Partnerschaft zwischen zwei einzigartigen großen Nationen wie den USA und Russland" für gemeinsame Entscheidungen in der Weltpolitik und über die internationale Sicherheit zu begründen, womit das alte Ebenbürtigkeitsstreben der Sowjetunion gegenüber den USA auch für die kle inere und schwächere "Russische Föderation" erneuert war. Amerika sah sich deshalb herausgefordert, nicht militärisch, wohl aber bezüglich seiner ordnenden Politik in Europa und im pazifischen Raum. Diese sah auch die Wahrung und Förderung seiner wirtschaftlichen Interessen in dem sich öffnenden Mittelasien – nach 150-jähriger russischer Herrschaft oder Vorherrschaft – mit dem "Erweiterten Mittleren Osten" um die Erdgas/Erdöl-Quellen des Kaspischen Raumes vor und das Golföl und die Küsten vom Persischen Golf im Süden bis zum Schwarzen Meer im Norden und dem Mittelmeer im Westen. War das "grand game" der anglorussischen Rivalitäten in diesem weiten Raum wieder auf der internationalen Agenda? Es schien so, zwar in einer neuen Konfiguration mit neuen "global players", an der Spitze eben die USA als allein übrig gebliebene "Supermacht" oder "singuläre" Weltmacht und einer entstehenden neuen Konstellation, in die China sich einzwängte, aber auf dem Grundmuster der Interessenpolitik und der internationalen Machtpolitik doch im harten Kern wesensgleich. Welche Rolle könnte und würde die noch ungeordnete "Russische Föderation" mit der vagen "Gemeinschaft Unabhängiger Staaten" dabei spielen? Die letztere blieb ephemer, die erstere prekär. Noch die Militärdoktrin 2000 der "Russischen Föderation" sprach zum Ende der beiden Präsidentschaften in Moskau und Washington wie zu deren Anfang 1993 von einem "Übergangszustand" im Zeichen der "Umwandlung". Ein Zwischenzustand ist naturgemäß labil, und der russische hat nach allen Seiten offene Grenzen, über die hinweg sich innere und äußere Bedrohungen verbinden können, russische Einflüsse und Gefahren in die Nachbarländer getragen werden, wie nach Georgien, Moldawien, 61 die baltischen Länder und die Ukraine selbst. Russlands unmittelbaren Nachbarn, die, so weit es sich um europäische handelt, in Moskau nicht wirklich als "Nahes Ausland", wie Kosyrew Ende 1991 formulierte, für besonderen russischen Einfluss gesehen, sondern eher als abgetrennte "kleinrussische" Grenzländer betrachtet werden, deren Unabhängigkeit von Russland als formal und ohnehin als vorläufig angesehen wird, ist in der "Russischen Föderation" ein Platz reserviert. Im Falle Belarus' ist die Annäherung auch von Minsk her vorangetrieben worden, während Jelzin in Moskau schon wegen der finanziellen Folgen eines Anschlusses Weißrusslands Zurückhaltung zeigte. Der Nachfolger Putin aber zeigt sich aktiv interessiert an einer nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch politischen und militärischen "Reintegration", zumindest der Ukraine und Weißrusslands, wobei die formale Unabhängigkeit als Vö lkerrecht ssubjekte bestehen bleiben könnte. Auch die Beziehungen zu den ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien sollen neu geordnet werden. Dabei sollen statt der bisher nicht realisierten multilateralen Kooperation in der "Gemeinschaft Unabhängiger Staaten" die bilateralen Bindungen jedes einzelnen dieser seit 1991 unabhängigen Staaten im Süden Russlands an Moskau gestärkt werden. Dies soll in Form von Verträgen mit gemeinsamen Institutionen und Organisationen, vor allem im Bereich der Sicherheit und Verteidigung, der Grenzsicherheit und des Zollwesens, was besonders kritisch an der russischen Südgrenze in Mittelasien und an den südlichen Grenzen dieser russischen Nachbarn ist, erfolgen. Zweifelsohne will Putin den "ehemals sowjetischen Raum" so weit wie möglich um Russland organisieren und von Moskau aus kontrollieren. Diese Linie seiner Politik hat sich seit dem Frühjahr 2000 deutlich abgezeichnet. Sie entspricht der Lage Russlands als Kontinentalmacht in Europa und Asien und dem historischgeopolitischen Denken in Moskau – auch ganz im Sinne Gorbatschows, der 1991 die Auflösung der Sowjetunion eine "gegen die Geografie und Geschichte gerichtete Anomalität ohne Zukunft" genannt hat. Verbunden mit einer solchen "Reintegration", wie Jelzin das Ziel 1992 etikettierte, ist das Ziel der Wiederaufrichtung der russischen Großmachtstellung, mit dem Streben gegenüber der vorläufig singulären amerikanischen Weltmacht wenigstens eine formale Ebenbürtigkeit in der internationalen Politik wieder zu gewinnen. Dies kann nur durch eine nuklearstrategische Rüstungskontrolle und bei den UN gelingen. Ohne einer Konsolidierung der einseitig geschrumpften russischen Militärmacht und einer Sanierung der russischen Volkswirtschaft mit neuen Technologien und einer vollkommen neuen Industriebasis würde aber selbst ein solches bilaterales Vertragsverhältnis nicht mehr sein als eine leere Hülle, die Russland nicht mit Handlungsfähigkeit füllen könnte. In jedem Fall aber wird dieses Streben in Moskau die Konstante der Außenpolitik bleiben und auch die Außenbeziehungen Russlands, nicht nur zu den USA, sondern auch in Europa und Asien, vor allem zu China, zu Indien, zu Japan, zum Iran und zu den arabischen Staaten bestimmen. 4. Die amerikanische Agenda zu Beginn der Clinton-Präsidentschaft Diese Fragen standen schon 1993 auf der außenpolitischen Agenda Washingtons, als Clinton nach einem vor allem innenpolitisch und wirtschaftlich bestimmten Wahlkampf, in dem er den Außenpolitiker Bush Senior aus dem Felde geschlagen hatte, ins Weiße Haus einzog. Da die Außenpolitik 1992 in der Präsidentschaftskampagne keine Rolle gespielt hatte, die Machtstellung der USA ungefährdet war und die Bush-Administration nach dem Ende des militärisch mit der Befreiung Kuwaits und der Verteidigung Saudi-Arabiens im Grossen und Ganzen erfolgreich geführten Golfkrieges von 1991 keine militärischen Engagements in Überseekrisen mehr eingegangen war, hatte die Clinton-Administration nach außen im Rahmen der 62 Bündnisverpflichtungen der USA freie Hand hinter dem Schleier der Ambivalenzen jeder politischen Rhetorik. Dies war ein großer Vorteil für eine "strategic review" und für ein "reassessment of national policy", also eine Überprüfung der internationalen Strategie und der Außenpolitik. Clinton operierte wie die meisten Regierungen der Welt nach der Erfahrungsregel von "trial and error" – Versuch und Irrtum oder Vorgehen unter ständiger Korrektur der getanen Schritte. Dieses Herantasten an die internationalen Probleme war 1993-94 nicht mit großen Risiken belastet, denn die Weltlage, die Präsident Bush hinterlassen hatte, war bei allen unbewältigten und fortschwelenden Konflikten doch für Amerika und dessen Verbündete überwiegend vorteilhaft. Die USA dominierten als die externe Macht die Lage im Mittleren Osten aus der Sicherheitsdistanz mit vorgeschobenen Kräften auf alliierten Stützpunkten. Die Herausforderung, die Saddam Hussein 1990 mit seiner Aggression gegen Kuwait und der direkten Bedrohung Saudi-Arabiens, später auch Israels, aufgeworfen hatte, war niedergeschlagen. Der Irak war besiegt und in seiner militärischen Angriffskraft im Kern geschwächt, in seinem Rüstungspotenzial kritisch getroffen und für wenigstens ein Jahrzehnt, wahrscheinlich für zwei, keine unmittelbare Bedrohung für seine Nachbarn. Russland war aus dem Nahen und Mittleren Osten herausgedrängt und die Unabhängigkeit der zentralasiatischen Staaten des ehemals sowjetischen Unionsterritoriums hatte die verbliebene russische Macht weiter von Europa, von der Türkei mit dem Balkan und den Meerengen, von Griechenland und der Ägäis samt Zypern und der Levante wie vom Persischen Golf und vom Indischen Ozean entfernt. Ein russischer Zugriff, der als Möglichkeit die amerikanische Politik seit 1944/46 beschäftigt hatte, war nahezu unmöglich geworden. Der Mittlere Osten war zum ersten Mal seit dem 19. Jahrhundert wie das Mittelmeer und der Indische Ozean außer Reichweite russischer Offens iven oder Expansionsstrategien. Die Türkei stellte gewisse Probleme im Bündnis, vor allem im Verhältnis zu Westeuropa über die Kurdenfrage und die Bürgerrechtsfragen, auch über die Behandlung des Iraks und des Irans, doch sie blieb im Wesentlichen ein wertvoller und zuverlässiger Verbündeter. Clintons Unterhändler Holbrooke formulierte dies 1994 so: "Einer der beiden wichtigsten Verbündeten der USA in Europa neben Deutschland, Frontstaat in allen drei strategischen Richtungen – Balkan, Kaukasus und Golf". Israel war seit dem Ende des Golfkrieges sicher und dank der amerikanischen Deckung in der beherrschenden Position als führende technologische und militärische Regionalmacht. Die arabischen Golfkriegsalliierten in der "Internationalen Koalition", die Präsident Bush 1990 zusammengebracht und 1991 zu einem halben Sieg mit einem halben Erfolg über den Irak geführt hatte, neigten 1993 Amerika zu, nicht Russland. China hatte keinerlei Einfluss auf die Region und der russische Einfluss konnte als bestenfalls gering eingeschätzt werden. Dasselbe galt für den europäischen. Präsident Clinton hatte deshalb bessere Chancen als je zuvor ein amerikanischer Präsident seit Wilson 1918-19, eine "pax americana" im Orient zu stiften – vorausgesetzt, die USA könnten eine stabile "Balance of Power" auf der Basis eines tragfähigen Interessenausgleichs zwischen den Staaten der Region, Irak und Iran noch ausgeschlossen, austarieren und festlegen. Ohne russischen Gegeneinfluss, der seit 1945 den amerikanischen in jeder Krise zu konterkarieren versucht hatte, konnte Clinton dies probieren, so wie Bush es im Ansatz eingeleitet hatte. Trotzdem blieben die Risiken eines Scheiterns groß und nur schwer beherrschbar, wie sich in den acht Jahren der Clinton-Administration zeigte. Dasselbe galt mutatis mutandis für Fernost und insbesondere für die Lage in Korea mit einer neuen nordkoreanischen Herausforderung im Bereich der nuklearen Rüstung mit Raketen, aber auch durch die erneuerte politische Aggressivität der kommunistischen Diktatur Nordkoreas gegen den Süden mit bedrohlichen Nebenwirkungen auf die Sicherheit Japans. Auch im Fernen Osten und im Nord- und Westpazifik stellte Russland keine offensive Bedrohung oder ein Behinderungsrisiko mehr für die 63 amerikanische Politik und Krisenbeherrschung um Korea oder Taiwan dar. Auch China war 1993-99 nicht mehr als ein festländischer Störfaktor, der zwar immer wieder Taiwan beunruhigen konnte und auf Japan eine große wirtschaftliche Anziehungskraft ausübte wie auf die USA selber, doch eine Wiederannäherung an Russland oder gar eine neue russischchinesische Allianz gegen die USA und Japan war noch weit außerhalb des Bereichs des Möglichen. Diese potenzielle Gefahr schien noch wenigstens zehn bis fünfzehn Jahre entfernt in einer unbestimmten Zukunft, auf deren Gestaltung die amerikanische Weltmacht ebenso einwirken könnte wie Russland. In dieser Hinsicht war der Fall des Russischen Imperiums nicht nur eine vollendete Tatsache, sondern auch für die absehbare Zukunft irreversibel. Was Russland selber, die Sicherheit Europas als Ganzes und das östliche Mitteleuropa zwischen Russland und Deutschland angeht, so konnte die Clinton-Administration auf den soliden Resultaten der westlichen Politik während der zweiten Reagan-Administration 1985-89 und der Bush-Administration aufbauen. Zwischen dem Beginn der Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenwaffen mit nuklearen Gefechtsköpfen in Westeuropa mit einer Reichweite bis nach Russland im Herbst 1983 und dem Abschluss des Vertrags zwischen den USA und der UdSSR über die weltweite Beseitigung aller bodengestützten Flugkörpersysteme mittlerer Reichweite beider Partner im Januar 1989 ("INF-Vertrag"), war die neue "eurostrategische" Raketendrohung der Sowjetunion gegen das NATO-Europa durch ein umfassendes Abrüstungsabkommen beseitigt. Es waren nicht nur die Ausführung des NATOStationierungsplans durch die beteiligten Verbündeten, die beharrliche amerikanische Verhandlungsführung und eine schlüssige nukleare Strategie der NATO zur Abschirmung Europas, die diesen Einschnitt möglich machten, sondern auch die noch vollkommen hypothetische, aber auch in Moskau als künftig realisierbar erscheinende Option der USA auf eine begrenzte strategische Raketenabwehr für Nordamerika nach der "Strategic Defense Initiative" Präsident Reagans. Gorbatschow sagte später, die Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenwaffen in Europa und Reagans Raketenabwehr-Vorhaben SDI hätten die Sowjetunion nach 1985 unter seiner Führung zu einer Revision ihrer Politik gegenüber der NATO in den strategischen Fragen gebracht, weil die Alternative eine zusätzliche Rüstungsanstrengung, nicht verkraftbar für die schon überanstrengte sowjetische Volkswirtschaft, gewesen wäre. In Moskau konnte man diese Konsequenzen abschätzen, weil die Sowjetunion trotz des ABM-Vertrags von 1972 (Begrenzung der strategischen Raketenabwehr auf je zwei Stellungen zu je 100 Abfangraketensystemen in der UdSSR und in den USA, Verbot von luft-, raum, see- und landbeweglich gestützten Abwehrsystemen), schon seit dieser Zeit an der Weiterentwicklung der Raketenabwehr arbeitete, also die Vertragsgrenzen umging. Außenminister Schewardnadse (der spätere Präsident des später unabhängig gewordenen Georgiens) räumte diese Vertragsumgehung auch im Juli 1991 in seiner Rede vor dem letzten Parteikongress der KPdSU in Moskau öffentlich ein. Bei dieser Gelegenheit teilte er mit, dass die Militärausgaben der UdSSR seit Jahren weit über dem amtlichen Verteidigungshaushalt und über den höchsten westlichen Schätzungen bei rund 22 Prozent des Volkseinkommens gelegen hätten. Es war damit klar, dass die Sowjetunion einen Rüstungswettlauf mit den USA in den Inneren Weltraum für Raketenabwehr nicht würde durchhalten können, ja dass sie auch den Rüstungswettbewerb auf der Erde und damit die militärische Konfrontation beenden musste. Die Aufgabe der nuklearen Angriffsfähigkeit mit bodengestützten Raketen einer Reichweite zw ischen 500 und 5500 km befreite Westeuropa, Nordafrika, den Mittleren Osten und den größten Teil Ostasiens von einer permanenten Raketenbedrohung aus der Sowjetunion. Es blieben in Europa noch die Raketen bis zu etwa 500 km Reichweite und alle luftgestützten nuklearfähigen Angriffsflugkörper an Kampfflugzeugen, mit rund 25.000 "substrategischen" oder "operativ-taktischen" Nuklearwaffen im Inventar der Streitkräfte. Doch mit der Beseitigung der weiter reichenden INF-Systeme hatte die Entnuklearisierung der Ost-West-Konfrontation in Europa begonnen und die Abrüstung den ersten wirklichen Durchbruch erzielt. Die Rüstungs- 64 kontrolle hatte im Kernwaffenbereich ihren ersten großen Erfolg. 1990 folgte der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa, der die Waffenzahlen auf beiden Seiten auf ein niedrigeres Paritätsniveau reduzierte und mit der Überzahl der gepanzerten Angriffskräfte des Warschauer Pakts gegenüber der NATO auch die bis dahin gegebene Invasionsfähigkeit für einen kontinentweiten Angriffskrieg der Sowjetmacht in Europa beseitigte. Damit war vor allem in der Zentralregion nördlich der Alpen eine neue Basis für eine militärische Stabilität in Krisen geschaffen und die Rüstungskontrolle auch an konventionellen Streitkräften durch starke Verringerungen eingeführt. 1990 gaben der Warschauer Pakt und die NATO in Paris auch die gemeinsame Erklärung über "Nichtfeindlichkeit" ab. Die KSZE vereinbarte eine neue, weiterführende Grundsatzdeklaration, die Pariser "Charta für ein Neues Europa", mit der die politische Kooperation gestärkt werden sollte. 1991 konnten Bush und Gorbatschow noch den Moskauer "START"-Vertrag über die Reduzierung der Zahl der strategischen Nuklearwaffen unterzeichnen, bevor nach dem Augustputsch gegen Gorbatschow, den Jelzin zum Scheitern brachte, die Sowjetunion Ende 1991 zusammenbrach. Präsident Clinton setzte die Politik seines Amtsvorgängers für Rüstungskontrolle und gegen die Weiterverbreitung von ABC-Massenvernichtungsmitteln, insbesondere die Nonproliferationspolitik im nuklearen Rüstungsbereich fort und suchte auch, die nuklearstrategische Abrüstung über "START-I und II" weiterzuführen. Amerikanische Finanzmittel wurden bereitgestellt, um die vertragskonforme Nuklear-Abrüstung Russlands im strategischen Kernwaffenbereich zu sichern und womöglich zu beschleunigen. Dies geschah durch den Ankauf russischen Plutoniums und angereicherten Uraniums aus delaborierten russischen Nukleargefechtsköpfen und Depots für Waffenzuladungen. Man hielt 1993-96 eine jährliche Subvention von etwa einer Milliarde US-Dollar über zehn Jahre für nötig, um die Reduzierung der russischen Kernwaffen auf die in START vereinbarten Obergrenzen zu finanzieren. Die Verhandlungen zwischen Washington und Moskau darüber gingen nur zähe voran, zumal auch in den USA nicht genügend technische Kapazitäten mit den geforderten Sicherheitsstandards frei waren. Clinton folgte dem von Bush eingeschlagenen Kurs der praktischen Kooperation mit Moskau zur Fortsetzung und Verfestigung der strategischen Rüstungskontrolle und wagte sich darüber hinaus weit vor auf das ungeordnete und unübersichtliche Feld der Atomwaffenversuche, die von dem umfassenden Versuchsverbot vertraglich unterbunden werden sollten. Schließlich legte er dem US-Senat diesen unterzeichneten Vertrag aber nicht vor, um eine drohende Ablehnung zu vermeiden und die Frage für bessere Zeiten offen zu halten. Sonst kam es nicht zu wesentlichen Abweichungen von der übernommenen Bush-Linie in der internationalen Nuklear-Sicherheitspolitik. Die Festschreibung des NPT oder internationalen Sperrvertrags gegen die Weiterverbreitung von Kernwaffen¸ der ohnehin den historischen Kernwaffenstaaten ein völkerrechtliches, nukleares Rüstungsprivileg und damit einen herausgehobenen Sonderstatus sichert, war Teil dieser Politik. Mit dieser wurde abermals die besondere internationale Stellung Russlands als der anderen Kernwaffen-Großmacht neben den USA, dieser also pro forma ebenbürtig, anerkannt. Für Moskau war dies ein wesentlicher Vorteil, obwohl auch die übrigen anerkannten Kernwaffenstaaten Großbritannien, Frankreich und China davon profitierten, und schließlich sogar noch die vertragsungebundenen, später hinzu gekommenen, neuen marginalen Nuklearmächte Indien und Pakistan. Gegenüber diesen beiden verfeindeten, südasiatischen Groß-Staaten mit nuklearen Waffen und Raketen erlitt Clinton in seinem Bemühen, den internationalen Status quo gegen weitere Kernwaffenrüstungen zu verteidigen und damit die befürchtete Proliferation aufzuhalten, eine – möglicherweise künftig folgenschwere, möglicherweise aber auch nicht in eine weitere Proliferation führende – Niederlage. 65 Weder Russland noch China unterstützten die USA wirksam in deren Nonproliferationspolitik, denn beide Mächte suchten ihren jeweiligen Klienten – Russland Indien, China Pakistan – zu schonen. Im Falle Nordkoreas blieb die Lage unsicher, obwohl es der ClintonAdministration gelang, durch eine Politik der verhaltenen Konzessionen und der ausgesprochenen Drohungen 1994-95 das kommunistische Regime in Pjöngjang für einen expliziten "do-ut-des"-Kompromiss zu gewinnen: Verzicht Nordkoreas auf sein Nuklear-ReaktorenProgramm mit waffenfähigem nuklearen Brennstoffanfall gegen einen kostenlosen Bau technisch nicht für waffenfähiges Material geeigneter moderner Reaktoren amerikanischen Typs und die Zusicherung von kostenlosen Erdöllieferungen. Zwar wurde das nordkoreanische Programm eingefroren, doch zu sicheren Kontrollen durch umfassende Inspektionen der Internationalen Kernkraftbehörde der UN (IAEA), war Nordkorea nicht bereit. Die diplomatische Hängepartie dauerte über fünf Jahre und das Ende der Clinton-Präsidentschaft hinaus an. Natürlich hatten und haben weder Russland noch China ein Interesse an einem nuklear bewaffneten Nordkorea als Unsicherheitsfaktor im Fernen Osten. Es ist sogar wahrscheinlich, dass Moskau und Peking versucht haben, Einfluss im amerikanischen Sinne auf Pjöngjang zu nehmen und Nordkorea zu mäßigen. Doch es ist unwahrscheinlich, dass beide asiatischen Großmächte eine sicherheitspolitische "pax americana" über Korea, dazu noch in Verbindung mit Japan und Taiwan, zulassen würden, wenn ihnen daraus nicht Vorteile und eine gesicherte Mitwirkung erwüchsen. Ein russisches Interesse daran war bis zum Ende der ClintonPräsidentschaft nicht sicher auszumachen. Putin verhielt sich ambivalent wie Jelzin vor ihm. Dies trifft auch für die nordkoreanische Raketenrüstung zu, die Japan zu beunruhigen begann. Nach einem offiziellen Besuch im Jahre 2000 in Nordkorea trat Putin als Vermittler zwischen Pjöngjang und Washington auf, indem er den bizarren Vorschlag machte, die USA sollten Nordkorea ein Weltraumprogramm ermöglichen. Dafür würde Nordkorea bereit sein, die Entwicklung und Erprobung eigener Langstreckenraketen, die amerikanisches Gebiet in Alaska erreichen könnten, einzustellen. Wenn diese Offerte tatsächlich die Zustimmung des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-il gehabt haben sollte, so wäre dies eine Reprise des Kompromisses über die Atomreaktoren, der noch immer nicht konsolidiert ist. Deutlich wurde damit nur, dass Russland auch im Fernen Osten wieder als eine politisch handlungsfähige Macht aufzutreten und Klienten russischen Einflusses zu werben oder zu reaktivieren sucht. Auch diese strategische Sicherheitsfrage blieb offen wie die wiederholt proklamierten "Sicherheitspartnerschaften" der USA mit Russland und mit China. Erkennbar aber wurde während der acht Clinton-Jahre, dass Moskau der "singulären Weltmacht" USA den Fernen Osten mit dem Nordwestpazifik nicht einfach überlassen wollte. Es versuchte daher der auch in Peking und in Europa, vor allem in Paris, als schädlich für die internationale Sicherheit und Kooperation bezeichneten "Unipolarität" der weltweiten Machtverteilung zu Gunsten Amerikas durch eine Partnerschaft gegen "Suprematie" und "Hegemonie" entgege nzuwirken. Tatsächlich hat Clinton keine Hegemonialmachtpolitik betrieben, sondern den Akzent der amerikanischen Außenpolitik zwar einerseits auf Entscheidungsfreiheit, aber andererseits auch auf Handelspolitik und die Unterstützung der amerikanischen Kapitalinvestition und der technologischen Dominanz in der Weltwirtschaft gesetzt. Ein Kernstück der Clintonschen Außenpolitik bildeten die Nordamerikanische Freihandelszone, um die der pazifisch-asiatische Wirtschaftsraum von der amerikanischen Hemisphäre aus angelegt wurde und der weltweite Freihandel, regional bedingt mit der Welthandelsorganisation als weitem Mantel, in dem auch Europa Platz finden sollte. Das strategische Ziel dieser Außenwirtschaftspolitik lag auf folgender Linie: Ausbreitung des amerikanischen Außenhandels, der amerikanischen Kapitalinvestition und der technologischen Prädominanz ohne Abhängigkeiten von anderen Ländern, in einer den USA vorteilhaften Korrelation der wirtschaftlichen und technologischen Kräfte. Diese Zielsetzung verursachte zunächst allerdings weniger Russland und 66 China Probleme als Europa und Japan, also den alliierten Schutzklienten Amerikas. Russland und in zweiter Linie China, an dem das amerikanische Interesse aber während der ClintonJahre wie zuvor schon während der Bush-Jahre stetig stieg, wurden für die strategische Sicherheit gebraucht, Russland dabei global und in Europa. Dabei suchte die amerikanische Mittelostpolitik unter Clinton Russland so weit wie möglich aus den orientalischen Angelegenheiten herauszuhalten, obwohl schon die Sowjetunion 1991 "Co-Schirmherrin" der internationalen Nahostkonferenz über Palästina und den Libanon gewesen war und Moskau natürlich versuchte, den russischen Einfluss darauf zu erhalten und zu vergrößern. Die Abschirmung des vielfältigen Krisenschauplatzes von russischer Einwirkung war für den Erfolg der amerikanischen Politik zur Kriseneindämmung und Konfliktbeendigung umso notwendiger, als Moskau seit Jahrzehnten systematisch jeweils die Gegenposition zu der Washingtons bezogen hatte. Damit hatte es versucht, für Russland eine arabische Klientel zu bilden, was während einiger Jahre in Kairo, Damaskus, Bagdad und Saana auch nahezu gelungen war. Clinton konnte aber ohne russische Mitwirkung immerhin 1993 als Schirmherr des "Oslo-Prozesses" einer schrittweisen Befriedung Palästinas in begrenzter Kooperation zwischen Israel und der PLO unter Abstützung auf Ägypten und Jordanien - beides amerikanische Klienten - moderierend und vermittelnd gute Dienste tun wie auch dem Friedensschluss zwischen Jordanien und Israel. Die amerikanische Prädominanz nach dem militärischen Erfolg über Irak 1991 bot zunächst eine ausreichende Grundlage, an der Russland unter Jelzin nichts ändern konnte. Zwar versuchte Primakov als Außenminister und später als Premierminister, Russland wieder im Nahen und Mittleren Osten zu etablieren. Doch Russland brachte nicht das nötige Gegengewicht auf die Waage, um eine Situation der "Balance of Power" gegenüber den USA herzustellen. Zwar blieben die USA als externe Macht auf Distanz mit militärischen Stützpunkten in der Region und schnell verfügbaren Eingreifkräften jeder russischen oder anderen Interventionsfähigkeit technisch-operationell und logistisch auch nach der militärischen Qualität der Truppen, weit überlegen. Doch eine politische Hegemonie konnten sie daraus auch ohne russische Gegenwirkung nicht gewinnen. Eine "pax americana" kam im Nahen und Mittleren Osten in den Clinton-Jahren ebenso wenig zu Stande wie unter den Präsidentschaften der 1970er- und 1980er-Jahre. Immerhin war die Situation in der Region des Weiteren Mittleren Ostens seit der Loslösung der ehemals russisch beherrschten mittelasiatischen Länder von Moskau im Zerfall der Sowjetmacht und nach dem schweren Misserfolg der sowjetischen Intervention im afghanischen Bürgerkrieg gegen die islamischen Rebellen einseitig zum Nachteil Russlands verändert. Ähnlich wie im Westen in Europa hatte der Gebietsverlust im Süden gegenüber dem Orient die russische Reichweite und Eingriffsfähigkeit radikal verkürzt und den größten Teil des weiten Raumes dem russischen Aktionsradius entzogen. Die USA mussten nur dazu beitragen, diesen neuen, noch provisorischen Zustand zu konsolidieren und für ihre und westliche Zwecke dauerhaft zu nutzen. Diese waren: die Ressourcen, ungehinderter Zugang und ungestörter Handel, freie Verbindungen, sichere Kapitalinvestitionen sowie einigermaßen zuverlässige regionale Partner. Hier lag und liegt die eigentliche Aufgabe amerikanischer Orientpolitik nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation in der postsowjetischen Epoche. Clinton fand allerdings drei erhebliche Hindernisse vor, als er das orientalische Erbe seines Amtsvorgängers antrat: − den israelisch-arabischen Konflikt, 67 − den feindlichen und aggressiven Irak unter der totalitären Diktatur eines modernen orientalischen Despoten in der Person Saddam Husseins und − den feindlichen, wenngleich nicht länger offen aggressiven Iran der schiitischen Revolution mit einem gleichfalls totalitären ideologischen Regime. Der Präsident versuchte die Probleme weniger durch direkte Konfrontation und massive Pressionen zu lösen als vielmehr durch indirekte Einflussnahme und Versuche der Diplomatie, die Gegner davon zu überzeugen, dass ihre Eigeninteressen besser auf einer Linie der internationalen Kooperation verfolgt werden könnten. Von dieser Generallinie wich Clinton auch dann nicht ab, als er punktuell Gewalt anwenden ließ, wie regelmäßig gegen den Irak zur Durchsetzung der von den UN formulierten und vom Irak nolens volens akzeptierten Waffenstillstandsbedingungen über Abrüstung und Flugverbotszonen zum Schutze von durch Bagdad verfolgter Minderheiten, oder im Falle Bosniens und später des Kosovos. Er ließ sich von den negativen Erfahrungen des "double containment" des Iraks und des Irans in der Anwendung der Sanktionspolitik insoweit leiten, als er die Embargos generell nicht verschärfte. Andererseits konnte er diese Politik auch nicht umkehren und wendete sie im Fall Nordkorea an, inklusive der Drohungen mit kriegerischer Zerstörung im Fall nordkoreanischer Angriffe gegen den Süden, die 1993-95 zeitweilig wahrscheinlich schienen. Doch letztlich setzte Clinton immer wieder auf Verhandlungen, gestützt auf sichtbare amerikanische Macht. In jedem einzelnen Fall einer internationalen Krise und in allen lang hingezogenen regionalen Konflikten traf die Politik Clintons immer wieder auf den russischen Widerpart, oft genug im alten Sowjetstil. Es kam nie zu offenen Konfrontationen, obwohl Jelzin mehrmals, vor allem 1999 über das Kosovo aber auch 1994 über Tschetschenien, damit drohte. Amerikanische Interessen und Positionen fanden sich mehr oder weniger direkt russischen gegenüber. Dabei führten diplomatische Bemühungen um einen Interessensausgleich oder Kompromissformeln für begrenzt gemeinsames Handeln wie 1995 in Dayton über Bosnien oder 1999 in Helsinki über das Kosovo und den Umgang mit Serbien nach der militärischen Intervention der NATO zumeist zu einem halbwegs tragbaren und zweckmäßigen Resultat. Niemals jedoch fanden sich optimale Lösungen im Sinne der Befriedung von Kriegs- und Krisengebieten. Der Fond der amerikanisch-russischen Beziehungen blieb antagonistisch, obwohl Jelzin und 2000, im letzten Jahr Clintons im Weißen Haus, Putin in der praktischen Politik der Kooperation den Vorrang gaben und externe Exzesse vermieden. Auf diese Weise konnte auch in Krisen wie 1999 über den Balkan gemeinsamer Boden für Schadensbegrenzung und Konfliktbeendigung gefunden oder erhalten werden. Insgesamt blieb Moskau ein beträchtlicher Risikofaktor, vor allem im Kaukasus. Dies zeigen die beiden tschetschenischen Kriege (1994-96, seit 2000), die auf maßgeblich russische Initiative hin eskalierten und andauerten. Dies umso mehr, als beide mit der russischen Innenpolitik verbunden und Teil des Machtspiels zwischen den Rivalen im Kreml und den Moskauer Machthierarchien waren. Putins "Anti-Terror"-Feldzug vor Beginn des Präsidentschaftswahlkampfes mit erneuerten Angriffen in Tschetschenien im Frühjahr 2000 bietet ein brutales Beispiel für diese destabilisierende Wechselwirkung zwischen russischer Innenpolitik und militärischer Gewaltanwendung mit Auswirkungen auch auf Länder außerhalb der "Russischen Föderation" wie z.B. Georgien. Das Gleiche gilt für die illegalen, die russische Wirtschaft weiter schwächenden Finanzmanipulationen und privaten Transaktionen des Kapitalexports im Maßstab von mehreren Milliarden US-Dollar pro Jahr, Vorgänge, die ohne massive Regierungskorruption und Behördenkriminalität nicht möglich wären, so wie das Absinken des erwarteten Steueraufkommens von 50 auf 30 und zeitweilig auf 10 Prozent der fälligen Zahlungen seitens der Steuerpflichtigen in den Jahren 1993-99. Zweifelsohne können fremde Staaten in Russland nicht ordnend eingreifen. Die internationalen Finanzinstitutionen und selbst die USA können Russland keine ottomanische oder ägyptische Schuldenverwaltung nach dem Vorbild des 19. Jahrhunderts zur Konsolidierung von 68 Haushalt, Finanzen und Währung aufzwingen. Dasselbe gilt für den Umgang mit der russischen Regierung und insbesondere mit dem vom Volk gewählten Präsidenten. Aus guten Gründen eigener und internationaler Sicherheits- und Gläubigerinteressen mussten die USA unter Clintons Administration auf Russland Rücksicht nehmen und Vorgänge dulden, die vor allem Russland selber schadeten. Clinton musste wie vor ihm Bush sen. und Reagan oder Carter Prioritäten setzen und beachten: − nukleare Sicherheit, − strategische Stabilität, − Einhaltung der Rüstungskontrollabkommen in Europa, die zum überwiegenden Vorteil der NATO und Westeuropas geschlossen wurden und seit 1991 diese Wirkung auf Europa als Ganzes haben, − Aufrechterhaltung der internationalen Nichtweiterverbreitungspolitik nach dem Atomwaffensperrvertrag, usw. Aber natürlich hatte die pragmatische Realpolitik Amerikas gegenüber Russland und den politischen Verhältnissen in Moskau unausweichliche und in kurzer Zeit nicht korrigierbare Effekte bezüglich der demokratischen Transformation Russlands und dem "Stabilitätstransfer" von West nach Ost. In dieser Hinsicht verstand die Clinton-Administration es nicht, die neuen internationalen Herausforderungen aufzunehmen und konstruktiv handzuhaben. Aber "kuratives" Handeln war im Falle Russlands nicht möglich und "palliatives" Handeln reichte zur Besserung nicht aus. Insofern hatte Kosyrew 1994 Recht, als er Amerika Lektionen über Russlands "Großmacht"-Qualität erteilte. Es war unstreitig, dass weder die USA noch eine andere Macht der Welt in den 90er-Jahren Russland im Kaukasus oder selbst im Baltikum in den Arm fallen hätten können. Auf dem Balkan lagen die Dinge anders, denn Russland war zu weit entfernt und militärisch nicht in der Lage, mit Aussicht auf Erfolg gegen westlichen Widerstand unter amerikanischer Führung und Einsatz amerikanischer Macht offensive Politik zu betreiben. Präsident Clinton hatte im Wahlkampf 1992 Jugoslawien und insbesondere die Lage in Bosnien nur flüchtig gestreift, war aber immerhin für einen energischen Einsatz zur Verteid igung der Menschenrechte eingetreten. Er hatte sogar vorgeschlagen, dass die USA gemeinsam mit ihren NATO-Partnern Streitkräfte einsetzen sollten, um den Bosnischen Krieg zu beenden und den Helsinki-Prinzipien der KSZE, die im November 1990 im Pariser KSZEDokument "Charta für eine Neues Europa" von allen Teilnehmern inklusive Jugoslawien und der Sowjetunion bekräftigt worden waren, Gültigkeit, zu verschaffen. Aber Clinton hatte 1993/94 keine klaren Ziele und jenseits allgemeiner Leit- und Grundsätze keine politische Konzeption für Bosnien, geschweige denn für eine Regelung des jugoslawischen Zerfallskonflikts. Hatte er eine Politik gegenüber Russland? Während der Übergangszeit von der Bush- zur Clinton-Administration beim Jahreswechsel 1992/93 zeichnete Clinton, noch nicht in sein Amt eingeführt, einen Text über die Politik gegenüber Moskau, in dem er Russland eine "strategische Partnerschaft" in Aussicht stellte, die nach seinen Worten den Charakter einer "strategischen Allianz" annehmen könnte. Die Floskel "strategische Partnerschaft" sollte in den folgenden Jahren das neue Modewort der öffentlichen Diplomatie des Westens im Umgang mit dem "neuen Russland" werden, einem Modewort von allerdings mehr rhetorischer als substanzieller Bedeutung. 1994 kehrte Clinton von einem Besuch in Kiew mit dem Abschluss eines mehrseitigen Abkommens zur Ausfü hrung der von der Sowjetunion im SALT-Vertrag eingegangenen Verpflichtungen, insbesondere der Reduzierung der Flugkörper- und Gefechtskopfzahlen, durch die Nachfolgestaaten mit 69 strategischen Kernwaffen aus dem Sowjet-Inventar in ihren Grenzen unter die vereinbarten Obergrenzen, zurück. Bei seinem darauffolgendem ersten Besuch in Moskau sprach er im Kreml den Gedanken aus, dass Russland in Zukunft einmal Mitglied der NATO werden könnte. Clinton wies keinen Zeithorizont, doch der Gedanke, dass Russland eines Tages der NATO beitreten könnte, trug schon als eine ferne hypothetische Möglichkeit zur Verwirrung über die Bedeutung dessen bei, was eines der Hauptthemen der amerikanisch-russischen Beziehungen in den Jahren bis 1999/2000 werden sollte: Die "NATO-Expansion", wie Clintons erster Außenminister Warren Christopher die NATO-Osterweiterung im Herbst 1993 zunächst nannte, bevor die mildere Version "NATO-Öffnung" gewählt wurde. Tatsächlich war dieses Hauptthema der amerikanischen Bündnispolitik in Europa und der Russlandpolitik mit drei weiteren zentralen Themen der Sicherheitspolitik verbunden: − Die Reduzierung der strategischen Nuklearwaffen der beiden START-Partner auf deutlich niedrigere Obergrenzen als die in START-I von Bush und Gorbatschow 1991 vereinbarten 6.000 Gefechtsköpfe an bis zu 1.500 strategischen Angriffsträgern ohne Verlust an "strategischer Stabilität" im Verhältnis der gegenseitigen Abschreckung in der globalen Bipolarität zwischen den beiden "Supermächten" USA und UdSSR. Für das künftige Anschlussabkommen "START-II" wurden bis zu 3.500 Gefechtsköpfe an Angriffsträgern (Raketen, Marschflugkörpern und "schweren Bombern") für die UdSSR und bis zu 3.000 für die USA vereinbart, für "START-III", das noch vorzubereiten war, um die 2.000 auf jeder Seite – noch unverbindlich – in Aussicht genommen, dazu die Beseitigung aller Mehrfachangriffs-Systeme an Flugkörpern (MIR V), aller bodenbeweglichen Startsysteme für strategische Flugkörper und der gesamten Klasse der schweren bodengestützten Interkontinentalraketen (ICBM), die nur die UdSSR besaß. Die einseitige strukturelle Abrüstung Russlands seit 1992 durch einen Mangel an Mitteln zur Modernisierung des Inve ntars und einen Kapazitätsverlust der russischen Rüstungsindustrie machte es aber schon 1993/94 unwahrscheinlich, dass Russland die noch immer relativ hoch angesetzten Obergrenzen unter START-II, geschweige denn unter START-I, das noch nicht ratifiziert war, jemals würde ausfüllen können. Daher war eine weitere radikale Plafondabsenkung auf russischer Seite unausweichlich, wenn die strategischen Streitkräfte konsolidiert und konserviert werden sollten. Die Moskauer Diskussion darüber war ambivalent, doch die dominierenden Vorstellungen wiesen in Richtung auf 2.500 bis 2.000 Gefechtsköpfe an ebenso vielen Trägersystemen (Flugkörper am Boden und in U-Booten plus an Kampfflugzeugen strategischer Reichweite), während einige Vorschläge ein noch niedrigeres Abschreckungsniveau bei 1.500 bis 1.000 strategischen Waffen vorsahen. Mit dieser Frage war auch das Thema strategische Raketenabwehr und Einhaltung oder Abänderung des ABM-Vertrags von 1972 über eine enge Begrenzung der Zahl der erlaubten und ein Verbot aller luft-, see- und raumgestützten sowie aller bodenbeweglichen Abwehrsysteme und technischen Komponenten inklusive ABM-Radargeräten verbunden. Dieses Thema sollte sich als ein weiterer Störfaktor und Anlass einer neuen Kontroverse zwischen Washington und Moskau über das Ende der Clinton-Präsidentschaft 2001 hinaus erweisen. Clintons Angebot an Putin, Russland möge mit den USA dabei zusammena rbeiten, um Sicherheit vor Raketenüberfällen seitens so genannter "Schurkenstaaten" (rogue states) oder "Besorgnis erregender Staaten" (states of concern) und internationaler Terroristen, die ganze Länder zu erpressen suchen würden (nuclear black-mail), mit Amerika zu teilen, traf zunächst auf schroffe Ablehnung in Moskau, wiewohl Putin schon im Sommer 2000 partielle Gegenvorschläge machte. Diese waren allerdings in der Sache 70 nicht nützlich, sondern lenkten vom Problemkern der Bedrohung Nordamerikas aus der Distanz mit aufwachsenden kleinen Raketenkräften ab. So war die strategische Stabilität im bilateralen Verhältnis zwar vorläufig gegeben, lag jedoch für die Zukunft in der Schwebe. − Das zweite mit Russland verbundene Sicherheitsthema war die militärische Stabilität auf konventioneller Waffenebene in Europa auf der Basis des mehrmals abgeänderten Pariser Vertrags von 1990 über konventionelle Streitkräfte vom Atlantik zum Ural (KSEVertrag). Dieser Vertrag, der das Kernstück der Beendigung der militärischen Ost-WestKonfrontation war, beruht auf der Parität der Zahlen schwerer konventioneller Waffe nsysteme der Land- und Luftstreitkräfte der Vertragspartner, ursprünglich der Mitgliedstaaten der NATO und des Warschauer Pakts (WP). Wegen der geopolitischen Veränderungen durch die Auflösung der UdSSR und des WPs selber im Jahr 1991 mussten das Zahlenwerk und einige Bestimmungen über regionale Obergrenzen an den Flanken Russlands seit 1992 verschiedentlich an die Veränderungen von Staatsgebieten angepasst werden. Moskau suchte ab 1993 solche Anpassungen, die vorwiegend Russland betrafen, mit der Frage der NATO-Osterweiterung in einem Junktim zu verbinden, in das zeitweilig auch die Ratifizierung des Vertrags START-I von 1991 und danach des START-IIVertrags hineingezwungen werden sollte. Die Clinton-Administration lehnte ein solches "linkage" ab, machte Moskau gemeinsam mit den NATO-Partnern aber doch in der Sache angemessene Konzessionen, sodass es zu einer Neuregelung kommen konnte. Die neu geschaffene Lage machte eine Folge von Abänderungen des KSE-Vertrags von 1990 notwendig und dringend, noch bevor die NATO-Politik für "Stabilitätstransfer" durch die Öffnung des Bündnisses für drei (bzw. später vier) ehemalige WP-Verbündete der UdSSR - Polen, Ungarn, Tschechoslowakei (nach deren Auflösung Tschechien und Slowakei) - nach Osten "ausgreifen" konnte. So hatte der US-Außenminister Christopher die Politik der NATO-Erweiterung im Dezember 1993 im Nordatlantikrat gekennzeichnet. 6 Zu dieser Zeit standen russische Truppen noch in Deutschland, während einige militärische Anlagen in den unabhängig gewordenen baltischen Ländern noch immer unter russischer Kontrolle und in Nutzung gegenüber der NATO waren. Dagegen war der frühere "Baltische Militärbezirk" der UdSSR wie der "Transkaukasische" im Südwesten jenseits des Schwarzen Meeres aufgelöst worden. Im Nordwesten blieb Russland nur der Teilbezirk "Kaliningrad" im alten Nordostpreußen als militärische Exklave. Eine russische Armee war noch immer in einer Grenzprovinz Moldawiens (Moldau) am Flusse Dnjestr stationiert, "Transnestrien", die Moskau mit Hilfe des dortigen Armeebefehlshabers General Lebed abgetrennt hatte. Auch in Georgien standen noch immer russische Truppen, die dort die Abtrennung der Küstenprovinz Abchasien in offener Rebellion gegen Georgien geschehen ließen und dann abdeckten. Hinzu kam die Rebellion in Tschetschenien gegen Russland. Diese Vorgänge erzwangen, verzögerten und erschwerten zugleich die Änderung des KSE-Vertrags zur Anpassung der Bestimmungen über regionale Waffenobergrenzen und zeitweilige Truppenzuzüge an die neue Realität. − Globale strategisch-politische Stabilität und ein kooperatives Management der internationalen Sicherheit bei den UN, im NPT-Vertragsregime der Kontrolle der vereinbarten Nichtweiterverbreitung nuklearer Rüstungen und Waffentechnologie, zur Einhaltung der bilateral vereinbarten strategischen Rüstungskontrolle nach den Verträgen SALT und START sowie INF und für Abkommen über wirtschaftliche Kooperation, Schuldentilgung, Kapitaltransfer und Handel für globale ökonomische Stabilität. Dafür hatte Jelzin 6 Vgl. Rühl, Lothar: Deutschland als Europäische Macht, S.199. 71 seit 1993 die Einladung Russlands zur Teilnahme an den Weltwirtschafts-Konferenzen der G-7 als achter Partner gefordert. Dieser dritte Bereich eignete sich besonders für eine symbolische Diplomatie, um Moskau Satisfaktion zu geben und zugleich auf Russland im Sinne westlicher Reformforderungen und politisch-wirtschaftlicher Transformationsziele bei der Stabilisierung der Reformen in Russland einzuwirken. Alle drei Bereiche sind miteinander und mit den NATO-Politiken der Osterweiterung und der Stabilisierung des Balkans verbunden. Der rapide wirtschaftliche Niedergang und die inneren Wirren Russlands, die 1993-94 auch nach der politischen Liquidierung der Opposition gegen Jelzin mit Hilfe der Armee im Oktober 1993 durch einen Sturm des Parlamentsgebäudes in der postsowjetischen Staatskrise andauerten, behinderten Russland, seinen außenpolitischen Zielen näher zu kommen. Die amerikanische Politik wurde dadurch einerseits kompliziert und zu besonderer Risikovorsorge im Umgang mit einem instabilen und explosiven, aber dennoch unersetzlichen und unumgehbaren Partner gezwungen, andererseits aber auch durch größere Handlungsfreiheit erleichtert. Moskau war zu wirksamen Gegenaktionen nicht fähig und hatte keine handlungsfähigen Partner mehr im Ausland. Die Clinton-Administration nutzte diese günstige Konstellation während der gesamten Dauer der Präsidentschaft mit bemerkenswerter Folgerichtigkeit im Handeln, nachdem sie sich jeweils gegenüber einem Problem orientiert und zu einer Politik entschlossen hatte. Die zeigte sich in allen wesentlichen internationalen Fragen in den drei Hauptlinien der Clintonschen Allianz- und Sicherheitspolitik in Europa: − NATO-Osterweiterung in Mitteleuropa bei Schonung Russlands durch vorläufige Ausklammerung der drei baltischen Staaten und Verzögerung der Aufnahmeverfahren für die fünf zwischen 1994 und 1999 schon erklärten südosteuropäischen Beitrittskandidaten mit den ehemaligen WP-Staaten Rumänien und Bulgarien an der Spitze des Feldes; − Intervention in den jugoslawischen Zerfallskonflikt mit dem Ziel der Stabilisierung der explosiven Balkansituation auf der Basis freiheitlich-demokratischer Strukturen, westlicher politischer Ordnungsprinzipien und Kontrolle durch die NATO in Verbindung mit der UNO, der EU und der OSZE bei Beteiligung Russlands als selbstständiger Partner, aber im bindenden Rahmen der internationalen Schutztruppen zunächst 1995 in Bosnien, danach 1999 im Kosovo; − "Einbindung Russlands" in eine organisierte sicherheitspolitische Kooperation mit der NATO im Sinne einer privilegierten Partnerschaft mit einem gegenüber allen anderen externen Sicherheits- und "Friedenspartnern" (nach dem "partnership for peace"- Programm der NATO von 1994) herausgehobenen Konsultations-Niveau, allerdings ohne die von Moskau geforderten extensiven Mitbestimmungsrechte an NATO-Planungen und NATOEntscheidungen für Krisenbeherrschung und "friedensschaffende Maßnahmen" oder mitentscheidende Einwirkung auf die militärische NATO-Führung. Für die besondere Partnerschaft mit Russland wurde unter amerikanischer Führung in Brüssel ein ausgeklügeltes Konsultationsverfahren mit mehreren Organen im Rahmen des "EuroAtlantischen Partnerschaftsrates" für alle "Friedenspartner" der NATO, aber mit einem separaten Konsultationszentralorgan "Ständiger Gemeinsamer Rat", kurz "NATO/Russland-Rat" genannt, geschaffen. Daneben ein zweites separates Konsultationsorgan für die Ukraine, deren besondere Bedeutung für die NATO und vor allem die USA auf diese Weise markiert werden sollte. Beide besonderen Beziehungen wurden 1997 mit dem Pariser "Gründungsakt" für Russland und etwas später einer "Charta" für die Ukraine etabliert, aber wegen der Kontroversen über das Kosovo und den Krieg gegen Serbien nur wenig weiterentwickelt. 1999 legte Moskau die Sonderbeziehung aus Protest still, ohne sie jedoch abzubrechen, und die 72 Russen kehrten nur allmählich für ausgewählte Themen in die Konsultation mit der NATO nach Brüssel zurück. Doch der Kontakt blieb inoffiziell selbst in der akuten Krise bestehen, wurde aber von direkten Kontakten zwischen Washington und Moskau überlagert und ersetzt. Auch dieser Vorgang verdeutlichte 1999/2000 abermals die Stärke des amerikanischrussischen Bilateralismus im Krisenmanagement, selbst zu den Bedingungen einer akuten Kontroverse zwischen Moskau und Washington. 5. Bilanz einer bilateralen Großmachtpolitik im Umbruch der europäischen Lage Präsident Clinton und seine Administration erwiesen sich gegenüber Moskau und den Problemen der Russlandpolitik in der NATO wie bei der UNO als im Grossen und Ganzen konsequent und überwiegend zielgerichtet, auch wenn sie in den beiden Hauptoperationen NATOErweiterung und Balkanstabilisierung zwei Mal die Etappenziele und die zunächst eingeschlagene Richtung wechselten. Für die NATO-Erweiterung und das Balkanengagement zeigte Clinton zunächst 1993 nur eine zögerliche und bedingte Bereitschaft. Das Programm "Friedenspartnerschaft" war im Januar 1994 nicht als Übergang zur NATO-Erweiterung angelegt. Es war vielmehr ein Unternehmen, das die drängenden osteuropäischen Länder im Vorhof der Brüsseler Zitadelle auf unabsehbare Zeit in einer Wartestellung zur Bewährung aufhalten sollte. Vor allem aber sollte es auch dem Zeitgewinn für Washington gegenüber Moskau mit dem Ziel einer Verständigung mit Russland über die künftige "europäische Sicherheitsarchitektur", möglicherweise auch ohne NATO-Erweiterung über Polen, Ungarn und Tschechien hinaus dienen. Zwar wurde ein möglicher Beitritt im Prinzip offen gelassen, aber die Hürden waren hoch. Erst 1996 im Vorfeld des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes öffnete der Präsident "die ausgestreckte Hand", weil er die Polen Amerikas für sich mobilmachen wollte, aber auch, weil er erkannte, dass das polnische, ungarische und tschechische Drängen in die NATO gute Gründe im Osten Europas hatte wie umso mehr das der Balten, dem er aber mit Rücksicht auf das Verhältnis zu Russland nicht nachgeben konnte: − Die russischen Unsicherheiten und die Tatsache, dass es außerhalb der NATO in Ost- und Südosteuropa keine zuverlässige Sicherheit gibt, wie der Fall Jugoslawien gezeigt hat, − die faktische Unmöglichkeit einer isolierten nationalen Landesverteidigung gegen einen überlegenen Angreifer, − das Eskalationsproblem von Grenzkonflikten und über die internationalen Grenzen schlagenden inneren Konflikten, − das Streben nach Teilnahme an allen westlichen Institutionen, um den inneren Wandel der Demokratisierung und Liberalisierung von außen abzustützen und − die nützliche Kongruenz von EU-Mitgliedschaft und NATO-Mitgliedschaft, die der Nordatlantikrat im Dezember 1994 zur Doktrin für seine Aufnahmepolitik im lockeren Zusammenhang zweier "paralleler Prozesse" erhob. Zudem war klar geworden, dass die USA nur wenig tun konnten, um den Veränderungsprozess in Russland im westlichen Sinne zu steuern oder um "erweiterte Sicherheit" aus der Distanz über die Bündnisgrenzen der NATO hinaus nach Osten ohne russische Duldung zu bieten. Selbst die USA waren für "Sicherheitsgarantien" außerhalb der NATO überfordert und die damit verbundenen internationalen Risiken nicht kalkulierbar, weil Krisen ihre eigene Natur haben und jede Krise ihre eigene Richtung und Dynamik nimmt. Mit dem postsowjetischen Russland, das sich 1993-96 darbot, waren wirksame Sicherheitsabkommen in Europa nicht zu schließen. Andererseits lehnte die Clinton-Administration wie ihre europäischen 73 NATO-Partner Sicherheitsarrangements mit Moskau über dritte Länder strikt ab. 1994 erwidert man auf die russischen Forderungen: − kein Vetorecht, − kein 'droit de regard' oder Mitspracherecht Russlands über die Aufnahme anderer Länder in die NATO, − keine Interessensphären, − kein Sicherheits-Kondominium NATO/Russland über Europa und − keine Sicherheitsprivilegien für Russland. Dies waren "die fünf Neins" der Alliierten an die Adresse Moskaus. Damit blieb als positive Politik nur noch die Aufnahme von Ländern in die NATO je nach den Bedürfnissen und dem Grad der Übereinstimmung und der Fähigkeit der Kandidaten, die Bündnisverpflichtungen zu erfüllen. Russland konnte dafür nicht gewonnen und die NATO ihm auch nicht geöffnet werden. Also musste eine quasi-privilegierte Ersatzbeziehung konstruiert werden, was im Mai 1997 geschah. Trotzdem blieb die russische Opposition gegen die NATO-Erweiterung erha lten und wirkte als ein ständiger Stachel im Verhältnis Washington-Moskau. Amerika konnte dies allerdings ertragen, weil er nur als Druck ohne Schärfe auf den Bündnispanzer in Europa wirkte. Russland hatte keine Aktions- und Pressionsmöglichkeiten gegenüber Amerika. Auf der anderen Seite hatten die USA nur marginale private Wirtschaftsinteressen in und an Russland. Die US-Wirtschafts- und Finanzhilfe für Russland war bescheiden und strikt objektgebunden, damit auch befristet. Amerika hatte wenig zu gewinnen und noch weniger zu verlieren, wenn das Reformexperiment Jelzins scheiterte. Nicht alle in Washington sahen die Lage so, doch Clinton brauchte nichts zu riskieren: Würde die Kooperation sich gut entwickeln, dann umso besser, wenn nicht, dann "business as usual" wie früher mit der Sowjetunion in der strategischen Rüstungskonkurrenz und der passiven militärischen Konfrontation im Ost-WestKonflikt, die Russland in seiner Schwäche ohnehin nicht länger aufrechterhalten konnte. "Engaging Russia" war ein Appell der Vernunft und des guten Willens im wohlverstandenen amerikanischen Eigeninteresse. Doch die Clinton-Administration folgte dieser Losung nur mit Vorsicht und hielt auf Sicherheitsdistanz, bei den Ausgaben auf einen ökonomisch sinnvollen und finanziell sorgfältig begrenzten Aufwand bedacht. Man hatte keinen Grund, Moskau weit entgegenzukommen, keine Komplexe gegenüber Russland, keine Wiedergutmachung zu leisten, keine nationale Einheit abzugelten, keine russischen Truppen aus dem Land nach Russland zurückzuführen und dafür zu bezahlen. Die europäischen Alliierten und Japan wie Südkorea, Israel, Saudi-Arabien, Ägypten waren gut abgeschirmt, die NATO konnte ausgebaut und auf Distanz zu Russlands Grenzen gehalten werden, bis die Zeiten sich weiter geändert hätten. Im Notfall stand die Macht bereit. So wurde die NATO-Osterweiterung in Mitteleuropa 1996/97 in Washington beschlossen und auf die drei Länder Polen, Tschechien und Ungarn begrenzt. Damit verbunden war jedoch die zweite Kursänderung: Clinton lehnte die Erweiterung der ersten Beitrittsgruppe um Rumänien und Slowenien, worauf Frankreich, Italien, Griechenland, schließlich auch Deutschland drängten, ab und hielt auch die drei Baltenländer auf Distanz. Sogar eine Auflistung der Namen der nächsten Gruppe als Ankündigung einer "zweiten Erweiterung" verweigerte Clinton, um nichts zu forcieren und mehr Zeit zu gewinnen. Damit entging er auch einer Entscheidung über die irgendwann notwendig werdende Begrenzung der "Öffnung" und über weitere Prioritäten auf der Zeitachse, vor allem zwischen dem Baltikum und Südosteuropa. 74 Diese restriktive Haltung musste aber zwei Jahre später wiederum etwas verändert werden, nämlich in der Tendenz, nachdem dem NATO/US-Engagement mit Militärpräsenz in Bosnien seit Ende 1995 – wo Clinton die US-Truppen nur bis zu sechs Monaten stationiert hatte lassen wollen – eine "präventive" Stationierung in Mazedonien und schließlich der Kosovo-Krieg 1999 folgten. Die Luftkriegsführung gegen Serbien und über dem Kosovo hatte sich nicht nur auf das erweiterte NATO-Gebiet inklusive Ungarn abgestützt, sondern auch den bulgarischen Luftraum für Angriffe auf serbisches Gebiet benutzt, den mazedonischen und albanischen ohnehin. Rumänien hatte der NATO geholfen, indem es wie Ungarn und Bulgarien seinen Luftraum für russische Flüge sperrte. Bosnien stand ohnehin unter einem de facto-Protektorat der NATO mit der Ifor/Sfor und in Albanien waren US-Truppen für die Kriegsführung gegen Serbien stationiert. Damit hatten alle diese Balkanländer bessere Argumente zur Begründung ihrer NATO-Kandidatur als zuvor. Hinzu kam die Sicherheits- und Beistandsgarantie für Montenegro wie für Mazedonien, Bosnien und Albanien gegen serbische Angriffe. So zeichnete sich eine bündnispolitische Präfiguration künftiger NATO-Erweiterungen in Südosteuropa ab, in die auch Slowenien und Kroatien eingeschlossen würden. Damit erweiterte sich das Problem gegenüber Russland um einen ganzen Teil Europas, in dem Moskau von jeher ein Gebiet russischer Interessen und Klienteln gesehen hatte. Die Verbindung der NATO-Erweiterung in Mitteleuropa mit der sich herausbildenden NATOSchirmherrschaft über den Balkan bis zum Schwarzen Meer ließ gegenüber Russland eine geopolitische Schieflage großer psychologischer Wirkung entstehen, die den Umgang mit Russland weiter komplizieren musste. Umso mehr Vorsicht war nun vor einem rein "prinzipiengesteuerten" Prozess der NATO-"Öffnung" geboten. Also begann die ClintonAdministration 1999 den Prozess wieder zu verlangsamen. Auch das Baltikum als künftiges Zielgebiet des Stabilitätstransfers durch einen Beitritt zur NATO rückte wieder in den Hintergrund, um Moskau nicht zu viel in zu kurzer Zeit zuzumuten, ohne wiederum die eigene Politik von russischer Zustimmung oder von Kompensationen für Russland abhängig zu machen, etwa hinsichtlich der Ukraine. Auch in der Sicherheitspolitik zur Eindämmung und Beendigung des jugoslawischen Ze rfallskonfliktes in Bosnien zwischen 1993 und Ende 1995 änderte Clinton seine Politik. Auf anfängliche Interventionsbereitschaft, auch mit US-Truppen im NATO-Rahmen, vor Beginn seiner Präsidentschaft, folgte zunehmend Distanz zu diesem Konflikt und wachsende Risikoscheu gegenüber der Entsendung von US-Soldaten auf den Balkan und dann 1994/95 die Intervention mit überwiegend US-Kampfflugzeugen in den NATO-Luftstreitkräften, die zum Einsatz gegen die Serben in Bosnien kamen. Gegenüber einer längerfristigen Stationierung von US-Truppen in Bosnien im Rahmen der von der NATO organisierten und befehligten Ifor/Sfor zeigte sich Clinton anfangs zurückhaltend, auch mit Rücksicht auf den Kongress, der zunächst keine Mittel dafür bewilligen wollte und auf Fristen der Stationierung beharrte, um eine Langzeitpräsenz auszuschließen. Zum Ende der Clinton-Präsidentschaft übte die Administration Kritik am Gegenkandidaten Bush jun., der forderte, die US-Truppen vom Balkan (Bosnien, Mazedonien, Kosovo) abzuziehen oder sie wenigstens weiter zu reduzieren und ihre Präsenz definitiv zu befristen. Die Clinton-Administration wollte dagegen eine unbefristete und nicht wesentlich verminderte US-Militärpräsenz auf dem Balkan, um dort die Stabilität der mühsam eingeleiteten Befriedung und Umwandlung der Verhältnisse nicht zu gefährden. Dies hieß nichts anderes, als dass die Clinton-Administration die Funktion der USMilitärpräsenz von der kurzfristigen Intervention zur militärisch gestützten internationalen Ordnungspolitik in der "Friedenskonsolidierung" verändert sah. Dabei hatte die Haltung Clintons im Kosovo-Krieg deutlich gezeigt, dass der Präsident die Entsendung von Bodentruppen auf einen Konfliktschauplatz mit hohem Kriegsrisiko vermeiden wollte,. Die Kfor 75 kam nur als "internationale Militärpräsenz" für Schutz- und Ordnungsaufgaben nach Beend igung der bewaffneten Feindseligkeiten mit Serbien durch ein Abkommen in das Kosovo. Abgesehen von den innenpolitischen und bündnispolitischen Erwägungen in Washington, wo man stärkere europäische Leistungen für Sicherheit in Europa auch außerhalb des Bündnisgebietes forderte, aber die Führung und operative Kontrolle über die alliierten Kräfte behalten wollte, spielte dabei das Verhältnis zu Russland eine maßgebende Rolle. Gegen Russland musste und konnte man zwar in der akuten Notlage des März 1999 militärisch ohne Ermächtigung seitens des VN-Weltsicherheitsrates eingreifen, doch für die Heilung des Satzungsbruchs brauchte man eine Resolution dieses Rates ohne russisches (und chinesisches) Veto. Washington musste also auf Moskau Rücksicht nehmen. Russland war ein unverzichtbarer Sicherheitspartner der USA und der NATO geworden, wie schon zuvor 1995 in Bosnien. Deshalb wurden die schwierigen Kompromisse mit Russland in Helsinki geschlossen, um "Russland einzubinden". Ohne US-Truppen wäre dies nicht gelungen, denn das kleine russische Kontingent sollte wie 1995 in Bosnien auch 1999 im Kosovo keine eigene Stationierungszone und keine autonome territoriale Zuständigkeit über Teilgebiete erhalten, besonders nicht im Kosovo. Also mussten die Russen den Amerikanern zugeteilt und als halbselbstständige Anhängsel an die US-Truppenstrukturen von Sfor und Kfor behandelt werden. Nur so konnte dem Ebenbürtigkeitsstreben Russlands mit den USA pro forma Genüge geleistet und die russische Beteiligung als eine formal eigenständige, tatsächlich USkontrollierte im NATO-geleiteten Sfor- und Kfor-Rahmen, auf dem Terrain organisiert werden. Alles in allem gelang es der Clinton-Administration, die gestellten internationalen Aufgaben gegenüber Russland und in der meist mühsamen Kooperation mit Russland zu bewältigen. Dies ist kein geringer Erfolg und kein kleines Verdienst. Unter den Umständen und angesichts der chaotischen inneren Lage Russlands mit den eklatanten Defiziten an Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Ordnung, Verlässlichkeit und Effizienz der Regierung unter der Präsidentschaft Jelzins, aber auch unter der Führung Putins im letzten Clinton-Jahr konnte kein externer Partner Moskaus ein besseres Resultat erzielen. Kritik an der nachgiebigen Haltung gegenüber der russischen "Smuta", der anarchischen Unordnung in den Wirren der Zeit, an der russischen Staatskriminalität und Regierungskorruption, vor allem aber an der Repression in Tschetschenien mit einem militärischen Besatzungsterror und der systematischen Vergewaltigung einer ganzen Bevölkerung durch Krieg ist auch gegenüber der Clinton-Administration angebracht. Doch welche Alternativen hatten die USA, wenn man die Prioritäten der europäischen und der internationalen Sicherheit bedenkt, nämlich − − − − − − globale, regionale und nukleare Krisenbeherrschung, militärische Stabilität in Europa, politische Stabilitätstransfers nach Osten mit dem Vehikel der NATO-Erweiterung, Konflikteindämmung im Kaukasus und auf dem Balkan, Zugang von Westen zu den Energiequellen des Kaspischen Beckens und Befriedung des Mittleren Ostens gegen beharrliche Widerstände und Konfliktursachen kriegstreibender Kräfte. Angesichts dieser Agenda hat die Clinton-Präsidentschaft die nahezu nicht handhabbaren Probleme des Umgangs mit Russland gut behandelt und so weit wie möglich unter Kontrolle gehalten. Eine Zulassung Russlands zum Kreise der "G-7" wäre dafür nicht unbedingt nötig gewesen und Clinton widerstand dem Drängen der europäischen Partner einige Jahre, bevor er nachgab und Jelzin zunächst einlud, dann Russland zum Partner der nunmehr "G-8" erhob. Das Verhalten Russlands wird zeigen, ob die USA unter Clinton in diesem Punkte der welt- 76 politischen und weltwirtschaftlichen Konsultationen die richtige Wahl trafen und ob der westliche Einfluss auf Moskau gestärkt wird. 77 Hannes Adomeit Russisch-amerikanische Beziehungen: von "strategic partnership" zu "strategic patience" Einleitung In seinem Beitrag hat Lothar Rühl eine umfassende Darstellung und Analyse der russischamerikanischen Beziehungen in der Clinton-Ära vorgenommen. Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist, einige der vorangegangenen Bewertungen zu kommentieren und Ergänzungen vorzunehmen. Dabei sollen vor allem die Entwicklungen in Russland unter Jelzin und die Reaktionen Moskaus auf die amerikanische Außenpolitik berücksichtigt werden. 1. Aufstieg und Fall der russisch-amerikanischen "strategischen Partnerschaft" Die Anfangsphase der Außenpolitik der Russischen Föderation ab ihrer Souveränitätserklärung (Juni 1990) mit Andrej Kosyrew an der Spitze des entsprechenden Ministeriums (ab Oktober 1990) ruhte auf einer klaren konzeptionellen Grundlage: der "euroatlantischen" Orientierung. Diese knüpfte an das unter Gorbatschow für die Sowjetunion entwickelte Neue Politische Denken mit seinem eindeutig prowestlichen Ansatz an. In seiner Funktion als Vo rsitzender des Obersten Sowjet und dann als gewählter Präsident der Russischen Föderation hatte sich Jelzin zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten des Präsidenten der zur Auflösung verdammten Sowjetunion gemausert. Sein wichtigstes Instrument im scharfen Wettbewerb um die Macht in Moskau war dabei die demokratische Legitimation. Westliche Entwicklungsmodelle, darunter nicht zuletzt das amerikanische, spielten in dieser Phase eine zentrale Rolle. Man könne viel von den Vereinigten Staaten lernen, meinte Jelzin im Juni 1990; schließlich könne man "nicht einfach die zweihundert Jahre der demokratischen Erfahrung Amerikas ignorieren". Ähnlich äußerte sich Jelzins außenpolitischer Berater Burbulis. Keines der dringenden inneren Probleme Russlands könnte gelöst werden, "ohne von der europäischen Erfahrung zu lernen"; ein Wiederaufleben Russlands außerhalb eines erneuerten Europas sei "unmöglich". 1 Die "euroatlantische" Modell-Orientierung fand ihre Entsprechung in der Außenpolitik. Jelzins Russland trat in Wettbewerb zur UdSSR und rang um die Gunst der westlichen Staaten. Der Präsident und sein Außenminister griffen die Schlagworte einer euroatlantischen Gemeinschaft von Vancouver bis Vladivostok auf. Jelzin besuchte im April 1991 das Europäische Parlament in Strassburg und fuhr weiter nach Paris, reiste nach Prag im Mai und Washington im Juni desselben Jahres; der Parlamentspräsident stattete dem NATOHauptquartier in Brüssel ein Art Antrittsbesuch ab. Und das neue Russland schloss Verträge über zwischenstaatliche Beziehungen mit der Ukraine, Weißrussland, den Baltischen Staaten, Kasachstan und Moldawien. Noch bis August 1991 zeigten die Vereinigten Staaten unter Präsident Bush und die europäischen Staaten dem Anbindungsbemühen der neuen russischen Führung die kalte Schulter. Der 1 Äußerungen Jelzins, zit. in: Sovetskaja molodëž’, 3.6.1990, S.3.; zu den Thesen von Burbulis siehe Obnovlennaja Rossija i obnovlennaja Evropa. K poezdke B. N. El’cina vo Franciju, in: Rossijskaja gazeta, 20.4.1991, S.1. 78 fehlgeschlagene Putsch jenes Monats begann aber die Situation zu verändern. Jelzin wurde zunehmend als demokratisch und marktwirtschaftlich eingestellte Alternative zu Gorbatschow verstanden. Die Auflösung der Sowjetunion im Dezember 1991 besiegelte diesen Prozess, und die Vereinigten Staaten setzten jetzt voll und ganz auf das neue Russland. Umgekehrt beschleunigte der Zerfall der UdSSR die euroatlantische Orientierung Russlands. Auf der Agenda Jelzins und Kosyrews standen nun verstärkt die Auflösung der imperialen Strukturen der Sowjetunion, Abbau regionaler militärischer Übergewichte in Europa, Abgehen vom Prinzip der "ominösen" nuklearstrategischen Ebenbürtigkeit mit den USA und Herstellung einer "strategischen Partnerschaft" mit Washington, Zusammenarbeit mit der NATO; ebenso auf der Agenda waren langfristig Mitgliedschaft in der westlichen Allianz sowie Mitarbeit und, wo immer möglich, Mitgliedschaft in internationalen Wirtschaftsorganisationen wie GATT, IMF, Weltbank und G 7. Noch ein weiterer Fehlschlag der Bemühungen, Russland "in die demokratische Staatengemeinschaft und somit in die Weltwirtschaft zu integrieren", warnte Kosyrew, "wäre ein Verrat an der Nation und würde das endgültige Abgleiten Russlands in die Kategorie drittrangiger Staaten bedeuten". 2 Praktischen Ausdruck fand diese Überzeugung in Jelzins Besuchen in Bonn, Rom, Paris, London, Washington, Ottawa und bei den Vereinten Nationen in New York (Ende 1991 bis Mitte 1992) sowie in seinen geplanten Besuchen in Tokio, Seoul und München - letzterer zur Teilnahme am Treffen der G 7. Und die mit den Vereinigten Staaten angestrebte strategische Partnerschaft schlug sich unter anderem in dem auf der russisch-amerikanischen Gipfelkonferenz im Juni 1992 getroffenen Vereinbarung nieder, ein Konzept für ein globales Schutzsystem gegen begrenzte ballistische Raketenangriffe auszuarbeiten. Bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 1992 nahm allerdings die Kritik an der von Jelzin und Kosyrew verfolgten Linie in Moskau zu. Eine Koalition aus Kommunisten, Konservativen und Nationalisten formierte sich. Dem Außenministerium wurde Konzeptionslosigkeit vorgeworfen, Kosyrews Richtung als "idealistisch" und "romantisch" abgetan. Sie sei der Größe und Würde Russlands unangemessen und stufe es lediglich zu einem "Juniorpartner" der USA herab. Sie verletze die nationalen Interessen des Landes, was sich vor allem in der Vernachlässigung der russischsprachigen Bevölkerung auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zeige. Als wollte man auf die besonderen Beziehungen Russlands zu den neuen unabhängigen Staaten hinweisen, wurde das postsowjetische Territorium sowohl im offiziellen als auch im inoffiziellen Sprachgebrauch als "Nahes Ausland" bezeichnet. Ein Wildwuchs von Theorien und Konzeptionen entstand, der sich bei aller Unterschiedlichkeit in Einzelheiten im Laufe der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre zu einem "patriotischen Konsens" verdichtete. Gedankenspiele mit geopolitischen Faktoren und militärischen Kräftegleichgewichten kamen wieder zur Geltung. Die Wiederherstellung russischer und sowjetischer Einflusssphären im "Nahen Ausland", in "Osteuropa" und auf dem Balkan sowie der Wiederaufbau von guten Beziehungen zu den "traditionellen Verbündeten" der Sowjetunion in der Dritten Welt (Iran, Irak, Libyen, Syrien, Nordkorea und Kuba) wurden zu Zielen der russischen Außenpolitik erklärt. Und der langfristigen Perspektive eines Beitritts Russlands zur NATO wurde die Herstellung eines kontinentaleuropäischen, "euroasiatischen" Bündnisses und die Entwicklung "strategischer Partnerschaften" mit China und Indien entgegengesetzt. Im Dezember 1992 erweckte Kosyrew in einem dramatischen Akt in einer Rede auf der KSZE-Außenministerkonferenz in Stockholm den Eindruck, als sei er selbst auf den nationa l2 Andrej Kosyrew: Preobraženie ili kafkianskaja metamorfoza, in: Nezavisimaja gazeta, 20.8.1992, S.1. 79 patriotischen Kurs der Opposition eingeschwenkt. Er stellte dann aber klar, sein Ziel sei es gewesen, davor zu warnen, was geschehen könne, wenn die antidemokratische kommunistische und nationalistische Bewegung das Heft in die Hand bekäme. Schon vor diesem Auftritt hatte er in einem Interview festgestellt, dass eine "Kriegspartei, die Partei der Neobolschewiken, ihr Haupt erhebt", und die Befürchtung geäußert, dass die Entwicklung in Russland in ihrem Verlauf dem Niedergang der Weimarer Republik folgen könnte. Er warnte auch vor einem "antidemokratischen Putsch". 3 So weit kam es zwar nicht, aber in der außenpolitischen Praxis beugten sich sowohl Jelzin als auch Kosyrew dem wachsenden Druck der kommunistischen und nationalistischen Opposition. Der neue Kurs wurde auch theoretisch untermauert. Die wichtigsten Machtministerien und Ämter arbeiteten die "Grundbestimmungen einer Konzeption der Außenpolitik der Russischen Föderation" aus, die im April 1993 von Präsident Jelzin zwar unterzeichnet, aber nicht veröffentlicht wurden. Gleich zu Beginn des nicht so geheimen Grundsatzdokuments wurde eine "aktive und gleichberechtigte Teilnahme [Russlands] als Großmacht" in der Weltpolitik angemahnt. Das Nahe Ausland wurde als ein Gebiet "vorrangiger militärpolitischer und wirtschaftlicher Interessen Russlands" bezeichnet. Bei der Auflistung vielfältiger Bedrohungen und Herausforderungen für die Sicherheit des Landes wurde auf Aktivitäten verwiesen, die sich auf eine "Untergrabung von Integrationsprozessen in der GUS" und die "Schwächung der Beziehungen Russlands mit den früheren Republiken der UdSSR, den Ländern Osteuropas sowie anderen Staaten und Regionen traditioneller Zusammenarbeit" mit der Sowjetunion richteten. Und bei der Diagnose der "geopolitischen Situation" wurde auf das "Streben der USA" hingewiesen, "ihre einseitige Führungsposition und Status als einzige Supermacht sicherzustellen". Festzuhalten ist also, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen bereits vor dem Amtsantritt Präsident Clintons begonnen hatten, sich weg von einer "strategischen Partnerschaft" zu entwickeln. Wohin aber? Nicht bereits schon zu einer umfassenden strategischen Konkurrenz. Auch nicht zu einem "antagonistischen" Verhältnis – hier finde ich die von Lothar Rühl gebrauchte Charakterisierung zu scharf –, sondern zu einem Mischungs-Verhältnis aus kooperativen und konfrontativen Elementen. Wie im vorangegangenen Beitrag, meiner Ansicht nach hier zu Recht, festgestellt wird: In internationalen Krisen und Konflikten trafen die Vereinigte Staaten immer wieder auf den russischen Widerpart, es kam aber nie zu offenen Konfrontationen. Westliche Bemühungen um Interessenausgleich und Kompromissformeln führten, wenn auch nicht zu optimalen Lösungen, so doch zu halbwegs tragbaren und zweckmäßigen Resultaten. Der im Verlauf der 90er-Jahre im Moskauer außen- und sicherheitspolitischen Establishment entstandene "patriotische" Konsens machte Washington verantwortlich für das Scheitern einer echten Partnerschaft zwischen den beiden Mächten mit dem dazu gehörenden Wandel der Begriffe von "strategic partnership" zu "lagging", "premature", "uneasy" und "troubled partnership" bis hin zur "strategic patience". Sicher haben die Vereinigten Staaten einen gewissen Teil zu diesem Wandel beigetragen – ein Aspekt, der im vorangegangenen Beitrag zu kurz kommt. Im Wesentlichen liegen aber die Gründe für die Verschlechterung der russischamerikanischen Beziehungen unter den Präsidenten Clinton und Jelzin in der inneren Entwicklung Russlands. Dies betrifft sowohl objektive als auch subjektive Gegebenheiten. 3 Andrej Kosyrew: Partija voiny nastupaet – i v Moldove, i v Gruzii, i v Rossii, in: Izvestija, 30.6.1992, S.1, 3. 80 2. "Troubled Partnership": Washington – Moskau Bei den objektiven Bedingungen spielt der Fehlschlag der von westlichen Modellen inspirierten Reformen die zentrale Rolle. Die demokratische und marktwirtschaftliche Transfo rmation des Landes blieb in ihren Anfängen stecken und war in einzelnen Bereichen schon vor dem Amtsantritt Putins rückläufig. Die in Richtung auf Demokratie und Marktwirtschaft erzielten Fortschritte konnten den Verfall der russischen Wirtschaft nicht aufhalten, führten zu eklatanten Einkommens- und Besitzunterschieden, sozialer Verelendung weiter Teile der ohnehin dünnen Mittelschicht, zu Machtmissbrauch, Kriminalität und Korruption. Weder entstanden die vom Westen angestrebten marktwirtschaftlichen Strukturen mit fairem Wettbewerb noch die erhoffte "Zivilgesellschaft". Statt sich zu verengen, verbreiterte sich die Kluft zwischen den Entwicklungen im Westen und in Russland. Bei den subjektiven Faktoren sind erstens innenpolitische Machtfaktoren zu nennen. Die Abkehr von den Vereinigten Staaten als wichtigstem Partner Russlands und die Abwertung wir tschaftlicher und technologischer Mittel der Einflussnahme in der internationalen Politik, ve rbunden mit einer Aufwertung militärischer Instrumente, stärkten tendenziell all diejenigen Institutionen und Kräfte im Konkurrenzkampf um immer knapper werdende Ressourcen, welche die Größe Russlands mit militärischer Macht gleichzusetzen pflegen: das Militär, die Sicherheitsdienste und der militärisch-industrielle Komplex. Den Ministerien, Ämtern und Betrieben des immer noch weit gespannten, aber maroden Netzwerks politischer und wirtschaftlicher Macht war offensichtlich daran gelegen, die Grundlage für größere Mittelzuweisungen mit Hilfe von grundlegenden Änderungen in der außenpolitischen Theorie und Praxis zu schaffen. Zu den subjektiven Faktoren gehört zweitens der wieder aufgelebte Großmachtanspruch der politischen Klasse Russlands. Das Argument gewann Auftrieb, Russland habe in seiner Geschichte oft Schwächeperioden und Zeiten der Wirren (smuta) erlebt, sei dann aber immer wieder zu altem Glanz aufgestiegen. Gegen eine derartige Sicht ist eigentlich nichts einzuwenden. Statt aber den Weg einer engen Anlehnung an den Westen konsequent weiter zu verfolgen, wurde die Möglichkeit eines "russischen Sonderwegs" und einer "eurasischen" oder "euroasiatischen" Entwicklungsrichtung ins Spiel gebracht. Unbestimmte, manchmal auch mystische Vorstellungen wie die einer besonderen "russischen Idee", eines "Dritten Weges" oder "Sonderweges" Russlands, vermischten sich mit einer antiwestlichen und insbesondere antiamerikanischen Haltung. Subjektive Gründe liegen drittens in den psychologischen Befindlichkeiten der politischen Klasse Russlands. Überspitzt kann man sagen, dass das Wiederaufleben von antiwestlichen und vor allem antiamerikanischen Anschauungen und außenpolitischer Distanz zum Westen, zu den Vereinigten Staaten eingeschlossen, nicht ohne Rückgriff auf psychopathologische Kategorien zu erklären ist: Der Verlust von einer mit den USA im militärstrategischen Bereich ebenbürtigen und bei den konventionellen Waffen in Europa überlegenen Position, der Zerfall des weit verzweigten Weltreichs von Kuba bis Vietnam, der Zusammenbruch der Sowjetherrschaft in Ostmitteleuropa, die Auflösung der Sowjetunion und der wirtschaftliche und soziale Abstieg Russlands innerhalb weniger Jahre waren offensichtlich schwer zu begreifen und zu verkraften. Verständlich war es also schon, dass es zu politischen Krankheitserscheinungen kommen würde und dass sich aus dem verletzten Nationalstolz nationalistische Strömungen formieren würden. Verständlich ja, aber was Jelzins Rolle anbetrifft, nicht entschuldbar. Denn ihm ist vorzuwerfen, dass er sich nicht bemühte, diesen Strömungen Einhalt zu gebieten, sondern sie treiben ließ, ja, dass er sich sogar mit ihnen identifizierte. 81 Die inneren Entwicklungen in Moskau mit ihren außenpolitischen Auswirkungen beeinflussten die Haltung und Politik Washingtons. Das betraf insbesondere den von Herrn Rühl erwähnten Einsatz von Panzern gegen das Parlament im Oktober 1993 und die Parlamentswahlen vom Dezember, in denen die extrem nationalistische Partei von Wladimir Schirinowskij als stärkste Fraktion hervorging. Nicht nur in den USA wurde das Ergebnis so interpretiert, dass Russland wieder verstärkt als Risikofaktor in der internationalen Politik angesehen werden müsse. Es sei notwendig, so die Überlegungen in der ClintonAdministration, einerseits die Bemühung fortzusetzen, Moskau auf einem reformistischen Weg zu halten beziehungsweise es wieder dorthin zurückzubringen, andererseits aber Vorsorge für den Fall einer im Inneren autoritären und nach außen neoimperialen Entwicklung zu treffen. Sowohl die erste als auch die zweite Zielrichtung der Doppelstrategie Clintons erweckte in der politischen Elite Moskaus großes Misstrauen. Die Wirtschaftshilfe der USA und der von ihnen stark beeinflussten internationalen Institutionen (IWF und Weltbank) sowie die Unterstützung von Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) durch öffentliche und private Stiftungen wurden als zum Scheitern verurteilter Versuch gewertet, Zugriff auf strategisch wichtige Ressourcen Russlands zu erlangen, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen und es nach amerikanischem Vorbild umzuwandeln. Der Vorsorge- oder Rückversicherungsansatz der Clinton-Administration wurde in einen ähnlichen Zusammenhang gestellt. Das betraf vor allem das amerikanische Bemühen, die Unabhängigkeit der neu auf postsowjetischem Territorium entstandenen Staaten zu stärken und die im Westen und Norden Europas bestehende Stabilitätszone auf das Baltikum, Ostmitteleuropa und den Balkan auszuweiten. Dieses Bemühen war nicht immer geschickt. Vermutlich aber hätte auch einfühlsameres Vorgehen das Moskauer Establishment dazu bewogen, sich zu einer geostrategischen Konkurrenz herausgefordert zu fühlen – nicht zuletzt deswegen, weil die Vereinigten Staaten auf Gebiete "vordrangen" und die NATO sich um Gebiete erweiterte, die als traditionelle russische Einflusssphären betrachtet wurden. Eine Wechselwirkung gegenseitigen Misstrauens und von Missverständnissen sowie teils vorgespielter, teils echter Fehlanschauungen setzte ein, die sich bis zum Ende der Ära Clintons und Jelzins fortsetzte und welche bis in die Amtszeit Putins und Bushs reicht. Diese Dynamik konnte auch nicht durch das - zumindest nach außen hin - enge Verhältnis zwischen den Präsidenten Clinton und Jelzin gebremst werden. Ja, die Duzfreundschaft zwischen Bill und Boris, die in Europa in der "Saunadiplomatie" zwischen Helmut (Kohl) und Boris seine Entsprechung fand, trug in mancher Beziehung noch zu der Abwärtsspirale im Verhältnis zwischen Moskau und Washington bei: Schon im Verlauf der ersten Hälfte der 90er-Jahre war Jelzins Popularität in Russland drastisch gesunken. Die Gründe dafür lagen auf der persönlichen Ebene: in seiner Trunksucht sowie in seiner zum Teil dadurch bewirkten Unberechenbarkeit im Verhalten, wie Absagen von Staatsbesuchen und peinlichen öffentlichen Auftritten. Auf politischer Ebene waren sie zu finden in seiner Willkür, dem häufigen Wechsel seiner Berater und Regierungschefs, der weit verbreiteten Korruption im Kreise seiner – im weiteren Sinne des Wortes – "Familie", seiner scheinbaren oder tatsächlichen Indifferenz gegenüber der sozialen Misere des Landes und nicht zuletzt in der bereits erwähnten Beschießung des Parlamentsgebäudes und dem Tschetschenien-Krieg 1994-96. In den russischen Präsidentschaftswahlen im Juni und Juli 1996 verbündete sich aber der Westen, allen voran Washington und der IWF, mit den im Lande unbeliebten "Oligarchen", um die Wiederwahl Jelzins sicherzustellen. So gewährte beispielsweise der IWF im Februar 1996 Russland einen Kredit in Höhe von 10,2 Mrd. US-Dollar, der zum Teil für (wahlwirksame) Pensionszahlungen genutzt wurde. In der Tat also: Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes. 82 Die Abwärtsspirale in den russisch-amerikanischen Beziehungen unter Clinton und Jelzin wurde auch durch die Haltung und Politik der beiden Mächte in der Außen- und Sicherheitspolitik beschleunigt. Der wichtigste Konfliktstoff war dabei zweifelsohne die NATO. 3. NATO und NATO-Osterweiterung Weithin betrachtet Russland die NATO nicht als einen freiwilligen Zusammenschluss unabhängiger Staaten mit Veto-Recht seiner Mitglieder, sondern als militärstrategischer Vorposten und politisches Instrument der USA in Europa. Unter anderem auf Grund dieser Anschauung lehnen die wichtigsten außen- und sicherheitspolitischen Akteure in Moskau, aber auch weithin die russische Öffentlichkeit die NATO als zentrale sicherheitspolitische Ordnungsinstanz in Europa ab. Der OSZE, so lautet das Argument, komme diese Rolle zu. Die von Clinton unterstützte und in Moskauer Sicht hauptsächlich von Washington betriebene Osterweiterung traf infolgedessen einen neuralgischen Punkt. Denn nach dem Ende des Kalten Krieges war in Russland die Vorstellung weit verbreitet, dass nun, nach der Auflösung des Warschauer Pakts, die NATO ihre Existenzberechtigung verloren habe und sich deshalb ebenfalls auflösen oder sich zumindest grundlegend wandeln müsse. Die Absicht der NATO, Artikel 5 des Washingtoner Vertrags über die kollektive Verteidigung beizubehalten, stieß darum auf Kritik. "Wir fragen erstaunt", meinte einer der Kritiker, "gegen wen wollen sich denn die heute bereits 19 Länder des Bündnisses mit ihren insgesamt 50 Divisionen verteidigen? Welchen noch mächtigeren Gegner hat man in Europa im Auge? Eine präzise Antwort ist nicht zu erhalten, doch es ist klar, dass die Rede von Russland ist."4 Die Osterweiterung der NATO wurde aber nicht nur auf Grund von politischen und militärstrategischen Überlegungen, sondern auch aus rechtlichen und moralischen Gründen abgelehnt. Bis heute wird hartnäckig die These vertreten, der amerikanische Außenminister James Baker habe bei seinen Gesprächen mit Gorbatschow am 9. Februar 1990 verbindlich zugesichert, dass sich die NATO über das Territorium der ehemaligen DDR nicht weiter nach Osten ausdehnen würde. Wie im Einzelnen von Herrn Rühl dargestellt, konnte Russland die Aufnahme Polens, Tschechiens und Ungarns (auf dem NATO-Gipfel in Madrid im Juli 1997) nicht verhindern. In diesem Jahr konnte man sogar den Eindruck gewinnen, als würden sich die russischen Anscha uungen gegenüber der NATO zum Besseren wandeln. Die Grundlage hierfür schien die im Mai 1997 in Paris unterzeichnete NATO-Russland-Grundakte zu sein, die weite Bereiche konkreter Zusammenarbeit aufzeichnete. Schon 1994 hatte Russland eine diplomatische Vertretung bei der NATO in Brüssel eingerichtet, im darauf folgenden Jahr eine militärische Vertretung beim Oberkommando der Alliierten Streitkräfte in Europa (SACEUR) für den Einsatz der damals ungefähr 1.500 Mann starken russischen Brigade in Bosnien und schließlich, im November 1997, eine Militärvertretung am NATO-Hauptquartier. Die Zusammenarbeit Russlands mit der NATO bei der Friedenssicherung (IFOR/SFOR) in Bosnien gestaltete sich problemlos und verlief in guter Atmosphäre. Die in der Grundakte vorgesehenen Sitzungen des Gemeinsamen Rates auf den verschiedenen Ebenen fanden regelmäßig statt. Noch Mitte Januar 1998 konnte man im Zusammenhang mit dem Besuch des Verteidigungsministers Sergejew in Paris und Bonn lesen, es sei "offensichtlich, dass der Refrain zur [angeblich] für Russland unannehmbaren NATO-Osterweiterung praktisch keine Wirkung gehabt hat und 4 Moskva-Brjussel’: celi prodeklarirovany, in: Nezavisimoe voennoe obozrenie, (29.5.-4.6.1998) 20, S.2. Interview mit Generaloberst Leonid Iwaschow, dem Leiter der Hauptverwaltung für internationale militärische Zusammenarbeit im russischen Verteidigungsministerium. 83 man lernen muss, in einem neuen Koordinatensystem zu leben, in dem das Nordatlantische Bündnis schon kein Feind mehr, aber auch kein Verbündeter und [die NATO] auch als Partner durchaus ungewohnt und nicht leicht zu verstehen ist. Aber wie dem auch sei, man muss sie verstehen und sich an sie gewöhnen."5 Abgesehen von Bosnien blieb die praktische Zusammenarbeit aber begrenzt. Das betraf sowohl die meisten der in die Grundakte aufgenommenen Bereiche als auch Aktivitäten des Programms "Partnerschaft für den Frieden" (PfP), für den der Euro-Atlantische Partne rschaftsrat den übergreifenden Rahmen bildet. Offizielle Sprecher warnten davor, aus dem Informationsaustausch im Gemeinsamen Rat und der praktischen Zusammenarbeit Russlands mit der NATO in Bosnien zu folgern, dass Moskau nun mit der NATO-Osterweiterung einverstanden sei; dies sei ein Trugschluss. 6 Diese Position vertrat auch Jelzin. Kurz vor seiner Abreise zum G-8-Gipfel in Birmingham sagte er, bei der NATO-Osterweiterung gebe es eine "rote Linie". Die Stabilität Europas würde darunter leiden, wenn ehemalige Sowjetrepubliken, z. B. die Baltischen Staaten oder die Ukraine, in die westliche Allianz aufgenommen würden. Dadurch würde die Sicherheit Russlands bedroht. 7 Auch die Tendenzen einer Anpassung an veränderte Gegebenheiten und die unverändert wichtige Rolle der NATO in der europäischen Sicherheitspolitik vom Frühjahr 1997 bis zum Sommer 1998 hingen zu einem großen Teil von der innenpolitischen Entwicklung in Russland ab. Der einer Zusammenarbeit mit dem Westen nicht abgeneigte Premierminister Tschernomyrdin und sein reformfreudiger Nachfolger Kirijenko bestimmten zusammen mit den an wirtschaftlichen Interessen ausgerichteten "Oligarchen" den Ton in Moskau. Die Wirtschafts- und Finanzkrise vom August 1998 und die Ablösung Kirijenkos verschärften aber das innenpolitischen Klima und damit die russische Haltung zu den Vereinigten Staaten und zur NATO. Aber auch die internationalen Entwicklungen trugen dazu bei: In ihrem im April 1999 in Washington verabschiedeten Strategischen Konzept und in den gleichzeitig stattfindenden Luftangriffen gegen Jugoslawien demonstrierte die NATO ein neues Selbstverständnis. Sie erhob den Anspruch, über kollektive Selbstverteidigung hinaus Ordnungsaufgaben überne hmen und diese auch unter Umgehung des Sicherheitsrates militärisch durchsetzen zu wollen. Von russischer Warte aus stellte diese Verbindung zwischen neuer Konzeption und praktischer Anwendung einen gefährlichen Präzedenzfall in dreierlei Hinsicht dar. Erstens war dieser dazu geeignet, die Verantwortung der Vereinten Nationen als universale Ordnungsinstanz zu untergraben und das Veto-Recht Russlands im Sicherheitsrat auszuhebeln – eines der wenigen Russland noch verbliebenen Insignien des früheren Supermachtstatus und scheinbares Beweismittel für eine unverändert wichtige Rolle dieses Landes in der Weltpolitik. Zweitens stärkte er die in den letzten Jahren klar erkennbare völkerrechtliche Tendenz, wegen Verle tzungen von Menschen- und Minderheitenrechten in einem Land auch gegen den Willen seiner Regierung militärisch zu intervenieren. Derartige Interventionen waren bis dahin immer mit einer Bedrohung des Friedens gerechtfertigt worden. Drittens konnte die NATO versuchen, in Zukunft auch in anderen Gebieten, beispielsweise im Kaukasus, mit militärischem Druck oder der Anwendung militärischer Gewalt Entwicklungen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die russischen Reaktionen weit über das Establishment in Moskau hinaus fielen entsprechend scharf aus. Auch die Ablehnung der im Strategischen Konzept vorgesehenen Funktionsveränderung der NATO und der Luftangriffe auf Jugoslawien ist bis heute ungebrochen. Hinter 5 Viktor Litovkin, Maršal Sergeev nalaž ivaet kontakty s NATO èerez Pariž , in: Izvestija, 15.1.1998, S.3; Hervorhebung nicht im Original. 6 Moskva-Brjussel, Iwaschow-Interview (Anm.4). 7 Interview mit der Zeitung The Guardian, in: Atlantic News (Brüssel), 32 (16.5.1998) 3010, S.3. 84 dieser Ablehnung verbarg sich allem übergeordnet die in der Jelzin-Ära gewachsene Besorgnis über eine globale militärstrategische und politische Vorherrschaft der Vereinigten Staaten. 4. Die militärstrategische Konkurrenz Unter Jelzin verlor Russland, wie Lothar Rühl anschaulich dargestellt hat, sein strategisches Glacis. Auch die Fähigkeiten zur Machtprojektion gingen drastisch zurück. Die Anzahl der regulären Streitkräft verringerte sich von 3,4 Mio. Mann (Sowjetunion, 1991) beziehungsweise 2,72 Mio. (Russland, 1992) auf nominal 1,2 Mio. Mann. Die Anzahl der in der Sowjetunion im militärisch-industriellen Komplex beschäftigten Wissenschaftler, Techniker, Angestellten und Arbeiter von ca. 10 Mio. schrumpfte im Russland Jelzins bis zum Jahre 2000 auf 2 Mio. Nach unterschiedlichen westlichen Schätzungen ging der reale Anteil der russischen Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt von 11 bis 20% auf 5 bis 6% zurück, nominal auf lediglich 2,8% im letzten Jahr der Amtszeit Jelzins und Clintons. In absoluten Zahlen betrugen die russischen Verteidigungsausgaben für das Jahr 2000 offiziell 140,9 Mrd. Rubel (2,76% des BIP), zum damaligen Wechselkurs lediglich 5 Mrd. Dollar. Auch wenn man diese Ausgaben kaufkraftbereinigt mit etwa 55 Mrd. Dollar ansetzt, waren doch Vergleiche mit entsprechenden amerikanischen Anstrengungen ernüchternd: Clinton hatte dem Kongress für sein letztes Fiscal Year (Oktober 2000 bis September 2001) ein Verteidigungsbudget in Höhe von 291 Mrd. Dollar vorgeschlagen. Nicht zuletzt infolge der Unterfinanzierung des Militärs und der Rüstungswirtschaft gerieten die russischen Streitkräfte in einen auch nach damaligen russischen Bewertungen "katastrophalen" oder "desolaten" Zustand. Das Militär büßte seine in der Sowjetära privilegierte Stellung ein. Immer wieder kam es entgegen allen Versprechungen zu erheblichen Verspätungen bei der Auszahlung des monatlichen Solds. Wegen Mittelknappheit und mangelnder Karriereaussichten wurden viele Abgänger der Offiziersschulen entlassen, freie Offiziersstellen nicht besetzt. Lediglich sieben bis acht Prozent der Wehrpflichtigen konnten aus unterschiedlichen Gründen zum Wehrdienst herangezogen werden. Desertion und Selbstmord von Angehörigen der russischen Streitkräfte waren im internationalen Vergleich sehr hoch. Die militärische Infrastruktur und der Waffenbestand wurden vom Verfall des Materials gefährdet. Luftwaffe und Marine waren wegen Treibstoffmangels nur noch bedingt einsatzbereit. Die Anzahl der militärischen Übungen und Manöver ging erheblich zurück. Infolge der Schwäche Russlands bei den konventionellen Streitkräften stützte es sich militärpolitisch auf Nuklearwaffen. Infolgedessen behielten auch im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten die nuklearstrategischen Systeme ihre Bedeutung. Sie stellten ein wichtiges politisches Gegengewicht zu den umfassenderen und moderneren konventionellen und nuklearen Streitkräften der USA dar. Wie die Indienstnahme der ersten zwei Regimenter von Topol-MRaketen im Dezember 1998 zeigte, wurde infolgedessen der Versuch unternommen, die strategischen Offensivsysteme zu modernisieren und so weit und so lange wie möglich Parität mit den Vereinigten Staaten zu bewahren. Dieser Ansatz war allerdings bereits unter Jelzin zum Scheitern verurteilt. Das lag und liegt zum einen an der Überalterung der russischen Offensivwaffen, zum anderen an den geringen Finanzierungsmöglichkeiten. Ein weiterer Faktor drohte zumindest die psychologische Wirksamkeit der russischen Offensivwaffen zu untergraben: die unter Clinton ohne sein Betreiben und gegen seine Skepsis entstandene Entschlossenheit der amerikanischen "defense community", ein landgestütztes nationales Abwehrsystem gegen weit reichende ballistische Raketen (NMD) zu entwickeln und zu stationieren. Damit verbunden war die sich unter Clinton ab- 85 zeichnende Bereitschaft in Washington, den ABM-Vertrag des Jahres 1972 einseitig aufzukündigen, falls Russland sich weigern würde, einer Modifizierung des Vertrags zuzustimmen. Wie bei der NATO-Osterweiterung reichte die Ablehnung von NMD unter Jelzin und im ersten Amtsjahr Putins weit in die russische Öffentlichkeit hinein. Das zentrale Argument der Ablehnung lautete: Das amerikanische NMD-Projekt solle dazu dienen, sowohl die globale politische als auch die militärstrategische Vorherrschaft der Vereinigten Staaten zu erringen beziehungsweise zu sichern. Eine Bedrohung seitens so genannten "Schurken"-Staaten, die einen Angriff mit interkontinentalen ballistischen Raketen gegen die Vereinigten Staaten planen und führen könnten, existiere in Wirklichkeit nicht. Gegen wen also richte sich das geplante Abwehrsystem? Offensichtlich vor allem gegen Russland. Strategische Offensiv- und Defensivwaffen werden auch in Moskau in einem engen Zusammenhang gesehen. Putin machte entsprechend in seiner Rede vor der Duma im April 2000 die Ratifizierung des START-II-Vertrages von der unveränderten und uneingeschränkten Gültigkeit des ABM-Vertrages abhängig. Sollte Washington den Vertrag brechen, sagte er, "können und werden wir nicht nur aus dem START-II-Vertrag aussteigen, sondern aus dem gesamten System vertraglicher Beziehungen zur Begrenzung und Kontrolle strategischer und konventioneller Waffen. Wir können auch die Frage nach einer Überprüfung unserer Entscheidungen im Bereich der taktischen [Nuklear]-Waffen stellen. Und unter diesen Bedingungen wird Russland eine eigenständige Politik der nuklearen Abschreckung ve rfolgen."8 In Russland wird Präsidenten der Demokratischen Partei und ihren Regierungen traditionell geringer ausgeprägtes Denken in militärstrategischen und geopolitischen Kategorien zugeschrieben als den Republikanern. Weil sich der unter Jelzin wieder aufgelebte Großmachtanspruch in derartigen Kategorien bewegte, wurden sogar in der amerikanischen Außenpolitik unter Clinton zunehmend entsprechende Tendenzen festgestellt. Wechselwirkungen entwickelten sich also auch in diesem Bereich der gegenseitigen Wahrnehmungen. Auf russischer Seite gehörte dazu die Anschauung, die Vereinigten Staaten seien bestrebt, Russland aus seinen angestammten Einflusssphären im Baltikum, in Ostmitteleuropa, auf dem Balkan, im Nord- und Transkaukasus und in Zentralasien herauszudrängen und durch amerikanische Vorherrschaft und Vormundschaft zu ersetzen. Zu fragen ist, wie dieses Bild aus der Bewertung regionaler Aspekte der amerikanischen Politik unter Clinton entstand. Indizien beziehungsweise Beweise für eine geostrategisch oder geopolitisch bestimmte Sicht und Politik der USA unter Clinton waren in Moskau leicht zu finden. Nachfolgend soll beispielhaft für die Gesamtentwicklung des Verhältnisses die russisch-amerikanische Konkurrenz im Baltikum, auf dem Balkan und in der kaspischzentralasiatischen Großregion untersucht werden. 8 Naši jadernye sily uniètožat ljubogo protivnika mnogokratno i garantirovanno. Polnyj tekst otkrytoj èasti vystuplenija Vladimira Putina 14 aprelja v Gosdume (Text des offenen Teils der Rede Wladimir Putins am 14. April vor der Duma), in: Kommersant, 15.4.2000, S.3; Hervorhebung nicht im Original. 86 5. Die geopolitische Rivalität 5.1 Das Baltikum Das Baltikum war eng mit dem Aufstieg Russlands zu einer beherrschenden Macht im Ostseeraum unter Peter dem Großen verbunden. Von Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des 1. Weltkriegs war diese Region Teil des Zarenreichs, als Folge seines Zusammenbruchs konnten aber Estland, Lettland und Litauen ihre Unabhängigkeit erlangen. Im Jahre 1940 wurden sie wieder in den russischen Staatsverband zurück gezwungen, die entsprechenden Verträge bildeten allerdings einen Teil der sowjetisch-amerikanischen Auseinandersetzungen im Kalten Krieg, denn ihre Gültigkeit wurde von Washington nie anerkannt. Dagegen hält das russische Außenministerium bis heute an der sowjetischen Interpretation über den "rechtmäßigen" Anschluss der Baltischen Staaten fest. In den Verträgen vom März 1990 erkennt Russland zwar die Unabhängigkeit Estlands und Lettlands an (Litauens 1991), im Moskauer außen- und sicherheitspolitischen Establishment wird aber ihr Abschluss als "schwerer politischer Fehler Russlands" gewertet, der für die "ganze Phase der 'Kosyrew-Diplomatie' charakteristisch ist", weil in ihnen "alle ernsten Probleme der beiderseitigen Beziehungen ignoriert werden". 9 Zu diesen Problemen wird in Moskau die Lage der russischen Minderheit in Estland und Lettland gerechnet (mit Litauen gibt es bei der Nationalitätenfrage weniger Schwierigkeiten, weil der Anteil der Russen an der Gesamtbevölkerung gering ist). Die Behandlung dieser Frage erweckt jedoch den Eindruck, als wolle Moskau über eine sich selbst zugebilligte Protektionsrolle für die russische Minderheit auch seinen Einfluss im Baltikum bewahren beziehungsweise wieder herstellen. Besonders gut sind dabei die russischen Karten nicht. Der den Baltischen Staaten von Moskau 1997 angebotene "regionale Sicherheitspakt" fiel in Tallin, Riga und Wilna auf taube Ohren. Dagegen bereiteten sie sich auf die EU-Mitgliedschaft vor und meldeten ihre Absicht an, Mitglied in der NATO zu werden. Die Vereinigten Staaten sahen zwar den Beitritt zum damaligen Zeitpunkt (wie auch heute noch) – unausgesprochen wegen des russischen Widerstands – als nicht opportun an, stellten ihn prinzipiell aber in Aussicht. Als Überbrückungsmaßnahme unterzeichnete Clinton im Januar 1998 mit den drei Baltischen Präsidenten eine Ba ltischAmerikanische Charta, in denen die USA dokumentierten, dass sie das Baltikum nicht als eine russische Einflusssphäre betrachte. Auch die militärischen Karten Russlands haben sich verschlechtert. Es hat Offensivoptionen in seiner Nordwestregion in großem Umfang abgebaut. Nach der Schließung der strategischen Frühwarn-Radarstation in Skrunda in Lettland 1994 waren sämtliche militärische Installationen Russlands in den Baltischen Staaten aufgelöst und die russischen Truppen aus diesen Ländern vollständig abgezogen. An der Grenze zu Norwegen befindet sich nur noch eine Brigade und auch die lange Grenze zu Finnland ist militärisch ausgedünnt. In Anbetracht dieser Entwicklung, so warnten russische Militärs, "müssten" bei einer NATO-Osterweiterung unter Einschluss der baltischen Staaten die operativ-strategischen Gruppierungen in dieser Region wieder verstärkt werden, und Russland müsste sich überlegen, ob es weiterhin die Anzahl der taktischen Nuklearwaffen verringern solle. 10 9 Sovet po vnenej i oboronnoj politike, Rossija i Pribaltika – II, in: Nezavisimaja gazeta, 13.10.1999, S.1415. 10 Moskva-Brjussel’, Iwaschow-Interview (Anm.4). 87 Auch die russische Militärpräsenz in Kaliningrad ist drastisch verringert worden, von mehr als 100.000 Mann in der Sowjetära auf weniger als 20.000 am Ende der Ära Jelzins und Clintons. Die militärische Infrastruktur befindet sich zudem in einem katastrophalen Zustand. Im Zusammenhang mit den in Russland und im Ausland gehegten optimistischen Erwartungen über eine schnelle Transformation des Landes zu Demokratie und Marktwirtschaft war hier und dort auch davon die Rede, Kaliningrad könne vielleicht zu einem "Hongkong der Ostsee" werden. Daraus ist noch nicht einmal ansatzweise etwas geworden. Die Exklave entwickelte sich vielmehr zu einem wirtschaftlichen und sozialen Notstandsgebiet, dessen Krisenpotenzial nur durch massive russische Wirtschafts- und Finanzhilfe sowie umfangreiche Auslandsinvestitionen begrenzt werden kann. Diese Tatsache unterstreicht das Paradox, dass Russland nur dann in der Konkurrenz um Einfluss im Baltikum insgesamt mit dem Westen bestehen kann, wenn es zu weitgehender Kooperation vor allem mit der Europäischen Union im Zuge des EU-Beitritts der Baltischen Staaten (und Polens) bereit ist. Ein Beitritt der Baltischen Staaten zur NATO könnte diese notwendige Erkenntnis in Moskau allerdings hinausschieben. 5.2 Der Balkan Eine der empfindlichsten Niederlagen in der geopolitischen Konkurrenz, welche die politische und militärische Führung Russlands in der Ära Jelzins und Clintons hinnehmen musste, war das Scheitern ihrer Balkanpolitik. Im russischen Bewusstsein war Serbien traditionell ein wichtiger Verbündeter Russlands und – nach der Auflösung des Warschauer Pakts – ein möglicher Angelpunkt für die Wiederherstellung des politischen Einflusses Moskaus in Südosteuropa. Wie die Balkankriege der 90er-Jahre zeigten, war die Wirklichkeit allerdings anders. Was waren die Gründe dafür? Die Ursachen für das Scheitern der Balkanpolitik Moskaus sind militärischer, wirtschaftlicher und politischer Natur. Wie erwähnt waren im Zuge des Zusammenbruchs des Warschauer Pakts und der UdSSR und der Auflösungserscheinungen in den Streitkräften und im militärisch-industriellen Komplex auch die Fähigkeiten Moskaus zur Machtprojektion mit konve ntionellen Mitteln verloren gegangen; Nuklearwaffen waren dafür als Ersatz ungeeignet. Im wirtschaftlichen Bereich hatte es Russland, abgesehen von Gaslieferungen schwer, mit seinen Produkten und Dienstleistungen Fuß zu fassen, da die Märkte in Südosteuropa einerseits klein und andererseits auf den Handel mit der EU ausgerichtet sind. Politisch lagen die Gründe in dem Widerspruch zwischen der öffentlichen Unterstützung der Serben als eines angeblich wichtigen traditionellen Verbündeten Russlands und dem immer wieder durch die äußeren Umstände erzwungenen Einschwenken auf mit dem Westen gemeinsame Positionen gegen Belgrad. Durch seine oft ungezügelte pro-serbische und anti-NATO Rhetorik erweckte Moskau immer wieder den Eindruck, als stehe sie voll und ganz hinter Miloœeviæ. In der Pr axis war aber Russland weder militärisch in der Lage noch – zumindest was den Präsidenten und die Regierung anbetrifft – bereit, die verbale politische Unterstützung wirksam in die Tat umzusetzen. Im Bosnien-Konflikt 1992-95 war hierfür charakteristisch, dass sich Jelzin nach dem durch bosnisch-serbische Artilleriegeschosse verursachten Massaker auf dem Marktplatz von Sarajewo im August 1995 und den daraufhin von der NATO Anfang September 1995 durchgeführten Luftangriffen gegen serbische Stellungen zu dem Vorwurf verleiten ließ, die NATO betreibe "Genozid an den Serben" und "beschwöre die Flamme eines neuen Weltkriegs über 88 Europa" herauf. 11 Die Konfliktregulierung bei den Friedensgesprächen in Dayton überließ Russland dann aber nahezu vollständig den USA. Russland stimmte den Ergebnissen zu und beteiligte sich aktiv an der Implementierung des Abkommens mit Truppen an der von der NATO geführten IFOR/SFOR. Das russische Verhaltensmuster im Kosovo 1998-99 folgte dem widersprüchlichen Verha ltensmuster. Einerseits bemühten sich russische Unterhändler bei den Verhandlungen in Rambouillet und Belgrad, Miloœeviæ zur Unterzeichnung des von den westlichen Staaten konz ipierten Abkommens zu bewegen; Moskau verweigerte dann aber selbst seine Unterschrift mit der Begründung, im Zusatzabkommen zur Vereinbarung (Anhang B, Kapitel 7) sei die militärische Implementierung des Abkommens durch eine NATO-KFOR-Truppe vorgesehen, Be lgrad werde aber einer derartig geführten Friedenstruppe nicht zustimmen. Nach dem Beschluss der NATO, die angedrohten Luftangriffe in der Nacht zum 25. März 1999 ohne UNMandat zu beginnen, blieb Russland keine andere Wahl, als in die übliche Hyperbolik zu ve rfallen. Dieses Mal war allerdings der Aufschrei der Empörung noch lauter und waren die verbalen Ausfälle noch schärfer. Das Vorgehen der NATO wurde als "völkerrechtswidrige Aggression" bezeichnet; Jelzin kündigte sogar "adäquate Maßnahmen" gegen den Westen an, sollten russische Sicherheitsinteressen direkt berührt werden. Das emotional aufgeladene Wort vom "Genozid" der NATO an der jugoslawischen Bevölkerung wurde wieder bemüht, ein Sprecher des Verteidigungsministeriums kündigte an, die russischen Streitkräfte würden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, und der Vorsitzende der Duma sprach davon, Jelzin habe ihm gegenüber erklärt, russische Atomsprengköpfe würden nunmehr wieder auf westliche Ziele gerichtet. In der Praxis blieb es aber bei der verbalen Unterstützung Belgrads und auch diese bröckelte in zunehmenden Maße ab, als klar wurde, dass die NATO fest entschlo ssen blieb, sich gegen Miloœeviæ durchzusetzen, und sei es unter Einsatz von Bodentruppen. Außenminister Iwanow stimmte widerwillig der UN-Resolution 1244 als Bestandteil des G-8Friedensplans zu und sicherte dadurch die Beendigung des Kosovo-Kriegs international ab; in der Praxis sanktionierte Moskau also ex post facto die seiner Auffassung nach weiterhin vö lkerrechtswidrige Aggression der NATO. 5.3 Der Kaukasus und Zentralasien Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde von der Weltgemeinschaft eine "Kaspische Region" wieder entdeckt, in der die neuen zentralasiatischen und südkaukasischen Staaten zu einem euroasiatischen Raum von erheblicher strategischer, wirtschaftlicher und verkehrspolitischer Bedeutung zusammengefasst sind. In der Sowjetära bildete das Kaspische Meer den Trennsaum zwischen den beiden Regionen, welche die Südperipherie der UdSSR bildeten: Kaukasien und Mittelasien. Nach der Auflösung der UdSSR flossen beide Regionen über das Kaspische Meer gleichsam zusammen, verbunden durch die großen Öl- und Gasvorkommen auf beiden Seiten des Meeres und bestehende beziehungsweise geplante neue Pipelines sowie andere Verkehrsverbindungen nach Südosteuropa, in den Nahen und Mittleren Osten und nach Ostasien. 12 11 Zit. bei: Dardykin, Sergej: Serbov, konež no, ž alko, no ëto ešèë ne povod gotovit’sja k tret’ej mirovoj vojne, in: Izvestija, 15.9.1995, S.1. 12 Zur Entstehung des Begriffs und zum Wandel der Bedeutung dieser Region in der Weltpolitik siehe Halbach, Uwe: Die "Kaspische Region" in der internationalen Wahrnehmung, in: Aktuelle Analysen des BIOst, 54/97, 28.11.1997, Köln. 89 In der amerikanischen Diskussion der 90er-Jahre wurde das Gebiet zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer, Golf und Kaspischem Meer als "Greater Middle East" bezeichnet und als eine der künftig wichtigsten geostrategische Interessenzonen der Vereinigten Staaten betrachtet. In Russland wiederum gab es Vorstellungen, die noch über diesen Raum hinausgehen und denen zufolge die Welt in einen von den USA dominierten atlantischen Raum und einen euroasiatischen Kontinentalraum (unausgesprochen unter russischer Führung) aufgeteilt ist. Insbesondere in der Zeit, in welcher der russische Widerstand gegen die Öffnung der NATO am größten war, wurde diese "euroasiatische" Alternative zur möglichen Westorientierung des Landes bis hin zu einer "strategischen Partnerschaft" mit China propagiert. Die Karten, die Russland in dem neuen geopolitischen und wirtschaftlichen "Great Game" hatte, waren je nach Teilregion unterschiedlich gut. Sezessionsbestrebungen und ethnische Konflikte in Abchasien, Südossetien und Nagorno-Karabach, die Abhängigkeit Armeniens von russischen Sicherheitsgarantien und militärischen Lieferungen sowie die innere politische Zerrissenheit Georgiens und Aserbaidschans waren einige der Trümpfe, die insbesondere die Anhänger neoimperialer und geostrategischer Lösungen gerne ausspielten – oder ausspielen wollten. Zumindest trugen diese Konflikte dazu bei, Russland weiterhin Militärbasen in Armenien und Georgien zu sichern. Andererseits bewirkten die Auseinandersetzungen, dass die von Russland nicht unterstützten Streitparteien nach politischen und militärischen Gegengewichten auch außerhalb der Region suchten. Charakteristisch hierfür war zum Beispiel der in Baku im Zusammenhang mit der russisch-armenischen militärischen Zusammenarbeit vorgebrachte Gedanke, die USA sollten ihre Militärbasis von Incirlik in der Türkei auf die Halbinsel Apscheron in Aserbaidschan verlegen. Ähnlich suchte Tiflis nach Rückversicherung und Unterstützung bei den Vereinigten Staaten. Es lud den amerikanischen Verteidigungsminister Cohen zu einem Besuch ein, in dessen Verlauf im August 1999 er in langfristiger Perspektive den Beitritt Georgiens zur NATO nicht ausschloss. Die Konflikte wirkten auch oft auf Russland zurück und verschärften die Unsicherheiten und Instabilitäten in den nordkaukasischen Republiken, wie beispielsweise in Dagestan, Tschetschenien, Inguschetien und Nordossetien. Die Konflikte in Tschetschenien und weiter östlich in Tadschikistan zeigten außerdem, dass das Bemühen Moskaus, neoimperiale Ansprüche durchzusetzen oder lediglich legitime Ordnungsfunktionen wahrzunehmen, mit großen Kosten verbunden ist. Sie verdeutlichen auch, dass die militärischen Mittel nicht immer geeignet sind, dem russischen Willen Geltung zu verschaffen. Russlands Blatt beim großen Spiel um Öl, Gas und Pipelines war ebenfalls gemischt. Um die Öl- und Gasvorkommen zu erschließen und zu den europäischen und asiatischen Märkten zu transportieren, war es notwendig, ausländisches Kapital in großem Umfang heranzuziehen. Am finanzkräftigsten wären dabei die amerikanischen Ölfirmen. Ihnen das Feld zu überla ssen, stieß zwar auf Widerstand bei all denjenigen Politikern und Militärs in Moskau, welche die Welt aus geostrategischer Warte betrachten, aber im Zeichen ökonomischer Zwänge in der russischen Außenpolitik setzten sich oft die wirtschaftlichen Interessen durch. Ein Beispiel hierfür war die Beteiligung der russischen Ölfirma LUKojl an dem im Jahre 1994 in Baku geschlossenen "deal of the century" zur Erschließung von Ölfeldern im Kaspischen Meer trotz gegenteiliger Vorstellungen des russischen Außenministeriums. Ein weiteres Beispiel war das Herangehen der Präsidialadministration an Völkerrechtsfragen bei der Erschließung des Kaspischen Meeres: Im April 1998 einigten sich Jelzin und Kasachstans Präsident Nasarbajew, das Kaspische Meer in nationale Sektoren aufzuteilen und es jedem Land freizustellen, über die Nutzung der Vorkommen in diesen Sektoren zu entscheiden. 90 Auch in Moskaus Politik gegenüber Irak und Iran kreuzten sich wirtschaftliche und geopolitische Interessen. Hierbei war zwischen möglichen kurz- und langfristigen Vorteilen zu unterscheiden. Bei Russlands Widerstand gegen die den Vereinigten Staaten zugeschriebene Neigung zu militärischer Gewaltanwendung gegen den Irak spielten selbstverständlich geostrategische Interessen mit. Auch die Vermittlerrolle, die Moskau immer wieder in den Auseinandersetzungen zwischen Bagdad und den westlichen Staaten einnahm, war von außenpolitischen Interessen und dem Wunsch geprägt, als wichtiger Mitspieler in der Weltpolitik anerkannt zu werden. Wirtschaftliche Gesichtspunkte bestärkten die politische Führung Russlands in ihrer Haltung. Sie wollte mit Bagdad wieder ins Geschäft kommen, vor allem ins Öl- und Waffengeschäft, und etwa 7 Mrd. US-Dollar Schulden eintreiben. Dies bedeutete allerdings nicht, dass Jelzin und Außenminister Primakow vorbehaltlos als Anwälte der Politik Saddam Husseins auftraten. Sie standen weiterhin zu den Beschlüssen des UN-Sicherheitsrats bis hin zu den Wirtschaftssanktionen. Eine nachhaltige Verschlechterung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, die ein Abgehen von diesen Beschlüssen unweigerlich nach sich gezogen hätte, wollten auch sie nicht riskieren: Den möglicherweise zu erwartenden wirtschaftlichen Vo rteilen im Geschäft mit dem Irak hätten die nachhaltigen negativen politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen im Verhältnis zum Westen entgegen gestanden. Diese Zwänge bestimmen auch die russische Politik in Iran. Sowohl geopolitische als auch – wiederum kurzfristige – wirtschaftliche Interessen waren geeignet, der russischen Führung nahe zu legen, eine Ausweitung der Rüstungsexporte zu betreiben. Für Russland problematisch war aber die Tatsache, dass auch Iran auf der amerikanischen Liste der damals noch so bezeichneten "rogue states" stand, über die von den Vereinigten Staaten Sanktionen verhängt wurden. Insbesondere sah sich Moskau Vorwürfen Washingtons ausgesetzt, es liefere Technologien an Iran, welche dieses Land in die Lage versetzen könnten, eine mit Mittelstreckenraketen ausgerüstete Nuklearmacht zu werden. Konkret sind angebliche russische Lieferungen zum Bau der Schahab-3- und -4-Raketen mit einer Reichweite von ungefähr 2 000 km und die russisch-iranische Zusammenarbeit bei der Nutzung von Nuklearenergie einschließlich des Baus eines nuklearen Kraftwerks in Buscher gemeint. Der russische Präsident und die Regierung wiesen diese Vorwürfe energisch zurück: Russische Lieferungen für Mittelstreckenraketen gebe es nicht, und bei dem Kraftwerk gehe es ausschließlich um die friedliche Nutzung von Atomenergie; darüber hinaus handele es sich bei dem Projekt um einen Leichtwasserreaktor genau des Typs, den die Vereinigten Staaten unter anderem an Nordkorea lieferten. In der Tat schien die Beweislage nicht eindeutig zu sein. Zumindest lehnten Außenministerin Madeleine Albright und der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Samuel Berger, wegen des "low evidentiary standard" vom Kongress geforderte Sanktionen gegen Russland ab. 13 Nicht auszuschließen ist allerdings, dass russische Rüstungsbetriebe Raketentechnologien ohne Wissen des Präsidenten und der Regierung an Iran geliefert haben. Zusammenfassend ist zu sagen, dass russischen Wunschvorstellungen, die Vereinigten Staaten als geopolitischen Rivalen von "Eurasien" fern zu halten, damit Russland wieder uneingeschränkt als Führungsmacht in dieser Großregion auftreten könne, in den 90er-Jahren eine Vielzahl von Faktoren entgegen wirkten. Zu diesen gehörten die Eigengesetzlichkeiten des Weltmarkts, die geostrategischen Abenteuern abgeneigten Interessen der neuen Industrie- und Finanzoligarchien, die gewachsene Macht und Sonderinteressen der Provinzgouverneure, die Unabhängigkeit der neuen Staaten, die wirtschaftlichen Realitäten in der GUS und nicht zu13 Senate Approves Sanctions Legislation Aimed at Russian-Iranian Missile Cooperation, in: Arms Control Today, 1.5.1998, S.30. 91 letzt die Tatsache, dass Rechnungen über eine uneingeschränkte Führungsrolle Moskaus in Eurasien ohne den Wirt oder genauer gesagt, ohne eine ganze Reihe von Wirten, aufgestellt werden. Zu diesen gehören nicht nur der Iran, die Türkei, Japan und Indien, sondern – trotz aller Beteuerungen einer "strategischen Partne rschaft – auch China. 6. Who lost Russia? Im amerikanischen Wahlkampf des Jahres 2000 spielte auch das Thema "Who Lost Russia?" eine Rolle. Hinter dieser Frage stand offensichtlich die Enttäuschung, dass es Russland unter Jelzin im Verlauf eines Jahrzehnts nach dem Ende der Sowjetunion nicht gelungen war, eine nach westlichen Begriffen ausgereifte und arbeitsfähige Demokratie, Marktwirtschaft und Zivilgesellschaft aufzubauen und dass darüber hinaus unter Putin Tendenzen zugenommen haben, die in dieser Richtung unternommenen Reformfortschritte durch Zentralisierungs- und Disziplinierungsmaßnahmen wieder zurückzuschrauben. Die verständliche Enttäuschung darüber verband sich mit Kritik an der Clinton-Administration, die angeblich eine falsche Politik gegenüber Russland betrieben habe und die infolgedessen mit- oder sogar hauptverantwortlich für die russische Fehlentwicklung gewesen sei. Wie bei allen Fragen der Art: Was wäre gewesen wenn?, lässt sich schwer entscheiden, ob eine andere als die von Clinton betriebene Russland-Politik, die russische Innen- und Außenpolitik in eine wesentlich andere Richtung gelenkt hätte. Vorstellbar ist beispielsweise, dass der wirtschaftliche und soziale Abstieg Russlands weniger steil gewesen wäre, wenn die Vereinigten Staaten erheblich mehr Finanzmittel für den Transformationsprozess bereitgestellt hätten. Denkbar ist auch, dass das Verhältnis Moskaus zu Washington heute entspannter wäre, wenn die NATO auf eine Osterweiterung verzichtet, auf dem Balkan nicht militärisch eingegriffen hätten, und wenn die USA keine Pläne zum Aufbau eines strategischen Abwehrsystems entwickelt hätte. Es ist aber keineswegs sicher, dass höhere amerikanische Wirtschafts- und Finanzhilfen oder, wichtiger noch, ein größerer Umfang gezielter Projekthilfen die innere Entwicklung in Russland wesentlich verändert hätten. Denn wenn es der politischen Klasse am Willen und der Fähigkeit fehlt, Reformmaßnahmen energisch durchzusetzen und der rechtsstaatliche Rahmen für Inlands- und Auslandsinvestitionen nicht vorhanden ist, dann ist wahrscheinlich, dass genau das eintritt, was in der Ära Jelzin zu beobachten war: Die Gelder fließen in großem Ausmaß, doch so schnell, wie sie eingehen, in die Taschen der politisch und wirtschaftlich Starken und verschwinden auf Bankkonten im Ausland und werden nicht für dringend notwendige Entwicklungsprojekte im eigenen Land genutzt. Dem Argument, eine größere Rücksichtnahme Washingtons auf Moskau in außenpolitischen Fragen, insbesondere bei der NATO-Osterweiterung, hätte möglicherweise Russlands Abkehr von der euroatlantischen Orientierung verhindern können, ist entgegenzuhalten, dass, wie oben ausgeführt, die Gründe für die außenpolitische Wende im Wesentlichen nicht in der Haltung und Politik der USA und des Westens, sondern in inneren Faktoren lagen. "Rücksichtnahme" bei der NATO-Osterweiterung hat es ja gegeben: bei der Entscheidung Clintons, die Baltischen Staaten nicht in der ersten Beitrittsrunde aufzunehmen. Das hat nicht zu einer Entspannung beigetragen, weder im Verhältnis Russlands zu den Baltischen noch zu den Vereinigten Staaten. Weiterhin verdient das Argument geprüft zu werden, ob eine (noch) größere Rücksichtnahme nicht gerade denjenigen Kräften in Russland Auftrieb gegeben hätte, die einer engen Zusammenarbeit mit dem Westen gegenüber skeptisch oder negativ eingestellt 92 sind. Und ob Europa durch eine andere amerikanische Russland-Politik Clintons oder der NATO sicherer geworden wäre, ist ebenfalls zweifelhaft. 93 Gary C. Jacobson Bill Clinton und die Wahlen des Jahres 2000 Das Ergebnis der Wahlen von 2000 war eines der erstaunlichsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Wählerschaft teilte sich deutlich und gleichmäßig entlang regionaler und kultureller Grenzen; die gewählte nationale Legislative besteht ungefähr hälftig aus beiden großen Parteien und ist stark polarisiert; Al Gore und Politikwissenschaftler, die Prognosen getroffen hatten, zerbrechen sich die Köpfe darüber, was schiefgelaufen ist; ein "mitfühlend konservativer" Republikaner bekennt sich im Weißen Haus zum Zweiparteiensystem; und schließlich gewinnt Hillary Clinton einen Sitz im Senat. Die Hauptthese meines Beitrags ist, dass sich in allen diesen Merkmalen der Wahlen des Jahres 2000 Bill Clintons Handschrift erkennen lässt. Obwohl einige dieser Eigenschaften nur die Fortsetzung von Trends darstellen, die bereits vor der Regierung Clinton existierten, sind andere ganz offensichtlich Clintons Erbe. Auch wenn Clinton nicht immer die treibende Kraft hinter diesen Entwicklungen war, agierte er doch oft als eine Art Katalysator, und löste Veränderungen aus, die bereits seit längerem anstanden. Leicht überzogen könnte man sagen, dass Clinton unwissentlich die Hebamme für die nun in den Vereinigten Staaten geborene politische Situation spielte. Zur Untermauerung meiner These möchte ich zunächst die außerordentlichen Wahlergebnisse untersuchen und ausloten, was sie über den gegenwärtigen Zustand der politischen Landschaft in den USA aussagen. Dann werde ich umreißen, inwiefern Clinton zu den Ereignissen des Jahres 2000 beigetragen hat. Schließlich möchte ich diese Veränderungen zu den Auseina ndersetzungen, die es nach der Wahl über die Zusammensetzung des Wahlmännergremiums in Florida gab, sowie den Aussichten für die neue Regierung in Bezug setzen. 1. Die Wahlergebnisse Die Wahlen des Jahres 2000 erbrachten das knappste Ergebnis, das es je in der Geschichte der Vereinigten Staaten gegeben hat. Bei den Präsidentschaftswahlen erzielte Vizepräsident Al Gore, der demokratische Kandidat, eine Mehrheit von 540.000 bei 105.000.000 abgegebenen Wählerstimmen, was einem Vorsprung von 48,4 zu 47,9 Prozent gegenüber George Bush, dem Gouverneur des Bundesstaates Texas, entsprach. Die amerikanische Verfassung enthält jedoch Bestimmungen, die ursprünglich aufgrund der politischen Lage im 18. Jahrhundert aufgenommen worden waren, und die besagen, dass die Präsidentschaftswahlen nicht durch die allgemeinen Wahlen, sondern die Stimmabgabe durch die Wahlmänner entschieden werden. Nach einem fünfwöchigen Streit über die Stimmenauszählung in Florida wurden Bush 25 die Wahlmännerstimmen des Staates zuerkannt, womit er gegenüber Al Gore einen Vo rsprung von 271 zu 267 Stimmen erlangte – genau eine Stimme mehr, als zwingend für eine Mehrheit vorgeschrieben ist. Durch dieselben Wahlen entstand eine Pattsituation im Senat. Republikaner und Demokraten hatten beide 50 Sitze inne. Die Macht im Senat besaßen jedoch die Republikaner, da der republikanische Vizepräsident, Dick Cheney, mit abstimmte und das Zünglein an der Waage 94 spielte. 1 Die Republikaner konnten auch ihre geringe Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen. Sie büßten zwar zwei Sitze ein, halten jedoch mit 221 zu 212 Sitzen noch immer die Mehrheit (auch von den beiden parteilosen Abgeordneten unterstützt je einer gewöhnlich die Republikaner, der andere die Demokraten). 2 Aufgrund des Wahlausgangs besaß die Republikanische Partei zum erstenmal seit 50 Jahren wenigstens für fünf Monate die Mehrheit in beiden Teilen der Regierung. Diese Mehrheit war jedoch so knapp, dass es ihnen ohne die Hilfe gemäßigter Demokraten fast nicht möglich war, zu regieren. Aus den Graphiken 1 bis 3 geht klar hervor, dass sich praktisch in allen drei Regierungsinstitutionen beide Parteien ungefähr paritätisch gegenüberstehen. Im Rennen um die Präsidentschaft lagen die Anzahl an Wählerstimmen und die Anzahl an Stimmen des Wahlmänner-Kollegiums in der Tat so nah beieinander wie noch nie in der Geschichte der Vereinigten Staaten; zu Al Gores Pech lagen beide eben auf der jeweils anderen Seite der 50-Prozent-Grenze (siehe Graphik 1, S. 107). Im Repräsentantenhaus ging die Mehrheit der Republikaner seit 1994 mit jeder Wahl etwas weiter zurück. Darüber hinaus sind die Mehrheiten der Republikanischen Partei sehr viel kleiner als die der Demokraten während des Zeitraums demokratischer Vorherrschaft, der mit den Wahlen von 1932 eingeläutet wurde (siehe Graphik 2, S. 108). Die Mehrheiten der vergangenen Legislaturperioden im Repräsentantenhaus sind tatsächlich die geringsten, die je in der Geschichte der USA aus vier aufeinanderfolgenden Wahlen hervorgingen. An knappe Mehrheiten im Senat sowie wechselnde Machtverhältnisse zwischen den beiden großen Parteien hat man sich im Lauf der Jahre gewöhnt. Zu einer Pattsituation kam es bislang jedoch nur einmal, nach den Wahlen des Jahres 1880. Unter den Wahlen, die seit 1932 abgehalten wurden, lässt sich nur die von 1952 mit der von 2000 unter dem Gesichtspunkt vergleichen, dass in beiden Häusern ein so knappes Mehrheitsverhältnis zwischen den Parteien herrscht (siehe Graphik 3, S. 109). Darüber hinaus war dies auch die letzte Wahl, die eine einheitliche republikanische Mehrheit in Legislative und Exekutive erbracht hatte. 2. Polarisierte Parteien, Wahlkampagnen ohne Parteiprogramm Das nahezu Gleichaufliegen der Parteien in Washington spiegelt exakt die Verteilung ihrer jeweiligen Anhängerschaft unter den Wählern, denn bei den Wahlen des Jahres 2000 ließ sich kein klarer Stimmungsumschwung in Richtung einer Partei feststellen und gemäß Umfragen, die an den Ausgängen der Wahllokale stattfanden, war der Anteil an Wählern, die aus ihrer Grundüberzeugung heraus für eine der Parteien stimmten, so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das letzte Mal, als die beiden großen Parteien im Hinblick auf ihre Unterstützung durch die Bevölkerung so dicht beieinander lagen, war im 19. Jahrhundert. Die massive Unterstützung, die die Demokraten seit dem New Deal seitens der Bevölkerung genossen, war bis zur Mitte der 1980er-Jahre abgebröckelt. Seitdem konnten sie sich zwar in den meisten Umfragen, mit welcher Partei man sich eher identifiziere, einen kleinen Vorsprung sichern, doch da die Anhänger der Republikaner eher zur Wahl gehen und sich dann auch ihrer Partei gege nüber loyaler verhalten, liegen beide großen Parteien nunmehr in der Wählergunst fast gleichauf. Diese Veränderung geht auch aus den ausgewählten Umfragen des Gallup-Instituts, abgebildet in Graphik 4 (siehe S. 110), hervor. 1 Dies änderte sich Anfang Juni 2001, als der Republikanische Senator Jeffords aus Vermont seiner Partei den Rücken kehrte und als Unabhängiger mit den Demokraten stimmt. 2 Durch eine Nachwahl, die durch den Tod eines demokratischen Abgeordneten nötig geworden war, gewannen die Republikaner im Juni 2001 ein Mandat hinzu. 95 Obwohl die Wahlen des Jahres 2000 die zugrundeliegende Parteilichkeit der Wählerschaft in ungewöhnlicher Klarheit aufzeigte, war in den Wahlkampagnen nichts von der extremen parteilichen Polarisierung zu spüren, die die politische Landschaft der Vereinigten Staaten während des vergangenen Jahrzehnts prägte. Ganz im Gegenteil wurden die Schlachten um die Macht im Weißen Haus und im Kongress in Staaten und Bezirken mit wechselnden Mehrheitsverhältnissen geschlagen und man buhlte um die Gunst unabhängig denkender Wechselwähler. Unter diesen Umständen waren Appelle zur Unterstützung einer Partei oder sogar Bezugnahmen auf eine Partei nur sehr gedämpft bis überhaupt nicht zu vernehmen. In einer Ära zunehmend polarisierter Lager von Parteianhängern führte das Kopf-an-KopfRennen beider Parteien ironischerweise zu Wahlkampfstrategien, die den Parteienbezug absichtlich herunterspielten. Am offensichtlichsten war dies bei Bushs Kampagne zu beobachten, der nicht nur die demokratische Opposition, sondern implizit auch den stark konservativen republikanischen Flügel im Kongress kritisierte und versprach, in seine Regierungspolitik beide Parteien einzubinden, um die beständigen Rangeleien und Kraftproben zu beenden, über die so viele der Wechselwähler verärgert waren. Bushs Verbündete im Kongress unterstützten diese Strategie. Während des Wahljahres gingen die konservativen republikanischen Unruhestifter im Kongress jeder potentiellen Auseina ndersetzung mit der Regierung Clinton aus dem Weg und machten Clinton gegenüber ein Zugeständnis nach dem anderen oder waren einverstanden, Entscheidungen auf die Zeit nach den Wahlen zu verschieben. In ähnlicher Weise spendeten die Delegierten zur republikanischen Parteikonvention – die meisten von ihnen überzeugte Konservative und nur wenige Vertreter von Minderheiten – regen Beifall für die Reden und Vorschläge, die dafür plädierten, Minderheiten und Benachteiligte zu unterstützen und darauf abzielten, die Partei als offen und sozial darzustellen. Kaum ein Wort der Kritik wurde laut, als Bush versuchte, sich selbst als "mitfühlenden Konservativen" zu präsentieren, der mit den Demokraten genauso wie mit den Republikanern zusammenarbeiten könnte, um Reformen des Schulwesens durchzuführen und soziale Programme wie Social Security und Medicare zu retten, die jahrzehntelang die Vorzeigeprojekte der Demokraten gewesen waren. Erst nach den Wahlen, während des Streits über die Stimmenauszählung in Florida, machte sich die Polarisierung zwischen den Parteien in vollem Ausmaß bemerkbar. Obwohl die meisten Amerikaner den Kampf um Florida mit ziemlicher Distanz verfolgten (weder Bush noch Gore bringen die Volksseele wirklich zum Kochen), sahen Kongressmitglieder und eifernde Aktivisten beider Seiten diesen Kampf als ein Mittel, um die andere Seite davon abzuhalten, unrechtmäßig die Wahl zu gewinnen. 3. Regionale und kulturelle Unterschiede 2000 teilten sich die Wähler der beiden Parteien entlang klarer demographischer, ideologischer, kultureller und religiöser Grenzen auf. Die regionalen Unterschiede sind klar nachvollziehbar auf einer Karte der Stimmen des Wahlmänner-Kollegiums, aufgeteilt in Staaten, in denen Bush bzw. Gore gewann (Graphik 5, S. 111; in den Graphiken 6, 7 und 8, S. 112-114 ist in Klammern der jeweilige Wähleranteil in jeder Kategorie in Prozent angegeben). Bush wurde stark im Süden favorisiert, während der Nordosten überwiegend Gore wählte. Im Mittleren Westen und im Westen war die Aufteilung ungefähr hälftig, wobei die demokratischen Mehrheiten in den Staaten an der Küste durch die überwiegend republikanischen Staaten in den Bergen ausgeglichen wurden. In den Großstädten konnte Gore einen großen Vor- 96 sprung erzielen, während in den ländlichen Gebieten Bush das Rennen machte. Auch in den Vorstädten lag Bush knapp vorne. Eine demographische Betrachtung ergibt, dass Männer Bush bevorzugten, während die Frauen für Gore stimmten. Beide Stimmenanteile waren in etwa gleich groß, wodurch ein "geschlechtsgebundener Unterschied" von 11 Prozentpunkten entstand – der größte, den je Umfragen an den Ausgängen der Wahllokale zum Ergebnis hatten. Bush trug den entscheidenden Sieg bei den Weißen davon, während Gore über 90 Prozent der Stimmen der schwarzen Bevölkerung und 64 Prozent der lateinamerikanisch-stämmigen Bevölkerung auf sich vereinte. Verheiratete Wähler stimmten eher für Bush, unverheiratete in großem Ausmaß für Gore. Die anderen in Graphik 6 (S. 112) gezeigten Vergleiche weisen jedoch auch auf andere Faktoren hin, die für den Wahlausgang 2000 entscheidend waren. In Übereinstimmung mit den traditionellen gesellschaftlichen Klassenunterschieden zwischen beiden Parteien erhöhte sich mit dem Einkommen eines Wählers auch die Wahrscheinlichkeit, dass er für Bush stimmen würde. Es gilt jedoch auch Unterschiede in der Bevorzugung eines der beiden Präsidentschaftskandidaten zu beachten, die mit den beiden nicht-wirtschaftlichen Faktoren des Waffenbesitzes und der Religiosität zusammenhängen. Hier ist die Differenz nämlich sogar noch größer als im Vergleich zwischen den Einkommensschichten. Der Unterschied in der Unterstützung für Bush oder für Gore zwischen den niedrigsten und den höchsten Einkommenskategorien beträgt 16 Prozentpunkte. Der Unterschied zwischen Haushalten, die Waffen besitzen und denen, die keine besitzen, liegt bei 23 Prozentpunkten und die Differenz zwischen den am meisten und den am wenigsten religiös aktiven Wählern liegt bei 29 Prozentpunkten. Der Schluss, dass die Wahlentscheidung stark von nicht-wirtschaftlichen Überlegungen abhing, wird durch eine Untersuchung der Antworten von Wählern auf Fragen über aktuelle Probleme bestätigt. Eine Auswahl solcher Fragen ist in Graphik 7 (S. 113) gezeigt. Am stärksten war die Wahlentscheidung an die Abtreibungsfrage gebunden. Hier lag die Unterstützung für Bush bei Vertretern der Ansicht, dass Abtreibung generell verboten sein sollte, um 51 Prozentpunkte höher als bei Vertretern der Ansicht, dass Abtreibung generell erlaubt sein sollte. Der drittgrößte Unterschied ist mit den Standpunkten über Maßnahmen zur Eindämmung der Flut an im Umlauf befindlichen Schusswaffen verbunden (41 Punkte, knapp überholt von Unterschieden bezüglich der Steuerfrage mit 42 Punkten). Bei anderen wirtschaftlichen Themen (was mit dem Sozialhilfeprogramm passieren soll, der Kompromiss zw ischen Umweltschutz und Förderung des Wirtschaftswachstums) ist die Kluft schmaler, aber dennoch gut feststellbar. Die Entscheidung der Wähler hing darüber hinaus stark von ihrer Meinung darüber ab, welche Themen oder welche Qualitäten am wichtigsten seien (siehe Graphik 8, S. 114). Wähler, für die die Steuern am meisten Bedeutung hatten, stimmten für Bush. Dasselbe gilt für die Wähler, die internationalen Angelegenheiten größte Bedeutung bemaßen. Dieses Ergebnis ist etwas überraschend, da Bush – um es milde auszudrücken – nicht gerade für sein Expertenwissen über außenpolitische Themen bekannt ist. Wahrscheinlich ist dies darauf zurückzufü hren, dass Bush von Wählern Unterstützung erhielt, die von seinen Versprechen, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen und ein Raketenverteidigungsprogramm ins Leben zu rufen, angetan waren. Wähler, denen innenpolitische Themen unter Ausnahme der Steuern am wichtigsten waren, neigten dazu, für Gore zu stimmen. Dessen Vorsprung im Bereich des Bildungswesens war jedoch gering genug, um den Schluss zuzulassen, dass Bush während des Wahlkampfes durch die Konzentration auf das Bildungswesen – also ein Themengebiet, das normalerweise die Demokraten für sich in Beschlag nehmen – sehr viel Boden gutmachen und fast gleichziehen konnte. 97 Noch größere Unterschiede findet man zwischen den Wählern, die unterschiedliche Ansichten darüber vertreten, welchen Eigenschaften des Präsidentschaftskandidaten die größte Bedeutung zukommt. Vor allem Wähler, die Ehrlichkeit und Integrität über alles andere stellten, unterstützten entscheidend Bush, während jene, die größeren Wert auf Erfahrung legten, in äußerst großem Ausmaß für Gore stimmten. Die "Charakterfrage" wirkte sich daher ganz klar zugunsten Bushs aus, während Gore Vorteile aus seiner Erfahrung und seinem Fachwissen ziehen konnte. Insgesamt bevorzugten die Wähler, die größeren Wert auf die Qualitäten des Präsidentschaftskandidaten legten, Bush, während die Wähler, denen die anstehenden Themen wichtiger waren, Gore bevorzugten. Aus den Umfragen geht außerdem auch hervor, dass Gore die Wahlen in kein Referendum zur Wirtschaft verwandeln konnte, da es den Republikanern gelang, zahlreiche Wähler davon zu überzeugen, dass die hervorragende Wirtschaftslage wenig oder gar nichts mit der von der Regierung Clinton verfolgten Politik zu tun hatte. Nur 28 Prozent der Befragten hielten die Wirtschaftslage für Clintons Verdienst, während 29 Prozent der Meinung waren, dass er wenig oder gar nichts dazu beigetragen hatte. Diese beiden Gruppen trennten sich auch in der Stimmabgabe genau. Unterschiede ließen sich der allgemeinen Parteienorientierung zuschreiben (mit der diese entgegengesetzten Ansichten zweifelsohne konform gehen). Die verbleibende Gruppe, also die 40 Prozent, die Clinton eine Teilverantwortlichkeit für die Wirtschaftslage zubilligten, neigten etwas mehr dazu, Gore zu wählen. Gores Versagen darin, sein bestes Zugpferd – die durch die Regierung Clinton stark verbesserte Volkswirtschaft – effektiv einzusetzen, war mehr als alles andere für seine Wahlniederlage ausschlaggebend. Teilweise lag dies wohl an mangelnden politischen Fähigkeiten, verstärkt durch seine Schwierigkeiten, eine effektive Beziehung zum Wähler herzustellen – die Wähler wurden mit ihm einfach nicht warm. Er war jedoch auch etwas verstimmt darüber, dass viele Amerikaner die starke Wirtschaft eher Alan Greenspan, dem Chef der amerikanischen Notenbank, zuschrieben. Gores Versagen, das Wirtschaftsthema besser zu seinen Gunsten auszuschlachten, erklärt, warum alle Prognosemodelle, die auf Wirtschaftswachstum und die Popularität des Präsidenten zur Vorhersage des Wahlausgangs setzten, mit ihren Ankündigungen eines bequemen Gore-Sieges falsch lagen. 4. Die Parteianhängerschaften Die Umfrageergebnisse zeigen auf, worauf die unterschiedlichen Präferenzen für eine der Parteien beim Wähler zurückzuführen sind. Die Anhänger der Republikanischen Partei und Bushs sind überwiegend weißer Hautfarbe, männlichen Geschlechts und leben in den Staaten im Süden, in den Great Plains und in den bergigen Staaten im Westen. Sie haben eine Vorliebe für die Jagd und für Schusswaffen, sind religiös-konservativ (unter den 14 Prozent der weißen Wähler, die sich selbst der "religiösen Rechten" zuordnen, stimmten 80 Prozent für Bush), leben in ländlichen Gebieten, sind verheiratet und wohlhabend. Gores demokratische Anhängerschaft ist vor allem weiblichen Geschlechts, gehört Minderheiten an, lebt im Nordosten oder an der Westküste, ist nicht religiös, gewerkschaftlich organisiert, nicht verheiratet, besitzt keine Schusswaffen und ist weniger wohlhabend. Die unterschiedlichen Standpunkte zu aktuellen Themen spiegeln diese demographischen Unterschiede und zeigen klar, dass es einen kulturellen Unterschied zwischen den beiden Parteien gibt. Die Anhänger der Republikaner sind typischerweise für ein liberales Waffengesetz, gegen Abtreibung, für niedrige Steuern und eine zurückhaltendere Rolle des Staates, und präferieren privatwirtschaftliche Lösungen um die Probleme des Medicare- und des Sozialhil- 98 fe-Programms zu lösen. Sie sind darüber hinaus bereit, den Umweltschutz dem Wirtschaft swachstum unterzuordnen. Die Wähler der Demokratischen Partei sind typischerweise für schärfere Waffengesetze, ein Recht auf persönliche Entscheidung in der Abtreibungsfrage, und präferieren staatliche Lösungen für Probleme mit dem Medicare- und dem Sozialhilfeprogramm sowie mit dem Schulsystem. Darüber hinaus fordern sie mehr Gesetze zum Umweltschutz. Aus diesen Umfrageergebnissen geht auch hervor, dass die Wähler Bushs und die Wähler Gores vollkommen unterschiedliche Auffassungen vertraten, worum es bei den Präsidentschaftswahlen in erster Linie ging. Den Wählern Bushs war vor allem die Charakterfrage (Ehrlichkeit, Integrität, moralische Führung) wichtig. Für die Wähler Gores ging es primär um Leistung und die Bewältigung aktueller Probleme (Wirtschaftslage, Erfahrung, Führung der Regierungsgeschäfte, soziale Programme). Bei diesen zwei unterschiedlichen Referenzsystemen handelt es sich natürlich um die Stärken des jeweiligen Kandidaten, die im Wahlkampf propagiert wurden. Doch sie zeigen in Verbindung mit den regionalen und demographischen Unterteilungen und den Meinungsunterschieden, dass sich die Wähler der Vereinigten Staaten in zwei fast gleich große Lager aufgeteilt haben, die sehr unterschiedliche soziale und politische Werte vertreten. Auch das Ergebnis der Kongresswahlen deutet auf die regionalen und kulturellen Unterschiede zwischen beiden Parteien hin. Wie auch das Ergebnis der landesweiten Wahl des Präsidenten verbirgt die relativ ähnliche Anzahl von Sitzen beider Parteien im Repräsentantenhaus und im Senat große regionale Unterschiede in der Wählergunst, die den regionalen Unterschieden bei den Präsidentschaftswahlen stark ähneln. Nach den Wahlen des Jahres 2000 erhielten die Republikaner 63 Prozent der Sitze im Repräsentantenhaus und 67 Prozent der Sitze im Senat in den Staaten im Süden, in den Great Plains und in den bergigen Staaten im Westen. In diesen Regionen gewann Bush in allen Staaten bis auf einen (New Mexico). Die Demokraten erhielten 57 Prozent der Sitze im Repräsentantenhaus und 69 Prozent der Sitze im Senat in Staaten im Nordosten, im Mittleren Westen und an der Westküste. In den genannten Regionen gewann Gore in 19 von 24 Staaten. Auch eine letzte Eigenart der Wahlen von 2000 sollte erwähnt werden: Hillary Clinton gewann einen Senatssitz für New York und wurde damit die erste Ehefrau eines Präsidenten, die überhaupt in ein öffentliches Amt (sogar in den einflussreichen Senat) gewählt wurde. 5. Clinton als Katalysator Aus all diesen Wahlergebnissen spricht klar und deutlich das Erbe Bill Clintons. Von seinem ersten Auftritt während des Wahlkampfs zur Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten im Jahre 1992 an schieden sich in der amerikanischen Politik die Geister an Clinton. Sozialkonservative Republikaner im Bunde mit der christlichen Rechten verachteten ihn vom ersten Tag an zutiefst und sahen ihn als einen Lügner und ein Schlitzohr an, als eine Person, die aus moralischen Gründen nicht für das Präsidentenamt in Frage kommt. Diese Fraktion sah auch nie einen Grund, ihr Urteil zu revidieren. Andere Republikaner haben ebenfalls – auch wenn sie die Leistung seiner Regierung in der Wirtschaft, bezüglich des Haushaltsdefizits und anderen Aspekten der Politik der öffentlichen Hand achteten – seine Moral generell in Frage gestellt. Begeisterte Unterstützung erfuhr er seitens einiger demokratischer Wählerkreise, vor allem von den Schwarzen. Andere Demokraten unterstützten ihn möglicherweise auch aus dem Grund, dass er neben seinen zahlreichen, ihnen zutiefst verhassten Feinden aus dem rechten Lager trotz mancher Schwächen das weitaus geringere Übel war. Die wichtigsten 99 Ereignisse während seiner Amtszeit als Präsident verstärkten die durch ihn hervorgerufene Polarisierung noch weiter, was tiefgreifende Konsequenzen für die Wahlen des Jahres 2000 hatte. 6. Der Fast-Gleichstand in der Wählergunst und im Kongress Für die gleichmäßige Verteilung der Wählergunst auf beide großen Parteien ist Clinton nicht direkt verantwortlich, da sich die Kluft zwischen beiden Parteien bereits während der Amtsjahre Reagans zu verringern begann (siehe Graphik 4, S. 110) und sich größtenteils auf den Aufstieg der Republikanischen Partei im Süden zurückführen lässt, der in den 1960er-Jahren begann und bis zu Beginn der 1990er-Jahre anhielt. 3 Er trug jedoch stark dazu bei, dass sich diese Entwicklung in den historischen Gewinnen der Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat 1994 ausdrücken konnte. Mit den Wahlen des Jahres 2000 genossen die Republikaner zum erstenmal seit den 1920er-Jahren über vier aufeinanderfolgende Wahlen hinweg die Mehrheit im Kongress. Während des Wahlkampfes von 1992 stellte sich Clinton als einen "neuen Demokraten" dar, vertrat gemäßigte Ansichten und distanzierte sich vom linken Flügel seiner Partei. Als er sein Amt dann angetreten hatte, zeigten seine wichtigsten Handlungen genau jene linken Ideen, die er während des Wahlkampfes vermieden hatte. Damit stieß er große Gemeinden von Wechselwählern – vor allem die "Reagan-Demokraten" aus der Arbeiterklasse und große Teile der männlichen Wählerschaft, die ursprünglich den exzentrischen Milliardär Ross Perot als Präsidentschaftskandidat unterstützt hatten – vor den Kopf. Der durch die Regierung Clinton während der ersten Amtszeit vertretene kulturelle Symbolismus war dem sozialkonservativen, weißen, männlichen Bevölkerungsteil, vor allem im Süden, ein Gräuel. Die augenfällige Aufmerksamkeit, die man bei der Besetzung von Regierungsposten dem Gesichtspunkt widmete, beide Geschlechter und eine möglichst große "Ra ssenvielfalt" einzubeziehen, erinnerte sie an die Programme zur Aufhebung der Rassentrennung und Einbindung von Minderheiten, die sie von Anfang an stark kritisiert hatten. Die Unterstützung Homosexueller bei den Streitkräften, die Einführung strengerer Waffengesetze, die Rolle Hillary Clintons (und wie sie sich verhielt und kleidete) – all dies erinnerte diese Wechselwähler an den kulturellen Links-Liberalismus, der genau das verkörperte, was sie an der Demokratischen Partei nicht mochten. Sie waren darüber hinaus auch gegen die Steuererhöhungen, die 1993 zusammen mit dem massiven Programm zur Reduzierung des Haushaltsdefizits verabschiedet wurden. Schließlich schlug noch Clintons Plan zur umfassenden Reform des Gesundheitssystems fehl, der seinen Kritikern wie ein Amoklauf eines teuren, die Rolle der Regierung extrem überbetonenden Links-Liberalismus anmutete. Bei den 1994, in der Mitte von Clintons erster Amtszeit stattfindenden Kongresswahlen beuteten die Republikaner unter der Führung von Newt Gingrich Clintons Unbeliebtheit bei diesen Gruppen aus und griffen die Demokraten im Kongress als Marionetten Clintons an. Da die Demokraten nach den Wahlen von 1992 im Kongress und in der Regierung die Mehrheit genossen, wurden sie auch zum einzigen Ziel der allgemeinen Unzufriedenheit der Wähler über die Regierung, die zu Beginn der 1990er-Jahre weit verbreitet war. Am Ende waren die Kampagnen der Republikaner jedoch vor allem in Bezirken erfolgreich, in denen Clinton be- 3 Vgl. Miller, Warren/Shanks, E. J. Merrill: The New American Voter, Cambridge, MA 1996, S.141-143. 100 reits 1992 relativ schlecht abgeschnitten hatte und in denen er 1994 vollends unbeliebt geworden war. 4 Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, gewannen die Republikaner die meisten Sitze in Bezirken, die bei den Präsidentschaftswahlen bereits eher für den republikanischen Kandidaten gestimmt, aber gemäßigte Demokraten in den Kongress gewählt hatten. 1994 begannen die Wähler in diesen Bezirken schließlich auch bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus so zu entscheiden, wie sie es bereits bei den Präsidentschaftswahlen getan hatten. Dadurch gingen die entsprechenden Sitze an Republikaner und das Ergebnis der Kongresswahlen spiegelte nun erst die Gewinne der Republikaner wider, die sie bereits vor einem Jahrzehnt gemacht hatten. Da die Mehrzahl der 1994 durch die Republikaner gewonnenen Sitze also bereits vorher durch die Republikaner bekleidet hätten werden sollen, gelang es den jeweiligen Vertretern, in den darauffolgenden Wahlen auch ohne einen starken pro-republikanischen Stimmungsumschwung wie er 1994 stattgefunden hatte, ihre Ämter zu verteidigen. Tabelle 1. Gefährdete und sichere Sitze im Repräsentantenhaus, 1992-2000, nach Parteien ________________________________________________________________________ Wahlrisiko Veränderung in Abhängigkeit von den Präsidentschaftswahlen 1992 1994 1996 1998 2000 1992-2000 ________________________________________________________________________ gefährdet Demokraten 67 36 40 36 33 -34 Republikaner 14 20 22 18 16 +2 Gesamt 81 56 62 54 49 -32 Konkurrenz Demokraten Republikaner Gesamt 49 23 72 32 40 72 27 29 56 31 27 58 33 25 58 -14 +2 -12 sicher Demokraten 142 136 140 144 146 +4 Republikaner 139 170 176 178 180 +41 Gesamt 281 306 316 322 326 +45 Anmerkung: "Gefährdete" Sitze sind jene, bei denen der Präsidentschaftskandidat der Siegerpartei mindestens 2 Prozent weniger als seinen bisherigen Durchschnitt an Stimmen in allen Wahlbezirken erhalten hat; "sichere" Sitze sind jene, bei denen der Präsidentschaftskandidat der Siegerpartei mindestens 2 Prozent mehr als seinen bisherigen Durchschnitt an Stimmen in allen Wahlbezirken erhalten hat; "Konkurrenz"-Sitze liegen zwischen diesen Kategorien. Für 1992 und 1994 wurden die Daten der Präsidentschaftswahlen von 1992 verwendet, für 1996, 1998 und 2000 die Daten der Präsidentschaftswahlen von 1996. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen nach Bezirken wurde in den Fällen angepasst, in denen im Zuge der Neuordnung der 4 Jacobson, Gary C.: The 1994 Elections in Perspective, in Political Science Quarterly, 1996, Bd.111, S.203223. 101 Wahlbezirke nach 1990 aufgrund von Gerichtsbeschlüssen die Grenzen von Wahlbezirken verlegt wurden. Clinton kann also als der Katalysator (sowie als Opfer) einer Veränderung betrachtet werden, die ohnehin anstand. Wenn auch unbeabsichtigt, half er den Republikanern ebenfalls dabei, ihre Mehrheit nach 1994 zu verteidigen. Weitverbreitete Zweifel an Clintons moralischer Integrität verhinderten zwar weder seine erneute Wahl, noch die allgemeine Wertschätzung seiner Leistung, doch die Wähler sahen Grund, seine Handlungsfreiheit etwas einzuschränken. Als jedermann klar wurde, dass er Bob Dole 1996 schlagen würde, nahmen einige Wähler Zweifel an der Sauberkeit von Clintons Wahlkampf-Finanzierungspraktiken und seinem Verhalten in anderen Belangen zum Anlass, Vertreter der republikanischen Partei in den Kongress zu wählen, um ein Auge auf den Präsidenten zu haben. 5 Der wachsende Wohlstand der Vereinigten Staaten während der Amtsjahre der Regierung Clinton erzeugte bei vielen Wählern auch Zufriedenheit mit dem Status quo, der allerdings zum Leidwesen der Demokraten auch bedeutete, dass durch die Wahlen von 1996, 1998 und 2000 republikanische Mehrheiten im Kongress erzielt wurden. 7. Die Bildung parteipolitischer Fronten im Kongress Wie auch bei der Veränderung der Anhängerschaft der großen Parteien unter der Bevölkerung war Clinton nicht die treibende Kraft hinter der zunehmenden Bildung parteipolitischer Fronten im Kongress, doch sie erreichte während seiner Präsidentschaft neue Extreme. Dies geht aus der durchschnittlichen ideologischen Position der republikanischen und der demokratischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses hervor, ausgedrückt durch die DW-NominateWerte von Poole und Rosenthal. Diese Werte errechnen sich aus allen namentlichen Abstimmungen von der 80. bis zur 105. Legislaturperiode des Kongresses (1947-1998). Dabei wird jeder Abgeordnete jeder Legislaturperiode des Kongresses auf einer Skala von links bis konservativ eingeordnet, die von –1,0 bis +1,0 reicht; umso höher der Wert, desto konservativer der Abgeordnete. 6 Graphik 9 auf Seite 115 zeigt, dass sich die Parteien bereits vor Clintons Amtsantritt 1993 (mit der 103. Legislaturperiode des Kongresses) auseinanderbewegten, dieser Trend zur Polarisierung sich jedoch durch die 1990er-Jahre hindurch fortsetzte. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch die Kraftproben anlässlich der Abstimmung über den Bundeshaushalt von 1993 (jeder republikanische Kongressabgeordnete stimmte gegen Clintons Maßnahmenpaket zur Reduzierung des Haushaltsdefizits, das einer der Hauptgründe für den gegenwärtigen Haushaltsüberschuss der Vereinigten Staaten ist) und die drakonischen Budgetkürzungen seitens der Republikaner 1995. Ihren Höhepunkt erreichte die Polarisierung jedoch 1998-1999 beim Versuch der Republikaner, Clinton seines Amtes zu entheben. Im Repräsentantenhaus stimmten 98 Prozent der Republikaner für mindestens einen der Punkte zur Begründung einer Amtsenthebung, während 98 Prozent der Demokraten gegen alle vier Punkte waren. Im Senat waren 91 Prozent der Republikaner für die Verurteilung Clintons in mindestens einem Punkt, während kein einziger Demokrat für irgendeinen der Punkte stimmte. Die Reaktion der Öffentlichkeit auf das Amtsenthebungsverfahren zeigte, dass sich nicht nur die Kongressabgeordneten, sondern auch die normalen Wähler entlang einer parteipolitischen 5 Jacobson, Gary C.: Congress: Unprecedented and Unsurprising, in: Michael Nelson (Hrsg.), The Elections of 1996, Washington DC 1997, S.143-167. 6 Vgl. Keith T. Poole, Howard Rosenthal: Congress: A Political-Economic History of Roll Call Voting, New York 1997, Teil 3, 11. 102 Linie gespalten hatten. Insgesamt ergeben die Dutzende von Umfragen, die zu diesem Thema durchgeführt wurden, dass im Schnitt zwei Drittel der Öffentlichkeit gegen eine Amtsenthebung waren. Doch die Befragten, die sich selbst als Demokraten oder als Republikaner bezeichneten, bezogen stark unterschiedliche Positionen und die Standpunkte der aktivsten unter dieser Gruppe von Befragten waren einander fast völlig entgegengesetzt. Im Durchschnitt waren etwa zwei Drittel der Befragten, die sich selbst als Republikaner bezeichneten, für die Amtsenthebung Clintons, während 85 Prozent der sich als Demokraten ausweisenden Befragten dagegen waren. Eine stärkere parteipolitische Abgrenzung zeigte sich unter den aktiven Wählern, eine noch stärkere Polarisierung unter den persönlich politischen Aktivisten. 7 Allgemeinere Daten zur öffentlichen Meinung deuten darauf hin, dass sich die Ansichten der Anhänger der jeweiligen Partei während der vergangenen zwei Jahrzehnte immer weiter auseinanderbewegt haben, wobei sich diese Entwicklung während der 1990er-Jahre verstärkte. Die wachsende parteipolitische und ideologische Kohärenz, Einheitlichkeit und Loyalität unter den Wählern und Aktivisten ließen die republikanischen und die demokratischen Kongress-Wahlbezirke homogener und einander ähnlicher werden, was anders herum wieder die Polarisierung ihrer Vertreter im Kongress verstärkte. Ein Beleg für diesen Trend sind die zunehmenden Unterschiede in der Entscheidung für einen Präsidentschaftskandidaten durch die republikanischen und die demokratischen Wahlkreise für das Repräsentantenhaus. Im Jahre 1972 fiel beispielsweise in einem durchschnittlichen mehrheitlich republikanischen Wahlkreis das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen nicht einmal acht Prozentpunkte "republikanischer" aus als in einem durchschnittlichen, mehrheitlich demokratischen Bezirk. Bis zum Jahr 1996 war diese Differenz auf über 16 Prozentpunkte angewachsen. 8. Der Wettstreit zwischen Wirtschaftslage und Charakterfrage Clinton überlebte den Amtsenthebungsversuch hauptsächlich, da die Demokraten zu ihm hielten – und das, obwohl sie glaubten, dass die gegen ihn ins Feld geführten Vorwürfe gerechtfertigt waren. Der Grund für ihre Unterstützung war teilweise, dass sie seine Gegner hassten und teilweise die sehr große Anerkennung für die Leistungen der Regierung unter Clintons Führung. Die Amerikaner wussten die niedrige Arbeitslosenrate, die steigenden Einkommen von Familien, den wachsenden Überschuss im Bundeshaushalt, den boomenden Aktienmarkt und die sinkende Kriminalitätsrate sowie den Rückgang der Zahl der SozialhilfeEmpfänger während Clintons Präsidentschaft durchaus zu schätzen. 8 Die Erbschaft, die Gore von Clinton übernahm, bestand also aus zwei widersprüchlichen Komponenten: einerseits die hervorragende Wirtschaftslage und andere innenpolitische Erfolge und andererseits die Skandale, die der "Charakterfrage" Auftrieb verliehen. Hauptreibungspunkt zwischen den Wahlkampagnen Gores und Bushs war daher, anhand welcher Kriterien die Wähler ihre Entscheidung treffen sollten. Wenn die meisten Wähler die Präsidentschaftswahlen als ein Referendum über die Leistung der Regierung, der Gore angehört hatte, betrachten würden, wäre sein Sieg sicher. Bush einzige Möglichkeit zu siegen, war daher der Versuch, eine ausreichende Anzahl an Wählern davon zu überzeugen, dass der Charakter eines Präsidenten wichtiger sei als die Wirtschaft und dass Gore einige von Clintons Charakterschwächen teile, wie beispielsweise einen eher lockeren Umgang mit der Wahrheit und 7 Vgl. Jacobson, Gary C.: Public Opinion and the Impeachment of Bill Clinton, in: British Elections and Parties Review, Bd.10, 2000. 8 Ibid. 103 recht durchsichtige taktische Manöver, um sich politische Vorteile zu verschaffen (siehe Graphik 10, S. 116). Die Charakterstrategie zahlte sich bei den sozialkonservativen Wählern in den sozialkonservativen Regionen des Landes aus, die Clintons Verhalten für moralisch völlig unvertretbar hielten, und glich klar die Vorteile aus, die Gore aus der Wirtschaftslage und anderen posit iven Entwicklungen während der Amtszeit Clintons ziehen konnte. Ironischerweise hatte sich Clinton zunächst als einen "neuen Demokraten" der politischen Mitte präsentiert, mit moderaten Ansichten über soziale und wirtschaftliche Angelegenheiten. Wie Gore auch stammt er aus dem kulturell konservativen Süden. Doch Clintons persönliches Verhalten und in gewissem Ausmaß auch seine Politik trugen stark zu dem regionalen/kulturellen Bruch bei, der im Ergebnis der Wahlen von 2000 so klar zu Tage tritt. Wie tief dieser Graben ist, zeigt sich auch in der Tatsache, dass Gore weder in seinem Heimatstaat Tennessee, noch in Bill Clintons Heimatstaat Arkansas gewinnen konnte. Beide Staaten liegen auf der republikanischen Seite des Grabens. Wäre es Gore gelungen, in einem dieser beiden Staaten die Mehrheit zu erringen, wäre er heute Präsident. Die Frage, ob Clintons Verhalten oder Gores Ungeschick in stärkerem Ausmaß für die Niederlage Gores verantwortlich war, wurde sogar nach den Wahlen von den beiden erörtert. Bei einem Treffen nach der Amtsübergabe Clintons an Bush, bei dem eine sehr gespannte Atmosphäre herrschte, gab Gore, wie berichtet wurde, Clinton die Schuld an seiner Wahlniederlage, und argumentierte, dass dessen Sexskandale und niedriger persönlicher Beliebtheitsgrad (im Gegensatz zu der Anerkennung seiner Leistung) seiner Wahlkampagne großen Schaden zugefügt hätten. Clinton "war anfänglich sprachlos, entgegnete dann jedoch mit ähnlicher Vehemenz, dass Gore sich durch sein eigenes Versagen darin, die Leistungen der Regierung für sich zu nutzen, die Chancen verbaut habe". Laut dem Bericht war Clinton "sehr erstaunt und manchmal verärgert über Gores Weigerung, die starke Wirtschaft und andere Themen auszuschlachten, für die Clinton eine gewisse Anerkennung für sich selbst und seinen Vizepräsidenten erwartete". 9 Diese Ansicht vertreten auch viele andere Demokraten. 9. Regionale Abgrenzungen im Kongress Die regionale/kulturelle Spaltung bei den Präsidentschaftswahlen des Jahres 2000 zeigte sich auch bei den Wahlen zum Kongress. 10 Doch auch bei diesem Verhaltensmuster handelt es sich um die Fortsetzung und Verstärkung eines bereits seit längerem existierenden Trends, wie die Daten zur Sitzaufteilung im Repräsentantenhaus und im Senat seit 1946 zeigen (siehe Graphiken 11 und 12, S. 117, 118). Während der vergangenen 50 Jahre und insbesondere während der 1990er-Jahre haben die beiden großen Parteien sozusagen die Hochburgen getauscht. Man beachte den Zeitraum der stärksten Entwicklung: auch hier agierte Clinton wieder als Katalysator für Veränderungen, die ohnehin bevorstanden. Gewinne im Süden, in den Great Plains und in den bergigen Staaten im Westen verhalfen den Republikanern 1994 zur Vorherrschaft im Kongress, der aufgrund dieser Unterstützung seitdem in republikanischer Hand geblieben ist. Soweit die Demokraten die 1994 erlittenen Verluste wieder gutmachen konnten, war das im Nordosten, im Mittleren Westen und an der Westküste der Fall. 9 Vgl. Harris, John F.: Clinton and Gore Clashed Over Blame for Election, Washington Post, 7.2.2001. 10 Vgl. Jacobson, Gary C.: A House and Senate Divided: The Clinton Legacy and the Congressional Elections of 2000, in: Political Science Quarterly, 2001, Bd.116, . 104 10. Bushs Strategie der politischen Mitte Es gelang Bush, diesen sehr knappen Sieg für sich herauszuholen, da er sich unter anderem Clintons Strategie bediente. Clinton belegte bei seinen Wahlsiegen von 1992 und 1996 die politische Mitte und spielte seine Verbindungen zum liberalen Flügel seiner Partei herunter. Bush folgte seinem Beispiel, distanzierte sich von den Konservativen seiner Partei, verschrieb sich einem weicheren "mitfühlenden Konservatismus", versprach traditionell demokratische Ziele sozialer Verbesserungen zu verfolgen und schlug mehrere Wege vor, wie diese Ziele zu erreichen seien. Bushs erfolgreiche Strategie stellt daher auch einen Teil des Clinton-Erbes dar, das das Vorgehen bei den Wahlen 2000 entscheidend prägte. 11. Senatorin Hillary Clinton Schließlich war Clintons skandalöses Verhalten in der Affäre um Monica Lewinsky auch ausschlaggebend dafür, dass Hillary Clinton heute einen Sitz im Senat innehat. Ihr würdevoller Umgang mit der Angelegenheit brachte ihr vor allem bei den Frauen Respekt und Sympathie ein. Der ihr zugefügte Schmerz und die Erniedrigung stachelten sie wahrscheinlich auch dazu an, sich selbst deutlicher politisch zu profilieren, was sie mit ihrer Kandidatur um einen Senatsposten für New York auch gewiss getan hat. Wie auch ihrem Gegner wurde ihr Unterstützung auf nationaler Ebene zuteil. Clinton-Hasser aus dem rechten Spektrum griffen sie massiv an, was ihr jedoch größere Sympathie seitens parteipolitisch weniger festgelegter Wähler und extrem hohe Wahlkampfspenden von Demokraten aus dem ganzen Land bescherte. Im Ergebnis stand die teuerste Senatswahlkampagne der Geschichte, bei der Hillary Clinton 29 Millionen US-Dollar und ihr republikanischer Gegner, Kongressabgeordneter Rick Lazio, 40 Millionen US-Dollar ausgaben. Nach einigen anfänglichen Pannen führte sie eine erstaunlich gute Wahlkampagne und konnte am Ende 56 Prozent der Stimmen verbuchen. 12. Florida und der 107. Kongress Der am Wahltag aufgezeigte annähernde Gleichstand beider Präsidentschaftskandidaten in der Wählergunst hielt auch nach der Wahl an, als beide Seiten versuchten, Florida für sich zu gewinnen. Die Wahlkampagnen wurden in vollem Ausmaß in den Gerichten und in den Medien fortgesetzt. Die Reaktion der Öffentlichkeit fiel voraussehbar parteiisch aus. Bei kurz nach den Wahlen durchgeführten Umfragen erklärten die Wähler Gores, dass der Wahlsieger nach den Stimmen der Bevölkerung ein größeres Recht auf das Amt des Präsidenten habe (63 Prozent). Die Wähler Bushs waren der Auffassung, dass der Wahlsieger nach den Stimmen des Wahlmänner-Kollegiums das größere Anrecht auf die Präsidentschaft habe (67 Prozent). Auf die Frage, wer denn nun Präsident werden sollte, teilte sich die öffentliche Meinung wiederum genau in der Mitte. 11 Auch einen Monat später, als das höchste Gericht der Vereinigten Staaten die Nachzählung der Wahlzettel in Florida beendete, und Gore seine Niederlage gegenüber Bush erklärte, herrschte in der Öffentlichkeit noch immer die gleiche tiefe Uneinigkeit über das Ergebnis. 93 Prozent der Bush-Wähler waren mit dem Wahlergebnis zufrieden, 92 Prozent waren der Ansicht, dass Bush die Wahl rechtmäßig gewonnen habe und 95 Prozent befanden die Entscheidung des höchsten Gerichts, die Nachzählung der Stimmzettel von Hand in Florida zu beenden, für gut. Von den Gore-Wählern waren 89 Prozent mit dem Wahlausgang unzufrie11 Siehe Berichterstattung über Umfragen unter http://www.pollingreport.com/wh2post.htm, 11.11.2000. 105 den, 81 Prozent hielten Bush nicht für den rechtmäßigen Sieger und 80 Prozent kritisierten die Entscheidung des Supreme Court. Die meisten Gore-Befürworter (65 Prozent) fanden, dass die Entscheidung des höchsten Bundesgerichts nicht politisch neutral war, während die meisten Bush-Anhänger (84 Prozent) die Entscheidung für unparteiisch hielten. Die GoreAnhänger waren überzeugt, dass mehr Wähler in Florida für Gore als für Bush stimmen wollten (83 Prozent). Die meisten Bush-Wähler waren vom Gegenteil überzeugt (59 Prozent, wobei weitere 28 Prozent sich nicht sicher waren). Die beiden Seiten vertraten darüber hinaus unterschiedliche Meinungen darüber, ob die gerichtliche Entscheidung, die Nachzählung abzubrechen, gerecht war oder nicht. Auf Bush-Seite antworteten 88 Prozent der Befragten mit "fair", auf Gore-Seite antworteten 78 Prozent mit "unfair". 12 Eine so ausgeprägte Parteilichkeit ist für Erhebungsdaten über die öffentliche Meinung ungewöhnlich, stimmt aber mit anderen Indizien für eine zunehmende Polarisierung der Wähler vor und während der Amtszeit der Regierung Clinton überein. 13. Die neue Regierung Mit seinem hart erkämpften und nicht gerade strahlenden Sieg hat George W. Bush das Amt des Präsidenten nicht nur mit keinem eindeutigen Mandat seitens der Bevölkerung angetreten, sondern auch ohne die (wenn auch vorübergehende) Karenzzeit, die die Oppositionspartei der neuen Regierung normalerweise aus Respekt vor der Entscheidung des Volkes einräumt. Seine Partei verfügte um fünf Monate in beiden Häusern des Kongresses über eine Mehrheit, die jedoch so dünn war, dass Bush ohne jegliche Unterstützung der Demokraten nicht regieren konnte. Er hatte zwar während seiner Wahlkampagne eine Zweiparteien-Führung versprochen, wie er sie auch Texas angeboten hatte, doch im Kongress bestehen sehr viel mehr parteipolitische Konflikte und Polarisierung als in der Teilzeit-Amateurlegislative in Texas. Es wird ihm nicht leicht fallen, sein Wahlversprechen, "ein Vereiniger, kein Spalter" zu sein, zu erfüllen. Wenn er hofft, irgendeines seiner Ziele zu erreichen, wird ihm jedoch keine andere Wahl bleiben, als es zumindest zu versuchen. Seit dem Wechsel der Mehrheit im Senat durch den Austritt von Senator Jeffords aus der Republikanischen Partei hat Bush keine andere Möglichkeit als von der Mitte aus zu regieren. Etwas ermutigend könnte für Bush das Beispiel seines Vaters sein. Bush Senior war während der ersten drei Jahre seiner Präsidentschaft bei der demokratisch und bei der republikanisch gesinnten Bevölkerung gleichermaßen beliebt. Während desselben Zeitraums waren sich die Parteien im Kongress auch über die gesetzgeberische Agenda Bushs eher einig als dies während der Amtszeiten Reagans oder Clintons der Fall war. Erst ab 1992 weisen die Daten auf eine parteipolitische Spaltung hin, die der während anderer jüngeren Präsidentschaften ähnelt. Die politischen Rahmenbedingungen machen es für George W. Bush allerdings schwerer, gemäßigte Demokraten auf die Seite seines "mitfühlenden Konservatismus" zu locken, als es für seinen Vater mit seiner Vorstellung von einer "freundlicheren, sanfteren Nation" war. Während es der Vater mit demokratischen Mehrheiten im Kongress zu tun hatte, die für die Entschlüsse der Regierung verantwortlich zeichneten und zuversichtlich waren, diese Macht auf absehbare Zeit erhalten zu können, steht der Sohn vor einem nahezu mittig gespaltenen Kongress, in dem jede Entscheidung im Hinblick darauf fallen wird, bei den nächsten Wahlen die Mehrheit zu halten oder zu erlangen. Bush muss eine sehr viel breitere ideologische Kluft überwinden als sein Vater, und dies gilt nicht nur für die Parteien. Eine der größten Herausforderungen kommt vonseiten der überzeugten Konservativen auf ihn zu, die in den Kon12 Jacobson: House and Senate Divided 2001, Tabelle 3. 106 gressfraktionen seiner Partei das Sagen haben. Nach sechs Jahren, in denen sie von Clinton mattgesetzt und ausmanövriert wurden, steht ihnen kaum der Sinn nach Kompromissen zugunsten einer Zweiparteienherrschaft. In dem Maß, wie sich Bush jedoch auf die Seite seiner konservativen Parteigenossen im Kongress stellt, werden die Demokraten versucht sein, eine ähnlich harte Opposition ohne Rücksicht auf Verluste zu betreiben, wie dies die Republikaner von 1993 bis 1994 im Kongress so erfolgreich taten. Schließlich kann Bush – es sei denn, er hat enormes Glück – nicht auf die Hilfe globaler Ereignisse hoffen, die seinem Vater während der ersten drei Jahre seiner Regierungszeit Aufwind gaben. Bush Senior konnte dem Abriss der Berliner Mauer vorstehen, war am Ende des Kalten Krieges maßgeblich beteiligt und konnte auf den Sieg im Golfkrieg verweisen, was seinen Beliebtheitsgrad in Rekordhöhen steigen ließ. Solche Gelegenheiten gibt es nur selten und gegenwärtig sind keine Anzeichen dafür zu erkennen. Darüber hinaus weist die Wirtschaft – die seinen Vater zum Sturz brachte – unheilverheißende Symptome dafür auf, dass die längste Wachstumsperiode in der Geschichte der Vereinigten Staaten just in Bushs ersten Amtsmonaten endet. Unter diesen Umständen wird sich in der politischen Landschaft nach den Wahlen des Jahres 2000 wahrscheinlich das Muster parteipolitischer Streitigkeiten und Konflikte fortsetzen, auf Grund derer die meiste Zeit Stillstand herrscht. Die Erfolge Bushs bei der Steuergesetzgebung und der Bildungsreform in seinen ersten Amtsmonaten zeigen aber, dass Bush über ein beachtliches politisches Geschick verfügt und eine eigene politische Agenda durchsetzen will. Mit dem Verlust der Mehrheit im Senat werden die Demokraten aber wieder deutlicher mitregieren und dafür sorgen, dass das Erbe Clintons noch einige Zeit in der Politik der Vereinigten Staaten erhalten bleiben wird. Graphik 1. Stimmen des Wahlmänner-Kollegiums und der Wähler in den Präsidentschaftswahlen, 1932-2000 100 80 40 20 107 Anteil der Republikaner minus Anteil der Demokraten 60 0 -20 -40 WahlmännerStimmen -60 Wählerstimmen -80 -100 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 Jahr Jahr 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 1944 1940 1936 1932 -50 0 50 100 108 -100 150 200 250 Sitze der Demokraten minus Sitze der Republikaner 300 Graphik 2. Mehrheiten im US-Repräsentantenhaus, 1932-2000 Jahr 0 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 1948 1946 1944 1942 1940 1938 1936 1934 30 109 -20 1932 Sitze der Demokraten minus Sitze der Republikaner Graphik 3. Mehrheiten im US-Senat, 1932-2000 70 60 50 40 20 10 X -10 Prozent 110 01 .0 1 01 .45 .0 1 01 .47 .0 1 01 .49 .0 1 01 .51 .0 1 01 .53 .0 1 01 .55 .0 1 01 .57 .0 1 01 .59 .0 1 01 .61 .0 1 01 .63 .0 1 01 .65 .0 1 01 .67 .0 1 01 .69 .0 1 01 .71 .0 1 01 .73 .0 1 01 .75 .0 1 01 .77 .0 1 01 .79 .0 1 01 .81 .0 1 01 .83 .0 1 01 .85 .0 1 01 .87 .0 1 01 .89 .0 1 01 .91 .0 1 01 .93 .0 1 01 .95 .0 1 01 .97 .0 1 01 .99 .0 1. 01 Graphik 4. Identifizierung mit Parteien gemäß Gallup-Umfragen, 1945-2000 (ohne unabhängige Kandidaten) 80 70 60 50 40 30 20 Republikaner 10 Demokraten 0 Datum Graphik 5. Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2000 nach Bundesstaaten AK WA ME MT OR ND MN WI SD WY NE NV UT IO PA IL CO CA NY MI KN IN OH WV MO VA KY AZ OK NM MS HI TX NC TN AR AL GA SC LA FL von Bush gewonnnen von Gore gewonnen NH MA RI CT NJ DE MD 111 ID VT Te iln ah m e re lig m iö H Ei se au H nk sh au eh n V om s a r a er ha lt 75 oh lt ls an 50 30 15 me H ü . m e ne is lä be 00 .0 .0 .0 n u e i in ein sta M i pa nd nt r 1 0- 00 00 00 itt W tW m ltu nm m no a 1 er al l l a a a e i l 0 n 7 5 3 0 c le al ffe ffe -A r v 0. ge 0. 5. 0. 0. N pr l p h G 1 e er i e n o 5 r 0 ro 0 0 0 m Sch 0 im o r n V n n W st he 00 00 00 00 00 ,0 be be Fr M ä G o r oß er S ü W e rdo W se e e 0 M Wo Wo /Go e s i au n s ik wa si si h e ra st 0 U U U U U ta bi ta d e s t e ste n i lte o n c h an rz e i ß t t t e S c S S S t en n e U S z d t z e d n e n n he es n e e e er er n D D D D t n D S a t t e d t e e ( ( ( (2 t ( ( ( r (1 ( (5 r ( 4 D ( ( ( d 2 2 ( 2 ( ( ( 1 4 ( ( 8 ( ( 6 3 15 13 25 24 16 (2 (7 35 5 52 (48 1% 1 2 6 3% 0% 1 % 3 % 9% 2% 8 % 4 % 8% 1 4 2 8 ( 1 4 i e n (7 % % % 8 % % % % % % % % % % % % ) ) % st ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) %) ) ) ) ) ) ) en ) ) : an 112 Graphik 6. Demographische Daten zur Stimmenabgabe bei den Präsidentschaftswahlen -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 Quelle : aktuelle Umfragen zum Wahltag, Ergebnisse entnommen unter http://www.cnn.com, 12. November 2000. Vorsprung/Rückstand Bushs in jeweiliger Kategorie 113 Graphik 7. Standpunkte zu Themen und deren Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahlen Abtreibung sollte: generell erlaubt sein (23%) in den meisten Fällen erlaubt sein (33%) in den meisten Fällen verboten sein (27%) generell verboten sein (13%) strengere Waffengesetzgebung: dafür (60%) dagegen (36%) Lösung des Schulproblems: Geldmittel zur Problembewältigung (78%) Schul-Gutscheinsystem (16%) Investition von Sozialhilfegeldern dafür (57%) dagegen (39%) Welche Art von Steuerreform wäre besser? allgemeine Steuersenkung (51%) gezielte Steuersenkung in Teilbereichen (44%) Was ist wichtiger? Umwelt (46%) Wirtschaftswachstum (48%) Quelle : aktuelle Umfragen zum Wahltag, Ergebnisse entnommen unter http://www.cnn.com, 12. November 2000. -30 -20 -10 0 10 20 Vorsprung/Rückstand Bushs in der jeweiligen Kategorie 30 114 Graphik 8. Anliegen der Wähler und deren Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahlen Welche Themen waren am wichtigsten? Steuern (14%) internationale Angelegenheiten (12%) Bildungswesen (15%) Sozialhilfeprogramm (14%) Medicare/Drogenprogramm (7%) Wirtschaft/Arbeitsmarkt (18%) Gesundheitswesen (8%) Welche Qualitäten waren am wichtigsten? ehrlich/vertrauenswürdig (24%) starke Führungsqualitäten (14%) sympathisch (2%) gutes Urteilsvermögen (13%) ist sozial eingestellt (12%) hat Sachwissen (13%) hat Erfahrung (15%) Was ist wichtiger? Qualitäten (35%) Themen (62%) Höchste Priorität für den Präsidenten: Führung der Regierungsgeschäfte (60%) moralische Führung (34%) Clintons Verdienst an der Wirtschaftslage: großer Verdienst (28%) etwas beigetragen (40%) wenig beigetragen (19%) nicht sein Verdienst (10%) -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Vorsprung/Rückstand Bushs in jeweiliger Kategorie Quelle : aktuelle Umfrageergebnisse zum Wahltag, entnommen unter http://www.cnn.com, 12. November 2000. Kongress 105 (1997-98) 104 (1995-96) 103 (1993-94) 102 (1991-92) 101 (1989-90) 100 (1987-88) 99 (1985-86) 98 (1983-84) 97 (1981-82) 96 (1979-80) 95 (1977-78) 94 (1975-76) 93 (1973-74) 92 (1971-72) 91 (1969-70) 90 (1967-68) 89 (1965-66) 88 (1963-64) 87 (1961-62) -0,4 86 (1959-60) -0,3 85 (1957-58) 84 (1955-56) 83 (1953-54) 82 (1951-52) 81 (1949-50) -0,2 Demokraten liberaler 0 115 80 (1947-48) durchschnittlicher DW-Nominate-Wert 0,2 0,1 konservativer Graphik 9. Ideologische Abweichung der Fraktionen im Repräsentantenhaus voneinander 0,5 0,4 0,3 -0,1 Republikaner -0,5 18 16 14 12 116 Durchschnittliche Differenz im Ergebnis der Präsidentschaftswahlen zwischen von den Demokraten und von den Republikanern gewonnenen Bezirken Graphik 10. Polarisierung von Wahlbezirken zum Repräsentantenhaus, 1952-2000 (Präsidentschaftswahl) 10 8 6 4 2 0 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 Jahr *basierend auf Clintons Wahlergebnis von 1996 1980 1984 1988 1992 1996 *2000 Graphik 11. Sitzanteil der Republikaner im Repräsentantenhaus nach Regionen, 1946-2000 90 Süden, Great Plains, and Mountain West andere Regionen 70 60 50 117 40 30 20 10 Jahr 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 1948 0 1946 prozentualer Anteil an Sitzen 80 118 Graphik 12. Sitzanteil der Republikaner im Senat nach Regionen, 1946-2000 90 70 60 50 118 40 30 20 Süden, Great Plains and Mountain West 10 andere Regionen Jahr 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 1948 0 1946 prozentualer Anteil an Sitzen 80 119 Peter Lösche "Europäisierung" amerikanischer Wahlen? In der Tat: So spannend sind die amerikanischen Präsidentenwahlen noch nie gewesen wie die im Jahre 2000. Das im Wahlkampf immer wieder beschworene Kopf-an-Kopf-Rennen wollte und wollte nicht aufhören. Es wurde bekanntlich erst mehrere Wochen nach dem Wahltag mit einer heftig umstrittenen Entscheidung des Supreme Court beendet. Finish hinter der Ziellinie. Die äußerst knappen Entscheidungen zwischen Kennedy und Nixon 1960, zwischen Nixon und Humphrey 1968 und zwischen Carter und Ford 1976 sind gar nichts verglichen mit der zwischen Gore und Bush 2000. Gary Jacobson hat in seinem Beitrag das Wahlergebnis scharfsinnig interpretiert, hat Argumente und Daten aufgeführt, warum Al Gore entgegen allen Auspizien die Wahlen verloren, warum George W. Bush schließlich mit viel Glück im Weißen Haus gelandet ist und warum und wie sich die Spuren Bill Clintons durch den Wahlkampf ziehen und auch im Wahlergebnis niederschlagen. Hinter diesem Wahlspektakel, das nicht zuletzt dem aus dem 18. Jahrhundert stammenden, in der Öffentlichkeit nicht immer verstandenen indirekten Wahlverfahren geschuldet ist, scheint sich eine Spaltung des Landes in zwei Lager zu verbergen, in zwei Wählerkoalitionen und in zwei Parteien, die mit Hilfe soziodemografischer und geografischer Indikatoren beschrieben werden können. Ich stimme Gary Jacobsons Analyse prinzipiell zu und könnte versuchen, sie in dem einen oder anderen Detail zu modifizieren, ohne doch in der Lage zu sein, eine Gegenthese zu formulieren, die eine lebhafte Diskussion entfachen könnte. Um der Debatte willen werde ich mich daher eines Tricks bedienen und bewusst aus der deutschen Perspektive die amerikanischen Wahlen 2000 betrachten und fragen, ob unter der medialen, von journalistischer Hektik und allgemeiner Aufgeregtheit gekennzeichneten Oberfläche sich nicht Veränderungen in den Tiefenstrukturen amerikanischer Politik vollziehen oder schon vollzogen haben, die auch für uns in der Bundesrepublik und überhaupt in Europa bedeutsam werden könnten. Gefragt wird also, ob es für uns Lehren aus dem jüngsten amerikanischen Wahlkampf und Wahlergebnis zu ziehen gibt. Und bekanntlich gab und gibt es in Deutschland ein ungeheuer großes Interesse an amerikanischen Wahlkampftechniken, -methoden und -strategien. Zu Dutzenden schicken unsere Parteien in Wahlzeiten ihre Experten über den großen Teich, um zu beobachten, sich anregen zu lassen und ggf. Einiges abzukupfern. Die SPD-Kampa 98 hat aus den Erfahrungen und dem Vorbild des ClintonWahlkampfes 1996 (und des von Tony Blair und New Labour 1997) geschöpft. Und die Hälfte der von Gallup befragten Deutschen zeigte sich Anfang Oktober 2000 an den amerikanischen Wahlen interessiert, selbst wenn man von den Kandidaten und deren politischen Vorstellungen relativ wenig wusste. 1 Es mag auch sein, dass ein deutscher Blick auf die amerikanischen Präsidentenwahlen die Sicht der amerikanischen Experten bei ihrer Interpretation dieses Ereignisses schärft. Wir werden am Schluss darauf zurückkommen. Konkret sollen im Folgenden zwei Sachverhalte bzw. Vorstellungen bzw. Klischees aufgenommen werden, die wir auf deutsche Wahlkämpfe und Wahlanalysen anwenden und von 1 Hierzu die entsprechende Umfrage von Gallup vom 9.10.2000 aus: www.gallup.com/poll/releases/pr0010009c.asp. Interessant an dieser Umfrage ist, dass 40 Prozent der Befragten gern Gore, 28 Prozent hingegen Bush als Präsidenten gesehen hätten. Ost- und Westdeutschland fielen aber in ihren Präferenzen auseinander: In Ostdeutschland wurde Bush mit 34 zu 28 Prozent Gore vorgezogen, in Westdeutschland hingegen erhielt Gore 43 Prozent Zustimmung gegenüber 27 Prozent für Bush. 120 denen wir meinen, sie seien aus den uns in der Entwicklung von Wahlkampftechniken und -methoden sowie -analysen weit vorangeeilten Vereinigten Staaten entlehnt und die wir deswegen auch unter dem Schlagwort "Amerikanisierung" zusammenfassen. Eben diese beiden Sachverhalte bzw. Stereotype wollen wir an die amerikanischen Präsidentenwahlen 2000 anlegen und kritisch auf ihren Realitätsgehalt überprüfen. Es handelt sich um die Vorstellungen − Wahlen und Wahlkämpfe würden immer mehr personalisiert, Bindungen an Parteien und soziale Gruppen ließen nach, es käme nicht auf Inhalte, sondern auf den (Spitzen)Kandidaten an und − damit zusammenhängend, der Anteil der Wechselwähler steige, der der Stammwähler sinke, die Volatilität in der Wählerschaft nehme zu. Auf Grund dieser beiden Vermutungen werden im folgenden – zugegeben zugespitzt – die amerikanischen Wahlen 2000 wider den Stachel gängiger Analysen interpretiert. Unsere These lautet: Klischees, die wir in Deutschland und Europa von amerikanischen Wahlen und Wahlkämpfen hegen und pflegen und die wir auch auf unsere politischen Systeme mit dem Schlagwort von der "Amerikanisierung" übertragen, zerschellen an der politischen Wirklichkeit der amerikanischen Präsidentenwahlen des Jahres 2000, sie werden zumindest in Frage gestellt. Oder aus einem anderen Blickwinkel und als gewagte These gegen manche üblichen Interpretationen formuliert: Die gerade abgelaufenen Wahlen in den USA ähneln eher deutschen und europäischen, als dass sie den Stereotypen entsprechen, die wir uns von der "Amerikanisierung" der dortigen und auch unserer Wahlen und Wahlkämpfe machen. 1. Stereotyp "Personalisierung" Da geistert kulturpessimistisch die Vorstellung von der "Personalisierung" der Wahlkämpfe und der Politik generell durch die politischen Feuilletons, aber auch durch politikwissenschaftliche Zeitschriften und Handbücher. Auf Inhalte käme es nicht mehr an. Programmatisch ähnelten Parteien und Kontrahenten sich immer mehr, sie seien zum Verwechseln ähnlich, ja austauschbar. Was diese überhaupt noch unterscheidbar mache, das seien die persönlichen Merkmale der Spitzenkandidaten, deren Charisma, ihre Anziehungskraft auf Frauen oder Jugendliche oder auch auf Facharbeiter, ihre Fernsehwirkung – wirkt jemand vertrauenserweckend oder dandyhaft borniert? Der erste Fernsehwahlkampf der Geschichte lässt an dieser Stelle grüßen mit seinem Mythos, Nixon habe die Wahlen gegen Kennedy 1960 verloren, weil er nicht glatt rasiert gewesen und deswegen dunkel, griesgrämig, ja böse im Vergleich zu seinem strahlend jungen Opponenten erschienen sei. Natürlich: Persönlichkeiten spielen eine Rolle in der Geschichte, selbstverständlich auch bei den Präsidentenwahlen 2000, das ist banal, wer wollte das anzweifeln. Nur: Nach Umfrage haben im Herbst 2000 amerikanische Wähler klar gemacht, dass es ihnen primär auf die politischen Inhalte ankäme, die die Kandidaten verträten, nicht auf deren Charakter- und Persönlichkeitsmerkmale. So etwa zeigte der Gallup/CNN Exit Poll, 2 dass 62% der Wähler Politikinhalte für wichtiger bei ihrer Entscheidung als die Charaktermerkmale der Kandidaten erachteten. Allerdings zeigte sich hier ein deutlicher Unterschied zwischen denen, die für Gore 2 Ich beziehe mich hier auf den Gallup/CNN Exit Poll a388.g.akamai.net/f/388/21/15/w...n.com/ELECTION7/2000/epoll/US/)000.html, im Weiteren zitiert als Gallup/CNN. 121 (mehr an Inhalten orientiert) und denen, die für Bush votierten (mehr an Persönlichkeit orientiert). Und: 67% meinten gar, große politische Differenzen zwischen beiden zu sehen. 3 Tatsächlich haben beide Spitzenkandidaten und beide große Parteien scharf unterscheidbare politische Programme vertreten, so in den Fragen, welche Rolle der Sozialstaat künftig spielen solle, ob und wie stark Steuern gesenkt werden sollten, wie über den Bundeshaushalt Prioritäten zu setzen seien, wie die Rentenversicherung und die damit verbundene Krankenversicherung (Medicare) bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts abzusichern seien. Auf der einen Seite stand George W. Bush, der Konservative, in der deutschen Begrifflichkeit: der Neoliberale. Er propagierte deutliche Steuersenkungen, weitere Deregulierung, Entstaatlichung, Entbürokratisierung, Teilprivatisierung (etwa der Sozialversicherung). Auf der anderen Seite stand Al Gore, der Liberale, in der deutschen Begrifflichkeit: der Sozialstaatler. Er versprach zwar auch die Steuern zu senken, aber längst nicht so drastisch wie Bush. Stattdessen setzte er auf den Ausbau bestehender und die Einrichtung neuer sozialstaatlicher Programme, die Reform und Effektivierung der Bundesbürokratie. Bush appellierte mit seinem Programm vor allem an die weiße mittlere und obere Mittelschicht, Gore an die untere Mittelschicht, die Armutsbevölkerung sowie an ethnische Minoritäten. Konkrete inhaltliche Differenzen waren zwischen beiden Kandidaten leicht auszumachen, z.B. in der Frage, wie die für die nächsten zehn Jahre prognostizierten 4,5 Billionen Dollar Steuerüberschuss im Bundeshaushalt zu verwenden seien. Bush plante 1,3 Billionen für Steuersenkungen, 457 Milliarden für Sozialprogramme und den Rest für die Absicherung der Rentenversicherung zu verwenden, Gore hingegen nur 480 Milliarden für Steuersenkung, 360 Milliarden für die Erweiterung von Medicare (Subventionierung von Medikamenten für Menschen mit niedrigem Einkommen), 870 Milliarden für verschiedenste sozial- und innenpolitische Programme sowie den Rest ebenfalls für die Absicherung der Rentenversicherung. Übrigens: So weit Außen- und Sicherheitspolitik überhaupt eine Rolle im Wahlkampf gespielt haben, wiederholte sich hier das gleiche Muster: Bush argumentierte, die Vereinigen Staaten sollten im internationalen System "bescheiden aber stolz" auftreten, sich mehr zurückhalten als unter der Clinton-Administration. Gore hingegen plädierte für eine stärker interventionistische Rolle seines Landes. Insgesamt standen vier "harte" handfeste, materialistische Politikbereiche im Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung während des Wahlkampfes: 1. Reform des amerikanischen Bildungssystems, insbesondere des primären und sekundären Bereichs; 2. Verwendung des Steuerüberschusses und damit verbundene mögliche Steuersenkungen; 3. Reform des Gesundheitssystems und 4. Rentenreform. Die "weichen", kulturkämpferischen Themen, die "social issues" wie Abtreibung, formelle Anerkennung homosexueller und lesbischer Partnerschaften, Todesstrafe, Verbot von Pornografie oder schärfere Kontrolle von Waffenverkauf und -besitz wurden im Wahlkampf angesprochen, spielten aber nicht die zentrale Rolle wie die sozialstaatlichen Themen. Allerdings gab es auch hier wieder eine Differenz zwischen den Bush- und den Gore-Wählern, die einen wurden mehr von den sozialmoralischen, die anderen mehr von den materialistischen Fragen angesprochen. 4 3 Mir steht hier der Exit Poll von Greenberg Quinlan Reserach Inc. zur Verfügung, einer den Demokraten nahe stehenden Firma für Politikberatung. Die Umfrage wurde im Auftrag von "Campaign for America's Future" durchgeführt, im Weiteren zitiert als Greenberg. 4 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Gary Jacobson in diesem Band. Siehe auch die Umfrage von Greenberg Quinlan Research Inc. (FN 3). 122 Warum ist die viel beschworene "Personalisierung" trotz des harten Zweikampfes und trotz mancher persönlicher Spitzen zwischen Bush und Gore weitgehend ausgefallen? Es gibt gute Gründe dafür. Beide Präsidentschaftsbewerber sind nicht aus dem Holz, aus dem Charismatiker geschnitzt werden: der eine steif, musterschülerhaft und sehr kompetent, der andere scharmant, aber dabei recht unbeholfen, kurz: zwei Typen von Mittelmaß. Ferner haben die Amerikaner schlicht und einfach genug gehabt von den persönlich-pikanten Eskapaden ihres Präsidenten Clinton. Solidität, ja Langeweile und "Moral" sollten wieder ins Weiße Haus einziehen – und beide Spitzenkandidaten verhießen eben das. Wahlkampf unter der Gürtellinie wäre in dem Zusammenhang kontraproduktiv gewesen. Zudem findet "negative campaigning", vor 20 Jahren in den USA in vollster Blüte und erfolgreich (in Deutschland heute immer mal wieder ausprobiert), kaum noch statt, da Wähler sich angewidert vom politischen Prozess ab- oder sich gar dem unfair Attackierten zuwenden. Also: Persönliche Attacken auf den jeweiligen Gegner wären für Bush wie für Gore wahrscheinlich zum Rohrkrepierer geworden. Schließlich: Zweifel an der Intelligenz des Gouverneurs aus Texas, die sich schnell zu einem Vorurteil, ja zu seinem Handicap hätten ausbreiten und verdichten können, waren nach der ersten Fernsehdebatte verflogen, da der Republikaner sich entgegen den Erwartungen wacker geschlagen hatte. Was den Stoff für die Kontroverse lieferte, waren also primär die politischen Inhalte. Und Jacobson ist zuzustimmen, dass Gore in seinem Wahlkampf viel stärker die Karte "boomende amerikanische Ökonomie" hätte spielen müssen, um zu gewinnen. 5 Dabei soll nicht geleugnet werden, dass die Kompetenz des einen, der Charme des anderen Wähler beeinflusst haben mag. Aber in dem entscheidenden Punkt des "character issue", ob nämlich ein Kandidat "ehrlich und vertrauenswürdig" sei, lagen beide im Plus, wenn auch hier wiederum parteiliche Präferenzen durchschlugen. 6 2. Stereotyp "Volatilität" Das zweite Stereotyp, die im Zusammenhang mit Wahlkämpfen und Wahlen bei uns aus den Vereinigten Staaten entlehnt wurde und unter dem Etikett der "Amerikanisierung" firmiert, ist die von der zunehmenden "Volatilität" der Wähler. Der Anteil der Wechselwähler an den Wahlberechtigten steige, Parteibindung lasse nach, die Parteien seien gesellschaftlich nicht mehr verwurzelt, mit Interessengruppen nicht mehr verbunden, wandelten sich immer mehr zu Schwebegewächsen über der Gesellschaft. Sozialmoralische Milieus, einst Kraftbrunnen der Volksparteien, seien ausgetrocknet. Parteiführer und Wahlkampfmanager wüssten weder ein noch aus, wie und wo Wähler zu gewinnen seien. Eben deswegen konzentriere man sich notgedrungen auf den Kampf um die Mitte, um die "neue Mitte". Die Schwankenden und Wankenden sollen eingefangen werden. Um sie ist vor allem und zuerst zu werben, so jedenfalls unser Klischee. Es trifft zu, dass amerikanische Politikwissenschaftler, genauer: die sozialpsychologische Schule der Wahlforschung der University of Michigan, die Wechselwähler als erste in den Fokus genommen haben. Bekanntlich fragen die Empiriker aus Ann Arbor nach der Parteiidentifikation, nach schwacher oder starker oder auch danach, ob sich jemand als Unabhängiger, also weder als Demokrat noch als Republikaner zu erkennen gibt. Und eben diese "Independents" gelten als Wechselwähler, wenn sie denn auch wirklich zwischen den Parteien bei den verschiedenen Wahlen wandern. Wer sich nur schwach mit einer Partei identifiziert oder als Unabhängiger, der einer bestimmten Partei zuneigt und diese dann auch tatsächlich immer 5 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Gary Jacobson in diesem Band. 6 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Gary Jacobson in diesem Band. Siehe auch hierzu die Umfrage von Gallup (FN2). 123 wieder wählt, gilt nicht als wirklich Unabhängiger. In den Vereinigten Staaten ist nun der Anteil der echten "Independents" von 1952, als die Michiganer zu forschen begannen, bis Mitte der Siebzigerjahre gestiegen, nämlich von 9% auf 16%. Seitdem ist die Zahl aber allmählich wieder auf den Ausgangspunkt gesunken: auf 9%. 7 Genau dieses Ergebnis brachten auch die amerikanischen Wahlen 2000. Greenberg hat in seinem Exit Poll nur 7% echter "Independents" unter den Wählern gefunden. Gary Jacobson weist nachdrücklich darauf hin, dass "party-line voting" , also Wählen entlang der Parteirichtung, seit Jahrzehnten nicht so intensiv stattfand wie 2000, 8 was durch den Gallup/CNN Exit Poll unterstützt wird. Dieses Resultat wird durch einen weiteren Befund bestätigt: Wähler haben sich nicht kurzfristig entschieden, sondern lange vor dem Wahltag wussten sie, für wen sie stimmen würden. Nur 10% von ihnen hatte sich erst kurz vor dem 7.11.2000 festgelegt. 9 All dies widerspricht der allgemeinen Aufgeregtheit in den Medien auf beiden Seiten des Atlantiks, wonach die Wähler völlig verunsichert seien, welche Partei oder welchen Kandidaten sie wählen sollten und dass sie sich deshalb häufig erst in der Wahlkabine zu einer Option durchrängen. Entgegen medialen Irritationen haben die Wahlkampfstrategen längst Konsequenzen gezogen, sie wissen: Der Wahlsieg hängt davon ab, ob die Stammwähler mobilisiert und ins Wahllokal gebracht werden. Entsprechend lautete der Rat des "Economist" an Bush und Gore: "Soccer mums be damned. Mobilising your troops might be the hey"10 . Sinngemäß übersetzt: Vergesst die Wechselwähler, bringt die eigenen Truppen ins Wahllokal. Und eben dies geschah: Der Kampf tobte um die Stammwähler, Wechselwähler wurden dagegen vernachlässigt. Gab es 1980 und 1984 Reagan-Demokraten und 1992 und 1996 Clinton-Republikaner, so fehlte die entsprechende Spezies am 7. November 2000 (fast) vollständig. Bush hat – um genau zu sein – einige geringe Erfolge bei solchen erzielt, die zur Hochburg der Demokraten gehören, bei Jüngeren und bei Katholiken. Prinzipiell aber galt, dass die Hochburgen unangetastet blieben, sie schon gar nicht geschliffen wurden. Denn: Noch jeder Wahlhelfer von Bush oder Gore wusste: Stammwähler über alles. Deswegen war die Wahlhilfe durch die mit den Republikanern bzw. mit den Demokraten sympathisierenden Interessengruppen so wichtig, sie appellierten an ihre Mitglieder und Freunde wählen zu gehen: Die National Rifle Association und die Christian Coalition für den Republikaner, die Gewerkschaften, die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), einige schwarze Kirchen und mehrere Frauenorganisationen für den Demokraten. Und die Interessengruppen waren äußerst rührig, 37% der Wähler wurden von ihnen angesprochen. 11 Sie waren zudem recht erfolgreich, so die Gewerkschaften: Der Anteil derjenigen an der Wähle rschaft, die in einem Haushalt mit einem Gewerkschaftsmitglied leben, stieg im Vergleich zu 1996 um 3 Prozentpunkte, nämlich von 23 auf 26%. Und 60% dieser Wähler gaben Gore ihre Stimme. 12 Das Wahlergebnis kam deshalb nicht überraschend: George W. Bush hatte die solide Mehrheit der Männer, der Weißen und der Reichen hinter sich, Al Gore die klare Mehrheit der Frauen, der Schwarzen, der Latinos und derjenigen, die im Jahr weniger als 50.000 Dollar verdienen. 90% der Schwarzen, 63% der Latinos, 54% der Frauen hatten für Gore gestimmt, dagegen 53% der Männer und 53% der Weißen für Bush. Bewegten sich die USA also vom Wahlkampf zum Klassenkampf oder doch wenigstens zur Klassenspaltung? Kein Zweifel: 7 Economist, 4.10.2000. 8 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Gary Jacobson in diesem Band. 9 Siehe hierzu die Umfrage von Greenberg Quinlan Research Inc. (FN 3). 10 Economist, 4.10.2000. 11 Siehe hierzu die Umfrage von Greenberg Quinlan Research Inc. (FN 3), ebenso die Umfrage von Gallup (FN2). 12 Washington Post, 9.11.2000. 124 Gespalten war im November 2000 das Land im Wahlverhalten, nämlich Männer v. Frauen, Weiße v. Schwarze, Land v. Stadt, bevölkerungsarme v. bevölkerungsreiche Staaten, reich v. arm. Die mittlere Mittelschicht und die Vorstädte, die suburbs, aber waren genau in der Mitte gespalten. 13 Zu dieser Spaltung passt, dass sich in den Vereinigten Staaten in den 90er-Jahren sich ein echtes, bundesweites Zweiparteiensystem entwickelt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir eindeutige regionale Schwerpunkte der Parteien. So war in den 70er-Jahren der Süden im Prinzip republikanisch, der Nordosten demokratisch. Heute haben in allen Regionen der USA beide große Parteien grundsätzlich Gewinnchancen. Auf Grund der ideologischen Polarisierung zwischen Demokraten und Republikanern in den 80er-Jahren und durch den Konflikt um den "Contract with America" zwischen dem Repräsentantenhaussprecher Newt Gingrich und Präsident Bill Clinton in dessen erster Amtsperiode hat sich ein um Konservatismus und Liberalismus polarisiertes Parteiensystem entfaltet. Eine moderat liberale Partei konkurriert mit einer moderat konservativen. Republikaner und Demokraten stehen sich programmatisch und inhaltlich so profiliert gegenüber wie Sozialdemokraten und Christdemokraten in Deutschland. Es überrascht daher nicht, dass die Basis der Stammwähler beider Parteien im Herbst 2000 konsolidiert worden ist. Schwarze haben zu 90%, Hispanics zu 63% für den Demokratischen Präsidentschaftskandidaten gestimmt, in so hohen Anteilen wie nie zuvor. Auch die Differenz im Wahlverhalten zwischen den Geschlechtern, das gender gap, war mit 11 Prozentpunkten niemals zuvor so groß. Zugleich hat die Zahl der für eine Partei sicheren Wahlkreise insgesamt zugenommen, 14 was ebenfalls als ein Zeichen der Konsolidierung zu werten ist. Nicht nur sind beide Häuser des Kongresses gleichmäßig zwischen Demokraten und Republikanern aufgeteilt, sondern dies gilt auch für die Landtage der Einzelstaaten: In 16 beherrschen die Demokraten beide Kammern, in 17 die Republikaner, in 16 gibt es eine Teilung der Kammern zwischen beiden Parteien und in Nebraska, dem einzigen Staat mit nur einer Kammer, verfügen die Republikaner über die Mehrheit. Schließlich: Jacobson weist darauf hin, dass die parteiliche Polarisierung im Kongress sowie das Abstimmungsverhalten nach Parteizugehörigkeit zugenommen haben. 15 Zwischen den beiden Lagern, die sich im letzten Jahrzehnt deutlich konturiert haben, wandern die Wähler seltener. Die Lehre daraus haben die jetzigen Präsidentenwahlen gezeigt: Primär sind die Stammwähler zu mobilisieren gewesen und dann erst konnte man zum Spagat ansetzen, um Wechselwähler zu gewinnen. Auch wenn die Parteien in den Vereinigten Staaten klarer voneinander abgegrenzt sind und ideologisch und organisatorisch so geschlossen auftreten wie seit den 60er-Jahren nicht, sei doch aus Anlass der Wahlergebnisse vom 7. Nove mber 2000 davor gewarnt, Erfahrungen des deutschen parlamentarischen Regierungssystems auf die Vereinigten Staaten zu projizieren, gleichsam unser Klischee vom Parteienstaat den Vereinigten Staaten überzustülpen. Als es in der Wahlnacht so aussah, als würde Bush ins Weiße Haus einziehen und als hätten die Republikaner ihre knappen Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus verteidigt und damit die Periode des "divided government" beendet, hieß es aus deutschem Journalistenmund, nun würde Regieren in Washington einfacher. Nein, diese Interpretation ist falsch und urdeutsch, verkennt die amerikanische politische Realität. Fraktionskohärenz ist dort noch immer ein Schimpfwort, ganz zu schweigen von Fraktions13 Übrigens ist die Wirtschaft in ähnlicher Weise gespalten gewesen wie das Land. Während die Erdöl-, Tabak- und pharmazeutische Industrie sowie die Banken eher Bush unterstützten, stand die Unterhaltungsindustrie, also "Hollywood", hinter Gore. Hightech-, Verteidigungs- und Automobilindustrie waren zwischen beiden Bewerbern gespalten. 14 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Gary Jacobson in diesem Band. 15 Ebda. 125 disziplin oder gar Fraktionszwang. Die Abgeordneten und Senatoren verstehen sich primär als Abgesandte ihrer Wahlkreise und Einzelstaaten, sekundär als Repräsentanten partikularer Interessen und bestenfalls tertiär achten sie auf nationales Interesse und Parteilinie. Das politische Patt, das in den letzten drei Jahren der Clinton-Präsidentschaft das Verhältnis zwischen Weißem Haus und Kapitol bestimmte, ist durch die Wahlen nicht aufgehoben worden. Auch ein Präsident Bush muss sich im republikanisch "beherrschten" Kongress mühsam und von Gesetzesvorlage zu Gesetzesvorlage seine Mehrheiten suchen, Abstimmungskoalitionen schmieden – und gleichwohl könnte sich der Politikstillstand der letzten drei Clintonjahre fortsetzen. 3. Ergebnisse Wir haben uns zwei Stereotype näher angesehen, die wir im Zusammenhang mit Wahlen und Wahlkämpfen in Deutschland unter das Schlagwort von der "Amerikanisierung" fassen. Es wurde gefragt, ob diese durch die amerikanischen Präsidentenwahlen bestätigt oder widerlegt werden. Es ging um die Vermutungen, dass Wahlkämpfe immer mehr personalisiert werden und dass die Volatilität der Wählerschaft zunimmt. Andere Klischees, die bei uns als Beispiel von "Amerikanisierung" gelten, könnten getestet werden. Etwa die Vorstellung, dass die Medien, allen voran das Fernsehen, in den USA hoch professionalisiert glänzend informieren, nicht zuletzt deswegen, weil sie um Einschaltquoten gegeneinander konkurrieren. Das genaue Gegenteil zeigte sich in der Wahlnacht, Berichterstattung und Analyse verliefen nachgerade stümperhaft. Nicht nur dass die verschiedenen Stationen den Staat Florida mal Gore und mal Bush zusprachen, bis schließlich klar wurde, dass das Kopf-an-Kopf-Rennen nicht zu entscheiden war. Schlimmer: Es gab keine Konkurrenz zwischen Umfrageinstituten und Fernsehsendern, sondern alle hingen von dem Monopolisten Voter News Service ab. In Deutschland konkurrieren die beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten am Wahlabend auch mit verschiedenen Meinungsforschungsinstituten gegeneinander, infratest dimap für die ARD, Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF. Weiter: Als schließlich das Patt in Florida klar wurde, waren die Fernsehsender nicht in der Lage, detailliert aus der Region über das Wahlrecht dieses Bundesstaates, das für die Endauszählung galt, zu berichten, z.B. von welcher Marge an Stimmauszählungen wiederholt werden mussten. 16 Oder ein anderes Klischee: Die Vereinigten Staaten seien ein urdemokratisches Land, politische Karrieren ständen allen offen, die politische Klasse schotte sich nicht ab, erst recht existierten keine politischen Dynastien. Auch hier sieht die Realität anders aus. Bekanntlich ist George W. Bush nicht nur Sohn eines Präsidenten, Enkel eines Senators, auch Al Gore entstammt einer Politikerfamilie. Politik stellte sich am 7. November 2000 in den USA nicht zum ersten Mal dynastisch dar. Und der glücklich Erkorene brachte viele Vasallen seines Vaters mit an den Hof des Weißen Hauses: Cheney Powell, Rice: "Die USA sind alt geworden, alt wie unser Kontinent, der alte", 17 kommentierte der Tagesspiegel treffend. Ziehen wir die Schlussfolgerung: Jene Stereotype, Klischees und Vorstellungen, die bei uns im Zusammenhang mit Wahlen und Wahlkämpfen unter dem Etikett "Amerikanisierung" subsumiert werden, bedürfen der Überprüfung, ja ätzender Kritik, um ihren empirischen Gehalt festzustellen. Angewendet auf die amerikanischen Wahlen vom November 2000 ha lten sie der politischen Wirklichkeit nicht stand. So dramatisch die Präsidentenwahlen und das 16 Hierzu auch Isaacs, Maxine: The Real Story of Election 2000, in: Update. Kennedy School of Government, Harvard University 2000, S.3. 17 von Rimscha, Robert: Land ohne Helden, in: Tagesspiegel vom 21.10.2000. 126 Auszählen des Wahlergebnisses auch abliefen, wir sollten uns von dieser bunten, hektischen, nervösen Oberfläche nicht täuschen lassen. Auch wenn unsere Medien nicht müde wurden zu betonen, im Kampf um die Wechselwähler sei die Auseinandersetzung zwischen George W. Bush und Al Gore – typisch amerikanisch – personalisiert und emotionalisiert worden, so sagt dies mehr über unsere Klischees von der "Amerikanisierung" als über die politische Realität in den Vereinigten Staaten aus. In Wirklichkeit standen sich in den USA zwei politische Konzepte, zwei klar voneinander abgegrenzte Parteien, zwei sozial deutlich unterscheidbare Wählerkoalitionen gegenüber – und sie haben das Land in zwei gleich große Hälften geteilt. Politische Inhalte haben im Wahlkampf und bei der Wahlentscheidung eine ganz zentrale, auf jeden Fall größere Rolle als die Persönlichkeit der Kandidaten gespielt. Und die Wähler wechseln nicht so hektisch und so oft zwischen Parteien und Kandidaten hin und her, wie es das Schlagwort von der Volatilität suggeriert. Wahlverhalten ist selbst in den Vereinigten Staaten von Kontinuität und Stabilität bestimmt. Es kommt auf die Stammwähler und deren Mobilisierung an. Vielleicht ist es an der Zeit, bei uns nicht mehr von "Amerikanisierung" zu reden. Vielmehr wäre zu überlegen, ob es angesichts der amerikanischen Wahlen vom Herbst 2000 und der Entwicklung der amerikanischen Parteien im letzten Jahrzehnt nicht angebracht ist, nach der "Europäisierung" der Vereinigten Staaten zu fragen. 18 18 Übrigens sind in der Bundesrepublik die Lektionen aus dieser Entwicklung, die natürlich auch bei uns stattfindet, bereits gezogen worden. Trotz allen Geredes vom Medienkanzler, von der Neuen Mitte usw. zeigt der Vorwahlkampf, der im Winter 2000/2001 für die Bundestagswahl im Herbst 2002 begonnen hat, dass es zunächst und primär um die Mobilisierung der Stammwähler geht. Die Stichworte in diesem Zusammenhang lauten: Betriebsverfassungsgesetz, Erhöhung des Kindergeldes, Zuwanderungsgesetz, Leitkultur, Patriotismus. 127 Autorenverzeichnis Adomeit, Hannes, Dr. Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin Bierling, Stephan G., Prof. Dr. Institut für Politikwissenschaft, Universität Regensburg Campbell, Edwina S., Prof. Dr. National Defense University, Washington DC Jacobson, Gary C., Prof. Dr. Department of Political Science, University of California, San Diego Lösche, Peter, Prof. Dr. Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Universität Göttingen Meier-Walser, Reinhard C., Dr. Leiter der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, München Neuss, Beate, Prof. Dr. Philosophische Fakultät – Politikwissenschaft, Technische Universität Chemnitz Rosen, Howard, Dr. Democratic Staff Director (bis Januar 2001), Institute for International Economics, Washington DC Rühl, Lothar, Prof. Dr. Staatssekretär a.D., Köln 128 Verantwortlich: Dr. Reinhard C. Meier-Walser Leiter der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, München Herausgeber: Dr. Reinhard C. Meier-Walser Leiter der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, München Prof. Dr. Stephan G. Bierling Institut für Politikwissenschaft, Universität Regensburg 129 "Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen" bisher erschienen: Nr. 1 Berufsvorbereitende Programme für Studierende an deutschen Universitäten (vergriffen) Nr. 2 Zukunft sichern: Teilhabegesellschaft durch Vermögensbildung Nr. 3 Start in die Zukunft – Das Future-Board (vergriffen) Nr. 4 Die Bundeswehr – Grundlagen, Rollen, Aufgaben (vergriffen) Nr. 5 "Stille Allianz"? Die deutsch-britischen Beziehungen im neuen Europa (vergriffen) Nr. 6 Neue Herausforderungen für die Sicherheit Europas (vergriffen) Nr. 7 Aspekte der Erweiterung und Vertiefung der Europäischen (vergriffen) Nr. 8 Möglichkeiten und Wege der Zusammenarbeit der Museen in Mittelund Osteuropa Nr. 9 Sicherheit in Zentral- und Südasien – Determinanten eines Krisenhe rdes Nr. 10 Die gestaltende Rolle der Frau im 21. Jahrhundert (vergriffen) Nr. 11 Griechenland: Politik und Perspektiven Nr. 12 Russland und der Westen (vergriffen) Nr. 13 Die neue Familie: Familienleitbilder – Familienrealitäten (vergriffen) Nr. 14 Kommunistische und postkommunistische Parteien in Osteuropa Ausgewählte Fallstudien (vergriffen) Nr. 15 Doppelqualifikation: Berufsausbildung und Studienberechtigung Leistungsfähige in der beruflichen Erstausbildung Nr. 16 Qualitätssteigerung im Bildungswesen: Innere Schulreform – Auftrag für Schulleitungen und Kollegien (vergriffen) Nr. 17 Die Beziehungen der Volksrepublik China zu Westeuropa – Bilanz und Ausblick am Beginn des 21. Jahrhunderts Nr. 18 Auf der ewigen Suche nach dem Frieden – Neue und alte Bedingungen für die Friedenssicherung (vergriffen) Union 130 Nr. 19 Die islamischen Staaten und ihr Verhältnis zur westlichen Welt – Ausgewählte Aspekte (vergriffen) Nr. 20 Die PDS: Zustand und Entwicklungsperspektiven Nr. 21 Deutschland und Frankreich: Gemeinsame Zukunftsfragen Nr. 22 Bessere Justiz durch dreigliedrigen Justizaufbau? Nr. 23 Konservative Parteien in der Opposition – Ausgewählte Fallbeispiele Nr. 24 Gesellschaftliche Herausforderungen aus westlicher und östlicher Perspektive – Ein deutsch-koreanischer Dialog Nr. 25 Chinas Rolle in der Weltpolitik Nr. 26 Lernmodelle der Zukunft am Beispiel der Medizin Nr. 27 Grundrechte – Grundpflichten: eine untrennbare Verbindung Nr. 28 Gegen Völkermord und Vertreibung – Die Überwindung des zwanzigsten Jahrhunderts Nr. 29 Spanien und Europa Nr. 30 Elternverantwortung und Generationenethik in einer freiheitlichen Gesellschaft Nr. 31 Die Clinton-Präsidentschaft – ein Rückblick in Vorbereitung: Alte und neue Deutsche? Staatsangehörigkeits- und Integrationspolitik auf dem Prüfstand Perspektiven zur Regelung des Internetversandhandels von Arzneimitteln