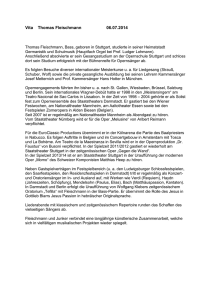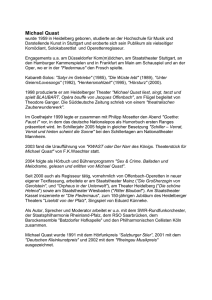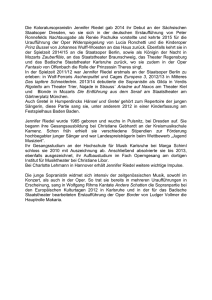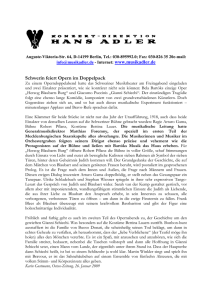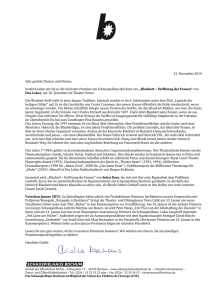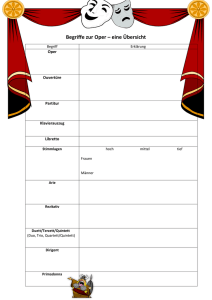Augen.Blicke / Herzog Blaubarts Burg
Werbung

Augen.Blicke Musikalische Leitung Michael Nündel Bühne Christoph Ernst Video Vincent Stefan Dramaturgie Katharina Ortmann .onion von Sivan Cohen Elias Für Sänger, Instrumentalensemble, Video und Elektronik (2016) Text: Reynard Hulme, Sivan Cohen Elias Inszenierung Sebastian Gühne Kostüme Christoph Ernst Mit: Mark Adler, Katja Stuber, Steffen Ahrens, Josef Müksch, Michael Veit, Marius Fink, Klaus Wilms, Ralph Müller Staatsorchester Darmstadt (On) The Other Side of The Skin. Lullaby von Marta Gentilucci Für Soli, Chor, Orchester und Elektronik Inszenierung Susanne Gauchel Kostüme Hanna Santelmann Mit: Aki Hashimoto, Katja Stuber, Agata Siebert, Jana Baumeister, Ariane Ganser, Anja Bildstein, Amira Elmadfa, Minseok Kim, Khvicha Khozrevanidze, Myong-Yong Eom, Nicolas Legoux Staatsorchester Darmstadt Premiere am 25. September 2016, 18.00 Uhr Staatstheater Darmstadt, Großes Haus Uraufführung: 30. Juli 2016, Staatstheater Darmstadt Aufführungsdauer: Augen.Blicke: 1 Stunde eine Pause, Herzog Blaubarts Burg: 1 Stunde Mark Adler, Katja Stuber, .onion Aki Hashimoto, (On) The Other Side of The Skin SIVAN COHEN ELIAS 4 5 Was ist Ihr Interesse an Musiktheater? .onion Der Hauptunterschied zwischen Musik und Musiktheater besteht in der Menge und Vielfalt gemeinschaftlichen Inputs. Es bietet Gelegenheiten, um Ideen durch Dialoge zu erproben und zu erweitern, was oft neue, unerwartete Möglichkeiten mit sich bringt. Die Art, in der verschiedene Künstler spontan auf unterschiedliche Weise auf Objekte, Aufgaben und ihren eigenen Körper reagieren, ist ebenfalls eine ergiebige Materialquelle. Meine Arbeit erforscht die Grenzen und Möglichkeiten, verschiedene Kunstformen in ein einheitliches Medium zu integrieren, was bedeutet, dass ich jede meiner Kompositionen so behandle, als wäre sie eine Theaterszene. Klang-, Körper-, Licht-, Kostüm- und Objektbewegungen werden in jede Komposition hineingewoben, wodurch ein Ganzes geschaffen wird, das aus vielen zusammenwirkenden (und oft mehrdeutigen) Teilen besteht. Die Restgeräusche der choreographierten Objekte/Künstler und die Choreographie der Klangerzeugung; ihre Beiträge zum und ihre Störungen des jeweils anderen Bereichs; die Bewegung des Künstlers und die Bewegung des Klangs – sie alle können als ursächlich Mitwirkende zur Geltung kommen. Es ist daher keine Überraschung, dass ich begeistert bin vom interdisziplinären Charakter des Musiktheaters und seiner steten Ausweitung auf neue Spielstätten, Teilnehmer, Themen und Techniken. Ich sehe es durch die mutige Aufnahme verschiedener expressiver und theatralischer Elemente gedeihen. Der faszinierendsten Themen und Inhalte entstehen für mich aus der Beobachtung der Zwischenräume, die sich in Klangstrukturen finden und die in der Gesellschaft insgesamt vorkommen; Orte, an denen Mehrdeutigkeiten kurz zum Vorschein kommen, Identitäten kommen und gehen und widersprüchliche Impulse – Aufführung, Spiel, Aufgabe, Absurdität – gleichzeitig agieren. In diesem Sinne versuche ich, sowohl in der Klangwelt als auch konzeptionell, ohne jegliche Kausalität zu komponieren. Das Informationszeitalter hat eine starke Zunahme an Stimmen und Verbreitungsmitteln erlebt. Wir unterliegen Vermittlern, jeder mit seinen eigenen Verwicklungen und Interessen; eine hochgradig hybride, sich ständig erneuernde Welt der Assoziationen. Das Deep Web ist das totale Reich der Interessen und Geheimnisse. Es ist im Wesentlichen durch Anonymität und Unsicherheit gekennzeichnet. Man weiß weder, wer sich am anderen Ende befindet – noch kann man herausfinden, ob irgendetwas von dem Angebotenen echt ist. Es ist ein Ort außer Kraft gesetzter Identitäten, an dem Kriminelle, Aktivisten und Gesetzeshüter die Erscheinungsbilder tauschen. Diese Mini-Oper schleudert den Zuschauer hin und her in unbestimmter Zeit, während er über fehlende Teile schwebt, und sich fortwährend inmitten der (gemeinsamen) Handlung befindet. Gleichzeitig schwankt der Protagonist zunehmend zwischen seinem Zuschauen und virtueller Assimilation, während seine Anonymität nachlässt. Ensemble .onion M A R TA G E N T I LU C C I 8 9 Was ist Ihr Interesse an Musiktheater? (On) The Other Side of The Skin Klang und Musik sind für mich vor allem eine körperliche Erfahrung. Das Musiktheater kann die Brücke schlagen zwischen der individuellen körperlichen Klangerfahrung und dem intellektuellen Akt, Musik zu komponieren oder wahrzunehmen, einschließlich dem Sinn der Betrachtung. Die Kombination von Musik und dem Geschehen auf der Bühne, auch im gesamten Theater, verstärkt die Möglichkeit, sich innerhalb des Klangs und seiner Dramaturgie zu befinden. Meine musikalische Ausbildung als Sopran, die Verbindung mit der Stimme und die Leidenschaft für Gesang sind der Ursprung meines Interesses am Musiktheater. Die Möglichkeit, jedes Mal die Beziehungen zwischen Vokalklängen, Instrumenten und den Konzertsaalräumlichkeiten zu erkunden oder neu zu erfinden, regen meine musikalische Vorstellungskraft an: Die Klangbahnen, die ich mir ausmale, rufen die theatralische Gestaltung hervor und bestimmen die Handlung auf der Bühne. Das Stück ist Teil eines größeren Projekts, das die Komposition einer Reihe von musikalischen Werken für Frauenstimmen zusammenfasst. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Erkundung der zahlreichen Facetten des weiblichen Universums, seine Bewegungen, Veränderungen, Eigenarten und Möglichkeiten. Es geht nicht um ein Geschlecht oder eine psychologische Studie oder darum, eine bestimmte politische Haltung im eigentlichen Sinne zu unterstützen. Vielmehr möchte ich das Augenmerk auf die Erfahrung der Welt legen, wie sie durch den weiblichen Körper, der auch der meine ist, „gesehen“ und wahrgenommen wird. Ich möchte mich mit dem inneren Klanguniversum des Körpers befassen, das unterschiedliche verbalisierte Formen annehmen und verschiedene Richtungen einschlagen kann. Die Haut ist die Membran, welche die Interaktion mit der Welt ermöglicht: Was befindet sich unter der Haut? Die (Wieder-) Entdeckung der Körperlichkeit des Klangs hat viele Deklinationen, viele Facetten: Er kann in ein Schlaflied, einen Trauergesang, den Geburtsschrei oder nur ein inneres Gebrabbel übergehen. Dieser Klangkorpus entsteht aus den weiblichen Körpern und ihren „Geschichten“. Die Resonanz der Worte, ihre Verbindungen und Projektionen gegenüber dem Musikmaterial sind für meine Vokalkompositionen schon immer von zentraler Bedeutung gewesen: Meine Projekte hatten meist einen poetischen Text als tragende Säule der Klangfülle, Farbe und Struktur. Bei dieser neuen Serie von Arbeiten beginnen die inneren Schwingungen nicht mit Worten, sondern mit den akustischen Geschichten der weiblichen Körper. Agata Sibert, Aki Hashimoto, (On) The Other Side of The Skin 12 Wir brauchen die avanciertesten Ideen Der Dirigent Johannes Harneit im Gespräch mit Dramaturgin Katharina Ortmann Katharina Ortmann (KO): Das Staatstheater Darmstadt realisiert mit dem Wettbewerb ein außergewöhnliches Projekt: fünf kurze Musiktheater-Uraufführungen an einem Abend. Fünf KomponistInnen haben ein dreiviertel Jahr für und mit dem Staatstheater gearbeitet. Was sind für Sie als musikalischen Leiter des Wettbewerbs die größten und spannendsten Herausforderungen? Johannes Harneit (JH): Die Einzigartigkeit und Verschiedenheit einer jeden Komposition deutlich herauszubringen. KO: Die fünf Stücke oder Szenen, die entstehen, sind extrem verschieden was die Arbeitsweise sowohl innerhalb des Kompositionsprozesses als auch innerhalb der Probenarbeit anbelangt. Anliegen des Wettbewerbs ist auch, auf die Projekte szenisch zu reagieren durch Vorschläge der Regisseure. Oftmals ist viel Dialog notwendig, der hin und wieder anstrengend, aber genauso oft sehr produktiv ist: sowohl für die KomponistInnen, die hier eben nicht für Spezialensembles sondern für ein Opernensemble schreiben und kaum Erfahrung mit den deutschen Staatstheaterstrukturen haben, als auch für die SängerInnen und OrchestermusikerInnen. Das zeitgenössische Musiktheater ist wieder attraktiv geworden für junge KomponistInnen. Betrifft das auch die Staatstheater als Auftraggeber? Oder entsteht dieses Interesse allein aus der Lust an der künstlerischen Interdisziplinarität, die Musiktheater als Genre ausmacht? JH: Wir tun hier einen ganz entscheidenden Schritt und ich freue mich sehr, dass ich das mit initiieren darf. Für mein Empfinden gehört dies längst wieder zusammen: die Staatstheater und die neuen Komponisten – und wir brauchen die avanciertesten Ideen, damit die Staatstheater 13 lebendig bleiben. Ich sehe dieses Projekt als einen positiven Input. Das Erstaunliche ist, dass an vielen Häusern sehr viel moderner gedacht wird, als man von außen annimmt. Wenn man eine ästhetisch konservative Oper sieht, gibt es oft die Annahme, das ganze Haus sei ästhetisch konservativ. Tatsächlich ist Theater eine große Maschinerie, die ständig neue Mittel einfordert – von sich selbst, aber auch von den AutorInnen. Ich habe beim Wettbewerb sehr schöne Erfahrungen gemacht mit den im Arbeitsprozess anwesenden KomponistInnen, die alle diesen Veränderungsprozess positiv begleitet haben: Sie sehen, dass das Theater selbst auch Veränderungen einfordert. Bei den MusikerInnen kann ich zudem sagen, dass die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, in Darmstadt besonders hoch ist. Gerade auch die SängerInnen gestalten die Werke kreativ mit. Ich würde mir wünschen, dass man ein derartiges Projekt regelmäßig hier durchführt. Es ist schön zu beobachten, dass die siebzig Jahre Darmstädter Denken vor Ort wieder in die Strukturen eingreifen. Es ist eine Chance, das Theater zu verändern durch die Denkweise der Ferienkurse – was mir sehr gefällt, da ich selber aus der Komposition komme. Für mich war Darmstadt vor dreißig Jahren aufgrund der Ferienkurse ein Begriff – dass es dort ein Theater gibt, wusste ich nicht. Heute sehe ich es auch umgekehrt: Das Theater bietet eine Möglichkeit, dass sich die Ferienkurse verändern. Deutlich gesagt: Nach meiner Meinung als Theaterschaffender sind über die dreißig Jahre viele theatrale Ereignisse in der neuen Musik kümmerlich und längst nicht auf dem Niveau, auf dem in den Theatern gedacht wird. Dass das hier zusammenkommt in produktiver Auseinandersetzung ist wunderbar: Es gibt im Wettbewerb KomponistInnen, die jetzt noch Dinge ändern, weil sie merken, was auf der Theaterbühne funktioniert – und mitnichten dabei vereinfachen, sondern noch mehr unter ihre Vision bringen. Für mich als Komponisten ist das der ganz normale Blutkreislauf. Das Staatsorchester Darmstadt hat schon zu Beginn der Institution Ferienkursen dort mitgewirkt – und das Interesse dafür ist bei vielen OrchestermusikerInnen wieder sehr groß. BIOGRAFIEN 14 Sivan Cohen Elias Geboren 1976 in Jerusalem. Sivan Cohen Elias ist Komponistin und Performerin. In ihrer Arbeit untersucht sie Grenzen und Möglichkeiten, unterschiedliche Kunstformen innerhalb eines Werkes zu verbinden. Sie beschäftigt sich zudem fortwährend mit Bildhauerei, Choreographie und Technik. Ihre Arbeit als Komponistin ist stark von partizipatorischer Forschung beeinflusst. Cohen Elias’ Arbeiten wurde von Ensembles in Europa, Israel und den Vereinigten Staaten aufgeführt und in Auftrag gegeben, u.a. vom Klangforum Wien, der MusikFabrik, dem Ensemble Mosaik, dem Ensemble Dal Niente und auf Festivals wie den Internationale Ferienkursen für Neue Musik Darmstadt, Wien Modern, den Wittener Tagen für neue Kammermusik, Ultraschall und dem Warschauer Herbst. 2012 war sie Stipendiatin der Akademie Schloss Solitude, Stuttgart. 2007 bis 2009 absolvierte sie ein zweijähriges Postgraduierten-Programm an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Derzeit ist Cohen Elias PhD-Kandidatin und Teaching Fellow an der Harvard University bei Prof. Chaya Czernowin und Prof. Hans Tutchku. 15 Marta Gentilucci studierte Gesang (Sopran) am Konservatorium in Perugia, wo sie zudem ihren Master in Englischer und Deutscher Literatur absolvierte. Sie studierte Komposition am Konservatorium in Florenz und an der Musikhochschule Stuttgart sowie Elektronische Musik in Stuttgart und am IRCAM. Derzeit beendet sie ihren PhD in Komposition an der Harvard University. Marta Gentilucci war Stipendiatin des Experimentalstudios des SWR Freiburg und des Elektronischen Studios der Akademie der Künste Berlin. Ihre elektro-nischen Kompositionen wurden auf dem SICMF (Seoul), dem nycemf 2013 und 2015 (New York) sowie bei mehreren Ausgaben der International Computer Music Conference gespielt. Aufführungen ihrer Werke erfolgten in Italien, Frankreich, Griechenland, Deutschland, Korea, Japan, USA und Großbritannien durch Ensembles wie u.a. Orchestra Nazionale RAI, Ensemble Surplus, Ensemble Ascolta, Ensemble Intercontemporain, Les Cris de Paris, Chiara Quartet, Hand Werk, Nikel und Dal Niente. 2014 erhielt Marta Gentilucci für ihr Streichquarett Proof Resilience eine Honorary Mention bei der Vergabe des Mivos/Kanter Prize. 16 Studienleitung Joachim Enders Musikalische Einstudierung Bartholomew Berzonsky, Irina Skhirtladze, Jason Tran Regieassistenz Sebastian Gühne Kostümassistenz Joanna Paszkiewicz Inspizienz Bernd Kaiser Maestro suggeritore Giacomo Marignani Anfertigung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten des Staatstheaters Darmstadt. Technischer Direktor Bernd Klein Bühneninspektor Uwe Czettl Leiter der Werkstätten Gunnar Pröhl Technische Assistenz Konstruktion Sonja Thorner- Vela Assistenz des Technischen Direktors Jonathan Pickers Leiterin der Kostümabteilung Gabriele Vargas-Vallejo Leiter des Beleuchtungswesens Dieter Göckel Leiter der Tontechnik Alfred Benz Chefmaskenbildernin Tilla Weiss Leiter des Malsaals Armin Reich Kaschierwerkstatt Lin Hillmer Leiter der Schreinerei Matthias Holz Leiter der Schlosserei Jürgen Neumann Leiter der Polster- und Tapezierwerkstatt Roland Haselwanger Leiterin der Requisitenabteilung Ruth Spemann Damengewandmeisterei Lucia Stadelmann, Roma Zöller Herrengewandmeisterei Brigitte Helmes Schumacherei Anna Meirer Bühnenmeister Marko Hechler Ton Karl Kraus, Joachim Becker Videotechnik Maren Junker, Johannes Kulz Maske Thomas Mattstädt, Denise Opheim Requisite Friderike Stallknecht, Claudia Bohl Textnachweise: Die Texte zu Augen.Blicke wurden aus dem Programmheft Internationaler Musiktheaterwettbewerb Darmstadt von Katharina Ortmann übernommen. | Das Zitat auf der Umschlaginnenseite stammt aus Jean-Paul Sartre: Geschlossene Gesellschaft, Reinbeck bei Hamburg, 1986. Alle weiteren Texte zu Herzog Blaubarts Burg sind Originalbeiträge. IMPRESSUM Spielzeit 2016 | 17, Programmheft Nr. 2 | Herausgeber: Staatstheater Darmstadt Georg-Büchner-Platz 1, 64283 Darmstadt, Telefon 06 15 1 . 28 11-1 www.staatstheater-darmstadt.de | Intendant: Karsten Wiegand Geschäftsführender Direktor: Jürgen Pelz | Redaktion: Sarah Grahneis Fotos: Vincent Stefan | Hauptprobe Augen.Blicke 25.7. 2016 und Klavierhauptprobe Blaubart 16.9.2016 Gestalterisches Konzept: sweetwater | holst, Darmstadt Ausführung: Hélène Beck | Hersteller: Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden 12 können sich kaum mehr vorstellen, dass Oper rein geschichtlich etwas sehr Abstraktes und Artifizielles ist. Momentan ist das die Krux: Wir merken, dass es mit der Psychologie und dem Singen immer hakt, weil Singen ein technischer Vorgang ist, kein psychologischer. Wenn ein Sänger seine Technik wahnsinnig gut beherrscht und risikobereit ist, kommt automatisch Persönlichkeit in die Sache. Und da wir, wie schon gesagt, psychologische Wesen sind, entsteht Nachvollziehbarkeit und Nicht-Beliebigkeit. Weil wir es in aller Regel nicht mit Ausnahmekünstlern wie der Callas zutun haben, die das von sich aus erledigen, müssen wir meistens so viel proben und ausprobieren, uns quasi zur Ausnahme-Qualifikation überlisten. Ein weiteres Problem ist, dass die wirklich kreativen, innovativen und querdenkenden Köpfe in der Gesellschaft nicht mehr auf die Idee kommen, sich für die Oper zu engagieren, weil diese – wie schon Strawinsky sagte – im Laufe der Institutionalisierung in die Hand von Hausmeistern geraten ist. Die Oper ist zu einer sehr abgehangenen, selbstreferentiellen Kunstübung verkommen. Inzwischen gibt es auch andere Orte – Internet, Kino, Fernsehen, zu denen sich solche Leute hingezogen fühlen, weil man dort irrere Sachen machen kann. Die kreativen Energien, die heute in Videospiele gesteckt werden, flossen früher in die Oper. Und was diese Spiele heute können … Früher gab es vielleicht vier Türen und du konntest nur eine aufmachen. Heute öffnen sich alle, du kannst durch die Welten gleiten. Da ist Oper einfach für die meisten nicht mehr interessant und somit steht auch viel weniger finanzielle Kraft als früher dahinter und du kannst so gut wie keine Tür mehr aufmachen – deswegen haben wir sie ja auch gleich weggelassen (lacht). SG: Eine gibt es ja schon … CE: Das ist aber nur eine Andienungstür und keine Bühnenbild-Ereignistür. SG: Spielen die Türen für dich überhaupt eine Rolle? CE: Ja, aber nur in mir selber. Ich bin meine Burg und muss entscheiden, welche Tür ich aufmache und welche ich verschlossen halte. Wir wollen hier herausfinden, wie viel Öffnung, wie viel Nähe und wie viel Verschlossenheit sich über die zwei Darsteller erzählen lässt. Das war unsere Frage: Wie viele Türen bin ich denn? 10 der Unterhaltungsebene passiert. Deshalb ist der Raum relativ übersichtlich – meine Bühnen sind in aller Regel übersichtlich. SG: Deine Fragestellung mutet aber zunächst psychologisch an. CE: Wir sind psychologische Wesen. Psychologie im Theater ist aber immer Verengung und hat nie die Komplexität von meinem eigenen Leben, weil man sich in einem künstlichen Raum bewegt und alles aufgrund von Verabredungen stattfindet. Das Leben ist improvisiert, im Theater ist nichts improvisiert – selbst wenn ich sage, dass wir jetzt nur über ein Thema oder eine Situation improvisieren, ist das schon eine Verabredung, wie es sie im Leben nicht gibt, weil es dafür ja erst mal keine zwingende Notwendigkeit gibt. Im besten Fall kommt das dann nah an die Komplexität von einem realen Dasein heran, aber weil ich mich ja in der Ausnahmesituation des auf-der-Bühne-Stehens befinde, mache ich mir als Performer ganz andere Gedanken: Ich stehe vor dem Publikum, habe eine Fragestellung, die nicht unbedingt meine ist … Die Darsteller werden in der Oper ja einfach besetzt, weil sie in das Stimmfach passen. Ob das Werk überhaupt ihre aktuellen Fragen ans Leben verhandelt, spielt keine Rolle. Damit sind wir in einer asymmetrischen Situation. Einerseits will man etwas Authentisches, Wahrhaftiges, Relevantes haben, andererseits hat man sich als Produktionsteam bisher nur darauf geeinigt, dass man gerne Theater spielen möchte und da hat im Zweifelsfall jeder seine persönlich eigene Vorstellung. Die Sehnsucht der freien Szene ist ja, dass sich nur diejenigen zusammentun, die die gleichen Fragen haben. Das wiederum kann dazu führen, dass man sich zu schnell einig ist. Im Umkehrschluss würde es bedeuten, dass ein Zusammenkommen von verschiedenen Leuten zu Widersprüchen führen kann, die nicht zwangsläufig unproduktiv sind, solange man sich und sein Gegenüber respektiert und als ernstzunehmendes Mitglied der Veranstaltung ansieht. Wenn man kritischere Fragen stellt oder eine gewagtere Ästhetik hat, kann es jedoch dazu kommen, dass die Etablierten des Betriebs einem vorwerfen, dass man alles zerstören und sich wichtig machen will … SG: Worauf verweist dein Raum für Blaubart mit all seinen Implikationen? 11 CE: Er ist rein assoziativ entstanden und zitiert instellative Raumstrategien zeitgenössischer Kunst. Das finde ich fürs Theater zunehmend interessant und produktiv, weil z. B. in diesem Fall ein Tisch und ein Stuhl nicht Tisch und Stuhl in einer realistischen, naturalistischen Situation wie Küche, Büro oder Hotellobby sind, sondern Alltagsgegenstände, die in einen nicht-alltagsgebräuchlichen Zusammenhang gestellt werden. Für mich wird es interessant, wenn Dinge nicht abbildhaft, sondern sinnbildhaft vorgenommen werden. Das nötige Assoziationsvermögen traue ich jedem Einzelnen zu. Würde man Aida in die afrikanische Militärdiktatur von heute setzen, unterstellt man dem Publikum, dass es zu blöd ist, um grundsätzliche Strukturen aus dem Werk auf ihren heutigen Gehalt zu übertragen. Da nehme ich mein Publikum schon ernst und sage, diese intellektuelle Leistung kann ich selber vollziehen, dann dürfte es für andere auch nicht so schwierig sein. Meine Raumbehauptung geht diametral in die entgegengesetzte Richtung. Als Anmutung hat er nichts, was ein klar lesbares Bild transportiert. Die äußere Eingrenzung zitiert einen Funktionsraum, den die Darsteller auch nur als das begreifen, was er ist: Ein Raum, in dem sie etwas verhandeln und kein Raum, der in irgendeiner Weise Privatheit oder sonst irgendeine konkrete Verortung bedeutet. Es ist ein öffentlicher Raum. SG: All die Dinge, die dem Raum, der Burg, in Text und Partitur zugeschrieben werden, finden in so einem Kunstraum allerdings nicht statt und in ihm verhält man sich auch anders, als wir es klassischerweise von der Oper erwarten. Dort finden eher Performances statt. Wie wirkt das zusammen? CE: Die Oper war schon immer eine Art Performance, die erst durch das Regietheater zunehmend psychologisch fixiert wurde. Es war auch notwendig, hohle Operngesten auszurümpeln und ein anderes System zu etablieren, im Leben ist nichts statisch. Dadurch hat man einen anderen Blick erhalten und in der Oper ein anderes Hörerlebnis. Inzwischen ist das aber die konventionelle Form der Oper geworden und jüngere Sänger 8 Wie viele Türen bin ich? Dramaturgin Sarah Grahneis im Gespräch mit Bühnen- und Kostümbildner Christoph Ernst Sarah Grahneis (SG): Wie gehst du grundsätzlich an eine Bühnenbild- Konzeption heran? Christoph Ernst (CE): Ich fange nie direkt beim Stück an, sondern frage mich immer, warum mache ich eigentlich Theater. Warum der ganze Aufwand? Meiner Meinung nach sollte man sich das öfter fragen. SG: Wie viele Produktionen machst du im Jahr, also wie oft fragst du dich das? CE: In den letzten Jahren gerne bis zu 12 mal, aktuell ungefähr 8. Das ist auch noch oft, aber die Frage ist eine interessante. Denn wenn Theater in meinem Sinne gut ist, hat es immer was mit dem Leben zu tun. Insofern ist es ein privilegierter Beruf: Man wird dafür bezahlt, übers Leben nachzudenken. Dann kommt das konkrete Stück dazu, dadurch rücken bestimmte Fragen und Themen in den Mittelpunkt. Im Verlauf der Arbeit sollte man nicht der Versuchung erliegen, Antworten zu geben, sondern die Frage erhalten. Dass mich persönlich viele Produktionen letztlich nicht mehr erreichen, liegt daran, dass ich das Gefühl habe, die Leute stellen sich die falschen Fragen oder geben Antworten. Um einen Betrieb am Laufen zu halten, ist es vielleicht auch wichtig, dass man intern Fragen beantwortet, aber künstlerische Fragen müssen offen bleiben. Nur dann kann ich die Frage ans Publikum weiterreichen bzw. das Publikum auffordern, mit mir in einen Gedankenraum zu kommen. Wenn ich den Zuschauern Antworten gebe, können diese nur sagen „find ich gut / find ich nicht gut“ – eine Facebook-Mentalität, die keine Qualität entwickelt. SG: Das heißt, du hast dir im Fall Blaubart zwei Fragen gestellt, die eine, warum du Theater machst. Wie lautet die andere? CE: Das Stück stellt die Frage: Wer bin ich? Komme ich aus meinem eigenen Komplex, meiner Befindlichkeit heraus und bin ich Herr über meine 9 „Burg“? Will ich Burgherr sein oder bin ich bereit, Kontrollverlust zuzulassen? Soll man, kann man sich öffnen? Und wenn ja oder nein, was ist daran gut oder schlecht und warum kann man es eben nicht. Bin ich mir selbst genug oder ist die Sehnsucht nach dem anderen einfach größer … SG: Wenn man für so etwas Beispiele sucht, kann es schnell banal werden, weil man bei Managern landet, die sich gerne sexuell unterwerfen oder beim Psychiater auf die Couch legen. CE: Genau, das wären Antworten, die wir nicht geben. Stattdessen probieren wir, gemeinsam mit den Darstellern herzustellen und auch auszuhalten, was der Prozess des Verschlossenseins und des Öffnens für Spannungen erzeugt, Verletzungen, Aggressionen, Sehnsüchte. Was das dann persönlich für den einzelnen Zuschauer bedeutet, ist der Teil der Aufführung, den jeder für sich selbst herausfinden muss. Da sehe ich derzeit ein großes Problem durch ein falsch verstandenes Regietheater, das Ende der 60er / Anfang der 70er aus einer wirklich notwendigen Neubefragung der RepertoireStücke entstanden ist, und nun dazu führt, dass lauter mittelmäßige Leute – ich nehme mich da explizit nicht aus – versucht sind, sich vor andere mittelmäßige Leute zu stellen und denen ständig ungefragt, fast schon zwanghaft, Antworten zu geben und die Welt zu erklären. Aber Theater ist nie gut, wenn es Antworten gibt. SG: Inwiefern unterstützt dein Raum diese Fragestellung? Theoretisch bräuchte man ja gar keinen Ort, um Fragen zu stellen. CE: Die Bühne muss zunächst nur Möglichkeitsraum sein, in dem viele Phantasien und unterschiedliche Ästhetiken ausprobiert werden können. Damit sich die Darsteller stellvertretend für uns alle darin ausagieren und diesen Fragen nachgehen können. Der Ort an sich ist eine leere Halle mit vielen technischen Möglichkeiten, im Idealfall aber ein Unort. Ich muss aber für die Fragestellung und dafür, wie ich ins Nachdenken komme, einen Raum schaffen, sodass dann dieser kollektive Prozess passieren kann. In diesem Fall ist es so, dass es mir wichtig war, einen Ort zu schaffen, durch den die Darsteller und alle, die in den Raum gucken, ein Gefühl kriegen, dass hier nichts Naturalistisches, Psychologisches oder rein auf 4 Bereits die ersten Klänge der Oper, eine volksliedähnliche pentatonische Melodie, die sich nicht auflöst, kein Ziel hat, geben schon den Hinweis, dass es hier keinen Ausweg und Überwinden der eigenen Einsamkeit gibt, sondern Ausgang und Schicksal beider Figuren längst entschiedenen sind. Damit korrespondieren auch die ersten Worte Blaubarts: „Wir sind am Ziele“ – ebenso in fünfstufiger Melodie notiert. Die Gestaltung von Blaubarts Gesangspartie verbleibt zunächst im gleichförmig rhythmisierten Balladentonfall, wohingegen Judith andere, lyrische und alsbald expressive Klänge beiträgt. Auch textlich scheint Blaubart erst einmal nichts mitzuteilen zu haben, äußert er sich doch vorwiegend fragmentarisch, indem er einzelne Worte aus Judiths vorausgegangener Feststellung nur stoisch wiederholt. Im Vergleich dazu ist Judith in ihrem Gestus beinah manisch in ihrer Mission, alle Türen zu öffnen. Als einzige und wenig plausible Begründung für ihre hartnäckigen Forderungen mit ostinato-Thema erhalten wir nur die Aussage, dass sie Blaubart liebe und die Burg heller machen möchte. Letzterer Grund erweist sich jedoch alsbald als hinfällig, wenn Blaubart ihr signalisiert, sie werde „nimmer heller“. Nahezu alles, was sich hinter den Türen verbirgt, erfahren wir durch ihre Augen – Blaubart gibt meist nur zögerlich die Schlüssel heraus und fragt direkt „Was siehst du?“. Was auch immer sie dabei entdeckt, projiziert sie sogleich auf Blaubarts Charakter und ihre Beziehung, ignoriert gar seine poetischen Komplimente. An keiner Tür verweilt sie, sofort will sie die nächste öffnen – weil sie ein Geheimnis oder eine ominöse Wahrheit vermutet? Zunehmend verstärkt sich der Eindruck, Judith handle aus egoistischen Gründen, auf der Suche nach etwas, das nur für sie relevant ist und nicht einer offenen Begegnung mit einem anderen Menschen entspricht. Die Burg wird zur Versinnbildlichung des eigenen Erlebens, der eigenen Wahrnehmung und Erwartung und gewinnt nur durch die Betrachtung und das sich-inBezug-Setzen Bedeutung. Diese musikalische Diskrepanz zwischen Blaubart und Judith führt im Verlauf der Handlung zu einer konstanten Spannung, noch unterstützt 5 durch das immer wiederkehrende Blut-Motiv, eine scharf dissonante kleine Sekunde, die den Schnitt zwischen beiden Figuren noch stärkt. Will man von einer Entwicklung sprechen, so findet diese zwar statt, aber nicht zueinander, sondern letztlich aneinander vorbei: Endlich erklingt Blaubart bei der fünften Tür im strahlenden Dur, ist es um Judiths leidenschaftliche Ausdrucksweise schon geschehen. Hier ist der dramatische Höhepunkt und gleichzeitig ein Wendepunkt erreicht; Judiths Reaktionen auf Blaubarts beinahe potente Angeberei könnte nicht unbeeindruckter sein: Das eben noch in voller Wucht erklingende und mit Orgel unterstützte Orchester hält inne, „Schön und groß sind deine Lande“ erklingt a cappella und syllabisch auf nahezu gleichbleibende Töne. Dem Blaubart vom Beginn ist sie nun näher, übernimmt gleichsam seine monotonen Antworten, er aber weiß längst (bereits vor der dritten Tür!), dass alles entschieden ist, ein Zusammenfinden in (musikalischer) Harmonie ausgeschlossen. Die dem Öffnen der fünften Tür folgende volksliedhaft-tänzerische Melodie mutet hier beinah humoristisch als Parodie auf Judiths vorausgegangene kurze Episode des Optimismus nach der ersten Tür an, die ähnlich in Text und Tanzrhythmus gestaltet ist. Diese Episode ist jedoch nur von kurzer Dauer, Judith findet kurz zu alter Kraft zurück und steuert unaufhaltsam auf die siebte und letzte Tür zu, deren Inhalt sie mittlerweile vermutet. Hinter ihr steckt aber kein „Skandal“, keine Mordtat, sondern ein Ort der subjektiven Erinnerung, in der sich Judith nun spiegelt und selbst erkennt. Schließlich endet Bartók mit einer Wiederkehr der ersten Takte, der Kreislauf ist vollendet, das Individuum in seiner Einsamkeit gefangen. „Nacht bleibt es nun ewig“ heißt es bei Balász / Bartók. Bei Samuel Beckett stünde die Einsicht, dass Judith und Blaubart die sind, „die sie seit jeher zu sein verdammt sind“. 3 Sarah Grahneis Im Spiegel der Burg Der Autor Béla Balázs war bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit den Komponisten Zoltán Kodály und Béla Bartók durch Ungarn gereist, um im Bereich der Volksmusik und Märchen zu forschen. 1910 griff er dann auf Motive der ungarischen Märchenräuberballade Anna Molnár und Charles Perraults Märchen La barbe bleu, welches 1812 auch in die Märchensammlungen der Brüder Grimm einging, zurück, um mit Herzog Blaubarts Burg ein neues Mysterienspiel zu schaffen. Die Figur des Blaubart selbst hat ein historisches Vorbild: den 1404 geborenen Grafen Gilles de Rais. Dieser hatte sich nach einer erfolgreichen Militärkarriere zu einem Serienmörder entwickelt: Er verschleppte unzählige Kinder, vor allem Jungen, in sein Schloss, wo er regelrechte Orgien abhielt und sie bestialisch ermordete. Dieser Blaubart wurde gern von verschiedenen Künstlern adaptiert. Unter anderem hatte der Symbolist Maurice Maeterlinck 1899 das Märchen bearbeitet und eine Fassung schließlich diente Paul Dukas als Vorlage für seine Oper Ariane et barbe-bleu, die 1907 in Anwesenheit von Balázs uraufgeführt wurde. Als dieser dann in Zoltán Kodálys Salon seine (wie er sein Stück nannte) ‚Bühnenballade’ vorlas, kam Béla Bartók die Idee zu einer psychologischen Programmmusik. Entstanden ist Bartóks einzige Oper, ein Werk voll existenzialistischsymbolistischer Kraft wie dramatischer Dichte. Im Gegensatz zu anderen Bearbeitungen ist dieser Blaubart jedoch kein Mörder, auch wird hier nicht explizit eine Beziehungsgeschichte erzählt – das intendiert bereits die Titelgebung: Nicht stehen hier die beiden Figuren, Judith und Herzog Blaubart, im Zentrum, sondern der Raum, die Burg als felsgewordener (Seelen-)Ort. Herzog Blaubarts Burg Béla Bartók Oper in einem Akt Libretto von Béla Balász Deutsche Fassung von Wilhelm Ziegler Revision von Karl Heinz Füssl und Helmut Wagner mit deutschen Übertiteln Musikalische Leitung Michael Nündel Inszenierung Isabel Ostermann Die Hölle, das sind die anderen. Jean-Paul Sartre Bühne und Kostüme Christoph Ernst Video Vincent Stefan Dramaturgie Sarah Grahneis Mit: Judith KS Katrin Gerstenberger Herzog Blaubart Krzysztof Szumanski Staatsorchester Darmstadt Premiere am 25. September 2016, 18.00 Uhr Staatstheater Darmstadt, Großes Haus Uraufführung: 24. Mai 1918, Königliches Opernhaus Budapest Aufführungsdauer: Augen.Blicke: 1 Stunde eine Pause, Herzog Blaubarts Burg: 1 Stunde DIE OPER staatstheater darmstadt