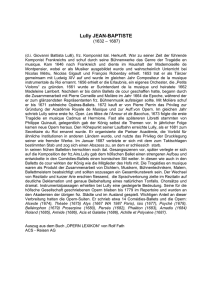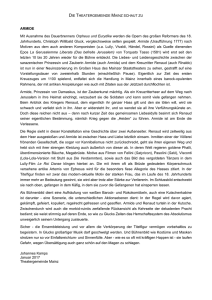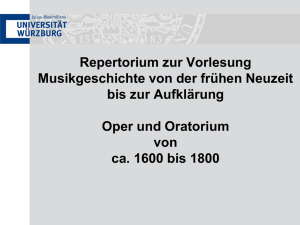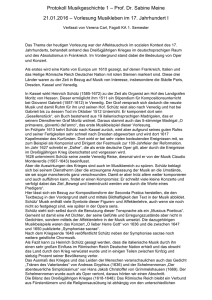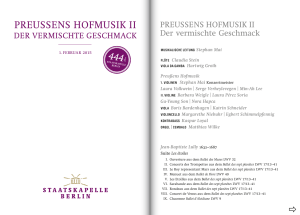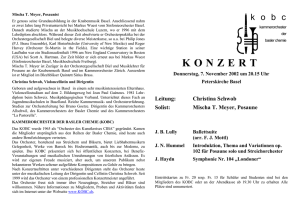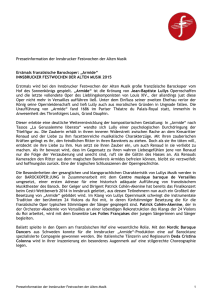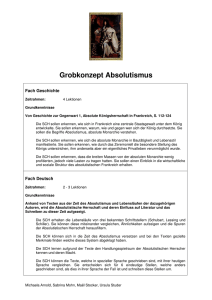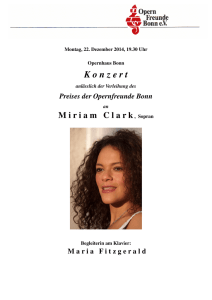christophe rousset
Werbung

C HR I S T O P HE R O U S S E T CHRISTOPHE ROUSSET Herr Rousset, Armide ist bereits Ihre sechste Gesamtaufnahme einer Oper von Jean-Baptiste Lully – nach Amadis, Bellérophon, Persée, Phaëton und Roland. Insgesamt 16 Opern hat Lully komponiert. Wollen Sie alle machen? Ich würde es tun. Aber wir haben keinen festen Plan, denn das wäre ja Selbstmord heutzutage. Ich werde im Sommer zunächst mit Alceste weitermachen. Der generelle Blick ist es, der mich interessiert. Lully hat ihn verdient, denn er war es, der die Form der Oper geschaffen hat, von der wir bis heute leben. ICH MAG KEINE EXZESSE Warum ist Lully dann so unbeliebt? Das frage ich mich auch. Und wissen Sie was: Genau das ist doch meine Chance! Lully gilt als pompös. Richtig – oder falsch? Nicht richtig. Ich würde es „Grandeur“ nennen. Lully ist aber auch voller Überraschungen. Bei ihm gibt es ein Moment der Exaltation – der festlichen Erregung und des musikalischen Fiebers. Doch dabei blieb er stets ein sehr politischer Komponist, der etwas über das Regime erzählt. Er betrieb Propaganda für seinen König und schrieb repräsentative Werke, in dessen Glanz sich der Monarch sonnen konnte. In Armide, seinem Meisterstück, kombiniert er alle seine Mittel. Er befindet sich auf der Höhe seines Könnens, allerdings nicht mehr auf der Höhe seiner Macht. Armide wurde 1686 außerhalb von Versailles uraufgeführt, nämlich in Paris. Lully war in Ungnade gefallen. Hat das seinen Stil beeinflusst? Überhaupt nicht. Das liegt daran, dass Lully hoffte, sich mit dem Werk gleichsam „zurückbewerben“ zu können. Er wollte etwas gutmachen, nachdem sein Privatleben für einen Skandal gesorgt hatte. CHRIS T OPHE ROUSSE T ist Experte auf dem Gebiet der französischen Barockmusik, vor allem die Werke seines Landsmannes Lully haben es ihm angetan. Im Interview spricht der Dirigent über seinen Lieblingskomponisten, die alten Herren der historischen Aufführungspraxis und über die Erotik der Macht. Sie spielen auf die Vorwürfe in Bezug auf Lullys Homosexualität an? Ganz genau. Vor allem für Madame de Maintenon, die heimliche Gemahlin des Königs, war Lully ein Dorn im Auge. Das Amüsement am Hof war insgesamt im Rückgang begriffen. Lully aber war der Skandal, der um seine Person entstanden war, nicht peinlich. Darin war er Pragmatiker. 46 Foto: Ignacio Barrios Von Kai Luehrs-Kaiser 47 CHRISTOPHE ROUSSET Foto: Ignacio Barrios Martinez C HR I S T O P HE R O U S S E T Französische Opern aus dieser Zeit weisen gewöhnlich auch einen sogenannten Haute-contre auf. Können Sie kurz erklären, was das ist? Der männliche Held, in diesem Fall Rinaldo bzw. Renaud, wurde zur Zeit Lullys grundsätzlich mit einem solchen Haute-contre besetzt. Es handelt sich um einen besonders hoch liegenden Tenor. Denn man mochte in Frankreich keine Kastraten. Ein richtiger Mann musste es sein! Der aber durfte einige Ambiguität ausstrahlen. Haute-contres sind heute nur noch schwer zu finden. In Deutschland hat man den wunderbaren Julian Prégardien. Mit Cyril Auvity und Emiliano Gonzalez Toro haben wir gleichfalls zwei exzellente Vertreter dieser Spezies im Boot. Man muss eine gewisse Autorität behaupten, sonst weiß das Orchester nicht mit dem umzugehen, was man ihm sagt. Ich habe eine Weile versucht, das zu unterlaufen, indem ich nach den Konzerten immer mit den Musikern essen gegangen bin. Davon habe ich schon lange Abstand genommen. Es klappt nicht. Dirigent kann man nur dann werden, sofern man sich nie langweilt, wenn man mit sich allein ist. Christophe Rousset Die Uraufführung im Palais Royal wird man sich als überaus festlich vorstellen. War sie es wirklich? Sie war zumindest weit größer als ich es mir heute leisten kann! Wir müssen bedenken: Versailles selbst verfügte damals über kein Theater. Man führte die Opern im Hof auf oder in der Grand Écurie, dem Marstall. In Paris dagegen waren die räumlichen Verhältnisse weit großzügiger. Lullys Ensemble war doppelt so groß wie meines. Wo bleibt denn da die historische Aufführungspraxis?! Wir spielen lauter. (lacht) Und wir haben, wie ich doch denken würde, die besseren Instrumente. Auf der Bühne sah man 50 Sänger und darüber hinaus 20 Tänzer – gigantische Verhältnisse. Man hatte Geld und wollte es zeigen. Was für eine Sorte Sopran verlangt die Titelrolle? Einen recht dramatischen. Armide ist ein sehr expressiver Charakter, stimmlich sehr fordernd. Sie ist fast ständig auf der Bühne, alles basiert auf ihr. Man braucht eine echte Performerin. Dafür habe ich hier erstmals mit der Sopranistin Marie-Adeline Henry gearbeitet, die das hervorragend macht. 48 Und was kommt danach? Schwer zu sagen, da sich Lully im Laufe der Zeit so stark verändert hat. Wenn Sie meine persönlichen Favoriten wissen wollen, so sind dies – außer Armide – sein Amadis und ebenso Roland. Mir kommt entgegen, dass in diesen späten Werken das Orchester immer wichtiger wird. Opernaufnahmen sind heutzutage das Teuerste, was man sich überhaupt leisten kann. Wie finanzieren Sie diese Projekte? Durch privates Sponsoring. Im Fall von Armide hatten wir außerdem eine szenische Produktion in Nancy. Ein eher einfacher Fall. Als einer der ganz wenigen Spezialisten der Alten Musik konzentrieren Sie sich gern auf die Barockmusik Ihrer französischen Heimat. Sind Sie dort im Vorteil? Ich glaube schon. Wir haben die ganze Geschichte in unseren Genen drin und müssen sie nicht erst mühsam zu verstehen suchen. Natürlich hat es auch etwas mit der Sprache zu tun. Je mehr man sie versteht, desto besser versteht man auch die Musik. Grundsätzlich allerdings ist alles eine Frage der theatralischen Geste. Foto: Eric Larrayadieu Lullys Armide steht heute ziemlich im Schatten der gleichnamigen Oper von Christoph Willibald Gluck. Ungerecht? Ja, denn man missversteht die Geschichte. Gluck hat seine Oper nur wegen Lully geschrieben. Glucks Armide ist ein fantastisches Stück, aber nicht sein bestes. Anders bei Lully: Armide ist der Gipfel seines Gesamtwerks. In den letzten Jahren hat die Alte Musik etliche Protagonisten der ersten Generation verloren, darunter Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt und Frans Brüggen. Zu welcher Generation rechnen Sie sich? Zur dritten Generation. Zur zweiten würde ich William Christie, auch Marc Minkowski zählen, die in den 80er Jahren begannen. Musiker meiner Generation, auch ich selber, haben in ihren Ensembles angefangen. Es gibt übrigens sogar einen musikalischen Unterschied. Ich mag keine Exzesse, halte mich treu an den Notentext und bin, glaube ich, in dieser Hinsicht „old school“. Angehörige jener zweiten Generation indes würden viel mehr darauf bestehen, dass alles neu sein muss. Ich bin altmodisch. Freilich, frisch muss es trotzdem sein. Ich rieche, hoffe ich, noch nicht wie alter Fisch. Sie haben in Interviews gelegentlich zugegeben, schüchtern zu sein. Können Sie sich das als Dirigent leisten? Von Haus aus bin ich eigentlich Cembalist. Das ist ein leises, intimes Instrument, das in eher kleinen Räumen seinen Platz hat. So erklärt sich die Wahl meines Instruments auch aus meiner Schüchternheit. Nur: Sobald ich raus auf die Bühne muss, nützt mir diese Tatsache gar nichts. Ich muss mich exponieren, egal hinter welchem Instrument ich mich verstecken will. Das Auftreten war für mich auch eine Art Therapie. Vor dem Orchester zu stehen, ist, daran gemessen, eher leichter. Ich muss zwar reden, fühle mich aber weniger nackt als alleine auf einem Podium. Es ist wie so oft bei ausübenden Künstlern: Sie sind privat das Gegenteil von dem, wofür man sie auf der Bühne hält. Den Beruf des Dirigenten stellt man sich gern als einsam vor. Ein Klischee? Nein, das stimmt. Man muss eine gewisse Autorität behaupten, sonst weiß das Orchester nicht mit dem umzugehen, was man ihm sagt. Ich habe eine Weile versucht, das zu unterlaufen, indem ich nach den Konzerten immer mit den Musikern essen gegangen bin. Davon habe ich schon lange Abstand genommen. Es klappt nicht. Dirigent kann man nur dann werden, sofern man sich nie langweilt, wenn man mit sich allein ist. Sie sind jetzt Mitte 50. Ist es für Dirigenten einfacher in die Jahre zu kommen als für andere? Ja, das mag wohl sein. Einerseits wird das Dirigieren immer leichter. Andererseits bleiben die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, immer gleich jung. Ich bin umzingelt von jüngeren Leuten, und das ist eine herrliche Sache. Es ist übrigens auch ein sehr gesunder Beruf. Gut für das Herz, weil man die ganze Zeit mit den Armen rudert. Die reinste Herzmassage. Viele Dirigenten haben sogar private Beziehungen zu deutlich Jüngeren. Würden Sie zugeben, dass Sie und Ihre Berufskollegen in einer beneidenswerten Lage sind? Ja, und ich weiß auch, warum das so ist. Es gibt da wohl irgend so eine Erotik der Macht, die an Dirigenten zu faszinieren scheint. Ich sage nicht, dass ich mich mächtig fühle. Aber die Folgen der Tatsache, dass es so rüberkommt, genieße ich durchaus. n 49