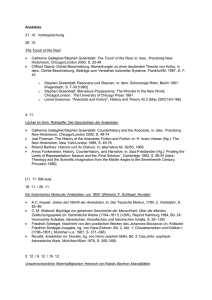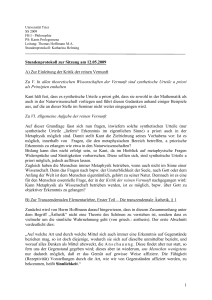Zum Grund des Seins - Journal-dl
Werbung

Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft Christoph Böhr Hrsg. Zum Grund des Seins Metaphysik und Anthropologie nach dem Ende der Postmoderne – Rémi Brague zu Ehren Das Bild vom Menschen und die ­Ordnung der Gesellschaft Herausgegeben von C. Böhr, Trier, Deutschland Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter http://www.springer.com/series/12749 Die Reihe Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft will das Den­ ken über den Zusammenhang von philosophischer Anthropologie und politischer Theorie neu beleben. Sie ist getragen von der Überzeugung, dass nur in der Zusam­ menschau beider Sichtweisen öffentliches Handeln sinnbestimmt zu begründen ist: Keine politische Theorie, der nicht eine philosophische Anthropologie beigesellt ist, wie umgekehrt gilt: Keine Anthropologie, die folgenlos bleibt für das Selbst­ verständnis von Politik. Zur Klärung dieses – heute weithin vergessenen – Zusam­ menhangs, wie er zwischen der Vergewisserung eines Menschenbildes und dem Entwurf einer Gesellschaftsordnung besteht, will die Schriftenreihe beitragen. Im Mittelpunkt stehen dabei soziale, ökonomische und politische Gestaltungsauf­ gaben. Öffentliches Handeln bestimmt sich über Ziele. Die jedoch lassen sich nur entwerfen, wenn das Leitbild sowohl für die Ordnung des Zusammenlebens als auch für die Beratschlagung der Gesellschaft in Sichtweite bleibt: im Maßstab eines Menschenbildes. Der Bestand einer Ordnung der Freiheit hängt davon ab, dass der zielbestimmte Sinn für den Zusammenhang, wie er zwischen der Anerkennung verbindlicher Regeln und der Bereitschaft zum selbstbestimmten Handeln besteht, immer wieder neu entdeckt und begründet wird. Die Reihe verfolgt mithin die Absicht, ein neues Selbstverständnis öffentlichen Handelns entwickeln zu helfen, das von der Frage nach den Zielen, auf die hin unsere Gesellschaft sich selbst versteht, ausgeht. Sie will die Reflexion der Theorie mit der Praxis der Deliberation verbinden, indem sie die Frage nach dem Handeln wieder im Zusammenhang mit dessen Zielbestimmung beantwortet. Herausgegeben von Christoph Böhr, Trier, Deutschland Christoph Böhr (Hrsg.) Zum Grund des Seins Metaphysik und Anthropologie nach dem Ende der Postmoderne – Rémi Brague zu Ehren Herausgeber Prof. Dr. Christoph Böhr Trier, Deutschland Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft ISBN 978-3-658-15144-7 (eBook) ISBN 978-3-658-15143-0 DOI 10.1007/978-3-658-15144-7 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National­ bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Springer VS © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa­ tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Lektorat: Frank Schindler Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer VS ist Teil von Springer Nature Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany Vorwort Vorwort Ist der Mensch ein missratenes Geschöpf, dessen kaum übersehbare Neigung, sich selbst zu verneinen – und gar sich selbst zu vernichten, mithin nur allzu verständlich erscheint? Angesichts der heute verfügbaren Möglichkeiten menschlicher Selbstzerstörung drängt sich die Frage auf, ob es überhaupt vernünft ige Gründe für das Überleben des Menschen gibt – und falls es sie gibt: Was sind das für Gründe? Die Antwort auf diese Frage darauf hängt ab vom Urteil über das Sein und den Wert des Menschen. Wenn es gute, bedingungslose Gründe für dessen Sein geben soll, können das keine vom Menschen selbst geschaffenen, mithin nur bedingt gültigen Gründe sein. Andernfalls wären sie nicht mehr und nicht weniger wert als die vom Menschen – voller Verzweiflung angesichts seines Elends – gegen sich selbst gerichtete Verneinung. Gibt es also Gründe, das Dasein des Menschen und das der Welt, die er bewohnt, zu rechtfertigen, sich mithin für deren Erhalt und Fortbestand in die Schanze zu schlagen? Was hat es mit dem Dasein des Menschen auf sich? Und warum ist uns heute seine Existenz keine Selbstverständlichkeit mehr? Alle diese Fragen lassen sich zu einer einzigen zusammenfassen: Welche Art von Sein kommt dem Sein des Menschen zu? Entscheiden allein akademische Konventionen und logische Konstruktionen darüber, was ist und was sein soll? Oder geht, um ein Wort von Rémi Brague aufzunehmen, dem Indikativ des Seins ein Imperativ zum Sein voran, so dass es gute Gründe für das Überleben des Menschen gibt – Gründe, die außerhalb seiner selbst liegen? Für diesen Fall wird man, um das Sein des Menschen erfassen zu können, vorgängig die Frage nach dem Sein Gottes stellen müssen. Wer nach dem Menschen Ausschau hält, kann dem Blick auf Gott schwerlich ausweichen. Wo der Mensch – einem Wort von Aurelius Augustinus im 9. und 10. Buch V VI Vorwort der Confessiones folgend: ‚quis ego et qualis ego?‘1 – sich selbst zur Frage – ‚quaestio mihi factus sum‘, schreibt Augustinus – wird, stößt er auf die Fragwürdigkeit nicht nur seines Da-Seins, sondern auch des Seins schlechthin, und kommt nicht daran vorbei, an Gott zu denken. Selbst wenn er davon überzeugt ist, sein Leben allein dem blanken Zufall zu verdanken, steht sein Da-Sein in einer Verhältnisbeziehung des geschuldeten Verdankens. So oder so, es liegen Folgen für die Lebensführung auf der Hand. Wenn Kontingenz an die Stelle Gottes tritt, wird ein Mensch sein Leben vermutlich anders ausrichten als derjenige es tut, der an einen Schöpfergott glaubt. In beiden Fällen aber wird er sich von der Frage nach dem Grund des Seins nicht entbunden wissen. Diese Frage tritt uns in doppelter Gestalt gegenüber: als Suche nach dem Sein als Grund – wie als Frage nach dem Grund des Seins. Wenn vom Dasein des Menschen die Rede ist, gar von den Gründen der Rechtfertigung dieses Daseins als einem Gut, einem möglicherweise sogar bedingungslosen Gut, kann man vielleicht behaupten, dass es allein der Mensch selbst ist, dem sein Dasein in die Hände gelegt ist, um es nach Gutdünken anzunehmen oder zu verwerfen. Aber zu behaupten, dass auch die Antwort auf die Frage nach den Gründen des Daseins ausschließlich in das eigene Ermessen des Menschen gestellt ist, fällt schon deshalb schwer, weil jeder Mensch sein Dasein – die Form seines Seins als ein Seiendes – vorfindet, verdankt und schuldet, also offenbar nicht von Anfang an Herr seines Daseins ist und jedenfalls nie gefragt wurde, ob er ins Sein gerufen werden wollte. Deshalb zeigt sich in dem Begriffspaar, das ‚Mensch‘ und ‚Gott‘ – verstanden als der Grund aller Gründe für Sein und Da-Sein – zusammenbringt und nebeneinander stellt, nicht eine willkürliche Wortverbindung, kein nebenbei sich dem Fragen des Menschen hinzugesellender Gesichtspunkt, sondern der Kern der Frage nach dem Dasein und dem Lebensrecht des Menschen – und zwar auch für den, der glaubt, in Gott nichts anderes als einen leeren Begriff vermuten zu müssen. Unversehens also schaut sich die Anthropologie an ihrer Wurzel hilfesuchend nach der Metaphysik um, wenn sie nach den – vielleicht – unbedingten Gründen eines heute nicht mehr selbstverständlichen Zieles sucht: einer Begründung der Rechtmäßigkeit des Menschen in der Welt. Wie aber soll das in einer Zeit gelingen, die sich nicht selten als ‚postmetaphysische‘ Epoche begreifen und deshalb den Zusammenhang von Anthropologie und Metaphysik eher auflösen als betonen will. Diese und weitere, daran anknüpfende Fragen stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Buches, das der Frage nach dem Menschen in Verbindung mit der 1 Vgl. dazu Jean Greisch, ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage, in diesem Band unten, S. 64: „Das qualis kann man in diesem Fall im Sinn des deutschen Wortes ‚Qual‘ verstehen. Es ist ein gequälter, von widersprüchlichen Sehnsüchten hin- und hergerissener Mensch, der sich hier seinen Lesern vorstellt.“ Vorwort VII Frage nach dem Grund seines Seins nachgeht. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln werden diese Fragen gestellt – und zu beantworten versucht. Die Frage selbst gehört zu jenen, die seit langer Zeit und in der besonderen Weise, wie sie die abendländische Geistesgeschichte geprägt haben, Brague beschäftigt – bis hinein in seine jüngsten Veröffentlichungen. Es geht mithin letztlich um das, was er im Untertitel seines 2011 erstmals erschienenen Buches Les Ancres dans le ciel die ‚metaphysische Infrastruktur‘ des menschlichen Lebens nennt. Am Ende einer ontologisch eher abspenstigen Postmoderne ist die Zeit gekommen, das ontologische Fundament des Menschen – und damit zugleich auch die Frage nach der Zukunft der Metaphysik – neu und prüfend in den Blick zu nehmen. Solange wir nämlich einer Metaphysik folgen, die das Sein und das Gute nicht im Einklang sehen kann – oder will, machen wir uns den Glauben, an dem alles Leben hängt, schwer. Brague, der in seinen Schriften immer wieder auf die Bedingungen der Möglichkeit dieses Einklanges zu sprechen kommt, gehört aufgrund seiner Gelehrsamkeit wie seines Scharfsinns zu den herausragenden Gestalten der Philosophie unserer Gegenwart weltweit. Er war von 2002 bis 2012 Inhaber des Romano-Guardini-Lehrstuhls für Philosophie der Religionen Europas an der Ludwig-Maximilians-Universität München und bis zu seiner Emeritierung in Frankreich im Jahr 2010 zeitgleich Professor für die Philosophie des Mittelalters an der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne in Paris. Zu seinen Ehren und in Würdigung seiner überragenden wissenschaftlichen Verdienste fand zu seinem 65. Geburtstag und anlässlich seiner Münchner Emeritierung in der Katholischen Akademie Trier ein Symposion zum Thema Mensch und Gott. Zum Grund des Seins. Metaphysik und Anthropologie nach dem Ende der Postmoderne statt. Zu danken ist allen, die – nicht selten in Freundschaft zu dem Geehrten – durch einen Vortrag diese Tagung für alle Anwesenden zu einem großen Erlebnis gemacht haben. Das jetzt vorgelegte Buch versammelt – bis auf wenige Ausnahmen – diese Vorträge, ergänzt um Beiträge von Philosophen, die aus zwingenden Gründen an der Tagung nicht teilnehmen konnten. Ihnen allen ist von Herzen zu danken – und alle verstehen ihren Beitrag auch als ein Zeichen der Verbundenheit mit dem Forscher und Gelehrten, den es zu ehren gilt. Zu danken ist nicht minder der Katholischen Akademie Trier, insbesondere ihrem vormaligen Direktor, Lic. phil. Jürgen Doetsch. Er war sofort bereit, seine Gastfreundschaft zu gewähren und die Veranstaltung in der Trägerschaft der Akademie durchzuführen. Für diese Bereitschaft kann man nicht dankbar genug sein, wenn man bedenkt, welchem Rechtfertigungsdruck heute Bildungshäuser ausgesetzt sind, sofern sie wissenschaftlichen Angeboten, die ja seit je eher selten als Massenveranstaltungen auffallen, einen Raum eröffnen. Mein Dank gilt ebenfalls 7 VIII Vorwort dem Lektorat des Verlages, insbesondere seinem Cheflektor Frank Schindler und Frau Katharina Gonsior, für die sorgfältige Betreuung der Drucklegung dieses Buches. Trier, im Mai 2016 Der Herausgeber Inhalt Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Existenz. Überlegungen zu einem Begriff, der keiner ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Thomas Buchheim Lesen im Buche der Welt – oder: Eine neue Gestalt der transzendentalen Theologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Richard Schaeffler Gott als Grund der Wirklichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Hans Otto Seitschek ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Jean Greisch „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“. Zum Verhältnis von Metaphysik, Phänomenologie und Mystik bei Jacques Derrida, Jean-Luc Marion und Michel Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Rolf Kühn Zum ontologischen Gottesbegriff, seiner normativen Bedeutung und seinen Spiegelungen im zeitgenössischen Denken: Emmanuel Levinas, Jacques Derrida und Jean-Luc Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Markus Enders IX X Inhalt Erfahrung und Erkenntnis Gottes – zur Wahrnehmung der Wahrheit. Gottes Unerkennbarkeit als letzte Erkenntnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 William J. Hoye Jenseits des Seins? Zur ontologischen Begründung der Frage nach Gott . . . . 145 Dominicus Trojahn ‚Es ist ein Gott‘. Kants Weg vom Wissen zum Glauben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Robert Theis Die Kraft des Guten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Rémi Brague Der Imperativ erst schafft den Indikativ. Ein Postscriptum zu Rémi Brague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Christoph Böhr Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zu den Verfassern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 239 255 261 267 Existenz Überlegungen zu einem Begriff, der keiner ist Thomas Buchheim 1 Was ist ein Begriff? Zunächst ist zu fragen, was denn im gewöhnlichen Fall überhaupt ein Begriff ist? Vorher wird man der im Titel formulierten These wenig abgewinnen können und sie für gewollt paradox halten. Der mathematische Logiker und Philosoph, Gottlob Frege, der wie kaum ein anderer, viel über diese Frage, was ein Begriff sei, nachgedacht hat, schreibt in seinen Kernsätzen zur Logik unter Nr. 4: „Der Gedanke enthält immer etwas über den besonderen Fall Hinübergreifendes, wodurch dieser als fallend unter etwas Allgemeines zum Bewusstsein kommt.“1 Ein Gedanke ist nach Frege kein subjektives Gebilde aus Vorstellungen, sondern eine bestimmte – gedankliche – Verknüpfung von Dingen, Eigenschaften, Begriffen und Beziehungen, die von allen, die sich im Denken eines Gedankens versuchen, als dieselbe und auf dieselbe Weise erfasst wird. Im vorangehenden Kernsatz zur Logik schreibt Frege dementsprechend: „Beim Denken werden nicht eigentlich Vorstellungen verknüpft, sondern Dinge, Eigenschaften, Begriffe, Beziehungen.“2 Das, was nun laut Satz Nr. 4 in einem Gedanken als „über den besonderen Fall Hinübergreifendes“ firmiert, ist von der Art eines ‚Begriffs‘. Es ist wie eine bestimmt geführte, sich öff nende und nach etwas heischende Geste, die über das betreffende weg, in eine bestimmte Richtung – Hinsicht – greift, aber eben deshalb, weil sie für etwas noch erst geöff net ist, für sich genommen, wie Frege sehr oft gesagt hat, „ungesättigt“ oder „prädikativ“ ist und erst, indem sie den betreffenden Fall fasst, selbst zu einem Abschluss gelangt. Dieser Fall dagegen kommt dadurch, dass sich 1 2 Gottlob Frege, Nachgelassene Schriften, hg. v. Hans Hermes, Friedrich Kambartel u. Friedrich Kaulbach, 2., revidierte u. erw. Auflage, Hamburg 1983, S. 189. Ebd. 1 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7_1 2 Thomas Buchheim in ihm der hinübergreifende Gestus sättigt und abschließt, als fallend unter etwas Allgemeines, das heißt als ein bestimmter Gegenstand zum Bewusstsein. Im gewöhnlichen Fall also kommt ein Begriff durch das, was ihn ‚sättigt‘ oder abschließt, als die Bestimmung oder Eigenschaft eines unter ihn fallenden Gegenstands zum Niederschlag. Ohne solch einen Niederschlag, das heißt als ungesättigter Teil des Gedankens, ist der Begriff nur ein bestimmt geführtes Hinübergreifen, wir können auch sagen, eine bestimmte Intentionalität oder Richtungsnahme des Denkens in dem betreffenden Gedanken. Es gibt Begriffe, die überhaupt nicht zur Sättigung, nicht zum definitiven Abschluss in einem Fall gelangen, der so als Fall eines Allgemeinen zum Bewusstsein käme; der Begriff ist dann wie ein gedanklicher Wegweiser, ohne je an das gewiesene Ziel zu kommen. Beispielsweise die Begriffe eines ‚runden Quadrats‘ oder eines ‚perpetuum mobile‘ verhalten sich so. Der Gedanke, dass das Foucaultsche Pendel in Kassel oder ein beliebiges anderes physikalisches System ein perpetuum mobile ist, ist falsch, aber dennoch ein echtbürtiger Gedanke im Fregeschen Sinn. Das ‚Hinübergreifende‘ in ihm bleibt in alle Wege – allenthalben – ungesättigt. Nichts wird je als Fall eines perpetuum mobile zum Bewusstsein kommen. Es gibt kein perpetuum mobile. So sind wir in diesem Beispiel bereits in den Umkreis unseres eigentlichen Themas gelangt, nämlich der Existenz. Es gibt kein perpetuum mobile, nichts ist ein perpetuum mobile, so etwas wie ein perpetuum mobile existiert nicht – das ist Verneinung der Existenz von etwas, die zudem eine hohe wissenschaftliche Signifikanz besitzt. Es sagt viel aus, lässt viel erkennen über die Physik und Naturgesetze unseres Universums, dass es kein perpetuum mobile gibt. Existenz oder Nichtexistenz von Dingen sind signifikante, erkenntnisträchtige Tatsachen, ohne dass Existenz ein Begriff von etwas im gewöhnlichen Sinne wäre. 2 Außer dem Begriff Warum ist nun aber ‚Existenz‘ kein Begriff im gewöhnlichen Sinn? Niemals kommt, wenn und indem etwas existiert, es als Fall eines gewissen Allgemeinen – nämlich eines Universale namens ‚Existenz‘ – zum Bewusstsein. Denn wäre es so, dann könnten wir auch dieses Allgemeine in den Begriff von etwas aufnehmen, wodurch sich die Existenz des betreffenden bereits in der Beschreibung eines Begriffs fände.3 3 Dies war Freges Argument bereits im Dialog über Existenz mit Pünjer; vgl. Gottlob Frege, Dialog mit Pünjer über Existenz, in: Ders., Schriften zur Logik und Sprachphilosophie. Aus dem Nachlaß, hg. v. Gottfried Gabriel, Hamburg 1978, S. 1-22. Existenz 3 Nur ein existierendes perpetuum mobile ist ja ein perpetuum mobile. Wenn also dieses Allgemeine – zu existieren – Teil des Begriffes eines perpetuum mobile wäre, dann wäre die Existenz tautologisch im Begriff vorausgesetzt und die Unterscheidung zwischen dem hinübergreifenden Begriff und dem sättigenden Fall oder Gegenstand aufgehoben. Alle wertvolle Erkenntnisträchtigkeit, die in der Existenz oder Nichtexistenz von etwas beschlossen liegt, wäre verloren. Ein Begriff ist immer nur ‚Protasis‘, das heißt eine ‚Vorstreckung‘ oder Vorschlag, hinübergreifender, ungesättigter Ausgriff des Denkens, der aber niemals zugleich seine eigene Sättigung oder ‚Apodosis‘ bildet. Die Apodosis der Existenz, also die Rückgabe oder Auszahlung, müssen wir immer von anderer Seite als der des Begriffs erwarten. Dies hatte auch Immanuel Kant ausdrücken wollen, wenn er darauf beharrte, dass Existenzaussagen immer „synthetisch“, niemals analytisch und daher die Existenz nie Teil eines Begriffs, kein „reales Prädikat“ sein könne. „Ich frage euch, ist der Satz: dieses oder jenes Ding (welches ich euch als möglich einräume, es mag sein, welches es wolle) existiert, ist, sage ich, dieser Satz ein analytischer oder synthetischer Satz? Wenn er das erstere ist, so tut ihr durch das Dasein des Dinges zu eurem Gedanken von dem Dinge nichts hinzu, aber alsdenn müßte entweder der Gedanke, der in euch ist, das Ding selber sein, oder ihr habt ein Dasein, als zur Möglichkeit gehörig, vorausgesetzt, und alsdenn das Dasein dem Vorgeben nach aus der inneren Möglichkeit geschlossen, welches nichts als eine elende Tautologie ist … Gesteht ihr dagegen, wie es billigermaßen jeder Vernünftige gestehen muß, daß ein jeder Existenzialsatz synthetisch sei, wie wollet ihr denn behaupten, daß das Prädikat der Existenz sich ohne Widerspruch nicht aufheben lasse? da dieser Vorzug nur den analytischen, als deren Charakter eben darauf beruht, eigentümlich zukommt.“4 Kant spitzt in der Folge diesen Punkt noch zu: dass Existenzurteile und ihnen entsprechende Erkenntnis zwar jederzeit „synthetisch“ seien, aber gerade nicht synthetisch in dem Sinn, dass mit ihr eine Bestimmung oder ein Prädikat zu dem Begriffe eines Dinges hinzukomme. Worin besteht aber dann das synthetische Moment von Existenz ? Einige wenige Stellen sprechen es mehr in Andeutungen als klar aus, was auch bei Frege und bis in die Philosophie der Gegenwart höchst problematisch und undurchsichtig geblieben ist: „Denn der Gegenstand ist bei der Wirklichkeit nicht bloß in meinem Begriffe analytisch enthalten, sondern kommt zu meinem Begriffe (der eine Bestimmung meines Zustandes ist) synthetisch hinzu, ohne daß, durch dieses Sein außerhalb meinem Begriffe, diese gedachte hundert 4 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781, B 625 f. / A 597 f. Hervorhebung im Original. 4 Thomas Buchheim Taler selbst im mindesten vermehrt werden.“5 Und wiederum ähnlich: „Unser Begriff von einem Gegenstande mag also enthalten, was und wie viel er wolle, so müssen wir doch aus ihm herausgehen, um diesem die Existenz zu erteilen.“6 „Denn, obgleich an meinem Begriffe, von dem möglichen realen Inhalte eines Dinges überhaupt, nichts fehlt, so fehlt doch noch etwas an dem Verhältnisse zu meinem ganzen Zustande des Denkens, nämlich daß die Erkenntnis jenes Objekts auch a posteriori möglich sei.“7 Das synthetische Moment der Existenz ist keine wie auch immer geartete Ergänzung des Begriffs von etwas, sondern ein Hinzukommendes zum Begrifflichen, zum Denken, meinem Zustand beim Denken überhaupt. Was ist dieses Moment, so dass man es zwar denken kann – Existenzurteile sind echte Gedanken – , aber nicht in der Form eines Begriffes oder Prädikats? Kant sagt, es sei ein „Herausgehen“ aus dem Begriff – „der eine Bestimmung meines Zustandes ist“ – nötig, ein Herausgehen, das aber dennoch eine „Erkenntnis jenes Objekts auch a posteriori“ gewährleisten würde. Erkenntnis a posteriori ist für Kant Erfahrungserkenntnis, also Erkenntnis davon in einem Zusammenhang mit sinnlicher Wahrnehmung. Aber Kant gibt durchaus zu, dass dies bei Erkenntnis der Existenz oder Nichtexistenz von Dingen, die nicht solche der zugleich sinnlichen Erfahrung sind, keine Anwendung finden kann. Wie wäre hier eine Erkenntnis a posteriori, eine Erkenntnis, die synthetisch zum Begriff, den wir denken, hinzukäme, zu verstehen? Kant gibt keinerlei Antwort mehr auf diese Frage, die später besonders Friedrich Wilhelm Joseph Schelling mit seiner ‚positiven Philosophie‘ sehr beschäftigen wird. Und die noch später auch Frege in seinen logisch-mathematischen Untersuchungen nicht losgelassen hat. Erkenntnis a posteriori in Beziehung auf das, was keine direkte Erfahrung zulässt, sei, so Schelling, Erkenntnis nicht eigentlich ‚a posteriori‘, das heißt ‚von dem späteren aus‘, sondern vielmehr ‚per posterius‘, das heißt ‚durch das Spätere‘, im Durchgehen des Späteren oder gewisser Folgen auf ein darin sich zeigendes und bestätigendes Früheres oder Vorausgehendes hin.8 Die von Schelling so bezeichnete ‚positive Philosophie‘ sei dadurch und dank eines solchen Verfahrens „eigentlicher Empirismus, insofern als das in der Erfahrung Vorkommende selbst mit zum Elemente, zum Mitwirkenden der Philosophie wird.“ Denn weil die Philosophie für gewöhnlich apriorische Wissenschaft sei, nämlich Wissenschaft aus 5 6 7 8 Ebd., B 627 / A 599. Ebd., B 629 / A 601. Ebd., B 628 / A 600. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Philosophie der Offenbarung, in: Sämtliche Werke, hg. v. Karl Friedrich August Schelling, 14 Bde., Stuttgart 1856-1861, Bde. XIII u. XIV, hg. aus dem Nachlaß, Bd. XIII, 1858, S. 129 f. Existenz 5 Vernunft- oder Denkbegriffen, nicht empirisch gefundenen Begriffen, so werde nun das Empirische gleichsam eingebaut oder einmontiert in die Entfaltung und Darlegung der Vernunftzusammenhänge. „Um den Unterschied aufs schärfste und kürzeste auszudrücken: die negative Philosophie ist apriorischer Empirismus, sie ist der Apriorismus des Empirischen [durchaus mit Kant: apriorische Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrungserkenntnis], aber eben darum nicht selbst Empirismus; dagegen umgekehrt ist die positive Philosophie empirischer Apriorismus, oder sie ist der Empirismus des Apriorischen, inwiefern sie das Prius per posterius als Gott seyend erweist.“9 Schelling fügt in Bezug auf das von Kant markierte Problem durchaus etwas Neues hinzu: Die Erfahrung lässt sich auf zweifache Weise für Erkenntnis nutzen: zum einen für die Ausbildung von Erfahrungserkenntnis in Bezug auf die direkt sinnlich zugänglichen Dinge; zum andern für die ‚diagnostische‘ oder durch das Erfahrbare hindurchschauende, nämlich auf das, was dahinter steckt, schauende Erkenntnis. Im zweiten – diagnostischen – Sinn wird Erfahrung zwar genutzt, aber deren Begriffe werden dabei in gewisser Weise hinter sich gelassen zugunsten des nicht unmittelbar Empirischen und Sinnlichen. Diagnostische Erkenntnis konstatiert nicht allein, was in der Erfahrung selbst liegt, sondern nimmt sie als Spuren, Indizien oder Symptome des selbst nicht direkt zu Erfahrenden. Diagnostische Erkenntnis sucht nach dem, dessen Existenz vermutet wird, ohne sie schon zu begreifen. Indem wir etwas begreifen, verstehen wir, was es ist. Wenn wir die Existenz von etwas behaupten, verstehen wir noch keineswegs, was es ist. Das Suchen, eigentlich auf allen Gebieten, sowohl empirischen wie mathematischen und logischen eine wichtige Tätigkeit und Operation der Vernunft, ist oft der Existenz von ‚irgendetwas‘ sicher, das Verstand oder Vernunft noch nicht begreifen oder hinreichend spezifizieren können. Gerade im Suchen dissoziieren Existenz und Begriff. Wir suchen nach einer Krankheit oder Diagnose; nach einem gesetzmäßigen Zusammenhang; nach einem Fehler im System; nach dem passenden Partner; nach Gott. Natürlich müssen wir gewisse, ebenfalls ‚begrifflich‘ zu nennende Anhaltspunkte für die Existenz des Gesuchten schon haben. Aber diese sind nicht ein Begriff dessen, was da womöglich existiert, sondern damit lose zusammenhängende Indizien. Haben wir das Gesuchte gefunden, zum Beispiel einen Erreger von BSE – Bovine spongiforme Enzephalopathie oder Rinderwahn – , dann können wir ans Werk gehen und zu begreifen versuchen, was es eigentlich ist. Die Existenz steht oft vor dem Begriff, nicht nur für uns und unsere Suche, sondern auch ‚an sich‘, etwa in Zusammenhängen, wo etwas entsteht oder sich bildet oder sich, wie man sagt, erst geltend macht. 9 Ebd., S. 130. Hervorhebung im Original. 6 Thomas Buchheim Ob eine bestimmte Krankheit vorliegt oder nicht, sondern eine andere oder gar keine, lässt sich nicht anhand von nur einer einzigen Erfahrung oder einem einzigen isolierten Indiz entscheiden, sondern durch ein ganzes Netz von Indizien und Symptomen, die in die gleiche Richtung zeigen. Existenzfragen sind im Grunde immer solche diagnostischen Fragen, die ein ganzes Netz einschlägiger Erfahrungen symptomatisch als unter sich verknüpfte Folgen ein und desselben Existierenden zusammenführen. Die diagnostische Erkenntnis, dass etwas bestimmtes existiert – wie beispielsweise ein Erreger von BSE10 – , ist daher wie die Lösung eines Rätsels, was womit zusammengenommen die einfachste Erklärung für alle der Erfahrung auffällig gewordenen Symptome bietet. Existenz präsentiert sich als einfachste Lösung eines sonst unübersichtlichen Knotens begrifflicher Anhaltspunkte. Darin liegt das ‚synthetische‘, den bloß begrifflichen Vorschlag, die gedachte Protasis überschreitende Moment der Existenz. Gewiss wird man sich genau überlegen müssen, wie man bei einer solchen Erkenntnis ‚a posteriori‘ im zweiten Sinn zu verfahren hat, welche methodischen Anforderungen zu stellen sind, damit man vernünftig bleibt und nicht schwärmt oder phantasiert. Aber in gewisser Weise ist dies auch schon das Problem mit der Erkenntnis a posteriori von Existenz oder Nichtexistenz überhaupt. Denn auch dies ist, wie deutlich wurde, eben nicht einfach eine Sache der von uns gebildeten Begriffe oder Theorien. Erkenntnis der Existenz muss synthetisch sein, muss einen Zugewinn zu unseren Begriffen von etwas leisten, ohne doch selbst als ein gewisses allgemeines Merkmal das begrifflich ‚Hinübergreifende‘ über gewisse Fälle sein zu können. Existenzfragen, obwohl, wie es scheint, durchaus erkenntnisträchtig, haben immer ein begriffsekstatisches Moment. Ich möchte damit noch einmal zu Frege zurückkehren. Nach Frege ist die Existenz, wie gesehen, nicht und niemals ein möglicher Begriff von gewissen Gegenständen, der irgendein Allgemeines bezeichnen würde, dem die Gegenstände unterfallen. Dennoch ist Existenz nach Frege auf gewisse Weise doch ein Begriff, in dem wir etwas Markantes denken, aber nicht ein Begriff von Gegenständen, sondern, wie Frege sagt, ein Begriff „zweiter Stufe“, das heißt einer von Begriffen, ein Begriff also, der nicht irgendwelche Gegenstände im mindesten qualifiziert oder bestimmt, sondern einer, der wenn etwas, dann unsere Begriffe qualifiziert. Existenz ist nach Frege ein Begriff von Begriffen oder ein Begriff zweiter Stufe. Er sagt von einem Begriff aus, dass er erfüllt ist; oder dass es Gegenstände gibt, die unter ihn fallen; dass ihm eine Anzahl größer als Null – „die Verneinung der 10 Es wurde seinerzeit befürchtet und gab auch Einzelbeispiele dafür, dass BSE – Bovine spongiforme Enzephalopathie oder Rinderwahn – in größerem Umfang auf den Menschen übergreifen könnte. Existenz 7 Nullzahl“ – zukommt. „Was hier an einem Beispiele gezeigt ist, gilt allgemein: der Begriff verhält sich wesentlich prädikativ auch da, wo etwas von ihm ausgesagt wird; folglich kann er dort nur wieder durch einen Begriff, niemals durch einen Gegenstand ersetzt werden. Die Aussage also, welche von einem Begriffe gemacht wird, paßt gar nicht auf einen Gegenstand. Die Begriffe zweiter Stufe, unter welche Begriffe fallen, sind wesentlich verschieden von den Begriffen erster Stufe, unter welche Gegenstände fallen … Der Unterschied von Begriff und Gegenstand bleibt also in ganzer Schroffheit bestehen.“11 Freges Beteuerung, der Unterschied zwischen Begriff und Gegenstand bleibe bei Begriffen zweiter Stufe – unter die Begriffe, nicht Gegenstände fallen – in ganzer Schroffheit erhalten, ist sehr wichtig. Denn es ist nicht so, dass hierdurch die Existenz doch zu einer Eigenschaft von gewissen, bloß anderen als gewöhnlichen Gegenständen wird, die somit aus begrifflichen Gründen existieren würden. Vielmehr existiert, wie schon Kant sagt, eben nichts aus begrifflichen Gründen oder deshalb, weil es zum Begriff davon gehört zu existieren. Sondern immer haben wir, um Existenz zu ermitteln, vom Begriff wegzugehen und uns auf Gegenstände zu richten, die ihm womöglich unterfallen. Wir erkennen bei manchen Begriffen – von denen wir Existenz aussagen – , dass wir uns auf Gegenstände zu richten, auf sie gefasst, nach ihnen mit allem, was uns zu Gebote steht, zu suchen haben – beispielsweise ‚dunkle Materie‘ – ; bei manchen Begriffen vermuten, erkennen oder wissen wir schon, dass dem nicht so ist, dass der Begriff leer, unerfüllt, nur ungesättigt ist – beispielsweise ‚perpetuum mobile‘. Bei wiederum anderen haben wir weder für das eine noch das andere Anhaltspunkte – zum Beispiel ‚extraterrestrische Intelligenz‘. In diesem Sinn bleibt die Einsicht Kants für Frege in Kraft, dass wir für Existenz niemals analytisch in Begriffen von Gegenständen nachsuchen dürfen, sondern stets synthetisch „aus ihm [dem Begriff] herausgehen müssen“, wie auch immer wir diesen Überschritt bewerkstelligen können. Es lässt sich auch – mit Frege – so ausdrücken: Die Frage ist, ob wir berechtigt sind, genuine singuläre Termini bezüglich eines begrifflich markierten Bereiches zu gebrauchen. 11 Gottlob Frege, Über Begriff und Gegenstand, in: Ders., Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien, hg. v. Günther Patzig, Göttingen 51980, S. 66-80, hier S. 75 f. 8 3 Thomas Buchheim Die Offenheit der Existenz Aus den Überlegungen zur Existenz als Begriff zweiter Stufe kann man ersehen, wie wenig die bloße Feststellung, dass gewisse Dinge, die wir korrekt ansprechen mit ‚das x0 unterfällt dem und dem Begriff‘ oder ‚ist ein Erfüllungsbeispiel für den Begriff X‘ eine Garantie dafür darstellt, dass dem betreffenden Begriff tatsächlich objektive Existenz zukommt oder er ein wirklich existenzqualifizierter Begriff ist. Vielmehr gibt es offenbar auch Fälle, in denen die Beibringung von Erfüllungsbeispielen für einen Begriff noch nicht die Annahme objektiver Existenz für die ihnen unterfallenden Instanzen des Begriffs rechtfertigt. Dann ist die Rede von einem objektiven Gegenstand eine bloße façon de parler. Das, was dem Existenzbegriff unterfällt, ist gar nicht objektiver Gegenstand, sondern vielmehr vorerst Begriff, bloße Protasis, von dem wiederum prätendiert wird, er werde durch objektive Gegenstände erfüllt, die in diesem Fall objektiv existieren. Die augenscheinlich formgerechte Erfüllung eines Begriffs durch gewisse Erfüllungsbeispiele kann objektive Existenz nicht per se garantieren. Suchen wir nach Beispielen für das Phänomen, das ich meine: Begriffe, für die es Erfüllungsbeispiele gibt, ohne dass wir sagen, die unterfallenden Instanzen existierten objektiv oder seien in Freges Verständnis objektive Gegenstände? Wie es scheint, wird man hier durchaus fündig. Zum Beispiel wären nach Freges eigener Ansicht die imaginären Zahlen solche Erfüllungsbeispiele für den Begriff ‚Quadratwurzel einer negativen Zahl‘. Denn man kann die Zahl ‚i‘ definieren als Wurzel von –1 und dann sogar damit rechnen, Gleichungen lösen und dergleichen. Doch steht nach Frege damit noch nicht außer Zweifel, ob ‚i‘ existiert oder tatsächlich ein objektiver Gegenstand ist. Zur objektiven Existenz gehören außerdem noch gewisse Anforderungen an eindeutiger Identifizierbarkeit und Unterscheidbarkeit,12 denen imaginäre Zahlen nicht ohne weiteres entsprechen. Und man kann nicht durch eine Definition oder Festsetzung der Bedeutung eines sprachlichen Terms einen objektiven Gegenstand erschaffen. Dies wirft Frege vielen Mathematikern seiner Zeit vor, und es ist bis heute gängige Praxis, alles worauf man sich mithilfe von Definitionen und Quantoren beziehen kann, allein deshalb schon für objektiv existierend zu halten. Ähnlich könnte man sich auch auf empirischem Sachgebiet darüber streiten, ob etwa der Begriff ‚Regenbogen‘, der sicherlich Erfüllungsbeispiele hat, etwas bezeichnet, das objektiv existiert. Regenbogen sind betrachterabhängige Lichtreflexe, wie Spiegelbilder oder Schatten. Wir nehmen nicht fraglos an, dass dergleichen objektive 12 Weil die Bedingungen für Definitheit der Objekte nicht hinreichend erfüllt sind, etwa: sie sind nicht je ein diskriminativ herauszugreifendes einzelnes etc. Existenz 9 Gegenstände sind. Vielmehr handelt es sich um perspektivisch auftretende Effekte in Beziehung auf anderes. Auch bestimmte Eigennamen aus der Geschichte sind so, dass man sich darüber streitet, ob das damit Bezeichnete existiert oder nicht. Zum Beispiel ‚König Artus‘, ‚Homer‘,13 ‚Jahwe‘. Vor wenigen Monaten war man in der Teilchenphysik noch dabei zu eruieren, ob das Higgs-Boson existiert oder nicht. Dies scheint mittlerweile festzustehen. Früher hat man sich darüber gestritten, ob es schwarze Löcher gibt oder nicht; ob es Äther gibt oder nicht. Bestimmte natürliche Arten, von denen feststand, dass sie einmal existierten, existieren heute nicht. Das heißt in Bezug auf denselben Begriff kann es Übergänge geben von Existenz zu Nichtexistenz und umgekehrt. Wenn das Higgs-Boson nicht existiert haben würde, dann wäre dieser Begriff und seine Rolle in der theoretischen Teilchenphysik kein wissenschaftlicher Begriff gewesen. So wie ‚Phlogiston‘ kein wissenschaftlicher Begriff ist, obwohl er ebenso scharfe Umgrenzung besaß wie zum Beispiel der Begriff ‚Sauerstoff‘. Schließlich wäre es doch etwa denkbar gewesen, dass es keinen Erreger von BSE gibt, sondern BSE eine endogene Erkrankung ist. Nun existiert aber ein solcher Erreger und zwar ein sehr merkwürdiger. Und es wäre nach wie vor denkbar, dass es ‚Potenzierungsfolgen‘ von homöopathischen Arzneimitteln gibt. Hier zum Beispiel gibt es einen gewissen Rätselknoten bis heute, den man nicht durch definitive Erkenntnis der Existenz oder Nichtexistenz entwirrt hat. In den angeführten Beispielen wird klar, dass in sozusagen allen Sach- und Wissenschaftsgebieten, die unsere Welt zu bieten hat, Fragwürdigkeiten in Bezug auf Existenz bestehen. Damit scheint also deutlich zu sein, dass weder das Vorkommen wissenschaftlich oder anderweitig verwendeter Eigennamen, noch definierter wissenschaftlicher Begriffe, für die auch Erfüllungsbeispiele eingeräumt werden, garantieren, dass etwas genuin existiert oder objektiver Gegenstand, objektive Wirklichkeit ist. Das macht die Frage nach dem, was existiert und was nicht, nach wie vor zu einer spannenden und, wie schon öfter hervorgehoben, erkenntnisrelevanten Frage. Es ist nicht sinnvoll und offenbar nicht im Sinne Freges und Kants zu meinen, dass die Frage der Existenz nur das sogenannte Commitment unserer besten wissenschaftlichen Theorien beträfe. Vielmehr ist sowohl zu befürchten, dass manches, wovon wir heute wissenschaftlich reden, sich morgen als gar nicht objektiv existierend herausstellt, als auch könnte durchaus etwas objektiv existieren, wofür wir gar keine wissenschaftsfähigen Begriffe zur Verfügung haben, von denen wir ‚Existenz‘ als Begriff zweiter Stufe mit verlässlicher Rechtfertigung aussagen könnten. 13 Auch ‚Homer‘, so wurde in früherer Philologie heiß diskutiert, könnte eine diachron weit ausgedehnte ‚Gilde‘ oder Gruppierung von Sängern gewesen sein. 10 Thomas Buchheim Noch einmal das Fazit aus den angeführten Beispielen zusammengefasst: Nicht alle Erfüllungsinstanzen von hinreichend scharf umgrenzten Begriffen rechtfertigen diesbezüglich die Annahme objektiver Existenz. Und es sind unscharf umgrenzte Konzeptualisierungen denkbar, für die mindestens eine sie definitiv erfüllende Instanz die Annahme objektiver Existenz wahr macht, obwohl wir diesbezüglich nicht zu einer Erkenntnis gelangt sind oder gelangen können. Was aber behaupten wir dann eigentlich, wenn wir mit Bezug auf etwas die Annahme objektiver Existenz für gerechtfertigt halten? Was, wenn wir mit Bezug auf etwas Existenz verneinen? Wann, unter welchen Bedingungen halten wir mit Bezug auf etwas die Annahme objektiver Existenz für gerechtfertigt? Nicht immer dann offenbar, wenn wir deutliche Erfüllungsbeispiele für hinreichend scharf umgrenzte Begriffe davon haben. Und nicht immer dann nicht, wenn wir keine eindeutigen Erfüllungsbeispiele für nicht einmal hinreichend scharf umgrenzte Begriffe davon haben. Was denken wir in den Fällen über genuine Existenz, wo wir sie behaupten, obwohl wir keine eindeutigen Erfüllungsbeispiele hinreichend scharf umgrenzter Begriffe dafür anführen können – beispielsweise Gott; extraterrestrische Intelligenz? Oder wo wir sie verneinen, obwohl wir deutliche Erfüllungsbeispiele hinreichend scharf umgrenzter Begriffe davon haben – beispielsweise imaginäre Zahlen; Regenbogen? Meine Antwort besteht in – neben dem begriffsekstatischen – zwei weiteren, meines Erachtens durchaus rational – obwohl nicht auf erster Stufe begrifflich – zu explizierenden Elementen, nämlich erstens der Unterstellung von über unseren Begriff hinausgehender ‚Situierung‘ für das, was existiert, und zweitens dem Gefasst-Sein auf eine Überraschungen bergende ‚Konfrontation‘ damit. 4 Situierung Alles, was existiert, befindet sich irgendwo oder irgendwie oder beides. Irgendwo befindet sich etwas nicht erst dann, wenn es als räumlich im Raum vorkommt, sondern wenn es als bestimmtes diskriminiert von anderem in einem für sie gemeinsamen Feld konsistent denkbarer Koexistenz aufzufinden ist.14 Diese Auffindbarkeit 14 Markus Gabriel spricht in seinem Buch Warum es die Welt nicht gibt, Berlin 2013, in ähnlicher Absicht von „Sinnfeldern“ oder auch einer „Umgebung“ von etwas, mit Bezug auf die alle Existenz zu verstehen sei. Jedoch fehlt ihm die ‚Wertigkeit‘ von Sinnfeldern oder das ‚Gewicht‘ der Existenz – ontologische Sparsamkeit – , welche nicht in jedem Fall Existenz 11 oder Entdeckbarkeit muss nicht empirisch verstanden werden. Genauso wenig wie das ‚irgendwo‘ Sein den empirischen Raum voraussetzt. Aber es muss doch eine Annäherungsweise spezifizierbar sein, die durch ein methodisches Verfahren im selben Feld anderes Existierendes mit dem Betreffenden verknüpfen und ansteuern ließe. So sind zum Beispiel auch bestimmte Primzahlen irgendwo auffindbar durch gewisse mathematische Operationen. Sie liegen irgendwo zwischen gewissen anderen Zahlen. Das ist ihre Situierung. Und regelmäßige geometrische Körper oder Figuren sind durch geometrische Operationen und Verhältnisse – Spiegelungen, Symmetrien etc. – auffindbar, die ebenfalls ihre Situierung eingrenzen. Immer wenn wir etwas in proprio situ entdecken, dann ist es auch in mehr und anderen Hinsichten situiert, als wir für eine Annäherung verwendet haben. Das scheint beispielsweise für die imaginären Zahlen nicht zu gelten: ‚i‘, die Wurzel aus –1 ist nur da, wo wir hindefiniert haben, dass sie sei. Und sie treten außerdem im undiskriminierbaren Doppelpack auf. Bei diesem Schema der Situierung ist klar, dass die Existenz von etwas immer als ein Zusammensein und Verhältnis mit anderem, das ebenfalls existiert, verstanden wird. Hier muss erstens die Existenz dessen, worüber die methodische Annährung erfolgt, vorausgesetzt werden und zweitens muss der Zugangsweg zur Situierung des fraglichen Dinges eine hinreichend tragfähige Verbindung darstellen; drittens muss das so Erreichbare vielleicht nicht für uns, aber an sich noch über andere Wege in seiner Situierung auffindbar sein. Epikurs Götter in den ‚Intermundien‘, die sich um nichts anderes scheren oder bekümmern würden und keinerlei Einfluss auf den Weltenlauf nehmen, sind nicht im verlangten Sinn situiert. Genauso wenig wie gegenüber der unsrigen abgeschlossene mögliche Welten, deren Existenzannahme – wie sie beispielsweise David Lewis trifft – der Intention des Ausdrucks ‚Existenz‘ nach meiner Auffassung widerspricht. Es ist nicht sinnvoll anzunehmen, dass irgendetwas, mit Bezug worauf Existenzbehauptungen wahr sind, nicht mit uns selbst in ko-existentieller Verknüpfung steht. Wenn etwas überhaupt existiert, dann irgendwie situiert in einem gemeinsamen Kreis mit allem anderen, was existiert. Existenz steht prinzipiell unter dem Druck alles damit Ko-Existierenden. Nichts kann mit etwas davon unverträglich sein. Wegen dieses ‚Koexistenzdrucks‘ gelten für Existierendes immer Ökonomieprinzipien oder Prinzipien der ontologischen Sparsamkeit wie Occams Razor. von ‚Sinn‘, sondern nur in ganz ausgewählten Ambienten auf Existenz im pointierten Gegensatz zu Nichtexistenz schließen läßt. Dieses Gewicht der Existenz macht es aus, dass es sich bei Erkenntnis der objektiven Existenz um wirkliche Entdeckungen oder Funde handelt. 12 Thomas Buchheim Wenn Kant von der Existenz als ‚absoluter Position‘ oder ‚Position eines Dinges an sich selbst‘ als Gegenstand in Entsprechung zu meinem Begriff spricht,15 dann unterdrückt oder vernachlässigt er diesen prinzipiell ko-existenzialen Aspekt aller Existenz als unterstellte Situierung. Er kapriziert sich vielmehr allein auf den früher herausgestellten ‚begriffsekstatischen‘ Aspekt der Existenz. Schon das Wort ‚Position‘ drückt aber gerade dies aus, da jede Position immer nur Position im bestimmten Verhältnis zu weiteren Positionen in einem gemeinsamen Feld ist. Auch ‚Dasein‘, ‚there is‘ und ähnliche Worte transportieren dieselbe Konnotation der Existenz. Mit diesem Wort durchbrechen wir immer die Isolation oder Alleinstellung dessen, wovon wir die Existenz behaupten. Existenz etabliert sich immer als Koexistenz. Nicht zu verschweigen ist bei diesem Situierungs- oder ko-existenzialen Aspekt der Existenz, dass er, jedenfalls auf den ersten Blick, gewisse Schwierigkeiten bereitet für den Fall, wo wir von der Existenz eines alleinigen Gottes oder überhaupt von ‚monistischer‘ Existenz im Sinne des Parmenides oder Plotins reden möchten. Es wäre aber ganz ungut, das philosophische Verständnis von Existenz so einschränken zu wollen, dass die Intention dieses Wortes nicht mehr anwendbar wäre auf ein Wesen wie Gott oder wie ‚das Seiende‘ des Parmenides. Zwar haben schon die klassischen griechischen Philosophen mit guten Argumenten gezeigt, dass das angebliche ‚Seiende‘ des Parmenides, wird es streng monistisch aufgefasst, eben nicht existiert. Insofern könnte ich mich damit noch abfinden. Aber gleiches sollte man meines Erachtens nicht in Kauf nehmen für die Frage nach einer möglichen Existenz Gottes, etwa ohne und bevor er noch etwas anderes erschaffen hätte, als er selbst ist. Für diesen Zweck ist es wichtig zu sehen, so wie es wiederum als einer der wenigen der späte Schelling tat, dass auf eine gewisse Weise auch das, was sich ‚irgendwie‘ befindet, das also für sich selbst in einem Zustand ist, der nicht der einzig mögliche Zustand ist, den das betreffende einnehmen kann, sondern der Alternativzustände dieses selben Wesens zulässt – dass also auch, sich auf diese Weise ‚irgendwie‘ zu befinden schon ein sich ‚wo‘ befinden, also eine gewisse Art der Situierung ist. Etwas ist auch in einer Situation, indem es sich irgendwie befindet, nicht nur dann, wenn es sich irgendwo, und das würde bedeuten: in Ko-Existenz mit anderem befindet. Ich habe ein längeres Textstück herausgesucht, in dem Schelling dies für die Situation Gottes noch abseits der Schöpfung von etwas anderem erklärt. Dieser Text ist, wie das meiste Wichtige beim späten Schelling, furchtbar verklausuliert und unverständlich. Er beschreibt die interne Unabhängigkeitserklärung Gottes von einem unvordenklichen Primär- oder Primordialzustand notwendiger Existenz. Dabei ist nicht gemeint, dass Gott tatsächlich einmal in dieser Verfassung war und 15Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 625-629; vgl. auch Immanuel Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, 1763. Existenz 13 dann ein anderer wurde oder in einen veränderten Zustand eintrat. Sondern es soll damit nur gesagt werden, dass die Verfassung Gottes, in der er der allein Existierende ist, schon ein in sich komplexer Zustand oder eine komplexe Verfassung sein muss, eine Verfassung, die ihn in eine minimal mannigfaltige Situation versetzt sein lässt: „Als solches [unvordenklich Notwendiges] hat es das entgegengesetzte Seyn (das durch Uebergang a potentia ad actum gesetzte) nicht ausgeschlossen, sonst hätte ihm der Begriff desselben vorausgehen müssen. Dieses durch Uebergang a potentia ad actum mögliche Seyn hat nun zwar keinen Anspruch auf Wirklichkeit; es könnte von ihm als wirklichem gar nicht die Rede seyn, wenn nicht das unvordenkliche Seyn wäre, nun aber dieses ist, und zwar selbst blindlings, d. h. zufällig ist, dem so seyenden gegenüber hat auch das bloß zufällige Seyn ein Recht als eine Möglichkeit zu erscheinen, sich dem, was in dem actu nothwendigen Existiren das eigentliche Selbst, das Wesen ist, zu zeigen, sich darzustellen. Ich brauche diese Ausdrücke, weil diese Möglichkeit für sich eine bloße Erscheinung ist, nur etwas ist gegenüber von einem, dem sie sich zeigt, dem sie bloß sagt, daß es selbst das Seynkönnende, das über sein unmittelbares Existiren hinaus Seynkönnende ist, daß es eben darum sich von diesem Seyn befreien, sich über dieses Existiren erheben kann, welches ihm jetzt erst gegenständlich wird, denn bis jetzt war das Seyn selbst an der Stelle des Subjekts; an dem Seynkönnen, als welches es sich sieht, hat es erst einen Standpunkt außer dem Seyn, ein ποῦ, von dem aus es sich in seinem Seyn bewegen, dieses gleichsam aus seinem Stand heben kann“.16 Das Sich-in-bestimmter-Verfassung-Befinden oder „Wo-Sein“ Gottes – auch ‚statt‘finden genannt – impliziert bereits ein Selbstverhältnis zum status quo als nicht dem einzig möglichen für dasselbe, was Gott ist. 5 Konfrontation Die Unterstellung von Situierung können wir auf eine rational zu rechtfertigende Weise auch dann vornehmen, wenn unsere Existenzvermutung bezüglich eines Etwas ins Leere geht oder es uns unmöglich ist, das Vermeinte zu einer es identifizierenden Konfrontation mit uns zu bringen. Eine etwas identifizierende Konfrontation ist durchaus nicht nur durch sinnliche Erfahrung möglich. Heute noch entdecken Computer durch ihre Rechnungen neue, bislang unbekannte Primzahlen unter den unendlich 16 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Andere Deduktion der Principien der positiven Philosophie, in: Sämtliche Werke, a. a. O., Bd. XIV, hg. aus dem Nachlaß, Stuttgart 1858, S. 347 f. Hervorhebung im Original. 14 Thomas Buchheim vielen natürlichen Zahlen. Und wenn wir einst ein Signal aus dem Weltraum empfingen, das wir sicher sein dürfen, als sprachliche Mitteilung einer fremden Intelligenz entziffern und verstehen zu können, dann wären wir konfrontiert mit der Existenz einer solchen extraterrestrischen Intelligenz. Zu sagen, dies sei doch empirisch und durch sinnliche Wahrnehmung vermittelt, ist meines Erachtens wenig überzeugend, weil gerade die Bedeutung von solchen Zeichen und das Verstehen von Bedeutung nicht eine empirische Erkenntnis ist. Und auch, wenn wir vielleicht neuartige Naturgesetze als existierend erkennen, etwa Gesetze, die das Verhältnis von Körper und Seele bestimmen, dann wäre das eine Überraschung bergende Konfrontation mehr mit unseren rationalen Erklärungsnetzen als mit unserer sinnlichen Wahrnehmung, auf die Kant unseren existenzentdeckenden Gesichtskreis einschränken wollte. Eine Überraschung kann nur etwas bergen, das in der Konfrontation identifiziert wird als etwas, wovon man nicht gedacht hätte und nicht begrifflich antizipiert hat, dass es sich genau so damit verhalte, wie jetzt entdeckt. Eine identifizierende Konfrontation ist die Entdeckung, dass es ohne gerade das betreffende nicht ginge, dass etwas ungedeckt bliebe in den Verknotungen der betrachteten Mannigfaltigkeit ohne es. Diesem, ohne was es nicht geht, müssen wir dann Existenz zubilligen. Um etwas zur identifizierenden Konfrontation zu bringen, müssen wir das betreffende über seine Situierung gleichsam in die Enge treiben und es so in seiner Identität stellen, oder, was auf dasselbe hinausläuft, uns seiner Identität stellen. Eigentlich unternehmen wir etwas dieser Art ganz oft und selbstverständlich. Das Problem ist nur, dass sich schon vieles, das wir gestellt oder dem wir uns gestellt sahen, auch wieder hat auflösen lassen. Wir hatten es nicht in der richtigen Situierung und nicht in zuverlässiger Identifikation gestellt, sondern nur zum Schein. Dass uns dies oft passiert und sogar in unseren besten Wissenschaften bis heute passiert, ist kein Einwand dagegen, dass Existenz neben dem begriffsekstatischen und dem ko-existenzialen eben auch diesen konfrontativen Aspekt besitzt. Was niemals gestellt wird noch werden könnte und von dem auch wir niemals gestellt werden noch werden könnten – wie Epikurs Götter in den Intermundien – das existiert auch nicht, hätten wir auch noch so scharf umgrenzte Begriffe davon. Am Ende möchte ich das Gesagte noch einmal in drei Thesen zusammenfassen: 1. ‚Existenz‘ ist nicht eine Frage des commitments unserer besten Theorien, sondern in vielen Bereichen durchaus offen und überraschungsträchtig: begriffsekstatischer Aspekt. 2. Alles Existierende steht in Verhältnissen der Koexistenz, das heißt: Es befindet sich irgendwo oder wenigstens irgendwie: ko-existenzialer Aspekt. 3. Mit Existierendem sind wir konfrontiert, das heißt sehen uns selbst als ‚gestellt‘ in Beziehung auf dasselbe an. Lesen im Buche der Welt – oder: Eine neue Gestalt der transzendentalen Theologie Richard Schaeffler Lesen im Buche der Welt 1 Der Titel Lesen im Buche der Welt bedarf einiger Erläuterungen: 1.1 Ein wissenschaftshistorischer Hinweis Die Formulierung ‚Lesen im Buche der Welt‘ verdanke ich dem Hinweis von Hans Blumenberg und dessen Buch Die Lesbarkeit der Welt. Blumenberg hat den Bedeutungwandel dieses Programmworts in der Geschichte der Renaissance und der frühen Neuzeit nachgezeichnet. Aus der Fülle dieser Informationen sei an dieser Stelle nur ein einziger Hinweis entnommen: Die Formulierung ‚Lesen im Buche der Welt‘ findet sich zuerst bei Ärzten und Naturforschern der Renaissance und ist dort konzipiert als Glied einer Antithese: Es kommt darauf an, nicht – nur – in ‚Büchern von Menschenhand‘ zu lesen, sondern – vor allem – im ‚Buche der Welt‘: Die eigene Beobachtung gilt nun als die primäre Quelle der Erkenntnis. Immanuel Kant setzt diese Metapher vom ‚Lesen im Buche der Welt‘ voraus, wenn er die Aufgabe des Erkennens darin sieht, dass wir „Erscheinungen buchstabieren, um sie als Erfahrung zu lesen“.1 Man wird interpretieren dürfen: Bloßes Buchstabieren reicht nicht aus. Man muß das Lesen lernen. 1.2 Eine weiterführende Deutung Bei der Formulierung ‚Lesen im Buche der Welt‘ handelt es sich um eine Metapher, aber nicht bloß um ein poetisches Bild. Was diese Formulierung anzeigt, ist ein 1 Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, 1783, § 30. 15 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7_2 16 Richard Schaeffler Möglichkeitsgrund: Es ist nur deshalb möglich, in Büchern von Menschenhand zu lesen, weil deren Autoren zuvor im Buche der Welt gelesen haben und ihre Leser auffordern, ihrerseits im Buche der Welt zu lesen und so ihre ‚Buchgelehrsamkeit‘ in eigenen Beobachtungen zu überprüfen. 1.3 Eine Folgerung zur Methode In der Reflexion auf das, was wir tun, wenn wir Bücher von Menschenhand lesen, werden wir uns zugleich darüber klar, was wir leisten müssen, um im Buche der Welt zu lesen. ‚Lesen‘ ist immer das Erfassen einer sinnenhaft perzipierbaren Gestalt – eines Gefüges von Graphemen – und zugleich die kritische Auslegung des so Perzipierten, um in ihm einen Bedeutungsgehalt freizulegen. Dieser macht das objektiv Gültige des Gelesenen aus. 1.4 Eine weiterführende Frage: Läßt der Text einen Autor erkennen? In Büchern von Menschenhand können wir am gelesenen und verstandenen Text ‚die Handschrift des Verfassers erkennen‘, das heißt die für ihn charakteristische Weise, die Sache, von der er spricht, in der sinnenhaft perzipierbaren Gestalt seiner Worte zur Sprache zu bringen. Denn an der Weise, wie der Verfasser dem, was er sagen will, eine für ihn spezifische Ausdrucksgestalt verleiht, läßt sich ablesen, wie er die Sache zunächst zu der seinen gemacht hat und wie er sie sodann dem Leser so präsentiert, dass auch dieser sie zu der seinen machen kann. Gilt das auch für das ‚Buch der Welt‘? Das Argumentationsziel der kommenden Ausführungen läßt sich vorwegnehmend in folgenden Thesen zum Ausdruck bringen: a. Eine Theorie, die alles Erkennen als ein ‚Lesen im Buche der Welt‘ versteht, ist geeignet, die leitenden Fragen der Transzendentalphilosophie auf neue Weise zu stellen und zu beantworten. b. Für eine ‚Hermeneutik des Lesens im Buche der Welt‘ ist Kants Potulatenlehre eine wichtige Auslegungshilfe c. Beim Lesen im Buche der Welt wird zugleich die Handschrift eines Autors erkennbar. Auf diese Weise öffnet sich ein Weg von der allgemeinen Transzendentalphilosophie zur transzendentalen Theologie. Dann erscheint Gott als der ‚Autor des Buches der Welt‘. Lesen im Buche der Welt 17 Auf diese Weise erweist der Versuch, im Buche der Welt die Handschrift eines göttlichen Autors zu entziffern; sich als der ‚höchste Standpunkt der Transzendentalphilosophie‘.2 2 Eine neue Gestalt der Transzendentalphilosophie These 1: Eine Theorie, die alles Erkennen als ein ‚Lesen im Buche der Welt‘ versteht, ist geeignet, die leitenden Fragen der Transzendentalphilosophie auf neue Weise zu stellen und zu beantworten. Die leitende Frage der traditionellen Transzendentalphilosophie lautet: Wie wird etwas zum Gegenstand für mich, ohne dadurch zum bloßen Moment meines Selbstbewußtseins zu werden? Diese Leitfrage entfaltet sich in zwei Teilprobleme: Was muß ich ‚dazutun‘, damit die Sachen zum Sprechen kommen und aus unseren subjektiven Eindrücken und Meinungen so ‚auftauchen‘ können, dass sie den Eigenstand von Objekten gewinnen, an denen ich meine Meinungen überprüfen kann? Die traditionelle Antwort lautet: Ich muß Kontexte aufbauen, in denen die Erscheinungen etwas bedeuten können. Darin liegt die transzendentale Bedeutung unserer Anschauungsformen, Begriffe und Ideen. Und, zweitens: Was muß ich vermeiden, damit ich dort, wo ich auf die Sache zu hören meine, nicht vielmehr Selbstgespräche führe? Die traditionelle, schon bis in die antike Philosophie zurückgehende Antwort lautet: Ich muß vermeiden, neue Inhalte meiner Erfahrung den bisher bewährten Formen meines Anschauens und Denkens anzupassen. Statt dessen muß ich vor allem auf solche Erscheinungen achten, die sich – scheinbar oder wirklich – unseren Anschauungsformen, Begriffen und Ideen nicht einfügen, sondern uns zum physischen oder intellektuellen Perspektivenwechsel nötigen. Gerade solche Erscheinungen führen uns ‚parà thēn dóxan‘ – über die subjektiven Eindrücke hinaus – und üben auf die Seele eine ‚élxis pròs ousían‘ – einen ‚Zug zum Sein hin‘ – aus. Oder von der Objektseite her gefragt: Wie wirft sich das Objekt mir entgegen – se mihi objicit – und wird so zur lebendigen Objektion gegen alle meine Vorurteile und Befangenheiten, ohne zum bloßen Stupendum zu werden, vor dem mein Denken verstummt? Wie kann die Sache ‚mir zu denken geben‘, statt mich durch die Übermacht der Eindrücke, die sie in mir hervorruft, zu verwirren oder durch die Faszination, die sie ausübt, am freien Urteil zu hindern? 2 Vgl. dazu das Opus postumum von Immanuel Kant; vgl. dazu auch unten Fußnote 8. 18 Richard Schaeffler Die gleiche Leitfrage stellt sich im Rahmen einer Theorie, die das Erkennen als ein ‚Lesen im Buche der Welt‘ versteht. Im Rahmen einer solchen Theorie, nimmt die Leitfrage der Transzendentalphilosophie folgende Gestalt an: Wie wird die Welt für mich zum lesbaren Text, ohne dass ich in sie einen Sinn hineinlege, der nur meine eigene subjektive Sicht der Dinge und damit mein eigenes Selbstbewußtsein spiegelt? Eine methodische Zwischenfrage muss hier gestellt werden: Was spricht eigentlich für diese Neuformulierung der transzendentalen Frage? Erst wenn wir den Unterschied zwischen ‚Buchstabieren‘ und ‚Lesen‘ betonen, wird deutlich: Zum Erkennen gehört immer auch eine Auslegungs-Leistung. Nicht schon die positivistisch beschriebene, sondern erst dies interpretierte Erscheinung gibt uns objektiv Gültiges zu erkennen. Auch die auf diese Weise neu formulierte transzendentale Frage entfaltet sich in die schon erwähnten Teilprobleme, die freilich nun auf neue Weise beantwortet werden. 2.1 Die Frage nach der Aufgabe des Subjekt Was muß ich ‚dazutun‘, damit die Sachen zum Sprechen kommen? Und was muß ich vermeiden, damit ich dort, wo ich auf die Sache zu hören meine, nicht vielmehr Selbstgespräche führe? Auf die erste Frage wird nun geantwortet werden müssen: Wir müssen unsere Anschauungsformen und Begriffe an den gelesenen Texten ‚bilden‘, weil nur eine solche ‚formatio mentis‘ uns fähig macht, die spezifische Kontext-Struktur zu erfassen, die dem, was der Text sagt, seine spezifische Bedeutung verleiht. Entsprechend wird die Antwort auf die zweite Frage lauten: Auch hier kommt es darauf an, besonders aufmerksam auf solche Passagen des Textes zu achten, die nicht unsere bisherige Sicht der Dinge bestätigen, sondern uns zu einem Perspektivenwechsel nötigen. Aber der Perspektivenwechsel, zu dem der gelesene Text mich nötigt, führt nicht immer, wie Hans-Georg Gadamer dies an einigen wichtigen Beispielen zeigen konnte, zur ‚Horizont-Verschmelzung‘, sondern immer wieder auch dazu, dass wir lernen müssen, die Einheit des Wirklichen in der bleibenden Verschiedenheit der Weisen zu suchen, wie es sich uns in unterschiedlichen Perspektiven präsentiert. 2.2 Eine erste Antwort auf die Frage nach dem ‚widerständigen Eigenstand‘ der Objekte Gerade das zunächst Fremdartige, mit der uns manche Bücher von Menschenhand begegnen, läßt uns erkennen: Auch das Buch der Welt, in dem die Autoren dieser Lesen im Buche der Welt 19 Bücher gelesen haben, ist in vielen Sprachen geschrieben. Die gleiche Wirklichkeit nimmt uns, in unterschiedliche Kontexte aufgenommen, auf unterschiedliche Weise in Anspruch. Und dieser Anspruch will durch unterschiedliche Weisen des Anschauens und Denkens beantwortet sein. Aber jede dieser Antworten entspricht dem Anspruch des Wirklichen nur in dem Maße, in welchem sie inmitten der gegebenen Antwort das Fremde des Wirklichen mit-benennt. Nur so kann inmitten unseres Anschauens und Denkens deutlich werden, dass das, was sich uns zeigt, sich in keiner der Weisen erschöpft, wie es für uns zum Gegenstand wird. Zu Beginn der hier vorgetragenen Überlegungen wurde die transzendentalphilosophische Frage auf die Formel gebracht: Wie kann das Objekt, das sich nur zeigt, wenn wir schon anschauen und denken, uns gegenüber jenen ‚widerständigen Eigenstand‘ wahren, kraft dessen es sich uns mit dem Anspruch auf objektive Geltung entgegenwirft? Die Erfahrung, die wir beim Lesen im Buche der Welt machen, gibt darauf eine Antwort: Der Eigenstand der Objekte gegenüber unserem Anschauen und Denken wird uns dadurch bewußt, dass das Wirkliche, das wir erfahren, uns in unterschiedlichen Kontexten begegnet: als Gegenstand der Forschung, als Quelle moralischer Verpflichtung, als Gegenstand religiöser Verehrung. So entfaltet sich das eine Buch der Welt in eine Vielzahl von Büchern. Diese Bücher sind in verschiedenen Sprachen geschrieben, die nicht bedeutungsgleich ineinander übersetzt werden können. Und dennoch gibt es Themen, von denen in jedem dieser Bücher die Rede ist. Daraus wird man folgern dürfen: Das Wirkliche erschöpft sich nicht in dem, was es in je einem besonderen Erfahrungskontext bedeutet, sei es der Kontext der Wissenschaft oder der Kunst, aber auch der Moral und der Religion. Aber in jedem Erfahrungs-Kontext zeigt es diesen Bedeutungs-Überschuß auf je besondere Weise an. Doch wird man hinzufügen müssen: Der Befund, dass das eine Buch der Welt sich in viele verschiedene Bücher entfaltet, ist nicht eindeutig. Die Tatsache, dass der gleiche Inhalt, in verschiedene Erfahrungskontexte aufgenommen, Unterschiedliches bedeutet, könnte auch als Anzeichen dafür gewertet werden, dass es nur von der subjektiven Betrachtungsart abhängt, auf welche Weise wir uns von den Inhalten unserer Erfahrung in Anspruch genommen fühlen. Dass es uns nicht gelingt, einen einzigen, umfassenden Erfahrungskontext aufzubauen, in den alle denkbaren Standorte des Betrachters und deshalb alle Perspektiven, die er gewinnt, eingeordnet werden können, erscheint dann als Anzeichen dafür, dass wir über derartige subjektive Perspektiven nicht hinauskommen und zu objektiv gültiger Erkenntnis unfähig sind. Auf diesen Befund beruft sich die subjektivistische Skepsis, die auf Wahrheit verzichtet und alle Beschreibung des Erkennens in die 20 Richard Schaeffler eine These zusammenfaßt: ‚Es ist alles eine Frage der Perspektive, unter der wir die Dinge betrachten.‘ 2.3 Die Frage nach dem ‚Autor des Buches der Welt‘ als Frage nach der rechten Auslegung unserer Welterfahrung Die folgenden Überlegungen werden zeigen: Die Erfahrung, dass das eine Buch der Welt sich in viele Bücher entfaltet, verliert ihre Zweideutigkeit, wenn wir diese vielen Bücher auf einen gemeinsamen Autor zurückführen: Die verschiedenen Weisen, wie uns die gleichen Dinge unter ihren Anspruch stellen, wenn sie uns in unterschiedlichen Erfahrungskontexten begegnen, können dann zugleich als die Erscheinungsgestalten der einen Weise verstanden werden, wie der identische göttliche Autor sich immer neu an uns wendet und uns dazu aufruft, seinen Blick auf die Dinge abbildhaft nachzuvollziehen. So verstanden ist Weg vom Text zum Autor zugleich der Weg zur Überwindung der Skepsis, die sich darauf beruft, dass die gesuchte Einheit der Wahrheit sich für uns in der Vielheit der Wahrheitsperspektiven verbirgt. 2.4 Eine abgrenzende Klärung der Fragestellung Die Frage, ob es möglich sei, vom Verstehen des Buches der Welt zur Erkenntnis seines Autors überzugehen, wird hier in transzendentalphilosophischer Absicht gestellt. Die Zuschreibung der vielen Bücher an einen und denselben Autor soll der Antwort auf die Frage dienen: Können wir die vielen, von unserer jeweiligen Erfahrungsart abhängigen Weisen, wie Wirkliches sich uns zeigt, als Erscheinungsgestalten der einen Wahrheit begreifen, die objektiv gilt? Das bedeutet: Die Frage nach dem Autor wird in hermeneutischer Absicht gestellt; es geht um die angemessene Auslegung unserer Welterfahrung. Wenn wir also den Weg vom Verständnis des Textes zur Erkenntnis des Autors gefunden haben, stellt sich die komplementäre Aufgabe, den Weg zurück vom Autor zu seinem Text zu finden.Und jede versuchte Aussage über den Autor muß sich als Anleitung zu einer Auslegung des Textes bewähren. Daraus ergibt sich zugleich eine Abgrenzung: Wer gelernt hat, in Büchern von Menschenhand zu lesen, wird alsbald bemerken: Man entdeckt die spezifische Weise, wie ein Autor seine Leser anredet, nicht primär dadurch, dass man nach Textstellen sucht, an denen der Verfasser seine Aussagen zur Sache unterbricht und zu ausdrücklichen Selbstaussagen übergeht. Weit deutlicher tritt die Eigenart des Lesen im Buche der Welt 21 Verfassers durch die Weise zu Tage, wie er die Sachen und Sachverhalte, von denen er spricht, so zur Sprache bringt, dass der Hörer veranlaßt wird, sie ‚zu seiner Sache‘ zu machen und ihren Anspruch durch seine Theorie und Praxis zu beantworten. An dieser Weise, von den Dingen zu sprechen, erkennt man die ‚Handschrift‘ des Autors oder seinen ‚Stil‘. Die Frage ist: Gilt dies auch vom Buche der Welt? An dieser Stelle darf angemerkt werden: Wird die philosophische Gottesfrage so verstanden, so wird sie von den ermüdenden Diskussionen darüber entlastet, ob in unserer Erfahrungswelt und in deren wissenschaftlicher Auslegung Gott vorkommen kann oder nicht. In jüngerer Zeit meinten Vertreter einer philosophischen Kosmogonie – insbesondere einer Urknall-Theorie – zu dem Ergebnis zu kommen: In der von ihnen ausgelegten Welt kann der göttliche Schöpfer nicht vorkommen; bekannt ist der Ausspruch von Stephen Hawking: ‚There is no place for any creator.‘ Um sich mit diesem Einwand auseinanderzusertzen, mußten Vertreter einer philosophischen Gotteslehre, die den Schöpfer am Anfang der Kausalreihe suchen, viel Mühe darauf verwenden, diese Kritik als Folge eines Fehlschlusses zu entlarven – und man kann nicht feststellen, dass sie mit all dieser Mühe einen erheblichen Eindruck auf die Vertreter dieser Art von Religionskritik gemacht hätten. Eine Theorie dagegen, die Gott als den Autor des Buches der Welt zu begreifen sucht, ist dieser zumeist wenig erfolgreichen Mühe enthoben. Die Tatsache, dass ein Autor in dem Buch, das er geschrieben hat, nicht vorkommt, beweist nichts gegen seine Autorschaft. Es wäre höchst töricht, mit Bezug auf Friedrich Schillers Wallenstein zu bemerken: ‚There is no place for any Frédéric Schiller!‘ Und niemand würde allein aus der Feststellung, dass Schiller in seinem Drama nicht auftritt, schließen wollen, das Drama sei nicht von ihm oder habe möglicherweise überhaupt keinen Autor. 3 Ein überraschender Befund: Kant als Auslegungshelfer These 2: Für eine Hermeneutik des Lesen im Buche der Welt ist Kants Postulatenlehre eine wichtige Auslegungshilfe 3.1 Kants Postulate als Auslegungsregeln Sucht man nun auf die soeben beschriebene Weise Gott nicht als einen besonderen Inhalt neben anderen Inhalten im Text des Buches der Welt, sondern als dessen Autor, dann kann schon jetzt gesagt werden: Es scheint möglich, in dieser Hinsicht von Immanuel Kant und seiner Postulatenlehre zu lernen. Denn die kantischen Postulate 22 Richard Schaeffler beschreiben ja nicht gewisse Teile der Erfahrungswelt, die uns sonst unzugänglich wären. Sie sind insofern keine besonderen Teile des ‚Textes der Welt‘, sondern legen den Anspruch der Dinge als die Erscheinungsgestalt einer göttlichen Anrede aus. Das klassische Beispiel dafür ist ‚die Erkenntnis unserer Pflichten als göttlicher Gebote‘.3 Entscheidend für das Verständnis dieser Aussage ist, dass die Postulate der Vernunft als Auslegungsregeln verstanden werden müssen. Das hermeneutische ‚als‘ in der soeben zitierten Formel ‚Erkenntnis unserer Pflichten als göttlicher Gebote‘ deutet diese hermeneutische Funktion der Postulate an. Für das Lesen im Buche der Welt bedeutet dies, dass Kant unsere sittlichen Erfahrungen, für deren Zustandekommen wir selbst durch unsere Ideen und Begriffe verantwortlich sind, als die Erscheinungsgestalten einer spezifischen Form der göttlichen Anrede begreift: als die Erscheinungsgestalten des göttlichen Gebotes. Aber was Kant an diesem Beispiel zeigt, gilt für jede Weise, wie aus unserem Anschauen und Denken, ohne dass sich uns nichts zeigen könnte, der Gegenstand in seiner bleibenden Fremdheit und zugleich in seiner unausweichlichen Maßgeblichkeit hervortritt. Der Gegenstand verdankt diese Fähigkeit, uns als Maßstab unserer wahren und falschen Urteile gegenüberzutreten, dem Umstand, dass er die Erscheinungsgestalt ist, in der Gott sich uns zuwendet und uns zur Antwort ruft. 3.2 Verschiedene Fassungen der Postulatenlehre Der Weg, auf dem Kant von unserer Erfahrung zur Gotteserkenntnis gefunden hat, führte von der Entdeckung einer unvermeidlichen Dialektik zu deren Aufhebung durch das Gottespostulat. Aber die Weise, wie Kant diese Dialektik beschrieben hat, war nicht immer die gleiche. In der Kritik der praktischen Vernunft geht es um die Divergenz zwischen den Bedingungen für die Reinheit der sittlichen Gesinnung und den Bedingungen für die Wirksamkeit der sittlichen Tat. Zur Überwindung der daraus entstehenden Dialektik ist das Postulat eines Gottes nötig, der als Herr der Natur den Weltlauf so lenkt, dass die Tat, die aus sittlicher Gesinnung getan wird, zugleich dazu beiträgt, die moralische Absicht des göttlichen Gesetzgebers zu erreichen. So wird dieser Gott zum Mittelglied, ‚vermitttelst dessen‘ die aus sittlicher Gesinnung hervorgehende Tat ihren ‚Endzweck‘ erreicht.4 In der Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft liegt der Kern des Problems darin, dass wir jene 3 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, 1788, A 233; Ders., Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 1793, 21794, B 229. 4Kant, Kritik der praktischen Vernunft, A 207. Lesen im Buche der Welt 23 Reinheit der sittlichen Gesinnung, über deren Wirkungslosigkeit in der Welt, wie sie ist, wir klagen könnten, gar nicht besitzen. Das Sittengesetz selbst überführt uns der Unreinheit unserer Gesinnung und verlangt deshalb von uns, ehe wir zur Tat schreiten können, zunächst eine moralische Umkehr. Diese Forderung aber scheint widersprüchlich zu sein. Denn um eine solche Umkehr auch nur zu wollen, müßten wir die reine Gesinnung schon haben; Umkehr ist aber gerade deswegen nötig, weil diese Reinheit der Gesinnung uns noch fehlt. Die Überwindung dieser Dialektik erfordert das Postulat eines ‚Urteilsspruchs aus Gnade‘, der dem Sünder die Umkehr nicht abnimmt, sondern ihn zu ihr befähigt. Im Streit der Fakultäten schließlich tritt die Erfahrungsbasis der scheinbar abstrakten Argumentation Kants zutage. Er hat, wie viele seiner Zeitgenossen, mit Schrecken beobachtet, wie während der Französischen Revolution das Pathos der Moralität, von dem die Revolutionäre erfüllt waren, in den Terror umgeschlagen ist. Und er fand dafür einen zweifachen Grund: Der erste Grund lag in jenem Selbst-Mißverständnis der ‚Gerechten‘, die eines ‚Urteilsspruchs aus Gnade‘ nicht zu bedürfen meinen und deshalb das Böse nur bei den Gegnern ihrer revolutionären Programme suchen. Diese Feinde der Umgestaltung der bestehenden Welt in eine ‚moralische Weltordnung‘ wollten sie mit Mitteln der Gewalt überwinden, um der moralischen Weltordnung zum Siege zu verhelfen. Doch zeigte sich, dass sie auf diesem Wege das erstrebte Ziel gerade verfehlen mußten. Die Revolution, um der moralischen Weltordnung willen begonnen, endete in neuer Unterdrückungsgewalt. Der zweite Grund lag in einem Mißverständnis der sittlichen Tat, zu der die Revolutionäre sich verpflichtet wußten: Sie verstehen diese Tat als ein Mittel, das die moralische Weltordnung als ihren Zweck hervorbringen kann. Recht verstanden aber ist die sittliche Tat nicht ein solches Mittel, sondern das wirksame Zeichen für ein Reich Gottes, das nur Gott selber hervorbringen kann. Kant benutzt zur Kennzeichnung dieses Verständnisses der sittlichen Tat Ausdrücke, die er dem christlichen Verständnis der Sakramente entlehnt hat: Die sittliche Tat ist „signum rememorativum, demonstrativum et prognostikon“ des göttlichen Heilswirkens, das dieses Reich immer schon gewirkt hat, gegenwärtig wirkt und künftig wirken wird.5 3.3 Eine weiterführende Auslegung Aus dem Gesagten kann man die Folgerung ziehen: Wenn die Verwechselung eines irdischen Abbilds mit seinem göttlichen Urbild das Wesen aller Idololatrie 5 Immanuel Kant, Streit der Fakultäten, 1798, A 142. 24 Richard Schaeffler ausmacht, dann ist es die Idololatrie menschlicher moralischer Programme, die den Umschlag der Moralität in der Terror verursacht hat. Der Gedanke, dass unsere Taten die Erreichung der göttlichen Heilsabsicht nicht bewirken, wohl aber, den christlichen Sakramenten vergleichbar, sich zu diesem göttlichen Wirken wie ‚signa efficacia‘ verhalten, wird von Kant an der zitierten Stelle nur angedeutet, nicht ausgeführt. Und doch scheint in diesem Gedanken der Schlüssel zu liegen, der auch die beiden früheren, ausführlicheren Darstellungen der Vernunftdialektik und ihrer Auflösung durch Postulate erst verständlich macht: Ergab sich der Terror der Französischen Revolution aus einer Idololatrie des Moralischen, dann ist es die Idololatrie des wissenschaftlichen Erkennens, die den Eindruck entstehen läßt: Weil in derjenigen Welt, die nach den regulativen Ideen dieser besonderen Erkenntnisart aufgebaut wird, weder Freiheit noch sittliche Verantwortung vorkommen, meint man, Freiheit und sittliche Verantwortung seien Fiktionen und das Sittengesetz sei ‚auf eingebildete, leere Zwecke gestellt‘. Und das Gleiche gilt auch für jene moralische Resignation, die sich in dem Urteil ausspricht, das Gewissens-Urteil, das uns der Notwendigkeit der Umkehr überführt, beweise zugleich, dass diese Umkehr notwendig sei. Auch dieses Ergebnis ergibt sich nur, wenn wir vergessen, dass dieses Gewissensurteil die für uns erfahrbare Abbildgestalt jenes göttlichen Urteils ist, das uns nicht nur zu richten, sondern zugleich zu retten vermag. So verstanden erinnert die Dialektik der Vernunftideen uns daran, dass der Text des Buches der Welt uns verwirrt und irreführt, wenn wir in ihm nichts anderes entdecken als die Gesetzmäßigkeiten, die wir selbst in ihn hineingelegt haben. Bleiben wir bei diesem subjektivistischen Mißverständnis stehen, dann verstricken wir uns in all jene Widersprüche, die Kant zutreffend aufgewiesen hat. Aus der Strukturverschiedenheit unserer Erfahrungskontexte entsteht so jene Dialektik, die uns veranlassen kann, an der objektiven Geltung jeder unserer Erfahrungen irrezuwerden. Diese Konsequenz kann nur dadurch vermieden werden, dass wir in den einzelnen Inhalten, die uns innerhalb je eines besonderen Erfahrungs-Kontextes begegnen, die Erscheinungsgestalten der einen Anrede des einen Gesetzgebers entziffern, der uns auch in den übrigen Kontexten unter seinen Anspruch stellt. Auf solche Weise bewähren sich die Postulate als Auslegungsregeln zum Lesen im Buche der Welt. Es ist der gleiche Autor, der in den verschiedenen Büchern zu uns spricht, in die das Buch der Welt zu zerfallen scheint. Für das Weltverstehen aber bedeutet das: Wir können uns auf die Ergebnisse unseres theoretischen und praktischen Vernunftgebrauchs verlassen. Denn wir dürfen die Vernunft-Gesetze, nach denen wir die Welt unserer Erkenntnisgegenstände und unserer sittlichen Handlungsziele aufbauen, die Gesetze der Logik und das Sittengesetz, als die Erscheinungsgestalten göttlicher ‚Gebote‘ – Mandata – verstehen. Dann begreifen Lesen im Buche der Welt 25 wir sie als ‚Aufträge‘, die Gott uns ‚anvertraut‘ – commendat – und denen wir uns unsererseits anvertrauen können. In diesem Vertrauen können wir dessen gewiß sein, dass unsere Theorie und Praxis nicht ‚auf eingebildete, leere Zwecke gestellt‘ ist, sondern auf objektiv gültigen Erkenntnissen beruht. 4 Das Programm einer neu verstandenen Transzendentalphilosophie: Unsere Erfahrungen als den ‚Text‘ zu verstehen, der die ‚Handschrift des Autors‘ erkennen läßt These 3:Beim Lesen im Buche der Welt wird zugleich die Handschrift eines Autors erkennbar. Auf diese Weise öffnet sich ein Weg von der allgemeinen Transzendentalphilosophie zur transzendentalen Theologie. Dann erscheint Gott als der Autor des Buches der Welt. 4.1 Die kantische Auslegungsregel: die absolute Geltung alles Wahren und Guten als ‚Handschrift des Autors‘ Orientiert man sich bei dem Versuch, im Buch der Welt die Handschrift seines Autors zu entdecken, an Kant, dann wird man sagen können: Diese Handschrift des Autors wird in dem unbedingten Geltungsanspruch erkennbar, den auch die kleinsten Gegenstände unserer Theorie und Praxis gegen uns erheben. Auch der unscheinbarste Gegenstand unserer theoretischen Erfahrung wird zur Instanz, an der ganze Theorie-Gebäude, die sich bisher als orientierungskräftig bewährt haben, zerbrechen können. Wahrheit ist, in welcher Gestalt immer sie begegnet, von unbedingter Geltung, vorausgesetzt, sie ist durch hinlängliche Argumente gesichert. Noch deutlicher gilt dies vom Geltungsanspruch der sittlichen Pflicht. Auch das kleinste Gebot im Gesetz der Sittlichkeit verlangt unbedingten Gehorsam. Und selbst der erfolgreiche Dienst an erhabenen Zielen der sittlichen Praxis wiegt die Nachlässigkeit nicht auf, mit der wir uns über ein solches ‚kleines Gebot‘ hinweggesetzt haben. Die Moral kennt keine Kompensation ‚kleiner Sünden‘ durch ‚große Verdienste‘. Erst diese Erfahrung von der unbedingten Geltung auch des unscheinbarsten Wahren und Guten macht es verständlich, dass Kant sich von dem erfahrenen Anspruch auch dann nicht dispensiert glaubt, wenn unvermeidlich auftretende Widersprüche den Anschein erwecken, als sei dieser Anspruch „auf leere, einge- 26 Richard Schaeffler bildete Zwecke gestellt“.6 Statt sich diese Erfahrung von der unbedingten Geltung des Guten und Wahren durch irgendwelche Vernünfteleien ausreden zu lassen, hält Kant jede Annahme für gerechtfertigt, die notwendig ist, um diesen Anschein aufzulösen. Nun gibt es eine einzige mögliche Annahme, die solche Vernünfteleien aufzulösen und die Erfahrung unbedingter Geltung ins Recht zu setzen vermag: Sie besteht darin, die unbedingte Verpflichtung, die wir erfahren, als die Erscheinungsgestalt eines göttlichen ‚Mandatum‘ zu verstehen. Wenn es aber keine andere Annahme gibt, die den Anspruch des Wahren und Guten auf unbedingte Geltung rechtfertigen kann, dann ist es eben dadurch gerechtfertigt, unsere Verpflichtung, diesen Geltungsanspruch anzuerkennen, als Erscheinungsgestalt eines göttlichen Gebotes zu verstehen. 4.2 Eine abweichende Antwort im Zeitalter wachsender Subjektivitätskritik In jüngerer Zeit ist die Kritik an der Subjektivität und ihrer angemaßten Herrschaft über die Gegenstandswelt immer radikaler geworden. Der Grund für diese Kritik liegt vor allem in der Erfahrung von der Gefährdung des Menschen und der Welt durch eine ungezügelte technische Naturbeherrschung. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrung entsteht der Anschein, als sei es nicht mehr möglich, die Gesetzgebung der Vernunft über die Natur und die Welt der Zwecke als die erfahrbare Abbildgestalt einer göttlichen Gesetzgebung zu begreifen und so in der Erfahrungswelt, die wir nach diesen Vernunftgesetzen aufbauen, die ‚Handschrift‘ des göttlichen Schöpfers zu entdecken. Eine Transzendentalphilosophie, die den Verdacht zurückweisen will, sie bringe nur den Herrschaftswillen der Vernunft auf seinen philosophischen Begriff, wird vor allem an jener Frage festhalten müssen, die an früherer Stelle im hier vorgetragenen Gedankengang als die Leitfrage einer weiterentwickelten Transzendentalphilosophie bezeichnet worden ist: Wie kann das Objekt, das sich nur zeigt, wenn wir schon anschauen und denken, uns gegenüber jenen ‚widerständigen Eigenstand‘ wahren, kraft dessen es sich uns mit dem Anspruch auf objektive Geltung ‚entgegenwirft‘? Man kann diese Frage auch auf folgende Weise formulieren: Wie gewinnt und behält unsere Erfahrungswelt jenen ‚widerständigen Eigenstand‘ gegenüber dem Subjekt, kraft dessen sie ihm als Maßstab des Wahren und Falschen entgegentreten kann? Wie ‚machen die Dinge das‘, dass sie uns so ‚zu denken geben‘, dass sie uns nicht faszinieren und unfrei machen, sondern im Gegenteil zum kritischen Urteil 6 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, A 205. Lesen im Buche der Welt 27 über uns selber befähigen und uns so aus unseren Befangenheiten und Vorurteilen befreien? Versteht man die transzendentale Frage so, dann wird diese befreiende Macht der Dinge zur Handschrift des göttlichen Autors, der im Buche der Welt zu uns spricht. Nun können die Dinge uns nur dann mit ihrem befreienden Anspruch begegnen, wenn wir unsererseits durch unser kritisches Urteil zwischen dem, was objektiv gilt, und dem, was uns zu Fehlurteilen verführen könnte, unterscheiden. Wenn der objektiv gültige Anspruch der Dinge es ist, der uns aus unseren Befangenheiten zur Freiheit des Urteils befreit, dann ist es dieses unser freies Urteil, das diesen objektiv gültigen Anspruch der Dinge aus mancherlei Verdeckungen durch trügerischen Schein löst. Erst dadurch wird der Gegenstand fähig, uns in der Eindeutigkeit seiner Geltung gegenüberzutreten. Darum ist die soeben gegebene Antwort auf die Frage nach der Handschrift des Autors noch einmal zu ergänzen und zu präzisieren: Alle Erfahrung beruht auf dem Wechselverhältnis zwischen der befreienden Macht der Dinge, die uns zum kritischen Urteil fähig machen, und der ermächtigenden Urteilsfreiheit des Subjekts, das den Anspruch der Dinge aus mancherlei Verdeckungen erst hervortreten läßt. Dieses Wechselverhältnis ist allen Teilen unserer Erfahrungswelt eingeschrieben und läßt die Handschrift des Autors erkennen, der uns das Buch der Welt vorlegt und uns zugleich befähigt, es zu lesen. Indem wir in allem, was wir erfahren, diese Handschrift des Autors entziffern, werden die Prädikate ‚befreiende Macht‘ und ‚ermächtigende Freiheit‘ zu Gottesprädikaten: An ihnen erkennen wir den Autor des Buches der Welt, der uns auf seine unverwechselbare Weise unter seine Anrede stellt. Und er stellt uns unter seine Anrede, indem er die Objektwelt und uns in jenes Wechselverhältnis von ‚befreiender Macht‘ und ‚ermächtigender Freiheit‘ gesetzt hat, das jeder Begegnung mit Gegenständen unserer Erfahrung zugrundeliegt. 4.3 Folgerungen für das Verständnis des Buches der Welt a. Ein neu formuliertes Postulat Der eine Satz ‚Wir dürfen unsere Pflichten als göttliche Gebote erkennen‘ kann als eine Kurzformel verstanden werden, in der die gesamte kantische Postulatenlehre zusammengefaßt ist. Auf ähnliche Weise führt die hier vorgeschlagene weiterentwickelte Transzendentalphilosophie auf ein Postulat, in dem das Gottes- und Weltverständnis dieser Philosophie zusammengefaßt ist: „Die Vielfalt der Weisen, wie das Wirkliche uns in Anspruch nimmt und zum Aufbau unterschiedlicher Erfahrungswelten herausfordert, darf als eine Vielfalt von Abbild- und Gegenwarts- 28 Richard Schaeffler gestalten der einen Weise verstanden werden, wie wir ‚in omnitudine realitatis‘, d. h. in allem, was ist und geschieht, von einer göttlichen Wirklichkeit in Anspruch genommen und zur Antwort herausgefordert werden.“7 b. Die Zweideutigkeit unserer Erfahrungswelt und ihre Überwindung Das so formulierte Postulat benennt ebenso wie das kantische die Bedingung, die die unterschiedlichen Erfahrungsweisen miteinander versöhnen kann. Aber in der hier vorgeschlagenen Gestalt orientiert sich das Postulat nicht einseitig an der sittlichen Erfahrung, der ‚Erkenntnis unserer Pflichten‘, sondern gibt allen Erfahrungsarten gleiches Gewicht. Gerade deswegen kann es verständlich machen, warum das eine Buch der Welt sich in eine Vielzahl von Büchern entfaltet. Und darum kann das so formulierte Postulat auch die Zweideutigkeit aufklären, die sich aus der Tatsache ergibt, dass die gleichen Gegenstände uns in unterschiedlichen ‚Welten‘ begegnen und uns dann auf höchst unterschiedliche Weise zu denken geben, dass also das eine Buch der Welt für uns in viele Bücher zerfällt. Diese Tatsache läßt, wie schon oben erwähnt, gegensätzliche Deutungen zu. Sie kann als Ausdruck dafür verstanden werden, dass die Dinge in keiner der Weisen, wie wir sie denken, erschöpfend erfaßt werden. Gerade dadurch wahren sie gegenüber jeder Weise, wie wir sie anschauen und denken, ihren ‚widerständigen Eigenstand‘ und werden so zu Objekten, die uns mit dem Anspruch auf Maßgeblichkeit gegenübertreten. Die gleiche Erfahrung kann aber auch als Ausdruck dafür verstanden werden, dass keine der Weisen, wie uns die Dinge begegnen, objektive Geltung beanspruchen kann, dass vielmehr alles subjektive Perspektive ist. Nun gehen beide Deutungen davon aus, dass es uns nicht gelingt, einen einzigen Kontext aufzubauen, innerhalb dessen die Gegenstände unterschiedlicher Erfahrungsarten ihre angemessen Stelle finden könnten. Das soeben vorgeschlagene Postulat aber macht diesen Sachverhalt daraus begreiflich, dass jede der Arten, wie die Gegenstände unserer Erfahrung uns begegnen, die bloße, aber zugleich wirkliche Gegenwartsgestalt einer göttlichen Anrede sei. Vergißt man, dass es sich um bloße Gegenwartsgestalten eines anderen, göttlichen Anspruchs handelt, dann wird für jede Weise, wie wir das Wirkliche erfahren, eine absolute Geltung in Anspruch genommen, die jede andere Art des Geltens ausschließt. Dann wird beispielsweise die spezifische Geltungsart des Gegenstands wissenschaftlicher Forschung zum Maßstab, an dem alle anderen Forme, unser Anschauen und Denken in Anspruch zu nehmen, gemessen und dann verworfen werden. 7 Richard Schaeffler, Erfahrung als Dialog mit der Wirklichkeit. Eine Untersuchung zur Logik der Erfahrung, Freiburg i. Br. u. München 1995, S. 685. Lesen im Buche der Welt 29 Der ‚Dogmatismus‘ einer einzelnen Erfahrungsart, zum Beispiel der wissenschaftlichen Empirie, erweist sich so als die Folge einer Idololatrie, die die Differenz zwischen Urbild und Abbild vergißt. Erweist dieser Dogmatismus sich als unhaltbar, schlägt er um in den Skeptizismus, der keiner der Arten, wie das Wirkliche sich zeigt, objektive Geltung zuerkennen will. Man kann diesen Skeptizismus als eine Art von erkenntnistheoretischem Ikonoklasmus verstehen, der den bloßen Abbildern den Charakter wirklicher Abbilder bestreitet. Ein solcher Ikonoklasmus freilich versperrt sich selber den Weg der Erkenntnis, weil die befreiende Anrede Gottes nicht anders als in ihren welthaften Abbildern erfahrbar wird. Das hier vorgeschlagene Postulat leitet uns dazu an, weder idololatrisch den Anspruch der Weltwirklichkeit, den wir in der Vielfalt unserer Erfahrungen vernehmen, mit der befreienden Anrede Gottes gleichzusetzen, noch ikonoklastisch diese ‚trügerische Welt‘ zu verachten, weil sie uns die allein wahrhaft befreiende Anrede Gottes nicht zu vermitteln vermag. Nicht selten ist gerade bei religiösen Menschen diese Geringschätzung der Welterfahrung mit dem fiktiven Anspruch verbunden, eine weltlose Unmittelbarkeit zu Gott gewonnen zu haben, die der Vermittlung durch die Erkenntnis innerweltlicher Gegenstände nicht bedarf. Indem das Postulat uns anleitet, sowohl den idololatrischen als auch den ikonoklastischen Irrweg zu vermeiden, leistet es das, was man von Postulaten erwarten muß und bewährt sich als eine Auslegungsregel für das Lesen im Buche der Welt. 5 Ein Ausblick: Die transzendentale Theologie als ‚höchster Standpunkt‘ der Transzendentalphilosophie These 4: Auf diese Weise erweist der Versuch, im Buche der Welt die Handschrift eines göttlichen Autors zu entziffern, sich als der ‚höchste Punkt der Transzendentalphilosophie‘ Kant hat an einer Stelle in seinem Opus postumum die transzendentale Theologie als den „höchsten Standpunkt der Transzendentalphilosophie“ bezeichnet.8 Sie ist derjenige Standort, den man einnehmen muß, um das gesamte Themenfeld der Transzendentalphilosophie zu überblicken. Nun fällt bei Kant die transzendentale Theologie zusammen mit seiner Postulatenlehre. Von Gottes Existenz und von seinem Wesen als oberster Gesetzgeber der Natur und des Reichs der Zwecke läßt sich auf keine andere Weise philosophisch sprechen als durch den Nachweis, dass dieser 8 Immanuel Kant, Opus postumum, 7. Konvolut, 5. Blatt. 30 Richard Schaeffler Gott ‚postuliert‘ werden muß, wenn wir der objektiven Geltung unserer Erfahrung, vor allem der sittlichen, gewiß bleiben wollen. Die Frage nach den Bedingungen objektiv gültigen Erkennens ist die Leitfrage der gesamten Transzendentalphilosophie. Und es ist das Gottespostulat, durch das die Transzendentalphilosophie diese Frage abschließend beantwortet. Das gilt ohne Einschränkung auch für die hier vorgeschlagene Weiterentwicklung der Transzendentalphilosophie. Die Frage,wie es möglich sei, zu objektiv gültigen theoretischen und praktischen Einsichten zu gelangen, wird hier in zwei Argumentationsstufen beantwortet: Objektiv gültige Erkenntnis ist möglich, weil die Dinge uns inmitten eines Kontextes, den wir ihrem Erscheinen durch unsere Anschauungsformen, Ideen und Begriffe bereiten, in ‚widerständigem Eigenstand‘ gegenübertreten und so für uns zu Maßstäben des Wahren und Falschen werden. Und sie können uns so begegnen, weil die Art wie sie uns ‚zu denken geben‘, als die Erscheinungsgestalt der Anrede Gottes verstanden werden kann – als bloße Erscheinungsgestalt, die der kritischen Auslegung bedarf, aber zugleich als wirkliche Erscheinungsgestalt, in der diese Anrede Gottes erfahrbar wird und uns zur Antwort ruft. Auf solche Weise verweist uns der Text des Buches der Welt auf seinen Autor; und die Transzendentalphilosophie führt zuletzt zu einer postulatorischen Theologie. Erst die so verstandene transzendentale Theologie gibt die abschließende Antwort auf die eingangs gestellte Frage: Wie wird etwas zum Gegenstand für mich, ohne dadurch zum bloßen Moment meines Selbstbewußtseins zu werden? Wie gewinnt das Objekt, das sich nur zeigt, wenn wir schon anschauen und denken, uns gegenüber jenen ‚widerständigen Eigenstand‘, kraft dessen es sich uns mit dem Anspruch auf objektive Geltung ‚entgegenwirft‘ – se nobis objicit? Die Antwort lautet: Die Objekte gewinnen, inmitten ihres Erscheinens, diesen Eigenstand gegenüber unserem Anschauen und Denken, indem ihr Anspruch auf objektive Geltung sich als die Erscheinungsgestalt erweist, in der das ‚Mandatum‘, das Gott uns anvertraut, für uns erfahrbar wird. Der Gott, dessen Existenz wir auf solche Weise postulieren, ist es, der uns dazu befähigt, im kritisch auslegenden Urteil über die Erscheinungen zugleich die objektive Geltung des Wahren und Guten zu erfassen, das in ihnen für uns erkennbar wird. Mit anderen Worten: Es ist der so postulierte Gott, der uns zum Lesen im Buche der Welt fähig macht. Gott als Grund der Wirklichkeit Hans Otto Seitschek Die Argumentation für und wider die Existenz Gottes ist eine zentrale Debatte in der Theologie und auch in der Philosophie in ihrer religionsphilosophischen Perspektive. Mit der Existenz Gottes steht und fällt aber nicht nur der Glaube an Gott, sondern auch die Möglichkeit einer Begründung ganz generell. Es ist dabei wichtig zu unterscheiden, dass es nicht um eine Begründung Gottes geht, sondern eher um die Frage einer belastbaren Argumentation für die Existenz Gottes. Ist eine solche überzeugende Argumentation gelungen, ist Gott philosophisch gewissermaßen als ‚archimedischer Punkt‘ anzusehen, von dem aus eine grundlegende Begründung der Wirklichkeit, also von Sein, Welt und Person, erfolgen kann. Gott ist nicht bloß Ursache, sondern mehr noch Grund des Seins im Sinne der klassisch metaphysischen Überlegung des ‚Satzes vom zureichenden Grund‘, dem zufolge für alles ein zureichender, suffizienter Grund vorhanden sein muss. Als höchste beziehungsweise letzte Realität gehört Gott selbst dieser Wirklichkeit an. Gott ist nach Thomas von Aquin jederzeit ‚causa prima‘ – erster Grund1 – und ‚ens a se‘ – Sein aus sich heraus2 – . Dieses ‚Sein aus sich heraus‘ wird als ‚Aseität‘ bezeichnet. Gott ist demnach selbst das Sein, gleichzeitig ist zwischen dem Sein Gottes und dem geschaffenen Sein zu unterscheiden. Das geschaffene Sein, die Schöpfung, hat ihr Sein von Gott erhalten, so dass Gott Grund des Seins der Schöpfung ist. Gleichzeitig ist Gottes Sein keine Selbstbegründung für die geschaffene Wirklichkeit, da das aus sich seiende, ‚primäre‘ Sein Gottes als des Schöpfers vom geschaffenen, zeitlich nachgeordneten, ‚sekundären‘ Sein der Schöpfung zu differenzieren ist. Diese Überlegungen knüpfen an das ontologische Argument für die Existenz Gottes an, wie es in unterschiedlicher Formulierung bei Aurelius 1 2 Vgl. Thomas von Aquin, Summa Theologiae, Ia, q. 2, a. 3. Vgl. Thomas von Aquin, De Ente et Essentia, V, 42: „Aliquid enim est, sicut Deus, cuius essentia est ipsummet suum esse.“ 31 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7_3 32 Hans Otto Seitschek Augustinus, Anicius Manlius Severinus Boethius und Anselm von Canterbury, aber auch bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu finden ist: Gott ist das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, deshalb muss ihm Existenz zukommen, da er sonst nicht das Größte wäre, was gedacht werden kann, würde ihm doch die Existenz zur Vollkommenheit fehlen. Andere Argumente für die Existenz Gottes schließen von der Existenz der Welt auf die Existenz Gottes, wie die ‚quinque viae‘ des Thomas von Aquin, die auf der realphilosophischen Metaphysik von Aristoteles beruhen. Ebenfalls von der Welt gehen die Wahrscheinlichkeitsüberlegungen bei Richard Swinburne3 aus: Durch die Hypothese der Existenz Gottes wird die Wahrscheinlichkeit für das Dasein der Welt erhöht, umgekehrt wird dadurch die Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes erhöht, da das Dasein der Welt offenkundig ist. Neuere Überlegungen, so bei Robert Spaemann, gehen von der absoluten Wahrheit und deren Begründung aus.4 Gott ist dabei nicht als Schlussstein in einem philosophischen System anzusehen, das den personalen, lebendigen Gott zu sehr einschränken oder einengen würde, sondern als Grund, der außerhalb eines philosophischen Systems steht. Diese Vorüberlegungen zeigen, dass es in der philosophischen Argumentation um die Existenz Gottes vor allem auch um transzendentalphilosophische Fragestellungen geht, nicht allein um transzendente Fragestellungen. Während transzendente Fragen sich auf Gott und seine Seinsweise richten, zielen transzendentale Fragestellungen auf die Bedingungen der Möglichkeiten von Sein und Erkenntnis ab. Diese letzteren Fragen verbleiben zunächst ganz im Rahmen eines philosophischen Begründungszusammenhangs und greifen nicht auf das Religiöse oder den Glauben aus. Daraus folgt, dass die philosophische Relevanz der Auseinandersetzung mit der Existenz Gott nicht religiösen Charakter trägt, sondern insbesondere der Möglichkeit der Begründung dient. Dieser Gedanke besteht aus zwei Schritten beziehungsweise Fragestellungen: 1. Inwiefern sind Begründungen überhaupt notwendig? 2. Ist Gott ein guter, vernünftiger Grund für etwas? Zunächst ist in der Tat zu fragen, inwiefern Begründungen notwendig sind. Eine der Hauptaufgaben der Philosophie besteht darin, Voraussetzungen des Denkens, die durchaus nicht sofort offenbar sein müssen, zu klären, um so zu einem möglichst voraussetzungslosen Denken zu gelangen, also zu einer Reinform des Denkens. 3 Vgl. Richard Swinburne, The Existence of God, Oxford 1979, 22004, S. 328-342; dt.: Die Existenz Gottes, Stuttgart 1987, S. 384-404: Kap. 14: Das Abwägen der Wahrscheinlichkeiten. 4 Robert Spaemann, Der letzte Gottesbeweis, München 2007, S. 9-32, hier S. 26-32. Gott als Grund der Wirklichkeit 33 Jedes menschliche Tun, jede Handlung eines Menschen setzt eine Motivation, einen Grund für das voraus, was getan wird. Anders kann menschliches Handeln – πρᾶξις – nicht gedacht werden, wenn man es in Anlehnung an Aristoteles als zielgerichtetes Tun auffasst. Menschliches Handeln hat ein Woher und Wohin. Doch nicht nur das Handeln, sondern auch die Wirklichkeit als solche, das Sein, die Existenz des Menschen als Person, bedürfen eines Grundes. Dieser Grund kann nun in einem nicht weiter reflektierten Gefühl liegen oder er kann als nicht wichtig angesehen und damit vernachlässigt oder implizit vorausgesetzt werden. Im Extremfall wird auf eine solche Begründung ganz generell verzichtet. Insbesondere die Philosophie der Postmoderne entzieht sich dieser Begründungspflicht, indem sie vor der Aufgabe der starken Begründung der Wirklichkeit kapituliert und sich mit einem „pensiero debole“ – einem schwachen Denken – begnügt, wie es Gianni Vattimo tut.5 Doch damit verliert die Philosophie die rationale Suche nach Gründen und deren Prüfung, was nicht zuletzt ein Abschied vom Projekt der Aufklärung darstellen würde, wie es Rémi Brague beklagt.6 Auch die Gefahr einer ideologischen Aufladung von Gründen ist gegeben, wenn deren vernünftige Untersuchung unterbleibt. Die Aufgabe der rationalen Prüfung von Begründungszusammenhängen ist also notwendig, wenn nicht ein Verzicht auf Vernunft überhaupt oder die Gefahr der weltanschaulichen Ideologisierung in Kauf genommen werden, was nicht wünschenswert, ja sogar gefährlich ist. Das Interesse an einer vernunftorientierten und wissenschaftlichen Ergründung und Untersuchung der Wirklichkeit ist unzweifelhaft größer als das Bestreben nach einem Verzicht auf eine solche Untersuchung. Hier setzt der zweite Gedankenschritt ein: Was macht einen Grund zu einem guten, starken Grund? Diese ebenfalls klassische Frage der Philosophie geht davon aus, dass für einen komplexen Zusammenhang, wie ihn die Wirklichkeit mit ihren Vorgängen darstellt, ein einfacher, nicht-komplexer Grund benötigt wird. Andernfalls könnte man beispielsweise die Welt oder menschliche Handlungen nur als ‚facta bruta‘, als bloße Gegebenheiten ohne vernünftigen Grund hinnehmen. Auch eine weitere natur- oder sozialwissenschaftliche Untersuchung von Welt, Mensch und Gesellschaft würde sich dann erübrigen, da über eine bloße Gegebenheit ohne vernunftorientierte Struktur nichts aussagbar wäre, außer bloße Beschreibungen 5 Gianni Vattimo, Dialettica, differenza, pensiero debole, in: Il pensiero debole, hg. v. Gianni Vattimo u. Leonardo Amoroso, Mailand 1988, S. 12-28, hier S. 12 f., S. 21-23 u. S. 26 f. 6 Siehe Rémi Brague, Les ancres dans le ciel, Paris 2011, und Ders., Seinsgrund und Grundgebot, in: Deutsches Jahrbuch Philosophie, Bd. 4: Welt der Gründe, hg. v. Elif Özmen u. Julian Nida-Rümelin, Hamburg 2012, S. 1122-1131, hier S. 1124-1126. 34 Hans Otto Seitschek wechselnder Zustände, was wiederum wissenschaftlich sehr unbefriedigend wäre. Eine umfassende transzendentale, nicht transzendente, Begründung des Seins und der Wirklichkeit ist also durchaus sinnvoll und vernünftig. Also ist demnach ein in sich einfacher, ewiger, überzeitlicher, unbegrenzter und ungeschaffener Grund notwendig, um einen komplexen Gegenstand der Wirklichkeit, wie die Welt und ihre Abläufe, sinnvoll und vernünftig begründen zu können. Folgt man der Argumentation von Swinburne, erhöht eine solche einfache Begründung für einen komplexen Zusammenhang die Wahrscheinlichkeit des Bestehens dieses ohnehin bekannten komplexen Zusammenhangs, wie dies bei der Existenz der Welt der Fall ist.7 Demnach wäre ein einfacher, ewiger, überzeitlicher, unbegrenzter und ungeschaffener Grund durchaus ein guter, ja sogar ein vollkommener und letzter Grund für die Existenz der Welt. Doch muss dieser Grund gleich mit Gott, gar mit dem Einen und Dreifaltigen gleichgesetzt werden? Genügt nicht die Begründung der Wirklichkeit ausgehend vom Subjekt als Descartesscher ‚res cogitans‘? Diesem Einwand ist entgegenzuhalten, dass erstens das Subjekt wiederum Teil der geschaffenen Welt ist, die es begründen soll und dass es zweitens ein zeitlich endlicher und nicht vollkommener Grund für die Wirklichkeit wäre. Wenn nicht das Subjekt als Begründung genügt, so mag die Annahme einer Art ‚Weltgeist‘, wie wir sie bei Plotin oder später bei Hegel finden, ausreichen. So könnte ein weiterer Einwand lauten. Ein solcher Weltgeist als Grund der Welt wäre aber mit der Welt und damit mit dem zu begründenden System untrennbar verbunden. Nimmt man Gott als ewigen und allmächtigen Schöpfer der endlichen Schöpfung, der Welt, an, dann wären Grund und Begründendes jedoch ontologisch voneinander unterschieden, wodurch die Stärke dieser Begründung für die Welt noch erhöht wird und ein Zirkelschluss vermieden wird. In ähnlicher Weise steht auch Platons Gutes „jenseits von Sein und Wesenheit“: ἐπέκεινα τῆς οὐσίας.8 Das Verhältnis des Schöpfers zur Schöpfung ist ferner als Gerechtigkeit und als liebende Vorsehung identifizierbar, wie sie sich in Jesus Christus in unüberbietbarer Weise selbst offenbart hat: In ihm hat sich Gott für die Welt hingegeben. Auch die Freiheit der menschlichen Person, die die Freiheit zum Scheitern, zum Bösen und damit zum Verlust der Freiheit einschließt, ist als Kennzeichen der Würde der Person vom Schöpfer ausdrücklich gewollt: Christus selbst verheißt „das Leben … in Fülle“: ζωὴν … καὶ περισσὸν.9 Damit wird Gott der Wirklichkeit so, wie sie ist, 7 Vgl. Swinburne, Die Existenz Gottes, a. a. O., S. 131-137. 8Platon, Politeia, VI, 509b. 9 Joh 10, 10. Gott als Grund der Wirklichkeit 35 als Begründung durchaus gerecht. Die philosophische Begründung von Sein und Wirklichkeit konvergiert dann mit der christlich-theologischen. Gott erweist sich also als guter, starker und letzter Grund der Wirklichkeit, der er, unterschieden von der Schöpfung, als höchste Realität auch angehört. Damit wird Gott nicht ‚verzweckt‘ oder instrumentalisiert, da er als Transzendenter und Ewiger für den Menschen zwar erkennbar, aber nicht abschließend erfassbar bleibt. Gott wird durch seinen begründenden Charakter, den er für die Welt hat, nicht eingeengt oder begrifflich so gefasst, dass es ihn nicht mehr gibt, oder dass Gott im Hegelschen Sinne ‚tot‘ wäre, da er nur begrifflich existiere. Gott bleibt, in Anlehnung an Jakob Böhme und Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, der selbst nicht zu ergründende ‚Urgrund‘ oder ‚Ungrund‘ des Seins. Will man nicht das Vernunftprinzip und damit ein Herzstück der Aufklärung aufgeben, muss die Notwendigkeit der Begründung als rationale Grundlage der Wirklichkeit, insbesondere des menschlichen Seins und Handelns, akzeptiert werden. Wenn der Mensch keinen Grund mehr für sein Handeln hat, handelt er irrational oder überhaupt nicht mehr. Dadurch wird der Mensch letztlich krank und kann sein Leben nicht mehr in freier Verantwortung selbst gestalten. Es besteht also durchaus die philosophische Notwendigkeit eines starken und guten Grundes der Wirklichkeit, des menschlichen Handelns und des Daseins überhaupt, wie es Brague in zahlreichen Vorträgen und Beiträgen darlegt, zuletzt in seiner Münchener Abschiedsvorlesung. Erweist sich nun Gott als eine mögliche, starke und gute Begründung der Wirklichkeit, wird dadurch, zusätzlich zu den bereits bestehenden Argumenten für die Existenz Gottes, die Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes weiter erhöht, da ein starker, aber nicht existenter Grund eben kein starker Grund mehr wäre. Doch mit dem Fehlen eines guten Grundes für das Sein ginge die Möglichkeit einer Begründung ganz generell verloren. Es gäbe also ohne die Existenz Gottes nichts mehr zu begründen, wodurch alles möglich wird, auch das Böse, das dann auch nicht mehr vom Guten unterschieden werden könnte. Beides hat ja dieselbe Begründung: nämlich keine. Damit gewinnt die Religion als menschliche Antwort auf das Transzendente eine neue und zentrale Bedeutung. Sie kann dann nicht mehr Privatsache sein, da in der Religion etwas reflektiert und über etwas argumentiert wird, das alle Menschen in gleicher Weise angeht: Gott als zentraler und guter Grund der Wirklichkeit, die den Menschen und sein Handeln einschließt. Doch was ist Wirklichkeit? So lautet eine der Grundfragen der Philosophie, die auch für die Religion von Relevanz ist, da die Religion in umfassender Weise die Wirklichkeit deutet. Die Deutung der Wirklichkeit aus Sicht der Religion ist sogar geeignet, eine religionsphilosophische Perspektive auf die Philosophie zu geben. 36 Hans Otto Seitschek Wirklichkeit ist das, was Menschen im umfassenden Sinne wahrnehmen, was ihnen gemeinsam ist und was sie deshalb teilen können. Die Wirklichkeit ist eine und unteilbar. Sie wird durch die höchste Wirklichkeit bestimmt, bei Platon durch die Ideen, besonders durch die Idee des Guten, oder im christlichen Kontext durch den dreifaltigen Gott. Die noumenale Welt prägt als unvergängliches und unwandelbares Sein die phänomenale Welt, aber beide sind keine Welten je für sich, sie machen gemeinsam die eine Wirklichkeit, die Realität, als Ganzes aus. John R. Searle weist deutlich auf diese Einheit der Wirklichkeit hin. Das Hauptproblem der zeitgenössischen Philosophie besteht für Searle zurecht in einem unüberwindlichen und philosophisch nicht weiterführenden „metaphysischen Dualismus“ zwischen der Welt des Materiellen und einer davon getrennten Welt des Geistes: „Given that any sort of Cartesianism or other form of metaphysical dualism is out of the question, how do we give an account of ourselves as conscious, intentionalistic, rational, speech-act performing, ethical, free-will-possessing, political, and social animals in a world that consists entirely of mindless, meaningless brute physical particles.“10 Eine weitere Frage schließt sich an diese Problemstellung an: Gestalten nun die Menschen durch ihre Wahrnehmung ihre Wirklichkeit selbst oder rezipieren ihre Sinne eine vorhandene Wirklichkeit, auf die die Menschen gemeinsam treffen und die sie gemeinsam betrifft? Spaemann optiert umsichtig argumentierend für letzteres, wobei die Wirklichkeit mit ‚objektiv‘ allein zu schwach11 konturiert wird. Er macht damit klar, dass die Menschen nie allein Wirklichkeit schaffen, obwohl es sicher richtig ist, dass das sinnliche Erfassen von Wirklichkeit eine große Rolle bei ihrer Wahrnehmung spielt. Als Personen haben die Menschen die Fähigkeit zur Wirklichkeitswahrnehmung durch ihre Sinne. Sie können ‚ganz bei der Sache‘ sein, wie es eine Redewendung ausdrückt. So greifen die Menschen auf die Wirklichkeit als ein Gegenüber aus, das eine Eigenständigkeit aufweist. Im Anerkennen 10 John Searle, The phenomenological Illusion, 2005, in: Ders., Philosophy in a new Century, Cambridge 2008, S. 107-136, hier S. 108; in deutscher Übersetzung des Verfassers: „Angenommen irgendeine Art von Cartesianismus oder irgendeine andere Form des metaphysischen Dualismus steht außer Frage, wie können wir dann für uns Rechenschaft ablegen als bewusste, intentionale, rationale, in Sprechakten handelnde, ethische, einen freien Willen besitzende, politische und soziale Lebewesen in einer Welt, die gänzlich aus geistlosen, bedeutungslosen und bloßen physikalischen Teilchen besteht“? Hervorhebung im Original. 11 Vgl. Robert Spaemann, Wirklichkeit als Anthropomorphismus, in: Grundvollzüge der Person. Dimensionen des Menschseins bei Robert Spaemann, hg. v. Hanns-Gregor Nissing, München 2008, S. 13-35, hier S. 19-22; Wiederabdruck in: Ders., Schritte über uns hinaus. Gesammelte Reden und Aufsätze, 2 Bde., Bd. 2, Stuttgart 2011, S. 188-215. Gott als Grund der Wirklichkeit 37 dieser Eigenständigkeit liegt ein wesentlicher Zug des Erfassens von Wirklichkeit. Die Wirklichkeit wird demnach vom Realen, nicht allein vom Menschen selbst, bestimmt: „Wirklichkeit als Wirklichkeit auffassen zu können, ist das Eigentümliche des Menschen. Es ist die höchste Form von Aktivität, Selbsttranszendenz.“12 Die Wirklichkeit scheint in anderen Personen in besonderem Maße auf. Sie wird anthropomorph, da es im Erkennen des Anderen als Person die Wirklichkeit ist, die der erkennenden Person gegenübersteht.13 Im Erkennen des Anderen ergibt sich ein besonderer, personaler Wirklichkeitsbezug. Die Wirklichkeit ist damit mehr als bloß objektiv. Sie ist wirklich in einem anthropomorphen Sinne – sie ist lebendige Wirklichkeit, die mehr als bloß objektiv oder empirisch fassbar ist. Thomas von Aquin fasst Wirklichkeit treffend als von göttlichem und menschlichem Verstand Erfassbares beziehungsweise Erfasstes auf, wobei die Wirklichkeitserfassung durch Gott der menschlichen Erfassung von Wirklichkeit vorausgeht. Die Wirklichkeit steht für Thomas zwischen göttlichem und menschlichem Verstand: „Res ergo naturalis inter duos intellectus constituta.“14 Basierend auf dieser wirklichkeitsorientierten Philosophie formuliert Spaemann dann das vorhin bereits erwähnte Gottesargument, basierend auf dem ‚futurum exactum‘: Auch in der Zukunft wird immer gewesen sein, was jetzt gerade ist. Garant für die Aufrechterhaltung dieser ewigen Wahrheit, die nicht erinnert werden darf, sondern stets gewusst werden muss, ist ein ewiges Gewissen, Gott.15 Die Religion vermittelt dem Menschen einen Wirklichkeitszugang, doch dabei muss sich die Religion der philosophischen Prüfung unterwerfen.16 „Grundmomente einer philosophischen Kriteriologie von Religion“17 sollen dabei zur Geltung kommen, wobei der Selbstvollzug der Person in Freiheit im Vordergrund steht. Doch die Selbstbezüglichkeit der Reflexion allein bleibt defizitär. Sie benötigt den Bezug zu Geschichte und Schöpfung, um die Person im umfassenden Sinne Person sein zu lassen, so Holger Zaborowski: „Denn auch Spaemanns Philosophie des Personseins kann als ‚spekulativer Empirismus‘ … verstanden werden: eine Philosophie, die 12Spaemann, Wirklichkeit als Anthropomorphismus, a. a. O., S. 34. 13 Ebd., S. 22-25. 14 Thomas von Aquin, Quaestiones disputatae de veritate, I, 2; siehe Josef Pieper, Wahrheit der Dinge, 1944, in: Ders., Werke in acht Bänden, hg. v. Berthold Wald, Bd. 5, Hamburg 1997, S. 99-179, hier S. 134-136. 15Spaemann, Der letzte Gottesbeweis, a. a. O., S. 117. 16 Holger Zaborowski, Göttliche und menschliche Freiheit. Robert Spaemanns Philosophie des Personseins und die Möglichkeit einer Kriteriologie von Religion, in: Grundvollzüge der Person, a. a. O., S. 55-82. 17 Ebd., S. 77-79. 38 Hans Otto Seitschek selbst positiv ist und darin die historische und transzendental unableitbare Tat der Schöpfung ernst nimmt“.18 Ein nicht zu unterschätzendes Problem liegt darin, dass die Philosophie oft selbst keinen belastbaren Wirklichkeits- und Realitätsbegriff mehr hat. Wirklichkeit und Realität sind dabei nicht einfachhin gleichzusetzen. Die Wirklichkeit hat zwar einen Sach- und damit einen Realitätsbezug, doch zur Realität zählt auch das höchste geistige Sein, das die sinnliche Wirklichkeitswahrnehmung des Menschen übersteigt und nur spekulativ erreicht werden kann. Die Wirklichkeit ist real und die Realität ist auch wirklich. Aber während die Wirklichkeit insbesondere das sinnlich Fassbare meint, umfasst die Realität mit dem höchsten geistigen Sein mehr als die bloße Wirklichkeit, die sie mitumfasst. Wie könnte die Religionsphilosophie nun die Religion als Wirklichkeitsdeutung ansehen, wenn sie selbst keinen Begriff von der Wirklichkeit oder auch der Realität mehr hätte? Die Religionsphilosophie würde damit eine ihrer zentralen Perspektiven verlieren. Folgende Gründe sind für die Schwächung des philosophischen Wirklichkeits- und Realitätsbegriffs ausschlaggebend: Zunächst ist hier die Gefahr einer zu großen Subjektzentrierung zu nennen. Ausgangspunkt dieser Überlegung sei hier die Transzendentalphilosophie. Die Verdienste dieser Richtung der Philosophie liegen vor allem im Denken des Anfangs und der Voraussetzungen des Erkennens. Jedoch verlagerte die Transzendentalphilosophie, die nicht mit dem Idealismus gleichzusetzen ist, schon früh die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis durch Immanuel Kants ‚kopernikanische Wende‘19 in das erkenntnisfähige Subjekt oder in ein abstrakt gefasstes Fichtesches ‚Ich‘ als ‚absolutes Subjekt‘. Dieses ‚Ich‘ setzt sich selbst als seiend: „Dasjenige, dessen Seyn (Wesen) bloß darin besteht, daß es sich selbst als seyend setzt, ist das Ich, als absolutes Subjekt. So wie es sich setzt, ist es; und so wie es ist, setzt es sich; und das Ich ist demnach für das Ich schlechthin und nothwendig. Was für sich selbst nicht ist, ist kein Ich.“20 Für Dieter Henrich zeigt sich darin der „Grundgedanke der Wissenschaftslehre von 1794“.21 18 Ebd., S. 79. 19 Die Rede von der ‚kopernikanischen Wende‘ bei Kant findet ihre Begründung in der Vorrede zur 2. Auflage der Kritik der reinen Vernunft, 1787, B XIV-XVIII. 20 Siehe Johann Gottlieb Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre als Handschrift für seine Zuhörer, 1794, in: Ders., Gesamtausgabe, hg. v. Reinhard Lauth u. a., Abt. I, Bd. 2: Werke 1793-1795, hg. v. Reinhard Lauth u. Hans Jacob, Bad Cannstatt 1965, S. 249-451, hier S. 256-261 u. S. 416-420; Zitat I, § 1, 7, S. 259 f. Hervorhebung im Original. 21 Dieter Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht, 1966, Frankfurt a. M. 1967, S. 7 u. S. 17-21; Zitat S. 17. Eine Vorform dieses Textes findet sich u. d. T. Fichtes ‚Ich‘ in: Dieter Henrich, Selbstverhältnisse, Stuttgart 1982, 21993, S. 57-82, hier S. 59 f. u. S. 70-73. Weiterführende Gedanken entwickelt Henrich in Subjektivität als Prinzip, 1998, in: Ders., Bewußtes Gott als Grund der Wirklichkeit 39 Mit diesen Überlegungen ist zwar noch bei weitem kein platter Subjektivismus verbunden, jedoch verflachte die Philosophie nach der klassischen Periode der Transzendentalphilosophie um 1800 mehr und mehr in eine philosophisch unfruchtbare Zentrierung des Subjekts, aus dem geistig alles hervorgeht, auch die Welt und schließlich sogar das Subjekt selbst. Walter Schulz kritisiert diese Entwicklung: „Die neuzeitliche Philosophie ist bestimmt durch das Bemühen, die in sich zentrierte Subjektivität in das Zentrum zu stellen und diese Subjektivität vom Seienden abzulösen.“22 Einzig Schelling behandelt im deutschen Idealismus systematisch die Reflexion einer eigenständigen Transzendenz: „Die Geschichte als Ganzes ist eine fortgehende allmählig sich enthüllende Offenbarung des Absoluten.“23 Durch die dann im 20. Jahrhundert einsetzende Wende zur Existenzphilosophie und zum Existentialismus, aber auch durch einen zunehmenden erkenntnistheoretischen Skeptizismus, konnte es zu einer weiteren unguten und wenig produktiven Konzentration auf das Subjekt kommen. Wurden in der Folge Grenzen und Schwächen des Subjekts aufgedeckt, so in unterschiedlicher Weise bei Gilbert Ryle24, Bernard Williams25 oder Donald Davidson26, geriet dadurch unweigerlich die Welt insgesamt ins Wanken, da sie vom Subjekt und seiner Erkenntnis abhängig gedacht wurde und nicht mehr als für und in sich bestehend. Daraufhin blieb die 22 23 24 25 26 Leben, Stuttgart 1999, S. 49 ff, hier S. 68-70, sowie in Subjektivität und die Frage nach dem Ganzen, in: Ders., Denken und Selbstsein, Frankfurt a. M. 2007, S. 15-48, hier S. 15-22. Erwähnt sei an dieser Stelle auch Henrichs monumentale zweibändige Studie Grundlegung aus dem Ich. Untersuchungen zur Vorgeschichte des Idealismus. Tübingen – Jena (1790–1794), Frankfurt a. M. 2004. Vgl. Walter Schulz, Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings, 1955, Pfullingen 21975, S. 167-186: Schelling und der sogenannte ‚Spätidealismus‘; Ders., Ich und Welt. Philosophie und Subjektivität, Pfullingen 1979, 21993, S. 15-30, S. 237-240 u. S. 244-246, sowie Ders., Das Problem der absoluten Reflexion, 1962, in: Ders., Vernunft und Freiheit, Stuttgart 1981, S. 6-38, hier S. 6-22 u. S. 35-38; Zitat S. 7. Siehe Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, System des transzendentalen Idealismus, 1800, in: Ders., Sämmtliche Werke, hg. v. Karl Friedrich August Schelling, Bd. I.3, Stuttgart u. Augsburg 1858, S. 600-604; Zitat S. 603; auch in der Historisch-kritischen Ausgabe, Reihe 1, Werke, Bd. 9.1: System des transscendentalen Idealismus (1800). Editorischer Bericht zur Edition des Textes, hg. v. Harald Korten u. Paul Ziche, Stuttgart, Bad Cannstatt 2005, S. 298-303; Zitat S. 301. Vgl. Gilbert Ryle, The Concept of Mind, London 1949, S. 35-40, hier S. 39 f. Vgl. Bernard Arthur Owen Williams, Imagination and the Self, 1966, in: Ders., Problems of the Self, London 1973, S. 26-45, hier S. 31-33 u. S. 41-45. Vgl. Donald Davidson, Epistemology Externalized, 1990, in Ders., Subjective, intersubjective, objective, Oxford 2001, S. 193-204, hier S. 203 f.; vgl. dazu Axel Hutter, Die Wirklichkeit des Geistes, in: Philosophisches Jahrbuch 115 (2008) S. 374-384. 40 Hans Otto Seitschek Philosophie beim bereits erwähnten postmodernen ‚pensiero debole‘. einem schwachen Denken27, stehen, das sich nicht mehr an die eigentlichen philosophischen Problemstellungen heranwagt, wie die Begründung des Seins und dessen Ordnung. Es ist bemerkenswert, dass inzwischen sogar Vertreter eines postmodernen Ansatzes – wie Wolfgang Welsch – an die Grenzen des subjektzentrierten Denkens stoßen und auf die Schwächen eines solchen Denkens hinweisen, wenn auch mit einem deutlichen Hang zum Evolutionären und nur zaghaft: „Vielleicht müssen wir generell anfangen, von außen nach innen zu denken“, so Welsch wörtlich.28 Man ist versucht, ein ‚wieder‘ zu ergänzen: ‚wieder‘ „von außen nach innen zu denken“, wie es die Realphilosophie seit jeher tut. Nicht verschwiegen werden soll aber auch die Stärke der Postmoderne, die darin liegt, dass sie – wenn sie nicht bloß die Wirklichkeit abbildet und damit verdoppelt – die Komplexität der Wirklichkeit zeigt. In hier vorliegenden Kontext geht es jedoch um die Begründung dieser Komplexität der Wirklichkeit, die nicht selten Widersprüche hervorbringt. Ziel einer Begründung der Wirklichkeit kann es nicht sein, diese Komplexität abzuschwächen. Doch zurück zur Transzendentalphilosophie: Ausgehend von der Transzendentalphilosophie wäre es viel lohnender, zu einer Metaphysik auf realphilosophischem Boden zurückzugelangen. Das würde auch dem philosophischen Wirklichkeitsbegriff aufhelfen. Das zentrale Erkenntnisinteresse der Transzendentalphilosophie ist zwar das Finden von objektiven Bedingungen der Erkenntnismöglichkeiten, jedoch verliert die Transzendentalphilosophie durch die soeben erwähnte Subjektzentrierung mehr und mehr an begründender Kraft und damit den Bezug zur Realphilosophie, die Sein, Wesen und Ordnung des Seins zu begründen und erschließen sucht. In diesem seit Platon und mehr noch Aristoteles klassisch gewordenen Konzept einer Metaphysik als πρώτη ϕιλοσοϕία – erste Philosophie – steckt ein direkter Realitäts- und damit Wirklichkeitsbezug, durch den die Philosophie Sein und Wesenheit, also das, was das „Seiende als Seiendes“ – τὸ ὂν ᾗ ὂν29 – ausmacht, begründet. Albertus Magnus und Thomas von Aquin führten dieses realphilosophische Denken in der Scholastik als erster europäischer Aufklärung zu einer beinahe unerreicht gebliebenen Blüte. Josef Pieper begründet 1944 in seiner Münsteraner Habilitati- 27 Vgl. Vattimo, Dialettica, differenza, pensiero debole, a. a. O., S. 12-28, hier S. 12 f., S. 21-23 u. S. 26 f. 28 Vgl. Wolfgang Welsch, Immer nur der Mensch? Entwürfe zu einer anderen Anthropologie, Berlin 2011, S. 231 f. u. S. 239 f., sowie Ders., Mensch und Welt. Philosophie in evolutionärer Perspektive, München 2012, S. 64-72 u. S. 79 f., und Ders., Blickwechsel. Neue Wege der Ästhetik, Stuttgart 2012, S. 173-175 u. S. 193 f.; Zitat S. 194. 29Aristoteles, Metaphysik, G (IV), 1, 1003a21. Gott als Grund der Wirklichkeit 41 onsschrift Wahrheit der Dinge, dass der Erfolg der Metaphysik des Aristoteles und später des Thomas von Aquin gerade darin besteht, dass sie sich in der Wahrheit der Wirklichkeit gründet und sich an ihr ausrichtet.30 Des weiteren kann sich die realphilosophisch verankerte Metaphysik dem Dialog mit empirisch orientierten Wissenschaften stellen. Sie ist dann nicht mehr bloß Begleiterin anderer Wissenschaften, läuft ihnen also nicht mehr nur hinterher, sondern kann im kontroversen Austausch mit diesen neue Gedanken und neue Orientierung im wissenschaftlichen Denken liefern. Eine solche realphilosophisch begründete Metaphysik kann sich, wie Horst Seidl31 betont, auf die gesamte ‚philosophia perennis‘ stützen und berufen.32 Es ist durchaus bemerkenswert, dass die analytische Philosophie im 20. Jahrhundert, nach einer Phase sprachphilosophischer Einengung, gerade die Wahrheitsfrage mit neuem Elan stellte. Jedoch ist der Wahrheitsbegriff der analytischen Philosophie eher ein formallogischer denn ein metaphysischer. Auch Fragen nach der Struktur von Sein33 und sogar religionsphilosophische Perspektiven hat sich die analytische Philosophie nach und nach erschlossen. Problematisch ist aber ihr Verhältnis zur Geschichte des eigenen Faches: Die historische Entwicklung, aber auch Wendepunkte der Philosophie sind der analytischen Richtung oft weniger geläufig. Ebenso wird die Philosophie analytischer Prägung durch ihre Opposition zur Hermeneutik und zur Phänomenologie in ihrer Entfaltung gehemmt. Auch diese Widerstände bringen die Philosophie zunehmend in eine schwierige Lage. Verliert die Philosophie den Bezug zur Realität und damit auch zur Wirklichkeit, dann fehlt ihr die wesentliche Basis für einen Austausch mit Wissenschaften wie der Physik, der Biologie oder der Medizin. Schlimmer noch geht die Philosophie ihres kontroversen Wesens verlustig, das im radikalen Denken Ausdruck findet, das ohne Kompromisse zur Wurzel eines Problems vordringen will. Konflikten 30 Vgl. Pieper, Wahrheit der Dinge, a. a. O., S. 101-104, S. 116-124 u. S. 134-143. 31 Horst Seidl, Realistische Metaphysik, Hildesheim, Zürich u. New York 2006, S. 7-15. 32 Vgl. Wilhelm Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, Frankfurt a. M. 1998, S. 49-63 – Elemente von Philosophia perennis und Spiritualität – u. S. 409-412 – Die historische Logik der Philosophia perennis – ; in erw. engl. Ausg. Philosophia perennis, Dordrecht 2004, S. 27-36 u. S. 409-412. Einen guten Eindruck über das Themenfeld gibt die zweibändige Festschrift für Joseph Geyser: Philosophia perennis. Abhandlungen zu ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Festgabe Joseph Geyser zum 60. Geburtstag, 2 Bde., Bd. 1: Abhandlungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. 2: Abhandlungen zur systematischen Philosophie, hg. v. Fritz-Joachim von Rintelen, Regensburg 1930; exemplarisch sei daraus der Beitrag von Gertrud Kahl-Furthmann Die Ordnung der philosophischen Disziplinen, Bd. 2, S. 531-539, genannt. 33 Vgl. Lorenz Bruno Puntel, Struktur und Sein, Tübingen 2006, S. 552-587: Grundzüge einer Theorie des Seins als solchen und im Ganzen. 42 Hans Otto Seitschek darf die Philosophie dabei nicht aus dem Weg gehen. Nicht die Meinung, sondern die Wahrheit muss stets das Ziel des philosophischen Erkenntnisstrebens sein. Die „kontroverse Natur“ ist ein konstitutiver Wesenszug philosophischen Denkens, wie Spaemann betont.34 Das Wahrnehmen der Religion als Wirklichkeitsdeutung ist eine wichtige Perspektive der Religionsphilosophie, da die Religionsphilosophie in Blick auf Metaphysik und Ontologie dann ihre analytische Trennschärfe bezüglich der Realität unter Beweis stellen kann und damit zu einer adäquaten Wirklichkeitsdeutung entschieden beitragen kann. Am Ertrag der Religionsphilosophie wird hier umgekehrt deutlich, dass die Religion tatsächlich eine adäquate Wirklichkeitsdeutung liefert, da die Religionsphilosophie keinen Ertrag bringen würde, wenn sie von der Religion als etwas bloß Erdachtem ausgehen würde. In diesem Falle würde die Perspektive der Religionsphilosophie an einer adäquaten Realitäts- und Wirklichkeitsdeutung vorbeiführen. Die Aufgaben, die Existenz Gottes argumentativ zu stützen und formal zu fassen sowie die Bedeutung Gottes als Grund der Wirklichkeit zu zeigen, sind zentrale, wenn nicht ‚die‘ zentralsten Aufgaben der Religionsphilosophie. Mit diesen Überlegungen steht und fällt die Religion, und nicht nur sie, sondern auch die den Menschen umgebende und ihn einschließende Wirklichkeit, die Realität.35 34 Robert Spaemann, Die kontroverse Natur der Philosophie, 1983, in: Ders., Philosophische Essays. Erweiterte Ausgabe, Stuttgart 1994, S. 104-129; Wiederabdruck in: Ders., Schritte über uns hinaus. Gesammelte Reden und Aufsätze, 2 Bde., Bd. 1, Stuttgart 2010, S. 56-80. 35 Vgl. Robert Spaemann, Das unsterbliche Gerücht, Stuttgart 2007, darin insbes. Das unsterbliche Gerücht, 1999; S. 11-36, hier S. 30-36, sowie Ders., Gottesbeweise nach Nietzsche, 1998; S. 37-53, hier S. 37-45 u. S. 259 f., und Ders., Der letzte Gottesbeweis, a. a. O., S. 9-32, hier S. 26-32. ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage Jean Greisch „Es ist eine Hauptkunst des Philosophen, sich nicht mit Fragen zu beschäft igen, die ihn nichts angehen.“1 Dieser Satz aus Ludwig Wittgensteins Kriegstagebüchern wirft mindestens zwei Fragen auf: 1. Wer entscheidet darüber, wo die Grenze zwischen dem, was uns angeht und dem, was uns nichts angeht, verläuft? 2. Was bedeutet für den Menschen, dass etwas ihn ‚angeht‘ oder nichts? Beide Fragen, die schon in Rémi Bragues früher Interpretation der ‚phrónesis‘ als ‚Wissen für ein Selbst‘ in seiner großen Untersuchung über den Weltbegriff bei Aristoteles eine Rolle spielen, sind, wie ein Blick auf seine jüngsten Veröffentlichungen Les Ancres dans le ciel2 und Le propre de l’homme3 zeigt, immer noch auf der Tagesordnung, weil beide eine grundsätzliche Frage der Legitimität aufwerfen. Falls die ‚Metaphysik‘ und der Mensch heute mehr denn je auf dem Prüfstand stehen, ermisst man die Tragweite der These, die Bragues Traum von einem ‚neuen Mittelalter‘ zusammenfasst: „Die Transzendenz, zu der die Religion uns einen Zugang verschafft, würde sich als das Gute manifestieren, das alles Seiende zum Sein aufruft, insbesondere den Menschen. Sie würde sich als die Vorsehung deklinieren, die jegliches Ding mit allem ausstattet, was es benötigt, um das zu sein, was es sein soll.“4 Diesem anspruchsvollen Programm möchte ich mich im Folgenden auf einem scheinbaren Seitenweg annähern, wobei meine hauptsächlichen Gesprächspartner Martin Heidegger und der Heilige Augustinus sind. 1 2 3 4 Ludwig Wittgenstein, Schriften 1, Frankfurt a. M. 1969, S. 135. Rémi Brague, Les Ancres dans le ciel. L’infrastructure métaphysique, 2011, Paris 2013. Rémi Brague, Le propre de l’homme. Sur une légitimité menacée, Paris 2013. Ebd., S. 248; hier und im Folgenden, wenn nicht anders vermerkt, ist die Übersetzung vom Verfasser. 43 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7_4 44 1 Jean Greisch Die ontologische Kategorie der Werheit und die Aufgaben einer Hermeneutik des Selbst Im Hintergrund dieses Versuchs steht Heideggers Hypothese, dass die Frage der Legitimität der Metaphysik und die des Menschen grundlegend mit dem Stellenwert zusammenhängen, den man der Wer-Frage – beziehungsweise in Heideggers eigener Terminologie – der Kategorie der ‚Werheit‘ einräumt. Am Ende seiner ausführlichen Diskussion der mittelalterlichen Unterscheidung von essentia und existentia in der im Sommersemester 1927 gehaltenen Vorlesung Grundprobleme der Phänomenologie hält Heidegger fest: „Das Seiende, das wir selbst sind, das Dasein, kann als solches mit der Frage, was ist das, überhaupt nicht befragt werden. Zu diesem Seienden gewinnen wir nur Zugang, wenn wir fragen: wer ist es? Das Dasein ist nicht durch die Washeit, sondern – wenn wir den Ausdruck bilden dürfen – durch die Werheit konstituiert.“5 Für die Ausarbeitung einer um den Begriff der ‚ontologischen Differenz‘ kreisenden ‚Fundamentalontologie‘ bedeutet das, dass mit der Einführung des Begriffs der ‚Werheit‘ „die ontologische Differenz verwickelter wird“ und dass damit auch die „Frage nach der Einheit des Begriffes von Sein überhaupt“ „brennend“6 wird. Ein Blick auf Heideggers Ende der zwanziger und anfangs der dreißiger Jahre gehaltenen Freiburger Vorlesungen zeigt, dass diese ‚Verwicklung‘ nicht nur Konsequenzen für die Ausarbeitung einer Fundamentalontologie, sondern auch für das Konzept einer ‚Metaphysik des Daseins‘ und folglich für die Stellungnahme gegenüber der damals in Hochblüte stehenden philosophischen Anthropologie hat. Immanuel Kants Frage ‚Was ist der Mensch‘ ist Heidegger zufolge „nicht nur die ursprünglich“ erste aller Fragen, die jeder Mensch sich als „Weltbürger“ stellen muss. Sie ist „auch etwas total anderes als eine anthropologische Frage“, weil sie nach dem, „was ursprünglicher als der Mensch“, nämlich nach dem ‚Menschen als Dasein‘ fragt. Keine wissenschaftliche Anthropologie, und auch keine philosophische Anthro­ pologie, sondern nur eine „Metaphysik des Daseins“7 ist dieser Frage gewachsen. In seiner Davoser Disputation mit Ernst Cassirer betont Heidegger besonders nachdrücklich, dass „eine auf die Möglichkeit der Metaphysik als solche gerichtete 5 Martin Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie. (Sommersemester 1927), in: Gesamtausgabe, Frankfurt a. M. 1975 ff., Bd. 24: Die Grundprobleme der Phänomenologie, hg. v. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 1975, S. 169. Hervorhebung im Original. 6 Ebd., S. 170. 7 Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, 1929, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 3: Kant und das Problem der Metaphysik, hg. v. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 1991, S. 236. ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 45 Metaphysik des Daseins“ „die Frage nach dem Wesen des Menschen stellen muss in einer Weise, die vor aller philosophischen Anthropologie und Kulturphilosophie liegt“.8 Die Tragweite dieser Neuformulierung des Problems zeigt sich spätestens dann, wenn man einsieht, dass die Frage ‚Was ist der Mensch?‘ in die ontologisch-phänomenologische Doppelfrage „Wer er ist, wie er ist“9 verwandelt werden muss. Wenn die Frage ‚Was ist der Mensch?‘ „fehlfragt“10, besteht die einzige Möglichkeit, diese ‚Fehlfrage‘ zu überwinden, darin, die Was-Frage konsequent durch die Wer-Frage zu ersetzen: „Die Wesensfrage ist eine Vorfrage. Die echte und angemessene Vorfrage ist nicht die Was-Frage, sondern die Wer-Frage. Wir fragen nicht ‚Was ist der Mensch?‘, sondern ‚Wer ist der Mensch?‘ “11 Die Antwort auf diese Frage kann nur in der Ausarbeitung einer ‚Hermeneutik des Selbst‘ bestehen. Welche konkrete Gestalt diese bei Heidegger selbst annimmt, soll hier nicht weiter erörtert werden. Für die folgenden Überlegungen sind mehrere Punkte ausschlaggebend. 1) Wenn Descartes in der Zweiten Metaphysischen Meditation unmittelbar anschließend an die Entdeckung der apodiktischen Selbstgewissheit der Existenz des cogito – mindestens insofern und solange es denkt – sich fragt, wer er ist,12 dann betritt er scheinbar den Boden einer neuen Ontologie der Werheit. Heidegger zufolge ist dieser Eindruck trügerisch, weil „die philosophische Umwendung der neueren Philosophie ontologisch grundsätzlich gesehen gar keine war“, denn „prinzipiell gesehen“ blieb „in der neueren Philosophie alles beim alten“13, nämlich dem allgemeinen Rahmen einer Ontologie der Vorhandenheit. 8 Ebd., S. 273. 9 Martin Heidegger, Der Deutsche Idealismus, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 28: Der deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) und die philosophische Problemlage der Gegenwart. (Sommersemester 1929), hg. v. Claudius Strube, 2011, S. 235. 10 Martin Heidegger, Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache. (Sommersemester 1934), auf der Grundlage einer Vorlesungsnachschrift v. Wilhelm Hallwachs hg. v. Günter Seubold, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 38: Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache. (Sommersemester 1934), 1998, S. 33. 11 Ebd., S. 34. 12 „J’ai reconnu que j’étais, et je cherche maintenant quel je suis, moi que j’ai reconnu être“ – „Novi me existere; quaero qui sim ego ille quem novi“. 13Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie. (Sommersemester 1927), a. a. O., in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 24, a. a. O., S. 175. 46 Jean Greisch 2) Obwohl Heidegger selbst der Werfrage eine Schlüsselstellung in seinem Denken einräumt, ist diese ausschließlich auf die ‚Werheit‘ des Daseins eingeschränkt – beziehungsweise dem Menschen als ‚Hirt des Seins‘ vorbehalten. Ob und inwiefern sie auch auf Gott anwendbar ist, ist eine Frage, auf die wir bei Heidegger, abgesehen von einigen vagen Andeutungen bezüglich der ‚Aseität‘ Gottes, keine Antwort finden. 3) Auch nach der in den Jahren 1936 bis 1938 vollzogenen ‚Kehre‘, in der sich die Frage nach dem Sinn des Seins in die Frage der als ‚Ereignis‘ verstandenen Wahrheit des Seins selbst14 verwandelt, bleibt die Vorrangstellung der Wer-Frage erhalten, wie eines der Gedichte, die Heidegger seinem 1938/39 entstandenen Manuskript Besinnung voranstellt, zeigt: Trag vor dir her Das Eine Wer? Wer ist der Mensch? Sag ohne Unterlaß Das Eine Was? Was ist das Seyn? Mißachte nie Das Eine Wie? Wie ist ihr Bund?15 4) Wenn die Frage ‚Wer sind wir?‘ beziehungsweise ‚Wer bin ich?‘ uns mehr als früheren Generationen auf den Nägeln brennt, und uns, mit Brague gesprochen, zur Einsicht zwingt, dass unser Humanismus auf schwankendem Boden steht, weil er „im Grunde genommen eigentlich nicht mehr als ein Anti-Antihumanismus ist“,16 dann weil die meisten von uns in den dunkelsten Stunden ihres Lebens mit der Nichtigkeit ihrer eigenen Identität konfrontiert sind. Bedeutet das, dass die Frage: ‚Wer bin ich?‘ im Extremfall gegenstandlos wird? In Das Selbst als ein anderer erwähnt Paul Ricoeur die „Nächte der personalen 14 Martin Heidegger, Brief über den ‚Humanismus’ in: Wegmarken, Frankfurt a. M. 1967, S. 162: „Doch Das Sein – was ist das Sein? Es ist Es selbst. Dies zu erfahren muss das künftige Denken lernen.“ 15 Martin Heidegger, Besinnung, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 66: Besinnung. (1938/1939), hg. v. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 1997, S. 5. 16Brague, Le propre de l’homme, a. a. O., S. 13. ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 47 Identität“, die sich in vielen Bekehrungsgeschichten widerspiegeln – zu denen in erster Linie die Bekenntnisse des Heiligen Augustinus gehören! – und er schreibt, dass „in solchen Augenblicken äußerster Entblößung“ „die Nicht-Antwort auf die Frage Wer bin ich? keineswegs auf die Nichtigkeit, sondern auf die Blöße der Frage selber“17 verweist. In solchen Stunden wird auch Bragues Frage nach dem Eigenen und Eigentlichen des Menschen unausweichlich. 5) Es ist kein Zufall, dass Ricoeur im Verlauf der Ausarbeitung seiner Hermeneutik des Selbst sich mehrfach auf Bragues Untersuchung Aristote et la question du monde18 bezieht, welche die phänomenologische Frage nach der Selbstheit des Menschen deutlich von der anthropologischen Frage nach den Wesensbestimmungen des Menschen unterscheidet. Auch wenn Ricoeurs Rezeption dieser „gewaltigen Untersuchung“19 sich auf einige umfangreiche Fußnoten beschränkt, besteht kein Zweifel an der grundsätzlichen Tragweite der sich hier andeutenden Auseinandersetzung, die unter anderem die Frage betrifft, inwiefern „der anthropologische Begriff des Menschen den phänomenologischen Begriff des Selbst erstickt, den nur eine Ontologie der Sorge zu konstituieren vermöchte“20. Ricoeur stimmt grundsätzlich mit Brague – und mit Heidegger – darin überein, dass das „Selbst und das In-der-Weltsein von Grund auf aufeinander bezogen sind“,21 eine Beziehung, der Aristoteles nicht voll gerecht wird, weil in seinem Denken „die Bedeutungskraft des Begriffs autos durch die Verwechslung des Selbst als phänomenologischer Begriff mit dem Menschen als anthropologischer Begriff abgestumpft wird“.22 Aber er fragt sich, ob die Wer-Frage die Frage ‚Was ist der Mensch‘ vollständig ersetzen kann. 6) Die Auseinandersetzung um den Stellenwert des Begriffs des Selbst und innerlich damit verbunden, das Verständnis der Weltoffenheit, bleibt solange unentschieden, als man sich nicht über Bragues Grundthese: ‚Alles betrifft mich‘, die uns eine Antwort auf unsere eingangs im Anschluss an Wittgenstein formulierten Fragen liefert, verständigt. Ricoeurs Alternative des ‚Umwegs der Reflexion über die Analyse‘ wirft 17 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris 1990, S. 197; dt. Das Selbst als ein Anderer, München 1996, S. 204. Hervorhebung im Original. 18 Rémi Brague, Aristote et la question du monde. Essai sur le contexte cosmologique et anthropologique de l’ontologie, Paris 1988. 19 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, a. a. O., S. 355; dt. a. a. O., S. 369. 20 Ebd., S. 220 f.; dt. a. a. O., S. 229. 21 Ebd., S. 363; dt. a. a. O., S. 378. 22 Ebd., S. 363; dt. a. a. O., S. 378. Hervorhebung im Original. 48 Jean Greisch ihrerseits zahlreiche Fragen auf, die im Rahmen der zehnten Abhandlung von Das Selbst als ein Anderer eher angeschnitten als beantwortet werden. Das hängt auch damit zusammen, dass Soi-même comme un autre – im Vergleich zum Originaltext der 1986 in Edinburgh gehaltenen Gifford Lectures – gleichsam ein monströses Torso ist. Einerseits sind die zehn Abhandlungen des Buches viel umfangreicher als die ursprünglichen acht ersten Vorlesungen; anderseits hat Ricoeur aus Gründen, die er im Vorwort erläutert,23 die beiden letzten Vorlesungen, in denen er sich mit den religiösen Gestalten des Selbst beschäftigt, nicht in die Veröffentlichung aufgenommen. Bragues oben erwähnten Schriften laden uns dazu ein, diese Klammer aufzulösen und auf diese Weise, wie ich im Folgenden zu zeigen versuche, die Auseinandersetzung um den Status einer Hermeneutik des Selbst auf einer anderen Ebene weiterzuführen. 2 Wurzeln im Himmel: eine neue Version der Philosophie als ‚verkehrte Welt‘? Versuchen wir zunächst einen Stolperstein aus dem Weg zu räumen. Zwischen Titel und Untertitel der Les racines dans le ciel betitelten Vorlesungsreihe Bragues besteht ein eigentümliches, geradezu irritierendes Spannungsverhältnis. Bildlich ausgedrückt hat eine Untersuchung über die ‚Infrastruktur‘ der Metaphysik mit den Wurzeln der Metaphysik zu tun, oder, um mit Heidegger zu sprechen, mit der Beschaffenheit des Bodens, in dem der cartesische Baum des Wissens wurzelt.24 Im Obertitel der Untersuchung werden diese Wurzeln in Anspielung auf ein Zitat des Timaios25 in den ‚Himmel‘ verlegt. 23 Ebd., S. 35-38; dt. a. a. O., S. 35-37. 24Heidegger, Wegmarken, a. a. O., S. 365-368. 25Platon, Timaios, 90a: „Die maßgebende Form von Seele bei uns müssen wir uns … folgendermaßen denken, dass nämlich Gott sie jedem als einen Schutzgeist verliehen hat; von ihr behaupten wir, dass sie im obersten Teil unseres Körpers wohnt und uns von der Erde zu unserer Verwandtschaft im Himmel erhebt, da wir kein irdisches, sondern ein himmlisches Gewächs sind. Und damit haben wir vollkommen Recht. Denn indem das Göttliche dort, wo die erste Entstehung der Seele sich vollzog, unser Haupt und unsere Wurzel befestigt, richtet es den ganzen Körper auf.“ ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 49 Dies ist eine eigentümliche Art von Umkehrung, die man nicht durch einen Hinweis auf Hegels Diktum von der Philosophie als „verkehrte Welt“26 rechtfertigen oder gar lächerlich machen darf. Sie muss in ihrer Eigentümlichkeit und auf ihre Voraussetzungen hin bedacht werden. Dazu gehört unter anderem die Erinnerung an eine der Aristotelischen Definitionen der Metaphysik als ‚Erste Philosophie‘. Ihr primärer Gegenstand ist einerseits das Seiende als Seiendes und dessen allgemeinsten Wesenseigenschaften, anderseits das Erste Seiende, nämlich das Göttliche. Ob das Bild der ‚Wurzeln im Himmel‘ auf eine Wiederherstellung der ‚Ontotheologie‘ hinausläuft, ist eine Frage, der hier nicht weiter nachgegangen werden soll. Ich begnüge mich damit, Platons Rechtfertigung des aufrechten Gangs und den Gebrauch, den Brague von ihr macht, in die oben angedeutete Richtung einer Hermeneutik des Selbst weiter zu verfolgen, die es auf den Versuch ankommen lässt, die Frage nach der Selbstheit des Menschen mit der Frage der göttlichen Selbstheit zu verknüpfen. 3 Fragendes Suchen: die Eigentümlichkeit der Gottesfrage bei Augustinus Der beste Gesprächspartner für einen derartigen Versuch ist meines Erachtens der Heilige Augustinus, insbesondere dessen Bekenntnisse, von denen Wittgenstein sagte, sie seien „das ernsthafteste Buch, das je geschrieben wurde“27. In immer neuen Anläufen macht Aurelius Augustinus seine Leser darauf aufmerksam, dass jedes Fragen – quaestio – von einem vorgängigen Suchen – quaerere – getragen ist. Die Bedeutung dieses Zusammenhangs, der sich noch verschärft, wenn man bedenkt, dass es Fragen gibt, in denen der Frager sich seiner eigenen Fragwürdigkeit bewusst wird28 - „quaestio mihi factus sum“ – ist der Aufmerksamkeit Heideggers nicht entgangen. 26 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jenaer Schriften. 1801-1807, hg. v. Eva Moldenhauer, Frankfurt a. M. 1970, S. 182. 27 Ludwig Wittgenstein, Porträts und Gespräche, hg. v. Rush Rhees, Frankfurt a. M. 1987, S. 132-134. 28 Aurelius Augustinus, Confessiones, X, 16, 25: „Ego certe, Domine, laboro hic et laboro in me ipso: factus sum mihi terra difficultatis et sudoris nimii.“ Die Confessiones werden hier und im Folgenden nach der Patrologia Latina [im Folgenden abgek. als PL], Paris 1844 ff., Bd. 32, 1845, gelegentlich auch nach der Bibliothèque Augustinienne. Oeuvres de Saint Augustin [im Folgenden abgek. als BA], Paris 1949 ff., Bd. 13 u. 14, zitiert. 50 Jean Greisch In seiner frühen Freiburger Vorlesung Augustinus und der Neuplatonismus unterbricht er seinen paraphrasierenden Kommentar des 10. Buches der Confessiones genau an dem Punkt, wo Augustinus selbst in seiner Analyse des Phänomens des Vergessens das biblische Gleichnis der verlorenen Drachme anführt, um eine generelle Frage zu stellen: „Was heißt denn ‚suchen‘?“29 Sofort fallen drei Stichworte, die nicht aus der Feder des Bekenners selbst stammen: „Angst – Möglichkeit – Intentionalität!“30 Was Suchen bedeutet, versteht man nur, wenn auf seinen ‚intentionalen Bezugssinn‘ achtet. Die volle Tragweite dieser phänomenologischen Beobachtung erschließt sich erst, wenn man sie in Bezug zur Frage: ‚Was suche ich denn, wenn ich Gott suche?‘ setzt. Diese Frage beantwortet Augustinus so, dass er das Erfragte der Frage als das glückselige Leben bestimmt, wobei Gott selbst als „vita vitae meae“ verstanden wird.31 Unter Verweis auf Søren Kierkegaard32 hält Heidegger fest, dass das Gott-Suchen nicht irgendeine Spezialbeschäftigung ist, die man sich leisten oder auch nicht leisten kann, sondern dass in diesem Suchen das Selbstverständnis des Fragers auf dem Spiel steht: „Im Suchen dieses Etwas als Gott komme ich selbst dabei in eine ganz andere Rolle. Ich bin nicht nur der, von dem das Suchen ausgeht und irgendwo sich hinbewegt, oder in dem das Suchen geschieht, sondern der Vollzug des Suchens selbst ist etwas von dem selbst.“33 Was ist diese „ganz andere Rolle“, in die wir im suchenden Fragen nach Gott geraten? Den Schlüssel zu einer Antwort liefert uns eine Besinnung auf den Sinn der Formel: „quaestio mihi factus sum“: „Das Sich-zur-Frage-Werden ist nur im konkreten Zusammenhang der Selbsterfahrung sinnvoll. Es ist keine Frage des objektiven Vorhandenseins, sondern des eigentlichen selbstlichen Existierens.“34 Die „Gottesfrage“ drängte sich Augustinus schon sehr früh, aufgrund der Lektüre von Marcus Tullius Ciceros Hortensius auf,35 sie wurde noch durch die Lektüre der 29 Martin Heidegger, Augustinus und der Neuplatonismus. (Sommersemester 1921), in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 60: Phänomenologie des religiösen Lebens, hg. v. Matthias Jung, Thomas Regehly u. Claudius Strube, 1995, S. 190. 30 Ebd., S. 191. 31Augustinus, Confessiones, X, 20, 29. Hervorhebung vom Verfasser. 32Heidegger, Augustinus und der Neuplatonismus, a. a. O., S. 248. 33 Ebd., S. 192. 34 Ebd., S. 281. 35Augustinus, Confessiones, III, 4, 7-8. ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 51 Libri Platonicorum,36 das heißt der Schriften der Neuplatoniker verschärft und hat ihn zeitlebens nicht mehr in Ruhe gelassen.37 Augustinus fragt nach dem „einzig wahren Gott“.38 Seine Frage betrifft nicht die Existenz Gottes, denn diese steht für ihn außer Frage.39 Wer nach ‚Gottesbeweisen‘ im modernen Sinn des Wortes sucht, befindet sich bei Augustinus an der falschen Adresse. Der typisch Augustinische Akzent der Gottesfrage lässt sich anhand von fünf Fragen kennzeichnen: 1) Die (Vor-)Frage nach der ‚rechten Art und Weise‘, wie man nach Gott fragen soll: „Wie nun suche ich dich, Herr? Denn wenn ich dich als meinen Gott suche, so suche ich das selige Leben. Ich will dich suchen, damit meine Seele lebe.“40 2) „Was sage ich, wenn ich ‚Gott‘ sage?“, anders ausgedrückt: ‚Wie redet einer, wenn er redet von dir?‘ – „quid dicit aliquis, cum te dicit?“.41 Dies ist keineswegs eine rein semantische Frage nach der etymologischen oder linguistischen Bedeutung des aus vier Buchstaben und zwei Silben zusammengesetzten lateinischen Wortes „deus“. Vielmehr handelt es sich für Augustinus um eine Verständnisfrage, die nur auf der Ebene des ‚inneren Wortes‘ – verbum cordis – beantwortet werden kann.42 Die Antwort, die Augustinus in seinem ersten Traktat über das Johannesevangelium gibt – „Magna et summa quaedam substantia cogitata est, quae transcendat omnem mutabilem creaturam, carnalem et animalem“ – löst sofort eine wahre Sturzflut neuer Fragen aus, welche die Fassungskraft des menschlichen Geistes betreffen: „quomodo ergo potuisti scintillare in illud quod est super omnem creaturam, ut certus mihi responderes incommutabilem Deum? Quid est ergo illud in 36 Ebd., VII, 9, 13-10. 37 Vgl. hierzu die vorzügliche Gesamtdarstellung von Goulven Madec, Le Dieu d’Augustin, Paris 1998; es handelt sich hierbei um eine Überarbeitung des Artikels Deus im Augustinus-Lexikon. 38 Aurelius Augustinus, Enarrationes In Psalmos, 49, 6. 39Augustinus, Confessiones, VI, 5, 7-8: „Est ergo Deus, absit ut dubitemus … Est ergo Deus, magisque fit quaestio quomodo colendus sit quam utrum sit.“: Aurelius Augustinus, Vingt-six Sermons au Peuple d’Afrique. Retrouvés à Mayence, hg. v. François Dolbeau, Paris 1996, 23, 10. 40Augustinus, Confessiones, X, 20, 29. 41 Ebd., I, 4. 42 Aurelius Augustinus, In Evg. Joh., I, 8, zitiert nach der BA, Bd. 71: Homélies sur l’Évangile de saint Jean, hg. v. Marie-François Berrouard, 1969, S. 144 f.: „Quid factum est in corde tuo, cum audisses: Deus? Quid factum est in corde meo, cum dicerem: Deus?“ 52 Jean Greisch corde tuo, quando cogitas quamdam substantiam vivam, perpetuam, omnipotentem, infinitam, ubique praesentem, ubique totam, nusquam inclusam?“43 3) Die Frage nach der ‚Antreffbarkeit‘ beziehungsweise der ‚Auffindbarkeit‘ Gottes: ‚Wo kann man Gott finden?‘: „Wo also fand ich dich, um dich zu lernen?“44 Augustinus stellt sie sich selbst, aber zugleich richtet er sie an Gott. „Ubi Deus invenitur, cum cognoscitur?“ „Wo also fand ich dich, um dich zu lernen, wenn nicht in dir, über mir – In Te supra me – ? Und nirgends ein Ort, wir mögen zurückgehen oder uns ihm nahen; und nirgends ein solcher Ort.“ 4) „Quid amatur, cum Deus amatur?“45, mithin: Was suche ich, wenn ich Gott suche? Die Antwort auf diese Frage fällt nicht weniger deutlich als die Antwort auf die Wo-Frage aus: „Cum Deum quaerimus, vitam beatam quaerimus.“ 5) Schließlich, und für unsere Fragestellung auschlaggebend, ist die Werfrage: „Wer ist jener, der über dem Haupte meiner Seele waltet?“46 Wer ist Gott? Die Antwort: „Idipsum“: „Er selbst“. 4 Über Gott und zu Gott sprechen Augustinus ist sich bewusst, dass die Vieldeutigkeit des Seins – to on pollachôs legetai – ein Gegenstück in der Vielnamigkeit Gottes hat. Gott kann man prinzipiell mit allen möglichen Namen benennen, salva dignitate.47 Jeder Name ist gleichsam eine Ehrbezeugung, die wir ihm erweisen. Das Verständnis dieser Namen hängt von ihrem Vollzugssinn, beziehungsweise der rechten ‚Gebrauchsanweisung‘, anders gesagt dem modus dicendi ab, weil alle Namen zugleich Anrufungen sind. Von Anfang bis Ende der Bekenntnisse konfrontiert Augustinus seine Leser mit dem Vollzugssinn der Gottesnamen: „Groß bist du, o Herr, und deines Lobes ist kein Ende.“ Eine Erklärung, welche die Möglichkeit eines solchen Lobes erst 43 Ebd., I, 8. 44Augustinus, Confessiones, X, 26, 37: „Ubi … te inveni, ut discerem te?“ Hervorhebung vom Verfasser. 45 Ebd., X, 5, 7. 46 Ebd., X, 7, 11: „Quis est ille super caput animae meae?“ Hervorhebung vom Verfasser. 47 Aurelius Augustinus, De trinitate, VI, 7, 8: „Deus vero multipliciter quidem dicitur, magnus, bonus, sapiens, beatus, verus et quidquid aliud non, indigne dici videtur.“ ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 53 begründen wollte, käme zu spät. Erst nachdem das Lob bereits lautgeworden ist, stellt sich die Frage: „Wie aber soll ich anrufen ihn, meinen Gott und Herrn? Denn zu mir hinein rufe ich ihn ja, wenn ich ihn anrufe.“ Die anschließende Frage: „Mein Gott, was bist du also?“, löst eine wahre Sturzflut möglicher Antworten aus, die fast die Gestalt einer Litanei annehmen.48 Die uferlose Vielheit der Anrufungen löst eine Frage aus, die man manchen Betern, die Litaneien herunterleiern, ohne sich dabei viel zu denken, dringend ans Herz legen könnte: „Was aber habe ich mit all dem vorgebracht, mein Gott, mein Leben, meine heilige Wonne? Oder wie redet einer, wenn er redet von dir?“ – „Et quid diximus, Deus meus, vita mea, dulcedo mea sancta, aut quid dicit aliquis, cum te dicit?“ Jean-Luc Marion macht darauf aufmerksam,49 dass die ebenerwähnte Liste nicht nur positive – kataphatische – und negative – apophatische – Kennzeichnungen – und, so könnte man hinzufügen, Komparative und Superlative – enthält, sondern dass sie allesamt als aktuelle oder potentielle Vokative, als Anrufungen verstanden werden müssen. Dies bestätigt die Auslegung der aus zwei Psalmversen zusammengesetzten Formel „Magnus Dominus et laudabilis nimis“ in Enarrationes In Psalmos50: „Quid enim dictura sit lingua parva ad laudandum valde?“ Ist die menschliche Sprache überhaupt der Größe der ihr gestellten Aufgabe gewachsen? „Indem sie sagt: ‚über die Maßen‘ bringt sie einen Laut hervor und sie gibt einen Gedanken zu denken, gleichsam, als ob sie sagen würde: Das, was ich nur verlauten lassen kann, denke du es, und wenn du es gedacht hast, wirst du sehen, dass es wenig ist.“ Marion unterstreicht noch zwei weitere wichtige Punkte: (a) Unter der Liste der Anrufungen läuft keine der anderen den Rang ab, gleichsam als ob sie allein der Hauptschlüssel zum Wesen Gottes wäre. Unter diesen Anrufungen findet sich das Prädikat ‚unbegreiflich‘ beziehungsweise ‚unfasslich‘ – incomprehensibilis, das uns mehr als andere mit den Grenzen unserer Sprache konfrontiert.51 48Augustinus, Confessiones, I, 4, 4. 49 Vgl. Jean-Luc Marion, Au lieu de soi. L’approche de saint Augustin, Paris 2008, S. 391-394. 50Augustinus, Enarrationes In Psalmos, 95, 4. 51 Aurelius Augustinus, Sermo, 117, 3, 5, nach der PL, Bd. 38, 1865, Sp. 663: „Si enim quod vis dicere, si capisti, non est Deus; si comprehendere potuisti, cogitatione tua decepisti. Hoc ergo non est si comprehendisti; si autem hoc est, non comprehendisti.“ Vgl. auch Ders., Sermo, 52, 6, 16, nach der PL, Bd. 38, 1865, Sp. 360: „De Deo loquimur, quid mirum si non comprehenderis? Si enim comprehendis, non est Deus … Attingere aliquantum mente Deum, magna beatitudo; comprehendere autem, omnino impossibile.“ Hervorhebungen vom Verfasser. 54 Jean Greisch Im De catechizandis rudibus52 reagiert Augustinus auf die Klagen des Diakons Deogratias über die relative Erfolglosigkeit seiner katechetischen Bemühungen, indem er bekennt, dass er selbst an der geringen Resonanz seiner Predigten leide. Handelt es sich hierbei nur um ein persönliches Versagen, oder um eine ‚objektive‘ Schwierigkeit? Augustinus zufolge ist letzteres der Fall. Seiner Auffassung nach haben wir es sogar mit einer doppelten, philosophischen und theologischen Schwierigkeit zu tun: Einmal die unüberwindliche Diskrepanz zwischen den inneren Einsichten und den Worten, in denen wir sie zur Sprache bringen; sodann die Diskrepanz zwischen der Fassungskraft des Menschengeistes und dem unergründlichen Geheimnis Gottes : „Gott lässt sich nämlich wahrer denken als er sich in Worte fassen lässt und er ist noch wahrer als er sich denken lässt.“ – „verius enim cogitatur Deus quam dicitur, et verius est quam cogitatur.“ Dies ist ein überaus bemerkenswertes Axiom, dessen Wirkungsgeschichte sich durch die ganze abendländische Philosophie und Theologie verfolgen ließe. Ein ganz und gar ‚verständlicher‘ Gott, der sich gleichsam vom menschlichen Denken ‚umarmen‘ ließe – „embrasser Dieu de la pensée“ schreibt René Descartes in einem berühmten Brief an Marin Mersenne – wäre kein wahrer Gott. Das Unbegreifliche muss so gesucht werden, dass der Sucher, wenn er zur Einsicht gekommen ist, wie sehr das Gesuchte unbegreiflich ist, nicht mutlos wird, sondern desto eifriger sucht.53 (b) Marion macht auf ein zweites auffälliges Merkmal der Augustinischen ‚Eröffnungslitanei‘ der Confessiones aufmerksam: In ihr kommt kein ‚ontologischer‘ Terminus vor. Gott wird weder als ‚Sein‘ noch als ‚Substantia‘ bezeichnet, und zwar aus gutem Grund: Im 5. Kapitel des 7. Buches seiner Untersuchung Über die Dreifaltigkeit behauptet Augustinus ausdrücklich, dass es eine „missbräuchliche“ – „abusive“ – Redeweise ist, Gott Substanz zu nennen. Man will damit nur ein gebräuchlicheres Wort verwenden zur Bezeichnung dessen, was das Wort ‚Wesen‘ besagen will. Spätestens hier stellt sich die Frage nach dem Durchbruch, der es Augustinus ermöglicht hat, Gott ‚ganz anders‘ – aliud totaliter – als bisher zu verstehen. Diese Frage setzt eine Vorentscheidung über den Zusammenhang des 7. und des 8. Buches der Confessiones voraus. Gegenüber zahlreichen Interpreten, in deren Augen das 7. Buch eine philosophische Abhandlung und das 8. Buch nur ein ‚geistliches Tagebuch‘ oder ein Seelenroman ist, betonen Goulven Madec und Dominique Dubarle, dass der philosophische und der religiöse Prozess der Umkehr unzertrennlich miteinander verbunden sind. 52 Aurelius Augustinus, De catechizandis rudibus, 1, 1; 2, 3. 53Augustinus, De trinitate, XV, 2, 2, 16. ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 55 Der entscheidende philosophische Durchbruch im Umgang mit der Gottesfrage lässt sich, Dubarle zufolge, in drei Punkten zusammenfassen: 1) Erkenntnis des ‚abgründigen Unterschieds‘ von Schöpfer und Geschöpf54: „Hierdurch gemahnt, zu mir selbst zurückzukehren, trat ich ein in mein Innerstes unter deiner Führung, und ich vermochte es, denn du standest mir helfend zur Seite. Ich trat ein und sah, so blöde auch das Auge meiner Seele noch war, ob diesem Auge meiner Seele, ob meinem Geiste das unwandelbare Licht, nicht dies gemeine und jedem Fleisch sichtbare, auch nicht, als wenn es größer wäre, jedoch von derselben Art und weit, weit heller noch erglänzend, alles mit seiner Größe erfüllt. Nein, nicht also, sondern anders, ganz anders und gewaltig von alledem unterschieden.“55 Weil Augustinus erkannt hat, dass das Licht, das seinen Geist erleuchtet, zugleich ein schöpferisches Licht ist – „superior quia fecit me, et ego inferior, quia factus ab ea“ – , geht ihm auch die philosophische Tragweite von Exodus 3, 14, auf: „ … und ich sprach: Ist denn die Wahrheit nichts, weil sie weder durch den endlichen noch durch den unendlichen Raum verbreitet ist? Und du riefst mir aus der Ferne: ja, sie ist; ich bin, der ich bin. Da hörte ich, wie man hört im Herzen, und der Zweifel wich von mir gänzlich. Eher hätte ich daran gezweifelt, dass ich lebe als dass es Wahrheit gäbe, die man an der Schöpfung der Welt wahrnimmt.“ 2) Entdeckung der positiv zu verstehenden ‚göttlichen Unendlichkeit‘.56 Etienne Gilson betont, dass hier eine für die Folgezeit und die Entwicklung der philosophischen Theologie entscheidende Weichenstellung stattfindet.57 Fortan genügt es nicht mehr, sich den menschlichen Geist als eine Art Schwamm im Ozean des Unendlichen vorzustellen.58 Augustinus verdankt es seiner Lektüre der Libri Platonicorum59, dass er diese rudimentäre Vorstellung des Unendlichen zugunsten eines adäquateren Begriffs der überwunden konnte. Weil er dieses ‚ganz andere‘ Unendliche mit Gott selbst identifiziert, erscheint dieses in einem völlig neuen Licht: „und dann erwachte ich in dir und sah dich unendlich anders, doch dies Schauen war nicht vom Fleisch“: Vgl. Augustinus, Confessiones, VII, 10, 16-14, 20. Ebd., VII, 10, 16. Ebd., VII, 15. Etienne Gilson, L’infinité divine chez saint Augustin, in: Augustinus Magister. Extrait des Communications du Congrés international augustinien, 3 Bde., Paris 1954, Bd. 1: Communications, S. 569-574. 58Augustinis, Confessiones, VII, 5, 7. 59 Vgl. insbesondere Plotin, Enn. V, Kap. 10, 18-11, 15. 54 55 56 57 56 Jean Greisch „et vidi te infinitum aliter … et in te cuncta finita, sed aliter“.60 Die Bedeutung dieses „sed aliter“ kann nicht überschätzt werden. Sowohl der Cusanische Begriff des ‚Nicht-Anderen‘ als der moderne Begriff des ‚Ganz Anderen‘ sind Versuche, diesem „sed aliter“ gerecht zu werden.61 3) Der dritte Durchbruch betrifft nicht mehr die ontologischen Wesensmerkmale, sondern die noetische Situation, in welcher der Menschengeist sich Gott gegenüber befindet, anders gesagt, das Problem der Erkennbarkeit Gottes. Dubarle spricht diesbezüglich von der Undurchdringlichkeit – oder Unfaßlichkeit – Gottes, die Augustinus in seinen wiederholten Versuchen, das Licht zu finden, das seine Seele erleuchtet, erfährt. Nicht nur gelingt es ihm nicht, das „im Moment eines zagenden Aufblicks“ – „pervenit ad id, quod est in ictu trepidantis aspectu“ – Erfasste festzuhalten; er erkennt auch, dass die neuplatonische Methode des stufenweisen Aufschwungs der Seele zum Einen, an eine noch tiefere Grenze als die der persönlichen Unzulänglichkeit stößt. Wenn man, wie Dubarle vorschlägt, die Formel „pervenit ad id quod est, in ictu trepidantis aspectu“ entsprechend der alten Lesart punktuiert, kann man eine allgemeine These aufstellen, die weit über jede Psychologie hinausreicht: „Ebenso wie Gott, ontisch gesehen, unendlich ist, ist er noetisch gesehen, unfasslich“62, wobei man sorgfältig darauf achten muss, dass diese noetische Undurchdringlichkeit nicht auf die Unmöglichkeit jeder Gotteserkenntnis, anders gesagt auf einen radikalen Agnostizismus hinausläuft. Wäre Augustinus ein Agnostiker im Sinne des von Thomas Henry Huxley geprägten Terminus, könnte er nicht schreiben: „Mit dem Geist ein Stück weit an Gott heran reichen – attingere aliquantum mente Deum – ist grosse Glückseligkeit, ihn zu begreifen – comprehendere – aber ist ganz und gar unmöglich.“ „Das ganze Augustinische Gottesdenken ist … von der Schrift entlehnten Formeln reguliert, die Gott ‚definieren‘ als ‚Der der ist‘: „Ego sum qui sum“ (Ex 3, 14), aber auch als ‚Liebe‘ (caritas, 1 Joh 4, 8), oder dilectio (1 Joh 4,16; als ‚Geist‘ (Joh 4, 24); als ‚Licht‘ (1 Joh 1, 5).“63 Was das „Ego sum qui sum“ aus Exodus 3, 14, betrifft, so betont Augustinus, dass es sich hierbei um einen Eigennamen handelt, der keiner weiteren Bestimmung oder Erläuterung bedarf: „Die Worte Gottes, die dem heiligen Moses durch 60Augustinus, Confessiones, VII, 14. 61 Siehe hierzu Jean Greisch, Du Non-autre au Tout autre. Dieu et l’absolu dans les théologies philosophiques de la modernité, Paris 2012. 62 Dominique Dubarle, Dieu avec l’être. De Parménide à Saint Thomas. Essai d’Ontologie théologale, hg. v. Jean Greisch, Paris 1986, S.188 f. Hervorhebung vom Verfasser. 63 Goulven Madec, Le Dieu d’Augustin, Paris 1998, S. 38. ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 57 einen Engel überbracht werden mit dem Auftrag, sie als Antwort auf die Frage zu erwidern, welches der Name dessen sei, der ihn hingehen hieß, das hebräische Volk aus Ägypten zu befreien, nämlich: ‚Ich bin, der ich bin, und du wirst zu den Söhnen Israels sagen: Der da ist, hat mich zu euch gesandt‘, wie wenn im Vergleich zu ihm, der wahrhaft existiert, weil er unwandelbar ist, alles, was als wandelbar erschaffen worden ist, nicht existierte: diesen Gedanken hat Plato entschieden vertreten und nachdrücklichst betont. Ob sich wohl derartiges irgendwo in vorplatonischen Schriften findet außer eben an der Stelle, wo es heißt: ‚Ich bin, der ich bin, und du wirst zu ihnen sagen: Der da ist, hat mich zu euch gesandt‘? … Aus den Dingen nämlich, die sich in der Schöpfung finden, pflegt die Heilige Schrift gleichsam Lockungen für Kinder zu bilden, damit durch sie die Herzen der Schwachen nach ihrem bescheidenen Maße gewissermaßen schrittweise zur Suche nach dem Höheren und zum Verlassen des Niederen hinbewegt würden. Was aber im eigentlichen Sinne von Gott ausgesagt wird und sich in keinem Geschöpfe findet, das behauptet die Heilige Schrift selten; sie tut es zum Beispiel in dem Worte, das an Moses gerichtet wurde; ‚Ich bin, der ich bin‘, oder in dem anderen: ‚Der da ist, hat mich zu euch gesandt.‘ Da nämlich das Sein in irgendeinem Sinne auch vom Körper und vom Geiste ausgesagt wird, so würde sie sicher nicht so reden, wenn sie das Wort nicht in einem Gott eigentümlichen Sinne verstanden wissen wollte.“64 4) ‚Ipse Deus, ipse idipsum‘: ein Augustinisches Sondergut? In seiner Kennzeichnung des Augustinischen Durchbruchs übergeht Dubarle die Tatsache, dass an zwei Schlüsselstellen der Confessiones der Ausdruck ‚Idipsum‘ verwendet wird. Einmal der Bericht über die Ekstase in Ostia, in dem der Aufschwung zum ‚Idipsum‘ das letzte Ziel des Gespräches zwischen Augustinus und seiner Mutter Monika ist. In „glühender Sehnsucht“ erheben sie sich „zu ihm selbst“: „erigentes nos ardiore affectu in idipsum“.65 Ferner der quasi-liturgische Text im 12. Buch, den Hans Urs von Balthasar mit einem dreifachen „sondern Derselbe, Derselbe, Derselbe“ übersetzt.66 Überblickt man die Sekundärliteratur über Augustinus der letzten Jahrzehnte, so fällt auf, wie viele Publikationen sich mit diesem Rätselwort ‚Idipsum‘ beschäf64Augustinus, De trinitate, I, 1, 2, 15. 65Augustinus, Confessiones, IX, 10, 24. Marion weist auf die Parallelstelle in Enarrationes In Psalmos, 121, hin: „Jam ergo, fratres, quisquis erigit aciem mentis, quisquis deponit caliginem carnis, quisquis mundat oculum cordis, elevet et videat idipsum“. Hervorhebung vom Verfasser. 66 Im Hintergrund steht natürlich der Paulinische Satz in Röm 11, 36: „Ex ipso et in ipso et per ipsum sunt omnia“. Vgl. Etienne Gilson, Introduction à la philosophie chrétienne, Paris 1960, S. 81: „Cette parole est dure, et beaucoup refusent d’y consentir“. 58 Jean Greisch tigen. „Ipse Deus, ipse idipsum“.67 Dass gerade diese Wendung heute soviel Interesse gefunden hat, hängt nicht nur mit den Entwicklungstendenzen der neueren Augustinusforschung zusammen, oder mit der Bestreitung der unter anderem von Jacques Maritain vertretenen These, dass Augustinus in dieser Sache nur ein Wegbereiter der thomistischen Definition Gottes als ‚ipsum esse subsistens‘ gewesen ist, sondern auch mit dem neuen Interesse an einer Hermeneutik der Selbstheit. Ein gutes Zeugnis hierfür ist das 7. Kapitel von Marions Untersuchung Au lieu de soi.68 „Tu autem idem ipse es“69: Wie lässt sich dieser Satz verstehen? In seiner Untersuchung über den Augustinischen Gottesbegriff unterstreicht Madec die überaus wichtige Rolle, die das Geheimnis der göttlichen Selbstheit in der Bekehrung des Heiligen Augustinus, insbesondere in den Schlüsselerlebnissen von Cassiacicum und Ostia gespielt hat.70 Die Selbstgespräche – Soliloquia – ebenso wie das 9. Buch der Confessiones ermöglichen es uns, diese Entdeckung auf die zugleich philosophische und christlichen ‚Einkehrwochen‘ im Herbst und Winter 386 zu datieren, während derer Augustinus „cum ipso me solo coram Te“71 über die Weisheit und die Glückseligkeit nachdenkt, wie es die Tradition der philosophischen Exerzitien empfiehlt. Zugleich aber lebt er sich mit großer, fast überschwänglicher Begeisterung in die Gebetssprache und Gedankenwelt des Psalters ein. Unter allen Psalmversen hat es ihm der 9. Vers des 4. Psalms besonders angetan. In der Ausgabe der Vetus latina lautet er: „in pace in idipsum obdormiam … quoniam tu domine, singulariter in spe constituisti me“. Immer noch von der Versuchung der Ehrsucht gequält, entdeckt der Meditierende in Cassiacicum, zur Zeit, als „eine unglaubliche Feuersbrunst“72 seinen Geist und sein Herz erfasst hatte, ein ‚Selbst-sein‘, das gleichbedeutend mit Frieden und absoluter Glückseligkeit ist. In allen seinen späteren Schriften wird Augustinus den Ausdruck ‚Idipsum‘ als Bezeichnung für das göttliche Leben selbst verwenden. Seine fundamentale Bedeutung zeigt sich nicht nur an der Häufigkeit seiner Verwendung – 1685 Verwendungen im Corpus Augustinianum Gissense, nebst 107 Verwendungen von „id ipsum“ – , sondern auch an der Rolle, die der Ausdruck in der Augustinischen Exegese von Exodus 3, 14, sowie – nicht zu vergessen! – in seinem Kommentar des Johannesevangeliums spielt. Beiderseits betont Augustinus, dass das ‚nomen sub- 67Augustinus, Enarrationes In Psalmos, 121, 12, nach der PL, Bd. 37, 1865, Sp. 1629. 68Marion, Au lieu de soi, a. a. O., S. 389-414. 69Augustinus, Sermo 7, 7, nach der PL, Bd. 38, 1865, Sp. 66-67. 70Madec, Le Dieu d’Augustin, a. a. O., S. 129. 71Augustinus, Confessiones, IX, 4, 7, nach der BA, Bd. 14, 1962, S. 82-83. 72 Aurelius Augustinus, Contra Academicos, II, 2, 5. ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 59 stantiae‘ und das ‚nomen misericordiae‘73 sich gegenseitig ergänzen, so dass man sie nicht gegeneinander ausspielen kann.74 Die Übersetzungsschwierigkeiten, die der Fachausdruck ‚Idipsum‘ aufwirft, sind zugleich Verständnisschwierigkeiten. Soll man ihn, wie Aimé Solignac vorschlägt, mit „das Sein selbst“ – „l’Etre même“, mit „eternal Being“ – so Henry Chadwick, „That which is“, „Being itself“ – wie Maria Boulding, „das Wesenhafte“ – mit von Balthasar – übersetzen, womit einer ontologisierenden Interpretation Vorschub geleistet wird, oder mit Dieter Hattrup vom göttlichen „Selbstsein“75, oder schließlich mit Madec vom „Identischen“ – „l’Identique“76 – sprechen? In einer meiner letzten Unterhaltungen mit Madec habe ich eine andere Übersetzungsmöglichkeit erwogen, die nicht ohne Bezug zum Titel von Ricoeurs Soi-même comme un autre ist: „Der Selbige selbst“ beziehungsweise „das Selbst“ in Person, ein Vorschlag, der diesem großen französischen Augustinuskenner keineswegs ungeheuerlich erschien. Wenn man sich ausschließlich auf das Problem der Kompatibilität der Attribute Gottes konzentriert, kann man mit Wilma C. Gundersdorf von Jess die These vertreten, dass die Termini ‚vere esse‘, ‚incommutabilitas, aeternitas, manentia, idipsum et simplicitas‘ denselben Wahrheitswert haben.77 Diese These blickt allerdings nur auf den propositionalen Gehalt der Aussagen und lässt die Weise des Sagens – das Augustinische ‚dire‘, wie man mit Emmanuel Levinas sagen könnte – unberücksichtigt. Nur ein Ohr, das auf das Sagen, und nicht nur auf das Gesagte achtet, kann verstehen, dass bei Augustinus, mehr als bei anderen Denkern, der Ton die Musik macht. Dies ist besonders wichtig, wenn man verstehen will, inwiefern für Augustinus ‚Idipsum‘ ein „philosophisches Lieblingswort“78 beziehungsweise „der typische Ausdruck des Geheimnisses des göttlichen Seins“79 ist. 73 Aurelius Augustinus, Sermons Denis, II, n° 5, 16, 4-17,2. 74 Emilie Zum Brunn, L’exégèse augustinienne de ‚Ego sum qui sum‘ et la métaphysique de l’Exode, in: Dieu et l’Etre. Exégèses d’Exode 3, 14 et de Coran 20, 11-24, Paris 1978, S. 141-164; Dubarle, Dieu avec l’être, a. a. O., S. 194-196; Madec, Saint Augustin et la philosophie, a. a. O., S. 75. 75 Dieter Hattrup, Die Mystik von Cassiciacum und Ostia, in: Die Confessiones des Augustinus von Hippo. Einführung und Interpretation zu den 13 Büchern, hg. v. Norbert Fischer u. Cornelius Mayer, Freiburg i. Br. 1998, S. 408. 76Madec, Le Dieu d’Augustin, a. a. O., S. 129. 77 Wilma C. Gundersdorf von Jess, Divine Eternity in the Doctrine of Saint Augustine, in: Augustinian Studies 6 (1975) S. 75-96. 78Hattrup, Die Mystik von Cassiciacum und Ostia, a. a. O., S. 408. 79 Aimé Solignac, Idipsum, BA, Bd. 14, a. a. O., S. 550-552; vgl. Marie-François Berrouard, Idipsum, BA, Bd. 71, a. a. O., S. 845-848. 60 Jean Greisch Besonders überschwänglich und fast liturgisch ist die Sprache, in der Augustinus im 12. Buch der Confessiones den Schöpfer von Himmel und Erde preist: „Du hast, o Herr, der du nicht bald auf diese, bald auf jene Weise bist, sondern immer und überall derselbe, heilig, heilig, heilig, Herr Zebaoth, im Anfange, der in dir ist, in deiner Weisheit, die aus deinem Wesen geboren ist, Etwas aus Nichts gemacht.“ „Idipsum et idipsum et idipsum, ‚sanctus, sanctus, dominus deus’ omnipotens“.80 Man kann sich schlecht vorstellen, dass die ‚Causa sui‘ Gegenstand einer solch überschwänglichen Rede sein kann! Einige Interpreten vertreten die Ansicht, dass dieser Fachausdruck seine Wurzeln schon im vorchristlichen Denken insbesondere bei den Neuplatonikern hat.81 Ausschlaggebender ist jedoch der Entdeckungszusammenhang, in dem dieser Begriff sich Augustinus aufgedrängt hat. Für Marion ist der ebenerwähnte Passus des 12. Buches der Confessiones die Schlüsselstelle, von der die Interpretation des Terminus auszugehen hat. Sie beweist erstens, dass es sich um eine Benennung und nicht um eine Bestimmung handelt. Ihr Sinn kann nur im Vollzug des Aktes der Lobpreisung verstanden werden. Das hinweisende Pronomen ‚id‘ wird durch das Adverb ‚ipsum‘ verstärkt, weshalb Marion betont, dass dieser deiktische Ausdruck – der Linguist würde in diesen Fall von einer Personaldeixis sprechen – nicht mit einer Definition verwechselt werden darf,82 wie es die ontologisierenden Übersetzungen von Confessiones, IX, 9, 4, 11, Confessiones, 12, 15, 21,und Confessiones, 13, 11, 12, tun. Diese Fehlübersetzungen laufen Marion zufolge auf einen fundamentalen Widersinn hinaus,83 in dem der Augustinische Text durch einen thomistischen Subtext ersetzt wird: Zwar sage Augustinus ‚idipsum‘, aber in Wirklichkeit würde er ‚ipsum esse‘ – das Sein selbst – sagen wollen! Der Schlüsseltext, auf den Marion seine Interpretation gründet, ist Ennar. In Ps., 121, 5, in dem er vier Punkte hervorhebt: 1) Mit der Benennung des ‚idipsum‘ rührt die menschliche Sprache an eine unüberwindliche Grenze. Sie dreht gleichsam im Kreise dessen, was analytische Sprachphilosophen als eine ‚bedeutsame Tautologie‘ bezeichnen würden. Für Marion handelt 80Augustinus, Confessiones, XII, 7. 81 James Swetnam, A note in idipsum in S. Augustine, in: The Modern Schoolman 30 (1953) S. 328-331. 82Marion, Au lieu de soi, a. a. O., S. 400. 83 Ebd., S. 401: „constant faux-sens qui aboutit à un contre-sens sur le fond“. ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 61 es sich um eine „radikale und endgültige apophatische Bezeichnung“,84 die weder das Wesen Gottes erfasst, noch den Anspruch erheben kann, eine Definition zu sein. 2) In einer solchen Situation ist die Versuchung groß, zu sagen: ‚Was ich nicht erreichen kann, geht mich nichts an‘ – oder mit Wittgenstein gesprochen: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Das ist aber gerade nicht das Fazit, das Augustinus aus seiner Einsicht in das Unvermögen der menschlichen Sprache zieht. Was man nicht definieren kann, kann man dennoch umschreiben und auf diese Weise versuchen, sich der unerreichbaren ‚Sache selbst‘ anzunähern. Die Annäherung besteht in diesem Fall im Vergleich zweier gegensätzlicher Seinsweisen: Ewigkeit – Unwandelbarkeit – und Vergänglichkeit – Veränderung – . Gegenüber dem vergänglichen und alterierbaren Sein, lautet der wahre Name des Seins: ‚incommutabilitas‘.85 3) Anschließend – in Marions Interpretation handelt es sich um ein ‚erst jetzt‘, das heißt: erst nachdem der apophatische Charakter des ‚Idipsum‘ festgestellt worden ist – schlägt der Kommentar die Brücke zu Exodus 3, 14: „Et quid est quod est, nisi ille qui quando mittebat Moysen, dixit illi: Ego sum qui sum? Quid est hoc, nisi ille qui cum diceret famulus eius: Ecce mittis me: si dixerit mihi populus: Quis te misit? quid dicam ei? nomen suum noluit aliud dicere, quam: Ego sum qui sum; et adiecit et ait: Dices itaque filiis Israel: Qui est, misit me ad vos. Ecce idipsum: Ego sum qui sum: Qui est, misit me ad vos. Non potes capere; multum est intellegere, multum est apprehendere.“86 Anstatt dass man die ‚thomasische‘ Gleichung: ‚Idipsum = ipsum esse‘ ratifiziert, wird man Augustinus besser gerecht, wenn man sagt, dass ‚Idipsum‘ der augustinische Schlüssel für die Formel ‚Ego sum qui sum‘ ist. Für Marion bedeutet das, dass die Unwandelbarkeit – und nicht das Sein selbst – den entscheidenden Unterschied zwischen Gott und Mensch ausmacht. 4) Ebenso bedenkenswert ist die anschließende christologische Interpretation des ‚Idipsum‘, im Rückgriff auf Joh 8, 27, Joh 12, 19, und Phil 2, 6: „Quid enim debes tenere? Quod pro te factus est Christus, quia ipse est Christus; et ipse Christus recte intellegitur: Ego sum qui sum, quo modo est in forma Dei. Ubi non rapinam arbitratus est esse aequalis Deo, ibi est idipsum. Ut autem efficiaris tu particeps 84 Ebd., S. 406. 85 Vgl. Augustinus, Sermo, 7, 7, PL Bd. 38, 1865, Sp. 66; Ders., De vera religione, 21, 41; Ders., De trinitate, III, 3, 8. Hervorhebungen vom Verfasser. 86 Ex 3, 14. Hervorhebungen vom Verfasser. 62 Jean Greisch in idipsum, factus est ipse prior particeps tui; et Verbum caro factum est, ut caro participet Verbum.“ Derjenige, der in ‚unzugänglichem Licht‘ wohnt, ist im fleischgewordenen Wort Gottes sichtbar geworden. Auf diese Weise erhält das ‚Idipsum‘ eine soteriologische Bedeutung.87 Dubarle spricht diesbezüglich von einer „Onto-Christologie des Wortes“88, die, seiner Auffassung nach, uns zwingt, mindestens vier Grundbedeutungen des Seins zu unterscheiden: • • • • das ‚absolute‘ und univoke Sein des Parmenides; das Sein der Gottesoffenbarung in Exodus 3, 14; das Sein der Teilnahme am Leben des Gotteswortes; das Sein der Selbstbezeichnung Christi in den ‚Ego eimi‘-Formeln des Johannesevangeliums. 89 Auch wenn man Marions Warnung vor einer voreiligen ‚metaphysischen‘ – das heißt ontologischen – Interpretation des Ausdrucks ‚Idipsum‘ ernstnimmt, stellt sich dennoch die Frage, ob die rein deiktische Interpretation des Ausdrucks sich restlos durchhalten lässt. Wenn etwa Augustinus im De trinitate behauptet, dass Gott das ‚Idipsum‘ selbst ist – „Deus … idipsum est“90 – , dann wird nicht nur auf Gott hingewiesen, sondern etwas über ihn ausgesagt. Dass der Steg vom ‚Idipsum‘ zum ‚ipsum esse‘ nicht ganz und gar unbetretbar ist, zeigt ein besonders bemerkenswerter Passus des Kommentars zu Psalm 101, in dem Augustinus sich fragt, wie der Satz: „Gott wird alles in allem sein“91 aus dem Brief an die Korinther zu verstehen ist. Die Antwort besteht zunächst im Hinweis darauf, dass die Ewigkeit die Substanz Gottes selbst ist. Das ewige ‚Ist‘ Gottes lässt sich weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft deklinieren denn es ist reine Gegenwärtigkeit. Wie er das häufig tut, stützt Augustinus seine Überzeugung auf einen Hinweis auf die scheinbar tautologische Selbstvorstellung Gottes in Exodus 3, 14b. Was kann ein Mensch mit der göttlichen Selbstbezeichnung „Ego sum qui sum“ anfangen, die offenbar anders funktioniert als die Eigennamen der Menschen? Ist das alles? Genügt es, Gott als ipsum esse zu bezeichnen?, lässt Augustinus Mose fragen, der in seiner Glosse sogar die Chuzpe hat, Gott zu fragen, ob er ihm nicht eine bessere Antwort 87 Aurelius Augustinus, In Joh. Tactatus, 38, 8. Hervorhebungen vom Verfasser. 88Dubarle, Dieu avec l’être, a. a. O., S. 243 f. 89 Ebd., S. 241. 90Augustinus, De trinitate, III, 10, 21. 91 1 Kor 15, 28. ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 63 anzubieten hat: „Ego sum. Quis? Qui sum. Hoc est nomen tuum? hoc est totum quod vocaris? Esset tibi nomen ipsum esse, nisi quidquid est aliud, tibi comparatum, inveniretur non esse vere? Hoc est nomen tuum: exprime hoc idem melius.“ Die Antwort, die Mose erhält, besteht in nichts anderem als im Sendungsauftrag, und, damit verbunden, in der Aufforderung, dieses große göttliche ‚Ist‘ ernstzunehmen: „Magnum ecce Est, magnum Est! Ad hoc homo quid est? Ad illud tam magnum Est, homo quid est, quidquid est? Quis apprehendat illud esse? quis eius particeps fiat? quis anhelet? quis aspiret? quis ibi se esse posse praesumat?“. Gottes Weigerung, seinen Namen zu erklären und zu erläutern, hat keinen rein negativen Sinn, gleichsam als würde der Mensch nur in seine Schranken verwiesen. Sie bereitet den Boden für das Verständnis der anschließenden Bezeichnung Gottes als „Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“ vor: „Noli desperare, humana fragilitas. Ego sum, inquit: Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Iacob. Audisti quid sim apud me, audi et quid sim propter te.“ Das nomen substantiae ‚Idipsum‘ und das nomen misericordiae „Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“92 sind ebenso unzertrennlich wie Tag und Nacht.93 Ist damit Augustinus zu einem Vorläufer und Wegbereiter Thomas von Aquins geworden? Paradoxerweise beruft Marion sich gerade auf Gilson, der darauf hinweist, wie weit die Augustinische These ‚Aeternitas ipsa Dei substantia‘ von der thomasischen These ‚Deus est suum esse‘ entfernt ist. Was in der Lektüre von Gilson – und ebenso von Dubarle – als eine Unzulänglichkeit erscheint, verwandelt sich in der Darstellung von Marion in eine weitaus grundsätzlichere Frage: Soll man sich darauf versteifen, „einem Denken, das sich einem ganz anderen Horizont als dem der Metaphysik, und bei dem etwas ganz anderes als die Seinsfrage auf dem Spiel steht, eine ontisch-ontologische Hermeneutik aufzuwingen“94? 92Augustinus, Sermo Denis, II, n 5. Hervorhebungen vom Verfasser. 93 PL, Bd. 39, 1865, Sp. 1726. 94Marion, L’approche d’Augustin, a. a. O., S. 414. Hervorhebung im Original. 64 5 Jean Greisch Die Selbstheit Gottes und das Selbstverständnis des Menschen Mehrere Indizien des 9. Buches der Confessiones weisen darauf hin, dass die Entdeckung Gottes als ‚Idipsum‘ ein neues Selbstverständnis des Menschen nach sich zieht. Am Anfang des ersten Kapitels ertönt bereits die Frage: „Wer bin ich und was bin ich?“ – „quis ego et qualis ego?“,95 die im 10. Buch wiederaufgegriffen wird.96 Das qualis kann man in diesem Fall im Sinn des deutschen Wortes ‚Qual‘ verstehen. Es ist ein gequälter, von widersprüchlichen Sehnsüchten hin- und hergerissener Mensch, der sich hier seinen Lesern vorstellt. Zwar möchte er seine „Zunge vom Markt der Geschwätzigkeit nicht gewaltsam, sondern unbemerkt zurücktreten … lassen“,97 aber ein somatisches Symptom, das, wie alle Symptome dieser Art, zweideutig ist, beweist, wie schwer ihm der zu leistende Verzicht fällt. Die Art und Weise, wie Augustinus seine Atemnot und die damit verbundene Aphasie beschreibt, zeigt, dass er schon eine Ahnung von dem hatte, was Sigmund Freud die „sekundären Vorteile“ der Krankheit nennt.98 Augustinus ahnt, was die Ursache dieses Gefühls der angstvollen Beklemmung, die ihm den Atem verschlägt, ist. Seine damaligen wissenschaftlichen Arbeiten beweisen, dass sie während dieser Bedenkpause „die Schule des Stolzes noch ausschnauften“.99 In dieser beklemmenden Situation nimmt er Zuflucht zu den Psalmen Davids, die sein Herz freimachen und seine Stimme lösen, die er jetzt gleichsam Gott selbst überläßt: „Wie pries ich dich – quas tibi voces dabam – bei diesen Lobgesängen, wie ward ich durch sie zu dir begeistert und entflammt!“100. Diese Wendungen deuten an, dass Augustinus nicht nur die Stimme wiedergefunden hat – il ‚donne de la voix‘, wie man im Französischen sagen würde, sondern auch, dass er indem er Gott selbst seine Stimme ausliefert, er zu einem anderen, einem ‚Hingegebenen‘ – „adonné“ im Sinne von Marion – geworden ist. Dies gilt in besonderer Weise für die Lektüre des 4. Psalms, die Augustinus ausführlich schildert, wobei er die performative und transformierende Wirkung dieser Rezitation besonders unterstreicht. Worum es ihm geht, ist „wie dieser Psalm 95Augustinus, Confessiones, IX, 1. Hervorhebung vom Verfasser. 96 Ebd., X, 17, 26: „Magna vis est memoriae, nescio quid horrendum, Deus meus, profunda et infinita multiplicitas; et hoc animus est et hoc ego ipse sum. Quid ergo sum, Deus meus? Quae natura sum? Varia, multimoda vita et immensa vehementer.“ 97 Ebd., IX 2, 2. 98Ebd., IX, 4, 2. 99 Ebd., IX, 4, 7. 100Ebd., IX, 4, 8. ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 65 auf mich wirkte“, beziehungsweise, wortwörtlicher: „was dieser Psalm aus mir gemacht hat“: „quid de me fecerit ille psalmus“. 101 Zweifellos hat er ihn immer wieder gelesen. Wenn man aber unter ‚Lektüre‘ die Aneignung des Sinnes eines Textes versteht, wäre es angebrachter zu sagen, dass in diesem speziellen Fall der Psalm Augustinus ‚gelesen‘, ihn ergriffen und viel besser begriffen hat, als er selbst es tu tun vermochte. Seine erste Wirkung besteht darin, dass er Augustin ‚freigesetzt‘, beziehungsweise, noch wortwörlicher: ihn ‚erweitert‘: „dilatasti mihi“.102 hat. Es ist eine ‚Erweiterung‘ eigentümlicher Art, die nichts mit einem ozeanischen Gefühl gemeinsam hat, denn sie hängt von einer bestimmten Weise, „mit mir selbst und für mich selbst vor dir zu sprechen“.103 Es ist diese neue Sprechsituation, anders gesagt: die Möglichkeit eines ganz anderen Sprechens, und nicht nur ein anderer Gottesbegriff, der Augustinus aus den Fallstricken der Manichäer befreit. Wenn er schreibt: „Ich schrie auf, da ich dies Wort las von außen und in meinem Innern seine Wahrheit erkannte“,104 dann bezeichnet er damit zugleich den Punkt, an dem seine Art und Weise des Lesens sich grundsätzlich von dem unterscheidet, was wir Postmodernen ‚Lektüre‘ nennen. Nur in einer derartigen Sprechsituation konnte die Entdeckung des göttlichen ‚Idipsum‘ sich ereignen. Wie weitreichend die Konsequenzen der Entdeckung des ‚Idipsum‘ für das Problem des Selbstverständnisses sind, zeigt sich schon in den Anfangskapiteln des 10. Buches der Bekenntnisse. Eine Schlüsselformel fasst die Bedeutung zusammen, die Augustinus der Wo?-Frage zumisst: „Wo fand ich dich, um dich zu lernen, wenn nicht in dir, über mir“ – „in Te supra me“?105 Die Frage nach dem ‚Wo?‘ Gottes ist unzertrennlich mit der Frage verbunden, „was ich selbst im Innern bin“: „quid ipse intus sim“.106 In seinem Kommentar des 10. Buches betont Johann Kreuzer, dass „das Selbst, das sich von Gott erkannt weiß, … nicht Voraussetzung, sondern Resultat der Geschichte(n)“107 ist, die es erinnert. Die memoria, die in 101Ebd. 102Ebd., IX, 4, 8. 103Ebd. 104Ebd., IX, 4, 10. 105Ebd., X, 26, 37; vgl. hierzu Goulven Madec, ‚In te supra me‘. Le sujet dans les ‚Confessions‘ de Saint Augustin, in: Revue de l’Institut Catholique de Paris 28 (1988) S. 45-63. 106Ebd., X, 3; vgl. hierzu Norbert Fischer, Unsicherheit und Zweideutigkeit der Selbsterkenntnis. Augustins Antwort auf die Frage ‚quid ipse intus sim’ im 10. Buch der ‚Confessiones‘, in: Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität, hg. v. Reto Luzius Fetz, Roland Hagenbüchler u. Peter Schulz, 2 Bde., Berlin u. New York 1998, Bd. 1, S. 340-367. 107Johann Kreuzer, Der Abgrund des Bewusstseins. Erinnerung und Selbsterkenntnis im 10. Buch, in: Die Confessiones des Augustinus von Hippo, a. a. O., S. 446. 66 Jean Greisch den ersten neun Büchern als eine Art von Erzählstimme fungiert hatte, welche die narrative Identität des Bekenners rekonstruiert, verwandelt sich nun in ein Prinzip der Selbsterkenntnis und der Gotteserkenntnis, die beide unzertrennlich miteinander verbunden sind. Das zeigt sich schon am literarischen Aufbau des 10. Buches, das in einem ersten Schritt den Aufstieg der memoria amans et desiderans zu Gott, und in einem zweiten Schritt die umgekehrte Bewegung des Abstiegs der Sorge – cura – zur jederzeit der Versuchung ausgesetzten Prüfung der Endlichkeit, die sich in den drei Grundformen der Versuchung widerspiegelt: voluptas carnis, curiositas – libido sciendi – und die innerlichste Form der Versuchung in der Gestalt der Ehrsucht – ambitio saeculi – . Offenbar haben wir es auch hier mit einer ‚Metaphysik der Umkehr‘ zu tun. Bezeichnenderweise konzentriert Heideggers phänomenologische Interpretation des 10. Buches der Confessiones sich weitaus stärker auf die Abstiegsals auf die Aufstiegsbewegung. Für Augustinus selbst ist der Gottesname ‚Idipsum‘ der Gipfel der Aufstiegsbewegung, der zugleich ein neues Selbstverständnis des Menschen ermöglicht. Insofern ist es „das Grundwort Augustins für das Leben Gottes. Gott hat ein Selbst, das der Mensch ersehnt und nicht besitzt.“108 Wenn wir von hier aus einen Blick auf Heideggers Kennzeichnung der ‚ontotheologischen‘ Konstitution der Metaphysik zurückwerfen, springen uns mehrere Punkte in die Augen. (a) Erstens deutet nichts darauf hin, dass der Gott, den Augustinus mit dem Ausdruck ‚Idipsum‘ bezeichnet, mit der ‚Causa sui‘ identifiziert werden kann. Abgesehen von den inhaltlichen Differenzen kann man sagen, dass beide Begriffe verschiedenen Fragen zugeordnet sind. ‚Causa sui‘ ist eine mögliche Antwort auf die Frage: ‚Was ist Gott?‘, während der Terminus ‚Idipsum‘ der Wer-frage zugeordnet werden muss. (b) In Heideggers „andersanfänglichem Denken“, das er nach der Kehre im Seinsdenken entwickelt, begegnen wir der rätselhaften Gestalt des „letzten Gottes“, von dem es heißt, er sei „der ganz Andere gegen die Gewesenen, zumal gegen den christlichen“.109 Diesen Spruch können wir vorläufig wie folgt verstehen: Heideggers ‚letzter Gott‘ ist der ‚Ganz Andere‘, zumal gegen das Augustinische ‚Idipsum‘. 108Ebd., S. 408. 109Martin Heidegger, Vom Ereignis, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 65: Beiträge zur Philosophie. (Vom Ereignis). 1936-1938, hg. v. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 2003, S. 403. ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage 6 67 Schluss Ist die eingangs erwähnte Frage: „Was ist in Deinem Herzen vorgegangen als du das Wort Gott hörtest? Was ging in meinem Herzen vor, als ich ‚Gott‘ sagte?“ – „Quid factum est in corde tuo, cum audisses: Deus? Quid factum est in corde meo, cum dicerem: Deus?“ – und die Antwort: ‚Idipsum‘, für uns unnachvollziehbar geworden? Man kann hierauf mit einem Autoritätsargument antworten, indem man auf die bleibende Faszination verweist, welche die Bekenntnisse gerade auf postmoderne Denker wie Jacques Derrida oder Jean-François Lyotard ausgeübt haben. Vielleicht kann man aber noch einen Schritt weitergehen, und sich im Rückgang auf Ricoeurs Unterscheidung der Selbigkeit – mêmeté – und der Selbstheit – ipséité – fragen, ob nicht gerade der Augustinische Gottesname Idipsum uns eine Möglichkeit entdeckt, Gott ganz anders als die Selbigkeit der ‚Causa sui‘ zu verstehen. In seinem Kommentar zu Exodus, 3, 14, lädt Ricoeur uns dazu ein, eine Brücke zwischen der von Grund auf brüchigen Selbstheit des Menschen und der abgründigen Selbstheit des Menschen zu schlagen. „Auf diese Weise tut sich die extremste Ferne zwischen einem unbekannten und unaussprechlichen Gott und den Menschen, die mit der abgründigen Frage: Wer bin ich? konfrontiert sind, auf. Jede Art der Beziehung zwischen den beiden Extremen kann nur die Durchschreitung eines Intervalls anhand anderer Weisen des Benennens sein, die Gott den Menschen näher bringen. Aber diese Nähe kann nur die Durchschreitung einer Distanz sein, in der die Ferne bestimmend bleibt, wie es der deutsche Ausdruck Ent-fernung nahelegt, der etymologisch eine Art von Aufhebung der Ferne andeutet.“110 Angenommen, dass unsere Aufgabe darin bestünde, diese Bewegung der ‚Ent-Fernung‘ zu vollziehen, dann fänden wir in Augustinus einen zuverlässigen Wegbegleiter. 110Paul Ricoeur, André LaCocque, Penser la Bible, Paris 1998, S. 165. Hervorhebung im Original. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ Zum Verhältnis von Metaphysik, Phänomenologie und Mystik bei Jacques Derrida, Jean-Luc Marion und Michel Henry Rolf Kühn Wenn Meister Eckhart paradigmatisch die ‚unio‘ und damit das Um-Gott-Wissen sowie das Um-sich-Selbst-Wissen der horizonthaften Welterscheinung entzieht, das heißt jegliche Weise aufgibt, sich Gott bildlich oder begrifflich zu re-präsentieren, dann fällt von seinem mystisch-philosophischen Verständnis her auch bereits die gegenwärtige Kritik an einer apophatischen Religionsphänomenologie dahin, wie dies im Folgenden betrachtet werden soll. So betonte Jacques Derrida zur Aufrechterhaltung seines eigenen Differänzgedankens im Sinne der durchgehenden Dekonstruktion der ‚metaphysischen Präsenz‘ als dem vorherrschenden phänomenalen Raum des Erscheinens im abendländischen Denken die angebliche Tatsache, die negative Theologie verstärke durch ihre ‚supra-essentiale‘ Betonung des Daseins Gottes nur auf eminente Weise die Unverzichtbarkeit solcher Präsenz eben, um Gott überhaupt denken zu können, falls er nicht zu einem unerwünschten ‚Nichts‘ werden soll, welches die Theologie als solche gerade nicht wollen könne.1 Ob die Replik Jean-Luc Marions darauf im Sinne eines ‚saturierten Phänomens‘, welches unseren ‚Namen‘ in Gottes ‚Anruf‘ einbezieht – und nicht umgekehrt – , die Problematik wirklich lösen kann, bleibt fraglich, wozu wir die weiterführenden Analysen Michel Henrys als radikal phänomenologische Kritik am Status ekstatischer Transzendenz heranziehen werden. 1 Vgl. Jacques Derrida, Comment ne pas parler. Dénégations, in: Psyché. Inventions de l’autre, Paris 1987, S. 535-595; dt. Wie nicht sprechen. Verneinungen, Wien 1989; vgl. dazu auch Jean-Luc Marion, De surcroît. Études sur le phénomène saturé, Paris 2001, S. 158 ff.; Markus Enders, Postmoderne, Christentum und Neue Religiosität. Studien zum Verhältnis zwischen postmodernem, christlichem und neureligiösem Denken, Hamburg 2010, S. 111-146: Zur Dekonstruktion negativer Theologie und zur Transformation mystischer Theologie bei Jacques Derrida. 69 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7_5 70 1 Rolf Kühn Die Mystik-Rezeption bei Jacques Derrida Nach dieser Vorbemerkung soll die eigentliche Analyse zu Jacques Derridas Rezeption der mystischen Tradition erfolgen, wie sie zunächst unter dem Titel Verneinungen vorliegt, wobei er für sein Dekonstruktions-Denken den Charakter einer ‚negativen Theologie‘ strikt zurückweist, da letztere immer noch einen propositionalen Charakter durch die „Einheit des Wortes“ und die „Autorität des Namens“ besitze und ontologisch noch einer schon genannten „Hyper-Essentialität“ unterliege. Das heißt, die Zuordnung Gottes zu einem „überwesentlichen Sein“ durch Dionysios Areopagita – die sich auch bei Meister Eckhart wieder findet – sei unstatthaft, da der Horizont des Seins dadurch nicht verlassen werde und ‚Gott‘ noch über eine Identifikation als ein gegenwärtiges ‚Etwas‘ gedacht werde – was angeblich in seinem eigenen Begriff von ‚Spur‘ und ‚Differänz‘ nicht mehr der Fall wäre, da diese vor Begriff, Namen und Wort – ‚Etwas‘ – operierten, also auch nicht mehr dem Gegensatz von Anwesenheit/Abwesenheit angehörten.2 Die Zurückweisung dieser onto-theologischen Logik und Grammatik, wie Martin Heidegger diesen Begriff eingeführt hat, lehnt aber nicht nur eine an Präsenz gebundene Seinsweise Gottes formal ab, sondern Derrida hält auch die Annahme oder Verheißung einer Vereinigung Gottes mit dem Menschen für falsch und irreführend. Dabei sieht er richtig, dass es sich gemäß der Tradition um eine „schweigend vollzogene Vereinung“ handelt, „dem Sprechen unzugänglich“; aber diese apophatische Reduktion wird nur als eine „absolute Verknappung“ der Zeichen, Figuren und Symbole beziehungsweise auch der Fiktionen und Mythen gesehen. Es ist hier bereits unübersehbar, dass Derrida einerseits mit einem ‚Textapriori‘ beginnt und andererseits mit einem Gott der Transzendenz, sofern er Mystik als „Aufstieg“ oder „Durchquerung … eines finsteren Lichts“ zu verstehen scheint, mit anderen Worten als „Anschauung“ einer „‚mehr als lichtvollen Dunkelheit“, wie es die Sprache des Dionysios’ vorgibt3, da Derrida rein phänomenologisch nicht von einer immanenten Unmittelbarkeit ausgeht, die noch vor dem ‚Vor‘ der Dekonstruktion liegen könnte. Dem entspricht auch die Feststellung, die negative Theologie habe stets die Tendenz zur Esoterik des Geheimnisses hin ausgebildet, welche in der gesuchten Jenseitigkeit von Bejahung und Verneinung angelegt sei, weshalb Derrida des Wei2Derrida, Wie nicht sprechen. Verneinungen, a. a. O., S. 16 ff.; vgl. ebd., S. 38 f., mit Bezug auf das ‚hyper‘ als ‚jenseits‘ und ‚mehr‘: „Gott (ist) jenseits des Seins, aber darin (Sein) über das Sein hinaus, mehr als das Sein“ – worin daher eine ‚zweideutige Hierarchie‘ gelesen wird. 3 Ebd., S. 20 f. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 71 teren zunächst eine „Topolitologie des Geheimnisses“ im Anschluss an De mystica theologia des Areopagiten4 festhält. Die Strukturelemente seien dabei folgende: (a) Gott fordere, sich vom Unreinen abzuwenden, wodurch das Versprechen gegeben werde, die verheißene Gabe zu erhalten, wenn ein vollkommenes Leben geführt werde. (b) Gemäß seiner disseminierenden Strategie erblickt Derrida hierin auch politische und pädagogische Aspekte, nämlich den doppelten Modus einer Einschreibung des Wissens in eine mystisch-verbergende und in philosophisch-beweisende Form. Dadurch ergebe sich jedoch eine Kreuzung wie innere Teilung von Geheimnis und Nicht-Geheimnis, was einen Widerspruch darstelle, der nur durch dessen Selbstaufhebung im Sinne einer Mittelung oder Offenbarung aufgehoben werden könne: „Und in dem als solches des Geheimnisses, welches sich verneint/ verleugnet/in Abrede stellt, weil es, um zu sein, was es ist, sich sich selbst offenbart, lässt diese absprechende Verneinung – dénégation – der Dialektik keine Chance.“ Gleichzeitig bedeutet jedoch für Derrida ‚Gott‘ das absolute Geheimnis schlechthin – so bereits wie Gabe oder Gerechtigkeit als das Undekonstruierbare – , weshalb sich der Name Gottes auch nicht aussagen lasse, was mit der „Modalität dieser geheimen absprechenden Verneinung“ übereinstimme.5 (c) Derridas „Topolitologie“ 4 Vgl. die deutsche Übersetzung Dionysios Areopagita, Über die mystische Theologie, hg. Adolf M. Ritter, Stuttgart 1994. 5Derrida, Wie nicht sprechen. Verneinungen, a. a. O., S. 45 u. S. 48. Hervorhebungen im Original. In seinem Beitrag Passionen. Die indirekte Opfergabe nennt dann Derrida auch „Geheimnis ohne Inhalt“, wie es sich performativ in der unbedingten sittlichen Verpflichtung zeige, ausdrücklich ein „absolutes Geheimnis“; vgl. Über den Namen. Drei Essays, Wien 2000, S. 15-62, hier S. 41, wobei, ebd., S. 45, der „Ruf des Geheimnisses“ wiederum darin besteht, „auf den Anderen oder Anderes“ zu verweisen, „wenn eben dies unsere Leidenschaft – passion – in Atem hält und uns an den Anderen bindet“. Allerdings wird, ebd., S. 45, der differäntielle Verdacht nicht aufgegeben, dass auch das Geheimnis „nicht mehr als ein Wort“ – mot – sein könnte. Gerade dies jedoch kann von keiner Passion gesagt werden, insofern ihre affektive Gegebenheit nicht zurückgewiesen werden kann in dem Augenblickt, wo sie sich manifestiert, wodurch auch die Verbindung zwischen Geheimnis und Passion nicht von einem Wort abhängen kann, sondern eben in der selbstaffektiven Rekurrenz – Reduktion – zurückzuverfolgen wäre. Derrida nennt, ebd., S. 46, dieses „absolute Geheimnis“ dann auch einfach „Leben, Existenz, Spur“ beziehungsweise „die absolute Einsamkeit einer Passion ohne Martyrium“, von der es keinen geschichtlichen oder sicher erkennbaren Zeugniswert gebe, was aber radikal phänomenologisch nur heißen kann, dass die Passion nicht der Transzendenz angehört – keine Distanz kennt, in der sie sich als Passion – Selbstaffektion – zeigen kann. Und die ‚Einsamkeit‘ wäre genau die Ipseität ohne jede Re-Präsentation – im Sinne von Bewusstsein, Subjektwissen, Eigentlichkeit des Daseins – , das heißt die Ipseität als absolute Alterität, sofern „man den einen nicht auf den anderen reduzieren“ darf, weil dies gar nicht geht – und dies macht in unseren Augen die phänomenologisch-ontologische ‚Einsamkeit‘ aus, die nicht Alleinsein bedeutet. 72 Rolf Kühn erkennt zwar Gottes Existenz an, betont aber gleichzeitig seine Inexistenz in Bezug auf irgendeinen Ort seines Seins, womit Gott als der ‚ganz Andere‘ gewahrt werden könne. Dies heißt mit anderen Worten, dass dieser Gott unsere Sprache, sinnliche Wahrnehmung und auch die intelligiblen Orte der geistigen Erkenntniskräfte transzendiere. Es gibt also letztlich eine ‚Atopik Gottes‘, seine für uns ortlose Gegenwart, welche im Sprach- und Denkhorizont als das „Absurde, das Extravagante, das Verrückte“ erscheine. Derrida sieht also richtig, dass der ‚Ort Gottes‘ nicht mit dem ‚göttlichen Überwesen‘ kommuniziert, was ihn aber nicht dazu führt, die Kategorie der Transzendenz als solche für die „Offenbarung Gottes“ – an sich und in uns – aufzugeben, sondern sie nur als Para-dox – das Ver-rückte – stehen zu lassen. Mit anderen Worten lässt die Transzendenz für Derrida die Möglichkeit zu, zwischen Ort Gottes, Zugang zu Gott und Sprache – Theologie – die begriffliche Rhetorik in Bezug auf Gott spielen zu lassen, denn einerseits ist Gott „nicht und findet er nicht statt“ – n’a pas lieu – , „oder eher, er ist und findet statt, aber ohne Sein/ohne zu sein und ohne Ort, ohne Ort zu sein“ – sans être son lieu – , und andererseits ist die Sprache jener „Ort Gottes“, wie dieser „ohne uns, in uns, vor uns“ bereits begonnen hat: „Das ist dies, was die Theologie Gott nennt und es ist geboten, es wird geboten gewesen sein zu sprechen.“6 Ein Zugang zu Gott innerhalb der Sprache als sein ‚stattfindender Ort‘ kann daher, weil Gott nicht selber oder direkt in seiner Selbstoffenbarung dieser ‚Zugang‘ ist, im ‚Ruf des Anderen‘ erfolgen, was einschließt, dass ein solcher Ruf als Zugang für immer die Präsenz Gottes differiert. Dass Derrida sich dabei die Unterscheidung innerhalb der mystischen Theologie zwischen dem ‚Zugang zum Schauen Gottes‘ und dem ‚Zugang zu dem Ort, wo Gott wohnt‘, für seine Argumentation zunutze macht, ist letztlich nicht stichhaltig, da diese Unterscheidung für eine Bestimmung des Mystischen nicht wesentlich ist, sofern diese die radikal phänomenologische Unmittelbarkeit Gottes bedeutet, welche weder an ‚Ort‘ noch ‚Zugänglichkeit‘ gebunden ist, sondern an die Selbstgebung Gottes, wodurch dann auch die Dissemination von sein/Statt haben – être/avoir lieu – und Ort – lieu – keine weitere Bewandtnis mehr besitzt. Dies lässt sich am weiteren responsorischen Charakter der Sprache überprüfen, von dem Derrida auch hier in Verneinungen feststellt „Dieser Ruf des Anderen, der stets bereits dem Sprechen vorangegangen, dem er also niemals ein einziges Mal gegenwärtig gewesen ist, kündigt sich im voraus an als ein Rückruf. Eine solche Referenz auf den Anderen wird Statt gefunden haben 6Derrida, Wie nicht sprechen. Verneinungen, a. a. O., S. 41 u. S. 55 f.; vgl. dazu auch Johannes Valentin, Atheismus in der Spur Gottes. Theologie nach Jacques Derrida, Mainz 1997, S. 185 f. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 73 … Spur eines Ereignisses, älter als sie, oder eines zukünftigen ‚Statt Findens‘, das eine und das andere: es gibt da weder Alternative noch Widerspruch.“7 Denn wenn die Spur als Ereignis immer schon gegeben ist, dann wird auch die Unterscheidung von Vorher/Nachher beziehungsweise Vergangenheit/Zukunft hinfällig, insofern der Anruf als stetiger Anruf wohl existentiell überhört werden kann, aber nicht in seiner immerwährenden Ge-Gebenheit, da er sonst nicht ‚stets‘ sprechen könnte. Die Negation einer nicht wahrnehmbaren Anwesenheit ist also kein Argument für die Selbst-Gegebenheit des Anrufs, ob man diese nun ‚Präsenz‘ nennt oder nicht. Derrida kommt bei seiner ‚Übersetzung‘ des angeblichen Paradoxes des Anrufs als vorher/zukünftig „in die christliche Apophatik des Dionysios“, welcher das Vermögen, von Gott gut zu sprechen, bereits als von Gott kommend unterstreicht, zur Anwendung seines Differänz-Denkens als eines responsorischen Sprechens: „Die Ursache, die Gabe der Gabe, die Anordnung und die Verheißung sind dasselbe, das Selbe, auf das oder eher noch auf Den die Verantwortung dessen, der spricht und der ‚gut spricht‘, antwortet.“ Dies kann dann konsequent im Levinasschen Sinne ausgeweitet werden auf alle Situationen, denn falls die Spur der responsorische Charakter jeglicher menschlichen Begegnung selbst ist, im Sprechen oder im Gesellschaftlichen, dann beinhaltet das „gute Sprechen“ von Gott: „Gott zu rufen, mit dem Namen Gottes diesen unterstellten Ursprung jeglichen Sprechens, seine erforderte Ursache, zu nennen.“ Für Derrida scheint die ‚christliche Apophatik‘ sich also nur im Sprachraum zu bewegen, „selbst wenn man“, um gut von Gott zu sprechen, „vermeiden muss, in dieser oder jenen Weise zu sprechen mit dem Ziel, direkt zu sprechen, oder wahr zu sprechen, selbst wenn man vermeiden muss, überhaupt zu sprechen. Dieses Vermögen ist eine Gabe und eine Wirkung Gottes.“8 Wenn allerdings das Nicht-Sprechen das äußerste Gebot des ‚guten Sprechens‘ – von Gott, zum Anderen – darstellen sollte, dann stellt sich die Frage, ob die Apophatik das Sprechen oder – über das Schweigen – etwas anderes im Blick hat, nämlich Gott selbst als Ab-Grund – Un-Grund – allen Vermögens, welches sich als unser reines Können in der radikalen Reduktion offenbart, wie Michel Henry dies rein lebensphänomenologisch annehmen wird. Dass Derrida die Apophatik des Anrufs für menschliches Sprechen als ‚erforderte Ursache‘ überhaupt ansetzen kann, also ‚Gott‘ in allem Sagen angenommen wird, ist nur im Rückgriff auf ein originäres Verlangen des Menschen möglich, sich im Antworten auf das auszurichten, „was man genauso gut auch den Sinn, den Referenten, die Wahrheit heißt“. Verlangen – désir – wird mithin intentional verstanden, so dass kein Blick auf seine innere, transzendentale Ermöglichung als 7Derrida, Wie nicht sprechen. Verneinungen, a. a. O., S. 53. Hervorhebungen im Original. 8 Ebd., S. 53 f. Hervorhebungen hier und in den folgenden Zitaten im Original. 74 Rolf Kühn ‚Können‘ fällt, wie wir andeuteten, was zur Folge hat, dass dann natürlich wieder die seins- und ortlose Transzendenz Gottes ins Spiel kommt, welche als ‚Namen Gottes‘ diesem Verlangen entspreche, und zwar als „die Spur dieses einzigartigen Ereignisses, welches das Sprechen möglich gemacht haben wird, noch bevor dieses sich, um darauf zu antworten, hin zu dieser ersten oder letzten Referenz zurückwendet. Und genau deshalb muss auch die apophatische Rede mit einem Gebet eröffnet werden, das dessen Bestimmung anerkennt, anweist oder absichert.“9 Dass Derrida hier dem Gebet einen eigenständigen, positiven performativen Charakter abgewinnen kann, soll unbestritten bleiben, aber es unterstreicht nicht mehr als die absolute Vorgängigkeit wie auch ebenso absolute Verheißung in Bezug auf Spur und Antwort, ohne dass das unmittelbar Verbindende von Vergangenheit/Zukunft selbst festgehalten wird – nämlich eine kaum zu leugnende ‚Gegenwart Gottes‘. Alle weiteren Kriterien, die Derrida anführt, kreisen um das, was er begrifflich nicht ‚Präsenz‘ aufgrund seines Differänz-Apriori nennen kann oder will, denn dass „ohne uns, in uns vor uns“ etwas spricht, sei durchaus – als „Spur“ – eine „unabsprechbare – indéniable – Notwendigkeit“ beziehungsweise das „Geheiß“ einer unvordenklichen Vergangenheit, die sich im „il faut“ – es ist geboten/man muss – der Antwortaufforderung ausdrücke. Und Heideggers Sprache vom ‚Wink‘ aufgreifend, wird natürlich die diskursive Vorsicht gegenüber der Gottes-Präsenz auch konsequenter Weise zur korrelativen Vorsicht gegenüber jeder Subjekt-Präsenz, und zwar unter dem zusätzlichen Levinasschen Gedanken der Asymmetrie: „Anordnung oder Verheißung, dieses Geheiß verpflichtet (mich) in einer strikt asymmetrischen Weise, noch bevor ich, ich – moi – , habe ich – je – sagen und, um sie mir wieder anzueignen, um die Symmetrie wiederherzustellen, eine solche Provokation habe signieren können.“10 Das imperativische Inanspruchgenommen-Sein in ethisch-religiöser Hinsicht wäre dann ohne Zweifel ein formaler Hinweis auf die Wesenhaftigkeit Gottes in Jacques Derridas Denken, aber zu fragen bleibt, wodurch ‚ich‘ überhaupt ‚Ich‘ zu ‚mir‘ sagen kann, falls nicht schon eine Ipseität vorausgeht, von der aus eine sprachlich pro-vokative oder asymmetrische Anforderung erst möglich wird, insofern ich sie als die ‚an-mich-gerichtete‘ erkenne. Kurz gesagt, sind Selbst-Präsenz und Gottes-Präsenz ungenannte Voraussetzungen in der Analyse Derridas, und es dürfte die phänomenologische Radikalität der ‚Mystik‘ sein, dass sie die Einheit beider Präsenzformen annimmt, ohne die sonst jegliches Sprechen von ‚mystischer Erkenntnis‘ – oder mystischem Leben – neben den anderen weiterhin gegebenen Erkenntnisformen – einschließlich der ‚negativen Theologie‘ – seinen Sinn verliert. 9 Ebd., S. 54. 10 Ebd., S. 55 f. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 75 Die ‚Spur‘ suggeriert ein unsicher bleibendes, das heißt nicht identifizierbares Wissen um das Gewesensein des Ereignisses des Anrufs – Gottes – , womit Derrida die autonome Verantwortung des Menschen garantiert sieht. Doch der (post-)moderne Autonomiegedanke ist nicht nur historisch bedingt, sondern er birgt vor allem eine transzendentale Illusion, nämlich der Frage der unmittelbaren Geburt in einem uns generierenden absoluten Leben als dessen selbstaffektiver Präsenz ausweichen zu können: „Die Autonomie selbst wäre nicht möglich ohne die Achtung vor dem Gesetz (die alleinige ‚Ursache‘ dieser Achtung) im strikt Kantischen Sinne dieser Worte. Um diese Verantwortung zu umspielen, sie abzusprechen, versuchen, sie durch einen absoluten Rückgang nach hinten auszustreichen, muss ich sie noch oder bereits gegenzeichnen.“11 Die hier gewählte Ausdrucksweise sowie der Rückbezug auf Immanuel Kant machen unter anderem deutlich, dass sich die Analyse von Spur/Autonomie noch in einem vorkritisch phänomenlogischen Feld bewegt, welches der Differänz-Methode als solcher anhaftet, weil sie über die einmal signierte Differenz oder den vermittelnden Aufschub strukturell nicht mehr die Unbedingtheit des absolut phänomenologischen Lebens im rein reduktiven ‚Jetzt‘ aufzufinden vermag. Es geht also letztlich nicht um die Frage eines persönlichen Gottesglaubens bei Derrida, der wohl nicht angezweifelt werden kann12, sondern um die Selbstimmunisierung des Denkens gegen den Offenbarungsanspruch Gottes als dessen ‚Selbstoffenbarung‘ eine unmittelbare Präsenz zu sein – oder keine. Mit der Differänz lassen wir ohne Zweifel die ‚Dialektik‘ hinter uns, aber der ‚Aufschub‘ befreit uns nicht vom ‚Entzug‘, den Gott in sich – von der Einfachheit und Einheit seines Wesens her – nicht kennt, und daher auch keine Rolle in der Frage der ‚Zugänglichkeit‘ spielen kann, da diese allein Gottes Leben als seine Wahrheit selbst ist. Derrida kann sich – philosophiegeschichtlich betrachtet – für die Distanz zwischen Gott und ‚Gegenwart‘ – sofern sie griechisch vom Sein her gedacht wird – selbstverständlich auf große Vorgänger berufen, nämlich auf die Nicht-Seiendheit des Guten bei Platon und des Seins bei Heidegger.13 Um auf dieses ‚Jenseits des Seins‘ hier genauer einzugehen, sieht Derrida in der platonischen Betonung des „Guten über das Sein hinaus“14 mehr eine „Bewegung in das sie hervorbringende, 11 Ebd., S. 56. 12 Vgl. Enders, Postmoderne, Christentum und Neue Religiosität, a. a. O., S. 120 f. 13 Vgl. auch Joseph Wohlmuth, ‚Wie nicht sprechen?‘ – Zum Problem der negativen Theologie bei Jacques Derrida, in: Gottesglaube – Gotteserfahrung – Gotteserkenntnis. Begründungsformen religiöser Erfahrung in der Gegenwart, hg. v. Günther Kruck, Mainz 2003, S. 135-156. 14Platon, Politeia, 509b8 ff. 76 Rolf Kühn sie anziehende oder sie führende Hyper“ als eine radikale Negation, was der zuvor schon festgehaltenen ‚Hierarchie‘ von Jenseits/Mehr entspricht. Diese Transzendenzbewegung sichert den „erkennbaren Dingen … nicht die alleinige Eigenschaft, erkannt zu werden, sondern auch das Sein – einai – , die Existenz und das Wesen – ousia – , auch wenn das Gute nicht aus der ousia herkommt …, sondern aus etwas, welches weit über das Sein hinausgeht“, und zwar sowohl hinsichtlich der Würde wie des Alters und der Kraft. Da Derrida in diesem platonischen Paradigma, welches durch die Analogie zur Sonne als Quelle allen Lichts und Lebens im sichtbaren Bereich die Präsenzidee auch im Charakter des Guten ‚jenseits des Seins‘ beibehält, fühlt er sich veranlasst, es auch für die Negative Theologie abzulehnen: „Die negative Rede über dieses, welches sich jenseits des Seins hält und augenscheinlich nicht mehr die ontologischen Prädikate unterhält, unterbricht diese analogische Kontinuität nicht. In Wahrheit unterstellt sie diese, sie lässt sich sogar von ihr führen. Die Ontologie bleibt möglich und notwendig.“15 So sehr sich auch diese Kritik an der Analogie nachvollziehen lässt, muss andererseits festgehalten werden, dass Derrida wiederum die Transzendenzstruktur als solche nicht in Frage stellt, sofern sie für die Offenbarung beziehungsweise den Anspruch des Guten in Frage kommen sollen. Vielmehr weist er durch die Abhängigkeit des mystisch-christlichen Paradigmas vom griechisch-platonischen auch die Reduktion auf die Einheit Gottes noch vor dessen trinitarischer Entfaltung bei Meister Eckart ab, denn insofern „sich die Apophasis in Bewegung setzt, initiiert sie sich im Sinne der Initiative und der Initiation, vom Ereignis einer Offenbarung aus, die gleichzeitig eine Verheißung ist“. Da diese Bewegung der Initiation – wie sie etwa über das Gebet geschehen kann – sich von der Absenz jeder Eigenwirksamkeit in der khora bei Platon unterscheidet, die Transzendenz aber keine Präsenz Gottes implizieren soll, kann Derrida Meister Eckhart allein dort zustimmen, wo sich die formlose Unbestimmtheit der khora der menschlichen Seele angleichen lässt, insofern sie Gott ausschließlich erleidet.16 Dieses ‚Gott-Erleiden‘ ist jedoch keine Unbestimmtheit durch kreatürlich Seinsformen – und insofern nicht mit Platons khora gleichzusetzen, sondern sie besagt bei Meister Eckhart die reine Empfänglichkeit der ‚Seele‘ für das einfache 15Derrida, Wie nicht sprechen, a. a. O., S. 61 f. Wir gehen hier nicht weiter auf die Nennung der khora bei Platon ein, die Derrida als „drittes Geschlecht“ zwischen sinnlich/ intelligibel beziehungsweise aktiv/passiv analysiert hat; vgl. Jacques Derrida, Khora, in: Ders., Über den Namen, a. a. O., S. 123-140. 16Derrida, Wie nicht sprechen, a. a. O., S. 79 u. S. 87. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 77 Wesen Gottes, mit dem sie in ihrer zeitlosen Geburt in und aus Gott identisch ist.17 Jacques Derrida scheint hier zwar nahe an die Wirklichkeit einer reinen Passibilität heranzukommen, wie wir sie als Wesen göttlicher Selbstoffenbarung nennen, aber seine Bestimmung des Gebets, welches den Weg dahin auslösen soll, bleibt gefangen in der Struktur von Bitte/Anderer: Das reine Gebet „bittet den anderen um nichts anderes als es anzuhören, es anzunehmen, für es gegenwärtig zu sein, der Andere als solcher, Gabe, Ruf uns sogar Ursache des Gebetes zu sein“.18 Bei Meister Eckhart entfällt die Bitte als Ausdruck von Distanz, da die Empfänglichkeit als absolute Armut mir sogar die Möglichkeit eines Bitten-Wollens nimmt.19 Hieran ändern auch nichts die Hinweise auf Heidegger letztlich, denn selbst wenn es stimmen sollte, wie Derrida vermutet, dass die Vermeidung des Wortes ‚Sein‘ in Bezug auf Gott bei Heidegger den Zugang zur Ankunft dieses Gottes öffnen möchte, der nicht ‚ist‘ und noch aussteht, so hebt auch die Annahme eines Heideggerschen Betens als „reine Adresse am Rand des Schweigens, fremd jedem Code und jedem Ritus und folglich jeder Wiederholung“ die Intentionalität eines solchen „Gebetes“ nicht auf. Was Derrida hierzu dann abschließend in seinem Beitrag Wie nicht sprechen. Verneinungen bemerkt, dürfte für ihn selbst wie in Bezug auf Heidegger eine große Zurückhaltung unterstreichen, solange sie sich als philosophisch Denkende äußern, aber das Gebet als solches in einem subjektiven Sinne nicht ausklammern können: „Vielleicht gäbe es das reine Gebet in seiner Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit gar nicht, wenn es nicht von den Gebeten bedroht wäre, die in Sprache und Schrift zum Ausdruck gebracht werden.“20 In der Mystik geht es jedoch letztlich nicht um 17Vgl. Predigt 1 in: Meister Eckhart, Werke I: Predigten. Text und Kommentar, hg. v. Niklaus Largier, Frankfurt a. M. 1993, S. 17: „Ganz so sollte der Mensch dastehen, der für die allerhöchste Wahrheit empfänglich werden und darin leben möchte ohne Vor und ohne Nach und ohne Behinderung durch alle Werke und alle jene Bilder, deren er sich je bewusst wurde, ledig und frei göttliche Gabe in diesem Nun neu empfangend und sie ungehindert in diesem gleichen Lichte mit dankerfüllten Lobe in unserm Herrn Jesus Christus wieder eingebärend.“ 18Derrida, Wie nicht sprechen, a. a. O., S. 76. 19 Vgl. bes. die Predigt 6: Iusti vivent in aeternum von Meister Eckhart, in: Werke I, a. a. O., S. 76-87, hier etwa S. 85 f.: „Wenn der Mensch etwas von außerhalb seiner selbst bezieht oder nimmt, so ist das nicht recht. Man soll Gott nicht als außerhalb von einem selbst erfassen und ansehen, sondern als mein Eigen und als das, was in einem ist; zudem soll man nicht dienen noch wirken im irgendein Warum, weder um Gott och um die eigene Ehre noch um irgend etwas, was außerhalb von einem ist, sondern einzig um dessen willen, was das eigene Sein und das eigene Leben in einem ist.“ 20Derrida, Wie nicht sprechen, a. a. O., S. 103 u. S. 109; zum Heideggerschen Gottesverständnis vgl. auch Philippe Capelle-Dumont, Théologie et sotériologie chez Martin Heidegger. Étude critique, in: Revue des Sciences Religieuses 84/4 (2010) S. 467-481. 78 Rolf Kühn Kriterien eines angemessenen Gebetes, sondern wie Meister Eckhart durch seinen Hinweis auf den Verzicht auf jedes Wollen zeigt, um das Wesen der Armut selbst, welches für uns reines Erleiden Gottes ist, so wie es für Gott die Unmöglichkeit darstellt, sich in irgendeiner ‚Welt‘ zeigen zu können – sei es Schöpfung oder Transzendenz als Horizont, beziehungsweise Spur als Entzug. Dass die Frage nach der Mystik eine Frage nach jener Phänomenalisierungsweise darstellt, welche dem Erscheinen als solchem zukommt, indem es Selbst-Erscheinen sein muss, um ‚erscheinen‘ zu können, ist eine radikal reduktive Problematik, der Derrida in seiner Kritik der negativen Theologie nicht gerecht zu werden vermag, weil seine eigenen Voraussetzungen sich nicht von der Kriteriologie der Mystik her in Frage stellen lassen, nämlich Präsenz nicht zu denken, sondern affektiv zu erproben, das heißt im lebendigen Können eines jeden Begehrens. 2 Jean-Luc Marions „Anruf“ als Einbezug unseres Namens in Gott Betreffs der These Derridas besonders hinsichtlich des Verbleibens der negativen Theologie im Bereich einer ‚Metaphysik der Präsenz‘ aufgrund des apophatischen ‚Über-Essentialismus‘ Gottes als sowohl negiertes wie affirmiertes ‚Sein‘ hat es eine Replik durch Marion gegeben, die zunächst bei einer öffentlichen Diskussion vorgetragen und dann schriftlich überarbeitet wurde.21 Wir greifen hieraus hauptsächlich die nähere Kritik auf, welche vor allem nachweisen möchte, dass Derrida sein Denken als die einzige wirkliche ‚Dekonstruktion‘ verstehe, ohne in der negativen Theologie eine historische Vorform zu besitzen, wobei wir auf die teilweise sehr detaillierte Exegese der mystisch-theologischen Schriften des Areopagiten durch Marion nur insofern eingehen, wie diese Kommentare die Kritik an Derrida stützen sollen. Wie schon ausgeführt wurde, hat Derrida sowohl in Wie nicht sprechen, 1987, wie in seinem frühen Différance-Vortrag, 1968, mehrere ‚Verneinungen‘ – dénégations – zugleich in seiner These ausgesprochen: 1. sage die Negative Theologie 21 Erste französische Veröffentlichung Jean-Luc Marion, Au Nom. Comment ne pas parler de ‚theólogie négative‘, in: Laval théologique et philosophique 55/3 (1999), sodann unter dem Titel Au nom ou comment le taire, in: Ders., De surcroît. Études sur le phénomène saturé, a. a. O., S. 155-195. Unsere folgenden Stellenangaben beziehen sich stets auf diese zweite Version des französischen Textes; vgl. auch Jean-Luc Marion, théo-logique, in: Encyclopédie Philosophique Universelle, Bd. 1: L’Univers philosophique, hg. v. André Jacob, Paris 1989, S. 17-25. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 79 nichts Positives von Gott; 2. sage sie dennoch noch etwas von Ihm, indem sie nichts zu sagen vorgibt, indem sie nämlich Gott in die erwähnte Präsenz-Metaphysik einschreibt, und 3. werde durch die Differänz die Negative Theologie definitiv dekonstruiert, wodurch sich solche Dekonstruktion gänzlich von der apophatischen Theologie unterscheide. Diese Debatte zwischen Derrida und Marion wurde von beiden immer wieder in einzelnen Schriften erweitert aufgegriffen, ohne dass wir hier die zusätzlichen Verzweigungen, besonders im Zusammenhang mit der Gabenproblematik, berücksichtigen.22 Denn was für uns wiederum im Mittelpunkt der Analyse steht, ist hauptsächlich die methodische Vorgehensweise bei Marion und die Frage, ob seine eigene Lösung – „Der Name – sc. Gottes – wird nicht durch uns gesagt, sondern er ruft uns – appelle – . Und nichts schreckt uns mehr als dieser Anruf – appel“23 – letztlich etwas sehr Unterschiedliches zu Derrida zum Ausdruck bringt. Wenn Derrida diesmal in Bezug auf die apophatische Theologie keine besondere metaphysische ‚Gegenwart‘ wie in seinen anderen Schriften dekonstruieren wolle, sondern vor allem eine Quasi-Dekonstruktion vor der eigentlichen Differänz-Dekonstruktion, dann geht es dabei um einen sehr hohen Einsatz nach Marion. Würde in der Tat die Negative Theologie bereits eine vollendete Dekonstruktion sein und uns in ihrem Vorgehen zugleich ‚Gott‘ geben, selbst wenn sie Ihm Präsenz und Wesen abspräche, dann wäre sie keine bloß „unbewusste Vorwegnahme, sondern die erste ernsthafte Konkurrenz der Differänz – différance –, vielleicht sogar die einzig mögliche“.24 Folglich ginge es Derrida gar nicht so sehr um die Negative Theologie als solche, sondern um die Originalität und Vorherrschaft der eigenen Dekonstruktion. Von daher würde Derridas Strategie erst verständlich, den doppelten Anspruch der Apophatik aufzuheben, der Gott verneinen und doch zugleich erreichen will. Wäre Letzteres wirklich möglich, dann wäre nicht nur die Differänz 22 Vgl. die Hinweise bei Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 158 Anm. 2; von seiten Marions findet sich die breiteste Auseinandersetzung mit Jacques Derrida in seinem Buch Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Paris 1998, Livre 2. 23Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 195. 24 Ebd., S. 159, wobei Marion auf den ersten Seiten zugleich nachzuweisen versucht, dass sowohl der Begriff der ‚negativen Theologie‘ wie der ‚Metaphysik der Präsenz‘ von den wenigen vorliegenden Quellen her – Dionysios Areopagita, Heidegger – außerdem sehr ungenaue Begriffe seien – vgl. ebd., S. 155-157 – , was natürlich Auswirkungen auf seine eigene Einschätzung der via eminentiae hat. Insofern Derrida noch in seinen späten Schriften wie Berühren: Jean-Luc Nancy, Berlin 2007, seine Dekonstruktion auf keinen Fall mit der destructio in der christlichen Tradition verwechselt sehen will – Apokalypse, Martin Luther – , stützt dies die Kritik Marions vom Einzigartigkeitsanspruch der Dekonstruktion bei Derrida. 80 Rolf Kühn schon einmal früher ideengeschichtlich realisiert worden, sondern es gäbe zudem einen wirklichen dekonstruktiven Zugang zu Gott ohne Sein und Präsenz im Sinne der traditionellen Metaphysik und Theologie. Daher bestimme auch nicht letztlich das Schweigen die Diskussion, welches zum Atheismus führe, 25 wie die negative Theologie oft kritisiert wird, sondern es gehe um jene entscheidende Frage, ob Derrida mit seiner zentralen Kritik Recht hat, dass die apophatische Negation immer noch eine Bejahung der Wahrheit und des ontologischen Wesens Gottes wäre – wenn auch in hyperbolisch-paradoxaler Form –, oder ob die Negative Theologie von der Aussagenlogik Bejahung/Verneinnung zu einer nicht-prädikativen ‚Rede‘ – parole – übergeht: zum Lobpreis. Wie wir sahen, disqualifiziert Derrida in der Tat ein solches Gebet als eine ‚verkleidete Aussage‘ indirekter Bejahung, um das reine, einfache Gebet ohne göttlichen Namensbezug dagegen zu stellen.26 Marion interessiert sich daher vor allem für die Problematik, was es für die christliche Theologie bedeute, wenn die via eminentiae augenscheinlich wiederherstellt, was die Apophase aufgehoben hatte. Denn sofern die christliche Theologie „durch eine Offenbarung hervorgerufen wird“27, unterliegt sie vielleicht letztlich keiner Dekonstruktion, auch wenn sie dabei nicht notwendiger Weise an die Grundbegriffe der Metaphysik wie Wesen, Sein, Denken oder Präsenz gebunden bleibe. Es liegt auf der Hand, dass Marion gegenüber Derrida methodische wie phänomenologisch-inhaltliche Fragen verhandeln will, die für sein eigenes Denken bekannt sind als das ‚Phänomen der Sättigung‘ in Bezug auf die Ablösung der Metaphysik/ Theologie durch die Phänomenologie.28 Dies ist für unsere eigene religionsphänomenologische Analyse insofern von Bedeutung, als sich daran gegenüber Marion wie Derrida die Frage ableiten lässt, ob die Mystik tatsächlich einen besonderen kriteriologischen Stellenwert hinsichtlich der Disziplinen Metaphysik/Theologie 25 Es wird bei Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 160 Anm. 1, unter anderem das Beispiel von Claude Bruaire aus Le Droit de Dieu, Paris 1974, S. 21, angeführt, wonach das „unveränderliche Absolute“ das atheistische „Nichts“ – Rien – signiere. Dagegen bleibt aber festzuhalten, dass Bruaire eine Selbst-Bestimmung Gottes im Auge hat, die als sein konkretes Sich-Geben/Offenbaren nicht aufgegeben werden kann, will man die Aporien der ‚Ontologie‘ zugunsten einer fundamentaleren ‚Onto-do-logie‘ überschreiten. 26Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 161, wozu natürlich die vielfältigen Analysen Marions zu Liturgie und Sakramentalität den Hintergrund bilden, insofern hierin das eigentliche Wesen der ‚Theologie‘ sich realisiere; vgl. Jean-Luc Marion, Die Phänomenalität der Sakramente, in: Perspektiven des Lebensbegriffs. Randgänge der Phänomenologie, hg. v. Stefan Nowotny u. Michael Staudigl, Hildesheim, Zürich u. New York 2005, S. 201-218. 27Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 162, was im Übrigen Marions Kernanliegen in all seinen Schriften darstellt. 28 Ebd., S. 190-195, heißt das 6. Kapitel daher auch Le phéomène saturé par excellence. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 81 und Phänomenologie behält – oder einfach von Dekonstruktion/Sättigung – Gegen-Methode zur Intentionalität – subsumiert wird. Was dabei zunächst Dionysios Areopagita selbst betreffe, so kann Marion herausheben, dass dort nicht einfach Bejahung/Verneinung gegenüber gestellt werden, sondern vielmehr eine Dreiteilung vorliegt, deren Begriffe nicht aufeinander reduziert werden könnten. Mit zusätzlichen Hinweisen auf Thomas von Aquin, Nikolaus von Kues und Johannes Scotus Eriugena unterstreicht Marion daher für das Verständnis der Verankerung der negativen Theologie in der christlichen Tradition, dass ein duales Modell der Apophatik nicht gerecht werde, woraus sich gegenüber Derrida die Frage ergibt, welchen Vorteil seine Dekonstruktion aus dem Verkennen des dritten Weges der via eminentiae zieht? Erinnern wir uns an Derridas Verdacht, die ‚hyperbolisch-paradoxale Verneinung‘ enthielte im Grunde wieder eine Bejahung, so kann jetzt mit Marion gesagt werden, dass die negative Theologie keinerlei Anlass hat, die via negativa überzubestimmen, da der ‚Aufstieg‘ des dritten Weges die binäre – aristotelische – Wahrheitsprädikation verlässt, insofern der Gegensatz von Wahr/Falsch beziehungsweise Synthese/Trennung überhaupt verlassen werde. Daraus aber folgt zugleich, dass der ‚dritte Weg‘ nicht mehr das Wahre/Falsche zum Gegenstand habe, sondern diese metaphysische Wahrheitsebene als solche transzendiert wird – mithin kein Prädikat mehr von einem Subjekt auszusagen ist. Dionysios Areopagita macht in seiner Schrift Über die mystische Theologie29 selber darauf aufmerksam, dass einerseits Negationen der Namen Gottes – besonders auch der Trinität – höher stünden als deren Bejahungen, aber „jenseits von jeder Verneinung und Bejahung“ etwas Höheres anzustreben sei, woraus Marion folgert, dass es – für die Theologie – nicht darum gehe, Gott zu benennen oder nicht zu benennen, sondern Ihn von jeder Benennung zu befreien: „Diese Bestimmung – dé-nomination – enthält in ihrer Zweideutigkeit die doppelte Funktion zu sagen (negativ bejahen) und dieses Sagen – dire – des Namen aufzulösen – défaire – .Es handelt sich um eine Rede/Wort – parole – , die/das nicht mehr etwas von etwas sagt (auch keinen Namen von irgend jemand), sondern sie verneint für die Urteilsaussage jegliche Triftigkeit – pertinence – … und hebt die Herrschaft der zwei Wahrheitsgeltungen – sc. von Wahr/Falsch – auf.“ Mit anderen Worten versucht Marion eine rational nachvollziehbare Transformation des begrifflichen Metaphysikdiskurses auf eine neue pragmatische Funktion der Sprache hin sichtbar zu machen, wobei der vom Areopagiten benutzte Ausdruck der aitía in Bezug auf den so bestimmten Gott nicht mehr Ursache – cause – bedeute, um vielmehr „einen Übergang zum Unendlichen“ im Sein jeder Kreatur als Seiende 29 Vgl. I,2, 1100 b – dt. Übers. Anm. 4 – , zit. Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 167. 82 Rolf Kühn von Gott her anzudeuten: „Mit der aitía sagt die Rede/das Wort ebenso wenig [etwas] wie sie [etwas] verneint – sie handelt, indem sie sich auf Den bezieht, den sie bestimmt – dé-nomme – .“ In diesem Sinne würde auch das ‚hyper‘ bei Dionysios Areopagita – wie schon im Neuen Testament – weder die Über-Wesenheit noch die Erkenntnis betreffen, sondern deren „Überstieg auf den Lobpreis dessen hin, was jeder Essenz vorausgeht und sie ermöglicht“.30 Wenn daher die Negation allein nicht genügt, um eine Theologie zu begründen, aber auch eine bloß ihr entgegen gesetzte Bejahung der Namen Gottes fortfällt, um das ‚Über-Wesen‘ Gottes zu sagen, dann lässt sich mit dem Areopagiten nicht mehr behaupten, die apophatische Theologie bejahe ‚Gott‘ insgeheim in ihrer begrifflichen Negation. Nach Marion geht es nicht mehr um irgendein Etwas-Sagen in Bezug auf Gott oder um das gegenteilige Nicht-Sagen, sondern es handelt sich darum, „sich auf Den zu beziehen, den die Benennung – nomination – nicht mehr berührt“.31 Dieser ‚pragmatische Bezug‘ des Sprechenden auf den „unerreichbaren Referenten (Gott)“ bleibt in unseren Augen mit Henry phänomenologisch gesehen ein intentionaler Transzendenzbezug, ein „Sich-Beziehen auf …“; das heißt, er impliziert weiterhin eine Kluft/Distanz, welche den ‚Entzug‘ insofern in sich bergen, als Gott durch die – transzendente – Unerreichbarkeit charakterisiert wird. Dies würde strukturell oder formal ebenfalls mit Derridas Dekonstruktion/Spur weiterhin übereinstimmen, auch wenn die These von der ‚Über-Wesenhaftigkeit‘ als implizite Seins-/Präsenz-Bejahung – Benennung – innerhalb der Negation aufgehoben wäre. Worin besteht dann aber die besondere sprachliche Pragmatik des Lobpreises? Gegen Derridas Einwand, ein Lobpreis – hymein – spreche im Unterschied zum einfachen Gebet – eúche – noch zu Jemandem und implizierte damit dessen Wesen wie Präsenz, hält Marion fest, dass die Benutzung des Eigenamens niemals Name der Essenz sei und auch nie dem eigen ist, der ihn erhält.32 In dieser Hinsicht verleiht der Lobpreis in der mystischen Theologie Gott ebenfalls keinen Namen, sondern nennt ihn mit den Aporien – Entzug – , welche schon bei menschlichen oder welthaften Namen auftreten. Des Weiteren sei auch das einfache Gebet ohne 30 Ebd., S. 167-169. Da der französische Begriff der ‚dé-nomination‘ auf die mittelalterliche ‚denominatio‘ der inneren wie äußeren Objekt-Bestimmung zurückgeht, übersetzen wir diesen Ausdruck mit ‚Bestimmung‘ und ‚nomination‘ bei Marion mit ‚Benennung‘. 31 Ebd., S. 171. 32 Vgl. ebd., S. 172, wobei mit Verweis auf Marion, Étant donné, a. a. O., §28-29, folgende Gründe angeführt werden: Das allgemeine Wesen bezieht das Individuum nur durch eine Reihe von unendlichen Akzidenzien ein; der Eigenname ist mehr deiktisch als definitorisch; er gehört der Familie oder dem Namenspatron, bevor er mir gehöre; ich identifiziere mich erst mit solchem Namen, nachdem Andere mich damit benannt und gerufen haben; die unsichtbare Präsenz des Individuums geht über das so bezeichnete ‚Wesen‘ hinaus. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 83 Anrufung nicht möglich, so dass Derrida sich im Widerspruch eines ‚anonymen Gebets‘ verfinge, welches es als solches nicht gäbe. Dies ermöglicht Marion den Zusammenhang mit der vorherigen Analyse der benannten aitia herzustellen, indem Gebet und Lobpreis als „indirekte Ausrichtung“ auf Gott gedeutet werden, nämlich nicht als eigentliche Bestimmung, sondern im Sinne einer Operation, die dem hermeneutischen ‚Als‘ bei Heidegger33 entspräche – mit anderen Worten als ‚interpretierendes Verständnis‘ des Intendierten nach Maßgabe dessen, der sich auf etwas ausrichtet. Entsprechend heißt es bei Dionysios Areopagita: „Es ziemt sich in der Tat, uns zunächst zur [Trinität] als Prinzip der Güte zu erheben.“34 Für den rein pragmatischen ‚dritten Weg‘ der via eminentiae unterstreiche dies nochmals, dass es nicht um Benennen oder Verleihung von Namen beziehungsweise Attributen ginge, sondern eben um ein ‚Sich-Beziehen auf …‘ oder ‚Verhalten gegenüber …‘. Wird damit die logisch-metaphysische Ebene der prädikativen Sprache verlassen, so kann Marion hier letztlich Levinas gegen Derrida wenden: Das Gebet zielt nicht auf die Essenz Gottes, sondern: „Das Wesen des Diskurses ist das Gebet.“35 Wenn nun insgesamt die Aufgabe der mystischen Theologie nicht darin besteht, Gott unter den Namen des Seins, des Guten und des Einen zu benennen, könne man ihr auch nicht vorwerfen, uns nicht mitzuteilen, wie es um das ‚Anders als Sein‘ in Bezug auf Gott gestellt sei. Marion hält es daher für viel komplexer und risikoreicher, sich einem ‚Nicht-Objekt‘ auszusetzen, um in solcher ‚Pragmatik der Rede/des Wortes‘ selber für die eigene Person „so neue und radikale Bestimmungen zu empfangen, dass diese mir mehr sagen und mich unendlich mehr erziehen, als dass sie mir Kenntnisse vermittelten und mich informierten“.36 Diese Umkehr des Sprechens unterhält also eine Benennung im Sinne des Lobpreises und Gebets nach Dionysos Areopagita, von der man nicht mehr fordern kann, wie Derrida es verlangt, dass nach der Negation Gottes noch eine weitere Aussage über sein ‚Nicht-Sein‘ oder ‚Nicht-Wesen‘ – Über-Wesen – versucht würde: „Bei dem Lob handelt es sich nämlich nicht mehr darum zu sprechen, sondern zu hören“, weil in Übereinstimmung mit Platon und Dionysios das „schöne Gute ruft“.37 Damit glaubt 33 Vgl. Martin Heidegger, Sein und Zeit, 1927, Tübingen 111967, §32, S. 148-153. 34 Dionysios Areopagita, Die Namen Gottes, hg. v. Beate Regina Suchla, Stuttgart 1988, III,1, 680 b; zit. Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 173. 35 Vgl. Emmanuel Levinas, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Paris 1991, S. 20; zit. Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 174. Allerdings bleibt die Frage, ob Derrida denselben Gedanken nicht unter dem Begriff des – unendlichen – ‚Versprechens‘ anstelle von ‚Gebet‘ seinerseits einholt. 36Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 178. 37 Ebd., S. 179, mit Bezug auf Dionysios Areopagita, Die Namen Gottes, a. a. O., IV, 7, 701 c-d, sowie Platon, Kratylos, 416 c-d. 84 Rolf Kühn Marion zugleich die expliziten wie impliziten Einschreibungen der – negativen – Theologie in die ‚Präsenz-Metaphysik‘ unterlaufen zu können, da es der Theologie vom Gesichtspunkt der Offenbarung aus letztlich nicht um die ‚Obsession‘ oder ‚Faszination der Präsenz‘ gehe. Nach Exodus 33, 23, und Johannes 1, 18, nämlich „hat niemand Gott gesehen“, so dass bereits im biblischen Sinne ‚Gott‘ von der Idolatrie der Schau wie des Begriffs zu lösen ist, worin gemäß Marion Gottes Offenbarung zunächst überhaupt bestehe, uns nämlich von dieser Illusion des ‚Blicks‘ auf Gott zu befreien. Die lange Tradition der griechischen wie lateinischen Kirchenväter bis hin zu Thomas von Aquin über die Unerkennbarkeit Gottes disqualifiziere daher alle Versuche, Gott zu benennen und aus seiner Präsenz einen – metaphysischen – Primat zu machen, wie dies etwa eher vonseiten des Arianismus versucht wurde.38 Ist aber mit dieser Kritik an Derrida und einem metaphysischen Theologieverständnis wirklich jede ‚Präsenz‘desavouiert oder ist das ‚Hören‘ strukturell etwas anderes als das ‚Sehen‘, sofern beide Weisen der ‚Intentionalität auf …‘ sind? Diese Fragen müssen abschließend für Marion geklärt werden, umso mehr als das ‚Erkennen von Nicht-Erkennen‘ eine andere Weise ‚echten Erkennens‘ sein soll. Vorausgesetzt, wir würden Gott nach/in seinem Wesen erkennen, bliebe uns im Sinne Marions erneut ein größerer Gott als der zu erkennen, den wir erkannt haben. Die Nicht-Erkennbarkeit Gottes im Sinne von‚ … über Den hinaus Größeres nicht erkannt/erfahren werden kann‘ gehört daher nach Aurelius Augustinus, Anicius Manlius Severinus Boethius, Anselm von Canterbury und René Descartes zum formalen Begriff Gottes, woraus für Marion folgt, dass die Erkenntnis der Unerkennbarkeit zur „operativen, pragmatischen und ohne Ende wiederholbaren Benennung Gottes gehört“.39 Marion kehrt also die Metaphysik/Präsenz-Problematik 38 Ebd., S. 180 f.; hinsichtlich der Scholastik findet sich eine sehr ausführliche Analyse diesbezüglich bereits in dem Artikel von Jean-Luc Marion, Saint Thomas d’Aquin et l’onto-théologie, in: Revue thomiste 1 (1995) S. 31-66, sowie betreffs Anselm von Canterbury in Jean-Luc Marion, Questions cartésiennes II. L’ego et Dieu, Paris 1996, Kap. VII: L’argument relève-t-il de l’ontologie? Außerdem verweist der ganze Kontext von Blick und Idolatrie natürlich auch auf seine frühen Analysen in L’idole et la distance, Paris 1977, 2 1991, sowie Dieu sans l’être, Paris 1982, 21991; dt. Gott ohne Sein, Paderborn 2012. Vgl. auch René Verneaux, Étude critique du livre ‚Dieu sans l’être‘, Paris 1986; sowie für eine kritische Rezeption des Aristoteles in Frankreich hinsichtlich des aporetischen Charakters des Seienden als Seiendes auch Rémi Brague, Aristote et la question du monde, Paris 1988; Jean-François Courtine, Inventio analogiae. Métaphysique et ontothéologie, Paris 2005, die allesamt wichtige Anstöße von Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, Paris 1962, 21991, erhielten. 39Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 187, mit dem bekannten Zitat aus dem Proslogion, Kap. XIV: „id quo majus – sive melius – cogitari nequit“; zu Aurelius Augustinus vgl. bes. auch Jean-Luc Marion, Au lieu de soi. L’approche de Saint Augustin, Paris „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 85 aus Derridas Kritik im Sinne einer ‚theologischen Pragmatik der Abwesenheit‘ um, der Wesen, Präsenz und Seins als Grundbegriffe fehlten, so dass die Einordnung in die Onto-Theo-Logie oder sogar in den „griechischen (Denk-)Horizont“ allgemein dahinfällt.40 Diese Nicht-Präsenz als ‚theologische Pragmatik‘ will Marion allerdings nicht als eine leere Abwesenheit verstanden wissen, sondern als die ‚Schwäche‘, welche Gott vor der Präsenz schützt, um Ihm damit dergestalt zu erlauben, davon ausgenommen zu sein. Mit dem zusätzlichen Hinweis auf das hebräische Tetragramm und Friedrich Hölderlins ‚Fehl der göttlichen Namen‘ geht es folglich nicht länger darum, Gott oder seinen Namen in den theoretischen Kontext unserer Aussagen einzuschreiben, sondern ‚uns in den Horizont Gottes selbst einzuschreiben‘, was im Sinne dieser radikal neuen Pragmatik in der Taufe geschehe. Denn gerade die Liturgie mit ihrer Sakramentenpraxis spricht nicht ‚von‘ Gott, sondern ‚zu‘ Gott mit den Worten des göttlichen Wortes, des Sohnes. Wenn also eine Übereinstimmung zwischen der liturgischen Funktion jedes genuin theo-logischen Diskurses und der mystischen Theologie festgehalten werden kann, nämlich durch die ‚unbenennbare Benennung Gottes‘ unseren Namen vom unsagbaren Namen Gottes zu empfangen, so erscheint es uns doch sehr problematisch, diese unsere Namensgebung von Gottes ‚wesentlichem Anonymat‘ her erfolgen zu lassen. Denn Marion benötigt letztere wohl nur, um sagen zu können, dass seine ‚theologische Pragmatik der Abwesenheit‘ sich zumindest ebenso sehr der Präsenz-Metaphysik widersetze wie Derridas Dekonstruktion.41 Wird damit nicht eine formale oder strukturell-theoretische Abhängigkeit eingegangen, die von der Mystik selber her kaum aufrecht zu erhalten ist, sofern ihr phänomenologischer wie theologischer Eigenstatus eine Erfahrung Gottes – épeuve – impliziert, die wohl kaum mit Begriffen wie Anonymat und Abwesenheit gefasst werden kann, sofern gerade apophatische Begriff wie Leere, Wüste, Finsternis, oder Armut Gottes eine unmittelbare Fülle 2008; dazu Saint Augustin, penseur du soi. Discussions de l’interprétation de Jean-Luc Marion, hg. v. Emmanuel Falque, Paris 2009. 40 In letzterem Punkt folgt er Levinas und Henry; vgl. in Bezug auf die Kirchenväter auch Rémi Brague, Jean-Yves Lacoste, La réception critique du platonisme chez les Pères de l’Eglise, Paris 1990; vgl. schon einen sehr frühen Text von Jean-Luc Marion, Aspekte der Religionsphänomenologie: Grund, Horizont und Offenbarung, in: Religionsphilosophie heute, hg. v. Alois Halder u. Karl Kienzler, Düsseldorf 1988, S. 84-103. 41 Vgl. Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 189. Wie kann im Übrigen das ‚Anonymat des Gebets‘ bei Derrida abgelehnt werden und gleichzeitig ein ‚Anonymat Gottes‘ als ‚Abwesenheit‘ in Anspruch genommen werden? Entweder ist der Begriff dann ungenau, oder es verbirgt sich dahinter eine tiefere Problematik – jene einer rein affektiven – passiblen – Phänomenalisierung, die zum Schluss unseres Beitrags daher zu diskutieren bleibt. 86 Rolf Kühn implizieren, die mehr beinhaltet als ein nur uns gegebener Name – es sein denn, man identifiziert diesen Namen mit der Geburt Gottes in der Seele, was dann die eigentliche ‚Pragmatik‘ wäre?42 Wenn die Theologie demzufolge den ‚Namen Gottes zu verschweigen‘ – taire – habe, dann ist damit nicht nur der Unterschied zum metaphysischen Ansinnen, „den Namen auf die Präsenz reduzieren zu wollen, um ihn – sc. so – zu zerstören“, deutlich markiert, sondern Marion hat dadurch auch – zumindest programmatisch – hier die kritische Sichtweise Derridas bezüglich Präsenz-Metaphysik und apophatischer Theologie völlig umgekehrt.43 Um aber nicht bei diesem Ergebnis allein stehen zu bleiben, welches natürlich auf die Begrenzung der Dekonstruktions-Methode in ihrer angeblichen Alleinherrschaft abzielt, ist Marion sowohl philosophisch wie theologisch verpflichtet, zumindest auch die formale Möglichkeit aufzuzeigen, wie man ‚in den Namen eintreten‘ kann, wenn seine Benennung als inadäquat erkannt wurde – und diese Erkenntnis für die Gottesfrage konstitutiv bleibt. Methodisch geht Marion hierzu von den bisherigen mehr exegetisch-hermeneutischen Interpretation der christlich-mystischen Tradition bei den Kirchenvätern zu einer rein phänomenologischen Vorgehensweise über, wobei auf Vorarbeiten zur Reduktion bei Edmund Husserl und Heidegger sowie zur Umkehr der Metaphysik durch die Phänomenologie zurückgegriffen wird.44 Da wir die Sättigungs-Problematik bereits an anderer Stelle ausführlicher dargestellt haben,45 auf die dieser rein formale Aufweis eines göttlichen Namens und seiner Selbstoffenbarung ohne benennenden Zugriff abzielt, können wir uns hier auf die Feststellung beschränken, dass die via eminentiae der mystischen Theolo42 Da Jean-Luc Marion gelegentlich auch sprachanalytische Diskussionen aufgreift – vgl. etwa die Fußnote 35 in diesem Aufsatz oben sowie sein Buch über Das Erotische. Ein Phänomen, Freiburg i. Br. u. München 2010 – , ist zu vermuten, dass er seinen Begriff der Pragmatik von dort bezieht, ohne in Bezug auf Liturgie und Sakramente deutlich zu machen, ob der Begriff der Praxis nicht angemessener wäre, denn es geht nicht nur um sprachliche Bezüge dabei, sondern um leiblich-gestenhaften oder rein subjektive Vollzüge, die eine andere Phänomenalisierung implizieren als auf der symbolischen oder prädikativen Referenzebene; vgl. auch Alfredo Sacci, Fenomenologia e liturgia. Confronto teologico partendo da Michel Henry – Jean-Luc Marion, Madrid 2011. 43Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 190. 44 Vgl. Jean-Luc Marion, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie. Paris 1989; Ders., Étant donné, a. a. O., §24, über die Offenbarung; vgl. auch Jean-Luc Marion, Joseph Wohlmuth, Ruf und Gabe. Zum Verhältnis von Phänomenologie und Theologie, Bonn 2000. 45 Vgl. Rolf Kühn, Radikale Phänomenologie. Heidegger, Levinas, Derrida, Marion, Frankfurt a. M. 2003, S. 175-189; ebenso zuletzt Jean-Luc Marion. Studien zu seinem Werk, hg. v. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Dresden 2012. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 87 gie schließlich genau im Sinne der Saturation aufgefasst wird: Die nicht zum Ziel führende Apophatik, was die Intentionalität der Bejahung/Verneinung und ihre Begriffsunangemessenheit betrifft, sei keineswegs dem Mangel an Intuition geschuldet, sondern dem Übermaß des Sich-Gebens dessen, was jeden Begriff auf die genannte prinzipielle Unerkennbarkeit Gottes hin übersteigt. Marion unterstreicht dabei, dass Gott dadurch jedoch nicht ‚nicht wahrgenommen‘ würde, also ‚unmerklich‘ – imperceptible – wäre, da der ‚inadäquate Begriff‘ eine ‚gebenden Anschauung‘ – intuition donatrice – nicht ausschließe.46 Die apophatisch notwendige unendliche Begrenzung der Namen Gottes zeige, dass diese durchaus ‚am Werk bleiben‘, aber insgesamt gesehen erweist sich der ‚Begriff im Allgemeinen‘ als ungenügend, um in Bezug auf Gott unsere Anschauung an ein Ziel führen zu können. Bleibt die Frage des Paradoxes, wie ‚etwas als gegeben‘ betrachtet werden kann, wenn die Evidenz in Bezug auf Gott dessen Nicht-Anschauung gerade an den Tag bringt. Streng phänomenologisch handelt es sich hierbei nicht mehr um die formale Möglichkeit eines ‚Phänomens‘ im mundanen Sinne, da die via eminentiae als Pragmatik, uns „in den Namen zu versetzen“, nur in ihrer „Wirktatsächlichkeit“ – effectivité – zu betrachten bleibe. Marion wiederholt hier dennoch seine bekannte Argumentation, dass – radikal phänomenologisch gesehen – nicht vorausgesetzt werden kann, jedes Phänomen habe sich der Bedingung einer ‚Objekt‘-Erfahrung zu unterwerfen. Außerdem beinhalte hier das Paradox nichts Widersinniges, da die „Gott eigene Phänomenalität“ in ihrer reinen Möglichkeit47 von mindestens zwei Manifestationen oder Gegebenheiten begleitet sei, die bezüglich der „anschauenden Gebung“ negativ erschienen: das Erschrecken und die Erstarrung. Allerdings scheinen uns die hermeneutischen Hinweise auf Texte der Kirchenväter und der 46Marion, Au nom ou comment le taire, a. a. O., S. 193. 47 Es wird in diesem Zusammenhang – und auch in den anderen Analysen von Marion – nicht klar, was diese ‚eigene Phänomenalität‘ Gottes sein könnte. Sofern Er uns anruft, wir uns in Seinen Namen einschreiben, verbleiben wir formal in einem Transzendenzbereich, der Gott nicht radikal eigen(tümlich) – propre – sein kann, weil er die Grundstruktur solcher Transzendenz als Distanz, Differenz und Andersheit mit der Welt-Transzendenz – Intentionalität – teilt. Das ‚Eigen(tümliche) Gottes‘ und Seiner Offenbarung impliziert also mehr als nur eine ‚andere‘ Weise der Transzendenz beziehungsweise ein ‚Anders als Sein‘ oder ‚Anders als der Begriff‘, denn solche Andersheit lebt noch vom Vergleich, der radikal phänomenologisch bei Gott fortfällt, so dass eine weitere – heterogene – Phänomenalisierungsweise aufgesucht werden muss, welche mit dem Begriff der ‚transzendentalen Affektivität‘ – Leben – gegeben ist. Marion ignoriert diese Problematik natürlich nicht, bleibt aber in seinem Erscheinens-/Gebungsbegriff im hier angefragten Sinne ambivalent; vgl. diesbezüglich auch eine seiner jüngerenVeröffentlichungen rein phänomenologischer Natur Jean-Luc Marion, Figures de phénoménologie. Husserl, Heidegger, Levinas, Henry, Paris 2012. 88 Rolf Kühn mögliche Vergleich mit biblischen Theophanieerfahrungen rein phänomenologisch nicht wirklich weiterzuhelfen, da die Erlebnisweise einer sich intuitiv verweigernden Zugänglichkeit Gottes auf die affektive Bestimmung in einer radikalen Passibilität – Rekurrenz – zurückzuführen wäre, welche nur ‚negativ‘ in Bezug auf den absoluten Transzendenzprimat – Gottes – auftritt, aber in sich eine Phänomenalisierung durch das Absolute – Name, Gott – birgt, die sich gerade niemals in einer Evidenz oder Intuition zeigen kann, also auch niemals defizitär betreffs einer (un-)möglichen Anschauung wäre.48 Die prinzipielle Unmöglichkeit eines angemessenen Begriffs in Bezug auf Gott muss daher konsequent zu Ende gedacht werden, das heißt bis zur – expliziten oder impliziten – Anwesenheit eines noch ek-statischen Horizontes bei Marion, denn die verbleibende Korrelation von Evidenzabwesenheit und Faszination/Betäubung durch eine überwältigende Gegebenheit – Gebung – Gottes wird noch von einer Transzendenzstruktur bestimmt, welche an sich von der Erfahrung widerlegt wird: Gott erscheint nicht sichtbar, das heißt im Raum irgendeiner sinnlichen oder intelligiblen Sichtbarkeit, aber unser Affekt ist absolut phänomenologisch betroffen – nach Marion bis zur Erstarrung hin. Dass Marion diese Transzendenzstruktur nicht konsequenter Weise noch reduziert, wie Henry49 es ihm gegenüber bereits 1991 gefordert hatte, zeigt sich schließlich in seiner zu Beginn schon erwähnten Lösung: „Im Namen Gottes wohnen, ohne ihn zu sagen“ – aber auch, ohne diesem Namen gegenüber ein Nein auszusprechen – , heißt im An-Ruf – appel – durch ein Erschrecken herausgerufen zu werden.50 Wohin allerdings, wenn im Grunde die Transzendenz uns verwehrt 48 Vgl. bereits eine ähnliche frühere Kritik unsererseits an Rudolf Ottos religionsphilosophischen wie -psychologischen Begriffe des fascinosum und tremendum bei Rolf Kühn, Geburt in Gott. Metaphysik, Religion, Mystik und Phänomenologie, Freiburg i. Br. u. München 2003, S. 192 ff. Für eine Verschiebung der hermeneutischen Ebenen bei Theophanie/Anruf vgl. auch Jean Grondin, La tension de la donation ultime et de la pensée herméneutique de l’application chez J.-L. Marion, in: Dialogue 18 (1999). 49 Vgl. Michel Henry, Quatre principes de la phénoménologie, in: Revue de Métaphysique et de Morale 1 (1991) S. 3-26; erneut in Michel Henry, Phénoménologie de la vie, Bd. 1: De la phénoménologie, Paris 2003, S. 77-104. 50 Die lautliche Gleichheit zwischen nom/non – Name/Nein – im Französischen scheint uns als angeführtes Argument ähnlich gelagerten rhetorischen Effekten bei Derrida nachgeahmt zu sein, auch wenn damit nochmals die These von der Triplizität der negativen Theologie anstelle einer bloßen Dualität unterstrichen werden soll. Es ist uns hier allerdings nicht möglich, auf alle Beiträge Marions zur Gottesfrage einzugehen, die in letzter Zeit die Frage nach der ‚Unmöglichkeit‘ Gottes und seiner Offenbarung sowohl rational-philosophisch, wie theologisch-gläubig und hermeneutisch-phänomenologisch in immer neuen Anläufen erweitern; vgl. Jean-Luc Marion, Le croire pour voir. Réflexions „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 89 ist? Das begriffliche Schweigen an dieser Stelle scheint uns letztlich nicht sehr verschieden vom Schweigen Derridas als ‚Spur‘ zu sein, auch wenn dessen bloßer Monotheismus zugunsten eines inkarnierten Gottes in Christus aufgehoben ist. Das Schweigen der mystischen Theologie impliziert allerdings – noch vor aller ethischen, pädagogischen Umkehr – eine reelle „Präsenz“.51 Wurde diese jedoch radikal als ‚metaphysisch‘ disqualifiziert – und zwar von Derrida wie Marion, dann bleibt keine Möglichkeit mehr, eine andere Phänomenalisierungsweise von Präsenz noch in den Blick zu bekommen, welche Unmittelbarkeit wäre, ohne Jetzt-Gegenwart mit entsprechender Evidenz im Sinne von Begriffsurteil zu sein – sondern gerade Dunkelheit als Abwesenheit ekstatischer Eröffnung, Transzendenz, Differenz. Dekonstruktion wie Sättigung sind daher im strengen Sinne letztlich kein abschließendes Wort zur Mystik – als einer ‚kriteriologischen Phänomenologie‘ – , sofern diese eben nicht nur Sinn(bedeutung), Begriff und Intuition als Zugang zu Gott in Frage stellt, sondern die Struktur des Denkens als solche, ohne dessen mögliche reduktive Vorleistungen verneinen zu müssen. Daher soll eine dritte Rezeptionsweise der Apophatik noch vorgestellt werden, welche sich bei Henry vor allem an Meister Eckhart und dem Evangelisten Johannes orientiert. Aber das radikal phänomenologische Wesen der transzendentalen diverses sur la rationalité de la révélation et l’irrationalité des quelques croyants, Paris 2010; Ders., Certitudes négatives, Paris 2010; hieraus als Teilübersetzung dt. Das dem Menschen Unmögliche – Gott, in: Unmöglichkeiten. Zur Phänomenologie und Hermeneutik eines modalen Grenzbegriffs, hg. v. Ingolf Dalferth, Philipp Stoelger u. Andreas Hunziker, Tübingen 2009, S. 233-264. Die Sekundärliteratur von Thomas Alferi, 2007, und Lorenz B. Puntel, 2010, liegt diesen Veröffentlichungen voraus, ebenso Hans-Dieter Gondek u. Lázló Tengelyi, Neue Phänomenologie in Frankreich, Frankfurt a. M. 2011, S. 352-390: Marion im Kampf mit der Ontotheologie, so dass wir im Augenblick nur auf Rezensionen verweisen können: Ulrich Roth, Jean-Luc Marions Weiterentwicklung der ‚Phänomenologie der Gebung‘, in: Philosophischer Literaturanzeiger 62/4 (2009) S. 397-414; Claudia Serban, Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, in: Studia Phaenomenologica 11 (2011). Im Übrigen geht die durchaus verdienstvolle kritische Arbeit von Lorenz B. Puntel, Sein und Gott. Ein systematischer Ansatz in Auseinandersetzung mit M. Heidegger, E. Levinas und J.-L. Marion, Tübingen 2010, in ihrem ontologischen Ansatz kaum auf die gegenwärtige phänomenologische Diskussion in Frankreich ein, so dass sie uns gerade für die Frage der Mystik nicht weiterhilft; vgl. auch unsere Rezension dazu im Jahrbuch für Religionsphilosophie 9 (2010) S. 215-220. 51 Ob alle ‚Metaphysik‘ durch eine ‚Phänomenologie der Gebung/Sättigung‘ aufgehoben werde, fragt auch kritisch Emmanuel Gabellieri, De la métaphysique à la phénoménologie: une relève, in: Revue philosophique de Louvain 94/4 (1996) S. 625-645; allerdings wird phänomenologisch kaum mehr die frühe Polemik von Dominique Janicaud geteilt, Marion „theologisiere“ die Phänomenologie: vgl. Dominique Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française, Combas 1991, S. 39-56. 90 Rolf Kühn Reduktivität – Epoché, Gegen-Reduktion – wird dabei weder formal noch inhaltlich dem ‚mystischen Denken‘ beziehungsweise der ‚mystischen Erfahrung‘ entlehnt, sondern es hat sich bereits als reine Phänomenologie des Lebens in der eigenen Analyse verwirklicht, so dass die pro-vokative Frage aufbricht, ob es nicht einen mystischen Kern im absolut phänomenologischen Leben selbst gibt, ohne bestimmte Traditionen – Judentum, Christentum, Islam, aber auch Buddhismus, Sufismus, Zen – in Anspruch nehmen zu müssen und ohne die Gleichwertigkeit von Religion und Phänomenologie zu postulieren. 3 Michel Henry und Meister Eckhart – ‚über Theologie und Phänomenologie hinaus‘ Die zuvor diskutierte Position Derridas sowie Marions im Vergleich mit der christlichen Mystik zeigt nicht nur, wie bei Heidegger schon, dass die Hermeneutik einer angeblich linearen Metaphysikgeschichte überhaupt problematisch ist, sondern sie übersieht überdies philosophisch – und besonders phänomenologisch – die Möglichkeit einer mystischen Kriteriologie eigener Natur,52 welche den Präsenzgedanken gerade einem ‚Vergessen‘ anheim gibt, an das keine Retention und Erinnerung des Denkens mehr zurückreicht. Besagte nämlich Reduktion schon im Husserlschen Sinne Distanz in Bezug auf das urimpressionale Jetztmoment, das heißt Verlust als Abwesenheit des absolut phänomenologischen Lebens an sich innerhalb der Konstitutionsanalyse, dann muss gerade dieses ‚Spiel‘ – oder auch die ‚Infektion‘ – von Anwesenheit/Abwesenheit, worauf Derrida wie Levinas ihren Gedanken der Differance/trace gründeten, noch überboten werden, wie gerade Meister Eckhart deutlich zeigen kann. Denn das Denken, das heißt die Seele in ihrem reinen Verlangen oder Begehren – désir – , muss nicht nur das retentionale Vergessen in Bezug auf Gott als Seine Fülle durchleben, sondern die Gottheit als solche ‚ist‘ absolutes Selbstvergessen ihrerseits, insofern sie keinen Namen und keine Weise für eine transzendente Manifestation beziehungsweise Erkenntnis mehr besitzt. 52 Vgl. dazu ausführlicher Michel Henrys radikal phänomenologische Eckhartlektüre L’essence de la manifestation, Paris 1963, §39-40 u. §49-50; dt. in: Meister Eckhart – Erkenntnis und Mystik des Lebens. Forschungsbeiträge der Lebensphänomenologie, hg. v. Rolf Kühn u. Sébastien Laoureux, Freiburg i. Br. u. München 2005, S. 11-78, Kap. 1-4; Gondek, Tengelyi, Neue Phänomenologie in Frankreich, a. a. O., S. 334-351: Henrys lebensphänomenologische Erneuerung des Christentums; zu Meister Eckhart bes. S. 336 ff.; Rolf Kühn, ‚Ungeteiltheit‘ – oder Mystik als Ab-Grund der Erfahrung. Ein radikal phänomenologisches Gespräch mit Meister Eckhart, Leiden 2012. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 91 Im strengen Sinne des Ab-Grundes – Un-Grundes – , welcher kein rationales, hermeneutisches oder dekonstruktives Apriori darstellt, ist ‚Gott‘ sogar sich selbst gegenüber Selbstvergessen, da er sich eben nicht im Gegenüber eines Bildes oder Erkennens erfährt, sondern nur passiv selbstrezeptiv im immerwährenden Sich-Offenbaren als ungeschaffene Logos-Selbstgeburt.53 Gleiches gilt ebenso ursprünglich von der Seele, so dass Gott wie die Seele alles Wissen – jeglichen Namen – von sich abgelegt haben, wodurch das Selbstvergessen zu ihrem phänomenologisch-ontologischen Wesen gehört – das heißt, sie nichts anderes als Selbstvergessen sind: „Was immer du mit Gott suchst, das ist nichts, was es auch sei; du suchst ein Nichts, darum findest du auch ein Nichts. Dass du ein Nichts findest, ist nur dadurch verursacht, dass du ein Nichts suchst. Alle Kreaturen sind ein reines Nichts … Der Seele jedoch macht er (Gott) sich so gleich und so ebenbildlich, auf dass er sich der Seele geben könne; denn was er ihr sonst gäbe, das achtet sie für nichts. Gott muss mir sich selbst so zu eigen geben, wie er sich selbst gehört, oder aber mir wird (überhaupt) nichts zuteil, und nichts sagt mir zu.“54 Wir wissen, dass Derrida über den Levinasschen Gedanken der ‚Spur‘ ein solches Vergessen selbst zu thematisieren versucht hat,55 aber zumindest in Bezug auf seine genannte Kritik an der Negativen Theologie einschließlich der teilweise berechtigten Replik Marions erweist sich über Meister Eckhart, dass hier ein solches Vergessen der ‚Präsenz‘ bis in deren Selbstvergessen hinein bereits zum inneren, radikal phänomenologischen Bestand des immanenten Erscheinens gehörte. Man muss sich daher mit Henry verdeutlichen, dass jedes Differenzdenken im besten Fall nur die vollkommene Indifferenz der Welt als Zeitlichkeit denken kann, das heißt die transzendentale Er-Öffnung der Transzendenz, aber eben nicht die heterogene Offenbarungsweise der Immanenz, die auf keine Kluft oder auf irgendeinen ‚Aufschub‘ beziehungsweise ‚Anruf‘ im retentionalen ‚Supplement‘ mehr angewiesen ist. 53 Vgl. zum Beispiel Meister Eckhart, Kommentar zum Buch der Weisheit in der Übersetzung v. Karl Albert, Sankt Augustin 1988, n. 4, S. 12: „‚In der Einfachheit des Herzens suchet ihn‘ (Weish 1,1). Hier ist anzumerken, dass wie ‚eines‘ und ‚seiend‘ miteinander austauschbar sind, so auch Einfachheit und Geistigkeit. Die erste Wurzel und der Grund der Geistigkeit ist nämlich die Einfachheit. Der Beweis dafür ist folgender: Erstens, weil das Einfache und es allein sich ganz auf sich zurückwendet in vollkommener Rückwendung und es deshalb nach dem Buch ‚Von den Ursachen‘ sich selbst und alles durch sein Wesen erkennt“. Die Umkehrbarkeit der Transzendentalien untereinander ist mithin nur dank der Eigenrezeptivität – Rückwendung – des Wesens oder der Gottheit möglich. Vgl. auch Willi Goris, Einheit als Prinzip und Ziel. Versuch über die Einheitsmetaphysik des Opus tripartitum Meister Eckharts, Leiden 1997. 54 Predigt 4, in: Meister Eckhart, Werke I, a. a. O., S. 53 f. Hervorhebungen im Original. 55 Vgl. Emmanuel Levinas, Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie, Freiburg i. Br. u. München 31992, S. 209-235: Die Spur des Anderen. 92 Rolf Kühn Was so radikal verborgen ist wie das Wesen des absoluten Erscheinens als sein Selbsterscheinen im Sinne von Gottheit/Leben – Abgrund – , verfällt also prinzipiell dem ‚Vergessen‘. Dieses Vergessen ist selbst keine thematische Abwesenheit oder ein retentionales Nichts, wie Erinnerung und Gedächtnis an Vergangenes zeigen, sondern das ‚Gegenwärtige‘ – die ‚Präsenz‘ – selbst kann absolut vergessen sein, und am meisten vergessen ist das universale Erscheinens-Wesen als immer unanschaulich gegenwärtige Gegenwart, die jedoch rein praktisch verlebendigend in uns lebt, ohne sich selbst jemals objekthaft zu präsentieren – auch nicht als ‚Spur‘ oder ‚Sättigung‘. Das Vergessen ist in diesem Zusammenhang folglich ein absolutes Nicht-Daran-Denken-Können, und solches Denken ist grundsätzlich nur möglich auf dem Boden dessen, woran thematisch niemals gedacht werden kann, ohne allerdings praktisch ohne Selbstgebung zu sein – nämlich das reine Wesen des originären Erscheinens. Nicht eine bestimmte Thematik als solche – Metaphysik, Dekonstruktion oder Negative Theologie – würde das Wesen mithin verfehlen, sondern es ist unaufhebbar die Notwendigkeit des Denkens, von Natur aus ein Denken des Außen sein zu müssen, was das Wesen prinzipiell ver-fehlt, weil eben die Horizontbedingung dieser Außenheit nie als solche sowie ihre passive Selbstrezeptivität nie gegenständlich thematisiert zu werden vermag – und sei es als ‚Differänz‘ oder ‚Sättigung‘.56 Dann aber ist eben ein strukturelles Vergessen als Ermangelung eines Zur-Verfügung-Stehens eine unausweichliche Tatsache des intentionalen Denkens, welches die Immanenz als Ursprungswesen der ‚reinen Gegenwart‘ nicht erreicht, wie wir mit Meister Eckhart und Henry unterstreichen möchten. Eine gegenlautende Bestimmung wie die der Wiedererinnerung oder Sammlung als ontologischer Grundaufgabe im klassisch phänomenologischen oder fundamentalhermeneutischen Sinne bei Husserl und Heidegger ist dann nicht mehr möglich, aber auch nicht die Dekonstruktion – oder recollectio – nach Derrida, weil diese wiederum im Horizont der Transzendenz oder des ‚Ereignisses‘ – beziehungsweise zumindest der 56 Vgl. Michel Henry, Die innere Struktur der Immanenz und das Problem ihres Verständnisses als Offenbarung: Meister Eckhart sowie Die ontologische Bedeutung der Kritik der Erkenntnis bei Meister Eckhart, in: Meister Eckhart – Erkenntnis und Mystik der Lebens, a. a. O., S. 22 f. u. S. 46 ff., wo unter anderem auch der Begriff der ‚Destruktion‘ – von Heidegger entlehnt – gebraucht wird, so dass wir uns rezeptionsanalytisch in Bezug auf die Mystik in einer gleichen Ausgangssituation wie bei Derrida und Marion befinden – mit dem großen Unterschied jedoch, dass bei Henry in den ersten Kapiteln von L’essence de la manifestation, a. a. O., die phänomenologische Heterogenität von transzendentaler Subjektivität und transzendentem Horizont schon geklärt wurde und Meister Eckhart nachträglich als ein herausragender Zeuge dieser radikalen Epoché mit Blick auf die reine Struktur der Immanenz herangezogen wird. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 93 Zeitlichkeit – gedacht werden müssten,57 so dass gerade eine Theorie des Seinsvergessens, Seinsaufschubs oder ‚Jenseits des Seins‘ mit am stärksten die ideologische Einflussmacht eines einseitig transzendenzorientierten Traditionsstromes in der Philosophie bisher unterstreicht. Wird die Negative Theologie mithin in einer solchen phänomenologischen Gesamtkonstellation religionsphilosophisch heute bedacht, dann impliziert sie eine mystisch-philosophische Re-volution des Präsenzgedankens ‚Gottes‘, denn je mehr wir an ‚Ihn‘ im Sinne der Weltgegenwart denken, desto mehr verfehlen wir ihn, weil seine urlebendige Gegenwart als ‚passible Präsenz‘ nicht die noch ontisch gedachte Rückseite einer mundanen Manifestationsweise ist, sondern das rein phänomenologische Wesen des Lebens selbst, welches in keiner Welt erscheint, um allein so im praktischen Vollzug der Selbsterprobung unseres unsichtbaren Lebens zu keinem Augenblick zu fehlen. Die ‚Mystik‘ wäre damit kein Erfahrungsbereich neben anderen Regionalontologien – Disziplinen – , sondern sie bildet als ursprüngliches Erfahrenkönnen vor allem einzelnen Erkennen und Tun die welthafte Ortlosigkeit einer rein verlebendigenden ‚Anwesenheit‘, die sich aus sich selbst genügt und daher in allen intentionalen Leistungen und deren innerer Affektion nicht-wissend aufgefunden werden kann.58 Die Praxis der Phänomenologie ist nicht Mystik in irgendeinem spezifischen – theologischen – Sinne, sondern sie erkennt diese im Ursprung jeder reinen Praxis wieder, wie ein längeres Zitat von Henry gut zeigt: „Jedes der Vermögen des Leibes baut sich nach und nach durch ein Wirken auf, das seine unterschiedlichen Konstitutionsphasen miteinander verkettet, so dass sich dieses Vermögen ausüben kann. Und genauso ist es für eine jede der Seelenkräfte. An sich scheint eine solche Entwicklung unendlich zu sein. Sie besteht im Ins-Werk-Setzen der Subjektivität und ist somit zweifach. Einerseits handelt es sich hierbei um die Selbstaktivierung des Pathos, in dem sich unser Sein innerlich erbaut. Daher gibt es eine Kultur des Gefühls, die zwar nicht die Kultur dieses oder jenes Gefühls ist: des Vergnügens, des Hasses, des Sadismus usw., sondern des Gefühls selbst als solchem, nämlich eines Sich-Selbst-Empfindens des Sich-Selbst-Empfindens, welches sich bis zu dem hin steigert, was sich eine ontologische Trunkenheit nennen ließe. Die Mystik ist die eigentliche Disziplin, welche die Selbsterfahrung des Gefühls in seinen grundsätzlichen Möglichkeiten im Blick hat. Als solche ist die Mystik 57 Vgl. auch Sébastien Laoureux, Material phenomenology to the test of Deconstruction: Michel Henry and Jacques Derrida, in: Studia Phaenomenologica 9 (2009) S. 237-248. 58 Vgl. dazu nochmals das Eckhart-Zitat aus Fußnote 16 in diesem Aufsatz. 94 Rolf Kühn deshalb eine wesenhaft praktische Disziplin. Jedoch ist sie in jeglicher Tätigkeit der Kultur gegeben, so dass deutlich gezeigt werden muss, warum.“59 Aus dem notwendigen Aufweis einer solch all-präsenten Gegebenheit der Mystik, wie wir dies in der Auseinandersetzung mit Derridas und Marions Kritik an der Negativen Theologie verfolgt haben, ergibt sich zunächst hier für das Verständnis einer ursprünglichen phänomenologischen Mystik, diese als ‚religio‘ des Reinen Erscheinens im Sinne des Wesens desselben im radikal oder material phänomenologischen Sinne aufzufassen. Eine solche Sichtweise des mystisch-religiösen ‚Gegenstandes‘ lässt sich dann nicht mehr von seiner originären Verbindung trennen, jedoch nicht allein im geschichtlichen Sinne – insofern die Mystik in der Entwicklung religiöser Traditionen nie gefehlt hat, sondern weil die Ursprungsgegebenheit des religiös Absoluten mit dessen ‚gottheitlicher‘ – ab-gründiger – Immanenzstruktur zusammenfällt, welche nur innerlich – oder eben praktisch – erprobt zu werden vermag – und keine angemessene theoretische Darstellung als methodisch gesichertes Wissen kennt. Dieses Verständnis einer religionsphilosophisch betrachteten Mystik, welche sich kriteriologisch eben in der ungeteilten Eckhartschen Mystik als Einheitsprinzip der göttlichen wie menschlichen Erscheinensweisen wieder findet, kann dann nicht mehr zu einer bloß historischen oder komparativen Wissenschaft des ‚Phänomens des Religiösen‘ absinken, weil letzteres in seiner radikal-subjektiv inneren Erprobung schon gegeben sein muss, um in einer deiktischen Rekurrenz davon überhaupt sachhaltig sprechen zu können. Der Aufweis des Zusammenhangs von Meister Eckharts ontologischer Mystik und dem Bemühen Negativer Theologie, den ‚Namen‘ Gottes einem rein intentional identifizierenden Zugriff zu entziehen, macht deshalb aus der Henryschen Sichtweise deutlich, dass die Verankerung der Mystik in der subjektiven Erprobung immanenten Lebens als einzig wirklicher Präsenz das göttlich Absolute – oder die Gottheit im Abgrund – dadurch keineswegs privatisiert. Vielmehr erweist sich solche rein phänomenologische Mystik durch unsere kritischen Rezeptionsanalysen unaufgeklärter Transzendenz rückgebunden an 59 Michel Henry, Die Barbarei. Eine phänomenologische Kulturkritik, Freiburg i. Br. u. München 1994, S. 319 f. Schon Mitte der 40er Jahre notierte Henry in bisher unveröffentlichten Manuskripten: „Gott kann kein Gott des Ressentiments sein. Ein Gott der Erkenntnis – reconnaissance – . Sollte Gott mich erkennen, dann nicht als Außenheit – extériorité – ; sondern wenn ich Gott wäre – in der Weise Eckharts“, in: Revue Internationale Michel Henry 2 (2012) S. 92 (Ms C 9-471-2915 Fonds Michel Henry, Université catholique Louvain-la-Neuve). Hervorhebungen im Original. Vgl. auch Rolf Kühn, Praxis der Phänomenologie. Einübungen ins Unvordenkliche, Freiburg i. Br. u. München 2009, S. 194 ff. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 95 eine Universalität des Gefühls, welche unmittelbare Konsequenzen im Bereich einer leiblich fundierten Christologie und eines ihr entsprechenden Ethos für jede Individualität und Gemeinschaftlichkeit besitzt.60 Daraus ergibt sich ein zusätzlich erhellendes Ergebnis aus dem Bezug von phänomenologischer Mystik und negativer Theologie, nämlich im Grunde die Entfernung jeglicher negatio im Ursprungsverhältnis der immanent absoluten Offenbarungsstruktur des göttlichen Wesens, welches ‚Verneinung der Verneinung‘ ist. Das Absprechen dessen, was Gott in seiner Benennung vernunftmäßig wie mystisch-religiös seinem Wesen nach nicht zukommen könne, ist ein Vernunftschluss, welcher sich notwendigerweise aus jener Distanz heraus ergibt, mit der die identifizierende Vernunft auf Gott schaut. Ist allerdings dieser Differenzhorizont erst einmal durch eine prinzipielle phänomenologische Erkenntnisreduktion im Sinne Henrys aufgehoben, dann fällt auch Gottes ‚Anwesenheit‘ nicht mehr in eine ‚Gegenwart‘, welche der identifizierenden Benennung ausgeliefert ist. Das Absolute Gottes, das heißt seine ihm eigentümliche Wesensoffenbarung als gottheitliches Selbsterscheinen, fällt ausschließlich in den Bereich der passiblen oder affektiven Erprobung, wo sich ‚mein‘ lebendiges Wesen – als ‚Seele‘ bei Meister Eckhart – aus der Lebensselbstaffektion Gottes entgegennimmt: „Alles, was vergangen und zukünftig ist, das ist Gott fremd und fern. Und darum: Wer von Gott als Gottes Sohn geboren ist, der liebt Gott um seiner selbst willen, das heißt: er liebt Gott um des Gott-Liebens willen und wirkt alle seine Werke um des Wirkens willen. Gott wird des Liebens und Wirkens nimmer müde, und auch ist ihm, was er liebt, alles eine Liebe.“61 Da in diesem ununterbrochenen affektiven Geschehen der göttlichen Liebe alle Modi der Phänomenalisierung radikal phänomenologische Bestimmungen darstellen, entfällt durch den Ausschluss jeglicher Kategorie der Denk-Andersheit auch die Möglichkeit einer hier problematisierten negatio, welche stets nur innerhalb eines Mediums der Vielfalt oder Vermittlung operativ sein kann. Im Bereich der mystischen Erprobung als reinem Affiziertwerden durch das Erscheinen-Können schlechthin ist aus dem genannten radikal phänomenologischen Grund keinerlei Verneinung mehr gegeben, da eben alle passiblen oder affektiven Manifestationsweisen unmittelbar praktische Bestimmungen des absoluten Lebens oder der Gottheit selbst bilden. Alles, was sich in solch originärem Erscheinen als affektive 60 Vgl. bereits unsere frühere Arbeit Rolf Kühn, Gabe als Leib in Christentum und Phänomenologie, Würzburg 2004, sowie die Auseinandersetzung mit Maurice Blondel und Jean-Luc Nancy etwa in unserer Untersuchung: Rolf Kühn, Französische Religionsphilosophie und -phänomenologie der Gegenwart. Metaphysische und post-metaphysische Positionen zur originären Erfahrungs(un)möglichkeit Gottes, Freiburg i. Br. 2013. 61 Meister Eckhart, Buch der göttlichen Tröstung, in: Werke II: Traktate. Lateinische Werke, hg. v. Niklaus Largier, Frankfurt a. M. 1993, S. 285. 96 Rolf Kühn Historialität des Absoluten gibt, ist jeweils auch schon eine absolute Positivität im phänomenologisch-ontologischen Sinne, mit anderen Worten die Selbstbejahung des absoluten Lebens oder Ab-Grundes in seiner jeweils immanent generierten Bestimmung als gebärende Modalisierung der Gottheit.62 Wenn mithin einmal die gegenreduktive Epoché im Sinne Henrys durchgeführt wurde, wie sie ihre kriteriologische Parallele in der Einheitsmystik eines Meister Eckharts besitzt, dann wird mit solchem Ausschluss der Andersheit oder Differenz als Bereich der Transzendenz und Kreatur auch die weitere Möglichkeit einer Negation ausgeschlossen, insofern keine Impression sowie kein Fühlen im Augenblick ihres Selbsterscheinens jemals negiert zu werden vermag. Ihr Sich-Geben ist eine absolute Affektion, insofern eine solche Ge-Gebenheit nicht möglich wäre ohne unmittelbare Rückbindung an die absolute Immanenzstruktur des transzendentalen oder gottheitlichen Selbsterscheinens im Sinne innerer Selbstrezeptivität als Selbstoffenbarung. So wie Gott sich in seiner Wesenheit nicht sich selbst verweigern kann, mithin die ‚Negation jeglicher Negation‘ verwirklicht, ebenso kann auch ein Affekt im Augenblick seiner Hervorbringung aus der Lebensimpressinabilität heraus nicht in phänomenologisch-ontologischer Hinsicht verneint werden. Dass theologiegeschichtlich die Problematik negativer Theologie alle Fragen der diskursiven und metaphorischen Benennungsaporien formulieren musste,63 liegt damit auf der Hand, sofern eben nicht unmittelbar die Reduktion auf den immanenten oder selbstaffektiven Erscheinensbereich des absoluten Wesens vorgenommen wird, sondern nur in einzelnen einklammernden Schritten der dreifachen Apophase. Eine Mystik, welche die Kriteriologie der Eckhartschen ‚Ontologie‘ als Entsprechung zu einer reinen Wesensphänomenalisierung direkt aufgreift, befindet sich damit auch von Vornherein in der apodiktischen Sphäre des Absoluten oder der Gottheit – und damit außerhalb der Negations- und Bejahungsproblematik in Bezug auf das Wesen Gottes. Insoweit lässt sich sagen, dass eine phänomenologische Mystik im genannten Sinne die klassisch metaphysischen Fragen jeglicher 62 So wie das Leben gegenüber der in ihm jeweils gezeugten Ipseität niemals indifferent ist, kann Eckhart entsprechend auch von der causa essentialis oder Gott sagen, sie sei „Fürsorge“; vgl. Meister Eckhart, Kommentar zum Buch der Weisheit, a. a. O., n. 71 f., S. 44: „Weil die einzelnen Seienden also aufgrund des Einen und im Einen hervorgehen, sind und im Sein stehen und folglich unter der ersten Ursache – sc. stehen – , die die Ursache des Seins ist, so folgt, dass sie auch in gleicher Weise unter der Fürsorge eben dieser ersten Ursache stehen: ‚in gleicher Weise‘, weil aufgrund eines und desselben Seins, welches das Sein des ganzen Universums ist.“ Die Indifferenz der Welt korreliert daher mit ihrer Außenheit, die keine Immanenz – und somit keine ‚Fürsorge‘ – kennt . 63 Vgl. Pierre Gire, Maître Eckhart et la métaphysique de l’Exode, Paris 2006, S. 49 ff., S. 88 ff. u. S. 288 ff. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 97 Ana-Logie in ihrer möglichen Berechtigung oder notwendigen Unangemessenheit suspendiert hat, weil sie sich selbst nicht mehr im Bereich der Re-Präsentation bewegt. Gott ist dann nicht mehr der transzendent Unübertreffliche auch mit Bezug auf einen ontologischen Gottesbeweis nach Anselm von Canterbury,64 sondern jegliches ‚Über-Treffen‘ und dessen Verneinung findet sich durch die absolute Selbstbindung des göttlichen Lebens an sich selbst in der Immanenz als reflexive oder metaphysische Problematik aufgelöst: Gott „ist ein lauteres In-Sich-SelbstStehen, wo es weder dies noch das gibt; denn was in Gott ist, das ist Gott …, denn in Gott kann nichts Fremdes einfallen.“65 Zwar lässt sich im Diskurs Negativer Theologie das stets gleichzeitig notwendige Verneinen einer ausgesagten Eigenschaft Gottes im Vergleich zu menschlichen Bestimmungen – wie etwa Macht, Weisheit, Güte – auch mit Marion als ein wesenhaftes Hinausstreben des ‚Sagens‘ selbst über das jeweils ‚Gesagte‘ hinaus verstehen.66 Aber diese Transzendenzbewegung im Sinne eines Überschusses, welcher jegliche sprachliche Referenz sofort auch wieder aufhebt, um damit die Negation in die je relativierte Bedeutungsentfaltung als solche hinein zu verlegen, bleibt dann nicht minder an einen grundlegenden Negativitätscharakter gebunden, wie wir hier nochmals unterstreichen möchten, insofern eine solche Bewegung im propositionalen Bereich nie an ein Ende gelangt. Wenn insbesondere dann die Metaphorik mehr das innere Verlangen nach dem Absoluten zum Ausdruck bringt als den diskursiven Versuch einer Benennung Gottes selber, so wäre nicht nur mit Derrida auf die Gefahr von libidinös-subjektiven Einfärbungen einer solchen mystischen Sprechweise hinzuweisen, sondern auf den phänomenologisch unaufgeklärten Charakter solchen Begehrens oder Strebens. Denn solange sich hierin noch ein Wollen nach Gott als einem intentionalen Ziel verbirgt, wodurch das Absolute weiterhin in einem teleologischen Außen oder Später gesucht würde, bleibt die 64 Vgl. in dieser Hinsicht den Vergleich zwischen Meister Eckhart und Anselm bei Michel Henry, Hinführung zur Gottesfrage: Seinsbeweis oder Lebenserprobung?, in: Meister Eckhart – Erkenntnis und Mystik des Lebens, a. a. O., S. 64-78, sowie zur Diskussion zwischen Lebensphänomenologie und Analogie-Denken Enders, Postmoderne, Christentum und Neue Religiosität, a. a. O., S. 147-184: ‚Ich bin die Wahrheit‘ – eine kritische Lektüre von Michel Henrys Philosophie des Christentums; Martin Lersch, Triplex Analogia. Versuch einer Grundlegung pluraler christlicher Religionsphilosophie, Freiburg i. Br. u. München 2009, S. 56 ff. u. S. 377 ff., sowie die Fußnote 38 in diesem Aufsatz oben zu Anselm von Canterbury und Thomas von Aquin bei Marion. 65 Meister Eckhart, Predigt 3, in: Werke I, a. a. O., S. 43 f. 66 Vgl. Marion, De surcroît, a. a. O., S. 162 ff. 98 Rolf Kühn unmittelbare Affektion des einen Wesens im Begehren als solchem unerkannt.67 Als phänomenologischer Modus ist letzteres nämlich in seiner immanenten Erprobung ebenfalls eine unmittelbare passible Präsenz Gottes, so dass selbst der Vollzug des Suchens zu einem Nicht-Suchen zu werden vermag, das heißt zu einer pathischen Rekurrenz oder Implosion auch dieser spezifischen Intentionalität: „Gott berührt alle Dinge, er aber bleibt unberührt. Gott ist über allen Dingen und ein ‚Einstehen‘ in sich selbst, und sein Insichtselbststehen erhält alle Kreaturen … Alle Kreaturen suchen außerhalb ihrer selbst stets eine an der andern das, was sie (selbst) nicht hat; das tut Gott nicht. Gott sucht nichts außerhalb seiner selbst. Was alle Kreaturen haben, das hat Gott allzumal in sich. Er ist der Boden, der Reif aller Kreaturen.“68 Dieses Eckhart-Zitat macht im Übrigen darauf aufmerksam, dass die von ihm verwandten Bilder zumeist der alltäglichen Umwelt, der Natur und der Kosmologie entstammen, und weniger dem Bereich der ‚Minne‘. Dies entspricht unter anderem nicht nur seinem exegetischen Grundsatz, „die Lehren des heiligen christlichen Glaubens und der Schrift beider Testamente mit Hilfe der natürlichen Gründe der Philosophen auszulegen“,69 sondern gerade auch seiner immer wieder neuen Anweisung, sich nicht in die Introspektion und deren psychologische Begrenzung zu verfangen, welche dann nicht mehr vom einseitigen Blick auf das ‚Ich‘ oder die eigene Seele frei wird. Wenn Meister Eckharts Seelenlehre daher ein ontologisches Einheitsdenken des absoluten Erscheinenswesens darstellt, dann ist nach ihm auch dort nur die Seele in ihrer phänomenologischen Reinheit anzutreffen, wo sie jenseits aller Bilder in den göttlichen Ab-Grund vor deren Herausbrechen eintritt, um eben mit dessen originärem ‚Wirken‘ – Gott – als ‚Nicht-Wirken‘ – Gottheit – vor jedem besonderen Werk eins zu sein: „Wenn ich zurückkomme in ‚Gott‘ und (dann) dort – sc. bei ‚Gott‘ – nicht stehen bleibe, so ist mein Durchbrechen viel edler als mein Ausfluss. Ich allein bringe alle Kreaturen aus ihrem geistigen 67 In jüngerer Zeit war vor allem Simone Weils Philosophie und Spiritualität ganz an der Zurückführung des Begehrens – désir – auf die reine Aufmerksamkeit für das Gute oder Gott mittels der Leere orientiert; vgl. Simone Weil, Zeugnis für das Gute. Traktate, Briefe, Aufzeichnungen, München 1990. Auch für Eckhart ist Gott das Gute schlechthin, im Unterschied zu „diesem oder jenem Guten“; vgl. Ders., Kommentar zum Buch der Weisheit, a. a. O., n. 96 f., S. 56 ff.: „Zu wem nämlich Gott kommt, zu dem kommt notwendig alles Gute … Dieses oder jenes Gute, das Gute für diesen oder das Gute für jenen, ist ein Geschaffenes und etwas unterhalb des Guten (selbst) … Das Dies und Das ist ein Fallstrick, durch den man nicht mehr ein Freier ist, sondern ein Gefangener“. 68 Meister Eckhart, Predigt 13A, in: Werke I, a. a. O., S. 165. 69 Meister Eckhart, Auslegung des heiligen Evangeliums nach Johannes, Vorwort, in: Ders., Werke II, a. a. O., S. 489; vgl. dazu Karl Heinz Witte, Meister Eckharts Verständnis des richtigen Lebens, in: Lebensphänomenologie in Deutschland. Hommage an Rolf Kühn, hg. v. Sophia Kattelmann u. Sebastian Knöpker, Freiburg i. Br. u. München 2012, S. 200-217. „…über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ 99 Sein in meine Vernunft, auf dass sie in mir eins sind. Wenn ich in den Grund, in den Boden, in den Strom und in den Quell der Gottheit komme, so fragt mich niemand, woher ich komme oder wo ich gewesen sei. Dort hat mich niemand vermisst, dort entwird (auch) ‚Gott‘ – sc. im Unterschied zur ‚Gottheit‘ – . Wer diese Predigt verstanden hat, dem vergönne ich sie wohl. Wäre niemand hier gewesen, ich hätte sie diesem Opferstocke predigen müssen.“70 Wenn demzufolge ebenfalls eine heutige (religions-)philosophische Mystik dem Wesen des Erscheinens als ursprünglicher religio entsprechen will, dann müssen alle zeitbedingten Vorgaben eines theologischen wie dekonstruktiven Humanismus und Anthropologismus phänomenologisch kritisch hinterfragt werden, um die Gottesfrage nicht mehr nur auf keine Sprachproblematik zu verkürzen, sondern um jegliche Beeinträchtigung durch eine irgendwie reduzierte Phänomenalität zu vermeiden. Damit besitzt solche Mystik ein kritisches Potential, welches sie sowohl über eine einseitige Präsenzmetaphysik wie aber auch über eine modernistische Abhängigkeit von bloßen Phänomenanalysen als dekonstruktiven Sinnzerstreuungen erhebt. Die Verbundenheit einer radikalisierten Phänomenologie mit der Mystik erlaubt ein Sprechen von Anwesenheit, deren Kategorien nicht mehr den mundanen Erscheinungskoordinaten geschuldet sind,71 sondern das göttliche Wesen des Absoluten als ‚Gottheit‘ dort verankern, wo wir uns in keinerlei Hinsicht mehr selbst aufheben oder verneinen können, nämlich in der reinen Empfängnisgegebenheit unseres Lebens beziehungsweise Fleisches als Verbindung mit dem notwendigerweise darin stets gegebenen absoluten Leben. Diese phänomenologische Apodiktizität unterliegt keiner Schau mehr, so dass sie folglich auch keiner perspektivischen theoretischen Disziplinen mehr unterliegt, sondern der impressional-affektiven Universalität eines Sich-Offenbarens des Absoluten selbst verpflichtet ist, welches trotzdem stets konkret singulär bleibt. Mag daher geschichtlich gesehen die mystische Erfahrung auch noch so sehr einzelne Individuen herausheben, wie es von den unterschiedlichen religiösen und spirituellen Traditionen bezeugt wird, so steht ihr Zeugnis über ein je einmaliges Gotterleben dennoch für die allgemeine 70 Meister Eckhart, Predigt 26, in: Deutsche Predigten und Traktate, hg. v. Joseph Quint, München 1978, S. 273. Von daher wird auch die Aussage Eckharts aus Predigt 14, in: Ders., Werke I, a. a. O., S. 171, verständlich: „Ich habe mich (als) dich und dich (als) mich ewig geboren.“ 71 Vgl. schon zuvor Rolf Kühn, Gottes Selbstoffenbarung als Leben. Religionsphilosophie und Lebensphänomenologie, Würzburg 2009, Kap. I,2: Grundlegende Zugänge zum Absoluten, S. 59-92. Ob damit auch eine Basisprämisse für das Verständnis der Weltreligionen untereinander heute gegeben ist, diskutiert Ulrich Felder, Apophatik als Lösungsformel für den interreligiösen Dialog? Das Konzept der negativen Theologie in den pluralistischen Religionstheorien von John Hick und Perry Schmidt-Leukel, Würzburg 2012. 100 Rolf Kühn Grundsätzlichkeit jener reinen Phänomenalisierung, welche sich darin bekundet – nämlich für einen ‚Gott‘, der in sich Selbstoffenbarung ist, dessen gottheitliches Wesen es ist, sich in seiner Einheit selbst zu zeugen und genau daran den Menschen prinzipiell Anteil zu gewähren. Alles andere bliebe im Bereich der Kreatürlichkeit oder Bilder, was der transzendentalen Affektivität als absolutem Leben im Sinne Eckharts und Henrys nicht entsprechen kann. Deshalb ist hier der Ort und die Weise aller – religionsphänomenologischen – Mystik als einer neu, das heißt rein passibel bestimmten ‚Metaphysik der Erprobung‘.72 Diese vermag sich nicht außerhalb dieses Grundes zu gründen, falls sie mit ihrem Wesen übereinstimmen will: „Wo die Kreatur endet, da beginnt Gott zu sein. Nun begehrt Gott nichts mehr von dir, als dass du aus dir selbst ausgehest deiner kreatürlichen Seinsweise nach und Gott Gott in dir sein lässt. Das geringste kreatürliche Bild, das sich je in dich einbildet, das ist so groß, wie Gott groß ist. Warum? Weil es dich an einem ganzen Gott hindert. Eben da, wo dieses Bild (in dich) eingeht. Da muss Gott weichen und seine ganze Gottheit.“73 72 Vgl. Rolf Kühn, Ungeteiltheit – oder Mystik als Ab-Grund der Erfahrung, a. a. O., Kap. 1: Phänomenologie zwischen Metaphysik und Mystik; zur weiteren Diskussion auch Jean Greisch, Philosophie, poésie, mystique, Paris 1999; Etienne Cattin, Eckhart, Schelling, Heidegger, Paris 2012, sowie in Bezug auf Johannes vom Kreuz, Heidegger und Levinas: Anton Glück, Offenheit – Empfänglichkeit. Mystik und Phänomenologie, Würzburg 2012; zu erwähnen bleibt außerdem die Analyse zu Johannes von Kreuz und Phänomenologie bei Jean-Louis Chrétien, L’appel et la réponse, Paris 1992, sowie bei Alain Cugno, Jean de la Croix avec Michel Henry, in: Michel Henry, l’épreuve de la vie, hg. v. Alain David u. Jean Greisch, Paris 2000, S. 439-452, und Ruud Welten, The Night in John of the Cross and Michel Henry. A Phenomenological Interpretation, in: Studies in Spirituality 14 (2004) S. 213-233. 73 Meister Eckhart, Predigt 5B, in: Werke I, a. a. O., S. 73. Zum ontologischen Gottesbegriff, seiner normativen Bedeutung und seinen Spiegelungen im zeitgenössischen Denken: Emmanuel Levinas, Jacques Derrida und Jean-Luc Marion Markus Enders Zum ontologischen Gottesbegriff 1 Thematik und Aufgabenstellung der folgenden Überlegungen Im Folgenden soll zunächst der ‚ontologische Gottesbegriff ‘ selbst vorgestellt werden, und zwar in seinem – intensionalen – Gehalt, ferner in seiner inhaltlichen und formalen Normativität und schließlich in seiner systematischen Bedeutung als der nach der Überzeugung des Verfassers seinem Gegenstand angemessenste Vernunftbegriff für Gott, den die klassische philosophische Gotteslehre im abendländischen Denken überhaupt entwickelt hat. Im zweiten Teil soll gezeigt werden, dass dieser Gottesbegriff auch bei solchen zeitgenössischen Denkern wie Emmanuel Levinas, Jacques Derrida und Jean-Luc Marion, die ihn explizit oder implizit ablehnen, dennoch eine Wirkungsgeschichte zumindest hinsichtlich seiner formalen, teilweise sogar auch in seiner inhaltlichen Normativität besitzt. Damit soll ein zumindest exemplarischer Ausweis der Normativität des ontologischen Gottesbegriffs für die philosophische Gotteserkenntnis auch in unserer Zeit und in der Gegenwart erbracht werden. 101 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7_6 102 Markus Enders 2 Gehalt und Bedeutung des ‚ontologischen Gottesbegriffs‘ 2.1 Der epistemische Gehalt des ‚ontologischen Gottesbegriffs‘1 Beginnen wir mit der Erläuterung des epistemischen Gehalts des ‚ontologischen Gottesbegriffs‘, also seiner – um mit Rudolf Carnap zu sprechen – Intension. Anselm von Canterbury, der die Vollform des ,ontologischen Gottesbegriffs‘ in seiner Schrift Proslogion entwickelt hat, kleidet diesen rein rationalen2 Gottesbegriff in die sprachliche Formel „aliquid quo maius nihil cogitari potest“, die im Folgenden der Kürze halber einfach mit ‚Q‘ bezeichnen werden soll.3 Anselm identifiziert den lateinischen Komparativ ‚maius‘ innerhalb von ‚Q‘ wiederholt mit ‚melius‘ und versteht daher Gott als etwas, über das hinaus nichts Besseres, gemeint ist: nichts im Sein Vollkommeneres gedacht werden kann.4 Dabei nimmt er mit seinem ,ontologischen Gottesbegriff‘, wie Jens Halfwassen gezeigt hat, einen Begriff von Sein als uneingeschränkter Vollkommenheit auf, den im Ausgang von Platon zuerst Plotin entwickelt hatte und den Anselm aus Aurelius Augustinus und Anicius Manlius Severinus Boethius kannte.5 Die diesbezügliche boethianische Formel für den rationalen Gottesbegriff, „dass nichts Besseres als Gott gedacht werden kann“6, steht bei Boethius im Kontext eines Beweises für die Existenz Gottes, als dessen Fundament sich der neuplatonische Seinsbegriff ausweisen lässt. Boethius übernimmt wie schon Augustinus die neuplatonische Konzeption eines 1 Die Überlegungen dieses ersten Teils stellen weitgehend eine Kurzform und Zusammenfassung dar von Markus Enders, Denken des Unübertrefflichen, in: Jahrbuch für Religionsphilosophie 1 (2002) S. 50 ff. 2 Zur Klärung des epistemischen Status von ‚Q‘ als eines rein rationalen Gottesbegriffs vgl. ebd., S. 57-60. 3 Anselm von Canterbury, Proslogion, 2, in: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera omnia, 6 Bde., Seckau, Rom u. Edinburgh 1938-1961, Neudr. Stuttgart u. Bad Cannstatt 1968, Bd. 1, S. 101, Z. 4-5: „Et quidem credimus te esse aliquid quo nihil maius cogitari possit.“ 4 Vgl. Enders, Denken des Unübertrefflichen, a. a. O., S. 60. 5 Vgl. Jens Halfwassen, Sein als uneingeschränkte Fülle. Zur Vorgeschichte des ontologischen Gottesbeweises im antiken Platonismus, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 56 (2002) S. 497-516; hierzu vgl. auch Klaus Kremer, Die Neuplatonische Seinsphilosophie und ihre Wirkung auf Thomas von Aquin, Leiden 21969, S. 135. 6 Vgl. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolatione philosophiae, III, pr. 10, hg. v. Ludwig Bieler, Turnhout 1957 [CSSL XCIV], 53, 22-23: „nam cum nihil deo melius excogitari queat, id quo melius nihil est bonum esse quis dubitet?“ Zum ontologischen Gottesbegriff 103 schlechthin vollkommenen Seins in allerdings modifizierter Form, insofern er das vollkommene Sein des absoluten Geistes als der zweiten Hypostase im System des philosophischen Neuplatonismus mit dessen erster Hypostase, dem geist- und seinstranszendenten Einen als dem in sich relationslos Einfachen, in eine einzige Wirklichkeitsstufe zusammenfasst. Erst durch diese schon von Porphyrius vorgenommene und von Marius Viktorinus und von Augustinus verständlicherweise begeistert aufgenommene Zusammenführung der beiden ersten neuplatonischen Hypostasen – des geist- und seinstranszendenten und des seienden Einen – in dem ersten und einzigen Prinzip aller Wirklichkeit wurde es christlicherseits möglich, den platonisch-neuplatonischen Seinsbegriff in dieser modifizierten Gestalt auch auf den trinitarischen Gott des christlichen Glaubens zu beziehen. Denn dieser ist in sich zugleich dreifaltiger Geist, höchstes, vollkommenes Sein und in seinem Wesen differenzlos einfach. Erst in dieser christlich adaptierten Gestalt konnte der neuplatonische Seinsbegriff daher zu einer unmittelbaren Voraussetzung für Anselms ontologischen Gottesbegriff werden. 3 Die inhaltliche Normativität des ‚ontologischen Gottesbegriffs‘ – ‚Q‘ – 3.1 Der affirmativ-theologische Gehalt von ‚Q‘ Anselm ersetzt ab dem fünften Kapitel des Proslogion bei seiner Wiedergabe von ‚Q‘ den lateinischen Komparativ ‚maius‘ durch den lateinischen Komparativ ‚melius‘, versteht also ‚Q‘ zugleich als etwas, über das hinaus Besseres von einem geschaffenen Intellekt nicht gedacht werden kann.7 Daher bezeichnet ‚Q‘ die Gesamtheit der vollkommenen Eigenschaften, zu denen nicht nur die drei im Denken der alten Griechen entwickelten klassischen Gottesprädikate der – vollkommenen – Macht, Weisheit und Güte, sondern auch die der realen und nur als real denkbaren, das heißt der seinsnotwendigen Existenz gehören und die als Wesensbestimmungen in einem widerspruchsfreien Verhältnis zueinander stehen müssen. Diese Seinsvollkommenheiten werden in den Kapiteln 5 bis 23 des Proslogion aus ‚Q‘ insofern abgeleitet, als ‚Q‘ vorschreibt, seinem Bezugsgegenstand oder Referenzobjekt alle jene Bestimmungen zuzusprechen, deren Besitz ihren Träger im Sein vollkommener machen als ihr Nichtbesitz. Diese Seinsvollkommenheiten sind etwa: Gerechtigkeit 7 Vgl. Anselm von Canterbury, Proslogion, 104, 14-15. 104 Markus Enders und zugleich Barmherzigkeit,8 ferner Wahrhaftigkeit, Glückseligkeit,9 Allmacht, Leidensunfähigkeit und damit Körperlosigkeit,10 Lebendigkeit, ja das Leben selbst zu sein, ferner höchste Güte,11 Ewigkeit als zeitfreie Gegenwart und damit als Nichtübergänglichkeit,12 folglich auch Unbegrenztheit im Sinne von zeit- und ortloser Allgegenwart;13 höchste Schönheit,14 auch immanente Ungeteiltheit, also vollkommene Einfachheit des Wesens,15 universelle Immanenz und Transzendenz,16 vollkommene Unbedürftigkeit, mithin Selbstbestimmung,17 Identität von Existenz und Essenz18 und nicht zuletzt die Geistnatur und deren vollkommenes Wissen; denn es ist besser, Geist, und zwar allwissender Geist, zu sein, als keinen Geist zu besitzen.19 Anselm leitet also aus seinem ontologischen, mit der Seinsvollkommenheit argumentierenden Gottesbegriff sowohl die Geistnatur als auch die wesenhafte Einfachheit Gottes ab. Mit anderen Worten: Die vollkommene Einfachheit Gottes geht aus seiner Seinsvollkommenheit hervor und nicht umgekehrt – ein Gedanke, der die Differenz zwischen Anselms Fassung des ontologischen Gottesbegriffs und dessen Vorstufen in der Geist- und Seinsmetaphysik des antiken Platonismus und 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vgl. ebd., 9, 106, 15-110, 3. Vgl. ebd., 5, 104, 15-17. Vgl. ebd., 6, 104, 20-25. Vgl. ebd., 12, 110, 5-8; Anselm will hier vor allem zeigen, dass alle göttlichen Eigenschaften Wesensbestimmungen Gottes und damit keine Akzidentien sind. Vgl. ebd., 13, 110, 12-18, insb. 17-18; ebd., 19, 115, 6-15. Vgl. ebd., 13, 110, 12-15. Zur Geschichte der Gottesprädikate der Allgegenwart und Unendlichkeit in der lateinischen Patristik, bei Boethius und Johannes Scottus Eriugena bis einschließlich ihrer Erörterung in Anselms Proslogion sowie in seiner Kontroverse mit Gaunilo von Marmoutiers vgl. Markus Enders, Allgegenwart und Unendlichkeit Gottes in der lateinischen Patristik sowie im philosophischen und theologischen Denken des frühen Mittelalters, in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 3 (1998) S. 43-68. Vgl. Anselm von Canterbury, Proslogion, 17, 113, 6-15. Anselm leitet auch die immanente Teillosigkeit beziehungsweise Einfachheit des Wesens Gottes aus dessen unübertrefflicher Seinsvollkommenheit ab: vgl. ebd., 18, 113, 17-115, 4. In den Kapiteln 19 und 20 des Proslogion zeigt Anselm, dass alles Geschaffene in Gott gleichsam enthalten ist, das heißt von ihm erhalten wird – vgl. ebd., 19, 115, 6-15 – und dass er alle, auch die ohne Ende existierenden Entitäten – wie etwa die Engel – transzendiert: vgl. ebd., 20, 115, 17-116, 3. Vgl. ebd., 22, 117, 1-2. Die Identität von Dass- und Was-Sein Gottes schließt Anselm aus der wesenhaften Einfachheit und zeitfreien Gegenwart Gottes: vgl. ebd., 22, 116, 15. Vgl. ebd., 6, 104, 24-25. Zum ontologischen Gottesbegriff 105 spätantiken Neuplatonismus deutlich hervortreten lässt: Denn der absolute Geist ist in der platonischen, altakademischen und neuplatonischen Geistmetaphysik dem Einen als dem Ersten Prinzip aller Wirklichkeit deshalb untergeordnet, weil er einen geringeren, schwächeren Grad an Einheit besitzt, sofern er als die geeinte Vielheit des gesamten Ideenkosmos nicht vollkommen einfach, sondern All-Einheit ist.20 3.2 Der negativ-theologische Gehalt von ‚Q‘ Mit dieser Interpretation des bejahend-theologischen Gehalts von ‚Q‘ ist die inhaltliche Normativität des ontologischen Gottesbegriffs allerdings noch nicht hinreichend ausgewiesen. Denn von der negativen sprachlichen Formel – „etwas, über das hinaus Größeres nicht“ beziehungsweise „nichts Größeres gedacht werden kann“ – wird nicht nur Gottes vollkommenes Sein, sondern zugleich auch gleichsam negativ-theologisch Gottes Über-Sein, das heißt seine Transzendenz über alle von einem endlichen Intellekt intellektuell anschaubaren begrifflichen Gehalte, ausgesagt. Der Gott des christlichen Glaubens ist zwar das für jeden geschaffenen Intellekt denkbar Größte, mithin der Inbegriff aller von ihm widerspruchsfrei denkbaren Seinsvollkommenheiten – dies bezeichnet der affirmativ-theologische Begriffsgehalt von ‚Q‘; darüber hinaus aber muss er gerade als das für einen endlichen Intellekt denkbar Größte zugleich größer sein als von einem endlichen Intellekt überhaupt gedacht werden kann, eine Einsicht, die Anselm im 15. Kapitel des Proslogion entfaltet.21 Denn es liegt im natürlichen Vermögen des endlichen Intellekts, sich gleichsam fiktiv etwas als wirklich existierend auszudenken, dessen Seinsweise die Reichweite seiner intellektuellen Anschauung prinzipiell übersteigt, wie Anselm in seiner Kontroverse mit Gaunilo zeigt.22 Daher gilt im Umkehrschluss: Wäre Gott nicht etwas Größeres als von uns widerspruchsfrei gedacht – im Sinne von 20 Zur platonischen und zur altakademischen Geistmetaphysik vgl. vor allem Hans Joachim Krämer, Der Ursprung der Geistmetaphysik. Untersuchungen zur Geschichte des Platonismus zwischen Platon und Plotin, Amsterdam 21967; zu Plotins Begriff des absoluten Geistes vgl. auch Werner Beierwaltes, Das wahre Selbst. Studien zu Plotins Begriff des Geistes und des Einen, Frankfurt a. M. 2001, insb. S. 16-30; Jens Halfwassen, Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin, München 22006, S. 130149; Jens Halfwassen, Hegel und der spätantike Neuplatonismus. Untersuchungen zur Metaphysik des Einen und des Nous in Hegels spekulativer und geschichtlicher Deutung, Bonn 1999, S. 328-365. 21 Vgl. Anselm von Canterbury, Proslogion, 15, 112, 14-17. 22 Vgl. Anselm von Canterbury, Quid ad haec respondeat editor ipsius libelli, 4, in: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera omnia, a. a. O., Bd. 1, 134, 8-10. 106 Markus Enders intellektuell angeschaut – werden kann, dann wäre er nicht das für uns denkbar Größte. Zur inhaltlichen Normativität des ontologischen Gottesbegriffs gehört also nicht nur seine begrifflich affirmative Bestimmtheit als die Summe aller denkbaren Seinsvollkommenheiten, sondern auch seine begrifflich negative Bestimmtheit als das unser Erkenntnisvermögen schlechthin übertreffende Sein, welches in seiner unendlichen Vollkommenheit erhaben ist über jede mögliche Steigerungsreihe begrifflicher Wertsetzungen des endlichen Intellekts, wie man ebenfalls Anselms Kontroverse mit Gaunilo entnehmen kann.23 Die negative Formulierung ‚maius nihil‘ beziehungsweise ‚maius non cogitari potest‘ aber ist geeignet, Gottes Erhabenheit über jeden möglichen Begriff eines endlich-geschaffenen Intellekts mitauszusagen. Der angemessenste reine Vernunftbegriff von Gott muss daher sowohl einen affirmativ-theologischen als auch einen negativ-theologischen Gehalt besitzen, wobei dieser negativ-theologische Gehalt genau genommen ein Implikat des affirmativ-theologischen Gehalts von ‚Q‘ ist.24 In dieser doppelten Gestalt als affirmativ-theologischer und zugleich auch als negativ-theologischer Gottesbegriff bringt daher der ontologische Gottesbegriff das prinzipielle Paradox des Gottdenkens der abendländischen Metaphysik – und weitgehend auch der christlichen Theologiegeschichte am reinsten zum Ausdruck: Gott als das denkbar Beste und zugleich als größer als alles von einem endlichen Intellekt Denkbare im Sinne von intellektuell Anschaubare annehmen zu müssen. 4 Die formale Normativität des ontologischen Gottesbegriffs : ‚Q‘ als eine Denkregel der Unübertrefflichkeit ‚Q‘ besitzt, wie bereits Karl Barth erkannt hat, 25 den Charakter einer negativen Denkregel, genauer einer Denkregel der Un- oder Nichtübertrefflichkeit, die negativ vorschreibt, wie über Gott nicht gedacht werden darf, wenn man ihn rational angemessen denken will. Man darf sich gemäß dieser Regel Gott nicht als etwas vorstellen, das in seinem Seinsgehalt noch von etwas anderem übertroffen werden 23 Vgl. ebd., 5, 135; 8-136, 2. 24 Diesen Hinweis verdanke ich meinem geschätzten Kollegen, Herrn Prof. Dr. Bernd Goebel, Ordinarius für Systematische Philosophie und Geschichte der Philosophie an der Theologischen Fakultät Fulda. 25 Vgl. Karl Barth, Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms, Zürich 31958, S. 73, S. 78. Zum ontologischen Gottesbegriff 107 könnte; dies aber bedeutet, affirmativ gewendet: Wenn sich ein endlicher Intellekt mit seinem Vernunftvermögen Gott angemessen denken will, dann muss sein Gottesbegriff die Form eines absoluten Superlativs besitzen, dann muss er sich Gott als das unübertrefflich Beste vorstellen. Wer also Gott nicht bereits rein formal als das schlechthin Unübertreffliche begreift, der denkt sicher nicht Gott, sondern etwas anderes, dessen Gottesgedanke ist schon formal und damit auch inhaltlich falsch. Auch diese formale Normativität26 des ‚ontologischen Gottesbegriffs‘, die nur einen präskriptiven Gebrauch zulässt,27 hat eine sie einschränkende Bedingung. Diese kann zwar nicht mit mathematischer Präzision bewiesen, wohl aber sowohl mit Blick auf die faktische Religionsgeschichte der Menschheit als auch auf die innere Finalität der endlichen Vernunft höchst wahrscheinlich gemacht werden: nämlich die Annahme, dass der Gottesbegriff Inbegriff des schlechthin Unübertrefflichen ist und damit einen singulären epistemischen Status besitzt und folglich nur ein einziges Referenzobjekt besitzen kann; mit anderen Worten: Weil absolute Unübertrefflichkeit nur ein einziges Mal verwirklicht sein kann, wenn sie überhaupt verwirklicht ist, muss Gott als Inbegriff dieser Unübertrefflichkeit einer, mithin einzig sein. Philosophisch legitimierbar ist daher nur ein monotheistischer Gottesbegriff. In dieser formalen Normativität aber liegt ein weiterer Vorzug des ontologischen Gottesbegriffs gegenüber allen anderen Gottesbegriffen der klassischen Metaphysik, denen in ihrer expliziten Gestalt diese formale Normativität fehlt, da sie den formalen Charakter von Gegenstandsbestimmungen besitzen. Im Unterschied zu diesen macht der ontologische Gottesbegriff Gott zu einer in Relation zum prinzipiellen Denkvermögen der endlichen Vernunft bestimmten Größe und hat damit sowohl einen ontologischen als auch einen gleichsam noologischen Charakter. 26 Der Normbegriff wird hier nicht in seiner rechtswissenschaftlichen, sondern in seiner philosophischen Bedeutung eines Begriffs für ein bestimmtes, objektiviertes Maß genommen; zu diesem Normbegriff vgl. Hermann Krings, Art. Norm I. Philosophie der Norm, in: Staatslexikon, 5 Bde., Freiburg i. Br. 71988, Bd. 3, S. 62. 27 Zu dieser Möglichkeit eines präskriptiven Gebrauchs eines Normbegriffs vgl. ebd., S. 63. 108 Markus Enders 5 Die systematische Bedeutung des ‚ontologischen Gottesbegriffs‘ 5.1 Eine Präzisierung des affirmativ-theologischen Gehalts des ‚ontologischen Gottesbegriffs‘ durch Johannes Duns Scotus: Die schlechthinnige Unübertrefflichkeit Gottes als seine aktuell unendliche Vollkommenheit Um die systematische Bedeutung des ontologischen Gottesbegriffs hinreichend verdeutlichen zu können, bedarf es einer Präzisierung seines affirmativ-theologischen Gehalts, die dieser philosophiehistorisch gesehen durch seine Verbindung mit dem Unendlichkeitsbegriff bei Johannes Duns Scotus erfahren hat. Dieser hat den affirmativ-theologischen Gehalt des anselmischen Gottesbegriffs der schlechthinnigen Unübertrefflichkeit als intensive Unendlichkeit beziehungsweise genauer als aktuell unendliche Vollkommenheit präzisiert. Scotus weist zunächst die Widerspruchsfreiheit zwischen den Begriffen ‚seiend‘ und ‚unendlich‘ nach, um die Möglichkeit eines unendlich Seienden zu sichern.28 Dann zeigt er in einem zweiten Schritt, dass in der Ordnung des Vorrangs nur ein solches Seiendes unübertrefflich sein kann, welches unendlich ist.29 Denn eine Unendlichkeit in der Vollkommenheit, die zugleich besteht – in perfectione simul essendo30 – , widerspricht nicht der Seiendheit und ist daher möglich. Mit diesem Begriff eines aktuell unendlich vollkommenen Seienden interpretiert Scotus Anselms ‚ontologischen Gottesbegriff‘ ‚Q‘, den er als das höchste – widerspruchsfrei – Denkbare – summum cogitabile sine contradictione31 – versteht und aus dessen realer Möglichkeit er auf dessen notwendigerweise reale Existenz schließen zu können glaubt, weil das ‚summum cogitabile‘ als ein bloßes ‚ens rationis‘ eine von einem anderen, dem endlichen Intellekt, abhängige Größe und somit nicht unendlich, mithin nicht es selbst wäre.32 28 Vgl. Johannes Duns Scotus, Ordinatio, I nn. 74-147, ed. Vat II. 29 Vgl. ebd., I d. 2 p 1’Q’ 1-2 n 131, 132, 134 ed. Vat. II 206 ff.; ebd. I d. 3. p 1’Q’ 1-2 nn. 38-40, ed. Vat III. 25 ff.; Lectiones, I d. 2 p 1’Q’1-2 n. 83, 84, ed. Vat XVI 141 f.; De primo principio, C 4 concl. 9 n. 78, hg. v. Wolfgang Kluxen, 102. 30 Vgl. Duns Scotus, Ordinatio, I n. 134, ed. Vat. II 208; Lectiones, n. 85, ed. Vat. XVI 142; De primo principio, C 4 concl. 9 n. 78, Ed. Kluxen, 104. 31 Duns Scotus, Ordinatio, I n. 137, ed. Vat. II 208 f.: „Deus est quo cognito sine contradictione maius cogitari non potest sine contradictione.“ 32 Ebd., I n. 138, ed. Vat II 209: „Non est autem hoc sic intelligendum quod idem si cogitetur, per hoc sit maius cogitabile existat, sed, omni quod est in intellctu tantum, est maius aliquod quod exsistit.“ Zum ontologischen Gottesbegriff 109 Dadurch gelangt Scotus zu der Einsicht, dass die intensive Unendlichkeit das Wesen Gottes konstituiert und damit dessen Attribute und Eigenschaften wie die der notwendigen Existenz, der Einfachheit und der Einzigkeit zwar nicht formaliter, aber in ihrem Vollkommenheitsgrad bestimmt. Denn die intensive Unendlichkeit beziehungsweise unendliche Vollkommenheit stellt nach Scotus kein einzelnes Gottesattribut, keinen Formalinhalt in Gott dar, sondern sie ist selbst nichts anderes als der höchste Vollkommenheitsgrad aller Wesensattribute Gottes.33 Als solche aber bedingt sie die reale Identität aller göttlichen Wesensbestimmungen – ohne diese in ihrem je eigenen formalen Was aufzuheben – und damit auch die Einfachheit des göttlichen Wesens. 5.2 Die systematische Bedeutung des ontologischen Gottesbegriffs : Gott als Inbegriff absoluter Unübertrefflichkeit Zusammenfassend betrachtet, ist es die Verbindung zweier Vorzüge, die den mit Duns Scotus als aktuell unendliche Seinsvollkommenheit präzisierten ‚ontologischen Gottesbegriff‘ Anselms gegenüber allen anderen Gottesbegriffen der endlichen Vernunft zumindest im Bereich des abendländischen Denkens auszeichnet: Zum einen seine inhaltliche Normativität, die in seinem affirmativ-theologischen und zugleich in seinem negativ-theologischen Gehalt begründet liegt; mithin darin, dass er mit einer einzigen sprachlichen Formel – ‚Q‘ – sowohl die allumfassende Seinsvollkommenheit als auch die Transzendenz Gottes – seine Erhabenheit über das intellektuelle Anschauungsvermögen der endlichen Vernunft – auszusagen vermag. Zum zweiten – und dieser Vorzug ist meines Erachtens der für die geistige Situation unserer Zeit entscheidende – seine formale Normativität. Denn der ‚ontologische Gottesbegriff‘ ist so geartet, dass er selbst dann, wenn man seine inhaltliche Bestimmung ablehnt, dennoch seiner Form zustimmen muss, sofern man ihm überhaupt eine referentielle Funktion zusprechen, das heißt als einen vernunftgemäßen Gottesbegriff verstanden wissen will. Diese formale Normativität von ‚Q‘ aber setzt ein grundsätzliches Verständnis der Bedeutung des Gottesbegriffs als eines Begriffs mit dem qualitativ bestmöglichen Gehalt und damit eine wertende Hierarchisierung begrifflicher Gehalte voraus. Wer sich jedoch Gott nicht einmal formal als den höchsten Gedanken seines eigenen Vernunftvermögens, als das vernünftigerweise denkbar Beste, vorstellen will, sondern als etwas anderes, suspendiert den Vernunftcharakter des Gottesgedankens. Mit anderen 33 Vgl. ebd., I, d 8, p 1‘Q’ 4 n. 192, ed. Vat. IV 261, 6-13. 110 Markus Enders Worten: Wer in Gott überhaupt etwas Reales und nicht etwa eine Projektion des eigenen Bewusstseins sehen will, weiß sich durch sein Vernunftvermögen dazu verpflichtet, sich unter Gott das denkbar Höchste und Größte vorstellen zu sollen. Damit aber dürfte alleine im Falle von ‚Q‘ als des schlechthin Unübertrefflichen eine Verbindung von inhaltlicher und formaler Normativität des Gottesbegriffs gegeben sein. Denn selbst ein Philosoph, der das prädikative und axiologische Existenzverständnis der klassischen Metaphysik, welches den begrifflichen Gehalt auch des ‚unum argumentum‘ Anselms bestimmt, de facto ablehnt und dennoch Gott rational denken will, wird von seiner Vernunft dazu verpflichtet, der bloßen Form des ontologischen Gottesbegriffs zuzustimmen, das heißt sich unter Gott zumindest formal das denkbar Größte und Beste vorzustellen, auch wenn dieser der inhaltlichen Normativität des ontologischen Gottesbegriffs nicht zustimmen zu können glaubt. In dieser seiner Verbindung von inhaltlicher und formaler Normativität aber liegt der Vorrang des ‚ontologischen Gottesbegriffs‘ gegenüber allen anderen Gottesbegriffen der abendländischen Philosophiegeschichte, die den Charakter von Gegenstandsbestimmungen besitzen, sowie seine besondere Aktualität gerade für die geistige Situation unserer Gegenwart, die nicht zuletzt auf Grund eines prinzipiell anderen Seins- und Existenzverständnisses den von ‚Q‘ verwahrten inhaltlich normativen Seinsbegriff nicht mehr akzeptieren zu können glaubt. Deshalb ist Gott auch für jene postmodernen Denker, die das klassische Verständnis von – unendlicher – Seinsvollkommenheit ablehnen, das für sie Höchste und Größte, was anschließend noch ausgeführt werden soll. Gemäß dieser formalen Normativität des ‚ontologischen Gottesbegriffs‘ ist daher der folgende Umkehrschluss gültig: Wer sich Gott als etwas denkt, welches gemäß seinem eigenen Urteil noch von etwas anderem übertroffen werden könnte, hat sicher kein vernunftgemäßes und daher auch kein angemessenes Gottesverständnis, weil er den singulären epistemischen Status des Gottesbegriffs als eines Inbegriffs absoluter, also in jeder möglichen Hinsicht bestehender, Unübertrefflichkeit nicht realisiert hat. Abschließend sei die eminente systematische Bedeutung des ‚ontologischen Gottesbegriffs‘ als des angemessensten Gottesbegriffs der endlichen Vernunft auf folgende Kurzformel gebracht: Gott muss, wenn es ihn gibt, schlechthin unübertrefflich sein.34 34 Zum Verhältnis zwischen dem ontologischen Gottesbegriff und dem mit seinem intensionalen Gehalt argumentierenden ontologischen Gottesbeweis in systematischer und historischer Hinsicht vgl. Markus Enders, Ontologischer Gottesbegriff und ontologischer Gottesbeweis. Der Vernunft-Charakter des ontologischen Gottes-Begriffs und dessen Entfaltung im ontologischen Gottesbeweis, in: Gottesbeweise als Herausforderung für Zum ontologischen Gottesbegriff 6 111 Die impliziten und indirekten Spiegelungen des ontologischen Gottesbegriffs im zeitgenössischen Denken: bei Emmanuel Levinas, Jacques Derrida und Jean-Luc Marion Die Spiegelungen des ontologischen Gottesbegriffs im zeitgenössischen Denken sollen im Folgenden an drei exemplarischen Positionen identifiziert werden, die prima facie gerade nicht zur Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte des ontologischen Gottesbegriffs gehören, sondern diesen zumindest implizit oder sogar – wie bei Marion – explizit als unangemessen ablehnen. Levinas sieht bekanntlich die göttliche Transzendenz jenseits des Seins und anders als Sein geschieht, er will Gott von seiner angeblichen begrifflichen Vereinnahmung und Verfälschung durch die klassische Metaphysik und Ontologie befreien und die ethische als die nach seiner Überzeugung Gott einzig angemessene Transzendenz sichtbar machen. Wie kann man dann entgegen Levinas‘ eigener Intention von einer Wirkungsgeschichte des ontologischen Gottesbegriffs bei ihm sprechen? Verstößt nicht ein solches Ansinnen massiv gegen das hermeneutische Grundgebot der Rekonstruktion des Selbstverständnisses eines Autors? Nicht anders verhält es sich bei Derrida, der die von Martin Heidegger inspirierte Metaphysikkritik von Levinas, dessen Totalitarismusvorwurf gegen das metaphysische Denken teilt; etwas weniger radikal fällt diese metaphysikkritische Einstellung bei Marion aus. Aber auch dieser teilt das metaphysikkritische Grundanliegen von Levinas und will Gott deshalb gerade nicht in ontologischen Begriffen, sondern ohne den begrifflichen Vorstellungshorizont des Seins denken. Entsprechendes gilt in wiederum modifizierter Form für Michel Henry auf den hier allerdings nicht mehr eingegangen werden kann. Beginnen wir mit Levinas. 6.1 Zur impliziten Normativität des ontologischen Gottesbegriffs für das Denken der – göttlichen – Transzendenz bei Levinas Mit dem Gottesgedanken hat sich Levinas, soweit ich sehen kann, thematisch zentral nicht in seinen Hauptwerken, sondern in einer erstmals 1975 in der Zeitschrift Nouveau Commerce erschienenen Abhandlung Dieu et la philosophie auseinan­ die moderne Vernunft, hg. v. Thomas Buchheim, Friedrich Hermanni, Axel Hutter u. Christoph Schwöbel, Tübingen 2012, S. 241-287. 112 Markus Enders dergesetzt.35 In dieser Abhandlung hat Levinas auf die strikte Korrespondenz zwischen dem philosophischen Denken in der klassisch-metaphysischen Tradition der abendländischen Philosophie und der Idee der Wirklichkeit hingewiesen, diese sogar als eine Koinzidenz überzeichnet und selbige als „Seinssage“ – „geste d’être“ – beziehungsweise als Zugehörigkeit zu dieser bezeichnet, so dass das Sein selbst als intelligibel erscheint.36 Sinnhaftes Denken und Denken des Seins sind nach dieser Auffassung Tautologien. Nach Levinas befindet sich daher der gedachte Gott stets innerhalb der „Seinssage“, und zwar als Seiendes schlechthin, wie er wörtlich behauptet.37 Damit dürfte Levinas sich Heideggers unzutreffende These von der onto-theologischen Grundverfassung des metaphysischen Denkens im Abendland zu eigen machen, nach der Gott sowohl von der philosophischen als auch von der christlich-theologischen Gotteslehre nicht als Sein, sondern als – höchstes – Seiendes missverstanden worden sei. Auf alle bedeutenden Vertreter einer systematischen Gotteslehre im abendländischen Denken trifft diese Behauptung aber gerade nicht zu und am wenigsten – trotz seines irreführenden Namens – auf den ontologischen Gottesbegriff selbst, der Gott nicht als ein in einer ontologischen Differenz zum Sein stehendes Seiendes, sondern als das unübertreffliche Sein selbst versteht. Für Levinas ist aber genau dieses metaphysisch-philosophische und christlich-theologische Gottesverständnis unangemessen, weil es Gott „in den Lauf des Seins mithineinnimmt“38, während der Gott der Bibel als der für Levinas einzig wahre Gott „das Jenseits des Seins, die Transzendenz“39 bedeutet. Deshalb bezichtigt er die gesamte abendländische Philosophie einer „Destruktion der Transzendenz“40. Levinas wirft einem Gottesverständnis im Horizont und im Lichte des Seins zu Unrecht eine bloße Bewusstseinsimmanenz41 und eine pervertierende Vergegenwärtigung des Gesagten vor, so als könne der ontologische Gottesbegriff nicht auf eine echte Transzendenz Gottes zu unserem menschlichen beziehungsweise zu jedem 35 Emmanuel Levinas, Dieu et la philosophie, in: Nouveau Commerce 30/31 (1975) S. 99128; zitiert wird diese Abhandlung im Folgenden nach Emmanuel Levinas, Gott und die Philosophie, in: Gott nennen. Phänomenologische Zugänge, hg. v. Bernhard Casper, Freiburg i. Br. u. München 1981, S. 81-123; einfache Seitenangaben beziehen sich im Folgenden auf diese Textausgabe. 36 Vgl. ebd., S. 82 f. 37 Vgl. ebd., S. 83: „Sobald aber dieser Gott gedacht wird, befindet er sich sogleich innerhalb der ,Seinssage‘. Er befindet sich darin als Seiendes schlechthin.“ Hervorhebung im Original. 38Ebd. 39Ebd. 40Ebd. 41 Vgl. ebd., S. 92: „Die Philosophie ist nicht nur Erkenntnis der Immanenz, sie ist die Immanenz selbst.“ Zum ontologischen Gottesbegriff 113 endlichen Anschauungsvermögen verweisen, so als ob er keine negativ-theologische Bedeutungsdimension besäße. Es geht Levinas ausdrücklich um einen – göttlichen – Sinngehalt jenseits des Seins, dem „eine Priorität vor dem Sein zukommt.“42 Er will aber nicht so weit gehen,43 den Gottesbegriff jedes begrifflichen Charakters und jeder vernünftigen Rede zu entkleiden, wie er ausdrücklich sagt;44 er bekämpft vielmehr nur den vergegenwärtigenden, identifizierenden Charakter des Gottesverständnisses im Horizont des Seins, welches er als Manifestation und die bewusstseinsmäßig abgebildete Wahrheit des Seins dementsprechend als „die Manifestation der Manifestation“45 bezeichnet. Auch den ontologischen Gottesbegriff eines uneingeschränkt beziehungsweise unendlich vollkommenen Seins einschließlich des zugehörigen ontologischen Gottesbeweises bei Descartes subsumiert Levinas konsequent unter sein Verdikt.46 René Descartes‘ Gottesidee des Unendlichen jedoch, die jede Idee des menschlichen Bewusstseins an Bedeutungsumfang und -fülle unendlich übersteige und daher dieses absolut transzendiere,47 nimmt er von seinem Verdikt aus. Denn diese führe zum „Bruch des Bewußtseins“48, weil sie Gott in uns sei, „aber bereits Gott, sofern er das auf Ideen abzielende Bewußtsein bricht und sich von jedem Inhalt unterscheidet.“49 Denn die Idee des Unendlichen sei in Wahrheit das Unendliche in mir,50 welches nicht vom endlichen Bewusstsein hervorgebracht sein, sondern nur dessen vollkommene Passivität – eine Passivität, die passiver sei als jede Passivität51 – bedeuten könne.52 Dabei bezeichne das ‚Un‘ oder die Negation im Begriff des ‚Unendlichen‘ die unermessliche Tiefe des Erleidens oder der Affektion des Unendlichen im Endlichen, die in diesem eine endlose Sehnsucht und Liebe erzeuge nach dem Guten jenseits des Seins.53 Damit jedoch diese Sehnsucht oder Liebe über das Sein hinaus gerichtet beziehungsweise transzendent bleibe und nicht wieder zu einem Aufgehen in der 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Ebd., S. 85. Hervorhebung im Original. Wie Frau Delhomme, auf die Levinas in dieser Hinsicht Bezug nimmt; vgl. ebd., S. 84. Vgl. ebd., S. 84 f. Ebd., S. 86. Vgl. ebd., S. 95. Vgl. ebd., S. 96. Ebd., S. 95. Ebd., S. 96. Vgl. ebd., S. 97. Vgl. ebd., S. 98. Vgl. ebd., S. 97. Vgl. ebd., S. 102 f. 114 Markus Enders Immanenz werde, müsse Gott als das Ersehnenswerte von der Sehnsucht getrennt bleiben, müsse er zwar nahe, aber unterschieden und damit heilig sein.54 Dies wiederum aber sei nur dann gegeben, wenn Gott als das Ersehnenswerte „mich auf das ausrichtet, was das Nicht-Ersehnenswerte … schlechthin“55 ist, auf die bis zur Stellvertretung, zur Leibbürgenschaft und Geiselhaft gehende Verantwortlichkeit für den Anderen. Diese „Weise des Unendlichen oder Gottes, uns aus der Tiefe seines Ersehnt-seins in die nicht ersehnenswerte Nähe des Andern zu verweisen, haben wir mit dem Terminus ‚Illeität‘ – illéité – bezeichnet.“56 Die Güte des Guten verweise uns auf den Anderen und so einzig auf das Gute hin. Gott trenne sich von der Beziehung der Sehnsucht und bleibe „durch diese Trennung oder Heiligkeit dritte Person: Er auf dem Grund des Du.“57 Gott erfülle mich nicht mit Gütern, „sondern dränge mich zur Güte, die besser ist als alle Güter, die wir erhalten können.“58 Darin sieht Levinas die strikt ethische Bedeutung der Transzendenz gegeben, die er allerdings zu Unrecht als seinslos auffasst, weil er ein extrem negatives Vorurteil gegen das Sein hegt: „Im Bereich des Seins bedeutet gutsein Defizit, Niedergang und Dummheit.“59 In Wahrheit ist jedoch das genaue Gegenteil der Fall: Sittliche Güte als freiwilliger Selbsteinsatz für das Wohlergehen des Anderen ist gerade eine Seinsvollkommenheit, ein Erweis von Seinsfülle und Seinsmacht. Doch Levinas will die Ethik vom Sein ausschließen60 und als eine „Vortrefflichkeit und Höhe … jenseits des Seins“61 verstehen, weil er ein von der Metaphysikkritik Heideggers negativ vorgeprägtes Zerrbild des Seins besitzt. Daher glaubt er, Gott „der Objektivität, der Gegenwart und dem Sein“62 entreißen zu müssen. Daher insistiert er darauf, dass die Transzendenz Gottes „in der Begrifflichkeit des Seins, dem Element, hinter dem die Philosophie nur Nacht sieht, weder gesagt noch gedacht werden“63 könne, dass „die Intelligibilität der Transzendenz … nicht ontologisch“64 sei. Die wahre 54 Vgl. ebd., S. 105. 55Ebd. 56 Ebd., S. 106. 57 Ebd., S. 107. Hervorhebung im Original. 58Ebd. 59Ebd. 60 Vgl. ebd.: „Die Ethik ist kein Moment des Seins.“ 61Ebd. 62Ebd. 63 Vgl. ebd., S. 121. 64Ebd. Zum ontologischen Gottesbegriff 115 Transzendenz des Unendlichen erhebe sich in Herrlichkeit in der desinteressierten und daher völlig selbstlosen Stellvertretung für den Nächsten.65 Die Andersheit des göttlich Anderen unterscheide sich grundlegend von der jedes menschlich Anderen, der sie vorausliege, indem ihr eine uneinholbare Transzendenz bis hinein in die Abwesenheit eigne, bis in ihre Verborgenheit und Entzogenheit also, die Ausweis ihrer unermesslichen Majestät und Heiligkeit sei. Diese ist es daher, die Levinas‘ negative Theologie ins völlig Inkommensurable steigern, die sie als schlechthin unübertrefflich aufweisen will. Darin aber können wir die Wirksamkeit der formalen Normativität des ontologischen Gottesbegriffs auch in dieser extremen Form einer negativen Theologie bei Levinas erkennen. Levinas meint zwar zu Unrecht, dass „die Transzendenz Gottes in der Begrifflichkeit des Seins … weder gesagt noch gedacht werden“66 könne; de facto denkt er selbst aber diese Transzendenz als eine unübertreffliche Bedeutsamkeit, die er in ihrem ethischen Bedeuten, ihrer gebieterischen Einweisung des ihr gegenüber zu blindem Gehorsam bereiten Subjekts in das „Der-Eine-für-den-Anderen-Sein“67 verwirklicht sieht, weil er das ethisch Gute jenseits des Seins und ,anders als Sein geschieht‘ als Inbegriff des Unübertrefflichen versteht. So ist auch für Levinas Gott in genau dieser und nur dieser rein ethischen, ontologiefreien, seinslosen Bedeutung der schlechthin Unübertreffliche. 6.2 Zur impliziten Normativität des ontologischen Gottesbegriffs für das Gottesverständnis Derridas Im Folgenden sollen nur jene Textpassagen aus Werken Derridas untersucht werden, die für dessen Gottesverständnis von zentraler Bedeutung sind. 65 Vgl. ebd., S. 108. 66 Ebd., S. 123. 67 Ebd., S. 120. 116 Markus Enders 6.2.1 Das Post-Scriptum Außer dem Namen zum Sammelband Über den Namen: Der Name Gottes und das unnennbare Jenseits dieses Namens – Derridas Gott absoluter Alterität und seine Differenz zum (seins-) vollkommenen Gott der abendländischen Philosophie und christlichen Theologie Da Derrida mit Levinas den seins- und identitätszentrierten Logos und folglich auch jeden Begriff Gottes ablehnt, weil der das Seiende identifizierende Logos in letzter Konsequenz zur Vernichtung des Anderen führe,68 hält er – mit Levinas – doch an einem fest, das bleibe, und zwar an dem Namen und daher in Bezug auf Gott an nichts anderem außer dem Namen Gottes. Daher muss Derrida mit Levinas dem Namen Gottes jegliche Referenz auf Seiendes beziehungsweise ein Sein absprechen. Was sagt für Derrida der Name Gottes? Der Name Gottes nenne nichts, was bleibe;69 vielmehr sei ‚Gott‘ „der Name für diesen bodenlosen Zusammenbruch – effondrement sans fond – , für diese unendliche Verwüstung – désertification – der Sprache“.70 Derrida spricht dem Gottesnamen demnach eine Zeigefunktion auf das – bleibende – Wesen Gottes ab. Insoweit besteht zwischen seinem Verständnis des Gottesnamens und demjenigen, sei es des Christentums, sei es von monotheistischen Religionen allgemein, eine erhebliche, eine unüberbrückbare Differenz. 68 Vgl. Karlheinz Ruhstorfer, Adieu. Derridas Gott und der Anfang des Denkens, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 51 (2004) S. 123-158, hier S. 126 – unmittelbar in Bezug auf Levinas formuliert, aber gleichermaßen auch für Derrida gültig – : „Welches ist nun die ursprüngliche Erfahrung von Levinas? Es ist genau jene Negation der Negation, die Vernichtung des Anderen – im Holocaust. Diese wird nicht nur mit der Aufhebung Hegels gleichgesetzt, sondern letztlich auf die parmenideische Scheidung von Sein und Nichtsein und damit auf den griechischen Anfang des metaphysischen Denkens zurückgeführt. Die Identität des Seienden mit sich selbst und der Ausschluß des Anderen wird hier als der Ausgangspunkt des abendländischen Denkens schlechthin angesehen, das in letzter Konsequenz zum Holocaust, zur Vernichtung des Anderen, des zum Abendländisch-Griechisch-Christlichen Fremden, führe.“ 69 Vgl. Jacques Derrida, Außer dem Namen (Post-Scriptum), in: Jacques Derrida, Über den Namen. Drei Essays, hg. v. Peter Engelmann, Wien 2000, S. 63-121, hier S. 85 f. [56]; einfache Seitenzahlen beziehen sich in diesem Kapitel auf diese Ausgabe; Seitenzahlen in eckigen Klammern verweisen auf das französischsprachige Original Jacques Derrida, Sauf le nom (Post-Scriptum), Paris 1993: „Außer dem Namen, der nichts nennt, was hielte, nicht einmal eine Gottheit*, nichts, dessen Entzug nicht den Satz, jeden Satz, der sich mit ihm zu messen versucht, fortreißt.“ 70 Ebd., S. 86 [56]. Zum ontologischen Gottesbegriff 117 Nun gibt es nach Derrida von dieser ‚negativen Operation‘ – des Zusammenbruchs der Sprache – aber eine Spur, die als ein stets kommendes Ereignis bleibe.71 Dieses Ereignis aber bleibe der Sprache eingeschrieben, es bleibe gleichsam auf den Lippen des Sprechenden, dessen Worte, nicht nur zu Gott, sondern von Gott zu ihm hin getragen werden würden. Es fällt auf, dass Derrida in diesem Zusammenhang einen Subjektwechsel beschreibt, der jenem analog ist, der von Erfahrungsberichten der apophatischen Mystik durchgängig beschrieben wird: Indem die Worte des menschlichen Sprechers von Gott sprechen, ihn nennen, lassen sie ihn zugleich in sich sprechen, lassen sie sich von ihm tragen und beziehen auf das unnennbare Nennbare jenseits des Gottesnamens.72 Denn es sei notwendig, auf das Jenseits des Namens zu gehen im Namen, auf das, was bleibe außer dem Namen.73 Dieses aber ist für Derrida ein absolutes Geheimnis, welches als ein Gott absoluter Alterität nicht nur ein Nicht-Gott – A-dieu – ,74 sondern in seiner schlechthinnigen Andersartigkeit zugleich auch kein Gott ist, der sich jemals offenbaren, sich zeigen, der sich dem Menschen enthüllen könnte. Der gravierendste Preis von Derridas prinzipiellem Differenz- und Alteritätsdenken wird erst in dessen Anwendung 71 Vgl. ebd., S. 86 [56]: „Doch die Spur dieser negativen Operation schreibt sich im und auf dem und als Ereignis ein (das, was kommt, was es gibt und was stets einzigartig ist, was in dieser Kenosis die entscheidende Bedingung für sein Kommen oder sein Heraufkommen findet). Es gibt – il y a – dieses Ereignis, das bleibt, wenn diese Bleibendheit – restance – auch nicht substantieller, wesentlicher ist als dieser Gott, ontologisch nicht besser bestimmbar als dieser Name Gottes … .“ Hervorhebungen im Original. 72 Vgl. ebd., S. 88 [61]: „Sie – sc. die Worte des über Gott Sprechenden – werden durch eine ‚Ferenz‘-Bewegung – Transfer, Referenz, Differenz – zu Gott getragen – portés – , zugleich hinausgetragen – exportés – und weggetragen – déportés – . Sie nennen Gott, sprechen von ihm, sprechen ihn, sprechen mit ihm, lassen ihn in sich sprechen, sie lassen sich von ihm tragen, sie referieren – machen sich zu einer Referenz – auf das, was der Name über sich selbst hinaus zu nennen voraussetzt, das Nennbare – nommable – jenseits des Namens – nom – , das unnennbare Nennbare.“ Hervorhebungen im Original. 73 Vgl. ebd., S. 89 [63]: „Auf Französisch würde ich sagen: il y a lieu de, es besteht Anlaß, (denn dies bedeutet „il faut“, „es ist notwendig/man muß“), sich dorthin zu begeben, wohin man unmöglich gehen kann. Dorthin, auf den Namen zu, auf das Jenseits des Namens im Namen zu. Auf das (den oder die) zu, was (der oder die) bleibt – außer dem Namen.“ Hervorhebungen im Original. Hierzu vgl. Ruhstorfer, Adieu, a. a. O., S. 133: „Lediglich dort, wo der logos durch den ,Namen‘ ersetzt wird, wo nichts an logischer Bestimmtheit bleibt – außer dem Namen – kann nach Derrida das Denken dem Namen Gottes gerecht werden.“ Hervorhebung im Original. 74 Vgl. ebd., S. 127: „Der griechische Gott der Identität, der stets als Grund, als Wesen, als Sein, als Identität gedacht worden ist, soll durch einen Gott der Alterität substituiert werden.“ Vgl. ebd., S. 131: „Verabschiedung des bisherigen Gottes, Bewegung auf einen Gott zu, der Nicht-Gott (a-dieu) ist.“ 118 Markus Enders auf das absolute Geheimnis, das wir Gott nennen, sichtbar: Es ist sein A-dieu, das heißt seine Verabschiedung von dem Gott der abendländischen Philosophie und der christlichen Theologie; an dessen Stelle tritt bei Derrida der sprachlich und gedanklich widersprüchlich bleibende Hinweis auf ein schlechthin anderes Geheimnis, auf einen Nicht-Gott, A-dieu, der mit dem vollkommenen Sein auch der Möglichkeit beraubt wird, sich dem Menschen jemals zeigen zu können. 6.2.2 Gott als der ganz Andere und als jeder andere – die bleibende Zweideutigkeit der Alterität Gottes 6.2.2.1 Die beiden Deutungsmöglichkeiten der Formel ‚tout autre est tout autre‘ Derridas eigenes Gottesverständnis geht vollends erst aus einigen Passagen seiner Schrift Den Tod geben hervor, die abschließend noch kurz betrachtet werden sollen: Im dritten Abschnitt dieser die Opferung Isaaks durch Abraham – die sogenannte Akedah – in das Zentrum ihrer Betrachtung rückenden Schrift führt Derrida aus, dass Gott der Name für den absolut Anderen sei.75 Diesem Anderen gegenüber sei der Einzelne verpflichtet und verantwortlich. Zugleich aber sei „[j]eder andere … jeder andere“ beziehungsweis „ganz anders – Tout autre est tout autre – “.76 Daher müsse eine allgemeine und universelle Verantwortung den Einzelnen an alle anderen binden. Entscheidend und weiterführend in Bezug auf Derridas Gottesgedanken ist in dieser Schrift sein Verständnis Gottes als eines Namens für den ganz Anderen: „Wenn Gott der ganz andere ist, die Figur oder der Name des ganz anderen, so ist jeder andere ganz anders/ist jeder andere jeder andere – tout autre est tout autre –“.77 Diese Formel ist nur scheinbar tautologisch beziehungsweise nichtssagend, in Wahrheit jedoch höchst aussagekräftig. Denn sie will sagen, „dass Gott als ganz anderer überall ist, wo es ganz anderes/dergleichen wie jeden anderen gibt …“.78 75 Vgl. Jacques Derrida, Den Tod geben, in: Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida – Benjamin, hg. v. Anselm Haverkamp, Frankfurt a. M. 1994, S. 331 ff., hier S. 395 [S. 68]; einfache Seitenzahlen beziehen sich in diesem Abschnitt auf diese Ausgabe; Seitenzahlen in eckigen Klammern verweisen auf das französischsprachige Original Jacques Derrida, Donner la mort, Paris 1992: „Gott ist der Name des absolut Anderen als anderer und als einziger (der Gott Abrahams: der eine und der einzige).“ 76 Vgl. ebd., S. 395 [S. 68]: „Es gibt auch noch andere, in unendlicher Zahl, die unzählbare Allgemeinheit der anderen, an die mich dieselbe Verantwortung (das, was Kierkegaard ethische Ordnung nennt) binden müßte.“ Hervorhebung im Original. 77 Ebd., S. 404 f. [76]. Hervorhebung im Original. 78 Vgl. ebd., S. 405 [76f.]: „Und wie jeder von uns ist jeder andere, ganz andere – chaque autre, tout autre – unendlich anders in seiner absoluten, unzugänglichen, solitären, transzen- Zum ontologischen Gottesbegriff 119 Die totale Alterität Gottes findet sich demnach in der Alterität jedes menschlich Anderen, das heißt in seiner Singularität, die ihn für jeden Anderen vollkommen unverfügbar sein lässt. Diese Relation zwischen der Alterität Gottes und jeder menschlichen Alterität dürfte nach dieser ersten Deutung so verstanden werden, dass Gott in seiner totalen Andersartigkeit selbst der formgebende Grund der Alterität und Singularität des beziehungsweise jedes menschlich Anderen ist. Zum zweiten ruft uns jeder Andere in jedem Augenblick gleichsam dazu auf, Verantwortung für ihn zu übernehmen. Dass die unendliche Andersheit des ganz Anderen jedem menschlich Anderen zukommt, so dass uns auch jeder menschlich Andere in jedem Augenblick gleichsam in eine prinzipiell unendliche Verantwortung für ihn ruft,79 darin liegt nach Derrida die zweite Bedeutung der Formel „tout autre est tout autre“80; im Unterschied hierzu behält ihre erste Deutung sich die Möglichkeit vor, die Eigenschaft der totalen beziehungsweise unendlichen Alterität nur einem einzigen Anderen, nämlich Gott, zuzusprechen.81 Derrida selbst scheint beide Deutungen dieses „hetero-tautologischen Satzes“82 nicht nur für möglich, sondern auch für zutreffend zu halten. Denn wenn er später – übrigens ganz analog zu Levinas – sagt, dass der erste und tiefste Grund der Verantwortung eines jeden für jeden – menschlich – Anderen in seinem Ange- 79 80 81 82 denten, nicht-offenbaren, meinem ego nicht ursprünglich gegenwärtigen Einzigartigkeit …, läßt sich das, was über die Beziehung von Abraham zu Gott behauptet wird, auch von meiner beziehungslosen Beziehung zu jedem anderen als ganz anderem behaupten, insbesondere zu meinem Nächsten oder zu den Meinen, die mir so unzugänglich, verborgen und transzendent sind wie Jahwe.“ Hervorhebung im Original. Vgl. ebd. [77]: „Im Moment einer jeden Entscheidung und im Bezug zu jedem anderen als ganz anderem verlangt jeder andere in jedem Augenblick von uns, daß wir uns als Ritter des Glaubens aufführen.“ Hervorhebung im Original. Vgl. ebd., S. 409f. [80 f.]: „Die andere Partitur attribuiert diese unendliche Andersheit des ganz Anderen jedem anderen, erkennt sie jedem anderen zu: mit anderen Worten jedem, einem jeden, zum Beispiel jedem Mann und jeder Frau. … Wenn jeder Mensch ganz anders ist, wenn jeder andere – chaque autre, ou tout autre – ganz anders ist, so kann man nicht mehr zwischen einer behaupteten Allgemeinheit des Ethischen, die es im Opfer zu opfern gälte, und dem Glauben, der sich Gott allein, als ganz anderem, zuwendet, unterscheiden … Doch auch Levinas seinerseits kann, wenn er die absolute Einzigartigkeit, das heißt die absolute Andersheit im Bezug zum anderen Menschen in Rechnung stellt, nicht mehr zwischen der unendlichen Andersheit Gottes und der eines jeden Menschen unterscheiden: seine Ethik ist bereits Religion.“ Vgl. ebd., S. 409 [80]: „Die eine – sc. Partitur als Interpretation der Formel – behält sich die Möglichkeit vor – garde en réserve – , die Eigenschaft des ganz Anderen, mit anderen Worten, des unendlich anderen Gott, einem einzigen anderen jedenfalls, zu reservieren.“ Hervorhebung im Original. Ebd., S. 409 [80]; zum „hetero-tautologischen“ Charakter dieser Formel vgl. ebd. 120 Markus Enders blicktwerden durch Gott liege, ohne dass wir Gottes Angesicht sehen könnten,83 dann kann dies nur bedeuten, dass in der totalen Andersheit des Anderen uns die schlechthinnige Andersheit Gottes selbst anblickt, die in der des menschlich Anderen nur auf verborgene Weise anwesend und für uns deshalb nicht unmittelbar sichtbar ist. Denn Gottes Angesicht, das mich im menschlichen Anderen anblickt und mich in eine unendliche Verantwortung für diesen ruft, sehe ich, wie Derrida ausdrücklich sagt, dennoch nicht.84 Worin liegt also die Spiegelung beziehungsweise richtiger die verwandelte Gestalt des ontologischen Gottesbegriffs in Derridas Gottesverständnis? Sie liegt in der, wie Derrida – übrigens auch darin konform mit Levinas – ausdrücklich bemerkt, totalen und unendlichen, das aber bedeutet: in der unübertrefflichen Andersheit oder Alterität Gottes, die Derrida wiederum mit Levinas als eine unübertreffliche Güte – jenseits des Seins – versteht. Dies geht aus Derridas Bestimmung dessen hervor, was wir dem menschlich Anderen in unserer ethischen Beziehung zu diesem schuldig sind. 6.2.2.2 Die Dissymmetrie der ‚Ökonomie des Himmels‘ Das, was wir dem menschlich Anderen schuldig sind, besteht, so Derrida in seiner Schrift Den Tod geben, nach dem Vorbild Abrahams – bei dem Opfer seines Sohnes Isaak auf die Weisung Gottes hin – und vor allem nach den Weisungen der neutestamentlichen Bergpredigt genau darin, die Symmetrie und Reziprozität weltlich-irdischer Tauschgerechtigkeit aufzugeben und die dissymmetrische, himmlische Ökonomie des freiwilligen Verzichts auf einen kalkulierbaren Lohn zu befolgen.85 Unsere Schuldigkeit besteht demnach in der bedingungslos schenkenden, der selbstlosen Gabe, bei der die linke Hand nicht wissen darf, was die rechte Hand tut. Denn die reine Gabe geschieht ohne jede selbstbezogene Absicht, ohne jedes Kalkül. Die Logik der göttlichen Ökonomie aber verheiße demjenigen, der so, nämlich rein, zu geben bereit ist, einen ungleich größeren, weil unermesslichen 83 Vgl. ebd., S. 417 [87]: „Gott erblickt mich und ich sehe ihn nicht, und von diesem mich erblickenden Blick her setzt meine Verantwortung ein.“ 84 Vgl. Fußnote 86 in diesem Aufsatz. 85 Vgl. ebd., S. 428 [96]: „Es geht darum, die strenge Ökonomie, den Tausch, das Zurückgeben, das Geben/Zurückgeben, das ,auf eine Rückgabe hin vorgestreckte‘ Eine und diese Art haßerfüllter Zirkulation in Gestalt von Vergeltung, Rache, das Zug um Zug, das Zug-um-Zug-Zurückgeben außer Kraft zu setzen. Was hat es auf sich mit dieser ökonomischen Symmetrie des Tausches, des Geben/Nehmen und des Zurückgebens, wenn es etwas später heißen wird, daß Gott der Vater, der ins Verborgene sieht, es dir zurückgeben, vergelten wird – reddet tibi – ?“ Zur anderen Ökonomie des Himmels vgl. ebd., S. 428-434 [96-102]. Zum ontologischen Gottesbegriff 121 Lohn dafür, dass er sich über den irdischen Nutzen erhebt.86 Dass diese Ausführungen Derridas nicht nur die Existenz Gottes im Allgemeinen, sondern eines Gottes im Besonderen voraussetzen, dessen andere als die weltliche Gerechtigkeit sich für jeden Menschen mit dessen Eintritt in eine jenseitige Welt als dem Herrschaftsbereich dieses Gottes durchsetzen wird, liegt auf der Hand. Doch worin liegt der normative Charakter dieser himmlischen Ökonomie für das sittliche Tun des Menschen eigentlich begründet? Die Bergpredigt, der Derrida seine Beschreibung der ‚Ökonomie des Himmels‘ weitgehend entlehnt, begründet das Gebot der selbstlosen Gabe und der Feindesliebe – „ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist“87 – mit dem vorbildlichen Handeln Gottes.88 Derrida macht sich diese Begründung dafür, warum der Mensch anderen bedingungs- und absichtslos schenken soll, expressis verbis nicht zu eigen; diese fehlende explizite Begründung zeigt zwar eine argumentative Leerstelle an, doch das von Derrida selbst gewählte Exempel der Opferung Isaaks durch seinen Vater Abraham macht die Annahme höchst wahrscheinlich, dass Derrida mit Levinas genau dies schon voraussetzt: Es gibt ein göttliches Geheiß, einen unvordenklichen Anspruch Gottes an den Menschen, sich, wie Abraham, selbstlos und ohne jede Berechnung, unter Verzicht auf jedes weltliche Kalkül, dem Willen Gottes anheimzustellen und sich für den Anderen und die Anderen gleichsam zu verschwenden. Damit dürfte Derrida seinem eigenen religiösen Glauben an eine zukünftige Welt als dem uneingeschränkten Herrschaftsbereich Gottes zumindest indirekt Ausdruck verliehen haben. Denn dass auch für ihn das Handeln Gottes und dessen andere Gerechtigkeit einen Vorbildcharakter besitzen, dies anzunehmen, setzen seine Ausführungen zu der dissymmetrischen Ökonomie des Himmels und ihren biblischen Bezugsstellen eindeutig voraus. Damit aber dürfte schlussendlich einsichtig geworden sein, dass nicht nur Levinas, sondern mit und nach ihm auch Derrida die unübertreffliche Alterität Gottes als die unübertreffliche Andersartigkeit seiner Güte und damit als radikal selbstlos und aus reinem Wohlwollen schenkende Liebe und somit Gott de facto, wenn auch nicht explizit, als etwas schlechthin Unübertreffliches versteht, das er in dieser von ihm mit einer unerhörten Radikalität gedachten Güte verwirklicht sieht. Insofern entspricht Derridas Gottesverständnis zumindest teilweise auch der inhaltlichen und nicht nur der formalen Normativität des ontologischen Gottesbegriffs. 86 Vgl. ebd., S. 433 [100 f.]: „Doch ein unendliches Kalkül übernimmt die Ablösung des endlichen Kalküls, auf das verzichtet wird: Gott der Vater, der ins Verborgene sieht, wird ihn dir zurückgeben, vergelten, diesen Lohn, und unendlich größer.“ 87 Mt 5, 48. 88Vgl. Mt 5, 44 ff. 122 Markus Enders Und wenn Derrida schließlich sogar einen begriffenen Gott verabschieden und jedem Gottesbegriff A-dieu sagen will, stimmt er darin – wenn auch vermutlich wider Willen – mit dem ontologischen Gottesbegriff insofern überein, als dessen negativ-theologische Bedeutung die Transzendenz und Erhabenheit Gottes über jeden von einem endlichen Intellekt intellektuell anschaubaren begrifflichen Gehalt bezeichnet. Dass diese Transzendenz aber sogar zum Inhalt eines Gottesbegriffs, des ontologischen nämlich, gemacht werden kann, das haben Levinas und Derrida in ihrer pauschalen Kritik an Gottesbegriffen nicht bedacht. 6.3 Zu Marions Auseinandersetzung mit dem ontologischen Gottesbegriff Im Unterschied zu Levinas und Derrida ist Marion ein Philosoph, der sich von Anfang seines Denkweges an offensiv zum Christentum, und zwar zum katholischen Christentum, bekannt hat. Marion ist ein christlicher Philosoph in dem Sinne des Wortes, dass er mit philosophischen Erkenntnismitteln, insbesondere denen der Phänomenologie, die christlich geglaubte Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus zu denken und vor dem Forum weltlicher, autonomer Rationalität zu verantworten sucht. Auf dieses aus deutscher Sicht gleichsam fundamentaltheologische Anliegen des Marionschen Denkens hat Thomas Alferi in seiner Dissertation ‚Worüber hinaus Größeres nicht ‚gegeben‘ werden kann …‘ zu Recht, wie ich finde, aufmerksam gemacht.89 Gilt dies auch für Marions phänomenologische Neufassung des christlichen Gottesverständnisses? Und kann diese vielleicht auch als ein Dokument der zeitgenössischen Wirkungsgeschichte des ontologischen Gottesbegriffs aufgefasst werden? Expressis verbis scheint dies wie bei Levinas und bei Derrida auch bei Marion gerade nicht der Fall zu sein. Denn dem ontologischen Gottesbegriff Anselms hat Marion in seinen frühen Questions cartésiennes ein Kapitel gewidmet und diesen darin einer von Heideggers und Levinas‘ Metaphysik- und Logozentrismus-Kritik inspirierten Analyse unterzogen, die sich gegen Anselms begriffliche Identifizierung Gottes und damit gegen den objektivierenden Charakter seines ‚unum argumentum‘ richtet und das Fehlen einer Reflexion auf seine subjektiven Erkenntnisbedingungen 89 Vgl. Thomas Alferi, ‚Worüber hinaus Größeres nicht ‚gegeben‘ werden kann …‘. Phänomenologie und Offenbarung nach Jean-Luc Marion, Freiburg i. Br. u. München 2007, S. 34-40. Zum ontologischen Gottesbegriff 123 anmahnt.90 Im Einzelnen hat Marion in diesem Kapitel erstens festgestellt, dass das sogenannte ‚ontologische Argument‘ diese seine Bezeichnung geistesgeschichtlich gesehen erst relativ spät erhalten hat, und zwar erst seit Kant und auch dort nicht als einzige Bezeichnung. Zweitens stellt er fest, dass das sog. ontologische Argument von dem reinen Begriff eines Wesens a priori auf dessen reale Existenz schließt.91 Alle traditionellen Fassungen des ontologischen Gottesbeweises teilten diese Annahme beziehungsweise setzten voraus, dass ein Begriff Gott erreichen und sein Wesen angemessen bezeichnen könne.92 Dieses Wesen sei von Descartes als ein in höchstem Maße vollkommenes Wesen bestimmt worden, das alle einzelnen Vollkommenheiten in sich vereinige; doch erst in der nachcartesischen Geschichte des ontologischen Gottesbeweises bei Nicolas Malebranche sei dieses Wesen mit seiner Existenz unmittelbar gleichgesetzt worden; erst durch diesen Schritt habe der Gottesbeweis seinen ‚ontologischen‘ Charakter erhalten,93 den Gottfried Wilhelm Leibniz durch die Prägung des Gottesbegriffs eines ‚notwendigen Seins‘ noch fortgeführt habe.94 In dieser Gestalt hätten Immanuel Kant und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling das ‚ontologische Argument‘ rezipiert. Vervollständigt worden sei der Begriff des ‚ontologischen Gottesbeweises‘ schließlich durch Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der in diesem Argument die Einheit des – absoluten – Denkens und des – vollkommenen, notwendigen – Seins ausgesprochen gefunden habe. Dieser Entwicklungsgeschichte des ontologischen Arguments aus seiner Sicht hält Marion in einem weiteren Schritt entgegen, was wir oben als die negativ-theologische Bedeutungsdimension des ontologischen Gottesbegriffs benannt haben: Die von Anselm wiederholt betonte Transzendenz Gottes über die Reichweite allen begrifflichen Erkennens hinaus, die jede begriffliche Definition Gottes ad absurdum führe, weil sie seine begriffliche Definierbarkeit ausschließe.95 Dabei übersieht Marion jedoch den Umstand, dass diese Unbegreifbarkeit Gottes nach Anselm96 ein zentrales Bedeutungsmoment seines ‚ontologischen Gottesbegriffs‘ selbst ist und von diesem daher mitausgesagt wird, so dass dieser Einwand von Marion zu Unrecht gegen den ‚ontologischen Gottesbegriff‘ erhoben wird. Denn es macht 90 Vgl. Jean-Luc Marion, Questions cartésiennes, Méthode et métaphysique, Paris 1991, S. 221-258: VII: L’argument relève-t-il de l’ontologie? 91 Vgl. ebd., S. 225. 92 Vgl. ebd., S. 226. 93 Vgl. ebd., S. 226 ff. 94 Vgl. ebd., S. 228. 95 Vgl. ebd., S. 231-243. 96 Vgl. Anselm von Canterbury, Proslogion, 15. 124 Markus Enders gerade die Stärke und das Raffinement dieses Gottesbegriffs aus, die begriffliche Unerreichbarkeit seines Signifikats mitzubedeuten. Den zweiten Einwand, den Marion gegen den ontologischen Gottesbegriff erhebt,97 leitet er aus seiner zutreffenden und oben belegten Beobachtung ab, dass Anselm in seiner Fassung des ontologischen Gottesbegriffs von der Formel „id quo maius cogitari non possit“ übergeht zu der Formel „id quo melius cogitari non possit“, das heißt zu einer qualitativen Bestimmung der Größe Gottes im Sinne seiner vollkommenen Güte. Damit verlässt Anselm jedoch keineswegs entgegen Marions Annahme die ontologische Bedeutungsdimension seines Gottesbegriffs; Anselm macht diese vielmehr und ganz entgegengesetzt zu Marions Deutung ausdrücklich, indem er durch die Substituierung des Komparativs ‚maius‘ durch den Komparativ ‚melius‘ in seiner sprachlichen Formel für Gott die Größe Gottes als die Allumfassendheit seiner Seinsvollkommenheiten beziehungsweise perfekten Eigenschaften bestimmt, auch wenn diese höchste Güte und (Seins-)Vollkommenheit Gottes erhaben ist über die Reichweite unseres intellektuellen Anschauungsvermögens.98 Deshalb muss das Fazit Marions, dass das Argument Anselms einer ontologisch-metaphysischen Deutung unzugänglich sei,99 zurückgewiesen werden. Schließlich ist auch Marions Zuordnung Anselms zur maßgeblich von Pseudo-Dionysius begründeten Tradition der negativen Theologie im abendländischen Denken revisionsbedürftig.100 Denn dass gemäß dieser Tradition die höchste Gotteserkenntnis des Menschen in seiner Einsicht in die begriffliche Unerkennbarkeit Gottes für uns Menschen besteht, lässt sich auf Anselms ontologischen Gottesbegriff nur mit der bedeutsamen Modifikation anwenden, dass dieser eine begriffliche Einsicht in die Erhabenheit Gottes über das intellektuelle Anschauungsvermögen der endlichen Vernunft beinhaltet. Marion rechnet Anselms Gottesbegriff einer „théologie spéculative“101 zu, die er in einen Gegensatz zur „métaphysique constitué selon l’onto-théo-logie“102 stellt. Daran aber wird wie schon bei Levinas sichtbar, dass Heideggers fatales Konstrukt einer ontotheologischen Verfassung der abendländischen Metaphysikgeschichte bedauerlicherweise auch von Marion wie überhaupt von nahezu allen bedeutenden französischen phänomenologischen Religionsphilosophen übernommen worden ist. Dass der frühe Marion 97 Vgl. Marion, Questions cartésiennes , a. a. O., S. 244 -253: Au-delà de l’essence. 98 Im Hintergrund dieser Deutung Marions steht freilich das antimetaphysische Verständnis des Guten, das der frühe Marion von Levinas übernommen hat, vgl. ebd., S. 254 f. 99 Vgl. ebd., S. 253. 100Vgl. ebd., S. 254 f. 101Ebd., S. 255. 102Vgl. ebd. Zum ontologischen Gottesbegriff 125 unter dem Einfluss von Levinas steht, zeigt sich in diesem Zusammenhang auch darin, dass er den ontologischen Gottesbeweis in Descartes‘ V. Meditatio der ontologisch-metaphysischen Deutungsgeschichte des anselmischen Gottesbeweises zurechnet, während er wie Levinas in dem ideentheoretischen Gottesbeweis der III. Meditatio eine Alternative zur begrifflichen Bestimmung Gottes im Horizont des Seinsdenkens sieht.103 Marions Resümee, dass Anselms Argument weder etwas von der Ontologie offenbare noch der Ontotheologie zugehörig sei,104 ist daher unter Zugrundelegung der Gültigkeit seines von Heideggers Metaphysik-Kritik übernommenen Metaphysik-Verständnisses konsequent, in der Sache jedoch nicht haltbar. Deshalb hat Marion Gott bekanntermaßen ohne das Sein zu denken versucht,105 und zwar als eine freie, sich selbst bis in den Tod am Kreuz gebende Güte oder Liebe, über die hinaus nach Marion in der Tat Größeres nicht ‚gegeben‘ und nicht erfahren und auch nicht – einmal – gedacht werden kann, wobei Marion zwischen diesen drei durchaus bedeutungsverschiedenen Varianten des ontologischen Gottesbegriffs meines Wissens nicht mehr differenziert. Auch wenn wir nach Marion alle Gottesbegriffe fahren lassen und uns von Gott vielmehr nur beim Namen nennen lassen sollen, so bleibt es dennoch wahr, dass auch Marion Gott als das schlechthin Unübertreffliche zu denken versucht, das er in der reinen Gratuität einer überströmenden, also sich selbst schenkenden und gebenden, Liebe und damit wie bei Levinas und Derrida in vollkommener Güte verwirklicht sieht. Insofern teilt er de facto in wenn auch erheblich eingeschränkter Form den affirmativ-theologischen Gehalt des ontologischen Gottesbegriffs, dessen negativ-theologischen Gehalt als einen in seinem Sinne ikonischen Gottesbegriff er ohnehin anerkennen dürfte. 7 Resümee So zeigt sich, zusammenfassend betrachtet, eine veritable Wirkungsgeschichte des ontologischen Gottesbegriffs als eines Inbegriffs schlechthinniger Unübertrefflichkeit auch bei jenen bedeutenden zeitgenössischen Gott-Denkern wie Levinas, Derrida und Marion, die das axiologische Seinsdenken der klassischen Metaphysik, das den traditionellen Fassungen des ontologischen Gottesbegriffs von Anselm bis Hegel zugrunde lag, ablehnen zu müssen glauben. Damit aber dürfte sich für die philo103Vgl. ebd., S. 256. 104Vgl. ebd., S. 258. 105Vgl. Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, Paris 1982. 126 Markus Enders sophische Gotteserkenntnis auch unserer Gegenwart die formale – und teilweise sogar auch die inhaltliche – Normativität des ontologischen Gottesbegriffs als eines Inbegriffs von in jeder möglichen Hinsicht bestehender Unübertrefflichkeit zumindest exemplarisch als gültig erwiesen haben. Erfahrung und Erkenntnis Gottes – zur Wahrnehmung der Wahrheit Gottes Unerkennbarkeit als letzte Erkenntnis William J. Hoye Die Lehre, dass Gott die Wahrheit selbst ist, schützt den Gläubigen vor der Einbildung, er habe Gott im Griff oder im Besitz. Nicht nur haben wir Gott nicht im Besitz, mehr noch: Wir können nicht einmal sein Wesen, also was er ist, erkennen. Der Mensch, der sagt, Gott sei die Wahrheit selbst, ist sich deutlich bewusst, dass die Wirklichkeit und somit die Welt letztlich unergründbar sind. Eine ‚Weltformel‘ wäre die Widerlegung dieser These. Ferner: Diese letzte Unwissenheit ist unüberholbar. Der mündige Mensch weiß, dass er die Wahrheit nicht hat, sondern an sie glaubt und nach ihr strebt. Gott ist also unerkennbar und meine These ist, dass die Erkenntnis dieser Unerkennbarkeit die letzte Erkenntnis ist. Diese These ist nicht neu. Am klarsten hat sie meines Erachtens Thomas von Aquin entwickelt. Ich berufe mich vor allem auf ihn und versuche auf diese Weise zu exemplifizieren, was Rémi Brague in Münster folgendermaßen ausgedrückt hat, wobei er sich auf Josef Pieper berief: „Heute lässt sich die Weltlichkeit nur noch theologisch gründen. Nur Theologisches kann die Welt bejahen. Marxistisch gesprochen: Der Glaube ist kein Überbau, sondern der unverzichtbare Unterbau des menschlichen Lebens.“1 1 Rémi Brague, Öff nen und Integrieren. Wie kann Europa eine Zukunft haben?, in: Europa auf der Suche nach sich selbst, hg. v. Hermann Fechtrup, Friedbert Schulze u. Thomas Sternberg, Münster 2010, S. 193 ff., hier S. 202: „Vor fünfzig Jahren hat Josef Pieper, den ich hier besonders gerne zitiere, das Wesen des ‚christlichen Abendlandes‘ in drei Wörter gefasst. Er spricht von einer ‚theologisch gegründeten Weltlichkeit‘. Die kurze Formel ist verblüffend treffend. Man könnte sie vielleicht noch verschärfen. So würde ich sagen: die christlich-europäische Art und Weise, die Weltlichkeit theologisch zu gründen, ist keine willkürliche Sonderbarkeit, keine Grille, die den Menschen des Mittelalters eingefallen wäre. Sie ist eine Notwendigkeit. Und gerade heute ist sie mehr als zuvor zu so einer Notwendigkeit geworden.“ 127 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7_7 128 William J. Hoye Ausdrücklich lehrt Thomas: „Das ist das Letzte menschlicher Erkenntnis über Gott, dass man erkennt, dass man Gott nicht kennt.“2 Diese wissende Unwissenheit komme erst „am Ende unserer Erkenntnis“ vor.3 Was diese Lehre meint und wie man zu ihr gelangt, bedarf einer näheren Untersuchung. Zu klären, was man unter dem ‚Letzten menschlicher Erkenntnis‘ zu verstehen hat, ist zunächst unproblematisch. ‚Das Letzte‘ ist nicht zeitlich gemeint. Die gemeinte letzte Erkenntnis ist die vollendetste Erkenntnis, die in diesem Leben möglich ist.4 Ihre Vollkommenheit ist der Grund, warum sie die Stellung des Letzten einnimmt. „Es wird von uns gesagt, wir erkennen Gott als den Unbekannten am Ende unserer Erkenntnis, weil dann der Geist sich in Erkenntnis am meisten vollendet findet“5, behauptet Thomas. In ähnlicher Weise nennt er sie die „höchste“ Erkenntnis.6 Sie ist also nicht als die Unwissenheit bezüglich der erhabensten Erkenntnis zu verstehen; vielmehr ist sie selbst die erhabenste Erkenntnis.7 Fernerhin bezeichnet Thomas sie als die „kraftvollste“ Erkenntnis.8 Die gemeinte Unwissenheit ist also nicht in sich ein Versagen, eine Verzweiflungsäußerung oder einfach ein Geständnis von Bescheidenheit. Als die Vollendung der Erkenntnis verkörpert sie vielmehr eine Errungenschaft. Aber die Frage nach ihrer näheren Bedeutung ist noch durchaus offen. Wenn es Gott gibt, muss er überall sein, unumgänglich, wie das Licht. Sehr nahe, näher zu den Dingen als die Dinge zu sich selbst. Und doch ist er leicht übersehbar. 2 Thomas von Aquin, De potentia, q. 7, a. 5, ad 14. 3 Thomas von Aquin, In Boethii De trinitate, q. 1, a. 2, ad 1. 4 Vgl. Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, III, c. 49: „Ultimum et perfectissimum nostrae cognitionis in hac vita.“ 5 Thomas von Aquin, In Boethii De trinitate, q. 1, a. 2, ad 1: „Secundum hoc dicimur in fine nostrae cognitionis Deum tamquam ignotum cognoscere, quia tunc maxime mens in cognitione profecisse invenitur, quando cognoscit eius essentiam esse supra omne quod apprehendere potest in statu viae.“ Vgl. Ders., In lib. De causis, lectio 6, n. 160: „Ille enim perfectissime Deum cognoscit qui hoc de ipso tenet quod, quidquid cogitari vel dici de eo potest, minus est eo quod Deus est.“ Vgl. außerdem Ders., Summa contra gentiles, I, c. 30; c. 5. 6 Vgl. Thomas von Aquin, De veritate, q. 2, a. 1, ad 9: „Et haec est summa cognitio quam de ipso in statu viae habere possumus, ut cognoscamus Deum esse supra omne id quod cogitamus de eo.“ 7 Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, III, c. 49: „Unde et ad huius sublimissimae cognitionis ignorantiam demonstrandam, de Moyse dicitur (Exod. 20-21), quod accessit ad caliginem in qua est Deus.“ 8 Vgl. Thomas von Aquin, In lib. De causis, lectio 6: „De causa autem prima hoc est quod potissime scire possumus quod omnem scientiam et locutionem nostram excedit.“ Erfahrung und Erkenntnis Gottes – zur Wahrnehmung der Wahrheit 129 Ich möchte versuchen, meine These der Unerkennbarkeit Gottes als letzte Erkenntnis anhand von vier uns vertrauten Phänomenen darzustellen: dem Erlebnis, dem Staunen, dem Konkreten und dem Aussagesatz. 1 ‚Erlebnis‘ als Verlangen nach Wirklichkeit Uns sehr naheliegend ist das Phänomen des Erlebnisses. In der Werbung lässt sich ein Verlangen, eine Sehnsucht nach Erlebnissen beobachten. Es scheint nichts zu geben, was nicht als ein Erlebnis anziehend gemacht werden kann. Ich habe mir eine Liste aus dem Internet zusammengetragen: Erlebnis Lesen, Erlebnis-Zoo, Erlebnis Wildpark, Erlebnis Bergwerk, Erlebnis Erde, Erlebnis Bahn, Erlebnis Fußball, Erlebnisgesellschaft, Erlebniswelten, Einkaufen als Erlebnis, Genuss-Erlebnis, Erlebniskommunikation, Erlebnislyrik, Kultur-Erlebnis, Erlebnis-Urlaub, Erlebnis-Wohnzentrum, Erlebnis-Sternwarte, Erlebnis Museum, Erlebnis Wissen, der Main-Donau-Kanal als ein Erlebnis-Kanal, Augenblicks-, Bildungs-, Bühnen-, Ferien-, Gemeinschafts-, Grund-, Jagd-, Jugend-, Kindheits-, Kriegs-, Kunst-, Liebes-, Musik-, Natur-, Reise-, Theatererlebnis, Flughafen Dresden als Erlebnis Flughafen, Erlebnis-Wanderkarte, Erlebnis Hotel, Erlebnis Wochenende, Erlebnistage, Natur-Erlebnis-Pädagogik, Erlebnis Gesundheit, Erlebnis-Planer, Erlebnis Arbeitswelt und so weiter. Eine Agentur bietet im Internet 818 Erlebnis-Geschenke an. Diese seien die besten Geschenkideen! Es lohnt sich, das Wort ‚Erlebnis‘ näher zu untersuchen. Man kann dann feststellen, dass das Wort ‚Erlebnis‘ selbst sehr viel jünger ist, als man zunächst erwarten würde – erheblich jünger als die Epoche des Sturm und Drang und jünger auch als der Beginn des 19. Jahrhunderts. Im gesamten Werk Johann Wolfgang Goethes ist es nirgends belegt, auch nicht in seinen Briefen und Tagebüchern, ebenso wie es zum Beispiel weder bei Friedrich Schiller, Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist noch bei Heinrich Heine zu finden ist.9 Es ist verwunderlich, dass das Wort vor dem 19. Jahrhundert nicht existierte. Man darf mutmaßen, dass ein großer Bedarf für ein solches Wort vor dem 19. Jahrhundert nicht bestand. 9 Vgl. Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960, 21965, S. 56; vgl. ebd.: „Die Untersuchung des Auftretens des Wortes ‚Erlebnis‘ im deutschen Schrifttum führt zu dem überraschenden Resultat, dass es im Unterschied zu ‚Erleben‘ erst in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts üblich geworden ist.“ 130 William J. Hoye Das Historische Wörterbuch der Philosophie gibt folgende Erläuterung des Wortes an: Es „trägt den Ton der Unmittelbarkeit, mit der etwas Wirkliches erfasst wird, die keiner fremden Beglaubigung bedarf und aller vermittelnden Deutung vorhergeht. Das Erlebte ist stets das Selbsterlebte, dessen Gehalt sich keiner Konstruktion verdankt.“10 Der Begriff ‚Erlebnis‘ betont die Unmittelbarkeit der Erfahrung, persönlich und authentisch, vor jeder Deutung. „Das Erlebte ist immer das Selbsterlebte“, hebt Hans-Georg Gadamer hervor.11 ‚Erlebnis‘ repräsentiert eine Verbindung von Subjekt und Objekt im Lichte der Wirklichkeit. Keine andere Art der Erkenntnis führt das Subjekt so nahe an die Wirklichkeit heran. Er-leben ist intensives Leben. Gadamer schreibt, „dass der Wortbildung Erlebnis eine verdichtende, intensivierende Bedeutung zukommt“12. Das Oxford English Dictionary definiert ‚Erlebnis‘ – aus dem Deutschen übernommen – als ‚eine bewusste, durch-lebte Erfahrung‘ – a conscious, ‚lived-through‘ experience. ‚Erlebnis‘ ist fundamentaler als empirische Wahrnehmung. Woher stammt also der inflationäre Bedarf für diesen Begriff? Wofür ist er ein Platzhalter? Warum ist die Sehnsucht nach Erlebnissen so stark? Eine plausible Erklärung sieht das Bedürfnis nach Erlebnissen im heutigen Leiden „an der Leere und Monotonie des Alltags, an einem abstrakten Leben, … an dem, was man seit dem 19. Jahrhundert unter dem Stichwort ‚Langeweile‘ kennt“13. Langweile sehnt sich nach Erlebnissen. Virtuelle Erfahrungen genügen uns nicht. Eine ‚Live‘-Fernsehsendung ist uns nicht ‚live‘ genug. Es fehlt die Gegenwart der Wirklichkeit. Überhaupt: Was ein Mensch am tiefsten will, ist Wirklichkeit, bei der Wirklichkeit zu sein, das heißt Wahrheit. Erlebnis setzt Aufmerksamkeit voraus. Aufmerksamkeit ist nichts anderes als die Mit-Wahrnehmung der Wirklichkeit des Gegenstandes. Ich sagte, der Mensch will Wahrheit. Was bedeutet das? Thomas von Aquin zufolge „versteht man unter Wahrheit nichts anderes als das Sichzeigen von Wirk10 Konrad Cramer, Art. Erleben, Erlebnis, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, Basel 1972, Sp. 702 ff., hier Sp. 703. 11Gadamer, Wahrheit und Methode, a. a. O., S. 57. 12 Ebd., S. 62. 13 Jost Schillemeit, ‚Erlebnis‘. Beobachtungen eines Literaturhistorikers zu einer Wortbildung des 19. Jahrhunderts, in: Sprache im Leben der Zeit. Beiträge zur Theorie, Analyse und Kritik der deutschen Sprache in Vergangenheit und Gegenwart, hg. v. Armin Burkhardt u. Dieter Cherubim, Tübingen 2001, S. 319 ff., hier S. 330: „Die Vermutung liegt nahe, dass hier ein gewisses Leiden an der Leere und Monotonie des Alltags, an einem Leben in einer ständig abstrakter, gleichgültiger oder auch menschenfeindlicher anmutenden Welt und an dem, was man seit dem 19. Jahrhundert unter dem Stichwort ‚Langeweile‘ kennt, eine beträchtliche Rolle gespielt hat.“ Erfahrung und Erkenntnis Gottes – zur Wahrnehmung der Wahrheit 131 lichkeit“14. Er analysiert Wahrheit als ein Werden. Nach ihm ist Erkenntnis die Präsenz des Gegenstandes im Bewusstsein.15 „Es findet eine reale Einswerdung des Objekts mit dem Subjekt“16 statt. Aus der Wahrheits-Vereinigung entsteht Erkenntnis. „Erkenntnis“, wie Thomas lehrt, „ist eine Wirkung der Wahrheit.“17 Man darf daher vermuten, dass der Grund für den Begriff des Erlebnisses in dem Bedürfnis nach Wirklichkeit, realer und nicht nur virtueller Wirklichkeit liegt. Die moderne Kultur ist in diesem Punkt blind geworden. Die Werbung versucht den Bedarf zu erfüllen. Eventuell zeugt der Begriff von einer Unzufriedenheit mit dem Rationalismus der Aufklärung. Das ist uns heute zu nüchtern. Gadamer hebt einen anderen Aspekt hervor. Seine Beobachtung ist bedenkenswert. Ihm zufolge wird das Leben in einem Erlebnis als eine Totalität gesehen und weist zugleich darüber hinaus: „Die Repräsentation des Ganzen im augenblicklichen Erlebnis geht offenbar weit über die Tatsache der Bestimmtheit desselben durch seinen Gegenstand hinaus.“18 Er konstatiert: „Das Erlebnis hat eine betonte Unmittelbarkeit, die sich allem Meinen seiner Bedeutung entzieht. Alles Erlebte ist Selbsterlebtes, und das macht seine Bedeutung mit aus, dass es der Einheit dieses Selbst angehört und somit einen unverwechselbaren und unersetzlichen Bezug auf das Ganze dieses einen Lebens enthält.“19 Erlebnis ist nicht einfach ein Aspekt des Lebens, sondern umfasst das Ganze des Lebens. Es scheint eine religiöse Dimension zu haben. Das nimmt nicht Wunder, wenn man bedenkt, dass ein Erlebnis ein Zeichen des menschlichen Hungers nach Erfüllung in der Wirklichkeit darstellt. Erfahrung strebt also nach mehr als Erfahrung. Ich würde gerne behaupten: Das Streben nach Erlebnissen ist das Streben nach Ewigem Leben. Auf jeden Fall ist es ein Streben nach Wirklichkeit. Was in einem Erlebnis undeutlich empfunden wird, lässt sich mit anderen Begriffen besser artikulieren. Daher gehe ich nun weiter zu den Phänomenen des Staunens, des Konkreten und des Satzes. 14 Josef Pieper, Was heißt Glück? Erfüllung im Schauen, in: Werke, 10 Bde., hg. v. Berthold Wald, Hamburg 1995-2008, Bd. 8.1: Miszellen, 2005, S. 411. 15 Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, q. 16, a. 1c: „Cognitio est secundum quod cognitum est in cognoscente.“ 16 Ebd., q. 54, a. 1, ad 3. 17 Thomas von Aquin, De veritate, q. 1, a. 1c: „Sic ergo entitas rei praecedit rationem veritatis, sed cognitio est quidam veritatis effectus.“ 18 Gadamer, Wahrheit und Methode, a. a. O., S. 65. 19 Ebd., S. 62; vgl. dazu auch ebd., S. 63: „Was wir emphatisch ein Erlebnis nennen, meint also etwas Unvergessliches und Unersetzbares, das für die begreifende Bestimmung seiner Bedeutung grundsätzlich unerschöpflich ist.“ 132 2 William J. Hoye Staunen als die Öffnung des Bewusstseins über das Ganze hinaus Wenn das Erlebnis Bezug auf das Ganze nimmt, dann ist das Staunen die Öffnung des Bewusstseins über das Ganze hinaus. „Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, … ist das Erstaunen“, beteuert Goethe.20 Staunen entsteht, wenn eine Wirkung – gerade als Wirkung – erkannt wird und ihre Ursache verborgen bleibt. Diese Definition wird etwa von Aristoteles und Thomas von Aquin vertreten.21 Staunen beinhaltet ihnen zufolge ein Verlangen, und zwar ein Verlangen danach, den Grund dessen zu erkennen, was man bereits kennt.22 Verlangen dieser Art wird in der Form des Staunens erlebt, solange die Ursache beziehungsweise der Grund des Erkannten verborgen bleibt.23 Thomas von Aquin formuliert es folgendermaßen: „Im Menschen gibt es ein naturhaftes Verlangen, seinen Urgrund zu erkennen, weil er dessen Wirkung erkennt. Daraus entsteht in Menschen ein Staunen.“24 Es ist ein in der menschlichen Natur liegendes Verlangen: ein desiderium naturale. Aber natürlich zielt nicht jedwedes Staunen auf Gott. Nur wenn es sich explizit durch die Wirklichkeit als solche entzündet, betrifft es den Grund von Wirklichkeit, nämlich Gott selbst.25 Denn etwas gerade als eine Wirkung – also als ‚gewirkt‘ – zu sehen, impliziert irgendeine Ursache, so wie Sohn einen Vater impliziert. Wenn ich über den Grund von Wirklichkeit nachdenke, das heißt über ihre Ursache, so 20 Johann Wolfgang von Goethe, Gespräch mit Eckermann am 18. Februar 1829, in: Goethes Werke. Naturwissenschaftliche Schriften. Tagebücher. Briefe. Weimarer Ausgabe, 143 Bde., Weimar 1887–1919, Anhang: Gespräche, Bd. 7: 1829 und 1830, hg. v. Woldemar v. Biedermann, 1890, S. 21. 21 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, q. 105, a. 7c; vgl. dazu auch ebd., II–II, q. 180, a. 3, ad 3: „Admiratio autem consurgit, cum effectus sunt manifesti et causa occulta.“ 22 „Cuiuslibet effectus cogniti naturaliter homo scire causam desiderat.“ Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, III, c. 25: „Von jeder erkannten Wirkung verlangt der Mensch von Natur aus die Ursache zu wissen.“ 23 „Inest enim homini naturale desiderium cognoscendi causam, cum intuetur effectum; et ex hoc admiratio in hominibus consurgit.“ Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, q. 12, a. 1, corpus: „Sobald der Mensch eine Wirkung sieht, regt sich sein natürliches Verlangen, auch deren Ursache zu erkennen; daher kommt es ja, dass der Mensch sich über etwas wundert.“ Vgl. dazu auch ebd., q. 105, a. 7, corpus: „Staunen entsteht, wenn eine Wirkung offenbar und deren Ursache verborgen ist.“ Vgl. ebd., II–II, q. 180, a. 3, ad 3. 24 Ebd., I, q. 12, a. 1, corpus. 25 Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, III, c. 25, n. 12: „Der menschliche Verstand erkennt das allgemeine Seiende: ens universale. Er verlangt also von Natur aus, dessen Ursache zu erkennen, welche allein Gott ist.“ Erfahrung und Erkenntnis Gottes – zur Wahrnehmung der Wahrheit 133 darf ich Gott natürlich nicht im Sinne einer Wirkursache verstehen. Denn diese Kategorie muss in diesem Zusammenhang gegenstandslos bleiben, da eine Wirkursache selbst nur als eine Wirklichkeit und damit nicht als Grund einer Wirklichkeit denkbar ist. Sie ist von ihrer Wirkung getrennt. Besser wäre es hier, das Ursache-Wirkung-Verhältnis mit Licht als dem Grund von Farben zu vergleichen. Farben werden vom Licht wie von einer Art Formalursache verursacht, ohne dass sie vom Licht getrennt sind. Farben sind gleichsam ‚Ausschnitte‘ von Licht. Was genau geschieht aber nun im Staunen? Das Staunen über eine Wirklichkeit als solche entsteht genauerhin auf folgende Weise: Alle menschliche Erkenntnis, sofern sie Wahrheit erreicht, bezieht sich ausnahmslos auf Wirklichkeiten, also auf die Welt insgesamt. Diese Wirklichkeiten treten immer in Gestalt von verwirklichten Möglichkeiten auf. Etwas als eine Wirklichkeit wahrzunehmen bedeutet, es als bewirkte Möglichkeit zu sehen. Die zweifache Dimension des aus Washeit – forma – und Dasein – esse – bestehenden Konkreten charakterisiert alle unsere Erfahrungen. Mit anderen Worten: Wirklichkeiten werden von uns immer als Möglichkeiten erfasst, welche Wirklichkeit – esse – haben: Ein ‚Was‘ und dessen Dasein. Von daher ergibt sich jedoch, dass jeder, der die Alltagssprache verwendet, aufgrund seines Staunens eine Wirklichkeit erahnt, die ihre Wirklichkeit nicht hat, sondern ist, das heißt, bei der also die Differenz von Möglichkeit und Wirklichkeit aufgehoben ist. Sobald wir etwas als eine Wirklichkeit erfassen, wissen wir implizit von der Wirklichkeit, an welcher diese einzelne Wirklichkeit teilnimmt, so wie eine Farbe an Licht teilnimmt. Wenn ich irgendeine Farbe in einem Raum sehe, weiß ich, dass es Licht in dem Raum gibt, obwohl Licht unsichtbar ist. Jede Wahrheit bezeugt die Wahrheit, jede Wirklichkeit verkörpert die Wirklichkeit. Thomas von Aquin argumentiert, dass alles, was Wirklichkeit hat, von dem verursacht wird, der seine Wirklichkeit ist. Anders ausgedrückt: „Die den erschaffenen Dingen innewohnende Wirklichkeit kann nur als von der göttlichen Wirklichkeit abgeleitet verstanden werden.“26 Es bleibt also letztlich, dass alles andere als Gott nicht sein eigenes Sein ist, sondern das Sein durch Teilhabe besitzt. Infolgedessen ist alles, was sich durch die verschiedene Teilhabe im Sein unterscheidet, so dass es mehr oder weniger vollkommen das Sein besitzt, notwendig verursacht von dem ersten Seienden, das auf vollkommenste Weise ist.“27 Derartiges Wissen ist jedoch weder eine Erfahrung noch eine direkte Erkenntnis der göttlichen Wirklichkeit selbst – denn sonst wäre das auf Wirklichkeit gerichtete Staunen eingeschränkt. Vielmehr handelt es sich bei der dadurch erlangten 26 Thomas von Aquin, De potentia, q. 3, a. 5, ad 1. 27 Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, q. 44, a. 1, corpus. 134 William J. Hoye ‚Wirklichkeit‘ um die Wahrheit des Satzes ‚Gott existiert‘; mit anderen Worten: in Wirklichkeit, das heißt in Wahrheit, existiert Gott. ‚Gott‘ und ‚existiert‘ kommen wirklich zusammen vor.28 Nach Thomas erreicht ein gelungener Gottesbeweis nicht mehr als die Wirklichkeit des wahren Satzes ‚Gott existiert‘. Mehr als dies wissen wir nach ihm über Gott nicht. Wir wissen nichts mehr über Gott, als dass er ist. Dazu eröffnet uns das Staunen. Und, da Gott ‚die‘ Wirklichkeit ist, hört das Staunen nie auf. In der deutschen Sprache wird diese Einsicht meines Erachtens erfasst und erhellt durch die Tatsache, dass man dasselbe Wort, nämlich ‚Wirklichkeit‘, sowohl für das Konkrete schlechthin als auch für das Umfassendste, das Abstrakteste verwendet. Wirklichkeiten vergegenwärtigen ipso facto die Wirklichkeit, ohne aber selbst die Wirklichkeit zu sein. Wir unterscheiden unverwechselbar zwischen Wirklichkeiten und der Wirklichkeit und nehmen zugleich ihre wesentliche Einheit wahr. Das weiß schon die Alltagssprache. Insofern sind auch in der Alltagssprache Metaphysik und Theologie anwesend. Sie ist in der Lage, gewissermaßen alles zu denken. Und an allem und jedem ist sie fähig, Transzendenz zu erblicken und darüber zu staunen. Wird uns irgendeine Wirklichkeit gerade als eine Wirklichkeit bewusst, so entsteht das auf Gott gerichtete Erstaunen. Dies genügt, um erneutes, das Konkrete jeweils aufhebendes Verlangen zu erwecken. Nicht eine irgendwie geartete Gotteserfahrung, sondern eigentlich ein Gotteserstaunen bildet die Grundlage von Religion in der Welt des Menschen. Der letzte Sinn des Lebens in der Welt besteht nicht im Erfahren von Glück, sondern in der unaufhörlichen Entwicklung des Strebens nach Glück – das ist das Menschenrecht. Auch die vorläufigen Freuden dienen schließlich nicht der Erfüllung, sondern eher der Stärkung des ‚homo viator‘, des pilgernden Menschen. Leben im Glauben ist Leiden des Dürstenden.29 Menschen können der Wirklichkeit auf solche Weise begegnen, dass sie Wirklichkeit als Wirklichkeit erkennen. Wenn wir uns über die Wirklichkeit wundern, dann ist das ein Verweis auf den Schöpfer. Das Staunen über die Wirklichkeit erkennt die Unerkennbarkeit Gottes. Wir wissen von Gott und, noch mehr, wir verlangen nach ihm. Im Staunen werden Erkenntnis und Verlangen miteinander verbunden. Die fundamentalste Form dieses religiösen Verlangens kommt als ein Staunen vor. 28 Vgl. ebd., q. 3, a. 4, ad 2; De potentia, q. 7, a. 2, ad 7; Summa contra gentiles, I, c. 12, n. 7. 29 Vgl. Carl Friedrich von Weizsäcker, Aufbau der Physik, München 1985, S. 633: „Die naturwissenschaftlich realistischste – sc. Sichtweise des Lebens – : Leben ist Durst und Leiden.“ Erfahrung und Erkenntnis Gottes – zur Wahrnehmung der Wahrheit 3 135 Konkret Ist das zu abstrakt? Dann gehen wir konkret vor. Die Lehre der Unerkennbarkeit Gottes ist zwar abstrakt, aber dennoch ist sie eine Lehre über unser konkretes Leben. Schon die Idee des Konkreten verwirklicht diese Erkenntnis. Das Konkrete führt uns zu demselben Ergebnis. Um Gott kommt man in dieser konkreten Welt nicht herum. Was bedeutet ‚konkret‘? Und was erkennen wir, wenn wir etwas als konkret erkennen? Erfahrung ist ‚konkret‘, das heißt, sie beruht auf dem ‚Zusammenwachsen‘ von Existenz und einer Sammlung von Eigenschaften, sagen wir: einer Washeit. ‚Dass‘ etwas ist und ‚was‘ es ist. Die beiden Begriffe ‚konkret‘ und ‚abstrakt‘ stammen historisch aus der christlichen Theologie und gehören heute – bemerkenswerterweise – fast zur Alltagssprache. Historisch betrachtet ist die Tatsache interessant, dass die Alltagssprache die ursprüngliche Stellung der beiden Begriffe zueinander geradezu umgedreht hat. Ein Nicolaus Cusanus konnte Gott als „die abstrakteste Tugend“30 bezeichnen, was bedeutet, dass er alle Tugenden in sich umfasst. Für uns heute besitzt das Konkrete mehr Realität als das Abstrakte. Ursprünglich war das umgekehrt. Die Urheber des Begriffs ‚konkret‘ haben damit das Geschöpf gemeint, das heißt das Nichtgöttliche. Heute wollen manche Gläubige Gott konkret haben. Im Bewusstsein vieler Theologen trägt das Wort ‚abstrakt‘ eine negative Konnotation. So wird etwas zurückgewiesen, gerade weil es abstrakt ist. Die Naivität dabei ist beachtenswert und bemitleidenswert. Der mit dem Wort ‚konkret‘ verknüpfte Denkfehler besteht gerade in der einfachen Annahme, dass dem Konkreten mehr Realität zukommt als dem Abstrakten. Das Abstrakte gilt uns als abgehoben, als abgelöst von der Realität, als wirklichkeitsarm. Abstraktionen mögen intellektuell anspruchsvoll sein, aber sie erscheinen aus heutiger Sicht eher wirklichkeitsfremd und trocken. Hingegen hat ‚konkret‘ ausgesprochen positive Konnotationen. Zu dem Begriff ‚konkret‘ stellt August Seiffert in seiner umfangreichen Studie fest: „Dieses Wörtchen wird zum philosophischen Allheilmittel, zum lobenden Prädikat schlechthin.“31 Die Begriffsgeschichte kann ungemein aufklärend wirken. In seinem Artikel zum Stichwort Abstrakt/konkret im Historischen Wörterbuch der Philosophie erklärt Ludger Oeing-Hanhoff: „Dieser Sprachgebrauch, nach dem ‚abstrakt‘ einseitig, leer, undialektisch, ‚konkret‘ wirklich, erfüllt, vollständig bestimmt meint, ist 30 Nicolaus Cusanus, Sermo XXIX, Nr. 9, Z. 8: „Deus enim ipsa virtus est abstractissima.“ 31 August Seiffert, Concretum. Gegebenheit – Rechtmäßigkeit – Berichtigung, Meisenheim am Glan 1961, S. 124. 136 William J. Hoye von Marx und vom Marxismus aufgegriffen worden und allgemein in die Sprache eingegangen.“32 Geht man aber zum Ursprung der Philosophie zurück, so stand es außer Frage, dass das Abstrakte mehr Wirklichkeit als das Konkrete besitzt. Dass die platonischen Ideen mehr Wirklichkeit als die konkreten, schattenhaften Dinge haben, lag auf der Hand. Doch schon Platon sah die verführerische Gefahr, die vom Konkreten ausgeht. Die Bewohner der Welt der Schatten, der Abbilder, fühlen sich in seinem Höhlengleichnis im Konkreten wohl und wehren sich geradezu gegen eine Befreiung durch jemanden, der die Abbilder als Abbilder durchschaut hat, indem er den anstrengenden Aufstieg der Abstraktionsstufen gegangen ist. Die Angeketteten greifen den Philosophen, der sie befreien will, an, sie lachen ihn aus und „wenn man seiner habhaft wird und ihn töten kann, so wird man ihn töten“, konstatiert Platon.33 Sie sind, wie Dionysius Areopagita sagt, in den konkreten Realitäten gefangen. Ihre Fesseln sind genau diese Realitäten. Anders ausgedrückt: Sie weigern sich, die tiefergehende Frage der platonischen Philosophie zu stellen, was denn die konkreten Realitäten eigentlich sind. Im Laufe der Zeit hat die platonische Sicht eine diametrale Umkehr erfahren. Für uns sind die Ideen nur Gedanken und die Gedanken der Dinge sind Abbilder. Der Tisch aus Holz, der hier und jetzt vor mir steht, gilt uns als wirklicher als der allgemeine Begriff ‚Tisch‘. Für Platon aber war es anders. Während der Begriff ‚Idee‘ früher den höchsten Grad an Wirklichkeit beinhaltete, sprechen wir ihm heute geradezu den geringsten Grad zu, wie etwa in dem Ausspruch: ‚Kannst du bitte eine Idee lauter sprechen?‘ Platon ist diesem natürlichen Umstand in seinem Höhlengleichnis dadurch entgegengetreten, dass man sich von den Schattenbildern an der Wand wegdrehen muss, um tiefer in ihr Wesen vorzudringen. Die Frage ‚Was ist das eigentlich?‘ bekommt eine Antwort, indem man eine ganz andere Perspektive einnimmt: Man dreht sich regelrecht um und erkennt, was sie sind. Sie sind ‚Abbilder‘, das heißt, man entdeckt nicht ein neues Eidos, sondern eine andere, ‚höhere‘ Wirklichkeitsweise desselben Eidos. Das Pferd aus Schatten, aus Ton und aus Fleisch verändert nicht das Wesen des Pferdes, sondern nur dessen Sein. Unter anderem steckt das alles in dem Ausdruck ‚Teilnahme‘. Die Stufen der hier gemeinten Abstraktion verlassen das Konkrete keineswegs. Dieses Bild von der Ironie der Abstraktion wird freilich leicht missverstanden. Die Abkehr von der konkreten Realität durch Abstraktion wird oft als ein Abrücken 32 Ludger Oeing-Hanhoff, Art. Abstrak/konkret, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 1, Basel 1971, Sp. 34 ff., hier Sp. 41. 33 Platon, Der Staat, 517a. Erfahrung und Erkenntnis Gottes – zur Wahrnehmung der Wahrheit 137 von der Wirklichkeit der konkreten Realitäten ausgelegt – und dann üblicherweise verspottet, genau wie Platon es prophezeit hat. In Wahrheit geht dabei die Individualität des Einzelfalls aber mitnichten einfach verloren. Die Beziehung zwischen Wirklichkeit und Washeit kommt im Begriff ‚konkret‘ zutreffend zur Sprache. Sie ist freilich etwas anderes als eine platonische Urbild-Abbild-Beziehung. Das kann schon ein komplexer Begriff, zum Beispiel ein Substantiv mit Adjektiven, ausdrücken. Was aber tatsächlich wahrgenommen wird, ist ein verwirklichter ‚Begriff‘, das heißt etwas Existierendes. Was das Wort ‚konkret‘ meint, ist etwas Wirkliches, etwas real Existierendes, etwas, das es gibt. Das ist wohlgemerkt mehr als ein Einzelfall von etwas Allgemeinem. Begriff und Wirklichkeit wachsen im Konkreten zusammen, indem ein Begriff an der Wirklichkeit teilnimmt. Die Erfassung einer Wirklichkeit geschieht existentiell schon in der elementaren Wahrnehmung. In ihr ist Wirklichkeit unmittelbar gegenwärtig. Erfahrung befindet sich per se schon in der Wirklichkeit, und der Inhalt einer Erfahrung ist immer schon eine Wirklichkeit. Selbst wenn ich fortschreitende Vorstellungen von Vorstellungen bilde – also nicht die objektivierte Wirklichkeit beachte, sondern die Erkenntnis davon, den Gedanken –, geschieht der Ablauf im Horizont der Wirklichkeit. Ich nehme wirkliche Gedanken wahr, ich nehme Bewusstsein wahr. Aber ‚die‘ Wirklichkeit selbst bleibt gleichsam reine Transzendenz, jenseits von Erfahrung. Dabei kommt es darauf an, dass das Konkrete und das Abstrakte nicht als zwei getrennte Bereiche, gleichsam zwei Stockwerke, gesehen werden. Vielmehr gilt Abstraktion als die spezifisch menschliche Weise, Konkretes zu erfassen: „Unser Bewusstsein ist imstande, in einer Abstraktion das zu betrachten, was es in Konkretion kennt“,34 und zwar im Hinblick auf die das Konkrete kennzeichnende Doppelstruktur, nämlich die konkrete Washeit einerseits sowie deren konkrete Existenz andererseits. Während das Tier – zumindest allem Anschein nach – tatsächlich restlos im Konkreten lebt und mit ihm eins ist, kennen wir Menschen, wenn wir mit dem Licht des Bewusstseins reflektieren, das Konkrete als konkret. Die Unterscheidung zwischen ‚konkret‘ und ‚abstrakt‘ ist charakteristisch für die spezifisch menschliche Weise, der Wirklichkeit zu begegnen. Das Konkrete als konkret zu erkennen ist aber an sich eine Leistung unserer Abstraktionsfähigkeit. Man kann es abschließend so ausdrücken: wir sind deshalb unfähig, Gott zu erkennen, weil wir unser Sein nicht ‚sind‘, sondern es nur ‚haben‘.35 Das heißt: Weil 34 Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, q. 12, a. 4, ad 3. 35 Vgl. ebd., a. 4, corpus. 138 William J. Hoye wir konkret sind. Die Reflexion, die das Konkrete als solches wahrnimmt, ist dieselbe Reflexion, die dem Erlebnis und dem Staunen zugrundeliegt. Jetzt möchte ich zum Schluss versuchen zu zeigen, dass sie ebenfalls mit der Wahrheitswahrnehmung, die in Aussagesätzen zum Ausdruck kommt, identisch ist. 4 Aussagesätze Auch Wahrheiten verkörpern einen Verweis auf den unerkennbaren Gott. Wahrheiten werden in Aussagesätzen artikuliert. Unser Kontakt mit der Wirklichkeit als solcher artikuliert sich in Form von Sätzen. Die Struktur des Aussagesatzes gibt die Struktur der Wirklichkeiten wieder. Ohne dabei auf Gott verwiesen zu werden, können wir keinen Satz denken. Natürlich steht es außer Frage, dass Wahrheit mit Sätzen zu tun hat. Oft wird Wahrheit geradezu als eine Eigenschaft von Sätzen definiert; demnach ist Wahrheit eine Qualität von Sätzen, nämlich in dem Sinne, dass diese Zutreffendes über die Realität aussagen. Der Zusammenhang ist auf jeden Fall sehr eng. Doch in philosophischer Rückbesinnung auf das Elementare und Selbstverständliche kann man fragen: Warum gibt es überhaupt die prädikative Satzform? Was macht ihre so fundamentale Bedeutung aus? Warum gibt es überhaupt Sätze, Begriffe? Besonders die tiefere Frage nach der Verbindung, nach dem Grund der Satzeinheit drängt sich auf. Woher kommt es, dass gerade diese Einheit von Subjekt und Prädikat ausgerechnet mit Wahrheit zu tun hat, und zwar mit Wahrheit, die eine Zweiwertigkeit aufweist: ein Aussagesatz ist entweder wahr oder falsch. Warum besteht ein Satz aus zwei Elementen, und nur zwei? Was macht eigentlich die Einheit der Satzintention aus? Woran liegt es, dass, während Sätze einen Wahrheitswert haben können, Begriffe, gleich wie komplex, dazu nicht fähig sind? Worin besteht „der Grund der Subjekt-Prädikat-Struktur des Satzes“?36 Außerdem lässt sich die Frage stellen: Ist Wahrheit eine Eigenschaft von Sätzen, oder aber, umgekehrt, sind Sätze eine Eigenschaft von Wahrheit, deren Ausdruck? Vielleicht sagen Sie: Ein Satz besteht aus zwei Begriffen, das heißt aus zwei Wahrnehmungen – Subjekt und Prädikat – ; durch die Verbindung der Begriffe entsteht die Wahrheitsfähigkeit. Damit befindet man sich zwar auf dem richtigen Weg, aber so einfach ist der Sachverhalt doch nicht. 36 Carl Friedrich von Weizsäcker, Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie, München 1977, S. 306. Erfahrung und Erkenntnis Gottes – zur Wahrnehmung der Wahrheit 139 Man kann auch komplexe Begriffe konstruieren: zum Beispiel, ‚der fliegende Vogel‘, aber die adjektivische Verbindung kann nicht wahr oder falsch sein – ganz egal wie komplex man den Begriff macht. Der Ausdruck ‚Der Vogel fliegt‘ jedoch kann wahr oder falsch sein. Was ist passiert? Worin liegt der Unterschied? Über Sätze müsste man sich wundern. Ist es nicht erstaunlich, dass ein solches sprachliches Gebilde in der Welt überhaupt vorkommt? Die Einheit besteht jedenfalls nicht lediglich darin, dass Begriffe miteinander vereinigt werden. Ein Satz ist zwar auch ein komplexer Begriff – aber in der Weise der inneren Verbindung liegt der wesentliche Unterschied, der die Einheit wahrheitsfähig macht. Carl Friedrich von Weizsäcker hat darauf hingewiesen, dass Sätze ursprünglicher als Begriffe sind, wie Wörter ursprünglicher als die Buchstaben sind, aus denen sie bestehen. Zu recht erkennt er, dass es eine nachträgliche Leistung des Denkens ist, einen Begriff als Begriff ins Auge zu fassen. Ursprünglich, gleichsam im natürlichen Zustand, nehmen wir zugleich den allgemeinen Begriff und das einzelne Ding als eins wahr. In zumindest ähnlicher Weise können auch Tiere wahrnehmen. Der Mensch aber vermag die ursprüngliche Wahrnehmung so zu zerteilen, dass er zwischen Subjekt und Prädikat wie zwischen Begriff und begriffenem Ding unterscheiden kann. Wichtig zu bemerken ist, dass diese analytische Leistung nachträglich geschieht. Es handelt sich um eine Vergegenständlichung der Wahrnehmung durch das Denken. Die Wahrnehmung selbst ist an sich prädikativ, das heißt eine komplexe Einheit, die in Form eines Satzes aussprechbar ist. Erfahrung ist prädikativ. Wie kommt dabei nun diejenige Einheit zustande, welche Wahrheit ist? In der Duden Grammatik gibt es eine überraschende Analyse des Satzes, die die alten, aristotelischen Begriffe Möglichkeit und Wirklichkeit verwendet. Die Duden-Grammatik spricht von einer „Spannung zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit, die allen Sätzen eigentümlich ist“37. Die Subjekt-Prädikat-Zweiheit wird ferner als eine Aufspaltung der Wirklichkeit gesehen: „Diese Aufspaltung einer zunächst nur komplexhaft wahrgenommenen besonderen Wirklichkeit in ein Etwas und in eine verhaltensmäßig geprägte Aussage über dieses Etwas ist allen unseren Sätzen eigentümlich. Erst durch die Gestaltung der Aussage schafft sich die Sprache die Möglichkeit, das gesamte Sein und Geschehen unter bestimmten Sehweisen zu bewältigen“. An den Aussagen „erkennen wir am deutlichsten den geistigen Zugriff unserer Muttersprache gegenüber dem Sein und Geschehen in der Welt.“38 Das Subjekt des Satzes stellt eine Möglichkeit dar, das heißt, es umfasst viele Möglichkeiten 37 Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Mannheim 1966, S. 471. Hervorhebung im Original. 38 Ebd., S. 468. 140 William J. Hoye wie gleichsam ein Oberbegriff. Das Prädikat ist die Konkretisierung auf eine einzige Möglichkeit. Der Duden nennt das Prädikat die „Satzaussage“ des Aussagesatzes.39 Wenn ich zum Beispiel sage: ‚Der alte schlafende Hund‘, empfindet man eine Spannung; es müsste ja mehr kommen. Es gibt mehrere Möglichkeiten und man weiß nicht, welche zutrifft. Wenn ich aber sage: ‚Der Hund schläft‘, dann ist der Gedanke abgeschlossen – Punkt – und besitzt nun die Fähigkeit, wahr oder falsch zu sein. Das Prädikat verwirklicht eine dieser Möglichkeiten.40 Ein Aussagesatz stellt auf diese Weise einen Wahrheitsanspruch. Begriffe können mit beliebig vielen Adjektiven versehen werden; sie werden dadurch nicht wahrheitsfähig. ‚Prädikat‘ und ‚Adjektiv‘ sind etymologisch ähnlich und könnten von vornherein dieselbe Bedeutung haben, aber der tatsächliche Unterschied ist doch wesentlich. Ähnlich auch bei ‚Subjekt‘ und ‚Substantiv‘; von ihrer Etymologie her könnten sie gleichbedeutend sein, aber in Wirklichkeit ist das eine Wort mit Wahrheit verknüpft und das andere nicht. Begriffe und Sätze sind gleichsam Werkzeuge, mit denen wir die Wirklichkeit um uns erfassen, in Besitz nehmen, bearbeiten und so weiter. Abstraktion ist eigentlich eine existentielle Tätigkeit mitten in der Wirklichkeit. Auch Weizsäcker beschreibt den Vorgang der Bildung eines Satzes als ein ‚Zugreifen auf die Wirklichkeit‘.41 Weiterhin verdeutlicht die satzhafte Struktur sinnbildlich die Entzweiung, die Gebrochenheit, die unsere Wahrheiten charakterisiert. Gerade weil wir Wahrheit immer nur satzhaft erreichen, ist menschliche Wahrheit stets unzulänglich, und zwar in sich selbst. Die zweiteilige Satzhaftigkeit ist auch unsere Unzulänglichkeit. Unsere Wahrheit ist Einheit aus Zweiheit, also: gebrochen, verfremdet, bruchstückhaft, rätselhaft. In jeder Wahrheit steckt eine neue docta ignorantia. Ein Satz ist die Einheit von Wirklichkeit und Möglichkeit, das heißt, dass eine Wirklichkeit als die Wirklichkeit einer Möglichkeit als Möglichkeit gesehen wird. Das heißt, dass uns die verwirklichte Möglichkeit in der Wahrnehmung ihrer Wirklichkeit gegenwärtig ist. Es handelt sich um eine zweifache Mit-Wahrnehmung. 39 Ebd., S. 471. 40 Ebd.: „Da durch das erste Satzglied zunächst nur das Seiende hingestellt wird, über dessen Verhalten das zweite Satzglied etwas aussagt, nennt man das erste Glied Subjekt …, das zweite Satzglied Prädikat. Das Subjekt stellt aus der Fülle der benannten wirklichen oder gedachten Dinge der Welt, ein Etwas im unabhängigen Kasus des Nominativs hin, wobei offen bleibt, was über dieses Etwas ausgesagt werden soll“. Hervorhebung im Original. 41 Weizsäcker, Garten des Menschlichen, a. a. O., S. 303: „Die Zweiwertigkeit, die Zerlegbarkeit der Wirklichkeit in Alternativen ist nicht eine Eigenschaft, die uns die Welt ohne unser Zutun zeigt; sie ist die Weise, wie wir auf die Wirklichkeit – erfolgreich – zugreifen. Der Verstand ist machtförmig. Die zweiwertige Logik gilt aber nur für reflektierte Aussagen; durch den Zugriff des Zweifels (des Sehens zweier Möglichkeiten, Zwiefalt = Zweifel) werden jeweils isolierte schlichte Aussagen zu reflektierten Aussagen.“ Hervorhebungen im Original. Erfahrung und Erkenntnis Gottes – zur Wahrnehmung der Wahrheit 141 Damit zeichnet sich eine absolute Beschränkung menschlicher Erkenntnis ab. Das ist entscheidend für die Behauptung der Unüberbietbarkeit der Einsicht in die göttliche Unerkennbarkeit. Dass es im Grunde zwei und nur zwei Arten von Erkenntnis gibt, leuchtet ein, wenn man bedenkt, dass wir schließlich nur zwei Grundarten von Bewusstsein kennen, nämlich – man kann es so ausdrücken – Bewusstsein und Selbstbewusstsein, mit anderen Worten, die Gegenwart eines Inhalts und die Reflexion derselben. Damit sind die zwei Teile des Aussagesatzes begründet. Diese Dualität kann sich natürlich auf vielen Stufen fortsetzen – beispielsweise: ich bin mir bewusst, dass ich mir bewusst bin, dass ich jetzt diesen Satz schreibe – , aber ihre Doppelstruktur hält sich repetitiv durch. Selbstbewusstsein, im eigentlichen und ursprünglichen Sinne, ist nach Thomas schließlich nichts anderes als ein weiterer Aspekt desselben Vermögens, durch das wir Existenz wahrnehmen. „Es ist unmöglich zu sagen, dass unsere Seele durch sich selber begreift, was sie ist … Unser Geist kennt sich selber durch sich selber insofern, als er über sich weiß, dass er ist. Denn von daher, dass er wahrnimmt, dass er tätig ist, nimmt er wahr, dass er ist.“42 Demgemäß ist auch ein unmittelbares Wissen des eigenen Wesens unmöglich. Menschliches Selbstbewusstsein ist indirekt. Wir erkennen uns immer nur anhand von bewussten Vorgängen. Es ist genau diese Zusammensetzung von Washeit und Dasein, die von uns als ein Seiendes – ens – , das heißt als eine konkrete Entität im Besitz einer bestimmten Natur, erfahren wird.43 Wirklichkeit im konkreten Sinne, ‚ens‘, ist der Horizont von aller Erfahrung und Erkenntnis des Menschen. Zwar nicht jeder Gedanke, der bei uns vorkommt, aber doch jeder Gedanke, der bewusst vorkommt – einschließlich des Selbstbewusstseins – ist durch diese Struktur bestimmt. „Damit Erkenntnis vorkommt, müssen zweierlei zusammenkommen: nämlich eine Wahrnehmung und ein reflektierendes Urteil über das Wahrgenommene.“44 Washeiten, durch Apprehension vermittelt, können zwar bis ins Unendliche variieren, aber es wird, dank der Mitbestimmung der Wahrnehmung der Existenz, immer und ausnahmslos ein Seiendes sein, das wir faktisch erfahren beziehungsweise erkennen. „Von Natur her erkennt man in jedweder Erkenntnis 42 Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, III, c. 46, n. 2; n. 8. Vgl. Ders., Super III Sententiarum, dist. 23, q. 1, a. 2, ad 3; Ders., De veritate, q. 10, a. 8; Ders., Summa theologiae, I, q. 87, a. 1; a. 3. 43 Thomas von Aquin, Super Colossenses, c. 1, lectio 4, Anfang: „Omnis cognitio terminatur ad existens, id est ad aliquam naturam participantem esse.“ 44 Thomas von Aquin, De veritate, q. 10, a. 8, corpus: „Ad cognitionem enim duo concurrere oportet: scilicet apprehensionem, et iudicium de re apprehensa.“ 142 William J. Hoye ein Seiendes.“45 Erfahrung ist ‚konkret‘, das heißt, sie beruht auf dem ‚Zusammenwachsen‘ von Existenz und Washeit. Für Thomas von Aquin bedeutet ‚konkret‘ eben nicht allein ein Ganzes von Eigenschaften, Washeiten, die ein Individuum hinlänglich bestimmen. Erst deren Existenz, deren Verwirklichung, schafft etwas Konkretes. Existenz ist etwas Einzigartiges, völlig verschieden von den Wesenseigenschaften, die sie verwirklicht. Somit umfasst ‚ens‘ die einzigartige Erfahrung der Existenz und steht überhaupt nicht auf der Leiter der übrigen Abstraktionen. Der Begriff ‚Gotteserfahrung‘ stellt von daher einen inneren Widerspruch in sich dar. Gar von einer ‚konkreten‘ Gotteserfahrung zu sprechen, wie manche Theologen es heutzutage gerne tun, müsste auf Thomas geradezu wie ein Oxymoron wirken.46 Wenn es die Verfremdungsfähigkeit der Sprache nicht sprengen würde, wäre es eigentlich weniger unangemessen, statt überhaupt von einem Gottesbegriff – den es gar nicht geben kann – , eher von dem Gottessatz zu sprechen. Vor diesem eben skizzierten Hintergrund muss die thomistische Lehre über die Unerkennbarkeit Gottes betrachtet werden. Wenn Thomas sagt, dass das Wesen Gottes sein Sein sei,47 dann ist die durch eine solche Behauptung gestiftete Verwirrung vermutlich beabsichtigt. Ebenso wenn er behauptet, Gott habe nicht sein Sein, sondern sei sein Sein, oder, mit anderen Worten, Gottes Sein subsistiere in sich und inhäriere nicht einem von ihm unterscheidbaren Wesen,48 dann ist das wohl direktes Einführen in das Unfassbare. Wer seine Anspielungen auf die Doppelstruktur menschlicher Erkenntnis nachvollzieht, erlebt selbst im eigenen Denken den Anstoß zur streng theologischen Betrachtungsebene. Gerade als das Sein selbst – ohne Möglichkeit – bleibt Gott an sich für uns unerkennbar. Dessenungeachtet ist er der Grund der Erkennbarkeit alles Erkennbaren. In allem, was wir erkennen, erkennen wir Gott implizit.49 Gerade wegen seiner übermäßigen Erkennbarkeit ist Gott an sich für uns in unserem zeitlichen und zusammengewachsenen Zustand unerkennbar, zumal er als Grund der Erkennbarkeit des Einzelnen auf einer anderen Ebene steht.50 Die göttliche Unerkennbarkeit ist also etwas Positives. Gott ist nicht ein Seiendes, eine Wirklichkeit, da er nicht aus 45 Thomas von Aquin, De natura generis, 2: „Ens in quolibet cognito naturaliter cognoscitur.“ 46 Vgl. beispielsweise Oeing-Hanhoff, Art. Abstrakt/konkret, a. a. O., Sp. 42. 47 Vgl. beispielsweise Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, q. 3, a. 4; Ders., Summa contra gentiles, I, c. 22. 48 Vgl. Thomas von Aquin, De potentia, q. 7, a. 2, ad 7; ad 5. 49 Thomas von Aquin, De veritate, q. 22, a. 2, ad 1: „Omnia cognoscentia cognoscunt implicite Deum in quolibet cognito.“ 50 Thomas von Aquin, Quodlibet VII, q. 1, a. 1, ad 1: „Essentia divina non est quid generale in essendo, cum sit ab omnibus aliis distincta, sed solum in causando; quia id quod est per Erfahrung und Erkenntnis Gottes – zur Wahrnehmung der Wahrheit 143 Washeit und Existenz zusammengesetzt ist, aber er ist auch nicht einfach kein Seiendes, sondern eigentlich ein Über-Seiendes, um es neuplatonisch auszudrücken.51 Wir erkennen zwar Wirklichkeiten, aber nur aufgespalten, das heißt, jede Wirklichkeit nehme ich als die Verwirklichung einer Möglichkeit, also als konkret wahr. Mit anderen Worten: Eine Möglichkeit erhält Wirklichkeit. Das ist Schöpfung. Somit weiß ich implizit von reiner Wirklichkeit, ohne Möglichkeit. In solchem Dämmerlicht kommt mir ‚die‘ Wirklichkeit zum Bewusstsein. Ich erwache zur Wirklichkeit. Wer prädikativ, satzhaft schaut, ist zur Wirklichkeit überhaupt erwacht. Die Alltagssprache kann ‚Wirklichkeit‘ nicht definieren, nicht begreifen – ebensowenig wie die Wahrheit. Dennoch wissen wir alle zuverlässig zu unterscheiden zwischen Wirklichkeiten – die immer konkret sind – und der Wirklichkeit selbst – die nie im Plural vorkommen kann. Gerade deshalb, wie Thomas sagt, weil er nicht eine Wirklichkeit ist, sondern die Wirklichkeit selbst – nicht ein ‚ens‘, Seiendes, sondern das ‚esse‘, Sein – , bleibt Gott unerkennbar. Zusammenfassend lässt sich die These meiner Ausführungen über den Satz wie folgt formulieren: Sätze verweisen auf Gott als den Unerkennbaren. Eine alte theologische Tradition sagt, wir wissen nicht, was Gott ist, aber wir wissen, dass er ist. Unser Wissen von der Existenz Gottes ist aber nicht eine Art Gotteserfahrung; wir erfassen die Existenz Gottes nicht. Was wir Thomas von Aquin zufolge wissen, ist, dass der Satz ‚Gott existiert‘ wahr ist. Als Ergebnis ist ein knapper Satz wohl enttäuschend wenig. Aber mehr brauchen wir nicht in diesem Leben. Eigentlich könnte mehr schon zu viel sein. Hier, das heißt in diesem Leben, geht es nicht darum, Gott zu erkennen – das ist ewiges Leben –, sondern Gott zu lieben, nach ihm zu streben, auf ihn hingeordnet zu sein. Das geschieht in der Welt und durch die Welt. Dafür genügen uns die Wirklichkeiten um uns herum. Gott ist aber nicht eine davon, neben anderen. Wir müssen nicht einen Spagat zwischen Gott und der Welt vollführen. Religion impliziert nicht, dass wir unsere Zeit und Aufmerksamkeit zwischen Gott und den Wirklichkeiten der Welt aufteilen müssen. Jetzt befinden wir uns in der konkreten Wirklichkeit. Wie Thomas es einmal ausgedrückt hat: Gott ist nicht der Inhalt der Religion, sondern ihr Ziel.52 se, est causa eorum quae per se non sunt. Unde esse per se subsistens est causa omnis esse in alio recepti. Et ita essentia divina est intelligibile quod potest determinare intellectum.“ 51 Thomas von Aquin, Summa theologiae, I, q. 12, a. 1, ad 3: „Deus non sic dicitur non existens, quasi nullo modo sit existens: sed quia est supra omne existens, inquantum est ipsum esse. Unde ex hoc non sequitur quod nullo modo possit cognosci, sed quod omnem cognitionem excedat.“ 52 Thomas von Aquin, Summa theologiae, II–II, q. 81, a. 5, ad 2. Jenseits des Seins? Zur ontologischen Begründung der Frage nach Gott Dominicus Trojahn Die Absichten dieses Aufsatzes sind in schwindelerregendem Maße beschränkt. Der Verfasser erlaubt sich, die Aporie zu zitieren – und sich zu eigen zu machen, mit der Hans Blumenberg seinen Leser zu Beginn des VII. Kapitels seiner posthum publizierten Beschreibung des Menschen: VII. Anthropologie: Ihre Legitimität und Rationalität in Stellung bringt: „Das Unbehagen am Zustand und Resultat des wissenschaft lichen Prozesses, das spürbar um sich gegriffen hat, lässt sich auf die anekdotische Form1 zurückführen, dass am Ende einer über Jahrhunderte sich erstreckenden theoretischen Anstrengung die ratlose, fast unheimliche Frage sich stellt: Was wollten wir überhaupt wissen?“2 Die Frage nach Gott hat eine lange Geschichte, und manches weist darauf hin, dass wir diese Geschichte nur teilweise kennen. Das hat weniger damit zu tun, dass deren Beginn im Dunkeln liegt – was er zweifellos tut – , sondern vielmehr damit, dass sie noch nicht zu ihrem Ende gelangt ist. Über Gott ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Im Gegensatz zu allen anderen Geschichten jedoch, die Menschen einander erzählen und deren Teil sie schließlich selber sind, gibt es im Falle der Geschichte des Gott-bezüglichen Fragens zwei gewichtige Unterschiede: Erstens folgt aus der Einfachheit des göttlichen Wesens – ob es den Theologen gefällt oder nicht – eine narrative Resistenz, die dazu führt, dass Gott sich aller Geschichten, weil jeder 1 2 Der Hinweis auf die ‚anekdotische Form‘ spielt an auf den Roman Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams: Der Computer Deep Thought beantwortet nach einer Rechenzeit von 7,5 Millionen Jahren mit der Zahl 42 eine Frage, deren genauer Inhalt nicht mehr in Erfahrung gebracht werden kann: ‚I think the problem, to be quite honest with you, is that you’ve never actually known what the question is.‘ Erläuterung vom Verfasser. Hans Blumenberg, Beschreibung des Menschen. Aus dem Nachlaß, hg. v. Manfred Sommer, Frankfurt a. M. 2006, S. 478. 145 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7_8 146 Dominicus Trojahn Geschichte entzieht. Daher kann gesagt werden, an ihm fände selbst die All-Macht der ‚schwarzen Magie‘3 ihre Grenze. Zudem – was hier jedoch nur im Vorübergang Erwähnung findet – steht im Falle der Frage des Menschen nach Gott zu vermuten, Gott wäre dabei, also im Akt des Fragens selbst, einer Alternation unterworfen, mithin einer Veränderung dessen, das er sich selbst gegenüber ist: wenn er nämlich in das Okular einer Frage gestellt und gezogen wird, und dort als Objekt – des Fragens – zustande kommt. Das wäre in etwa das, von dem Meister Eckhart spricht, wenn er sagt, Gott sei durch die Schöpfung – erst – zu Gott geworden.4 Immerhin muss doch mit aller Akribie nachgefragt werden, als ‚nach was‘ der Mensch fragt, wenn er Gott in Frage stellt.5 Doch ist – andererseits – der Mensch dem Interesse und der Absicht seiner Frage nach wandelbar und unbeständig, weshalb es zwar durchaus eine Geschichte der Frage nach Gott oder des nach Gott fragenden Menschen, jedoch – wie gesagt – keine Geschichte Gottes geben kann. So wird man es am Ende bezüglich der hier benannten Unabgeschlossenheit vorziehen, von einer Geschichte des im Horizont der Frage nach Gott nach sich selbst fragenden Menschen zu sprechen. Der andere diesbezügliche Unterschied betrifft den Gang dieser Geschichte selbst. Während wir uns im Verlaufe des 19. Jahrhunderts angewöhnt haben, Geschichte mit Entwicklung – also Evolution – gleich zu setzen, vermuten wir – kraft dieses Verständnisses der Zeit als der Zahl der Fortschritt generierenden Bewegung – , der Sinn der Zeit – wenn Zeit zeitlich überhaupt einen Sinn hat – verliefe vom Einfachen 3 Karl Kraus, Der Untergang der Welt durch schwarze Magie, Wien u. Leipzig 1922, S. 486: „Nur in ihr hat eine Jugend Spielraum, ihre erlebte Unfähigkeit zur Größe nicht in zitterndem Schweigen zu begraben, sondern mit respektlosem Schwall sich vor dem Unerreichbaren bemerkbar zu machen und in jämmerlich ungelogener Furcht vor dem Geist ihm soziale Talente gegenüberzustellen, dem Ideal das selbst dieser Sorte einmal Erreichbare: den Rekord. Der Himmel des Heute ist die Zuflucht dieser nunmehr von einem Englischen Clown der Gottlosigkeit bedienten Schwäche, und der Trost dieses Shaw, der am Sterbebett der Menschheit seine Lazzi macht, hat schon manchem Leib über die Unbequemlichkeit des Glaubens hinweggeholfen. Mit einem Witz, der den Zweck des Lebens mit dem Zweck eines Gebrauchsgegenstandes verwechselt, setzt sich die maßlose Banalität über das hinweg, was sie mit dem Mikroskop nicht wahrnehmen kann: die Größe.“ 4 Meister Eckhart, Expositio libri Genesis, c. I, v. 1, in: Ders., Die lateinischen Werke, 5 Bde, Stuttgart 1936 ff., Bd. 1, hg. v. Konrad Weiß, 1940, S. 190: „Ait ergo Moyses deum coelum et terram creasse in principio absolute primo in quo deus ipse est, sine quolibet medio et intervallo. Unde cum quaereretur a me aliquando quare deus primus mundum non creasset, respondi quod non potuit, eo quod non esset.“ Hervorhebung vom Verfasser. 5 Vgl. Thomas von Aquin, STh I, q. 2, a. 2 ad 2: „Quia ad probandum aliquid esse, necesse est accipere pro medio quod significet nomen, non autem quod quid est: quia quaestio quid est, sequitur ad quaestionem an est. Nomina autem Dei imponuntur ab effectibus.“ Vgl. Ders., STh I, q. 3, a. 4 ad 2. Hervorhebung vom Verfasser. Jenseits des Seins? 147 zum Komplexen, und die in’s mehr strebende Zahlenreihe bezeichne daher zugleich – einmal als historische genommen – den Skalenwert einer auf der Innovationslinie vermerkten Position im Ranking der Optimierungen. Hatten Generationen von Menschen die Zeit als katabole Bedrohung jeder Sinnsetzung erfahren, so findet sich die Zeit kraft eines revolutiven Umschwungs gigantischen Ausmaßes nun als Anabolikum jener Dynamiken wieder, die den Menschen als Kulturwesen vorantreiben. Was immer geschieht lässt sich derart, einmal als Ereignis, das heißt als die jeweilige, partikulare Erscheinung einer diachronen Total-Bewegung verstanden, deren Sinn nicht im Ziel, sondern der verlässlichen Gestimmtheit der Bewegung selbst liegt, verstehen, das heißt hier: einordnen. So gesehen kann dann der Kalender als Index des Fortschrittes recht praktisch gebraucht werden, indem die je höhere Jahreszahl zugleich den je größeren Mehrwert an Wissen und taffness anzeigt. Dieses heute weitverbreitete – und statistisch überwältigend abgesicherte – Konzept kann auch so ausgedrückt werden: der Sinn der Zeit fällt mit der Aussicht auf umfassenden Fortschritt zusammen; oder: In der Zeit selbst liegt die Dynamik des gegen sein absolutes Selbst strebenden Menschen zugrunde. Die Grenzen dieses Konzeptes sind offensichtlich: Es wird nämlich darin (a) die fehlerlose Linearität der durch die Zeit zeigbaren Fortschrittsbewegung ebenso unterstellt, wie (b) das konstante Interesse des diese Bewegung betreibenden und damit Zeit erzeugenden Menschen an immer demselben, wenigstens jedoch an der Idee des Fortschrittes selbst. Beides gehört zu jenen paradigmatischen Voraussetzungen, die zwar Epoche machen können, jedoch nie vom Vorwurf ideologischer Einseitigkeiten frei bleiben. Es ist die Annahme einer linearen Entwicklung der auf das vor-wissenschaftliche Interesse antwortenden Wissenschaft als ein wirklichkeitsfremdes Abstraktum grundsätzlich abzulehnen, da die Geschichte weit eher durch Brüche und anarchische Agitationen ihre Gestalt erringt, denn durch Kohärenz und methodologische Anpassung. All dies bleibt eine Frage der Auslegung, und als hermeneutische Anstrengung stets nie mehr als ein formales Ordnungskriterium oder der dogmatische Anschlag politischer Macht auf das Unternehmen des Geistes. Was Geschichte wirklich ist, wird – einer alten Anregung des Aristoteles folgend – sich erst dann erweisen lassen, wenn sie (a) als geschlossene vorliegt, und (b) die Frage beantwortet ist, ob es sie überhaupt als etwas Wirkliches gibt: also schließlich erst dann, wenn sie überwunden ist. Darin steckt die alte Frage nach der Beziehung von Sein und Zeit, oder – um genauer zu sein – die Frage danach, was den absurden Eintritt der Zeit in den Sinnkreis des Seins überhaupt ermöglicht hat. Was nun die Geschichte der Frage nach Gott in Sonderheit anlangt, so hat die evolutive Auffassung von der immanenten Mechanik der Zeit zu einer Antwort geführt, die als Säkularismus bereits sprachlich ihren Anspruch auf die Welt im Ganzen der Zeit – also der Geschichte – anmeldet und schließlich im 19. Jahrhundert – einmal 148 Dominicus Trojahn mit den entsprechenden modischen Bedeutungen ornamentiert – das Ende jener Polarität aussprach, der sich das Wort ursprünglich verdankte.6 Dass die Geschichte der Frage nach Gott in einem säkularen Zeitalter einer säkularen Welt endet, sollte nun sagen, dass in der neu erfassten Weltgeschichte – ‚histoire seculaire’ – für eine solche Frage weder Raum noch Anlass bestünde. Denn was jetzt mit Geschichte gemeint war, sollte die Weltverhältnisse um die Kategorie all dessen vereinfachen, das zuvor als Kompliment der Welt zwar in ihr angetroffen werden konnte, wenn es auch von ihr selbst nicht stammte. Die Weltgeschichte, mitsamt ihrer progressiven Dynamik und ihren soteriologischen Ambitionen war durchaus im Sinne eines totalitären Schlüssels zum Verständnis dessen erdacht worden, das in der Welt überhaupt der Fall ist. So konnte dann gesagt werden, dass die Hoheitssphäre der Transzendenz in der Geschichte als dem einzigen Modus ontologischer Relevanz nur als säkulares Phänomen – und damit als das Gegenteil ihrer selbst – in Erscheinung zu treten vermöge. Die Willfährigkeit, mit der liberale Theologen sich darum mühten, Gott und die Dinge Gottes nach der säkularen Mode umzukleiden, gehört zweifellos zu den absurdesten Unternehmungen einer an die Weltgeschichte verlorenen Vernunft. Wer im 19. Jahrhundert von ‚säkularer‘ Zeit sprach, der wollte damit eben vor allem sagen, dass die alte Komplexität von ‚geistlich‘ und ‚weltlich‘, deren literarisch weit strahlender Ausdruck die beiden Staaten der Civitas Dei des Augustinus von Hippo gewesen waren, für ein neues Verständnis der Zeit – im Sinne der Weltgeschichte – jede Bedeutung verloren hatte. Das neue und totalitäre Verständnis der Zeit sollte als der ursprünglichste und letzte Sinn von Sein überhaupt – wonach Sein gar nicht anders denn als Zeit in Erscheinung tritt – die Grenzen dessen verantworten, das wirklich ist, und jenseits derer Alices Wunderland beginnt. Es ist gerade dieser Totalitarismus, zu dem das 19. Jahrhundert in allen Belangen eine psychotische Empathie beweist, der die Welt nicht allein gründlich entzaubert hat, sondern der schließlich dazu führen sollte, dass der Mensch in einem Strudel aus Ekel, Skepsis und Relativität unterging. Es ist viel von den sozialen Bedingnissen der psychischen Labilität des Menschen in der Moderene gesprochen worden, die auf unterschiedlichste Weise toxische und ideologische Kompensationen gesucht und gefunden hat. Es wollte so scheinen, als vermöchte der Mensch den Monismus seiner Weltlichkeit nur zu ertragen, wenn er auf gänzlich absurde Weise seine Seele von Neuem an Kräfte verkauft, deren Existenz er 6 Bemerkenswert ist, dass in Grimms Wörterbuch zu ‚säkular‘ – Säkularfeier, Säkularjahr, säkularisch, Säkularuhr, Säkulum – keine weitere Bedeutung genannt wird als ‚hundertjährig‘, von der Kontraposition des Säkularen zum Religiösen es also gar nichts weiß: vgl. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 8, bearb. v. Moriz Heyne, Leipzig 1893, Neudr. München 1984, Bd. 14, Sp. 1678. Jenseits des Seins? 149 sich von der Warte seiner Fortschrittlichkeit aus zu bestreiten nicht nur verpflichtet, sondern vor allem berechtigt hält. Dass die Moderne zur strengsten Kritikerin der Neuzeit wurde, hängt vor allem damit zusammen, dass sie – schamlos oder naiv – als Exekutive einer epistemologischen Tartufferie agiert, indem sie irgendwann zwischen öffentlichem Wissen und privater Weisheit zu unterscheiden begann und sich damit eine Ausnahme von dem gestattete, das in Wahrheit den Kern des ganzen Problems ausmacht: dem Monismus. Wie sollte sonst verstanden werden können, dass die sublimsten Früchte technischer Intelligenz mit den absurdesten Phantasmagorien längst überwundenen Aberglaubens zu einer ganz und gar unkritischen Harmonie gelangen konnten. Da es jedoch im Gang der Zeit niemals eine Wiederkehr desselben gibt, verfiel der Mensch der Moderne den Surrogaten seiner spirituellen Obdachlosigkeit in einem ganz und gar neuen Ausmaß, nämlich – wie man sagt: mit Haut und Haar. Was er also fürderhin tun würde, das täte er mit der Emphase des Fanatikers, eines psychischen Aggregatzustandes, der ebenso leicht durchschaut werden kann, wie die Lieblingsrolle, in der er zur Anwendung gelangt: der revolutionäre Charakter. Beides beruht auf der Beunruhigung durch den Hermetismus einer monisitisch alternativlosen Welt. Der mit solchen Erscheinungen verbundene Hingabewille steht in keinem Verhältnis zum religiösen Engagement, das die Kirche im Falle des durchschnittlichen Gläubigen erwartet, dessen Eifer zudem durch das milde Licht der Barmherzigkeit Gottes mit seiner Schwäche versöhnt wird. Niemals zuvor ist – wenige Ausnahmen anerkannt – mit derselben verzweifelten Inbrunst an Gott geglaubt worden, wie später an die Rasse, die Nation, den Schamanen, den Schicksalstein und die Glaskugel.7 Und erst als der Mensch gelernt hatte, die Martyrer zu verachten, war er bereit, für seine Gesundheit den Heldentot zu sterben. So wird auch heute noch von den Segnungen einer säkularen Welt betrügerisch weitergeredet, in der Meinung, mit der Wahl der Welt den Himmel gewonnen zu haben. Wer das allen Ernstes glaubt, mag für sich die Klugheit dessen in Anspruch nehmen, der sich publikumswirksam auf die Seite dessen schlägt, zu dem ohnehin keine Alternative besteht. Das Hochgefühl, das in der scheinbaren Wahl des Notwendigen gründet, befriedigt jedoch den Wunsch nach einer Alternative nicht, die der – ohnehin erzwungenen – Wahl die Qualität der Freiheit sichert. Die Diktatur der Immanenz, die das Attribut ‚säkular‘ über die Welt ausübt, lässt nur einen Weg 7 Vgl. Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou: Ein Dorf vor dem Inquisitor 1294-1324, Frankfurt a. M. 1980: bietet eine erstaunlich frühe demoskopische Erhebung von Form, Niveau und Praxis des religiösen Lebens in Südfrankreich zur Zeit der Katharer- und Albigenserkriege, durchgeführt im Auftrag von Jaques Fournier OCist, General-Inquisitor für Süd-Frankreich, dem späteren Papst Benedikt XII. Die Studie zeigt mit unverstellter Offenheit die wissenschaftlich oft vernachlässigte Koexistenz von persönlichen Sinnund Verhaltensinteressen mit den Klassifikations-Mustern der historischen Soziologie. 150 Dominicus Trojahn zur Deklaration einer begründeten Entscheidung offen: die durch die Geschichte ermöglichte Differenzierung dessen, um das es geht, nämlich der Welt selbst. Im Falle der – unterstellten – säkularen Welt gibt es um nichts in der Welt zu ihr eine Alternative, immerhin jedoch eine Vergangenheit – und das macht den Unterschied: als die Welt noch verzaubert war und 500 Jahre zurück lag. Wer von säkularer Welt redet, der verwendet den Begriff kritisch, wenn nicht polemisch; mitunter nicht ohne verständnisvolle Nachsicht für jenen naiven Rest, der mit der verzauberten Welt – gemeinsam zurückgeblieben ist. Geschichte entsteht im reflektierenden Selbstbewusstsein eines Subjektes, das sich ein weiteres Mal für davongekommen hält und den jeweiligen Augenblick für das erreichte Ziel der respektiven Flucht ausgibt. Einem solchen Subjekt ist es eigen, nicht allein um den Gang der Geschichte zu wissen, sondern ihn auf das dekorative Niveau einer selbstständig agierenden Notwendigkeit zu erheben. Das mit der Flucht mag ja noch angehen, doch ist – so gesehen – der Exodus entweder grundsätzlich, negativ perpetual und endlos, so dass aus ihm ebenso grundsätzlich kein Herauskommen ist, weil er sich niemals an einem Ziel erschöpft und anonym in der Zukunft verläuft – und item davon auf den Begriff gar nichts zu bringen ist und grundsätzlich alles ungereimt stehen bleibt; oder die kausale Necessität als das schönste Ornament der historischen Vernunft löst sich in Anwendung der diachronen Nachfrage nach der Richtigkeit des darin waltenden Entscheids wie der Traum des Erwachenden am Morgen in rein gar Nichts auf. Das Subjekt in seiner Neigung zum absoluten Standpunkt – dem Gedanken – kann sich als Element der Geschichte niemals begründen; einzig in der Fiktion der Zeitlosigkeit gelangt es zu Verständnis und Reim der Geschichte. Dann zudem noch zum Bewusstsein seiner Selbst obendrein, doch allein im Verzicht auf jede Historie, wie er dem Denken zu eigen ist. So setzt sich das Subjekt grund-los als solches selbst. Die Zeit – nämlich – lässt sich nicht denken. Das heißt, einerseits schon: im Maße sich am Geschehenen zeigenden und darstellbaren Sinnes, der sich vollziehend die Zeit ebenso voraussetzt, wie er sie logisch bestimmt und damit begründet; dies jedoch allein als Abstraktum von allem partikularen und konkreten Geschäftlichem, das in der und als Erscheinung der Zeit abgewickelt wird, demnach als Begriff, den einer denkend aus der polymorphen Suppe des Geschehens heraus fischt und sich als deren Verständnis zu eigen macht, der sich ihm zugleich in ihr – es war gesagt worden – darstellt und für ihn sich beweisend begründet. Beweisend ist hier genommen in dem Sinne, wie man sagt: dass es das – überhaupt – gibt. Was man dabei vor allem sieht, ist die zirkulare Fiktion der Zeit, die sich als die Voraussetzung ihrer – eigenen – Erscheinung begründet und das allein, weil solcher Weise ein Begriff vom Sinn der Geschichte entstehen kann, der ja der Begriff von irgendetwas sein muss, das es tatsächlich gibt. In Wahrheit jedoch gibt es für diesen Fall nichts weiter als den Mechanismus des Denkens mitsamt seiner Neigung zum Sinn. So erscheint Jenseits des Seins? 151 also die Zeit dem Denken niemals als sie selbst, sondern allein als der Begriff vom Sinn, auf den alle Zeit hinausläuft, der ihr, wenn nicht im Ganzen so doch für das hier erweckte Interesse, denkend unterstellt wird, und in dem allein sie – sich selbst in ihrer Erscheinung begründend – verstehend gefasst wird. Der Begriff jedoch fällt, als der systembildende Knoten, aus der Zeit ebenso heraus, wie das telos der aristotelischen Ontogenese als ‚entelechie‘ oder ‚oikeiosis‘ die Zeit hinter sich bringt als dasjenige, nach dem als solchem nicht weiter gefragt wird, weil am Ende nicht das ‚facere‘, sondern das ‚factum‘ zählt. Wenn demnach Denken und Sein tatsächlich in eins fallen, dann kann keine Seinsschwäche das Interesse des Denkens erwecken, deren mitnichten unbedeutendste eben als ‚die Zeit‘ in Erscheinung tritt. Eine – wenn auch nur gedachte – Totalität der Zeitlichkeit untergräbt nicht allein das Unternehmen des Denkens, sondern endet – da solcher Weise das Sein schließlich seiner Nichtigkeit nach gedacht werden muss – in einem morbiden Kult des Todes als dem letzten Akt der Metaphysik. Dann käme am Ende heraus, dass der Sinn des Seins immer schon im Nicht-Sein bestände und daher das in Zeitlichkeit gefasste Seiende nur im Anschlag des Nichts als Vernichtung zu Sinn kommt. Dann jedoch, nachdem dies einem aufgegangen ist, stellt sich die Frage: Warum ist nichts, und nicht vielmehr Seiendes? Und da endlich, in Ansehung der bestehenden Welt, erfasst das Denken den in ihm waltenden Abschied vom Sein als mindestens vorschnell, wenn nicht gar töricht. Der so hervorgetretene Hinzug zum Nichts als dem Sinn von Sein ist bei Martin Heidegger, dem vorgängigen Verfasser von Sein und Zeit, in reiferen Jahren deutlich zu Tage getreten. Heidegger ist der nachdrücklichste Verkünder einer ‚apokalyptischen Metaphysik‘, in der das Sein in der Verwirkung der Zeit end-gültig zum Grunde der Zeit geht und damit das Nichtige und zugleich Nichtende der Zeit als Zeitlichkeit dessen, das ursprünglich in der Kontradiktion des Nichts stand, offenbar macht.8 8 Martin Heidegger, IV. Der Sprung, 161. Das Sein zum Tode, in: Gesamtausgabe, Frankfurt a. M. 1975 ff., Bd. 65: Beiträge zur Philosophie. (Vom Ereignis). 1936-1938, hg. v. FriedrichWilhelm von Herrmann, 1989, S. 284: „Daß der Tod in dem wesentlichen Zusammenhang der ursprünglichen Zukünftigkeit des Daseins in seinem fundamentalontologischen Wesen entworfen ist, heißt doch zunächst im Rahmen der Aufgabe von ‚Sein und Zeit‘: er steht im Zusammenhang mit der ‚Zeit‘, die als Entwurfsbereich der Wahrheit des Seyns selbst angesetzt ist. Schon dieses ist ein Fingerzeig, deutlich genug für den, der mitfragen will, daß hier die Frage nach dem Tod im wesentlichen Bezug steht zur Wahrheit des Seyns und nur in diesem Bezug; daß daher nicht und niemals der Tod als die Verneinung des Seyns oder gar der Tod als ‚Nichts‘ für das Wesen des Seyns genommen wird, sondern im genauen Gegenteil: der Tod als das höchste und äußerste Zeugnis des Seyns.“ Vgl. auch Ders., Anmerkungen IV (1947/48), in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 97: Anmerkungen I-V. (Schwarze Hefte 1942-1948), hg. v. Peter Trawny, 2015, S. 372: „Denkbar wird das Wesen der Geburt des Menschen nur aus dem Wesen des Todes.“ 152 Dominicus Trojahn Vor allem nämlich – und wenn anders gar nicht – ist ‚zu Sein‘ als ‚nicht Nichts ‚bedeutsam.9 Zeit soll es als Zeitlichkeit – also als Überfall des Seins – vermögen, die Stabilität der ontologischen Widersetzlichkeit von Sein und Nichts zu überspringen, in dem sie am Sein das Wesen des Nichts vollstreckt – und ‚erwirkt’ – und so zur Anschauung bringt. So gelte der Bedeutungsabstand, den das Sein stets zum Nichts hält, im Sinne der Zeit als verworfen, denn was immer erfasst wird von Zeit, und ihr unterstellt ist, daran exekutiert die Zeit ihre Herkunft aus dem Nichts, das sie unbedingt als Verminderung des ‚zu sein‘ bis hinein in dessen äußerste Verlorenheit, den Verlust des Seins selbst im Nichts vor sich her treibt. Dann erst ruht sie – wie jedes destruktive Prinzip – in der Sinn-losigkeit aus. Es kann gleichwohl nicht übersehen werden, das der Hinzug zum Nichts als dem Sinn-Vektor des ‚zu sein‘ das, was ist, nicht allein einer infernalen Endlösung zuführt, sondern ebenso eine Antwort auf die Frage schuldig bleibt, welcher Art aus dem seinsbezüglichen Ziel-Grund des Nichts ein begründeter Anfang dessen sich auftut, das als das jeweils Seiende ist. Denn wenn alles Seiende durch die Nichts-Verfallenheit des Seins vermögens der Zeit auf Vernichtung aus ist, dann muss sich ebenso das Sein, als Sein in der Zeit, dem Nichts als seinem Ursprung verdanken: denn alle Zeit betreibt als Bewegung zum Ende die Rückkehr des von ihr Bewegten in dessen Anfang. Die Zeit vermag jedoch niemals einen Umschwung zählend zu erwalten, dem Sein und Nicht-Sein als bezügliche Termini verfügbar sind: kein Weg in der Zeit geht vom Nichts in das ‚zu sein‘, oder vom ‚zu sein‘ in das Nichts zurück. Wer ernsthaft in der Wägung solchen Denkens steht, hat die Sache des Denkens selbst hinter sich gebracht – und vor sich das Chaos. Die diesbezügliche Klärung empfing Parmenides nach eigener Auskunft als Offenbarung der Göttin ‚Dikee‘ – der vielstrafenden – , und verknüpfte sie so mit dem Anspruch der Gerechtigkeit, mit demjenigen, was der Wirklichkeit als solcher zukommt oder geschuldet ist.10 Was er sagt, kann als ein nachdrücklicher Hinweis 9 Dagegen Martin Heidegger, Grundbegriffe § 9. Das Sein ist das Gemeinste und zugleich das Einzige, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 51: Grundbegriffe. (Sommersemester 1941), hg. v. Petra Jaeger, 1981, S. 54: „Das Nichts bedarf nicht des Seienden, wohl dagegen bedarf das Nichts des Seins … Ja, vielleicht ist sogar das Nichts dasselbe wie das Sein. dann kann aber die Einzigkeit des Seins durch das Nichts niemals gefährdet werden, weil das nichts nicht ein anderes zum Sein ‚ist‘, sondern dieses selbst. Gilt nicht gerade auch vom Nichts, was wir vom Sein sagten, daß es einzig und unvergleichlich sei? Die unbestreitbare Unvergleichlichkeit des Nichts bezeugt in der Tat seine Wesenszugehörigkeit zum Sein und bestätigt dessen Einzigkeit.“ Hervorhebung im Original. 10Parmenides, Peri Physeoos, 1, 27-28, in: Die Fragmente der Vorsokratiker, hg. v. Hermann Diels u. Walther Kranz, 3 Bde., Berlin 1951-1952 [im Folgenden abgekürzt als DK], Bd. 1, 1951, S. 230: „Denn keinerlei schlechte Fügung entsandte dich, diesen Weg zu kommen (denn fürwahr außerhalb von der Menschen Pfad ist er), sondern Gesetz und Recht“: Jenseits des Seins? 153 darauf gelesen werden, dass ein letztes Verständnis dessen, was ist, auf dem Weg der Erfahrung nicht erreicht werden kann, sondern ‚über alle Wohnstätten hin‘ in eine andere, und den Sterblichen gewöhnlich verschlossene Perspektive verweist. Parmenides denkt von der Identität her, die zwischen Sein und Denken waltet, weshalb Nicht-Sein und Wahrheit – als Ziel und Vollendung des Denkens – sich mit Notwendigkeit ausschließen; es ist eben diese Notwendigkeit, die den Erfolg des Unternehmens des Denkens überhaupt ermöglicht und sichert; so, wie man sagt: ohne Vater kein Kind! Es folgt: Das Denken denkt das ‚Sein‘ und nicht das ‚NichtSein‘; es folgt: Daher ‚ist‘ nur Sein, Nicht-Sein ‚ist nicht‘. Es folgt: Es ‚ist‘ nur Sein, da das Nicht-Sein ‚nicht gedacht‘ wird. Daraus folgt: Das Denken des Seins versichert das Denken des Nicht-Seins des Nichts, und damit des Seins. Weil es gedacht wird, ist das Sein – vor dem Nicht-Sein – sicher. Das Nicht-Sein des Nichts versichert das Denken; so wie man sagt: es bewahrt und bewahrheitet! Der Anfang11 der Metaphysik ist schicksalsträchtig in das Gefüge der Konvertibilität von Sein und Denken eingestellt – Sein ist das dem Denken entsprechende Objekt; durch das Denken wird sich das Sein seiner selbst als der Geschiedenheit vom Nicht-Sein bewusst – , weshalb außerhalb dieses Gefüges oder jenseits dessen Wahrung die Sache der Metaphysik für verwirkt gilt. Noch im Sprachgebrauch der Scholastiker findet sich darum die Differenz von Denken ‚in potentia‘ und Denken ‚in actu‘, von schlafendem und erwachtem Intellekt. Was zwischen dem einen und dem anderen steht, ist der ‚Einfall des Sein‘ als des primum, des Es-überhaupt-zum-tätigen-Denken-gebracht-Habens; so wie man sagt: Ich bin gestern zur Frau geworden! Anders als in der cartesischen Selbstgewissheit des Subjektes gelangt hier das Denken durch das Gegenüber-Sein des Seins zu dem Urteil, dass ist, was – dort – ist; die blinde, taube und erinnerungslose Selbstgewissheit des Subjektes, die um den Preis der Entwirklichung der objektiven Wirklichkeit gewonnen ist, waltet hingegen als Kollateraleffekt der sich im Akt des Erkennens selbst überschreitenden Vernunft: als ‚intentio obliqua‘. Parmenides hat seine Einsicht, alles Denken beruhe auf der Entschiedenheit, mit der das Nicht-Sein des Nicht-Seins gedacht werde, im Prolog von Peri Physeoos nicht zuletzt mythologisch abgesichert. Diese Versicherung für redundant zu halten, zeigt – diesseits der Gefahr, für geistreich gehalten zu werden – nichts als die peinliche alla themis te dikä te. Es ist kein ernsthafter Grund erkennbar, den mythologischen Rahmen von Peri Physeoos als einen solchen abzutun; vielmehr muss jeder Versuch einer Deutung des Parmenideischen Denkens von dort herkommen und ausgehen. 11 ‚Anfang‘ – griechisch: hee archee – meint das bleibend Durchragende, das – wie weit einer die Sache der Metaphysik auch getrieben haben mag – jedes gültig Gedachte als Fundament ermöglicht und trägt: So wie man sagt: Es ist stets bei ihm!; anders der ‚Beginn‘, den eine Bewegung hinter sich lässt. 154 Dominicus Trojahn Arroganz zeitkonformer Interpreten antiker Texte. Wer offensichtliche und verifizierbare Tatsachen als Täuschungen entlarvt, muss dafür gute Gründe haben und noch bessere Beziehungen vorweisen können. Auch wenn zugeben wird, dass die Leugnung des Raumkontinuums in keinem zwingenden Zusammenhang mit den Thesen des Parmenides vom Denken und Sein steht, verdient dennoch der Mut, den ein Denker aufbringt, um der Sicherheit des Denkens und der Wirklichkeit willen die unbestreitbare Erfahrung dieser Wirklichkeit in schwindelerregender Weise zu kritisieren, tiefsten Respekt. Ohne den darin liegenden Widerspruch abzuweisen, hat der abendländische Diskurs um das Sein stets die Grenzen ausgehalten, die Parmenides als die transzendentalen Bedingungen der Aktualität der Wirklichkeit und die fehlerlose Sicherheit des Denkens gezogen hat. Die staunenswerten Leistungen, die in der Antike im Feld des Unternehmens der Metaphysik erbracht worden sind, leben von der Dynamik und Kraft des Widerspruchs, den die Sturheit des Parmenides ‚über alle Wohnstätten hinweg‘ sich weigerte auszugleichen. Das ist zweifellos ein Höhepunkt an Arroganz; aber eben so, wie man sagt: Er spielt gut Schach! Die erste spekulative Frucht der von Parmenides losgetretenen Aufwendung war die Ideen-Metaphysik des mittleren und späteren Platon. Auch er brachte nicht unbedeutende Opfer;12 aber so kritisierbar13 seine Lehren auch sein mögen, sie verliehen von Beginn an den widersprüchlichen Erfahrungen der menschlichen Existenz eine heilsame Transparenz. Kein philosophisches System hat das Bewusstsein des Menschen von sich selbst je mehr beeinflusst als das platonische; keines ist dem Menschen je zutreffender erschienen; keines vermochte den Menschen dem Menschen mehr zu enträtseln und sich selbst gegenüber vertraut zu machen; aber keines hat in vergleichbarem Maß seine Bestätigung aus dem Erfolg bezogen. Insofern Platons Philosophie dualistisch ist, ist sie unschlagbar! Aristoteles war davon überzeugt, die Versuchung des Dualismus abweisen zu müssen; er beharrte auf der Einheit der Wirklichkeit, oder – wie er wohl gesagt hätte – des ‚Vorhandenen‘14. Das ist bereits ein Ergebnis, wenigstens jedoch eine Stellung12 Ernst Cassirer hat die Spannung, die sich aus Platons systematisch zwingender Ablehnung der mimetischen Künste und dessen persönlicher Liebe zur Kunst ergibt, thematisiert in Eidos und Eidolon. Das Problem des Schönen und der Kunst in Platons Dialogen, Hamburg 2008, S. 7-50; vgl. auch Erwin Panofsky, Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie, Hamburg 2008, S. 51-301. 13 So führt ex. gr. Thomas von Aquin die Grundlagen der Ideenlehre auf die defiziente Psychologie Platons zurück; vgl. Thomas von Aquin, STh I, q. 85, a. 1; Ders., In de Anima, L, III, l, 12, bei Marietti nr. 784. 14Aristoteles, Metaphysik A (I), 1, 982b, 11-13: „Verwunderung war den Menschen jetzt wie vormals der Anfang des Philosophierens, indem sie sich anfangs über das unmittelbar Auffällige – ta procheira toon aporoon thaumazantes – verwunderten.“ Jenseits des Seins? 155 nahme: das Wirkliche ist das Vorhandene, dasjenige, das in die Hand genommen werden kann. Etwas genauer wird man sagen müssen: es ist – bereits – dasjenige, an dem sich die philosophischen Neugier entzündet. Auch für Aristoteles gibt es diverse Wirklichkeitsmodi, wie zum Beispiel in den Sphären unterhalb und oberhalb der Bahn des Mondes. Lassen sich die materiellen Dinge in der sublunaren Sphäre auf die vier von Empedokles benannten Elemente zurückanalysieren, so bestehen die Himmelskörper aus einem besonderen Stoff, dem ‚fünften Element‘, der ‚quinta essentia‘. So folgenreich diese Unterschiede auch sein mögen, so sind sie doch immer Differenzen an der einen und der selben Wirklichkeit. Der Weg der Philosophie beginnt – durchaus pragmatisch – mit und bei Handgreiflichkeiten und damit in jenem Bereich unterhalb des Mondes, dessen elementares Substrat Feuer, Wasser, Erde und Luft bilden. Wo immer aber das, was ist, in materieller Hinsicht als ein Potpourri unterschiedlicher Elemente erscheint, ergeben sich zwei Fragen: 1. was garantiert die Identität dessen, das derart ist – und findet es überhaupt dazu, etwas für sich und nicht nur die Summe unterschiedlicher An-teile der für sich reinen Elemente zu sein; 2. wie und welcher Art steht es um die Beziehung der Veränderung – metabolee – , der dasjenige, was auf elementare Weise zusammengesetzt ist, notwendig untersteht, zu jener Identität, die die Sache selbst ausmacht? Auf die erste Frage hat Aristoteles mit seiner Lehre von der ‚ousia‘ geantwortet. Dass Seiendes sich dem Intellekt zunächst als ‚ousia‘ zeigt, gilt für die Aristotelische ‚Erste Philosophie‘ für eine so grundlegende Einsicht, dass einige Interpreten vorgeschlagen haben, die Metaphysik des Aristoteles überhaupt als ‚Ousiologie‘ anzusprechen.15 ‚Ousia‘ bedeutet – grammatisch genommen – in etwa ‚Seiendheit‘, und formuliert die Reflexion über die Weise, in der Seiendes grundsätzlich verfasst ist. Die Lehre von der ‚ousia‘ bezeichnet bei Aristoteles exakt die Stelle seines Denkens, an der, und auf Grund derer er – vermittels eines von seinem Lehrer übernommenen Begriffs – der Ideenlehre Platons widerspricht. In der Terminologie der philosophischen Latinität wird ‚ousia‘ seit Marcus Fabius Quintilianus – gestorben 96 n. Chr. – nicht ohne Risiko16 mit ‚Substantia‘ wiedergegeben. Der ‚ousia‘, dem ursprünglichen, ersten und 15 Vgl. u. a. Werner Marx, Einführung in Aristoteles’ Theorie vom Seienden, Freiburg i. Br. 1972, S. 30 ff. 16 Ein Risiko, das darin wurzelt, dass ‚ousia‘ bei Aristoteles nicht allein den Identitätsgrund des jeweils für sich bestehenden, einzelnen Seienden – tode ti – bezeichnet, sondern, als ‚deutera ousia‘ – zweite Substanz – ebenso das der Abstraktion zugängliche Allgemeine, das später essentia – Wesenheit – genannt werden sollte, und die Antwort auf die Frage ermöglicht, was das jeweilige einzelne Seiende ist, und als was es angesprochen werden kann. Diese in der Kategorien-Schrift vermerkte Unterscheidung, die – wie leicht zu sehen ist – von Aristoteles als eine Unterscheidung an der Sache selbst verstanden wird, spielt in den XIV Metaphysik-Abhandlungen keine bestimmende Rolle mehr; dort 156 Dominicus Trojahn eigentlichen Sinn von Sein, steht in konträrer Position das ‚symbebeekon‘ gegenüber, dem jeder Eigenstand ermangelt, und das als zufällige Eigenschaft an sich selbst das Stigma der Unselbstständigkeit mit dem der Unbeständigkeit verbindet: zwei Wirklichkeitsschwächen, durch die sich das Akzidenz am meisten von der ‚ousia‘, dem ‚Seienden an sich‘17, unterscheidet. Diese beiden, ‚ousia‘ und ‚symbebeekon‘, bilden eine erste Differenz, in der Seiendes auf je verschiedene Weise sein kann, eben jeweils als Substanz und als Akzidenz. Auf der Grundlage dieser intensiven Polarität, der gemäß jedes Seiende ausnahmslos entweder Substanz oder Akzidenz ist, gelingt Aristoteles die Entdeckung der ‚analogen‘ Prädikation des Seins: von was und wem auch immer das ‚zu sein‘ ausgesagt wird, alle damit benannten Differenzen stehen in einer sie übermächtigenden Drift auf einen gemeinsamen Anfang – archee – zu, in dem die Grundbedeutung des Seins vorliegt und der zugleich das Sein und die Einheit des inhaltlich differenzierten Seienden garantiert. Dieser Grund ist die ‚ousia‘, woraus sich ergibt, dass die in ihm und an ihm in die Einheit der Bedeutung des Seins gefügten Differenzen ‚kata symbebeekon‘ das Sein in dessen Grund benennen.18 Die Frucht dieser schlichten Überlegung ist die aristotelische Kategorientafel, die der Absicht folgt, dem flüchtigen Sein der in neun Klassen geordneten beiläufigen Bestimmungen19 – bei Wahrung der Differenz – in wird die ‚ousia‘ entschieden im Sinne des ‚ti to än einai‘ aufgefasst, also im Sinne der spezifischen Bestimmung des jeweils Seienden verstanden. Diese Verschiebung ergibt sich aus dem neuen Interesse, jede Nähe der ‚ousai‘ zur ‚hylee‘ – Materie, dem für die Jeweiligkeit des Einzel-Seienden causalen Prinzips, zu vermeiden. 17 Im Buch D (V) der Metaphysik erklärt Aristoteles in Form eines Lexikons die elementaren Begriffe, aus denen sich Absicht und Interesse der in Aussicht gestellten ‚Ersten Philosophie‘ erkennen lassen. Das 7. Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung und den Aporien des sprachlichen Gebrauchs des Wortes ‚to on‘; wie es seiner Gewohnheit entspricht, referiert Aristoteles zu Beginn die geläufigen sprachlichen Konnotationen, in denen der Begriff gewöhnlich prädiziert wird. Im Falle des Seienden – to on – werden vier Intentionen benannt, in denen sich das Sein-Sagen mit je anderen Inhalten verbindet; als deren erste nennt Aristoteles die Differenz von Seiendem ‚kata symbebeekon‘ und Seiendem ‚kath’ auto‘; vgl.: Metaphysik D (V), 7, 1017a, 7-8. 18 Aristoteles, der das Wort Analogie nicht kannte, spricht vorsichtig von einer ‚pros hen Relation‘: vgl. Aristoteles, Metaphysik G (IV), 2, 1003a, 33-34: „Das Seiende wird in mehrfacher Bedeutung ausgesagt, aber immer in Beziehung auf eines und auf eine einzige Natur.“ 19Aristoteles, Metaphysik D (V), 7, 1017a, 22-27:„An sich zu sein – kath’auta – wird von all dem gesagt, was die Formen der Kategorien bezeichnen; denn so vielfach diese ausgesagt werden, so viele Bedeutungen des Seins bezeichnen sie. Da nun die Kategorien teils ein Was bezeichnen, teils etwas Qualitatives, teils etwas Quantitatives, teils etwas Relatives, teils ein Tun oder Leiden, teils ein Wo, teils ein Wann, so hat mit jedem von diesen das Sein gleiche Bedeutung.“ Jenseits des Seins? 157 der ‚ousia‘ einen stabilen Grund zu verschaffen. Die ‚ousia‘ ist bei Aristoteles nicht allein die ‚erste‘ von allen Bedeutungen, die mit dem ‚zu sein‘ verbunden werden können, sie verleiht diesen Anwendungen auch jene Geltung und Wirklichkeit, die diesen von sich her nicht zu kommt. Damit hat die ‚Erste Philosophie‘ zu ihrer Frage gefunden: sie fragt, als nach dem, das allem sonstigen Grund gibt, nach den Gründen und Prinzipien dieses Ersten selbst, nämlich des Seienden an sich, der ‚ousia‘.20 Damit wird die ‚ousia‘ für Aristoteles zu jener ‚gewissen Natur an sich‘,21 deren Prinzipien und Ursachen er ‚die höchsten‘ nennt und deren jede Gattung transzendierende Einheit die ‚Erste Philosophie‘ für immer von jeder anderen Wissenschaft unterscheiden wird.22 20 Vgl. Aristoteles, Metaphysik G (IV), 2, 1003b, 16-18. 21Aristoteles, Metaphysik G (IV), 1, 1003a, 26-28:„Indem wir nun die Prinzipien und die höchsten Ursachen suchen, ist offenbar, dass diese notwendig Ursachen einer gewissen Natur an sich sein müssen“: physeoos tinos kath’auteen. 22 Die Lektüre der XIV Abhandlungen zur Ersten Philosophie des Aristoteles gehört zum Erregendsten, das einer überhaupt lesen kann, da der Leser zum ‚Augen-Zeugen‘ des systematischen Ertastens der Metaphysik als Abschluss und Vollendung der Wissenschaft im Ganzen wird. Streitbar wird – neben den bekannten Problemen hinsichtlich der chronologischen und systematischen Redaktion der ‚Metaphysik’ – immer bleiben, wo genau bei Aristoteles der Anfang der Metaphysik gemacht wird, und welche Koordinaten im Register der aristotelischen Schriften Ort und Anlass ihres ersten Erscheinens notieren. Wie auch immer die Antwort auf diese Frage ausfallen mag, immer wird sie eine Klärung voraussetzen, die Aristoteles in der Diskussion der 8. Aporie in Metaphysik B (III), 4, anstößt und damit die kritischen Voraussetzungen für das Zustandekommen der Metaphysik auslotet. Die Frage liegt in dem Zweifel beschlossen, ob die endlose Vielzahl, in der die einzelnen Dinge – ta kath’hekasta apeira – in Erscheinung treten, jeden Anspruch auf Verstehen als Täuschung entlarvt. Das Einzelne als solches schließt jedes Erkennen aus, das notwendiger Weise – der Natur des Intellektes entsprechend – auf dem ‚ti para ta kath’hekasta‘ beruht, demjenigen, das ‚neben‘ dem Jeweiligen und Einzelnen als das Eine – hen ti – , das Identische – tauton – und das Allgemeine – katholu ti – das Einzelne denkbar macht; vgl. Metaphysik B (III), 4, 999a, 26-28. Um des gesamten Unternehmens des Wissens willen muss ein Weg gefunden werden, die Flucht der Kausalreihen in die Unbegrenztheit zum Stehen zu bringen. Nur wenn dies gelingt, lässt sich das Unternehmen Wissenschaft überhaupt erfolgreich abschließen; und allein unter solchen Umständen hat es überhaupt einen Sinn, nach einer über alles bekannte Wissen hinausfragende Wissenschaft zu suchen – zu Beginn von Met. B spricht Aristoteles von der Metaphysik als ‚hee epizeetumenee episteemee‘: Metaphysik B (III), 1, 995a, 24. Die – nicht verschwiegene – platonische Lösung schließt Aristoteles als ‚adynaton‘ aus; es wird sich später zeigen, dass die Frage zunächst nur indirekt ontologische Interessen verfolgt; sie muss daher neu gestellt werden: Ist es möglich, dass der Intellekt am je Einzelnen ein Allgemeines auszumachen vermag, und – davon abhängig, doch davon verschieden – in welcher Verfassung muss sich das Einzelne dem Intellekt ‚zeigen’, damit diesem eine solche Ansicht gelingt. Exakt diese gnoseologische Prämisse formuliert Ausgang und Schicksal der Metaphysik. 158 Dominicus Trojahn Was hingegen die zweite Frage, das Problem der Veränderung – metabolee – und Bewegung – kineesis – anlangt, ist die von Aristoteles angebotene Lösung vielleicht von noch größerer Bedeutung. Trotz der durch Platon nicht nur, aber auch zu diesem Zweck entwickelten Ideen-Metaphysik stand das Unternehmen der Philosophie nach wie vor der quälenden Aporie gegenüber, die sich aus der These des Parmenides von der absoluten ‚Unzerstörbarkeit‘ – anoolethron – , ‚Identität‘ – mounon – und ‚Unerschütterlichkeit‘ – atremes – des Seins um den Preis der Entwirklichung von Veränderung und Bewegung ergab. Einerseits konnte kaum bestritten werden, dass das Seiende „als Ganzheit von Seiendem innen erfüllt ist“23 und weder dem NichtSein noch irgendeiner anderen Unvollkommenheit was auch immer schuldig bleibt. Das Seiende repräsentiert als Ganzes eine durch keinerlei Nichtigkeit begrenzte oder differenzierte Vollkommenheit:24 „Es ist entweder ganz und gar – oder gar nicht.“25 Die verstörende Erfahrung wirklich erlebten Werdens und Vergehens – des unermüdlichen Hin und Her – blieb all dem zu Trotz – und andererseits – bestehen. Platon’s genial einfache Verweisung dieses Widerspruchs auf zwei heterogene ontologische Sphären heterogener Erfahrung, von denen selbst die schwächere die Qualität des Nichts-seins nie vollständig erreicht und doch von ihr durchdüstert wird, erscheint von der absoluten Warte des Eleaten her gesehen als nichts weiter, denn als ein schnöder Kompromiss demgegenüber und geradezu mit dem, das als das ganz und gar Unmögliche nur im ‚pseudos‘ Duldung erfährt. Noch immer den sprachlichen Umgang mit dem Seienden klärend, räumt Aristoteles im Begriffs-Lexikon des V. Buches der Metaphysik eine dritte Art ein, das Seiende zu benennen: „Ferner bezeichnet das Sein und das Seiende in diesen angeführten Fällen teils das Vermögen, teils die Vollendung.“26 Dass Seiendes in zwei konträren Weisen des Seins sein kann, deren eine es in dessen Möglichkeit zu sein anspricht, während die andere deren Vollendung aussagt, vermochte die Einheit und Einzigkeit des Seins zwischen Idealität und Empirik zu retten. Von daher ergibt sich für Aristoteles ein neues Verhältnis zur Zeit, deren Sinn nun nicht weiter aus der Kontradiktion von Sein und Nicht-Sein gedacht wird, wodurch die Zeit als das andere zum Sein an dem, das in der Zeit ist, dasjenige erwirkt, was deren Abkunft und ‚archee‘ entspricht, nämlich das Nichts dessen, das einfach nicht 23Parmenides, Peri Physeoos, 8, 24, in: DK, a. a. O., S. 237. 24 Seiendes ist – nach des Parmenides gut begründeter Überzeugung – nicht verbesserbar: „äd’ ateleston“: Ders., Peri Physeoos, 8, 4, in: DK, a. a. O., S. 235. 25 Ebd., 8, 11, in: DK, a. a. O., S. 236: „hutoos ee pampan pelenai chreoon estin ee ouchi.“ 26Aristoteles, Metaphysik D (V), 7, 1017b, 1-2: „eti to einai seemainei kai to on to men dynamei, to de entelecheia toon eireemenoon tutoon.“ Hervorhebungen in der Übersetzung vom Verfasser. Jenseits des Seins? 159 sein soll. Indem Aristoteles die Zeit in die Hoheit des Seins des Seienden zieht und deren ontologische Insuffizienz durch die ‚ousia‘ entlastet, wird die Zeit, von der zunächst durchaus zweifelhaft ist, ob mit ihr überhaupt zu rechnen sei,27 als Qualität des Raumes zum Maß dessen, das innerhalb dieses Raumes an der Substanz geschieht: „touto gar estin ho chronos, arithmos tees kineseoos kata to prooteron kai hysteron“.28 Es erscheint zweifellos erstaunlich, dass Aristoteles die Zeit als ein Maß des Raumes – topos – bestimmt. Doch steht das Seiende im Raum ebenso notwendig an einen Ort, wie es hinsichtlich der Bewegung als das ‚jetzt‘ – nün – die Einheit der Zeit garantiert und deren Grenze bildet. Die Zeit erwirkt so die auf der Zählung beruhende Erkenntnis des Raumes, den die Bewegung durchmisst. Auf diese Weise kann die Zeit als das Maß des Raumes bestimmt werden. Aristoteles sagt auch noch, die Zeit und der Raum seien jeweils mehr als die Bewegung, die notwendig sowohl im Raum als auch in der Zeit ist. Bewegung und Veränderung sind Zeit ausschließlich dann, wenn sie zählbar – arithmeeta – sind, das heißt, wenn vom Seienden eine Zahl prädiziert werden kann – nicht als Menge, sondern im Übergang von Sein der Möglichkeit nach zu Sein in der Verwirklichung. Dies jedoch setzt als ein Drittes dasjenige voraus, das von der jeweils abzulesenden Zeit selbst unberührt bleibt, wie – in allen Fällen kategorialer Veränderung – die Substanz. Einzig das absolute Vergehen und Entstehen substantieller Veränderung lässt sich von der ‚betroffenen‘ Sache selbst her gar nicht – mehr – entdecken. Deren Zeugen sind allein diejenigen, die diesbezüglich die Anderen sind. So beruht epistemologisch nicht weniger als ontologisch jede Bewegung auf der Aktualität des ihr gegenüber Anderen, das – jenseits der sublunaren Sphäre des aristotelischen Kosmos – das Anders-artige ist. Eine absolut in Raum und Zeit wesende Welt muss ihrer eigenen Nichtigkeit mit parmenideischen Konsequenz verfallen: sie wird von ihrer eigenen Natur durch das, was sie ist, nicht allein verschlungen, sondern in dem Maße unverständlich, in dem nicht erklärt werden kann, aus welchem Prinzip sie sich gegen ihre eigene ontologische Unmöglichkeit behauptet. Später – bei den Scholastikern – wird gelten: kausales Unvermögen ist – absolut genommen – identisch mit dem Nichts. Der absurde Gedanke von der Selbstbegründung des Grundlosen kann nicht durch das Postulat eines sich selbst begründenden Grundes entlastet werden: vielmehr verlangen die Aktualität des im Ganzen nicht notwendigen Seins und die darum verwehrte Möglichkeit, es zu wissen, nach einen grund-losen Grund, einem 27Aristoteles, Physik, IV, 10, 217b, 32-218a, 8. 28 Ebd., IV, 11, 219b, 1-2: „Denn eben das ist die Zeit: die Messzahl der Bewegung hinsichtlich des ‚davor‘ und ‚danach‘.“ 160 Dominicus Trojahn Sein von absoluter Aktualität und vollendeter ‚noeesis‘ – Erkenntnis – , durch dessen Denken das von ihm Gedachte erst denkbar wird.29 Die Wirklichkeit dessen, das das ‚Vorhandene‘ ist, von dem Aristoteles sagte, es finde im Verwundern darüber der Beginn der Philosophie statt, und die Aussicht, davon in begründeter Weise zu wissen, sind auf Gedeih’ und Verderb an die Einsicht gebunden, dass ‚Sein‘ und ‚Zeit‘ nicht konvertibel sind. Zu Beginn dieses Essays war gesagt worden, dessen Absichten seien in schwindelerregendem Maße beschränkt. Hätte der Verfasser damit sagen wollen, es verlohne nicht, ihn zu lesen, wäre er ein billiger Heuchler. Im Gegenteil ist er der Überzeugung, etwas höchst Wichtiges sagen zu sollen, dem die befremdliche und umwegliche Pilgerschaft zu den Heiligtümern der antiken Philosophie den Boden bereiten wollte. Auf das allein kommt es ihm an: soviel zur Beschränkung; und da es um die extremsten Höhen dessen geht, das dem Denken als Gedanke zugänglich zu sein scheint, ist mit dem Schwindel – seiner doppelten Bedeutung nach – ernsthaft zu rechnen. Wer in der Philosophie für sich nicht den Vorzug in Anspruch nimmt – oder aus historischen Gründen nehmen kann – , von Gott zu schweigen, der steht leicht in Versuchung, sich dem Wort von der Transzendenz anzuvertrauen und das Objekt diesbezüglichen Denkens in die Sphäre ‚jenseits des Seins‘ zu verlegen. Wer das tut, hat nicht allein – mit einer gewissen Unschärfe, die sich jedoch leicht ausgleichen lässt – Platon auf seiner Seite,30 sondern den ganzen Plotin hinter sich.31 Der Autor dieses Artikels hingegen hält einen solchen Versuch sowohl aus historischen, wie systematischen Gründen für 29Aristoteles, Metaphysik A el (II), 2, 994b, 28-3. 30 Vgl. Platon, Politeia, VI, 509b; in: Platon, Werke in acht Bänden, bearbeit. v. Dietrich Kurz, griech. Text v. Émile Chambry, übers. v. Friedrich Schleiermacher, Bd. 4: Politeia, 1990, S. 544-545: „Ebenso nun sage auch, daß dem Erkennbaren nicht nur das Erkanntwerden von dem Guten komme, sondern auch das Sein und Wesen habe es von ihm, da doch das Gute selbst nicht das Sein ist, sondern noch über das Sein an Würde und Kraft hinausragt“: all’ eti epekeina tees usias prestheiai kai dynamei huperechontos. 31 Plotin, V 3, 12(50)-13(6); in: Plotins Schriften, hg. v. Richard Harder, neubearb. v. Rudolf Beutler u. Willy Theiler, Bd. 5, Teilbd. a: Die Schriften 46-54 in chronologischer Reihenfolge. Text und Übersetzung, 1960, S. 156-157 „Jenes aber ist schlechthin Eins – hen – , ohne das ‚etwas‘ – aneu tu ti – ; denn wäre es nur etwas Eines, so wäre es nicht das Eine an sich selber – ei gar ti hen ouk an autohen – ; denn das ‚an sich selber‘ liegt vor dem Etwas. Daher Es auch in Wahrheit unaussagbar – arreeton – ist; denn was du von ihm aussagen magst, immer mußt du ein Etwas aussagen – ho ti gar an eipees ti ereis – . Vielmehr ist allein unter allen andern die Bezeichnung ‚jenseits von allen Dingen und jenseits des erhabenen Geistes‘ – epekeina pantoon kai epekeina tu semnotatu nu – zutreffend, denn sie ist kein Name, sondern besagt, daß es keines von allen Dingen ist, daß es auch ‚keinen Namen für Es‘ gibt, weil wir nichts von Ihm aussagen können; sondern wir versuchen nur nach Möglichkeit, uns untereinander einen Hinweis über Es zu geben.“ Hervorhebung im Original. Jenseits des Seins? 161 falsch. Das Interesse der Philosophie an der Frage nach Gott entstammt weder der Religion, noch den achtbaren Motiven der Frömmigkeit. Wie Heidegger richtig sagt, sucht der Philosoph keinen Horizont zum Tanzen und Singen. Aus diesem Grund ist Theologie für Philosophie genommen schwer ertragbar. Was die Philosophie jedoch zwingt, die Frage nach Gott zu stellen, ist nichts weiter – jedoch auch nichts weniger – als der schwindelerregende Zweifel, es könnte am Ende die Wirklichkeit gar nicht wirklich sein und daher der Versuch, sie zu erkennen, nichts als ein Glasperlenspiel. Die Philosophie fragt nach Gott, weil sie ihres eigenen Terrains versichert sein will, der Wirklichkeit der Welt und des Ganzen des Seins ebenso, wie der illusionsfernen Möglichkeit, diese denkend und begründet zu erkennen; die Philosophie fragt nach Gott als nach einer gewissen Natur von Sein. Ein Gott ‚jenseits des Seins‘ hingegen ist – philosophisch betrachtet – ganz und gar belanglos und die nach ihm gestellte Frage ohne jeden erkennbaren Sinn.32 32 Es wäre hier Ort und Stelle auf die – bei Aristoteles angelegte – Vorsicht zu verweisen, der gemäß der Frage, ‚was‘ etwas ist, sachlich die andere Frage vorausgeht, ‚ob‘ es ist. Für Thomas von Aquin, den Kronzeugen eines demonstrativen Diskurses ‚Vom Dasein Gottes‘ – vgl. STh, I, a. 1, q. 2 – , stellt sich die diesbezügliche Frage zunächst allein aus Gründen methodischer Konsequenz, oder einfach deswegen, weil sie dem formalen Ethos des Logos entspricht. Einer existentiellen Frage-Stellung dürfte der Beginn der STh im Hochmittelalter wohl kaum entnommen worden sein. Dabei darf nicht übersehen werden, dass damit tatsächlich die Frage nach der Existenz von etwas gestellt wird, von dem an diesem Punkt der Untersuchung noch niemand weiss, um was es sich handelt – und es, nimmt man Thomas ernst, auch später nicht wissen wird – . Streng genommen könnte damit nach irgendetwas Beliebigem gefragt sein, da das etwas, dem hinterher- oder nachgefragt wird, in Wesen und Dasein dem Denken nicht vor(aus) liegt. Doch liegt es im Wesen der Frage, von einem solchen Vorausliegenden her zu sich selbst zu gelangen. Die Frage, ‚was‘ etwas ist, setzt einen Anstoss voraus, der sich als der Ruf äussert: ‚Was, zum Teufel, liegt da herum?‘. Auf solche Weise aber fragt niemand nach Gott! Wenn das Fragen stets vom Anstoß des Dasein her fragt, warum fragt dann überhaupt jemand nach etwas, dessen Dasein er in der Weise des Anstosses gar nicht begegnet? Die Frage nach Gottes Dasein und Wesen ergibt nur insofern Sinn, als sie sich auf eine besondere Qualität von Sein richtet, die an einem bereits zuvor Befragten auf die Weise des letzten Grundes erscheint. Nach dem letzten Grund eines bereits an sich Befragten wird nicht gefragt in der Absicht, dessen Dasein zu zeigen, sondern zu klären, welche besondere Weise von Sein dessen Sosein ermöglicht. So kann zum Beispiel die sich im Falle des beliebigen – kontingenten – Seienden zeigende Notwendigkeit nur dann vom Denken angenommen werden, wenn ihr ein ‚Nichts-anderes-als-Notwendiges‘ als Grund voraus liegt. Damit wäre jene besondere Qualität von Sein in Erscheinung getreten, deren Da-Sein als das ‚Nicht-anders-können-als-zu sein‘ am zufällig Seienden als dessen Ursache entdeckt worden ist. Von daher ist es dann möglich, diesen sich von allen anderen Seienden in der Weise des Seins unterscheidenden Grund mit dem Namen ‚Gott‘ zu benennen, der jedoch von ganz woanders her semantisch bedeutsam wird. ‚Es ist ein Gott‘ Kants Weg vom Wissen zum Glauben Robert Theis Martin Heideggers Diktum, für Immanuel Kant sei die Frage, „ob und wie und in welchen Grenzen der Satz ‚Gott ist’ als absolute Position möglich sei“, der „geheime Stachel, der alles Denken der Kritik der reinen Vernunft antreibt und die nachfolgenden Werke bewegt“1, aufnehmend beziehungsweise abwandelnd, möchten wir uns in den folgenden Darlegungen verschiedene Bedeutungsaspekte der Aussage ‚Es ist ein Gott‘ in der Entwicklung von Kants Denken im Übergang von seinen Frühschriften hin zum kritischen Hauptwerk untersuchen. Mehrere Aspekte sollen dabei herausgearbeitet werden: 1. das Grundmuster der in ein ‚dogmatisches‘ Philosophiekonzept eingebetteten frühen Theologie, in der der Existenzaussage ‚Es ist ein Gott‘ eine epistemisch starke Begründungsfunktion im Sinn eines objektiven ontologischen Ermöglichungsgrundes zukommt; 2. das strukturell analoge Grundmuster der Reflexion über den Grundbegriff der Theologie − das transzendentale Ideal − im Rahmen der Kritik der reinen Vernunft, die dazu führt, der theologischen Idee im Kontext der transzendentalen Vernunft konzeption die Funktion einer quasi-ontologischen – sit venia verbo − Begründung zuzusprechen; 3. die sich auf der Grundlage der Einführung der ‚Epistèmè‘ des Glaubens ergebende neue Möglichkeit eines theologischen Diskurses angesichts der Lehre von der Begrenzung des Gebrauchs der Verstandesbegriffe. 1 Martin Heidegger, Kants These über das Sein, in: Wegmarken, Frankfurt a. M. 1967, S. 283. 163 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7_9 164 1 Robert Theis Die ‚bestimmende‘ Theologie in Kants Frühschriften Im 1763 erschienenen Einzig möglichen Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes – der einzigen Schrift übrigens, die Kant ausschließlich und ausdrücklich dem Thema der rationalen Theologie gewidmet hat – heißt es gleich zu Beginn der Vorrede: „Ich habe keine so hohe Meinung von dem Nutzen einer Bemühung, wie die gegenwärtige ist, als wenn die wichtigste aller unserer Erkenntnisse: Es ist ein Gott, ohne Beihülfe tiefer metaphysischer Untersuchungen wanke und in Gefahr sei“.2 Bedenkenswert sind diese – immerhin programmatisch am Anfang der Schrift stehenden – Sätze deswegen, weil sich in ihnen eine Spannung kundtut, die ihr Pendant in dem Satz hat, mit dem die ganze Abhandlung endet: „Es ist durchaus nöthig, daß man sich vom Dasein Gottes überzeuge; es ist aber nicht eben so nöthig, daß man es demonstrire“.3 Die demonstrative Gewissheit – sprich: der höchste Grad mathematischer Gewissheit4 − , die immerhin in der Schrift beabsichtigt ist, zumindest was den Beweis‚grund‘ betrifft, steht hier in einem eigentümlichen Kontrast zu dem, was als ‚Überzeugung‘ bezeichnet wird, womit Kant an eine bloß „subjecitve Gewisheit“5 denkt. Eine solche schreibt er der „gesunden Vernunft“ zu. Von dieser, gar von „gesundester Vernunft“, ist auch die Rede in der Vorlesung über praktische Philosophie nach der Mitschrift von Johann Gottfried Herder. Hier heißt es: „Die Religion kann die gesundeste Vernunft machen: da sie die Verstandeskräfte auf so nützliche Dinge als nöthig ist, dazu, dass die Religion in mir leben kann: und sie von Spekulationen abzieht: die vielleicht feine aber unnutze Vernunft machen können“.6 Wenn vorhin von einer Spannung die Rede war, dann handelt es sich um eine solche, die zwischen religiöser Überzeugung – Religion verstanden als „cognitio practica relationis moralis entis creati ad voluntatem Dei“7 − und Metaphysik, 2 Immanuel Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes [im Folgenden abgekürzt als Beweisgrund], in: Kant’s gesammelte Schriften, hg. v. der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften und Nachfolger, Berlin 1900 ff., Bd. II, 65. Kants Werke werden im Folgenden nach dieser Ausgabe zitiert unter Voranstellung der Sigle AA und der Angabe des Bandes in römischen, der Seitenzahl in arabischen Ziffern. Hervorhebungen in allen Zitaten Kants, wenn nicht anders vermerkt, nach dem Original. 3Ebd., AA II, 163. 4 Vgl. ebd. AA II, 66. 5 Reflexion 2695, AA XVI, 473; siehe auch Reflexion 2596, AA XVI, 434. 6 Praktische Philosophie Herder, AA 27.1, 22. 7Ebd., AA 27.1, 17. ‚Es ist ein Gott‘ 165 verstanden als objektiver Erkenntnis. Diese aber ist letztlich unerheblich, wenn es um Glückseligkeit geht; Einsichten diesbezüglich bedürfen nicht der „Spitzfindigkeit feiner Schlüsse“8. Es zeichnet sich demnach bereits ab dieser frühen metaphysischen Schrift hinsichtlich der Verortung der Aussage ‚Es ist ein Gott‘ eine Richtung ab, die hier wohl noch nicht in ihrer systematischen Tragweite durchschaut wird, der aber späterhin eine zentrale Bedeutung zukommen wird, nämlich da, wo es um den letzten Zweck des Gebrauchs der Vernunft geht, der ein praktischer ist.9 Die Erörterung und systematische Entfaltung dieses Zusammenhangs − so zentral sie auch ist − übersteigt den Rahmen der vorliegenden Untersuchung Im Folgenden soll demnach die metaphysische beziehungsweise ontologische Verankerung des theologischen Diskurses in dieser Frühphase von Kants Denken in ihren Grundzügen rekonstruiert werden. Sie steht im Rahmen eines Projekts, das Kant bereits programmatisch in seiner Erstlingsschrift, den Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte angekündigt hatte: „Unsere Metaphysik ist wie viele andere Wissenschaften in der That nur an der Schwelle einer recht gründlichen Erkenntniß; Gott weiß, wenn man sie selbige wird überschreiten sehen“.10 Ein erster Versuch diesbezüglich findet sich in der 1755 veröffentlichten Habilitationsschrift Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio. Das Thema dieser Schrift ist, wie bereits im Titel ersichtlich, die Untersuchung über die ersten Grundsätze der Erkenntnis, nämlich den Satz vom Widerspruch und den Satz vom zureichenden Grund – eine deutliche Anspielung an Christian Wolffs Metaphysik.11 Es ist im Rahmen der Diskussion des zweiten dieser Grundsätze, wo sich Kants erste Skizze einer erneuerten ontologischen Theologie findet. Diese Verortung der theologischen Reflexion scheint uns von zentraler Bedeutung zu sein, da sich in ihr eine radikale Neuorganisation des Konzepts der Metaphysik ankündigt. Während für Wolff, gemäß dessen methodischer Maxime, die sogenannte natürliche Theologie ihre Grundsätze aus der Ontologie, der Kosmologie und der Psychologie hernimmt, und demzufolge im ordo 8Kant, Beweisgrund, AA II, 65. 9 Vgl. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 825; wir zitieren im Folgenden die Kritik der reinen Vernunft im laufenden Text nach der Auflage A von 1781 beziehungsweise B von 1787. 10 Immanuel Kant, Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte, § 19, AA I, 30. 11 Christian Wolffs Deutsche Metaphysik von 1720 und die lateinische Philosophia prima sive ontologia von 1730 heben beide mit der Darstellung dieser beiden Prinzipien als der „ersten Gründe unserer Erkenntnis und allen Dingen überhaupt“ – so der Titel des 2. Kapitels der Deutschen Metaphysik – an. 166 Robert Theis inventionis erst am Schluss der Metaphysik abgehandelt wird, obwohl der ‚Gegenstand‘ selber, Gott, im ordo essendi von der höchsten Dignität ist,12 wird Kant in dieser frühen Schrift den Erweis von Gottes Dasein an den Anfang der Ontologie selber setzen, indem er den Ausgangsbegriff der Wolffschen Ontologie, nämlich den des ‚possibile‘, den Wolff zunächst am Leitfaden des Widerspruchsprinzips formal als das „primum conceptibile“13 – da nicht widersprüchlich – setzt, auf seine materialen Voraussetzungen hinterfragt, die gegeben sein müssen, damit überhaupt formal von Nicht-Widersprüchlichkeit geredet werden kann und die selber letztlich nicht mehr in etwas bloß Möglichem fundieren können, sondern – will man nicht in einen unendlichen Regress verfallen – in etwas wirklich Existierendem, das der Quell aller Möglichkeit und Wirklichkeit ist. Das Innovative dieser Vorgehensweise gegenüber Wolff liegt darin, dass dessen Ansatz einer „science l’être intégralement désexistentialisé“14 bei Kant gleichsam überwunden wird durch die Sezung eines originär Existierenden. Die Kernaussage der Nova dilucidatio lautet diesbezüglich: „Datur ens, cuius exsistentia praevertit ipsam et ipsius et omnium rerum possibilitatem, quod ideo absolute necessario exsistere dicitur. Vocatur Deus“: Es gibt ein Ding, dessen Dasein selbst seiner eigenen und aller Dinge Möglichkeit vorangeht, das demnach als unbedingt notwendig daseiend bezeichnet werden kann. Es wird Gott genannt.15 Man kann diese These als die Protoversion von Kants Ontotheologie ansehen; sie bildet den Leitfaden des Beweisgrundes, den er sieben Jahre später in der ersten Abteilung des Beweisgrundes entwickeln wird.16 Es sind drei Aussagen, die in dieser These enthalten sind: 1. die Behauptung des Daseins eines Seienden, das seiner eigenen und aller Dinge Möglichkeit vorausliegt, das demzufolge alle Realität, verstanden als das das Mögliche als Mögliches inhaltlich Konstitueirende enthält – ‚omnitudo realitatis‘ beziehungsweise ‚realissimum‘ – ; 2. dass ein solches ‚realissimum‘ notwendig existiert; 3. dass es ‚Gott‘ genannt wird. 12 Vgl. Christian Wolff, Discursus praeliminaris de philosophia in genere, in: Christian Wolff, Gesammelte Werke, hg. v. Jean École u. a., Hildesheim 1962 ff., II. Abt., Bd. 1.1, 1983, § 55. 13 Vgl. Christian Wolff, De notionibus directricibus et genuino usu philosophiae primae, in: Horae subsecivae marburgenses. Trimestre vernale 1729, in: Christian Wolff, Gesammelte Werke, a. a. O., II. Abt., Bd. 14.1, 1983, S. 311. 14 Étienne Gilson, L’être et l’essence, 1948, Paris 1987, S. 172. 15Kant, Nova dilucidatio, AA I, 395. 16 Vgl. Robert Theis, Gott. Untersuchungen zur Entwicklung des theologischen Diskurses in Kants Schriften zur theoretischen Philosophie bis hin zum Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft, Stuttgart-Bad Cannstatt 1994, S. 35 ff. ‚Es ist ein Gott‘ 167 In unserer vorliegenden Untersuchung braucht uns Kants Beweisführung in ihrem Detail nicht zu interessieren. Wir ersehen aus der ersten These, inwiefern es Kant bei der theologischen Frage um eine ontologische Grundlegungsfrage geht. Desweiteren wird ersichtlich, dass in dieser Grundlegung der Ontologie der Existenz Priorität zukommt: Hervorhebenswert ist schließlich, dass die Argumentation in der Identifikation des notwendigen Wesens mit Gott gipfelt: „Vocatur Deus“. Dem scheint der Gedanke zugrunde zu liegen, dass der Begriff von Gott zunächst nicht dem philosophischen Denken innewohnt. Das philosophische Denken gelangt erst aufgrund einer Entfaltung der im Begriff des notwendig Existierenden enthaltenen Bestimmungen zu diesem Begriff. Im Beweisgrund hat Kant diese Entfaltung in einer äußerst gerafften Formulierung zusammengefasst: „Es existirt etwas schlechterdings nothwendig. Dieses ist einig in seinem Wesen, einfach in seiner Substanz, ein Geist nach seiner Natur, ewig in seiner Dauer, unveränderlich in seiner Beschaffenheit, allgenugsam in Ansehung alles Möglichen und Wirklichen. Es ist ein Gott. Ich gebe hier keine bestimmte Erklärung von dem Begriffe von Gott. Ich müßte dieses thun, wenn ich meinen Gegenstand systematisch betrachten wollte. Was ich hier darlege, soll die Analyse sein, dadurch man sich zur förmlichen Lehrverfassung tüchtig machen kann. Die Erklärung des Begriffs der Gottheit mag indessen angeordnet werden, wie man es für gut findet, so bin ich doch gewiß, daß dasjenige Wesen, dessen Dasein wir nur eben bewiesen haben, eben dasjenige göttliche Wesen sei, dessen Unterscheidungszeichen man auf eine oder die andere Art in die kürzeste Benennung bringen wird“.17 Hier wird das gesamte Spektrum der ontologischen und metaphysischen Bestimmungen des unbedingt Notwendigen, die es als ‚Gott‘ zu qualifizieren in der Lage sind, durchbuchstabiert. Überraschend in dieser Aufzählung ist allerdings, dass zwei – metaphysische – Prädikate fehlen, nämlich Verstand und Wille, wodurch das notwendige Wesen als Geist identifizierbar ist, und denen Kant immerhin einen eigenen Abschnitt in der Schrift gewidmet hat,18 fehlen. In der Reflexion 3733, die man als Entwurf für die erste Abteilung des Beweisgrundes ansehen kann, bringt Kant die genannten Begriffe in Beziehung zu dem der Person: „Das nothwendige Wesen hat den Vollkommensten Verstand und Willen. / 17Kant, Beweisgrund, AA II, 89. In dieser Vorgehensweise trifft sich Kants Argumentation mit derjenigen von Christian Wolff, der in seiner Theologia naturalis. Pars prior ebenfalls zunächst beweist, dass ein notwendiges Wesen existiert – § 24 – und in der Folge eine Reihe ontologischer Bestimmungen – wie Selbständigkeit, Ewigkeit, Einfachheit – eruiert – §§ 25-66 – , um dann, ab § 67, die Identität dieses auf dem Wege der natürlichen Vernunft gewonnenen Seienden mit dem Gott der Hl. Schrift aufzuzeigen. 18 Siehe Kant, Beweisgrund, AA II, 87 ff. 168 Robert Theis Das nothwendige Wesen ist also eine Persohn, welche den Grund von allem Daseyn enthält durch Verstand und Willen. D. i. es ist ein Gott“.19 Haben wir es also hier mit der „Verwandlung des Neutrums in die Person“20 zu tun, so taucht im Beweisgrund indes, wie das vorige Zitat zeigt, noch ein weiterer Begriff auf, der offensichtlich in Kants Augen umfassender ist, um den Begriff von Gott angemessen auszusagen, nämlich der der Allgenugsamkeit. Von diesem wird es später in der Schrift heissen, es sei der erhabenste Gedanke, den sich endliche Wesen von Gott machen können.21 So gesehen dürfte es denn auch kein Zufall sein, wenn Kant in der 2. Abteilung der Schrift, in der er auf dem „Erkenntnisweg a posteriori“22 zu demselben „Grundbegriff des schlechterdings nothwendigen Daseins“23 gelangt wie im apriorischen Beweis, gerade mit einer Betrachtung über die göttliche Allgenugsamkeit den Abschluss macht: „Gott ist allgenugsam. Was da ist, es sei möglich oder wirklich, das ist nur etwas, in so fern es durch ihn gegeben ist“.24 In diesem Gedanken verdichten sich Personalität und ‚Urgrundlichkeit‘. Die vorigen Darlegungen ergeben, dass auf der Grundlage der genannten frühen Schriften der Aussage ‚Es ist ein Gott‘ eine doppelte Bedeutung zukommt: einmal die einer Existenzaussage, auf die die apriorisch verfahrende Vernunft stößt, zum andern die einer Wesensaussage, die sich als Ergebnis einer Reflexion über den ontologisch beziehungsweise metaphysisch explizierten Begriff in einer identifizierenden Aussage ‚Es‘ ist ‚ein Gott‘ formulieren läßt. Kants frühe theologischen Entwürfe stellen den Versuch dar, auf der Grundlage einer ‚dogmatisch‘ verfahrenden Vernunft und dem damit einhergehenden epistemischen Anspruch systematischer Philosophie, der Existenzaussage Gottes eine ontologische Begründungsfunktion zuzuordnen: Gott ist Quelle aller Realität und Ursache aller Wirklichkeit. 19 Reflexion 3733, AA XVII, 275. 20 Hermann Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, 1918, Wiesbaden 1988, S. 48. 21 Siehe Kant, Beweisgrund, AA II, 151. 22Ebd., AA II, 92. 23Ebd. 24Ebd., AA II, 151. ‚Es ist ein Gott‘ 2 169 Das theologische Programm der Kritik der reinen Vernunft Kants immer wieder anhebende Ausführungen zur Theologie im Rahmen seiner kritizistischen Metaphysik – als der „Wissenschaft, von der Erkenntnis des Sinnlichen zu der des Übersinnlichen durch die Vernunft fortzuschreiten“25 − sind naturgemäß vor dem Hintergrund der in der transzendentalen Ästhetik und Analytik in der Kritik der reinen Vernunft herausgearbeiteten Konfiguration über die Leistungen des Verstandes zu lesen. Zusammenfassen lautet deren Ergebnisse, „dass der Verstand a priori niemals mehr leisten könne, als die Form einer möglichen Erfahrung überhaupt zu anticipiren, und, da dasjenige, was nicht Erscheinung, kein Gegenstand der Erfahrung sein kann, daß er die Schranken der Sinnlichkeit innerhalb denen uns allein Gegenstände gegeben werden, niemals überschreiten könne“.26 So gesehen ist jeder Überschritt hin auf das Übersinnliche, den die Fortschritte als den „natürlichste[n] nach dem Zweck der Vernunft“27 bezeichnen, in kognitiv konstitutiver Hinsicht als Schein enttarnt, freilich als ein unvermeidlicher, insofern die Vernunft, „wie es ihre Natur mit sich bringt“,28 zum Unbedingten hin tendiert und von den ihr zur Verfügung stehenden reinen Begriffen des Verstandes einen nicht rechtmäßigen Gebrauch macht. Dies ist in Kants Augen in den traditionellen Disziplinen der speziellen Metaphysik – allgemeine Kosmologie, rationale Psychologie, natürliche Theologie – dokumentiert, deren Themen, von der inneren Notwendigkeit der Vernunft aus gesehen zwar legitim sind, deren Erkenntnisansprüche aber mangels einer Kritik der Vernunft grundlos, eben bloßer Schein sind. Die sich auf dieser Linie ergebende Kritik an der speziellen Metaphysik, das, was Kant als „dialektische Schlüsse der reinen Vernunft“29 bezeichnet, bildet konsequenterweise den Hauptteil der „transzendentalen Dialektik“, diese verstanden als „Kritik des dialektischen Scheins“.30 Was diesbezüglich spezieller die natürliche Theologie – in den „drei Beweisarten vom Dasein Gottes aus speculativer Vernunft“31, sprich: der ontologischen, kos25 Immanuel Kant, Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht hat?, AA XX, 260 [im Folgenden abgekürzt als Fortschritte]. 26Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 303. 27Kant, Fortschritte, AA XX, 262. 28Kant, Kritik der reinen Vernunft, A VII. 29 Ebd., B 396. 30 Ebd., B 87. 31 Ebd., B 618. 170 Robert Theis mologischen und physikotheologischen – betrifft, gelangt Kant zu dem Ergebnis, „daß alle Versuche eines bloß spekulativen Gebrauchs der Vernunft in Ansehung der Theologie gänzlich fruchtlos und ihrer inneren Beschaffenheit nach null und nichtig sind“.32 Der systematische Ort dieser Kritik wird aber nur verständlich, wenn man sie in den Rahmen von Kants Theorie der Vernunft – im engeren Sinn, so wie er sie im ersten Buch der Transzendentalen Dialektik entfaltet – einbettet. Trifft zu, dass es keinen Beweis vom Dasein Gottes im Sinn einer objektiven Existenzaussage gibt, so folgt daraus nicht, dass die ‚Arbeit am Gottesbegriff‘ müßig sei. 2.1 Die Vernunft und ihre Begriffe Im zweiten Punkt der Einleitung in die Transzendentale Dialektik spricht Kant davon, dass die Erkenntnis als ein Ganzes anzusehen sei, das seinen Ausgang bei den Sinnen nimmt, von da zum Verstande übergeht und bei der Vernunft endigt, „über welche nichts Höheres in uns angetroffen wird, den Stoff der Anschauung zu bearbeiten und unter die höchste Einheit des Denkens zu bringen“.33 Damit ist die Funktion der Vernunft im Gesamt des menschlichen Erkenntnisgeschehens benannt, nämlich höchste Einheit als Vollendung des Verstandes hervorzubringen. Dies ist zunächst als eine Forderung zu verstehen. Höchste Einheit kann aber nur aufgrund von höchsten Prinzipien zustande kommen. Die leitende Frage ist nun die, ob die Vernunft auch „Urheberin“34 beziehungsweise ein „eigener Quell von Begriffen und Urteilen“35 ist, womit ein transzendentaler Gesichtspunkt anvisiert ist, insofern dies heißt: ob Vernunft „a priori synthetische Grundsätze und Regeln enthalte“.36 Bei der Beantwortung dieser Frage geht Kant, genau so wie im Fall der reinen Verstandesbegriffe,37 von der logischen Funktion der Vernunft aus. Die Vernunft wird in dieser Hinsicht als das „Vermögen, mittelbar zu schließen“38, definiert. Der Vernunftschluss ist insofern die „Erkenntniß der Nothwendigkeit eines Satzes durch die Subsumtion seiner Bedingung unter 32 Ebd., B 664. 33 Ebd., B 355. 34 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA IV, 448. 35Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 362. 36 Ebd., B 363. 37 Vgl. ebd., B 105. 38 Ebd., B 355. ‚Es ist ein Gott‘ 171 eine gegebene allgemeine Regel“39. Der hier zum Ausdruck kommende Vollzug des in-Beziehung-Setzens erlaubt es, in einem ersten Ansatz, der Rede von der Einheit ihre Konturen zu verleihen: Einheit unter Erkenntnissen gründet zunächst in der Gültigkeit des Schliessens. Sie ist also dann gegeben, wenn ein Urteil – Konklusion – mit Notwendigkeit als enthalten unter einer allgemeinen Regel und unter einer bestimmten Bedingung gedacht wird.40 Gemäss dem dreifach möglichen in-Beziehung-Setzen, das sich aus den logischen Arten des Verhältnisses überhaupt ergibt, erschliessen sich drei mögliche Arten von Einheit. Im Begriff der Vernunft als dem Vermögen der Prinzipien liegt nun in dieser formalen Hinsicht die Maxime beschlossen, die Erkenntnisse auf die „kleinstmögliche Zahl“41 zu bringen und zwar auf Prinzipien, durch welche die Einheit der Erkenntnisse vollendet wird, anders gewendet, auf unbedingte Bedingungen. Geht man nun von dieser logischen einheitsstiftenden Funktionsweise der Vernunft über zur transzendentalen, also zu dem in ersterer notwendig mitvollführten Aktus der synthetischen Leistung, dann ergeben sich ebensoviele synthetische Grundbegriffe beziehungsweise unbedingte Bedingungen der Synthesis – die a priori auf Objekte gehen – wie es einheitsstiftende formale Typen von Vernunftschlüssen gibt: ein Unbedingtes der kategorischen Synthesis, der hypothetischen Synthesis sowie der disjunktiven Synthesis.42 Damit aber ergibt sich nun das eigentliche Problem, das diese Grundbegriffe betrifft, und zwar auf der Basis der Grundthese von der Begrenztheit der objektiven Gültigkeit der Erkenntnis, die, in einer der vielen Formulierungen besagt, dass der Gegenstand einem Begriff nicht anders als in der Anschauung gegeben werden kann.43 Den unbedingten Synthesebegriffen können keine kongruierenden Gegenstände in der Erfahrung gegeben werden und sie sind als Begriffe der aboluten Totalität in gegenstandskonstitutiver Hinsicht „ohne Sinn“.44 Mit dieser pointierten Behauptung stehen wir nun vor einem paradoxen Sachverhalt, insofern sich einerseits die Notwendigkeit des Gründens aus dem Bedürfnis der Vernunft selber her ergibt, was, wie oben gezeigt, in spezifischen synthetischen Leistungen seinen Ausdruck findet, andererseits diese selben Leistungen gleichzeitig mit Notwendigkeit ohne Synthesis sind – im Sinne einer Beziehung aufs Objekt. 39 Immanuel Kant, Logik, § 56, AA IX, 120. 40 Vgl. ebd., § 57, AA IX, 120. 41Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 362. 42 Ebd., B 379. 43 Vgl. ebd., B 298 f. 44 Ebd., B 299. 172 Robert Theis Solche paradoxen Begriffe der Vernunft bezeichnet Kant als Ideen: „Ich verstehe unter der Idee einen nothwendigen Vernunftbegriff, dem kein congruirender Gegenstand in den Sinnen gegeben werden kann. Also sind unsere jetzt erwogene reine Vernunftbegriffe transcendentale Ideen. Sie sind Begriffe der reinen Vernunft; denn sie betrachten alles Erfahrungserkenntniß als bestimmt durch eine absolute Totalität der Bedingungen. Sie sind nicht willkürlich erdichtet, sondern durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben und beziehen sich daher nothwendiger Weise auf den ganzen Verstandesgebrauch. Sie sind endlich transcendent und übersteigen die Grenze aller Erfahrung, in welcher also niemals ein Gegenstand vorkommen kann, der der transcendentalen Idee adäquat wäre“.45 2.2 Die dritte transzendentale Idee und das Ideal der reinen Vernunft Wir haben oben darauf hingewiesen, daß Kant die transzendentalen Ideen als die eigentlichen Begriffe der reinen Vernunft am Leitfaden der Formen der Vernunftschlüsse gewinnt: die sogenannte metaphysische Deduktion der Ideen. Dem dritten – diskunktiven – Vernunftschluß entspricht die Idee von der absoluten Einheit der Bedingung aller Gegenstände des Denkens überhaupt, welche mit dem Gegenstand der Theologie gleichgestellt wird.46 Untersuchen wir genauer, wie sich diese Idee aufgrund des dritten Vernunftschlusses ergibt, um auf diese Weise einen ersten Zugang zu ihrem Inhalt zu gewinnen. Die Definition des disjunktiven Vernunftschlusses entnehmen wir Kants Logik: „In den disjunctiven Schlüssen ist der Maior ein disjunctiver Satz und muß daher, als solcher, Glieder der Eintheilung oder Disjunction haben. - / Es wird hier entweder 1) von der Wahrheit Eines Gliedes der Disjunction auf die Falschheit der übrigen geschlossen, oder 2) von der Falschheit aller Glieder, außer Einem, auf die Wahrheit dieses Einen“.47 Inwiefern ergibt sich die oben genannte dritte transzendentale Idee aus dem Gedanken des disjunktiven Vernunftschlusses? In diesem Schluß wird einem Begriff 45 Ebd., B 383 f.; über die neue Bedeutung des Begriffs ‚Idee‘ bei Kant vgl. Norbert Hinske, Kants Anverwandlung des ursprünglichen Sinnes von Idee, in: Lessico Intelletuale Europeo: Idea. VI Colloquio Internazionale, Roma 5-7 gennaio 1989, hg. v. Marta Fattori u. Massimo Luigi Bianchi, Rom 1992, S. 317-327. 46 Vgl. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 391. 47Kant, Logik, § 77, AA IX, 129 f.; vgl. Georg Friedrich Meier, Auszug aus der Vernunftlehre, Halle 1752, § 396, nach dem Wiederabdruck in AA XVI, 749 f. ‚Es ist ein Gott‘ 173 ein Prädikat zu- oder abgesprochen durch Ausgrenzung aus einem Inbegriff von Prädikaten. Damit ein solcher Schluß aber überhaupt denkbar ist, muß man einen höchsten Obersatz denken, der alle möglichen Prädikate aller möglichen Dinge umfaßt, also den Inbegriff aller möglichen positiven Prädikate oder Realitäten. Der Begriff, dem im Schlußsatz ein Prädikat zu- beziehungsweise abgesprochen wird, steht unter dem Prinzip der Bestimmbarkeit. Wenn ich aber einem Begriff eine Bestimmung zu- oder abspreche, dann liegt darin, daß meine Urteilskraft die gesamte Sphäre der möglichen Prädikate durchläuft und bezüglich eines jeden dieser Prädikate entschieden hat, ob die mit ihm vermeinte Bestimmung dem Subjektbegriff zukommt oder nicht. Jedesmal also, wenn ich ein Ding denke, habe ich implizit, indem ich das Ding als dieses ‚Etwas‘ denke – und als solches geht es sachlich jeder erkenntniskonstitutiven Leistung des Verstandes voraus, die Gesamtheit der möglichen Prädikate, also den Inbegriff, als die schlechthinnige Bedingung der Möglichkeit des Denkens dieses Dinges, also seiner sachhaltigen Bestimmungen selber vorausgesetzt. Die Frage, die sich nun stellt, ist, inwiefern diese Gesamtheit mit der theologischen Idee kongruent ist. Diese Gleichsetzung, die Kant bereits programmatisch im ersten Buch der Transzendentalen Dialektik aufstellt − „das Ding, welches die oberste Bedingung der Möglichkeit von allem, was gedacht werden kann, enthält (das Wesen aller Wesen) [ist] der Gegenstand der Theologie“48 − wird verständlich, wenn man einen Blick auf Kants Konzeption von Gott wirft, wie sie sich im ontotheologischen Rahmen artikuliert. Wir haben oben bereits darauf hingewiesen, dass in Kants früher Ontotheologie der Begriff von Gott als der eines notwendigen – ens necessarium – und absolut realen – ens realissimum – Wesens gedacht wird. Alles, was in unseren Begriffen an Realität – sprich: Sachhaltigkeit – da ist, ist es aufgrund eines notwendig existierenden Wesens, das den „letzten Realgrund aller andern Möglichkeit“ enthält.49 Dieser Begriff der Allheit der Realität hält sich in Kants Entwicklung während der 60er und 70er Jahre durch – wenngleich gelegentlich Interpretationsschwankungen auftreten – und das mit ihm verbundene Bedeutungspotential bildet den Kern der späteren dritten transzendentalen Idee, den aus reinem Denken erreichbaren Grundbegriff der transzendentalen – reinen – Theologie. Genau dieser Begriff der Allheit als der Totalität der Realitäten im Sinne ihrer kollektiven Einheit – also als ein Ding – kommt im Begriff der „absoluten Einheit der Bedingung aller Gegenstände des Denkens überhaupt“50 zum Ausdruck. Es ist 48Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 391. 49Kant, Beweisgrund, AA II, 83. 50Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 391. 174 Robert Theis auch dieser Begriff, der mit dem Titelbegriff des 3. Hauptstücks des 2. Buches der ‚Transzendentalen Dialektik‘ vermeint ist, welches mit Das Ideal der reinen Vernunft51 überschrieben ist. Da, wo Kant den Plan seiner Analyse der dialektischen Vernunftschlüsse skizziert, beschreibt er das Thema, das unter diesem Titelbegriff verhandelt werden soll, folgendermaßen: „Endlich schließe ich … von der Totalität der Bedingungen, Gegenstände überhaupt, so fern sie mir gegeben werden können, zu denken, auf die asbolute synthetische Einheit aller Bedingungen der Möglichkeit der Dinge überhaupt, d. i. von Dingen, die ich nach ihrem bloßen transcendentalen Begriff nicht kenne, auf ein Wesen aller Wesen, welches ich durch einen transcendentalen Begriff noch weniger kenne, und von dessen unbedingter Nothwendigkeit ich mir keinen Begriff machen kann. Diesen dialektischen Vernunftschluß werde ich das Ideal der reinen Vernunft nennen“.52 Wir wollen im Folgenden diesen Begriff nur soweit ausdifferenzieren, wie dies für unsere These von der Begründungsfunktion der theologischen Behauptung von Interesse ist. Dem Abschnitt über das ‚transzendentale Ideal‘ geht ein kurzer Abschnitt voraus, der überschrieben ist Von dem Ideal überhaupt 53. Dieses endet mit einer für unseren Zweck wichtigen Bemerkung: „Die Absicht der Vernunft mit ihrem Ideale ist … die durchgängige Bestimmung nach Regeln a priori; daher sie sich einen Gegenstand denkt, der nach Prinzipien durchgängig bestimmbar sein soll, obgleich dazu die hinreichenden Bedingungen in der Erfahrung mangeln und der Begriff selbst also transzendent ist“.54 Der Von dem transzendentalen Ideal (Prototypon transcendentale) überschriebene Abschnitt55 gliedert sich in zwei ungleiche Gedankenschritte,56 deren erster uns hier 51 52 53 54 55 56 Vgl. ebd., B 595. Ebd., B 398. Ebd., B 595-599. Ebd., B 599. Ebd., B 599-611. Der erste – Abschnitte 1-14 – enthält den Aufweis der inneren Notwendigkeit des Begriffs beziehungsweise dessen absolute Begründungsfunktion im Aufbau des theoretischen Wissens, der zweite – Abschnitte 15-17 – hingegen das Diaklektische dieses Begriffs; vgl. Heinz Heimsoeth, Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Dritter Teil, Berlin 1969, S. 409 ff.; François Marty, La naissance de la métaphysique chez Kant, Paris 1980, S. 159 ff.; Svend Andersen, Ideal und Singularität. Über die Funktion des Gottesbegriffes in Kants theoretischer Philosophie, Berlin u. New York 1983, S. 190 ff.; Claude Piché, Das Ideal. Ein Problem der Kantschen Ideenlehre, Bonn 1984, S. 13 ff.; Giovanni B. Sala, Kant und die Frage nach Gott. Gottesbeweise und Gottesbeweiskritik in den Schriften Kants, Berlin u. New York 1990, S. 229 ff.; Norbert ‚Es ist ein Gott‘ 175 vor allem beschäftigen soll, weil sich in ihm die transzendentale Arbeit am Gottesbegriff als einer „natürlichen und nicht bloß willkürlichen Idee“57, aufzeigen lässt, die dem Denken von Dingen – nicht der Erkenntnis von Gegenständen – zugrundeliegt. Kant entwickelt den Begriff des transzendentalen Ideals auf mehreren, aufeinander aufbauenden Ebenen. Die erste ist ontologisch-transzendentaler Natur. Auf sie wird gleich zu Beginn des Abschnitts Bezug genommen. Kant geht dort von der These aus, dass jedes Ding, „seiner Möglichkeit nach“,58 unter dem Grundsatz der durchgängigen Bestimmung steht. Das bedeutet: um als dieses Ding in seiner Singularität, und also überhaupt existieren zu können, muss es vollständig bestimmt sein. Dies impliziert, dass es von ihm einen vollständigen Begriff geben muss. Diesem Grundsatz zufolge wird jedes Ding, um als ein solches denkbar zu sein, auf den Horizont aller möglichen Prädikate, also auf die Gesamtheit des Möglichen, bezogen werden müssen. Das besagt, daß die Vernunft den Inbegriff aller Möglichkeit – oder Realität: omnitudo realitatis – , der zur vollständigen Denkbarkeit eines Dinges notwendig ist, als ‚Idee‘ voraussetzen muß und diese demnach insofern notwendig ist,59 wenn und insofern überhaupt etwas soll gedacht werden können. Kant bezeichnet sie auch als „transcendentale[s] Substratum … welches gleichsam den ganzen Vorrat des Stoffes, daher alle mögliche Prädicate der Dinge genommen werden können, enthält“.60 Dieser Begriff aller Möglichkeit wird bei vertiefter Analyse dahingeghend zugespitzt, dass unterschieden wird zwischen ursprünglichen und abgeleiteten Prädikaten oder Realitäten eines Dinges. So findet sich, „daß diese Idee, als Urbegriff, eine Menge von Prädikaten ausstoße, die als abgeleitet durch andere schon gegeben sind, oder neben einander nicht stehen können, und daß sie sich bis zu einem durchgängig a priori bestimmten Begriffe läutere, und dadurch der Begriff von einem einzelnen Gegenstande werde, der durch die bloße Idee durchgängig bestimmt ist, mithin ein Ideal der reinen Vernunft genannt werden muß“,61 welches als ‚Ding an sich selbst‘ vorgestellt wird, dieses verstanden als ens realissimum.62 Fischer, Dieter Hattrup, Metaphysik aus dem Anspruch des Anderen, Paderborn 1999, S. 103 ff.; Giovanni Ferretti, Ontologie et théologie chez Kant, Paris 2001, S. 153 ff.; Robert Theis, La raison et son Dieu. Étude sur la théologie kantienne, Paris 2012, S. 175-189. 57Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 609. 58 Ebd., B 599. 59Vgl. Reflexion 5775, AA XVIII, 351; vgl. auch Reflexion 6282, AA XVIII, 549. 60Kant, Kritik der reinen Vernunft, B. 603. 61 Ebd., B 601 f. 62 Vgl. ebd., B 603 f.; die Rückkoppelung des Begriffs des transzendentalen Ideals an die Argumentation bezüglich der dritten transzendentalen Idee, die sich im 2. Abschnitt 176 Robert Theis Dieser zunächst ‚neutrale’ Begriff – neutral in dem Sinne, daß er auf dieser Ebene zunächst rein ontologisch-transzendental und noch nicht theologisch interpretiert wird – dient nun Kant wiederum als Ausgangspunkt einer neuen Reflexion über das Verhältnis des Ideals zu den möglichen Dingen. War dieses Verhältnis im vorigen Schritt – Phase 1 – dahingehend bestimmt worden, daß die durchgängige Bestimmung alles Existierenden – und demnach auch Erkennbaren – den Inbegriff der Realität voraussetze, so wird jetzt dieses Verhältnis im Sinne einer Ableitung der möglichen Dinge von der „unbedingten Totalität der durchgängigen Bestimmung“63 gedeutet, diese wiederum als Einschränkung verstanden. Demzufolge kommt dem Begriff des realissimum gegenüber den Möglichkeiten die Ursprünglichkeit zu. Genau dieser Aspekt nun führt dazu, das realissimum auf dieser noch neutralen Stufe im Sinne eines Urwesens – insofern es unabhängig ist – höchsten Wesens – insofern es vollkommen ist – oder Wesens aller Wesen – insofern es allgenugsam ist64 – zu bestimmen.65 Die zweite Ebene, die zur Sprache kommt, betrifft die theologische Deutung im engeren Sinne des transzendentalen Ideals. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt bei der Reflexion über die oben dargestellte Deutung des Verhältnisses des realissimum zu den möglichen Dingen. Hier rückt jetzt der Gedanke des Grundes in den Vordergrund, ein Gedanke, der auf älteste Schichten in Kants theologischem Denken verweist. Die Zuspitzung des realissimum als Grund impliziert ihrerseits eine Reihe von Bestimmungen, die es als theologischen Grundbegriff aufscheinen lassen. Kant schreibt: „Wenn wir nun dieser unserer Idee, indem wir sie hypostasieren, so ferner nachgehen, so werden wir das Urwesen durch den bloßen Begriff der höchsten Realität als ein einiges, einfaches, allgenugsames, ewiges, etc., mit einem Worte, es in seiner unbedingten Vollständigkeit durch alle Prädikamente bestimmen können“.66 Die Hypostasierung, von der hier die Rede ist, besagt nicht die Position – im Sinne der objektiven Wirklichkeit – des realissimum, sondern die Singularität seines Bestehens, wie dies aus der Aufzählung der Prädikamente – Einigkeit, Einfachheit, Allgenugsamkeit, Ewigkeit67 – hervorgeht. Der so zugrundegelegte Begriff des reades ersten Buches der Transzendentalen Dialektik befindet, kann hier unberücksichtigt bleiben: vgl. ebd., B 604 f. 63 Ebd., B 606. 64 Vgl. ebd., B 606 f. 65Vgl. Reflexion 6251, AA XVIII, 531. 66Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 608. 67 Ebd., B 608; diese Aufzählung entspricht zum Teil derjenigen, die man bereits im Beweisgrund antrifft: vgl. AA II, 89. ‚Es ist ein Gott‘ 177 lissimum ist nun der von Gott „im transcendentalen Verstande gedacht, und so ist das Ideal der reinen Vernunft der Gegenstand einer transcendentalen Theologie“.68 Mit dem Erreichen des theologischen Grundbegriff sind die Darlegungen des ersten Gedankenschritts in diesem Abschnitt der Kritik abgeschlossen. Dabei ging es Kant offenbar darum, den notwendigen Gang des Vernunftgeschehens darzutun, mithin die Tatsache, daß die Vernunft aus sich heraus, auf die Bildung des Begriffs von Gott hindrängt,69 wenngleich ihr verwehrt bleibt, diesem Begriff objektive Realität zuzusprechen. Am Ende des Theologiekapitels behauptet Kant – und dies trotz der in den Schlussabsätzen des Idealkapitels entwickelten Entzauberung − , das höchste Wesen bleibe „für den bloß speculativen Gebrauch der Vernunft ein bloßes, aber doch fehlerfreies Ideal, ein Begriff, welcher die ganze menschliche Erkenntnis schließt und krönet“.70 68Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 608. 69 Wir werden aus systematischen Gründen, die unseren Darlegungen als Leitfaden dienen, die kritische Dekonstruktion des Idealbegriffs, so wie sie in den letzten Absätzen des Idealkapitels erfolgt, außer Acht lassen. Verwiesen sei lediglich auf die eigentliche Schwierigkeit, die Kant gleich in den ersten Sätzen des 15. Absatzes – vgl. B 608 – folgendermaßen formuliert: „Indessen würde dieser Gebrauch der transzendentalen Idee doch schon die Grenzen ihrer Bestimmung dun Gültigkeit überschreiten. Denn die Vernunft legte sie nur, als den Begriff von aller Realität, der durchgängigen Bestimmung der Dinge überhaupt zum Grunde, ohne zu verlangen, daß all diese Realität objektive gegeben sei und selbst ein Ding ausmache. Dieses letztere ist eine bloße Erdichtung, durch welche wir das Mannigfaltige unserer Idee in einem Ideale, als einem besonderen Wesen, zusammenfassen undrealisieren, wozu wir keine Befugnis haben“. Der Überschritt betrifft zwei Aspekte: Einerseits wird aus dem Begriff zur Realisierung fortgeschritten, also zur Behauptung der objektiven Realität; andererseits wird zur Behauptung übergegangen, daß der transzendentalen Idee ein ‚einiges‘ Ding entspreche. Dies sind zwei voneinander zu unterscheidende Aspekte, wenngleich hinzugefügt werden muß, daß die objektive Realisierung nur unter der Voraussetzung eines einigen Dinges denkbar ist. 70 Ebd., B 669. 178 2.3 Robert Theis Die Vollendung des kritischen Geschäfts oder Entwurf einer philosophischen Theologie in der Modalität eines doktrinalen Glaubens Die transzendentale Reflexion, so wie sie in der Kritik der reinen Vernunft zur Durchführung gelangt, ist als „Metaphysik von der Metaphysik“71 ein Metadiskurs, der, indem er bestimmte kognitive Ansprüche der – nicht kritisch geläuterten – Vernunft als unvermeidlichen Schein entlarvt, zugleich Raum freigibt für Diskurse, die es überhaupt erst zu entwerfen gilt. Dies trifft unseres Erachtens – sofern wir uns auf den Bereich der theoretischen Vernunft beschränken – insbesondere auf die Theologie zu. Weder von ihren Zielsetzungen noch von ihrem systematischen Aufbau her ist die transzendentale Elementarlehre der Kritik der reinen Vernunft nicht der Rahmen, innerhalb dessen ein solcher Diskurs zu entwickeln ist. Nun ist es aber bemerkenswert, dass Kant der Transzendentalen Dialektik einen Anhang anfügt, in dem er genau dies tut. In diesen abschließenden Abschnitten finden wir in der Tat die systematische – freilich noch um ihre begrifflichen Konturen ringende − Skizze einer Theologie unter den Voraussetzungen der transzendentalen Analytik und der transzendentalen Dialektik.72 Bevor wir uns ihr zuwenden, ist jedoch zunächst die grundlegende Frage nach dem epistemischen Status eines derartigen Diskurses zu fragen. Unsere These lautet, dass dieser als ‚Glaube‘ zu bezeichnen ist. Dieser Begriff ist in dem Sinn zu verstehen, wie ihn Kant im dritten Abschnitt des Kanons der reinen Vernunft in der transzendentalen Methodenlehre definiert, nämlich als subjektiv zureichendes, aber objektiv unzureichendes Fürwahrhalten73 – dies im Gegensatz einerseits zum Wissen, das sowohl subjektiv als auch objektiv zureichendes Fürwahrhalten ist, andererseits zum Meinen, das weder objektiv noch subjektiv zureichend ist. Hinsichtlich der spekulativen Fragen, und hier insbesondere hinsichtlich der Frage nach dem möglichen Sinn der Rede von Gottes Existenz und den damit verbundenen Nachfolgeproblemen, ist in Kants Augen das Meinen zu wenig, das Wissen jedoch zu viel.74 Daraus folgt, dass der theologische Diskurs epistemisch dem Glauben zuzuordnen ist. 71 Brief an Marcus Herz nach dem 11. Mai 1781, in: AA X, 269. 72 Erste Ansätze eines solchen Diskurses findet man bereits in der Metaphysik Pölitz, die vermutlich aus der zweiten Hälfte der 70er Jahre stammt. 73Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 850. 74 Ebd., B 851. ‚Es ist ein Gott‘ 179 Nun schränkt Kant in besagtem Abschnitt allerdings diese Epistèmè auf den Bereich des Praktischen ein: Das theoretisch unzureichende Fürwahrhalten kann „überall bloß in practischer Beziehung“75 – wobei die Moral gemeint ist – als Glauben bezeichnet zu werden. Allerdings gibt er dann einige Absätze später zu bedenken, dass es „in bloß theoretischen Urteilen“ ein Analogon zum practischen Glauben gibt, das er als „doctrinalen Glauben“76 – im übrigen ein hapax − bezeichnet. Mit diesem Ausdruck scheint Kant an eine Art ‚Lehrsystem‘ – das Opus postumum spricht häufig von einem ‚systema doctrinale‘, mithin Doktrin und nicht Kritik − zu denken. Gleichzeitig aber soll der Begriff als „Ausdruck der Bescheidenheit“77 in objektiver Hinsicht verstanden werden.78 Bemerkenswert ist, dass Kant in besagtem Abschnitt das Thema des doktrinalen Glaubens in direkten Zusammenhang mit der „Lehre vom Dasein Gottes“79 bringt: „Nun müssen wir gestehen, daß die Lehre vom Dasein Gottes zum doctrinalen Glauben gehöre“.80 Die Begründung dieser Aussage erfolgt mit Rückgriff auf ein Argument, das im Anhang zur Transzendentalen Dialektik entwickelt wurde. Daraus lässt sich wohl schliessen, dass die dortige Skizze als ein doktrinales Fragment einer Theologie gelesen werden kann. Nach ihrer Ausdifferenzierung ist nun zu fragen.81 Den Ausgang wollen wir bei folgendem Gedanken nehmen: „Alles, was in der Natur unserer Kräfte gegründet ist, muß zweckmäßig … sein“.82 Mit Bezug auf die transzendentalen Ideen heisst dies, dass sie „ihre gute und zweckmäßige Bestimmung in der Naturanlage unserer 75Ebd. 76 Ebd., B 853. 77 Ebd., B 855. 78 Von ‚Bescheidenheit der Vernunft‘ ist noch einmal die Rede in der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, und zwar im Zusammenhang der Wunder: Die Bescheidenheit der Vernunft besteht darin, in ihren Ansprüchen nicht über die Grenzen der Erfahrung hinauszugehen: vgl. Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI, 89. 79Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 854. 80Ebd. 81 Vgl. Rudolf Malter, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft. Systematische Überlegungen zu Kants Ideenlehre, in: 200 Jahre Kritik der reinen Vernunft, hg. v. Joachim Kopper u.Wolfgang Marx, Hildesheim 1981, S. 129 ff.; Rolf-Peter Horstmann, Die Idee der systematischen Einheit. Der Anhang zur transzendentalen Dialektik in Kants Kritik der reinen Vernunft, in: Bausteine kritischer Philosophie. Arbeiten zu Kant, Bodenheim 1997, S. 109 ff.; Horstmann tut sich aber offensichtlich äusserst schwer mit diesem programmatischen Text. 82Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 670. 180 Robert Theis Vernunft haben“.83 Diese sucht Kant zu erweisen, indem er nach den semantischen Merkmalen der Ideen fragt, sprich nach deren Gültigkeit, die er über den Weg einer Deduktion zu begründen sucht. Grundsätzlich gilt zwar, dass von den Ideen keine „objektive Deduction“84 möglich ist, weil es keinen ihnen kongruierenden Gegenstand in einer möglichen Erfahrung geben kann. Sollen die Ideen indes nicht gänzlich zwecklos sein, „so muß durchaus eine Deduction derselben möglich sein“.85 Und dann folgt der bedeutsame Satz: „Das ist die Vollendung des kritischen Geschäftes der reinen Vernunft, und dieses wollen wir jetzt übernehmen“86: Das deduktionsanaloge Verfahren der Ideen also als die eigentliche Vollendung des kritischen Geschäfts – oder als erster Schritt einer Doktrin! Wie konzipiert Kant diese Deduktion? Die Antwort auf diese Frage erfolgt über den Weg einer Unterscheidung zwischen dem, was Kant eine ‚suppositio absoluta‘ und eine ‚suppositio relativa‘, also einen „Gegenstand schlechthin“ und einen „Gegenstand in der Idee“87 nennt, von der es heisst, es handle sich um einen Unterschied der Denkungsart, der „ziemlich subtil, aber gleichwohl in der Transzendentalphilosophie von großer Wichtigkeit sei“.88 Die quasi-transzendentale Deduktion der Ideen besteht also nicht darin, die Idee auf einen möglichen kongruierenden absoluten Gegenstand zu beziehen, um auf diese Weise ihre objektive Gültigkeit zu erweisen, sondern, ausgehend von der Annahme dieser den Ideen entsprechenden Gegenstände – als gedachter Existenzen – die Erfahrungswelt so zu deuten, als ob sie von diesen her ihre Einheit hätte.89 Dieser Gedanke ist nun in einer doppelten Perspektive zu sehen. Die erste ist systemtheoretischer Natur und schreibt sich in die Linie derjenigen Ausführungen ein, die Kant bezüglich der Funktion der Ideen im Gesamt der menschlichen Erkenntnis aufgestellt hat: Es ist Aufgabe für die Vernunft, in der Suche nach Einheit unter den Erkenntnissen90 am Leitfaden der Ideen zu verfahren und sie demzufolge als Regeln zugrundezulegen. Diesem Aspekt entspricht der Gedanke des Systems der Erkenntnisse, in dem die höchste Einheit Gestalt annimmt: „Die Vernunfteinheit ist die Einheit des Systems“.91 Das systematische Ganze ist dasjenige, worin die 83 Ebd., B 697. 84 Ebd., B 393. 85 Ebd., B 698. 86Ebd. 87Ebd. 88 Ebd., B 704; vgl. auch B 705; B 707 u. B 713. 89 Vgl. ebd., B 707. 90 Ebd., 355. 91 Ebd., B 708. ‚Es ist ein Gott‘ 181 Vernunft Ruhe findet.92 Ein solches Ganzes konzipiert Kant aus unterschiedlichen Blickwinkeln: Einmal in theoretischer Hinsicht als System der Metaphysik,93 freilich einer Metaphysik unter den Voraussetzungen der Lehren der Analytik, dann aber auch von dem Gesichtspunkt her, den er als die Endabsicht der Spekulation der Vernunft bezeichnet, die sich unter den Titeln ‚Freiheit‘, ‚Unsterblichkeit‘ und ‚Dasein Gottes‘ zusammenfassen lässt, eine Endabsicht, von der es freilich auch heisst, ihr Interesse in spekulativer Hinsicht sei nur sehr gering.94 Die zweite Perspektive, die uns hier besonders interessiert, bildet ganz eigentlich die Voraussetzung der ersteren, wenngleich der Zusammenhang mit der inhaltlichen Ausdifferenzierung des Systems, so wie er eben angedeutet worden ist, nicht direkt hergestellt werden kann. Sie besagt, dass die Weltwirklichkeit so vorzustellen sei, als ob sie als Ganze – in ihrem Wesenskern95 – aus der Idee96 oder Absicht97 einer allerhöchsten Vernunft entsprungen sei: „Alle Verknüpfung der Dinge [ist] so anzusehen, als ob sie in diesem Vernunftwesen ihren Grund hätten“.98 Gemäß dieser Perspektive lässt sich die Weltwirklichkeit als ein nach teleologischen Gesetzen verknüpftes und verfasstes Ganzes denken. Die Einführung eines teleologischen Gesichtspunktes steht – dies dürfte wohl ersichtlich sein – unter dem oben angeführten Gedanken der suppositio relativa, also der Annahme eines Gegenstandes ‚in der Idee‘. Dies ist für die epistemische Verortung dieses Gesichtspunktes von Bedeutung. Es besagt, dass die Idee eines solchen Zusammenhangs die Welterkenntnis nach mechanischen Gesetzen – die „Erforschung der Ursachen … nach allgemeinen Gesetzen des Mechanismus“99 – nicht zu ersetzen vermag, sondern dass der Vernunft auf diese Weise ganz neue Aussichten auf dem Felde der Erfahrung eröffnet werden.100 Kant spricht davon, dass die teleologische Betrachtung die Natureinheit nach allgemeinen Gesetzen zu ergänzen vermag.101 92 93 94 95 96 97 98 Vgl. ebd., B 824. Vgl. ebd., B 874. Vgl. ebd., B 825. Vgl. ebd., B 722. Vgl. ebd., B 843. Vgl. ebd., B 714. Ebd., B 709; dieser Gedanke steht in Kontinuität mit den ersten theologischen Entwürfen von Kant: vgl. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 8. Hauptstück, AA I, 331 ff.; Beweisgrund, II. Abt., 6. Betrachtung, AA II, 123 ff. 99Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 719. 100Vgl. ebd., B 715. 101Vgl. ebd., B 720. 182 Robert Theis Wie überträgt Kant diesen Gedanken ins Theologische? Zwischen der Idee eines Systems und der eines nach Zwecken verfassten Ganzen besteht kein äusserlicher Zusammenhang. Vielmehr ist das System, wie formal auch immer man seine Definition konzipiert,102 die Artikulation in der Form des Diskurses einer Zweckmässigkeit, die als den Objekten selbst anhängend gedacht wird.103 Anders gewendet: Einheit der Erkenntnisse in der Form des Systems ist für die Vernunft die logische Aufgabe, deren Leitfaden aber die vorausgesetzte Zweckmässigkeit der Natur ist, die sich ihrerseits nur so denken lässt, als ob sie in einem Verstand ihren Grund hätte. Das aber bedeutet, dass die zu erstrebende logische Vollkommenheit des Systems die Idee selber, die der Grund der Zweckmässigkeit ist, nämlich die eines verständigen Urhebers, zum Erscheinen bringen muss. Theologisch formuliert ist das gesuchte System seiner Richtung nach – wenigstens für den Bereich der theo­ retischen Philosophie104 – in seiner „höchsten Ausbreitung“ Physikotheologie.105 Freilich führt Kant in der Kritik diese Physikotheologie nur in Umrissen durch. Dabei ist der Topos einer Physikotheologie überhaupt fragwürdig, nicht allein vor dem Hintergrund der Kritik, die Kant am physikotheologischen Beweis ausübt,106 sondern auch auf der Folie der Anmerkungen der Kritik der Urteilskraft zum Thema Physikotheologie.107 Die Grundrichtung dieser Kritik ist wohl zu berücksichtigen, um den genauen Status einer Physikotheologie in dokrtinaler Absicht richtig zu verorten. Man weiss, dass die Kritik an der Physikotheologie ihre erste Formulierung im Beweisgrund findet. Das dort entwickelte Argument, das sich fast wortwörtlich an David Humes Ausführungen in der ersten Enquiry anlehnt,108 gipfelt in der Aussage, dass der physikotheologische Gottesbeweis letztlich nicht zur bewiesenen 102Vgl. beispielsweise ebd., B 860; dazu vgl. auch Immanuel Kant, Prolegomena, § 56, A 162, AA IV, 349. 103Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 678. 104Wir wollen in diesem Zusammenhang den Aspekt der systematischen Einheit der Zwecke nicht in der Seite des Systems der Freiheit her erörtern. Die physikotheologische ‚Ausbreitung‘ des Systems der Zwecke gilt aber auch hinsichtlich der moralischen Welt, des regnum gratiae: vgl. ebd., B 844. 105Ebd. 106Vgl. ebd., B 648 ff. 107Vgl. Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, § 85, A 395 ff., AA V, 436 ff. 108Vgl. David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, 1748, XI; vgl. Robert Theis, Le moment humien dans la critique kantienne de l’argument physico-théologique, in: Les soruces de la philosophje kantienne aux XVIIe et XVIIIe siècles. Actes du 6e Congrès de la Société d’Études Kantiennes de langue française, hg. v. Robert Theis u. Lukas Sosoe, Paris 2005, S. 125-133. ‚Es ist ein Gott‘ 183 Behauptung des „Daseins des vollkommensten unter allen möglichen Wesen“109 gelangt. Anders gewendet: Im Ausgang von der beobachteten Ordnung, Harmonie und Schönheit der Weltwirklichkeit, die als Wirkung gedeutet wird, lässt sich letztlich nur mit Gewissheit auf eine dieser proportionierten Ursache schliessen. Wir erkennen „viel Vollkommenheit, Größe und Ordnung in der Welt, und können daraus nichts mehr mit logischer Schärfe schließen, als daß die Ursache derselben viel Verstand, Macht und Güte besitzen müsse, keineswegs aber, daß sie alles wisse, vermöge etc. etc. Es ist ein unermeßliches Ganze, in welchem wir Einheit und durchgängige Verknüpfung wahrnehmen, und wir können mit großem Grunde daraus ermessen, daß ein einiger Urheber desselben sei. Allein wir müssen uns bescheiden, daß wir nicht alles Erschaffene kennen, und daher urteilen, daß, was uns bekannt ist, nur einen Urheber blicken lasse, woraus wir vermuten, was uns auch nicht bekannt ist, werde eben so bewandt sein; welches zwar sehr vernünftig gedacht ist, aber nicht strenge schließt“.110 Die Grundrichtung dieser Kritik bleibt auch in der Dekonstruktion des physikotheologischen Beweises in der Kritik präsent. Gleich im zweiten Absatz des Über die Unmöglichkeit eines physikotheologischen Beweises überschriebenen Abschnittes stellt Kant die Frage: „Wie kann jemals Erfahrung gegeben werden, die einer Idee angemessen sein sollte?“111 Das aber bedeutet, dass der physikotheologische Beweis von sich aus niemals zu einem bestimmten Begriff eines höchsten Wesens gelangen kann.112 Wird dennoch in der traditionellen Physikotheologie ein solcher behauptet, so ist dies nur möglich durch eine Ergänzung, die nicht mehr mit den Mitteln dieses Diskurses begründet zu werden vermag, sondern nur, über den Umweg des kosmologischen Beweises, durch Rekurs auf den ontologischen. Von dort her wird dann, gleichsam in einer arguemtnativen Gegenbewegung, dieser nun bestimmte Begriff des Urwesens, „über das ganze Feld der Schöpfung“113 verbreitet. Die Kritik der Urteilskraft ihrerseits zieht den Schluss aus diesem Sachverhalt, dass die Teleologie, die wir in die Natur und in organisierte Wesen hineindeuten, uns zwar antreibt, eine Theologie zu suchen,114 dass sie eine Propädeutik zur Theologie ist,115 aber selber keine hervorbringen kann. 109Beweisgrund, AA II, 160. 110Ebd. 111Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 649. 112Vgl. ebd., B 656; vgl. auch Kant, Kritik der Urteilskraft, § 85, AA V, 437 f. 113Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 658. 114Kant, Kritik der Urteilskraft, § 85, AA V, 440. 115Vgl. ebd., § 85, AA V, 442. 184 Robert Theis Wie ist aber dann, vor diesem gesamten dekonstruktiven Hintergrund, die Behauptung der Kritik zu verstehen, die Naturforschung, gemäss ihrer Richtung nach der Form eines Systems der Zwecke werde in ihrer höchsten Ausbreitung Physikotheologie?116 Diese These lässt sich nur dann mit der skizzierten Kritik in Einklang bringen, wenn man den Begriff der Physikotheologie in einer zweifachen Weise ausdifferenziert, nämlich im Sinne einer bestimmenden und einer reflektierenden Physikotheologie. Diese doppelte Perspektive, genauer gesagt: die Einführung einer zweiten Perspektive geschieht in der Kritik der reinen Vernunft ohne ausdrücklichen Rekurs auf deren transzendentale Voraussetzung, nämlich die reflektierende Urteilskraft und zwar deshalb, weil das hier zur Diskussion stehende Problem in der Kritik überhaupt nicht an dieses Vermögen rückgekoppelt wird. An diesem Punkt zeigt sich erneut, wie Kant in der Kritik der reinen Vernunft ganz eigentlich mit Problemlösungen ringt. Wir müssen den Begriff einer reflektierenden Physikotheologie zunächst in der reflektierenden Urteilskraft verankern. Diesen Begriff gewinnen wir zunächst am Leitfaden der Ausführungen der Kritik der Urteilskraft. Die Urteilskraft überhaupt lässt sich nach Kant als bestimmende und reflektierende denken. Als bestimmende subsumiert sie das Besondere unter einem gegebenen allgemeinen Prinzip; als reflektierende sucht sie zu dem Besonderen das Allgemeine zu finden.117 Dies aber kann sie nur unter einem Prinzip, das sie sich selbst gibt. Dieses nennt Kant das Prinzip der „Zweckmäßigkeit der Natur in ihrer Mannigfaltigkeit“.118 Warum ist dies so? Weil es nur aufgrund eines solchen Prinzips möglich ist, die Natur in dem, was für uns an ihr unbestimmt bleibt, als von einer Einheit durchherrscht zu denken und dementsprechend diese zu suchen. Dieses Prinzip bestimmt somit nichts an der Natur selber, sondern dient lediglich als subjektives Prinzip dazu, der „Reflexion über die Gegenstände der Natur in Absicht auf eine durchgängig zusammenhängende Erfahrung“119 als Leitfaden zu dienen. Diesem Prinzip der reflektierenden Urteilskraft wohnt nun eine theologische Tendenz inne. Das wird deutlich, wenn man sich folgende Bemerkung Kants vor Augen hält: „Nun kann dieses Princip kein anderes sein, als: daß, da allgemeine Naturgesetze ihren Grund in unserem Verstande haben, der sie der Natur … vor116 Wir wollen in diesem Zusammenhang die Problematik der Physikotheologie unabhängig von ihrer Ergänzung durch die ‚moralische Teleologie‘ und der damit einhergehenden Ethikotheologie betrachten. 117Vgl. Kant, Kritik der Urteilskraft, Einleitung IV, AA V, 179. 118Ebd., AA V, 180. 119Ebd., AA V, 184. ‚Es ist ein Gott‘ 185 schreibt, die besonderen empirischen Gesetze in Ansehung dessen, was in ihnen durch jene unbestimmt gelassen ist, nach einer solchen Einheit betrachtet werden müsen, als ob gleichfalls ein Verstand (wenn gleich nicht der unsrige) sie zum Behuf unserer Erkenntnißvermögens, um ein System der Erfahrung nach besonderen Naturgesetzen möglich zu machen, gegeben hätte“.120 Mit dem Hinweis auf einen anderen Verstand ist nun in der Tat der göttliche gemeint, der somit als in der Maxime der Urteilskraft als Grund der Zweckmässigkeit gedacht wird. Insofern also kraft der Setzung dieses Verstandes die Einheit des Mannigfaltigen, die Ordnung, gedacht werden kann, lässt sich dieser Argumentationstypus als physikotheologischer kennzeichnen; insofern der so gesetzte Verstand lediglich zum Zweck des notwendigen Geschäfts der Suche nach dem Allgemeinen dient, kann von reflektierender Physikotheologie gesprochen werden. Sie ist die Modalität, in der sich der doktrinale Glaubensdiskurs artikuliert. Mit dem Grundkonzept der bestimmenden Physikotheologie stimmt diese darin überein, dass sie in der Idee des Zusammenhangs zwischen zweckmässiger Anordnung und verständiger Ursache wurzelt. Als reflektierende jedoch geht sie nicht zur Existenzaussage betreffend die Ursache über. Gerade darin aber zeigt sich indes ihre Überlegenheit gegenüber der bestimmenden Physikotheologie, weil sie nämlich deren Unzulänglichkeit vermeidet und die verständige Ursache als Urwesen oder Urgrund zu denken vermag, dem unendliche Vollkommenheiten121 zugeschrieben werden. Dies ist deshalb möglich, weil ihr Ausgangspunkt nicht, wie in der bestimmenden Physikotheologie, in der empirischen Weltordnung angeiedelt ist, sondern der Forderung der Vernunft selber, nach systematischer Ordnung zu suchen, die als höchste Einheit ein Maximum bedeutet, von dem aus die in der Idee gesetzte Ursache nicht anders als unter dem bestimmten Begriff der absoluten Vollkommenheit zu denken ist, die allein Grund von höchster Einheit zu sein vermag. In dem auf diese Weise eruierten Begriff der Urwesens als einem absolut vollkommenen stößt diese Argumentation dann gleichzeitig auch auf den Grundbegriff der transzendentalen Theologie, nämlich den des Ideals. Dass Kant diese Verbindung zwischen dem Idealbegriff und dessen physikotheologischer Instanziierung hergestellt hat, ergibt sich aus der folgenden Bemerkung: „Das Ideal des höchsten Wesens … nichts anders, als ein regulatives Prinzip, alle Verbindung in der Welt so anzusehen, als ob sie aus einer allgenugsamen notwendigen Ursache entspränge, um darauf die Regel einer systematischen und nach allgemeinen Gesetzen notwendigen Einheit in der Erscheinung derselben zu gründen“.122 120Ebd., AA V, 180; Hervorhebung vom Verfasser. 121Vgl. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 728. 122Ebd., B 647. 186 Robert Theis In der Kritik und in den Prolegomena unternimmt es Kant, über den Weg der Analogie123 der so gedachten Weltursache anthropomorphistische Prädikate zuzuschreiben, von denen es freilich heisst, sie seien ein symbolischer Anthropomorphismus124, und die den Begriff des Urgrundes theistisch zuspitzen: „Allein der theistische Begriff von Gott interessiert uns“.125 Bereits in der Metaphysik Pölitz hatte Kant diese Problematik angeschnitten: „Ein Geschöpf erkennt Gott per analogiam, nach den Vorstellungen, die ihm durch die Natur gegeben sind, und die davon abstrahirt werden. Diese Begriffe, die von den Sinnen abstrahirt sind, drücken nichts aus, als Erscheinung. Gott ist aber ein Gegenstand des Verstandes; also kann kein Geschöpf die Eigenschaften Gottes nach den Begriffen, die von den Sinnen abgezogen sind, absolut erkennen, sondern nur das Verhältniß, das Gott als eine Ursache zur Welt hat … Hieraus können wir aber Gott nicht erkennen, wie er ist, sondern wie er sich als ein Grund zur Welt bezieht; und das nennt man Gott per analogiam erkennen“.126 Dieser Text, der zwar nur eine Vorlesungsnachschrift ist, enthält dennoch die Kerngedanken von Kants Analogieauffassung. In der Kritik wie in den Prolegomena lautet Kants Grundthese: Dem höchsten Wesen werden keine Eigenschaften an sich selbst zugesprochen.127 Mit diesem Standpunkt ist der sogenannte ‚dogmatische Anthropomorphismus‘ vermieden,128 aber „wir legen sie … dennoch dem Verhältnisse desselben zur Welt bei, und erlauben uns einen symbolischen Anthropomorphismus, der in der Tat nur die Sprache und nicht das Objekt selbst angeht“.129 Dementsprechend ist diese Art von Erkenntnis analoger Natur, eine Erkenntnis 123Zum Problem der Analogie im Rahmen der Kantischen Theologie vgl. Marty, La naissance de la métaphysique chez Kant, a. a. O., S. 157-198; Ders., Symbole et discours théologique chez Kant. Le travail d‘une pensée, in: Le mythe et le symbole. De la connaissance figurative de Dieu, Paris 1997, S. 55-92; Aloysius Winter, Transzendentale Theologie der Erkenntnis, in: Der andere Kant. Zur philosophischen Theologie Immanuel Kants, Hildesheim 2000, S. 407 ff.; vgl. auch Annemarie Pieper, Kant und die Methode der Analogie, in: Kant in der Diskussion der Moderne, hg. v. Gerhard Schönrich u. Yasushi Kato, Frankfurt a. M. 1996, S. 92-112, bes. S. 100-103. 124Vgl. Kant, Prolegomena, § 57, AA IV, 357; in der Reflexion 6056, AA XVIII, 439, spricht Kant von einem „regulativ gedachten Anthropomorphismus“, der die Bedingungen der Sinnlichkeit auf göttliche Handlungen als ein Schema der Anwendung derselben im Erfahrungsgebrauch anwendet, im Gegensatz zum konstitutiven Anthropomorphismus. 125Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 664. 126Metaphysik Pölitz, AA XXVIII.1, 329 f. 127Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 726. 128Vgl. Kant, Prolegomena, § 57, AA IV, 357. 129Ebd. ‚Es ist ein Gott‘ 187 nach der Analogie, deren Begriff, in Übereinstimmung mit den Bemerkungen in der Metaphysik Pölitz dahingehend bestimmt wird, daß sie „nicht etwa, wie man das Wort gemeiniglich nimmnt, eine unvollkommene Ähnlichkeit zweier Dinge, sondern eine vollkommne Ähnlichkeit zweier Verhältnisse zwischen ganz unähnlichen Dingen bedeutet“.130 In den Fortschritten wird derselbe Gedanke noch einmal verdeutlicht. Hier führt Kant den Ausdruck „Symbolisirung des Begriffs“131 ein, den er folgendermaßen definiert: „Das Symbol einer Idee (oder eines Vernunftbegriffes) ist eine Vorstellung des Gegenstandes nach der Analogie, d. i. dem gleichen Verhältnisse zu gewissen Folgen, als dasjenige ist, welches dem Gegenstande an sich selbst, zu seinen Folgen beygelegt wird, obgleich die Gegenstände selbst von ganz verschiedener Art sind … Auf diese Art kann ich vom Übersinnlichen, z. B. von Gott, zwar eigentlich kein theoretisches Erkenntniß, aber doch ein Erkenntniß nach der Analogie, und zwar die der Vernunft zu denken nothwendig ist, haben; wobei die Kategorien zum Grunde liegen, weil sie zur Form des Denkens nothwendig gehören, dieses mag auf das Sinnliche, oder Übersinnliche gerichtet seyn, ob sie gleich, und gerade eben darum, weil sie für sich noch keinen Gegenstand bestimmen, kein Erkenntniß ausmachen“.132 Es ist insbesondere dieser Gedanke der Proportionalität, welcher der Argumentation in der Kritik zugrundeliegt. Das X ist das ‚unbekannte Substratum‘, das in Beziehung auf die Zweckmäßigkeit und Ordnung gesetzt wird. Wie wird dieses X nun näherhin bestimmt? Kant spricht von „gewisse[n] Anthropomorphismen“,133 die diesbezüglich erlaubt sind. Der im Vordergrund stehende Begriff ist der der Intelligenz. In Beziehung auf die „zweckmäßige Ordnung des Weltbaues“134 denken wir uns das X „nach der Analogie mit einer Intelligenz“.135 Dies besagt nicht, das oberste Wesen sei Intelligenz, sondern die zweckmäßige und systematische Einheit der Welt sei so, als ob es eine höchste Intelligenz gebe. Dieses Prädikat ist demnach „respektiv auf den Weltgebrauch unserer Vernunft ganz gegründet“.136 In der Reflexion 6065 spricht Kant diesbezüglich vom Anthropomorphismus „regulativ gebraucht“.137 Kant sieht es aber auch aufgrund eines vollständigeren Verstehens 130Ebd. 131Kant, Fortschritte, AA XX, 279. 132Ebd., AA XX, 280. 133Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 725. 134Ebd., B 726. 135Ebd. 136Ebd.; vgl. auch Reflexion 6286, AA XVIII, 554 f. 137Reflexion 6056, AA XVIII, 439. 188 Robert Theis der systematischen Ordnung als geboten, die analoge Bestimmung des höchsten Wesens „nach einem subtileren Anthropomorphism“138 weiterzuführen, so daß demselben „unendliche Vollkommenheiten“139 zukommen. Der wichtige Gedanke in Kants Analogiekonzeption − und in diesem Punkt unterscheidet er sich von der klassischen Analogielehre, die von dem Gedanken getragen ist, daß die analoge Erkenntnis „affirmative Erkenntnis“ ist, „die die lauteren Vollkommenheiten Gott positiv zuspricht“140 − ist allerdings der, daß alle Bestimmungen des höchsten Wesens, wie vorhin bereits hervorgehoben, nicht das Objekt, sondern die Sprache betreffen. Dies heißt aber: die ‚Ordnung des Diskurses‘. Hier kommt das Spezifische der doktrinalen Theologie zum Vorschein: Vor dem Hintergrund der prinzipiellen Unerkennbarkeit Gottes besteht die höchste Leistung der Vernunft darin, den theologischen Gedanken als Horizont aufzuzeigen, innerhalb dessen sich die Naturbetrachtung in ihren letzten Motiven entfaltet. Die Rede von Gott, der theologische Diskurs, ist somit die ‚andere Rede von der Welt‘ und vom Menschen in der Welt in dem Maße, wie die Artikulation des theologischen Gedankens die Naturbetrachtung um eine umfassende Verstehensperspektive ergänzt – die gewollt sein muss.141 Diese ist keine Erkenntnis, aber dennoch ist sie der Erkenntnisordnung nicht fremd – doktrinaler Glaube als sinnstiftender Diskurs, in dem das Denken in ein Verhältnis zu sich selber gelangt, durch das es – dem Recht des Bedürfnisses der Vernunft entsprechend – gleichzeitig über sich selber hinausweisen kann. Aber in diesem Hinausweisen liegt gleichzeitig auch ein ‚Entsagen‘: dass die sich im Diskurs ergebende Notwendigkeit des konstitutiven Setzens, von der die Analyse des Vernunftvermögens Auskunft gibt, gleichzeitig ein kognitives Entsagen bedeutet. Um diese Doppelung im Sprechen ringt Kant: mit den dem Denken allein zur Verfügung stehenden Begriffen das nicht zu behaupten, was mit den Mitteln der Begriffe sich nicht nicht behaupten lässt. So ist auch in der Aussage ‚Es ist ein Gott‘ das Eingeständnis mitzulesen, dass die endliche Vernunft des Unendlichen nicht habhaft zu werden vermag – aber auch: „daß mir niemand den Satz … werde widerlegen können.“142 Gott lässt sich nicht erkennen, aber wir selber vermögen uns und die Welt ohne diesen Urgrund nicht zu verstehen. Mehr ist nicht möglich, mehr ist aber auch nicht nötig. 138Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 728. 139Ebd. 140Caspar Nink, Philosophische Gotteslehre, 1948, Bonn 1977, S. 196. 141Siehe Immanuel Kant, Was heißt: sich im Denken orientieren?, AA VIII, 139. 142Ebd., AA 142 Anm. Die Kraft des Guten Rémi Brague Der vorliegende Beitrag besteht aus drei Teilen ungleicher Länge. Worauf ich hinauswill, ist letztendlich die Begründung einer These: Der Glaube ist zu einer Lebensnotwendigkeit des heutigen Menschen geworden. In einem vorbereitenden ersten Teil möchte ich zum Ausdruck bringen, warum das der Fall ist. In den beiden übrigen Teilen möchte ich jeweils eine der zwei Quellen unserer Kultur, die mit den Chiff ren Athen und Jerusalem benannt werden sollen, zum Zeugnis aufrufen: Im zweiten Teil lege ich die Interpretation einer Bibelstelle vor; im dritten Teil schließlich versuche ich, dasselbe Ergebnis im philosophischen, ‚atheniensischen‘ Stil auszudrücken. 1 Eine gefährliche Lage Mit dem ‚Leben‘, für das der Glaube zu einer Notwendigkeit geworden ist, meine ich hier nicht die Art und Weise, dieses Leben zu gestalten und nach Normen zu auszurichten. Keineswegs möchte ich die alte Leier noch einmal anstimmen, nach der die Religion notwendig sei für ein gelungenes soziales Leben. Diese These geistert seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden durch das Denken. Man findet sie unter der Feder konservativ gesinnter Denker, Politiker und Soziologen, schon bei Platons Onkel, dem Sophisten Kritias, bei Alexis de Tocqueville, aber auch bei gewissen Soziologen.1 Sie mag übrigens stimmen, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass keine 1 Kritias, Sisyphos, in Die Fragmente der Vorsokratiker, hg. Hermann Diels u. Walther Kranz, 3 Bde., Berlin 1951-1952, Bd. 2, 1952, n 88, Fgt. B 25; S. 386-389; Alexis de Tocqueville, La Démocratie en Amérique, 1835 u. 1840, in: Oeuvres, hg. André Jardin, 189 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7_10 190 Rémi Brague radikal atheistische Gesellschaft langfristig reibungslos funktionieren könnte. Auf jeden Fall hat man dieses Experiment noch nicht in seiner ganzen Reinheit gewagt. Die These scheint mir aber zu oberflächlich, als dass sie uns zu einem besseren Verständnis der heutigen Lage verhelfen könnte. Das Leben des Menschen, das geschützt werden soll, bezeichnet hier, ganz naiv und krass, das Überleben der Gattung des homo sapiens. In aller Kürze möchte ich diese Lage schildern, um zu zeigen, dass sein Überleben gefährdet ist. 1.1 Die konkrete Möglichkeit einer Auslöschung der Menschheit Das völlige Auslöschen unserer Spezies ist zu einer Möglichkeit geworden, und zwar nicht nur zu einer logischen Möglichkeit, sondern zu einer ganz konkreten. Die Möglichkeit eines Sachverhalts wird nämlich dadurch zu einer konkreten, wenn dessen Ursachen schon wirklich existieren. Zwar sind sie wirklich, aber nicht wirksam, vielleicht nur: noch nicht wirksam. Nun sind heute die Ursachen so eines Auslöschens schon da. Hier seien drei solcher Ursachen erwähnt: a. Die Kernwaffen und, generell, die seit dem Ende des Weltkriegs und um des Kriegs willen geleisteten Fortschritte in der militärischen Technik machen eine allgemeine Katastrophe denkbar. Hier kann das Stichwort ‚Hiroshima‘ genügen. b. Die Umweltverschmutzung könnte unsere Lebensgrundlage derart vergiften, dass die Lebensbedingungen der Menschheit nicht mehr gesichert werden können. Von Berichten über diese Probleme sind die Zeitungen, ja, alle Medien voll. So kann ich es hier bei ihrer Erwähnung belassen, ohne näher darauf eingehen zu müssen c. Eine dritte Möglichkeit ist diskreter Natur, könnte sich jedoch langfristig als gefährlicher erweisen, ja umso gefährlicher, als sie sich eben lautlos einschleicht. Ich meine den Geburtenrückgang. Ich darf auf dieser Tatsache bestehen, obwohl es noch viele Leute, ja gebildete Leute gibt, die sich ausmalen, die große Gefahr für die Zukunft sei die Überbevölkerung der Erde. Seit mehreren Jahrzehnten wissen dagegen die Demographen, dass das Wachstum der Weltbevölkerung nicht steil, geschweige denn exponentiell steigt, sondern sich immer mehr verlangsamt. So soll die Weltbevölkerung ihren Gipfel um 2080 erreichen, um Paris 1992, vor allem II, i, 5, S. 530 ff. u. II, ii, 15, S. 655 ff.; dt. Über die Demokratie in Amerika, hg. v. Hans Zbinden, 2 Bde., Zürich 1987, Bd. 2, S. 34 ff. u. S. 211 ff. Die Kraft des Guten 191 danach rasch zu sinken. Ernste Demographen haben sogar seelenruhig und kaltblütig das Ende der Menschheit vorausgesagt, selbstverständlich nur als Hypothese: Wenn sich die Geburtenraten, wie sie im heutigen Europa dem Durchschnitt entsprechen, über die gesamte Welt verbreiten, dann muss die Menschheit um das 24. oder 25. Jahrhundert allmählich verschwinden. So schreibt es beispielsweise Jean Bourgeois-Pichat, der ehemalige Vorsitzende des französischen Staatsinstituts für Demographie, in einem Artikel, den er 1988 in der Zeitschrift dieses Instituts veröffentlichte.2 Ob das nun stimmt oder nicht, ist nicht mein Problem. Ich bin nämlich Philosoph und nicht Demograph. Auf jeden Fall nehme ich hier diese Möglichkeit als Anlass für ein Gedankenexperiment. 1.2 Eine offene Frage Dieses Gedankenexperiment nimmt die Form einer Frage an: Können wir dieses Überleben, das auf dem Spiel steht, tatsächlich wollen? Das Wort ‚wollen‘ nehme ich hier im klassischen Sinne einer durch Vernunft geleiteten und gerichteten Begierde, im Unterschied zum bloßen blinden Trieb. Das Überleben der Gattung könnten wir selbstverständlich auch der Natur anvertrauen. Das bedeutet letztendlich: dem Instinkt, dem Trieb. Diese Antwort hört man des Öfteren, auch aus dem Munde von aufgeklärten Leuten, ja von Leuten, die auf ihre ‚säkulare‘ Gesinnung und Aufgeklärtheit pochen. Es ist in der Tat durchaus möglich, dass der Trieb für ein gewisses Überleben bürgt. Man darf aber fragen, wessen Überleben – das Überleben eines wie beschaffenen Wesens – in diesem Fall gesichert würde. Die Antwort fällt tautologisch aus: Der Trieb wird das Leben derjenigen Wesen bewahren, die sich dem Trieb überlassen. Zwar kann die Natur für das Weiterexistieren eines Naturwesens sorgen, indem sie ihm die geeigneten Automatismen einpflanzt. Das tut sie auch und gibt den Lebewesen Instinkte und Reflexe. Der Mensch gilt aber als ein ‚zōon logon ekhon‘, ein ‚animal rationale‘, kurz, ein vernünftiges Wesen. Nun unterscheidet sich so ein Wesen von den übrigen dadurch, dass es nach Gründen handelt, ferner nach Gründen verlangt, um überhaupt zu handeln. Möglich ist dabei, dass die vorhandene Welt keines Grundes bedarf. Gründe sind aber notwendig für das Dasein dessen, was von uns abhängt. Insbesondere 2 Jean Bourgeois-Pichat, Du XXe au XXIe siècle: l‘Europe et sa population après l‘an 2000, in: Population 43 (1988) S. 9-44. 192 Rémi Brague brauchen wir Gründe, um die Zukunft der Menschheit zu befördern. Das bedeutet, dass wir imstande sein müssen, zu sagen, inwiefern es tatsächlich gut ist, dass es Menschen gibt. Wenn wir dagegen das Überleben unserer Gattung dem Instinkt überlassen, dann würde das heißen, dass wir auf den Traum der Aufklärung verzichten, ja auf das Projekt der Philosophie überhaupt Verzicht leisten, weil die ja nun immer darauf aus ist, Gründe zu suchen und ausfindig zu machen. Deshalb ist es so überraschend, wenn man profilierte Anhänger der Aufklärung hört, die diese Frage von der Hand weisen und mit einem Schmunzeln sagen, der Instinkt würde schon dafür sorgen. Wofür der Instinkt sorgen würde, wäre aber nur das Verschwinden aufgeklärter Leute, in einer Art umgekehrten natürlichen Auslese. Nichts sagt uns übrigens, dass diese Auslese ausgerechnet diejenigen bevorzugt, die wir nach unseren eigenen Kriterien als überlebenswerter betrachten würden. Das Einzige, das uns die Biologie lehrt, ist die seit Charles Darwin grassierende Tautologie des sogenannten ‚survival of the fittest‘; nach dieser Formel überleben nur die Überlebensfähigsten. Sie bürgt jedoch keineswegs dafür, dass die Überlebenden die wertvollsten, also etwa die klügsten oder die tugendhaftesten sind.3 2 Wert des Individuums und Wert der Spezies Damit begegnen wir einem zweiten Problem. Haben wir Gründe, Wert auf das Überleben der Menschheit zu legen? Was ist der Wert des menschlichen Lebens? Die Frage ist nicht neu. Die Literatur über das Elend des menschlichen Lebens ist genauso alt wie die Abhandlungen über die Würde des Menschen. Beide sind schon bei den alten Griechen da, mit dem Sophisten Prodikos auf der Seite der Neinsager, mit Xenophon zugunsten der Jasager.4 Sie hat eine Wende erfahren mit der Lehre Arthur Schopenhauers. Lange Zeit hat man sie aber an die schon anwesenden Menschen gerichtet und versucht zu zeigen, dass sich das Leben in Bausch und Bogen lohnt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis zum Ersten Weltkrieg hat man Bücher über den Wert des Lebens geschrieben. In Deutschland kann man die Namen Eugen Dühring und Rudolf Eucken zitieren. In England 3 Vgl. George Edward Moore, Principia Ethica, 1903, II, § 31, hg. Thomas Baldwin, Cambridge 1993, S. 101. 4 Vgl. Prodikos in Ps-Platon, Axiochos, 366d-369; Xenophon, Memorabilia, I, iv. Die Kraft des Guten 193 William Hurrell Mallock, in Frankreich Léon Ollé-Laprune, in den Vereinigten Staaten kein geringerer als William James.5 Es ist aber eine ganz andere Frage, ob die Menschheit als Spezies eine Legitimität besitzt. Die Zukunft dieser Spezies liegt in unseren Händen. Mit den Fortschritten der Biologie und der Medizin ist es immer entschiedener der Fall. Wir können darüber entscheiden, ob wir Kinder in die Welt setzen wollen, wie viele, möglicherweise gar keine. Die zwei Fragen sind nicht gleich. In der Frage nach dem Wert unseres Lebens erwägen wir die Vor- und Nachteile jener Lage, in der wir ohnehin schon sind. In der Frage nach dem Wert des menschlichen Lebens überhaupt setzen wir Sein und Nichtsein gegeneinander, wobei wir selbst außerhalb stehen. In der ersten Frage ist der Befragte ein bestimmter Mensch, oder, wenn es hoch kommt, haben wir die Gesamtheit der bisherigen Menschheit im Blick. Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir schon existierende Menschen betrachten, und zwar Menschen, deren Dasein nicht von uns abhing oder abhängt. Der erste, dessen Dasein nicht von uns abhing, war übrigens … unsere Wenigkeit selbst. So kommen wir, was uns anbelangt, notwendigerweise mit unserer Frage immer zu spät. Wie aber ist es, wenn wir uns fragen müssen, ob wir andere Menschen ins Leben rufen dürfen, die es noch nicht gibt: unsere möglichen Kinder. Sie zu zeugen trägt dazu bei, die Zukunft der Menschheit überhaupt zu ermöglichen. Ist die Fortexistenz der Menschheit denn ein Gutes? 3 Auf der Suche nach einer Legitimation Nun gerät der Mensch ins Fadenkreuz. In der Vergangenheit, und vor allem in der Neuzeit, hat er den Thron, auf dem er Platz nahm, in drei Etappen bestiegen, die es hier zu skizzieren gilt. Erstens unterscheidet sich der Mensch nicht nur graduell, sondern wesentlich von den übrigen Lebewesen. Er besitzt gewisse Merkmale, von denen sich nicht die geringste Spur findet bei den Tieren: abgesehen von leiblichen Phänomenen wie 5 Eugen Dühring, Der Werth des Lebens. Eine philosophische Betrachtung, Breslau 1865; Rudolf. Eucken, Der Sinn und Wert des Lebens, Leipzig 1908; William H. Mallock, Is Life Worth Living?, New York 1899; Léon Ollé-Laprune, Le Prix de la Vie, Paris 1894; William James, Is Life Worth Living?, in: The Will to Believe and other essays in popular philosophy, New York 1897, S. 32-62. 194 Rémi Brague etwa der aufrechte Gang kann man erwähnen: das Hantieren mit Werkzeugen, den Gebrauch der Sprache, das moralische Gefühl, und vieles mehr. Zweitens ist der Mensch nicht nur als verschieden von jenen Wesen, sondern als ihnen überlegen – oder wenigstens als das beste Wesen unter den Erdbewohnern – betrachtet worden, wobei der Mensch sich unter der Obhut der Natur, insbesondere der himmlischen Körper, oder unter dem Schutz Gottes fühlte. Drittens hat sich diese – zunächst als ein ruhiger Besitz betrachtete – Überlegenheit durch das Projekt einer Eroberung der Natur ausweisen müssen. Das geschah, als das Projekt einer Herrschaft des Menschen die seit der Renaissance lebendige Tradition der Traktate über die Würde der menschlichen Natur auslöste. Nach anderthalb Jahrhunderten ersetzte jedoch Francis Bacons das ‚regnum hominis‘ der von Gianozzo Manetti festgestellten ‚dignitas hominis‘. Eine vierte Stufe sieht in den Menschen das höchste Wesen, das keinen Nebenbuhler duldet, dem zu gehorchen, oder gar, den nachzuahmen er angehalten wäre. Im Viktorianischen England wurde ‚humanism‘ zu einem salonfähigen Ausdruck für ‚Atheismus‘, als dieser noch verpönt war. In den Schriften von Karl Marx begegnet man dann einem radikalen Atheismus. In Frankreich verteidigte Auguste Comte eine ‚Religion der Humanität‘, dem ‚Höchsten Wesen‘ verpflichtet, um eben im Namen dieser Religion den Gottesbegriff wegzuschaffen und zu ersetzen. 4 Der Abbau des Humanismus Diese ersten drei Stufen sind allmählich aus der Mode gekommen. a. Gegen das frühneuzeitliche Projekt der Beherrschung der Natur durch die Technik macht man jetzt die Schattenseiten der Industrialisierung geltend: die Umweltverschmutzung, das Treibhauseffekt, das Aussterben mancher Tierarten und dergleichen. b. Gegen die antike, christlich-mittelalterliche und in der Renaissance aufblühende Vorstellung einer Würde und Größe des Menschen erinnert man jetzt an die Gefährlichkeit des Menschen und seine Rücksichtslosigkeit im Umgang mit den anderen lebendigen Spezies. Der Mensch, so heißt es jetzt, sei das grausamste aller Raubtiere, durch sein bloßes Dasein gefährde er dasjenige der übrigen Lebewesen, erst recht seit der Industrialisierung. c. Gegen die uralte, vielleicht schon prähistorische Vorstellung eines wesentlichen Unterschieds des Menschen gegenüber dem Tier benutzt man jetzt gewisse Ergebnisse der Molekularbiologie oder der Verhaltensforschung, um zu behaupten, Die Kraft des Guten 195 der Mensch unterscheide sich von den übrigen Tieren nur graduell. Man hört etwa: Der Mensch habe mit dem oder jenem Affen mehr als 90 Prozent seiner DNA gemeinsam. Deshalb sei er im Grunde ein Affe, der Glück gehabt hat. An und für sich ist die Schlussfolgerung schwach. Man könnte nämlich ebenso gut sagen, dass ich 90 Prozent meines Wortschatzes mit Johann Wolfgang von Goethe teile, wobei jedoch der jeweilige Gebrauch der Sprache eine tiefe Kluft zwischen uns sichtbar macht. Interessant ist allerdings – und zwar als Symptom, das es zu deuten gilt – die Schadenfreude, mit der die Medien für den Widerhall solcher Ideen sorgen. Der Mensch braucht – das scheint offensichtlich – für sein Dasein eine Rechtfertigung. Dieser Begriff der Rechtfertigung zielt gewöhnlich auf den Menschen und seine Taten – im Blick auf die Weise, wie er handelt, und er zielt auf seine Sündhaftigkeit, infolge derer er der Erlösung bedarf. So sieht es das Christentum, vor allem nach seiner Paulinischen Prägung, wobei die Notwendigkeit einer solchen Rechtfertigung durch Aurelius Augustinus, später noch mehr durch Martin Luther eine zusätzliche Verschärfung erfuhr. Die Rechtfertigung, mit der ich mich hier befasse, betrifft nun allgemein das Dasein des Menschen. Das ist keine neue Fragestellung. Schon in der Antike wurde die Legitimität des Menschen in Frage gestellt, wie zum Beispiel im Corpus Hermeticum oder im Talmud, wenn gefragt wird, ob Gott Recht gehabt hat, den Menschen zu erschaffen.6 Aber diese Frage blieb ein akademischer Streit. Den Menschen gab es sowieso schon, und kein Mensch verfügte über die Mittel, ein negatives Urteil über sein Dasein zu vollstrecken. Jetzt ist dieses Problem aktuell geworden. Nun ist die neuzeitliche Bewegung des ausschließlich atheistischen Humanismus in eine Sackgasse geraten. Sie verwirft das Dasein irgendeiner Instanz, die dem Menschen überlegen ist. Dabei verliert sie jede Möglichkeit, ein unparteiisches Urteil über den Wert oder Unwert des Daseins des Menschen zu fällen. Zwar könnte der Mensch, im Prinzip, sich zugunsten seiner selbst entscheiden. Dagegen aber ist zweierlei einzuwenden: a) de jure: so ein positives Urteil wäre kaum unvoreingenommen; b) de facto: die dritte, oben erwähnte Stufe der Kritik an den Menschen, zeigt, dass diese Selbstbejahung gar keine Selbstverständlichkeit darstellt. 6 Hermes Trismegistos, Fragment XXIII – Korè Kosmou – , § 44; in: Corpus Hermeticum, 4 Bde., Paris 1954-1960, Bd. 4, hg. v. Arthur Darby Nock, 1954, S. 14 f. 196 5 Rémi Brague Jerusalem: Die göttliche Weltbejahung Eine praktische Antwort auf die Frage nach der Legitimität des Menschen ist die traditionelle, die am Anfang des Grundbuchs der westlichen Kultur, sprich der Bibel, steht: Der Mensch wurde geschaffen von Gott als Sein Ebenbild, dazu als der krönende Teil einer Schöpfung, deren Gesamtheit von Gott bejaht wurde, der sie als „sehr gut“ – tov me’od – erklärte.7 Nicht nur der Mensch wird bejaht, sondern die Gesamtheit derjenigen Wesen, die stufenartig zu ihm führen—wir würden heute sagen: die ihn im Verlauf der Evolution hervorgebracht haben. Im Unterschied zur uferlosen Literatur der Kommentatoren theologischer Färbung, sind die Philosophen, die sich mit diesem Abschnitt ernst und als Philosophen auseinandergesetzt haben, nicht gerade zahlreich. Schopenhauer konnte diesen Schlusssatz und die Weltbejahung, die er zum Ausdruck bringt, gar nicht leiden und bespottete ihn mehrmals im Wortlaut der ihm nur zugänglichen griechischen Septuaginta-Übersetzung – panta kala lian – . Mit Fug und Recht sah er in diesem positiven Urteil der Welt gegenüber die diametral entgegengesetzte Position zu jenem Pessimismus, den er selbst vertrat.8 Der englische Ethiker Henry Sidgwick hat den Schöpfungsbericht zwar berücksichtigt, er hat ihn jedoch als für eine Ethik nutzlos abgetan: „No doubt there is a point of view, sometimes adopted with great earnestness, from which the whole universe and not merely a certain condition of rational or sentient beings is contemplated as ‚very good‘: just as the Creator in Genesis is described as contemplating it. But such a view can scarcely be developed into a method of Ethics. For practical purposes, we require to conceive some parts of the universe as at least less good than they might be. And we do not seem to have any ground for drawing such a distinction between different portions of the non-sentient universe, considered in themselves and out of relation to conscious or sentient beings“.9 Was die Relevanz des biblischen Abschnitts für eine mögliche Ethik anbelangt, so kann man dem englischen Philosophen nur rückhaltlos beipflichten: Auf so einem Unterbau lässt sich keine Ethik bauen. Es ist jedoch sehr die Frage, ob diese Aufgabe so dringend ist, ja, ob sie die Gutheit eines Subjekts einer wie immer auch beschaffenen Ethik überhaupt voraussetzt. 7 Gen 1, 31. 8 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, II, iv, Kap. 48; in: Sämtliche Werke, hg. v. Wolfgang von Löhneysen, 5 Bde., Darmstadt 1980, Bd. 2, S. 795 ff. 9 Henry Sidgwick, The Methods of Ethics, 1874, I, ix, § 4, Anm., London 71907, S. 113 f. Die Kraft des Guten 5.1 197 Zum Kontext des ersten Schöpfungsberichts Zuerst möchte ich hier fragen, was diese Weltbejahung eigentlich bedeutet. Geistesgeschichtlich rührt sie wohl von dem Bedürfnis, eine ihr entgegengesetzte Weltanschauung, einen Pessimismus avant la lettre, zu entkräften. Wir besitzen nämlich Spuren so einer Weltsicht, etwa in Babylonien. Als Beispiel kann man den Weltentstehungsmythos nennen, wie er im kosmogonischen Epos Enuma Eliš dargestellt wird. Die Schöpfung als Einsetzung der Ordnung in die bis dahin ungeordnete Welt sei der Sieg des jungen Gottes Marduk, der sich dadurch zum Rang des höchsten Gottes emporschwang, wird dort erzählt. Marduk habe ein riesengroßes Urungeheuer besiegt und geschlachtet, dann seine Leiche in zwei Hälften geteilt, die zur Erde und zum Himmel wurden. Nach dieser kriegerischen Auffassung der Weltentstehung sei das Bestehende das Ergebnis einer Gewalttat, ja eines Mordes. Das Sein wird dadurch zutiefst illegitim. Mit dem Menschen ist es nicht besser bestellt: Was ihn betrifft, so sei er nämlich aus dem Blut eines besiegten Gottes entstanden.10 Die jüdische Elite, die in Babylon als Geisel gefangengesetzt war, hatte wohl von dieser Weltsicht Wind bekommen. Möglich ist, dass der erste Schöpfungsbericht als Antwort auf diesen Mythen konzipiert wurde. Auch die großen Seeungeheuer – für die Bauern Kanaans ein Greuel – wurden von Gott geschaffen.11 Noch wichtiger: die Himmelskörper, die zwei großen Leuchten, Sonne und Mond, die doch götzendienerisch als Nebenbuhler des Gottes Israel auftraten, sind auch in der Gesamtgutheit des Seienden mit einbezogen. So ist das Böse keine kosmologische Tatsache, geschweige denn eine metaphysische, in der Tiefenstruktur der Dinge liegende. Es gehört dem Gebiet des Moralischen an. Das Böse ist das, was geschah und weggeschaffen werden soll. Daher folgt dem ersten Schöpfungsbericht der zweite, der erklärt, dass das Böse einen Anfang genommen hat, was impliziert, dass es auch ein Ende haben kann. So ist die Erzählung über den Sündenfall kein Grund der Verzweiflung. Ganz im Gegenteil ist sie eine Botschaft der Hoffnung, nicht nur im sogenannten Protevangelium.12 Die Welt ist nicht deshalb ‚gut‘, weil sie vollkommen wäre. Sie ist gut ‚für‘ …, weil sie eine Geschichte beherbergen kann. In diesem Sinne lässt sich die Liste der Weltkomponenten, die wiederholend als ‚gut‘ erklärt werden, analog zur sogenannten Check-List, die man abhakt, bevor ein Flugzeug abheben darf, deuten. 10 Enuma Elish, Tafel IV, 136, u. Tafel VI, 5-8, in: James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton 1955, S. 67b u. S. 67a. 11 Gen 1, 21. 12 Gen 3, 15. 198 5.2 Rémi Brague Der Schöpfungsbericht als erstes Gebot Wozu bietet der erste Bericht eine Einführung? Hier möchte ich jetzt noch einen weiteren Schritt zum Verständnis des biblischen Abschnitts wagen, indem ich eine einfache Frage formuliere: diejenige nach der Stelle der Äußerung im allgemeinen Kontext der Bibel, genauer noch der Fünf Bücher Mose, des Pentateuch. Dieses gilt bei den Juden als die Torah. Das hebräische Wort wurde von den alexandrinischen Juden, die die Septuaginta-Übersetzung anfertigten, im Griechischen durch ‚nomos‘ widergegeben. Das Wort wird wiederum ins Deutsche durch ‚Gesetz‘ übersetzt. Das befriedigt manche heutige Juden nicht, die andere Wörter bevorzugen, die dann den Aspekt der Gesetzgebung abblenden – ab und zu als Abwehr gegen die Paulinische Polemik gegen ‚das Gesetz‘: so beispielsweise Martin Buber, der in seiner Bibelübersetzung die Torah durch ‚Die Weisung‘ übersetzte. Warum beginnt ein Buch, das wesentlich Gebote und Verbote enthält, mit Erzählungen über Leute, die früher als die Gabe der Torah lebten? Die Frage wurde schon von den Weisen des Talmuds gestellt und unterschiedlich beantwortet. Der Schlüssel zum Verständnis liegt meines Erachtens in der Tatsache, dass auch die Teile des Pentateuchs, die vor dem ersten Gebot an Israel vorkommen, ebenfalls Gebote enthalten. Nur sind diese Gebote anders geartet als die 613 klassisch gezählten Gebote, sie fallen auf den ersten Blick weniger als Gebote auf. Es lohnt sich, diese Gebote zu mustern. Das möchte ich jetzt tun, anhand der folgenden Tafel: Die Tafel der Gebote im Pentateuch Anzahl Stelle Äußerung Adressat (1) Genesis, 1, 3.6.14 1 (2x.) Genesis, 1, 22.28 7 [Genesis, 9, 9-17] bSanhedrin, 56a Alleingespräch Von Gott Ohne Gottes (1,22), – elohim – Angeredete dann Befehl diktiert (1,28: „ihnen“) Das Das Jeder Nach‚potentiell‘ Lebendige; fahre Noahs = Seiende: Seetiere und jeder Mensch Licht, v. 3; Vögel; Firmament, v. Männliche 6; Leuchten, und weibliche v. 14; Menschen; 10 Exodus, 20, 2-17 613 Die ganze Torah nach Exodus, 12, 2 Von Gott als YHWH diktiert (v. 2) Israel aus Ägypten gezogen = freier Mensch Durch die Vermittlung Mose Israel in seinem Land, unter seinem König, um seinen Tempel Die Kraft des Guten Befehl Sei! – „es gebe!“ Gegenteil Konkretisierung Nichts Dasein 199 Seid fruchtbar und mehret euch, das heißt: Sei lebendig als Gattung! Lebloses Fortpflanzung Sei ein Mensch! Sei ein freier Mensch! Sei Israelit / Jude! Tier •Offener Zugang zur Transzendenz – kein Götzendienst – •Inzestverbot – giluy ‛erayot – •Kochkunst – eyvar min ḥay – •Sprache – keine Lästerung – •Achtung für das Leben – kein Mord – •Achtung für die Freiheit – kein Menschenraub – •Gerichtshöfe = ein 3. Mensch zwischen den zwei Streitenden Sklave •Kein anderer Gott als der Befreier •Kein Bild •Keine Berufung des Namens •Sklave = Sabbat •Eltern = Achtung •der Mitmensch = kein Mord •Frau = kein Ehebruch •Güter = kein Diebstahl •Wahrheit = kein Meineid •Nachbar = kein Neid Völker Regelungen für das ganze Leben: 365; Verbote für das ganze Jahr: 248; Befehle für all die Glieder des menschlichen Leibes. bMakkot, 23b Die Anordnung, von links nach rechts, folgt der Ordnung des Pentateuchs, so wie wir es jetzt lesen. Sie fällt bekanntlich mit der zeitlichen Folge der Entstehung der verschiedenen Dokumente nicht zusammen. Hier nehme ich die Torah en bloc, als der Kristall, der wahrscheinlich um das 3. Jahrhundert vor Christus seine feste Form fand. Mein Ziel ist dabei, die innere Logik der Komposition zu verstehen. Ich habe fünf Wellen oder Breitseiten von Geboten unterschieden. Jetzt will ich die Tafel in der umgekehrten Ordnung lesen und kommentieren, von rechts nach links. 200 Rémi Brague a. Ganz rechts steht die Torah, so wie sie sich jetzt zu lesen gibt. Ihre 613 Geboten richten sich an Israel als Volk, und zwar als ein Volk, das in ‚normalen‘ Verhältnissen steht: Wirtschaftlich lebt es auf seinem Land und ernährt sich von den Früchten der Äcker und des Landbaues. Politisch ist es einem Staat untertan, dessen Regierungsform – wie es damals fast überall war – eine Monarchie ist. Religiös bringt es seine Opfer im Tempel zu Jerusalem dar. b. Der Dekalog richtet sich an das Volk, das noch in der Wüste lebt. Es ist soeben aus Ägypten befreit worden. Gott nennt sich und bezeichnet sich als der Befreier. Hauptthema ist die gegenseitige Anerkennung der Freiheit: Nur der befreiende Gott soll angebetet werden; man darf Ihn nicht in einem Bild oder in einer Schwurformel gefangen nehmen; seinem Diener soll man einen freien Tag gewähren; die Eltern, denen man seinen sozialen Status als rechtmäßiges Mitglied der Gemeinde verdankt, soll man ehren; Menschen darf man weder als Tiere, die man schlachten kann, noch als Dinge, die man einfach wegnehmen kann, behandeln. c. Die sieben Gebote an Noah sind nicht ausdrücklich entwickelt im Text der Genesis. Dort kommt lediglich das Verbot des Tötens und des Blutverzehrs zum Ausdruck, als Noah und seine Familie die Arche verlassen. Noah ist der Urahne eines jeden heute lebenden Menschen, da die anderen Nachfahren Adams Sintflut nicht überlebt haben. Deswegen betreffen diese an Noah gegebenen Gebote jeden Menschen als solchen. Erst die Weisen des Talmuds haben eine Liste aufgestellt. Sie beträgt sieben Regeln, die die Grundbedingungen eines menschlichen Lebens ausdrücken. Einige sind für die heutigen Anthropologen besonders wichtig, wie das Inzestverbot und die Zubereitung des zu verzehrenden Fleisches, das heißt die Kochkunst. Da findet man die Grundsteine der Anthropologie eines Claude Levi-Strauss. d. Das Gebot der Vermehrung wird wiederholt. Es richtet sich an die Lebewesen im Allgemeinen, und dann an das erste Menschenpaar. Im ersten Fall, da Gott vor sich stumme Tiere hat, nimmt es die Form eines Alleingesprächs an. Im zweiten Fall redet Gott Wesen an, die einen sprachlichen Ausdruck verstehen können. Dann sagt er inhaltlich genau dasselbe, aber er sagt es ‚ihnen‘. Damit wird die Kluft, die zwischen dem Unpersönlichen und dem Persönlichen gähnt, diskret evoziert. e. Das erste (Quasi-)Gebot: Es ist in Imperativ, aber ohne Adressat, daher grammatisch ein sogenannter Jussiv. Von drei Dingen wird gesagt, dass sie ins Sein von einem „Es sei!“ gerufen wurden: das Licht, das Firmament, die Leuchten. Die Formel ist ungewöhnlich, ja einzig. Pseudo-Longinos, der römische Ver- Die Kraft des Guten 201 fasser des Traktats Peri Hypsous, hat den Ruf „Es sei Licht!“ als Beispiel einer erhabenen Rede gewählt.13 Nicht von ungefähr sind drei Dinge Gegenstand eines direkten „Es sei!“, und zwar das Licht und das, was das Licht ermöglicht: das Firmament als Lampenstock, an welchen die zwei Leuchten aufgehängt werden. Warum ist es so? Vielleicht weil das Licht als erste, vorbegriffliche Metapher des Seins wirken kann: Licht und Sein sind an sich selbst unsichtbar. Das Licht tritt erst in die Sichtbarkeit ein, indem es Oberflächen beleuchtet und an ihnen Farben sehen lässt. Ähnlich kann man das an sich unsichtbare Sein nur am Seienden erfahren. Unschwer kann man beobachten, dass die Befehle und, parallel zu ihnen, die Adressaten, immer breiter und ausgedehnter ausfallen, von einem besonderen Volk über den freien Menschen, dann den Menschen überhaupt, dann das Lebewesen im Allgemeinen zur Gesamtheit des Seienden. 5.3 Sein als Gebot So enthält auch der erste Schöpfungsbericht, der mit der allgemeinen Bejahung des Bestehenden schließt, Gebote, und zwar die ersten zwei Gruppen. Nun liefern diese Urgebote, so meine These, den richtigen hermeneutischen Rahmen für das Verständnis eines jeden der nachfolgenden Gebote und Verbote. Das gilt von dem Gebot, das Leben zu propagieren und zu schützen. Das gilt in erster Linie vom allerersten Gebot. Es lässt sich in der einfachsten Form des Verbs ‚Sein‘ ausdrücken: ‚Sei!‘ Wichtig ist, sich dessen bewusst zu werden, dass der Inhalt der Salven von Geboten, die nach dem ersten kommen, im Grunde derselbe ist, nämlich ‚Sei!‘ Dem ersten Anschein nach lauten sie alle ‚Tue!‘ und ‚Lasse!‘ So hat sie die jüdische Tradition benannt und übersetzt. Und sie hat recht, wenn man sie bloß ihrem Wortlaut nach betrachtet. In der Tat sind sie jedoch nur die kleinere Münze des ersten Gebots. Oder, wenn man ein anderes Bild wünscht: Sie sind die Brechung dieses ersten Gebots durch eine Reihe von Prismen. Diese Prismen sind die konstitutiven Eigenschaften des jeweiligen Adressaten, ihr ‚Wesen‘, wenn man will. Jede Reihe von Geboten bedeutet eigentlich: ‚Sei das, was Du bist!‘ So habe ich sie formuliert – in der 4. Reihe: Sei ein Seiendes! Sei ein Lebewesen! Sei ein Mensch! Sei ein freier Mensch! Sei ein Mitglied des erwählten Volkes! Jedes Gebot befiehlt, 13Ps-Longinos, Über das Erhabene, IX, 9, hg. v. Henri Lebègue, Paris 1939, S. 14. 202 Rémi Brague das zu sein, was man ist. Das ‚Werde, was Du bist!‘, das Pindar prägte und viel später Friedrich Nietzsche wieder aufnahm,14 könnte auch als Motto der biblischen Gesetzgebung gelten. Aus dem Gesagten kann man drei Folgen herleiten: für die Moral, für die Ontologie, für die Metaphysik. a. Die Gebote sind keine Schranken, die etwa der Freiheit den Kampf ansagen sollen, sondern Grenzen, die, im Sinne des griechischen ‚horos‘ –das, was wir ‚Definition‘ nennen – , das Wesen des jeweiligen Adressaten in dem ihm entsprechenden Bestand sicherstellen. b. Das Sein ist ein Gebot. Die Gesetzgebung birgt eine Ontologie. Oder umgekehrt ausgedrückt: Die Ontologie der Bibel, wenn ich diesen Ausdruck wagen darf, ist eine solche, die den Imperativ vor den Indikativ setzt. c. Das Seiende ist das, was es sein soll. Es ist so, weil es eben dafür geschaffen wird, und zwar von einem Willen, der das Seiende ins Sein setzt. Jedes Geschöpf entspricht einem unwiderstehlichen Willen. Deswegen ist es im Grunde gut. So sind die Äußerungen Gottes nach jedem Schöpfungstag, das Geschaffene sei gut, bis zu einem gewissen Grade tautologisch. Damit drückt die Bibel in ihrem erzählerischen Stil denselben Gedanken aus, wie er sich bei Platon in seiner berühmten, hin und her kommentierten Lehre von der Jenseitigkeit des Guten dem Sein gegenüber – epekeina tēs ousias – findet.15 5.4 Schluss Selbstverständlich will ich hier keineswegs behaupten, der erste Schöpfungsbericht enthalte als solcher die Antwort auf unser Legitimitätsproblem. Das wäre eine Art Fundamentalismus, nicht viel klüger als derjenige, der diesen Bericht als eine Kosmogonie deutet. Was ich aber behaupte, ist: dass er ein Modell liefert für die Bearbeitung einer Frage, von der ich hoffe, gezeigt zu haben, dass sie eine dringende Beantwortung braucht. 14Pindar, Pythia, II, 72 (131); Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, 1889/1908, hier der Untertitel der Schrift: Wie man wird, was man ist. 15Platon, Staat, VI, 509b. Die Kraft des Guten 6 203 Athen: Die Notwendigkeit des Guten In einem im Jahr 2011 veröffentlichten Büchlein habe ich darauf hingewiesen, dass es vielleicht nötig wäre, den Begriff des Guten des Näheren zu betrachten und ernster zu nehmen. Das würde nach sich ziehen, sagte ich an demselben Ort, dass man die Platonische Auffassung der Idee des Guten wieder geltend machen würde. Damit würde man zugleich deren durch Aristoteles geschehene Außerkraftsetzung rückgängig machen.16 All das blieb skizzenhaft und der ausführlicheren Begründung bedürftig. Der vorliegende Beitrag soll ein paar Schritte in diese Richtung wagen. 6.1 Wir sind alle Jünger des Aristoteles Erlauben wir uns ein wenig beim soeben genannten Aristoteles zu verweilen. Es wird sich nämlich erweisen, dass wir immer noch vom Aristotelischen Gedankengut zehren, wenn vom Guten die Rede ist. Mit ihm teilen wir eine Grundvoraussetzung, die so tief verankert liegt, dass es uns schwer fällt, sie als solche zu identifizieren. Bekanntlich hat der Jünger den Meister kritisiert, indem er behauptete, die Idee des Guten sei für eine Ethik nutzlos. Nützlicher sei das ‚prakton agathon‘, das Gute, das sich vollbringen lässt, und zwar von uns Menschen.17 Generell wirft Aristoteles seinem Lehrer Platon vor, er habe die Ideen nicht arbeiten lassen, die Ideen seien müßig.18 Während die konkreten Dinge aufeinander wirken – während beispielsweise, wie im immer wieder angeführten Beispiel, „ein Mensch einen Menschen zeugt“19 – , bleiben die platonischen Ideen in ihrem überhimmlischen Ort, wobei sie ihre Däumchen drehen. Nur die Sonne in ihrem ganz konkreten Himmel hilft dabei dem Tun des Menschen: „ein Mensch zeugt einen Menschen, mit Hilfe der Sonne“ – anthrōpos gar anthrōpon gennai kai hēlios20 – . An einer Stelle seiner Schriften sagt Kant: im Unterschied zu Platons Schwärmerei sei die Philosophie 16 Vgl. Rémi Brague, Les Ancres dans le ciel. L’infrastructure métaphysique de la vie humaine, Paris 2011, S. 113-115. 17Aristoteles, Nikomachische Ethik, I, 7, 1097a23. 18Aristoteles, Metaphysik, Z (VII), 8, 1033b28; weitere Belege bei Hermann Bonitz, Index aristotelicus, 1870, Sp. 599a46-49. 19 Belege bei Bonitz, Index aristotelicus, a. a. O., Sp. 59b40-45. 20Aristoteles, Physik, II, 2, 194b13; Miguel de Cervantes, Don Quijote, 1605/1615, II, 45, hg. v. Francisco Rico, Madrid 2012, S. 887; dt. Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von la Mancha, 2 Bde., Leipzig 2004, Bd. 2, S. 353. 204 Rémi Brague des Aristoteles Arbeit.21 Arbeitgeber war dabei der Stagirit selber, da er die Ideen in die Dinge versetzt, damit sie wie in einer Fabrik sich die Ärmel hochkrempeln und etwas herstellen. Von diesem Gesichtspunkte her könnte man das Gute als überflüssig betrachten, ja als eine Art Ausstattungsstück, als etwas, das unser Leben zwar verschönert, aber doch dieses Leben immer schon voraussetzt. Dabei würde man sich im Sog der Aristotelischen Unterscheidung zwischen dem Leben schlechthin – zēn – und dem guten Leben – eu zēn – bewegen. So entsteht zum Beispiel die politische Gemeinschaft um des Lebens willen, besteht aber um des guten Lebens willen fort.22 Im marxistischen Wortschatz ausgedrückt: das Leben tout court, das am-LebenSein – zōē – beziehungsweise das ein-Leben-Führen – bios – ist der Unterbau; und das Gute ist nichts mehr als der Überbau, das, was dem Leben eine Krone aufsetzt. Wie das Vergnügen, nach einem anderen Abschnitt aus dem Werk des Aristoteles, mit dem Glanz zu vergleichen ist, der der Jugend hinzukommt.23 Das Gute ist für Aristoteles nie der Grund, in dem sich das Leben verwurzelt und wächst; es ist nie ein Notwendiges. So unterscheidet Aristoteles beispielsweise den Gebrauch der Zunge für den Geschmack und für die sprachliche Mitteilung, ebenfalls den Gebrauch des Atems für die Kühlung der inneren Hitze – nach den Erkenntnissen der damaligen Physiologie – und für die Stimme. Geschmack und Atmen dienen dem Notwendigen, Sprache und Stimme sind für das Gute da.24 Ein anderes Beispiel stellen die Sinneswahrnehmungen dar. Unter ihnen gibt es diejenigen, die dem Leben, und diejenigen, die dem guten Leben dienen, wie das Sehen und das Hören: Das sind die oberen Sinne.25 Diejenigen, die dem nackten Leben dienen, sind wohl der Tastsinn und diejenigen, die mit ihm zusammenhängen, der Geschmack und der Geruch. Nur der Tastsinn ist fürs Leben absolut notwendig. Mit ihm steht und fällt die Möglichkeit des Weiterlebens.26 21 Immanuel Kant, Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie, 1796, A 397, in: Werke in sechs Bänden, hg. v. Wilhelm Weischedel, Darmstadt 1983, Bd. 3, S. 382. 22Aristoteles, Politik, I, 2, 1252b29-30; vgl. auch Proklos, In Platonis rem publicam commentarii, VII, 2 Bde., hg. v. Wilhelm Kroll, Leipzig 1899 u. 1901, Bd. 1, 1899, S. 206. 23Aristoteles, Nikomachische Ethik, X, 4, 1174b33. 24Aristoteles, De anima, II, 8, 420b17-22. 25Aristoteles, Peri philosophias, § 24, in: Fragmenta selecta, hg. v. William David Ross, Oxford 1955, S. 92. 26Aristoteles, De anima, III, 13. Die Kraft des Guten 205 Als Fazit kann man sagen: Das Gute ist zwar ein Gutes, diese Tautologie bestreitet keiner, aber ein Notwendiges ist es keineswegs. Es kommt hinzu, wie ein Überbau einem Unterbau folgt. Das Gute in aller Ehre, aber ein Erstes ist es im aristotelischen Denken nicht. Der zweitrangige Charakter der Beschäftigung mit dem Guten entstammt übrigens einer uralten Weisheit des griechischen Volks, aus der Aristoteles wie auch schon Platon geschöpft hatten. Vom Dichter Phokylides, einem Milesier des frühen 6. Jahrhunderts v. Chr., wird ein Spruch überliefert: „Man soll einen Broterwerb suchen, auch die Tugend zwar, aber erst wenn der Broterwerb schon da ist“: dizēsthai biotēn, aretēn d’, hotan ēi bios ēdē; auf diesen Spruch spielt Platon ausdrücklich an.27 Wirtschaft ist Pflicht-, Tugend dagegen Kürlauf. Später wird dieselbe Ansicht an mehreren Stellen zum Ausdruck gebracht, etwa in Sprichwörtern, wie zum Beispiel ‚primum vivere, deinde… philosophari‘ oder was auch immer anschließend kommen mag.28 Niccolò Machiavelli legt die folgende Äußerung in den Mund eines Anführers der aufständigen Ciompi in Florenz: „della coscienza noi non dobbiamo tener conto; perché dove è, como è in noi, la paura della fame e delle carcere, non può né debbe quella dello inferno capere.“29 Noch krassere, zynischere Fassungen derselben Idee sind überall zu finden, wie bei Bert Brecht, dessen Satz „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“30 heute in aller Munden ist. Die Grundvoraussetzung, auf das ich oben angespielt habe, lautet: das Gute ist etwas, das sich tun lässt. Wir können das Gute tun – oder leider auch lassen. Dann und wann müssen wir es vorläufig lassen, indem wir es auf die Zukunft vertagen. Als Gegenstand der Praxis gehört es folglich dem Bereich der praktischen Philosophie an, insbesondere dem Zweig, der sich mit den Handlungen der Person beschäftigt, sprich: der Moral. Das Gute ist dann ausschließlich ein moralischer Begriff. Kein Wunder, dass wir unseren Anfang mit der Aristotelischen Ethik gemacht haben. 27Phokylides, Fgt. 9, in: Anthologia lyrica graeca, hg. v. Ernst Diehl, 2 Bde., Leipzig 1925, Bd. 1, 21936, S. 60; Platon, Staat, III, 407a. 28 Ähnliches in einer Äußerung von Marcus Tullius Ciceros, die von Laktanz, Divinae Institutiones, III, 14, 17, hg. v. Eberhard Heck u. Antonie Wlosok, Berlin u. New York 2007, S. 248, zitiert wird; vgl. auch Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, a. a. O., IV, Kap. 46, Bd. 2, S. 746. 29 Niccolo Machiavelli, Storie fiorentine, III, 13, in: Tutte le opere storiche, politiche e letterarie, hg. v. Alessandro Capata, Rom 2011, S. 541. 30 Bertolt Brecht, Die Dreigroschenoper, 1928, II: Wovon lebt der Mensch? 206 6.2 Rémi Brague Das Gute als ein Notwendiges Wie aber, wenn das Gute eine Bedingung des Lebens, und zwar eine absolut notwendige Bedingung des Lebens, darstellen sollte? Eine ganz klassische Art und Weise, die Notwendigkeit des Guten zu begründen, ist diejenige der klassischen Metaphysik, wo die Herabsetzung von dessen Gegenteil, dem Schlechten, auf der Leiter des Seins erfolgt. Das Schlechtere habe einen niedrigeren Grad des Seins als das Bessere, sozusagen eine geringere Seinsintensität. Diese Lösung findet man zum Beispiel bei Anicius Manlius Severinus Boethius, der sie dem ganzen lateinischen Mittelalter weitergegeben hat, und zwar als ein Gedankengut, das er selber von der Neuplatonischen Tradition geerbt hatte.31 Das nun setzt voraus, dass das Gute und das Sein miteinander wachsen und schwinden, dass sie sozusagen parallel laufen. Unschwer erkennt man die scholastische Lehre der Konvertibilität der Transzendentalien, insbesondere des Ens und des Bonum.32 Wenn jedes Seiende – als solches – gut ist, dann ist die Anwesenheit des Guten überall notwendig. Diese Lehre, der ich mich übrigens bis zu einem gewissen Grade anschließe, möchte ich hier plausibler machen, indem ich indirekt vorgehe. Dieser Umweg, den ich hier einschlagen möchte, ist ein einfacher. Er tut sich auf, wenn man das ethische Unterfangen bis zum Ende fortführt, im Denken wie in der Tat. Mit Aristoteles haben wir das Gute auf das Moralische verengt. Das Handeln wird ethisch bewertbar, wenn es frei ist. Nur in diesem Fall ist es eine echt menschliche Tätigkeit. Die menschliche Freiheit ist das, was die Ethik voraussetzt und wiederum fordert. Die Begründung der Moral durch Kant zeigt diese Verhältnisse mit großer Klarheit. Folglich werden wir mit ihm einige Augenblicke verweilen. Das ethische Leben ist am freiesten, ja eigentlich erst frei, indem es die Einflüsse äußerlicher Agenten – das, was Kant als ‚pathologisch‘ brandmarkt – außer Kraft setzt, und zwar zugunsten einer Handlung, die sich nach ihren eigenen Gesetzen richtet, und folglich verdient, das man sie als ‚autonom‘ bezeichnet. Dabei setzt man jedoch voraus, dass die Handlung von einem Subjekt herrührt, das schon da ist. 31 Anicius Manlius Severinus Boethius, Trost der Philosophie, III, pr. xii, Cambridge, Mass. 1973, S. 304; IV, pr. ii, S. 326, pr. iii, S. 334. 32 Ebd., III, pr. xi, S. 288. Die Kraft des Guten 6.3 207 Das Subjekt Nun ist dieses Subjekt ein vernünftiges Wesen überhaupt. Vernünftig muss es sein, um überhaupt handeln zu können. Nicht jede Bewegung ist eine Handlung. Ein Stein, der einen Abhang herunterrollt, handelt nicht. Ebenso wenig eine Pflanze, die wächst, ihre Wurzeln in die Erde eindringen lässt, während sie ihren Wipfel nach oben ausstreckt. Ob ein Tier im eigentlichen Sinne handelt, ist unklar. Handeln bedeutet eher eine Handlung durchführen, die man bewusst gewählt und geplant hat, beides mit und in Freiheit. In diesem Sinne konnte Aristoteles sagen, dass die Tiere nicht handeln.33 Kant betont ausdrücklich, ja mit Nachdruck, dass die Handelnden, die sich nach dem moralischen Gesetz richten sollen, nicht notwendig Menschen sind, sondern vernünftige Wesen überhaupt. In der zweiten Kritik wird das Thema mehrmals behandelt. Am deutlichsten ist wohl die zweite Anmerkung zum „Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft“: „Dieses Prinzip der Sittlichkeit … erklärt die Vernunft zugleich zu einem Gesetze für alle vernünftigen Wesen, sofern sie überhaupt einen Willen, d. i. ein Vermögen haben, ihre Kausalität durch die Vorstellung von Regeln zu bestimmen … Es schränkt sich also nicht bloß auf Menschen ein, sondern geht auf alle endlichen Wesen, die Vernunft und Willen haben, ja schließt sogar das unendliche Wesen, als oberste Intelligenz, mit ein.“34 In derselben Weise weigerte sich die erste Kritik, „die Anschauungsart in Raum und Zeit auf die Sinnlichkeit des Menschen ein[zu]schränken; es mag sein, dass alles endliche denkende Wesen hierin mit dem Menschen notwendig übereinkommen müsse.“35 Schopenhauer machte sich über solche Äußerungen lustig und sagte spottend, Kant habe wohl an die lieben Engelein gedacht.36 Dabei traf er den Nagel auf den Kopf, und zwar weit mehr, als er es glaubte. Das zeigt ein anderer Text aus aus der Feder des Königsberger Philosophen. Bekanntlich schreibt Kant, dass das Problem der Errichtung einer politischen Verfassung im Prinzip lösbar ist, auch wenn die Bürger Teufel wären, sofern diese 33Aristoteles, Nikomachische Ethik, VI, 2, 1139a20. 34 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, 1788, I, i, 1, § 7, hg. Karl Vorländer, Hamburg 1929, S. 37 f. 35 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781, Elementarlehre, I. Transzendentale Ästhetik, 2: Von der Zeit, B 72. 36 Arthur Schopenhauer, Preisschrift über die Grundlage der Moral, 1841, § 6, in: Werke, a. a. O., Bd. 3, S. 658. 208 Rémi Brague Teufel nur vernünftig sind.37 Wenn sie ihrem rechnenden Verstand gehorchen, können diese doch völlig bösen Wesen verstehen, dass es in ihrem Interesse ist, miteinander in Frieden zu leben. Da überspitzt Kant das Paradox, das David Hume eine Generation früher zum Ausdruck gebracht hatte, nach dem die Politiker davon ausgehen müssen, dass jeder Mensch ein Schurke ist – every man must be supposed a knave – , was eine weise und politisch sehr brauchbare Maxime sei.38 Viel früher hatte schon Aurelius Augustinus darauf angespielt, dass auch die Gauner ihre Gesetze haben und achten, wenn sie nur eine dauerhafte Gang bilden wollen, um ihren kriminellen Beruf tüchtig auszuüben.39 Die Neueren verallgemeinern, indem sie betonen, dass jede menschliche Gesellschaft im Grunde ein Rudel von Wölfen oder eine Gang von Verbrechern sei. Nun darf man fragen – und ja, ich habe auch schon andernorts diese Frage gestellt40 – , ob sich Kant die Aufgabe nicht zu leicht gemacht hat, ob er nicht tatsächlich einen einfacheren Fall sich vorgenommen und untersucht hat, der allerdings nur dem allerersten Anschein nach als der schwierigere erscheinen mag. Heikler ist zunächst in der Tat der Fall der Teufel, weil sie durch und durch böse sind: ohne die geringste Spur einer guten Absicht gehen sie zur Errichtung eines Pandämoniums vor. Das ist aber nur die eine Seite. Die zweite, andere ist aber, dass man sich im Falle der Betrachtung von teuflischen Wesen die Frage nach der Zeitlichkeit dieser Wesen und nach dem, was diese mit sich bringt, erspart. Als Engel schweben die Teufel in einer Art Überzeitlichkeit, im sogenannten ‚aevum‘; als solche überfliegen sie die physischen, biologischen Verhältnisse und damit auch die Notwendigkeit, sich fortzupflanzen, um als Spezies existieren zu können. Jeder Teufel – wie jeder gute Engel – ist seine eigene Gattung. Diese Ausführungen über reine Geister mögen willkürlich scheinen, ja, sich gar erübrigen. Möglich ist jedoch, dass eine Besinnung über diese Geister ein gewisses, zwar grelles, aber hilfreiches Licht auf unsere neuzeitlichen Verhältnisse wirft. In seinem Buch über die Anführer der Neuzeit bemerkte Jacques Maritain, dass René Descartes den menschlichen Intellekt in eine Höhe emportrieb, die seitens der klassischen Metaphysik nur dem Intellekt von Engeln zugewiesen und zugebilligt 37 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, 1795, 1. Zusatz: Von der Garantie des ewigen Friedens, in: Werke, a. a. O., Bd. 6, S. 224. 38 David Hume, On the Independency of Parliament, 1741, in: Essays moral, political and literary, Oxford 1963, S. 40, S. 42. 39 Aurelius Augustinus, Der Gottesstaat, XIX, 12, 2 Bde., hg. Carl Johann Perl, Paderborn 1979, Bd. 2, S. 466. 40 Vgl. Rémi Brague, Modérément moderne, Paris 2014, S. 304. Die Kraft des Guten 209 wurde.41 Ob das für Descartes wirklich gilt, darüber bin ich mir nicht im Klaren. Trotzdem bleibt der Hinweis aufschlussreich für jeden, der das neuzeitliche Denken untersucht. Seine Kategorien sind eher für Engel als für Menschen gezimmert worden. 6.4 Freiheit als Prinzip Das Selbstbild des modernen Denkens pocht darauf, die Freiheit ins Zentrum des Menschlichen zu rücken. Nach Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist die Weltgeschichte „der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit“.42 Dazu nimmt im allgemeinen Rahmen der Weltgeschichte die Neuzeit einen bestimmten Platz ein, als das Zeitalter nämlich, in dem die Freiheit als ein für alle Menschen geltendes Prinzip entdeckt wurde – mit dem Aufstieg des Christentums und des Germanentums. So wieder Hegel: „Das Recht der subjektiven Freiheit macht den Wende- und Mittelpunkt in dem Unterschied des Altertums und der modernen Zeit.“43 Jetzt heißt es – wenn man Hegel nachfolgt – davon die Schlussfolgerungen bis zum Ende zu ziehen. Das hat in der Tat die Bewegung der Moderne getan. Wenn man die Richtung verlängert, kommt man zum Punkt, an dem ein völlig freies Wesen sich selbst ins Sein rufen könnte. Die radikale Autonomie wäre eine Art der Fähigkeit zur Selbstschöpfung. Da begegnen wir unseren Freunden, den Engeln, wieder. Nach der klassischsten Auffassung der rechtgläubigsten Theologie sind die Teufel gefallene Engel.44 Als reine, körperlose Geister, sind die Engelscharen von Gott ins Sein gesetzt worden, haben jedoch sofort nach ihrer Schöpfung eine Entscheidung fällen müssen, ob sie sich als gottgewandt verstehen oder als gottesunabhängig wähnen. Ein Teufel wird zu dem, was er ist, also einem Bösen und Gefallenen, durch einen Akt der Freiheit, ebenso wie die guten Engel sich von den Abtrünnigen nur dadurch unterscheiden, dass sie die Liebe Gottes wiederum durch einen Akt der Freiheit bejaht haben. Das geschah in einer Freiheitsentscheidung, die sich in einem Augenblick vollzog,45 sie 41 Jacques Maritain, Trois Réformateurs. Luther, Descartes, Rousseau, 1925, II, 3, in: Œuvres Complètes, 17 Bde., Fribourg u. Paris 1982-2008, Bd. 3, 1984, S. 488. 42 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Einleitung, in: Sämtliche Werke, hg. v. Hermann Glockner, 20 Bde., Stuttgart 1927-1940, Bd. 11, 1971, S. 46. 43 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 124, in: Sämtliche Werke, a. a. O., Bd. 7, 1952, S. 182. Hervorhebungen im Original. 44Augustinus, Der Gottesstaat, XII, 6, a. a. O., Bd. 1, S. 788. 45 Thomas von Aquin, Summa Theologiae, I a, q. 63, a. 5, c. 210 Rémi Brague aber dann, nach diesem Augenblick, für immer zu dem bestimmte, was sie sind. Der Teufel erschafft sich nicht selbst, trotz der frechen Lüge Satans bei John Milton.46 Wir Menschen können zwar, selbstverständlich nur bis zu einem bestimmten Grade, die Eigenschaften wählen, die wir uns geben möchten, wie etwa unseren Lebensstand, unseren Beruf und unseren Ehepartner. In diesem Sinne sagt Søren Kierkegaard: Wir schöpfen – erschaffen – uns nicht selbst, wir wählen uns nur selbst.47 In der Neuzeit kokettiert jedoch der Mensch mit dem Wunsch einer totalen Selbstbestimmung, die ihn zu einem Quasi-Engel machen würde. Analog zum Engel, der als Geschöpf sein Dasein passiv von seinem Schöpfergott bekommt, muss er ebenfalls in sich die Anwesenheit eines Moments der Passivität erkennen, indem er seinen biologischen Unterbau unmöglich leugnen kann. Er spielt aber mit dem Gedanken, die Anker zu lichten und sich von der Natur zu emanzipieren. 6.5 Die Tatsache der Geburt Steigen wir jetzt von den Engeln zu den Menschen herab. Die Frage bleibt nämlich, wie das Handeln im konkreten Fall geschieht, jenem Fall, der uns interessiert, weil er uns direkt betrifft, wo mithin die handelnden Subjekte menschliche Wesen aus Fleisch und Blut sind. Die konkreten Subjekte, mit denen wir verkehren, ja, die wir selbst sind, wurden irgendwo und irgendwann geboren. Nun ist die Geburt ein Ereignis, das nicht von dem oder der Betroffenen bestimmt wird, da es ihn oder sie noch gar nicht gibt. Jede Geburt stellt einen Fall der radikalen Heteronomie dar, da sie nicht nur das Sosein eines Wesens betrifft, sondern dessen Dasein selbst. Ob ich existiere, das haben andere für mich entschieden. Geborenwerden ist keine Handlung, das von einem Subjekt herrühren könnte, sondern das, was der Handlung überhaupt erst ihr Subjekt liefert. Dazu kommt, dass unsere Geburt – als Individuen der Gattung homo sapiens – nur die letzte ist in einer Kette, die bis zum Anfang des Lebens reicht, jenem „lauwarmen Tümpel“, von dem Darwin einst sprach.48 Ja, sie reicht bis zum soge- 46 John Milton, Paradise Lost, 1667, VI, 860. 47 Søren Kierkegaard, L’Alternative, 1843, II, hg. v. Paul-Henri Tisseau u. Else-Marie Jacquet-Tisseau, 2 Bde., Paris 1970, Bd. 2, S. 194; dt. Entweder – Oder, 2 Bde., Düsseldorf 1964 u. 1957, S. 174 – in der Originalpaginierung nach der Ausgabe von 1901 auf S. 194: Ich „wähle … absolut mich selbst … in einem Sinne …, der nicht identisch ist mit sich selbst erschaffen“. 48 Charles Darwin, Brief an Joseph Hooker v. 1. Februar 1871. Die Kraft des Guten 211 nannten Urknall, da uns die Physiker erklären, dass die Atome, aus denen unser Leib besteht, nur ein paar Augenblicke nach dem Anfang des Universums schon geschmiedet waren. Man kennt Hannah Arendts Begriff der Natalität – natality – , den sie bewusst dem Insistieren der Philosophen auf der menschlichen Sterblichkeit als dessen Widerpart entgegensetzte.49 Nun nimmt dieser Begriff, seinen großen Verdiensten zum Trotz, das Phänomen nur etwas einseitig in Sicht. Er betont die Möglichkeit, einen neuen Anfang zu machen. Im Begriff, so wie ihn Arendt versteht, wird der Aspekt der völligen Passivität des Geborenwerdens abgeblendet. Aber es ist gerade diese Seite eben das, was die Natalität mit der Sterblichkeit gemeinsam hat. Man kennt die schon zu einer alten Leier gewordenen Verse Rainer Maria Rilkes: „O Herr, gib jedem seinen eignen Tod. / Das Sterben, das aus jenem Leben geht, / darin er Liebe hatte, Sinn und Not.“50 Hier darf man nüchtern fragen: Wessen Tod sonst sollten wir sterben? Ferner sollte man fragen, ob es sinnvoll wäre, wenn – symmetrisch zum Tod – der Mensch seine eigene Geburt erleben könnte. Die Suche nach einem ‚eigentlichen‘ Geborenwerden erübrigt sich. Meine Geburt ist notwendig meine eigene, nicht diejenige eines Anderen, etwa meines Bruders. Ihre ‚Jemeinigkeit‘, um es in der Sprache Martin Heideggers auszudrücken, weist aber paradoxe Züge auf, indem das ‚Ich‘, das dieses Ereignis betrifft, keine Präexistenz beanspruchen darf, sondern vom Ereignis allererst hervorgebracht und ermöglicht wird. Aus dieser Verflechtung der Autonomie und des radikal Heteronomen – zweier unvereinbarer Gegensätze – entsteht ein Gefühl des Unbehagens. Nach einer etwas kryptischen Äußerung von Emmanuel Levinas sei „die Geburt, die wir nicht wählen und unmöglich wählen können, der große Jammer – drame – des zeitgenössischen Denkens“.51 Man hat schon beobachtet, wie sehr der heutige, moderne Mensch sich irgendwie schämt, nur ein Mensch zu sein und deshalb davon träumt, mehr zu sein. Zum ersten Aspekt – dem Schämen – schrieb Fjodor Michailowitsch Dostojewski schon 1864 am Ende seiner rätselhaften Aufzeichnungen aus dem Kellerloch: „Wir halten es … für eine Last, dass wir Menschen sein sollen, Menschen mit wirklichem, eigenem Leib und Blut; wir schämen uns dessen, betrachten es wie eine Schande 49 Hannah Arendt, The Human Condition, 1958, Chicago 1998, S. 9; dt. Vita activa oder Vom tätigen Leben, Stuttgart 1960, S. 9 – wie auch andernorts im Werk der Philosophin. 50 Rainer Maria Rilke, Das Stunden-Buch, 1903, 3. Buch: Das Buch von der Armut und vom Tode, in: Werke in drei Bänden, hg. v. Beda Allemann, Frankfurt a. M. 1966, Bd. 1: Gedicht-Zyklen, S. 103. 51 Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Den Haag 1961, S. 199. 212 Rémi Brague und möchten eine Art von nie dagewesenen Universalmenschen – общечеловек – sein.“52 Dostojewski, der kein Philosoph war, lässt sich jedoch relativ leicht ins Philosophische transponieren, nämlich wie folgt: Das Ärgernis Erregende ist die Individuation, die Tatsache, dass wir unseren ureigenen Leib bekommen haben, dessen Materie uns individualisiert. Gerne möchten wir dieselbe Allgemeinheit besitzen, wie sie die Engel haben, von denen jeder eine eigene Spezies darstellt. Man könnte ebenfalls an Günther Anders Begriff der „prometheischen Scham“ denken, durch den der Mensch sich schämt, der Perfektion seiner eigenen Produkte nicht gewachsen zu sein.53 Perfekt sind die Artefakte, weil sie geplant und nach dem Plan gemacht wurden – und nicht gezeugt und geboren sind. Zum zweiten Aspekt, dem Traum eines Ausgangs aus der Menschheit, ist der Kronzeuge Friedrich Nietzsche, mit seinem im Zarathustra geäußerten Wunsch, den Menschen zu überwinden, um in die Richtung des Übermenschen zu aufzubrechen.54 Die jetzigen Träume einer posthumanen Vollendung der Menschheitsgeschichte schlagen ihre Wurzeln tief in der Sehnsucht des neuzeitlichen Menschen. Davon rührt die Faszination her, die der sogenannte ‚Transhumanismus‘ auf unsere Zeitgenossen ausübt, mit seinem Projekt einer technischen Verwandlung des Menschen in ein Wesen, das am Ende mehr als – nur – ein Mensch wäre. 7 Zugang zum Guten Was können wir aus diesem radikalen Nicht-Tun-Können heraus tun? Welche Ethik soll gelten in einem Bereich, wo jede Handlung schlicht und einfach unmöglich ist? In einer so dünnen Luft wäre der Name der Ethik nicht mehr angebracht. Es besteht dagegen die Möglichkeit, einen Zugang zum Guten zu finden. Dieser Zugang erweist sich als der notwendige Grund oder Unterbau des Lebens wenn wir bedenken, dass es einen Punkt gibt, an dem die Freiheit als Bedingung des Handelns und die radikale Unfreiheit der Geburt einander begegnen, ja, gegen52 Fjodor Dostojewski, Записки из подполья / Carnets du sous-sol, 1864, II, 10, hg. v. Michelle-Irène Brudny, Paris 1995, S. 376 f.; dt. Aufzeichnungen aus dem Dunkel der Großstadt, II, 10, in: Aus dem Dunkel der Großstadt. Helle Nächte, hg. v. Hans Röhl, Leipzig 1922, S. 199. 53 Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, 2 Bde., 1956, Bd. 1: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, München 2010, S. 23-95. 54 Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, I, Prolog, 3, in: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari, München, Berlin u. New York 1980, Bd. 4, S. 14 ff. Die Kraft des Guten 213 einander stoßen. Es ist die Zeugung. Das Dasein der Menschenart hängt von der freien Entscheidung ihrer Mitglieder, und zwar immer mehr, je weiter die Technik fortschreitet. Der Instinkt bürgt für das Weiterleben der tierischen Gattungen. Im Menschen gerät dieses Weiterleben immer stärker in einen Widerstreit mit der Freiheit und wird von dieser immer entschiedener verdrängt und abgelöst. Diese Unterjochung der Natur ist an und für sich ein durchaus zu bejahender Fortschritt, wenn – und nur wenn – sie in die Freiheit zur menschlichen Selbstbejahung führt. Dafür braucht man aber einen äußerlichen Stützpunkt. Platon stellte sich das Gute nicht so sehr als eine Norm vor, die die Handelnden zu befolgen haben, sondern eher als ein schöpferisches Prinzip. Die Idee des Guten hat er bekanntlich mit der Sonne verglichen. Nun betont Platon, dass die Sonne nicht nur das schon Seiende beleuchtet – und ihm den Weg zur gelungenen Handeln ebnet – , sondern das noch-nicht Existierende sein und leben lässt. Sie gewährt nämlich Entstehen – genesis – , Wachstum – auxē – und Nahrung – trophē – .55 Das entspricht unserer alltäglichen Erfahrung: die Sonne lässt die Pflanzen wachsen, veranlasst im jahreszeitlichen Wechsel die immer wiederkehrende Brunftzeit der Tiere wieder, und was dergleichen Beispiele mehr sind. Aristoteles stimmte dem zu – mit der schon erwähnten Äußerung, nach der ein Mensch einen Menschen zeugt – mit Hilfe der Sonne.56 Das, was er zweifelsohne wörtlich, also materiell meinte, kann man auch metaphorisch deuten: als die Notwendigkeit des Guten für das Weiterleben des Menschen. Nur wenn ich von einem Guten herkomme, kann ich die Tatsache ertragen, dass ich mich nicht selbst ge- und erschaffen habe. Nehmen wir an, dass ich mich dem Zufall verdanke, sprich, der Zusammenkunft blinder Kräfte: ‚Sich verdanken‘ wäre in diesem Fall bloß eine Metapher, da es ja doch niemanden gäbe, dem ich danken könnte. Wenn das so wäre, dann hätte ich nicht den geringsten Grund, im Leben weiterzumachen. Wenn der blinde Uhrmacher mich ohne mein Zutun in die Welt geworfen hat, warum sollte ich denselben Streich anderen Leuten spielen, indem ich sie mit dem Leben infiziere? Wenn ich mich dahingegen als das Geschöpf eines guten, großzügigen Gottes fühle, der mich zu seinem eigenen Liebesleben ruft, dann habe ich Gründe, das Leben weiterzugeben. Der Zugang zum Guten ist nichts anderes als der Erhalt – die Empfängnis – dessen, was das Gute uns gibt. Die Wahl zugunsten des Guten und einer Gesamtdeutung der Welt im Licht des Guten koinzidiert mit der höchsten Selbstbejahung des Subjekts, das die Gesamtheit des Seienden in dieser Sicht wahrnimmt. 55Platon, Staat, 509b. 56 Vgl. in diesem Aufsatz oben Fußnote 20. Der Imperativ erst schafft den Indikativ Ein Postscriptum zu Rémi Brague Christoph Böhr Seitdem Rémi Brague mich vor etlichen Jahren auf jene Fragestellung, die im Mittelpunkt seines in diesem Sammelband veröffentlichten Aufsatzes steht, aufmerksam machte, lässt diese mich nicht mehr los. Wer ihr nachgeht, stellt alsbald fest, dass sich hinter der Frage nach der ‚Kraft des Guten‘ ein umfangreiches Forschungsvorhaben verbirgt, dem nachzugehen umso wichtiger ist, als jenes Verständnis des Guten, an das Brague erinnert, unserem Denken schon lange nicht mehr vor Augen steht,1 ja fremd geworden ist. Wie es dazu kommen konnte und welche Gründe aufzuarbeiten sind, damit wir verstehen, warum wir haben vergessen können, was doch so bedeutsam ist, erläutert Brague mit wenigen Federstrichen in seinem Beitrag, zu dem hier ein kurzes Postscriptum geliefert werden soll. Nun ist es nicht üblich, dass einem Brief, den man erhalten hat, vom Empfänger eigenhändig ein Postscriptum angefügt wird. Im vorliegenden Fall mag es dennoch 1 Soweit ich sehe, zählt das vor mehr als einem halben Jahrhundert erschienene, weithin vergessene Buch von Helmut Kuhn, Das Sein und das Gute, München 1962, bis heute zu den letzten dieser Fragestellung gewidmeten Schriften aus der Feder eines deutschen Philosophen; Kuhn erläutert in seinem Buch, ebd., S. 12, die These: Das „Sein ist mit dem Guten untrennbar verbunden. Von dem Guten hängt das Sein alles Seienden ab.“, und, ebd., S. 61: Das Gute ist „ein ontologischer Begriff. Das Sein und das Gute gehören zusammen, Mehr noch: das Gute ist das Sein, sofern es Seiendes konstituiert. Aber erst auf der Ebene personalen Seins, durch die menschliche Entscheidung, erschließt sich die ontologische Sinnfülle des Guten in seinem Gegensatz zum Bösen als Verneinung des Seins.“ Das erkennende Suchen nach dem Sein in der Zuwendung zu der drängenden Frage, was der Mensch ist, nährt sich, so Kuhn, ebd., S. 11, „aus der Sorge um die Seele“. Dieser Begriff der ‚Sorge um die Seele‘ geht zurück auf eine Äußerung von Sokrates, die Platon in der Apologie, 30a-b, wiedergibt. Für die Bildung der Identität Europas wurde dann dieser Gedanke grundlegend, wie zuletzt Martin Cajthaml, Europe and the Care of the Soul. Jan Patočka’s Conception of the Spiritual Foundations of Europe, Nordhausen 2014, herausgearbeitet hat. 215 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7_11 216 Christoph Böhr erlaubt sein, weil der Schreiber des Postscriptums sich ganz unter die Vorzeichen des Praescriptums stellt, mit anderen Worten: die von Brague aufgeworfene Fragestellung nicht nur für eine spannende, sondern die von ihm angeregten Antworten auch für zuträglich und weiterführend hält. Die Fragen, denen sich Brague widmet, liegen für jedermann nachvollziehbar auf der Hand: Wie kann, wenn es den Schöpfer der Welt gibt, dieser im Anblick seiner Schöpfung sagen: „Es war sehr gut“?2 Belehrt uns nicht der Blick in diese Schöpfung, dass doch wohl eher das Gegenteil der Fall ist, die Schöpfung gründlich missraten, eben verfehlt,3 und der Mensch, wenn nicht gar ein Untier,4 dann zumindest ein trauriges, bemitleidenswertes Geschöpf, das lebenslang sein Dasein im Schatten des unausweichlichen Todes fristen muss und sein Ende immer vor Augen hat. Nun mag man biblisch den Sachverhalt aufnehmen und darauf hinweisen, dass es eben die gefallene Schöpfung ist, die sich aufgrund menschlicher Entscheidung dieser Verfallenheit zum Tode selbst ausgeliefert hat. Dennoch bleibt die Frage: Verdient eine Schöpfung, die eine solche Möglichkeit in sich trägt, jenen umfänglich anerkennenden und ausnahmslos bejahenden Satz: ‚Alles war sehr gut‘? Brague gehört zu den großen Denkern der Gegenwart. Seine umfassende Kenntnis des jüdischen, griechischen und arabischen Schrifttums der Antike ist wohl kaum zu überbieten. Ein zweites, weiteres Merkmal seiner Forschungsarbeit scheint mir aber fast noch wichtiger: Brague zählt zu den nicht allzu vielen Denkern unserer Zeit, die eine universale Gelehrsamkeit mit einem fundamentalen Bekenntnis verbinden: Sein Denken folgt der Hypothese: ‚veluti si Deus daretur‘ – in einer Epoche, die sich offenbar von einer ungeheuren Begeisterung für die gegenläufige Antithese – ‚etsi Deus non daretur‘5 – tragen und immer weiter forttragen lässt. Das ist zweifellos das 2 Gen 1, 31. 3 Émile M. Cioran, Die verfehlte Schöpfung, Wien 1969. 4 Ulrich Horstmann, Das Untier. Konturen einer Philosophie der Menschenflucht, Wien u. Berlin 1983. 5 Der Satz geht auf Hugo Grotius – 1583 bis 1645 – zurück und diente der Scheidung von Jurisprudenz und Theologie im Rahmen der Abwendung vom Naturrecht; vgl. Hugo Grotius, De jure belli ac pacis Libri tres. Drei Bücher vom Recht des Krieges und des Friedens, 1625, hg. v. Walter Schätzel, Frankfurt 2008, Vorrede, Absatz 11, S. 33; Joseph Ratzinger, Europa in der Krise der Kulturen, in: Marcello Pera, Joseph Ratzinger, Ohne Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur, Augsburg 2005, S. 62 ff., hier S. 82, hat demgegenüber den Vorschlag gemacht: „Der zu Ende geführte Versuch, die menschlichen Dinge unter gänzlicher Absehung von Gott zu gestalten, führt uns immer mehr an den Rand des Abgrunds – zur Abschaffung des Menschen hin. Sollten wir da nicht das Axiom … umkehren und sagen: Auch wer den Weg zur Bejahung Gottes nicht finden kann, sollte doch zu leben und das Leben zu gestalten versuchen ‚veluti si Deus daretur‘ – als ob es Gott gäbe … Da wird niemand in seiner Der Imperativ erst schafft den Indikativ 217 gute Recht jedes Menschen und jedes Zeitalters. Aber kann es sein, dass uns diese Begeisterung schnell und allzu oft den Blick verstellt, also daran hindert, die Dinge zu erkennen, wie sie sind? Und ist nicht vor allem die Philosophie aufgefordert, immer wieder zu prüfen, ob Sehstörungen möglicherweise zu einem verzerrten Bild der Welt beitragen? Ist nicht der Satz ‚etsi Deus non daretur‘ längst zu einem Vorurteil abgesunken, einer vorschnell vollzogenen Nachahmung jenes Denkens, das den Satz einst als das nahm, was er ist: eine Hypothese nämlich? Wenn aus einer Hypothese eine Konfession wird, kommt das Denken schnell unter die Räder. Brague hat sich dieser besonderen Art der Hypostasierung der Hypothese zur Konfession immer verweigert. Aber er stellt sich ihr nicht kämpferisch und feindselig in den Weg, sondern begegnet ihr mit dem Scharfblick und der Klugheit, die der Gelehrsamkeit des Philosophen zu eigen sein sollten. Nicht in der theologischen, sondern in der philosophischen Durchdringung eines Sachverhaltes erkennt er seine Profession. Das aber heißt, dass er der heute zur Konfession gewordenen Hypothese ‚etsi Deus non daretur‘ nicht einfach die gegenteilige Konfession des ‚etsi Deus daretur‘ entgegensetzt, sondern tastend und fragend – unter den Vorzeichen jener Hypothese, dass es Gott gibt – den Zusammenhang der Dinge zu ergründen sucht – oder, anders und treffend in den Worten von Jean Greisch ausgedrückt: Er lässt „es auf den Versuch ankommen …, die Frage nach der Selbstheit des Menschen mit der Frage der göttlichen Selbstheit zu verknüpfen.“6 Auf diesem Weg findet er zu Einsichten, die ihresgleichen suchen. Bragues Schriften folgen jenem Merkmal, das er selbst im Blick auf das Neue, wie es mit dem Christentum in die Welt und unser Denken tritt, bestimmt hat: „Es liefert eine neue Perspektive.“ Das Christentum beansprucht nicht, „der Kultur neue Inhalte zu bringen. Es liefert eine neue Perspektive. Sie besteht darin, das bisher Unsichtbare sichtbar werden zu lassen. Ein neues Licht geht auf, wobei in einem gewissen Sinne gar nichts geschieht: Wenn ich das Licht in meinem Zimmer einschalte, wird der Möbelbestand um kein neues Stück bereichert. In einem gewissen Sinne geschieht jedoch Wichtigeres: Mit einem Satz springt das Ganze in die Sichtbarkeit hinein.“7 Eben dieses Erlebnis hat der Leser, wenn er Bragues Schriften zur Hand nimmt. Brague fügt den vorhandenen Dingen keine neuen hinzu. Die Dinge, über die er Freiheit beeinträchtigt, aber unser aller Dinge finden einen Anhalt und ein Maß, deren wir dringend bedürfen.“ Pera hat übrigens in einem Vorwort zur polnischen Ausgabe des Buches diesem Vorschlag ausdrücklich zugestimmt. 6 Jean Greisch, ‚Idipsum‘: Gott und Mensch im Licht der Wer-Frage, in diesem Band oben, S. 49. 7 Rémi Brague, Europa, das Christentum und die Moderne, in: Europa und die Anthropologie seiner Politik. Der Mensch als Weg der Geschichte – Zur Philosophie Karol Wojtyłas, hg. v. Christoph Böhr u. Christian Schmitz, Berlin 2016, S. 19 ff., hier S. 22. 218 Christoph Böhr nachdenkt, sind oft sogar hinlänglich bekannt – dem Arabisten, Mediävisten, Ideenhistoriker, Kulturanthropologen, Philologen und, allem voran, dem Philosophen. Aber er schaltet das Licht ein – und mit einem Satz springt das, wovon man vielleicht entweder schon eine gewisse Ahnung zu haben meinte oder aber was man für gar nicht vorhanden hielt, in die Sichtbarkeit hinein. Kurzum: Brague liefert eine neue Perspektive. Auch das macht es so gewinnreich, seine Arbeiten zu lesen. Dass es Licht gibt, erkennt der Mensch erst an dessen Wirkung. Licht ist unsichtbar. Es gelangt zur Sichtbarkeit, wenn es auf die Oberfläche eines Gegenstandes trifft, der sich dann, sobald er beleuchtet wird, in seiner Form, seiner Gestalt und seinen Farben zeigt. Ähnlich verhält es sich mit der Hypothese ‚veluti si Deus daretur‘: Das, was sie propositional zum Ausdruck bringt, sieht man nicht. Niemand hat je Gott gesehen, schreibt der Evangelist Johannes.8 Aber eine Hypothese kann – wie das Licht – ein anderes, neues Sehen ermöglichen, ja, sie ist ein Licht, in dem wir Eigenschaften von Dingen erkennen, die uns zuvor unzugänglich geblieben waren oder die wir bis dahin nur halb verstanden hatten. Trifft sie auf einen Gegenstand, dann zeigt sich dieser oft in einer ganz anderen Weise als zuvor. Es ist also – in beiden Fällen – die nachfolgende Wirkung, die auf eine vorgängige Ursache Rückschlüsse zulässt, und ein Sehen überhaupt erst möglich macht – ein Sehen, das die Augen nicht blendet, sondern öffnet. Das ist, meine ich, Aufklärung – Enlightenment, Lumières, Illuminismo – im besten Sinne. 1 Das Sein und das Gute In besonders eindringlicher Weise zeigt sich diese Wirkung des Lichtes, das Brague dem Denken zuteil werden lässt, in seinem Aufsatz über die Kraft des Guten in diesem Band. Man glaubt, das, worum es geht, schon zu kennen: die Genesis, den Pentateuch, die altorientalischen Kosmogonien, die Lehre der Scholastik über die Transzendentalien. Brague stellt das, was man zu kennen glaubt, in ein neues Licht – und zeigt sich in dieser Hinsicht als Phänomenologe von der denkbar besten Seite, wenn er beispielsweise den Pentateuch von hinten nach vorne liest.9 Und beim Leser stellt sich Verblüffung ein, weil dieser feststellt, so klar und zusammenhängend den Sachverhalt noch nie vor Augen gehabt zu haben. So entsteht am Ende dann eben doch etwas Neues: Der Raum, in dem – um im Bild zu bleiben – das Licht eingeschaltet wurde, zeigt sich auf einmal zur Gänze, 8 Joh 1, 18. 9 Vgl. im vorliegenden Band, S. 198 ff. Der Imperativ erst schafft den Indikativ 219 und erscheint vor dem Auge des Betrachters in seinen einzelnen Bestandteilen, seiner Farbigkeit, in Tiefe und Höhe, der Anordnung seiner Inhalte und in klaren Umrissen, wo zuvor ahnend mehr zu vermuten als klar zu sehen war – kurz: als der Ausdruck eines Sinnes, der den Gegenstand so, wie er sich dem Betrachter zeigt, geschaffen hat. Diese Wirkung stellt sich beim Leser in sehr vielen Fällen bei der Lektüre Bragues ein, dass er nämlich die Welt neu – und besser – zu sehen und zu verstehen lernt. Das gilt auch für Bragues Buch über Europa, seine Kultur und seine Barbarei.10 Wer dieses Buch zur Hand nimmt, stößt auf eine Darstellung von Sachverhalten, die Brague nicht neu ‚erfunden‘ hat – dagegen sprechen schon seine vielfältigen, erhellenden Bezugnahmen auf viele Generationen vormaliger Wissenschaftler und Forscher – , die er aber sehr wohl neu ‚entdeckt‘ hat, indem er das in Teilen gelegentlich schon Bekannte auf seine Weise sichtbar macht – besser sagt man vielleicht: in ein neues Licht taucht – , so dass es sich neu und funkelnd zeigen kann, um sich auf diese Weise in einen für den Betrachter und seine Wahrnehmung veränderten, bisher verborgen gebliebenen, im Dunkeln gelegenen Sinnzusammenhang einordnen zu können. Welche Sicht also eröffnet sich uns, wenn ein Philosoph wie Brague das Licht einschaltet und uns, beleuchtet von diesem Licht, Europa vor Augen stellt? Die Frage ist umso spannender, als heute angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Begriffsbildungen von der geographischen, politischen, ökonomischen, kulturellen und administrativen Figur Europas immer unklarer wird, was denn Europa eigentlich ausmacht – worum es zum Beispiel geht, wenn wieder einmal gesagt wird, Europa müsse sich neuerlich auf sich selbst besinnen, statt sich in einem planlosen Aktionismus zu verzetteln. Bragues These lautet: Die besondere Eigenart der europäischen Identität liegt in ihrer kulturellen Zweitrangigkeit: in der Tatsache, selbst nicht ursprünglich zu sein, sondern im Anderen, Früheren zu wurzeln: kulturell im Griechentum, religiös im Judentum, habituell im Römertum. Vor allem das Römertum hat unseren Begriff von Europa geprägt – Brague spricht in diesem Zusammenhang von Europas römischer Sekundarität – , indem es seinen Habitus den Europäern vererbte: nämlich die Haltung der Aneignung, der Überlieferung und der Weitergabe. Und so ist, schreibt Brague, Europas exzentrische – außerhalb seiner selbst liegende – Identität die Quelle aller Renaissancen, zu denen es fähig war und ist, angefangen bei der karolingischen Renaissance. Das Römertum der Europäer ist zur Quelle ihres Reichtums geworden. Und heute, so schlussfolgert Brague, stellt 10 Rémi Brague, Europa – seine Kultur, seine Barbarei. Exzentrische Identität und römische Sekundarität, hg. v. Christoph Böhr, Wiesbaden 2012. 220 Christoph Böhr sich die Frage, ob wir noch Römer sind als Europäer und ob wir es künftig noch sein wollen: aneignend, überliefernd, weitergebend? Aus der Beute, die Europa im Denken anderer machte, ist eine Kultur erwachsen, das sich – eine Deutung von Brague aufnehmend – ihrer Sekundarität, ihrer Zweitrangigkeit, im Vergleich zu dem ihr geschichtlich vorgelagerten Älteren, bewusst ist. Sie speist sich aus dem, was ihr vorausgegangen ist. Und hier findet sich die entscheidende Gemeinsamkeit von Europäertum und Christentum, dass sich nämlich Europa, im Vergleich zu der ihm vorausgehenden Kultur des Hellenismus, mit dem Status der Sekundarität, der Zweitrangigkeit, zufrieden geben muss: so, wie das Christentum nach einem Wort von Paulus11 dem ihm vorausgehenden Judentum wider die Natur eingepfropft ist, so ist das Europäertum anderen, ursprünglicheren Kulturen als Denkform aufgepfropft. Die Bereitschaft, fremde Inhalte dem eigenen Denken zuzuführen, ohne das Eigene preiszugeben,12 kennzeichnet die Denkform des Christentums. Es ist die Denkform der Römer, die sich der Abgeleitetheit ihrer Kultur bewusst waren. Um diese Denkform in der Ordnung der Beziehung zwischen dem Eigenen und dem Fremden geht es – bis heute. Die christliche Idee der Inkarnation wurde hermeneutisch mit den Instrumenten der paganen Philosophie entfaltet. Man bediente sich des Fremden, um das Eigene zum Ausdruck zu bringen. Dabei waren die Begriffe der Philosophie nicht nur die Gefäße, die mit dem Glauben der Christen gefüllt wurde. Die Begriffe gaben diesem Glauben durchweg seine Form, so dass man sagen kann: In den Umrissen philosophischer Termini entfaltete sich mit der Zeit das Bekenntnis der christlichen Religion. Das war wohl überhaupt nur möglich, weil Griechentum und Judentum in der für die zukünftige Entwicklung ihrer Synthese im Christentum entscheidenden Frage unabhängig voneinander – hier auf dem Weg philosophischen Denkens, dort auf dem Weg biblischer Offenbarung – zu einer Art von Gleichklang gefunden hatten: in der Überzeugung nämlich, dass Gott in seinem Sein gleichbedeutend ist mit dem Guten. Da Gott als das Sein in seiner Fülle zu begreifen ist, steht alles Sein, das – greift man nicht zur Figur eines Gegengottes und der von ihm veranlassten zweiten Schöpfung zur restitutio omnium nach dem fehlgeschlagenen Versuch der ersten Schöpfung – nur in einer Anteilsbeziehung zu dieser Fülle in ihrer Vollkom- 11 Röm 11, 24. 12 Vgl. dazu den ausgezeichneten Überblick bei Michael Fiedrowicz, ‚Wir dienen dem Logos‘. Die Vernünftigkeit des Glaubens in der Argumentation frühchristlicher Theologen, in: Der christliche Glaube vor dem Anspruch des Wissens, hg. v. Tobias Kampmann u. Thomas Schärtl, Münster 2006, S. 1 ff., hier S. 22: „Der Glaube ist nicht nur Gegenstand der Reflexion, sondern deren treibende Kraft“. Der Imperativ erst schafft den Indikativ 221 menheit gedacht werden kann, mithin gleichbedeutend für das Gute. Im biblischen Schöpfungsbericht ist der entsprechende Hinweis im Buch Genesis ausdrücklich ausgesprochen: „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut.“13 Ein wenig verwickelter ist dieser Gedanke bei den Griechen zum Ausdruck gebracht, hier vor allem – nach einer langen Vorgeschichte in der rationalen Theologie der Griechen – bei Platon in der Politeia; dort fasst Sokrates die Gotteslehre politisch-theologisch in zwei – öffentlichen – Gesetzen zusammen; im ersten dieser beiden Gesetze wird festgelegt, dass im Staat nur gesagt und gedichtet werden darf, dass der Gott – in der Einzahl genannt – nicht von allem, sondern ausschließlich vom Guten die Ursache sein kann.14 Markus Enders fasst diesen Befund treffend zusammen, wenn er schreibt: So konnte bei Platon „die philosophische Theologie der Griechen eine von Aristoteles später noch zum Teil präzisierte begriffliche Vorstellung finden, weil Platon als erster einen Begriff vollkommenen Seins adäquat zu denken vermochte, mit dem er das Göttliche deshalb wie selbstverständlich prädikativ identifizierte, weil die Griechen sowohl im Bereich der dichterischen …, besonders aber in dem der natürlichen, rein rationalen Theologie ‚Gott‘ stets als Inbegriff des denkbar Besten, das heißt eines vollkommenen Seins, zu denken versucht haben.“15 Gott – ‚der‘ Gott, wie Platon sagt – ist das vollkommene Sein. Was er schafft, ist ausnahmslos gut. Damit war jene These aufgestellt, die zu dem vermutlich wichtigsten Grundpfeiler des europäischen Denkens werden sollte und die wie kaum eine andere – in Annahme und Ablehnung – das europäische Denken in Bewegung hielt. Ihre Wurzel hat diese These in dem geschilderten Gleichklang sokratisch-platonischer Philosophie und hebräisch-biblischer Religion, sie wird vom Christentum in den Mittelpunkt seiner Botschaft gerückt und findet in der hochmittelalterlichen Philosophie zu ihrer vollen Blüte. Dort rücken – nicht zuletzt im Rückgriff auf Aristoteles – ens und bonum in 13 Gen 1, 31. 14Platon, Politeia, 379c6-9; vgl. auch den Hinweis auf die Parallelen zu Gen 1, 31, bei Platon, Timaios, 37c, sowie ebd., 92c, bei Michael Landmann, Die Weltschöpfung im ‚Timaios‘ und in der Genesis, in: Ursprungsbild und Schöpfertat. Zum platonisch-biblischen Gespräch, München 1966, S. 142 ff., hier S. 169; Landmann, ebd., spricht von einem „Zusammenfließen griechischer und biblischer Tradition“ im Christentum und der zusammenfassenden Festzustellung über Einklang und Verschiedenheit der beiden Traditionen: „Für Platon ist die Welt mit der Idee verwandter als in der Bibel mit Gott – dem sie streng gegenüber bleibt – , aber sie ist ihr verwandt nur durch ihren eigenen ideellen Kern oder Widerschein, während umgekehrt die Distanz, in die die Welt bei Platon zur Idee durch die Materie tritt, ihre biblische Distanz zu Gott weit übertrifft, denn hier ist sie Geschöpf, nicht jedoch Gegenprinzip.“ 15 Markus Enders, Natürliche Theologie im Denken der Griechen, Frankfurt a. M. 2000, S. 94. 222 Christoph Böhr den Rang von Transzendentalien, die ausnahmslose Geltung besitzen: Das Seiende ist das Wirkliche, und das Wirkliche ist das Gute – ens et bonum convertuntur.16 In diesem Licht erscheint das Böse, dem ein Sein keinesfalls abgesprochen wird, als böse aufgrund eines Seins-Mangels, der allem Übel zugrunde liegt. In der Neuzeit entbrennt um diesen Satz – ens et bonum convertuntur – ein heftiger Streit. Aber auch dort, wo der Zusammenhang negiert wird – weil entweder geleugnet wird, dass es ein Sein der Wirklichkeit gibt, oder aber die Austauschbarkeit der beiden mittelalterlichen Transzendentalien bestritten wird – , bleibt der Satz als Objekt der Zurückweisung selbst in seiner Negation gegenwärtig. Die Denkform des Europäers kann sich, wie es scheint, von dieser Perspektive, in der das Sein und das Gute gleichgesetzt werden, nicht gänzlich lösen. Diese Perspektive ist der Grund, warum die Frage, wie das Sein angemessen zu denken ist, zum cantus firmus aller Versuche der Bestimmung des Europäertums geworden ist. Für Europa ist diese Frage bis heute die Frage aller Fragen. Die Vorstellung und der Begriff von Europa sind dieser Denkform – die in der zuletzt erwähnten These von der Gleichsetzung Gottes mit dem Sein und dem Guten ihren Unterbau findet – entsprungen: Europa, als es sich am Beginn formte, hat sie vorgefunden und sich angeeignet. Das aber heißt: Europa wird durch seine besondere Weise, eine Synthese zu bilden, bestimmt – im Rückgriff und der Aneignung einer Denkform, die sich zuerst in der Synthese des griechischen Denkens und dessen römischer Aneignung und sodann – und vor allem – in der Synthese von christlichem Impuls – eben jener durch das Christentum ausgelösten phänomenologischen Revolution, von der Brague spricht – und dessen philosophischer Durchdringung gezeigt hat. Europa baut auf eine von Anderen geborgte Denkform, die es vorfand, entlehnte und sich aneignete. Durch diese Denkform wird es in seinem Kern bestimmt, konzeptionell konstituiert – und in der Vergegenwärtigung dieses seines Ursprungs, durch den seine Eigenart festlegt ist, auf Schritt und Tritt daran erinnert, dass es im Blick auf das vorgängige Christentum nur über den Status der Sekundarität verfügt, wie das Christen immer im Blick auf das ihnen vorgängige Judentum werden sagen müssen. 16 Vgl. Thomas von Aquin, Sth, I, 16, 3: „Et ideo sicut bonum convertitur cum ente, ita et verum. Sed tamen sicut bonum addit rationem appetibilis super eius, ita et verum comparationem ad intellectum.“ In der Übersetzung der Deutschen Thomas-Ausgabe: „Wie also das Gute sich mit dem Seienden vertauschen läßt, so auch das Wahre, und dennoch, wie das Gute den Charakter des Begehrbaren zum Seienden hinzufügt, so fügt das Wahre die Beziehung auf den Verstand hinzu.“ Der Imperativ erst schafft den Indikativ 2 223 Folgen für das Menschenbild Vor diesem Hintergrund ist eine Anthropologie entstanden, die wir die europäische nennen: eine bis dahin unbekannte, unter den Vorzeichen des antiken Denkens für unmöglich gehaltene Sicht auf den Menschen, der trotz seiner ganzen Verfallenheit – zum Bösen und zum Tode – das Göttliche immer doch unverlierbar in sich trägt und findet.17 Auf den ersten Blick scheint das ein Paradoxon. Doch begründet gerade diese Sichtweise auf den Menschen eine ganz besondere Beziehung im Verhältnis zum Anderen. Joseph H. H. Weiler, gläubiger Jude und amerikanischer Rechtsgelehrter, hat diese Beziehung in seinem Buch Ein christliches Europa eindrucksvoll beschrieben. Dabei nimmt er Bezug auf die Missionsenzyklika Redemptoris Missio von Johannes Paul II. aus dem Jahr 1990. Dort geht es um die Frage, wie wir – als Christen – anderen Menschen, den Heiden, begegnen, und zwar in jener Polarität, die sich zwischen dem eigenen Anspruch auf Wahrheit und dem Anspruch auf Wahrheit seitens des Anderen aufspannt. Weiler stellt fest: Nur wenn Wahrheit authentisch, also nicht fähig zu einem Kompromiss, gedacht wird, ist sie das, was dich dich – und mich mich sein lässt. Die Verneinung der Authentizität der Wahrheit – sprich die Bereitschaft, Abstriche von ihr zu machen und ihr so ihre unbedingte Geltung zu nehmen – hingegen bedeutet, nicht nur die eigene, sondern folgerichtig auch die andere Identität zu leugnen. Warum? Nur die Freiheit des Anderen, ‚Nein‘ zu sagen, gibt meiner Freiheit, ‚Ja‘ zu sagen, Bedeutung – und Rechtfertigung. Und die „Wichtigkeit der Freiheit, ‚Nein‘ zu sagen (einer Freiheit, die dem ‚Ja‘ Bedeutung gibt), ist integraler 17 Spuren dieser Anthropologie finden sich fraglos schon in der Antike, beispielsweise in der sokratischen Wende von der Beobachtung des Himmels zur Selbsterkenntnis des Menschen als der vorrangigen Aufgabe der Philosophie, um so über die Erkenntnis des Selbst zur Erkenntnis Gottes zu finden; vgl. dazu Rémi Brague, Die Weisheit der Welt. Kosmos und Welterfahrung im westlichen Denken, München 2006, S. 102 ff., nennt diese Gnoseologie den abrahamitischen Sokratismus, eine Verbindung sokratischen und biblischen Denkens, wie es sich in besonderer Weise bei Philon von Alexandria – einem jüdischen Philosophen, der um die Zeitenwende lebte – findet: vgl. dazu ebd., S. 105 f.: „Das Subjekt, zu dem zurückzukehren aufgefordert wird, ist auch das erkennende Subjekt, das sich selbst prüfen und seine Erkenntnisfähigkeit messen muß. Das ‚Erkenne dich selbst‘ erinnert entfernt an die biblischen Passagen, die raten, ‚achte auf‘, ‚hüte dich‘ … Es ist dies nicht die letzte Station. Das Ziel ist und bleibt die Erkenntnis Gottes … Philon kann uns deshalb auffordern, … in uns selbst Wohnung zu nehmen. Unser Forschungsgebiet sind wir selbst. Daraus wächst die Erkenntnis Gottes … Ich meinerseits möchte … die von Philon eingeführte Revolution in der Methode hervorheben: Für den, der sich selbst zu prüfen weiß, ist der Umweg über die Betrachtung der Natur nicht mehr notwendig; der Geist gelangt auf direktem Weg zu Gott.“ 224 Christoph Böhr Bestandteil jener Wahrheit, die bekräftigt wird. Die Verneinung des einen beraubt die andere ihrer Bedeutung.“18 In der Rückweisung des Anspruchs liegt eine Bekräftigung des Zurückgewiesenen. In diesem Sinne zeigt sich die Confessio der Europäer als ein Paradoxon. Denn nichts anderes ist der Satz, dass in der Rückweisung eines Anspruches dessen Bekräftigung liegt. Nun hellt sich dieses Paradoxon auf, wenn man den Blick weitet: Die von Johannes Paul II. erläuterten Grundsätzen der Verkündigung der authentischen Wahrheit betreffen, so Weiler, den Begriff der Wahrheit selbst und deren Verhältnis zur Freiheit: Der Mensch ist frei. Der Mensch kann ‚Nein‘ zu Gott sagen. Deshalb gilt: Die Freiheit, ‚Nein‘ zu sagen, gibt dem ‚Ja‘ Bedeutung. Eben hier deutet sich die den Europäern eigene Lösung jenes Konfliktes an, der heute wieder an Brisanz gewonnen hat: dass nämlich dort, wo die Wahrheitsfrage ins Spiel kommt, der Weg des Kompromisses nicht offen steht. In seiner Freiheit kann sich der Mensch gegen das Sein und das Gute stellen. Er kann aus der Wahrheit fallen und sich eine eigene Welt bauen, um Wege der Selbsterlösung ringen oder sogar von seiner Neuerschaffung kraft eigenen Entschlusses und eigener Tatkraft träumen. Er kann der These ‚etsi Deus non daretur‘ folgen, die Konditionalität des Satzes vergessen und die Hypothese zu seiner Konfession machen. Dann bleibt jedoch immer noch Weilers Feststellung: Gerade die Freiheit, ‚Nein‘ zu sagen, gibt dem ‚Ja‘ Bedeutung. Nichts anderes als dieser Zusammenhang wird heute mit dem Begriff der Würde – der unbedingten Achtung des Menschen, auch wenn er irrt – bezeichnet. In ihm findet sich der Kern der zeitgenössischen Selbstauslegung europäischen Denkens. Rechtliche Verbindlichkeit erlangte der Begriff erstmals 1949 mit dem Deutschen Grundgesetz, dessen Konstitutionsprinzip – als Überschrift der ganzen Verfassung ihre innere Richtung weisend – lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz macht nur Sinn, wenn man das Sein des Menschen für bedingungslos gut hält, denn nur dann kann er allen Anfechtungen und Angriffen, denen er tagtäglich ausgesetzt ist, standhalten. In jedem Bezugsrahmen, der auf die Selbsterlösung oder Selbsterschaffung des Menschen zielt, wird aus der Feststellung unantastbarer Würde die Möglichkeit ihrer umstandsabhängigen Deutung. Selbst der Begriff der Autonomie, der auf den ersten Blick zu gewinnen scheint, wenn der Mensch sich – ohne Anerkennung seines Seins als ein gutes – selbst ermächtigt, wird dann zur Phrase, weil die Frage unbeantwortet bleiben muss, welche Gründe denn die beanspruchte Autonomie rechtfertigen können – außer eben der Tatsache, dass auf sie Anspruch erhoben wird. 18 Joseph H. H. Weiler, Ein christliches Europa. Erkundungsgänge, Salzburg u. München 2004, S. 112. Der Imperativ erst schafft den Indikativ 225 Die metaphysische Traurigkeit19, die jedes Denken befällt, das sich unter die Hypothese ‚etsi Deus non daretur‘ stellt und infolge die Konversion von ens und bonum in Abrede stellt, hat weitreichende Folgen, die Brague hinlänglich und eindrücklich beschrieben hat20 – wie umgekehrt weitreichende Folgen mit einem Denken einhergehen, dass nicht der Trauer über das Missgeschick einer ,verfehlten Schöpfung‘, sondern einem ‚Denken am Ort lebendiger Hoffung‘21 folgt. Auf dem Kampfplatz der Philosophie – um eine Redewendung von Kurt Flasch22 aufzunehmen – wird dieser Streit seit langer Zeit ausgetragen. Es ist ein Streit, der im Mittelpunkt der Moderne steht und sich um sich um die Frage dreht, ob das Sein 19 Der Begriff findet sich, soweit ich sehen kann, erstmals als Überschrift eines Gedichtes aus dem Jahr 1924 bei Lucian Blaga, Tristețe Metaphysică / Metaphysische Traurigkeit, in der Übersetzung von Oskar Pastior in: Lucian Blaga, Tristețe Metaphysică / Metaphysische Traurigkeit. Gedichte. Zweisprachige Ausgabe, hg. v. Wolf Aichelberg u. Ion Acsan, Bukarest 1995, S. 146 ff.: „Neben Brunnen, die kein Lot ergründet, / tat ich das Aug der Erkenntnis auf … Mit aller Kreatur / hob ich die Wunden in den Wind / und wartete: Oh, kein einziges Wunder erfüllte sich. / Keines erfüllt sich, keines erfüllt sich!“ Eine ausführliche Befassung mit der Fragestellung, auf die der Begriff verweist, findet sich bei Werner Post, Kritische Theorie und metaphysischer Pessimismus. Zum Spätwerk Max Horkheimers, München 1971, S. 80, mit Verweis auf die „pessimistische Spätphilosophie Horkheimers“ : „Die Trauer ergreift das Denken nicht mehr nur angesichts des unversöhnlichen Leidens in Geschichte und Natur, sondern auch im Hinblick auf einen Prozeß, den die Gesellschaft – nachdem sie ihre großen Möglichkeiten vergeben hat – offenbar unaufhaltsam beschreitet.“ Die Kritische Theorie, so Post, ebd., S. 131, weist das „argumentum ontologicum des Anselm von Canterbury“ zurück: „was sein könnte, sollte, müßte, ist es nicht deswegen auch schon. Soweit die Desillusionierung, aber: das Intelligible, das nicht real sein kann, kann gleichermaßen nicht vollends nicht sein. Die mystische Dialektik, das Nichts sei privativ und setze noch Etwas frei, das im Nihil negiert wird, ist der Kritischen Theorie nicht fremd … Unter diesen Vorzeichen qualifiziert Horkheimer seinen Pessimismus als metaphysisch.“ Auch wenn das Nicht-Sein der Welt eigentlich ihrem Sein vorzuziehen wäre, zielt diese Spielart des metaphysischen Pessimismus gleichwohl nicht auf einen radikalen Nihilismus, sondern ebd., S. 148, S. 150, auf die völlige Hingabe ans Endliche als eine „Identifizierung mit dem Hinfälligen und Vergänglichen“. 20 Vgl.Rémi Brague, Les Ancres dans le Ciel, 2011, Paris 2013; dt. Übers. i. Vorb. 21 Vgl. dazu Christoph Böhr, Denken am Ort der Hoffnung. Eine philosophische Reflexion auf eine theologische Tugend, in: Heimat und Fremde. Präsenz im Entzug. Festschrift für Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, hg. v. Beate Beckmann-Zöller u. René Kaufmann, Dresden 2015, S. 181-193. 22 Kurt Flasch, Kampfplätze der Philosophie. Große Kontroversen von Augustin bis Voltaire, Frankfurt a. M. 2008. 226 Christoph Böhr für sich und von Anfang an das Gute in sich trägt,23 oder aber ob Sein bestimmter Additive und Attribute – hinzutretender Eigenschaften wie Schönheit, Gesundheit, Begabung, Fähigkeit oder Leistungskraft, vielleicht auch der Beheimatung in einer bestimmten menschlichen Rasse oder gesellschaftlichen Klasse – bedarf, so dass es erst dadurch, in einem zweiten Schritt, zum Guten gerechnet werden darf. Dieser Streit überdauerte, wie nicht anders zu erwarten war, auch die wenigen Jahrzehnte der Postmoderne, die zumindest in Teilen glaubte, ihn durch die von ihr vollzogene Wende zum Postmetaphysischen entschärfen zu können. Aber entschärfen lässt sich dieser Streit, wie man von Anfang an hat wissen können, nicht dadurch, dass eine der widerstreitenden Hypothesen unter der Hand zur siegreichen erklärt wird – gelegentlich verbunden mit dem gönnerhaften Hinweis, die eine oder andere antiquierte Requisite des ‚vormodernen‘ metaphysischen Denkens könne ja durchaus gesellschaftsnützlich im säkularen Paradigma dadurch bewahrt werden, dass Religion als Ressource wohltätigkeitstauglicher Einstellungen und gemeinwohlstützender Verhaltensweisen in einer Nische der Gesellschaft unter Schutz gestellt bleibt. Die Tragfähigkeit eben dieses Vorschlags scheitert nun allerdings schon an der Tatsache, dass Religion als Ressource und Stimulans für menschliche Wohltätigkeitsneigungen nicht erhalten bleibt, wenn sie ansonsten als vormodernes Relikt samt ihren Rechtfertigungsmöglichkeiten als überlebt und überholt zu gelten hat. Im Unterschied nun zu den Erwartungen der Postmetaphysiker und deren eher als Beschwichtigung im Streit um das allem Seienden vorangehende Sein zu bewertenden Einschätzung vom religiösen Residuum hat dieser sich in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten nicht gemildert, sondern im Gegenteil scharf radikalisiert und schließlich auf der Seite der Verächter des Seins zum Vorschlag einer „Endlösung der Lebensfrage“24 geführt. Es ist nicht selten der auf Günther Anders zurückgehende Begriff der „schwarze Ontologie“25, die diesem Denken 23 Als „das eingefleischteste Vorurteil“ des westlichen Denkens bezeichnet Ludger Lütkehaus, Nichts. Abschied vom Sein. Ende der Angst, 1999, Frankfurt a. M. 2003, S. 28, diese Gleichsetzung. 24 Ludger Lütkehaus, Schwarzbuch des Menschen, in: Die Zeit v. 4. September 1992. 25 Günther Anders, Mensch ohne Welt. Schriften zur Kunst und Literatur, München 1984, S. 229; Anders deutet die späten Bilder von George Grosz, die aus seiner Sichtung dem Betrachter eine „Meldung“ überbringen, und „diese ist eine ontologische Meldung, die Meldung nämlich, daß ‚Sein‘ und ‚Nichtsein‘ nunmehr einfach ausgetauscht sind … die Ontologie der Groszschen Welt ist also … eine ‚schwarze Ontologie‘. Sie gipfelt … in dem Satze: ‚Nicht das Nichtseiende ist die Negation des Seienden, sondern umgekehrt ist das Seiende die Negation des Nichtseienden‘.“ Die Anthropologie von Anders entspricht ganz dieser Deutung der Bilder von Grosz; vgl. ebd., S. 228: Es gehört „zum ‚Wesen‘ Der Imperativ erst schafft den Indikativ 227 seine Richtung wies: bis hin zu einer zum Äußersten sich vorantastenden anthropofugalen Position,26 die in die unverhohlene Aufforderung zum kollektiven Suizid der Menschheit einmündet. 3 Der Satz von der unantastbaren Würde: eine nicht begründbare Annahme? Die Behauptung, dass ein Mensch Würde – unantastbare Würde gar – hat, bedarf einer Begründung, die nicht davon absehen kann, wie der Mensch selbst sich versteht. Wenn der Mensch ein gänzlich erbarmungswürdiges Geschöpf, ein hoffnungsloser Fall, gar ein ausschließlich durchtriebener Bösewicht ist, Anlass zum kollektiven Suizid, dann gibt es erkennbar kaum einen Grund, ihm trotzdem eine unantastbare Würde beizumessen. So wird denn heute nicht selten der Versuch unternommen, den Sinn des Verfassungssatzes von der unantastbaren Würde neu zu deuten, indem dessen Bezugnahme auf ein Unbedingtes bestritten und als eine nicht begründbare Annahme – eine metaphysische Illusion, die in einer Selbsttäuschung wurzelt – zurückgewiesen wird. Dieses Unterfangen folgt, alles in allem, zwei verschiedenen Argumentationsfiguren. 3.1 Der Mensch: Teil einer verfehlten Schöpfung Beispielhaft findet sich dieses Menschenbild, wie es der Annahme einer misslungenen Schöpfung entspricht, im mephistophelischen Blick, wie Johann Wolfgang von Goethe ihn im Prolog des Faust beschreibt: Den „Schein des Himmelslichts“, die Vernunft, gebraucht der Mensch, um „tierischer als jedes Tier zu sein.“ Gott versteht infolge des Dialogs mit dem Teufel diese Klage richtig, nämlich so, wie sie des heutigen Menschen … , daß sein ‚Wesen‘ bereits geopfert ist.“ Hervorhebungen von Anders. Sie haben „kein Selbst mehr“, da „sie das, was sie sind, allein dadurch sind, was sie nicht sind.“ Zur schwarzen Ontologie und dem damit einhergehenden Nihilismus bei Anders vgl. Ludger Lütkehaus, Schwarze Ontologie. Über Günther Anders, Lüneburg 2002, bes. S. 80 f., hier S. 80: „Es gibt keinen plausiblen Grund, warum Seiendes ist und nicht vielmehr Nichts – wenn es denn als zeitlich episodische und kosmisch exzentrische Bagatelle überhaupt wahrhaft ist“. Hervorhebung von Lütkehaus. 26 Diese findet sich beispielsweise bei Rigo Baladur, Gründe, warum es uns nicht geben darf. Frontbericht von einem sterbenden Stern mit Motiven des Widerstands, Essen 1991. 228 Christoph Böhr gemeint ist – als eine grundsätzliche Anklage gegenüber der ganzen Schöpfung, und fragt deshalb zurück: „Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?“ Und Mephistopheles, der Widersacher, bekräftigt sein vorangegangenes Urteil: „Nein, Herr! Ich find‘ es dort, wie immer, herzlich schlecht.“27 Goethe beschreibt damit jene Argumentationsfigur, die seit je als Grundwiderspruch zum schon erwähnten biblischen Schöpfungsbericht gilt, wie er sich in Gen 1, 31, findet. Die Verneinung dieses Urteils kommt zu dem Ergebnis: Die Schöpfung ist – im Gegensatz zum Zeugnis ihres Schöpfers – schlecht und missglückt. In Folge dieser Verneinung stellt sich eine metaphysische Melancholie ein, die ‚acedia‘ genannt wird: gemeint ist damit der Überdruss des Menschen an sich selbst, seine unüberwindliche, bodenlose und verzweifelte Traurigkeit in der ständigen Vergegenwärtigung seines Schicksals, als verunglückte Kreatur sein Leben fristen zu müssen. Wenn die Schöpfung keiner Schätzung wert ist und der Mensch ein missratenes Geschöpf ist, was bleibt dann zu tun? Gibt es ein Entkommen aus dieser Falle unabwendbaren, sinnlosen Unglücks? Zwei Auswege bieten sich an, die hier mit den Namen des Marcionismus und des Nihilismus bezeichnet werden: Marcion, ein gelehrter Schüler des Apostel Paulus, sah in Jesus Christus den gutwilligen Erlösergott des Neuen Testaments, der dem böswilligen Schöpfergott des Alten Testaments den Garaus machte. Deswegen stritt er für eine strikte Abspaltung des Alten vom Neuen Testament. Die Hebräische Bibel bringt seiner Meinung nach Kunde von einem Gott, der boshaft eine schlechte Schöpfung ins Werk setzte. Die Evangelien hingegen bringen Kunde von einem Gott, der gutwillig die Schöpfung von ihrer ursprünglichen Verfallenheit befreite, alles neu machte, die restitutio omnium bewirkte und so die Welt erlöste. Für den Marcionismus – in alter wie in neuer Form – bedarf es um der Rettung des Guten willen der schonungslosen Abkehr von den alten, missglückten Ursprüngen. Die Politischen Religionen des 20. und des 21. Jahrhunderts tragen dieses Denken in sich. Der andere Ausweg, den der Nihilismus vorschlägt, führt den Menschen in die Verzweiflung, aus der ihn nichts und niemand retten, in der er sich aber vielleicht überlebenswillig einrichten kann. In diesem Sinne verfällt der Mensch notgedrungen in jene acedia, eine umfassende Weltverachtung und eine verzweifelte Hoffnungslosigkeit, die in eine Leugnung Gottes mündet,28 mithin gar nicht erst 27 Johann Wolfgang von Goethe, Faust, I, Prolog im Himmel, Z. 285 f., Z. 295 f. 28 Benedikt von Nursia, Regula S. Benedicti, 4, 74, zählt zu den „instrumenta artis spiritalis“ auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Wüstenväter – vgl. dazu Gabriel Bunge, Akedia. Die geistliche Lehre des Evagrios Pontikos vom Überdruß, Köln 1983 – im Umgang mit der acedia: „de Dei misericordia numquam desperare“: niemals an Gottes Barmherzigkeit zu verzweifeln. Der Imperativ erst schafft den Indikativ 229 nach einem Sinn des Lebens suchen lässt, um dann am Ende folgerichtig jenem ethischen Immoralismus zu frönen, von dem Friedrich Nietzsche wohl zu Recht meint, dass er nach dem ‚Tod‘ Gottes allein noch übrig bleibt – oder aber dessen Zwilling, dem politischen Moralismus, den Hermann Lübbe einmal treffend als den Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft29 kennzeichnete. Beide genannten Strömungen, die sich in ihren Grundformen in eben jener Zeit bildeten, als die religiöse Revolution, die durch das antike Christentum ausgelöst wurde, die ganze alte Welt samt ihrer Herrschaftsordnung zum Einsturz brachte, stehen in einem heftigen, unversöhnlichen Widerstreit zu jenem Menschenbild, das den Einzelnen in seiner Ambiguität und seiner Ambivalenz – in seiner Doppelveranlagung und in seiner Doppelwertigkeit – sieht: fähig zum Guten wie zum Bösen, totus filius Dei und totus peccator, und dabei frei, sich in der Entscheidung zum Guten oder zum Bösen selbst zu bestimmen. Diese Denkhaltung begegnet uns beispielsweise bei Giovanni Pico della Mirandola, der den Begriff der Würde30 am Beginn der Renaissance für die Neuzeit gewissermaßen (wieder-)entdeckt und zum bestimmenden Merkmal des menschlichen Seins gemacht hat. Pico sieht im Menschen ein Chamäleon, ein Wesen also, das sich – besser würde man vielleicht sagen: seinen Charakter – im Blick auf die eigenen – guten oder bösen – Entscheidungen selbst erschafft, oder, richtiger und in den Worten Picos: sich selbst in seiner Gestalt ausformt: ein bewundernswertes Chamäleon, wie Pico schreibt, von Gott, den er gerade aus diesem Grund als einen 29 Hermann Lübbe, Politischer Moralismus. Der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft, Berlin 1987. 30 Aus der Fülle der Dignitas-Literatur muss hier zumindest erinnert werden an Francesco Petrarca, Secretum meum, 1342, das noch von einem Widerstreit zwischen dem Gefühl der acedia und dem Bewusstsein der dignitas zeugt, während dann bei Giannozzo Manetti, De dignitate et excellentia hominis, 1452, der Gedanke der dignitas zur alles überragenden Bestimmung des Menschen aufrückt; zu einem wichtigen Gesichtspunkt, der den Begriff der ‚dignitas‘ seit dem Zeitalter des Humanismus prägt und vor allem bei Giovanni Pico della Mirandola neu hinzutritt, vgl. August Buck, Einleitung, in: Giannozzo Manetti, Über die Würde und Erhabenheit des Menschen. De dignitate et excellentia hominis, hg. v. August Buck, Hamburg 1990, S. VII ff., hier S. XIII f.: Um die Mitte des 15. Jahrhunderts verdrängte die ‚dignitas‘-Literatur durch den Glauben an den absoluten Primat der ‚dignitas‘ gegenüber der ‚miseria hominis‘ – und der durch sie ausgelösten acedia – die zuvor verbreitete Literatur über das Elend des menschlichen Daseins. Dabei veränderte sich die „Bedeutung der Wesenswürde“ und „der Begriff erhält“ im Vergleich zu seinen antiken und christlichen Wurzeln „einen dynamischen Charakter.“ Diese erweiterte Deutung der dignitas bleibt bei Pico allerdings ontologisch verankert im Sein des Menschen als Folge der göttlichen Schöpfung, und ist mithin nicht Synonym für eine Autopoiesis des Menschen. 230 Christoph Böhr gutwilligen Schöpfer einer geglückten Ordnung zeichnet,31 in die Ihm ähnliche Freiheit entlassen: ein Geschöpf, das zu Metamorphosen fähig ist, je nachdem, was es aus sich macht – als Mensch. Gottfried Benn beschreibt diesen Spannungsbogen im menschlichen Dasein eindrücklich in einem frühen Gedicht: „Die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch – “.32 Der Mensch, so sagt diese Sichtweise, kann eine Brücke zum Guten wie zum Bösen bauen. Gegen dieses Menschenbild, das von Ambiguität und Ambivalenz geprägt ist, steht jene Sicht vom Menschen, die auf die Verneinung des Lebens zielt, weil ihr im Blick auf den Menschen nichts Gutes zu Gesicht kommt. Der Mensch erscheint dann, wie schon erwähnt, als ein ‚Untier‘, als Teil einer misslungenen Schöpfung, als ein Störenfried in der Welt, eine Fehlform der Natur. Émile M. Cioran spricht in diesem Zusammenhang von einer verfehlten Schöpfung: „Zum Glück ist die Leere da, und wenn das ‚Selbst‘ untergeht, tritt sie an seine Stelle, an die Stelle von allem, erfüllt und übertrifft unsere Erwartungen, bringt uns die Gewißheit unseres Nicht-Seins.“33 Dieses Nicht-Sein wird zum einzig erstrebenswerten Ziel. So scheint es folgerichtig, „die älteste Abweichung des Geistes wieder zurechtzurücken, die darin besteht anzunehmen, daß etwas existiert … “.34 Der Mensch ist lediglich ein „beschädigtes Tier“, dem nichts anderes bleibt, als inmitten der „Nichtigkeit aller ‚Wahrheiten‘ … “35 in die Bestürzung über sich selbst zu versinken: „Eine vollgültige metaphysische Erfahrung ist nichts anderes als eine ununterbrochene, eine triumphierende Bestürzung.“36 Für Cioran scheint das Nichts die letzte Hoffnung angesichts der Krankheit des Seins. Seine Infragestellung des Menschen geht Hand in Hand mit der Unverzeihlichkeit seiner Geburt37 und mündet in den Selbsthass, die Verachtung des Lebens, 31 Giovanni Pico della Mirandola, De hominis dignitate. Über die Würde des Menschen, 1486, hg. v. August Buck, Hamburg 1990; die Schrift erschien im Druck erstmals 1496 posthum. 32 Gottfried Benn, Der Arzt. II, in: Gesammelte Werke, hg. v. Dieter Wellershoff, 8 Bde., Wiesbaden 1960-1968, Bd. 1, 1960, S. 12. 33Cioran, Die verfehlte Schöpfung, a. a. O., S. 78. 34 Ebd., S. 79. 35 Ebd., S. 80: Das ‚Nichts‘ ist nicht nur eine Erfahrung, sondern auch das Ergebnis des Willens: Der Mensch will ein Nichts sein; vgl. auch S. 86 f.: Selbst „wenn die Erfahrung der Leere nur ein Trug wäre, sie verdiente dennoch, gemacht zu werden. Was diese Erfahrung sich vornimmt, was sie versucht, ist, das Leben und den Tod aufs Nichts zurückzuführen … “. 36 Ebd., S. 80. 37 Émile M. Cioran, Vom Nachteil, geboren zu sein, Frankfurt a. M. 1979, S. 15: „Ich verzeihe mir nicht, geboren zu sein.“ Der Imperativ erst schafft den Indikativ 231 in Selbstverneinung und Selbstzerstörung. Wer den Menschen so sieht, kann ihn schlechterdings nicht für ein schutzwürdiges und schutzbedürftiges Wesen halten. Wo Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung maßgebend werden,38 ist für solche Überlegungen kein Raum. 3.2 Hoffnung in aller Hoffnungslosigkeit? – die Neu- und Selbsterschaffung des Menschen Wenn nun der Mensch tatsächlich ein missratenes Geschöpf sein sollte, dann hat er ja vielleicht doch eine Möglichkeit, seiner metaphysischen Melancholie zu entkommen, indem er, ganz im Geist des Denkens Marcions, die missglückte Schöpfung hinter sich lässt, um sich selbst neu zu erschaffen – und sich auf diese Weise jenseits aller Makel und Mängel, die er als Teil der verfehlten Schöpfung mit sich herum schleppt, selbst zu erlösen. Dieser zunächst durchaus naheliegende Gedanke setzt allerdings eine folgenschwere Bedingung voraus: Wenn der Mensch in die Rolle des guten Schöpfer- und Erlösergottes schlüpft, um sich neu zu erschaffen, dann ist das nur möglich, wenn er der Herr über das Sein – zumindest sein eigenes Sein – ist. Für den Gedanken der Selbsterlösung reicht es nicht, nur anzunehmen, der Mensch sei ein unbeschriebenes Blatt: eine tabula rasa, über deren Beschriftung er selbst entscheidet. Sicherlich kann man mit guten Gründen behaupten, dass der Mensch tatsächlich ‚offen‘ ist, im Sinne Arnold Gehlens nicht festgelegt wie beispielsweise ein Tier durch seine Instinktnatur. Die Offenheit, an die in der Anthropologie in diesem Zusammenhang gedacht wird, muss allerdings zu einer ontologischen Unbestimmtheit radikalisiert werden, um den Anspruch der Selbsterschaffung vorstellbar und möglich machen zu können: in dem Sinne, dass ein ‚Sein‘ des Menschen – wenn überhaupt – zunächst als für sich unbestimmt, leer und damit wertlos betrachtet wird. Im genannten Sinn noch radikaler denken diejenigen über den Menschen, die ihm ein Sein als ontologische Bestimmung schlechterdings und überhaupt absprechen, oder bestenfalls als die soziale Konstruktion eines – selbst – zugeschriebenen beziehungsweise durch Anerkennung Dritter festgelegtes Sein gelten lassen wollen. Sich selbst neu erschaffen kann der Mensch nur, wenn er nicht ein für allemal geschaffen ist auf ein bestimmtes Sein hin, nicht konstituiert dank einer ihm unverwechselbar eigenen Natur oder, wie man auch sagen kann, ohne ein eigenes, sein Mensch-Sein unwiderruflich bestimmendes Wesen. Er ist dann zu vergleichen mit einem leeren Nichts, über dessen Füllung – zum Beispiel der Zugehörigkeit zu einem 38 Vgl. Émile M. Cioran, Auf den Gipfeln der Verzweiflung, 1934, Frankfurt a. M. 1989. 232 Christoph Böhr Geschlecht – er selbst entscheidet, und wird, wenn er eine entsprechende Bestimmung getroffen hat, das Produkt einer – seiner eigenen – radikalen autopoietischen Konstruktion.39 Wer den Menschen so beschreibt, erblickt in ihm ein Geschöpf, das sein eigener Schöpfer ist, und der Dritten ausschließlich sein vegetatives Leben als einer Hülse für beliebige Verfügungen schuldet: ein Geschöpf, das sich selbst erschafft und erzeugt, ja, gezwungen ist, da ohne vorangehende Bestimmung in die Welt gesetzt, sich selbst zu erschaffen und neu zu zeugen, indem es sich kraft eigenen Entschlusses zu Wesen und Gestalt bringt, ohne dabei irgendeine innere Natur – von der in diesem Fall behauptet werden muss, dass es sie gar nicht gibt – zur Entfaltung zu bringen. In dieser Selbsterschaffung folgt der Mensch mithin keinerlei unverfügbaren Verbindlichkeiten, außer den durch Konvention und Konsens – also jeweils bis zu ihrem Widerruf, mithin nur bedingt geltenden und – festgelegten Vorgaben. Mit anderen Worten: In diesem Fall versteht der Mensch sich als ein Seiender, ohne Anteil an einem Sein zu haben. Das, was er als Seiender aus sich macht, steht unter dem Vorbehalt jederzeit möglichen Widerrufs – so wie, diesem Menschenbild folgend, alles, was gilt, nur unter Vorbehalt und auf Widerruf gilt. Eine Folge dieses menschlichen Selbstverständnisses fällt sofort ins Auge: Das ganze Leben wird auf diese Weise zu einer Machtfrage. Denn es muss ja den- oder diejenigen geben, die in Konvention und Konsens festlegen, was heute am Tage – und morgen vielleicht – gilt, die also Macht haben, jene sozialen Konstruktionen herbeizuführen, zu widerrufen und neu zu bestimmen – jene Konventionen, zu denen dann auch ‚der Mensch‘ gehört. Und für den Einzelnen gilt nicht minder: Wer sich nach eigenem Gutdünken zum Sein – und nicht nur zum Ausdruck und zur Gestalt – bringen will, muss sich mit diesem Ansinnen durchsetzen und braucht die dafür notwendigen Mittel: eben Macht. Selbstverwirklichung, Selbstgestaltung und Selbstvollzug vollziehen sich dann nach dem Geschmack des Augenblicks, in wechselnden, widerruflichen, befristeten Identitäten, gleichsam nomadisierend. Solche Nomaden-Identitäten gehören tatsächlich zum Denken eines flüchtigen Lebens in der liquiden Moderne,40 die meint, dass alles – und eben auch eine Identität – im Fluss der Veränderung nicht nur Anpassungen unterworfen ist, sondern angenommen und verworfen, mithin nach Belieben ausgetauscht werden kann. Jegliches Verständnis von Freiheit zielt dann auf eben diese Möglichkeit, das Recht 39 Auf die Fülle der Literatur, die sich diesem radikalen Konstruktivismus verpflichtet weiß, kann hier so wenig eingegangen werden wie auf die gelegentlich unter dem Namen des ‚Neuen Realismus‘ angetretene Gegenbewegung zu dieser Strömung. 40 Der Begriff wird hier verwandt, wie ihn Zygmunt Bauman in zahlreichen Schriften eingeführt hat. Der Imperativ erst schafft den Indikativ 233 zu haben, sich jeden Augenblick neu und anders erfinden, zur Geltung zu bringen, erschaffen und ins Sein rufen zu können: beispielsweise als ‚genderfluider‘ Mensch, der biologische Dispositionen zu sozialen Konstruktionen abstuft, die beliebiger, wechselnder Formbarkeit offen stehen. Die Gender-Ideologie und die ihr zugrunde liegende Theorie nähren und befeuern diese Überzeugung: Sie machen den Menschen ganz und gar zu einem – seinem eigenen und ausschließlich eigenen – Projekt. Da ist es ganz folgerichtig, dass der Auftrag, sich selbst in einem umfassenden Sinne als Entwurf eines projektierten Seins zu planen, als ein Recht, ja, als ein Menschenrecht gesehen wird. Nun kann nicht bestritten werden, dass der Mensch tatsächlich immer – auch – sein Projekt ist, weil er nie abgeschlossen, sondern – im Sinne Picos – stets unfertig zur Welt kommt. Aber der Unterschied zwischen dieser Annahme und der geschilderten Denkweise ist trotzdem unüberbrückbar: Denn entscheidend ist die Frage, ob der Mensch sich als Projekt auf der Grundlage unverfügbarer Bedingungen und Bestimmungen seines Mensch-Seins, die allerdings der Entfaltung und Ausgestaltung bedürfen, versteht, oder ob er es ablehnt, überhaupt solche unverfügbaren Voraussetzungen im Sein anzuerkennen – also im Blick auf seine Selbst-Bestimmung frei schalten und walten zu können glaubt, wie es ihm gerade in den Sinn kommt, eingegrenzt in seiner Autopoiesis bestenfalls durch widerrufbare soziale Konventionen und politischen Konsens. In diesem zuletzt beschriebenen Geist lebt heute ein großer Teil der sozialen Akteure der politischen Deliberation in den pluralistischen Demokratien. Weite Teile der Legislation und der Jurisdiktion folgen diesem Denken. Im Westen prägt dieses Denken möglicherweise eine Mehrheit, die behauptet, es gäbe kein Sein, also keine Wahrheit, sondern – im Plural – so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. „Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners“, schreiben Heinz von Foerster und Bernhard Pörksen,41 und meinen damit: Es geht nicht um das ihrer Meinung nach ohnehin aussichtslose Unterfangen, Wirklichkeit zu erkennen; es geht vielmehr um das Erschaffen von Wirklichkeit, die Erfindung und Gestaltung einer je eigenen ‚Wahrheit‘. 41 Heinz von Foerster, Bernhard Pörksen, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Gespräche für Skeptiker, Heidelberg 1999; Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld, Wie wir uns erfinden. Eine Autobiographie des radikalen Konstruktivismus, Heidelberg 1999. 234 4 Christoph Böhr Bragues Weckruf Diese Entwicklungen auf dem Weg in die Moderne nimmt Brague prüfend in den Blick – reduktiv, den Weg bis zu ersten Anfängen hin zurück verfolgend, wie konsekutiv, im Blick auf künftige Folgen dieser Entwicklungen, wobei er das individuelle Denken, das solche Entwicklung sowohl hervorbringt als auch wiederspiegelt, mit den sozialen Verhältnissen, in die Denkformen gesellschaftlich eingebettet sind, in Verbindung setzt. Auf diese Weise schreibt er die Geschichte des abendländischen Denkens neu.42 Sie wird dem Leser in ihren unterschiedlichen, oft gegenläufigen Strömung durchsichtig und begreifbar, so dass es ihm manchmal wie Schuppen von den Augen fällt, wenn er Zusammenhänge erkennt, die ihm bis dahin nie vor Augen standen. Diese ideenhistorische Arbeit ist kein Selbstzweck – obwohl sie, für sich betrachtet, schon aller Anerkennung wert ist. Brague gestaltet seine geistesgeschichtlichen Relecturen zu einem Weckruf, der dem Leser unausweichlich die durchaus abgründige Frage vorlegt: Ist das wirklich gut, so wie es gelaufen ist? Entspricht dieses Denken dem Sein des Menschen? Wollen wir nicht einmal einen Augenblick innehalten und uns fragen, ob es nicht vielleicht besser wäre, einen anderen Weg einzuschlagen – genauer hinzuschauen auf das, was im Halbdunkel des Fast-Vergessens liegt und uns deshalb nicht auf Anhieb ins Auge springt? Der normative Impetus, der Bragues Denken vorantreibt, zeigt sich nicht als erhobener Zeigefinger. Er äußert sich auch nicht im Gestus des Warners und Mahners. Brague schlüpft nicht in die Rolle der Kassandra – das wäre auch, wie wir wissen, eine vergebliche Mühe. Sein Fragen folgen in Stil und Inhalt denen von Sokrates, sie zielen auf die erwägende Prüfung dieser und jener Überzeugung, das schonungslose Aufdecken von Schwächen und die gebotene Achtung vor Stärken der unterschiedlichen Denkbewegungen. Brague ist, wie schon betont wurde, Philosoph. Und die Methode des Philosophen ist – in sokratischer Tradition – die Mäeutik, die Hebammenkunst. Die Hilfe einer Hebamme erfordert einfühlsame Umsicht und behutsame Unterstützung. Nichts anderes wird vom Philosophen verlangt: gleichermaßen einfühlsam wie behutsam nach Gründen zu fragen, Bekräftigungen und Zurückweisungen beim Gegenüber hervorzulocken, einerseits zu verunsichern, andererseits aber auch zu versichern. Philosophie ist nicht doktrinäre 42 Vgl. dazu die Trilogie von Rémi Brague, La Sagesse du Monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers, Paris 1999; dt. Die Weisheit der Welt. Kosmos und Welterfahrung im westlichen Denken, München 2006; Ders., La loi de Dieu: Histoire philosophique d’une alliance, Paris 2005; dt. Übers. i. Vorb.; Ders., Le Règne de l’homme. Genèse et échec du projet moderne, Paris 2015. Der Imperativ erst schafft den Indikativ 235 Besserwisserei, sondern reflektierende Hilfestellung – heute würde man sagen: eine Dienstleistung. Es geht dem Philosophen wie der Hebamme. Sie gibt Beistand, gebären aber muss die schwangere Frau selbst. Und ähnlich gibt der Philosoph eine Sehhilfe, hinschauen43 und zu Ende denken aber muss sein Gegenüber selbst. In dieser Hilfe zum Denken zeigt sich Bragues Verständnis seines Berufes. Die Profession des Philosophen ermächtigt diesen nicht, anderen zu sagen, wo es lang geht. Aber sie lenkt den Blick auf Tiefen und Untiefen, Schlaglöcher und Stolpersteine, Schatten und Licht auf dem beschwerlichen Weg zur Wahrheit. Zu diesen Wahrheiten zählt, dass es eine – von Brague so genannte – metaphysische Infrastruktur unseres menschlichen Lebens gibt, die auch noch in ihrer Zurückweisung anwesend bleibt. Das wird uns klar, nachdem jene Lampe angeschaltet wurde, die den zuvor im Halbdunkel liegenden Raum hell beleuchtet, so dass wir auf einmal Dinge sehen, die im Dämmerlicht nicht zu erkennen waren. Es ist das die Weise, wie Brague seine Phänomenologie versteht: Er schaltet das Licht ein, damit wir besser sehen können. Und so wird er zum Verteidiger einer Philosophie, die sich mit dem Schatten der Dämmerung, in der alle Katzen grau sind, nicht zufrieden gibt, anders gesagt: Die jeder Selbstverkürzung des Denkens abhold ist und lieber genauer hinsieht, bevor sie schlichtweg und abschließend behauptet, es gäbe gar nichts zu sehen. Und nicht alles, was uns nicht schon auf den ersten Blick ins Auge fällt, ist, wenn es bei hellerem Licht dann klarer in Erscheinung tritt, nur eine Sinnestäuschung. So kann man vielleicht sagen: Bragues Weckruf beinhaltet die Aufforderung, das Licht einzuschalten, um besser sehen zu können. Er taucht die alte Frage, wie die Bedingungen jener Beziehung, die sich zwischen der Fähigkeit des Menschen zur Erkenntnis und dem Dasein Gottes in seiner Unbegreiflichkeit aufspannt, unter den Vorzeichen des zeitgenössischen Denkens in ein neues Licht. Wer nicht weiß, wo er den Schalter findet, kann sich der Hilfe des Philosophen versichern. Aber hinschauen muss er dann selbst. Dazu fordert Brague auf – und das macht seine Philosophie so ansprechend: als ein Aufriss der Beziehung zwischen Mensch und Welt, in Achtung vor dem Selbststand des Seins, unabhängig davon, welche Gestalt wir ihm in unserem ‚antwortenden Erkennen‘ geben.44 Und dann sehen wir, neu beleuchtet, was bis dahin für uns vielleicht unsichtbar geblieben war: Mitten in diese Beziehung zwischen Mensch und Welt ist Gott gestellt. 43 Vgl. Rémi Brague, On the God of the Christians (and on one or two others), South Bend, Ind. 2013, S. 26 ff., bes. S. 35 f. 44 In Anspielung auf Richard Schaeffler, Erkennen als antwortendes Gestalten: Oder wie baut sich vor unseren Augen die Welt der Gegenstände auf?, Freiburg i. Br. u. München 2014. Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis A a. a. a. O. Abs. Anm. Art. art. B BA Bd. Bde. bes. CSSL d. i. dargest. Ders. dt. ebd. ed. eds. eingel. engl. erw. Ex ex. gr. f. ff. Erste Auflage der Schriften Immanuel Kants andere, am am angegebenen Ort Absatz Anmerkung Artikel articulus Zweite Auflage der Schriften Immanuel Kants Bibliothèque Augustinienne. Oeuvres de Saint Augustin Band Bände besonders Corpus Christianorum, Series Latina das ist dargestellt Derselbe deutsch(e Übersetzung) ebenda Herausgeber (im Singular), herausgegeben Herausgeber (im Plural) eingeleitet englisch(e Übersetzung) erweitert(e) (Buch) Exodus zum Beispiel folgende fortfolgende 237 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7 238 Fgt. Fn. frz. Gen gr. H. Hg. hg. v. i. e. i. Ersch. i. Vorb. Joh Kap. Lk Mk Mos Mt n. Chr. Neudr. N.F. Nr. orig. Ps q. S. s. s. a. sc. Sp. Sth Tl. Tle. u. u. a. u. d. T. Übers. übers. v. vgl. Z. zit. Abkürzungsverzeichnis Fragment Fußnote französisch(e Übersetzung) (Buch) Genesis griechisch Heft Herausgeber, Herausgeberin herausgegeben von id est / das ist im Erscheinen in Vorbereitung Evangelium nach Johannes Kapitel Evangelium nach Lukas Evangelium nach Markus (Fünf Bücher) Moses Evangelium nach Matthäus nach Christi Geburt Neudruck Neue Folge Nummer im Original Psalm quaestio Seite siehe siehe auch scilicet (das heißt) Spalte Summa Theologiae Teil Teile und unter anderem unter dem Titel Übersetzer, Übersetzung übersetzt von vergleiche Zeile zitiert Bibliographie Bibliographie Alferi, Thomas, Worüber hinaus Größeres nicht ‚gegeben‘ werden kann … Phänomenologie und Offenbarung nach Jean-Luc Marion, Freiburg i. Br. u. München 2007. Anders, Günther, Die Antiquiertheit des Menschen, 2 Bde., München 1956. Ders., Mensch ohne Welt. Schriften zur Kunst und Literatur, München 1984. Andersen, Svend, Ideal und Singularität. Über die Funktion des Gottesbegriffes in Kants theoretischer Philosophie, Berlin u. New York 1983. Anselm von Canterbury, Proslogion, in: S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera omnia, 6 Bde., Seckau, Rom u. Edinburgh 1938-1961, Neudr. Stuttgart-Bad Cannstatt 1968. Arendt, Hannah, The Human Condition, 1958, Chicago 1998; dt. Vita activa oder vom tätigen Leben, Stuttgart 1960. Aristoteles, De anima. Ders., Metaphysik. Ders., Nikomachische Ethik. Ders., Peri philosophias. Ders., Physik. Aubenque, Pierre, Le problème de l’être chez Aristote, Paris 1962, 21991. Augustinus, Aurelius, Bibliothèque Augustinienne. Oeuvres de Saint Augustin, Paris 1949 ff. Ders., Confessiones. Ders., Contra Academicos. Ders., De catechizandis rudibus. Ders., De trinitate. Ders., Enarrationes In Psalmos. Ders., Der Gottesstaat, 2 Bde., hg. Carl Johann Perl, Paderborn 1979. Ders., In Evg. Joh., in: Bibliothèque Augustinienne, a. a. O., Bd. 71: Homélies sur l’Évangile de saint Jean, hg. v. Marie-François Berrouard, 1969. Ders., In Joh. Tactatus. Ders., Sermones, in: Patrologia Latina, Paris 1844 ff., Bd. 38, 1865. Ders., Vingt-six Sermons au Peuple d’Afrique. Retrouvés à Mayence, hg. v. François Dolbeau, Paris 1996. 239 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7 240 Bibliographie Baladur, Rigo, Gründe, warum es uns nicht geben darf. Frontbericht von einem sterbenden Stern mit Motiven des Widerstands, Essen 1991. Barth, Karl, Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms, Zürich 31958. Beierwaltes, Werner, Das wahre Selbst. Studien zu Plotins Begriff des Geistes und des Einen, Frankfurt a. M. 2001. Benedikt von Nursia, Regula S. Benedicti. Benn, Gottfried, Gesammelte Werke, hg. v. Dieter Wellershoff, 8 Bde., Wiesbaden 1960-1968. Blaga, Lucian, Tristețe Metaphysică. / Metaphysische Traurigkeit. Gedichte. Zweisprachige Ausgabe, hg. v. Wolf Aichelberg u. Ion Acsan, Bukarest 1995. Blumenberg, Hans, Beschreibung des Menschen. Aus dem Nachlaß, hg. v. Manfred Sommer, Frankfurt a. M. 2006. Ders., Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt a. M. 1981. Böhr, Christoph, Denken am Ort der Hoffnung. Eine philosophische Reflexion auf eine theologische Tugend, in: Heimat und Fremde. Präsenz im Entzug. Festschrift für Prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, hg. v. Beate Beckmann-Zöller u. René Kaufmann, Dresden 2015, S. 181 ff. Boethius, Anicius Manlius Severinus, De consolatione philosophiae, hg. v. Ludwig Bieler, Turnhout 1957 [CSSL XCIV]. Bonitz, Hermann, Index aristotelicus, Berlin 1870. Bourgeois-Pichat, Jean, Du XXe au XXIe siècle: l’Europe et sa population après l’an 2000, in: Population 43 (1988) S. 9 ff. Brague, Rémi, Les ancres dans le ciel. L’infrastructure métaphysique, Paris 2011, 22013. Ders., Aristote et la question du monde. Essai sur le contexte cosmologique et anthropologique de l’ontologie, Paris 1988. Ders, Europa, das Christentum und die Moderne, in: Europa und die Anthropologie seiner Politik. Der Mensch als Weg der Geschichte – Zur Philosophie Karol Wojtyłas, hg. v. Christoph Böhr u. Christian Schmitz, Berlin 2016, S. 19 ff. Ders., Europa – seine Kultur, seine Barbarei. Exzentrische Identität und römische Sekundarität, hg. v. Christoph Böhr, Wiesbaden 2012. Ders., La loi de Dieu: Histoire philosophique d’une alliance, Paris 2005. Ders., Modérément moderne, Paris 2014. Ders., Öffnen und Integrieren. Wie kann Europa eine Zukunft haben?, in: Europa auf der Suche nach sich selbst, hg. v. Hermann Fechtrup, Friedbert Schulze u. Thomas Sternberg, Münster 2010, S. 193 ff. Ders., On the God of the Christians (and on one or two others), South Bend, Ind. 2013. Ders., Le propre de l’homme. Sur une légitimité menacée, Paris 2013. Ders., Le Règne de l’homme. Genèse et échec du projet moderne, Paris 2015. Ders., La Sagesse du Monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers, Paris 1999; dt. Die Weisheit der Welt. Kosmos und Welterfahrung im westlichen Denken, München 2006. Ders., Seinsgrund und Grundgebot, in: Deutsches Jahrbuch Philosophie, Bd. 4: Welt der Gründe, hg. v. Elif Özmen u. Julian Nida-Rümelin, Hamburg 2012, S. 1122-1131. Ders., Die Weisheit der Welt. Kosmos und Welterfahrung im westlichen Denken, München 2006. Ders., Jean-Yves Lacoste, La réception critique du platonisme chez les Pères de l’Eglise, Paris 1990. Bibliographie 241 Brandom, Robert, The Significance of Complex Numbers for Frege’s Philosophy of Mathematics, in: Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, 96 (1996) S. 293-315; published by Wiley on behalf of The Aristotelian Society, abrufbar unter http://www. jstor.org/stable/4545241. Brecht, Bertolt, Die Dreigroschenoper, Berlin 1928. Bruaire, Claude, Le Droit de Dieu, Paris 1974. Buck, August, Einleitung, in: Giannozzo Manetti, Über die Würde und Erhabenheit des Menschen. De dignitate et excellentia hominis, hg. v. August Buck, Hamburg 1990, S. VII ff. Bunge, Gabriel, Akedia. Die geistliche Lehre des Evagrios Pontikos vom Überdruß, Köln 1983. Cajthaml, Martin, Europe and the Care of the Soul. Jan Patočka’s Conception of the Spiritual Foundations of Europe, Nordhausen 2014. Capelle-Dumont, Philippe, Théologie et sotériologie chez Martin Heidegger. Étude critique, in: Revue des Sciences Religieuses 84/4 (2010) S. 467 ff. Cassirer, Ernst, Eidos und Eidolon. Das Problem des Schönen und der Kunst in Platons Dialogen, Hamburg 2008. Cattin, Etienne, Eckhart, Schelling, Heidegger, Paris 2012. Cervantes, Miguel de, Don Quijote, 1605/1615, hg. v. Francisco Rico, Madrid 2012; dt. Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von la Mancha, 2 Bde., Leipzig 2004. Chrétien, Jean-Louis, L’appel et la réponse, Paris 1992. Cioran, Émile M., Auf den Gipfeln der Verzweiflung, 1934, Frankfurt a. M. 1989. Ders., Die verfehlte Schöpfung, Wien 1969. Ders., Vom Nachteil, geboren zu sein, Frankfurt a. M. 1979. Cohen, Hermann, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, 1918, Wiesbaden 1988. Die Confessiones des Augustinus von Hippo. Einführung und Interpretation zu den 13 Büchern, hg. v. Norbert Fischer u. Cornelius Mayer, Freiburg i. Br. 1998. Corpus Hermeticum, 4 Bde., Paris 1954-1960. Courtine, Jean-François., Inventio analogiae. Métaphysique et ontothéologie, Paris 2005. Cramer, Konrad, Art. Erleben, Erlebnis, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, Basel 1972, Sp. 702 ff. Cugno, Alain, Jean de la Croix avec Michel Henry, in: Michel Henry, l’épreuve de la vie, hg. v. Alain David u. Jean Greisch, Paris 2000, S. 439 ff. Davidson, Donald, Epistemology Externalized, 1990, in Ders., Subjective, intersubjective, objective, a. a. O., S. 193 ff. Ders., Subjective, intersubjective, objective, Oxford 2001. Derrida, Jacques, Außer dem Namen (Post-Scriptum), in: Ders., Über den Namen. Drei Essays, hg. v. Peter Engelmann, Wien 2000, S. 63 ff. Ders., Berühren. Jean-Luc Nancy, Berlin 2007. Ders., Comment ne pas parler. Dénégations, in: Psyché. Inventions de l’autre, Paris 1987; dt. Wie nicht sprechen. Verneinungen, Wien 1989. Ders., Donner la mort, Paris 1992. Ders., Den Tod geben, in: Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida – Benjamin, hg. v. Anselm Haverkamp, Frankfurt a. M. 1994, S. 331 ff. Ders., Über den Namen. Drei Essays, Wien 2000. 242 Bibliographie Dionysios Areopagita, De mystica theologia, dt. Über die mystische Theologie, hg. v. Adolf M. Ritter, Stuttgart 1994. Ders., Die Namen Gottes, hg. v. Beate Regina Suchla, Stuttgart 1988. Dostojewski, Fjodor, Записки из подполья. / Carnets du sous-sol, 1864, hg. v. Michelle-Irène Brudny, Paris 1995; dt. Aufzeichnungen aus dem Dunkel der Großstadt, in: Aus dem Dunkel der Großstadt. Helle Nächte, hg. v. Hans Röhl, Leipzig 1922. Dubarle, Dominique, Dieu avec l’être. De Parménide à Saint Thomas. Essai d’Ontologie théologale, hg. v. Jean Greisch, Paris 1986. Duden – Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Mannheim 1966. Dühring, Eugen, Der Werth des Lebens. Eine philosophische Betrachtung, Breslau 1865. Duns Scotus, Johannes, Ordinatio I. Enders, Markus, Allgegenwart und Unendlichkeit Gottes in der lateinischen Patristik sowie im philosophischen und theologischen Denken des frühen Mittelalters, in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 3 (1998) S. 43 ff. Ders., Denken des Unübertrefflichen, in: Jahrbuch für Religionsphilosophie 1 (2002) S. 50 ff. Ders., Natürliche Theologie im Denken der Griechen, Frankfurt a. M. 2000. Ders., Ontologischer Gottesbegriff und ontologischer Gottesbeweis. Der Vernunft-Charakter des ontologischen Gottes-Begriffs und dessen Entfaltung im ontologischen Gottesbeweis, in: Gottesbeweise als Herausforderung für die moderne Vernunft, hg. v. Thomas Buchheim, Friedrich Hermanni, Axel Hutter u. Christoph Schwöbel, Tübingen 2012, S. 241 ff. Ders., Postmoderne, Christentum und Neue Religiosität. Studien zum Verhältnis zwischen postmodernem, christlichem und neureligiösem Denken, Hamburg 2010. Enuma Elish, in: James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton 1955. Eucken, Rudolf, Der Sinn und Wert des Lebens, Leipzig 1908. Europa und die Anthropologie seiner Politik. Der Mensch als Weg der Geschichte – Zur Philosophie Karol Wojtyłas, hg. v. Christoph Böhr u. Christian Schmitz, Berlin 2016. Felder, Ulrich, Apophatik als Lösungsformel für den interreligiösen Dialog? Das Konzept der negativen Theologie in den pluralistischen Religionstheorien von John Hick und Perry Schmidt-Leukel, Würzburg 2012. Ferretti, Giovanni, Ontologie et théologie chez Kant, Paris 2001. Fichte, Johann Gottlieb, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre als Handschrift für seine Zuhörer, 1794, in: Ders., Gesamtausgabe, hg. v. Reinhard Lauth u. a., Abt. I, Bd. 2: Werke 1793-1795, hg. v. Reinhard Lauth u. Hans Jacob, Bad Cannstatt 1965, S. 249 ff. Fiedrowicz, Michael, ‚Wir dienen dem Logos‘. Die Vernünftigkeit des Glaubens in der Argumentation frühchristlicher Theologen, in: Der christliche Glaube vor dem Anspruch des Wissens, hg. v. Tobias Kampmann u. Thomas Schärtl, Münster 2006, S. 1 ff. Fischer, Norbert, Unsicherheit und Zweideutigkeit der Selbsterkenntnis. Augustins Antwort auf die Frage ‚quid ipse intus sim‘ im 10. Buch der ‚Confessiones‘, in: Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität, hg. v. Reto Luzius Fetz, Roland Hagenbüchler u. Peter Schulz, 2 Bde., Berlin u. New York 1998, Bd. 1, S. 340 ff. Ders., Dieter Hattrup, Metaphysik aus dem Anspruch des Anderen, Paderborn 1999. Flasch, Kurt, Kampfplätze der Philosophie. Große Kontroversen von Augustin bis Voltaire, Frankfurt a. M. 2008. Bibliographie 243 Foerster, Heinz von, Bernhard Pörksen, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Gespräche für Skeptiker, Heidelberg 1999. Ders., Ernst von Glasersfeld, Wie wir uns erfinden. Eine Autobiographie des radikalen Konstruktivismus, Heidelberg 1999. Die Fragmente der Vorsokratiker, hg. v. Hermann Diels u. Walther Kranz, 1903, 3 Bde., Berlin 1951-1952. Frege, Gottlob, Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl, hg. v. Christian Thiel, Hamburg 1988. Ders., Über Begriff und Gegenstand, in: Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien, hg. v. Günther Patzig, Göttingen 51980, S. 66 ff. Ders., Der Gedanke. Eine logische Untersuchung, in: Logische Untersuchungen, hg. v. Günther Patzig, Göttingen 21976, S. 30 ff. Ders., Nachgelassene Schriften, hg. v. Hans Hermes, Friedrich Kambartel u. Friedrich Kaulbach, Hamburg 21983. Ders., Dialog mit Pünjer über Existenz, in: Schriften zur Logik und Sprachphilosophie. Aus dem Nachlaß, hg. v. Gottfried Gabriel, Hamburg 1978, S. 1 ff. Gabellieri, Emmanuel, De la métaphysique à la phénoménologie: une relève, in: Revue philosophique de Louvain 94/4 (1996) S. 625 ff. Gabriel, Markus, Warum es die Welt nicht gibt, Berlin 82013. Gadamer, Hans-Georg, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960, 21965. Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität, hg. v. Reto Luzius Fetz, Roland Hagenbüchler u. Peter Schulz, 2 Bde., Berlin u. New York 1998. Gilson, Étienne, L’être et l’essence, 1948, Paris 1987. Ders., L’infinité divine chez saint Augustin, in: Augustinus Magister. Extrait des Communications du Congrés international augustinien, 3 Bde., Paris 1954, Bd. 1: Communications, S. 569 ff. Ders., Introduction à la philosophie chrétienne, Paris 1960. Gire, Pierre, Maître Eckhart et la métaphysique de l’Exode, Paris 2006. Glück, Anton, Offenheit – Empfänglichkeit. Mystik und Phänomenologie, Würzburg 2012. Goethe, Johann Wolfgang von, Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust, hg. v. Erich Trunz, München 1972. Ders., Weimarer Ausgabe. Goethes Werke auf CD-ROM, Cambridge 1995. Gondek, Hans-Dieter, Lázló Tengelyi, Neue Phänomenologie in Frankreich, Frankfurt a. M. 2011. Goris, Willi, Einheit als Prinzip und Ziel. Versuch über die Einheitsmetaphysik des Opus tripartitum Meister Eckharts, Leiden 1997. Gottesbeweise als Herausforderung für die moderne Vernunft, hg. v. Thomas Buchheim, Friedrich Hermanni, Axel Hutter u. Christoph Schwöbel, Tübingen 2012. Greisch, Jean, Du Non-autre au Tout autre. Dieu et l’absolu dans les théologies philosophiques de la modernité, Paris 2012. Ders., Philosophie, poésie, mystique, Paris 1999. Grimm, Jacob, Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, 32 Bde., Leipzig 1854 ff., Neudruck 1999. Grondin, Jean, La tension de la donation ultime et de la pensée herméneutique de l’application chez J.-L. Marion, in: Dialogue 18 (1999). 244 Bibliographie Grotius, Hugo, De jure belli ac pacis Libri tres. Drei Bücher vom Recht des Krieges und des Friedens, 1625, hg. v. Walter Schätzel, Frankfurt a. M. 2008. Gundersdorf von Jess, Wilma C., Divine Eternity in the Doctrine of Saint Augustine, in: Augustinian Studies 6 (1975) S. 75 ff. Halfwassen, Jens, Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin, München 2 2006. Ders., Hegel und der spätantike Neuplatonismus. Untersuchungen zur Metaphysik des Einen und des Nous in Hegels spekulativer und geschichtlicher Deutung, Bonn 1999. Ders., Sein als uneingeschränkte Fülle. Zur Vorgeschichte des ontologischen Gottesbeweises im antiken Platonismus, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 56 (2002) S. 497 ff. Hattrup, Dieter, Die Mystik von Cassiciacum und Ostia, in: Die Confessiones des Augustinus von Hippo, a. a. O. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Sämtliche Werke, a. a. O., Bd. 7, 1952. Ders., Jenaer Schriften. 1801-1807, hg. v. Eva Moldenhauer, Frankfurt a. M. 1970. Ders., Sämtliche Werke, hg. v. Hermann Glockner, 20 Bde., Stuttgart 1927-1940. Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in: Sämtliche Werke, a. a. O., Bd. 11. Heidegger, Martin, Anmerkungen IV (1947/48), in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 97: Anmerkungen I-V. (Schwarze Hefte 1942-1948), hg. v. Peter Trawny, 2015. Ders., Augustinus und der Neuplatonismus. (Sommersemester 1921), in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 60: Phänomenologie des religiösen Lebens, hg. v. Matthias Jung, Thomas Regehly u. Claudius Strube, 1995. Ders., Besinnung, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 66: Besinnung. (1938/1939), hg. v. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 1997. Ders., Brief über den ‚Humanismus’ in: Wegmarken, a. a. O. Ders., Der Deutsche Idealismus, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 28: Der deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) und die philosophische Problemlage der Gegenwart. (Sommersemester 1929), hg. v. Claudius Strube, 2011. Ders., Gesamtausgabe, Frankfurt a. M. 1975 ff. Ders., Grundbegriffe, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 51: Grundbegriffe. (Sommersemester 1941), hg. v. Petra Jaeger, 1981. Ders., Grundprobleme der Phänomenologie. (Sommersemester 1927), in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 24: Die Grundprobleme der Phänomenologie, hg. v. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 1975. Ders., Kant und das Problem der Metaphysik, 1929, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 3: Kant und das Problem der Metaphysik, hg. v. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 1991. Ders., Kants These über das Sein, in: Wegmarken, a. a. O. Ders., Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache. (Sommersemester 1934), auf der Grundlage einer Vorlesungsnachschrift v. Wilhelm Hallwachs hg. v. Günter Seubold, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 38: Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache. (Sommersemester 1934), 1998. Ders., Sein und Zeit, 1927, Tübingen 111967. Ders., Der Sprung. Das Sein zum Tode, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 65: Beiträge zur Philosophie. (Vom Ereignis). 1936-1938, hg. v. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 1989. Ders., Vom Ereignis, in: Gesamtausgabe, a. a. O., Bd. 65: Beiträge zur Philosophie. (Vom Ereignis). 1936-1938, hg. v. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, 2003. Bibliographie 245 Ders., Wegmarken, Frankfurt a. M. 1967. Heimsoeth, Heinz, Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Dritter Teil, Berlin 1969. Henrich, Dieter, Bewußtes Leben, Stuttgart 1999. Ders., Denken und Selbstsein, Frankfurt a. M. 2007 Ders., Fichtes ursprüngliche Einsicht, Frankfurt a. M. 1966. Ders., Grundlegung aus dem Ich. Untersuchungen zur Vorgeschichte des Idealismus. Tübingen – Jena (1790–1794), Frankfurt a. M. 2004. Ders., Selbstverhältnisse, Stuttgart 1982. Henry, Michel, Die Barbarei. Eine phänomenologische Kulturkritik, Freiburg i. Br. u. München 1994. Ders., L’essence de la manifestation, Paris 1963. Ders., Hinführung zur Gottesfrage: Seinsbeweis oder Lebenserprobung?, in: Meister Eckhart – Erkenntnis und Mystik des Lebens. Forschungsbeiträge der Lebensphänomenologie, a. a. O., S. 64 ff. Ders., Die innere Struktur der Immanenz und das Problem ihres Verständnisses als Offenbarung: Meister Eckhart, in: Meister Eckhart – Erkenntnis und Mystik des Lebens. Forschungsbeiträge der Lebensphänomenologie, a. a. O., S. 13 ff. Ders., Die ontologische Bedeutung der Kritik der Erkenntnis bei Meister Eckhart, in: Meister Eckhart – Erkenntnis und Mystik des Lebens. Forschungsbeiträge der Lebensphänomenologie, a. a. O., S. 46 ff. Ders., Phénoménologie de la vie, 5 Bde., Paris 2003-2015, Bd. 1: De la phénoménologie, Paris 2003. Ders., Quatre principes de la phénoménologie, in: Revue de Métaphysique et de Morale 1 (1991) S. 3-26; ebenfalls in: Ders., Phénoménologie de la vie, a. a. O., Bd. 1, 2003, S. 77 ff. Hinske, Norbert, Kants Anverwandlung des ursprünglichen Sinnes von Idee, in: Lessico Intelletuale Europeo: Idea. VI Colloquio Internazionale, Roma 5-7 gennaio 1989, hg. v. Marta Fattori u. Massimo Luigi Bianchi, Rom 1992, S. 317 ff. Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. Joachim Ritter, Karlfried Gründer u. Gottfried Gabriel, 13 Bde., Basel 1971-2007. Horstmann, Rolf-Peter, Die Idee der systematischen Einheit. Der Anhang zur transzendentalen Dialektik in Kants Kritik der reinen Vernunft, in: Bausteine kritischer Philosophie. Arbeiten zu Kant, Bodenheim 1997. Horstmann, Ulrich, Das Untier. Konturen einer Philosophie der Menschenflucht, Wien u. Berlin 1983. Hume, David, An Enquiry Concerning Human Understanding, 1748. Ders., On the Independency of Parliament, 1741, in: Ders., Essays moral, political and literary, Oxford 1963. Hutter, Axel, Die Wirklichkeit des Geistes, in: Philosophisches Jahrbuch 115 (2008) S. 374 ff. James, William, Is Life Worth Living?, in: The Will to Believe and other essays in popular philosophy, New York 1897, S. 32 ff. Janicaud, Dominique, Le tournant théologique de la phénoménologie française, Combas 1991; dt. Die theologische Wende der französischen Phänomenologie, hg. v. Marco Gutjahr, Berlin 2014. Jean-Luc Marion. Studien zu seinem Werk, hg. v. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Dresden 2012. 246 Bibliographie Kahl-Furthmann, Gertrud, Die Ordnung der philosophischen Disziplinen, in: Philosophia perennis. Abhandlungen zu ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Festgabe Joseph Geyser zum 60. Geburtstag, 2 Bde., hg. v. Fritz-Joachim von Rintelen, Bd. 2: Abhandlungen zur systematischen Philosophie, , Regensburg 1930, S. 531 ff. Kant, Immanuel, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755. Ders., Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, 1763. Ders., Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte, 1746. Ders., Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785. Ders., Kritik der praktischen Vernunft, 1788. Ders., Kritik der reinen Vernunft, 1781. Ders., Kritik der Urteilskraft, 1790. Ders., Logik, 1800. Ders., Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio, 1755. Ders., Opus postumum, hg. v. Erich Adickes, Berlin 1920. Ders., Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, 1783. Ders., Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 1793. Ders., Der Streit der Fakultäten, 1798. Ders., Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie, 1796. Ders., Was heißt: sich im Denken orientieren?, 1786. Ders., Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht hat?, 1804. Ders., Werke in sechs Bänden, hg. v. Wilhelm Weischedel, Darmstadt 1956-1964. Ders., Zum ewigen Frieden, 1795. Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. v. der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften und Nachfolger, Berlin 1900 ff. Kierkegaard, Søren, L’Alternative, 1843, hg. v. Paul-Henri Tisseau u. Else-Marie Jacquet-Tisseau, 2 Bde., Paris 1970; dt. Entweder – Oder, 2 Bde., Düsseldorf 1964 u. 1957. Krämer, Hans Joachim, Der Ursprung der Geistmetaphysik. Untersuchungen zur Geschichte des Platonismus zwischen Platon und Plotin, Amsterdam 21967. Kraus, Karl, Der Untergang der Welt durch schwarze Magie, Wien u. Leipzig 1922. Kremer, Klaus, Die Neuplatonische Seinsphilosophie und ihre Wirkung auf Thomas von Aquin, Leiden 21969. Kreuzer, Johann, Der Abgrund des Bewusstseins. Erinnerung und Selbsterkenntnis im 10. Buch, in: Die Confessiones des Augustinus von Hippo, a. a. O. Krings, Hermann, Art. Norm I. Philosophie der Norm, in: Staatslexikon, 5 Bde., Freiburg i. Br. 71988, Bd. 3. Kritias, Sisyphos, in Die Fragmente der Vorsokratiker, hg. v. Hermann Diels u. Walther Kranz, 1903, 3 Bde., Berlin 1951-1952, Bd. 2, 1952, n 88, Fgt. B 25, S. 386 ff. Kühn, Rolf, Französische Religionsphilosophie und -phänomenologie der Gegenwart. Metaphysische und post-metaphysische Positionen zur originären Erfahrungs(un)möglichkeit Gottes, Leiden u. Boston 2013. Ders., Gabe als Leib in Christentum und Phänomenologie, Würzburg 2004. Ders., Geburt in Gott. Metaphysik, Religion, Mystik und Phänomenologie, Freiburg i. Br. u. München 2003. Bibliographie 247 Ders., Gottes Selbstoffenbarung als Leben. Religionsphilosophie und Lebensphänomenologie, Würzburg 2009. Ders., Praxis der Phänomenologie. Einübungen ins Unvordenkliche, Freiburg i. Br. u. München 2009. Ders., Radikale Phänomenologie. Heidegger, Levinas, Derrida, Marion, Frankfurt a. M. 2003. Ders., Rezension Lorenz B. Puntel: Sein und Gott, in: Jahrbuch für Religionsphilosophie 9 (2010) S. 215 ff. Ders., ‚Ungeteiltheit‘ – oder Mystik als Ab-Grund der Erfahrung. Ein radikal phänomenologisches Gespräch mit Meister Eckhart, Leiden 2012. Ders., Sébastien Laoureux eds., Meister Eckhart – Erkenntnis und Mystik des Lebens. Forschungsbeiträge der Lebensphänomenologie, Freiburg i. Br. u. München 2005. Kuhn, Helmut, Das Sein und das Gute, München 1962. Laktanz, Divinae Institutiones, hg. v. Eberhard Heck u. Antonie Wlosok, Berlin u. New York 2007. Landmann, Michael, Die Weltschöpfung im ‚Timaios‘ und in der Genesis, in: Ursprungsbild und Schöpfertat. Zum platonisch-biblischen Gespräch, München 1966, S. 142 ff. Laoureux, Sébastien, Material phenomenology to the test of Deconstruction: Michel Henry and Derrida, in: Studia Phaenomenologica 9 (2009) S. 237 ff. Le Roy Ladurie, Emmanuel, Montaillou: Ein Dorf vor dem Inquisitor 1294-1324, Frankfurt a. M. 1980. Lebensphänomenologie in Deutschland. Hommage an Rolf Kühn, hg. v. Sophia Kattelmann u. Sebastian Knöpker, Freiburg i. Br. u. München 2012. Lersch, Martin, Triplex Analogia. Versuch einer Grundlegung pluraler christlicher Religionsphilosophie, Freiburg i. Br. u. München 2009. Levinas, Emmanuel, Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Paris 1991. Ders., Gott und die Philosophie, in: Gott nennen, hg. v. Bernhard Casper, Freiburg i. Br. u. München 1981, S. 81 ff. Ders., Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie, Freiburg i. Br. u. München 31992. Ders., Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Den Haag 1961; dt. Totalität und Unendlichkeit, Versuch über die Exteriorität, Freiburg i. Br. u. München 2014. Lübbe, Hermann, Politischer Moralismus. Der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft, Berlin 1987. Lütkehaus, Ludger, Nichts. Abschied vom Sein. Ende der Angst, 1999, Frankfurt a. M. 2003. Ders., Schwarzbuch des Menschen, in: Die Zeit v. 4. September 1992. Ders., Schwarze Ontologie. Über Günther Anders, Lüneburg 2002. Machiavelli, Niccolo, Storie fiorentine, in: Tutte le opere storiche, politiche e letterarie, hg. v. Alessandro Capata, Rom 2011. Madec, Goulven, Le Dieu d’Augustin, Paris 1998. Ders., ‚In te supra me‘. Le sujet dans les ‚Confessions‘ de Saint Augustin, in: Revue de l’Institut Catholique de Paris 28 (1988) S. 45 ff. Mallock, William H., Is Life Worth Living?, New York 1899. Malter, Rudolf, Der Ursprung der Metaphysik in der reinen Vernunft. Systematische Überlegungen zu Kants Ideenlehre, in: 200 Jahre Kritik der reinen Vernunft, hg. v. Joachim Kopper u.Wolfgang Marx, Hildesheim 1981, S. 129 ff. 248 Bibliographie Manetti, Giannozzo, Über die Würde und Erhabenheit des Menschen. De dignitate et excellentia hominis, 1452, hg. v. August Buck, Hamburg 1990. Marion, Jean-Luc, Aspekte der Religionsphänomenologie: Grund, Horizont und Offenbarung, in: Religionsphilosophie heute, hg. v. Alois Halder u. Karl Kienzler, Düsseldorf 1988, S. 84 ff. Ders., Au lieu de soi. L’approche de Saint Augustin, Paris 2008. Ders., Au Nom. Comment ne pas parler de ‚theólogie négative‘, in: Laval théologique et philosophique 55/3 (1999). Ders., Au nom ou comment le taire, in: Ders., De surcroît, a. a. O., S. 155 ff. Ders., Certitudes négatives, Paris 2010; dt. Teilübers. Das dem Menschen Unmögliche – Gott, in: Unmöglichkeiten. Zur Phänomenologie und Hermeneutik eines modalen Grenzbegriffs, hg. v. Ingolf Dalferth, Philipp Stoelger u. Andreas Hunziker, Tübingen 2009, S. 233 ff. Ders., Le croire pour voir. Réflexions diverses sur la rationalité de la révélation et l’irrationalité des quelques croyants, Paris 2010. Ders., Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Paris 1998; dt. Ruf und Gabe. Zum Verhältnis von Phänomenologie und Theologie, Freiburg i. Br. u. München 2013. Ders., De surcroît. Études sur le phénomène saturé, Paris 2001. Ders., Dieu sans l’être, 1982, Paris 1991; dt. Gott ohne Sein, Paderborn 2012. Ders., Das Erotische. Ein Phänomen, Freiburg i. Br. u. München 2010. Ders., Figures de phénoménologie. Husserl, Heidegger, Levinas, Henry, Paris 2012. Ders., Gott ohne Sein, Paderborn 2012. Ders., L’idole et la distance, 1977, Paris 1991. Ders., Die Phänomenalität der Sakramente, in: Perspektiven des Lebensbegriffs. Randgänge der Phänomenologie, hg. v. Stefan Nowotny u. Michael Staudigl, Hildesheim, Zürich u. New York 2005, S. 201 ff. Ders., Questions cartésiennes, Méthode et métaphysique, Paris 1991. Ders., Questions cartésiennes II. L’ego et Dieu, Paris 1996. Ders., Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie, Paris 1989. Ders., Saint Thomas d’Aquin et l’onto-théologie, in: Revue thomiste 1 (1995) S. 31 ff. Ders., Théo-logique, in: Encyclopédie Philosophique Universelle, Bd. 1: L’Univers philosophique, hg. v. André Jacob, Paris 1989, S. 17 ff. Ders., Joseph Wohlmuth, Ruf und Gabe. Zum Verhältnis von Phänomenologie und Theologie, Bonn 2000. Maritain, Jacques, Trois Réformateurs. Luther, Descartes, Rousseau, 1925, in: Œuvres Complètes, 17 Bde., Fribourg u. Paris 1982-2008, Bd. 3, 1984. Marty, François, La naissance de la métaphysique chez Kant, Paris 1980. Ders., Symbole et discours théologique chez Kant. Le travail d’une pensée, in: Le mythe et le symbole. De la connaissance figurative de Dieu, Paris 1997, S. 55 ff. Marx, Werner, Einführung in Aristoteles’ Theorie vom Seienden, Freiburg i. Br. 1972. Meier, Georg Friedrich, Auszug aus der Vernunftlehre, Halle 1752. Meister Eckhart, Auslegung des heiligen Evangeliums nach Johannes, in: Ders., Werke II, a. a. O., S. 488 ff. Ders., Buch der göttlichen Tröstung, in: Ders., Werke II, a. a. O. Ders., Deutsche Predigten und Traktate, hg. v. Joseph Quint, München 1978. Ders., Expositio libri Genesis, in: Ders., Die lateinischen Werke, Stuttgart 1936 ff., Bd. 1, hg. v. Konrad Weiß, 1940. Ders., Kommentar zum Buch der Weisheit, hg. v. Karl Albert, Sankt Augustin 1988. Bibliographie 249 Ders., Die lateinischen Werke, 5 Bde., Stuttgart 1936 ff. Ders., Werke, 2 Bde., hg. v. Niklaus Largier, Frankfurt a. M. 1993. Meister Eckhart – Erkenntnis und Mystik des Lebens. Forschungsbeiträge der Lebensphänomenologie, hg. v. Rolf Kühn u. Sébastien Laoureux, Freiburg i. Br. u. München 2005. Milton, John, Paradise Lost, 1667. Moore, George Edward, Principia Ethica, 1903, hg. Thomas Baldwin, Cambridge 1993. Nicolaus Cusanus, Sermo XXIX, in: Opera omnia, Bd. 17, hg. v. Rudolf Haubst u. Hermann Schnarr, Hamburg 1996. Nietzsche, Friedrich, Also sprach Zarathustra, in: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, a. a. O., Bd. 4. Ders., Ecce Homo, 1889/1908, in: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, a. a. O., Bd. 6. Ders., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari, München, Berlin u. New York 1980. Oeing-Hanhoff, Ludger, Art. Abstrak/konkret, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 1, Basel 1971, Sp. 34 ff. Ollé-Laprune, Léon, Le Prix de la Vie, Paris 1894. Panofsky, Erwin, Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie, Hamburg 2008. Parmenides, Peri Physeoos, in: Die Fragmente der Vorsokratiker, hg. v. Hermann Diels u. Walther Kranz, 1903, 3 Bde., Berlin 1951-1952, Bd. 1, 1951. Pera, Marcello, Joseph Ratzinger, Ohne Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur, Augsburg 2005. Perspektiven des Lebensbegriffs. Randgänge der Phänomenologie, hg. v. Stefan Nowotny u. Michael Staudigl, Hildesheim, Zürich u. New York 2005. Petrarca, Francesco, Secretum meum, 1342, hg. v. Gerhard Regn u. Bernhard Huss, Mainz 2004. Philosophia perennis. Abhandlungen zu ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Festgabe Joseph Geyser zum 60. Geburtstag, 2 Bde., hg. v. Fritz-Joachim von Rintelen, Bd. 1: Abhandlungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. 2: Abhandlungen zur systematischen Philosophie, Regensburg 1930. Phokylides, Fgt. 9, in: Anthologia lyrica graeca, hg. Ernst Diehl, 2 Bde., Leipzig 1925, Bd. 1, 21936. Piché, Claude, Das Ideal. Ein Problem der Kantschen Ideenlehre, Bonn 1984. Pico della Mirandola, Giovanni, De hominis dignitate. Über die Würde des Menschen, 1486, hg. v. August Buck, Hamburg 1990. Pieper, Annemarie, Kant und die Methode der Analogie, in: Kant in der Diskussion der Moderne, hg. v. Gerhard Schönrich u. Yasushi Kato, Frankfurt a. M. 1996, S. 92 ff. Pieper, Josef Wahrheit der Dinge, 1944, in: Ders., Werke in acht Bänden, a. a. O., Bd. 5, 1997, S. 99 ff. Ders., Werke, 10 Bde., hg. v. Berthold Wald, Hamburg 2002-2008. Pindar, Pythia. Platon, Politeia. Ders., Sämtliche Dialoge, 7 Bde., hg. v. Otto Apelt, Leipzig 1922 u. 1923, Nachdr. Hamburg 2004. 250 Bibliographie Ders., Staat. Ders., Timaios. Plotin, Ennéades, 8 Bde., hg. v. Emile Brehier, Paris 1924-1938. Ders., Plotins Schriften, hg. v. Richard Harder, Rudolf Beutler u. Willy Theiler, Hamburg 1956-1971. Post, Werner, Kritische Theorie und metaphysischer Pessimismus. Zum Spätwerk Max Horkheimers, München 1971. Pritchard, James B., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton 1955. Proklos, In Platonis rem publicam commentarii, hg. v. Wilhelm Kroll, 2 Bde., Leipzig 1899 u. 1901. Pseudo-Longinos, Über das Erhabene, hg. v. Henri Lebègue, Paris 1939. Pseudo-Platon, Axiochos. Puntel, Lorenz B., Sein und Gott. Ein systematischer Ansatz in Auseinandersetzung mit M. Heidegger, E. Levinas und J.-L. Marion, Tübingen 2010. Ders., Struktur und Sein, Tübingen 2006. Ratzinger, Joseph, Europa in der Krise der Kulturen, in: Marcello Pera, Joseph Ratzinger, Ohne Wurzeln. Der Relativismus und die Krise der europäischen Kultur, Augsburg 2005, S. 62 ff. Ricoeur, Paul, Soi-même comme un autre, Paris 1990, S. 197; dt. Das Selbst als ein Anderer, München 1996. Ders., Das Selbst als ein Anderer, München 1996. Ders., André LaCocque, Penser la Bible, Paris 1998. Revue Internationale Michel Henry 2 (2012). Rilke, Rainer Maria, Das Stunden-Buch, 1903, in: Werke in drei Bänden, hg. v. Beda Allemann, Frankfurt a. M. 1966, Bd. 1. Roth, Ulrich, Jean-Luc Marions Weiterentwicklung der ‚Phänomenologie der Gebung‘, in: Philosophischer Literaturanzeiger 62/4 (2009) S. 397 ff. Ruhstorfer, Karlheinz, Adieu. Derridas Gott und der Anfang des Denkens, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 51 (2004) S. 123 ff. Ryle, Gilbert, The Concept of Mind, London 1949. Sacci, Alfredo, Fenomenologia e liturgia. Confronto teologico partendo da Michel Henry – Jean-Luc Marion, Madrid 2011. Saint Augustin, penseur du soi. Discussions de l’interprétation de Jean-Luc Marion, hg. v. Emmanuel Falque, Paris 2009. Sala, Giovanni B., Kant und die Frage nach Gott. Gottesbeweise und Gottesbeweiskritik in den Schriften Kants, Berlin u. New York 1990. Schaeffler, Richard, Erfahrung als Dialog mit der Wirklichkeit. Eine Untersuchung zur Logik der Erfahrung, Freiburg i. Br. u. München 1995. Ders., Erkennen als antwortendes Gestalten: Oder wie baut sich vor unseren Augen die Welt der Gegenstände auf?, Freiburg i. Br. u. München 2014. Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, Andere Deduktion der Principien der positiven Philosophie, hg. aus dem Nachlaß v. Karl Friedrich August Schelling, in: Sämtliche Werke, a. a. O., Bd. XIV, Stuttgart 1858, S. 337 ff. Ders., Philosophie der Offenbarung, hg. aus dem Nachlaß von Karl Friedrich August Schelling. In: Sämtliche Werke, a. a. O., Bde. XIII u. XIV, Stuttgart 1858. Bibliographie 251 Ders., Sämtliche Werke, hg. v. Karl Friedrich August Schelling, 14 Bde., Stuttgart u. Augsburg 1856-1861. Ders., System des transzendentalen Idealismus, 1800, in: Ders., Sämtliche Werke, a. a. O., Bd. I.3, Stuttgart u. Augsburg 1858. Schillemeit, Jost, ‚Erlebnis‘. Beobachtungen eines Literaturhistorikers zu einer Wortbildung des 19. Jahrhunderts, in: Sprache im Leben der Zeit. Beiträge zur Theorie, Analyse und Kritik der deutschen Sprache in Vergangenheit und Gegenwart, hg. v. Armin Burkhardt u. Dieter Cherubim, Tübingen 2001, S. 319 ff. Schmidt-Biggemann, Wilhelm, Philosophia perennis, Frankfurt a. M. 1998; erw. engl. Philosophia perennis, Dordrecht 2004. Schopenhauer, Arthur, Preisschrift über die Grundlage der Moral, 1841, in: Sämtliche Werke, a. a. O., Bd. 3. Ders., Sämtliche Werke, hg. v. Wolfgang von Löhneysen, 5 Bde., Darmstadt 1980. Ders., Die Welt als Wille und Vorstellung, in: Sämtliche Werke, a. a. O., Bd. 2. Schulz, Walter, Ich und Welt. Philosophie und Subjektivität, Pfullingen 1979. Ders., Das Problem der absoluten Reflexion, 1962, in: Ders., Vernunft und Freiheit, Stuttgart 1981, S. 6 ff. Ders., Vernunft und Freiheit, Stuttgart 1981. Ders., Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings, 1955, Pfullingen 21975. Searle, John, The phenomenological Illusion, 2005, in: Ders., Philosophy in a new Century, Cambridge 2008, S. 107 ff. Seidl, Horst, Realistische Metaphysik, Hildesheim, Zürich u. New York 2006. Seiffert, August, Concretum. Gegebenheit – Rechtmäßigkeit – Berichtigung, Meisenheim am Glan 1961. Serban, Claudia, Jean-Luc Marion, Certitudes négatives, in: Studia Phaenomenologica 11 (2011). Sidgwick, Henry, The Methods of Ethics, 1874, London 71907. Spaemann, Die kontroverse Natur der Philosophie, 1983, in: Ders., Philosophische Essays. Erweiterte Ausgabe, Stuttgart 1994, S. 104 ff.; Wiederabdruck in: Ders., Schritte über uns hinaus. Gesammelte Reden und Aufsätze, 2 Bde., Bd. 1, Stuttgart 2010, S. 56 ff. Ders., Der letzte Gottesbeweis, München 2007. Ders., Philosophische Essays. Erweiterte Ausgabe, Stuttgart 1994. Ders., Schritte über uns hinaus. Gesammelte Reden und Aufsätze, 2 Bde., Stuttgart 2010 u. 2011. Ders., Das unsterbliche Gerücht, Stuttgart 2007. Ders., Wirklichkeit als Anthropomorphismus, in: Grundvollzüge der Person. Dimensionen des Menschseins bei Robert Spaemann, hg. v. Hanns-Gregor Nissing, München 2008, S. 13 ff.; Wiederabdruck in: Ders., Schritte über uns hinaus. Gesammelte Reden und Aufsätze, a. a. O., Bd. 2, a. a. O., S. 188 ff. Swetnam, James, A note in idipsum in S. Augustine, in: The Modern Schoolman, 30 (1953) S. 328 ff. Swinburne, Richard, The Existence of God, Oxford 1979, 22004; dt. Die Existenz Gottes, Stuttgart 1987. Ders., Die Existenz Gottes, Stuttgart 1987. 252 Bibliographie Theis, Robert, Gott. Untersuchungen zur Entwicklung des theologischen Diskurses in Kants Schriften zur theoretischen Philosophie bis hin zum Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft, Stuttgart-Bad Cannstatt 1994. Ders., Le moment humien dans la critique kantienne de l’argument physico-théologique, in: Les soruces de la philosophje kantienne aux XVIIe et XVIIIe siècles. Actes du 6e Congrès de la Société d’Études Kantiennes de langue française, hg. v. Robert Theis u. Lukas Sosoe, Paris 2005, S. 125 ff. Ders., La raison et son Dieu. Étude sur la théologie kantienne, Paris 2012. Thomas von Aquin, De Ente et Essentia. Ders., De potentia. Ders., Die deutsche Thomas-Ausgabe, 34 Bde., Salzburg, Graz, Heidelberg, Wien u. Köln 1933 ff. Ders., In de Anima. Ders., Opera omnia, hg. v. Roberto Buso, Stuttgart u. Bad Cannstatt 1980. Ders., Quaestiones disputatae de veritate. Ders., Summa contra gentiles libri quattuor, 4 Bde., hg. v. Karl Albert u. Paulus Engelhardt, Darmstadt 2001. Ders., Summa Theologiae. Ders., Super Colossenses. Tocqueville, Alexis de, La Démocratie en Amérique, 1835 u. 1840, in: Oeuvres, hg. André Jardin, Paris 1992; dt. Über die Demokratie in Amerika, hg. v. Hans Zbinden, 2 Bde., Zürich 1987. Valentin, Johannes, Atheismus in der Spur Gottes. Theologie nach Jacques Derrida, Mainz 1997. Vattimo, Gianni, Dialettica, differenza, pensiero debole, in: Il pensiero debole, hg. v. Gianni Vattimo u. Leonardo Amoroso, Mailand 1988. Verneaux, René, Étude critique du livre ‚Dieu sans l’être‘, Paris 1986. Weil, Simone, Zeugnis für das Gute. Traktate, Briefe, Aufzeichnungen, München 1990. Weiler, Joseph H. H., Ein christliches Europa. Erkundungsgänge, Salzburg u. München 2004. Weizsäcker, Carl Friedrich von, Aufbau der Physik, München 1985. Ders., Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie, München 1977. Welsch, Wolfgang, Blickwechsel. Neue Wege der Ästhetik, Stuttgart 2012. Ders., Immer nur der Mensch? Entwürfe zu einer anderen Anthropologie, Berlin 2011. Ders., Mensch und Welt. Philosophie in evolutionärer Perspektive, München 2012. Welten, Ruud, The Night in John of the Cross and Michel Henry. A Phenomenological Interpretation, in: Studies in Spirituality 14 (2004) S. 213 ff. Williams, Bernard Arthur Owen, Imagination and the Self, 1966, in: Ders., Problems of the Self, London 1973, S. 26 ff. Ders., Problems of the Self, London 1973. Winter, Aloysius, Transzendentale Theologie der Erkenntnis, in: Der andere Kant. Zur philosophischen Theologie Immanuel Kants, Hildesheim 2000. Witte, Karl Heinz, Meister Eckharts Verständnis des richtigen Lebens, in: Lebensphänomenologie in Deutschland. Hommage an Rolf Kühn, hg. v. Sophia Kattelmann u. Sebastian Knöpker, Freiburg i. Br. u. München 2012, S. 200 ff. Wittgenstein, Ludwig, Porträts und Gespräche, hg. v. Rush Rhees, Frankfurt a. M. 1987. Bibliographie 253 Ders., Schriften, 8 Bde., hg. v. Rush Rhees u. a., Frankfurt a. M. 1960 ff. Wohlmuth, Joseph, ‚Wie nicht sprechen?‘ – Zum Problem der negativen Theologie bei Jacques Derrida, in: Gottesglaube, Gotteserfahrung, Gotteserkenntnis. Begründungsformen religiöser Erfahrung in der Gegenwart, hg. v. Günther Kruck, Mainz 2003, S. 135 ff. Wolff, Christian, De notionibus directricibus et genuino usu philosophiae primae, in: Horae subsecivae marburgenses. Trimestre vernale 1729, in: Gesammelte Werke, hg. v. Jean École u. a., II. Abt., Bd. 14.1, Hildesheim 1983. Ders., Discursus praeliminaris de philosophia in genere, in: Gesammelte Werke, hg. v. Jean École u. a., II. Abt., Bd. 1.1, Hildesheim 1983. Xenophon, Memorabilia. Zaborowski, Holger, Göttliche und menschliche Freiheit. Robert Spaemanns Philosophie des Personseins und die Möglichkeit einer Kriteriologie von Religion, in: Grundvollzüge der Person. Dimensionen des Menschseins bei Robert Spaemann, hg. v. Hanns-Gregor Nissing, München 2008, S. 55 ff. Zum Brunn, Emilie, L’exégèse augustinienne de ‚Ego sum qui sum‘ et la métaphysique de l’Exode, in: Dieu et l’Etre. Exégèses d’Exode 3, 14 et de Coran 20, 11-24, Paris 1978. Personenregister Personenregister Abraham 63, 118-121, 223 Acsan, Ion 225 Adam 200 Adams, Douglas 145 Aichelberg, Wolf 225 Albertus Magnus 40 Alferi, Thomas 89, 122 Allemann, Beda 211 Amoroso, Leonardo 33 Anders, Günther 212, 226 f. Andersen, Svend 174 Anselm von Canterbury 32, 84, 97, 102106, 108-110, 118, 122-125 Arendt, Hannah 211 Aristoteles 32 f., 40 f., 43, 47, 84, 132, 147, 154-161, 203-207, 213, 221 Aubenque, Pierre 84 Augustinus, Aurelius V f., 32, 43, 47, 4967, 84 f., 91, 102 f., 148, 195, 208 f., 225 Bacon, Francis 194 Baladur, Rigo 227 Baldwin, Thomas 192 Balthasar, Hans Urs von 57, 59 Barth, Karl 106 Bauman, Zygmunt 232 Beckmann-Zöller, Beate 225 Beierwaltes, Werner 105 Benedikt von Nursia 228 Benedikt XII., Papst 149 s. a. Jaques Fournier Benedikt XVI., Papst 216 s. a. Joseph Ratzinger Benn, Gottfried 230 Berrouard, Marie-François 51, 59 Beutler, Rudolf 160 Bianchi, Massimo Luigi 172 Biedermann, Woldemar von 132 Bieler, Ludwig 102 Blaga, Lucian 225 Blumenberg, Hans 15, 145 Böhme, Jakob 35 Böhr, Christoph X, 215, 217, 219, 225 Boethius, Anicius Manlius Severinus 32, 84, 102, 104, 206 Bonitz, Hermann 203 Bourgeois-Pichat, Jean 191 Brague, Rémi V, VII, X, 33, 35, 43, 46-49, 84 f., 127, 189, 203, 208, 215-220, 222 f., 225, 234 f. Brecht, Bert 205 Bruaire, Claude 80 Brudny, Michelle-Irène 212 Buber, Martin 198 Buchheim, Thomas IX, 1, 111 Buck, August 229 f. Bunge, Gabriel 228 Burkhardt, Armin 130 255 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7 256 Cajthaml, Martin 215 Capata, Alessandro 205 Capelle-Dumont, Philippe 77 Carnap, Rudolf 102 Casper, Bernhard 112 Cassirer, Ernst 44, 154 Cervantes, Miguel de 203 Chambry, Émile 160 Cherubim, Dieter 130 Chrétien, Jean-Louis 100 Cicero, Marcus Tullius 50, 205 Cioran, Émile M. 216, 230 f. Cohen, Hermann 168 Colli, Giorgio 121 Comte, Auguste 194 Cramer, Konrad 130 Cugno, Alain 100 Dalferth, Ingolf 89 Darwin, Charles 192, 210 David 64 David, Alain 100 Davidson, Donald 39 Derrida, Jacques IX, 67, 69-86, 88-94, 97, 101, 111, 115-122, 125 Descartes, René 34, 45, 54, 84, 113, 123, 125, 208 f. Diehl, Ernst 205 Diels, Hermann 152, 189 Dionysios Areopagita 70 f., 78 f., 81-83, 136 Doetsch, Jürgen VII Dolbeau, François 51 Dostojewski, Fjodor Michailowitsch 211 f. Dubarle, Dominique 54-57, 59, 62 f. Dühring, Eugen 192 f. Duns Scotus 108 f. Eckermann, Johann Peter 132 École, Jean 166 Empedokles 155 Enders, Markus IX, 69, 75, 97, 101 f., 104, 110, 221 Personenregister Engelmann, Peter 116 Epikur 11, 14 Eucken, Rudolf 192 f. Falque, Emmanuel 85 Fattori, Marta 172 Fechtrup, Hermann 127 Felder, Ulrich 99 Ferretti, Giovanni 175 Fetz, Reto Luzius 65 Fichte, Johann Gottlieb 38, 45 Fiedrowicz, Michael 220 Fischer, Norbert 59, 65, 175 Flasch, Kurt 225 Foerster, Heinz von 233 Fournier, Jacques 149 s. a. Benedikt XII. Frege, Gottlob 1-4, 6-9 Freud, Sigmund 64 Gabellieri, Emmanuel 89 Gabriel, Gottfried 2 Gabriel, Markus 10 Gadamer, Hans-Georg 18, 129-131 Gaunilo von Marmoutiers 104-106 Gehlen, Arnold 231 Gerl-Falkovitz, Hanna-Barbara 86, 225 Geyser, Joseph 41 Gire, Pierre 96 Gilson, Etienne 55, 57, 63, 166 Glasersfeld, Ernst von 233 Glockner, Hermann 209 Glück, Anton 100 Goebel, Bernd 106 Goethe, Johann Wolfgang von 129, 132, 195, 227 f. Gondek, Hans-Dieter 89 f. Gonsior, Katharina VIII Greisch, Jean VI, IX, 43, 56, 100, 217 Grimm, Jacob 148 Grimm, Wilhelm 148 Grondin, Jean 88 Personenregister Grosz, George 226 Grotius, Hugo 216 Gundersdorf von Jess, Wilma C. 59 Hagenbüchler, Roland 65 Halder, Alois 85 Halfwassen, Jens 102, 105 Hallwachs, Wilhelm 45 Harder, Richard 160 Hattrup, Dieter 59, 175 Haverkamp, Anselm 118 Hawking, Stephen 21 Heck, Eberhard 205 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 32, 34 f., 45, 49, 105, 116, 123, 125, 209 Heidegger, Martin 43-50, 66, 70, 74 f., 77, 79, 83, 86 f., 89 f., 92, 100, 111 f., 114, 122, 124 f., 151 f., 161, 163, 211 Heimsoeth, Heinz 174 Heine, Heinrich 129 Henrich, Dieter 38 f. Henry, Michel IX, 69, 73, 82, 85-97, 100, 111 Herder, Johann Gottfried 164 Hermanni, Friedrich 111 Hermes Trismegistos 195 Hermes, Hans 1 Herrmann, Friedrich-Wilhelm von 44, 46, 66, 151 Heyne, Moriz 148 Hick, John 99 Hinske, Norbert 172 Hölderlin, Friedrich 85, 129 Hooker, Joseph 210 Horstmann, Rolf-Peter 179 Horstmann, Ulrich 216 Hoye, William J. X, 127 Hume, David 182, 208 Hunziker, Andreas 89 Husserl, Edmund 86 f., 90, 92 Hutter, Axel 39, 111 Huxley, Thomas Henry 56 257 Isaak 63, 118, 120 f. Jacob, André 78 Jacob, Hans 38 Jacquet-Tisseau, Else-Marie 210 Jaeger, Petra 152 James, William 193 Janicaud, Dominique 89 Jardin, André 189 Jesus Christus 34, 77, 122, 228 Johannes, Evangelist 51, 58, 62, 84, 89, 98 Johannes Paul II. 223 f. s. a. Wojtyła, Karol Johannes vom Kreuz 100 Jung, Matthias 50 Kahl-Furthmann, Gertrud 41 Kambartel, Friedrich 1 Kampmann, Tobias 220 Kant, Immanuel X, 3-5, 7, 9, 12, 14-17, 21-29, 38, 44, 75, 123, 163-188, 203 f., 206-208, 237 Kato, Yasushi 188 Kattelmann, Sophia 98 Kaufmann, René 225 Kaulbach, Friedrich 1 Kienzler, Karl 85 Kierkegaard, Søren 50, 118, 210 Kleist, Heinrich von 129 Kluxen, Wolfgang 108 Knöpker, Sebastian 98 Kopper, Joachim 179 Korten, Harald 39 Krämer, Hans Joachim 105 Kranz, Walther 152, 189 Kraus, Karl 146 Kremer, Klaus 102 Kreuzer, Johann 65 Krings, Hermann 107 Kritias 189 Kroll, Wilhelm 204 Kruck, Günther 75 258 Kühn, Rolf IX, 69, 86, 88, 90, 94 f., 98 f. Kuhn, Helmut 215 Kurz, Dietrich 160 Lacoste, Jean-Yves 85 Laktanz 205 Landmann, Michael 221 Laoureux, Sébastien 90, 93 Largier, Niklaus 77, 95 Lauth, Reinhard 38 Le Roy Ladurie, Emmanuel 149 Lebègue, Henri 201 Lersch, Martin 97 Levi-Strauss, Claude 200 Levinas, Emmanuel IX, 59, 73 f., 83, 8591, 100 f., 111-116, 119-122, 124 f., 211 Lewis, David 11 Löhneysen, Wolfgang von 196 Lübbe, Hermann 229 Lütkehaus, Ludger 226 f. Luther, Martin 79, 195, 209 Lyotard, Jean-François 67 Machiavelli, Niccolò 205 Madec, Goulven 51, 54, 56, 58 f., 65 Malebranche, Nicolas 123 Mallock, William Hurrell 193 Malter, Rudolf 179 Manetti, Giannozzo 194, 229 Marcion 228, 231 Marduk 197 Marion, Jean-Luc IX, 53 f., 57 f., 60-64, 69, 78-92, 94, 97, 101, 111, 122-125 Maritain, Jacques 58, 208 f. Marty, François 174, 186 Marx, Karl 127, 136, 194, 204 Marx, Werner 155 Marx, Wolfgang 179 Mayer, Cornelius 59 Meier, Georg Friedrich 172 Meister Eckart 69 f., 76 f., 89-100, 146 Mephistopheles 227 f. Personenregister Mersenne, Marin 54 Milton, John 210 Moldenhauer, Eva 49 Monika, Mutter des Augustinus 57 Montinari, Mazzino 212 Moore, George Edward 192 Moses 56 f., 238 Nancy, Jean-Luc 79, 95 Nicolaus Cusanus 81, 135 Nida-Rümelin, Julian 33 Nietzsche, Friedrich 42, 202, 212, 229 Nissing, Hanns-Gregor 36 Noah 198, 200 Nock, Arthur Darby 195 Nowotny, Stefan 80 Oeing-Hanhoff, Ludger 135 f., 142 Özmen, Elif 33 Ollé-Laprune, Léon 193 Otto, Rudolf 88 Panofsky, Erwin 154 Parmenides 12, 62, 152-154, 158 Patočka, Jan 215 Paulus, Apostel 220, 228 Pera, Marcello 216 f. Perl, Carl Johann 208 Petrarca, Francesco 229 Philon von Alexandria 223 Phokylides 205 Piché, Claude 174 Pico della Mirandola, Giovanni 229 f., 233 Pieper, Annemarie 186 Pieper, Josef 37, 40 f., 127, 131 Pindar 202 Platon 34, 36, 40, 48-50, 55, 75 f., 83, 102, 105, 136 f., 154 f., 157 f., 160, 189, 192, 202-205, 213, 215, 221 Plotin 12, 34, 55, 102, 105, 160 Pörksen, Bernhard 233 Porphyrius 103 Personenregister Post, Werner 225 Pritchard, James B. 197 Prodikos 192 Pseudo-Dionysius 124 Pseudo-Longinos 200 Pseudo-Platon 192 Puntel, Lorenz Bruno 41, 89 Quint, Joseph 99 Quintilianus, Marcus Fabius 155 Ratzinger, Joseph 216 s. a. Benedikt XVI. Regehly, Thomas 50 Rhees, Rush 49 Rico, Francisco 203 Ricoeur, Paul 46-48, 59, 67 Rilke, Rainer Maria 211 Rintelen, Fritz-Joachim von 41 Ritter, Adolf M. 71 Röhl, Hans 212 Ross, William David 204 Roth, Ulrich 89 Rousseau, Jean-Jacques 209 Ruhstorfer, Karlheinz 116 f. Ryle, Gilbert 39 Sacci, Alfredo 86 Sala, Giovanni B. 174 Schaeffler, Richard IX, 15, 28, 235 Schärtl, Thomas 220 Schätzel, Walter 216 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 4 f., 12 f., 35, 39, 45, 100, 123 Schelling, Karl Friedrich August 4 Schillemeit, Jost 130 Schiller, Friedrich 21, 129 Schindler, Frank VIII Schleiermacher, Friedrich 160 Schmidt-Biggemann, Wilhelm 41 Schmidt-Leukel, Perry 99 Schönrich, Gerhard 186 259 Schopenhauer, Arthur 192, 196, 205, 207 Schulz, Peter 65 Schulz, Walter 39 Schulze, Friedbert 127 Schwöbel, Christoph 111 Scotus Eriugena, Johannes 81, 104 Searle, John R. 36 Seidl, Horst 41 Seiffert, August 135 Serban, Claudia 89 Seitschek, Hans Otto IX, 31 Seubold, Günter 45 Sidgwick, Henry 196 Sokrates 215, 221, 234 Solignac, Aimé 59 Sommer, Manfred 145 Sosoe, Lukas 182 Spaemann, Robert 32, 36 f., 42 Staudigl, Michael 80 Sternberg, Thomas 127 Stoelger, Philipp 89 Strube, Claudius 45, 50 Suchla, Beate Regina 83 Swetnam, James 60 Swinburne, Richard 32, 43 Tengelyi, Lázló 89 f. Theiler, Willy 160 Theis, Robert X, 163, 166, 175, 182 Thomas von Aquin 32, 37, 40 f., 56, 61, 63, 81, 84, 97, 102, 128, 130-134, 137, 141-143, 146, 154, 161, 209, 222 Tisseau, Paul-Henri 210 Tocqueville, Alexis de 189 Trawny, Peter 151 Trojahn, Dominicus X, 145 Valentin, Johannes 72 Vattimo, Gianni 33, 40 Verneaux, René 84 Victorinus, Marius 103 Voltaire, François-Marie Arouet de 225 260 Vorländer, Karl 207 Wald, Berthold 37, 131 Weischedel, Wilhelm 204 Weil, Simone 97 f. Weiler, Joseph H. H. 223 f. Weiß, Konrad 146 Weizsäcker, Carl Friedrich von 134, 138140 Wellershoff, Dieter 230 Welsch, Wolfgang 40 Welten, Ruud 100 Williams, Bernard 39 Winter, Aloysius 186 Witte, Karl Heinz 98 Wittgenstein, Ludwig 43, 47, 49, 61 Wlosok, Antonie 205 Wohlmuth, Joseph 75, 86 Wojtyła, Karol 217, 223 f. s. a. Johannes Paul II., Papst Wolff, Christian 165-167, 169 Xenophon 192 Zaborowski, Holger 37 Zbinden, Hans 190 Ziche, Paul 39 Zum Brunn, Emilie 59 Personenregister Sachverzeichnis Sachverzeichnis A D Acedia 228, 229 Agnostizismus 56 Anthropologie 6, 44, 45, 47, 200, 223, 226, 231 - europäische 223 Anthropomorphismus - dogmatischer 186 - regulativer 186 f. - symbolischer 186 Antihumanismus 46 Apophatik 73, 76, 79-82, 87, 90 Atheismus 80 Autopoiesis - des Menschen 210, 224, 229, 231-233 Differänz 69-71, 74 f., 78 f., 92 Differenz - ontologische 44 B Begriff - und Gegenstand 2, 6 f. Begriffe - der reinen Vernunft: Siehe Ideen - transzendentale: Siehe Ideen Buddhismus 90 C E Entelechie 151 Epoché 90, 92, 96 Erkenntnis - objektiv gültige 29 f. Erste Philosophie 40, 48, 155, 157 Europa - und das Christentum 220 - und sein Begriff 219, 222 - und seine Identität 219 - und seine Sekundarität 219 f., 222 Existenz 1-14, 137, 141 f., 167, 175 - der Menschheit 193 - des Menschen 5, 33 - gedachte 180 - Gottes 31 f., 35, 51, 72, 102, 134, 143, 168, 178 - Selbstgewissheit der - 45 - und Washeit 142 Existenzurteil 3 f. Christentum 90, 195, 209, 217, 220-222, 229 261 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7 262 G Gewissen 23 f., 37 Glaube - als Lebensnotwendigkeit 189 - und Wissen 163, 178 Gott 5 f., 20, 22 f., 25, 27-30, 32, 34, 50 f., 54, 57, 61 f., 66 f., 70 f., 73-76, 79, 80 f., 83-88, 91, 95, 97-100, 105, 107, 109, 112-114, 116 f., 119, 132-135, 137 f., 145 f., 160 f., 163168, 170, 177, 186-188, 200, 202, 216, 218, 220 f., 228 f., 235 - als Grund 31 f., 34 f., 42, 117, 183, 186, 188 - als Grund des Seins 31, 73, 132, 145 - als Schöpfer 6, 20, 26, 31, 34, 60, 134, 146, 195, 210, 213, 216, 228, 230 f. - das Erste Seiende 49 - Gottesname 67, 81-83, 85 - jenseits des Seins 161 - Namen Gottes 63, 70, 116, 117 f. - Substanz Gottes 54, 62, 167 - und die Geschichte 145 - und Sein 5, 31, 70, 75-77, 80, 83, 103, 105, 111 f., 115 f., 125, 133, 142 - und seine Alterität 71 - und seine Aseität 31, 46 - und seine Atopik 72 - und seine Erkennbarkeit 56, 142 - und seine Erkenntnis 128, 223 - und seine Existenz 29, 31 f., 42 - und seine Selbstgebung 72 - und seine Selbstheit 64 - und seine Selbstoffenbarung 72 - und seine Transzendenz 74 - und seine Unerkennbarkeit 84, 87, 124, 127 f., 134 f., 138, 142 f., 188, 235 - und sein Selbstvergessen 91 - und Unendlichkeit 55 - und Wahrheit 127 - Vernunftbegriff von - 101 Sachverzeichnis - vieldeutig und vielnamig 52 - Wesensattribute 109 Gottesbegriff 88, 107, 113, 116, 122 f., 142, 170, 194 - der endlichen Vernunft 109 - der Vernunft 106, 109 f. - ikonischer 125 - monotheistischer 107 - noetischer 56 - ontologischer 56, 80, 101-104, 106113, 115, 120, 122-125, 145 - rationaler 102 - sein epistemischer Status 110 Gottesbeweis 134 - ideentheoretischer 125 - kosmologischer 183 - ontologischer 31, 97, 110, 113, 123, 183, 225 - physikotheologischer 182 f. Gotteserfahrung 127, 142 f. Gotteserkenntnis - philosophische 101, 125 Gotteserstaunen 134 Gottesfrage - philosophische 20, 86 Gottesname 88 Gute - als moralischer Begriff 205 - als schöpferisches Prinzip 213 - Begriff des - 203 - des Seienden 197 - Idee des - 203, 213 - Notwendigkeit des - 203-206, 213 H Hermeneutik der Selbstheit 58 Hermeneutik des Selbst 44 f., 47, 49 Humanismus 46, 99 - Abbau des - 194 - atheistischer 195 Sachverzeichnis I Ideal - transzendentales 163, 174-176 Ideen - transzendentale 172 f., 175, 177, 179 f. Ideenlehre Kants 171, 187 Ideenlehre Platons 136 f., 154 f., 203 Idolatrie 23, 28 f., 84 Ikonoklasmus 28 f. Islam 90 J Judentum 90, 168, 219 f., 222 K Konstruktivismus - radikaler 232 f. L Licht - als Metapher des Seins 201 Liebe - göttliche 95 M Mäeutik 234 Manichäismus 65 Mensch 43-46, 64, 67, 131 f., 139, 145, 147, 193-195, 200, 206 f., 212, 216, 230 - als Dasein 44 - als Kulturwesen 147 - als soziale Konstruktion 232 f. - anthropologischer Begriff des - 47 - der Moderne 149 - ein missratenes Geschöpf 5, 216, 227 f., 230 f. - genderfluid 233 - Lebensrecht des - 6 - ontologisches Fundament des - 7, 45 - und der Wert seines Lebens 192 f., 195 263 - und die Legitimität seines Daseins 193, 195, 202 - und Freiheit 34 - und Gott 5 f., 146 - und Sein 5, 7, 43, 231 f., 234 - und seine Autopoiesis Siehe Autopoiesis: - des Menschen - und seine metaphysische Infrastruktur 7, 235 - und seine Natur 194 - und seine Selbstheit Siehe Selbstheit: - des Menschen - und seine Würde 34, 192, 194, 224, 227, 229 f. - und sein Überleben 190-192, 213 - und Wahrheit 130, 133, 140 - und Wirklichkeit 130 Metaphysik 6 f., 40, 42-44, 48, 62 f., 66, 79-81, 83-86, 89 f., 92, 107, 110112, 124, 134, 151, 153-158, 164167, 172, 178, 181, 202, 206, 230 - des Daseins 44 f. - klassische 125, 208 - kritizistische 169 - metaphysische Infrastruktur des Menschen 7, 235 - metaphysische Traurigkeit 225, 228, 231 - spezielle 169 - und Phänomenologie 69 Metaphysikkritik 111, 114, 125 Moderne - liquide 232 Moralismus - politischer 229 Mystik 69 f., 72, 74, 77 f., 80 f., 85, 89 f., 93-96, 225 - apophatische 117 - phänomenologische 96 - religionsphänomenologische 99 f. 264 Sachverzeichnis N S Natalität 211 Neoplatonismus 49 f., 56, 60, 102 f., 105, 143, 206 Nichts - als der Sinn von Sein 151 Säkularismus 147 Sein - als Gebot 202 - als Grund 6 - als ontologische Bestimmung 231 - als Sinnkreis 147 - das Ganze des - 161 - des Seienden 156, 159 - Grund des - 5-7 - grundloses 160 - Illegitimität des - 197 - Imperativ zum - 5, 200-202, 215 - in der Zeit 152 - Indikativ des - 5, 202, 215 - in Möglichkeit und Verwirklichung 159 - und Dasein 6, 162 - und das Gute 206, 215, 218, 220-222, 224 f. - und Nichts 152 f. - und Nicht-Sein 153, 158, 225, 230 - und sein Selbststand 235 - und Wahrheit 153, 233 Selbstheit des Menschen 47, 49, 67, 217 Skeptizismus 28, 39 Sokratismus 223 Staunen 132-134, 138 Subjekt 18, 26 f., 34, 38 f., 130 f., 150, 153, 173, 206 f., 210, 213, 223 Subjektivität 26, 38 f., 65, 92 f. Substanz 156, 159, 380 Sufismus 90 O Ökonomie des Himmels 120, 121 Ontogenese 151 Ontologie 44 f., 56, 59, 62 f., 89, 152, 158-160, 163, 165-169, 176, 202, 215, 229 - Aporien der - 80 - der Bibel 202 - der Sorge 47 - Fundamentalontologie 44 - klassische 111 - ontologische Unbestimmtheit 231 - schwarze 226 f. Ontotheologie 49, 66, 70, 85, 89, 112, 124 f., 166, 173 P Philosophische Theologie 55, 178, 221 Phrónesis 43 Physikotheologie 182, 184 Politische Religionen 228 Postmetaphysik 6, 226 Postmoderne 7, 33, 40, 65, 75, 110, 226 Postulatenlehre Kants 21-24, 27-29 R Reduktion - apophatische 70 Religionsphänomenologie - apophatische 69 Reziprozität 120 T Teleologie 97, 181 - als Propädeutik zur Theologie 183 - moralische 184 Theologie - apophatische 86 - christliche 80 - doktrinale 188 Sachverzeichnis - Ethikotheologie 184 - liberale 148 - mystische 82, 87, 89 - natürliche 165, 167, 169, 221 - negative 70, 74, 78-81, 91-97, 105 f., 109, 115, 122 f., 125 - ontologische 165 - philosophische 55, 178, 221 - Physikotheologie 182-185 - postulatorische 30 - rationale 164, 221 - transzendentale 15, 25, 29 f., 177, 185 Transhumanismus 212 Transzendentalien 206, 218, 222 - und ihre Konvertibilität 206 Transzendentalphilosophie 17, 19 f., 2530, 32, 38-40, 180 Transzendenz 71 f., 76, 82, 88, 92, 97, 105, 109, 111 f., 114 f., 122 f., 134, 137, 148, 160 - unaufgeklärte 94 265 V veluti si Deus daretur 216, 218 Vernunft - dogmatische 168 - und das Unbedingte 169 Verstandesbegriffe 163 W Wahrheit - und Wirklichkeit 130 Würde des Menschen Siehe Mensch: - und seine Würde Z Zen 90 Zu den Verfassern Zu den Verfassern Böhr, Christoph, Professor Dr., geboren 1954, ao. Professor am Institut für Philosophie der Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz / Wien, arbeitete nach seinem Studium der Philosophie, Politikwissenschaft, Germanistik und Neueren Geschichte zunächst im Wissenschaft lichen Dienst des Deutschen Bundestages sowie als Mitarbeiter an der Universität und war von 1987 bis 2009 Abgeordneter – und Oppositionsführer – im Landtag. Er wurde mit einer Arbeit über die Philosophie für die Welt promoviert; 2013 erfolgte seine Berufung zum Permanent Fellow des Collegium Artes Liberales / Institute for Advanced Studies in the Humanities and the Social Sciences der Vytautas Magnus Universität, Kaunas/Litauen. Böhr ist Herausgeber der Reihe Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, Wiesbaden 2012 ff., bisher 10 Bände, der Wojtyła-Studien, Berlin 2016 ff., sowie Mitglied im International Editorial Advisory Board der Zeitschrift Ethos, Lublin. Neben einer Vielzahl von Zeitungsbeiträgen und Aufsätzen liegen von ihm zahlreiche Buchveröffentlichungen zu philosophischen und politischen Fragen vor, zuletzt: Philosophie für die Welt. Die Popularphilosophie der deutschen Spätaufklärung im Zeitalter Kants, Stuttgart-Bad Cannstatt 2003; Der Maßstab der Menschenwürde. Christlicher Glaube, ethischer Anspruch und politisches Handeln, Köln 2003; Gesellschaft neu denken, Frankfurt am M. 2004; Arbeit für alle – kein leeres Versprechen; Köln 2005; Friedrich Spee und Christian Thomasius. Über Vernunft und Vorurteil. Zur Geschichte eines Stabwechsels im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert, Trier 2005, 2006; Eine neue Ordnung der Freiheit, Osnabrück 2007 (Mitherausgeber und Koautor); Facetten der Kantforschung. Ein internationaler Querschnitt, Stuttgart-Bad Cannstatt 2011 (Mitherausgeber und Koautor); Glaube, Gewissen, Freiheit. Lord Acton und die religiösen Grundlagen der liberalen Gesellschaft, Wiesbaden 2015 (Mitherausgeber und Koautor); Die Verfassung der Freiheit und das Sinnbild des Kreuzes. Das Symbol, seine Anthropologie und die Kultur des säkularen Staates, Wiesbaden 2016 (Herausgeber und Koautor); Europa und die Anthropologie seiner 267 © Springer Fachmedien Wiesbaden 2017 C. Böhr (Hrsg.), Zum Grund des Seins, Das Bild vom Menschen und die Ordnung der Gesellschaft, DOI 10.1007/978-3-658-15144-7 268 Zu den Verfassern Politik. Der Mensch als Weg der Geschichte – Zur Philosophie Karol Wojtyłas, Berlin 2016 (Mitherausgeber und Koautor). Brague, Rémi, Professor Dr., geboren 1947, Promotion 1976 und Habilitation 1986 in Philosophie, unterrichtete von 1972 bis 1976 als Gymnasiallehrer, war sodann von 1976 bis 1988 Forschungsbeauftragter, im Wintersemester 1979/1980 Visiting Associate Professor im Department of Philosophy an der Pennsylvania State University, Stipendiat der Alexander-von-Humboldt Stiftung am Thomas-Institut der Universität Köln von 1987 bis 1988, lehrte als Professor – und Gastprofessor – an den Universitäten Dijon, Lausanne, Boston, Navarra, San Rafaele, Mailand; von 1990 bis 2010 bekleidete er einen Lehrstuhl an der Universität Panthéon-Sorbonne in Paris; von 2002 bis 2012 war er Inhaber des Guardini Lehrstuhls und Professor für Religionswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der europäischen Religionsgeschichte und der christlichen Weltanschauung an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Brague ist Honorarprofessor der Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz / Wien, seit 2009 Mitglied des Institut de France – Académie des Sciences Morales et Politiques, Träger zahlreicher Auszeichnungen, so zuletzt des Josef-Pieper Preises, 2009, des Grand prix de philosophie de l’Académie Française, 2009, des Premio Joseph Ratzinger, 2012, des Aquinas Medal der American Catholic Philosophical Association, 2015, und des Madame de Staël Prize for Cultural Values der All European Academies, 2016. Von seinen Buchveröffentlichungen, die bis heute in achtzehn Sprachen übersetzt wurden, seien hier in Auswahl erwähnt: Le Restant. Supplément aux commentaires du Ménon de Platon, Paris 1978, 1999; Du temps chez Platon et Aristote. Quatre études, Paris 1982, 1995, 2003; Aristote et la question du monde. Essai sur le contexte cosmologique et anthropologique de l’ontologie, Paris 1988, 2001, 2009; Europe, la voie romaine, Paris 1992, 1993, 1999, 2005; La Sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers, Paris 1999, 2002; Introduction au monde grec. Études d’histoire de la philosophie, Chatou 2005, Paris 2008; La Loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance, Paris 2005, 2008; Au moyen du Moyen Age. Philosophies médiévales en chrétienté, judaïsme, islam, Chatou 2006, Paris 2008; Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux autres, Paris 2008, 2009; Image vagabonde. Essai sur l’imaginaire baudelairien, Chatou 2008; Les Ancres dans le ciel. L’infrastructure métaphysique, Paris 2011, 2013; Le Propre de l’homme. Sur une légitimité menacée, Paris 2013, 2015; Modérément moderne, Paris 2014; Le Règne de l’homme. Genèse et échec du projet moderne, Paris 2015; Où va l’histoire? Paris 2016. Zudem ist Brague Übersetzer und Herausgeber mehrerer Bücher, unter anderem: Herméneutique et ontologie. Mélanges en l‘honneur de P. Aubenque à l‘occasion de son 60e anniversaire, Paris Zu den Verfassern 269 1990, gemeinsam mit Jean-François Courtine; Saint Bernard et la Philosophie, Paris 1993; Die Macht des Wortes, München 1996, gemeinsam mit Tilo Schabert; Paul Kraus, Alchemie, Ketzerei, Apokryphen im frühen Islam. Gesammelte Aufsätze, Hildesheim 1994. Buchheim, Thomas, Professor Dr., geboren 1957, Professor der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Geschäftsführender Herausgeber des Philosophischen Jahrbuchs der Görresgesellschaft, Mitglied der Schelling-Kommission und Mitherausgeber der historisch-kritischen Schellingausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften; Mitinitiator und Gründungsmitglied des Munich Center of Neurosciences (MCNLMU). Schwerpunkte seiner Arbeit liegen auf den Gebieten der Metaphysik – Philosophie der Freiheit, Begriff der Seele und der Person, der Ontologie – Naturphilosophie, Begriff der lebendigen Substanz, der Antiken Philosophie, besonders bei Aristoteles, den Vorsokratiker und der Sophistik, sowie der Klassische deutsche Philosophie (Leibniz, Kant, Schelling). Nach dem Studium der Philosophie, Gräzistik und Soziologie in München war er von 1993 bis 1999 Professor für Philosophie in Mainz und ist seit 2000 Ordinarius an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Von seinen zahlreichen Buchveröffentlichungen seien hier in Auswahl erwähnt: Die Sophistik als Avantgarde normalen Lebens, Hamburg 1986; Eins von Allem. Die Selbstbescheidung des Idealismus in Schellings Spätphilosophie, Hamburg 1992; Die Vorsokratiker. Ein philosophisches Porträt, München 1994; Aristoteles, Freiburg 1999; Unser Verlangen nach Freiheit, Hamburg 2006; als Herausgeber: Gorgias von Leontinoi: Reden, Fragmente, Testimonien, Griechisch-Deutsch, Hamburg 1989, 2012; F.W.J. Schelling: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, Hamburg 1997; Kann man heute noch etwas anfangen mit Aristoteles?, Hamburg 2003 (zusammen mit Helmut Flashar u. Richard A. King); Das Leib-Seele-Problem, München 2006 (zusammen mit Friedrich Hermanni); Freiheit auf Basis von Natur?, Paderborn 2007 (zusammen mit Torsten Pietrek); Aristoteles: Über Werden und Vergehen, übersetzt und erläutert, Berlin 2010; Gottesbeweise als Herausforderung der modernen Vernunft, Tübingen 2012 (zusammen mit Friedrich Hermanni, Axel Hutter u. Christoph Schwöbel); zahlreiche Aufsätze. Enders, Markus, Professor Dr., geb. 1963, von 1983 bis 1989 Studium der Katholischen Theologie, Philosophie, Christliche Religionsphilosophie und Religionsgeschichte, der Gräzistik und der Germanistik – Mediävistik – an der Albert-Ludwigs-Universität 270 Zu den Verfassern in Freiburg i. Br., 1988 Magister Artium, 1889 Diplom im Fach Katholische Theologie, 1991 Promotion im Fach Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München; 1997 Habilitation, 1999 Promotion zum Dr. theol., Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 2000 Ruf auf den Lehrstuhl für Christliche Religionsphilosophie an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br., seit 2001 Inhaber dieses Lehrstuhls; von 2002 bis 2010 Herausgeber des Jahrbuchs für Religionsphilosophie, seit 2004 zusammen mit Bernhard Uhde Herausgeber der monographischen Schriftenreihe Scientia et Religio S & R. Studien zu Philosophie und Religion; Gastprofessuren in Spanien, Japan und Chile; seit 2008 Herausgeber des Heinrich-Seuse-Jahrbuchs. Zeitschrift für eine interdisziplinäre Erforschung der Spiritualität Heinrich Seuses und der Deutschen Mystik, seit 2009 Adjunct Professor für am Department for Philosophy der Memorial University in St. John’s, Neufundland, Herausgeber der Schriftenreihe Scientia mystica. Studien zur christlichen und außerchristlichen Mystik, Münster, und Mitherausgeber – zusammen mit Georg Steer – der Deutschen Werke Meister Eckharts; seit 2011 Mitherausgeber – zusammen mit Holger Zaborowski – des Jahrbuchs für Religionsphilosophie/Religion of Philosophy Annual, Freiburg i. Br. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen zählen in Auswahl: Das mystische Wissen bei Heinrich Seuse, Paderborn, München, Wien u. Zürich 1993; Wahrheit und Notwendigkeit. Die Theorie der Wahrheit bei Anselm von Canterbury im Gesamtzusammenhang seines Denkens und unter besonderer Berücksichtigung seiner antikenQuellen (Aristoteles, Cicero, Augustinus, Boethius), Leiden, NewYork u. Köln 1999; Transzendenz und Welt. Das daseinshermeneutische Transzendenz- und Weltverständnis Martin Heideggers auf dem Hintergrund der neuzeitlichen Geschichte des Transzendenz-Begriffes, Frankfurt a. M., Berlin u. Bern 1999; Natürliche Theologie im Denken der Griechen, Frankfurt a. M. 2000; La teología natural en el pensamiento de los griegos, Cordoba 2010; Gelassenheit und Abgeschiedenheit. Studien zur Deutschen Mystik, Hamburg 2008; Zum Begriff der Unendlichkeit im abendländischen Denken. Unendlichkeit Gottes und Unendlichkeit der Welt, Hamburg 2009; Postmoderne, Christentum und Neue Religiosität. Studien zum Verhältnis zwischen postmodernem, christlichem und neureligiösem Denken, Hamburg 2010; Philosophie der Religionen im Mittelalter. Christliche Denker von Anselm bis Cusanus im Gespräch mit Judentum und Islam, Freiburg i. Br. u. München 2016; als Herausgeber: Anselm von Canterbury, Über die Wahrheit, Hamburg 2002, 2003; Phänomenologie der Religion. Zugänge und Grundfragen.Akten des internationalen religionsphilosophischen Kongresses Freiburg im Breisgau 2003, Freiburg i. Br. u. München 2004 – zusammen mit Holger Zaborowski – ; Gustav Siewerth, Erziehende und bildende Liebe, Konstanz 2005 – zusammen mit Jan Szaif – ; Die Geschichte des philosophischen Begriffs der Wahrheit, Berlin 2006; Bernhard Welte. Gesammelte Schriften II/1: Denken in Zu den Verfassern 271 Begegnung mit den Denkern I: Meister Eckhart, Thomas von Aquin, Bonaventura, Freiburg, Basel u. Wien 2007; Bernhard Welte. Gesammelte Schriften III/2: Kleinere Schriften zur Philosophie der Religion, Freiburg, Basel u. Wien 2008; ‚Im Anfang war der Logos … ‘. Studien zur Rezeptionsgeschichte des Johannesprologs von der Antike bis zur Gegenwart, Freiburg, Basel u. Wien 2011 – zusammen mit Rolf Kühn – ; Bernhard Welte. Gesammelte Schriften VI: Gesamtregister zu den Abteilungen I bis V, Freiburg, Basel u. Wien 2011 – in Zusammenarbeit mit Bernhard Casper und den Mitherausgebern der Gesammelten Schriften von Bernhard Welte – ; Kritik gegenwärtiger Kultur. Phänomenologische und christliche Perspektiven, Freiburg i. Br. u. München 2013 – zusammen mit Rolf Kühn – ; Immanenz & Einheit. Festschrift zum 70. Geburtstag von Rolf Kühn, Leiden u. Boston 2015; Meister Eckhart und Bernhard Welte. Meister Eckhart als Inspirationsquelle für Bernhard Welte und für die Gegenwart, Münster u. Berlin 2015; Michel Henry. Radikale Religionsphänomenologie. Beiträge 1943-2001, Freiburg i. Br. u. München 2015 – zusammen mit Rolf Kühn – ; Meister Eckhart interreligiös. Meister Eckhart-Jahrbuch, Stuttgart 2016 – zusammen mit Christine Büchner u. Dietmar Mieth –; zahlreiche Aufsätze. Greisch, Jean, Professor Dr., geboren am 27. August 1942 in Koerich, Großherzogtum Luxemburg, Studium de Philosophie und Theologie in Luxemburg, Innsbruck und Paris; Promotion in Philosophie 1985, Habilitation 1990 an der Universität Straßburg; Enseignant-Chercheur attaché au Centre National de la Recherche Scientifique, Archives Husserl; Lehrstuhl für Ontologie und Metaphysik an der Philosophischen Fakultät des Institut Catholique in Paris von 1976 bis 2007, emeritiert im Jahre 2007. Titular der Hans-Georg Gadamer-Chair in Boston College, USA, 2007, Titular der Chaire Cardinal Mercier in Louvain-la-Neuve, 2007, Titular der Chair for Christian Philosophy an der Villanova-University, USA, 2008, Titular des Romano-Guardini-Lehrstuhls an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin von 2009 bis 2012. Greisch ist Mitglied des Institut International de Philosophie, Mitglied des Comité Editorial Paul Ricoeur, sowie Gründungsmitglied der Société francophone de philosophie de la religion. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen zählen: Herméneutique et Grammatologie, Paris 1977; L’Âge herméneutique de la Raison. Paris 1985; La Parole Heureuse. Martin Heidegger entre les choses et les mots, Paris 1987; Hermeneutik und Metaphysik. Eine Problemgeschichte, München 1993; Ontologie et Temporalité. Esquisse d’une interprétation intégrale de ‚Sein und Zeit‘, Paris 22002; japanisch 2006; L’arbre de vie et l’arbre du savoir; Paris 2000; Le Cogito herméneutique. L’herméneutique philosophique et l’héritage cartésien, Paris 2000, spanisch El Cogito Herido. La herméneutica filosofica y la herencia cartesiana, Buenos Aires 2001; Paul Ricoeur. 272 Zu den Verfassern L’itinérance du sens. Grenoble 2001; Le Buisson ardent et les Lumières de la Raison. L’invention de la philosophie de la religion, Bd 1: Héritages et héritiers du 19e siècle, Paris 2002; Bd 2: La Scène contemporaine, 2002; Bd 3: Vers un paradigme herméneutique, 2004; spanische und arabische Übersetzung in Vorbereitung; Entendre d’une autre oreille. Les enjeux philosophiques de l’herméneutique biblique, Paris 2006; Qui sommes-nous? Chemins phénoménologiques vers l’homme, Leuven 2009; Fehlbarkeit und Fähigkeit. Paul Ricoeurs philosophische Anthropologie, Münster 2009; Du non-autre au tout-autre. Dieu et l’absolu dans les théologies philosophiques de la modernité, Paris 2012 – ausgezeichnet mit dem Prix La Bruyère der Académie Française im Jahr 2013; Vivre en philosophant. Expérience philosophique, exercices spirituels et thérapies de l’âme, Paris 2015; L’herméneutique comme sagesse de l’incertitude, Paris 2015; zahlreiche Aufsätze. Hoye, William J., Professor Dr., geboren 1940 in den USA, lehrt seit 1980 Systematische Theologie, insbesondere Theologische Anthropologie, an der Universität Münster. Er hat in Boston, Straßburg, München und Münster – als Schüler von Karl Rahner – studiert; in Mainz und Halle hat er Philosophie, in Mainz, Landau, Bielefeld und Milwaukee (USA) Theologie gelehrt; Gastprofessuren in Milwaukee an der Marquette University und in Rom, S. Anselmo; Gastforscher an der Columbia University, New York, der Catholic University of America, Washington, D. C., und der Marquette University, Milwaukee. Zu seinen Veröffentlichungen zählen unter anderem: Gotteserfahrung? Klärung eines Grundbegriffs der gegenwärtigen Theologie, 1993; Demokratie und Christentum. Die christliche Verantwortung für demokratische Prinzipien, 1999; Die mystische Theologie des Nicolaus Cusanus, 2004; Liebgewordene theologische Denkfehler,2006; Tugenden. Was sie wert sind, warum wir sie brauchen, 2010; Die Wirklichkeit der Wahrheit. Freiheit der Gesellschaft und Anspruch des Unbedingten, Wiesbaden 2013. Kühn, Rolf, Professor Dr., geboren 1944, Dr. phil. an der Sorbonne, Paris, philosophische Habilitation an der Universität Wien; Universitäts-Dozent für Philosophie in Wien, Beirut, Nizza, Lissabon, Louvain-la-Neuve, Freiburg i. Br., dort auch Leiter der ‚Forschungsstelle für jüngere französische Religionsphilosophie‘; zahlreiche Veröffentlichungen in Phänomenologie, psychologischer Anthropologie, Kulturund Religionsphilosophie; Übersetzer wichtiger Werke Maine de Birans und Michel Henrys ins Deutsche; Herausgeber der Reihe Seele, Existenz und Leben im Karl Alber Verlag, Freiburg i. Br. u. München; Leiter des ‚Forschungskreises Lebensphä- Zu den Verfassern 273 nomenologie‘ – im Netz unter www.lebensphaenomenologie.de – ; Lehrausbilder und Supervisor in Existenzanalyse – Réseau de Logothérapie France. Seine jüngsten deutschsprachigen Hauptveröffentlichungen: Subjektive Praxis und Geschichte. Phänomenologie der politischen Aktualität, 2008; Praxis der Phänomenologie. Einübungen ins Unvordenkliche, 2009; Natur und Leben. Entwurf einer aisthetischen Proto-Kosmologie, 2011; ‚Ungeteiltheit‘ – oder Mystik als Ab-Grund der Erfahrung. Ein radikal phänomenologisches Gespräch mit Meister Eckhart, 2012; zahlreiche Aufsätze. Schaeffler, Richard, Professor Dr. phil., Dr. theol., Dr. phil. h.c., geboren 1926 in München; von April 1936 bis Juli 1941 Besuch des Internats des Humanistischen Gymnasiums in der Benediktinerabtei Ettal; nach Auflösung dieser Anstalt kehrte er nach Solln zurück und besuchte bis zum Oktober 1942 das Theresien-Gymnasium in München; zu diesem Zeitpunkt wurde Schaeffler aus rassischen Gründen – seine Mutter war Jüdin – von der Schule verwiesen und erhielt privaten Unterricht von Lehrern, die mit ihm sympathisierten. In der Folgezeit arbeitete er als Drogisten-Lehrling im väterlichen Betrieb, einer Großhandlung pharmazeutischer Präparate; im November 1944 wurde er und sein Vater durch die Gestapo inhaftiert und in ein ‚Sonder-Arbeitslager‘ gebracht, in dem er bis zur Befreiung durch amerikanische Truppen verbleiben musste. Nach seiner Rückkehr im Mai 1945 arbeitete er bis zum September dieses Jahres wieder im väterlichen Geschäft. Ende September 1945 erhielt er die Erlaubnis, als Gast an den Vorlesungen und Seminaren der philosophischen Fakultät des Berchmanns-Kollegs in Pullach bei München – der heutigen Hochschule für Philosophie – teilzunehmen. Er schloss nach einem Jahr mit der Zwischenprüfung ab. Seine Lehrer zu dieser Zeit waren unter anderem Walter Brugger und Josef de Vries. Im März 1946 legte er am Theresien-Gymnasium in München sein Abitur ab. Ab dem Wintersemester 1946/47 studierte er an der Universität Tübingen Philosophie, Psychologie und Katholische Theologie. Philosophische Lehrer waren jetzt Gerhard Krüger, Eduard Spranger und Wilhelm Weischedel, in der Psychologie Eduard Spranger und Hans Wenke, in der katholischen Theologie der Dogmatiker Karl Adam, der Exeget Fridolin Stier, der Kirchengeschichtler August Fink und der Fundamentaltheologe Heinrich Fries. Im Sommersemester 1952 reichte er beim Heidegger- und Bultmann-Schüler Gerhard Krüger, der 1950 zur katholischen Kirche konvertiert war, seine umfangreiche philosophische Dissertation Der Glaube bei Karl Jaspers ein. Schaeffler habilitierte sich 1961 in Tübingen an der Philosophischen Fakultät mit der Arbeit Die Struktur der Geschichtszeit. Von 1968 bis zu seiner Emeritierung 1989 war er Professor für philosophisch-theologische Grenzfragen an der Katholisch-Theologischen Fakul- 274 Zu den Verfassern tät der Ruhr-Universität Bochum. Für seine wissenschaftlichen Verdienste in der Religionsphilosophie, Geschichtsphilosophie und Wissenschaftstheorie verlieh ihm die Hochschule für Philosophie München, an der er seit seiner Emeritierung 1989 als Gastprofessor tätig war, am 11. November 2005 die Ehrendoktorwürde. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit engagierte sich Schaeffler in den Jahren von 1972 bis 1983 im ‚Ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen‘ und dem Gesprächskreis ‚Juden und Christen‘ beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Die Hochschule für Philosophie München verleiht einen nach ihm benannten Richard-Schaeffler-Preis. Zu seinen zahlreichen Buchveröffentlichungen zählen: Religion und kritisches Bewußtsein, 1973; Einführung in die Geschichtsphilosophie, 1973, 41991; Religionsphilosophie, 1983, 32004; Glaubensreflexion und Wissenschaftslehre, 1983; Erfahrung als Dialog mit der Wirklichkeit, 1995; Philosophische Einübung in die Theologie, 3 Bde., Freiburg i. Br. u. München 2004, Neudr. 2008; Philosophisch von Gott reden, Freiburg i. Br. u. München 2006; Ontologie im nachmetaphysischen Zeitalter. Geschichte und neue Gestalt einer Frage, Freiburg i. Br. u. München 2008; Erkennen als antwortendes Gestalten. Oder: Wie baut sich vor unseren Augen die Welt der Gegenstände auf?, Freiburg i. Br. u. München 2014; Was ist der Mensch? Unbedingte Wahrheit und endliche Vernunft, Wiesbaden, 2016 (im Erscheinen). Seitschek, Hans Otto, PD Dr., geboren 1974, von 1995 bis 2005 Studium der Philosophie, Psychologie und Katholischen Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, insbesondere bei den Professoren Werner Beierwaltes, Rémi Brague, Hans Maier, Alfons Reckermann, Robert Spaemann, Jörg Splett und Wilhelm Vossenkuhl im Fach Philosophie, Klaus A. Schneewind und Sabine Walper im Fach Psychologie sowie Heinrich Döring im Fach Katholische Theologie; Magister Artium 1999, Promotion zum Dr. phil. 2005 bei Professor Dr. Hans Maier und 2011 Habilitation im Fach Philosophie mit der Arbeit Religionsphilosophie als philosophische Perspektive? Versuch einer systematisch-historischen Einordnung; 2013 Diplom in Katholischer Theologie; von 2000 bis 2002 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt ‚Totalitarismus und Politische Religionen‘, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Guardini-Lehrstuhl des Seminars für Religionswissenschaft und Philosophie der Religionen Europas bei Rémi Brague, 2005 bis 2011 Wissenschaftlicher Assistent und seit 2011 Wissenschaftlicher Oberassistent ebendort, Privatdozent für Philosophie; Seitschek lehrt am Guardini-Lehrstuhl an der Universität München, am Lehrstuhl für Christliche Religionsphilosophie der Universität Freiburg sowie im Fachbereich Kirchenrecht der Universität Augsburg. Zu den Verfassern 275 Zu seinen Veröffentlichungen zählen: Politischer Messianismus, Totalitarismuskritik und philosophische Geschichtsschreibung im Anschluß an Jacob Leib Talmon, 2005; Raymond Arons Konzept der ‚politischen Religionen‘. Ein eigener Weg der Totalitarismuskritik, München 2009; als Herausgeber: Christ und Zeit. Hans Maier zum 75. Geburtstag, München 2007; Sein und Geschichte. Grundfragen der Philosophie Max Müllers, Freiburg i. Br. u. München 2009; Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Die philosophische Lehre an der Universität Ingolstadt-Landshut-München von 1472 bis zur Gegenwart, St. Ottilien 2010; zahlreiche Aufsätze und Artikel in Lexika, Zeitschriften und Zeitungen. Theis, Robert, Professor Dr. phil. habil., Lic. Phil., M. theol., Élève titulaire Ecole Pratique des Hautes Etudes – 5e section; geboren 1947, bis 2010 o. Professor für Philosophie an der Universität Luxemburg, Vize-Präsident der ‚Société d’Etudes Kantiennes de Langue Française‘, Herausgeber der Christian Wolff Werke und der Reihe Europaea Memoria, Hildesheim; Mitglied der International Academy of Philosophy, Eriwan, und der Academia Scientiarum et Artium, Salzburg. Veröffentlichungen in Auswahl: Le discours dédoublé. Philosophie et théologie dans la pensée du jeune Hegel, Paris 1978; Approches de la Critique de la raison pure, Hildesheim 1991; Gott. Untersuchungen zur Entwicklung des theologischen Diskurses in Kants Schriften bis hin zum Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft, Stuttgart-Bad Cannstatt 1994; Hans Jonas. Habiter le monde, Paris 2008; La raison et son Dieu, Paris 2012; zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften über Anselm, Leibniz, Kant, Hegel, Levinas, Jonas; als Herausgeber: De Christian Wolff à Louis Lavelle. Métaphysique et histoire de la philosophie. Festschrift für Jean Ecole, Hildesheim 1995; Die deutsche Aufklärung im Spiegel der neueren französischen Aufklärungsforschung, Hamburg 1998; Reinhold Bernhard Jachmann, Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie, Hildesheim 1999; Emmanuel Kant, L‘unique argument possible pour une démonstration de l’existence de Dieu, Paris 2001; Anselm von Canterbury, Proslogion, Stuttgart 2003; Les sources de la philosophie kantienne aux 17e et 18e siècles, Paris 2005; Kant et la France, Hildesheim 2005; Descartes und Deutschland, Hildesheim 2009; Religion, Hamburg 2009; Kant: Théologie et religion, Paris 2013; De Wolff à Kant. Von Wolff zu Kant. Etudes. Studien, Hildesheim 2013. Trojahn, P. Dominicus OCist, Lic. phil., Mag. theol., geboren 1958, Mönch und Priester in der Cistercienserabtei Stift Heiligenkreuz, Studium der Philosophie mit dem Schwerpunkt antike und mittelalterliche Metaphysik in Freiburg i. Br. und in Rom, Pontificia Università Gregoriana; von 1993 bis 2011 Dozent für Metaphysik an 276 Zu den Verfassern der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz; 1994 bis 2011 Bibliothekar des Stiftes; seit 2013 Kirchenrektor der Heiligenkreuzer-Hof Kapelle in Wien.