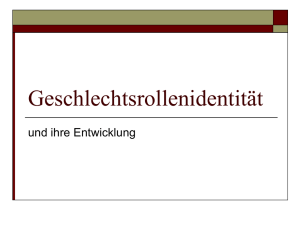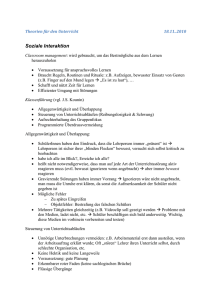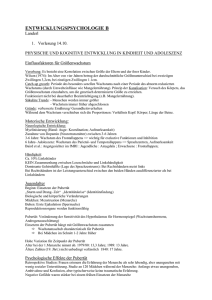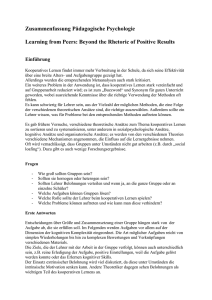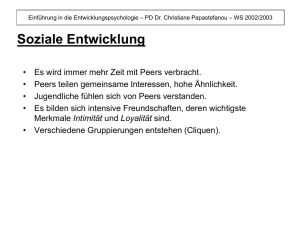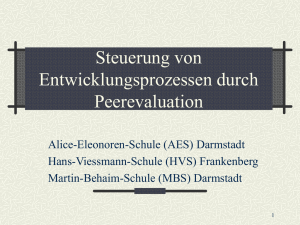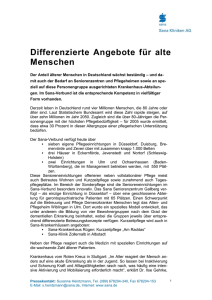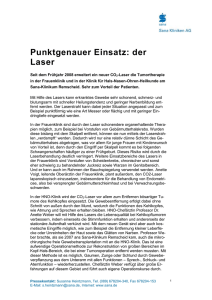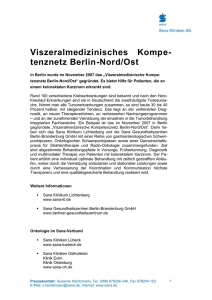Psychiatrie-Experten aus Erfahrung
Werbung

Wissen Sonntag, 3. November 2013 / Nr. 44 Zentralschweiz am Sonntag 46 Psychiatrie-Experten aus Erfahrung Gesundheit Was in den USA vor 25 Jahren begann, fasst auch in der Schweiz Fuss: Ehemalige Betroffene unterstützen Ärzte und Fachpersonal bei der therapeutischen Arbeit mit aktuellen Patienten. mals einen Suizidversuch unternommen hat, ist heute psychisch stabil. Wie Martin Reinert erzählt auch sie von einem positiven Effekt der Peer-Ausbildung auf die eigene Gesundheit. Filomena Russo strahlt im Gespräch ein grosses Einfühlungsvermögen aus: «Ich versuche, allen Patienten gerecht zu werden, was nicht immer einfach ist.» Mittlerweile gebe es eine Patientin, die sich nur bei ihr öffne. Das Verhältnis zu ihr sei sehr vertrauensvoll – die Hemmschwelle im Gespräch sei ihr gegenüber weniger hoch. Womöglich wird das Pensum von Russo an der ZugerseeKlinik in Oberwil bald auf 20 Prozent und um eine weitere Station erhöht. SUSAnnE Holz [email protected] Martin Reinert (37) erkrankte mit 22 Jahren erstmals an einer Psychose: «Davor und in den folgenden Jahren gab es Zeiten mit viel Leid und Hoffnungslosigkeit.» Insgesamt verbrachte er dreimal je drei Monate in einer Klinik. Er konnte seine Matura nicht machen und hatte einen schwierigen Einstieg ins Berufsleben. Der Wahlzürcher ging insgesamt sieben Jahre regelmässig in eine Psychotherapie, er wollte gesund werden, «blieb immer dran», wie er es formuliert. Und er hat es geschafft: «Seit vier Jahren fühle ich mich sehr gut, zufrieden und gesund», sagt Reinert. tiefe Gespräche eigene stabilität festigen Seit dreieinhalb Jahren hat er einen 50-Prozent-Job als kaufmännischer Angestellter. «Ganz wichtig ist, nie aufzugeben, immer was zu machen, ein Ziel zu haben.» Und: «Genauso wichtig ist es, Leute um sich zu haben, die einem Hoffnung machen. Mein Umfeld hat an mich geglaubt.» Martin Reinert entwickelte ein Bewusstsein dafür, was ihm guttut und was nicht. Er lernte, «auf sich zu schauen». 2010 begann er bei der Pro Mente Sana (siehe Hinweis am Schluss) eine Ausbildung zum «Experten aus Erfahrung» – zum Peer. Diese Ausbildung dauerte anderthalb Jahre, sie beinhaltet unter anderem theoretisches Wissen zu psychischen Krankheiten, eine Ausbildung in Gesprächsführung, Selbstreflexion und Gruppenreflexion. Das Studium AnzEigE Angewandte Traumatherapie Neue Ausbildung/Infoveranstaltung «Ganz gleich, in welchem Setting Menschen mit Traumafolgestörungen behandelt werden, sie brauchen in jedem Fall eine traumaadaptierte, traumaspezifische Psychotherapie und/oder Beratung.» (Flatten 2004) Im Dezember 2013 starten wir mit einer neuen Ausbildung, welche die angewandte Traumatherapie ins Zentrum rückt. Wir wollen mit dieser Ausbildung Menschen ansprechen, die mit Traumata in Berührung kommen und Hilfsmittel/Techniken brauchen, um in akuten Situationen Traumata zu begleiten und sich selber zu schützen. Das Erkennen, sowie die therapeutische Behandlung von PatientInnen mit komplexen Traumafolgestörungen benötigt ein spezifisches Fachwissen im Bereich der Psychotraumatologie, der Neurobiologie sowie der Bindungstheorie. Darüber hinaus erfordert diese therapeutische Begleitung ein hohes Mass an menschlichem Engagement. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Besu­ chen Sie unsere Infoveranstaltung und erfahren Sie mehr darüber. <wm>10CAsNsjY0MLQ01zUwM7c0MgEAalymbw8AAAA=</wm> Sie weiss, wovon sie spricht: Filomena Russo als Peer im Gespräch mit einer Patientin der Psychiatrischen Klinik Zugersee in Oberwil (gestellte Szene). Bild Stefan Kaiser hatte ausserdem einen Nebeneffekt. Martin Reinert: «Die Ausbildung festigte meine psychische Stabilität zusätzlich – ich konnte noch einmal mit meiner Krankheit abschliessen.» Genesung im Vordergrund An dieser Stelle kommt der 37-Jährige auf den Begriff Recovery (Genesung) zu sprechen. Recovery und Peer-Arbeit sind in der modernen Psychiatrie eng miteinander verbunden: Die Genesung steht im Vordergrund, und «die Genesungserfahrung von psychisch erschütterten Menschen wird zunehmend anerkannt, in die Behandlung einbezogen und so für andere nutzbar gemacht», wie es in der Zeitschrift «Pro Mente Sana aktuell» (2/2013) heisst. «Recovery bedeutet für mich: Es ist möglich, gesund zu werden», erklärt Martin Reinert. Er sitzt seit Dezember 2012 als erster Betroffener im Stiftungsrat von Pro Mente Sana und begann nach dem Abschluss seiner Ausbildung mit der Peer-Arbeit: So leitet er Recovery-Workshops, nimmt an Podiumsdiskussionen und Tagungen teil, verfasst Artikel und vernetzt andere Peers. Gemeinsam mit drei anderen organisierte er im letzten Sommer ein nationales Treffen in Luzern. Derzeit gibt es in der Schweiz 30 Peers mit einer Ausbildung. Man traf sich zum Erfahrungsaustausch. Und was ergab dieser? Beispielsweise, dass man inzwischen bei den Kliniken auf offene Türen stosse – man sei erwünscht. Peers in der Psychiatrie setzten den Schwerpunkt auf Beziehungsarbeit, die Patienten redeten offener, wenn sie wüssten, dass der Gesprächspartner ein Experte aus eigener Erfahrung ist. Ein bisschen Zeit brauche mancherorts noch «ich versuche, allen Patienten gerecht zu werden, was nicht immer einfach ist.» F i lo m E n A R U S S o , P E E R A n dER KliniK zUgERSEE das Pflegepersonal, um sich an die Peers zu gewöhnen. Auch seien die Kompetenzen der Peers noch nicht klar geregelt. Was aber womöglich nicht mehr lange zu beklagen sein wird: Die Institutionalisierung der Peers schreitet voran. Gestern Samstag haben sich 17 Peers aus der Deutschschweiz in Zürich zur Gründungsversammlung ihres Vereins «Peer+ – Fachverband der ExpertInnen aus Erfahrung» getroffen. Der Verein will für die ganze Schweiz offen sein. Vom Pflegepersonal geschätzt Beim Verein dabei ist auch Filomena Russo (53), die seit November 2012 als Peer auf einer Akutstation der Psychiatrischen Klinik Zugersee in Oberwil arbeitet. Für sie läuft die Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal nach anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten «sehr gut». Nur ganz zu Beginn habe sie das Gefühl gehabt, man wisse gar nicht, «warum ich da bin». Inzwischen sei das Personal froh um sie und die Zeit, die sie für Patienten aufbringe. Filomena Russo ist jeden Freitagnachmittag im Einsatz. Vor Arbeitsbeginn sowie am Abend gibt es einen Austausch mit dem Pflegepersonal: über die Patienten und auch darüber, wie es ihr selbst mit ihrer Arbeit ergeht. Die Altdorferin, die eine schwere Kindheit hatte und als Jugendliche erst- Gut 20 Jahre Psychiatrie-Erfahrung hat Momo Christen (43). Als sie 1990 zum ersten Mal in psychiatrische Behandlung kam, lautete ihre Diagnose auf Depression und dissoziative Störung sowie auf eine posttraumatische Belastungsstörung. Auch die Bernerin hat eine sehr schwere Kindheit hinter sich. Ab 2010 absolvierte die gelernte Pflegeassistentin und Kindergärtnerin den ersten Ex-InStudiengang (siehe Box) an der Fachhochschule für Gesundheit in Bern. Seit 2012 arbeitet sie in einem Fünf-ProzentPensum an der Psychotherapie-Tagesklinik der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern – als Peer. Alle zwei Wochen nimmt Christen montags an der Morgenrunde teil, danach ist sie frei verfügbar für Patienten. Auf neue und schüchterne Patienten gehe sie zu, viele kämen aber von selbst zu ihr. «Es gibt tiefe Gespräche», sagt die Bernerin. Häufig würden die Patienten denken, dass kein gutes Leben mehr möglich sei. Wenn sie als ehemalige Betroffene den psychisch Erschütterten Hoffnung mache, sei das für diese vermutlich glaubwürdiger, als wenn der Therapeut das sage. «Wir sprechen die gleiche Sprache – und überwiegend sagen die Patienten zu mir: Toll, dass es dich gibt.» Einen Nutzen für sich selbst sieht Momo Christen auch: «Ich trage Verantwortung – meine Geschichte hat einen Sinn bekommen.» nicht alle findens gut Doch es gibt auch kritische Stimmen zur Peer-Arbeit in der Psychiatrie. In der «Pro Mente Sana aktuell»-Ausgabe vom Juni schreibt Marta T., Fachfrau und Psychiatrie-Erfahrene: «In der RecoveryBewegung heisst es nun: Du bist krank, und ich bin an dir interessiert. Du sollst es so machen, wie ich es dir empfehle ... und weil mir deine Gesundung ein Erfolgserlebnis verschafft.» Zwingen die Peers ihre eigenen Erfahrungen und Heilungswege womöglich den Patienten auf? Thomas IhdeScholl, Chefarzt der psychiatrischen Dienste Interlaken, sieht das nicht so: «Gerade hier liegt ja einer der Schwerpunkte der Ex-In-Ausbildung – nämlich vom Ich-Wissen zum Wir-Wissen zu gelangen, im gemeinsamen Gespräch auf gleicher Augenhöhe.» HinWeis Die schweizerische stiftung Pro Mente sana setzt sich für die Anliegen von Menschen mit einer psychischen erkrankung sowie gegen Vorurteile und Benachteiligung ein. Die Organisation wurde 1978 von der stiftung «forum psychosociale» und der schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft gegründet. Mehr infos: www.promentesana.ch <wm>10CFXKoQ6AMAxF0S-i6evo2lJJ5hYEwWMImv9XLDjEVff0nkr8tbbtaHuCETZxtZA5oUrBNdWENHzMAmGUhW2GCLz8_AkNlqqOMqB5VYCe634BBM5yuWYAAAA=</wm> 13.11.2013 18.00 bis 20.00 Uhr Kosten: CHF 25.00 Anmeldung: Paramed Akademie AG, Bildungszentrum für Ganzheitsmedizin, Haldenstrasse 1, 6340 Baar, 041 768 20 70, [email protected] www.paramed.ch Bildungszentrum und Ambulatorium in Baar www.paramed.ch «Peers sind niederschwellige Brückenbauer» Die psychiatrischen Dienste der Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken beschäftigen zwei festangestellte PeerFachfrauen und drei Peers. Chefarzt Thomas Ihde-Scholl (Bild) bezeichnet die bisherigen Erfahrungen als «insgesamt sehr erfreulich». Welche Vorteile bringt die PeerArbeit mit sich? Thomas Ihde-Scholl: Peers sind Brückenbauer zwischen dem traditionellen Behandlungsteam und den Betroffenen. Sie werden vom Patienten als niederschwellig erlebt, als nicht wertend und als lösungsorientiert. Gerade auch Angehörige schätzen das Peer-Ange- bot sehr. Erfahrungen zeigen zudem, dass die Peer-Arbeit auch der eigenen Gesundung der Peers zugutekommt. Peers als sehr demütig gegenüber psychischer Erkrankung, viel mehr, als Fachpersonen dies sind. Können Peers auch emotional überfordert sein oder ihre eigenen Erfahrungen unbewusst den Patienten aufzwingen? Ihde-Scholl: Peer-Arbeit ist emotional sehr belastend. Oft sind die Erwartungen aller Beteiligten an die Peers sehr hoch, und oft werden gerade auch die schwierigsten Patienten, bei denen traditionelle Therapien wenig wirksam sind, an Peers vermittelt. Die Gefahr, dass Peers ihre eigenen Erfahrungen und Heilungswege unbewusst dem Patienten aufzwingen, sehe ich aber nicht. Einer der Schwerpunkte der Ex-In-Ausbildung liegt ja darin, vom Ich-Wissen zum WirWissen zu gelangen im gemeinsamen Gespräch auf Augenhöhe. Ich erlebe Wo steht die Peer-Arbeit in der Schweiz im Moment? Ihde-Scholl: Bei den Institutionen entdecken viele die Peer-Arbeit, und auch die Betroffenen sind sehr interessiert – für die 20 Ausbildungsplätze im letzten Kurs gab es 130 Bewerbungen. Aktuell gibt es viele alltagspragmatische Fragen zu klären: Wie werden Peers entlöhnt und eingestuft, wer bezahlt sie, wie verhält es sich mit der Schweigepflicht? Bei allen offenen Fragen: Peers und Recovery sind wichtige Schritte hin zu einer nachhaltigen und menschlichen Psychiatrie. Es ist ein Abkehren von der reinen Fokussierung auf Symptome und Defizite hin zu einer ressourcenaktivierenden Behandlung. das Ex-in-diplom AusbildunG sh. Ex-In steht für Experienced Involvement, den Einbezug Erfahrener: Menschen, die Erfahrung mit psychischer Krankheit und psychiatrischer Behandlung haben, reflektieren diese Erfahrungen und setzen sie dann zur Unterstützung anderer Erkrankter ein, sei es als Peer-Mitarbeiter in der Psychiatrie, sei es in der Antistigma-Arbeit oder in Gremien. Von 2010 bis 2012 wurde an der Berner Fachhochschule für Gesundheit die erste Ex-In-Weiterbildung angeboten, in Form des Diploma of Advanced Studies (DAS) Experienced Involvement (Studiengang für Psychiatrie-Erfahrene). Der zweite Studiengang begann im September 2012 und dauert bis August 2014 – in Kooperation mit der Stiftung Pro Mente Sana. 20 Studierende absolvieren ihn (www.ex-in-bern.ch).