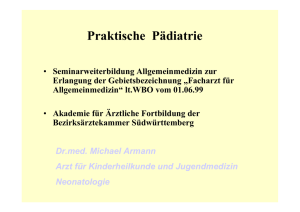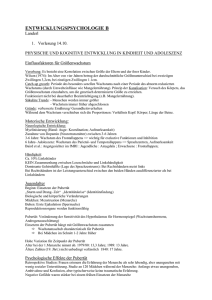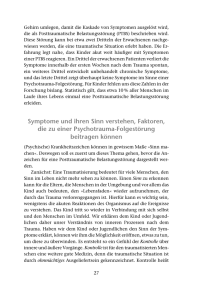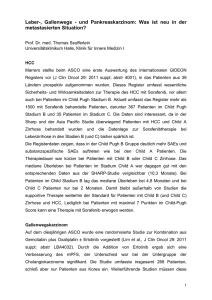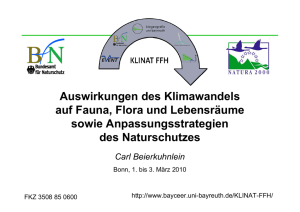1. Besonderheiten und Entwicklungsrelevanz von Peer
Werbung

Kinder brauchen Kinder - Die Bedeutung von Peers Susanne Viernickel, ASH Berlin Einleitung ................................................................................................................................... 1 1. Besonderheiten und Entwicklungsrelevanz von Peer-Beziehungen ...................................... 2 2. Formen und Entwicklung von Peer-Beziehungen .................................................................. 4 2.1 Kontakte, Interaktionen, soziales Spiel ...................................................................... 4 Kooperation im sozialen Spiel ........................................................................................... 4 Prosoziales Verhalten ......................................................................................................... 5 Konfliktverhalten ............................................................................................................... 6 Aggressives Verhalten ........................................................................................................ 6 2.2 Status in der Peer-Gruppe .......................................................................................... 6 2.3 Gruppenkonstellationen, Spielpartnerpräferenzen und Freundschaften .................... 8 Beziehungsmuster und Präferenzen ................................................................................... 8 Erste Freundschaften .......................................................................................................... 9 3. Einige Schlussfolgerungen für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen ....... 10 3.1 Förderliche Rahmenbedingungen schaffen .............................................................. 10 3.2 Interaktionen zwischen Kindern anbahnen, moderieren und erweitern ................... 11 4. Fazit ...................................................................................................................................... 12 Literaturhinweise ...................................................................................................................... 12 Verwendete Literatur ............................................................................................................ 12 Leseempfehlungen ............................................................................................................... 14 Einleitung Welche Bedeutung haben junge Kinder füreinander? Welche Entwicklungsimpulse vermögen sie einander zu geben? Dies sind Fragen, die im Zuge der Diskussion um frühkindliche Bildung zu kurz kommen. Wir sprechen viel von der Gestaltung der Erzieherin-KindBeziehung und von der Verantwortung, die pädagogischen Fachkräften für die Unterstützung und Förderung des kindlichen Lernens und der kindlichen Entwicklung zukommt. Wir sprechen auch gern vom Raum als dem „dritten Erzieher“, dessen Gestaltung die Art und Weise mitbestimmt, in der Kinder sich eigenständig die Welt aneignen und der Möglichkeiten dieser Weltaneignung begrenzen oder aber eröffnen und erweitern kann. Seltener sprechen wir davon, dass die Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen in erster Linie ein Arrangement ist, wo Kinder auf andere Kinder - auf recht viele andere Kinder treffen und mit denen sie einen großen Teil ihrer wachen Zeit verbringen. Es liegt sehr nahe, dass sich die Kinder bei ihren tagtäglichen Begegnungen untereinander beeinflussen, dass sie sich aufeinander beziehen und voneinander lernen. Kinder sind füreinander eine Beziehungsund Bildungsressource. Um den Umstand zu verdeutlichen, dass Kinder im sozialen Kontakt mit Peers qualitativ andere Erfahrungen als in der Interaktion mit Erwachsenen machen, dass der Umgang von Kindern untereinander, die Themen, die von Bedeutung sind, die Maßstäbe, nach denen Verhalten beurteilt wird und wodurch sich die Stellung Einzelner in der Gruppe entscheidet, andere sind als zwischen Kindern und ihren Eltern, Erzieherinnen und Lehrerinnen, sprechen WissenschaftlerInnen auch von einer eigenständigen Peer-Kultur. Kinder produzieren, sobald sie in relativ stabilen sozialen Gruppen zusammentreffen, eine eigenständige Kinderkultur mit ihr eigenen Verfahren, Aushandlungsprozessen und Regeln. Mit dem Begriff der Kinderkultur ist dabei sowohl die aktive Leistung der Kinder beim Vorantreiben der eigenen Entwicklung als auch die Einbettung dieser Vorgänge in soziokulturelle Zusammenhänge angesprochen. 2 Sie muss somit abgegrenzt werden von der „Kultur für Kinder“, womit die von Erwachsenen für Kinder hergestellten und angebotenen Institutionen, Produkte und Ereignisse gemeint sind. Nach Corsaro und Eder (1990) haben Kinder zwei zentrale Anliegen in der Kinderkultur zu bewältigen. Das erste Thema ist Kontrolle. Hierunter ist das Bestreben nach Kompetenz und Unabhängigkeit gefasst, aber auch nach Kontrolle über gemeinsame Aktivitäten, Rituale und symbolische Akte. Das zweite, zur Kontrolle in einer Wechselbeziehung stehende Thema ist Teilhabe: das Gewinnen von verlässlichen Spielpartnern und vertrauten Freunden, das Herstellen und Bewahren von Gemeinsamkeit, und das Finden und Beanspruchen eines bestimmten Platzes in der Gruppe. Dieser Beitrag befasst sich mit den Vorgängen, die sich in dieser „Kinderkultur“ vom ersten Lebensjahr an beobachten lassen, und mit den Entwicklungs- und Bildungschancen, die für Kinder hiermit verbunden sind. Er geht zunächst auf die Besonderheiten von PeerBeziehungen ein, woraus sich erschließen wird, weshalb diese andere Entwicklungs- oder Bildungsimpulse setzen können als Erwachsenen-Kind-Beziehungen (Kap. 1). Im zweiten Teil wird dargelegt, wie sich Peer-Kontakte und -beziehungen in Abhängigkeit vom Alter und anderen Faktoren entwickeln und welche Kompetenzen Kinder in diesem Zusammenhang erwerben. Dabei wird auch auf mögliche Risiken hingewiesen (Kap 2). Schließlich werden einige Konsequenzen für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen aufgezeigt (Kap. 3). 1. Besonderheiten und Entwicklungsrelevanz von PeerBeziehungen In der Fachliteratur zu Kontakten und Beziehungen zwischen Kindern werden häufig die englischen Begriffe „Peer“ bzw. im Plural „Peers“ verwendet. Damit sind Kinder gemeint, die auf einem ähnlichen kognitiven und sozio-moralischen Entwicklungsstand stehen, gegenüber Institutionen und ihren Repräsentanten (z.B. Kindergarten, Schule) eine gleiche Stellung einnehmen, gleiche Entwicklungsaufgaben und normative Lebensereignisse (z.B. Schuleintritt) zu bewältigen haben und einander im Wesentlichen gleichrangig und ebenbürtig sind (vgl. von Salisch 2000, 347ff). Vor allem die Arbeiten von James Youniss (1980) haben dazu beigetragen, die PeerSozialwelt als besonderen und fruchtbaren Lernkontext zu beschreiben und theoretisch zu fundieren. Youniss versteht Entwicklung aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive heraus und sieht das Individuum als ein Produkt seiner Erfahrungen in sozialen Beziehungen. In den sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen werden nach Youniss dem Kind vielfältige Realitätssichten präsentiert, im Gegensatz zur “partikularistischen” Realitätssicht der Eltern, deren Unvollständigkeit bzw. Einseitigkeit das Kind jedoch lange nicht erkennen könne. Die Aushandlungen zwischen Gleichaltrigen sind geprägt von “symmetrischer Reziprozität”, die sich durch zwei Merkmale auszeichnet. Erstens sind Handlungen des einen Partners durch die Reaktionen des Anderen bedingt und umgekehrt, und zweitens kann jeder Aushandlungsbeitrag des einen Kindes mit einem gleichwertigen Beitrag oder Gegenargument des anderen beantwortet werden. Da weiterhin das Kompetenz- und Machtverhältnis zwischen den Individuen in Peer-Beziehungen relativ ausgeglichen ist, sei die Chance gegeben, dass widersprüchliche Ansichten und entstehende Konflikte so lange und so intensiv verhandelt werden, bis eine umfassendere Perspektive in “Ko-Konstruktion” gebildet werden kann. 2 3 Der Begriff der “Ko-Konstruktion” umschreibt Youniss’ Überzeugung, dass Kinder nicht nur lernen, die Sichtweisen des Anderen zu übernehmen, also Perspektiven zu teilen, sondern dass sie in einer echten gemeinsamen Konstruktionsleistung Perspektiven entwickeln, wobei keiner aufgrund seiner Autorität oder seiner intellektuellen Überlegenheit dem anderen die Lösung quasi „serviert“. Vielmehr sind beide Interaktionspartner gefordert, die eigenen Gedanken und Überlegungen dem anderen plausibel darzulegen, die Argumente des Gegenübers zu prüfen und eine beiderseits akzeptierte Sichtweise zu entwickeln. Kommt es zum Streit, haben alle Beteiligten vergleichbare Machtmittel zur Verfügung; außerdem werden die Kinder immer wieder prüfen, bis zu welchem Punkt das Beharren auf dem eigenen Recht und der Einsatz unfairer Taktiken sich „lohnt“, weil sonst unter Umständen die Beziehung gefährdet sein könnte oder andere plötzlich Partei für den „Gegner“ ergreifen. Auf der Basis dieser grundsätzlichen Gleichrangigkeit entwickeln Kinder schon im Kindergartenalter so anspruchsvolle Konzepte wie moralisches Handeln und Urteilen, ein Gerechtigkeitsverständnis und konstruieren nicht zuletzt Anteile ihrer Identität (vgl. Völkel, 2002). Interaktionen mit Gleichaltrigen fordern also andere Verhaltensweisen und Kompetenzen heraus als Interaktionen mit Erwachsenen (vgl. zusammenfassend Viernickel, 2000). Darauf stellen sich selbst die jüngsten Kinder schon ein. So richten Kleinkinder z.B. bestimmte soziale Verhaltensweisen wie Gesten oder Berührungen eher an ihre Peers; mit Erwachsenen vokalisieren die Kinder dagegen häufiger, und diese werden auch häufiger angelächelt. Besitzkonflikte treten fast ausschließlich zwischen Kindern auf. In Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern geht es dagegen oft um eher pflegerische Handlungen wie Nase putzen oder Schuhe anziehen, oder der Erwachsene gibt Anweisungen, die das Kind dann ausführt (oder auch nicht). Jean Piaget, der große Genfer Entwicklungspsychologe, hat zu diesem Thema einmal eine zunächst recht merkwürdig anmutende Bemerkung gemacht, die die Bildungsimpulse von Peer-Beziehungen jedoch noch besser verstehen lässt. Er schrieb: „Der Spielkamerad dagegen ist sowohl dem Ich des Kindes ähnlich als auch davon verschieden. Er ist ihm ähnlich, weil er gleich ist im Können oder Wissen; ganz verschieden aber, gerade weil er auf demselben Niveau steht und nicht wie ein überlegener Erwachsener in das Innere der Wünsche oder in die Perspektive des eigenen Denkens eindringt“ (Piaget 1968/1972, S. 72). Der erste Teil – der Spielkamerad oder „Peer“ ist dem Kind gleich im Können oder Wissen – ist gut nachvollziehbar: Kleinkinder setzen ähnliche Verhaltensweisen und Kompetenzen ein, wenn sie in Kontakt miteinander treten; sie teilen miteinander den Spaß am gegenseitigen Imitieren und das Interesse an kleinen Spielen mit unzähligen Wiederholungen. So wirken die anderen Kinder wie ein Spiegel der eigenen Aktivitäten und Interessen, in dem sich Kleinkinder wieder erkennen und darüber Informationen über ihr eigenes „Ich“ erhalten. Der zweite Teil des Zitats von Jean Piaget bezieht sich dagegen auf die fundamentale Differenzerfahrung, die Kleinkinder machen, wenn sie z.B. erleben, dass ihre Kontaktangebote ignoriert werden, oder wenn es ihnen nicht gelingt, ihre Anliegen klar genug zu kommunizieren, und es zu Missverständnissen, Konflikten oder Spielabbrüchen kommt. Eltern und Erzieherinnen gleichen die noch nicht hinreichenden Kompetenzen der jungen Kinder aus, indem sie in Interaktionen die Führung übernehmen, das Verhalten der Kinder so interpretieren, dass es zur intendierten Interaktion passt und ihre eigenen Handlungen und Reaktionen feinfühlig anpassen. Dass in den Interaktionen zwischen den Kleinkindern dagegen kein kompetenterer Partner zur Stelle ist, der missverständliche Signale richtig deuten und Störungen integrieren könnte, verdeutlicht den Kindern, dass es auch an ihnen liegt, ob eine Interaktion weiter geführt werden kann oder sich die eigene Spielidee gemeinsam mit dem Anderen verfolgen lässt. Dabei erwerben die Kinder Wissen über die 3 4 erlebte soziale Situation und über den eigenen Beitrag, den sie hierzu leisten. Über diesen Weg entwickeln sie neben verfeinerten kommunikativen und sozialen Kompetenzen ebenfalls ein Bewusstsein darüber, ein von anderen Menschen abgegrenztes, eigenständiges und handlungsfähiges Wesen zu sein. 2. Formen und Entwicklung von Peer-Beziehungen 2.1 Kontakte, Interaktionen, soziales Spiel Bereits sehr junge Kinder nehmen einander als Ziele ihrer sozialen Signale wahr und zeigen Gleichaltrigen gegenüber ein deutlich anderes Verhalten als gegenüber materiellen Objekten. Babys unter einem Jahr versuchen, Gleichaltrige anzulächeln, Laute zu äußern, sich anzunähern und zu berühren. Im letzten Viertel des ersten Lebensjahres können erste Interaktionen, u.a. der Austausch von Spielobjekten, gegenseitige Nachahmung und erste einfache Spiele – wie einen Ball hin- und herrollen - bereits regelmäßig beobachtet werden. Gleichzeitig beginnen die Kleinkinder, um Spielzeug zu streiten, und auch aggressives Verhalten tritt auf. Das zweite Lebensjahr ist eine Periode, in der sich im Verhalten gegenüber Gleichaltrigen rasche Entwicklungen vollziehen (vgl. Viernickel 2000). Wenn sie Gelegenheit dazu haben, treten Kleinkinder zunehmend öfter in den Kontakt und sozialen Austausch mit anderen Kindern ein. Dies geschieht zunächst überwiegend in einer Zweier-Konstellation. Aufgrund der noch rudimentär ausgeprägten Fähigkeit zur sprachlichen Verständigung nutzen Kleinkinder verstärkt mimische und gestische Ausdrucksmittel. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Imitation bzw. Nachahmung des Verhaltens anderer Kinder, über die es gelingt, auch längere Interaktionssequenzen aufrecht zu erhalten. Kinder erleben sich in diesen Situationen nicht nur als kompetent und effektiv im sozialen Austausch, sondern demonstrieren einander Gleichartigkeit und Verbundenheit. Nicht ohne Grund wird die gegenseitige Imitation gelegentlich als die „Sprache“ von Kleinkind-Freundschaften bezeichnet (Whaley & Rubenstein, 1994). Die zunehmend höhere Komplexität der Peer-Interaktionen zeigt sich in ihrer Organisation um bestimmte Thematiken und darin, dass die Kinder bestimmte Rollen einnehmen und diese miteinander koordinieren, wenngleich diese einfachen sozialen Spiele noch keinem Vergleich mit den späteren elaborierten sozialen Rollenspielen standhalten. Im zweiten Lebensjahr fungieren Spielzeuge oder, allgemeiner gesagt, Gegenstände als „Mittler“ sozialer Kontakte, und das Anbieten bzw. Überreichen eines Spielobjekts ist eine häufige Kontaktstrategie (Viernickel, 2000, S. 122). Gegen Ende des zweiten Lebensjahres sind Kinder unter bestimmten Umständen in der Lage zu kooperieren, und zwar sowohl um Probleme zu lösen, als auch im Spiel. Sie zeigen sich gegenseitig Mitgefühl und entwickeln in häufigen, aber meist kurzen Auseinandersetzungen Regeln für Besitzfragen und -konflikte (Bakeman & Brownlee, 1982). Kooperation im sozialen Spiel Kontakte und Interaktionen zwischen Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren vollziehen sich überwiegend im Rahmen sozialen Spiels. Komplexes soziales Spiel gilt als ein Indikator für die soziale Kompetenz eines Kindes. Es beinhaltet ähnliche, aufeinander bezogene und einander ergänzende Spielaktivitäten mit geplanten Spielhandlungen und gemeinsamen Zielen und ist durch einen hohen Anteil symbolischer Elemente gekennzeichnet. Komplexes soziales Spiel setzt Aushandlungsprozesse voraus. Im dritten Lebensjahr beginnen Kleinkinder, Themen, Rollen und Regeln zu vereinbaren wie auch fortlaufend zu erweitern (Howes, 1988). 4 5 Sie werden in solchen Spielen auf mehrfache Weise in ihrer Entwicklung herausgefordert. Zum einen müssen sie ihre eigenen Spielhandlungen und Spielthemen mit denen der Interaktionspartner abstimmen und koordinieren (sozialer Aspekt); sie müssen ihre Emotionen regulieren und angemessen äußern (emotionaler Aspekt) und sie erbringen gleichzeitig kognitive Leistungen, indem sie imaginäre und symbolische Inhalte in ihr Spiel integrieren, Handlungspläne verfolgen und komplexe Szenarien entwickeln. In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass soziales und imaginäres Spiel einer verschränkten Entwicklungsabfolge unterliegt und soziales Symbolspiel immer etwas später auftritt als soziales Spiel ohne symbolische Inhalte oder imaginäres Alleinspiel (vgl. z.B. Howes & Matheson 1992). Im Austausch mit seinen Peers und in der Konfrontation mit ihren oftmals von den eigenen abweichenden Spielideen und Situationsinterpretationen ist ein Kind beständig aufgefordert, die eigenen Ideen und Handlungen zu erproben, zu begründen, zu verteidigen oder aber zu überprüfen, zu verändern und anzupassen. Dabei werden u.a. die Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und die Entwicklung sprachlicher Kompetenzen stimuliert, aber auch so grundlegende soziale Fertigkeiten erworben wie Abwarten können, eigene Interessen vertreten, ohne die der anderen zu missachten, oder Frustrationen und Unklarheiten aushalten zu können. Auch spezifische interaktive Fähigkeiten werden sowohl gefordert als auch gefördert: angefangen von der Einigung auf ein Thema und die Aufgaben oder Rollen der einzelnen Kinder, kann kooperatives Spiel nur weitergehen, wenn die zeitliche Abfolge der einzelnen Handlungsbeiträge abgestimmt wird und Unterbrechungen oder Themenänderungen bewältigt werden können. Kinder müssen lernen, den Kontext einer Situation als „Spiel“ oder als „kein Spiel“ zu identifizieren; sie müssen das dem Spiel zugrunde liegende Organisationsmuster erfassen und schließlich auch das Thema der Interaktion erkennen und zu seiner Aufrechterhaltung beitragen (vgl. Göncü, 1993). Es überrascht deshalb nicht, dass Kinder, die elaborierte soziale Spielformen zu einem früheren Zeitpunkt entwickelten, als es ihrem Alter nach zu erwarten gewesen wäre, geselliger, prosozialer, weniger zurückgezogen und weniger aggressiv waren und von den Betreuerinnen als problemloser im Umgang mit Peers eingeschätzt wurden als Kinder, die diese Spielformen später zeigten (Howes & Matheson, 1992). Prosoziales Verhalten Als prosozial werden Verhaltensweisen bezeichnet, die darauf abzielen, dem Interaktionspartner zu nutzen, ohne dass ein direkter eigener Vorteil erkennbar ist (wie Helfen, Teilen oder Trösten). Bereits im zweiten Lebensjahr helfen und trösten Kleinkinder sich gegenseitig und teilen Besitz mit ihren Peers (Viernickel, 2000; Simoni u.a., 2008). Dies erfolgt zunächst noch ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Hilfsbedürftigkeit des Gegenübers; außerdem können Kleinkinder bis zum ca. dritten Lebensjahr noch nicht abschätzen, welche Form der Hilfe oder des Trostes aus der Perspektive des anderen angemessen wäre. Im Alter zwischen drei und sechs Jahren entwickeln Kinder dann Regeln und Überzeugungen bezüglich des Teilens, berücksichtigen den Grad der Vertrautheit und der Gegenseitigkeit beim Teilen und entwickeln Vorstellungen darüber, wer aus welchen Gründen und in welchen Situationen Hilfe verdient (vgl. Hay, 1994). Im Verlauf des Kindergartenalters differenzieren sich prosoziale Verhaltensweisen; so wirken sich Faktoren wie (angenommene) Bedürftigkeit, Schuldlosigkeit, Reziprozität, Vertrautheit sowie PeerStatus positiv auf das Gewähren von Hilfe und Trost aus. Auch Geschlechtsunterschiede werden berichtet. Demnach werden Mädchen in der Regel prosozialer eingeschätzt als Jungen, was sich bei einer differenzierten Betrachtungsweise jedoch nur bedingt als empirisch unterlegt erweist (Eisenberg & Fabes, 1998). 5 6 Konfliktverhalten Konflikte sind ein regelmäßiger Bestandteil von Peer-Interaktionen. Sie sind meist kurz und entstehen aus vielfältigen Anlässen, wobei im zweiten und dritten Lebensjahr Besitzkonflikte dominieren (vgl. Viernickel, 2000). Dittrich u.a. (2002) betonen, dass sich in Peer-Konflikten bestimmte Hintergrundthemen manifestieren, die für die soziale Struktur der Gruppe und die sozialen Beziehungen zwischen einzelnen Kindern relevant sind (wie z.B. einander kennen lernen; Positionen in der Gruppe finden, festigen oder ändern). Dabei entwickeln Kinder ein breites Repertoire von Aushandlungsformen, die verbal, mimisch und gestisch kommuniziert werden. Neben direkten körperlichen und symbolischen Angriffen sind Hilfegesuche an die Erzieherin, das Berufen auf Regeln, Kompromisse anbieten und Argumentieren beobachtet worden. In diesen Aushandlungen vollziehen sich wichtige soziale Lernprozesse, insbesondere wenn sie im Zusammenhang mit gemeinsamen Spielvorhaben der Kinder auftreten, z.B. wenn es um die Verteilung und die Ausführung von Spielrollen geht. Die Häufigkeit, mit der Kinder in Konflikte involviert sind, gilt deshalb nur im Zusammenhang mit den verwendeten Konfliktstrategien und den erzielten Konfliktlösungen als Indikator für eine geringe soziale Kompetenz. So streiten Kinder, die sich als beste Freunde bezeichnen, nach Hartup et al. (1988) sogar häufiger miteinander als nicht befreundete Kinder, haben aber auch sehr viele positive Interaktionen und gelangen oft zu konstruktiven Konfliktlösungen. Aggressives Verhalten Dagegen wird als Risiko für spätere Anpassungsprobleme betrachtet, wenn Kinder häufig aggressive Durchsetzungsstrategien nutzen, insbesondere, wenn diese nicht reaktiv nach einer empfundenen Provokation oder Frustration, sondern proaktiv, also geplant und zielgerichtet eingesetzt werden (Card & Little, 2006). Reaktives und proaktives aggressives Verhalten, und zwar sowohl körperlich als auch relational (z.B. von gemeinsamem Spiel ausschließen, drohen, ignorieren), wird schon im zweiten und dritten Lebensjahr beobachtet (Viernickel, 2000). Körperlich-aggressive Verhaltensweisen gehören in dieser Zeit zum normalen Verhaltensrepertoire von Kindern, nehmen jedoch bis ins Grundschulalter hinein kontinuierlich ab (NICHD ECCR, 2004). Mit zunehmenden Alter verstehen Kinder immer besser, dass aggressives Verhalten eingesetzt werden kann, um die eigenen Ziele zu erreichen; entsprechende Prädispositionen können sich deshalb über die Zeit verfestigen. Die Stabilität klinisch relevanten aggressiven Verhaltens in seinen unterschiedlichen Formen ist über den Entwicklungsverlauf relativ hoch (vgl. u.a. Olweus, 1979). Viele Studien zeigen, dass Mädchen und Jungen unterschiedliche Formen aggressiven Verhaltens präferieren, wobei Mädchen eher verdeckt aggressiv sind und dementsprechend relationale Formen bevorzugen. Aggressive Kinder werden von ihren Peers als weniger beliebt eingestuft und eher gemieden. Manche erleben dennoch wechselseitige Freundschaftsbeziehungen und können sich ein Netzwerk sozialer Beziehungen aufbauen, zumeist mit Kindern, die sich auch aggressiv bzw. dissozial verhalten (Snyder, Horsch & Childs, 1997). Sowohl Ablehnung innerhalb der Peer-Gruppe als auch der Einfluss ebenfalls devianter Peers gilt als ein - wenn auch nicht dominanter - Risikofaktor für die Entwicklung aggressiv-dissozialer Verhaltenstörungen (Petermann u.a., 2004, S. 387). 2.2 Status in der Peer-Gruppe Der Platz oder Status innerhalb der Peer-Gruppe und mit welchem Einfluss und welcher Anerkennung er verbunden ist, kann über soziometrische Wahlen erfasst werden. Die Soziometrie (zuerst Moreno, 1934/ deutsch 1974) beschäftigt sich mit der Struktur einer 6 7 Gruppe bzw. mit deren „emotionalem Beziehungsgeflecht“. Für den Einsatz in Kindergartenbzw. Vorschulgruppen haben sich zwei Grundformen etabliert. Bei soziometrischen Nominierungsverfahren wird jedes Gruppenmitglied gebeten, einige Kinder zu nennen, die am liebsten bzw. am wenigsten gemocht werden, oder die andere interessierende Merkmale aufweisen (z.B. kämpft häufig mit anderen, spielt oft allein). Soziometrische Ratingverfahren fordern, dass alle Kinder der jeweiligen Gruppe vom Befragten in eine von mehreren Kategorien eingeordnet werden (z.B. „Mit x spiel ich „sehr gerne“ – „weder gern noch ungern“ – „überhaupt nicht gerne““). Um die Zuverlässigkeit der kindlichen Aussagen zu erhöhen, werden die Befragungen mit Hilfe von Fotos oder einfachen Symbolen (lachende neutrale - traurige Gesichter) unterstützt. Bei Anwendung des Nominierungsverfahrens können über die Anzahl und Relation der positiven und negativen Wahlen Statusgruppen gebildet werden. So gelten Kinder mit vielen positiven und wenig negativen Nennungen als „beliebt“ bzw. „populär“, Kinder mit vielen negativen und wenig positiven Wahlen als „abgelehnt“. Kinder mit vielen positiven und vielen negativen Wahlen sind zwar „umstritten“, haben aber einen hohen sozialen Einfluss auf die Gruppe; dagegen sind Kinder mit nur sehr wenig Wahlen insgesamt „isoliert“ bzw. „vernachlässigt“. Für Kinder im Schulalter konnte in verschiedenen Studien gezeigt werden, dass es Zusammenhänge zwischen sozialem Status in der Peer-Gruppe (hier ist normalerweise die Schulklasse gemeint), sozialer Kompetenz und internalisierenden und externalisierenden Verhaltensproblemen gibt. Beliebte Kinder werden als sozial kompetent und seltener als aggressiv oder störend beschrieben und berichten weniger Selbstwertprobleme und depressive Symptome (vgl. von Salisch 2000). Sie scheinen im Durchschnitt einen höheren Intelligenzquotienten aufzuweisen und zeigen bessere Schulleistungen. Beliebte Kinder erlangen z.B. Zugang zu einer Gruppe, indem sie Selbstvertrauen zeigen, fragen, ob sie mitspielen dürfen und Gespräche beginnen. Kinder, die von ihren Mitschülern abgelehnt werden, halten sich dagegen in der Nähe der Gruppe auf oder drängen sich störend hinein (Petermann u.a., 2004). Kinder mit einem niedrigen sozialen Status schreiben eigene Misserfolge inneren und stabilen Ursachen zu und gehen von feindlicheren Einstellungen anderer aus. Sie sind aggressiver, zeigen weniger prosoziales Verhalten und sind häufiger in negative Peer-Interaktionen involviert als sozial besser akzeptierte Peers (Putallaz & Dunn, 1990). Als „vernachlässigt“ bzw. „isoliert“ eingestufte Kinder zeigen sich im Vergleich zu anderen Kindern schüchterner und sondern sich mehr ab. Kontroverse Kinder verhalten sich dagegen häufig aggressiv, verfügen jedoch parallel dazu auch über hohe sozial-kognitive Fertigkeiten (Newcomb et al., 1993). Es ist allerdings schwierig zu beurteilen, ob diese Verhaltensmerkmale Ursache oder Auswirkung des problematischen Peer-Status´ darstellen. Was die Stabilität der Zuordnung zu einer der genannten Gruppen angeht, scheinen abgelehnte Kinder länger in diesem kritischen sozialen Status zu verbleiben als vernachlässigte Kinder. Dies gilt auch über die Zeit und Situation hinweg, also unabhängig von der Zusammensetzung der Peer-Gruppe. Die Ergebnisse soziometrischer Nominierungen können deshalb erste Hinweise auf Risiken für Anpassungsprobleme oder psychische Schwierigkeiten geben. 7 8 2.3 Gruppenkonstellationen, Spielpartnerpräferenzen und Freundschaften Beziehungsmuster und Präferenzen Offensichtlich formieren Kleinkinder, sobald sie regelmäßig in einem vertrauten Kontext aufeinander treffen, auch erste Beziehungsmuster. Schon Babys unter einem Jahr verteilen ihre Aufmerksamkeit unterschiedlich auf die anwesenden Peers; meist erhalten eher ältere und damit in ihrem Verhalten kompetentere Kinder mehr Blicke und Kontaktangebote als andere Kinder (Rauh, 1985). Bald kommt es in stabilen Gruppen zu einer nachweisbaren Bevorzugung bestimmter Interaktionspartner. Die meisten Kinder präferieren ein oder zwei andere Kinder der Gruppe und treten mit diesen verstärkt in einen sozialen Austausch, während zu anderen wenig oder kein Kontakt entsteht. Diese Tendenz verstärkt sich im Verlauf der ersten Lebensjahre. Eine wichtige Rolle spielt hierbei das Geschlecht der Kinder. Spätestens mit dem dritten Lebensjahr beginnen Kinder, gleichgeschlechtliche Spielpartner zu bevorzugen; dies wird in der Fachliteratur als „Peer Segregation“ bezeichnet, also die von den Kindern selbst gewählte Trennung jeweils gleichgeschlechtlicher Spielgruppen bzw. –konstellationen. Diese Entwicklung setzt sich verstärkt bis zum Ende der mittleren Kindheit fort. In einer amerikanischen Längsschnittstudie (Maccoby & Jacklin, 1987) verbrachten viereinhalb jährige Kinder dreimal so viel Zeit im Spiel mit gleichgeschlechtlichen als mit gegengeschlechtlichen Kindern. Zwei Jahre später war dieses Verhältnis auf 11:1 angestiegen. In den Mädchen- bzw. Jungengruppen pflegen die Kinder einen unterschiedlichen Interaktions- und Spielstil und sie lernen und praktizieren unterschiedliche soziale und kognitive Fertigkeiten. Jungen unterbrechen einander öfter, gebrauchen mehr Befehle und Drohungen, verweigern sich häufiger eine Bitte oder Forderung des Anderen und versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Mädchen im Kontext reiner Mädchengruppen drücken dagegen häufiger Zustimmung aus zu dem, was die andere gesagt hat, pausieren, um jemand anderen sprechen zu lassen und greifen das von der anderen Gesagte in ihrem eigenen Redebeitrag auf. Der von den Jungen bevorzugte Spielstil ist gruppenorientiert, körperbetont und raumgreifend, der Spielstil von Mädchen dyadisch und ruhiger. Durch diese sich selbst verstärkenden unterschiedlichen Erfahrungen werden – so nimmt man an – unterschiedliche Beziehungsformen begünstigt. Die Mädchen erwerben in ihren Peer-Gruppen soziale Sensitivität und die Wertschätzung und Fähigkeit zu interpersonaler Nähe, wahrend das von Dominanz- und Wettbewerbsstreben geprägte soziale Milieu der Jungengruppen eher Selbstbehauptungs- und Durchsetzungsstrategien befördert (vgl. zusammenfassend Viernickel, 2000). Es hat gute entwicklungspsychologische Gründe, dass Kinder sich gleichgeschlechtliche Spielpartner suchen. Die kognitive Entwicklungstheorie betont den Zusammenhang dieser Wahlen mit der sich entwickelnden Geschlechtsidentität. Kinder wählen gleichgeschlechtliche Spielpartner, um mehr über das Verhalten zu erfahren, das mit Geschlechtsrollen assoziiert wird, und auch, weil sie Personen, die ihnen ähnlich sind, als positiv erleben und beurteilen. Sie setzen sich intensiv mit der eigenen Geschlechtszugehörigkeit auseinander und finden in den gleichgeschlechtlichen Gruppen Sicherheit und Bestätigung. Es ist also pädagogisch wenig sinnvoll, die beschriebenen Gruppenkonstellationen durchbrechen zu wollen. Dagegen zeugt es von pädagogischer Professionalität, sich selbst und sein eigenes Verhalten in Bezug auf die Vermittlung von Geschlechtsrollenstereotypien kritisch zu hinterfragen und allen Kindern unabhängig von ihrer Geschlechtszugehörigkeit hinreichend Angebote zu machen, die verschiedenste Interessen ansprechen und Kompetenzen befördern. 8 9 Erste Freundschaften Neben der Formation dieser beschriebenen Gruppenkonstellationen gibt es auch bereits in einem sehr frühen Alter deutliche Hinweise auf recht stabile Spielpartnerpräferenzen, die sich manchmal zu engen Freundschaften entwickeln. Erzieherinnen und Eltern berichten immer wieder von engen Beziehungen, die sich zwischen sehr jungen Kindern entwickeln. Die Forschung bestätigt, dass es bereits im zweiten Lebensjahr Kinder“paare“ gibt, die sich dadurch auszeichnen, dass die aneinander gerichteten Kontaktinitiativen meist erfolgreich sind, ihre Interaktionen mit positiven Gefühlsäußerungen einhergehen und in Länge und Komplexität die Interaktionen anderer Kind-Kind-Dyaden übertreffen. Einige der Verhaltensdimensionen, wie sie in Freundschaftsbeziehungen älterer Kinder nachgewiesen wurden, konnten auch schon zwischen Kleinkind-Dyaden beobachtet werden, z.B. sich gegenseitig Helfen, Intimität suchen bzw. sich von anderen Kindern abgrenzen, Loyalität und Gleichartigkeit demonstrieren und Besitz mit dem Partner teilen (Whaley & Rubenstein, 1994). Im Alter von drei Jahren benutzen Kinder bereits den Begriff des Freundes und benennen bestimmte Kinder als Freunde. Diese Wahlen sind unter Umständen recht stabil. Howes (1983) konnte zeigen, dass Kinder im Vorschulalter ihre Freundschaften im Mittel ca. zwei Jahre lang aufrechterhielten. Doch können elaborierte Vorstellungen darüber, was eine Freundschaft ausmacht, erst von älteren Kindern artikuliert werden und sind u.a. abhängig von der kindlichen Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Das zentrale Freundschaft konstituierende Thema in der frühen Kindheit zwischen drei und sechs Jahren ist die Maximierung von Anregung, Aufregung und Spaß; gemeinsam verbrachte Spielzeit, gemeinsame Spielthemen und die einseitig eingeforderte „Nettigkeit“ des Anderen sind für Kinder bis zum Alter von ca. acht Jahren Motive für ihre Freundschaftsbeziehungen (Selman, 1984). Erst später gewinnen Persönlichkeitseigenschaften und ideelle Werte wie Vertrauen und Intimität an Bedeutung. Auf der Verhaltensebene zeigen sich aber bereits früher Unterschiede zwischen befreundeten und nicht befreundeten Kindern. Kinder, die sich als beste Freunde auswählen, schaffen es besonders gut, in sozialen Spielen ihre Emotionen zu kontrollieren, eigene Handlungsimpulse mit den Bedürfnissen des Spielpartners abzustimmen und Konflikte nicht eskalieren zu lassen. Es gelingt ihnen, ein Klima gegenseitigen Einverständnisses und der Solidarität zu schaffen (Gottman, 1983). Freundschaftsbeziehungen gelten in vielfacher Hinsicht als wichtig für die Sozial- und Persönlichkeitsentwicklung. Sie stärken das Selbstwertgefühl, bieten Raum für Intimität und Zuneigung und das Gefühl von Zusammengehörigkeit und einer verlässlichen Allianz. Freunde widmen einander Hilfe, Unterstützung und Fürsorge (Harring u.a., 2010). Freundschaften bieten beste Möglichkeiten zum Ausbau sozial kompetenten Verhaltens, weil zusätzlich zur von James Youniss beschriebenen symmetrischen Reziprozität noch die gegenseitige Wertschätzung und affektive Bindung dazukommt, was die Bereitschaft zur Suche nach Lösungen oder Kompromissen noch erhöht. Damit sind sie auch ein Prototyp für gelingende Beziehungen. In vielen Studien finden sich Belege, dass Kinder mit reziproken Freundschaften in der Peer-Gruppe besser zurechtkommen. Sie werden z.B. häufiger von anderen Kindern visuell beachtet und initiieren häufiger Interaktionen; außerdem werden sie von trainierten Beobachtern als sozial kompetenter eingeschätzt (Vaughn et al., 2000). 9 10 3. Einige Schlussfolgerungen für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen In Peer-Gruppen vollziehen sich - vom Kleinkindalter an - wichtige Entwicklungs- und Lernprozesse; gleichzeitig sind mit dem Gruppenleben in Kitas aber auch negative Erfahrungen und Entwicklungsrisiken verbunden. Im Folgenden sollen abschließend noch einige Hinweise darauf gegeben werden, was pädagogische Fachkräfte konkret tun können, um positive Peer-Interaktionen und den Aufbau von Beziehungen und Freundschaften zwischen den Kindern zu fördern. 3.1 Förderliche Rahmenbedingungen schaffen Bevor sich Kleinkinder gegenseitig entwicklungsanregende Impulse geben können, müssen sie zu den betreuenden Erwachsenen eine tragfähige Beziehung aufgebaut haben. Dies wird durch ein generell feinfühliges und kindorientiertes Verhalten, durch eine langsame Gewöhnung an die neue Umgebung und durch die Gewährleistung einer stabilen Betreuungssituation (keine Wechsel der Betreuungspersonen) unterstützt. Auch die Gruppe sollte in ihrer Gesamt-Zusammensetzung auf Kontinuität ausgelegt sein, damit die Kinder Gelegenheit haben, die anderen Kinder als Sozialpartner in ihren Reaktionsweisen und Spielvorlieben kennen zu lernen und ein geteiltes Wissen über Interaktionsmuster und –rituale zu erwerben. Kinder bis zum vierten Lebensjahr sind noch stark auf Einübung und Wiederholung von ganz spezifischen Situationen und Ritualen angewiesen, um deren Bedeutung zu erlernen, wiederzuerkennen und adäquate Handlungsbeiträge zu leisten. Die Chance, dass sich aus Spielkontakten individuelle soziale Beziehungen zwischen Kleinkindern entwickeln, bietet sich ebenfalls nur auf der Basis regelmäßig gemeinsam verbrachter Zeit in vertrauter Umgebung (Howes, 1988). Ideal im Sinne der Anbahnung und positiven Wirkung von Peer-Kontakten wäre, wenn jedem Kind regelmäßig mindestens drei oder vier altersgleiche oder altersähnliche Kinder sowie mindestens ein oder zwei Spielpartner desselben Geschlechts zur Verfügung stünden, wobei es weniger auf das tatsächliche Geburtsdatum als vielmehr auf das Entwicklungsalter ankommt. Dies ist in altershomogenen Gruppen gut zu realisieren, und ebenso in altersgemischten Arrangements, sofern zwei Gruppen gut miteinander kooperieren und sich Kinder auch regelmäßig gruppenübergreifend zusammenfinden können (Riemann & Wüstenberg, 2004). Die Räumlichkeiten sollten daraufhin überprüft werden, ob sie so gestaltet sind, dass sie ungestörte Spielabläufe ermöglichen, Rückzugsmöglichkeiten für zwei oder drei Kinder sowie Platz zum Rennen, Ballspielen, Verstecken und Jagen bieten. Wenn Tische mit einer Decke zu Höhlen, Stühle hintereinander gestellt zu Eisenbahnen werden können, unterstützt das Kleinkind-Kontakte ebenso wie eine sinnvolle Spielzeugauswahl. Kleinere, attraktive Materialien, auch Bewegungsspielzeuge sollten mehrfach vorhanden sein; besonders hervorzuheben ist jedoch die Vorliebe für Alltagsmaterialien, insbesondere große, stabile Elemente wie Verpackungskartons, Plastikwannen, große Papprollen usw. – sie werden in der Kleinkindgruppe zu wahren „Kommunikationsförderern“ mit hohem Spiel- und Anregungswert. Für ältere Kinder sind es vor allem vielfältige Rollenspielmaterialien, die die Kinder dazu animieren, miteinander in komplexe soziale Spielaktivitäten einzutreten. Diese sollten möglichst nicht nur, wie es leider noch sehr typisch ist, Familien- und Haushaltsszenarien entlehnt sein (Küchenutensilien, Röcke, Hüte und Schals), sondern auch Arbeits- und Berufswelten abbilden und Abenteuer- und Heldenspiele usw. ermöglichen. 10 11 3.2 Interaktionen zwischen Kindern anbahnen, moderieren und erweitern Interaktionen zwischen Kleinkindern fördern und ihr Entwicklungspotenzial nutzen heißt zunächst einmal respektvoll damit umzugehen und anzuerkennen, dass diese für Kinder eine wichtige Bedeutung haben. Leider passiert es recht häufig, dass Erzieherinnen Kind-KindInteraktionen unterbrechen. Oft geschieht das ungewollt, weil sie nicht genau hingesehen haben und deshalb nicht sensibel dafür sind, was gerade zwischen den Kindern vor sich geht. Manchmal steckt aber auch Absicht dahinter, weil sie z.B. einen sich vermeintlich anbahnenden Konflikt vermeiden wollen, aggressives Verhalten unterstellen oder einfach der gute Wille da ist, schnell zu helfen. Die Kinder können aber nur Erfahrungen miteinander machen und im Kontakt voneinander lernen, wenn Erwachsene sie auch lassen. Kindern vermittelt sich durch unser Handeln - oft ganz ohne Worte -, ob wir das, was sie miteinander tun, für wichtig erachten, und ob wir ihnen die Regelung der eigenen Angelegenheiten zutrauen. Der erste Schritt besteht also darin, den sozialen Austausch bewusster wahrzunehmen und nicht vorschnell einzugreifen - also im Zulassen. Bei jüngeren Kindern ist es zudem sinnvoll, sie in ihrer Wahrnehmung füreinander zu unterstützen und den sozialen Austausch unter ihnen in alltäglichen Situationen anzuregen. Hierfür kann man im Alltag unaufdringlich immer wieder Hinweise geben, indem man sich selbst am Spiel beteiligt, Spielszenen initiiert, auf Tätigkeiten und Entdeckungen von anderen Kindern aufmerksam macht und Vorschläge für gemeinsame Handlungen entwickelt. Der Handlungsfluss der Kinder sollte dadurch weder unterbrochen noch dominiert werden. Es geht darum, gerade so viel Impulse zu setzen, dass ein begonnener Kontakt nicht abbricht oder eine Spielidee weiter geführt werden kann („Zone nächster Entwicklung“). Marie soll vom Sandkuchen kosten, aber sie versteht nicht ganz, was Oleg von ihr will? Nehmen Sie Blickkontakt zu Marie auf, und kosten Sie selbst mit weit geöffnetem Mund und klarer Gestik. Dann können Sie Oleg nochmals ermuntern: So, nun lass die Marie auch probieren! Eine solche Form der Begleitung hilft Kindern, der Situation eine gemeinsam geteilte Bedeutung zu verleihen und ihr Verhalten daran auszurichten. Man muss Kleinkinder nicht fortwährend und permanent aufeinander aufmerksam machen. Vielmehr gilt es, Interaktionssituationen, die sich sowieso gerade zwischen den Kleinen anbahnen, als solche wahrzunehmen und ihnen feinfühlig ein „Gerüst“ oder „Geländer“ anzubieten, damit sie sich weiter entwickeln können (Viernickel & Stenger 2010). Ein zentraler Bestandteil des Zusammenlebens in Krippe und Kindertageseinrichtung ist es, sich durch die Teilhabe an vielfältigen soziokulturellen Aktivitäten als Teil einer sozialen Gemeinschaft zu erleben, in der soziale Umgangsformen geformt, kulturelle Praktiken erlernt sowie gesellschaftliche Werte erfahren und gebildet werden. Alltagsrituale mit der gesamten Gruppe (z.B. Tischsprüche) und fest installierte Gelegenheiten zum Austausch und zur wechselseitigen Bezugnahme (z.B. im Morgenkreis, im Kinderparlament) sind hierfür von Bedeutung. Wichtig ist auch der Umgang mit Konflikten, die etwa in Form von Besitzkonflikten ein wichtiges Lernfeld sind. Konflikte können nicht als isolierte Geschehnisse betrachtet werden. Es geschieht häufig, dass ein gemeinsam begonnenes Spiel in einen Konflikt umschlägt oder sich umgekehrt aus einer konflikthaften Interaktion eine gemeinsame Handlung entwickelt. Die Kinder erfahren hierbei, dass der Kontakt zu einem anderen Menschen nicht nur zu verschiedenen Gelegenheiten unterschiedliche Formen haben kann, sondern auch bei ein und derselben Gelegenheit wechseln kann - und dass sie als Beteiligte an der Form des Kontakts aktiven Anteil haben. Konflikte und damit die Chance ihrer Lösung gehören somit zum sozialen Spiel und machen einen Teil ihres Lern- und Anregungswertes aus. 11 12 Es ist eine hohe Kunst herauszufinden, wann genau Unterstützung wichtig wird und die Konfliktlösung zu moderieren, ohne sie den Kindern aufzuzwingen. Dazu ist es notwendig, die individuelle innere Logik, die die beteiligten Kinder der Situation geben, nachzuvollziehen und anzuerkennen. Wenn die Aushandlungskompetenzen der Kinder erschöpft sind, sollte allerdings rechtzeitig vor einer Eskalation eingegriffen werden. Dabei hat es sich bewährt, die Gefühle und Bedürfnisse der beteiligten Kinder zu verbalisieren, ihnen Beruhigung und Trost zu gewähren, beide Sichtweisen einzunehmen und zu vermitteln, auf eine für alle zufrieden stellende Lösung hinzuarbeiten oder Alternativen anzubieten. Wichtig ist, nach Beendigung des Konflikts ausdrücklich die positive Beziehung zwischen den Kindern hervorzuheben. Schließlich sollten pädagogische Fachkräfte ein Auge auf die individuellen Kompetenzen der einzelnen Kinder haben, um ihre Spielkontakte und -beziehungen zu gestalten, und auf die Konstellationen, die sich in ihren Gruppen zusammen finden. Manche Kinder benötigen Unterstützung, um den „Eingang“ in eine spielende Gruppe zu finden; sei es, weil sie noch neu sind und die anderen Kinder nicht gut kennen, sei es, weil sie von ihrem Temperament her eher zurückhaltend sind oder weil sie über keine oder unangemessene Strategien verfügen. In solchen Fällen ist es sinnvoll, den Kindern Anknüpfungspunkte zu eröffnen, das Anliegen des Mitspielens gegenüber der Spielgruppe zu verbalisieren oder auch konkrete Vorschläge zur Weiterführung der Spielideen zu machen. Über Beobachtung und auch mit Hilfe der Erstellung von Soziogrammen kann Aufschluss darüber gewonnen werden, welche Kinder sich eventuell in der Rolle der „vernachlässigten“ oder „abgelehnten“ Kinder befinden. Hier ist besondere Aufmerksamkeit und auch ein abgestimmtes Vorgehen im Team notwendig, um die Ursachen für die ungünstigen Positionen in der Peer-Gruppe besser zu verstehen und pädagogisch reagieren zu können. 4. Fazit Kinder brauchen Kinder, und die Peer-Gruppe hält wichtige Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten bereit, die Erwachsene in dieser Form nicht anbieten können. Somit ist es auch entlastend zu wissen, dass sich Bildung in Kindertageseinrichtungen nicht immer über die Erzieherinnen und Erzieher vermittelt und sich Bildungsprozesse gar nicht selten dem Zugriff von Erwachsenen entziehen. Trotzdem gehören Fingerspitzengefühl und entwicklungspsychologisches wie pädagogisches Fachwissen dazu, um eine Balance herzustellen zwischen dem Respektieren und Nicht-Einmischen in die Kinderkultur einerseits und der Gestaltung von förderlichen Bedingungen, manchmal eben auch der aktiven Regulierung von Peer-Interaktionen und -beziehungen andererseits. Literaturhinweise Verwendete Literatur Bakeman, R. & Brownlee, J.R. (1982). Social rules governing object conflicts in toddlers and preschoolers. In K. Rubin & H. Ross (Eds.). Peer relationships and social skills in childhood (pp. 99112). New York: Springer. Card, N.A. & Little, T.D. (2006). Proactive and reactive aggression in childhood and adolescence: A meta-analysis of differential relations with psychosocial adjustment. International Journal of Behavioral Development, 30, 466-480. 12 13 Coie, J.D., Dodge, K.A. & Coppotelli, H. (1982): Dimensions and types of social status: a cross-age perspective. Developmental Psychology, 18, 557-570. Corsaro, W.A. & Eder, D. (1990). Children's peer culture. Annual Review of Sociology, 16, 197-220. Dittrich, G., Dörfler, M. & Schneider, K. (2001). Wenn Kinder in Konflikt geraten. Eine Beobachtungsstudie in Kindertagesstätten. Weinheim: Beltz. Eisenberg, N. & Fabes, R.A. (1998). Prosocial Development. In W. Damon (Ed.), Handbook of Child Psychology (3), 701-778. New York: Wiley. Göncü, A. (1993). Development of intersubjectivity in the dyadic play of preschoolers. Early Childhood Research Quarterly, 8, 99-116. Gottman, J.M. (1983). How children become friends. Monographs of the Society for Research in Child Development, 48 (3, serial no. 201). Harring, M., Rohlfs, C., Palentien, Ch., Böhm-Kasper, O. (Hrsg.) (2010): Freundschaften, Cliquen und Jugendkulturen: Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Hartup, W.W., Laursen, B., Stewart, M.I. & Eastenson, A. (1988). Conflict and the friendship relations of young children. Child Development, 59, 1590-1600. Hay, D.F. (1994). Prosocial Development. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 35 (1), 29-71. Howes, C. (1983). Patterns of friendship. Child Development, 54, 1041-1053. Howes, C. (1988). Peer interaction of young children. Monographs of the Society for Research in Child Development, 53 (1, serial No. 217). Howes, C. & Matheson, C.C. (1992). Sequences in the development of competent play with peers: Social and social pretend play. Developmental Psychology, 28(5), 961-974. Maccoby, E.E. & Jacklin, C.N. (1987). Gender segregation in childhood. In E.H. Reese (Ed.), Advances in child development and behavior, Vol. 20 (pp. 239-287). New York: Academic Press. Moreno, Jakob L. (1974). Die Grundlagen der Soziometrie. Wege zur Neuordnung der Gesellschaft. Opladen: Leske + Budrich. Newcomb, A.F., Bukowski, W.M. & Pattee, L. (1993). Children`s peer relations: A meta-analytic review of popular, rejected, neglected, controversial, and average sociometric status. Psychological Bulletin, 113, 99-128. NICHD Early Childcare Research Network (2004). Trajectories of physical aggression from toddlerhood to middle childhood. Monographs of the Society for Research in Child Development, 69 (Serial No. 278). Olweus, D. (1979). Stability of aggressive reaction patterns in males: A review. Psychological Bulletin, 86, 852-857. Piaget, J. (1968/1972): Sprechen und Denken des Kindes. Düsseldorf: Schwann. Putallaz, M. & Dunn, J. (1990). The importance of peer relations. In M. Lewis & S.M. Miller (Eds.), Handbook of developmental psychopathology (pp. 227-236). New York: Plenum. Riemann, I. & Wüstenberg, W. (2004). Die Kindergartengruppe für Kinder ab einem Jahr öffnen? Eine empirische Studie. Frankfurt: Fachhochschulverlag. Rauh, H. (1985). Soziale Interaktion und Gruppenstruktur bei Krabbelkindern. In Ch. Eggers (Hrsg.), Bindungen und Besitzdenken beim Kleinkind (S. 204-232). München: Urban & Schwarzenberg. Selman, R.L. (1984). Die Entwicklung des sozialen Verstehens. Entwicklungspsychologische und klinische Untersuchungen. Frankfurt: Suhrkamp. 13 14 Simoni, H., Herren, J., Kappeler, S. & Licht, B. (2008). Frühe soziale Kompetenz unter Kindern. In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklungsprozesse und Fördermöglichkeiten (S. 15-34). Stuttgart: Kohlhammer. Snyder, J., Horsch, E. & Childs, J. (1997). Peer relationships of young children: Affiliative choices and the shaping of aggressive behavior. Journal of Clinical Child Psychology, 26, 145-156. Vaughn, B.E., Azria, M.R., Caya, L.R., Newell, W., Krzysik, L., Bost, K.K. & Kazura, K.L. (2000). Friendship and social competence in a sample of preschool children attending head start. Developmental Psychology, 36 (3), 326-338. Viernickel, S. (2000). Spiel, Streit, Gemeinsamkeit. Einblicke in die soziale Kinderwelt der unter Zweijährigen. Landau: VEP. Viernickel, S. & Stenger, U. (2010). Didaktische Schlüssel in der Arbeit mit null- bis dreijährigen Kindern. In Kasüschke, D. (Hrsg.), Didaktik in der Pädagogik der Frühen Kindheit (S. 175-198). Kronach: Carl Link. Völkel, P. (2002). Geteilte Bedeutung – Soziale Konstruktion. In: H.-J. Laewen & B. Andres (Hrsg.), Bildung und Erziehung in der frühen Kindheit (S. 159-207). Weinheim: Beltz. Von Salisch, M. (2000). Zum Einfluss von Gleichaltrigen (Peers) und Freunden auf die Persönlichkeitsentwicklung. In M. Amelang (Hrsg.), Determinanten individueller Unterschiede (S. 345-405). Göttingen: Hogrefe. Whaley, K.L. & Rubenstein, T.S. (1994). How toddlers ‘do’ friendship: a descriptive analysis of naturally occurring friendships in a group child care setting. Journal of Social and Personal Relationships, 11, 383-400. Youniss, J. (1980). Parents and peers in social development: A Sullivan-Piaget perspective. Chicago: University of Chicago Press. Leseempfehlungen Brandes, H. (2008): Selbstbildung in Kindergruppen. Die Konstruktion sozialer Beziehungen. München: Reinhardt Hammes-DiBernardo, E., Speck-Hamdan, A. (2010): Kinder brauchen Kinder: Gleichaltrige – Gruppe – Gemeinschaft. Berlin: das Netz. Viernickel, S. (2011). Spiele und Kontakte unter Kleinstkindern. In: Neuss, Norbert (Hrsg.). Grundwissen Krippenpädagogik. Berlin Mannheim: Cornelsen. Viernickel, S. (2010). Soziale Kompetenzen im Kontext von Peer-Beziehungen. In Stamm, M. & Edelmann, D. (Hrsg.). Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung: Was kann die Schweiz lernen? (S. 55-73). Zürich: Ruegger. Viernickel, S. (2006). Zur Bedeutung der Peerkultur. In Fried, L. & Roux, S. (Hrsg.). Handbuch Pädagogik der frühen Kindheit (S. 65-74). Weinheim: Beltz. Viernickel, S. (2000). Spiel, Streit, Gemeinsamkeit. Einblicke in die soziale Kinderwelt der unter Zweijährigen. Landau: Verlag Empirische Pädagogik. 14