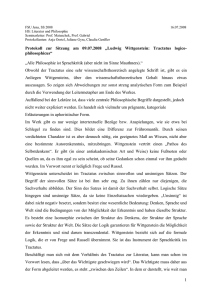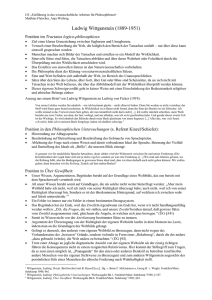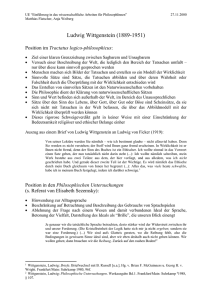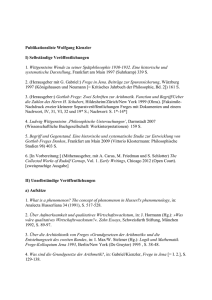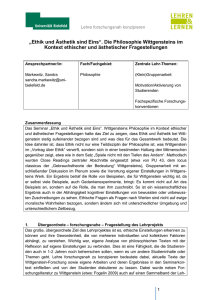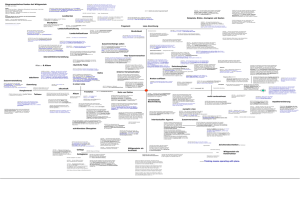Foto: David C. Schneider
Werbung

Foto: David C. Schneider Inhalt Ronny Kraus Was ist ein Philosoph? Eine steuerrechtliche Antwort......................... ................ 3 A Sprachphilosophie Pirmin Stekeler-Weithofer Die Frage nach dem Sinn........................................................................................... 9 Stefan Tolksdorf Reden ‚Als-ob’ – Sind Fiktionalisten die besseren Anti-Realisten? .................. 29 James Conant A Development in Wittgenstein’s Conception of Philosophy: From “The Method” to Methods…………………………………….. .......... 55 Geert Keil „Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder“ .................................. ............. 81 Birgit Griesecke / Werner Kogge Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang. Wittgensteins grammatische Methode als Verfahren experimentellen Denkens.............................................101 Günter Abel Epistemische Objekte als Zeichen- und Interpretationskonstrukte........ .......127 Christian Stetter Freind oder feund? Einige sprachphilosophische Konsequenzen aus Nelson Goodmans Analyse des Induktionsproblems........................................157 viii Inhalt B Philosophie des Geistes Joachim Schulte Wie ist der Solipsist in der Fliegenglocke zur Ruhe zu bringen?................. ....177 Andrea Kern Handeln ohne Überlegen............................................................... ........................193 Matthias Schloßberger Diltheys ursprüngliche Einsicht. Verstehen ist Verstehen von Ausdruck...................................................................................................................221 Christoph Demmerling Kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts. Nachdenken über Empfindungen und Gefühle im Anschluss an Wittgenstein............................239 Heinke Deloch Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität. E.T. Gendlins Philosophie des Impliziten und die Methode Thinking at the Edge..................................................................................................257 Ralf Stoecker „Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich“ – Hilfreiche Anregungen Wittgensteins für die moderne Handlungstheorie.....................................................................................................283 Richard Raatzsch Logisches und Psychologisches, Subjektives und Objektives in Bezug auf das Wesen der Zahl……………………………………………301 C Religionsphilosophie Holm Tetens Nach dem „Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee“...................................................................................................325 Thomas Rentsch Was ist spezifisch religiöse Transzendenz? Kritische Bemerkungen zu Hans Julius Schneider, Religion..............................................................................339 Inhalt ix Hans G. Ulrich Tradition und Reflexion.........................................................................................347 Herta Nagl-Docekal ‚Many Forms of Nonpublic Reason’? Religious Diversity in Liberal Democracies...............................................................................................363 Harald Wohlrapp Eine pragmatische Definition der Religion........................................................379 Matthias Kroß Doch noch einmal zurück zum frühen Wittgenstein!.......................................409 Kuno Lorenz Der Buddhismus – Eine gottlose Religion des Friedens..................................429 Peter Ackermann Ahnen in einer buddhistisch geprägten Kultur..................................................453 Gottfried Gabriel Rudolf Carnaps Mitschrift der Fregeschen Vorlesung „Logik in der Mathematik“...................................................................................467 D Stellungnahmen Hans Julius Schneider Stellungnahmen…………………………………………………………..493 Literaturverzeichnis………………………………………………………561 Register…………………………………………………………………..571 Vorwort In den meisten Fällen ist der Versuch zum Scheitern verurteilt, in den vielfältigen Schriften und Vorträgen eines Philosophen trotzdem einen durchgehenden Gedanken und ein gemeinsames Motiv des Philosophierens zu entdecken. Im philosophischen Werk von Hans Julius Schneider jedoch glauben wir Herausgeber der ihm zugedachten Festschrift einen solchen durchgehenden Grundgedanken zu erkennen. Der Titel versucht ihn auf den Begriff zu bringen: „In Sprachspiele verstrickt – oder: wie man der Fliege den Ausweg zeigt“. Die Zweiteilung des Titels verweist auf zwei Themen, die gleichwohl miteinander zusammenhängen. Im ersten Teil nimmt der Begriff des Sprachspiels eine Konzeption des späten Wittgenstein auf, die in beinahe allen Schriften Schneiders entweder einen unübersehbaren impliziten Hintergrund bildet oder aber sogar explizit thematisiert wird. Der Begriff des Sprachspiels bringt die konstitutive Verflechtung von Wissen und Können, von sprachlichen und nicht-sprachlichen Handlungsformen in ein Bild. Die Einsicht, dass Sprechen Handeln ist und Wissen auf Können basiert, entfaltet bei Schneider an unterschiedlichsten Stellen ihre Konsequenzen, etwa beim Zusammenspiel von Phantasie und Kalkül, Handlung und Logik, beim Verstehen mentaler und moralischer Sprachspiele, aber auch bei der Frage nach dem Sinn der Rede von „Gott“ und dem Charakter religiöser Erfahrungen. Die angedeutete Synthese von Können und Wissen setzt Schneider produktiv zu neuartigen Antworten auf alte Fragestellungen der Philosophie um und verschmilzt auf diese Weise höchst originell die Spätphilosophie Wittgensteins mit einigen Schlüsselideen des Erlanger Konstruktivismus. Gerade mit dieser Verschmelzung hört die Sprachanalyse auf, nur eine „negative“ Therapie zu sein, die die philosophischen Probleme wie eine „Krankheit“ überwindet. Sie eröffnet vielmehr jetzt auch positive systematische Einsichten bis hin zu einer existenztragenden Klarheit etwa im Falle der Schneiderschen Analyse religiösen Sprechens. Damit sind wir beim zweiten Teil des Titels angekommen: der Fliege und dem Fliegenglas. Bei Wittgenstein heißt es: „Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen“. Wie immer dieser Aphorismus letztendlich auch zu deuten ist (vgl. dazu den Beitrag von Joachim Schulte in diesem Band), in jedem Fall bezieht er sich auf den therapeutischen Weg des Philosophierens, Probleme durch übersichtliche Darstellung unserer sprachlichen und nicht-sprachlichen Handlungszusammenhänge zu entwirren. Der Begriff des Sprachspiels hat bei Wittgenstein und Schneider seinen systematisch Ort in der Beseitigung begrifflicher Verwirrungen. Dabei zielt die Therapie in erster Linie auf die Klärung unserer Gedanken, um so die vielfältigen Formen beispielsweise von moralischen, religiösen, wissenschaftlichen und lebensweltlichen Praxen besser zu verstehen. Bei Wittgenstein aller- 2 Vorwort dings bleibt die Antwort auf eine nahe liegende Frage ambivalent bis undurchsichtig: Wohin entwischt die Fliege (der Philosoph) nach ihrer Befreiung, erhält sie die Chance zu einem neuartigen, einem besseren Philosophieren oder führt sie nun ein Leben frei von philosophischen Erwägungen? Einige Beiträge und nicht zuletzt die Stellungnahmen Schneiders plädieren für eine These, die Schneiders philosophisches Werk insgesamt so nachdrücklich bekräftigt und durch die philosophische Tat illustriert: Es gibt ein substanzielles Philosophieren nach der Befreiung aus dem Fliegenglas. Anlässlich seiner Emeritierung wurde Schneider im Sommer 2009 an der Universität Potsdam mit einer Tagung unter dem Motto „Der Geist im Fliegenglas“ geehrt. Die vorliegende Festschrift greift den Geist dieser Veranstaltung auf. Dort ging es nicht zuletzt um den Gedanken, was am Ende einer Klarstellung unserer Zeichenvollzüge steht. Für Wittgenstein endet jede Klarstellung (auch) mit der Einsicht: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. In einem autobiografischen Abschnitt zu Beginn seiner Stellungnahmen zu den Beiträgen der anderen Autoren kommentiert Schneider dieses berühmte Diktum Wittgensteins auf seine Weise: „Bevor ein Text das bei seiner Veröffentlichung jeweils erreichte Maß an Klarheit hat, habe ich das mir unerträgliche Gefühl, ihn selbst nicht wirklich zu verstehen.“ Es muss dieses Gefühl sein, das Schneider beharrlich antreibt, an seinen Texten zu arbeiten. Den Lohn dieses Ringens um seine Texte dürfen seine Leser dankbar ernten: Philosophische Texte, die sich außerordentlich gut lesen und verstehen lassen. Sie stehen damit gegen eine bis heute verbreitete Untugend in der philosophischen Schriftstellerei, die Günther Patzig einmal so charakterisiert hat: Nur was dunkel gesagt ist, ist philosophisch tief gedacht. Die Festschrift vereint Aufsätze zu den drei Schwerpunkten der Philosophie Schneiders: der Sprachphilosophie, der Philosophie des Geistes und der Religionsphilosophie. Eingerahmt werden sie durch zwei Beiträge am Anfang und am Ende, die sich der thematischen Dreigliederung entziehen. Ronny Kraus eröffnet den Band. Auf pfiffige Weise und mit einem Augenzwinkern berichtet er von der, Philosophen durchaus vertrauten, Erfahrung, sich als Philosoph oder als Philosophin der Gesellschaft in der Öffentlichkeit andienen zu müssen. Am Ende steht Gottfried Gabriels Veröffentlichung der Mitschrift Carnaps einer Vorlesung Freges zur Logik in der Mathematik aus dem Jahr 1914. Der hier erstmals abgedruckte Text der Mitschrift weicht gelegentlich vom Format der anderen Beiträge ab. Diese Abweichungen sind inhaltlich motiviert, sie ergeben sich aus der Verwendung mathematischer / logischer Formeln und Darstellungen. Potsdam & Berlin, Frühjahr 2010 Stefan Tolksdorf & Holm Tetens Was ist ein Philosoph? Eine steuerrechtliche Antwort Ronny Kraus Die Ausgangslage In Deutschland gibt es ein Steuerprivileg für die sogenannten Freien Berufe. Wer einen der Freien Berufe ausübt (und die entsprechende Qualifikation nachweisen kann), ist von der Gewerbesteuer befreit. Wer die Qualifikation nicht nachweisen kann, übt ein Gewerbe aus und muss für dieselbe Tätigkeit Gewerbesteuer abführen. Für Steuerzahler mit einem Abschluss in Philosophie bedeutet das: Wenn man als Selbständiger z.B. als Unternehmensberater arbeitet, übt man ein fachfremdes Gewerbe aus für das man nicht qualifiziert ist und muss deshalb Gewerbesteuer zahlen. So ist die Rechtslage. Ein Brief an das zuständige Finanzamt Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrem Schreiben vom 27.05.2009 legen Sie dar, dass ich nicht als beratender Betriebswirt arbeiten kann, weil der Nachweis über meine betriebswirtschaftliche Qualifikation fehlt. Sie bieten mir an, dass ich dies nachhole und die in Selbststudium und praktischer Arbeit erworbenen Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre nachweise. Dieses Vorgehen möchte ich mir, da es Ihr Vorschlag ist, ausdrücklich vorbehalten. Bevor ich diesen Weg einschlage, möchte ich jedoch darlegen, was mein Beruf ist (1), was die Tätigkeit in diesem Beruf ist (2), was meine Tätigkeit ist (3) und dass es sich um einen der sonstigen Freien Berufe im Sinne des § 18 Abs. 1 EStG handelt (4). Ich hielt die Forderung nach einer Tätigkeitsbeschreibung und den Ausbildungsnachweisen für eine bloße Formalie und habe nicht in der gebotenen Präzision geantwortet. (1) Was ist mein Beruf? Nach meiner Ausbildung habe ich den seltenen Beruf eines Philosophen. Die Kopien meiner Abschlüsse liegen Ihnen vor. Ronny Kraus 4 (2) Was ist die Tätigkeit eines Philosophen? Die Tätigkeit eines Philosophen besteht wie bei allen anderen Berufen in der Anwendung des in der Ausbildung Gelernten. Ich zitiere dazu die Studienordnung des Instituts für Philosophie der Universität Leipzig für Magister, die die Grundlage meiner Ausbildung darstellt: Im Unterschied zu den Fachwissenschaften ist die Philosophie nicht durch einen Gegenstandsbereich bestimmt, sondern durch eine bestimmte Vorgehensweise. Philosophie ist wesentlich Reflexion […]. Ein zweites wichtiges Merkmal der Philosophie ist dasjenige der Kritik oder genauer: der Erhaltung der Kritikfähigkeit gegenüber dem Bestehendem. Ob es sich beim Gegenstand philosophischer Reflexion um die Ergebnisse, Methoden und Grundlagen der Wissenschaften handelt […] oder um die Prinzipien menschlichen Handelns […]: stets geht es dabei auch darum, Bestehendes in seinen Grenzen zu beschreiben, und das heißt letztlich: Kritik zu üben an allzu einfachen oder dogmatischen Erklärungs- und Begründungsmustern […]. Die Philosophie-Ausbildung ist darauf bedacht, kritisches Problembewusstsein zu wecken und zu entfalten, mit dem Ziel, sowohl die Reflexion theoretischer und praktischer Probleme als auch historisch-kritisches Verstehen zu ermöglichen […].1 Zusammenfassend kann man sagen, dass die Philosophie durch eine bestimmte Verfahrensweise gekennzeichnet ist, die auf (dann: nichtphilosophische) inhaltliche Gegenstandsbereiche angewendet wird. (3) Was ist meine Tätigkeit? Ich berate Unternehmen in schwierigen Situationen in denen die herkömmlichen betriebswirtschaftlichen Instrumente a) an Grenzen geraten, b) zu einem angemessenen Einsatz gebracht werden sollen, c) die schwierige Situation selbst erst herbeigeführt haben. Dies betrifft insbesondere die Situation von Unternehmen bei der Fortführung nach einer Insolvenz oder die Situation von Unternehmen in einer Krise, die durch das Versagen des (in der Regel betriebswirtschaftlich geschulten) Führungspersonals überhaupt erst entstanden sind. Grundlage dieser Arbeit ist meine Ausbildung als Philosoph, indem ich die oben genannten kritischen und analytischen Methoden anwende. D.h., der Gegenstand der Beratung ist betriebswirtschaftlicher Art, die Mittel sind philosophischer Art. Ganz analog berät ein (Arbeits-)Psychologe Unternehmen mit den Mitteln der Psychologie. _____________ 1 Die Studienordnung für den Magisterstudiengang am Institut für Philosophie der Universität Leipzig (Stand April 2005) können Sie als PDF auf folgender Internetseite einsehen: http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/ angebot/ studienangebot/ auslaufende-studiengaenge/studiendetail-alt.html?ifab_id=40 Was ist ein Philosoph? 5 Auch hier würde man den Psychologen nicht als Betriebswirt mit inadäquater Ausbildung einordnen. Da Sie gar nicht in Betracht ziehen, dass ich als Philosoph arbeite, gebe ich zwei Beispiele: Wenn ich ein Softwareeinführungsprojekt leite, lehne ich die Benutzung einiger im BWL-Studium vermittelter Instrumente bewusst ab. Es gibt z.B. keinen Projektplan, und es wird kein einziges Flussdiagramm gezeichnet. Warum? Als Philosoph weiß ich, dass ein Projektplan nur dann sinnvoll ist, wenn die Ressourcen bekannt sind, was bei einem dezidiert didaktischen Projekt wie einer Softwareeinführung eine petitio principii2 bedeutet. Als Philosoph weiß ich, dass ein Flussdiagramm keine Darstellung eines realen Vorgangs ist, sondern eine idealtypische, normative Modellierung, die, was ihren Realitätsbezug betrifft, so beliebig ist wie die Sternenbilder. Wer nicht sieht, dass ein Flussdiagramm nur darstellt, was die Mitarbeiter tun sollen und nicht was sie tun, läuft in einen naturalistischen Fehlschluss3. Bei meiner Tätigkeit versuche ich nicht, den Betriebswirten blind nachzueifern, sondern bringe vielmehr alternative Ansätze ein. Diese formuliere ich nicht in der Sprache der akademischen Philosophie, sondern in der Sprache meiner Kunden. Dass ich dies nicht ohne die in Selbststudium und durch praktische Erfahrung erworbene Kenntnis der betriebswirtschaftlichen Instrumente machen kann, versteht sich von selbst. Daher biete ich Ihnen an, zusätzlich, über die hier vorgetragene Argumentation hinaus, den Nachweis über meine umfassenden Kenntnisse in der Betriebswirtschaft vorzulegen. Da meine Arbeit und mein Rat bei Fragen der Bilanzierung, Kostenrechnung, Softwareeinführung, Produktionssteuerung und Konzernkonsolidierung (um einige der wichtigsten Arbeitsgebiete zu nennen) geschätzt werden bin ich sehr zuversichtlich, hierzu Referenzen von Wirtschaftsprüfern, Kaufmännischen Leitern und Geschäftsführern von Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, vorlegen zu können. (4) Ist der Beruf des Philosophen ein Freier Beruf? Der Beruf des Philosophen ist nicht unter den Katalogberufen des § 18, Abs. 1 EStG aufgelistet. Nach seiner Art, der Form der Ausbildung an einer Universität und der Möglichkeit der Promotion, auf Grund der oben beschriebenen Tätigkeiten eines Philosophen sowie der Tatsache, dass die Philosophie historisch und systematisch die erste aller Wissenschaften ist, vertrete ich die Auffassung, dass der Beruf des Philosophen den sonstigen Freien Berufen _____________ 2 3 die Voraussetzung des Beizubringenden der Schluss vom Sollen auf das Sein 6 Ronny Kraus zuzurechnen ist. Dies deckt sich mit der in § 1 Abs. 2 PartGG gegeben Definition der Freien Berufe: Die Freien Berufe haben im Allgemeinen auf der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt. Wer Philosoph ist und seinen Beruf durch schreibende oder mündliche Tätigkeit ausübt ist als Philosoph tätig. Es ist nicht plausibel, dass ein ausgebildeter Philosoph, der den ureigensten philosophischen Tätigkeiten, der kritischen Reflexion und dem vernünftigen Argumentieren, nachgeht, ein fachfremdes Gewerbe ausübt. Ich bitte Sie daher, meine Einkünfte aus der Tätigkeit als Philosoph als Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit zu behandeln. Ihrer Antwort sehe ich mit großem Interesse entgegen. Denn die Frage Was ist ein Philosoph? hat vor über 2300 Jahren bereits Platon in seinem Dialog Der Sophist behandelt. Platon lässt als Philosoph (wörtlich: Liebhaber der Weisheit) im strengen Sinne nur gelten, wer die Wahrheit um ihrer selbst willen anstrebt, so dass letztlich nur die private Beschäftigung als Philosophie i.e.S. gilt. Wer Kunden einen Vorteil aus seiner Beratung verspricht ist nach Platon ein bloßer Sophist (wörtlich: Ein Weiser). „Sophist“ nannte man in der klassischen Antike wandernde Berater, die ihre Dienste gegen Geld bei Rechtsstreitigkeiten, politischen Auseinandersetzungen und Festreden anboten. Die Sophisten sind damit die Vorläufer aller Berater und Anwälte bevor sich im Laufe der Zeit die Tätigkeitsbereiche ausdifferenziert haben. Nach der Ansicht Platons bin ich also nicht den Philosophen i.e.S. zuzurechnen, sondern den Sophisten, die ihre „Weisheit“ (heute: „Dienstleistungen höherer Art“) gegen Geld (in freiberuflicher Tätigkeit?) anbieten. Mit freundlichem Gruß … Das Ergebnis Das Finanzamt hat – wie zu erwarten – nie auf dieses Schreiben geantwortet. Allerdings erging der betreffende Steuerbescheid ohne Gewerbesteuerforderungen, so dass das Finanzamt die Tätigkeit offenbar stillschweigend als philosophische Tätigkeit anerkennt. A Sprachphilosophie Die Frage nach dem Sinn Pirmin Stekeler-Weithofer Wahrem Eifer genügt, dass das Vorhandne vollkommen sei; der falsche will stets, dass das Vollkommene sei. F. Schiller 1. Sinn in einer Redepraxis und Sinn einer Praxis 1.1 Die Sinnfrage in Philosophie und Religion 1. Die Frage nach dem Sinn ist die Frage der Philosophie. Dabei geht es um Sinn und Bedeutung von Wörtern, Sätzen und Texten, bzw. von Aussagen im allgemeinen Sinne von Sprechhandlungen (unter Einschluss von Versprechungen oder Fragen oder Aufforderungen) ebenso wie um die Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens oder der Welt im ‚Ganzen’. Die Frage nach dem Sinn führt damit zu dem, was traditionell unter dem Titel „Transzendenz“ steht, auch wenn zunächst unklar sein sollte, was das ist. 2. Bei Gregor von Nazianz wird am Anfang eines schönen religiösen Gedichts oder Gebets Gott unter dem (neu)platonischen Titel „Jenseits aller Erscheinungen!“ angesprochen. Unmittelbar darauf folgt die bezeichnende zweite Zeile: „Wer kann Dich nennen?“. Sie baut eine Art Ich-Du-Beziehung zu dieser Transzendenz auf, wie sie dann auch Thema des berühmten Buches „Ich und Du“ von Martin Buber sein wird. Ob personal angesprochen oder nicht, in jeder Rede von einer Transzendenz geht es um eine Überschreitung eines allzu eingeschränkten Sinns, d.h. eines allzu eng gefassten ‚Bereich des Normalen’. Man kann z.B. eine objektstufige Fokussierung auf endliche Dinge und empirische Phänomene überschreiten, indem man nicht auf Gegenstände der Rede und der empirischen Untersuchungen achtet, sondern auf den Rahmen, in dem sie stehen, und wie durch ihn die Konstitution oder Verfassung der Gegenstände (mit)bestimmt ist. Martin Heidegger deckt im Dasein, unserer eigenen Seinsweise, eine Art Gesamtrahmen für Sinn auf. Der Vollzug von Wissenschaft, ja alles Wissen, steht immer schon im Zusammenhang zu anderen Vollzügen des Lebens. 10 Pirmin Stekeler-Weithofer Diese immanente Transzendenz führt von begrenzten Gegenständen des Wissens, etwa den empirischen Dingen, zum allgemeinen Rahmen, vom Seienden zum Sein. Ein solcher Übergang ist wie der von einem Tun zum Nachdenkens über das Tun immer auch schwer zu artikulieren und schwer zu verstehen, so wie ja auch der Schritt von der Erforschung der Natur (physike techne) zum Nachdenken über das Wissen von der Natur (Metaphysik) als Eintritt in eine ‚höhere’ Sphäre erscheint. Entsprechendes gilt schon für den Weg des Parmenides vom Denken zum Nachdenken über das Denken, zur Logik und Methode. Schon hier handelt es sich aber ‚nur’ um eine ‚metastufige’ Explikation eines schon praktisch bekannten Könnens. 3. Auch in Kants Gegenüberstellung von „transzendent“ und „transzendental“ geht es darum, immanent sinnvolle Reden, die sich nicht unmittelbar auf die empirische Welt der Erscheinungen beziehen, von sinnlosen, weil willkürlichen, Annahmen über ein unzugängliches Jenseits zu unterscheiden. Transzendentale Reden artikulieren Formmomente unserer condition humaine. Transzendentale Bedingungen eines auf Objekte bezogenen und insofern objektiven (Erfahrungs-)Wissens sind implizite oder besser empraktische (Karl Bühler) Präsuppositionen im Vollzug des Wissens. Diese werden in der objektstufigen Fokussierung auf Erfahrung nicht bemerkt, eben weil wir sie als selbstverständlich voraussetzen. Sie zu artikulieren oder explizit zu machen ist die Aufgabe von Transzendentalphilosophie. Diese ist kritische Philosophie, indem sie sich gegen ‚transzendente’ Deutungen des Übertritts von empirisch Einzelnem zum begrifflich Allgemeinem bzw. von Erscheinungen zu einem ‚Jenseits’ der Erscheinungen richtet, und das durchaus auch in den theoretischen Erklärungen der Erscheinungen durch die Wissenschaften. Gerade die Einbettung konkreter Wissensansprüche, auch der Ergebnisse der Wissenschaft, in ihren praktischen Rahmen zeigt deren je begrenzte Reichweite. Man denke z.B. an die Arbeitsteilung zwischen Physik, Chemie und Biologie bzw. an Entsprechendes in den Humanwissenschaften, samt der thematischen und methodischen Aspektdifferenz des jeweiligen Wissens. 4. Über deskriptive Explikationen der realen Formen unserer Praxis hinaus geht die Artikulation so genannter regulativer Ideen, in denen wir kontrafaktisch so sprechen, als gäbe es ‚unendliche’ Erfüllungen idealer Bedingungen. Der rechte Sinn einer solchen Betrachtung sub specie aeternitatis ist nun aber selbst erst zu befragen. In dieser besonderen Form unseres Redens über uns selbst und unsere Welt spielt ein fingierter Blickpunkt eines vorgestellten Gottes eine besondere Rolle. Doch am Ende gibt es hier weniger zu ‚glauben’ als zu verstehen. Die Frage nach dem Sinn 11 5. Charles Taylor sieht in seinem 2007 erschienen Buch A Secular Age1 den ‚Glauben an Gott’ als Überschreitung einer stabilen ‚mittleren Lage’ („stabilized middle condition“) in Richtung auf eine am Ende nie voll erreichbare Fülle („fullness“). Eine derartige Sinnorientierung verfehle ein moderner Ungläubiger („unbeliever“) allein schon deswegen, weil er, wie ich Taylors Gedanken kurz zusammenfassen würde, die Beurteilung seiner mittleren, sozusagen ‚bürgerlichen’, Erfolge am Ende selbst in seinen Händen behalten möchte. Diese Art von Streben nach Macht und durchgehender Selbstbeurteilung führt aber gerade nicht zu Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, sondern zu Selbstgerechtigkeit. Diese verhindert jeden Enthusiasmus und jede Erfahrung einer widerfahrnisartigen ‚göttliche Gnade’, wie sie für ein gutes Leben nötig sind. Problematisch wird dann aber Taylors These, die immanente Zielsetzung der Verbesserung der menschlichen Lage („human flourishing“) vermöge die Frage nach dem Sinn nie zu befriedigen. Taylor verwischt in ihr nämlich die zentrale Differenz zwischen dem begrenzten Ziel der Verbesserung bloß meiner Lage oder der Lage der Meinen, wer immer das auch sein mag, die Familie, der Stamm, die Nation, und der Teilnahme an einem ‚unendlichen’ Projekt der Entwicklung ‚der Menschheit’. Letzteres transzendiert jeden bloß ‚subjektiven’ Sinn, und zwar ohne ein ‚göttliches’ Jenseits. Wenn ‚der Mensch’ im Mittelpunkt steht, heißt das also noch lange nicht, dass je ich oder je wir uns zu wichtig nehmen. Wer ‚den Menschen’ im rechten Sinn in den Mittelpunkt stellt, tut dies außerdem notwendigerweise schon unter Einschluss von Tieren, Pflanzen, der Erde und dem Leben auf ihr. Außerdem ist es problematisch, dass Taylor seine Untersuchung des Verhältnisses von Säkularität und Religiosität mit der bloß subjektiven Empfindungsperspektive des Einzelnen anfängt. Damit werden die allgemeinen begrifflichen Analyse-Ansätze im Nachgang zu Kants Transzendentalphilosophie, von Hegel bis Heidegger, im Grunde unterschätzt. Denn um Erfüllungsgefühle geht es hier überhaupt nicht. Es geht eher um eine Kritik eines bloß partialen Selbstbewusstseins sowohl der religiösen Traditionen, als auch einer vermeintlich ‚wissenschaftlichen’ Aufklärung und szientistischen Säkularisation mit ihren Materialismen und Empirismen. Taylors Verdächtigung ‚der Vernunft’ als bloß verstandesmäßige Haltung instrumentellen Denkens und eines nietzscheanischen oder auch nur pragmatistischen Willens zur Macht verkennt, dass es hier, sozusagen, dritte Wege gibt. Die erwähnte Gefahr der Selbstgerechtigkeit einer bloß vermeintlichen Aufklärung und Vernunft der Moderne wurde im 19. Jahrhundert, etwa auch bei Heinrich Heine, bekanntlich unter dem Titel „Philistertum“ diskutiert. Die Diskussion stand im Einflussbereich der so genannten Romantik und der klassischen deutschen Philosophie. Zu ihr gehört auch die auf Rousseau zu_____________ 1 Charles Taylor: A Secular Age, Harvard 2007, S. 7-9. 12 Pirmin Stekeler-Weithofer rückgehende Gegenüberstellung von Citoyen und Bourgeois. Der Lebensentwurf eines Citoyen reicht über sein eigenes Leben insofern hinaus, als er sein Tun im Rahmen eines Menschheitsprojektes versteht, also nicht etwa nur, wie im 19. Jahrhundert leider zumeist, bloß im Dienste seiner Nation. Dem gegenüber kreist der Bourgeois in seinem Denken und Tun nur um sich selbst und ist eben deswegen ein entsprechend eitler, also sinnentleerter, blasierter, Philister. Damit sehen wir, dass und wie es auch auf der Seite einer philosophisch säkularisierten Moderne, welche jeden ,ontischen’ Glauben an Gott als begrifflich verwirrt erkennt, ohne damit religiöse Reden in Bausch und Bogen abzulehnen, um eine Differenzierung zwischen Menschen geht, die sich mit einer ‚mittleren Lage’ im Sinne Taylors abfinden (möchten), und Personen, welche nur im Streben nach immer größerer Fülle eine Sinngebung ihres Tuns und Strebens erkennen. Die teils szientistische, teils philiströse Säkularität des 20. und 21. Jahrhunderts scheint diesen Gegensatz freilich kaum mehr zu kennen oder nicht mehr zu verstehen und damit in den Zustand zu verfallen, den Johann Gottlieb Fichte mit dem etwas blumigen Titel eines „Standes der vollkommenen Sündhaftigkeit“ bezeichnet hat. Es ist die Haltung der unbefragten Akzeptanz einer rein durch Macht und Geld gesteuerten gesellschaftlichen Ordnung, die keine weiteren Ziele der Verbesserung der allgemeinen Situation der Menschen verfolgt. 6. Der Mensch ist kein Tier (bestia). Seine Seinsform ist der von Tieren existenzial entgegengesetzt. Heidegger hat in seiner wichtigen und schwierigen Unterscheidung zwischen existenzialen Momenten einer Vollzugsform (dem Sein) und den kategorialen Aspekten einer Bezugsform (den Gegenständen eines Wissens etwa) diesen neuen Ausdruck eingeführt. Entsprechend unterscheidet sich das Sein der Tiere existenzial von dem der Pflanzen und deren Seinsweise von der der unbelebten Natur. In unseren kategorialen Unterscheidungen von Gegenstandsbereichen der Wissenschaften versuchen wir, diese Differenzen so gut es geht widerzuspiegeln – und vergessen eben diese Tatsache regelmäßig wieder, indem wir meinen, ‚eigentlich’ könnte die aus der klassischen Mechanik der Bewegungsformen unbelebter Dinge entwickelte mathematische Physik ‚alles’ erklären, ‚im Prinzip’ auch das Leben. Der Mensch ist, wie das Tier, ein zoon, ein ‚animalisches Lebewesen’. Er hat besondere ‚Eigenschaften’ und ‚Fähigkeiten’, die freilich ebenfalls genauer als besondere Daseinsweise zu bestimmen sind. Unsere besondere Seinsform ist ja in jeder Tätigkeit des Bestimmens längst schon vorausgesetzt. Ebenfalls vorausgesetzt ist, dass rein physische, unbelebte, ‚Dinge’ in ihrem Sein zu unterscheiden sind von dem Sein etwa eines Tieres; das animalische Leben eines Tieres ist aber auch verschieden von dem Leben sprach- und handlungsfähiger Menschen. Es ist schon von daher ein ‚logischer’ Irrtum szientistischer Lebenswissenschaften, das ‚Leben’ unmittelbar ‚kategorial’ als ‚Eigenschaft’ eines ‚Systems’ bestimmen zu wollen. Die Frage nach dem Sinn 13 7. Die Bedeutung von Seins- bzw. Lebensformen und dann auch von Institutionen und Praxisformen für die Frage nach dem Sinn wird insbesondere dadurch klar, dass nur im Rahmen konkreter menschlicher Praxisformen Wörter und Sprechhandlungen eine konkrete Bedeutung erhalten. Sinn und Bedeutung von Wörtern, Sätzen und Sprechhandlungen müssen sogar selbst als Institutionen oder Praxisformen betrachtet werden. Der Unterschied zwischen Institution und Praxisform besteht dabei im Grunde nur darin, dass Institutionen wenigstens in ihren Prinzipien auch durch explizite Regeln bestimmt sind. Praxisformen können weitgehend durch implizite Normen des rechten Handelns bestimmt sein, die per se noch keiner Artikulation durch sprachliche Sätze oder Regeln bedürfen. Freilich sind die Übergänge fließend. Je formeller, ausdifferenzierter und schematischer die Regeln und Regelbefolgungskontrollen werden, desto selbstverständlicher sprechen wir von einer Institution, wie z.B. der allgemeinen Institution des Rechtswesens oder der besonderen des Universitätswesens. Je informeller die normativen Formen der rechten Teilnahme an einer Praxisform sind, desto weniger neigen wir zum Gebrauch des Wortes „Institution“, so dass etwa das moralische Urteilen gerade wegen des (wohlbegründeten) Mangels an festen Regeln besser als Praxisform angesprochen wird. 1.2 Entwicklung des Besseren und der Begriff der Idee 1. Von zentraler Bedeutung für die Frage nach dem Sinn im Kontext eines Strebens nach Vollkommenheit oder Fülle ist eine Einsicht, welche im Kern schon bei Sokrates und Platon zu finden ist und welche für die Philosophie als Institution oder bestimmte kulturelle Praxis geradezu fundamental ist: Institutionen und Praxisformen haben aufgrund ihrer Tradition eine Form (eidos). Sie sind also schon geformte Praxen mit zunächst impliziten, besser: empraktischen, Normen des Richtigen und Falschen. Sie sind aber, zweitens, immer auch schon auf Verbesserung angelegt und damit, wie besonders bei Augustinus klar wird, auf eine reale oder auf eine fiktive, ‚eschatologische’, Zukunft hin ausgerichtet. Die tradierten Formen und Normen bestimmen unser Tun und Leben, und zwar indem wir die richtige Teilnahme an ihnen lernen. Was wir dabei lernen, wird seit alters am Schnellsten und Besten durch die Rede von der Rolle in einem Spiel erläutert. Hierher gehört auch die Rede von einer individuellen Person, welche, als Person, ein bestimmtes Set von Rollen gut bzw. richtig spielen gelernt hat oder zu spielen lernen kann. Eine Person zu sein, besteht daher gerade darin, verschiedene relevante Rollen spielen zu können. 2. Aufgabe von Philosophie ist es, diese Formen explizit zu machen. Ziel ist es, durch Artikulation von impliziten Normen in der Form von Sätzen, Prinzipien oder Regeln die Aktualisierungen und Entwicklungen von Praxisfor- 14 Pirmin Stekeler-Weithofer men und Normen selbstbewusst kontrollierbar zu halten. Doch das ist nicht einfach. Schon die Auseinandersetzung des platonischen Sokrates mit seinen eigenen Forderungen nach definitorischen und kriterialen Bestimmungen von normativen Urteilen über Aspekte oder Dimensionen unseres (gemeinsamen) Handelns zeigen dies. Das gilt für die Frage, was Wissen oder Wahrheit sind und wie sie erkennbar sind, bis zur Frage nach einer gerechten Ordnung oder Verfassung im Staat oder danach, welche Handlungen als fromm, tapfer, besonnen oder einfach als gut und richtig zu beurteilen sind. Dabei erkennt Platon, dass, wie im Fall des Wortes „groß“, die Grundform dieser Bewertungen relational ist, so dass eine Handlung schon dann als gut und richtig gilt, wenn sie die relevanten Mindestanforderungen des Richtigen, also sozusagen die des relativ Vollkommenen erfüllt, nicht erst dann, wenn sie absolut perfekt ist. Platon drückt sich dabei so aus, dass die Handlung ausreichend Teil haben (metechein) sollte an der Idee des Richtigen oder Guten. Die ideale Idee des Guten (idea tou agathou) artikuliert damit gewissermaßen immer nur die Richtung einer relationalen Ordnung, so wie eine geometrische Idee oder Form (eidos), z.B. die des Geraden oder der Ebene, die Richtung einer Verbesserung der Geradheit von realen Linien oder der Ebenheit von realen Oberflächen artikuliert. Was realiter je hinreichend gerade oder eben ist, muss unter kompetentem Gebrauch der Idee des Guten immer in relevanter Anpassung des Allgemeinen an den besonderen Fall beurteilt werden. Das gilt auch für die Idee der Wahrheit und des Wissens. Praxisformen oder Institutionen haben nun aber ebenfalls eine solche relationale Form. Es werden, erstens, einzelne Aktualisierungen als hinreichend gut bewertet. Und wir urteilen, zweitens, über die Vernünftigkeit allgemeiner Entwicklungen der Formen selbst. Die Formen sind als empraktische Ideen im einzelnen Handeln wirksam, indem sie ihm Sinn und Orientierung geben. Sie verweisen darüber hinaus auch auf die immer bestehende Möglichkeit der Verbesserung der allgemeinen Idee im gemeinsamen Handeln. Sie sind, sozusagen, als Ideen auf eine solche Verbesserung angelegt. Als Ideen-im-Vollzug leiten sie sowohl jede hinreichend gute Umsetzung im einzelnen Handeln, als auch die Versuche einer ausdifferenzierenden Entwicklung der Praxisformen im Ganzen. Wir können daher sagen: Der Sinn einer Handlung ist in der Regel im Rahmen einer Praxisform bestimmt. Der Sinn der Praxisform aber ist durch die Idee des guten Lebens bestimmt, die ihrerseits eine Art ‚ideale’ Richtungsbestimmung ist, nicht eine eindeutige Form. 3. Damit führt die Frage nach dem Sinn, wie schon Sokrates und Platon zu sehen scheinen, immer auch gleich zur Frage nach dem Status von Ideen und Idealen. Es könnte dabei schon ein tiefes Missverständnis sein, wenn die jüdisch-christlichen Traditionen nur in einem Gottesglauben ein die endlichen und bürgerlichen ‚mittleren’ Verhältnisse transzendierenden Sinn zu erkennen vermögen. Sicher, man kann die Rede von Göttern und Gott dazu gebrau- Die Frage nach dem Sinn 15 chen, um die Ideen und Ideale metaphorisch in einem weiten Sinn des Wortes darzustellen. Doch wer nur solche figurativen, etwa auch allegorischen, Formen der Darstellung der Ideen und Ideale kennt, der versteht sie noch nicht in ihrer Funktion, jedenfalls nicht autonom und selbstbewusst. Er beantwortet die Sinnfrage am Ende bloß erst mythisch. Und das heißt, er liest Allegorien als vermeintlich historische Erzählungen. Er sieht damit noch nicht, dass es um eine Art appellative Vergegenwärtigung von Formmomenten einer immer offenen, also nie abgeschlossenen, Entwicklung unserer eigenen ‚Idee des Guten’ geht, und um nichts sonst. Als das gemeinsame Grundproblem jedes üblichen religiösen Glaubens weltweit lässt sich damit eine verfehlte Reifizierung figurativer Redeformen ausmachen. Man geht, wie Hegel so schön sagt, ‚bewusstlos’, weil allzu ‚schematisch’, mit religiöser Sprache im Besonderen, der Metaphorik existenzialer Reflexion im Allgemeinen um. Die Folge eines solchen allzu ‚wörtlichen’ Verstehens ist eine uns von uns selbst entfremdende ‚Vergegenständlichung’ von Momenten unseres Seinsvollzugs. Selbstbewusstes Denken ist dagegen nur über eine entsprechende Aufhebung dieser ‚Ontisierungen’ religiöser Redegegenstände möglich. Das hatte vor Heidegger schon Hegel für den Kenner sachlich deutlicher als der weit populäre Feuerbach herausgearbeitet. Gegen ‚theologische’ Vergegenwärtigungen der condition humaine ist also nur solange nichts einzuwenden, als nicht behauptet wird, der mythische Glaube an einen Gott sei die beste oder gar einzige Antwort auf ‚die Sinnfrage’. Dabei mag ein solcher Glaube als Haltung immer noch besser sein als die Selbstgerechtigkeit des Philisters. In jedem Fall aber sehen wir, in welchem Sinn die Frage nach dem Sinn immer zugleich auch eine Frage nach der Religion – und ihrer Kritik ist. 4. Die Frage nach dem Sinn nicht in, sondern von unserem Leben und Sein ist für manchen die Frage aller Fragen. Glücklich scheint, wer auf sie eine Antwort weiß. Doch mit dem Vorzug der Frage nach dem Sinn in unserem Tun und Leben wird allererst explizit anerkannt, dass die Sinnfrage selbst immer nur relativ zu einem schon implizit anerkannten Rahmen Sinn hat. 1.3 Rahmenbedingungen für Orientierungen und Bedeutungen von „Sinn“ 1. Die Frage nach dem Sinn ist generell eine Frage nach einer als gut bewerteten Orientierung oder Richtungsbestimmung für unser weiteres Tun. Das gilt durchaus auch für die Frage nach dem Sinn von etwas Gesagtem, seinem rechten Verständnis auf Seiten des Hörers und seiner für das Verstehen oder die Verständigung zureichenden Artikulation auf Seiten des Sprechers. Denn das gute Sinnverstehen in der sprachlichen Kommunikation ist längst selbst schon durch die gute Richtung des gemeinsamen Tuns bestimmt. Dabei ist hervorzuheben, dass eine Richtung, wie in der räumlichen Orientierung auch, 16 Pirmin Stekeler-Weithofer nur manchmal durch ein endlich erreichbares Ziel bestimmt ist. So sind z.B. auf der Erde die Richtungen nach Norden und Süden durch zwei Orte, die beiden Pole, bestimmt. Für die Richtungen Ost und West gilt das nicht. Es gilt schon gar nicht für die Richtungen im Raum. Entsprechend ist der Sinn eines Tuns nur manchmal, nicht immer, durch den endlich zu erreichenden Zweck bestimmt. Wo der Sinn eines Tuns wie z.B. im Streben nach einer besseren, vielleicht gerechteren, glücklicheren und schöneren Welt durch die Richtung des Tuns selbst bestimmt ist, wie wir jetzt metaphorisch sagen können, ist es kein Argument, wenn erklärt wird, dass das Tun nie endgültig an ein ‚vollkommenes’ Ziel gelangt. Es lohnt sich daher auch aus logisch-strukturellen Gründen, den begriffsgeschichtlichen Zusammenhang von (Dreh-)Sinn und Richtung zu beachten, aber dann auch von (Wahrnehmungs-)Sinn und Orientierung im Verhalten und Tun. Die (beim Menschen ‚fünf’) Sinne der Wahrnehmung geben der Selbstbewegung von animalischen Lebewesen relativ unmittelbar Orientierung. Der Mensch orientiert sich im Handeln darüber hinaus an symbolischen Vorwegnahmen von Zwecken, Zielen und Mitteln. 2. „Sinn“ bedeutet also im Deutschen sowohl „Wahrnehmung“, „Orientierung“ („Drehsinn“) als auch „Ziel“, „Zweck“, aber auch „Bedeutsamkeit“ und „Bedeutung“. Sinnfragen fragen daher möglicherweise immer auch nach ganz Verschiedenerlei. Es wird darum gehen, auseinander zu halten, wonach gerade gefragt ist, und dennoch auch Zusammenhänge bemerkbar zu machen. Wir betrachten zunächst den Zusammenhang zwischen der Rede vom Sinn einer symbolischen Handlung bzw. der in ihr gebrauchten Zeichen mit der gemeinsamen Orientierung im kommunikativen und kooperativen Handeln. Dabei sind auch gleich terminologische Sonderverwendungen in philosophischen Spezialkontexten als solche zu beachten. Zunächst ist zwar Sinn auch dort allgemeine Richtungsangabe, wo, wie bei Gottlob Frege, zwischen dem Sinn eines benennungsartigen Ausdrucks, etwa einer Kennzeichnung, und seiner Bedeutung, worauf er also deutet, nämlich den benannten Gegenstand, unterschieden wird. Die Bedeutung ist gemäß diesem terminologischen Unterscheidungsvorschlag der konkrete oder abstrakte Gegenstand, den ein namenartiger Ausdruck benennt. Der Sinn ist, sozusagen, die mit dem Ausdruck mitgegebene Form der Suche nach der Bedeutung, also nach dem benannten Gegenstand. Manchmal, aber nicht immer, korrespondiert dieser Suche ein Verfahren des Findens. Namenartige Ausdrücke können demgemäß Sinn haben, ohne dass sie Bedeutung haben, etwa wenn es gar keinen eindeutigen Gegenstand gibt, den der namenartige Ausdruck benennt. So hat z.B. der Ausdruck „die größte Primzahl“ Sinn, aber keine Bedeutung. Das heißt, wir wüssten, ‚wo’ zu suchen wäre, wenn es eine solche Zahl gäbe. Die Die Frage nach dem Sinn 17 Richtung der Suche ist durch die kennzeichnende Eigenschaft bestimmt, nicht aber ein Gegenstand, der die Eigenschaft erfüllte. Daher ist auch, wie Frege offenbar noch besser wusste als die meisten seiner Leser, für den Sinn zweier namenartiger Ausdrücke zunächst noch gar keine Gleichheit oder Ungleichheit bestimmt, für die Bedeutung von zwei namenartigen Ausdrücken aber sehr wohl. Der Ausdruck „der Sinn des Ausdrucks A“ klingt daher nur so, als sei er ein namenartiger Ausdruck mit einer Bedeutung. Das aber ist er gerade nicht: Der Sinn des Ausdrucks A ist kein Gegenstand, also auch nicht seine Bedeutung. Da wir verbal oder formal jeden Ausdruck durch Nominalisierung in eine Art Benennung verwandeln können – wir können ja sogar von ‚dem Sein’ oder ‚dem Werden’, ‚dem Begriff X’ oder ‚der Eigenschaft Y’ sprechen, als wären Begriffe und Eigenschaften Gegenstände –, fragt sich, was wir tun müssen, um solchen namenartigen Ausdrücken, die schon einen Sinn zu haben scheinen, eine Bedeutung zu geben. Das heißt, was müssen wir tun, um solche namenartige Ausdrücke in bedeutungsvolle Namen zu verwandeln? Das ist die Grundfrage jeder aufgeklärten Abstraktionstheorie. Sie wird regelmäßig unterschätzt, gerade auch von Abstraktionstheoretikern mit rein formalanalytischem Ansatz. Hier liegt die wahre Entwicklung der Gedanken Freges eher bei Autoren wie Paul Lorenzen und Hans Julius Schneider. Aber das wird leider noch nicht wahrgenommen, ist wohl noch zu schwer zu verstehen für den heutigen Bildungstand in der Philosophie. Die Antwort auf die Frage lautet: Wir müssen allererst Gleichungen definieren und passende Eigenschaften festlegen, indem wir die Geltungs- oder Begründungsbedingungen für konkrete Sätze bzw. Aussagen ‚über’ die so zu schaffenden neuen Redegegenstände allererst bestimmen. Diese Bestimmung geschieht in praktischen Erläuterungen, welche kompetent zu verstehen sind, nicht im Rahmen einer formalen Definitionslehre, welche schon Frege und dann auch die formalanalytische Philosophie bis hin zu Tarski und Davidson in die Irre führt. Denn nur manche Prädikate P(x) lassen sich durch logisch komplexe Aussageformen A(x) in einem schon als definiert unterstellten Gegenstandsoder Redebereich definieren, also in der von Frege und im ‚Logizismus’ favorisierten Form „P(x) gilt dann und nur dann, wenn A(x) gilt“. Schon Zahlen und ihre basalen (relationalen) Eigenschaften lassen sich so nicht zureichend definieren, gerade auch nicht, wenn man, wie in Hilberts ‚Formalismus’, axiomatizistisch vorgeht. Denn die Rede- oder Gegenstandsbereiche als Bereiche der Bedeutung etwa für Zahlkennzeichnungen und Zahlvariablen sind dann gar nicht mehr vollständig definiert. Dasselbe gilt für die arithmetischen oder geometrischen Wahrheitsbegriffe – womit der Axiomatizismus die philosophische Frage Freges nach dem Sinn mathematischer Wahrheit endgültig nicht mehr beantwortet, sondern sozusagen ‚philiströs’ oder ‚bewusstlos’ zur mathematischen Tagesordnung übergeht. 18 Pirmin Stekeler-Weithofer Frege erkennt die logische Differenz zwischen bloß namenartigen Ausdrücken und bedeutungsvollen Namen unter anderem auch daran, dass der Ausdruck „der Begriff ‚Pferd’“ keinen Begriff ‚benennt’, es sei denn wir legen fest, wie wir Begriffe zu identifizieren gedenken. Zunächst aber kommen Ausdrücke für fregesche Begriffe nicht an Namen- oder Subjektstellen im Satz vor, sondern an Prädikatstellen, haben also die ‚offene’ oder auch ‚funktionale’ Form ‚x ist P’. Entsprechend gilt dann auch, dass ‚der Sinn’ eines namenartigen Ausdrucks wie z.B. „der erste Konsul Frankreichs im Jahre 1799“ zwar auf Napoleon verweist, aber als Sinn kein Gegenstand ist. Der Ausdruck „der Sinn des Ausdrucks „der erste Konsul Frankreichs im Jahre 1799““ hat dann zwar einen Sinn, aber zunächst noch gar keine Bedeutung, da auch dazu eine Relation der Sinngleichheit allererst festzulegen, zu definieren wäre. 3. Ein teils zu lernender, teils erst festzulegender oder als bekannt und anerkannt unterstellter Redekontext und Rahmen bestimmt allererst den Sinn der Frage nach dem Sinn, also die Richtung dieser Frage. Damit ist grob bestimmt, welche Orientierung von einer Antwort erwartet wird bzw. was die Bedingungen sind, deren Erfüllung eine Antwort zu einer befriedigenden oder hinreichend guten machen würde. Wahrheit wird damit als eine Art des Guten und Richtungsrichtigen begreifbar. Dabei sind sogar formale Wahrheiten wie in der Mathematik als Artikulationen verlässlicher Urteile und Schlüsse bzw. Schlussregeln zu deuten. Sie orientieren eben damit unser mathematisches Begründen und Rechnen. Wahre Informationen über die Welt orientieren entsprechend unser weltbezogenes Urteilen, Schließen und Handeln. Erst dadurch erhält eine mögliche Wahrheit einen Sinn und Sitz im Leben, wie mit der Bewegung des ‚Pragmatismus’ auch Ludwig Wittgenstein bemerkt und Friedrich Kambartel durchgehend betont hat. Mit der Relativität von Orientierungen im Bezug zu einem vorausgesetzten Orientierungsrahmen wird dann auch, wenigstens in erster Näherung, klar, warum nicht alle Fragen nach dem Sinn in allen Kontexen einen guten Sinn haben. Die Frage nach dem Sinn von Verkehrszeichen endet z.B. mit der Angabe ihrer Funktion für einen reibungslosen und sicheren Verkehr. Die Frage nach dem Sinn (der Berechtigung) des Verkehrs schließt sich dann nicht etwa ‚logisch’ an, sondern wird schon als positiv beantwortet vorausgesetzt. Sie ist daher eine ganz andere Frage. Wie wichtig diese Unterscheidung ist, sieht man z.B. an der Unterscheidung zwischen der ‚objektstufigen’ Frage, ob Diebstahl sittlich verwerflich ist und der ‚metastufigen’ Frage, ob die Institution von Besitz und Eigentum, welche den moralischen und rechtlichen Begriff des Diebstahls allererst möglich machen, eine erwünschte und entsprechend zu schützende Institution ist. Die Existenz der Institution ist nicht etwa dadurch gerechtfertigt, dass wir sie subjektiv wollen können, sondern sie ist objektiv gewollt, nämlich im Rahmen einer unsere Lebensform ermöglichenden Kultur, die sich faktisch dadurch Die Frage nach dem Sinn 19 ergeben hat, dass entsprechende Handlungsformen und Normen anerkannt sind. In dieser ‚Normativität des Faktischen’ bzw. ‚faktischen Normativität’ tradierter Sittlichkeit (Hegel) ist Geltung definiert, und zwar zumindest zunächst unabhängig davon, wie wir als je einzelne zu dieser Tradition Stellung zu nehmen belieben, etwa in verbaler Anerkennung oder Kritik. Der Satz, dass Diebstahl sittlich verwerflich und rechtlich verboten ist, ist daher, wie Hegel erklärt, schon ‚analytisch’ bzw. ‚begrifflich’ wahr, und hängt doch auch von Fakten ab, nicht aber davon, ob ich subjektiv wollen könnte, dass die Maxime, zu nehmen, was ich brauche, eine allgemeine Regeln werde oder nicht. Kants allgemeiner kategorischer Imperativ ist daher nicht unmittelbar geeignet, um die Frage zu beantworten, warum wir nicht stehlen sollen. Der Satz, dass das Eigentumsregime und damit das ‚System’ des ökonomischen Handelns eine sinnvolle und gute Institution ist, ist dagegen nicht analytisch wahr. Er gehört zu einer normativen Ideengeschichte der uns prägenden Institutionen. Deren ‚Rekonstruktion’ besteht aus einer Verbindung von Gründe- und Wirkungsgeschichte. Sie ist nie losgelöst von präsentischen Wertungen der Vernunft in der Geschichte, und zwar im Rückblick von heute her. Änderungen von Institutionen kann man dann zwar vorschlagen. Aber Vorschläge schaffen noch keine neuen Normen. Was aber ist nun der Sinn der Institution des privaten Eigentums? Zur Beantwortung dieser Frage kann es durchaus helfen, mit Kant zu bedenken, was die Folgen wären, wenn jeder jedem Beliebiges wegnimmt, wann immer es ihm beliebt. Doch es gibt keine unmittelbare Antwort. Denn wir können das nur deswegen nicht wollen, weil es naiv wäre zu glauben, jeder würde sich ‚in moralischer Weise’ immer nur das nehmen, was der andere gerade nicht braucht. Anders gesagt, wir brauchen ein Eigentumsregime samt der zugehörigen expliziten Ächtung des Diebstahls oder dann auch des Raubes und die entsprechenden rechtlichen Strafandrohungen gerade deswegen, weil eine freie Moralität keineswegs ausreicht, um eine gute ökonomische Koordination des eigeninteressierten Handelns unter ansonsten freien Personen zu etablieren. Hegel verteidigt mit derartigen, durchaus auch von Platon oder Hobbes belehrten, Überlegungen einen Liberalismus des Rechtsstaates gegen ein allzu unmittelbar ‚moralistisches’ Denken, das der Tendenz nach anarchisch ist und demgemäß auch die Marxsche Utopie des Kommunismus und naive sozialistische Vorstellungen von ‚freien’ Gesellschaften prägt – mit der geradezu ironischen Inkonsistenz, dass der Staat allmächtig und die zentrale Differenz zwischen freier Moral und sanktionsbewehrtem Recht aufgehoben wird. Zugleich verteidigt Hegel die Bindung oder ‚religio’ an die ‚Sittlichkeit’ im Sinne unserer kulturellen Traditionen samt ihren Normen des ethisch Richtigen als Bedingung von Freiheit. 4. Rechtliche Normen, Gesetze, setzen schon den Staat voraus. Fragt man dann etwa nach dem Sinn der Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag, 20 Pirmin Stekeler-Weithofer also nach dem Sinn der rechtlichen Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten des intentionalen Zustandekommens eines Homizids, ist der Weg nicht weit zur allgemeineren Frage nach dem Sinn von Strafe überhaupt. Eine begangene Tat kann doch ohnehin nicht ungeschehen gemacht werden. Lässt man hier den Rahmen außer acht, nämlich die Rolle von Sanktionsandrohungen für die Steuerung individuellen und kollektiven Verhaltens und Handelns, insbesondere auch zum Erhalt von Institutionen wie Eigentum und Besitz, versteht man den Sinn von Strafe in der Tat nicht mehr. Der Sinn von Strafe liegt eben nicht darin, die begangene einzelne Tat ‚zu sühnen’, wie mit Nietzsche viele meinen. Sondern es geht darum, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Taten getan werden, durch Strafandrohungen zu beeinflussen. Diese aber wirken nur, wenn sie durch wirkliche Strafen untersetzt werden. Erst mit der Sanktionsmacht erhält, sozusagen, der Sprechakt der Drohung Einfluss auf unser Handeln. Erst die res publica (der ‚Staat’ im Sinne Hegels) gibt entsprechend den Gesetzen, und das sind am Ende Worte, Einfluss auf das Handeln in der Öffentlichkeit der Gesellschaft. Dabei können Sanktionsdrohungen ganz offenbar nur ein ‚freies’ Handeln beeinflussen. Daraus ergibt sich ‚logisch’, dass keine Widerfahrnisse zu bestrafen sind. Eben daher gilt auch das Prinzip: Nulla poena sine lege: Es soll keine ‚Strafe’ geben ohne explizite Strafandrohung. Zumindest ein realer Zugang zum Wissen um das Unrechte muss vorausgesetzt sein, auch wenn eigenverantwortetes Unwissen vor Strafe nicht schützt. Das ‚freie’ Handeln ist gleichursprünglich mit der ‚Verantwortung’ für das handelnd Getane. Dem ist so gerade im Blick auf die Sanktionsdrohungspraxis des Rechtsystems als zentrale Institution der Vergesellschaftung. Wer daher leugnet, dass es einen signifikanten Realunterschied in der Welt zwischen Widerfahrnissen bzw. nicht steuerbarem Geschehen und freiem Handeln gibt, plädiert im Grunde für die Abschaffung einer kulturell zentralen Institution – und mit ihr für die Abschaffung von Freiheit. Man meint etwa, es ginge nur um die Unschädlichmachung von potentiellen Schädigern. Aber es geht um eine freie Gesellschaft, welche ohne Rechtsordnung, staatliche Strafandrohung und staatliche Sanktionsmacht, samt ihrer realen Ausübung, nicht existieren kann. Die Alternative ist ein Rückfall in die archaische Praxis einer barbarischen Menschheit, den ‚Verursacher’ eines Geschehens und nicht den ‚Handelnden’ zu ‚strafen’ – wie man den Boten für Nachricht bestraft haben mag, Meere ausgepeitscht hat oder auch den, der einem aus Versehen auf die Zehen trat. Der Rückfall ist nicht zu vermeiden, wenn man – auf noch so hohem szientistischem Niveau – den Sinn von Strafe und die Unterscheidung zwischen einem freien Handeln und einem widerfahrnisartigen Verhalten nicht mehr versteht. Die Frage nach dem Sinn 21 2. Sinn des Lebens, Sinn des Ganzen 2.1 Objektstufiges und metastufiges Fragen 1. Wie steht es nun aber mit der großen Frage nach dem Sinn ‚des Ganzen’? Ist nicht diese Frage die eigentliche philosophische Frage? Im Buch von Oswald Hanfling2 wird die Frage nach dem Sinn von vornherein als Kurzform für die Frage nach dem Sinn des Lebens im Ganzen verstanden. Ganz grob lassen sich dabei schon jetzt die unterschiedlichen Weisen, auf diese Frage zu reagieren, so charakterisieren: Religionen und Weltanschauungen unterstellen, dass die Frage sinnvoll sei. Und sie bieten entweder positive oder negative Antworten an. Besonders positiv scheinen Antworten zu sein, welche in der Rede von Gott ein Sinnfundament behaupten. Die Philosophie dagegen befragt zunächst den Sinn der Frage. Und sie prüft die möglichen Antworten, bevor sie selbst zu antworten versucht. Das philosophische Nachdenken ist also metastufig. Das heißt, die Philosophie reflektiert immer auch auf den Sinn der eigenen und fremden Sprach- und Urteilspraxis. Das wiederum heißt, dass wir Philosophie so verstehen sollten, und zwar schon in unserer Rekonstruktion dessen, was zu einer Geschichte der Idee der Philosophie als Institution gehört. 2. Weltanschauliche Meinungsphilosophien meinen in der Regel, auf die Frage nach dem Sinn selbst oder zusammen mit einer Theologie eine mehr oder minder endgültige Antwort geben zu können. Dabei könnte diese Antwort auch darin bestehen, dass das Leben und der Kosmos, insgesamt genommen, sinnlos und, wie Nietzsche glaubt, am Ende alles Zufall sei. Doch in welchem Sinn sollen das Leben und der Kosmos sinnlos sein? In dem Sinne etwa, dass die Existenz von Leben im Allgemeinen, von humanem Leben im Besonderen gleichgültig wäre? Die Gegenfrage lautet natürlich: Wem soll sie gleichgültig sein? Uns selbst? Dem Weltall? Unser Leben ist schon dem kleinsten Stein und den meisten anderen Lebewesen völlig gleichgültig. Genauer: Es hat gar keinen Sinn, von einer derartigen Gleichgültigkeit zu sprechen. Es wäre daher offenbar erst einmal zu klären, wovon man und von wem man auf eine sinnoder gehaltvolle Weise überhaupt sagen kann, dass es ihm gleichgültig ist oder nicht gleichgültig sein könnte oder sollte. 3. So wie etwas nur groß ist, wenn klar ist, in Bezug worauf es einen relevanten Standard der Minimalgröße überschreitet, was offenbar schon Platon bemerkt hat, so ist auch etwas gleichgültig oder sinnvoll nur unter Bezugnahme auf einen solchen Standard. Das Grundwort ist daher im einen Fall „größer“, im anderen „sinnloser“ bzw. „gleichgültiger“. Während aber dafür, dass etwas _____________ 2 Oswald Hanfling: The Quest for Meaning, Oxford 1987. 22 Pirmin Stekeler-Weithofer groß ist, nicht immer eine Bezugnahme auf uns selbst nötig ist, ist die Grammatik des „sinnvoll“ und „gleichgültig“ komplexer. Denn sinnvoll oder gleichgültig ist etwas immer nur für Lebewesen, oft sogar nur für Personen, also für uns. Dabei kann etwas sinnvoll oder gleichgültig für manche von uns sein oder für jeden einzelnen von uns. Oder etwas kann für uns Menschen im generischen Sinn, also für uns allgemein, sinnvoll oder gleichgültig sein, unabhängig davon, wie Einzelpersonen darüber urteilen. Denn ein zufälliges Einzelurteil kann sich täuschen. Ein Einzelner kann z.B. meinen, was seine Frau von ihm denkt, sei ihm gleichgültig. Doch das ist selten bis nie der Fall. Es könnten sogar viele meinen, das und das sei gleichgültig oder sinnlos, ohne dass das ‚wirklich der Fall ist’. Was also manche oder viele für sinnvoll oder sinnlos, für relevant oder gleichgültig halten, muss nicht schon sinnvoll oder sinnlos sein. Das gilt, ohne dass wir beanspruchten, völlig ‚objektiv’ zu urteilen. Es heißt nur, dass wir zwischen den Urteilen „für sinnvoll halten“ und „sinnvoll sein“ unterscheiden. Freilich ist es nicht leicht, zu sehen, dass mein Urteil der Form „x ist sinnvoll“ nicht einfach gleichbedeutend ist mit „ich halte x für sinnvoll“. Was aber ist hier ‚wirklich der Fall’? Bedeutet der Gebrauch des emphatischen Ausdrucks „wirklich“ schon, dass ein metaphysisch-transzendenter Sinn jenseits je unserer Sinnanerkennungen ‚ontisch’ unterstellt würde? Gibt es ‚wirklich’ Urteile über den Sinn von etwas, der darüber hinaus geht, dass je ich oder einige oder viele von uns etwas je für sich als sinnvoll anerkennen? Was wäre das für eine ‚Objektivität’ des Sinns? Beruht also jeder Appell an einen allgemeinen Sinn oder Unsinn schon auf einem metaphysisch-dogmatischen Urteil? Oder ist die umgekehrte Meinung schon ein dogmatischer Glaube, etwas sei immer nur sinnvoll, soweit einzelne Wesen, etwa Personen, es als sinnvoll für sich anerkennen? Könnte sich dieser ‚methodische Individualismus’ in Wertungsurteilen nicht gerade auch als Ausdruck einer bloßen Weltanschauung unserer Zeit, einer im Grunde in ihrem Subjektivismus ‚nihilistischen’ Glaubensphilosophie, und am Ende noch dazu als ethisch problematisch herausstellen? 2.2 Letzte Antworten, tiefste Fundamente 1. Kritische Philosophie hebt hervor, dass alle angeblich letzten Antworten und fundamentalste Prinzipien, praktisch gesehen, bloß eine ‚formale Allgemeinheit’ und ‚Wahrheit’ beanspruchen können. Von Seiten der Philosophie ist es daher gerade in Bezug auf die Sinnfrage gar nicht verwunderlich, dass sich immer nur einige, wenn auch oft viele, mit den je gegebenen religiösen Antworten begnügen, und dass sich immer gerade die tiefsten ‚religiösen’ Denker oder Frager mit den konventionellen Antworten ihrer ‚alten’ Religion nicht Die Frage nach dem Sinn 23 mehr (ganz) zufrieden gegeben haben. Sie haben gemerkt, wie Worte schal werden und wie Institutionen zur bloßen Äußerlichkeit geist- oder lebloser Riten erstarren können. Auf der anderen Seite ist ebenfalls nicht verwunderlich, warum der Umgang der Philosophie mit der Frage nach dem Sinn nicht die Verbreitung und Anhängerschaft finden kann wie die der Religionen. Denn die Philosophie gibt keine schematisch lehr- und damit ‚bewusstlos’ anwendbare Antworten. Das aber wünschen sich die Menschen: letzte Antworten auf ihre tiefsten Fragen, Richtlinienkompetenz auf Orientierungsfragen, und schematisch ohne die Anstrengung eigenen Denkens begehbare Wege oder Methoden, die dazu verhelfen sollen, ‚richtig zu leben’. Ein solcher Wunsch aber widerspricht sich selbst. 2. Mit dem Stellen von Fragen, genauer: mit der Artikulation von Fragesätzen, ist außerdem noch gar nichts gefragt. Den Sinn der Frage, ja ob die Frage überhaupt einen (guten, klaren, bestimmten) Sinn hat, sieht man ihrem Wortlaut nicht unmittelbar an. Entsprechendes gilt für die Antworten, aber auch für Wünsche oder Absichten. Auch sie sind, sozusagen, schneller artikuliert als dass schon ein kohärenter Sinn ausgedrückt wäre. Sogar schon dann, wenn es keine realen Erfüllungen gibt, ‚verlieren’ verbale Wünsche ihren Sinn. 3. Der Glaube ‚an Gott’ bringt, so erläutert Kant, wenn man seinen Realsinn betrachtet, nur eine bestimmte Haltung zum gemeinsamen Ethos und zur Kultur der Menschheit auf mythische Weise zum Ausdruck. Das ist dann längst schon eine säkularisierte, verweltlichte, rein immanente Form von ‚Faith’. Es ist diese Haltung der vertrauenden Hoffnung auf ‚das Gute’ in der Menschenwelt, die wir nach Kant ‚a priori’ einnehmen dürfen, aber auch sollen, wenn wir denn moralisch sein wollen; aber eben ohne jede subjektive Planungssicherheit in Bezug darauf, wie die anderen Menschen handeln werden und was daher der ‚Erfolg’ unseres moralischen, also frei kooperativen, Handelns sein wird. Kant mag diese Funktion der „regulativen Idee“ Gottes für die Moral überbewerten. Die intendierte Transformation christlichen Glaubens ist aber unverkennbar. Es ist allein diese Haltung hoffenden Glaubens, der Kants ‚endlicher’ Wissensbegriff Platz machen möchte. Kants Religion in den Grenzen der Vernunft und seine Christologie erweisen sich damit am Ende als Verteidigung einer rein immanenten Bedeutsamkeit analogischer Vergegenwärtigungen der ethischen condition humaine in religiösen Mythen. 2.3 Begriffliche Grenzen von Sinnfragen 1. Wozu aber leben wir? – Ist eine solche Frage überhaupt sinnvoll? Man kann fragen, wozu ein Ding, ein Gerät taugt, oder wozu eine Handlung dient. Aber 24 Pirmin Stekeler-Weithofer man kann nicht fragen, wozu das Taugen taugt, oder das Leben, in dem es zum Leben Taugliches gibt. Warum müssen wir sterben? Mit dieser Frage mag man wissen wollen, was es so alles an Todesursachen gibt. Es hat aber keinen Sinn zu fragen, warum das Leben endlich ist. Es ist endlich. Punkt. Wen es beruhigt, der mag noch glauben, dass der Generationenwechsel für das Überleben einer Gattung von Lebewesen ‚gut’ sei. Ansonsten müssen wir uns mit der Endlichkeit des Lebens abfinden. Dasselbe gilt für die Existenz von Unglück und Schmerz. Auch hier wäre die Unterstellung falsch, es könne doch auch einen ‚Sinn’ im Unglück und Schmerz geben. Unglück und Schmerz sind, andererseits, aber auch nicht einfach ‚ohne Sinn’. Es hat nur keinen Sinn, nach einer positiven Orientierung bei etwas zu suchen, was als Defekt zu verstehen ist. Es kann zwar einen Sinn für eine gewisse Unordnung geben; aber per se ist Unordnung Abwesenheit einer sinnvollen Ordnung. Es gibt dabei viele Weisen der Unordnung. Man kann eine gute Ordnung auf vielfältige Weise durcheinander bringen (diaballein). Es gibt daher in gewissem Sinn immer viele Teufel (diaboloi), doch nur eine Idee der guten Ordnung (wobei Varianten möglich sind.) Insbesondere aber gibt es keinen ‚idealen Defekt’. Es wäre schon ironisch, wenn wir etwa sagen würden, Fouché sei ein Muster eines politischen Schurken gewesen. Ideale geben nämlich eine positive Orientierungsrichtung vor, eben einen Sinn. Es verwirrt daher, wenn man Defekte in Gegenbildern als ‚teuflische’ oder ‚diabolische’ Gegenideale deuten wollte. Es sollte uns dennoch nicht wundern, dass das Böse und Diabolische oder Falsche oft ‚interessanter’ ist als die Ordnung des Guten und Wahren. Das Wahre und die Ordnung sind am Ende immer langweilig, und zwar weil sie zu Selbstverständlichkeiten werden sollen und wollen. Nicht langweilig ist immer nur der Kampf um die Anerkennung des Wahren und Guten. Demgegenüber ist der Aufweis der vielfältigen ‚Mängel’ der realen Welt eine leichte Übung, am Ende selbst eher langweilig. Denn es besteht realiter keine Gefahr, dass der Kampf um das Gute und Bessere je an ein Ende kommen könnte. Alles andere ist bloße Fiktion. 2. Soll aber mit dem Tod, mit dem Ende unseres Lebens, wirklich ‚alles’ aus und vorbei sein? Wird damit nicht das ganze Leben selbst, all die Mühe und all das Leid sinnlos? Oder sollte man sogar, wie noch Locke vorschlägt, den Unglauben an ein Weiterleben der Seele nach dem Tod staatlich verbieten, weil sonst zu viele nach dem Motto ‚nach mir die Sintflut’ handelten? Und könnte es nicht wirklich ein solches Weiterleben geben? Wäre es nicht wenigstens schöner und besser, wenn derartige Lehren wahr wären? Wird unser Leben nicht glücklicher? Was sollte sonst der Sinn ‚des Ganzen’ sein, wenn nicht nur die Menschen und Tiere, sondern sogar die Erde, das Sonnensystem, der Kosmos eine begrenzte ‚Lebensdauer’ haben, und alles, wie wir aus der Physik wissen, dem großen Wärmetod entgegen geht? Welchen Nutzen Die Frage nach dem Sinn 25 sollte es, umgekehrt, haben, den Glauben an die Unsterblichkeit und an einen Gott als falsch oder unbegründet widerlegen zu wollen – sofern sich einer, der glaubt, überhaupt so widerlegen bzw. überzeugen lässt? Es sind Fragen dieser Art, die als die großen Sinnfragen angesehen werden. Wir können sie als die kosmologischen Sinnfragen von handlungstheoretischen oder praktischen Sinnfragen unterscheiden. Es sind aber Fragen ohne Sinn. Sie sind jedenfalls, zumal im Bezug auf das Verhältnis von ‚Nutzen’ und ‚Wahrheit’, noch viel zu vage formuliert, als dass eine Antwort auf sie schon eine gute Orientierung darstellen könnte. Hier erst mal nur ein Punkt: Die Endlichkeit von Leben oder Erde beeinträchtigt relative Urteile über Sinnvolles und Sinnloses in der Zeit des Lebens auf der Erde nicht. Und mit dem Ende des Einzellebens ist nie ‚alles’ vorbei. 3. Eine Hauptschwierigkeit ist zu begreifen, dass auch jede allgemeine Frage nach Sinn eng mit besonderen Fragen nach Bedeutsamkeit, Relevanz und der durch entsprechende Reden mitgetragenen praktischen Orientierungen zusammenhängen. Die Frage nach dem Sinn einer Rede steht dabei als allgemeine Frage der besonderen Frage nach dem Sinn des Redens über den Sinn des Lebens gegenüber. Was wollen wir durch diese Fragen und Reden erreichen? Wollen wir etwas ‚wissen’? Geht es um Haltungen zum Leben? Wie sind diese als gut oder schlecht, empfehlenswert oder irreführend zu beurteilen? Soweit Sinnfragen Haltungsfragen sind, ist dann aber auch Gleichgültigkeit ihnen gegenüber eine zu bedenkende Haltung. Sinnfragen sind insbesondere auch keine von ethischen Urteilen über das Gute unabhängigen ‚Wissensfragen’. Wissen ist zwar – gerade so haben wir es verfasst – weitgehend invariant zu den bestimmten Zwecken, die wir im Handeln verfolgen können, indem wir Wissen einsetzen. Das heißt aber nicht, das Wissen zweckfrei wäre. Wissen und Wahrheit sind immer auf Sinn hin orientiert, freilich nicht bloß auf ‚subjektiven’ Sinn, auf einzelne, zufällige, Zwecke. 4. Wir haben schon gesehen: Wenn alles, was geschieht, auch wie wir uns verhalten, durch die jeweilige Vorgeschichte ‚kausal’ vorausbestimmt wäre, hätten Ermahnungen und Drohungen, Tadel und Strafe, auch Gewissenskontrolle und Reue keinen Sinn. Daraus folgt schon, dass die Prämisse falsch ist. Dasselbe gilt für die Frage nach dem Sinn unseres Bemühens, wo doch alles prädeterminiert sein könnte. Auch diese Frage geht von falschen Prämissen aus. Das Wort „könnte“ hat hier nämlich keinen Sinn. Dabei meinen viele sogar zu wissen, dass alles in Wirklichkeit kausal prädeterminiert sei. Es ist freilich nicht einfach zu unterscheiden, wann die Annahme, dass etwas möglich oder wirklich ist oder etwas anderes bloßer Schein ist oder sein könnte, selbst bloßer Schein ist, wann nicht. Das gilt für das freie Wollen und Handeln ebenso wie für die Kritik der ‚wissenschaftlichen’ Psychologie an einer 26 Pirmin Stekeler-Weithofer ‚folk-psychology’, also unserem Gebrauch ‚mentaler’ und psychologischer Ausdrucksweisen in der Normalsprache. Es ist entsprechend schwer zu sehen, warum es einfach falsch, ja sinnlos, ist zu sagen, wir redeten zwar von einer Freiheit des Willens, aber ‚in Wirklichkeit’ litten wir dabei doch nur an der Tatsache, dass unsere Wünsche in der Regel nicht in Erfüllung gehen. Man fügt dann gern noch hinzu: Wenn unsere Wünsche in Erfüllung gehen, schreiben wir dies, stolz wie wir sind, uns selbst zu, wenn nicht, dann anderen oder anderem. Auf diese Weise belügen wir uns selbst. Die wahre Haltung sei dagegen, das meint z.B. Arthur Schopenhauer, an dem Wollen und Wünschen möglichst nicht teilzunehmen, sondern die Welt so unvoreingenommen und so uninteressiert zu betrachten, wie es nur möglich sei. Das stehe besonders den Wissenschaften an. Eine solche Haltung ist der Tendenz nach ‚buddhistisch’ oder auch ‚stoisch’. Sie korrespondiert dem Sufismus im Islam oder mystischen Traditionen im Christentum. Aber macht nicht gerade eine derartige Beschränkung auf eine vita contemplativa, auf eine reine theoria, auf die bloße Betrachtung oder ‚Beobachtung’ des unvermeidlichen und zugleich kontingenten Geschehens alles Erschaute und am Ende das Schauen selbst sinnlos, wie Nietzsche gegen Schopenhauer sagt? Sitzen wir dann nicht machtlos der Welt vis à vis, glotzen sie, um mit William James zu sprechen, fatalistisch wie eine peruanische Mumie mit großen, leeren Augen bloß an? 5. Zunächst weniger dramatisch, aber nicht weniger bedeutsam erscheint die Frage nach dem Sinn aus der Perspektive jedes einzelnen Menschen, der sich in eine vorgeprägte soziale Welt einzufügen hat. Was, so fragt der Jugendliche, soll der Sinn der Schule sein, wenn es doch nur darum geht, nachher entweder arbeitslos herumzuhängen oder tagein, tagaus die von anderen bestimmten Anforderungen eines Arbeitsplatzes zu erfüllen? Der Sinn der Arbeit ist doch oft kaum einzusehen, und dies nicht nur dann, wenn etwa Waffen oder unsinnige Konsumartikel produziert oder wenn überflüssige Akten verwaltet werden. Selbst ein Lehrer oder Architekt oder Arzt und andere allgemein für nützlich erachtete Mitglieder der Gesellschaft könnten (oder sollten sich manchmal) fragen, worin denn der Sinn ihres Tuns besteht. Und sie könnten dann sehen, wie wenig sie an den bestehenden Verhältnissen ändern können. Zumindest ist jeder ersetzbar. Und überhaupt: Was tun wir nicht alles Sinnloses für Geld? Das Geld ist dabei am Ende selbst nur die Anrechtsbescheinigung dafür, ein langweiliges Leben in Wohnblocks oder Reihenhäusern mit ihren Fernsehern und Küchen, Kakteen und Vorgartenzwergen führen zu können, soweit man die Zeit nicht schon in Büros oder Fabriken, in Kneipen oder sonst wo hinter sich gebracht hat! Ist das nicht insgesamt sinnlos? Sicher, denn es gibt bessere Alternativen, die nicht ergriffen wurden. Die Frage nach dem Sinn 27 Sind wir aber nicht alle immer den Routinen ausgeliefert? Das Schematische, manchmal geradezu betonartig Festgefügte ist keineswegs beschränkt auf abhängige Arbeit. Auch die scheinbar freieren akademischen Berufe oder scheinbar selbständigere Arbeiten bleiben wesentlich geprägt von Routinen und von einer bloß relativen Sinnhaftigkeit. Vielleicht ist ein Leben, das weitgehend allgemeinen Routinen folgt und durch Konventionen und Lebensablaufsmuster fest und sicher geprägt ist, die ‚große Errungenschaft der Moderne’ mit ihrer technischen Arbeitsteilung und ihrer Ausrichtung auf ‚Wohlstand’ in einer bald die ganze Welt umspannenden Massengesellschaft. Dabei fallen uns das Uniformierte in Gesellschaften wie der Nordkoreas oder der Volksrepublik China nur etwas deutlicher auf als das Konventionelle unserer eigenen Zivilisation. Verständlicherweise bemerken gerade die jungen Leute, die den Betrieb noch von außen betrachten, die Routinen und Konventionen und fragen angesichts einer so nicht schöner werdenden Welt nach deren Sinn. Diese praktische Sinnfrage unterscheidet sich von den ‚kosmologischen’ Frage nach dem ‚Sinne des Lebens überhaupt’ und dem Sinn allen ‚Wollens’ und ‚Sollens’. Es ist dies die Frage nach dem Sinn des eigenen, authentischen, Lebens als je besonderem, zumindest partiell jenseits des vorgeprägten Laufs des Riesenrades einer Menschenmasse. 6. Es gibt eine bekannte Haltung zu den Sinnfragen der geschilderten Art, welche der Haltung des Pilatus zur Wahrheitsfrage ähnelt: man geht schulterzuckend zur Tagesordnung über. Und in der Tat, worin soll der Sinn bestehen, sich mit sinnlosen Fragen nach dem Sinn zu beschäftigen? Man kümmere sich doch lieber um die Probleme des Alltags, das Studium etwa oder den Beruf, die Familie oder die Freunde, um die, welche unsere Hilfe brauchen, und dann auch um uns selbst und um unsere absehbare Zukunft. Diese Haltung, für welche eine konservative philosophische ‚Skepsis’ wie die Odo Marquardts beredt eintrat, mag dort als vernünftig erscheinen, wo das Fragen zum leeren Pathos oder Selbstzweck geworden ist oder uns von Wichtigerem abhält. Aber diese Art von Sinnskepsis könnte auch dazu führen, dass uns Sinnfragen unvorbereitet überfallen, gerade weil wir sie zuvor durch allerlei Aktivitäten verdrängt hatten. Es könnte z.B. weiser sein, um die Möglichkeit existentieller Sinnkrisen zu wissen, in die wir am Ende auch ohne besonderes eigenes Zutun geraten können, etwa durch Krankheit oder im Scheitern eines Lebensplanes oder einfach in gewissen Stimmungslagen. Freilich gibt es falsche und rechte Zeitpunkte für jedes Tun, auch für das Fragen nach dem Sinn. Es kann aber auch zum Sinn einer philosophischen Beschäftigung mit der Frage nach dem Sinn gehören, sich gegen einen allzu unvermittelten Überfall durch Sinnfragen partiell zu immunisieren und sich auf die aktuelle Auseinandersetzung mit ihnen vorzubereiten. Vielleicht meinte (Platons?) Sokrates eben dies in seinem tiefen Orakelspruch, Philosophieren hieße: Sterben lernen. Es ist dabei nicht anzunehmen, jeder geriete in die gleichen Frag- 28 Pirmin Stekeler-Weithofer lichkeiten. Je nach Person bleibt Unterschiedliches fragwürdig. Es ist schon gar nicht notwendig, diejenigen für die tieferen Menschen zu halten, die sich intensiver mit Sinnkrisen und Sinnfragen herumschlagen. Es reicht, sich die mögliche Bedeutung derartiger Fragen und Krisen zu vergegenwärtigen. 7. Andererseits gibt es dann doch auch die erstaunliche Erfahrung, dass viele Menschen im Rückblick auch ihr Unglück, ihr Leid oder ihre (praktischen) Sinnkrisen nicht missen wollen. Manche sprechen, fast religiös, von einer zweiten Wiedergeburt, wie dies etwa William James tut. Andererseits gilt auch das Hölderlin-Wort, an das auch Heidegger erinnert: „Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste.“ Die Rückkehr aus dem Fraglichen zum ‚einfachen’, d.h., wenn man es unbedingt so ausdrücken will, zum ‚oberflächlichen’ Leben, zum selbstverständlichen Vollzug einer durch Tradition schon weitgehend vorgeprägten Form, kann eine adäquate Antwort sein. Und doch bleibt oft ein Unterschied, wie wir mit James wissen, zwischen einem vielleicht sogar robusten ‚einfachen Leben’ im Rahmen einer unmittelbar eingeübten Praxis und einer reflektierten Anerkennung von Tradition und Kontingenz, samt der grundsätzlichen Fragilität und Endlichkeit des Lebens. Jedes Verstehenwollen ist dabei selbst schon eine sinnkritische Bemühung. Indem dabei ein Teil einer zunächst nur im Vollzug des Lebens, also bloß empraktisch und insofern ‚bewusstlos’ bekannten Praxis eingeklammert wird, tritt sie uns fremd gegenüber, als verstünden wir ihren Sinn nicht (mehr). Diese Art der Entfremdung ist eine explikationslogisch notwendige Bedingung von Selbstbewusstsein, wie uns Hegel gelehrt hat. Entsprechend stellt auch Wittgenstein in seinen Sprach- und Bedeutungsanalysen die Frage nach dem Sinn eines üblichen Gebrauchs, ohne dass damit das Selbstverständliche als fragwürdig behauptet würde. Mit der Antwort, der Lösung oder Auflösung der Frage, bleibt dann oft alles, wie es ist; und ist doch zugleich ganz anders. Reden ‚Als-ob‘ – Sind Fiktionalisten die besseren Anti-Realisten?1 Stefan Tolksdorf 1. Debatten zwischen Realisten und Anti-Realisten Ich möchte zu Beginn der Arbeit einige meiner Karten offen auf den Tisch legen und Annahmen bzw. Thesen formulieren, die den Rahmen abstecken, in dem sich die folgenden Überlegungen bewegen werden. Dieser vorausgesetzte Rahmen skizziert gleichzeitig das, was als unreine und vollblütige Sprachphilosophie angesehen werden kann. Unrein und damit gegen Rortys Reinheitsgebot gerichtet, weil der epistemische Anspruch dieser Art von Sprachphilosophie zu ihrem Wesen gehört; vollblütig und damit gegen McDowells Beschränkung auf Bescheidenheit in der Philosophie gerichtet, weil zwar Sprache nicht durch Sprache erklärt werden kann, weil man aber sehr wohl an einer erklärenden, nicht-behavioristischen Stufenfolge sinnvoller Übergänge innerhalb der Sprache, aber auch vom Nicht-Sprachlichen zum Sprachlichen festhalten kann und sollte.2 Zu den Annahmen: Erstens gehe ich, entgegen weit verbreiteten quietistischen und deflationistischen Tendenzen in der gegenwärtigen Philosophie (Rorty, McDowell, der späte Putnam), davon aus, dass Diskurse zwischen Realisten und Anti-Realisten gehaltvoll sind. Darüberhinaus will ich mich auf die stärkere These festlegen, dass solche Diskurse einen Nutzen haben, da wir aus ihnen eine Menge über das Funktionieren unserer Lebens- und Handlungswelt lernen können. Darauf komme ich gleich zurück. Zweitens bin ich der Überzeugung, dass die Motivation anti-realistischer Erklärungsstrategien in dem zu suchen sei, was ich ‚Asymmetrie-Erfahrung‘ nennen möchte. Gemeint ist damit eine Asymmetrie bezüglich der Erklärung und Verständlich_____________ 1 2 Ich danke Ute Feldmann, David Löwenstein, Claudio Roller und Jan Kromminga für hilfreiche Besprechungen des Manuskripts. Vgl. Rorty: Der Spiegel der Natur, Frankfurt a. M. 1981; Dummett: Reply to John McDowell, in: Auxier / Hahn (eds.): The Philosophy of Michael Dummett. The Library of Living Philosophers, Vol. XXXI, Chicago 2007, S. 367-381; McDowell: Dummett on Truth Conditions and Meaning, in: Auxier / Hahn (eds.): The Philosophy of Michael Dummett, a.a.O., S. 351-363. Stefan Tolksdorf 30 machung alltagsweltlicher Sprachspiele, eine Differenz beispielsweise zwischen modalen, mentalen, moralischen, mathematischen und religiösen Diskursen auf der einen und der Rede über Personen, Tiere und „mittelgroße Trockengüter“ auf der anderen Seite. Anti-Realisten entsprechender Art versuchen Züge der erwähnten Sprachspiele (man denke etwa an folgende Sätze: „2+2=4“, „Gott hält seine schützende Hand über den Demütigen“, „Das Töten von Menschen ist moralisch verwerflich“, „Sprechende Bäume sind unmöglich“) auf eine andere Weise zu erklären als beispielsweise den Satz „Die Katze sitzt auf der Matte“, wobei die angedeutete Differenz durch Blackburns Frage auf den Punkt gebracht werden kann, ob Werte, Götter, Modalitäten und Zahlen die Eltern der Erklärung sind oder aber besser als die Kinder einer solchen angesehen werden sollten. Auf das moralische Sprachspiel bezogen schreibt Blackburn: Moral ‚states of affairs‘, above all, play no role in causing or explaining our attitudes, their convergences, their importance to us. They are constructs from our procedures, not their originators, their children, not their parents.3 Auf einen anderen Fall übertragen: Erklären wir das modale Sprachspiel dadurch, dass wir auf mögliche Welten verweisen, die als Objekte der Bezugnahme die Funktion modaler Sätze erhellen, indem wir also eine Strategie in Anschlag bringen, die uns bezüglich der Rede über Katzen und Matten durchaus einleuchtend zu sein scheint? Anti-Realisten beantworten diese Frage negativ. In dem Sinne, in dem Katzen dem Sprachspiel voraus gehen, demnach Eltern sind, sind es Modalitäten nicht. Vielmehr stellen sie das Ergebnis (die Kinder) modaler Praktiken dar. Die Differenz zwischen Entitäten als Eltern oder als Kinder des Sprachspiels läuft auf die Frage hinaus, ob wir das wahrheitskonditionale Paradigma <„x ist F“ ist wahr genau dann, wenn x F ist> in allen Fällen als die beste Erklärung unserer sprachlichen Züge ansehen wollen. Anti-Realisten beantworten auch diese Frage mit Nein. Gerade unter der Voraussetzung der Wahrheit des Deflationismus, wonach „ist wahr“ lediglich minimal zu denken ist, bleibt die Frage akut, ob die wahrheitskonditionale Oberfläche immer auch der explanatorische Wegweiser zur semantischen Tiefenstruktur ist. Das heißt: Wahrheitsminimalismus und Referenzdeflationismus gegenwärtiger Sprachphilosophie heben die Asymmetrie-Erfahrung nicht auf. Das Gegenteil ist der Fall. Aus diesem Grunde sind Anti-Realismus (und Realismus) und Minimalismus vereinbar, verstanden als Antworten auf unterschiedliche Fragen. Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass die Erfahrung der Asymmetrie an eine Bifurkations-These gebunden ist, welche uns dazu führt, abs_____________ 3 Blackburn: Rule-Following and Moral Realism, in: Holtzmann / Leich (eds.): Wittgenstein – To Follow a Rule, London-New York 1981, S. 163-187, S. 185f. Reden ‚Als-ob‘ 31 trakten Entitäten wie mögliche Welten, Zahlen und Götter kritischer gegenüber zu stehen als Katzen und Matten.4 Aber diese (ontologische?) Festlegung scheint mir weniger das Ergebnis einer philosophischen Theorie (Metaphysik) zu sein, als vielmehr Ausdruck des alltagsweltlichen Datenbestands, vor dem Philosophie aller erst ins Rollen kommt. Die Bifurkation ist eine solche des vor-theoretischen Handelns.5 Drittens legen die ersten beiden Punkte eine Skizze nahe, wie Diskurse zwischen Realisten und Anti-Realisten geführt werden können – und zwar nicht primär als ontologische Auseinandersetzungen über die Existenz mehr oder weniger fraglicher Entitäten. Vielleicht sind Rorty und McDowell auf jeweils ihre Weise im Recht, dass wir unsere Haut nicht verlassen können, dass wir Sprache und Welt nicht ungefärbt miteinander vergleichen können, es keinen Zugang zur „Welt-an-sich“ gibt. Ich sage bewusst „vielleicht“, weil mir nicht ganz klar ist, ob ich verstehen kann, was ein solcher Versuch überhaupt bedeuten soll.6 Glücklicherweise sind beide Parteien auf solche Szenarien nicht angewiesen. Worum es stattdessen in solchen Diskursen geht, so mein Vorschlag, ist die Frage, mit welcher Metageschichte bezüglich eines Ausschnitts unserer Handlungswelt wir uns zufrieden geben sollten. Mit anderen Worten: Wenn der Philosoph mit der Aufgabe beauftragt wird, eine problematisch gewordene, höherstufige Handlungskompetenz, beispielsweise mentale Selbst- und Fremdzuschreibungen oder modale Inferenzpraktiken zu erhellen, dann bietet es sich in solchen Fällen an, eine genealogische Geschichte zu erzählen, wie aus einfacheren, bereits verstandenen Fähigkeiten sprachlicher und nicht-sprachlicher Art, die höherstufigen Sprachspiele haben entstehen können.7 Die Methodologie des Erzählens von genealogischen Geschichten ist selbst jenseits von Realismus und Anti-Realismus, d.h., es gibt realistische und anti-realistische Varianten solcher Geschichten. Auf der ersten _____________ 4 5 6 7 Vgl. zur kritischen Diskussion der Bifurkations-These: Kraut: Varieties of Pragmatism, in: Mind 99 (1990), S. 157-183; Price: Expressivism, Pluralism, and Representationalism – A New Bifurcation Thesis, Syndey 2007 (Vortrag); Price / Macarthur: Pragmatism, quasirealism and theglobal challenge, in: Misak (ed.): The New Pragmatist, Oxford 2007, S. 91-120; und Blackburn: Pragmatism: All or Some, Sydney 2007 (Vortrag). Ich will nicht leugnen, dass an dieser Stelle die ernst zu nehmende Frage zur Debatte steht, wo Metaphysik beginnt. Vgl. dazu: Chalmers / Manley / Wasserman (eds.): Metametaphysics, Oxford 2009. Angedeutet werden soll, dass ich einen Unterschied sehe zwischen metaphysischer Theoriebildung auf der einen und lebensweltlichem Common sense auf der anderen Seite. Es erscheint mir deshalb wenig sinnvoll, sowohl Realisten als auch Anti-Realisten auf eine unverständliche (metaphysische) Annahme festzulegen. Dieser Zug wird keiner Seite gerecht. Vgl. zur Synthese von Pragmatismus und Genealogie in der Spätphilosophie Wittgensteins Tolksdorf: Wittgenstein und das Projekt einer pragmatisch-genealogischen Philosophie der Sprache, in: Lütterfelds u.a. (eds.): Wittgenstein-Studien 2, Berlin-New York 2010/11. 32 Stefan Tolksdorf Stufe beginnt eine solche genealogische Geschichte nicht mit repräsentationalistischen Paradigmen, sondern schlicht mit der Frage nach der Funktion und dem Witz des sprachlichen Zuges. Was tun wir, wenn wir uns selbst und anderen mentale Eigenschaften zuschreiben? Warum handeln wir so und wie tun wir es? Es kann nun selbstverständlich so sein, dass uns die pragmatische Genealogie auf Gegenstände und Eigenschaften verweist, es also eine Funktion des Diskurses ist, über die Ausstattung der Welt zu berichten, eine Darstellung derselben zu geben. Der Leser denke an die Katze auf der Matte. Gleichwohl sollten wir damit rechnen, dass das nicht immer der Fall ist. Vielleicht bringt unsere modale Sprache einzig die Urteilsneigung zum Ausdruck, gewisse Inferenzen gut zu heißen, Festlegungen als solche kenntlich zu machen und/oder über Grenzen der Vorstellungskraft zu berichten. Unter diesen Umständen benötigen wir keine „möglichen Welten“ um die modale Praxis zu erklären. Andersherum wird ein Schuh aus der Sache: Mögliche Welten sind lediglich ein Mittel, jene praktischen Züge sprachlich zu verpacken. Solche Geschichten machen uns reflexiv verständlich, wie Bereiche der Lebenswelt funktionieren – und sie sind nicht auf einen extraterrestrischen Standpunkt angewiesen. Dieser Interpretationsvorschlag der Debatten zwischen Realisten und Anti-Realisten kann als wohlwollend angesehen werden, lässt er doch beide Seiten zu ihrem (eingeschränkten) Recht kommen. In meinen Augen sind globale Anti-Realismen ebenso unplausibel wie globale Realismen. Was es zu verstehen gilt, ist, an welcher Stelle eine realistische Erklärung ihre Erklärungskraft verliert, an welchem Punkt die Rede von Gegenständen und Eigenschaften zwar zulässig, aber nicht die beste Erklärung des Sprachspiels ist. In solchen Fällen überträgt der Realist ein bekanntes Bild auf Bereiche der Handlungswelt, in denen es seine explanatorische Kraft verloren hat. 2. Die Hauptakteure: Fiktionalismus und Non-Faktualismus Nachdem ich meine Karten offen gelegt und so die Bühne vorbereitet habe, sollen nun die beiden Hauptakteure die Bühne betreten, der Fiktionalismus und der Non-Faktualismus. In beiden Fällen handelt es sich um Spielarten des AntiRealismus, die miteinander konkurrieren und nicht selten verwechselt werden. Eine solche Verwechselung hat dramatische Konsequenzen und sollte vermieden werden. Als prominente Beispiele solcher Verwechselungen seien David Lewis und Hilary Putnam angeführt. Lewis’ Interpretation des Blackburnschen Quasi-Realismus (der in meiner Terminologie eine non-faktualistische Spielart ist) läuft entlang folgender Punkte: We look for something the quasi-realist says that the realist will not echo. And when that’s what we look for, we find it. So the realist’s and the quasi-realist’s linguistic dis- Reden ‚Als-ob‘ 33 positions are not, after all, just alike. There are prefixes or prefaces that rob all that comes after of assertoric force.8 Der letzte Satz führt uns direkt zum fiktionalistischen ‘Als-ob’. Dazu gleich mehr. Auch Putnam sieht in der quasi-realistischen Deutung mathematischer Sprachspiele eine fiktionalistische Elimination am Werke: Someone who says “There aren’t any such things as numbers or sets or functions, mathematics is a kind of make-believe” is an eliminationist. … Simon Blackburn’s ‚quasirealism’ with respect to mathematics seems to me to be a form of this eliminationist position.9 Beide Interpretationen sind meines Erachtens falsch. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass es gute Gründe gibt, zwischen Non-Faktualismus und Fiktionalismus (bzw. Putnams Eliminationismus) strikt zu unterscheiden. Ich widme mich beiden Positionen und der angedeuteten Verwechselung nicht zuletzt deshalb, weil ich viele Arbeiten Hans J. Schneiders im Sinne des Non-Faktualismus lese, gleichwohl die Gefahr sehe, sie fälschlicherweise fiktionalistisch zu deuten. Um einige Beispiele zu geben: Ist das zentrale Anliegen der Religionsphilosophie des späten Wittgensteins, welche Schneider als Sprungbrett benutzt und um wichtige Punkte ergänzt, nicht gerade die These, dass es keinen Gott gibt, wir aber so reden, als gäbe es einen? Vergleicht Schneider die religiöse Sprache nicht mit Märchen und Fiktionen? Und sagt er nicht explizit: „So können wir feststellen, dass die Aussage, für den Ausdruck „Gott“ existiere kein gegenständliches Referenzobjekt im Sinne von Freges ‚Bedeutung’ keinen Verlust anzeigt.“10? Oder nehmen wir den Umgang mit mathematischen Zeichen ins Bild hinzu, genauer die Verwendung von Sätzen wie „Diese Steine sind fünf“. In Phantasie und Kalkül spricht Schneider von einem Als-ob in folgender Weise: Die Fügungsweise ‚x ist P’ muss jetzt anders gedeutet werden als früher; eine alte Ausdrucksform wurde zur Etablierung eines neuen Handlungszusammenhangs benutzt, indem Ergebnisse von Zählhandlungen so mitgeteilt werden, als ob es sich dabei um ‚Eigenschaften von Dingen’ handeln würde.11 In einem anderen Aufsatz spricht Schneider von mentalen Zuständen als „metaphorische Schöpfungen“. Legt nicht diese Redeweise allein schon nahe, hier würden mentale Zustände als fiktionale Gebilde aufgefasst – als Gebilde, die lediglich in der Sprache bzw. in der Geschichte existieren? Schneider _____________ 8 9 10 11 Lewis: Quasi-Realism is Fictionalism, in: Kalderon (ed.): Fictionalism in Metaphysics, Oxford 2005, S. 314-321, S. 314f. Putnam: Ethics without Ontology, Harvard 2004, S. 20, 135. Schneider: Religion, Berlin 2008, S. 94. Schneider: Phantasie und Kalkül, Frankfurt a. M. 1999, S. 408. Stefan Tolksdorf 34 schreibt: „Der ‚Bezug’ auf den ‚mentalen Zustand’ ist im alltäglichen Sprechen metaphorischer Art; es gibt keinen Gegenstand...“12. Die Gefahr, von der ich oben sprach, besteht darin, diese Ausschnitte und die darin enthaltenen Thesen – analog der Interpretation des QuasiRealismus bei Lewis und Putnam – fiktional zu deuten, also immer dort, wo ein ‚als-ob’ auftaucht, Fiktionalismus zu vermuten. Das aber wäre in meinen Augen ein Fehler. Im Folgenden wird sich zeigen, dass vieles davon abhängt, was Wittgenstein unter einer „grammatischen Fiktion“ verstanden wissen wollte.13 3. Zwei Deutungen der Rede vom „propositionalen Gehalt“ – grammatische versus ontologische Fiktionen Beginnen wir mit einer kurzen Skizzierung der beiden Positionen. Der Fiktionalismus hat als eigenständige Position relativ spät die philosophische Bühne betreten, wird dafür aber gegenwärtig intensiv diskutiert.14 Fiktionalisten fühlen sich der fregeschen Unterscheidung zwischen dem propositionalen Gehalt eines Satzes und dem mit diesem Gehalt verbundenen Gebrauch (Kraft, Witz, illokutionäre Rolle, etc.) verpflichtet. Über die bloße Annahme der allgegenwärtigen Differenz von Bedeutung und Gebrauch hinausgehend, halten sie daran fest, dass der Sinn des Satzes stets auf die gleiche, repräsentationalwahrheitskonditionale Weise gebildet wird: der Subjektausdruck des Satzes greift einen Gegenstand heraus, von dem dann mittels Prädikatausdruck eine Eigenschaft ausgesagt wird. Dieses Paradigma des propositionalen Gehalts, wonach in allen Fällen wahrheitsbezogener Rede ein Gegenstand unter einen Begriff fällt, führt dann ganz natürlich dazu, mit jedem assertorischen Satz einen repräsentierten Sachverhalt zu verbinden, der dem ausgedrückten Gedanken des Satzes entspricht. In diesem Sinne sagt Kalderon: „The fictionalist can maintain that the sentences from the region of discourse are genuine representations of a putative domain of fact.”15 _____________ 12 13 14 15 Vgl. Schneider: Mentale Zustände als metaphorische Schöpfungen, in: Kellerwessel / Peuker (eds.): Wittgensteins Spätphilosphie. Analysen und Probleme, Würzburg 1998, S. 209-226, S. 212. Vgl.: „‘Bist du nicht doch ein verkappter Behaviorist? Sagst du nicht doch, im Grunde, dass alles Fiktion ist, außer dem menschlichen Benehmen?‘ – Wenn ich von einer Fiktion rede, dann von einer grammatischen Fiktion.“ (Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a. M. 2003, § 307). Vgl. Kalderon: Moral Fictionalism, Oxfod 2005; ders. (ed.): Ficitionalism in Metaphysics, a.a.O., Lewis: Quasi-Realism is Fictionalism, a.a.O., Rosen: Modal Fictionalism, in: Mind 99 (1990), S. 327-354. Kalderon (ed.): Ficitionalism in Metaphysics, a.a.O, S. 4. Reden ‚Als-ob‘ 35 Was den Fiktionalisten nun zum Anti-Realisten werden lässt, denn bisher spricht er wie ein echter Realist, ist die Tatsache, dass er der eben dargestellten semantischen These eine ontologische Annahme an die Seite stellt. Gemäß der oben erwähnten Asymmetrie-Erfahrung urteilen Fiktionalisten, dass es die Gegenstände, Eigenschaften und/oder Tatsachen gar nicht gibt. Oder anders ausgedrückt: Alle Sätze des ausgewählten Diskurses sind wörtlich genommen falsch, da in diesen von Entitäten und ihren Beziehungen zueinander die Rede ist, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Um das Sprachspiel aufrecht zu erhalten wird angenommen, es liegt eine Fiktion vor, wir reden in einem ‚Als-ob‘Modus: als gäbe es Zahlen, Werte, Götter und mögliche Welten. Das mag als eine erste Skizze genügen. Non-Faktualisten gehen einen anderen Weg. Sie interpretieren die Erfahrung der Sprachspiel-Asymmetrie auf eine andere Weise, nämlich so, dass Wittgensteins Rede von Fiktionen nicht ontologisch, sondern grammatisch verstanden wird. Was heißt das? Die Deutung der Asymmetrie vollzieht sich gemäß non-faktualistischer Ansätze so, dass zwischen sprachlicher Oberflächen- und Tiefengrammatik unterschieden wird. Die Diskrepanz entsteht dann, wenn die Form der Darstellung, also die Oberflächengrammatik, von der Logik des Sprachspiels bzw. von der Bedeutung des Satzes abweicht. Bereits 1929 schreibt Wittgenstein über die logische Form von Sätzen: Diese Formen sind die Normen unserer spezifischen Sprache, in die wir alle möglichen verschiedenen logischen Formen nach allen möglichen verschiedenen Verfahren projizieren. Formen, die wie ‚Dieser Vortrag ist langweilig‘, ‚Das Wetter ist schön‘, ‚Ich bin faul‘ gar nichts miteinander gemein haben, präsentieren sich als SubjektPrädikat-Sätze.16 Ausschlaggebend ist, dass Wittgenstein die Allgegenwärtigkeit der SubjektPrädikat-Form nicht ontologisch oder transzendental begründet, sondern von einer etablierten Norm der Darstellung spricht. Es ist demnach weder so, dass die Welt uns zwingt, Subjekt- und Prädikatausdrücke zu verwenden, weil wir in unseren Handlungsvollzügen eben auf unterschiedliche Gegenstände und Eigenschaften treffen. Noch sind es die „Bedingungen der Möglichkeit des Denkens“, welche eine solche Form erzwingen. Stattdessen deutet Wittgenstein in den Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik eine pragmatischgenealogische Erklärung dieser sprachlichen Norm an: Nun, können wir denn nicht das Begriffsgebäude ausbauen als Behältnis für welche Anwendung immer daherkommt? Darf ich denn nicht die Form ausbauen und gleichsam eine Sprachform vorbereiten für mögliche Anwendungen? Ist denn nicht die _____________ 16 Wittgenstein: Vortrag über Ethik, in: ders.: Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften, herausgegeben von Joachim Schulte, Frankfurt a. M. 1995, S. 22. Stefan Tolksdorf 36 Subjekt-Prädikat Form in dieser Weise offen und wartet auf die verschiedensten neuen Anwendungen?17 Ich kann der Idee der schrittweisen Ausdehnung einer sprachlichen Form der Darstellung an dieser Stelle nicht weiter nachgehen. Plausibel scheint jedoch, dass Wittgenstein folgendes Bild vor Augen hatte: Wir starten (zu Beginn der Philosophischen Untersuchungen wie auch im Leben) mit einfachen inhaltlichen Verhältnissen, in denen ein Gegenstand, zum Beispiel eine Platte, über eine gewisse Eigenschaft verfügt, zum Beispiel die Farbe Rot. Die sprachliche Darstellungsweise „Die Platte ist rot“ wird dann in einem zweiten Schritt auf andere Kontexte übertragen, in denen die vermeintlichen „Gegenstände“ und/oder „Eigenschaften“ vom ursprünglichen Paradigma abweichen. Der Leser denke an folgende Sätze: „Rot ist eine häufige Farbe“, „Der Tisch ist schön“, „Die Liebe ist verblasst“. In diesen Fällen wird das Schema übertragen, jedoch, so Wittgenstein, gehen wir in die Irre, wenn das inhaltliche Verstehen darauf ausgerichtet bleibt, Röte und Liebe in Analogie zum Tisch zu denken, oder aber Schönheit und Verblassen als Eigenschaften eines Dinges zu deuten, wie wir ursprünglich Tischen Farben zugeschrieben haben. Wir können diesen Gedanken nun wie folgt in das skizzierte Bild einfügen. Wenn die Subjekt-Prädikat-Form als propositionale Oberfläche mit realistisch-kognitiven Begleitassoziationen angesehen wird, denn sie bringt alle Inhalte auf das Fregesche Bild: Gegenstand und Begriff, und wir darüber hinaus die Erfahrung der Asymmetrie hinzunehmen, dann besteht die Möglichkeit, dass ein Satz lediglich oberflächengrammatisch repräsentational funktioniert, die für den Gedanken (Sinn, Gehalt) jedoch ausschlaggebende inhaltliche Fügung anders zu erklären ist. Genau auf diese Möglichkeit machen Non-Faktualisten als realisiert in vielen Bereichen der Lebenswelt aufmerksam. Die Sprache homogenisiert die Vielfältigkeit des menschlichen Handelns. Wer diese Gleichmachung übersieht, versteht die Logik des Handelns nicht vollständig. Hans J. Schneider hat diese Vorgänge der Projektion einer grammatischen Form unter den Begriff der „syntaktischen Metapher“ gebracht: wir übertragen alte Komplexbildungsweisen auf neue Inhalte.18 Im Kern der Auseinandersetzung zwischen Fiktionalisten und NonFaktualisten steht folglich der Begriff des „propositionalen Gehalts“ selbst. Letztere werfen den Fiktionalisten vor, naiv von der Oberfläche auf die Tiefengrammatik zu schließen und so die „grammatische Fiktion“ zu übersehen. Das ‚Als-ob‘ ist ein solches lediglich auf der Ebene der Darstellungsform, _____________ 17 18 Wittgenstein: Bemerkungen über die die Grundlagen der Mathematik, Frankfurt a. M. 1999, S. 295. Vgl. Schneider: Phantasie und Kalkül, a.a.O., ders.: ‚Syntaktische Metaphern’ und ihre begrenzende Rolle für eine systematische Bedeutungstheorie, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 41 (1993), S. 477-486. Reden ‚Als-ob‘ 37 nicht aber auf der Ebene sprachlicher Handlungszusammenhänge. Der Fiktionalist deutet den propositionalen Gehalt auf homogene Art und Weise, wobei die unterschiedlichen Gehalte auf ontologische Differenzen zurück geführt werden. Zahlen sind halt keine Tische, Unmöglichkeiten keine Farben. Wenn Wittgenstein jedoch im Recht ist, dann haben wir es mit einer Vielzahl von semantischen Komplexbildungsweisen zu tun – und damit also mit propositionalen Gehaltsformen im Plural.19 Daraus folgt, dass wir zwei Propositionsbegriffe klar voneinander trennen müssen: Bezogen auf die syntaktische Form haben Fiktionalisten völlig Recht. Uns tritt in den meisten Sprachspielen ein „repräsentationaler Gehalt“ entgegen. Jedoch bezogen auf den Sinn einiger Sätze und ihren Verankerungen in der nicht-sprachlichen Lebensform, glauben Non-Faktualisten ihrerseits zu Recht zeigen zu können, dass der ausgedrückte Gedanke (die Proposition) des Satzes für anti-realistische Geschichten anfällig ist, weil er ohne Bezugnahme auf die fraglichen Gegenstände und Tatsachen erklärt werden kann. Das muss selbstverständlich im Einzelfall gezeigt werden. Ansatzweise sei an dieser Stelle auf die bereits erwähnten Beispiele verwiesen: Wenn wir davon ausgehen, dass modale Sätze wie „Runde Vierecke sind nicht möglich“ oder „Menschen müssen sterben“ dazu dienen, gewisse Zeichenkombinationen auszuschließen bzw. die Sätze aus dem Fluss der Kommunikation zu nehmen, sie als Rahmenpunkt und methodologische Setzungen des Fragens und Antwortens anzusehen, dann gewinnen Modaloperatoren ihren Sinn primär über solche Handlungsvollzüge und weniger dank der Darstellung möglicher Welten bzw. der Bezugnahme auf existierende Modalitäten – auch dann, wenn die Sprache ein anderes Bild nahe zu legen scheint. Die Fähigkeit, modal zu urteilen erwerben wir nicht durch Einsicht in modale Realitäten. Was erläutert werden muss, ist gerade der Begriff der modalen Realität. Die Anwendung von Wahrnehmungsprädikaten auf modale Beziehungen ist folglich eine sekundäre Ausdehnung (Projektion, ein metaphorischer Zug) basalerer Verwendungen von „Sehen“, und als solche nicht selbsterklärend. Analog könnte eine Geschichte moralischer Diskurse aussehen. Moralische Wahrheiten, Werte und Eigenschaften könnten das Ergebnis unserer rationalen und emotionalen Einstellungen gegenüber Vorkommnissen in der natürlichen und sozialen Welt sein. Als natürliche Wesen reagieren wir auf Probleme und Situationen mit der Ausbildung von positiven und negativen Einstellungen, welche, wollen sie moralisch verbindlich sein, selbst noch ein_____________ 19 Vgl. Tolksdorf: Die Vielfalt semantischer Komplexbildungsweisen, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 57 (2009), S. 597-617. Propositionale Gehalte homogen zu konstruieren ist das gemeinsame Erbe Freges in den Ansätzen von Dummett, Quine und Davidson. Stefan Tolksdorf 38 mal rational-diskursiv auf den Prüfstand gestellt werden. Was wir für eine solche pragmatische Geschichte an ontologischer Ausstattung benötigen, sind lediglich alltagsweltliche Gegenstände, interagierende Personen und einen Raum des Handelns. Wollen wir herausfinden, ob die ablehnende Haltung gegenüber Folterungen moralisch adäquat ist, müssen wir sie gewissen kognitiven Erwägungen aussetzen. Was in eine solche Prüfung einfließt, sind Handlungen des Folterns, die Erfahrung von Schmerz und Leid, das Wissen um die Konsequenzen von Folterungen, etc. Von Werten und moralischen Wahrheiten ist am Ende, nicht jedoch am Anfang dieser Geschichte die Rede. Das ist bekanntermaßen das Arbeitsfeld von Blackburns „Quasi-Realisten”: I have now given several examples of the device of propositional reflection, the ways in which expressions of attitude and propositions concerning the interrelations of attitudes with each other and with beliefs are given a syntax that makes them appear to relate to facts in a peculiar, unobservable, moral realm. It must in no way be considered surprising that this device should exist. For disagreement in moral attitude is one of the most important disagreements there is, and working out the consequences of moral attitudes, is one of the most important subjects there is. The device of propositional reflection enables us to bring the concepts of propositional logic to this task. It enables us to use notions like truth, knowledge, belief to give moral argument all the structure and elegance of argument about facts.20 Meines Erachtens erzählt Hans J. Schneider, bezogen auf mentale und religiöse Sprachspiele, ganz ähnliche Geschichten. Schneiders Verzicht auf einen religiösen Überglauben, verbunden mit der Fokussierung auf „religiöse Erfahrungen“ als dem Zentrum des Glaubens, führt zu einem Religionsbild, in welchem die Praxis in den Mittelpunkt gerät und damit Fragen der Lebenseinstellung und des Leben-Könnens relevant werden. Die ungegenständliche Erfahrung von Tod und Leid auf der einen und von Sich-fallen-lassen und Aufgefangen-werden auf der anderen Seite versehen die religiöse Sprache mit Sinn. Damit gilt im Sinne Blackburns, dass es nicht eine Entität namens „Gott“ ist, die der Praxis ihren Wert verleiht.21 Stellen wir auf analoge Weise die realistische Interpretation mentaler Selbst- und Fremdzuschreibungen vom Kopf auf die Füße, dann gerät die Objektunterstellung unter Beschuss, solche Sätze handeln von inneren, versteckten Entitäten mit Namen „Absicht“ oder „Wünsch“. So kann im gleichen Atemzug der Einsicht in die pragmatische Funktion solcher Züge Raum gegeben werden, welche unter anderem etwas damit zu tun hat, dass Personen für ihre Handlungen Verant_____________ 20 21 Blackburn: Moral Realism, in: ders.: Essays in Quasi-Realism, Oxford 1993, S. 111.129, S. 129. Auf dieser Ebene ist Putnams Slogan von der „objectivity without objects“ völlig zuzustimmen. Er sagt: „The pragmatic pluralism does not require us to find mysterious and supersensible objects behind our language games.“ (Putnam: Ethics without Ontology, a.a.O., S. 22). Reden ‚Als-ob‘ 39 wortung übernehmen, sie ihren Charakter offenbaren oder eine gewisse Selbstinterpretation präsentieren, ihr Tun in den Raum der Gründe stellen.22 Die benötigte Ontologie kommt auch hier ohne „innere Gegenstände“ aus, ohne deshalb reduktionistisch zu sein.23 4. Nützliche Fiktionen und Quasi-Behauptungen Wo stehen wir nach der Skizzierung der beiden Hauptakteure des vorliegenden Aufsatzes? Es sollte deutlich geworden sein, dass beide Positionen bestimmte Thesen teilen, diese aber anders verstehen bzw. andere Konsequenzen daraus ziehen. Diese Unterschiede hinter den Gemeinsamkeiten weisen den Non-Faktualismus, wie im Fortgang immer deutlicher werden wird, als die bessere anti-realistische Alternative aus. Wie sehen die Gemeinsamkeiten aus? Als erstes können wir festhalten, dass beide Ansätze der ontologischen Festlegung auf religiöse, moralische oder modale Entitäten skeptisch gegenüber stehen. Das Sprachspiel lebt auch ohne den Gegenstand, verfügt im Sinne Putnams über Maßstäbe der Angemessenheit und Normativität auch ohne zugeordnete Referenzen. Entscheidend ist jedoch, dass diese Skepsis aus unterschiedlichen Gründen genährt wird. Wo der Fiktionalismus glaubt, die Rede von solchen Entitäten im Prinzip verstehen zu können und demnach die Zweifel auf der ontologischen Ebene verortet, auf welcher – wie auch immer – sich zeigen soll, dass die Entitäten nicht existieren, beginnt der Non-Faktualismus bereits auf der Stufe des Verstehens Fragezeichen aufzustellen. Wittgensteins Bedenken, die in gleicher Weise bei Schneider und Blackburn zur Sprache kommen, richten sich zu aller erst auf die Frage, was die Annahme von „Zahlen“, „Werten“ und „Göttern“ als dinghafte Bestandteile der Welt, also über ihre Präsenz als „Gegenstände der Rede“ hinausgehend, überhaupt bedeuten soll. Bedenken dieser Art greifen nicht nur den Realisten, sondern in gleicher Weise auch den Fiktionalisten an, der, durch diese Brille betrachtet, wie ein halbherziger Realist erscheint. Denn beiden Positionen ist der semantische Mantel gemein und damit eine sprachphilosophische Annahme, deren Basis durch das Phänomen der „syntaktischen Metapher“ gerade untergraben wird. Die unterschiedliche Skepsis den Gegenständen gegenüber führt uns daher zur Differenz zwischen einem semantischen und einem ontologischen ‚Als-ob‘: der Fiktionalist bezieht sein „als gäbe es die Gegenstände wirklich“ auf die _____________ 22 23 Vgl. den Beirag von Ralf Stoecker. Vgl. dazu Schneider: ‚Den Zustand meiner Seele beschreiben’ – Bericht oder Diskurs?, in: Köhler (ed.): Davidsons Philosophie des Mentalen, Paderborn 1997, S. 33-51; und ders.: Mentale Zustände als metaphorische Schöpfungen, a.a.O. Stefan Tolksdorf 40 Existenz der Dinge, der Non-Faktualist dagegen auf die Form der sprachlichen Darstellung. Bereits an dieser Stelle scheint der Non-Faktualismus einen argumentativen Vorteil zu haben, beginnt seine Kritik doch an einer früheren und fundamentaleren Stelle. Fiktionalisten schulden uns, so können wir sagen, eine Antwort auf die Frage, was die repräsentationalistische Rede von Werten und Zahlen eigentlich bedeuten soll. Darauf komme ich gleich zurück. Der Vorteil, dieser Erklärungslast nicht ausgesetzt zu sein, hängt eng mit einem zweiten Vorteil zusammen, nämlich jenem, dass Non-Faktualisten die Annahme eines systematischen Wahrheitswert-Fehlers gar nicht erst benötigen. Mit anderen Worten: Unsere alltäglichen Sprachspiele sind nicht defekt. Die zu erbringenden pragmatischen Metageschichten zeigen gerade, dass die fraglichen Begriffe anders funktionieren und anders zu verstehen sind, nämlich so, dass auf das ontologische Hintergrundbild – und damit auf den Fehler – verzichtet werden kann. Dieses Bild wird einzig durch die Kleider der Sprache erzeugt, welche Analogien und Ähnlichkeiten nahelegen, wo das Sprachspiel über relevante Unterschiede verfügt. Der Fehler steckt nicht in der Sprache, sondern in der (fiktionalistischen) Theorie.24 Kommen wir zur zweiten Gemeinsamkeit, die mit der ersten in Zusammenhang steht, dennoch auf den ersten Blick etwas überraschen mag. Wir werden jedoch schnell erkennen, dass ein zweiter Blick uns argumentativ einen wichtigen Schritt weiter bringt. Fiktionalisten und Non-Faktualisten stimmen auch hinsichtlich der Überzeugung überein, dass die kognitive Oberfläche der fraglichen Sätze und Diskursklassen irreführend ist. Abweichend ist erneut die Interpretation dieser These. Dass der Non-Faktualismus der Oberfläche kritisch gegenübersteht, sollte oben deutlich geworden sein, schickt sie uns doch, so die Wittgensteinsche Deutung, nicht selten auf die Suche nach Chimären. Was aber meinen Fiktionalisten, wenn sie den kognitiven Anschein für irreführend halten? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir etwas tiefer in das fiktionalistische Terrain eindringen. _____________ 24 An dieser Stelle sollte zugestanden werden, dass in der Literatur zwischen einem hermeneutischen und einem revolutionären Fiktionalismus unterschieden wird. Diese Unterscheidung ist für die Frage, von welcher Art der unterstellte systematische Fehler ist, durchaus von Belang. Der revolutionäre Fiktionalismus ist seinem Wesen nach revisionär, das heißt, er plädiert aus ontologischen Gründen für eine fiktionalistische Neuinterpretation des entsprechenden Diskurses. Hermeneutisch gestimmte Fiktionalisten gehen eher davon aus, dass ihre Analyse offenbart, was wir im Alltag immer schon gemacht haben. Der Fiktionalismus entspricht also der mehr oder weniger expliziten Interpretation unserer Sprachspiele (vgl. dazu Kalderon: Fictionalism in Metaphysics, a.a.O., S. 5ff.). Da es mir nicht um eine umfassende Darstellung des Fiktionalismus geht, lasse ich diese Differenz im Folgenden außer Acht und will unter „Fiktionalismus“ stets die hermeneutische Spielart verstanden wissen. Reden ‚Als-ob‘ 41 Angenommen wir stimmen um des Arguments willen der These zu, dass alle moralischen Sätze wörtlich genommen falsch sind, da es so etwas wie die „präskriptive Objektivität“25 nicht gibt. Sofort stellt sich dann aber die Anschlussfrage, weshalb wir trotz dessen moralische Urteile fällen, wozu das moralische Sprachspiel am Leben gehalten wird, ja mehr noch, von den meisten sogar mit besonderer Relevanz versehen wird? Wäre Wahrheit die einzige oder die maßgebliche Norm der Äußerung moralischer Urteile (die primäre Diskurs-Norm), dann wären wir sicher gut beraten, den gesamten Diskurs zu eliminieren. Geht es um Wahrheit, dann ist die systematische, moralische Falschheit ohne Wert. An diesem Punkt angelangt, vollziehen Fiktionalisten ein interessantes Manöver, indem sie sich pragmatischen Überlegungen hingeben und für die Existenz anderer, nicht auf Wahrheit bezogener Normen eines Diskurses argumentieren. Das Ausspielen von propositionalen Gehalten in einem rationalen Diskurs verpflichtet Sprecher und Hörer gleichermaßen darauf, die Akzeptanz des Satzes im Auge zu behalten. Wer aber sagt, dass Wahrheit der einzige Akzeptanz-Maßstab ist? Kalderon erinnert uns beispielsweise an folgendes: „The epistemic value of truth might be outweighed in a given circumstance by some nonepistemic value.”26. Damit betreten wir den Raum nützlicher Fiktionen: etwas kann falsch, aber akzeptierbar sein, wenn es pragmatisch gesehen nützlich ist, eine nichtepistemische Funktion erfüllt. Es ist der Begriff der nützlichen Fiktion, der es unter Umständen erlaubt, eine zentrale Asymmetrie zwischen der Moraltheorie auf der einen und den bekannten Theorien über Hexen und Phlogiston auf der anderen Seite herauszustellen. Denn alle drei Theorien sind für Fiktionalisten gleichermaßen falsch: es gibt keine Hexen, kein Phlogiston und auch keine moralischen Werte in der Welt. Wieso aber haben wir die beiden pseudo-wissenschaftlichen Theorien aufgegeben, das moralische Gebilde dagegen nicht?27 Die Antwort lautet: Moralische Systeme erfüllen eine soziale Norm, sie halten die Gesellschaft am Leben, dienen einer Ordnungsfunktion, lassen die Menschen träumen, sie seien moralische Wesen, etc. Für Hexen dagegen haben wir keine Verwendung mehr, es gibt keine starken nicht-epistemischen Werte, die den epistemischen Defekt ausgleichen können. Gibt es weitere Beispiele für nützliche Fiktionen? Naheliegenderweise bietet sich der religiöse Diskurs als ein ausgezeichnetes Tätigkeitsfeld des Fiktiona_____________ 25 26 27 Vgl. Mackie: Ethics: Inventing Right and Wrong, Penguin Books 1977. Kalderon: Moral Fictionalism, a.a.O., S. 104. Hans J. Schneider hat mich darauf hingewiesen, dass Theorien über Hexen und Theorien über Phlogiston nicht gleichermaßen pseudo-wissenschaftlich sind. Letztere haben eher den Status veralteter, wissenschaftlicher Ansichten. Dem kann ich zustimmen, wenngleich sich die Frage anschließt, wo die Grenze zwischen pseudowissenschaftlich und veraltet-wissenschaftlich verläuft. Stefan Tolksdorf 42 lismus an. „Gott“ als nützliche Fiktion anzusehen bedeutet zum Beispiel, als aufgeklärter und naturwissenschaftlich gebildeter Mensch nicht an Wesen mit zauberhaften Fähigkeiten zu glauben, gleichwohl aber in den religiösen Geschichten Hilfe zu finden, geht es um Krankheit, Tod und Älterwerden. Religion, so ließe sich vielleicht etwas verkürzt sagen, ist die Antwort auf das menschliche Alleinstellungsmerkmal: nur der Mensch weiß um seinen eigenen Tod. Gemessen am in Aussicht gestellten Nutzen einer religiösen Fiktion, ist die Tatsache der Falschheit nebensächlich. Fiktionalistische Ansätze beschränken sich nicht auf außerwissenschaftliche Handlungszusammenhänge. Sie betreffen nicht selten den theoretischen Kern moderner Naturwissenschaften selbst. Der Wissenschaftstheoretiker Bas van Fraassen hat in vielen Schriften für die These argumentiert, theoretische Schlüsselbegriffe wie „Kraft“, „Feld“ und „Atom“ seien ebenfalls nützliche Fiktionen. Die Bezugnahme auf unbeobachtbare Entitäten zielt nicht primär auf Wahrheit, das heißt, der Forscher geht nicht davon aus, dass die theoretischen Terme die Struktur der Welt erfassen. Was wir von einer wissenschaftlichen Theorie erwarten, ist eher so etwas wie empirische Adäquatheit hinsichtlich der Ordnung und Anordnung wahrnehmbarer Phänomene. Van Fraassen sagt: In accepting a theory T, competent speakers who understand T do not believe the theoretical proposition expressed. In accepting T, competent speakers believe only that the theory is empirically adequate and they intend to deploy that theory in the conduct of science.28 Ich kann in dieser Arbeit nicht weiter auf die erwähnten Beispiele eingehen.29 Wichtig für die vorliegende Fragestellung ist lediglich, dass Fiktionalisten alltagsweltliche und wissenschaftliche Diskurse in gewisser Hinsicht wie literarische Werke (wie einen Roman beispielsweise) behandeln. Wenn Patrick Süskind in Die Taube seinen Helden Jonathan Noel denken lässt: „’Was meint sie? Was will sie? Warum sagst sie: man muss die Taube verjagen? Meint sie vielleicht, ich solle die Taube verjagen?’ … er wünschte, er hätte es nie gewagt, Madame Rocard anzusprechen.“30, dann behauptet Süskind nicht, so der Fiktionalist, dass es einen Noel wirklich gab, dieser panische Angst vor einer Taube hatte und mit Madame Rocard gesprochen hat. Es kommt nicht auf die Wahrheit der Beschreibung an. Das literarische Genre erfüllt andere Funktionen. Allgemein gefasst heißt das, dass gemäß der fiktionalistischen Interpretation, assertorische Züge des Diskurses nicht das behaupten, was sie vorgeben zu behaupten. _____________ 28 29 30 Bas van Fraassen: The Scientific Image, Oxford 1980. Vgl. für den Fiktionalismus in der Philosophie der Mathematik Field: Science without Numbers, Princeton 1980. Süskind: Die Taube, Zürich 1987, S. 38. Reden ‚Als-ob‘ 43 Eine solche These hat semantische Auswirkungen auf die Begriffe „Überzeugung“ und „Behauptung“. Unter normalen Umständen impliziert das assertorische Ausspielen einer Behauptung nämlich, dass der Sprecher von der Wahrheit des durch den Satz ausgedrückten propositionalen Gehalts überzeugt ist. Unter fiktionalistischen Vorzeichen dagegen kann es nicht darum gehen, dass der Sprecher seine Überzeugung bezüglich des ausgedrückten Gedankens zur Sprache bringt, denn er ist ja gerade von der Wahrheit nicht überzeugt. Ohne Überzeugung aber auch keine Behauptung. Damit ist die Frage aufgeworfen, welchen Sprechakt ein Fiktionalist vollzieht, und von welcher Art die kognitiv-propositionale Einstellung ist, wenn Behauptung und Überzeugung als mögliche Kandidaten ausscheiden. Bevor wir diese Fragen beantworten, kann die zweite Gemeinsamkeit zwischen Fiktionalisten und Non-Faktualisten - der Leser erinnere sich an die These, dass die kognitive Oberfläche der Sprache bisweilen irreführend ist aus fiktionalistischer Sicht wie folgt gedeutet werden: Unsere Sprache legt es nahe, assertorische Sätze stets als echte Behauptungen aufzufassen, durch welche der Sprecher seine Überzeugung bezüglich der Wahrheit des propositionalen Gehalts zum Ausdruck bringt. Das aber, so der Fiktionalist, ist häufig ein Irrtum, weil kognitiv gesehen in moralischen Diskursen beispielsweise eine solche Überzeugung gerade nicht primärer Teil des sprachlichen Zuges ist. Interessanterweise wird diese Form der sprachlichen Täuschung, die nicht mit der non-faktualistischen, an Wittgenstein angelehnten Diskrepanz zwischen grammatischer und logischer Form zusammenfällt, ebenfalls unter Bezugnahme auf die Spätphilosophie Wittgensteins abgesichert. Kalderon sagt diesbezüglich: A representation can be used in all sorts of ways. Using it to claim that the world is the way the representation represents it to be is but one of them. Indeed, this is an important insight of Wittgenstein’s … section 23. In making up a story and reading it one does not put forward the story as true, but it remains a representation nonetheless.31 Dieses Zitat ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Festgehalten werden soll in diesem Zusammenhang, dass ich die von Kalderon angesprochene Wittgenstein-Lesart nicht für völlig verfehlt ansehe, sie meines Erachtens aber nur die halbe Wahrheit ist. Wittgenstein thematisiert gerade nicht nur das, was wir mit Repräsentationen tun können, sondern auch den Begriff der „Repräsentation“ selbst. Kalderon liesst PU 23 so, als wolle Wittgenstein sagen, die Philosophen hätten übersehen, dass wir Darstellungen für sehr unterschiedliche pragmatische Zwecke einsetzen können. Eine Repräsentation mag Teil eines Theaterstückes sein, sie kann als Voraussetzung für einen Witz fungieren oder aber eine Beleidigung, Aufmunterung, etc. darstellen. All das ist richtig. Die _____________ 31 Kalderon: Moral Fictionalism, a.a.O., S. 92f. 44 Stefan Tolksdorf kleine pragmatische Revolution der Spätphilosophie Wittgensteins, wie ich sie nennen will, hat sicher mit dem Kampf gegen die Vormachtstellung der Wahrheitsnorm zu tun. Es gibt unbestritten eine Tendenz in der Logik, Philosophie, aber auch im Alltag, die anderen eigenständigen Diskursziele zu übersehen. Darüberhinaus – und dieser Punkt wird von Non-Faktualisten betont – gibt es aber bei Wittgenstein auch eine zweite, große pragmatische Revolution. Der Bruch mit Frege geht gerade nicht in der Searleschen Hinzufügung eines „illocutionary force indicators“ auf, sondern betrifft das Wesen der Wahrheit selbst. Wenn Wittgenstein in PU 304 sagt - : Das Paradox verschwindet nur dann, wenn wir radikal mit der Idee brechen, die Sprache funktioniere immer auf eine Weise, diene immer dem gleichen Zweck: Gedanken zu übertragen – seien diese nun Gedanken über Häuser, Schmerzen, Gut und Böse, oder was immer. - dann greift er das Paradigma an, alle wahrheitsfähigen Sätze seien propositional homogen zu konstruieren, nämlich im Sinne der fregeschen Grundbeziehung ‚Gegenstand und Begriff‘ oder ‚Täter und Tätigkeit‘, welche von Searle im Wesentlichen übernommen wird. Die Doppeldeutigkeit von PU 304, welche fiktionalistische und non-faktualistische Interpretationen zulässt, besteht darin, dass wir in der Wendung „Gedanken zu übertragen“ einmal das „übertragen“ und einmal den „Gedanken“ in den Mittelpunkt der Interpretation stellen können. Diskutieren wir das Übertragen von propositionalen Gehalten, dann liegt die These nahe, dass nicht jeder Gehalt behauptet wird. Betonen wir dagegen den Gedanken, dann öffnet sich das Feld semantischer Komplexbildungsweisen. In Sätzen wie „Es regnet“ oder „Die Schmerzen hörten langsam auf“, bei denen es durchaus um Wahrheit geht, ist von Tätern oder Gegenständen („Es“, „die Schmerzen“) nur im übertragenen Sinne die Rede, wie auch das Aufhören keine Eigenschaft oder Tätigkeit ist. Wir tun also gut daran, soll der ausgedrückte Gedanke verstanden werden, die Konstruktion des Satzsinns nicht auf das Fallen eines Gegenstandes unter einen Begriff zu reduzieren. Fiktionalisten übersehen, so meine These, die Tiefe der pragmatischen Überlegungen Wittgensteins. 5. Fazit: Die 4 Thesen des Fiktionalismus Kommen wir zum systematischen Fazit des letzten Abschnitts zurück und wiederholen die noch offene Fragestellung: Welchen Sprechakt vollzieht ein Fiktionalist mit der Äußerung eines assertorischen Satzes und welche propositionale Einstellung bringt er dadurch zum Ausdruck? In der Literatur hat sich die Rede von „Quasi-Behauptungen“ und „Quasi-Überzeugungen“ als Ant- Reden ‚Als-ob‘ 45 wort auf diese Frage durchgesetzt. Was ist damit gemeint? Zuerst einmal ist es plausibel, die Behauptungskategorie im Spiel zu belassen. Auch wenn QuasiBehauptungen keine Behauptungen im engen Sinne des Wortes sind, so kann doch nicht geleugnet werden, dass fiktionale Sätze mit einem Wahrheitsanspruch auftreten. Das heißt: Fiktionale Äußerungen sind in den meisten Fällen nicht ironisch gemeint, der Gesprächspartner soll nicht getäuscht oder hinters Licht geführt werden. Kurzum: Der Sprechakt intendiert eine gewisse wahrheitsfokussierte Ernsthaftigkeit. Es wird etwas behauptet, nur eben nicht das, was durch den wörtlich genommenen Satz ausgedrückt wird. Behauptet wird ein anderer als der ausgedrückte propositionale Gehalt. Um dieser Unterscheidung zweier Gehaltsarten gerecht zu werden, bietet es sich an, zwischen einem realen und einem fiktionalen Gehalt zu differenzieren. Der fiktionale Gehalt entspricht dabei der ausgedrückten Proposition, also zum Beispiel „Jonathan Noel sah die Taube völlig eingeschüchtert an“. Da dieser Gehalt aber nicht behauptet wird, kann er nicht der reale Gehalt sein – nicht der Gehalt, von dessen Wahrheit der Sprecher überzeugt ist. Der reale Sinn des Satzes entsteht der fiktionalistischen Standardlesart zufolge, wenn dem fiktionalen Gehalt ein F(iktions)-Operator vorangestellt wird. Das Ergebnis lautet dann: F(propositionaler Gehalt). David Lewis sprach weiter oben von: „There are prefixes or prefaces that rob all that comes after of assertoric force“, was wir nun wie folgt deuten können: der reale Gehalt einer fiktionalen Behauptung ist beispielsweise: - Gemäß der Geschichte gilt, dass Jonathan Noel die Taube völlig eingeschüchtert ansah, Im Sinne der religiösen Schrift können wir sagen, dass Gott seine Hand über den Demütigen hält, Folgen wir dem Moralsystem, dann ist das Töten von Menschen verwerflich, etc. Die Quasi-Behauptung behauptet den realen Gehalt, die Quasi-Überzeugung bringt zum Ausdruck, dass der Sprecher den realen Gehalt für wahr hält. Die Äußerungen des Fiktionalisten sind demnach wahr, wenn es sich in der Fiktion tatsächlich so verhält, wie der Sprecher sagt. Der reale Gehalt ist dieser Lesart des Fiktionalismus nach also metasprachlich zu verstehen: wir reden über fiktionale Gedankengebäude. Damit haben wir den Fiktionalismus etwas ausführlicher beschrieben. Fassen wir die gewonnene Charakterisierung thesenartig zusammen: (1) Semantische These: Die Sätze des fraglichen Diskurses sind repräsentational zu verstehen. 46 Stefan Tolksdorf (2) Ontologische These: Die Sätze des fraglichen Diskurses sind aufgrund ontologischer Tatsachen systematisch falsch. (3) Irreführung der kognitiven Oberfläche: Entgegen dem Anschein der sprachlichen Oberfläche sind die Sätze des fraglichen Diskurses keine Behauptungen und drücken keine Überzeugungen aus, stattdessen liegen Quasi-Behauptungen und Quasi-Überzeugungen vor. (4) Der reale Gehalt des Satzes ergibt sich aus der Einklammerung des fiktionalen Gehalts, welche durch einen F-Operator vollzogen wird. 6. Non-faktualistische Kritik am Fiktionalismus Wir sind jetzt in der Lage, die Kritik am Fiktionalismus klarer zu fassen und um weitere Punkte zu ergänzen. Ich habe oben bereits angedeutet, dass uns Fiktionalisten eine Geschichte darüber schulden, wie die Sätze eines fiktional erschlossenen Diskurses repräsentational zu verstehen sind. Diesen Einwand können wir nun wie folgt konkreter fassen: Wie ist der fiktionale Gehalt zu verstehen? Die formale Struktur der fiktionalistischen Theorie, also F(propositionaler Gehalt), macht deutlich, dass das Rettungsmanöver der Einklammerung des propositionalen Gehalts von sekundärer Signifikanz ist. Ein solcher Zug macht nur dort Sinn, wo bereits klar ist, von welcher Art die Proposition ist, d.h., was die Rede von Zahlen, Werten und Modalitäten gemäß der semantischen These bedeuten soll. Entscheidend ist, dass der Wahrheitswert nach dem Sinn kommt – nur sinnvolle Sätze können wahr oder falsch sein. Wer der Meinung ist, dass der Satz „Gott hält seine schützende Hand über den Demütigen“ aus ontologischen Gründen falsch ist, der legt sich darauf fest, verstanden zu haben, wie die mit „Gott“ benannte Entität in den Lauf der Dinge eingreifen kann. Der Non-Faktualist fragt nun aber gerade, ob wir wissen, was das bedeuten soll – und ich teile die Ansicht, dass hier massive Zweifel angebracht sind. Der Fiktionalist kommt mit seinem Rettungsversuch – in den meisten Fällen – also zu spät. Diese Diagnose lässt sich auf die anderen Beispiele übertragen. Die antirealistischen Bedenken in der Metaehtik betreffen Fragen der folgenden Art: Was soll es heißen, von moralischen Eigenschaften zu reden, die wahrnehmbar sind, die ihrem Wesen nach objektiv genug sind, um nicht idealistisch genannt zu werden, zu deren Natur es gleichwohl gehört, intrinsisch handlungsanleitend zu sein? Oder wie kann der Realist die Supervenienz zwischen moralischen und nicht-moralischen Eigenschaften erklären? Wieso sollten Tatsachenarten, die in keiner Beziehung zueinander stehen, supervenient aufeinander abgestimmt sein? All diese Frage bleiben virulent, wenn sie durch die Phrase „angenommen, das Moralsystem ist korrekt“ lediglich eingeklammert werden. Reden ‚Als-ob‘ 47 Die erste These des Fiktionalismus, die wir oben semantisch genannt haben, mag zwar mehr als ein Lippenbekenntnis sein, stellt in meinen Augen aber bereits den entscheidenden Fehler dar. Der sprachliche Zug des Annehmens, so sagt Wittgenstein in den Aufzeichnungen für Vorlesungen über ‚privates Erlebnis’ und ‚Sinnesdaten’, ist dem, was angenommen wird, semantisch nachgeordnet. Zuerst müssen wir gelernt haben, die Wahrheit zu sagen, bevor der parasitäre Zug kommt, die Wahrheit vorzutäuschen oder anzunehmen: Wie macht man das: Annehmen, dass dies oder jenes der Fall ist? Was ist eine Annahme wie z.B. ‚A hat Zahnschmerzen’? Ist es nichts weiter, als dass man die Worte ‚A hat Zahnschmerzen’ sagt? Oder besteht es nicht darin, dass man mit diesen Worten etwas tut?“32 Wittgensteins Antwort ist, dass die Annahme ein funktionierendes Sprachspiel benötigt, da sie ein Handlungszug, nicht nur ein Zustand des Bewusstseins ist. Dieser Einwand erlaubt es uns darüberhinausgehend, eine wichtige Differenz zwischen den literarischen Beispielen, also gewissermaßen der Heimat des Fiktionalismus, und den anti-realistischen Übertragungen auf modale und moralische Sprachspiele herauszuarbeiten. Denn niemand würde bezweifeln, dass wir Süskinds Sätze in einem wörtlichen, d.h. nicht-fiktionalen Sinne verstehen. Weil wir das tun, kann der Autor mit ihnen weitere Züge ausführen. Die Frage im modalen Fall ist aber, wie wir die Rede von „möglichen Welten“ tatsächlich repräsentational verstehen können. Ich sage daher nicht, dass fiktionalistische Varianten in der Literatur keine Aussicht auf Erfolg hätten, jedoch spricht die eben dargestellte Differenz dafür, dass anti-realistische Diskurse in den meisten Fällen nicht fiktionalistisch interpretiert werden können. Ich möchte dieser sprachphilosophischen Fundamentalkritik weitere Einwände an die Seite stellen. Der erste Einwand betrifft die Motivation hinter der fiktionalistischen Erklärung. Erscheint es nicht inhaltlich reichlich unmotiviert, mit der These zu starten, dass ein bestimmtes Vokabular (oder eine philosophische Metageschichte darüber) intrinsisch defekt ist, dann aber dazu überzugehen, unter gewissen Vorzeichen doch an diesem Diskurs festzuhalten? Was spricht dafür, in einem ersten Schritt den gesamten Diskurs kognitiv zu ächten, also alle Sätze des Bereichs als falsch auszuweisen, dann in einem nachgeordneten zweiten Schritt die Rehabilitation des Falschen zu wagen? Ich sehe nicht, weshalb man so etwas tun sollte. Wieso tauschen wir die Theorie nicht gegen eine ein, die ohne die Irrtumsunterstellung auskommt, aber den gleichen pragmatischen Nutzen verspricht wie die fiktionale _____________ 32 Wittgenstein: Aufzeichnungen für Vorlesungen über ‚privates Erlebnis’ und ‚Sinnesdaten’, in: ders.: Vortrag über Ehtik, a.a.O., S. 64. Stefan Tolksdorf 48 Geschichte? Genau solche alternativen Wege bieten uns Non-Faktualisten an. Damit widerspreche ich Kalderon, wenn dieser festhält: Thus, having established noncognitivism, moral fictionalism should be the default hypothesis, since the nonfactualist hypothesis involves further semantic commitments unnecessary to explain the noncognitive nature of moral acceptance.33 Der Fiktionalismus erscheint nur dann als default-Position, wenn übersehen wird, dass er eine semantische Erklärung schuldig bleibt. Die Herausforderung ist nicht das Einfangen der non-kognitivistischen Einstellung einem propositionalen Gehalt gegenüber, sondern der Gehalt selbst. Die Beweislast liegt meines Erachtens eindeutig auf der anderen Seite. Wenn der Fiktionalist sagt, wir reden so, als gäbe es Zahlen, dabei gibt es sie gar nicht, dann muss er dem Non-Faktualisten erklären, was der Nachsatz „dabei gibt es sie gar nicht“, bedeuten soll. Der Non-Faktualist versieht die entsprechenden Sprachspiele mit einer pragmatischen Genealogie, die den Zeichen und Sätzen einen Sinn gibt. Zu sagen, dass es Zahlen nicht wirklich gibt, kann dann aber lediglich bedeuten, dass es das mathematische Sprachspiel nicht gibt, das heißt, dass die Menschen nicht rechnen, keine Anzahlen bilden, etc. Das aber ist offensichtlich falsch. Zahlen existieren im vollen Sinne des Wortes „Existenz“, welcher sich aus dem Sprachspiel ergibt und nicht durch ein schwächeres Surrogat ersetzt werden muss. Wer zum Beispiel korrekterweise behauptet, dass es eine Zahl größer 6 gibt, der legt sich darauf fest, dass unsere Zählhandlungen nicht bei 6 enden, wir 6 mit einer weiteren positiven Zahl in der Addition verwenden können, etc. Mathematische Sätze können ebenso wahr und falsch sein wie Beschreibungen eines Raumes, wenngleich wir damit rechnen müssen, dass die Zuschreibung von Wahrheit in beiden Fällen anders zu rechtfertigen ist. Unklar bleibt also, was die Differenz zwischen echter und scheinbarer Existenz noch besagen soll, wenn mit dem ontologischen Bild im Hintergrund gebrochen wird – jenem Bild, das den Fiktionalisten gefangen hält. Zum Schluss sei aus der eigenen Handlungsperspektive phänomenologisch angeführt, dass wir wohl die These nicht unterschreiben würden, unsere moralischen und religiösen Einstellungen seien ihrer Verbindlichkeit und ihrer Natur nach lediglich ‚Als-ob‘-Einstellungen. Wir sagen nicht, angenommen das Töten von Menschen ist verwerflich und wir tun nicht so, als gäbe es moralische Werte. Nichts würde unserem Selbstverständnis stärker entgegen stehen.34 Das Töten von Menschen ist verwerflich und es gibt moralische Werte. _____________ 33 34 Kalderon: Moral Fictionalism, a.a.O., S. 118. Blackburn: Quasi-Realism no Fictionalism, in: Kalderon (ed.): Fictionalism in Metaphysics, a.a.O. S. 322-338. Reden ‚Als-ob‘ 49 7. Zur Logik non-faktualer Diskurse: die Frege-Geach-Searle Problematik - eine Skizze Wer mit der vorliegenden Debatte und den modernen Auseinandersetzungen in der Metaethik vertraut ist, wird eventuell den Verdacht haben, ich hätte dem Fiktionalismus an einer Stelle Unrecht getan, nämlich dort, wo die Motivation eines solchen Ansatzes in Frage gestellt wurde. Kalderons Bemerkung in diesem Zusammenhang, der Non-Faktualismus stelle eine unnötige und selbst massiv problembehaftete semantische These dar, deutet an, dass es durchaus eine Motivation für den Fiktionalismus im Hintergrund geben mag. Und diese Einschätzung stimmt. Die Rede ist dabei von der so genannten Frege-Geach-Searle-Problematik35, die viele Autoren für anti-realistisch unlösbar halten und deshalb dem Anti-Realismus ganz abschwören oder aber zu fiktionalistischen Alternativen Zuflucht suchen. Solche Reaktionen halte ich für voreilig. Natürlich kann ich an dieser Stelle nicht ausführlich auf die Problematik eingehen. Was jedoch abschließend geleistet werden soll, ist die Darstellung einer Skizze, wie Non-Faktualisten die Sache angehen können. Erst dann kann die Kritik am Fiktionalismus als einigermaßen vollständig angesehen werden. Das Problem hat mit der von Frege betonten Tatsache zu tun, dass sich beim Übergang von sprachlichen Äußerungen in direkten Kontexten zu solchen in indirekten Kontexten die beiden Bedeutungsaspekte des Sinns und der Kraft voneinander lösen. „Direkt“ wird ein Äußerungskontext bezeichnet, wenn der Sprecher einen atomaren Satz, zum Beispiel eine Behauptung, assertorisch ausspielt, also sagt: „Die Katze sitzt auf der Matte“. Unter diesen Bedingungen wird der Sinn des Satzes mit der Kraft des Behauptens ausgesagt. In indirekten Kontexten dagegen gebraucht der Sprecher diesen Satz, ohne ihn auszusagen, wie die folgenden Beispiele deutlich machen: „Wenn die Katze auf der Matte sitzt, dann ist sie nicht im Körbchen“, „Ich glaube nicht, dass die Katze auf der Matte sitzt“. In beiden Konstruktionen geht der Sinn des Satzes ‚die Katze sitzt auf der Matte‘ als Bestandteil in den Komplex ein, nicht jedoch die Kraft des Behauptens. Wer darüber nachdenkt, was der Fall wäre, wenn die Katze auf der Matte sitzt, oder aber nicht glaubt, dass sie es tut, der behauptet gerade nicht, dass die Katze auf der Matte sitzt. Sinn und Kraft werden also insofern voneinander getrennt, wie der Sinn, nicht aber die Kraft eines atomaren Satzes in direkten Äußerungskontexten Bestandteil eines komplexen Satzes in indirekten Sprechsituationen ist. Dass der Sinn konstant bleibt, sieht _____________ 35 Vgl. zum Beispiel: Geach: Ascriptivism, in: Philosophical Review 69 (1960), S. 221-225; ders.: Assertion, in: Philosophical Review 74 (1965), S. 449-465; Searle: Meaning and Speech Acts, in: Philosophical Review 71 (1962), S. 423-432; ders.: Speech Acts, Cambridge 1969; Blackburn: Attitudes and Contents, in: Ethics 98 (1988), S. 501-517. Stefan Tolksdorf 50 man unter anderem daran, dass eine Antwort semantisch auf die Frage bezogen ist und Konditionalsätze logische Übergänge von ‚p‘ zu ‚q‘ rechtfertigen. Jede semantische Theorie sollte daher in der Lage sein, zu erklären, welche semantischen Dimensionen beim Übergang von direkten zu indirekten Kontexten konstant bleiben und welche nicht. Wieso stellt dieser Sachverhalt nun für Non-Faktualisten ein Problem dar, für Fiktionalisten dagegen nicht? Wir haben gehört, dass Non-Faktualisten einen Satz wie „Das Quälen von Tieren ist moralisch verwerflich“ nicht primär über Wahrheit und Wahrheitsbedingungen erklären, sondern darüber, welche Einstellungen Sprecher mit der Äußerung des Satzes gegenüber dem Tierquälen ausdrücken. Wenn die Einstellungsanalyse nun die Bedeutung des Satzes offenlegt, wie lässt sich dann das Antezendens des moralischen Konditionals verstehen „Wenn das Quälen von Tieren verwerflich ist, dann auch das Quälen von Menschen“, welches sicher nicht mit der entsprechenden Pro- oder Kontra-Einstellung des atomaren Satzes ausgespielt wird. Analog der deskriptiven Fälle gilt auch hier, dass das Konditional nicht nur die Kraft des Behauptens, sondern auch das Eingehen bzw. Ausdrücken einer Einstellung einklammert. Es besteht somit die Gefahr, dass Non-Faktualisten unsere Praxis des moralischen Argumentierens nicht adäquat einfangen können, in welcher wir von ‚p‘ und ‚p q‘ zu ‚q‘ übergehen. Denn wenn die Bedeutung durch die Einstellung bestimmt wird, dann bedeutet <p> offensichtlich in ‚p‘ und ‚pq‘ etwas anderes, was unweigerlich implizieren würde, dass der Modus ponens nicht gültig sein kann. Searle hat diesen Einwand unter den Begriff des „pragmatischen Fehlschlusses“ gebracht: Non-Faktualisten schließen, so der Vorwurf, vom nichtrepräsentationalen Gebrauch eines Satzes auf die nicht-repräsentationale Bedeutung desselben – und dieser Schluss ist ungültig.36 Die Tatsache, dass ein Satz eine bestimmte illokutionäre Rolle besitzt, einen gewissen Witz zum Ausdruck bringt oder Teil konkreter perlokutiver Zusammenhänge ist, erlaubt keine Schlüsse auf die semantischen Dimensionen des Satzes im engeren Sinne. Die Rede vom pragmatischen Fehlschluss setzt demnach eine explanatorisch basale Differenz zwischen Bedeutung und Gebrauch voraus. Fiktionalisten geben den Non-Faktualisten gerne zu, dass die Sätze eine non-kognitive Funktion haben, nicht aber, dass sie deshalb auch über eine nonkognitivistische Bedeutung verfügen. Wie sind diese Einwände zu bewerten? Beginnen wir mit einem Zugeständnis. Auch Non-Faktualisten benötigen eine Theorie indirekter Kontexte und damit eine gewisse Differenz zwischen Bedeutung und Gebrauch, zwi_____________ 36 Diskutiert werden in Speech Acts drei Fehlschlüsse dieser Art: der Fehlschluss der Kritik des naturalistischen Fehlschlusses, der Sprechakt-Fehlschluss und der Behauptungs-Fehlschluss. Vgl. Searle: Speech Acts, a.a.O. Reden ‚Als-ob‘ 51 schen den Aspekten des Fregeschen Sinns und der Fregeschen Kraft. Das Wort „Würfel“ bedeutet in der Frage „Wie viele Würfel liegen auf dem Tisch?“ das gleiche wie im Konditionalsatz „Wenn fünf Würfel auf dem Tisch liegen, dann müssen zwei auf dem Boden sein“. Soviel ist sicher unstrittig. Gleichwohl habe ich die Zustimmung mit einer Einschränkung versehen: in gewisser Weise sollten wir zwischen Bedeutung und Gebrauch unterscheiden. Was aus dem gemachten Zugeständnis nicht folgen soll, ist eine semantisch basale und grundsätzliche Abkoppelung der Bedeutung von einer allgemein verstandenen Gebrauchsdimension, welche dazu führt, dass die Bedeutung eines Satzes oder Zeichens als einer jedem Gebrauch vorgelagerten Dimension semantischer Signifikanz aufgefasst wird. In der Regel wird angenommen, dass wahrheitskonditionale Bedeutungstheorien vom Frege-Geach-Searle-Problem nicht betroffen sind, weil die Konstante in direkten und indirekten Kontexten der repräsentational verstandene propositionale Gehalt ist, welcher der gebrauchsneutralen Dimension des Sinns entspricht. Diese Überzeugung findet dann in gewisser Weise in der Thematisierung der Logik als auf Wahrheit gerichtet ihren Ausdruck. Konkret formuliert: Ein logisch gültiger Schluss ist einer, der wahrheitserhaltend ist. Da Non-Faktualisten ihre primären Gegenstandsbereiche nicht-repräsentational deuten und damit als nicht wahrheitswertfähig ansehen, stellt sich für sie die Frage, was mit der Logik in diesen Handlungsbereichen passiert. Das Problem ist also ein Doppeltes: Wie lässt sich der Zusammenhang von direkten und indirekten Kontexten nicht-repräsentational verstehen? Und wie sieht eine nicht auf Wahrheit gerichtete Logik aus? Da der Fiktionalismus den repräsentationalistischen Realismus bezüglich Gehalt und Wahrheit nachahmt, stellen sich diese Frage für ihn nicht. An dieser Stelle kommt es nun zum non-faktualistischen Gegenschlag. Wenn Wittgenstein mit der These von der Projektion der Subjekt-PrädikatForm im Recht ist, dann hat die semantisch grundlegende Abkoppelung des propositionalen Gehalts vom konkreten Handlungsvollzug, von der Stellung des Satzes im Sprachspiel, wenig Aussicht auf Erfolg. In Fällen der Projektion ist es nämlich erst diese Form des Gebrauchs, die uns zum Beherrschen des Sprachspiels führt und so erkennen lässt, welcher Gedanke ausgedrückt werden soll. Wer den Satz „er hatte die Absicht ...“ als Bericht über die Existenz einer inneren Entität auffasst oder sprachliche Willensbekundungen generell als Bezugnahme auf versteckte Antriebsmechanismen deutet, der versteht diese Sätze möglicherweise nicht nur nicht bezogen auf die Dimension der Kraft oder des Witzes, sondern dem entgeht in einem grundsätzlicheren Sinne die Bedeutung des Satzes. Es ist erst die Stellung des Satzes im Sprachspiel, das Zusammenwirken von sprachlichen und nicht-sprachlichen Eingangs- wie Anschlusshandlungen, welche uns sagt, dass mit solchen Sätzen Handlungs- Stefan Tolksdorf 52 erklärungen gegeben werden und was es heißt, sich als handelndes Wesen zu verstehen.37 Diese Antwort deutet nun die Auflösung der Problematik an. Meines Erachtens können wir ohne Bauschmerzen zugestehen, dass der propositionale Gehalt beim Übergang von direkten zu indirekten Sprechsituationen erhalten bleibt und dass Wahrheit der Schlüssel zur Logik ist. Damit ist aber wenig gesagt bzw., richtiger, der springende Punkt lediglich auf eine andere Ebene verschoben worden. Aufgrund der Differenz zwischen Oberflächen- und Tiefengrammatik erhalten die Begriffe „propositionaler Gehalt“ und „ist wahr“ eine Bedeutung auf beiden Ebenen. Auf der syntaktischen Ebene können wir zugestehen, dass die meisten assertorischen Sätze durch das Wahrheits-Prädikat ergänzt werden können. „Propositionaler Gehalt“ und „Wahrheit“ bilden eine Art Begriffsfamilie, da sich das Wahrheitsprädikat auf den Gehalt bezieht, welcher selbst wiederum durch die Frage bestimmt werden kann, was als wahr angenommen wird. Bezogen auf die syntaktische Ebene besitzen beide Begriffe eine minimalistische bzw. deflationistische Bedeutung. Jedoch inhaltlich gesehen, bezogen auf die Tiefengrammatik, hilft uns diese Antwort nicht weiter. Auf dieser Ebene muss etwas mehr gesagt werden, um die Differenzen zwischen religiösen, empirisch-deskriptiven und etwa modalen Sprachspielen deutlich werden zu lassen. Das heißt: Was „Wahrheit“ im Einzelnen bedeutet und wie propositionale Gehalte im konkreten Sprachspiel konstruiert werden, ist selbst erklärungsbedürftig und nicht homogen zu beantworten. Non-Faktualisten können indirekte Kontexte und logische Operatoren demnach wie folgt rekonstruieren: (1) Der pragmatische Witz logischer Operatoren besteht darin, atomare Festlegungen und Akzeptanzen aneinander zu binden, sie in ein System zu integrieren – ganz gleich, um welche Inhalte es geht. Der Nutzen solcher Gelenke in der Sprache liegt auf der Hand: Wenn wir mit Sätzen wie „Das Quälen von Tieren ist verwerflich“ unsere ablehnende Einstellung gegenüber Handlungen des Tierquälens ausdrücken, dann sollten wir uns auch fragen, welche weiteren Einstellungen aus dieser atomaren Einstellung folgen, mit welchen anderen Einstellungen und Überzeugungen sie zusammen hängt, etc. Solche Beziehungen lassen sich dann sprachlich wie folgt ausweisen: „Wenn das Quälen von Tieren verwerflich ist, dann auch das Anstiften dazu; das Töten von Tieren; etc.“. Was ich hier erwähne, entspricht zum Teil Brandoms inferentieller Pragmatik, der zufolge logisches Vokabular lediglich inferentielle Beziehungen explizit macht, die bereits implizit Teil der Handlungswelt sind. Ob das Bild der Explizitmachung des Impliziten die beste Beschreibung solcher Vorgänge ist, kann an dieser Stelle offen bleiben. Was allerdings überzeugt, ist die _____________ 37 Vgl. abermals den Beitrag von Ralf Stoecker. Reden ‚Als-ob‘ 53 Idee, dass das Konditional pq beispielsweise lediglich festhält, dass das Ausspielen von p den Sprecher auf das Ausspielen von q festlegt, wie immer das konkrete Sprachspiel und die konkrete Rechtfertigung dafür zu verstehen sei. Logische Schlussmuster wie der Modus ponens sind dieser pragmatischen Geschichte folgend deshalb kein Problem für Non-Faktualisten, weil ein solches Muster aus dem Konditional folgt. Oder anders ausgedrückt: Konditionale kodieren inferentielle Schlussmuster – das Ausspielen von p muss vom Ausspielen von q begleitet werden. Statt also zu sagen, dass logische Schlüsse wahrheitserhaltend sind, erscheint es weitsichtiger zu behaupten, dass sie festlegungserhaltend sind. Die Logik, so können wir jetzt sagen, gehört weder dem Realisten, noch dem Anti-Realisten. Jedoch versieht uns der Non-Faktualismus mit einer pragmatischen Genealogie, mit einer Geschichte also, die uns verständlich macht, wie es zur Ausbildung logischer Begriffe kommen konnte und welche Funktion sie in unserer Lebenswelt übernehmen. Das als basal und nicht erklärungsbedürftig angesehene realistische Verständnis, wonach Logik und Wahrheit auf Abbildung zielen, ist dann lediglich ein Sonderfall dieser pragmatischen Geschichte – einige Festlegungen und Akzeptanznormen nennen wir Wahrheit im engeren Sinne. (2) Eine analoge Antwort bietet sich nun auch für indirekte Kontexte an, die im gewissen Sinne der allgemeinere Fall sind. Das heißt: Logische Operatoren erzeugen indirekte Kontexte, es gibt daneben aber weitere Möglichkeiten, in den Modus des Sprechens über Festlegungen einzusteigen. Es liegt deshalb auf der Hand, nach ähnlichen pragmatischen Erläuterungen dieser Möglichkeiten Ausschau zu halten und im erläuterten Sinne deutlich zu machen, dass es sinnvoll ist, über Einstellungen zu sprechen. Wenn ‚p’ im Sprachspiel vorgesehen ist, dann ist der Weg zu „ich glaube (nicht), dass p“ oder „S ist gerechtfertigt zu glauben, dass p“ nicht sehr weit, da wir uns vorstellen können, Handlungen der Ungewissheit oder der Bestätigung p gegenüber auszuführen. Was konstant bleibt, ist tatsächlich der propositionale Gehalt, der uns aber zu sehr unterschiedlichen Zügen im Sprachspiel führt, zum Beispiel zu modalen, moralischen und religiösen Aussagen. Der Verweis auf die atomaren Aussagen in direkten Kontexten, quasi auf das Heimat-Sprachspiel, ist für den indirekten Kontext unverzichtbar, weil abkünftige Kontexte dieser Art im gewissen Sinne nichts anders tun als sinngemäß zu sagen: wenn du über die Handlungskompetenz des p-Sagens verfügst, dann gehe einen Schritt weiter und erweitere sie um den pragmatischen Witz des Zweifelns, des Versicherns, indem sprachliche Züge wie ‚ich glaube; zweifle; etc., dass p’, ausgeführt werden. A Development in Wittgenstein’s Conception of Philosophy: From “The Method” to Methods James Conant 1. How Many Wittgensteins? I had the pleasure and good fortune in the summer semester of 2004 to teach a seminar on Wittgenstein together with Hans Julius Schneider while I was visiting in the capacity of Gastprofessor at the Institute for Philosophy at the University of Potsdam. I cannot think of a more fitting tribute to Hans Julius Schneider than for me now to try to develop my thoughts a bit further on the topics that he and I discussed in that seminar. Some of what I will say in this paper, in order to set up the framework for the rest, will cover some ground that will be quite familiar to him; but some of it, I hope, will broach ground that is less familiar and hopefully also of interest to him. As my aim here is to provoke further dialogue about matters of common interest, I will not shrink from making some rather heterodox claims about the character and shape of Wittgenstein’s philosophical development. Six years since co-teaching that seminar, as I sit now before my desk writing this paper in Chicago in the year 2010, a minor controversy in which I am one of the alleged participants is taking place in the tiny world of Wittgenstein scholarship – a controversy about how many Wittgensteins there are. My colleague David Stern, at the comparatively nearby University of Iowa, takes me not only to be a participant in this controversy, but also to be a proponent of one particular extreme view, (what he calls) “the one-Wittgenstein view”. His main complaint is directed, however, not only at people who, as I allegedly do, espouse this view, but also against their alleged opponents in the controversy: [I]t is nearly always presupposed that either there was one Wittgenstein, that in essentials Wittgenstein’s philosophy never really changed, or that there were two Wittgenstein’s, that there was a fundamental change between the early and the philosophy…. Very few interpreters seem prepared to even consider the possibility that these are restrictive and constricting alternatives, or that the best interpretation might well be one James Conant 56 that recognizes both continuities and discontinuities in Wittgenstein’s philosophical development.1 What Stern says here (“very few interpreters seem prepared to even consider”) ought to strike one as a bit of a stretch, given that the revelation (“the best interpretation might well be one that recognizes both continuities and discontinuities”) is a truism – true about pretty much any interesting philosopher. Kant, Russell, Heidegger, and Putnam come immediately to mind as particularly pertinent examples about whom this is obviously true, but in each case it is not at all easy to say how it is true. And it is perhaps especially difficult in the case of Wittgenstein to see precisely how properly to balance the continuities against the discontinuities in a full narrative of the character of his philosophical development. The devil lies in the details here. It has been a central motivation of mine in developing, together with Cora Diamond, a certain reading of Wittgenstein’s early work – which has come to be known as “the resolute reading” – to begin to fill in some of the background which I believe needs first to be in place before one is in a position fully to appreciate the specific difficulties which must attend any attempt to sketch such a narrative of the overall arc of Wittgenstein’s philosophical trajectory. In a moment I will say more about what I mean when I speak of “a” (or what others mean when they speak of “the”) “resolute reading”. First, however, I just want to say this much about the original motivation behind developing such a reading of early Wittgenstein: the motivation was to help put one in a position better to understand better what sort of break it is with traditional philosophy (and therefore with his own earlier philosophy) that Wittgenstein sought to undertake in his masterwork Philosophical Investigations. Given that this was the original motivation, the misunderstanding involved in Stern’s claim that Conant (and Diamond, and various other resolute readers) are committed to “the one-Wittgenstein view” is quite fundamental. I would be happy if this paper were able to put an end to the ascription of such a view to a commentator on Wittgenstein simply on the grounds that he or she advocates a resolute reading of the Tractatus. For to advocate such a reading of the Tractatus is not yet to take a stance on the question “How many Wittgensteins are there?” nor, for that matter, even if one thinks there is more than one Wittgenstein, is to commit oneself to any particular answers to questions about where and when a (or “the”) significant break in Wittgenstein’s philosophizing occurs over the course of his development. This is not to deny that such a reading of Wittgenstein’s early work has substantive implications for how one answers questions such as those men_____________ 1 David Stern: How Many Wittgensteins?, in: Wittgenstein: The Philosopher and his Works, edited by Alois Pichler and Simo Säätelä, Working Papers from the Wittgenstein Archives at the University of Bergen, No. 17 (2005), p. 170. From “The Method” to Methods 57 tioned above. It is only to maintain that these implications are not straightforward and that they themselves therefore represent matters about which resolute readers might well disagree. In this paper, I will defend one particular line of thought about these matters. I should not be taken to be speaking for other resolute readers of Wittgenstein in doing so. I do hope, however, to illustrate how the framework of a resolute reading of Wittgenstein’s early work can furnish a fresh perspective from which to consider questions about the overall development of Wittgenstein’s conception of philosophy. The real interest of this paper will therefore lie not in contributing to debates about how to read Wittgenstein’s early philosophy, but rather in addressing a certain question about the development of his philosophy as a whole. A good way to begin on the latter topic is to consider what a remark such as the following is doing in the Preface to Philosophical Investigations: Four years ago I had occasion to re-read my first book (the Tractatus LogicoPhilosophicus) and to explain its ideas to someone. It suddenly seemed to me that I should publish those old thoughts and the new ones together: that the latter could be seen in the right light only by contrast with and against the background of my old way of thinking.2 Proponents of the standard narrative of Wittgenstein’s development can and do take this passage as a bit of textual evidence that Wittgenstein is here asking us to see his early work as directed against his later work. But how is it directed against his early work? In particular, why does he say that “the latter could be seen in the right light only against the background of my old way of thinking”? The presence of the word “only” here suggests that what is to be found in the pages of the Tractatus is not simply a recurrence of confusions also to be found in the less difficult writings of lesser philosophers, but rather that there is something to be found there that is not easily found elsewhere; and that it is this difference between what is found there and what can be found elsewhere in philosophy that recommends those early pages for inclusion in the single volume at issue here. The presence of the “only” suggests that, if we want to see his new way of thinking in the right light, we need first to see it against the background of features of his old way of thinking which he takes to be both peculiar to that way of thinking and peculiarly important to an understanding of the new way of thinking. Otherwise any of a variety of other backgrounds would serve just as well. What I will be calling “a resolute reading of the Tractatus”, I shall suggest, helps to focus attention on one important aspect of his old way of thinking which he both takes to be peculiar to that way of thinking and the overcoming of which he takes to be peculiarly important to an understanding of the new way of thinking. _____________ 2 Ludwig Wittgenstein: Philosophical Investigations, op cit, p. x. James Conant 58 2. Resolute Readings of the Tractatus The dispute between resolute readers and their critics has tended to take its point of departure from the question how one ought to understand the following climactic3 moment in the Tractatus: My propositions serve as elucidations in the following way: anyone who understands me eventually recognizes them as nonsensical, when he has used them -- as steps -- to climb out through them, on them, over them. (He must, so to speak, throw away the ladder after he has climbed up it.)4 Taking this passage as my point of departure, I will provide, in this section of the paper, a very sketchy account of what will be meant in the remainder of this paper by “a resolute reading of the Tractatus”,5 primarily by saying a bit about what is involved in climbing up and throwing away this ladder on any resolute interpretation of the book of which that ladder forms the body. Beyond this, I will have nothing further to say in these pages about the internal commitments of such a reading. In particular, this paper will refrain from rehearsing any of the (exegetically or philosophically motivated) reasons why an open-minded reader might want to look with sympathy on such an interpretative approach to the Tractatus. The burden of this paper will rather be to clarify one of the ways in which such a reading might bear on questions pertaining to an understanding of the relation between Wittgenstein’s early and later work, and thereby to explore one aspect of the question whether such an approach to reading Wittgenstein commits one, as David Stern alleges, to some version of a “one-Wittgenstein view”. In section 6.54 of the Tractatus, the author of the work does not ask us to understand his sentences, but rather to understand him. Resolute readers take this particular nicety of formulation to be tied to the way in which we are supposed to come to see, regarding those sentences of the work that are at issue here, that there is nothing that could count as understanding them. The primary characteristic that marks out a reading of the Tractatus as “resolute”, in the sense of the term at issue here, is its rejection of the following idea: what _____________ 3 4 5 Pun intended. Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus, §6.54. (my emphases). Quotations from the Tractatus will be drawn from either the David Pears and Brian McGuinness translation (London 1963) or from the reprint of the C. K. Ogden translation ( London 1981), or some emendation or combination thereof. The characterization of such readings as “resolute” is first due to Thomas Ricketts and first used in print by Warren Goldfarb in his: Metaphysics and Nonsense: On Cora Diamond’s The Realistic Spirit, Journal of Philosophical Research 22 (1997), pp. 57-73, at p. 64; cf. also p. 73, note 10. Goldfarb’s article lays out some of the issues in dispute very well. See also Diamond’s: Realism and Resolution (which replies to Goldfarb) in the same issue. From “The Method” to Methods 59 the author of that work, in section 6.54, aims to call upon his reader to do (when he says that she will understand him when she reaches the point where she is able to recognize his sentences as nonsensical) is something that requires the reader of the work first to grasp and then to apply to the sentences of the work a theory that has been advanced in the body of the work – a theory that specifies the conditions under which sentences make sense and the conditions under which they do not.6 In order to be able to give content to the idea that we are able to come to grasp the commitments of such a theory, a commentator must hold that there is a fairly substantial sense in which we can come to “understand” the sentences that “explain” the theory, despite the fact we are eventually called upon to recognize these very same sentences as nonsense. Resolute readers hold that to read the Tractatus in this way is seriously to underestimate what is involved in the request that we come to recognize these sentences as nonsense. On standard readings of the book, the point of a significant number of the sentences of the work is to achieve the formulation of an adequate set of theoretical criteria of meaningfulness. These criteria when applied to the very sentences that adumbrate them yield the verdict that they do not meet their own criteria and thus are to be condemned as nonsensical. Resolute readers are unhappy with any such reading for a variety of reasons. For the present purpose, however, it will suffice to note that they are committed to rejecting any such reading because they are committed to rejecting the idea that the author of the work aims to put forward substantive theories or doctrines. Wittgenstein tells us that the kind of philosophy he seeks to practice in this work consists not in putting forward a theory, but rather in the exercise of a certain sort of activity – one of elucidation.7 The core commitment of a resolute reading for the purpose of this paper lies in its insistence that a proper understanding of the aim of the Tractatus depends upon taking Wittgenstein at his word here. A close reading of the text guided by this commitment leads us to the following gloss on his early understanding of the aim of this activity: Early Wittgenstein aimed to practice a conception of philosophy in which philosophy is not a matter of putting forward theses, doctrines or theories, but consists rather in an activity of elucidation; and any apparent theses that are put forward in the course of that activity, if it succeeds in its aim, are to be revealed as either (1) initially philosophically attractive yet in the end only apparently meaningful (Unsinn), or (2) either _____________ 6 7 Notice: this feature of a resolute reading – as, too, with regard to each of the other features to be mentioned below – merely says something about how the book ought not to be read, thereby still leaving much undetermined about how the book ought to be read. For more discussion of this topic, see my: The Method of the Tractatus, in: From Frege to Wittgenstein: Perspectives in Early Analytic Philosophy, ed. Erich H. Reck, Oxford 2002. James Conant 60 genuinely meaningful (sinnvoll) or merely tautologous (sinnlos) but only once clarified and hence drained of their initial philosophical eros.8 Let’s call this “the avowed aim”. If one adopts it as a point of departure for reading the text and allows oneself “strictly to think it through”9, resolute readers take a proper understanding of the avowed aim to have far-reaching exegetical consequences. It is perhaps not an exaggeration to say that, once this business of strictly thinking it through gets underway, many of the further commitments of resolute readers can be seen to fall into place as corollaries that follow from it. I will confine myself here simply to mentioning three such corollaries. The first pertinent corollary (of a resolute rejection of an intended commitment on the part of the author of the work to any theory or doctrine) is the rejection of any intended commitment to an ineffable theory or doctrine. This means that resolute readers are bound to reject the widely held view that the relevant “propositions” of the work (namely, those concerning which Wittgenstein said, at §6.54, that they are to be recognized as “nonsensical”) are to be “understood” as conveying ineffable insights that the reader is to “grasp” even though the author cannot “express” them. On standard readings of the work, the alleged insights here in question are held to be individuated through an identification of substantive constraints on sense adumbrated through the aforementioned criteria on meaningfulness set forth in the body of the work. It is through the “violation” of these constraints that the sentences in question are revealed as simultaneously meaningless yet able to convey something determinate. The form of their meaninglessness is _____________ 8 9 It would be a mistake to read this paragraph as saying (as the writings of standard readers sometimes seem to suggest) that we can just go about inspecting sentences and (apart from consulting their context of use) sorting them into categories such as the sinnlos and the sinnvoll. For discussion of this topic, see Cora Diamond: Crisscross Philosophy, in: Wittgenstein at Work, ed. Erich Ammereller and Eugen Fischer, op. cit. In the interest of keeping things as simple as possible, I will have nothing further to say about the topic of that which is sinnlos in this paper. For a discussion of some of the points that arise in connection with this topic and how to accommodate them in a resolute reading, see Michael Kremer: Mathematics and Meaning in the Tractatus, in: Philosophical Investigations 25 (2002). I am alluding here to a formulation of Wittgenstein’s regarding what is involved in philosophical elucidation that surfaces in passages such as the following: “[I]dealism, strictly thought out [streng durchgedacht], leads to realism.” – and: “[S]olipsism, strictly followed through [streng durchgeführt], collapses into pure realism.” The first is from Notebooks: 1914-1916, eds. G. H. von Wright and G .E. M. Anscombe, tr. G. E. M. Anscombe (Chicago 1979); p. 85. (I have emended the translation). The second is from the Tractatus, 5.64. (I have emended the translation.) For further discussion of the importance in Wittgenstein’s work of such a conception of thinking things through, see my: On Going the Bloody Hard Way in Philosophy, in: John Whittaker (ed.): The Possibilities of Sense, New York 2003. From “The Method” to Methods 61 supposed to highlight, in each case, a particular feature of the general conditions on sense specified by the theory in question. This requires that the meaninglessness of these sentences has, in each case, a logically distinct and specifiable character. It becomes, on standard readings, a central burden of the theory (supposedly adumbrated in the book) to give content to this idea of logically determinate forms of nonsense – where each of these forms of nonsense is alleged to acquire the potential for communication that it specifically possesses in virtue of its violation of a distinct requirement on sense laid down by the theory. This commits standard readers to the idea that the sort of nonsense that is at issue here must come in a variety of logically distinct kinds. This brings us to the second pertinent corollary: the rejection of the idea that the Tractatus holds that there are logically distinct kinds of nonsense. This is sometimes put by saying that the Tractatus aims to show that there is no such thing as substantial nonsense. From the perspective of a resolute reader, it makes little difference whether the candidate criteria for lending substance to nonsense involve considerations of verifiability, bipolarity, logical wellformedness, or some other putative respect in which a “proposition” is held to be intrinsically flawed because of its own internal logical or conceptual structure. Part of what the Tractatus seeks to show, according to resolute readers, is that all such “criteria of meaningfulness” cannot do the sort of work to which we want to put them in our philosophical theorizing. Any reading of section 6.54 that takes the recognition on the part of a reader there called for to require a substantive employment of such criteria qualifies as an instance of an irresolute reading, as long as it is committed to ascribing to the Tractatus a theory which its author must endorse and rely upon (if he is to be able to prosecute his program of philosophical critique) and yet which he must also regard as nonsense (if he thinks through the commitments of his own theory).10 _____________ 10 Many critics of resolute readings notice that resolute readers are committed to one or another of the corollaries, without ever managing to get the guiding commitment of such a reading clearly into view. Such critics notice that resolute readers are committed to rejecting some particular putatively Tractarian account of what makes some sentences nonsensical (say, an account based on illegitimate syntactical combination), while assuming that a resolute reader must share with the proponent of a standard sort of reading the idea that the charge of nonsense leveled at the end of the Tractatus is to be underwritten by some theory – be it one that is advanced within the body of the work or one that is imported into the work from the outside. These critics thereby assume that these readers must want to substitute some alternative theoretical account of the grounds of sense for the particular one under criticism. These critics then become understandably very puzzled about how such a reading can possibly be thought to be sustainable. For they assume that the discovery that there are no logically distinct kinds of nonsense is itself arrived at through the elaboration 62 James Conant At a minimum, what a resolute reading seeks to avoid here is the mess that commentators get into when they refuse to (allow that they are, at the end of the day, supposed to) throw away the following paradoxical idea: The author of the Tractatus wants its reader to reject the sentences of the book as nonsense on principled grounds; yet, in the very moment of rejecting them, the reader is to continue to retain a grip on these grounds by continuing to identify, grasp, and believe that which these sentences would say, if they had a sense.11 Let’s call this “the paradox”. To be resolute in one’s approach to the Tractatus involves taking this paradoxical idea itself to form a part of the ladder that we, as readers, are meant to climb up and throw away (rather than taking it to be an account of what it is to throw away the ladder). Thus, it involves taking the sort of recognition that readers of the work are called upon to attain in section 6.54 to require a recognition that the intermediate stages that we, as readers, seem to occupy (when we take ourselves to be able to identify, grasp, and believe what these sentences intend to convey) are aspects of the illusion that the work as a whole seeks to explode – that they are themselves rungs on the ladder that we are asked to climb up and throw away. The third corollary has to do with how one ought to conceive the details of the Tractarian procedure of elucidation – and, in particular, the role of the many notational devices (the Sheffer stroke, the truth tables, the special notation for quantification, etc.) that are introduced in the course of the book. It is evident that logical notation is supposed to play some sort of important role in a reader’s ascent up the ladder. A standard reader will assume that the notation at issue here is one which is to be constructed so as to reflect the requirements of the theory that is laid down in the book: only those sentences the theory deems permissible will be constructible in the notation; and those sentences the theory deems nonsensical will involve illegitimate constructions forbidden by the syntactical rules governing the employment of the notation. It should by now be evident that it is not open to a resolute reader to construe the role of logical notation in Tractarian philosophical clarification in anything like this way. According to a resolute reader, the forms of logical _____________ 11 and application of a theory of sense that these readers are now committed to viewing as having somehow been successfully articulated by the author of the Tractatus, even though the propositions by means of which it is to have been articulated have been relegated to the status of mere nonsense. This then leads to the criticism that the resulting reading renders the propositions of the book too semantically impoverished to be able to articulate the theoretical conceptions about the nature of nonsense that the readers in question are committed to ascribing to the work. I enthusiastically endorse this line of argument as a criticism of a possible (misguided) reading of the Tractatus. But it is a species of irresolute reading that is here criticized. This idea that we can grasp what certain sentences would say if they had a sense is sometimes called chickening out. See Diamond: The Realist Spirit, op. cit., pp. 181-2, 1945. From “The Method” to Methods 63 notation employed by the author of the Tractatus (in order to make certain philosophical confusions manifest) must be elucidatory instruments whose employment is not itself supposed to require commitment (on the part of those engaged in an elucidation) to any particular philosophical theses. We are familiar in ordinary critical discussion with procedures in which confusion in thought can be brought to a person’s attention through a procedure of reformulation – in effect, through substituting one expression for another. This is most commonly accomplished by substituting one expression in the speaker’s native language for another. But if the speaker is familiar with a foreign language then that familiarity can be exploited to bring further elucidatory resources to bear on the situation. Thus, an equivocation involving “or“ in ordinary English can be brought to a speaker’s notice, if he speaks Latin, by asking him whether he wants to translate his English sentence into Latin using “aut” or “vel”. No “theory of Latin” is required in order for the speaker to take advantage of this elucidatory tool. All that is required is knowledge of how properly to translate English sentences into Latin ones. By being forced to reflect upon what is involved in the task of having to choose one of these Latin expressions over the other, the speaker can be made to realize that he has been hovering between alternative possibilities for meaning his words without determinately settling on either one.12 According to resolute readers, this is what nonsense is for the author of the Tractatus: an unwitting wavering in our relation to our words – failing to make genuine determinations of meaning, while believing that we have done so.13 And the Tractatus’s understanding of the character of nonsense, according to resolute readers, is internally related to its understanding of the proper role of logical notation in philosophical clarification. If our English speaker above did not know Latin, but instead had been taught an appropriately designed logical notation (in which each of these two different possible translations of the English sign “or” corresponds to a different symbol in the notation) then exactly the same clarification could be effected using this notation. No theory of the notation is supposed to be here required, merely a mastery of its proper use. What is needed here – to paraphrase Tractatus, §4.112 – is not a commitment to some doctrine, but rather a practical understanding of how to engage in a certain sort of activity. The forms of notation to which the Tractatus introduces us, of course, involve manifold degrees and dimensions of designed regimentation (in our use of _____________ 12 13 For further discussion of this example, see Conant and Diamond: On Reading the Tractatus Resolutely, in: Max Kölbel / Bernhard Weiss (eds.): Wittgenstein’s Lasting Significance, London 2004, pp. 61-2. See Wittgenstein: Tractatus, op. cit., §5.4733. 64 James Conant distinct signs to express logically distinct modes of symbolizing) far beyond a single distinction in the use of signs to mark a mere distinction between two different ways of using a particle of speech such as “or”. In principle, however, if our aim is restricted to the Tractarian clarification of thought, then the point of the exercise of mastering and applying such notation and the justification of the procedures involved need not differ in any essential way from those involved in the case of asking someone to translate “or” as either “vel” or “aut”. The difference here (in the character of the exercise and the procedures it involves) is one of degree not of kind. The forms of notation introduced by the Tractatus therefore are not conceived by its author as requiring independent theoretical justification; and, if they did, this would defeat their purpose. They are put forward as proposals. If we try this notation, we will see that it allows us to become clear (when there is something we want to say) about what we want to say; and (when there is not) it allows us to become clear about the character of our failure in our having unwittingly failed to say anything. With respect to understanding his purpose in introducing us to these instruments of logical notation, we may be said to understand the author of the Tractatus each time we recognize how these alternative forms of expression (which the notation makes available) enable the recognition of nonsense.14 It is in this way that the notation is meant to serve as a device that facilitates a reader’s ascent up the rungs of the ladder. 3. The Old Way of Thinking against the Background of the New The author of Philosophical Investigations tell us that the most crucial moments in philosophical conjuring tricks are the ones that are apt to strike one as most innocent.15 This remark, I take it, bears on the evolution of his later philosophy in two ways. First, it is tied to his later apprehension that it is much more difficult to avoid laying down requirements in philosophy than his earlier self had ever imagined – where this is tied in the later work, in turn, _____________ 14 15 A story about this can count as a version of a resolute reading only to the extent that an understanding of the author here rests upon nothing more than a cultivation of the reader’s logical capacities – capacities that she exercises whenever she thinks or speaks. These capacities are honed in the context of philosophical elucidation through our learning such things as how properly to parse sentences whose surface grammar confuses us, how properly to employ the fragments of logical notion to which the author of the Tractatus introduces us, and so on. But the point of exercising such comparatively more determinate logical capacities is to refine the antecedently available general capacity which the reader brings with her to an encounter with the text: namely her ability to discern sense, recognize nonsense, and distinguish the one from the other. Wittgenstein: Philosophical Investigations, op. cit., §308 From “The Method” to Methods 65 to the need to develop a form of philosophical practice that can diagnose, identify, and clarify the precise moments in which such requirements on thinking are first unwittingly laid down, well prior to their manifesting themselves to the thinker as commitments of any consequence.16 Second, it required a set of procedures for the conduct of the new activity of diagnosis, identification, and subsequent clarification that would not themselves prove to carry further unwitting commitments in their train (introducing another metaphysics newly built into the successor conception of clarification). Hence the need to develop a non-dogmatic mode of philosophical correction (an, as it were, further layer of correction directed at each of the moments of correction themselves, and a further layer upon that, and so forth). An elucidatory procedure whose steps are arraigned in the form of a ladder is no longer up to this task: the procedure must be able to crisscross in such away as to allow each step in the investigation devoted to exorcising a philosophical demon to itself be pondered, reassessed, and purged, in turn, of the possible latent forms of overstepping or overstatement that may unwittingly have insinuated themselves in the course of the elucidation of the original misconception.17 It is in this context (of cultivating such a non-dogmatic mode of philosophizing) that a method of writing characterized by an alternation of voices (including ones of overly insistent temptation and ones of overly zealous correction) proves its value and comes to transform the face of Wittgenstein’s authorship. This raises many questions (regarding the aims and methods of Wittgenstein’s later philosophy) well beyond the scope of this paper. It will suffice to confine our attention here briefly to the ever-recurring first step in this crisscrossing procedure – a step that has no role and can have no role to play in his earlier ladder-climbing mode of philosophical elucidation: namely, the step in which one seeks to uncover that crucial sleight of hand in the philosophical conjuring trick that is apt to strike one as most innocent. Wittgenstein’s original aim, in writing the Tractatus, was to bring metaphysics to an end; and the method of clarification he thereby sought to practice, to achieve that end, was to be one that was itself free of all metaphysical _____________ 16 17 One way of summing up this immense difference between early and later Wittgenstein would be to say that the following question assumes a pivotal importance in later Wittgenstein’s investigations that it never (could have) had in early Wittgenstein’s procedures: How does philosophy begin? On this, see Stanley Cavell’s: Notes and Afterthoughts on the Opening of Wittgenstein’s Investigations, in: Hans Sluga / David Stern (eds.): The Cambridge Companion to Wittgenstein, Cambridge 1996. “[M]y thoughts were soon crippled if I tried to force them on in any single direction against their natural inclination—And this was, of course, connected with the very nature of the investigation. For this compels us to travel over a wide field of thought crisscross in every direction” (Philosophical Investigations, p. ix). James Conant 66 commitments. The following remark brings out how his later writing (unlike most of the commentary on it) continues to keep this feature of his earlier thought firmly in perspective while seeking to focus attention on its problematic commitments: We now have a theory, a “dynamic theory” of the proposition; of language, but it does not present itself to us as a theory. For it is the characteristic thing about such a theory that it looks at a special clearly intuitive case and says: “That shews how things are in every case; this case is the exemplar of all cases.” – “Of course! It has to be like that”, we say, and are satisfied. We have arrived at a form of expression that strikes us as obvious. But it is as if we had now seen something lying beneath the surface.18 This passage brings out nicely why things must go wrong if one’s reading of Wittgenstein is organized around a focus on the following question: “Which parts of the theory that the Tractatus aimed to put forward did later Wittgenstein think was wrong?” If one reads Wittgenstein in this way, then one is apt to skip over the following seven aspects of later Wittgenstein’s interest in (what one thereby calls) “the theory of the Tractatus”: (1) that what we are able to see as heavily freighted philosophical commitments in the early work did not present themselves to the author of the Tractatus as such, (2) that it is the characteristic thing about such “theories” that, at the deepest level, they garner their conviction not from a conscious intention to put forward an ambitious philosophical claim, but rather from an apparently innocent attention to what presents itself as a special clearly intuitive case, (3) that an unprejudiced view of such a case already appears to permit one (without any additional theoretical underpinning) to exclaim: “That shews how things are in every case; this case is the exemplar of all cases”, (4) that it is therefore particularly helpful to look at examples of philosophers who are already in the grip of such apparent forms of clarity in those moments in their thinking that occur prior to any in which they take themselves yet to have begun philosophizing, (5) that it is even better, if one can find one, to look at the example of a philosopher who, in the teeth of an avowed aim to eschew any such commitments, nonetheless falls into them, (6) that the author of the Tractatus is the prime example of such a philosopher, and therefore, in a sense, the ideal target for the form of philosophical criticism to be prosecuted in the pages of Philosophical Investigations, (7) that the ultimate quarry of philosophical criticism in these pages is never this or that philosophical thesis or theoretical commitment, but rather a characteristic form of expression – one that holds us captive and strikes us as so very obvious that we imagine that it allows us to be able to penetrate the appearance of language and see what must lie beneath the surface. _____________ 18 Wittgenstein: Zettel (translated by G. E. M. Anscombe), Oxford 1967, §444. From “The Method” to Methods 67 The preceding seven points represent a brief attempt to summarize certain aspects close to the heart of Wittgenstein’s mature conception of philosophical method, as well as to summarize an important aspect of his thinking close to the heart of his mature perspective on the differences between the conceptions of philosophical method present in the Tractatus and the Investigations respectively. With these seven points before us, allowing ourselves to assume that they capture important differences in the conceptions of philosophy in the Tractatus and the Investigations respectively (and allowing ourselves for a moment to subscribe to the facile idea that there is just one important “break” in Wittgenstein’s philosophical development), the following point can now be made: any account of something that deserves to be called “the break” between early and later Wittgenstein must be one which is able to locate in the philosophy that supposedly lies on the far side of this break resources for philosophical criticism sufficient to vindicate an entitlement to these seven points. And now let us ask: does the later Wittgenstein who comes into view on the standard narrative of his philosophical development command such resources? Or, correlatively: does the Wittgenstein of 1929 – or, for that matter, the Wittgenstein of 1935 – command such resources? 4. Norway, 1937 Wittgenstein spent most of the twelve years between 1929 (after he returned to living and thinking full time about philosophy in Cambridge, England) and 1951 (the year of his death), trying to write the book that eventually would become the Philosophical Investigations. Halfway through this period, in August of 1936, he withdrew to the tiny hut that he had built himself, in a remote location at the very end of the Sognefjord, in Skjolden, Norway, in order to be able to continue his work on the book in complete solitude. After an abortive start, he turned his attention in November, 1936, to reworking material that essentially consisted of a draft of sections 1 – 189 of Part I of Philosophical Investigations. Roughly the first half of this material was re-worked in the remaining two months of 1936 and (after a break to spend Christmas with his family in Austria) the second half of it was re-worked in Skjolden between February and May of 1937. It was during these months that sections 89 to 133 came to assume something close to resembling the form in which they now appear in the final published version of Philosophical Investigations. What happened during this period in Norway? On a standard narrative of Wittgenstein’s philosophical development, the most significant break in his philosophical development came in or around 1929. On this telling of the story, the period shortly thereafter is the one in 68 James Conant which the most significant revolution in his conception of philosophy was allegedly effected. What happened in Norway in 1937, according to this narrative, therefore, is simply that later Wittgenstein turned his attention more closely to certain topics, thereby applying his already fully developed later conception of philosophy to hitherto comparatively unexplored philosophical issues, with the consequence that he further developed the implications already latent in that conception (that he began to espouse in or around 1929) for the particular topics at hand. This narrative, of course, leaves lots of room for us to view what happened in Norway in 1937 to be of great consequence, especially in as much as it is there and then that Wittgenstein completed the first fairly finished draft of the opening bit of the famous passages of the Philosophical Investigations now known as “the rule-following considerations”. But what the standard narrative does not countenance is the idea that Wittgenstein’s conception of his method in philosophy underwent a significant revolution while he was in Norway in 1937. One reason it does not countenance this is simply because the standard narrative puts in place and operates with a particular sort of idea of what would and could count as a significant sort of development in Wittgenstein’s conception of philosophy. This blinds it to certain possibilities. As David Stern indicates, there is a tendency to distinguish between two Wittgensteins: an early and a later one. It is also customary to see the former’s activity as culminating in the Tractatus, while dating the inception of the latter’s activity at around 1929, when he becomes centrally concerned to criticize the Tractatus. This much seems to me to be right about this standard telling of the story of Wittgenstein’s development: if we want to understand the nature of a break between someone whom we want to call an “early” Wittgenstein and someone whom we want to call a “later” Wittgenstein, then we do need to understand the nature of the latter’s criticism of the former. The customary way of locating this break is via certain philosophical doctrines – doctrines that are taken to be central of the teaching of the Tractatus and then subjected to criticism by the later Wittgenstein. The doctrines that are usually seized upon and most highlighted in standard tellings of this story (about what early Wittgenstein was for and later Wittgenstein was against) are ones that resolute readers have argued are already fiercely under attack in the Tractatus. This has led to others saying about such readers, as David Stern does, that their view must be that there are no significant differences between early and later Wittgenstein. And when they say this about me, I deny what they say. This is not my view, I say, far from it. Thus a situation of the following sort comes about: one in which it now seems incumbent upon me to offer a tidy alternative picture of my own of Wittgenstein’s development – one in which I specify where and when, according to me, the break between early and later Wittgenstein occurs. And I find that I cannot do this. The more From “The Method” to Methods 69 closely I look at the character of the development of Wittgenstein’s thought, the more complex and nuanced and graduated the sorts of changes that development undergoes come to appear to me to be. So, in answer to the question “What is your story of Wittgenstein’s development?”, I am inclined to say “Well, it’s complicated.” But that is not a satisfying answer. If, however, I had to go on German television right now, and the host of the TV show were to point a pistol at my temple and to say to me: “Professor Conant, please tell our TV audience right now where and when, according to you, the biggest single break comes in Wittgenstein’s philosophical development, or else we will shoot you here and now in front of millions of people on German television!”, then I would answer: “Norway, 1937” Of course, if I were on a television show, I would not be given any time to explain this answer. As I am, fortunately, not addressing this question as the guest on a television show, I will take advantage of the situation to try to explain a bit more why I would say this. I offer this answer, however, not because I wish to endorse the idea that Wittgenstein’s philosophical development underwent a single decisive moment of discontinuity and that it is useful to sort of everything in his work into two separate and utterly distinct categories – the category of the texts that he wrote before the crucial moment dawned and the category of the texts that he wrote after that crucial moment dawned. In the end, it is precisely this aspect of the standard narrative that I would most like to do away with. Thus I offer my overly simplistic answer to my imaginary German television interviewer not as some form of last word about how to tell the story of Wittgenstein’s philosophical development. Rather I offer it as a corrective and an antidote to the standard narrative, precisely in the hope that it will help to bring out an important aspect of the actual complexity of the development of Wittgenstein’s philosophy that goes missing on the standard narrative. I am willing to maintain that the “break” in Wittgenstein’s philosophy that I will go on to identify in the pages that follow is at least as significant as any that takes place in or around 1929. This is a strong claim. To say this, however, is not to deny that significant reasons for dissatisfaction with his early philosophy did begin to come into view for Wittgenstein in and around 1929. Nor is it to deny that there are other very significant revolutions that his thought undergoes, for example, in the period between 1913 and 1918, and, for example, again in the period between 1945 and 1951. Thus to claim the importance that I wish to for what happens in Norway in 1937 therefore is not suggest that this is actually where the real “break” happens. It is merely to suggest that a careful attention to the sort of criticism of his earlier conception of philosophy that Wittgenstein begins to initiate in 1937 can afford us a perspective from which we can begin to see much of what is partial and distorted in the standard narrative of Wittgenstein’s philosophical development. James Conant 70 5. Two Senses of ‘Piecemeal’ In order to achieve this perspective, it will help first to distinguish between two different things that commentators have meant to say when they have said what seemingly amounts to the saying of a single sort of a thing about the character of Wittgenstein’s approach to philosophy. In saying these two different things, in each case, commentators tend to use the same word – the word ‘piecemeal’ – which helps to create a certain confusion that I would first like to undo. Wittgenstein’s approach to philosophical problems is a piecemeal one, we are told by the commentators that I have in mind. But what does this mean? In the passages from McGinn and Goldfarb that I will cite below, we will encounter two different commentators explaining the sense in which the expression ‘piecemeal’ does or does not properly apply to early Wittgenstein’s conception of method in philosophy. In the former of these passages, Marie McGinn comments on the way in which early Wittgenstein strives not to treat each of the problems piecemeal; whereas, in the latter, Warren Goldfarb’s explicates the sense in which Wittgenstein’s practice of philosophical clarification is only properly understood once it is recognized as essentially piecemeal in character. Thus, on a superficial reading, it might appear that one of these commentators is concerned to affirm something that the other is concerned to deny. The apparent disagreement here might be summed up as follows: Goldfarb thinks early Wittgenstein’s method is piecemeal (whatever that means); whereas McGinn denies this. I think the disagreement here is merely apparent. But, before I say why, let us see look more closely at why each of these commentators is drawn to reach for the concept of the piecemeal in their respective attempts to characterize some aspect of early Wittgenstein’s philosophical procedure. I take it, first of all, that each of them has a hold of an important part of the truth of Wittgenstein’s philosophy, at this early point in its development, and, secondly, that it is not easy to keep these two parts of the truth about Wittgenstein’s early philosophy sufficiently far apart – far enough apart so that one of these can vary independently of the other over the course of Wittgenstein’s development. McGinn’s aim is to try to bring out what is at issue in remarks of Wittgenstein’s, especially in his early Notebooks, in which he speaks of himself as grappling with “a single great problem”. Here is one such remark: Don’t get involved in partial problems, but always take flight to where there is a free view over the whole single great problem, even if this view is still not a clear one.19 _____________ 19 Wittgenstein: Notebooks, 1914-1916 (translated by G. E. M. Anscombe), Oxford 1961, p. 23. The following is a related passage: “The problem of negation, of disjunction, of From “The Method” to Methods 71 Let me say, first of all, that I agree with McGinn that the aspiration that is expressed here in the Notebooks is one that continues to shape the conception of philosophical method at work in the Tractatus. In fact, I wish to argue for an even stronger claim: namely, that this aspiration – for a single free view over the whole of philosophy – continues well into the period of work that people ordinarily think of as belonging to that of the “later” Wittgenstein. I will also be concerned to argue for two further related claims: (1) that Wittgenstein’s eventual abandonment of this aspiration represents as significant a development in Wittgenstein’s philosophical trajectory as any that is properly associated with the break between the Tractatus and the work that Wittgenstein wrote during the first half of the 1930s, and (2) that it represents a shift in his thinking about the nature of philosophy whose momentousness becomes completely obscured on the standard telling of Wittgenstein’s philosophical development. Here is how McGinn summarizes what is at issue in the passage from the Notebooks in question: Wittgenstein here [in the above passage from Notebooks, 1914-1916, p. 23] instructs himself not to try to treat each of the problems piecemeal.20 I will return to McGinn’s point here in a moment. But before I do, let us complete our brief survey of the two different senses in which the expression ‘piecemeal’ can be helpfully employed in the context of elucidating Wittgenstein’s thought. Here is Goldfarb explaining the sense in which the Tractatus is committed to (to something one might want to call) “a piecemeal approach” to solving philosophical problems: The lesson is that “nonsense” cannot really be a general term of criticism. As a general term of criticism, it would have to be legitimized by a theory of language, and Wittgenstein is insistent that there is no such thing. (“Logic must take care of itself.”) … Wittgenstein’s talk of nonsense just is shorthand for a process of coming to see how words fall apart when worked out from the inside. What Wittgenstein is urging is a case-by-case approach. The general rubric is nothing but synoptic for what emerges in each case. Here the commonality with his later thought is unmistakeable.21 The sense of ‘piecemeal’ that concerns McGinn – that is, the sense in which early Wittgenstein’s approach to philosophical problems is anything but piecemeal – has to do with the unitary character of the method he employs, that is, with what makes it correct to speak of there being such a thing as the method of the Tractatus. The sense of ‘piecemeal’ that concerns Goldfarb – _____________ 20 21 true and false, are only reflections of the one great problem in the variously placed great and small mirrors of philosophy” (Notebooks, 1914-1916, p. 40). Marie McGinn: Wittgenstein’s Early Philosophy and the Idea of ‘The Single Great Problem’, in: Alois Pichler / Simo Säätelä (eds.): Wittgenstein: The Philosopher and his Works, op. cit., p. 100. Goldfarb: Metaphysics and Nonsense, op. cit., p. 71. James Conant 72 that is, the sense in which early Wittgenstein’s approach to philosophical problems of necessity requires a case-by-case approach – has to do with the application of “the method of the Tractatus” to individual philosophical problems, and with why such an application must of necessity be retail, rather than wholesale. Let us first explore for a moment this latter sense of the term, in accordance with which early Wittgenstein’s conception of philosophical method can properly be said to be piecemeal. This requires getting firmly into focus a critical difference between standard and (what have now become know as) resolute readings of the Tractatus. As we saw above, according to standard readers, what the author of that work, in section 6.54, aims to call upon his reader to do (when he says that she will understand him when she reaches the point where she is able to recognize his sentences as nonsensical) is something that requires the reader of the work first to grasp and then to apply to the sentences of the work a theory that has been advanced in the body of the work. And, as we also saw, in order to be able to give content to the idea that we are able to come to grasp the commitments of such a theory, a commentator must hold that there is a fairly substantial sense in which we can come to “understand” the sentences that “explain” the theory, despite the fact we are eventually called upon to recognize these very same sentences as nonsense. And, finally, as we saw, resolute readers are committed to rejecting such a reading, in part on account of some of the consideration above. In the context of summarizing this aspect of the dispute between standard and resolute readers above, I touched upon Wittgenstein’s declaration that the kind of philosophy he seeks to practice in the Tractatus consists not in putting forward a theory, but rather in the exercise of a certain sort of activity – one of elucidation22; and I remarked that a core commitment of a resolute reading lies in an insistence upon the thought that a proper understanding of the aim of the Tractatus depends upon taking Wittgenstein at his word here. Peter Hacker is explicit about the fact that a standard reading of the Tractatus requires that one not take Wittgenstein at his word on this point: To understand Wittgenstein’s brief remarks about philosophy in the Tractatus, it is essential to realize that its practice and its theory are at odds with each other. The official de jure account of philosophy is wholly different from the de facto practice in the book.23 _____________ 23 P. M. S. Hacker: Insight and Illusion, 2nd Edition, Oxford 1986, p. 12. From “The Method” to Methods 73 What would it be to take Wittgenstein’s remarks about philosophy in the Tractatus at face value? According to resolute readers, to regard one of the sentences (of which the body of the book is comprised) to be a rung on the ladder (that we are asked to climb up and then throw away) is to take it to belong to this aspect of the task that the author of the work has set us. The reader reaches a moment in which she understands the author (and what he is doing with one of his sentences) each time she moves from a state of appearing to herself to be able to understand one of these sentences to a state in which it becomes evident to her that her earlier “state of understanding” was only apparent. This point is reached not through the reader’s coming to be convinced by an argument that forces her to believe that such-and-such is the case, say, by convincing her that the sentence fails to meet certain necessary conditions on sense. (Why should she ever believe the conclusion of such an argument, if she takes herself still to be able to understand the sentence in question? As long as she is able to do this, doesn’t she have good reason to question the premises of the argument?) Rather, the point is reached, in each case, by her experience of the sentence (and the sort of understanding it can seem to support) undergoing a transformation. Each such moment of “understanding the author” involves, in this sense, a change in the reader. Her sense of the world as a whole, at each such moment, waxes or wanes, not by her coming to see that p (for some effable or ineffable, propositional or quasi-propositional p), but rather by her coming to see that there is nothing of the form ‘that _____’ (of the sort she originally imagined) to believe. So a point of understanding the author is reached when she arrives at a moment in her relation to a given form of words when she is no longer able to sustain her original experience of “understanding the sentence”. The task of thus overcoming each such particular appearance of sense (that each such rung on the ladder at first engenders in a reader) is an arduous one. The form of understanding that is at issue here for resolute readers can only be attained piecemeal, sentence by sentence. Since they hold that the Tractatus has no general story about what makes something nonsense, resolute readers are obliged to hold that these moments of recognition that a reader is called upon (in section 6.54) to attain must come one step at a time, in the way that Goldfarb sketches in the quotation on your handout. This is contrary to the spirit of most standard readings, according to which there can be a possible moment in a reader’s assimilation of the doctrines of the book when the theory (once it has been fully digested by the reader) can be brought simultaneously to bear wholesale on all of the (putatively nonsensical) propositions that make up the work. According to such a reading of the Tractatus, once we have equipped ourselves with the right theory of language, we can determine where we have gone right and 74 James Conant where we have gone wrong in philosophy, simply by applying the theory to each of the things we are drawn to say when speaking philosophically. According to resolute readers, it is a central project of the Tractatus to criticize just this conception of the role that theory can play in philosophical clarification – the very conception that standard readers assume lies at the heart of the book. Equally controversially, according to resolute readers, this rejection of the understanding of the role of theory in philosophy not only marks an important point of discontinuity between Wittgenstein’s thought and that of the philosophical tradition, but it also makes an important point of continuity between the thought of early and that of later Wittgenstein. We might sum up the alternative (so-called resolute) view of Wittgenstein in question here as follows: Wittgenstein, early and late, rejected a wholesale conception of how progress in philosophy is to be achieved – philosophical clarity must be won piecemeal, one step at a time – thus not through the application of a general philosophical account to a class of instances that fall under the categories catered for by the account, but rather through a procedure of philosophical clarification that requires the case-by-case interrogation of genuinely felt individual expressions of philosophical puzzlement. The foregoing was my vey brief attempt to summarize (what we might call) the Goldfarb sense of ‘piecemeal’ – the sense in which, according to resolute readers, Wittgenstein is committed to a piecemeal procedure in philosophy. Now what about (what we might call) the McGinn sense of ‘piecemeal’? In the quotation from McGinn above, she comments on the passage about the Single Great Problem from the Notebooks by saying that Wittgenstein there “instructs himself not to try to treat each of the problems piecemeal”. The first thing we need to see is that what McGinn takes early Wittgenstein to be there instructing himself not to do (in her use of the expression “treat each of the problems piecemeal”) and what resolute readers (such as Goldfarb and myself) take early Wittgenstein to be committed to doing (in their use of the expression “treat each of the problems piecemeal”) are not the same thing. The ambition touched on in the remark from the Notebooks (the ambition to attain a view of the problems of philosophy that allows them all simultaneously to come into view as aspects of “a whole single great problem”) is an ambition that Wittgenstein takes himself to have realized by the time of completing the Tractatus. It is tied to the remark in the Preface of the Tractatus that “the problems have in essentials finally been solved”. The problems have in essentials been solved because the method of their (dis)solution has been found. The application of this method to the problems of philosophy (that require treatment by the method) is for early Wittgenstein, nonetheless, a piecemeal process in (what I have called) the Goldfarb sense – that is why the From “The Method” to Methods 75 problems have been solved only in essentials, and not in their details. It is the latter distinction (between solving the problems in essentials vs. in their details) that mandates the early procedure of piecemeal interrogation of sentences that resolute readers insist upon. This is not to be confused with a more fundamental distinction in philosophical conception between the methodological monism of the early Wittgenstein (who seeks to present the method of clarification) and the methodological pluralism of the later Wittgenstein (who seeks to present an open-ended series of examples of methods – a series that can be continued in both unforeseen and unforeseeable ways) – and that can be broken off at any point. A resolute reader who insists upon things being piecemeal in the sense that goes with the first of these distinctions need not hold that they are piecemeal in the sense that goes with the second of these distinctions (and therefore need not deny that there is an enormous difference in methodological conception between early and later Wittgenstein). The definite article in the title of my paper “The Method of the Tractatus” (a paper which, incidentally, insists upon the piecemeal character of any application of the method) is supposed to mark an important point of difference between early and later Wittgenstein in this regard.24 A resolute reader who fails carefully to distinguish these two senses (in which something about the early method can be said to be “piecemeal”) runs the risk of falling into thinking that a bare commitment to resolution itself entails a needlessly severe claim regarding the extent of the continuity that can be found in Wittgenstein’s philosophy.25 The expression ‘piecemeal’ therefore, employed in the Goldfarb sense, can be a useful locution for marking a profound continuity in Wittgenstein’s thought that runs from the Tractatus to the end of his philosophical life. And the expression ‘piecemeal’, employed in the McGinn sense, can be a useful locution for marking a profound discontinuity in Wittgenstein’s thought. At what point does this latter break in his conception of philosophy arise? 6. From Methodological Monism to Methodological Pluralism As I already mentioned that I would tell the host of the imaginary German television show: I believe that the correct answer to that question is 1937. To document that claim properly would require going into a level detail that does _____________ 24 25 See: The Method of the Tractatus, in: Reck (ed.): From Frege to Wittgenstein, op. cit. Oxford 2002. There are such resolute readers around now who take themselves to be in agreement with my work. They are not. 76 James Conant not fit well into the genre of an article-length contribution to a volume of essays. I will therefore confine myself here to an attempt to sketch the larger framework within which such an investigation would take place. As I have already in effect indicated above, I do think this much is clear: whenever exactly that break took place, it has been fully accomplished in the final version of Part I of Philosophical Investigations. Of particular interest in this connection is the entire stretch in Philosophical Investigations that runs from §89 to §133. In almost every remark we have some effort on Wittgenstein’s part to bring his later methods of philosophy into relief by contrasting them with his earlier conception of the method (cf. §133) of philosophy, and yet numerous local moments of continuity surface within this overarching contrast. This contrast – between the (early) method and the (later) methods – draws many of the other points of difference between the early and later philosophies together and, in particular, the difference between the Tractatus’s point of view on the problems of philosophy (according to which they have in essentials been solved) and the refusal of such a point of view in the Investigations (in which the essentials can no longer be separated in such a manner from the details of their treatment). The confidence expressed in the claim (in the Preface to the Tractatus) that the problems of philosophy have in essentials been solved is tied to a confidence that, at least in its essentials, the basic outline of the method for dissolving all such problems has been put been in place. (This, in turn, is tied to a confidence that there is something which is the logic of our language – the structure of which can be displayed in a perspicuous notation.) The Tractatus aims to furnish this basic outline and demonstrate its worth. Once it has successfully done so, it is now to become clear, in retrospect, that the prior absence of a serviceable method had been the big problem for the early philosophy – for the solution to all other problems had depended on the solution to this one – and now that it has been resolved, they, are in principle (if not yet in practice) also resolved. This central (apparent) achievement of the early philosophy, in turn, becomes a central target of the very late philosophy. The entire stretch in Philosophical Investigations that runs from §89 to §133 can be read as seeking to expose the latent preconceptions that allowed early Wittgenstein to imagine that he had done this – that he had been able to survey the structure of the problems as such and attain a perspective on them from which there could appear to be one big problem that could admit of an overarching form of solution (at least in its essentials). Yet, at the same time, there is much of local value in his early conception of clarification that is to be recovered within this fundamental break with the early conception. Hence, even in the course of this markedly critical sequence of reflections on the relation between the early and later conceptions of philosophical method, a crisscrossing method of investigation is required – one that denies nothing of value and recoups each of the gains of the early philosophy, while From “The Method” to Methods 77 laboring to identify each of the moments in which it oversteps or overreaches. One might think that the question of “the extent of the continuity and the discontinuity in Wittgenstein’s philosophy” here at issue has primarily to do with the relation between the author of the Tractatus and the author of the Investigations. But I think this would be quite mistaken. And the mistake in question here extends to the scope of the contrast between conceptions of philosophical method drawn in the last sentence of §133: “There is not a philosophical method, though there are indeed methods, like different therapies.”26 I do not meant to suggest that it is incorrect to understand the contrast in play here to be one that marks a difference between the Tractarian methodological conception (the conception of the method) and that of §133 (the conception that there is not one philosophical method, though there are indeed methods). But one should not conclude on this ground that §133 contains no criticism by Later Wittgenstein of Middle Wittgenstein. For this idea of “the method” did not immediately die with Wittgenstein’s return to fulltime philosophizing in 1929. §133 is arguably equally concerned to draw a contrast between the later methodological conception and the very emphatic views of Middle Wittgenstein. Despite the far-reaching differences in their respective methodological conceptions, there remains the following important similarity between Early and Middle Wittgenstein: each believes he has hit upon the method. One of Middle Wittgenstein’s favorite ways of putting this, in the context of discussing his “new” method, is to emphasize how philosophy can now become a matter of skillful practice. There can be skillful philosophers as there are skillful chemists, because “a new method” had been discovered, as happened when chemistry was developed out of alchemy: “The nimbus of philosophy has been lost. For we now have a method of doing philosophy… Compare the difference between alchemy and chemistry; chemistry has a method”.27 What matters now is not the truth or falsity of any specific philosophical results but rather this all-important fact: “a method had been found”.28 The contrast between there being a philosophical method (according to Middle Wittgenstein) and there being philosophical methods (according to Later Wittgenstein) represents an important difference in the respect in which he thinks philosophy can and should aspire to a form of maturity – a form of maturity that does, for example, properly characterize the manner in which an immature discipline (say, chemistry) can be said to _____________ 26 27 28 Wittgenstein: Philosophical Investigations, op. cit., §133. Ludwig Wittgenstein: Wittgenstein’s Lectures: Cambridge, 1930-1932, edited by Desmond Lee, Ottawa-New York 1980, p. 21. Ibid., p. 21. 78 James Conant have successfully differentiated itself from the form it took in its infancy through having come to attain a form of maturity marked out by the fact that the fundamental questions of the discipline are no longer primary concerned ones of method – a condition, that is, in which the majority of the practitioners, at any given time, are properly able to rest content with a stable conception of the sort of methods appropriate to such a form of inquiry. It would be a mistake here to think that Middle Wittgenstein here thought that philosophy should aspire to imitate the method or methods of science. That would be a misunderstanding of how Wittgenstein viewed philosophy, early, middle, and late. The point is rather that Middle Wittgenstein, like Early Wittgenstein yearned for the possibility of an overview of the possible forms of difficulty that characterize philosophical problems. In this respect, a possible (and arguably fantastic) imaginary future state of medicine might serve as a better analogy here than chemistry. Imagine a future in which the science of medicine has attained the sort of maturity that Wittgenstein postulates the science of chemistry can and has, where even once the science of the possible forms of disease and their possible forms of cure has been completed, the art of medicine might well persist as a form of craft that cannot itself be reduced to a form of science, even if its instruments of cure rests on one. What makes this analogy more fitting is the fact that, for the author of the Tractatus, for example, the provision of a proper Begriffsschrift is the sort of thing that would, on the one hand, at least implicitly afford an inventory of all of the possible forms of philosophical confusion, just as the tools it would afford would provide a complete toolkit for the treatment of those forms of confusion. Yet its exhaustiveness in these respects would not eliminate the need for a form of elucidatory craft when it came to the clarification of philosophical problems. So to say that one has attained an overview of all of the forms of philosophical confusion need to be to deny that, for example, the discernment of which particular – or which particular combination of – forms of notation (of the sort that the Tractatus introduces, such as the truthtable notation, the Klammerausdruck notation for generality, the N-operator notation for the general form of the proposition, etc. for the treatment of philosophical problems) will be help with this particular philosophical confusion might not be readily apparent, so that such a form of discernment might well require considerable elucidatory experience, delicacy of judgment, and philosophical craft. Similarly, even once the right elucidatory tools have been identified, their application to a particular form of confusion might well be a piecemeal matter, yielding limited relief and freedom from perplexity at each step in the process, such that the overall procedure (which aims to make the problems completely disappear) might require considerable deftness, patience and art on the part of its practitioner. From “The Method” to Methods 79 To employ a dangerous (because potentially misleading) analogy: just as the discovery of all possible medical vaccines and cures for all possible forms of disease would not necessarily eliminate the art of medicine, since even the medical practitioner armed with a complete medical toolkit would still require experience, judgment and medical craft properly to diagnose, treat and, heal any particular form of illness, so that the true business of medicine must remain a forever piecemeal and unfinished task; so, too, for the author of the Tractatus, even after the method of philosophy has been discovered (and thus, in this sense, the problems have been solved in their essentials), the work of philosophical elucidation – the true business of philosophy – must remain a forever piecemeal and unfinished task (one which, with respect to its application in detail, must go on indefinitely without ever reaching a final resting place). It is this aspect of the methodological aspiration of the Tractatus that remains very much alive in Middle Wittgenstein, so that what is at issue here is arguably the central difference in the thought of (what we might call) the Early Later Wittgenstein and the Later Later Wittgenstein. Thus it would be a mistake to think that §133 (in its denial that there is “a philosophical method”) is primarily concerned to draw a contrast between the “early” view (where early = Tractatus) and the “later” view (where later = Investigations). It is worth noting in this connection that the predecessor version of §133 in The Big Typescript is missing the last sentence (about there not being a philosophical method, but rather different methods).29 Yet much of §133 as we find it in the Investigations is already in The Big Typescript, and is clearly concerned with drawing contrasts between the author’s (i.e., Middle Wittgenstein’s) conception of philosophy and that of the Early Wittgenstein. We here stand at the threshold of a broader inquiry. In order to see how the point just made about §133 represents only the tip of a larger iceberg of forms of revision in Wittgenstein’s texts – forms of revision that themselves are symptomatic of a sea-change in his conception of philosophical method – what one would need to do is to investigate the detailed ways in which entire stretch in Philosophical Investigations that runs from §89 to §133 involves a careful rewriting of the chapter on Philosophy in The Big Typescript, so as to purge of it of its commitment to the idea that the method has been found once and for all (so that the problems of philosophy are of such a sort that the essentials of their solution allow for a sort of discovery that can be separated from the messy details of their treatment) and thus that – even though much work remains for individual practitioners of the subject to – the nimbus of philosophy has been lost once and for all (for philosophy has now been reduced to a _____________ 29 Ludwig Wittgenstein: The Big Typescript (translated by C. G. Luckhardt and M. A. E. Aue), Oxford 2005, p. 316. 80 James Conant craft of applying a set of tools whose fundamental nature and character have been successfully identified and supplied). It this conception of what he seeks, in seeking the method of philosophy, that Wittgenstein finally came to abandon in Norway in 1937. On later later Wittgenstein’s conception, the treatment of philosophical problems can no longer be separated in this way from a continuing exploration of the fundamental character of philosophy itself – which is to say that philosophy can never lose its nimbus while remaining philosophy. The forms of creativity required for the discovery of fruitful methods in philosophy and the forms of creativity required for the fruitful application of such methods to particular problems of philosophy are recognized by later later Wittgenstein as two aspects of a single task, each of which requires an unending cultivation of the latter. A careful examination of the relevant differences between §89 to §133 of Philosophical Investigations and the chapter on Philosophy in The Big Typescript nicely brings out one aspect of the way in which the break with the Tractatus was a graduated one, that was distributed over widely dispersed junctures in his philosophical development. Here we see two crucial steps coming one after the other. Middle Wittgenstein (who still thought there was one method) thought that Early Wittgenstein had been confused (in thinking that it was possible to solve all the problems at once by solving them in essentials). Yet Later Wittgenstein (who thinks there can only be methods) thinks Middle Wittgenstein is still confused in his criticisms of Early Wittgenstein (i.e., he has unwittingly preserved an essential feature of the metaphysics of the Tractatus). This shows how, as a matter of historical fact, the process of purging himself of the unwitting metaphysical commitments of the Tractatus is one that unfolded for Wittgenstein, over the course of his own philosophical development, in (what we might call) a “piecemeal” manner– in yet a third application of that term to Wittgenstein’s philosophy. In this third application of the term, what is at issue is not some particular aspect of Wittgenstein’s conception of philosophical method, but rather the shifts that the various aspects of that conception undergo over time. What I hope to have begun to make plausible in this paper is that a proper and careful telling of that tale is a delicate and difficult matter and one which has still gone largely untold. „Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder“ Geert Keil Den Satz von Frege, den ich für den Titel meines Beitrags ausgeliehen habe, könnte man für ein philosophisches Glaubensbekenntnis halten. Als einem solchen könnte man ihm die Bemerkung Adornos zur Seite stellen, in der Philosophie sei die halbe Wahrheit schon die ganze Unwahrheit. Und wem Adorno keine Autorität ist, der mag an Matthäus 5, 37 denken: „Deine Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel“. All das meint Frege nicht. Es geht ihm nicht um die Tugend der eindeutigen Rede oder um einen Rat an die Philosophen, sich nicht mit Halbwahrheiten zufriedenzugeben. Es geht ihm schlicht darum, was Wahrheit ist. Lässt sich das Prädikat „ist wahr“ abstufen, oder ist Wahrsein eine Entweder-oderAngelegenheit? Frege selbst ist der Auffassung, dass mit der Rede von mehr oder minder Wahrem das Wahrheitsprädikat missbraucht wird. Dieser Auffassung war schon Aristoteles und mit ihm die Mehrheit der Philosophen, die über diesen Gegenstand nachgedacht haben. Auch die klassische Logik und die meisten Bedeutungstheorien basieren auf dieser Annahme: Eine wohlgeformte Aussage, die überhaupt wahrheitsfähig ist, ist entweder wahr oder falsch. Den Entweder-oder-Charakter der Wahrheit drücken drei eng verwandte logische Prinzipien aus, das Bivalenzprinzip, das Tertium non datur und der Satz vom Widerspruch. Über die Unterschiede zwischen diesen drei Prinzipien ist viel Tinte vergossen worden. Ich behelfe mich mit den folgenden Standarderläuterungen: (i) Das Bivalenzprinzip sagt, dass alle Aussagen wahrheitswertdefinit, nämlich entweder wahr oder falsch sind. Es verbietet Wahrheitswertlücken und lässt als Wahrheitswerte nur „wahr“ und „falsch“ zu. (ii) Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten behauptet die Allgemeingültigkeit des Aussageschemas P oder non-P. Mit anderen Worten: Jede Aussage der Form P ¬P ist logisch wahr. Aristoteles drückt das Prinzip so aus, dass es zwischen den beiden Gliedern eines Widerspruches nichts Drittes oder Mittleres geben könne (Met. 1011b). 82 Geert Keil (iii) Der Satz vom (ausgeschlossenen) Widerspruch besagt, dass eine Aussage und ihre kontradiktorische Negation nicht zugleich wahr sein können, oder dass keine Aussage zugleich wahr und falsch sein kann: ¬ (P ¬P). Mit welchem oder welchen dieser drei Prinzipien steht die Rede von halbwahren oder annähernd wahren Aussagen in Konflikt? Am offensichtlichsten konfligiert die Annahme von Wahrheitsgraden mit dem Bivalenzprinzip. Dass Wahrheitsfähiges nur einen der beiden Wahrheitswerte „wahr“ oder „falsch“ annehmen kann, scheint eine Aussage über den Wahrheitsbegriff selbst zu sein, oder über die Natur der Wahrheit. Mit dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten, so könnte man argumentieren, konfligiert die Annahme von Wahrheitsgraden mittelbar. In diesem Prinzip wird zwar über die Natur der Wahrheit nichts explizit behauptet, doch der Wahrheitsbegriff, und anscheinend der klassische zweiwertige, wird in ihm bereits verwendet. Im Tertium non datur würde demnach die Zweiwertigkeit unterstellt, während sie im Bivalenzprinzip behauptet wird. Die Formulierung des Bivalenzprinzips, dass es neben den beiden klassischen Wahrheitswerten keinen weiteren gebe, ist auslegungsbedürftig. Unvereinbar mit dem Bivalenzprinzip ist die Auffassung, dass es einen dritten Wahrheitswert gibt. Ob die in einigen dreiwertigen Logiken vorkommende Zuweisung „weder wahr noch falsch“ als dritter Wahrheitswert zählen sollte, ist umstritten. Man könnte argumentieren, dass die Zuweisung “’neither true nor false’ no more signifies a third truth value […] than ’either true or false’ does”.1 In diesem Fall widerspricht sie dem tertium non datur, nicht aber dem Bivalenzprinzip. Das Prinzip, dass die Wahrheit kein Mehr oder Minder verträgt, hat keinen eigenen Namen. Man könnte es das Prinzip vom kategorischen, absoluten, nichtgradualen oder nichtabstufbaren Charakter der Wahrheit nennen. (iv) Das Prinzip vom nichtabstufbaren Charakter der Wahrheit: Wahrsein lässt keine Abstufungen zu. Was wahr ist, ist ganz wahr. „Was nur halb wahr ist, ist unwahr. Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder.“2 Indem das Nichtabstufbarkeitsprinzip weitere Wahrheitswerte neben „wahr“ und „falsch“ verbietet, ist es in das Bivalenzprinzip eingeschlossen. Nun könnte, wer eine Aussage „annähernd wahr“ nennen, sich aber nicht mit Frege anlegen möchte, argumentieren, er habe nicht den zusätzlichen Wahrheitswert „annähernd wahr“ zugeschrieben, sondern den gewöhnlichen Wert „wahr“ nur mit Abstrichen zugeschrieben. Das Weitere wäre dann jenseits der Wahrheitstheorie in einer Logik des Zuschreibens oder Zutreffens zu _____________ 1 2 Wolfgang Künne: Conceptions of Truth, Oxford 2003, S. 352. Gottlob Frege: Der Gedanke. Eine logische Untersuchung [1918], in: ders.: Logische Untersuchungen, hrsg. von Günther Patzig, Göttingen 1966, S. 30-53, hier: S. 32. „Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder“ 83 klären. Diesen Weg, der weitgehend analoge Probleme aufwirft, werde ich hier nicht weiterverfolgen. Wenn das Nichtabstufbarkeitsprinzip ein Spezialfall des Bivalenzprinzips ist, sind alle Argumente für Wahrheitsgrade zugleich solche gegen Bivalenz. Umgekehrt spricht aber nicht alles, was gegen Bivalenz spricht, auch für Wahrheitsgrade. Ich werde den Unterschied zwischen beiden Prinzipien immer dort vernachlässigen, wo er für die Argumentation keine Rolle spielt. Wie gesagt: Die meisten Philosophen, die über Wahrheit nachgedacht haben, sind der Auffassung, dass die Rede von mehr oder minder Wahrem das Wahrheitsprädikat missbraucht. Und selbst diejenigen, die dieser Auffassung widersprechen, finden auf Nachfrage meistens, dass sie damit die Sache richtig sehen und die anderen falsch. Sie bestreiten das Nichtabstufbarkeitsprinzip oder das Bivalenzprinzip rundheraus und sagen nicht etwa, dass die Wahrheit darüber in der Mitte liege. Nehmen sie damit in Anspruch, was sie bestreiten? Nicht zufällig spielen elenktische Argumente und Selbstwiderlegungsargumente seit Aristoteles eine besondere Rolle in Diskussionen über die fraglichen Prinzipien. Aber Aristoteliker und Fregeaner haben kein Copyright auf den Wahrheitsbegriff. Die Alltagssprache kennt eine ganze Reihe von Wendungen, in denen das Wahrheitsprädikat anders zu funktionieren scheint. Man spricht von „Halbwahrheiten“, man spricht davon, der Wahrheit „näherzukommen“. Man sagt, dass eine Lehre „ein Körnchen Wahrheit“ enthalte, dass sie „eher wahr“ sei oder „eher falsch“, oder davon, dass die Wahrheit „in der Mitte“ liege. Alle diese Redeweisen scheinen Wahrheit zu einer Sache des Grades zu machen. Jeder, der mit Frege die Auffassung verteidigt, dass die Wahrheit kein Mehr oder Minder verträgt, sollte etwas zu diesen verbreiteten Redeweisen zu sagen haben. In der Philosophie möchten – oder sollten! – wir schließlich denjenigen Wahrheitsbegriff analysieren, den wir tatsächlich besitzen und verwenden, und nicht ein neues, stipulativ definiertes Wahrheitsprädikat einführen. Die philosophische Standardauffassung und die Art, wie wir im Alltag oft über Wahrheit reden, passen offenkundig nicht zusammen. Die Wahrheit über etwas kann nicht zugleich eine Entweder-oder-Sache und eine Mehroder-weniger-Sache sein. Ein überzeugter Nichtgradualist könnte diese Spannung freilich so kommentieren, dass außerhalb des Philosophischen Seminars häufig Unsinn geredet werde. Doch diese Reaktion käme einer philosophischen Arbeitsverweigerung gleich. Mit etwas hermeneutischer Caritas lässt sich den gradualen Redeweisen durchaus ein Sinn abgewinnen. Es gibt offensichtlich Phänomene, denen mit der gradualen Rede über Wahrheit Rechnung getragen werden soll. Welches sind diese Phänomene? Einen ersten Hinweis gibt die aus dem forensischen Kontext bekannte Aufforderung, die ganze Wahrheit und nichts als Geert Keil 84 die Wahrheit zu sagen. Ich erinnere mich, schon als kleiner Junge gefunden zu haben, dass die Tugend der Wahrheitsliebe durch die zweite Hälfte der Formel hinreichend ausgedrückt sein sollte. Nichts als die Wahrheit zu sagen kann man guten Gewissens versprechen. Wer nichts als die Wahrheit sagen möchte, darf nichts Falsches sagen. Genaugenommen kann man nur versprechen, nichts zu sagen, was man für falsch hält, aber über den Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit wird außerhalb der Philosophie oft hinweggegangen.3 Die ganze Wahrheit zu sagen erscheint dagegen als ein nachgerade frivoles Ansinnen. Was soll das sein, die ganze Wahrheit über etwas? Wann wäre dieses Ziel erreicht? Austin nennt „die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit etwa über die Schlacht bei Waterloo oder über Botticellis Primavera“ ein „trügerisches Ideal“.4 Auch beim frühen Wittgenstein findet sich der Gedanke einer vollständigen, nichts auslassenden Beschreibung der Wirklichkeit. Er steht im Kontext seiner Version des logischen Atomismus, in der atomare Tatsachen und entsprechende Elementarsätze angenommen werden, so dass gilt: „Die Angabe aller wahren Elementarsätze beschreibt die Welt vollständig“.5 Diese Vollständigkeit der Beschreibung wird bei Wittgenstein aber nur stipuliert. Was in der Beschreibung überhaupt vorkommen kann, wird durch die Wahl des Notationssystems eingeschränkt, und wie man feststellen könnte, dass nichts ausgelassen wurde, erklärt Wittgenstein nicht.6 Bei näherem Nachdenken gehört die Rede von der ganzen Wahrheit wohl nicht in den Kontext der Bivalenz- oder der Gradierungsdebatte. Plausiblerweise geht es hier um eine quantitative Beurteilung von Wahrheiten über einen Gegenstand, und da scheint es durchaus ein Mehr oder Minder zu geben. Ob man Wahrheiten zählen kann und wie, sind schwierige Fragen, aber unstrittig kann man einen Gegenstand oder einen Sachverhalt mehr oder weniger umfassend beschreiben, mehr oder weniger genau, mehr oder weniger facettenund implikationsreich. Wer vor Gericht aufgefordert wird, die ganze Wahrheit über etwas zu sagen, soll nicht nur nichts Falsches sagen, er soll darüber hinaus nichts verschweigen, was potentiell relevant sein könnte – insbesondere nichts, was die Sache in ein neues Licht rücken könnte. Er soll den Hörern _____________ 3 4 5 6 Innerhalb der Philosophie ebenfalls, wie das fehlbenannte Lügnerparadoxon zeigt: Beim „lügenden“ Kreter geht es um die Wahrheit des Gesagten, nicht um die Aufrichtigkeit des Sprechers. John L. Austin: Wahrheit [1950], zitiert nach: Gunnar Skirbekk (ed.): Wahrheitstheorien, Frankfurt a. M. 1977, S. 226-245, hier: S. 237. Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, in: Schriften Bd. 1, Frankfurt a. M. 1960, Satz 4.26. Vgl. dazu die erhellenden Ausführungen von Hans Julius Schneider in ders.: Ein ›Rätsel des Bewusstseins‹ – für wen?, in: W.-J. Cramm / G. Keil (eds.): Der Ort der Venunft in einer natürlichen Welt, Weilerswist 2008, S. 88-102, hier: S. 90-95. „Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder“ 85 ermöglichen, sich ein möglichst vollständiges und unverzerrtes Bild vom Tatgeschehen und seinen Umständen zu machen. Nehmen wir um des Argumentes willen an, dass es Mengen von Wahrheiten gibt, die sich quantitativ vergleichen lassen. Dieser Mengenvergleich verlangt kein gradiertes Wahrheitsprädikat. Wenn man mehr Wahres sagt, sagt man dadurch nicht Wahreres. Entsprechend erfordern auch die „Halbwahrheiten“ und „Teilwahrheiten“, von denen im politischen Diskurs oft die Rede ist, etwa bei Dementis mit kunstvollen Auslassungen, nicht die Annahme von Wahrheitsgraden. Die Einsicht, dass „die ganze Wahrheit“ über eine Sache ein unerreichbares Ideal ist, lässt sich ohne Abstufung des Wahrheitsprädikats ausdrücken. Dass man schwerlich die ganze Wahrheit über etwas sagen kann, bedeutet nicht, dass das, was man sagen kann, immer nur annähernd wahr wäre. Insbesondere Kohärenztheoretiker der Wahrheit neigen dazu, beides zu verwechseln.7 Es wäre ein großer Klärungsfortschritt, wenn man auch die anderen angeführten Redeweisen – wie „Annäherung an die Wahrheit“ und „Halbwahrheit“ – in einer Weise interpretieren könnte, die mit dem Nichtabstufbarkeitsprinzip vereinbar ist. Poppers Theorie der „Annäherung an die Wahrheit“ läuft in der Sache auf eine quantitative Einschätzung hinaus. „Wahrheitsähnlich“ („verisimilar“) ist für Popper eine Theorie, die einen hohen Wahrheitsgehalt hat. Diesen bestimmt er als die Menge aller wahren Aussagen, die sich aus der Theorie herleiten lassen.8 Allgemein bemerkt der Linguist Pinkal zu den alltagssprachlichen Belegen für ein gradiertes Wahrheitsprädikat: Man muß mit diesen Belegen vorsichtig sein, weil sie keineswegs nur zur Charakterisierung von Wahrheitsgraden dienen. Sie können z. B. auf den ›Wahrheitsgehalt‹ komplexer Äußerungen (grob gesagt, das Verhältnis von wahren zu unzutreffenden Einzelinformationen) zielen.9 Mein Beitrag hat ein doppeltes Ziel: erstens einen nichtgradualen Wahrheitsbegriff so weit wie möglich zu verteidigen, zweitens zu zeigen, worin das begrenzte Recht der gradualen Redeweisen besteht.10 Man wird den nicht_____________ 7 8 9 10 Dies tun beispielsweise B. Blanshard und H. H. Joachim. Vgl. dazu Künne: Conceptions of Truth, a. a. O., S. 386 f. Vgl. Poppers (nie gehaltenen) Vortrag: Wahrheit, Rationalität und das Wachstum der wissenschaftlichen Erkenntnis [1960], in ders.: Vermutungen und Widerlegungen 1, Tübingen 1994, S. 312-365. Manfred Pinkal: Logik und Lexikon – Die Semantik des Unbestimmten, Berlin-New York S. 1985, 134. Man verzeihe mir die unübliche und unschöne Rede von einem „nichtgradualen“ Wahrheitsbegriff. Nahe läge die Bezeichnung „absoluter Wahrheitsbegriff“, aber da Absolutismen jedweder Art in der Gegenwartsphilosophie in geringem Ansehen stehen, möchte ich diesen Ausdruck vermeiden. Um ihn hier in geklärter Form ins Spiel zu bringen, wäre zunächst der Gemeinplatz, es gebe keine absolute Wahrheit, einer Geert Keil 86 gradualen Wahrheitsbegriff nur dann überzeugend verteidigen können, wenn man auch den legitimen Ort der gradualen Redeweisen bezeichnet – auf dass das Wahrheitsprädikat nicht mit Problemen belastet werde, die andernorts gelöst werden müssen. Insbesondere werde ich am Schluss des Beitrags zu zeigen versuchen, dass das Problem der semantischen Vagheit keinen abgestuften Wahrheitsbegriff erfordert. An manchen Stellen wird meine Verteidigung auch das Bivalenzprinzip umfassen. Ich lege aber Wert auf die Feststellung, dass damit kein Votum zur Zulässigkeit der Zuweisung „weder wahr noch falsch“ verbunden ist. Wenn diese Zuweisung ohnehin nicht als dritter Wahrheitswert zählt (s. o.), ist dieser Hinweis überflüssig. Ob das Zulassen von Aussagen, die weder wahr noch falsch sind, nun gegen das Bivalenzprinzip verstößt oder nicht, solche Aussagen erfordern jedenfalls kein graduales Wahrheitsprädikat.11 Mein Kritikziel in diesem Aufsatz sind die Halbwahrheiten, nicht die Weder-wahr-noch-Falschheiten. Herausforderungen für das Nichtgraduierbarkeitsund das Bivalenzprinzip Welches sind die Phänomene, die ein nichtgraduales Wahrheitsprädikat und das Bivalenzprinzp herausfordern? In der Philosophie und der Linguistik hat sich eine Handvoll von üblichen Verdächtigen angesammelt. Gelegentlich werden Aussagen angeführt, die sich aus irgendeinem Grund nicht verifizieren lassen. Auf diese Fälle werde ich hier nicht eingehen, weil der Nichtgradualist hier mit Recht anführen kann, dass sie nur für einen epistemischen Wahrheitsbegriff ein Problem darstellen, also für einen, der Wahrheit an gerechtfertigte Behauptbarkeit bindet. Legt man einen realistischen Wahrheitsbegriff zugrunde, wie ich in diesem Aufsatz, so folgt aus der Unmöglichkeit, die Wahrheit einer Proposition festzustellen, niemals, dass sie keinen Wahrheitswert hat.12 _____________ 11 12 sinnkritischen Analyse zu unterziehen. Eine erste Sichtung der Belege zeigt, dass mit dem Gemeinplatz in der Regel eine (krude) erkenntnistheoretische Behauptung aufgestellt wird, keine wahrheitstheoretische. Auch Frege ist kein kompromissloser Bivalentist, denn er hält ja „Odysseus wurde tief schlafend in Ithaka an Land gesetzt“ für weder wahr noch falsch. Vgl. Gottlob Frege: Über Sinn und Bedeutung, in ders.: Funktion, Begriff, Bedeutung, hrsg. von G. Patzig, Göttingen 1962, S. 32. Ein realistischer Wahrheitsbegriff, der unerkannte und möglicherweise unerkennbare Wahrheiten zulässt, steht für einige Autoren in engem Zusamenhang mit dem Bivalenzprinzip. Nach Dummett ist das Bivalenzprinzip das Signum des Realismus, und für Quine sind unerkennbare Wahrheiten der Preis für die Aufrechterhaltung der Zweiwertigkeit. Vgl. Michael Dummett: Truth and Other Enigmas, London 1978, S. 145- „Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder“ 87 Mit den „üblichen Verdächtigen“ meine ich vielmehr Gebilde, deren Wahrheitsfähigkeit in Frage steht, obwohl sie die Form grammatisch wohlgeformter Aussagesätze haben bzw. durch solche ausgedrückt werden.13 Folgende Phänomene gehören zu dieser Klasse: – Sätze mit nichterfüllten Präsuppositionen, beispielsweise Kennzeichnungen mit leeren Singulärtermen („Die gegenwärtige Königin von Italien ist blond“) – Paradoxe Sätze, darunter die semantischen Antinomien („Ich sage immer die Unwahrheit“) – Sätze mit Kategorienfehlern („Caesar ist eine Primzahl“) – Sätze über die kontingente Zukunft („Morgen wird eine Seeschlacht stattfinden“) – Sätze, die metaphorische Prädikationen enthalten – Sätze, die vage Ausdrücke enthalten – Moralische Urteile – Ästhetische Urteile – ? ? ? 14 Schnell wird klar, dass nicht alle Herausforderungen für das Bivalenzprinzip auch solche für das Nichtgraduierbarkeitsprinzip sind. Den meisten der Sorgenkinder wäre mit dem Zulassen von Wahrheitsgraden nicht geholfen. Sie verlangen andere Lösungen wie einen präzisierten Begriff der Wohlgeformtheit oder die Unterscheidung verschiedener Arten der Negation. Im Einzelnen und in der gebotenen Kürze: Sätze mit nichterfüllten Existenzpräsuppositionen werden von Russell als falsch angesehen, während sie für Frege und Strawson weder wahr noch falsch sind (Strawson: „The question does not arise“). In singulären Kennzeichnungen wird nach Russells Analyse die Existenz des gekennzeichneten Gegenstands mit ausgesagt, während Strawson und die an ihn anschließenden neueren linguistischen Präsuppositionstheorien das Präsupponieren vom Aussagen und Behaupten unterscheiden. Für kategorienfehlerhafte Prädikationen wird vorgeschlagen, sie in die Klasse der nicht wohlgeformten Sätze abzudrängen, die als nicht wahrheitsfähige nicht unter das Bivalenzprinzip fallen. Dafür ist ein Begriff der Wohlgeformtheit erforderlich, der über syntaktische Korrektheit hinausgeht. Ohnehin erscheint vielen Linguisten die scharfe Unterscheidung zwischen syntaktischer _____________ 13 14 165, bes. S. 155 (möglicherweise spricht Dummett an dieser Stelle auch vom Tertium non datur); W. v. O. Quine: What Price Bivalence?, in ders.: Theories and Things, Cambridge, Mass. 1981, S. 31-37, hier: S. 32. Das Schwanken zwischen „Satz“ und „Urteil“ in der Liste wird unten kommentiert. Weitere in jüngerer Zeit diskutierte Kandidaten sind Wahrscheinlichkeitsurteile, Wissenszuschreibungen und fiktionale Sätze. Geert Keil 88 und semantischer Korrektheit als eine Idealisierung. Chomsky hat „Grade der Grammatikalität“ vorgeschlagen, je nachdem, welche Subkategorisierungsund Selektionsregeln verletzt werden. Metaphern sind nach Goodman „kalkulierte Kategorienfehler“. Von vielen metaphorischen Sätzen wird man aber sagen müssen, dass sie in wörtlicher (Fehl-)Interpretation durchaus nicht kategorial absurd sind, sondern schlicht falsch, und dass erst ihre eklatante Falschheit Anlass dazu gibt, nach einer metaphorischen Interpretation zu suchen. Für den Absurditätsgrad spielt offenbar der kategoriale Abstand zwischen Subjekt- und Prädikatausdruck eine Rolle. Dieser ist bei „Caesar ist eine Primzahl“ größer als bei „Fritz ist ein Fuchs“ oder bei „Alle Männer sind Schweine“. Deshalb hebt beim Caesar-Satz die Negation „Caesar ist keine Primzahl“ die kategoriale Absurdität nicht auf, während „Fritz ist kein Fuchs“ in wörtlicher Interpretation schlicht wahr ist. Ob der kommunikative Erfolg metaphorischer Äußerungen zur Annahme einer eigenen „metaphorischen Wahrheit“ nötigt, ist umstritten. Wenn man wie Goodman eine metaphorische Wahrheit annimmt, erscheinen Metaphern als ein Spezialfall von Ambiguität: Mit einem und demselben Satz („Alle Männer sind Schweine“) wird in wörtlicher Interpretation eine trivial falsche, in metaphorischer Interpretation eine in ihrem Wahrheitswert zumindest umstrittene Aussage gemacht. Dagegen schlagen pragmatische Metapherntheorien metaphorische Äußerungen den indirekten Mitteilungen zu und suchen ihren kommunikativen Erfolg durch einen Griceschen Mechanismus zu erklären. Für die semantischen Antinomien erscheint das Verfahren des Abdrängens in den Bereich der syntaktisch oder semantisch nicht wohlgeformten Sätze wenig aussichtsreich. Ein Satz wie »Ich sage immer die Unwahrheit« ist nicht nur auf den ersten Blick, sondern auch auf den zweiten noch wohlgeformt. Durch Typentheorien werden antinomieerzeugende Prädikationen verboten, doch diesem Zug wird mit Recht entgegengehalten, dass das gewöhnliche Wahrheitsprädikat den Lügnersatz nun einmal zulässt. Spätestens an dieser Stelle müssen wir uns der bisher ignorierten Frage der Wahrheitswertträger zuwenden: Von was für Gebilden sagt man überhaupt, dass sie wahr oder falsch sind? In der Liste der Sorgenkinder war mehrheitlich von Sätzen die Rede, aber vieles spricht dafür, nicht Sätze, sondern das jeweils mit ihnen Ausgesagte als Wahrheitswertträger anzusehen, also die ausgedrückte Proposition. Für den terminus technicus „Proposition“ halten weder die deutsche noch die englische Sprache ein unzweideutiges Äquivalent bereit. Frege spricht eigenwillig von „Gedanken“, Künne behilft sich mit „thinkables and sayables“.15 _____________ 15 Vgl. Künne: Conceptions of Truth, a. a. O., bes. S. 249-269. „Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder“ 89 Zwei einschlägige Argumente für Propositionen als primäre Wahrheitswertträger sind, dass man mit zwei verschiedenen Sätzen ein und dieselbe Wahrheit ausdrücken kann, so mit einem deutschen Satz und seiner englischen Übersetzung. Umgekehrt kann ein und derselbe Satz, wenn er indexikalische Ausdrücke enthält, bei zwei verschiedenen Gelegenheiten verwendet werden, um einmal etwas Wahres, ein andermal etwas Falsches zu sagen. Wenn man nun statt den Satz das mit ihm jeweils Ausgesagte als Wahrheitswertträger ansieht, wird man von einigen unserer Sorgenkinder sagen können, dass der fragliche Satz gar keine Proposition ausdrückt: nichts, was Wahrheitsbedingungen hätte, keine mögliche Weise, wie die Dinge sich verhalten. Es ist vorgeschlagen worden, diese Überlegung auch auf die semantischen Antinomien anzuwenden. Dass in den meisten Einträgen der Liste aus Traditionsgründen von Sätzen die Rede war, ist also kein Plädoyer dafür, Sätze als Wahrheitswertträger anzusehen. Vielmehr scheint für einige der aufgelisteten Phänomene zu gelten, dass sie nur solange Sorgenkinder sind, als man sie als Sätze auffasst. Offenbar sind nicht alle Sätze geeignet, eine Proposition und damit etwas Wahrheitsfähiges auszudrücken. Was aber kein Wahrheitswertträger ist, ist auch keine Herausforderung für das Bivalenz- und das Nichtabstufbarkeitsprinzip. Bei den kontingenten Wahrheiten über die Zukunft gibt es eine zusätzliche Komplikation, die allein durch die Wahl von Propositionen als Wahrheitswertträger nicht ausgeräumt wird. Die Frage, ob es „jetzt schon“ wahr sei, dass morgen eine Seeschlacht stattfindet, unterstellt, dass Wahrsein eine in der Zeit erwerb- oder verlierbare Eigenschaft von Propositionen ist. Diese Unterstellung könnte falsch sein. Dem Eternalismus zufolge ist Wahrsein eine unverlierbare Eigenschaft von Propositionen. Was sich mit der Zeit wandelt, seien Kenntnis oder Behauptbarkeit, aber nicht die Wahrheit der Proposition. Ein Eternalist sollte deshalb Fragen nach „jetzt schon“ oder „noch nicht“ Wahrem nicht zu beantworten suchen, sondern kühlen Blutes als kategorial verwirrt zurückweisen. Zeitindikatoren können Äußerungen qualifizieren, aber keine Wahrheitswertträger. Moralische Urteile werfen für das Bivalenzprinzip nur dann Probleme auf, wenn der moralische Realismus falsch ist. Realisten halten moralische Urteile schlicht für wahrheitsfähig. Alternativen dazu sind der Emotivismus und der Expressivismus (solche Urteile brächten Gefühle oder subjektive Einstellungen zum Ausdruck), der Präskriptivismus (sie beschrieben nicht, sondern empföhlen Handlungen) und der moralische Relativismus (ihr Wahrheitswert variiere mit Sprecher und Kontext). Die relativistische Lösung wird auch für ästhetische Urteile vorgeschlagen. Für Geschmacksurteile mit geringem kognitiven Gehalt bietet sich der Phänomenalismus als Alternative an, demzu- Geert Keil 90 folge das Geschmacksurteil „Rhabarber schmeckt gut“ elliptisch für „Rhabarber schmeckt mir gut“ verwendet wird. Natürlich gibt es für alle hier angedeuteten Lösungen Alternativvorschläge. Was als Herausforderung für das Nichtabstufbarkeitsprinzip in jedem Fall übrig bleiben wird, ist das Phänomen der semantischen Vagheit. Viele Prädikate der natürlichen Sprache sind vage, lassen also Grenzfälle zu. Wie viele Sandkörner bilden einen Haufen, wie viele Resthaare darf jemand haben, um als glatzköpfig zu zählen, wo geht rot in orange über? Liegt es nicht überaus nahe, angesichts eines Grenzfalls von „Haufen“ die Aussage „Dies ist ein Sandhaufen“ nur halbwahr, approximativ wahr oder mit Abstrichen wahr zu nennen? Der Klärung dieser Frage dient der Rest des Beitrags. Freges Einwand gegen graduale Wahrheit Zunächst ist noch Freges Begründung dafür nachzureichen, dass das Wahrheitsprädikat kein Mehr oder Minder zulasse. Sie findet sich in der folgenden berühmten Passage aus „Der Gedanke“: [W]as nur halb wahr ist, ist unwahr. Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder. Oder doch? Kann man nicht festsetzen, daß Wahrheit bestehe, wenn die Übereinstimmung in einer gewissen Hinsicht stattfinde? Aber in welcher? Was müßten wir dann aber tun, um zu entscheiden, ob etwas wahr wäre? Wir müßten untersuchen, ob es wahr wäre, daß – etwa eine Vorstellung und ein Wirkliches – in der festgesetzten Hinsicht übereinstimmten. Und damit ständen wir wieder vor einer Frage derselben Art, und das Spiel könnte von neuem beginnen. So scheitert dieser Versuch, die Wahrheit als eine Übereinstimmung zu erklären. So scheitert aber auch jeder andere Versuch, das Wahrsein zu definieren. Denn in einer Definition gäbe man gewisse Merkmale an. Und bei einer Anwendung auf einen besonderen Fall käme es dann immer darauf an, ob es wahr wäre, daß diese Merkmale zuträfen. So drehte man sich im Kreise.16 Frege kommt es in dieser Passage auf mehrere Dinge an. Er behauptet (i), dass es mehr oder minder Wahres nicht geben könne, dass (ii) die Rede von partieller oder aspektueller Übereinstimmung und (iii) letztlich von Übereinstimmung überhaupt unbrauchbar sei, dass (iv) das Wahrheitsprädikat schlechterdings undefinierbar sei, was er (v) mit einem Regress- oder Zirkelargument zu erweisen sucht. Zu jeder dieser Behauptungen gibt es eine ausgedehnte Literatur. Es ist nicht ganz klar, wie in der zitierten Passage die Ablehnung von Wahrheitsgraden mit der Kritik am Kriterium der „Übereinstimmung in einer gewissen Hinsicht“ zusammenhängt. Um beim Thema zu bleiben, hätte Frege _____________ 16 Gottlob Frege: Der Gedanke. Eine logische Untersuchung [1918], a.a.O., S. 30-53, hier: S. 32. „Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder“ 91 von einer annähernden Übereinstimmung sprechen müssen. Im Umkreis der zitierten Passage findet sich ein Hinweis. Frege stellt dort der Aussagenwahrheit die bildliche Darstellung gegenüber, bei der man durchaus von einer größeren oder geringeren Übereinstimmung, Ähnlichkeit oder Wiedergabetreue sprechen kann.17 Aber Wiedergabetreue ist eben nicht Wahrheit. Bilder machen keine Aussagen und können deshalb, beiseite bemerkt, auch nicht lügen. Bilder können falsche Überzeugungen induzieren, aber sie tun es nicht dadurch, dass sie falsche Aussagen machen. Damit ist nicht gesagt, dass die abstufbaren Eigenschaften der Wiedergabetreue und der Ähnlichkeit keinerlei Analogon auf der Seite sprachlicher Repräsentationen hätten. Auch wenn eine Aussage nicht mehr oder minder wahr sein kann, scheinen sich doch ihr Informationsgehalt und ihre Genauigkeit abstufen zu lassen. An anderer Stelle habe ich dazu einen Vorschlag gemacht, der auf einer Übertragung der Eigenschaft des optischen Auflösungsvermögens auf sprachliche Repräsentationen beruht.18 Freges Hauptargument gegen die Definierbarkeit von Wahrheit als partieller oder aspektueller Übereinstimmung besteht darin, dass er den Verfechter eines solchen Wahrheitsbegriffs in einen Regress verwickelt. Er gesteht ihm um des Argumentes willen einen Begriff der Wahrheit als „Übereinstimmung in einer gewissen Hinsicht“ zu und wendet ein, dass man dann wiederum entscheiden müsse, ob die Übereinstimmung in der fraglichen Hinsicht besteht. Dies wäre aber wieder eine Entweder-oder-Frage, denn man möchte _____________ 17 18 Vgl. ebd., S. 33. Wie Bilder lassen sich auch geometrische Figuren nach dem Grad ihrer Ähnlichkeit vergleichen. Diesen Umstand nutzt der Wissenschaftstheoretiker Peter Smith, um der Rede von der „approximativen Wahrheit“ einen physikalischen Sinn abzugewinnen. Es gelte: „a dynamical theory is approximately true just if the modelling geometric structure approximates (in suitable respects) to the structure of the modelled: a basic case is where trajectories in the model closely track trajectories encoding physical real behaviors.” Eine entsprechende physikalische Theorie ist also annähernd wahr, wenn die berechnete Kurve nahe an der tatsächlichen Bahnkurve liegt; vollständige Wahrheit wäre Kongruenz beider Kurven. Peter Smith: Approximate Truth, in: ders.: Explaining Chaos, Cambridge 1998, S. 71-90, hier: S. 73. Den Begriff der „partial truth“ verteidigen mit wissenschafts- und modelltheoretischen Argumenten Newton C. A. da Costa und Steven French (Science and Partial Truth. A Unitary Approach to Models and Scientific Reasoning, Oxford-New York 2003). Wissenschaftliche Überzeugungen als „partially true only” anzusehen, so die Autoren, „fully captures the vagueness, uncertainty, and fallibility of a scientist’s doxastic attitude” (S. 77). Wie schon die heterogene Konjunktion „vagueness, uncertainty, and fallibility“ vermuten lässt, bleibt im Plädoyer von Costa und French wahrheits- und bedeutungstheoretisch vieles im Vagen und im Argen. Wenn der Grundschullehrer im Unterricht den Satz „Frankreich ist sechseckig“ äußert, legt er einen niedrigen Auflösungsgrad des Prädikats „sechseckig“ zugrunde. Nur deshalb kann er mit dem Satz etwas Wahres sagen. Vgl. Keil: Über die deskriptive Unerschöpflichkeit der Einzeldinge, in: G. Keil / U. Tietz (eds.): Phänomenologie und Sprachanalyse, Paderborn 2005, S. 83-125, hier: S. 99-104. Geert Keil 92 ja wissen, so Frege, „ob es wahr wäre“, dass die besagte Übereinstimmung vorliegt. Freges Einwand ist in Aristoteles’ Argument für den Satz vom ausgeschlossenen Dritten vorgebildet. Im Buch Gamma der Metaphysik führt Aristoteles als einen Grund dafür, dass es „das Mittlere zwischen den beiden Gliedern des Widerspruches“ nicht geben kann, an, dass man dann ja das Mittlere selbst wieder bejahen oder verneinen können müsste, und das müsste „ins Unendliche fortgehen“, so dass man am Ende „nicht nur das Anderthalbfache der seienden Dinge erhalten würde [sc. neben dem Wahren und dem Falschen noch das Mittlere], sondern noch mehr“.19 Der Regresseinwand20 ist für unseren Zusammenhang einschlägig. Er lässt sich auch gegen die Idee einer approximativen Wahrheit ins Feld führen: Es soll also annähernd wahr sein, dass etwas sich so und so verhält. Ist das nun wenigstens wahr, dass es annähernd wahr ist, oder ist es wieder nur annähernd wahr? Führt man in der Objektsprache Wahrheitsgrade oder -approximationen ein, so braucht man in der Metasprache ein sprachliches Mittel, um deren Bestehen zu behaupten.21 Früher oder später, so scheint es, brauchen wir ein Wahrsein simpliciter, eben einen nichtgradualen Wahrheitsbegriff – eher früher als später, denn die natürliche Sprache zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie ihre eigene Metasprache enthält. Leider verschwinden durch dieses bestechend einfache Argument die Phänomene nicht, denen die Annahme von Wahrheitsgraden Rechnung tragen soll. Das einschlägigste dieser Phänomene ist das der semantischen Vagheit.22 _____________ 19 20 21 22 Aristoteles: Metaphysik IV, 7, 1011b S. 29-30 und 1012a S. 9-15. In der Frege-Philologie gibt es eine subtile Debatte darüber, ob Frege seinem Gegner an dieser Stelle einen Regress oder einen Zirkel vorwirft. Zum Überblick vgl. Ulrich Pardey: Freges Kritik an der Korrespondenztheorie der Wahrheit, Paderborn 2004; sowie Künne: Conceptions of Truth, a. a. O., S. 129-133. Diese Überlegung entspricht allerdings nicht mehr ganz Freges Argument. Für Freges Regresseinwand scheint weniger die Nichtgradierbarkeit als vielmehr die Primitivität des Wahrheitsprädikats entscheidend zu sein, also dessen Zutreffen unabhängig von definierenden relationalen Merkmalen. In folgender Präzisierung bin ich Christian Nimtz verpflichtet: Frege argumentiert in der zitierten Passage gegen drei Varianten der Korrespondenztheorie, (a) gegen vollkommene Übereinstimmung, (b) gegen Übereinstimmung in einem bestimmten Grade, (c) gegen Übereinstimmung in einer bestimmten Hinsicht. Gegen (a) argumentiert Frege, dass vollkommene Übereinstimmung Identität impliziere, gegen (b), dass die Wahrheit kein Mehr oder Minder vertrage, gegen (c) mit dem Zirkel- oder Regressargument, das er zu einem Argument gegen die Definierbarkeit des Wahrheitsprädikats überhaupt ausbaut. Die folgenden Überlegungen sind genauer ausgeführt in meinem parallel erscheinenden Aufsatz: Halbglatzen statt Halbwahrheiten. Über Vagheit, Wahrheits- und Auflösungsgrade, in: Adolf Rami (ed.): Realismus, Wahrheit und Existenz, Heusenstamm 2010. „Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder“ 93 Warum semantische Vagheit keine Wahrheitsgrade erfordert Ein vages Prädikat, so heißt es, zieht keine scharfe Grenze zwischen den Dingen, auf die es zutrifft und denen, auf die es nicht zutrifft. Es lässt Grenzfälle zu. Wie viele Resthaare darf jemand haben und wo, um als „glatzköpfig“ zu gelten, wo geht „rot“ in „orange“ über, wo verläuft die Grenze zwischen „gesund“ und „krank“, wann ist jemand „groß“? Semantische Vagheit ist nicht nur ein notorisches Problem für das Bivalenzprinzip, sondern auch für das Prinzip, dass die Wahrheit kein Mehr oder Minder verträgt. Vagheit ist dasjenige unter unseren Sorgenkindern, für das ein graduales Wahrheitsprädikat am ehesten Abhilfe verspricht. Wenn man zeigen könnte, dass nicht einmal das Phänomen der Vagheit Wahrheitsgrade erfordert, hätte man etwas Interessantes gezeigt. Aus der Perspektive des Sprechers äußert sich semantische Vagheit in der Unsicherheit, in welchen Fällen das Prädikat anzuwenden ist und in welchen nicht. Als definierendes Merkmal von Vagheit gilt weiterhin, dass diese Unsicherheit nicht durch Kenntnis empirischer Tatsachen beseitigt werden kann. Dies drückt die vielzitierte Arbeitsdefinition von Grice aus: To say that an expression is vague […] is presumably, roughly speaking, to say that there are cases (actual or possible) in which one just does not know whether to apply the expression or to withhold it, and one’s not knowing is not due to ignorance of the facts.23 Unter „Vagheit“ verstehe ich hier die Randbereichsunschärfe von Prädikaten, also diejenige semantische Unbestimmtheit, die das Sorites-Paradox erzeugt, indem sie die schrittweise Ausdehnung des Anwendungsbereichs eines Prädikats von unkontroversen Fällen über kontroverse bis hin zur Absurdität erlaubt oder zu erlauben scheint. Vagheit ist zunächst einmal ein unleugbares Phänomen. Viele, wenn nicht alle Prädikate der natürlichen Sprache sind in unterschiedlichem Ausmaß randbereichsunscharf. Das Phänomen der Vagheit wird unter bestimmten Bedingungen zum Problem. Freilich gibt es nicht das Vagheitsproblem, sondern eine ganze Reihe davon. Wenn im Folgenden vom Vagheitsproblem im Singular die Rede ist, meine ich die Herausforderung, die sich aus dem Phänomen der semantischen Vagheit für das Bivalenz- und/oder das Nichtgradierbarkeitsprinzip der Wahrheit ergibt. Frege behauptet in der zitierten Passage die Nichtgradierbarkeit ausschließlich für das Wahrheitsprädikat und nicht für die übrigen Prädikate einer Sprache. Andernorts fordert er allerdings, Begriffe müssten „scharf _____________ 23 H. P. Grice: Studies in the Ways of Words, Cambridge, Mass.-London 1989, S. 177. Geert Keil 94 begrenzt sein“.24 Unscharf begrenzte Begriffe würden nämlich über SoritesSchlüsse die Herleitung von Falschem erlauben. Anders gewendet: Nur auf scharf begrenzte Begriffe ließen sich die logischen Gesetze überhaupt anwenden. Noch anders gewendet: „Das Gesetz des ausgeschlossenen Dritten ist ja eigentlich nur in anderer Form die Forderung, dass der Begriff scharf begrenzt sei.“25 Eine unscharfe Begriffsgrenze ist nach Frege überhaupt keine Grenze, ein unscharf begrenzter Begriff strenggenommen kein Begriff. Wittgenstein hat dem widersprochen und sinngemäß kommentiert, dass wir die Grenzen jeweils so scharf zögen wie für den Kommunikationszweck erforderlich.26 Doch vielleicht gibt es eine Möglichkeit, beiden Recht zu geben, Frege hinsichtlich des Wahrheitsprädikats und Wittgenstein hinsichtlich seines Lobs der semantischen Unschärfe. Ich behaupte, dass man das nichtabstufbare Wahrheitsprädikat und das Bivalenzprinzip verteidigen kann, ohne zu leugnen, dass es allgemein gute Gründe für die Gradierung von Prädikaten geben mag. Am Beispiel des Sandhaufens: Man kann die Unsicherheit, ob „Sieben Sandkörner bilden einen Haufen“ wahr ist, entweder dem Begriff des Haufens anlasten oder dem der Wahrheit. Vernünftigerweise wird man ersteres tun, aber jedenfalls nicht beides zugleich. Es wäre widersinnig, das Problem der Vagheit an beiden Fronten zugleich anzugehen, also durch eine Semantik, die unscharfe oder gradierte Prädikatausdrücke zulässt und durch die Rede von „annähernd“, „ein bisschen“ oder „ziemlich“ wahren Aussagen. Es besteht hier nachgerade ein inverser Zusammenhang: Je mehr Abstufungen oder semantische Unschärfe wir in den restlichen Prädikaten einer Sprache zulassen, desto weniger sind wir genötigt, am Wahrheitsprädikat zu manipulieren. Das ist ein Vorteil, denn früher oder später brauchen wir, wie die Argumente von Aristoteles und Frege zeigen, einen kategorischen Begriff des Wahrseins oder des Zutreffens auf etwas. Den Regresseinwand gegen die Abstufung des Wahrseins einer Aussage oder des Zutreffens eines Prädikats möchte ich noch einmal auf eigene Rechnung paraphrasieren: Wenn auch nur die Fragen sinnvoll bleiben sollen, ob eine Aussage wahr ist oder ob ein Prädikat auf einen Gegenstand zutrifft, dann darf man nicht zugleich die Begriffe des Wahrseins und des Zutreffens selbst gradieren. Man darf an der Intension von „Wahrsein“ und „Zutreffen“ nicht herumbasteln, um im Einzelfall deren Extension problematisieren zu können, d.h. um die Frage, ob ein vages Prädikat auf einen gegebenen Fall zutrifft oder nicht, sinnvoll stellen zu können. _____________ 24 25 26 Vgl. Gottlob Frege: Grundgesetze der Arithmetik II, a. a. O., S. 69 (§ 56); vgl. §§ 57-58, 62 und 65. Ebd., S. 69 (§ 56). Vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, in: ders.: Schriften Bd. 1, a.a.O., §§ 68-79. „Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder“ 95 Verfechter mehrwertiger Logiken sehen es anders, denn sie nehmen Zutreffens- oder Wahrheitsgrade an. Mehrwertige Logiken und Semantiken sind ein naheliegender Vorschlag zum Umgang mit dem Vagheitsproblem. Nun liegt es auf der Hand, dass die bloße Einführung eines dritten Wahrheitswerts für das Vagheitsproblem nur einen bescheidenen Fortschritt darstellt. Weist man Grenzfällen den Wahrheitswert „unbestimmt“, „halbwahr“ o. ä. zu, so ergibt sich das Problem der höherstufigen Vagheit. Schon die vortheoretische Rede von Grenzfällen und Grau- oder Übergangszonen wirft dieses Problem auf. Führt man zwischen den Prädikaten „rot“ und „gelb“ oder zwischen „rot“ und „orange“ eine Übergangszone ein, so stellt sich die Frage, wo genau sie beginnt und endet. Auch die Extensionen der Prädikate „Grenzfall“ und „Grauzone“ scheinen unscharf begrenzt zu sein. Das bedeutet aber, dass das ursprüngliche Problem vervielfacht wird, denn mit der Frage, wo die Grauzone beginnt und wo sie endet, sind zwei Abgrenzungsprobleme entstanden, wo zuvor nur eines war. Sainsbury kommentiert den Zug des Einführens von Grenzfällen treffend: „You do not improve a bad idea by iterating it“.27 Besser geeignet erscheinen mehrwertige Logiken, die nicht drei, sondern unbegrenzt viele Wahrheitswerte annehmen. Das bekannteste Beispiel ist die von Zadeh 1965 vorgeschlagene „fuzzy logic“, die die beiden Wahrheitswerte „wahr“ und „falsch“ durch ein Spektrum von Graden des Wahrseins bzw. des Zutreffens von Prädikaten ersetzt.28 Motivieren lassen sich unendlichwertige Logiken durch den Umstand, dass es zwischen Rot und Orange oder zwischen schütterem und vollem Haar kontinuierliche Übergänge gibt. Auf den zweiten Blick hat die Modellierung kontinuierlicher Übergänge durch fein abgestufte Wahrheitswerte große Nachteile. Ist es wirklich eine gute Idee, einer Aussage wie „Peter hat volles Haar“ einen Wahrheitswert von beispielsweise 0,43 zuzuschreiben? Ein einschlägiger Einwand besagt, dass solche Wahrheitswertzuweisungen eine Scheingenauigkeit erzeugen, die über alle verfügbaren Belege und Sprecherüberzeugungen hinausgeht. Pinkal nennt dies das „Problem der intuitiv unhaltbaren Überpräzisierung“: „Wie soll man entscheiden, ob ein bestimmter – einfacher oder komplexer – Satz 0.72 oder 0.73 oder auch 0.82 ‚wahr’ ist?“29 Kein Sprecher kann für typische Fälle vager Prädikationen die genauen Zutreffens- oder Wahrheitsgrade angeben. Tut er es dennoch, haben die Zuweisungen etwas Beliebiges. Mit Blick auf dieses Problem hat Ulrich Blau sein „Vagheitsdilemma“ formuliert: „Wollen wir die klassische Logik anwenden, so sind wir zu einem unsinnig scharfen Schnitt gezwungen“; führen wir hingegen zwischen wahr und falsch weitere Wahrheits_____________ 27 28 29 Mark Sainsbury: Concepts Without Boundaries, in: R. Keefe / P. Smith (eds.): Vagueness. A Reader, Cambridge, MA 1996, S. 251-264, hier: S. 255. Lotfi A. Zadeh: Fuzzy Sets, in: Information and Control 8 (1965), S. 338-353. Pinkal: Logik und Lexikon, a. a. O., S. 133 und S. 132. 96 Geert Keil werte ein, so wird die Klassifikation immer schärfer und am Ende „zu scharf, also wieder willkürlich“.30 Summarische Urteile über die verschiedenen Reaktionen auf das Vagheitsproblem – Epistemizismus, mehrwertige Logiken, Kontextualismus, Supervaluationismus – verbieten sich hier. Wenn mit „dem Vagheitsproblem“ die Frage gemeint ist, an welcher Stelle einer Sorites-Schlusskette wir unser Urteil ändern und warum, helfen die sprachphilosophischen Standardtheorien der Vagheit nicht weiter. Keine von ihnen löst das Problem, dass sich auch für einen präzisierten Ausdruck stets wieder Grenzfälle finden lassen, also Gegenstände am Rand der Extension, auf die der Ausdruck weder eindeutig zutrifft noch eindeutig nicht zutrifft. Wer den Kern des Vagheitsproblems in der Nichteliminierbarkeit von Grenzfällen erblickt, wird vermutlich lange nach einer Lösung suchen. Grenzen ziehen, wo noch keine gezogen sind Die Frage, an welcher Stelle in einer Sorites-Reihe Zutreffen in Nichtzutreffen übergeht, ist keine gute Frage. Sie leistet dem semantizistischen Mythos Vorschub, Prädikate hätten für ihre eigene Anwendung zu sorgen. Schon die übliche Definition von Vagheit – vage Prädikate seien solche, die keine scharfe Grenze im Anwendungsbereich ziehen – befördert den Semantizismus. Geboten ist demgegenüber, von vornherein die Sprecher und ihre Fähigkeiten ins Spiel zu bringen. Die Prädikate ziehen keine scharfe Grenze? Das Grenzenziehen ist eine Leistung von Sprechern. Wir benutzen sprachliche Mittel, um bestimmte Unterscheidungen zu treffen, um auf Gegenstände Bezug zu nehmen oder sie allererst zu individuieren, um etwas von ihnen auszusagen und unsere Hörer das jeweils Ausgesagte erkennen zu lassen. Wie viele Sandkörner für einen Haufen erforderlich sind, wird durch das Prädikat „Haufen“ in der Tat nicht festgelegt. Dass der generelle Term „Haufen“ eine unscharf begrenzte Extension hat, hat zur Folge, dass er sprachrichtig zur Bezeichnung von Ansammlungen verschiedener Größe verwendet werden kann. Da nun Ansammlungen in beliebig feinen Abstufungen vorkommen können, wird früher oder später ein Fall eintreten, in dem ein Sprecher unsicher ist, ob eine fragliche Ansammlung noch unter das Prädikat „Haufen“ fällt. Was an dieser Unsicherheit misslich ist, versteht sich nicht von selbst. Misslich wäre, wenn aus ihr ein Verständigungsproblem erwüchse. Misslich wäre insbesondere, wenn die Unsicherheit die Ressourcen oder die Fähigkeit des Sprechers beeinträchtigte, seine Hörer das jeweils Gemeinte erkennen zu lassen. _____________ 30 Ulrich Blau: Die dreiwertige Logik der Sprache, Berlin 1978, S. 28. „Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder“ 97 Beziehen wir an dieser Stelle Wittgensteins pragmatische Einwände gegen Freges Forderung nach scharf begrenzten Begriffen ein: Frege vergleicht den Begriff mit einem Bezirk und sagt: einen unklar begrenzten Bezirk könne man überhaupt keinen Bezirk nennen. Das heißt wohl, wir können mit ihm nichts anfangen. – Aber ist es sinnlos zu sagen: »Halte dich ungefähr hier auf!«? Was ist noch ein Spiel und was ist keines mehr? Kannst Du die Grenzen angeben? Nein, Du kannst welche ziehen: denn es sind noch keine gezogen. (Aber das hat dich noch nie gestört, wenn du das Wort »Spiel« angewendet hast.) Wie gesagt, wir können – für einen besonderen Zweck – eine Grenze ziehen. Machen wir dadurch den Begriff erst brauchbar? Durchaus nicht! Es sei denn, für diesen besonderen Zweck.31 Hervorhebung verdienen die letzten vier Worte: Wir können für einen besonderen Zweck eine Grenze ziehen, wo noch keine gezogen war. Brauchbar war der Ausdruck schon als unscharf begrenzter. Dass das Grenzenziehen eine menschliche Tätigkeit ist und also uns Sprechern obliegt, ist eine hilfreiche Erinnerung wider den semantizistischen Mythos. Es bedeutet aber nicht, dass vorab überhaupt noch keine Grenzen gezogen wären. Eine Entgegensetzung von durch die Sprache selbst und durch Sprecher gezogenen Grenzen wäre irreführend, denn der Zustand einer natürlichen Sprache geht auf kollektive Leistungen früherer Sprechergemeinschaften zurück. Der sprachliche Sinn von Prädikaten, wie er in Bedeutungswörterbüchern erläutert wird, ist ein geronnenes Ergebnis ungezählter vergangener kommunikativer Handlungen. Dieses Ergebnis limitiert, was wir mit unseren Worten meinen können. Ein Sprecher kann seine Worte nicht Beliebiges bedeuten lassen. Allerdings schießt nicht nur Humpty Dumpty über das Ziel hinaus, sondern auch seine sich auf Wittgenstein berufenden konventionalistischen Kritiker. „Rot“ zu sagen und „blau“ damit zu meinen ist nicht ganz einfach, doch in besonderen Kontexten mag es mithilfe flankierender Maßnahmen gelingen. Wenn die semantische Vagheit von Prädikaten zu Verständigungsproblemen zu führen droht, kann der Sprecher die Grenzen „für diesen besonderen Zweck“ schärfen. Diese Operation der semantischen Schärfung wird in Supervaluationstheorien der Vagheit sowie in der linguistischen „Präzisierungssemantik“32 beschrieben. Was in einer gegebenen Verwendungssituation vom Sprecher geschärft wird, ist allerdings nicht der sprachliche Sinn des fraglichen Ausdrucks. Der Sinn (die lexikalische Bedeutung) beispielsweise des Wortes „Haufen“ bleibt unverändert und steht in anderen Kontexten weiterhin für abweichende Präzisierungen oder für gewünscht unscharfe Verwendungen zur Verfügung. _____________ 31 32 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a. a. O., § 71, 68 und 69. Vgl. Pinkal: Logik und Lexikon, a. a. O., S. 160-206. Geert Keil 98 Entsprechende Kontextwechsel können sich blitzschnell vollziehen. Ein Beispiel: Während einer Operation gibt der Chirurg das Skalpell mit der Bemerkung „Stumpf!“ an seinen Assistenten zurück. Der Assistent reicht das Messer an die OP-Schwester weiter und sagt „Vorsicht, scharf!“33 Beide Sprecher mögen Recht haben. Binnen Sekunden hat eine Kontextverschiebung stattgefunden, die den zugrunde gelegten Auflösungsgrad der Prädikate „stumpf“ und „scharf“ verändert hat. Ein Instrument, das nicht scharf genug zum Operieren ist, kann immer noch scharf genug sein, um sich daran zu verletzen. Durch die Berücksichtigung des Auflösungsparameters lässt sich erklären, warum die Vagheit von Prädikaten die Wahrheitsfähigkeit vieler Aussagen, die mithilfe dieser Prädikate gemacht werden, nicht gefährdet. So vage die generellen Terme „scharf“ und „stumpf“ auch immer sein mögen, die jeweiligen Adressaten sind im gegebenen Fall durchaus in der Lage, die beiden Wahrheiten zu erkennen, die der Chirurg und sein Assistent ihnen mit den Stummelsätzen „Stumpf!“ und „Vorsicht, scharf!“ mitgeteilt haben. Sprecher verfügen über mannigfache Mittel, Prädikate wie „Haufen“, „scharf“ oder „Glatze“ zu präzisieren oder zu gradieren. Wir können den Grad des Haarverlustes einer Person so genau charakterisieren, wie es jeweils nötig ist. Manchmal führen wir ein neues Prädikat ein, zum Beispiel „Halbglatze“. Wenn die verfügbaren Prädikate nicht ausreichen und es zu aufwendig erscheint, ad hoc neue einzuführen, gibt es eine weitere Methode der Wahl, nämlich das Bilden komparativer Prädikate wie „größer als“ oder „mehr als“. Zwei Sandhaufen oder Haaransammlungen lassen sich nach dem Mehr oder Weniger ordnen, und diese Ordnung ist eine bestimmte, eindeutige, selbst wenn die Ansammlungen sich nur um ein einziges Element unterscheiden. Wir können als ultima ratio beide Ansammlungen zählen, und es ist dann wahr simpliciter und nicht cum grano salis, dass die eine Ansammlung, sei sie ein Haufen oder nicht, größer ist als die andere. Zumindest in einigen Fällen scheint es also gerade die Möglichkeit des expliziten, gegebenenfalls numerischen oder metrischen Gradierens von Prädikaten zu sein, die ein nichtgraduales Wahrheitsprädikat zu bewahren und die Rede von approximativ wahren Aussagen zu vermeiden hilft. In nuce: Da es Halbglatzen gibt, muss es nicht auch noch Halbwahrheiten geben. Das Grenzenziehen ist eine Leistung von Sprechern und das gegebenenfalls erforderliche Präzisieren ebenfalls. Kein Bedeutungswörterbuch und keine Bedeutungstheorie kann Sprachbenutzern diese Leistungen abnehmen. An diesen Umstand zu erinnern ändert nichts am Phänomen der Vagheit, hilft aber bei der Eingrenzung der daraus entstehenden Probleme. In einer natür_____________ 33 Das Beispiel stammt von Crispin Wright: Intuitionism, Realism, Relativism and Rhubarb, in: P. Greenough / M. P. Lynch (eds.): Truth and Realism, Oxford 2006, S. 38-60, hier: S. 53. „Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder“ 99 lichen Sprache können Sprecher beliebig viele und beliebig feine semantische Unterscheidungen treffen.34 Wir können stets noch spezifischer werden, wenn es darauf ankommt. Dabei wird die erreichbare Genauigkeit einer Beschreibung durch den Umstand, dass die verwendete Sprache vage Prädikate enthält, nicht vermindert. Wenn es darauf ankommt, können Sprecher zwei Sandansammlungen, die nur um ein einziges Korn differieren, voneinander unterscheiden, denn Körner lassen sich zählen. Aber meistens kommt es nicht darauf an, und darum bleibt der Ausdruck „Haufen“ brauchbar. Bei all dem kann das Wahrheitsprädikat zweiwertig bleiben, feiner abgestuft oder höher aufgelöst werden im Bedarfsfall allein die restlichen Prädikate. Das bivalenzskeptische Motiv, dass die bunte und unermesslich fein abgestufte Vielfalt des Seienden in verpixelten Schwarzweißbildern nur unvollkommen repräsentiert wird, verdient Sympathie. Nur haben die Freunde der Wahrheitsgrade das falsche Mittel gewählt. Es ist nichts gegen die Rede einzuwenden, dass eine präzisere oder höher aufgelöste sprachliche Darstellung eine Welt größeren Detailreichtums erschließt oder uns mehr von der Welt erkennen lässt. Wahrer werden unsere Aussagen dadurch nicht. Die Wahrheit verträgt kein Mehr oder Minder.35 _____________ 34 35 Vgl. dazu Andreas Kemmerling: The Philosophical Significance of a Shared Language, in: Ralf Stoecker (ed.): Reflecting Davidson, Berlin-New York 1993, S. 85-116, hier: S. 105 f. Hans Julius Schneider wird nicht entgangen sein, dass auch dieser Beitrag eine religionsphilosophische Implikation besitzt. Mir ist sie durch ein Aperçu von Matthias Beltz deutlich geworden: „Die einen sagen, dass Gott existiert, die andern, dass Gott nicht existiert. Die Wahrheit wird, wie so oft, in der Mitte liegen.“ Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang Wittgensteins grammatische Methode als Verfahren experimentellen Denkens1 Birgit Griesecke / Werner Kogge 1. Triste Therapie – Wittgenstein im New Wittgenstein In den Jahren seiner Umorientierung von der logischen Architektonik des Tractatus zum grammatischen Sprachspieldenken der Philosophischen Untersuchungen äußert Wittgenstein, dass die Philosophie, so wie er sie jetzt vorführe, nicht einfach ein weiteres Stadium im Rahmen einer „stetigen Fortentwicklung“2 sei, sondern ein „Knick“ in der „Entwicklung des menschlichen Denkens“, vergleichbar dem, was geschah, als Galileo die Dynamik ersann oder aus der Alchemie die Chemie zum Vorschein kam: Eine „neue Methode“ sei gefunden worden, und „geschickte Philosophen“ könnten nun – so gut wie „geschickte Chemiker in ihrem Metier“ – (s)eine Methode zur Anwendung bringen. Bemerkenswert in dieser Einlassung vor seinen Studenten und Kollegen in Cambridge ist das Zusammenspiel eines eminenten Selbstbewusstseins, mit dem hier eine sich gerade erst entwickelnde Methode als philosophische Methode in die Reihe bedeutender wissenschaftlicher Umwälzungen eingeschrieben wird, mit der Rede von einem „Knick“ (nicht von einem Sprung oder einer Revolution), die fast konterkarierend wirken könnte. Wie ist das zu verstehen? ‚Geknickt’ wird der Nimbus hochindividuellen genialischen Denkens, das den tiefsten Beunruhigungen und Verwirrungen der Menschen mit der philosophischen Suche nach den tiefsten Gründen zu begegnen trachtet; ‚geschickt’ („skilful“) wird eine methodisch erneuerte Philosophie daran gehen können, _____________ 1 2 Es handelt sich um die aktualisierte Fassung eines im August 2005 fertiggestellten Textes. Dieses und die folgenden Zitate stammen aus einem Referat über Wittgensteins Vorlesungen, das George E. Moore auf Grundlage seiner Mitschriften angefertigt hat: George E. Moore: Wittgenstein’s Lectures in 1930-33, in: ders.: Philosophical Papers, London 1959, S. 252-324, hier S. 322. Vgl. dazu auch: P.M.S. Hacker: Wittgenstein im Kontext der analytischen Philosophie, Frankfurt a. M. 1997, S. 162. Birgit Griesecke / Werner Kogge 102 begriffliche Konfusionen in Ordnung zu bringen und auf diesem Weg die durch falsche Fragestellungen, metaphysische Hoffnungen, fahrlässige Terminologie entstandenen Beunruhigungen zu kurieren. Dass diese durchgreifende Tätigkeit des Aufräumens eine methodisch angeleitete ist, bricht nicht nur mit der herkömmlichen philosophischen Exklusivität, sondern auch mit der zählebigen Idee, dass die Philosophie – von Anmaßung getrieben, von Selbstzweifeln gepeitscht – wenn sie nur ausdauernd genug nach den letzten Dingen sucht, diese eines Tages auch in Letztgültigkeit vor uns hinstellen wird und damit ihre Aufgabe zufrieden stellend gelöst sein könnte. Die Philosophie, die Wittgenstein seit den frühen 1930er Jahren verficht, operiert offenbar nicht länger in diesem Horizont: Wenn sie sich ihrem Auftrag, die ganze Sprache zu „durchpflügen“3, stellt, so geht es nicht um eine vielleicht sehr langwierige, aber letztlich doch teleologisch motivierte Sinnsuche, „sondern es wird jetzt an Beispielen eine Methode gezeigt, und die Reihe dieser Beispiele kann man abbrechen/ kann abgebrochen werden.“4 „Kann abgebrochen werden“ heißt nicht: „wird an ihr Ende kommen“, sondern, dass es im Kreuz und Quer durch die Verstellungen der Sprache immer wieder andere, in sich begrenzbare Aufgabenfelder geben wird: Die Unruhe in der Philosophie kommt daher, daß die Philosophen die Philosophie falsch ansehen, falsch sehen, nämlich gleichsam in (unendliche) Längsstreifen zerlegt, statt in (endliche) Querstreifen. Diese Umstellung der Auffassung macht die größte Schwierigkeit. Sie wollen also gleichsam den unendlichen Streifen erfassen, und klagen, daß dies nicht Stück für Stück möglich ist“5 Der philosophische ‚Knick’ steht also offenbar für das Ende von philosophischen Höhen- oder Tiefflügen (eine Frage der Perspektive), für das Ende von „turbulenten Mutmaßungen und Erklärungen“6, und eben nicht für das Ende der Philosophie; die ‚neue Methode’ steht für eine immer wieder ansetzende Arbeit an sprachlichen Verwirrungen, nicht dafür, das Philosophische ein für allemal zu überwinden . Gerade dies jedoch, dass in Wittgensteins philosophische Arbeiten, in die vermeintliche Begrenztheit ihrer Aufgabenstellung, eine Selbstabschaffung der Philosophie eingeschrieben sein könnte, legen mehr oder minder offensiv die Interpretationen nahe, die das therapeutische Motiv in Wittgensteins Selbstdarstellung forcieren. Diese Deutungsrichtung, die sich unter dem Titel ‚New Wittgenstein’ um Cora Diamond und James Conant zu einer Art Schule formierte, aber auch außerhalb davon in den letzten Jahren an Boden gewon_____________ 3 4 5 6 Vgl. Ludwig Wittgenstein: The Big Typescript. Wiener Ausgabe Bd. 11, Wien 2000, S. 290. Ebd. Ebd. Ebd. Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 103 nen hat7, behauptet, dass Wittgensteins philosophisches Bemühen eigentlich nur darauf gerichtet gewesen sei, uns die Einsicht nahezubringen, dass Aussagen, zu denen wir in der Philosophie neigen, unsinnig sind, weil sie auf der illusorischen Annahme eines sprachexternen Standpunkts beruhen.8 Wittgensteins Methode bestünde demnach vornehmlich darin, uns die metaphysischen Sätze vorzuführen, so dass wir erkennen, dass sie nicht ausdrücken, was wir sagen wollen.9 Ziel dieser Methode sei folglich eine Form der Erkenntnis, die nur individuell zu vollziehen ist.10 Wir sollten die metaphysischen Sätze als Leiter benutzen, um über die Philosophie hinauszukommen. Somit gäbe es gar keinen wirklichen Bruch zwischen dem Früh- und dem Spätwerk Wittgensteins: „Vielmehr hätte“, so fasst Edward Kanterian die Position des New Wittgenstein zusammen, „Wittgenstein zeit seines Lebens an der Unsinnigkeit philosophischer Thesen festgehalten“.11 Manches an dieser Darstellung der Philosophie Wittgensteins ist richtig, aber trivial, anderes ganz und gar missverstanden. Sicherlich richtig ist, dass Wittgenstein in seinen Spätschriften gerade keine Art von Theorie aufstellen wollte und dass er jeglichen sprachexternen Standpunkt ablehnte (aber wer hat dem je widersprochen?). Doch diese konsequent immanente Haltung bedeutet gerade nicht, die philosophische Arbeit auf einen einzigen negativen Nachweis zu beschränken, der in gebetsmühlenartiger Wiederholung durchexerziert wird. Es bedeutet vielmehr, in der Sprache selbst den Sprachgebrauch auszulegen, um die Möglichkeiten, Grenzen und Verhältnisse der Verwendung von Worten offen zu legen. Mit dem Verzicht auf externe theoretische Aussagen und Standpunkte ist die philosophische Arbeit also nicht getan, sie fängt genau hier erst an. Die hunderte von Textpassagen, die Wittgenstein z.B. zum Thema Schmerz oder zum Thema Aspektsehen hinterlassen hat, zeugen von solcher Arbeit. An der ‚therapeutischen’ Deutung des New Wittgenstein frappiert besonders die Idee, dass es Wittgenstein in seinem ganzen Werk – vom Tractatus bis zu den Spätschriften – nur um ein einziges, negatives Ziel gegangen sein soll, _____________ 7 8 9 10 11 Vgl. etwa Gordon Baker: Wittgenstein’s Method and Psychoanalysis, in: Katherine J. Morris (ed.): Wittgenstein’s Method. Neglected Aspects. Essays on Wittgenstein by Gordon Baker, Malden-Oxford-Victoria 2004, S. 205-222. Vgl. Alice Crary: Introduction, in: Crary / Read (eds.): The new Wittgenstein, London-New York 2000, S. 1-18. Ebd., S. 7. Vgl. James Conant: Elucitation and Nonsense in Frege and Early Wittgenstein, in: The New Wittgenstein, a.a.O., S. 174-217, hier S. 197. Ders.: Two Conceptions of Die Überwindung der Metaphysik: Carnap and Early Wittgenstein, in: McCarthy / Stidd (eds.): Wittgenstein in America, New York 2001, S. 13-61. Ähnlich aber auch: Baker: Wittgenstein’s Method and Psychoanalysis, a.a.O., S. 213. Edward Kanterian: Timothy McCarthy/ Sean C. Stidd (Eds.): Wittgenstein in America, in: Philosophischer Literaturanzeiger 4/2002, S. 376-384, hier S. 377. 104 Birgit Griesecke / Werner Kogge nämlich, das Selbstmissverständnis der Philosophie aufzulösen. Es kann daher nicht verwundern, dass Peter Hacker, ein Philosoph, der sich an Themen wie Sprachspielen, Lebensformen, Regelfolgen seit Jahrzehnten abarbeitet, die Folgenlosigkeit einer solcher Argumentation beklagt: Suppose they are right – so what? What follows from this about the correct way to tackle philosophical problems in any domain of thought? Surely nothing whatsoever.12 Doch ‚nichts’ ist es nicht, was aus der Konzeption des ‚New Wittgenstein’ folgt. Denn, so die Argumentation Crarys, einen sprachexternen Standpunkt radikal aufzugeben, bedeute eben zugleich, dass es überhaupt keinen Standard der Richtigkeit sprachlicher Ausdrücke gebe – auch keinen sprachspielrelativen. Diejenigen, die den späten Wittgenstein in die Nähe relativistischer Positionen rücken wollten, seien deshalb in einem fundamentalen Irrtum befangen13, woraus im Umkehrschluss gefolgert wird, dass es Wittgenstein gerade darum gegangen sei zu zeigen, dass die Aufgabe der Illusion eines sprachexternen Standpunkts ohne alle Konsequenzen für unsere „epistemischen Ideale“14 bleibe. Hier tritt nun zum ersten Mal, wenngleich wiederum nur indirekt formuliert, eine positive Aussage der ‚neuen Wittgensteinianer’ auf den Plan: worin nämlich diese epistemischen Ideale bestehen, ist Erkenntnis in Form von „full blooded objectivity“15. Könnte Hacker also recht haben, wenn er den amerikanischen Philosophen zuschreibt, sie seien „mesmerized by science“16 und einer „certain form of scientism“17 verpflichtet? Der problematischste Punkt aber scheint bei genauerer Betrachtung nicht einmal die inhaltliche Schlichtheit einer Argumentationslinie zu sein, die mit Befriedigung ob der Rettung ihrer „epistemischen Ideale“ und mit nicht gerade tief schürfender provokativer Lust, einer bloß noch negativ selbstreflexiven Philosophie das Wort reden will, sondern der Umstand, dass uns einer der im besten Sinne des Wortes beunruhigendsten Denker des 20. Jahrhunderts hier – im Gewand eines ‚neuen’ – als ein höchst uninteressanter, als ein ganz und gar monotoner, als ein vollkommen verharmloster Wittgenstein begegnet; einer, der der Philosophie nicht etwa einen produktiven Knick beigebracht, sondern sie auf eine bloße Geste der Selbstbescheidung reduziert hat – auf eine Geste, die für Wittgensteins Philosophie tatsächlich außerordentlich wichtig ist, aber in ihr eine liminative, keine eliminative Funktion hat. _____________ 12 13 14 15 16 17 Peter Hacker: Interview with Edward Kanterian, Nov.-Dec. 2001, Internetquelle: http://www.information-philosophie.de/philosophie/kanterian.html, 14. 7. 2005, S. 7. Crary: Introduction, a.a.O., S. 10. Ebd., S. 4. Ebd., S. 3. Hacker: Interview, a.a.O., S. 4. Ebd., S. 5. Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 105 Was aufgelöst werden soll, sind bestimmte philosophische Probleme, nicht die Philosophie, für die es gerade darum geht, „daß sie nicht mehr von Fragen gepeitscht wird, die sie selbst in Frage stellen.“18 Gegen die philosophische Tristesse des „new Wittgenstein“, aber auch über die bislang bekannte, übliche Wittgensteininterpretation hinausführend, wollen wir einen noch ‚anderen’, einen sehr beweglichen, einen im Material der Sprache arbeitenden Wittgenstein stark machen, einen Wittgenstein, der das philosophische Denken experimentalisiert und Möglichkeitsräume schafft. Dieses experimentelle Denken lässt sich so wenig auf die Aufgabe (im doppelten Sinne des Wortes) der Philosophie reduzieren wie zur Therapie individueller philosophischer Verwirrung herabwürdigen. Es ist auf die „allgemeinste Philosophie“19 gerichtet und macht sich unermüdlich zu schaffen an den kollektiv erfahrbaren Finten und Fallen von durchaus überindividuellen Denkstilen. Und die Beruhigung, die es zeitigen mag, ist keine, die durch Ausblendungen erzielt wird, sondern eine, die sich – immer wieder neu – im offensiven Durcharbeiten von Beunruhigungen einstellt. Den ‚anderen’ Wittgenstein als einen ‚experimentellen’ Denker auszuweisen, steht dies nicht im Widerspruch zu all dem, was er selbst als Kennzeichnung seiner Philosophie hätte gelten lassen? Erinnern wir uns nur an jene Stelle, wo er gegen Ernst Mach einwendet: Was Mach ein Gedankenexperiment nennt ist natürlich gar kein Experiment. Im Grunde ist es eine grammatische Betrachtung.20 Was Wittgenstein mit dieser bemerkenswerten Volte vollführt, ist einerseits eine Annäherung von Machs Methode einer Gedankenbewegung, die „die in der Erinnerung und namentlich in der Sprache aufbewahrten Erfahrungsschätze“ durch „wenn möglich kontinuierliche Variation der Umstände“21 zu einer „Gedankenerfahrung“22 führt, an seine eigene grammatische Methode, die ganz ähnlich auf ein Erinnern, Durchspielen und Erfinden von Sprachspielen setzt, aber andererseits eine klare Absage an den Titel des Experiments. Warum ist ihm diese Absage so wichtig? Offenbar weil Wittgenstein zum Zeitpunkt dieser Notiz das Experimentieren noch ganz und gar mit einer _____________ 18 19 20 21 22 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, Werkausgabe Bd. 1, Frankfurt a. M. 1984, § 133 (Herv. im Orig.). Diese Bemerkung findet sich auch bereits im Big Typescript, a.a.O., S. 290. Vgl. Wittgenstein: The Big Typescript, a.a.O., S. 285. Ludwig Wittgenstein: Manuskriptband Nr. 107. Band III. Philosophische Betrachtungen, in: Wittgenstein’s Nachlass. The Bergen Electronic Edition, Oxford-Bergen 2000, Item 107, S. 284 f., 6.2.1930. Ernst Mach: Über Gedankenexperimente, in: ders.: Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung, Darmstadt 1976, S. 183-200, hier S. 191. Ebd., S. 186. Birgit Griesecke / Werner Kogge 106 genuin naturwissenschaftlichen Methode identifiziert, von der er die Philosophie gerade abzuheben trachtet: Philosophen haben ständig die naturwissenschaftliche Methode vor Augen und sind in unwiderstehlicher Versuchung, Fragen nach Art der Naturwissenschaften zu stellen und zu beantworten. Diese Tendenz ist die eigentliche Quelle der Metaphysik und führt den Philosophen in vollständiges Dunkel.23 Diese Kritik aus dem Jahr 1933 steht im Einklang mit Bemerkungen, in denen es heißt, dass es in der Philosophie nichts zu entdecken und nichts zu erklären gäbe24 und dass die Aufgabe der Philosophie darin bestehe, „den tatsächlichen Gebrauch der Sprache ... nur [zu] beschreiben.“25 Wittgensteins Emphase, mit der er, das „nur beschreiben“ einfordert, ist gegen die Adaption einer naturwissenschaftliche Methode in der Philosophie gerichtet, gemäß der es darum ginge, eine das Denken und Sprechen begründende Logik, d.h. dahinterliegende Prinzipien und Gesetze ans Licht zu fördern. Solange Wittgenstein nun der herkömmlichen Auffassung vom Experiment folgte, nach der Experimentieren ein Verfahren ist, Erkenntnisse über eine unabhängig gegebene Natur zu gewinnen,26 solange musste also er seine Methode der grammatischen Betrachtung gerade in Opposition zum Begriff des Experiments konturieren. Wenn wir nun im folgenden mit Wittgenstein die Nähe von ‚grammatischer Betrachtung’ und Machs ‚Gedankenexperiment’ bestätigen, aber gegen die frühe Auffassung Wittgensteins das eminent Experimentelle darin herausstellen werden, bringen wir einen Begriff des Experimentellen in Anschlag, der nicht mehr derjenige ist, gegen den Wittgenstein seine philosophische Methode zunächst meinte abgrenzen zu müssen. Unsere Überlegungen nehmen vielmehr ihren Ausgang von neueren Experimentaltheorien, die die praxeologische Dimension experimentellen Handelns betonen und die klassische Dichotomie aus theoretisch gewonnenen Annahmen und der unabhängigen Instanz Natur, die diese Annahmen bestätigt oder widerlegt, durch die damit unvereinbare Zweiheit von fraglichen, noch unbestimmten Wissensobjekten (‚epistemische Dinge’) und stabilisierten, verkörperten Bedingungen (‚techni_____________ 23 24 25 26 Ludwig Wittgenstein: Das Blaue Buch. Werkausgabe Bd. 5, Frankfurt a. M. 1984, S. 39. Vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 124-126. Ebd., § 122. Dass Wittgenstein in seinen programmatischen Grenzziehungen zur naturwissenschaftlichen Methodik immer einen sehr herkömmlichen Wissenschaftsbegriff, im wesentlichen reduziert auf Hypothesenbildung und Kausalität, in Anschlag gebracht hat, der schon seinerzeit vielfach umstritten gewesen ist, steht auf einem anderen Blatt. Auch hat sich Wittgenstein seiner eigenen Programmatik zum Trotz nicht davon abhalten lassen, von Physikern wie Boltzmann und Hertz wichtige Anregungen für seine Methode zu übernehmen. Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 107 sche Dinge’) ersetzt.27 Solche Experimentalsysteme sind nicht mehr bloße Prüfverfahren theoretisch vorgefertigter Anfragen an die Natur, sondern „werden eingerichtet, um Fragen auf Antworten zu geben, die wir noch nicht klar zu stellen in der Lage sind.“28 Dank dieser produktiven Vagheit können sie Ergebnisse zeitigen, die nicht lediglich eine Ausgangsannahme bestätigen oder widerlegen, sondern unter Umständen auch ein Drittes hervorbringen, das keineswegs vorhersehbar war. In dieser Perspektive erscheint nun das Experimentieren als ein radikal ergebnisoffenes Unternehmen, das unauflöslich in die materielle Welt verwoben ist, in der es agiert – was zum einen bedeutet, dass in ihm kein abgeschlossenes Wissen über die Welt gewonnen werden kann, zum anderen aber auch, dass es stets realitätshaltig und nicht etwa haltloses Hirngespinst ist. Wenn wir im folgenden Wittgensteins ‚grammatische Methode’ als eine beschreiben, die große Übereinstimmungen mit der Konzeption der Experimentalsysteme aufweist, bedeutet dies, die fragliche Grammatik eines Wortes als das ‚epistemische Ding’, dem die „Anstrengung des Wissens“ gelten soll, aufzufassen, und die erinnerten wie die erfundenen, die tatsächlichen wie die möglichen Verwendungsweisen als die Experimentalbedingungen, die ‚technischen Dinge’ also, mit denen die jeweilige Grammatik, das ‚epistemische Ding’, durchgespielt, erprobt und in vielfältige Spannungen (mit anderen Begriffen) versetzt wird, zu begreifen. Weiterhin bedeutet es, jene von Wittgenstein angestrebte ‚übersichtliche Darstellung’, das mühevolle Arrangement der verschiedenen Fälle, als das – unvorwegnehmbare und überraschungsträchtige – Ergebnis eines solchen experimentellen Verfahrens anzusehen. Mit diesem Ansatz ziehen wir ausdrücklich und gegen manche Vorbehalte innerhalb des ‚neuen Experimentalismus’ den experimentellen Umgang mit Sprache und Gedanken in sein ‚pragmatogones’ Konzept hinein, dessen Antrieb und Wirkkraft sich aus der konsequenten Aufwertung des PraktischExperimentellen gegenüber dem beharrlichen Postulat der Vorgängigkeit von Theorie und Denken speist. Aber gerade weil offenbar bei aller tiefgreifenden Reflexion und allen wichtiger Weichenstellungen für die Wissenschaftsforschung der ‚neue Experimentalismus’ letztlich doch die Tendenz mit sich bringt, dem Gemeinplatz zu verfallen, dass Denken sich im Kopf ereignet und Handeln mit Händen vollzogen wird, fällt es ihnen in der Regel genau so schwer wie den ‚alten Experimentalisten’, gegen die sie angetreten sind, von Gedankenexperimenten in einem eigentlichen Sinne, ohne Anführungszeichen, zu sprechen – und schon ist das Feld ganz jenen Ansätzen überlassen, _____________ 27 28 Vgl. Hans Jörg Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Eine Geschichte der Proteinsynthese im Reagenzglas, Göttingen 2001, S. 24f. Hans Jörg Rheinberger: Experiment. Differenz. Schrift: Zur Geschichte epistemischer Dinge, Marburg an der Lahn 1992, S. 25. Birgit Griesecke / Werner Kogge 108 in denen der Terminus ‚Gedankenexperiment’ schlichtweg mit ‚Fiktion’ kurzgeschlossen, ‚Fiktion’ dann mit ‚Kontrafaktischem’ synonymisiert29 und das Experimentelle dadurch um das entleert wird, was nicht nur Empiristen seit Bacon am Experiment fasziniert: das dialogische Verhältnis mit einer Wirklichkeit, das Verwobensein mit einer Materialität, die sich auf eigentümliche Weise verhält.30 So werden wir uns also zunächst mit einer Schrift Ian Hackings, einem neuen Experimentalisten, auseinandersetzen, in der er mit, wie wir zeigen werden, anachronistischen Anleihen bei Wittgenstein betont, dass Gedankenexperimente mehr mit gedanklichen Bildwechseln als mit wirklichen Experimenten zu tun hätten. Dagegen werden wir erläutern, wie Wittgenstein in den 1930er Jahren, im Zuge seiner Revision des Tractatus, sowohl zu einer komplexeren Auffassung des Experimentellen als auch zu einer neuen philosophischen Methode gelangt, die es einem leicht macht, Gedankenexperimente und grammatische Betrachtung in eine Verwandtschaftslinie zu fügen, und zwar in einem starken Sinne des Experimentellen, nicht einem uneigentlichen, analogischen oder spielerischen. Mit anderen Worten: In der Aufmerksamkeit auf experimentelle Denkbewegungen in der Philosophie Wittgensteins seit den frühen 1930er Jahren wird – in Abgrenzung zum ‚neuen Wittgenstein’ – ein ganz anderer Wittgenstein, aber auch – in Erweiterungen und Präzisierungen des ‚neuen Experimentalismus’ – eine veränderte Experimentaltheorie zum Vorschein kommen. 2. Bild, Beweis, Gedankenexperiment: Hat Denken ein Eigenleben? Ian Hacking, dem vor einigen Jahren im Rahmen eines wissenschaftsphilosophischen panels zu Gedankenexperimenten die Rolle eines Kommentators zukam, nutze diese Gelegenheit, Ludwig Wittgenstein, insbesondere dessen Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, als einen wichtigen Gewährsautor ins Spiel zu bringen; als einen Gewährsautor wohlgemerkt gegen die Auf_____________ 29 30 Vgl. z.B. Hans-Ludwig Freese: Abenteuer im Kopf. Philosophische Gedankenexperimente, Weinheim-Berlin 1995, S. 21. Albrecht Behmel: Was sind Gedankenexperimente? Kontrafaktische Annahmen in der Philosophie des Geistes - der Turingtest und das Chinesische Zimmer, Stuttgart 2001, S. 9. Annette Wünschel / Thomas Macho: Zur Einleitung: Mentale Versuchanordnungen, in: diess. (ed.): Science & Fiction. Über Gedankenexperimente in Wissenschaft, Philosophie und Literatur, Frankfurt a. M. 2004, S. 914. Vgl. dazu auch: Birgit Griesecke / Werner Kogge: Was ist eigentlich ein Gedankenexperiment? Mach, Wittgenstein und der neue Experimentalismus, in: Marcus Krause / Nicolas Pethes (eds.): Literarische Experimentalkulturen. Poetologien des Experiments im 19. Jahrhundert, Studien zur Kulturpoetik Bd. 4, Würzburg 2005, S. 41-72, hier S. 44f. Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 109 nahme der Gedankenexperimente in das Reich ‚echter’ Experimente. Wie kommt er dazu? Hackings zugrundeliegende Argumentationslinie ist die, dass Gedankenexperimente ihren Einsatzpunkt dort finden, wo es gilt, konkurrierende Weltbilder in eine sozusagen augenscheinliche Spannung miteinander zu versetzen.31 Die Weise, in der sie diese Aufgabe erfüllen, unterscheide sich vom Vollzug gewöhnlicher Experimente genau dadurch, dass sie eher wie Witze und optische Illusionen schlagartig eine neue Sichtweise zur Geltung bringen: „They can replace one picture by another. That is their job, their once and future job.“ Dann, seinen eigenen berühmt gewordenen Satz aufnehmend, dass Experimente ein Eigenleben haben, versetzt er den Gedankenexperimenten gleichsam den Todesstoß: I think of experiments of having a life: maturing, evolving, adapting, being not only recycled but also, quite literally, being retooled. But thought experiments are rather fixed, largely immutable. That is yet another respect that they are like mathematical proofs... Von mathematischen Beweisen unterscheiden sich Gedankenexperimente lediglich darin, dass, während jene in verschiedenen Kontexten anwendbare Beweisideen umsetzten, diese lediglich eine bestimmte Spannung zum Vorschein bringen. Mehr noch als mathematische Beweise sind Gedankenexperimente für Hacking daher Bilder, Figuren, die eine spezifische gedankliche Wendung zur Darstellung bringen: „Once the thought experiment is written out in perfection it is an icon. Icons, to reiterate, do not have a life of their own.“ An dieser Stelle untermauert Hacking seine Argumentation mit einer von Wittgensteins Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik: „Das Experimentelle verschwindet, indem man den Vorgang bloß als einprägsames Bild ansieht.“32 Vergegenwärtigt man sich nun jedoch, dass Wittgenstein den mathematischen Beweis bereits als stillgestelltes Bild eines Experiments auffasst und ergänzt man Hackings Argument, dass das Gedankenexperiment sich vom Beweis durch seine noch enger fixierte Anwendung unterscheidet, dann wird deutlich, dass das Gedankenexperiment nach dieser zweifachen Verschiebung nur noch den Schein eines schwachen Abglanzes vom strahlenden Licht empfängt, das das lebendige Experiment ausstrahlt. Mit Wittgenstein rückt Hacking Gedankenexperimente weit weg von der Sphäre des praktischen Expe_____________ 31 32 Vgl. Ian Hacking: Do Thought Experiments Have a Life of Their Own? Comments on James Brown, Nancy Nersessian and David Gooding, in: PSA: Proceedings of the Biennal Meeting of the Philosophy of Science Association. Vol. 1992, Volume Two: Symposia and Invited Papers (1992), 302-308, hier: S. 307, die folgenden Zitate ebd. Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik. Werkausgabe Bd. 6, Frankfurt a. M. 1984, S. 68. Birgit Griesecke / Werner Kogge 110 rimentierens. In einer Denkbewegung, die das konkrete Handeln, das Eingreifen und Erzeugen betont, werden Gedankenexperimente zu Stilleben des Denkens, frappierend in ihrer Präsenz, formal perfektioniert – aber alles andere als experimentell. Doch sieht Wittgenstein tatsächlich wie Hacking das Gedankenexperiment in Opposition zu wirklichen Experimenten und in enger Verwandtschaft zu mathematischen Beweisen? Wenn wir bei Wittgenstein lesen: „Der Beweis [...] muß ursprünglich eine Art Experiment sein – wird aber dann einfach als Bild genommen”33, so sollte uns dies stutzig machen. Denn welche Art von Experiment führt zu mathematischen Beweisen? Deutet Wittgenstein hier nicht an, dass zwar der Beweis tatsächlich als stillgestelltes Bild eines Gedankengangs aufzufassen ist, dass dem Bild aber ein erprobendes, ein experimentelles Denken vorhergeht? Ist also Wittgenstein tatsächlich ein Gewährsmann für die Ablehnung des Experimentellen am Gedankenexperiment oder liegen die Verhältnisse hier komplizierter? Ein Blick auf die Passagen, an denen Wittgenstein von Gedankenexperimenten spricht, zeigt: beides ist der Fall, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. In der Tat finden sich ausgezeichnete Belege für Hackings Auffassung, jedoch sind diese wesentlich früher verfasst als die Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, auf die Hacking verweist. So ist etwa in dem Notizbuch Philosophische Grammatik folgende Bemerkung, die vom 5. Juni 1932 datiert, zu lesen: „Wir überlegen uns Handlungen, ehe wir sie ausführen. Wir machen uns Bilder von ihnen; aber wozu? Es gibt doch kein ‚Gedankenexperiment’!”34 Weiter heißt es: „Ein Gedankenexperiment kommt auf dasselbe hinaus wie ein Experiment das man statt es auszuführen aufzeichnet.”35 Zwischen 1930 und 1933 zieht Wittgenstein immer wieder diese Verbindung vom Gedankenexperiment zum Bild. Betrachtet man das Umfeld dieser Bemerkungen, so wird schnell klar, dass Wittgenstein hier noch aus der Perspektive der ‚Abbildtheorie’ des Tractatus argumentiert:36 _____________ 33 34 35 36 Ebd., S. 160. Ludwig Wittgenstein: Manuskriptband Nr. 114. Band X. Philosophische Grammatik, in: Wittgenstein’s Nachlass, a.a.O., Item 114, S. 95 f., 5.6.1932. Ebd., S. 224, 5.6.1932. Matthias Kroß erklärt sehr deutlich, warum in der Perspektive des Tractatus der Begriff Gedankenexperiment ein „Oxymoron“ (S. 125) ist, kommt allerdings hinsichtlich der Spätphilosophie Wittgensteins zu einer anderen Auffassung als wir. Matthias Kroß: Von einem Marsstandpunkt betrachtet. Ludwig Wittgenstein über Gedankenexperimente, in: Macho/ Wünschel: Über Gedankenexperimente in Wissenschaft, Philosophie und Literatur, a.a.O., S. 115-141. Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 111 Mein Gedanke, der Satz sei ein Bild, war Gut [sic!]. Er sagte, denken sei dasselbe oder etwas ähnliches wie, sich ein Bild machen, und denkbar dasselbe oder etwas ähnliches wie vorstellbar.37 Entscheidend ist nun aber, dass – bis auf eine Ausnahme, auf die wir unten zurückkommen werden – sich in späteren Schriften Wittgensteins keine Gegenüberstellung von Gedanklichem und Experimentellem mehr findet. Nachdem in den Jahren 1934 und 1935 überhaupt keine Überlegungen zu Gedankenexperimenten verzeichnet sind, findet sich in dem Manuskriptband Nr. XI Philosophische Bemerkungen; Philosophische Untersuchungen. Versuch einer Umarbeitung, datiert vom 25. 8. 1936, eine Argumentationsskizze, in der Wittgenstein zum ersten Mal eine neue, eigenwillige Perspektive zum Thema Gedankenexperiment andeutet. Dort heißt es zunächst – in Bezug auf ein Beispiel zu Empfindungen beim Anblick vertrauter und unvertrauter Gegenstände – ganz in der Diktion der älteren Auffassung: Aber wie ist es: haben wir hier ein ‚Gedankenexperiment’ gemacht? – Wie wissen wir denn, daß es sich so verhält, bloß dadurch, daß wir es uns so vorstellen? Was ist das für eine seltsame Weise, festzustellen, wie sich eine Sache verhält?38 Doch lässt es Wittgenstein hier nicht mehr bei diesen Bedenken bewenden, sondern entwickelt eine Unterscheidung, die für seine späteren Überlegungen ausschlaggebend sein wird. Er räumt ein: „Nun kann man ja wirklich ein Experiment machen, dadurch, daß man sich etwas vorstellt.“ Und präzisiert: „Nicht ein Experiment in der Vorstellung, d.i., das bloße Vorstellungsbild eines Experiments. (Ein Laboratorium kann man nicht dadurch überflüssig machen, daß man sich Apparate und Versuche einfach vorstellt.)“ In der Vorstellung versus durch Vorstellungen: ersteres wäre nur die Bewegung in einem gegebenen Bild, zweiteres dagegen die Durchführung eines erprobenden Gedankens: Wenn mich z.B. jemand fragt, ‚Wie begrüßt Du den N., wie gehst Du auf ihn zu?’, so kann ich, um antworten zu können, mir vorstellen N trete herein und ich mache etwa dabei die Bewegung des Begrüßens. Und dies ist ein Versuch.39 Wittgenstein geht es in dieser Passage vorrangig um die Rede von ‚inneren Vorgängen’ und deshalb diskutiert er daran anschließend Subjektivität und Objektivität solcher Vorstellungen. Für unsere Frage ist aber entscheidend, dass Wittgenstein hier die Verquickung eines Experimentierens in Gedanken mit statischen Vorstellungsbildern auflöst und damit einen Weg aufzeigt, in welchem Sinne von Gedankenexperimenten oder experimentellem Denken _____________ 37 38 39 Ludwig Wittgenstein: Typoskriptband Nr. 219, in: Wittgenstein’s Nachlass, a.a.O., Item 219, S. 14, 1.1.1933. Ludwig Wittgenstein: Manuskriptband Nr. 115, in: Wittgenstein’s Nachlass, a.a.O., Item 115, S. 226, 25.8.1936. Wittgenstein: Manuskriptband Nr. 115, a.a.O., S. 226 f., 25.8.1936. Birgit Griesecke / Werner Kogge 112 gesprochen werden sollte. Wir werden zwar noch sehen, dass dieses Beispiel in einem wichtigen Punkt ein Hybrid bleibt, doch der entscheidende Schritt, Denken von statischen Bildern abzulösen – der Schritt, der über die bei Hacking diskutierte Auffassung hinausgeht – ist an dieser Stelle bereits getan. Nahezu alle Bemerkungen zum Verhältnis von Experiment, Rechnung und mathematischem Beweis, die in den Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik versammelt sind, stehen im Lichte dieser Einsicht. Es sind drei Facetten der begrifflichen Verhältnisse, die Wittgenstein hier immer wieder unterstreicht: Erstens, dass der mathematische Beweis nicht als Experiment, sondern als Bild eines Experiments anzusehen ist;40 zweitens, dass Denkvorgänge, auch Praktiken wie Zählen durchaus als Experiment verwendet sein können (wobei in dieser Verwendung aber gerade nicht die mathematische Relevanz des Vorgangs zur Geltung kommt)41 und drittens, dass das mathematische Ableiten sich vom Experimentieren dadurch unterscheidet, dass es auf unzeitliche, normative Verhältnisse zielt, nicht auf zeitgebundene, faktische.42 Im Fokus des Interesses steht hier also die eigentümliche Erscheinungsweise des Mathematischen und die Frage, wie diese sich zum naturwissenschaftlichen Entdecken verhält. Es geht um die Differenz von Mathematik und empirischer Forschung, nicht um die Differenz von Denken im allgemeinen und empirischer Forschung. Anders gesagt: Wittgenstein stellt das Spezifische der mathematischen Veranstaltung heraus – mit der allgemeinen erkenntnistheoretischen Problematik des Verhältnisses von Denken und Natur beschäftigt er sich hier nicht. Die Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik für eine Argumentation gegen das Experimentelle von Gedankenexperimenten anzuführen – wie Hacking dies tut – beruht auf einem Missverständnis, das Denken mit mathematischer oder logischer Deduktion identifiziert und damit gerade das Spezifische dieser Denkformen, die sich von jeder konkreten Sachhaltigkeit abheben, ignoriert. Lediglich an einer Stelle scheint Wittgenstein ins Fahrwasser der herkömmlichen erkenntnistheoretischen Differenz von Denken (Vernunft, Vorstellung) und Natur (Kausalität, Experiment) zu geraten und das Gedankliche mit dem Mathematischen in eins zu setzen, wenn er nämlich ausführt: ‚Ich stelle mir einen Kreis vor aus schwarzen und weißen Stücken, eines ist groß, gekrümmt, die folgenden werden immer kleiner, das sechste ist schon gerade.’ Wo liegt hier das Experiment? In der Vorstellung kann ich rechnen, aber nicht experimentieren. 43 Betrachten wir nun aber den Kontext dieser Bemerkung, so ist sie als Relikt von Wittgensteins älterer Auffassung zu erkennen. Sie taucht zum ersten Mal im Manuskriptband Nr. 118 auf und datiert vom 8. September 1937. Dort _____________ 40 41 42 43 Wittgenstein: Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, a.a.O., S. 51, 68, 160, 382. Ebd., S. 51, 98, 194, 338, 380, 382, 413. Ebd., S. 75, 98, 187, 194f., 338f, 424f. Ebd., S. 73 (Herv. von uns). Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 113 folgt ihr die Überlegung: „Die Grundlage der Mathematik ist das Rechnen. Gib uns ein Gift, was das Rechnen unmöglich macht, & es gibt keine Mathematik mehr.”44 Nur drei Tage später erscheint die Passage im Manuskript 117 wieder, dort aber schließt an sie eine andere Bemerkung an: „In einer Demonstration einigen wir uns mit jemand. Einigen wir uns in ihr nicht, so trennen sich unsere Wege, ehe es zu einem Verkehr mittels dieser Sprache kommt.”45 Diese Montage wurde dann einige Monate später in ein Typoskript – nämlich Nr. 221 – übernommen, das eine Überarbeitung der Manuskriptbände 117120 und 162a darstellt. Doch auch dieses Typoskript hat Wittgenstein – ab Januar 1938 – wiederum überarbeitet und auf der Basis von ausgeschnittenen Passagen aus 221 neu zusammengestellt. Im Typoskript 222 folgt dann der genannten Formulierung die Passage: „Was ist die charakteristische Verwendung des Vorgangs der Ableitung als Rechnung – im Gegensatz zur Verwendung des Vorgangs als Experiment?”46 Wir sehen also: Obwohl es in jeder Montage um das Spezifische von mathematischer Rechnung und Beweisführung geht, unterscheidet sich jede spätere Montage von der früheren insofern, als sie sich schrittweise auf die Hauptaussagen der Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik hin bewegen. Während die erste Fassung lediglich den elementaren Unterschied von Rechnen und Experimentieren unterstreicht und die Rolle des Rechnens – in Abhebung vom Experimentieren – für die Mathematik hervorhebt, spezifiziert die zweite Version die besondere Form intersubjektiver Wirksamkeit des mathematischen Beweisens, wobei die Demonstration bereits zum Bild gerinnt, in dem alle Kraft der Überzeugung beschlossen liegt. Die letzte Montage geht darüber hinaus, indem sie die apodiktische Schärfe der Aussage „In der Vorstellung kann ich ... nicht experimentieren” bricht und das Experimentelle – in der Entgegensetzung zum Rechnerischen – zu einer Frage der Verwendung umdeutet. Ableitungen können gemäß dieser Formulierung durchaus experimentell sein – solange sie nicht als Rechnungen fungieren. Einen Schlüssel zum Motiv dieser Reformulierung finden wir, wenn wir das weitere Umfeld der Passagen mitberücksichtigen. Sowohl in den früheren Manuskripten als auch in den späteren werden die Überlegungen zum Beweisen und Experimentieren von übergreifenden Reflexionen begleitet. Doch während die früheren Fassungen offensichtlich von dem Motiv geleitet sind, die philosophische Methode als Arbeit am „alltäglichen, allbekannten” von der naturwissenschaftlichen, deren Zweck es gerade nicht sei, „Dich aufmerk_____________ 44 45 46 Ludwig Wittgenstein: Manuskriptband Nr. 118. Bd. XIV. Philosophische Bemerkungen, in: Wittgenstein’s Nachlass, a.a.O., Item 118, S. 69v, 8.9.1937. Ludwig Wittgenstein: Manuskriptband Nr. 117. Bd. XIII. Philosophische Bemerkungen, in: Wittgenstein’s Nachlass, a.a.O., Item 117, S. 88,11.9.1937. Ludwig Wittgenstein: Typoskriptband Nr. 222, in: Wittgenstein’s Nachlass, a.a.O., Item 222, S. 73, 1.1.1938. Birgit Griesecke / Werner Kogge 114 sam zu machen auf das, was Du schon längst wusstest”47, abzuheben, ist für die letzte Version diese Abgrenzung offenbar nicht mehr zentral. Stattdessen kann nun sachlich unterschieden werden zwischen mathematischer Rechnung, welche als Bild fungiert und dem Experiment, für das dies nicht gilt: „Ich mache einen Schnitt; zwischen der Rechnung mit ihrem Resultat (d.i. einem bestimmten Bild, einer bestimmten Vorlage) und einem Versuch mit seinem Ausgang.”48 Stehen also die früheren Passagen noch im Kontext der Profilierung einer philosophischen Methode und stellen deshalb das Gedankliche dem Experimentellen gegenüber, so machen sich die späteren Überlegungen von dieser strategischen Opposition frei und betrachten das Experimentelle als eine Frage der Verwendung: „Experiment ist etwas durch den Gebrauch, der davon gemacht wird.”49 Wir werden nun in den folgenden beiden Abschnitten darlegen, wie diese Dynamisierung des Denkens sich bei Wittgenstein in methodologischen Überlegungen und in der Praxis grammatischer Versuche niederschlägt. 3. Erinnern, Erfinden, Erfahren: Was die grammatische Methode ausmacht Wir haben bereits gesehen, dass Wittgenstein einst Machs ‚Gedankenexperimente’ unter dem Vorbehalt, dass hier Experimentelles nicht im Spiel sei, mit seiner eigenen Methode ‚grammatischer Betrachtung’ identifizierte. Und tatsächlich scheinen ja auf den ersten Blick Experiment und Grammatik unvereinbar zu sein: Grammatik als Inbegriff sprachlicher Konventionalität und Experiment als Ermöglichung von Neuem – wie sollte das zusammengehen? Doch dass die Dinge so schlicht nicht zueinander stehen, zeigt sich, sobald wir etwas mehr Licht in Wittgensteins Verwendung des Begriffs der Grammatik bringen. Die Grammatik in Wittgensteins Terminologie ist kein Normierungsinstrument, das Sprachverwendungen vorschreibt. Grammatik bezeichnet bei Wittgenstein vielmehr die Regeln, nach denen wir im Sprachgebrauch wirklich (und nicht metaphysisch verirrt) verfahren und die nicht „anzutasten“, sondern – vornehmlichste Aufgabe der Philosophie – „nur zu beschreiben“ sind.50 _____________ 47 48 49 50 Wittgenstein: Manuskriptband Nr. 117, a.a.O., S. 95, 11.9.1937. Wittgenstein: Typoskriptband Nr. 222, a.a.O., S. 81, 1.1.1938. Wittgenstein: Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, a.a.O., S. 98; vgl. Manuskriptband Nr. 117, a.a.O., S. 28, 11.9.1937. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 122. Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 115 Dieser – vermeintliche – Beschreibungspurismus hat nun zu mancherlei Missverständnissen geführt,51 deren schwerwiegendstes wohl in der Fehldeutung besteht, die Aufgabe der Philosophie habe sich nunmehr im Beschreiben gegebener Sprachformen zu erfüllen. Doch genau dies, ein irgend positiv Gegebenes, ist nicht Gegenstand der grammatischen Methode. Deren Aufmerksamkeit richtet sich gerade nicht auf die Sprache im Sinne eines Korpus von Worten oder Sätzen, über den empirische Untersuchungen angestellt werden können. Nichts in diesem Sinne Gegebenes und Erforschbares, sondern die Möglichkeiten des Gebrauchs sind der Gegenstand der Wittgensteinschen Untersuchungen. Diese Möglichkeiten nun sind formiert durch Regeln und Kriterien, die den Sprachgebrauch leiten und die wir sozusagen vor uns bringen müssen. So gesehen trifft der Begriff Grammatik genau das, was Wittgenstein durch die Untersuchung von Sprachformen eigentlich zur Darstellung bringen will: letztlich nicht das Sprachmaterial, sondern die Regeln und Kriterien, die im Gebrauch von Worten und im Bilden von Sätzen wirksam werden. Allerdings unterscheidet sich Wittgensteins Untersuchungsgegenstand, den er zuweilen ‚Tiefengrammatik’ nennt und so von einer ‚Oberflächengrammatik’ unterscheidet,52 von der gewöhnlichen Grammatik dadurch, dass erstere keine Regelform vorgibt, sondern Darstellungen der fein differenzierten und vielseitigen Kriterien versucht, die den tatsächlichen Sprachgebrauch leiten. Für diesen Sprachgebrauch ist nun aber entscheidend, was Wittgenstein in dem zentralen Paragraphen 23 der Philosophischen Untersuchungen zum Ausdruck bringt: Wieviele Arten der Sätze gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und Befehl? – Es gibt unzählige solcher Arten: unzählige verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, was wir ‚Zeichen’, ‚Worte’, ‚Sätze’ nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für allemal Gegebenes; sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, entstehen und andre veralten und werden vergessen.53 Berücksichtigt man diese Unabgeschlossenheit der Gebrauchsformen von Sprache und ihre Veränderlichkeit, so leuchtet unmittelbar ein, dass die Grammatik im Sinne Wittgensteins, die sich in den Kriterien und Regeln dieses lebendigen Sprachgebrauchs manifestiert, kein abgeschlossenes Regelwerk sein kann.54 Einleuchtender wird nun aber auch der emphatische Beschreibungsbegriff: die Kriterien und Regeln, die den Sprachgebrauch tatsächlich leiten, lassen sich durch keine Rückführung auf ein ‚zugrundeliegendes’, _____________ 51 52 53 54 Vgl. zur verwandten Problematik in der phänomenologischen Beschreibungsdevise Husserls: Birgit Griesecke: Japan dicht beschreiben. Produktive Fiktionalität in der ethnographischen Forschung, München 2001, S. 54ff. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 664. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 23. Daher Wittgensteins Betonung, dass die grammatische Untersuchung immer nur zu einem bestimmten Zweck erfolgen kann. Birgit Griesecke / Werner Kogge 116 ‚ideales’, ‚logisch vereindeutigtes’ oder sonstwie extern reguliertes Sprachspiel erfassen. Der Sprachgebrauch folgt keinem von ihm ablösbaren, potentiell eigenständigen Regelwerk. Die Regeln sind vielmehr Regeln, die im Sprachgebrauch wirksam sind und die daher nur in der Mannigfaltigkeit des Sprachgebrauchs aufgefunden werden können. Grammatik bezeichnet also den offenen ‚Möglichkeitsraum’ gehaltvollen, im Lebenszusammenhang greifenden sprachlichen Handelns, nicht die Strukturen faktisch vollzogener Sprechakte. Folglich ergibt sich eine Beschreibung im Wittgensteinschen Sinne nicht schon, indem man ‚realistisch’ auf die Dinge blickt, sondern ‚Beschreibung’ verlangt eine ganz eigene Leistung: Wenn man an eine Beschreibung als ein Wortbild der Tatsachen denkt, so hat das etwas Irreführendes: Man denkt etwa nur an Bilder, wie sie an unsern Wänden hängen; die schlechtweg abzubilden scheinen, wie ein Ding aussieht, wie es beschaffen ist. (Diese Bilder sind gleichsam müßig.)55 Gesetzt nun den Fall, wir geraten in begriffliche Verwirrung und sind zu deren Klärung an der Grammatik eines bestimmten Wortes interessiert, wie ließe sich dieser Möglichkeitsraum gestalten, woher gewinnen wir das Sprachmaterial als Material der Beschreibung? Ganz in Einklang mit Ernst Mach, der in seiner gedankenexperimentellen Konzeption auf „die in der Erinnerung und namentlich in der Sprache aufbewahrten Erfahrungsschätze“ setzt, weil wir schließlich „noch in der Erinnerung Einzelheiten finden, die wir bei unmittelbarer Beobachtung der Tatsache keiner Aufmerksamkeit gewürdigt haben“56, die uns aber zu Entdeckungen verhelfen, setzt auch Wittgenstein auf Erinnerungsarbeit: „Die Arbeit des Philosophen ist ein Zusammentragen von Erinnerungen zu einem bestimmten Zweck.“57 Was hier als eine beschauliche Sammlungstätigkeit genauso leicht genommen werden könnte wie die vermeintliche Bescheidung ins ‚nur beschreiben’, unter dessen Devise es steht, wird sich als ein aufwendiges Unterfangen entpuppen. Denn, bei der Klärung grammatischer Verwirrungen ist es keineswegs damit getan, die erstbesten Erinnerungen über eine alltägliche Verwendungsweise schlichtweg zur Norm zu erklären. Denn das Erstbeste wird kaum schon das Klärendste sein. Vielmehr geht Wittgenstein davon aus, dass „die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge [...] durch ihre Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen [sind]. (Man kann es nicht bemerken, weil man es immer vor Augen hat.)“58 _____________ 55 56 57 58 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., aus § 291. Vgl. zur Debatte über Beschreibung versus Erklärung: Birgit Griesecke: Japan dicht beschreiben, a.a.O., S. 54ff. Mach: Über Gedankenexperimente, a.a.O., S. 187. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 127. Die Bemerkung findet sich bereits im Big Typescript, a.a.O., S. 280. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., aus § 129. Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 117 Verborgen? Hat Wittgenstein nicht immer wieder unterstrichen, dass es in der Philosophie nichts zu entdecken, sondern eben nur zu beschreiben gäbe? Das Missverständnis, dass Wittgensteins Methode sich im Rückbesinnen auf die Alltagssprache erschöpfe, kommt, wie wir an dieser Stelle festhalten sollten, zustande, weil Wittgenstein den Unterschied zwischen zwei Begriffen von Entdeckung nicht expliziert: wogegen er sich wendet, ist die Auffassung, dass in der Philosophie eine zugrundeliegende Ordnung von Gesetzen oder Formen, auf die die Erscheinungen zurückgeführt werden können, zu entdecken ist; was aber für Wittgenstein ebenso klar ist, ist, dass das Einfache und Alltägliche, dass die ‚Sprache bei der Arbeit’ eben nicht unbedingt offen vor unseren Augen liegt und es, um Einsicht und Klärung ihrer vielfältigen Möglichkeiten zu erlangen, drastischere Maßnahmen erforderlich sind als die erinnernde Sammlung, wie immer sorgsam sie auch betrieben werden mag. So gesellt sich in der Beschreibung zum Finden (oder Auffinden) das Erfinden, ein hervorragendes Mittel sowohl zum Hervortreiben des im Alltäglichen Verborgenen als auch gegen zu schnelle Zufriedenheit, gegen voreilige Selbstberuhigung: [...] unser Zweck ist vielmehr, jemandes Verlegenheit zu beseitigen, die dadurch entstand, daß er dachte, er habe den genauen Gebrauch eines gewöhnlichen Wortes begriffen. Auch aus diesem Grund zählen wir mit unserer Methode nicht nur bestehende Wortgebräuche auf, sondern erfinden bewusst neue – davon einige, gerade weil sie absurd erscheinen.59 Indem er den Satz Martin Luthers aufgreift, die Theologie sei die Grammatik des Wortes ‚Gott’, zeigt Wittgenstein, was damit gemeint sein könnte: Dies fasse ich so auf, daß eine Untersuchung dieses Wortes eine grammatische wäre. Es könnte z.B. sein, daß sich die Leute darüber streiten, wie viele Arme Gott hat und dann würde sich womöglich einer in die Debatte einmischen, indem er bestreitet, daß von den Armen Gottes überhaupt gesprochen werden kann. Dies würde Licht werfen auf den Gebrauch des Wortes. Auch was als lächerlich oder ketzerisch gilt, läßt die Grammatik des Wortes erkennen.60 Um die Grammatik eines Wortes zu erkunden, genügt also nicht eine einzelne Testfrage, ob dieses oder jenes Prädikat anwendbar, ob wir in diesem oder jenem Fall noch von Gott oder xy sprechen würden. Vielmehr müssen solche erfinderischen Fragen in immer wieder variierender Weise und in wechselnden Perspektiven an einen Begriff gestellt werden. So erschließt sich allmählich sein Spielraum, und wo man „eine glatte, regelmäßige Kontur“ erwarten würde, kann es sich erweisen, dass man „eine zerfetzte zu sehen“61 bekommt. Tatsächlich steht auch dieser Aspekt der grammatischen Arbeit, die fingierende Variation der Gedanken, die an Begriffen und den ihnen zugehörigen _____________ 59 60 61 Wittgenstein: Das Blaue Buch, a.a.O., S. 52. Ludwig Wittgenstein: Vorlesungen 1930-1935, Frankfurt a. M. 1989, S. 187. Ludwig Wittgenstein: Zettel. Werkausgabe Bd. 8, Frankfurt a. M. 1984, S. 293. Birgit Griesecke / Werner Kogge 118 Phänomenen arbeitet, wiederum durchaus in Übereinstimmung mit Ernst Machs Konzeption des Gedankenexperiments, wo die „Umschau in der Erinnerung an die Erfahrungen und die Fiktion neuer Kombinationen von Umständen“62, die auf Fälle setzt, „welche auf den ersten Blick von dem Ausgangspunkt wesentlich verschieden scheinen“63, weil gerade die vermeintlich abwegigen Konstellationen „am besten die Natur eines Problems fühlen“64 lassen, zum experimentellen Grundprinzip erklärt werden. Man könnte auch so sagen: Kontinuierliche, fingierende Variation erzeugt einen differentiellen Raum, in dem durch „Denkhandlungen“65 (Wittgenstein) „Gedankenerfahrungen“66 (Mach) stattfinden können. Zweierlei ist in diesem Zusammenhang wichtig: zum einen, dass das, was Mach eine „Gedankenerfahrung“ nennt, keine Erfahrung in Gedanken, keine bloß vorgestellte Erfahrung bezeichnet, sondern eine im Verlauf des Denkens ‚erfahrene Erfahrung’ meint, eine, die erst im Vollzug des Denkens gemacht wird; zum anderen, dass das abwegig oder absurd Erscheinende nicht einfach mit Kontrafaktischem in eins fällt, es vielmehr für eine fingierende Erprobung des Spektrum des Faktischen nutzbar gemacht wird, eines Spektrums, das eben viel umfassender sein könnte als bislang denkbar gewesen war. Als ein befreiendes, aber eben nicht beliebiges Erkunden des, wenn man so will, ‚wirklich Möglichen’, wird Wittgenstein auch in einer späten Vorlesung von 1946 noch einmal seine Methode als Therapie umreißen – freilich in einem deutlich anderen Sinne als im ‚New Wittgenstein’ propagiert: Was ich gebe, ist die Morphologie des Gebrauchs eines Ausdrucks. Ich zeige, daß er Arten des Gebrauchs hat, von denen Sie sich oft nichts haben träumen lassen. In der Philosophie fühlt man sich genötigt, einen Begriff auf eine bestimmte Weise anzusehen. Was ich tue, ist, andere Weisen der Betrachtung anzuregen oder sogar zu erfinden. Ich schlage Möglichkeiten vor, an die Sie früher gar nicht gedacht haben. Sie dachten, es gebe eine Möglichkeit oder höchstens nur zwei. Ich aber habe Sie dazu gebracht, an noch andere zu denken. Außerdem habe ich Sie erkennen lassen, es sei absurd zu erwarten, der Begriff füge sich diesen beschränkten Möglichkeiten. So hat sich Ihre geistige Verkrampfung gelöst, und Sie sind frei, sich im ganzen Feld des Gebrauchs des Ausdrucks umzuschauen und die verschiedenen Arten seines Gebrauchs zu beschreiben.67 Solche Serien begrifflicher Einsätze, die an jene zunächst absurd erscheinenden Punkte zu führen vermögen, werden erst dann wirklich produktiv, wenn _____________ 62 63 64 65 66 67 Mach: Über Gedankenexperimente, a.a.O., S. 187. Ebd., S. 189. Ebd., S. 196. Wittgenstein: The Big Typescript, a.a.O., S. 160. Mach: Über Gedankenexperimente, a.a.O., S. 186. Norman Malcolm: Ludwig Wittgenstein. Ein Erinnerungsbuch, München-Wien 1961 [1958], S. 66f. Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 119 man die gesammelten Fälle in ihrer Beziehung zueinander präsentiert und zwar, wie Wittgenstein es programmatisch formuliert, durch die Gruppierung dieses Materials in Form einer ‚übersichtlichen Darstellung’. Auch Mach spricht mit Blick auf seine Gedankenexperimente von einer klärenden „Übersicht der möglichen Fälle“, doch Wittgenstein geht noch einen Schritt weiter und integriert auch an dieser Stelle programmatisch die Arbeit der Fiktion: Die übersichtliche Darstellung vermittelt das Verständnis, welches eben darin besteht, dass wir die ‚Zusammenhänge sehen’. Daher die Wichtigkeit des Findens und Erfindens von Zwischengliedern. Der Begriff der übersichtlichen Darstellung ist für uns von grundlegender Bedeutung.68 Zwischenglieder sind die gefundenen und erfundenen Fälle, die eingeschliffenen Gebrauchsweisen an die Seite gestellt und diese heilsam destabilisieren, umbiegen, öffnen können. Es sind Einsätze (enjeu) ins ergebnisoffene Spiel der Beschreibungen. So erfüllen Zwischenglieder eine unverzichtbare Aufgabe inmitten eines Tableaus mehr oder minder vertrauter Gebrauchsweisen: sie markieren begriffliche Übereinstimmungen, Übergänge und Unverträglichkeiten. Gerade weil in einer solchen ‚übersichtlichen Darstellung’ verschiedenste, gewöhnlichste und ungewöhnlichste Verwendungszusammenhänge in eine produktive Spannung versetzt werden, die etwas über die Reichweite und die sinnvollen Grenzen bestimmter Worte zu sehen, zu erfahren gibt, darf sie nicht mit einer panoramatischen Überschau verwechselt werden, wo von einem entrückten Standpunkt aus feinste Differenzierungen im schweifenden Rundblick eingeebnet werden. In der grammatischen Methode befindet man sich – kreuz und quer gehend, prüfend, eingreifend – immer inmitten der Darstellungsarbeit und gewinnt Übersicht im radikalen Wechsel der Perspektiven. Folglich ist die erzielte ‚Übersicht’ der Grammatik eines Wortes als aufwendiges kritisches Arrangement lebendigen Sprachmaterials kein Bild für die Ewigkeit, sondern von äußerst begrenzter Stabilität; sie ist ergänzbar, veränderbar, sie gerät in prekäre Nachbarschaft zu anderen übersichtlichen Darstellungen und gerade in dieser vollkommen unbeschaulichen Beweglichkeit funktioniert sie – Kennzeichen aller guten Experimentalsysteme – als ein Forschungsaggregat am allerbesten.69 _____________ 68 69 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., aus § 122. Die Bemerkung findet sich auch bereits, allerdings noch ohne den ausdrücklichen Verweis auf das Erfinden, in: Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über Frazers Golden Bough, in: ders.: Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften, herausgegeben von Joachim Schulte, Frankfurt a. M. 1989, S. 29-46, hier S. 37. Vgl. Birgit Griesecke: Zwischenglieder (er)finden. Wittgenstein mit Geertz und Goethe, in: Wilhelm Lütterfelds / Djavid Salehi (eds.): ‚Wir können uns nicht in sie finden‘. Probleme interkultureller Verständigung und Kooperation, Frankfurt a. M. 2001, S. 123146. Hans-Jörg Rheinberger: Augenmerk, in: ders.: Iterationen, Berlin 2005, S. 51-73, hier S. 69. 120 Birgit Griesecke / Werner Kogge 4. Wie experimentell ist Wittgensteins Methode? Ein Beispiel Wenn ‚experimentell zu sein’ ein angemessenes Prädikat für Denken sein soll und wenn dies in einem strengen Sinne des Begriffs ‚experimentell’ gelten soll, dann müssen die Kriterien dafür, dass etwas experimentell genannt wird, für Vorgänge des Denkens erfüllt sein. Und zu diesen Kriterien gehört zumindest, dass wir eine Versuchsanordnung aus relativ stabilen Elementen vorfinden, die gleichwohl variabel ist (technische Dinge), dass es etwas gibt, über das etwas in Erfahrung gebracht werden soll (epistemisches Ding), dass ein Vorgang zum Ablauf gebracht wird (das Experiment also durchgeführt wird) und zwar in einer Weise, dass das Ergebnis nicht nur zurechtgedrechselt oder konstruiert wird, sondern sich auch aus Eigenschaften des untersuchten Materials ergibt. Der Behauptung, dass Denken experimentell sein kann, stehen die in der Ablehnung von Gedankenexperimenten vorgebrachten Zweifel entgegen, was denn das objektiv Gegebene im Denken sei. Auf der einen Seite fehle es an einem Gegenüber, das – gleich der Natur – objektive Ergebnisse zeitigt, auf der anderen Seite mangle es an einem realen, intersubjektiv reproduzierbaren Versuchsaufbau, denn Denken, so wird vorausgesetzt, sei eine persönliche, im Inneren des Subjekts sich vollziehende Angelegenheit. Dass beides für den Fall der grammatischen Betrachtung nicht zutrifft, kann folgendes Beispiel zeigen: Daß etwa der König eines Stammes für niemanden sichtbar bewahrt wird, können wir uns wohl vorstellen, aber auch, daß jeder Mann des Stammes ihn sehen soll. Das letztere wird dann gewiß nicht in irgendeiner mehr oder weniger zufälligen Weise geschehen sollen, sondern er wird den Leuten gezeigt werden. Vielleicht wird ihn niemand berühren dürfen, vielleicht aber berühren müssen. Denken wir daran, daß nach Schuberts Tod sein Bruder Partituren Schuberts in kleine Stücke zerschnitt und seinen Lieblingsschülern solche Stücke von einigen Takten gab. Diese Handlung, als Zeichen der Pietät, ist uns ebenso verständlich, wie die andere, die Partituren unberührt, niemandem zugänglich, aufzubewahren. Und hätte Schuberts Bruder die Partituren verbrannt, es wäre auch das als Zeichen der Pietät verständlich. Das Zeremonielle (heiße oder kalte) im Gegensatz zum Zufälligen (lauen) charakterisiert die Pietät.70 Diese Passage aus den Auseinandersetzungen mit dem Ethnologen James George Frazer, stellt ein hochverdichtetes Beispiel für Wittgensteins experimentelles Verfahren dar. Inhaltlich geht es hier um die Kritik an einer Sichtweise, die Wittgenstein als eng, roh und irreführend charakterisiert, die nämlich, vom Standpunkt aufgeklärter, wissenschaftlicher Rationalität, die fremden Gebräuche, über die sie handelt, „als Irrtümer erscheinen“71 lässt. Dagegen führt Wittgenstein ins Feld, dass sich selbst von zunächst äußerst _____________ 70 71 Wittgenstein: Bemerkungen über Frazers Golden Bough, a.a.O., S. 33f. Ebd., S. 29. Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 121 fremd erscheinenden Ritualen Linien ziehen lassen zu uns vertrauten Praktiken, dass also Frazers Darstellung von den irrationalen, in Irrtümern befangenen Wilden seiner eigenen Erklärungshypothese, die andere Lebensformen nur als Vorstufen des eigenen zivilisatorischen Entwicklungsstandes betrachten kann („Welche Enge des seelischen Lebens bei Frazer! Daher: Welche Unmöglichkeit, ein anderes Leben zu begreifen als das Englische seiner Zeit!“)72, geschuldet sei.73 Wenn Wittgenstein in diesem Zusammenhang die Fälle eines Königs, der im Verborgenen gehalten wird und eines Königs, der ausgestellt wird, entwirft, dann kreiert er vor dem Hintergrund des vertrauten Souveräns, der zu bestimmten Anlässen seine repräsentative Funktion ausübt, eine sehr exotische, ja möglicherweise absurd erscheinende Konstellation. Betrachten wir – bevor wir dazu kommen, in welchem Sinne hier ein Experiment durchgeführt wird – die Bestandteile dieses settings. Was wird hier ins Spiel gebracht? Zunächst einmal sind die verschiedenen Konstellationen aus Worten wie ‚König’, ‚verborgen’ und ‚zeigen’ so einfach, dass sie im experimentellen Rahmen kontrolliert und gezielt variiert werden können. Stellt man in Bezug auf solche Konstellationen die Frage, welcher Status von Objektivität ihnen zukommt, so lässt sich festhalten, dass es sich nicht um persönliche Erinnerungen Wittgensteins handelt – und ebenso wenig um auf die Persönlichkeit Wittgensteins beschränkte Phantasien. Denn mit Recht weist Wittgenstein ja darauf hin, dass wir uns Konstellationen wie den unsichtbaren oder jedermann gezeigten König leicht vorstellen können. ‚Vorstellbarkeit’, ‚Denkbarkeit’ – diese Begriffe bezeichnen den Status der Objekte, die für das experimentelle setting der grammatischen Betrachtung zusammengestellt werden. Dass es sich mit ihnen tatsächlich so verhält wie sie vorgestellt werden, erscheint möglich. Möglichkeitsgebilde könnten wir diese Objekte nennen oder ‚mögliche Sachverhalte’, wenn wir in der Terminologie des Tractatus sprechen wollen. Was in diesem Sinne denkmöglich ist, entscheidet nicht das einzelne Subjekt, es ist aber auch nicht in irgendeinem Regelverzeichnis zum richtigen Sprachgebrauch festgelegt. Seine Objektivität bezieht es aus seiner frappierenden Plausibilität, die so weit reicht, wie die eingesetzten Elemente bekannt und vertraut sind. Was das experimentelle setting einsetzt, ist also der Grundschatz unseres kulturellen Wissens, Selbstverständlichkeiten, die so geläufig sind, dass sie der Befragung und Kritik für gewöhnlich entzogen bleiben.74 In ihrer unser ganzes Denken und Handeln konstituierenden Funktion bleiben _____________ 72 73 74 Wittgenstein: Bemerkungen über Frazers Golden Bough, a.a.O., S. 33. Vgl. dazu: Birgit Griesecke: Cambridge 1930. Die neuen Denk- und Schreibversuche des mittleren Wittgenstein, in: Wolfgang Braungart / Kai Kauffmann (eds.): Euphorion. Beiheft: Essayismus 1870-1930 (in Vorbereitung). Vgl. Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über Frazers Golden Bough, a.a.O., S. 34: „Die eigentlichen Grundlagen seiner Forschung fallen dem Menschen gar nicht auf. Es sei denn, daß ihm dies einmal zum Bewusstsein gekommen ist. (Frazer etc., etc.)“ Birgit Griesecke / Werner Kogge 122 Unterscheidungen wie die von sichtbar und unsichtbar der subjektiven Bestimmung ebenso wie der konventionellen Regelung entzogen, und diese Unabhängigkeit, verbunden mit einer manifesten Stabilität und Wirksamkeit, ist es, was diesen Konstellationen einen objektiven Status, vergleichbar mit dem der naturwissenschaftlichen Gegenstände verleiht. Wenn wir nun fragen, in welchem Sinne hier ein Experiment durchgeführt wird, gilt es zunächst einmal zu betonen, dass mit dem Entwurf von artifiziellen Konstellationen noch gar nichts Experimentelles verrichtet ist. Phantasievolle Konstruktion alleine – und seien die Ausgangsannahmen noch so irreal und befremdlich – reicht nicht hin, um zu experimentieren. So besteht das Experiment in Wittgensteins Beispiel auch nicht schon darin, monarchische Rituale zu ersinnen, die von den uns vertrauten denkbar weit entfernt liegen, vielmehr wird aus dieser Konstruktion ein Experiment erst dadurch, dass diese Vorstellungen in ein präzises Arrangement gefügt werden, mit dem Ziel, etwas geschehen zu lassen. Nicht also schon die Vorstellung von etwas, sondern das Geschehen, das durch Vorstellungen ermöglicht und induziert wird, macht einen gedanklichen Prozess zum Experiment, ‚denke dir ...’, nicht: ‚stelle dir vor ...’ ist demgemäß Wittgensteins notorische Einleitung zu seinen gedanklichen Versuchen. Neben der Anordnung von relativ stabilen Elementen benötigt das Experiment etwas, worauf sich das Erkenntnisbestreben richtet, ein ‚epistemisches Ding’. In unserem Beispiel richtet sich dieses Bestreben auf den Begriff der Pietät, genauer: auf die Kriterien und Grenzen seiner Verwendung. Herausgefordert durch Frazers naserümpfende Darstellung außereuropäischer Rituale und der beschränkten Perspektive des modernen Rationalisten fragt Wittgenstein danach, welche Verwendungen in unserem Begriff der Pietät (als Beispiel für eine mit Rituellem verknüpfte „geistige[ ] Angelegenheit“)75 angelegt – denkmöglich – sind. Geleitet von der Vermutung, dass sich unser Begriff der Pietät sehr wohl auf Fälle wie den verborgenen König beziehen lässt, macht Wittgenstein den Versuch, ‚Zwischenglieder zu finden’, die diesen Fall mit unzweifelhaften Fällen verknüpfen. Im Beispiel unserer Textpassage geschieht dies durch eine Parallelmontage der monarchischen Inszenierung mit dem Totenritual Schuberts.76 Umkehrungen wie der ausgestellte König und Variationen wie die zerschnipselte oder verbrannte Partitur korrelieren den zunächst äußerst fremd anmutenden Fall des für niemanden sichtbaren Königs mit dem Fall der unzugänglich aufbewahrten Partitur, der uns als paradigmatisch für eine pietätvolle Handlung gilt. In dieser Kette von Varianten zeigt sich nun auch das dritte Kriterium für Experimente erfüllt, nämlich dass ein Vorgang zum Ablauf gebracht wird, der _____________ 75 76 Wittgenstein: Bemerkungen über Frazers Golden Bough, a.a.O., S. 36. Zu einer genauen Analyse der Passage vgl. Birgit Griesecke: Cambridge 1930, a.a.O. Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 123 in seinem Ergebnis offen ist. Denn durch das Arrangement der Verwendungsfälle kommen zugleich Möglichkeiten der Verwendung im Begriff der Pietät zum Vorschein, die in dem Bild, das wir uns zuvor davon machten, gar nicht in den Blick kamen oder ganz unklar waren. Dieses Hervortreten von Möglichkeiten ist ein tatsächlich „unvorwegnehmbares Ereignis“77, denn die Frage, wie weit die Möglichkeit der Verwendung eines Begriffes reicht, lässt sich nicht vorentscheiden, sondern nur durch Erprobung von Fallvarianten erkunden. In der Erprobung kann sich erweisen, dass der Versuch glückt, aber auch, dass er scheitert, eine Grenze zu anderen Begriffen markiert. Verbindungen und Grenzen, die uns nicht bekannt waren, werden so sichtbar und in eine übersichtliche Darstellung gebracht; dies sind die Entdeckungen, die uns das experimentelle Verfahren der grammatischen Betrachtung liefert. Während der Versuch mit dem Begriff der Pietät glückt und daher einlädt, ihn ex post als Beweisführung zu deuten, zeigt sich das experimentelle Moment noch klarer in einem Beispiel, in dem ein Fallarrangement eine Grenze zum Vorschein bringt: Frage dich: Wäre es denkbar, daß einer im Kopf rechnen lernte, ohne je schriftlich oder mündlich zu rechnen? – ‚Es lernen’ heißt wohl: dazu gebracht werden, daß man’s kann. Und es fragt sich nur, was als Kriterium dafür gelten wird, daß jemand dies kann. – Ist aber auch dies möglich, daß einem Volksstamm nur das Kopfrechnen bekannt ist und kein andres? Hier muß man sich fragen ‚Wie wird das aussehen?’ – Man wird sich dies als einen Grenzfall ausmalen müssen. Und es wird sich dann fragen, ob wir hier noch den Begriff des Kopfrechnens anwenden wollen – oder ob er unter solchen Umständen seinen Zweck eingebüßt hat; weil die Erscheinungen nun zu einem anderen Vorbild hin gravitieren.78 Die Konstruktion von Fallarrangements, an denen Möglichkeiten und Grenzen der Begriffsverwendung sichtbar werden, ist materialgebunden, eingreifend und beobachtend genau in dem Sinne, in dem es jedes experimentelle Handeln ist: die einzelnen Elemente und Konstellationen sind weder irreal noch einfach vorgefunden, sie verhalten sich vielmehr indifferent zu ihrem außerexperimentellen Auftreten: „wir betreiben“, schreibt Wittgenstein, „nicht Naturgeschichte, – da wir ja Naturgeschichtliches für unsere Zwecke auch erdichten können.“79 Doch wie lässt sich der Gegenstand der grammatischen Versuche begreifen? Welche ‚Wirklichkeit’ wird durch grammatische Betrachtung erforscht? Ginge es nur um den gegebenen faktischen Gebrauch, so würde zum Rätsel, wozu das Erfinden von Fällen und Zwischengliedern, wozu deren kunstvolles Arrangement mit gewöhnlichen Verwendungen nützlich sein sollte. Die Realität der durchschnittlichen Verwendung wäre ja viel eher einer soziolinguistischen _____________ 77 78 79 Hans Jörg Rheinberger: Experiment. Differenz. Schrift, a.a.O., S. 15f. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 385. Ebd., S. 578. Birgit Griesecke / Werner Kogge 124 Erhebung zugänglich, die – eventuell ebenfalls durch Experimente – das Material unserer jeweiligen sozialen Sprachkompetenz erforschte. Doch um dieses Material geht es nicht bei der grammatischen Betrachtung; es geht in ihr nicht darum zu erkunden, welcher Anteil einer Sprachgemeinschaft welchen Begriff in welchen Weisen gebraucht, sondern darum, in welcher Weise der Begriff sich gebrauchen lässt. Doch inwiefern kann diese Möglichkeit als empirische Wirklichkeit betrachtet werden, die experimentell zu erforschen ist? Wittgensteins Beispiel für ein Experimentieren durch Vorstellungen war die Situation ‚wie begrüße ich N?’ Fragt man, was hier erkundet wird, so heißt die Antwort: eine Verhaltensroutine, die im alltäglichen Leben nicht bewusst wird, die aber durch ausdrückliche Vergegenwärtigung vor sich gebracht werden kann. Wie wir angedeutet haben, bereitet dieses Beispiel der Auffassung der grammatischen Betrachtung als experimentelles Verfahren zwar das Feld, bleibt aber selbst ein Hybrid. Denn obschon hier durch Gedanken experimentiert wird, ist das, worauf sich das Erkenntnisstreben richtet, nicht ein Gedanklich-Begriffliches. Modifizieren wir das Beispiel nun so, dass es um den Begriff des Begrüßens, also um die Frage geht: Was würde ich (noch) als Begrüßung auffassen, dann gelangen wir ins genuine Feld der Versuche durch grammatische Betrachtung. Es ginge dann z.B. darum, ob und unter welchen Umständen es eventuell mit dem Konzept des Begrüßens vereinbar wäre, wenn N mir die Hand zum Gruß stoßartig mit ausgetrecktem Arm reichte. Gegenstand der grammatischen Untersuchung wäre hier nicht eine Verhaltensdisposition, sondern die Begründungen und Kriterien, die in der Situation eine Rolle spielen. Auch diese Untersuchung hat es mit konkreten Situationen zu tun, nämlich mit Anwendungsfällen, an denen sich die begrifflichen Kriterien mehr oder weniger reiben.80 Erforscht wird hier nicht ein außerhalb des Denkens Erfahrbares, ebenso wenig aber auch ein Denkmögliches jenseits der Erfahrungen; erforscht wird vielmehr das Gefüge aus Erfahrungen und Kriterien der Begriffsverwendung. Gedankenexperimente entdecken, wie unsere Begriffe in unserer Erfahrungswelt wurzeln, indem sie sie sowohl auf die Verwendungssituationen zurückführen, in denen sie unproblematisch arbeiten als auch so strapazieren, dass sie mit der (sozialen) Wirklichkeit unserer Erfahrungen inkompatibel werden. Was erkundet wird, ist also die empirische Wirklichkeit des Zusammenspiels von Begriffen und Erfahrungen. _____________ 80 Vgl. Werner Kogge: Das Gesicht der Regel: Subtilität und Kreativität im Regelfolgen nach Wittgenstein, in: Wilhelm Lütterfelds / Andreas Poser / Richard Raatzsch (eds.): Wittgenstein-Jahrbuch 2001/2002, Frankfurt a. M. 2003, S. 59-85. Ein Arbeitsprogramm, kein Abgesang 125 5. Nicht ohne Experimente: der Ausweg aus dem Fliegenglas Wir haben zu Anfang bereits angedeutet, dass die jüngere Debatte über die Philosophie Wittgensteins nur den Anschein erweckt, als reduzierte sich diese Philosophie auf eine Geste der Selbstüberwindung philosophischer Bemühungen. Gegen diese Beschränkung behaupten wir, dass der Gegenstand der philosophischen Methode, wie sie Wittgenstein seit Beginn der 30er Jahre entwickelt, nicht nur die Philosophie oder bestimmte philosophische Probleme (etwa bedeutungstheoretische) sind, sondern jedwedes Denken, insofern es in Bildern und Fallen befangen ist. Der therapeutische Impuls in Wittgensteins Spätphilosophie geht deshalb auch nicht dahin, uns von irgend etwas Bestimmtem zu befreien, schon gar nicht von der Philosophie selbst, sondern dahin, eine Methode zu entwickeln und vorzuführen, Verengungen, Verirrungen und Blockaden zu überwinden, in die das Denken sich immer wieder manövriert, da es die Möglichkeiten des Sprachgebrauchs nicht genügend überblickt. Dass der Überblick, auf den Wittgenstein hinaus will, sich auf Möglichkeiten richtet, kann nicht genug betont werden, denn dieser Aspekt birgt das entscheidende Moment, in dem sich Wittgensteins philosophische Methode vom wissenschaftlichen Verfahren der Untersuchung einer gegebenen Sprache abhebt. Nicht im bloßen Zurückführen, sondern im zurückführenden Hinausführen, liegt – pointiert gesprochen – das therapeutische Motiv der Wittgensteinschen Spätphilosophie. Eines der stärksten Bilder, das Wittgenstein zur Kennzeichnung seiner Arbeit benutzt, ist deshalb in der Formulierung ausgedrückt: „Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.“81 Diese Bemerkung, die Wittgenstein immer wieder an verschiedenen Stellen seiner Manu- und Typoskripte eingesetzt hat, entfaltet ihre Bedeutung, wenn man weiß, dass ein Fliegenglas eine Art Glockenform besitzt mit einer Öffnung unten. Genau dieser Ausweg, der als Eingang ganz unproblematisch war, bleibt der Fliege, deren schematische Bewegungs- und Fluchtrichtungen nach oben oder zur Seite gehen, unzugänglich, solange sie sich nicht von ihrer vorgeprägten Aktionsweise löst und – gegen ihren Trieb82 – die Richtung einschlägt, aus der sie gekommen ist. Eine solche Umwendung, die aus der Panik eines Gefangenseins erlöst, befreit tatsächlich aus einer Unruhe, löst tatsächlich aus scheinbarer Aporie und kann deshalb in einem gewissen Sinne als eine Therapie verstanden werden. Doch was Wittgensteins Methode für die Philosophie bedeutet, ist eben nicht die Auflösung des einen oder anderen metaphysischen Rätsels, auch nicht die Auflösung aller philosophischen Probleme; ihre eigentliche Leistung besteht vielmehr darin, Verfahren und Fähigkeiten vorgeführt zu haben, durch die _____________ 81 82 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 309. Ebd., § 109. 126 Birgit Griesecke / Werner Kogge begriffliche Probleme sich lösen lassen. Die Einsicht, dass die Sprache, dort, wo sie arbeitet, immer auch sachhaltig ist, ist die elementare Voraussetzung zum Verständnis dieser Methode. Denn nicht in einer Definition oder logischen Ableitung, sondern erst in der erprobenden Anwendung auf je konkrete Fälle stellt sich heraus, welche Koordinaten ein Begriff in unserer Erfahrungswelt, in unserer Lebensform einnimmt. Und weil diese Methode die Sprache als Organ unserer Weltverbundenheit ernst nimmt, sich also auf einen Bereich richtet, in dem wir stehen und von dem wir daher so wenig klar wissen, ist sie auf tentative Erkundungen, auf die Durchführung von Versuchen angewiesen. Epistemische Objekte als Zeichen- und Interpretationskonstrukte Günter Abel I. Epistemische Objekte – Gefährliche Dinge? Im Britischen House of Lords kam es vor einigen Jahren zu einer denkwürdigen Diskussion über die „Fullerene“, ein ausgezeichnetes Exemplar eines „epistemischen Objekts“. Fullerene (die im Jahre 1985 entdeckt wurden) sind Moleküle, die aus Kohlenstoff bestehen und die Form von hohlen fußballartigen Körpern besitzen. Ihren Namen verdanken sie dem amerikanischen Architekten Richard Buckminster Fuller, der durch die Konstruktion der geodätischen Traglufthalle bekannt wurde, die in ihrer Gestalt eine Ähnlichkeit mit der Struktur des Fullerene-Moleküls aufweist. Das Anhörungs-Protokoll des House of Lords enthält die folgende Passage: Baroness Sear: My Lords, vergeben Sie meine Unwissenheit; aber kann der edle Lord sagen, ob ein Fulleren ein Tier, ein Gemüse oder ein Mineral ist? (...) Lord Renton: My Lord, ich frage nach der Form des Fullerens: hat es die Form eines Rugby-Balls oder eines Fußballs? Lord Reay: My Lords, ich glaube, es hat die Form eines Fußballs. (...) Lord Campbell of Alloway: My Lords, was tut es? Lord Reay: My Lords, man denkt, dass es mehrere mögliche Verwendungen haben könnte: für Batterien, als Schmieröl oder als Halbleiter. All dies ist Spekulation. Es könnte sich auch herausstellen, dass es überhaupt keine Verwendung hat. Lord Russell: My Lords, kann man sagen, dass es nichts Besonderes kann, dies aber sehr gut tut? Lord Reay: Das könnte gut der Fall sein.1 Leicht mag man sich vorstellen, dass eine der weiteren Fragen hätte lauten können, ob Fullerene „gefährliche Dinge“ seien, ob nicht der Security Service eingeschaltet und insbesondere deren Abteilung MI 5 mit ihrer permanenten Observation betraut werden müsse. „Epistemische Objekte“ sind das, worauf sich in den Wissenschaften, in der Philosophie und in anderen Künsten unsere epistemische, d.h. unsere wissens- und erkenntnis-orientierte Aufmerksamkeit und Neugierde, unsere _____________ 1 Internetquelle: http://www.fkf.mpg.de/andersen/fullerene/lords.html. (deutsche Übersetzung G.A). 128 Günter Abel Wissens- und Denkanstrengungen richten. Sie sind die Objekte der intellektuellen Begierde in Theorie und Praxis.2 In den Wissenschaften ist dies der Fall auf dem ganzen Spektrum von z.B. Elementarteilchen, Molekülen, Genen, Buckminster Fullerenen, Hirnmechanismen, mathematischen Knoten, bis hin zu astrophysikalischen Galaxien. In der Philosophie reicht die Bandbreite epistemischer Gegenstände von z.B. Sinnesempfindungen, über Vorstellungen, Wahrnehmungen, Bedeutungen, Referenzen, Repräsentationen, Gedanken, bis hin zu Verstandes- und Vernunftkonstruktionen (wie etwa Kausalität, Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Idee, Gut und Böse). In Theorie und Praxis des Umgangs mit epistemischen Objekten möchten wir Näheres über sie und ihre Rolle in unserem Welt-, Fremd- und Selbstverständnis erfahren. Dabei ist mit der Frage nach den charakteristischen Merkmalen epistemischer Objekte im Kern die sinnkritische Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen des Wissens und Erkennens ebenso verbunden wie die Frage der Veränderung und der Transformation von Wissensordnungen.3 Im Folgenden konzentriere ich mich vor allem auf epistemische Objekte in den Wissenschaften. Und dort wiederum konzentriere ich mich auf die Rolle von Zeichen, Sprachen und Interpretationen hinsichtlich epistemischer Objekte und wissenschaftlicher Erfahrung. Vorschlagen möchte ich eine zeichen- und interpretationsphilosophische Konzeption epistemischer Objekte, eine Konzeption epistemischer Objekte als welterschließender Zeichen- und Interpretationskonstrukte in theoretisch-kognitiver ebenso wie in praktischtechnischer Hinsicht. II. Objektaspekt und Epistemikaspekt In Bezug auf die Rede von epistemischen Objekten denkt man zunächst an die Objektseite des Ausdrucks, also bei „Viren“ an tatsächliche Viren, bei „Elementarteilchen“ an tatsächliche Elementarteilchen oder bei „Wahrnehmungen“ an reale Wahrnehmungen. Aber offenkundig beschränkt sich der Sinn der Rede von epistemischen Objekten nicht auf diese Seite. Weitere semantische Merkmale kennzeichnen den Ausdruck. Wichtig ist zunächst zwischen der Objektseite bzw. dem Objektaspekt und der Epistemikseite bzw. dem Epistemikaspekt zu unterscheiden. Freilich ist diese Unterscheidung eine nur _____________ 2 3 Zu den Merkmalen epistemischer Objekte und zu ihrer Rolle für eine zeitgemäße Epistemologie vgl. im einzelnen G. Abel: Epistemische Objekte - was sind sie und was macht sie so wertvoll? Programmatische Thesen im Blick auf eine zeitgemäße Epistemologie, in: Pragmata. Festschrift für Klaus Oehler, Tübingen 2008, S. 285-298. Zu letzterem vgl. G. Abel: Die Transformation der Wissensordnungen und die Herausforderungen der Philosophie, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, 34 (2009), S. 5-28. Epistemische Objekte 129 heuristische und darstellerische (nicht eine theoretische). In der Sache gilt, dass Objektaspekt und Epistemikaspekt intern so miteinander verschränkt sind, dass sie zwei Seiten ein und derselben Medaille bilden. Aber – und das ist wichtig – im Epistemikaspekt werden wir sogleich auf die zentrale Funktion der Zeichen, Sprachen und Interpretationen aufmerksam. Jedes epistemische Objekte und mithin jede Konzeption der Wirklichkeit ist von der Grammatik und den Regeln der verwendeten und epistemisch wirkenden Zeichen- und Interpretationsfunktionen abhängig. Das, was im Sinne der oben genannten Beispiele epistemischer Objekte als ein Gegenstand unserer Aufmerksamkeit und Neugierde, unseres Wissens, unserer Erfahrung und unseres Erkennens zählt, ist unter kritischem Vorzeichen stets bereits „Gegenstand in der Aufmerksamkeit, in der Neugierde, im Wissen, in der Erfahrung und im Erkennen“. Berechtigterweise kann in Bezug auf jedes individuierte Stück Erfahrung die Frage nach den Instrumenten der Individuation, der Diskrimination und der Spezifikation der jeweiligen Gegenstände und Erfahrungen gestellt werden. Annehmen zu wollen, dass die für uns relevante Welt, die Welt, auf die wir uns verstehen, als eine gänzlich geist- und schematisierungsunabhängige, als eine gänzlich nicht-epistemische Welt vorfabriziert individuiert fertig daliegt, wäre sinnkritisch nicht explizierbar. Wir können die epistemische Situation der endlichen menschlichen Geister nicht überspringen. In diesem Sinne kann jede Welt als eine Zeichen- und Interpretationswelt angesehen, konzipiert und modelliert werden. Dieser interne Zusammenhang von Epistemikaspekt und Objektaspekt bildet den Kern und den heuristischen Ausgangspunkt der Allgemeinen Zeichen- und Interpretationsphilosophie.4 III. Die Individuation materieller Objekte und Ereignisse kraft epistemischer Zeichen und Interpretationen Hervorzuheben ist, dass die skizzierte Sichtweise weder in Bezug auf die verwendeten Zeichen- und Interpretationssysteme noch hinsichtlich des Sinns der Rede von „epistemischen Objekten“ in einen Idealismus führt. Epistemische Objekte (wie z.B. Fullerene, Elementarteilchen, Gene, Hirnmechanis_____________ 4 Deren Grundzüge werden näher entfaltet in G. Abel: Interpretationswelten. Gegenwartsphilosophie jenseits von Essentialismus und Relativismus, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1995; Abel: Sprache, Zeichen, Interpretation, Frankfurt a. M. 1999; und in Abel: Zeichen der Wirklichkeit, Frankfurt a. M. 2004. Zum Ansatz insgesamt vgl. die treffliche Darstellung bei U. Dirks: Interpretation / Interpretationsphilosophie, in: Enzyklopädie Philosophie, hrsg. von H. J. Sandkühler, 2. Auflage, Hamburg 2009. Günter Abel 130 men) sind keine idealistischen Konstrukte im Sinne bloßer Bedeutungen und Referenzen.5 Unter einem Idealisten in puncto „epistemische Objekte“ verstehe ich jemanden, der auf die Frage „Wovon handelt und worauf bezieht sich die Rede von epistemischen Objekten, z.B. von „Elementarteilchen“ oder „Galaxie“?“ letztlich antwortet: „Auf die Idee/Proposition ‚Elementarteilchen’ oder ‚Galaxie’ als Bedeutung und Referenz des Wortes bzw. des Einwortsatzes“. Doch diese Antwort ist offenkundig nicht zutreffend. Die Rede vom epistemischen Objekt „Elementarteilchen“ handelt von und bezieht sich auf materielle Elementarteilchen, nicht auf die Proposition „Elementarteilchen“ als Bedeutung des Satzes oder Ausdrucks. Und dass es Elementarteilchen gibt ist die Erfüllungsbedingung der erfolgreichen Rede vom epistemischen Objekt „Elementarteilchen“. Epistemische Objekte sind keine idealistischen Konstrukte. Sie können vielmehr als die realen Objekte des wissenschaftlichen Forschens und der philosophischen Reflexion konzipiert werden. Ein epistemisches Objekt ist – um eine Kantische Unterscheidung ins Spiel zu bringen – weder bloß ein Phaenomenon (im Sinne eines Gegenstandes als Erscheinung) noch ein Noumenon (im Sinne des unbestimmten Begriffs von einem Etwas überhaupt, das außerhalb der Sinnlichkeit gedacht wird). Aber es ist im Hinblick auf das, was für endliche menschliche Geister überhaupt Gegenstand eines gehaltvollen wissenschaftlichen Forschens und einer gehaltvollen philosophischen Reflexion sein kann, intern stets bereits vorausgesetztes und als real präsupponiertes Zeichen- und Interpretationskonstrukt. In den Wissenschaften besteht ein interner Zwang zur Bildung epistemischer Objekte, da Wissenschaften Wirklichkeit nicht einfach so beschreiben und abbilden, wie diese uns alltäglich begegnet. Vielmehr geht es in den Wissenschaften darum, in bestimmten Hinsichten und unter relevanten Aspekten Regelhaftigkeiten, Ordnungen, Strukturen und Gesetzesartigkeiten herauszupräparieren, die so zuvor noch nicht bekannt waren. In diesem Sinne sind z.B. „Strukturen“ ausgezeichnete epistemische Objekte in der Grundlagenphysik. Die Bildung solcher epistemischer Objekte (einschließlich der mit ihnen verbundenen möglichen wissenschaftlichen Hypothesen und Theorien) erfolgt ebenso wie die Artikulation und die Kommunikation der Resultate wissenschaftlichen Forschens in der Scientific Community mit Hilfe, genauer: kraft Sprache, allgemeiner: kraft Zeichen und Interpretationen. Dabei ist hinsichtlich szientifischer Objekte heute nicht mehr nur darauf zu achten, dass diese allgemein in Theorien konstituiert werden. In vielen Bereichen geht es vor allem auch darum, wie speziell durch den Einsatz von Methodendesign, Fachsprachen, Mathematisierung und gegenwärtig zunehmend _____________ 5 Vgl. im einzelnen Abel: Epistemische Objekte - was sind sie und was macht sie so wertvoll? Programmatische Thesen im Blick auf eine zeitgemäße Epistemologie, a.a.O., Punkt 4. Epistemische Objekte 131 durch den Einsatz von Computern auf die Objektindividuation Einfluss genommen wird. In den modernen Wissenschaften sind zudem vornehmlich auch diejenigen epistemischen Objekte von besonderer Wichtigkeit, die nicht in unsere direkte sinnliche Wahrnehmung fallen, sondern nur über komplizierte Zeichen- und Interpretationsvorgänge wie insbesondere aufgrund von Wirkungen und Messungen ausgemacht werden können. Man denke exemplarisch an die Bereiche Mikrophysik, Nanotechnik oder Genetik. In sprach-, zeichen- und interpretationsphilosophischer Perspektive ist dabei das Verhältnis besonders wichtig, das zwischen dem Wandel der semantischen Merkmale (Bedeutung, Referenz, Wahrheits- oder Erfüllungsbedingungen) von Termini und Begriffen (z.B. von „Atom“, „Gen“) einerseits und dem entsprechenden Wandel der darin ausgedrückten, bedeuteten und referierten Objekte andererseits besteht. Die schleifenförmig in sich zurücklaufende Struktur des Verhältnisses von Epistemikaspekt und Objektaspekt, von epistemischen Objekten und materiellen Objekten (generell: von epistemischen Zeichen und materieller Wirklichkeit) ist z.B. auch für die Sprache und Logik der Physik, insbesondere der Quantenphysik kennzeichnend. So denotiert, beschreibt und artikuliert z.B. ein mathematischer Formalismus die Zustände eines physikalischen Systems kraft Zeichen, im Beispiel: kraft mathematischer Größen, etwa durch Vektoren. Darüber hinaus noch einmal trennscharf zwischen den Zeichenfunktionen einerseits und den gänzlich zeichen- und interpretationsunabhängigen Zuständen, Ereignissen und Prozessen andererseits unterscheiden zu wollen, führt, zumindest in epistemologischer Hinsicht, in bekannte und letztlich desaströse Schwierigkeiten. Diese gleichsam nach Art eines Möbius-Bandes in sich zurücklaufende Struktur gilt generell für das Verhältnis von epistemischen Objekten und materiellen Objekten des Forschens und der Reflexion. Jenseits des erfolgreichen Erforschens von und Reflektierens auf epistemische Objekte noch einmal nach den gänzlich nicht-epistemischen Objekten-an-sich und deren nichtepistemischen Eigenschaften-an-sich fragen zu wollen, verkennt von Grund auf die nicht zu überspringende Tiefenwirkung „epistemischer Objekte“ für das, was überhaupt als ein Gegenstand der Erfahrung, des Wissens und Erkennens gelten kann. Im Falle der Physik wird zugleich deutlich, auf welch tiefsitzende und drehtürartige Weise vor allem die dort überaus relevante mathematische Modellierung und die darin denotierten und erfassten Zustände, Ereignisse und Prozesse intern ineinander liegen. In diesem Sinne kann die ganze Betrachtung in Sachen epistemische Objekte und die auf epistemische Objekte bezogene Rede von „ontologischen Verpflichtungen“ („ontological commitments“; Quine) aus dem Würgegriff der Dichotomie von „materiellem Naturalismus“ und „begrifflichem bzw. sprachlichem/linguistischem 132 Günter Abel Idealismus“ herausgeholt, auf die Ebene der Zeichen- und Interpretationsverhältnisse überführt und dort rekonstruiert, modelliert und weitergeführt werden. Das läuft auf eine adualistische Zeichen-und-Interpretationstheorie epistemischer Objekte hinaus, die sich erklärtermaßen jenseits der inzwischen steril gewordenen Dichotomie von „konstruktionalistischem Idealismus“ und „metaphysischem Realismus“ bewegt. IV. Sprach-, Zeichen- und Interpretationscharakter der Wissenschaften Der Sprach-, Zeichen- und Interpretationscharakter der Wissenschaften ist unter zumindest drei Gesichtspunkten offenkundig:6 (1) Jede Wissenschaft ist auf Sprache und Zeichen gebaut und setzt damit intern zugleich die Interpretation dieser Sprache und Zeichen voraus. Im Falle der Naturwissenschaften ist dies vor allem die Sprache der Mathematik. Modelle, Beschreibungen, Hypothesen, Theorien und Begründungen in den Wissenschaften werden in öffentlichen, mit anderen Forschern geteilten Sprachen und Zeichen artikuliert, kommuniziert und intersubjektiv überprüft. Bedeutung (mithin das, wovon die Ausdrücke handeln) und Referenz (mithin das, worauf sie sich beziehen) aller Sprachen, zumal der Sprachen der Wissenschaften sowie ihrer epistemischen Ausdrücke und Termini (wie z.B.: „Gen“, „Molekül“, „Gravitation“, „Feld“) sind Ergebnis öffentlicher Interaktion in Sprache und Zeichen, im Falle der Wissenschaften interaktiver Verständigung in der Scientific Community. (2) Hinsichtlich des Verhältnisses von „Realitätsausschnitt und Sprache“ wird man sich leicht darauf verständigen können, dass sich die ModellRealität-Verhältnisse in Zeichen vollziehen. Sie vollziehen sich nicht bloß vermittels, sondern kraft der Zeichen, des näheren der Modell-Zeichen und ihrer Interpretation. Modelle können als Zeichen- und Interpretationskonstrukte verstanden werden. Und dies wiederum erfolgt nicht so, dass zwischen „Zeichen“ und „Tatsachen“ (etwa zwischen dem mathematischen Formalismus und der durch diesen individuierten und artikulierten Realität) epistemische Vermittler und Zwischen- oder Überbrückungs-Instanzen anzusetzen wären, die den Zeichen ihre symbolisierende Kraft und ihre Repräsentationsleistung allererst zukommen lassen. Zeichen sind in ihren Zeichenfunktionen keine Stellvertreter der Gegenstände, von denen sie handeln und auf die sie sich beziehen (z.B. von Galaxien oder von mikrophysikalischen Ereignissen) und sie bedürfen in ihren Zeichenfunktionen keiner weiteren epistemischen Ver_____________ 6 Vgl. dazu G. Abel: Zeichen der Wirklichkeit, Frankfurt a. M. 2004, Einleitung, S. 47-48 und S. 39. Epistemische Objekte 133 mittlungsstücke. Dies wirft die Frage auf, wie es uns kraft der verwendeten und verstandenen Zeichen eigentlich gelingt, das zu benennen, zu beschreiben oder zu repräsentieren, was wir ohne Zeichen- und Interpretationsfunktionen gar nicht als Wirklichkeit erfahren könnten. (3) Angesichts des direkten Weltbezugs kraft Zeichen kann im Falle erfolgreichen Zeichenverwendens und Zeichenverstehens letztlich nicht mehr verständlich gemacht werden, was es heißen soll, zwischen dem erfolgreichen Zeichengebrauch und der Wirklichkeit resp. der darin beschriebenen Realität eine logische Kluft ansetzen zu wollen. Vielmehr handelt es sich um „Zeichen der Wirklichkeit“ im genitivus objectivus und subjectivus. Daher kann es auch nicht mehr darum gehen, eine Brücke von den Zeichen zur Wirklichkeit zu schlagen und zu diesem Zwecke etwa Brückenprinzipien anzusetzen oder nach solchen zu fahnden. Die Pointe liegt vielmehr darin, dass die Wirklichkeit im erfolgreichen Verwenden und Verstehen der Zeichen intern immer schon bei den Zeichen ist, und diese nicht erst noch mit jener in eine externe Verbindung gebracht werden müssen. Wenn man aufgefordert wird, eine semantische Charakterisierung der Ausdrücke, sagen wir: „Elementarteilchen“, „Molekül“, „Virus“ oder „neuronales Assembly“ zu geben, so wird man schnell genötigt, etwas über die materielle Beschaffenheit von Elementarteilchen, Molekülen, Viren und neuronalen Assemblies sagen zu müssen. Und im Sinne genau dieses Drehtüreffekts ist Wirklichkeit stets ebenso zeichen- und interpretations-abhängige Wirklichkeit wie umgekehrt in funktionierenden Zeichen Wirklichkeit stets bereits präsupponiert, gegeben ist. Mit dem Drehtür-Genitiv der Formulierung „Zeichen der Wirklichkeit“ haben wir es auch im Bereich der Wissenschaften und ihrer Modelle, Sprachen, Zeichen und Interpretationen zu tun. Ist das Verhältnis zwischen epistemischen Objekten/Ereignissen und materiellen Objekten/Ereignissen nicht als ein Dualismus, sondern als der skizziert schleifenförmige Drehtüreffekt, als die zwei Seiten ein und derselben Medaille zu konzipieren, dann handelt es sich in puncto Repräsentation nicht mehr um Verhältnisse der Isomorphie, des kopierenden oder mimetischen Spiegels, der Fotographie, sondern um Verhältnisse des Passens. Repräsentation ist daher nicht mehr vorzustellen im Sinne des älteren Modells der Repräsentation als eine zwei-stelligen Relation („x repräsentiert y“). Vielmehr ist, noch im älteren Modell von Repräsentation und bewusst paradox gesprochen, eine nicht-repräsentationalistische Theorie der Repräsentation erfordert. Das ist das Desiderat. Entsprechend kann die zeichen- und interpretationstheoretische Konzeption der epistemischen Objekte und der Repräsentation nicht mehr im Sinne des älteren Repräsentationalismus verstanden werden. Die Kunst besteht darin, die entsprechenden Verhältnisse des skizzierten Drehtüreffektes in Sachen epistemische Objekte nicht mehr im alten Sinne repräsentationalistisch zu denken, sondern vielmehr z.B. das Wahrnehmen als Günter Abel 134 einen nicht-repräsentationalistischen Prozess zu konzipieren und zu modellieren. Im Beispiel und im Sinne der drehtürartigen Struktur könnte man zugespitzt sagen: die interpretatorischen Perzeptual-Zeichen formen die Wahrnehmungsobjekte bzw. Perzepte, die ihrerseits und ohne weitere epistemische Vermittler die Erfüllungsgegenstände der Perzeptual-Zeichen sind. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: die Zeichenverfasstheit einer „Adler“-Wahrnehmung macht auch erst, dass der wahrgenommene Adler der Erfüllungsgegenstand der Wahrnehmung des Adlers ist.7 Eine mit dieser Auffassung verbundene Herausforderung besteht in der Frage, wie man sinnvoll überhaupt von nicht-linguistischen, nicht-propositionalen und nicht-begrifflichen, jedoch gleichwohl diskriminierten und individuierten Formen und Gehalten sensorischer sowie perzeptueller Erfahrung sprechen kann. Die zeichen- und interpretationsphilosophische Antwort auf diese Frage besteht vor allem darin, zwischen der urteilsgrammatischen Sprachabhängigkeit im engeren Sinne und der (nicht-sprachliche Zeichen einschließenden) Zeichen- und Interpretationsgebundenheit im weiteren Sinne zu unterscheiden. In einem solchen Horizont sind sprachunabhängige und nicht-propositionale Gehalte ohne Schwierigkeiten konzipierbar, sofern diese eben innerhalb des weiter gefassten Rahmens der nicht-sprachlichen Zeichen- und Interpretationsverfasstheit gesehen werden.8 Sinnwidrig wird die Betrachtung unter kritischem Vorzeichen erst dann, wenn auch aus der Zeichen- und Interpretationsgebundenheit herausgesprungen werden und ein gänzlich nicht-epistemischer, gar ein absoluter externer Standpunkt eingenommen werden soll. Ein solches Unterfangen wäre selbst-destruktiv hoch angesetzt und erwiese sich eben darin als unvernünftig. V. Epistemische Objekte als Zeichen- und Interpretationskonstrukte Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten kann man die szientifischen epistemischen Objekte, Zustände, Phänomene und Prozesse als Zeichen- und Interpretations-Objekte, -Zustände und -Prozesse konzipieren und modellieren. Dabei sind die epistemischen Objekte, die Zeichen und die Interpretationen nicht bloß sekundär und nicht bloß instrumentell miteinander verbunden. Vielmehr können wir (in Abwandlung einer Formulierung von Charles S. _____________ 7 8 Vgl. dazu im einzelnen G. Abel: Zeichen- und Interpretationsphilosophie der Wahrnehmung, in Abel: Wissen in Zeichen, 2010. Zu dem damit verbundenen Unterschied zwischen einem Sprach-Nominalismus und einem Zeichen-Nominalismus vgl. näher G. Abel: Zeichen der Wirklichkeit, a.a.O. Kap. 8. Epistemische Objekte 135 Peirce in Bezug auf den inneren Zusammenhang von Zeichen und Denken) sagen: „es gibt keine epistemischen Objekte ohne Zeichen und Interpretation“ bzw. ins Positive formuliert: „wir haben epistemische Objekte nur kraft Zeichen und Interpretation“. Der Zusammenhang zwischen „epistemischen Objekten“ und „Zeichen- und Interpretationsprozessen“ ist intern, nicht extern. Er meint nicht nur die Verstrickung der Rede von „Gegenständen als Gegenständen“ in begriffliche und konzeptionelle Aspekte. Die ursprüngliche Zeichen- und Interpretationsverstrickung geht über die sprachlichpropositionalen Aspekte und auch über die bekannte Rede von der Theoriegeladenheit epistemischer Objekte ebenso hinaus wie über die Grammatik des sprachlichen Urteils in Bezug auf Merkmale und Eigenschaften epistemischer Objekte. Sie betrifft die zeichen- und interpretations-bestimmten Prozesse der Objekt-Individuation selbst. Sie ist bereits auch in den zeichen- und interpretations-bestimmten Prozessen der Diskrimination und Individuation epistemischer Objekte auf der Ebene vor-sprachlicher und vor-propositionaler Muster-, Form- und Gestaltbildungen gegeben. Und sie setzt sich fort in den Prozessen und Resultaten der Wahrnehmung, des Denkens und des Handelns. Beide, die Konstitution epistemischer Objekte ebenso wie die Artikulation und Kommunikation der Resultate wissenschaftlicher Forschung, sind konditional an Zeichen und Interpretation gebunden. Zeichen, Sprache und Interpretation begleiten Wissen, Wissenschaft und Erfahrung keineswegs in einem bloß sekundären und instrumentellen Sinne. Sie sind vielmehr konstitutiv für szientifisches Diskriminieren, Individuieren, Spezifizieren, Wissen und mithin für die szientifische Erfahrung selbst. Zugleich tritt der weitere und kardinale Punkt hervor, dass die in wissenschaftlichen Experimenten zu Tage tretenden Phänomene, Daten und Befunde einerseits selbst etwas sind, was es zu verstehen gilt (sie mithin Zeichen im weiten und eher passivischen Sinne sind), andererseits jedes Experiment eine Interpretation erfordert. Offenkundig haben Zeichen- und Interpretationssysteme einen weitreichenden und wesentlichen Einfluss auf die Art und Weise, in der Wissen konstituiert, artikuliert, erworben, kommuniziert und verwendet wird. Man denke etwa an die bereits erwähnte Rolle der mathematischen Notation in den Wissenschaften oder an die Relation zwischen Sprache/Wort und Bild im Wissen und in den Wissenschaften (unter Einschluss sowohl ästhetischer als auch epistemologischer Aspekte, wie z.B. im Falle des „Magnetic Resonance Imaging (MRI)“). Die Prozesse der Interaktion bzw. des Wechselspiels von Zeichen- und Interpretationssystemen verdient eine sehr viel größere Aufmerksamkeit als dies in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Zu nennen wäre etwa der wichtige Einfluss, der gegeben ist durch die zeichen- und interpretations-basierten Werkzeuge/Instrumente wie etwa chemische Formeln, Klassifikationstafeln, MR-imaging, Computergraphiken, Computersimulationen, Günter Abel 136 Computer als symbolische Maschinen im Sinne des Vollzugs algorithmischer Kalkulationen und logischer Operationen in den Wissenschaften. Wissen zu haben, Erfahrungen zu machen, Wissenschaft zu treiben, Tatsachen und Sachverhalte zu schaffen, – alle diese Aktivitäten sind offenkundig ohne den Einsatz von Zeichen und Interpretationen nicht möglich. Die Formen der zeichen- und interpretationsbasierten Symbolisierungen in Wissen, Wissenschaft und Erfahrung (wie z.B. in Theorien, Modellen, Hypothesen, Bildern, Graphen, Diagrammen, Datenbanken, Sammlungen, Simulationen) differieren auf signifikante Weise im Laufe der Zeit und über die Jahrhunderte ebenso wie zwischen den Kulturen. Das gleiche gilt für die zeichen- und interpretations-basierten Wege der Systematisierung des Wissens und der Wissenschaften in Wissensordnungen (in z.B. Theoremen, Beweisen, Handbüchern, Forschungsjournalen, Forschungsberichten, Sammlungen, im Generieren, Konservieren, Revidieren von Wissen ebenso wie in dessen Degeneration und Verlust), – alle diese Aktivitäten und Prozesse waren und sind signifikantem Wandel unterworfen. Gegenwärtig stellen neue Transformationen der Wissensordnungen eine besondere Herausforderung für Philosophie, Wissenschaften und andere Künste dar.9 Durch diese Prozesse der Modifikationen in der Symbolverwendung bzw. des Wandelns in den Zeichen- und Interpretationspraktiken hindurch bleibt jedoch als entscheidend festzuhalten: gänzlich zeichen- und interpretations-freie Profile des menschlichen Wissens, der Wissenschaften und der Erfahrung sind nicht verständlich zu machen. Der Wandel der Zeichen- und Interpretationsfunktionen und deren semantischer Merkmale tut der These von der Zeichen- und Interpretationsgebundenheit eines jeden menschlichen Wissens nicht nur keinen Abbruch. Er lässt sie vielmehr umso deutlicher hervortreten, indem er die Aufmerksamkeit auf das lenkt, was man die historische und kulturspezifische Seite der Zeichenund Interpretationsprozesse nennen muss. In diesem Sinne muss der kognitive ebenso wie der historische Zugang zur konstitutiven Rolle der Zeichen und Interpretationen im Wissen, in den Wissenschaften und in der Erfahrung eine Erweiterung um zwei intern ineinander verwobene Perspektiven erfahren: um eine allgemeine Theorie der Zeichen und der Interpretationen. Diese erstreckt sich auf alle unterschiedlichen Formen, Praktiken und Dynamiken von Wissen, Wissenschaft und Erfahrung. Die Frameworks des Denkens können als Modi des Zeichengebrauchs und darin intern als stets bereits vorausgesetzte öffentliche Praxis der Zeichen-Interpretation konzipiert werden. Diese differieren über die Zeit und zwischen den Kulturen und können durchaus zu „clashes“ des Wissens, der Wissenschaften und der Erfahrungen führen, – was heute in vielen Fällen auch tatsächlich der Fall ist. Man denke etwa nur an die ethischen Fragen, die _____________ 9 Vgl. dazu G. Abel: Die Transformation der Wissensordnungen, a.a.O. Epistemische Objekte 137 mit dem biotechnologischen, neuroprothetischen, nanotechnologischen und medizinischen Fortschritt in den gegenwärtigen Wissenschaften einhergehen (in letzterem Bereich etwa an das Konzept des Gehirntods). Zur konstitutiven Rolle der Zeichen und Interpretationen in den Formen und Praktiken des Wissens und der Wissenschaften gehört auch, was Nelson Goodman einmal die „suggestive power of symbols“10 genannt hat. Damit ist der überaus spannende und grundlegende Punkt gemeint, dass wir z.B. an einem mathematischen oder chemischen oder diagrammatischen Formalismus eine Modifikation vorzunehmen bereit sind, schlicht aufgrund der suggestiven Kraft des Formalismus hinsichtlich seiner möglichen Fortsetzbarkeit, Abkürzung oder Pointierung. Aufgrund der skizzierten schleifenförmigen Rückbindung der Zeichen an das, was als das Denotat eines Zeichens gilt, gehen die suggestiven Veränderungen der Zeichen, Symbole und Interpretationen als realitäts-erschließende Kräfte an die so erschlossenen und kraft des Formalismus bestimmten Wirklichkeiten über. Solche Zeichen-Modifikationen werden in den empirischen Wissenschaften dann zurückgebunden an das Experiment. Arbeit am Zeichen-Formalismus wird zu einer Methode, um ein neues Experiment-Design zu entwerfen, und das heißt auch: neue wirklichkeits-erschließende Aspekte ebenso zu eröffnen wie Grenzen der Theorien abzustecken. Wie aber genau bildet sich ein „epistemischer Gegenstand“ und wie der intern korrelierte „Begriff“ des Gegenstandes heraus, sofern in jede Gegenstandskonstitution auch begriffliche Aspekte involviert sind, und umgekehrt? Gegenstandskonstitution und Begriffskonstitution hängen intern und drehtürartig miteinander zusammen. Epistemische Objekte ohne begriffliche Komponenten sind – um Kants berühmtes Diktum abzuwandeln – „blind“, und Begriffe ohne epistemisch-materialen Gehalt sind „leer“, d.h. keine empirisch gehaltvollen Begriffe. Die hier relevante zeichen- und interpretations-konstruktionale Seite tritt schlagartig in den Blick, sobald wir „Begriffe“ nicht mehr weder als mentale Entitäten ansehen (deren wir auf dem Wege einer introspektionistischen Schau ansichtig werden könnten) noch als dasjenige verstehen, was durch eine Auflistung von Prädikatoren (z.B. des Begriffs „Haselnuss“ durch Prädikatoren wie „hartschalig“, etc.) gebildet wird. „Begriffe“ können vielmehr, mit Hilary Putnam11 gesprochen, als Zeichen angesehen werden, die auf eine bestimmte Weise verwendet werden, nämlich: situationsgerecht und regelgemäß. Über einen Begriff verfügt man dann, wenn man die volle Bedeutung _____________ 10 11 N. Goodman: Ways of Worldmaking, Cambridge 1978. Vgl. H. Putnam: Reason, Truth and History, Cambridge 1981, S. 18 ff. Günter Abel 138 des entsprechenden Wortes kennt12, und dies ist der Fall, wenn man das Wort bzw. das Zeichen situationsgerecht und regelgemäß zu verwenden und zu verstehen weiß. In diesem Sinne ist sowohl die Rede von „epistemischen Objekten“ als auch die damit korrelierte Rede vom „Begriff“ des Gegenstandes zeichen- und interpretations-abhängig, denn die Bedeutung eines Zeichens angeben heißt, die angemessene Interpretation des Zeichens liefern. In allen Bereichen der genannten Spektren in Wissenschaft, Philosophie und anderen Künsten sind epistemische Objekte nicht einfach vorfabriziert fertig in der Welt herumliegende Objekte, die darauf warten, in unserem Sprechen, Denken, Experimentieren und Handeln repräsentiert und erfasst zu werden. Vielmehr haben sie stets bereits eine Genealogie und Konstruktionsgeschichte hinter sich und ihre Entwicklung und Zukunft, gleichsam ihr „Schicksal“, noch vor sich. Epistemische Objekte sind nicht einfach da. Sie entstehen als Zeichen- und Interpretationskonstrukte aus einem Geflecht von theoretisch-begrifflichen, praktischen und anschaulich-ästhetischen Interessen, im Zuge von Auffälligkeiten sowie aus sensorischen, perzeptuellen, verstandes- und handlungsmäßigen Netzwerken und Hintergründen heraus und auf diese hin. Daher können epistemische Objekte auch alt werden und ihre bis dato die Aufmerksamkeits-, die Wissens- und die Erkenntnisanstrengungen motivierende und orientierende Kraft verlieren. Epistemische Objekte können sterben. Manche von ihnen besitzen eine lange Lebensdauer, andere sind eher kurzlebiger (hin und wieder auch bloß modischer) Art. Epistemische Objekte sind ihrer Natur nach epistemische Objekte auf Zeit. Von hoher Relevanz ist auch das Verhältnis von „epistemischen Objekten“ und „Modellierung“. Unter den Gesichtspunkten der Schematisierung und Formatierung eines Gegenstandes als Gegenstand und unter zeichen- und interpretations-konstruktionalen Gesichtspunkten kann die Artikulation vieler epistemischer Objekte als eine Form der Modellierung, also in dem Sinne verstanden werden, in dem z.B. die konkrete Bewegung der Planeten ein Modell des Keplerschen Gesetzes ist. Freilich gilt das nicht für alle epistemischen Objekte. Dass dies nicht so ist, verhindern letztlich auch die evaluativen und normativen Aspekte, die mit dem Verhältnis von epistemischen Objekten und epistemischen Rechtfertigungen verbunden sind. Deutlich wird aber auch im Rahmen der Modellierungsfrage der enge Zusammenhang zwischen Modellierung, wissenschaftlichem Realismus und epistemischer Rechtfertigung. In der Ausarbeitung dieses Punktes muss deutlich unterschieden werden zwischen den Objekten der „Philosophie und Geschichte des Wissens und der Wissenschaften“ und den „Objekten der Wissenschaften selbst“ sowie _____________ 12 Solche Rede von der „vollen“ Bedeutung impliziert keineswegs die Annahme einer definitiven, abschließenden, endgültigen, unveränderbaren oder ultimativen Bedeutung eines Wortes. Doch dieser Unterschied soll hier nicht weiter verfolgt werden. Epistemische Objekte 139 den „Objekten des alltäglichen Lebens“. Die Objekte der Wissenschaftsphilosophie sind nicht die Objekte der Wissenschaften und beide wiederum sind nicht mit den Objekten der alltäglichen Welt gleichzusetzen. Dass die Zeichen- und Interpretationsphilosophie epistemischer Objekte grundlegender ist als die Theorie darüber, „was es gibt“, mithin grundlegender als die Ontologie ist, manifestiert sich vor allem unter zwei Aspekten. Zum einen (a) liegt den epistemischen Objekten eine Zeichen- und InterpretationsGenealogie bereits im Rücken und können epistemische Objekte als Zeichenund Interpretations-Konstrukte modelliert werden. Zum anderen (b) rekurriert die epistemische Rechtfertigung im Sinne des drehtürartigen Passens nicht auf überzeitliche und/oder ideale Entitäten, Standards und Normen. Jede Ontologie setzt eine Zeichen- und Interpretationstheorie bereits voraus, nicht umgekehrt. Entsprechend liegt die Theorie epistemischer Objekte innerhalb der allgemeinen Zeichen- und Interpretationstheorie. Jene können auf dem Boden dieser modelliert werden, nicht umgekehrt. VI. Diskrimination und Individuation als Zeichen- und Interpretationsprozesse Auf der ganzen Bandbreite und in allen unterschiedlichen Kontexten des Sinns der Rede von „epistemischen Objekten“ sind zwei grundlegende Fähigkeiten stets bereits vorausgesetzt und in Anspruch genommen: dass wir in der Lage sind zu diskriminieren und zu individuieren. Von epistemischen Objekten und komplementär von epistemischer Rechtfertigung sprechen zu können, setzt die Diskrimination und die Individuation von Gegenständen als Gegenständen bereits voraus. Die elementarste Stufe der Diskrimination ist die sensorische, die Fähigkeit, sinnliche Qualitäten (wie z.B. Farben oder Töne, aber auch Zustände wie Lust, Schmerz, Angst) unterscheiden zu können. Mit der Fähigkeit zur Diskrimination ist intern die Fähigkeit zur Individuation sensorischer und perzeptueller Objekte und Ereignisse verbunden. Wichtig ist zunächst zu sehen, dass die beiden Fähigkeiten des phänomenalen Diskriminierens und Individuierens diesen grundlegenden Status besitzen. Sodann ist von kardinaler Bedeutung, dass sie bereits vor unseren verstandesbestimmten Klassifizierungen und bereits vor unserer Fähigkeit funktionieren, über die so bestimmten Gegenstände dann auch zu epistemischen Meinungen, Überzeugungen, Experimentalanordnungen und zu ganzen Theorien zu gelangen und diese Komponenten mit epistemischen Rechtfertigungen zu korrelieren. Dass diese vor-theoretischen Schematisierungen gegeben sind und funktionieren, sieht man z.B. im Falle eines Kleinkindes daran, dass dieses in Bezug auf Objekte und Ereignisse in der Welt zwar noch nicht das 140 Günter Abel entsprechende Sprach- und Begriffs-Spiel gelernt hat, offenkundig aber dennoch bereits über Fähigkeiten des Diskriminierens und Individuierens von Objekten und Ereignissen verfügt (Objekte z.B. voneinander unterscheiden, sie identifizieren und re-identifizieren und sensorische Unterschiede in Bezug auf Klänge und Farben registrieren zu können). Zeichen- und interpretationsphilosophisch sind hier vor allem zwei Aspekte zu betonen. Erstens, dass das sensorische Diskriminieren und Individuieren noch nicht an sprachliche (gar urteilsgrammatische) Zeichen, des näheren noch nicht an konzeptionelle Voraussetzungen gebunden ist. Zweitens, dass das Diskriminieren und Individuieren aber ganz offenkundig – man denke an Empfindungsgehalte, Gestalterfassung, Musterbildungen, sensorisch feinkörnige Unterscheidungen zwischen Farben, zwischen Klängen, zwischen Gerüchen – Vorgänge bzw. Ereignisse in Zeichen, in bzw. kraft nichtsprachlicher Zeichen sind. Des näheren sind hier die Prozesse zu nennen des phänomenalen Unterscheidens, der sinnlichen Schematisierung, der sensorischen Umgrenzung, der phänomenalen Gestalt- und Musterbildung, der perzeptuellen Klassifikation etwa kraft Bilder (z.B. auf Flughäfen, in Bahnhöfen, im Blick auf WC-Anlagen, etc.). Ich möchte sagen, dass es sich hier um (obgleich es wie ein hölzernes Eisen klingen mag) anschauliche Urteilskraft, um z.B. visuelle Kognitionen handelt, die sich in bzw. kraft Zeichen vollziehen und nichtbegrifflichen Gehalt, d.h. einen Gehalt besitzen, dessen Diskrimination, Individuation und Manifestation sich nicht einem sprachlichen Aussagesatz, nicht einer sprachlichen Proposition verdankt und dieser auch nicht bedarf. Dass Diskriminations- und Individuations-Aspekte bereits auch in vorsprachlichen und vor-diskursiven Zusammenhängen von Wissen im weiten Sinne anzutreffen sind, sieht man schon bei praktisch-inkorporierten Wissens-Zusammenhängen, z.B. an dem „Wissen-wie“ im Sinne eines Könnens (etwa im Wissen, wie man Farben oder Töne oder Erlebniszustände, z.B. visuelle Erlebnisse, Lust, Angst, Schmerz unterscheidet und individuiert). Generell setzt die Fähigkeit zu wissen und zu erkennen die Fähigkeiten zu diskriminieren und zu individuieren stets bereits voraus, nimmt diese in Anspruch und baut auf ihnen auf. In den modernen Wissenschaften sind dann, wie betont, vor allem auch diejenigen epistemischen Objekte von besonderer Wichtigkeit, die nicht in unsere direkte sinnliche Wahrnehmung fallen, sondern nur über komplizierte Wirkungen und Messungen ausgemacht werden können. Man denke z.B. an Nanotechnik, Genetik oder Teilchenphysik, in letzterem Bereich heute etwa an das epistemische Objekt „Raumzeit-Quanten“, die weder im Alltag noch bislang in physikalischen Experimenten bemerkbar wurden, sondern vorerst allein in der Interpretation der diesbezüglichen Gleichungen bestehen. Die besondere Herausforderung und der besondere Reiz liegt hier in der Frage, Epistemische Objekte 141 welcher Art die für diese epistemischen Objekte zu unterstellenden Diskriminations- und Individuationsprinzipien sind. VII. Epistemische Rechtfertigung kraft Zeichen und Interpretation Komplementär zur Genealogie und zu den Konstituenten dessen, was als ein epistemisches Objekt angesehen wird und was nicht, sind intern stets auch sinnlogische Annahmen im Blick auf die Triftigkeit der Meinungen, Urteile und Aussagen über eben diese epistemischen Objekte (des näheren über ihre Eigenschaften, Merkmale, Qualitäten, Regularitäten, Verhaltensweisen) und damit Fragen der „epistemischen Rechtfertigung“ im Spiel. „Epistemische Objekte“ und „epistemische Rechtfertigung“ bilden eine Einheit, sind eine Art siamesische Zwillinge. Rechtfertigung ist ein Vorgang, der an seine Artikulation in einer Sprache gebunden ist, das heißt seinerseits ein Vorgang, der sich in bzw. kraft Zeichen (sprachlicher, urteils-grammatischer oder nicht-linguistischer, etwa diagrammatischer Zeichen) im öffentlichen Raum des Verwendens, Verstehens und Erfindens von Zeichen vollzieht. Zu beachten ist, dass epistemische Objekte in den verschiedenen Wissens- und Wissenschaftsbereichen von unterschiedlicher Art sind. Man denke an epistemische Objekte (a) in den Naturwissenschaften, z.B. in der Mikrophysik an „Elementarteilchen“, „Raumzeit-Quanten“, „Energie“, oder z.B. in der Hirnforschung an „Neuronale Assemblies“, „Neurotransmitter“, „Assoziationscortex“; (b) in den Geisteswissenschaften, z.B. in der Geschichtswissenschaft an „Absolutismus“, „Feudalismus“, „Totalitarismus“; (c) in den Sozialwissenschaften etwa an „Gruppe“, „Herrschaft“, „soziale Beziehungen“; (d) in den Technikwissenschaften an z.B. „Maschinen“, „Systeme“, „Artefakte“; und (e) in den Planungswissenschaften an z.B. „Wirtschaftssystem“, „Finanzmärkte“, „Bruttosozialprodukt“. Neben diesen engen Sinn der Rede von epistemischen Objekten ist der weite zu stellen. Er umfasst auch ganze Diskurse in ihrer diachronen Tiefenstaffelung und synchronen Breite, die dann z.B. auch thematisch werden bei der rationalen und kulturgeschichtlichen Rekonstruktion von Entwicklungen etwa der okzidentalen Physik, etwa die Entwicklung von dem, was es heißt, ein physikalisches Objekt und/oder ein physikalisches Gesetz zu sein. 142 Günter Abel VIII. Epistemische Objekte als Zeichen im engen und im weiten Sinne Eine weitere zeichen- und interpretationstheoretische Klärung der Rede von „epistemischen Objekten“ kann erreicht werden, indem wir die Unterscheidung zwischen „Zeichen im engen Sinne“ und „Zeichen im weiten Sinne“ ebenso wie die Unterscheidung zwischen „Interpretation im engen Sinne“ und „Interpretation im weiten Sinne“ auf den Sinn der Rede von „epistemischen Objekten“ anwenden.13 Unter Zeichen im engen Sinne seien diejenigen sinnlich wahrnehmbaren Gebilde (wie z.B. Wörter, Bilder, Notationen, Diagramme) verstanden, die, wie man gern sagt, „für etwas anderes stehen“: das Photo von Onkel Paul für Onkel Paul oder das Wort „Kastanie“ für Kastanien. Hier geht es um Zeichen, die etwas symbolisieren und darin durch ihre semantischen Merkmale charakterisiert sind. Zeichen in diesem Sinne sind gegebene, bereits vorhandene oder konstruktional eingeführte Zeichen. Man denke etwa an die Mathematik. Zu sagen, dass das Zeichen „r“ für den Radius des Kreises steht, heißt, dass „r“ Zeichen im engen Sinne ist. Man denke aber auch an lebensweltliche und alltäglich-praktische Zusammenhänge, etwa daran, dass man mit Peter die Verabredung trifft, immer dann, wenn er die Hand hebt, auf einen _____________ 13 Zu diesen Unterscheidungen vgl. im einzelnen G. Abel: Zeichen der Wirklichkeit, a.a.O., Einleitung, S. 20f.: Empfinden, Wahrnehmen, Sprechen, Denken und Handeln, kurz: alle Formen des Welt-, Fremd- und Selbstverhältnisses sind Ereignisse in Zeichen, vollziehen sich in bzw. kraft Zeichen. Eine vertiefende Reflexion des Zeichencharakters dieser Prozesse führt in die Zeichen- und Interpretationsphilosophie. Etwas wird zum Zeichen und setzt darin intern zugleich Interpretation voraus, sobald es darum geht, es zu verstehen, ihm Bedeutung zukommen zu lassen und es in den Fällen, in denen es nicht direkt verstanden wird, zu deuten bzw. auszulegen. In diesem Sinne sind Zeichen- und Interpretationsfunktionen grundlegend für jedes Erschließen von Welt und jede Form des Wirklichkeitsbezuges, für jedes Verständnis anderer Personen, für jedes Selbstverständnis, für jede Orientierung in der Welt und anderen Personen gegenüber, für alle Handlungen in ihren situativen, kontextuellen und pespektivischen Zusammenhängen und für alle Wissenschaften und Künste. Zeichen- und Interpretationsprozesse sind für Wirklichkeit konditional, nicht bloß optional. In der allgemeinen Zeichen- und Interpretationsphilosophie werden sie zur Grundlage und zum Leitfaden der Betrachtung erhoben. Jede nähere Erörterung dieser Aspekte und Zusammenhänge muss innerhalb der Rede von ›Zeichen‹ und ›Interpretation‹ Unterscheidungen und Stufungen vornehmen, um im Blick auf die betreffenden Zustände, Prozesse und Phänomene diskriminativ leistungsfähig zu sein. Zunächst und vor allem ist grundsätzlich zwischen dem weiten und dem engen Sinn von Zeichen und Interpretation zu unterscheiden. Dieser Unterschied ist in dem hier erörterten Zusammenhang ebenso wichtig wie die unten in Abschnitt IX vorgenommene Anwendung des Stufenmodells der Zeichen- und Interpretationsverhältnisse auf epistemische Objekte, um den Semantikaspekt, den Konventionsaspekt und den Kategorialaspekt unterscheiden und zugleich aufeinander beziehen zu können. Epistemische Objekte 143 Knopf zu drücken. Damit ist seine Handbewegung ein konventionelles Zeichen im engen Sinn des Ausdrucks, denn sie steht für die Aufforderung, jetzt den Knopf zu drücken. In diesem engen Sinn von Zeichen sind auch epistemische Objekte in ihrem Epistemikaspekt Zeichen (z.B. der Terminus „Atom“), sofern wir sie als konstruktional eingeführte und dann denotierende und referenziale Zeichen sowie ihre semantischen Merkmale verstehen. Freilich sind epistemische Objekte unter ihrem Objektaspekt in dem eingangs betonten Sinne nicht bloß „Zeichen im engen, stellvertretenden Sinne“. Denn sie werden in ihrer Referenzfunktion als intern verknüpft mit ihren Referenzobjekten und darin als intern referenziale Zeichen gegenstandskonstitutiv eingesetzt und in Anspruch genommen. Gegenüber diesem engen Sinne sei unter „Zeichen im weiten Sinne“ jedes Gebilde verstanden, dass irgendwie auffällt, Aufmerksamkeit auf sich zieht, als bedeutungstragend und als etwas angesehen wird, an dem und in Bezug auf das es etwas zu verstehen gibt. Um ein Beispiel zu geben: Während eines wissenschaftlichen Experiments entdecken wir plötzlich einen irgendwie irritierenden Effekt auf dem Computerbildschirm. Die irritierenden Flecken und Streifen könnten vernachlässigt werden. Sie könnten aber auch etwas sein, was es von jetzt an zu verstehen gilt. In letzterem Falle sind die Flecken und Streifen zum Zeichen im weiten Sinne des Ausdrucks geworden. Offenkundig wird dieser weite Sinn vor allem daran deutlich, dass man nach der Bedeutung der Phänomene, Gebilde und Vorkommnisse explizit fragen kann. So fragt man in der alltäglich-lebensweltlichen Praxis etwa, was denn diese Handbewegung Onkel Pauls, was diese rote Fläche, was dieses Geräusch, was dieser Blick, was dieser Duft, was dieses Licht am Himmel bedeutet. Und im Falle eines wissenschaftlichen Experiments fragt man indexikalisch, was denn dieser Fleck und dieser Streifen auf dem Bildschirm bedeutet. Dieser weite Sinn von Zeichen ist offenkundig nicht auf sprachliche oder bildliche Zeichen begrenzt. Er kann von jedem Objekt realisiert werden, sobald es in den Horizont der Aufmerksamkeit, in die Dimension der Fragen des Verstehens und der Bedeutung gerät, – sobald es eben zum Übergang von einem bloßen Sinneseindruck zum Zeichen in dem skizziert weiten Sinne kommt. Auch in puncto „Interpretation“ ist ein enger und ein weiter Sinn zu unterscheiden.14 Angesichts der internen Verschränkung von Zeichenfunktion und Interpretationsfunktion ist dies nicht überraschend. Der enge wie der weite Sinn von Interpretation sind im Blick auf eine nähere Bestimmung der Rede von epistemischen Objekten wichtig. Der enge Sinn von Interpretation meint die Deutung, die Auslegung, das aneignende Verstehen eines Zeichens, das nicht oder nicht mehr auf Anhieb verstanden wird, zum Beispiel eines Wor_____________ 14 Ebd., S. 22f.. 144 Günter Abel tes, eines Notationszeichens, eines abkürzenden Formalismus, eines Bildes, einer Geste oder einer Handlung. Hier geht es um die nachträgliche Prozedur, die erforderlich wird, sobald die Zeichen nicht Zeichen nicht mehr direkt und nicht mehr störungsfrei verstanden und verwendet werden. Ziel der Interpretation im Sinne von Deutung ist das (erstmalige oder erneute) aneignende Verstehen der neu auftretenden oder der fraglich gewordenen Zeichen und die Herstellung oder Wiederherstellung eines Zustandes direkten, störungsfreien und flüssigen Verstehens und Verwendens der Zeichen im Empfinden, Wahrnehmen, Sprechen, Denken und Handeln. Im Blick auf die epistemischen Objekte ist dieser enge Sinn von Interpretation in beiden Fällen des Auftretens von Zeichen erfordert: zum einen in den Fällen, in denen z.B. nach der Bedeutung eines während des Experimentes irritierend auftretenden Phänomens gefragt und damit Interpretation gefordert wird; zum anderen in den Fällen, in denen nach der Bedeutung z.B. der Begriffe „Atom“, „Elementarteilchen“, „Bruttosozialprodukt“, „neuronales Aktionspotential“ gefragt und dann eine Antwort unter Verwendung anderer Zeichen und/oder Handlungen, mithin auch hier eine Interpretation der Zeichen im engen Sinne von Interpretation gegeben wird. Demgegenüber meint der weite Sinn von Interpretation den adjektivischen und adverbialen Gebrauch der Wörter „Interpretation“, „interpretativ“ und „interpretatorisch“. Das betrifft vor allem den intern perspektivischen, konstruktionalen, schematisierenden, projizierenden, vereinfachenden und modellierenden Charakter der Zeichenverwendungen selbst. In puncto epistemische Objekte ist dieser Charakter gemeint, wenn man sagt, dass epistemische Objekte als Interpretationskonstrukte angesehen werden können. Gemeint ist damit, dass sie unter ihrem Epistemikaspekt als perspektivische, konstruktionale, schematisierende, projizierende und modellierende Konstruktbildungen verstanden werden können. Dieser Interpretationscharakter ist ipso facto in jede Zeichenfunktion intern insofern eingebaut, als eine gänzlich perspektive-, konstruktions- und in diesem Sinne interpretationsfreie Zeichenfunktion im Grunde gar keine Zeichenfunktion wäre (ebenso wie ein gänzlich perspektive- und interpretationsfreier Standpunkt gar kein Standpunkt wäre). Die Interpretationsgebundenheit eines jeden Zeichens beginnt mithin nicht erst dort, wo über die semantischen Merkmale und über die pragmatischen Merkmale (Situiertheit und Eingebettetsein in Kontext, Situation, Zeit und Kultur) „berichtet“ wird. Sie ist vielmehr konstitutiv bereits für das, was es für ein Zeichen heisst, eine Zeichenfunktion, etwa seine denotierende und referenziale Kraft auszuüben. Wenn etwas überhaupt als ein Zeichen fungiert, symbolisierende Kraft besitzt und diese ausübt, dann liegt dieser Funktion stets bereits eine interpretative Praxis der Zeichenverwendung zugrunde. Die Bedeutung eines Zeichens ist in einem doppelten Sinne an die Interpretation gebunden: nach der Seite des Epistemische Objekte 145 direkten und störungsfreien Verwendens und Verstehens ist sie an die interpretativ-perspektivische Verfasstheit der Zeichenfunktion selbst geknüpft; und nach der Seite des nicht mehr störungsfreien Funktionierens eines Zeichens ist es die Deutung des Zeichens, mit deren Hilfe die flüssige Verständigung wieder hergestellt wird. In diesem Sinne liegt auch jedem Verständnis und erfolgreichen Einsatz epistemischer Objekte stets bereits eine Interpretationsgebundenheit im Rücken. Wenn etwas überhaupt als ein epistemisches Objekt fungiert, symbolisierende, objekt-, phänomen- und sachstands-erhellende Kraft besitzt und diese ausübt, dann liegt dieser Funktion des epistemischen Objekts als Zeichen bereits eine interpretative Praxis zugrunde. Gemeint ist damit die interpretativ-konstruktionale Verfasstheit des epistemischen Objektkonstrukts in seinem Profil und seinem Funktionieren selbst. Das ist der Tiefensitz der Rede, dass epistemische Objekte als Zeichen- und Interpretationskonstrukte angesehen werden können. Mit Rekurs auf den weiten Zeichenbegriff lässt sich meines Erachtens auch reformulieren, was es heißt wissenschaftliche Forschung als die Suche nach Neuem zu betreiben, und was es heißt, dass epistemische Objekte keineswegs als statische, sondern als dynamische, als die bisherige Standpunkte überschreitende, als Standpunkt-bewegende Zeichen- und Interpretationskonstrukte angesehen werden können. Diese beiden Punkte werden unten in Abschnitt X näher ausgeführt. Ist die Standpunkt-überschreitende/bewegende Komponente nicht oder nicht mehr gegeben im theoretischen wie im praktischen Einsatz epistemischer Objekte als Zeichen- und Interpretationskonstrukte, dann haben wir es nicht mehr mit Forschung im radikalen Sinne, nicht mehr mit horizont-eröffnenden epistemischen Objekten zu tun. Dann handelt es sich vielmehr um teils automatisierte Abläufe in den Wissenschaften und Experimenten und/oder, im Theoriebereich, um Begriffsgehäuse und fest-gezurrte, um gleichsam sterile epistemische Objekte, von denen her es nicht mehr zur Erschließung neuer radikaler Erfahrung kommt. Letzteres ist, was wir meinen, wenn wir z.B. von nicht mehr fruchtbaren, gleichsam ausgeknautschen epistemischen Objekten sprechen. Dass ein bloß passivischer und zunächst epistemisch noch gar nicht auffälliger Sinneseindruck zu einem dann epistemisch überaus relevanten Zeichen im weiten Sinne werden kann, ist in den Fällen szientifischer epistemischer Objekte zugleich auch in genau dem Sinne möglich, dass das epistemische Objekt über das hinaus, was wir bislang bereits von ihm wissen, die Aufmerksamkeit auf umgebende Aspekte und Phänomene so lenkt, dass wir dann neugierig, aufmerksam, wissens- und erkenntnis-hungrig an- und aufgeregt fragen „Was das (etwa: dieses weder theoretisch noch praktisch und auch anschaulich-ästhetisch bislang noch nicht aufgetretene Phänomen, diese Anomalie, dieser Ausreißer im Experiment, dieser unerwartete Effekt, diese Günter Abel 146 Suggestion des Formalismus) wohl bedeutet und wie es bzw. er zu verstehen ist?“ Vor diesem Hintergrund können wir nun auch einen weiten und einen engen Sinne der Rede von epistemischen Objekten unterscheiden. Zu sagen, dass epistemische Objekte als Zeichen- und Interpretationskonstrukte gefasst werden können, heißt dann ein Doppeltes: (1) Im engen Sinne der Rede von „epistemischen Objekten“, aufgefasst als Zeichen und Interpretationskonstrukte, handelt es sich um den Epistemikaspekt der Rede von epistemischen Objekten im Sinne denotierender und darin zugleich interpretatorisch-organisierender Zeichen, etwa des Wortes „Atom“, des Zeichens „“, eines Graphen, einer chemischen oder einer mathematischen Notation. Hier denotieren Zeichen im engen Sinne Gegenstände, Zustände, Phänomene, Prozesse und/oder Sachverhalte und besitzen die zugehörigen semantischen Merkmale. Im Falle wissenschaftlicher Theorien sind wir des näheren und primär an buchstäblich denotierender Theorie und Deskription interessiert. (2) Im weiten Sinne der Rede von „epistemischen Objekten“ meine ich diese Rede im Horizont genau des oben entfalteten weiten Sinns der Rede von „Zeichen“ und „Interpretation“, epistemische Objekte also in dem Sinne, in dem ein Gebilde uns affiziert, auffällt, das Denken anregt und in Bezug auf das es etwas zu fragen und zu verstehen gibt. Das betrifft – ein Aspekt fundamentaler Wichtigkeit in jedem denkenden Forschen – in dem skizzierten Sinne des Drehtür-Modells das interne Ineinandergreifen von Objektaspekt und Epistemikaspekt in der Rede von „epistemischen Objekten“. IX. Semantikaspekt – Konventionsaspekt – Kategorialaspekt. Das Stufenmodell der Zeichen- und Interpretationsverhältnisse in Bezug auf epistemische Objekte In einem Stufenmodell werden die Zeichen- und Interpretationsverhältnisse nach Ebenen unterschieden, um verschiedene Hinsichten auseinanderhalten und sie in ihren Wechselwirkungen deutlicher vor Augen führen zu können.15 In Bezug auf epistemische Objekte erlaubt das Stufenmodell die wichtigen Unterscheidungen zwischen dem Semantikaspekt, dem Konventionsaspekt und dem Kategorialaspekt. Im Blick auf die epistemischen Objekte lassen sich die Zeichen- und Interpretationsverhältnisse wie folgt auffächern: _____________ 15 Das folgende Modell wurde in den in Anmerkung 4 genannten Arbeiten entwickelt und vor allem in G. Abel: Interpretations-Welten, in: Philosophisches Jahrbuch, 96 (1989), S. 1 – 19, detailliert ausgeführt. Epistemische Objekte 147 (a) Semantikaspekt: – Auf dieser Ebene sind unter anderem die folgenden und im Blick auf die epistemischen Objekte wichtigen Komponenten angesiedelt: die semantischen Merkmale (Bedeutung, Referenz, Wahrheits- oder Erfüllungsbedingungen), die aneignenden Deutungen, die Hypothesen- und Theoriebildungen, die Erklärungen und Rechtfertigungen. In der allgemeinen Zeichen- und Interpretationsphilosophie wird diese Ebene mit einem Index versehen und die „Zeichen-und-Interpretations-Ebene-3“ genannt. (b) Konventionsaspekt: – Auf dieser Ebene sind unter anderem die folgenden und im Blick auf den Einsatz sowie das Verständnis epistemischer Objekte wichtigen Komponenten angesiedelt: die auf Übereinkunft und Vereinbarung beruhenden Konventionen und die durch Gewohnheit habituell gewordenen Praktiken, Fertigkeiten und Muster in der Verwendung und im Verstehen von Zeichen- und Interpretationskonstrukten in Handlungszusammenhängen. Diese Ebene sei indiziert die „Zeichen- und Interpretations-Ebene2“ genannt. (c) Kategorialapekt: – Auf dieser Ebene sind hinsichtlich der Objekte und Ereignisse der Welt sowie unserer Fremd- und Selbstverhältnisse die folgenden und im Blick auf den Einsatz und das Verständnis epistemischer Objekte wichtigen Prozesse angesiedelt: die Kategorialisierung, die raum-zeitliche Lokalisierung, die Individuation, die sortale Prädikation, die primäre Klassifikation, die Identifikation und Re-Identifikation, kurz: die Prozesse der Umgrenzung und Individuation dessen, was überhaupt als ein Objekte und Ereignis zählt und was nicht. Diese Ebene sei indiziert die „Zeichen- und Interpretatons-Ebene-1“ genannt. Diese Stufungen können Top Down ebenso wie Bottom Up gelesen werden. Und man kann sie anwenden, um z.B. im Blick auf epistemische Modelle, aber eben auch hinsichtlich der epistemischen Objekte sowohl Stufen voneinander abzuheben als auch diejenigen in der Rede von epistemischen Objekten im engeren Sinne in Anspruch genommenen Voraussetzungen zu analysieren, denen sich Form, Profil, Charakter, Gehalt und Reichweite der epistemischen Objekte verdanken. Die Anwendung dieses Stufenmodells erfolgt im Horizont der Grundthese, dass epistemische Objekte in dem dargelegten Sinne als Zeichen- und Interpretationskonstrukte konzipiert und modelliert werden können. Dieser Auffassung zufolge sind epistemische Objekte zeichen- und interpretationsverfasst und -abhängig, funktionieren konstruktional und haben eine Genealogie aus einem projektional und perspektivisch verfassten Netzwerk mit anderen epistemischen Objekten ebenso wie Hintergrundannahmen und Zwecksetzungen stets bereits im Rücken. Konstruktion ebenso wie Status und Rolle von epistemischen Objekten erfolgen aus diesen Netzwerken und Hintergrundannahmen heraus und auf sie hin. 148 Günter Abel Es ist sinnvoll, heuristisch und methodisch noch etwas näher zwischen der kategorialisierenden, der konventionalistischen und der semantischen Ebene zu unterscheiden: (1) Die kategorialisierende Funktion ist diejenige Funktion, die die epistemischen Objekte kraft ihres Epistemikaspektes in Sachen Diskrimination, Individuation, Klassifikation und Prädikation auf diejenigen Objekte und Ereignisse ausüben, denen dann unsere wissens- und erkenntnisbezogene Aufmerksamkeit, Neugierde, Forschung und Reflexion gilt. Insofern epistemische Objekte als Zeichen- und Interpretationskonstrukte aufgefasst und modelliert werden können, heißt dies innerhalb des Stufenmodells, dass wir uns hier auf der „Zeichen- und Interpretations-Ebene-1“ bewegen. Man kann hier von der kategorialisierenden Kraft epistemischer Objekte und in diesem Sinne von kategorialen epistemischen Objekten bzw. von deren Kategorialaspekt sprechen. (2) Von dieser Kategorialebene können heuristisch die Gewohnheiten, Praktiken, Muster und Konventionen der Verwendung und des Umgangs mit epistemischen Objekten in einer gegebenen Zeit, Kultur und Disziplin, kurz: die konventionalistischen Aspekte unterschieden werden. In den Wissenschaften entspricht dieser zweiten bzw. mittleren Ebene das, was Thomas Kuhn als „normal science“, das heißt als das bezeichnet hat, was Forscher nach der erfolgreichen Etablierung eines Paradigmas (und im Falle epistemischer Objekte können wir sagen: nach der erfolgreichen Etablierung eines epistemischen Objekts) als wissenschaftliche Arbeit betreiben, um das, was sie über dieses epistemische Objekt wissen, weiter zu festigen und näher auszubuchstabieren. Auch alle Aktivitäten der „normalen Wissenschaft“ vollziehen sich natürlich in bzw. kraft Zeichen und Interpretationen, in eben den habituell gewordenen, gewohnheitsmäßig verankerten Mustern, Praktiken und Konventionen. Hier bewegen wir uns auf der „Zeichen- und InterpretationsEbene-2“ und in diesem Sinne auf der Ebene des Konventionsaspektes epistemischer Objekte, auf der Ebene der habituell verankerten und konventionellen epistemischen Objekte. Im Blick auf wissenschaftliche Forschung geht es auf dieser Ebene-2 primär darum, die Instrumente der Forschung zu spezifizieren und (vor allem durch Beobachtung, Experiment und Simulation) Daten zu generieren, die den Kategorialaspekt des jeweiligen epistemischen Objekts (z.B. von „Galaxie“, „neuronale Aktivität“) belegen und empirisch weiter unterfüttern. Wir bewegen uns auf dieser Ebene noch nicht auf der Ebene-1 genuiner Grundlagenforschung. Denn auf letzterer Ebene geht es nicht bloß um die Spezifikation dessen, was man über ein epistemisches Objekt im Grundsatz und bislang weiß. In radikaler Forschung geht es vielmehr darum, genuin Neues zu entdecken, etwas also, das man bislang noch nicht kannte und im Blick auf das man im Grunde vorab noch nicht einmal recht weiß, wonach man eigent- Epistemische Objekte 149 lich sucht. Dies schließt auch die Möglichkeit ein, ein bislang erfolgreiches epistemisches Objekt zu modifizieren, zu revidieren, es im Grenzfall zu verabschieden, durch ein anderes zu ersetzen, in Bezug auf das dann neue Forschungen durchgeführt werden, weiter in unbekanntes Gelände aufgebrochen wird. In diesen Fällen bewegen wir uns auf der „Zeichen-und-InterpretationsEbene-1“. Finden hier Um- und Neu-Kategorialisierungen statt, kommt es zu andersartigen Diskriminationen, Individuationen, Klassifikationen und sortalen Prädikationen, kurz: nimmt sich Welt anders aus. Im Feld der Wissenschaften sprechen wir dann von „wissenschaftlichen Revolutionen“, im Blick auf unser Welt-, Fremd- und Selbstverständnis von Transformationen der Wissensordnungen, im Grenzfall von Revolutionierungen des Menschen- und Weltbildes. (3) Von diesen ersten beiden Ebenen, der Kategorialebene und der Konventionsebene, kann die Semantikebene unterschieden und näher beschrieben werden. Das ist die Ebene der Deskriptionen, Deutungen, Berichte, Hypothesen- und Theoriebildungen, Erklärungen und Rechtfertigungen. Diese Ebene ist in puncto epistemische Objekte vornehmlich in zwei Hinsichten explizit erfordert. Zum einen dann, wenn die epistemischen Objekte eingeführt, zum anderen dann, wenn sie nicht bzw. nicht mehr direkt, d.h. nicht mehr ohne weitere Fragen nach den semantischen Merkmalen des EpistemischenObjekt-Ausdrucks, z.B. von „Galaxie“, verstanden werden. Wird diese Seite epistemischer Objekte relevant, das heißt: fragen wir nach Deskriptionen, Konstituenten, Deutungen, Erklärungen, Referenzobjekten und im kritischen Falle nach Rechtfertigungen der Ausdrücke, Sätze und Urteile, in denen sich die epistemischen Objekte manifestieren, dann bewegen wir uns auf der semantischen Ebene der Rede von epistemischen Objekten, im Semantikaspekt epistemischer Objekte. Alle angeführten Operationen (wie Beschreiben, Deuten, Erklären, Berichten, Hypothesen- und Theoriebilden sowie Rechtfertigen) vollziehen sich selbstredend in bzw. kraft Zeichen und Interpretation. Das ist zum einen in dem Sinne der Fall, dass wir ein neues Zeichen deskriptiv einführen, zum anderen in dem Sinne, dass wir ein in seinen semantischen Merkmalen fraglich gewordenes Zeichen deuten, erklären und rechtfertigen müssen, um auf diese Weise den semantischen Störfall zu beseitigen. In beiden Fällen tun wir dies, indem wir andere Zeichen als die, die eingeführt werden sollen, und andere Zeichen als die, nach deren semantischen Merkmalen jetzt gefragt wird bzw. deren semantische Merkmale fraglich geworden sind, verwenden. Damit bewegen wir uns hier auf der „Zeichen-und-InterpretationsEbene-3“. Profil, Charakter, Funktion und welterschließende Leistungsfähigkeit von epistemischen Objekten sind nicht einfach auf jeweils nur einer der drei Ebenen der Zeichen- und Interpretationsverhältnisse angesiedelt. Kennzeichnend ist vielmehr, dass epistemische Objekte erst durch das Zusammenspiel und 150 Günter Abel die Wechselwirkungen der drei Ebenen als die erfolgreichen epistemischen Objekte, die sie für uns sind, fungieren und funktionieren. Im Falle z.B. der elementaren Struktur der Materie bedeutet dies hinsichtlich der Rede von „Elementarteilchen“: grundlegend ist die kategorialisierende Ebene-1 der Zeichen- und Interpretationsprozesse in dem Sinne, dass auf ihr allererst umgrenzt (diskriminiert, raum-zeitlich lokalisiert, individuiert, sortal prädiziert, primär klassifiziert) wird, was überhaupt als ein Elementarteilchen gilt und was nicht. Auf der konventionalen und habituell-gewohnheitsverankerten Ebene-2 der Zeichen- und Interpretationsprozesse wird dieses als grundlegend vorausgesetzte Verständnis der Ebene-1 dann in operativen Verfahren spezifiziert (etwa in einer szientifischen Beobachtung, in einem mit spezifischem Design versehenen physikalischen Experiment, in einer Messung nach festgelegten Standards und Messgrenzen), mithin empirisch bestimmt. Auf der semantischen Ebene-3, das heißt auf der Ebene der Bedeutung, der Referenz sowie der Wahrheits- bzw. Erfüllungsbedingungen der Verwendung des Terminus „Elementarteilchen“ gehen wir davon aus, dass der Ausdruck „Elementarteilchen“ oder das entsprechende Äquivalent im mathematischen Formalismus die Bedeutung „Elementarteilchen“ hat, sich auf Elementarteilchen bezieht und dass die Rede von „Elementarteilchen“ in Urteilen Elementarteilchen als ihren Erfüllungsgegenstand hat und dass dieses Erfüllungsverhältnis, wenn es erfüllt ist, intern mit der Wahrheit des entsprechenden Erkenntnisurteils verknüpft ist. Mit Hilfe des Stufenmodells der Zeichen- und Interpretationsverhältnisse können wir die horizontalen ebenso wie die vertikalen Wechselwirkungen sowohl zwischen dem Epistemikaspekt und dem Objektaspekt als auch die zwischen dem Semantikaspekt, dem Konventionsaspekt und dem Kategorialaspekt darstellen. Das Stufenmodell vermag diese Wechselwirkungen erstens zu benennen und sie zweitens so zu modellieren, dass das Wechselspiel der auf den unterschiedlichen Ebenen angesiedelten Komponenten transparent wird. In diesem Sinne stellt das Modell Instrumente bereit, das zu beschreiben, was passiert, wenn epistemische Objekte welterschließend und in intersubjektiven Kommunikationsverhältnissen erfolgreich eingesetzt werden (einschließlich der jederzeit möglichen Modifikation, Verschiebung, Transformation, Revision, bis hin zum Ausmustern von nicht mehr als fruchtbar angesehenen epistemischen Objekten, wie zum Beispiel im Falle des berühmtberüchtigten „Phlogiston“ oder in der Philosophie der Cartesianischen „Zirbeldrüse“ als dem Sitz und Zentralorgan des menschlichen Bewusstseins). Der Status des Stufenmodells der Zeichen- und Interpretationsverhältnisse ist, es sei nachdrücklich betont, der einer Heuristik und eines Modells, nicht der einer Theorie im terminologisch starken Sinne der Behauptung, dass es ontologisch und nomologisch definitiv genau so sei, wie die Sätze der Theorie es aussagen. Epistemische Objekte 151 Wichtiger aber als dieser letztgenannte Aspekt ist zu sehen, dass es sich in den Fällen erfolgreicher epistemischer Objekte um das Zusammenspiel und die Wechselwirkungen zwischen Momenten der unterschiedlichen Ebenen der Zeichen- und Interpretationsverhältnisse handelt. Epistemische Objekte fungieren nicht auf nur jeweils einer der drei genannten Ebenen. Zudem funktionieren sie nur dann welterschließend und kommunikativ, wenn es zu einer Integration der drei Ebenen kommt. Wir haben es im Falle von epistemischen Objekten und deren Funktionen sowohl mit einem distribuierten als auch einem integrierten Zusammenspiel zu tun. Die jeweils spezifische Ausprägung dieses Verhältnisses kommt durch das jeweils besondere Profil des epistemischen Objekts, durch die besondere Art der mit ihm verbundenen Fragestellung und durch den mit ihnen verfolgten Zweck einer Welt-, Fremdund Selbstthematisierung ins Spiel. X. Die zeichen-interpretationalen Wurzeln der Entdeckung von Neuem kraft epistemischer Objekte In Sachen epistemische Objekte lässt sich der zentrale Aspekt des Forschens bzw. dessen, was es heisst, nach Neuem zu forschen, zeichen- und interpretationsphilosophisch reformulieren. Dabei lassen sich zumindest vier zeicheninterpretationale Wurzeln des forschenden Entdeckens von Neuem benennen. Sie haben mit Aspekten der Überschreitung, der Unbestimmtheit und der Unterbestimmtheit von Zeichen und Interpretationen zu tun: (1) mit einer Standpunkt-Überschreitung, (2) mit einer Begriffs-Überschreitung, (3) mit einer Determiniertheits-Überschreitung und (4) mit einer systematischen Unterbestimmtheit. Das ist zugleich der vierfache Sinn, in dem epistemische Objekte Zeichen und Interpretationen in dem skizziert weiten Sinne sind und eben genau darin intern zugleich die Möglichkeit des Forschens eröffnen, – sie mithin, so könnte man sagen, ihren Kernjob erfüllen, genau dies nämlich zu ermöglichen und eben darin auch zu unserem Weltbild beizutragen. (1) Standpunkt-Überschreitung: – Epistemische Objekte sind von ihrer zeichen- und interpretations-theoretischen Seite und in ihrem engen Sinne betrachtet Standpunkt-abhängige Zeichen- und Interpretationskonstrukte. In ihrer erfolgreichen Anwendung und ihrem explanatorischen und prognostischen Einsatz verfügen sie jedoch über die höchst bemerkenswerte und höchst wertvolle Eigenheit, in der Standpunkt-abhängigen Exekution ihrer Funktionen Standpunkt-modifizierend und Standpunkt-überschreitend zu wirken, zu neuen Phänomenen, Prozessen und Zuständen führen zu können, uns über einen bisherigen Standpunkt im buchstäblichen Sinne hinaus zu bewegen. Lebendige und Forschung anstachelnde epistemische Objekte sind keine statischen, sondern dynamische Objekte, sind Epistemische-Objekte-in-Bewegung-und-auf- 152 Günter Abel Zeit. Sie bewegen uns über einen zu einer Zeit gegebenen Standpunkt hinaus, geben uns in diesem Sinne (wissenschaftlich und philosophisch) zu denken, und führen, im gelingenden Falle, zu Neuem, zu neuem Erkennen und Wissen. (2) Begriffs-Überschreitung: – Epistemische Objekte sind, was ihre Konstituenten angeht, auch Begriffs-abhängige Objekte, d.h. in die Konstitution von epistemischen Objekten gehen immer auch begriffliche Aspekte ein. Hinsichtlich der die Forschungs-Lebendigkeit eröffnenden Kraft epistemischer Objekte ist zugleich aber der folgende Punkt entscheidend. Im Zuge der Applikation der Begriffsanteile eines spezifischen epistemischen Objektes sowie vor allem in Zusammenhängen mit anderen und interagierenden Momenten kann es zu unerwartet neuen Phänomenen, Prozessen und Zuständen, zum Eintreten von neuem und vom bisherigen Begriff her unerwartetem Geschehen kommen. Tatsächlich geschieht dies auch häufig, in natur-, geistes- und sozialwissenschaftlichen ebenso wie in lebensweltlichen und alltäglichen Zusammenhängen. Man denke etwa an folgendes Beispiel: Man beginnt in der Elementarteilchen-Physik zunächst mit einem physikalistischen Begriff von Teilchen und Eigenschaften. Sodann wird dieses physikalische Setting in eine Verbindung mit einem mathematischen Formalismus gebracht. Und diese Interaktion zwischen dem „physikalischen Begriff“ und dem „mathematischen Formalismus“ kann zur Suche und zur Entdeckung von neuen Elementarteilchen führen. In dieser Interaktion lädt der Mathematiker den Physiker gleichsam ein, in Experimenten nachzusehen, ob er das neue Elementarteilchen findet. Gegenwärtig ist die Suche nach den Higgs-Teilchen mit Hilfe des Großbeschleunigers am CERN ein augenfälliges Beispiel für diese Zusammenhänge. In diesem Sinne steckt in jedem epistemischen Objekt das Potential zu Unerwartetem, zu Neuem, das begrifflich ebenso wie empirisch so zunächst nicht zu erwarten war. In dem, was wir wissenschaftliches Forschen und philosophische Reflexion nennen, gehen wir in der Erfahrung ebenso wie im Denken (aufgefasst im weiten Sinne als das Verbinden von Vorstellungen) über unsere bis dato leitenden Begriffe hinaus. Das ist der kreativ Wirklichkeits-erschließende und -eröffnende Charakter epistemischer Objekte. In diesem Sinne sind epistemische Objekte sowie die intern korrelierten Phänomene, Prozesse und Zustände in dem dargelegten Sinne „Zeichen und Interpretationen bzw. Interpretationszeichen im weiten Sinne“. Dieser begriffsmodifizierende und -überschreitende Charakter kann sich natürlich auch erschöpfen, kann erlöschen. Epistemische Objekte können in den festen Bestand einer Wissenschaft übergehen (und dort unter anderem auch Auslöser weiterer epistemischer Objekte werden) oder aus diesem aussortiert werden, ihre epistemische Attraktivität verlieren, können mithin auch „sterben“. Epistemische Objekte 153 (3) Determiniertheits-Überschreitung: – Epistemische Objekte sind als Zeichen- und Interpretationskonstrukte und hinsichtlich ihrer semantischen Merkmale durch ihre „Unerforschlichkeit der Referenz“ (Quine) bzw. ihre Unbestimmtheit gekennzeichnet. Die semantischen Merkmale der Ausdrücke epistemischer Objekte, z.B. von „Atom“, „Gen“ oder „Bruttosozialprodukt“, sind nicht unexakt und nicht ohne Regeln der Anwendung. Aber sie sind auch nicht exakt und definitiv umgrenzt. Die Grenzen der semantischen Merkmale epistemischer Ausdrücke sind nicht ein für alle Mal fixiert, und sie sind auch nicht, wie Definitionen in Mathematik und Logik, exakt über Prädikatoren eingeführt und definiert für alle möglichen Situationen, Kontexte und Zeiten. Und der wichtige Punkt ist: diese Unbestimmtheit ist keineswegs ein Hindernis (das es zu überwinden gälte), sondern vielmehr gerade eine Kondition für die wissenschaftliche Forschung ebenso wie für die philosophische Reflexion. Ich möchte diese Unbestimmtheit die „semantisch-epistemische Unbestimmtheit“ nennen. Sie ist entscheidend, ist konditional und essentiell für das, was wir die auf reale Objekte und Ereignisse in der Welt bezogene Forschung und Reflexion in Wissenschaften, Philosophie und anderen Künsten nennen.16 (Im Unterschied dazu ist Forschung in Mathematik und Logik nicht an die Determiniertheits-Überschreitung gebunden. Forschung bewegt sich dort – darin von natürlichen Sprachen und Zeichen unterschieden – auf dem Boden von klar umgrenzenden Definitionen und bestimmten Konstruktionen.) Wenn epistemische Unbestimmtheit in Bezug auf die Grenzen der semantischen Merkmale gegeben ist, dann ist sie (aufgrund der dargelegten internen Zusammengehörigkeit von Epistemikaspekt und Objektaspekt) intern auch hinsichtlich der Relationen zwischen epistemischen Objekten und den durch diese denotierten materiellen Objekten selbst gegeben. Dies ist der Fall, da eine der Voraussetzungen zum Auf- und Erfassen von Objekten darin besteht, dass wir uns zunächst auf eine Form der Bezeichnung, mithin auf Zeichen- und Interpretationsfunktionen verstanden haben müssen, und dass wir es erst dadurch (und in dem skizziert adualistischen und nichtidealistischen Sinne) mit den zugehörigen Gegenständen zu tun haben, - nicht umgekehrt.17 _____________ 16 17 Die Situation ist in etwa so wie im Falle von Sprache und Kommunikation: die nichteliminierbare Unbestimmtheit der Bedeutung, der Referenz und der Übersetzung ist kein Hindernis, sondern eine Bedingung für die inter-individuelle Kommunikation. In diesem Sinne machen die semantisch offenen bzw. die nicht exakt umgrenzten Valenzen auch den Unterschied aus, der offenkundig zwischen einem Datenaustausch zwischen Computern und der Kommunikation zwischen Personen besteht. Das Umgekehrte behaupten zu wollen hieße, die Nachweise führen zu müssen, (a) dass wir gänzlich nicht-epistemisch und gänzlich zeichen- und interpretations-frei von Gegenständen sprechen könnten, (b) dass die Natur sich selbst in Gegenstände, Gattungen und Arten einteilte und (c) dass die Natur ihr eigener Epistemiker sei, – was ein offenkundig selbstdestruktiver naturalistischer Fehlschluß wäre. Günter Abel 154 Die epistemische Unbestimmtheit ist nicht eine empirische Unbestimmtheit. Sie kann nicht durch empirische Vollständigkeit eliminiert werden. Sie ist eine logische Unbestimmtheit, betrifft also alle möglichen epistemischen Objekte in allen möglichen semantischen Zusammenhängen. Die Situation ist hier analog zu der der Geschichtlichkeit und der Zeitlichkeit epistemischer Objekte. Wir neigen zu der nicht explizierbaren Auffassung, im Laufe der Zeit (sic!), „in the long run“ (Peirce), würden sowohl die Unbestimmtheit als auch die Zeitbedingtheit und die Geschichtlichkeit epistemischer Objekte aufhören bzw. zu einem Ende kommen. Diese Hoffnung jedoch, die Unbestimmtheit, die Geschichte und die Zeitbedingtheit aus der Epistemologie letztlich doch heraustreiben zu können, ist bloß ein eschatologischer Traum. (4) Systematische Unterbestimmtheit: – Epistemische Objekte, aufgefasst als zeichen-interpretationale Konstrukte, sind systematisch durch „Unterbestimmtheit“ (Quine) gekennzeichent, d.h. durch eine systematische Differenz, ein systematisches Gefälle zwischen (mit dem Bild Quines gesprochen) „the meager (empirical) input of data“ für eine Theorie und „the torrential output“ in der Konstruktion von Theorien, deren Anspruch auf Gültigkeit weit über die Datenbasis hinaus geht (und sich z.B. auf das ganze Universum erstreckt). Sie sind nicht nur kontingenterweise, sondern systematisch unterbestimmt in Bezug auf die empirischen Objekte und Gehalte, die sie als Zeichen- und Interpretationskonstrukte instantiieren. Ich möchte diese Unterbestimmtheit die „epistemische Unterbestimmtheit“ nennen. Die Unterbestimmtheit ist zunächst empirischer Natur. Aber sie ist (ebenso wenig wie die Unbestimmtheit) nicht durch empirische Vollständigkeit behebbar. Auch die Unterbestimmtheit ist in Bezug auf alle möglichen empirischen Fakten gegeben, die einen zeicheninterpretational funktionierenden epistemischen Ausdruck verifikationistisch instantiieren können. Diese vier Charakteristika epistemischer Objekte (d.h.: StandpunktÜberschreitung; Begriffs-Überschreitung; epistemische Unbestimmtheit; epistemische Unterbestimmtheit)18 sind das, was (a) wissenschaftliche Forschung ebenso _____________ 18 Diese Charakteristika epistemischer Objekte lassen sich in eine positive Verbindung, aber auch in eine kritische Diskussion mit dem bringen, was H.-J. Rheinberger (im Sinne seiner wissenschaftshistorischen Studie Experimentalsysteme und epistemische Dinge: Eine Geschichte der Proteinsynthese im Reagenzglas, Göttingen 2001) in seiner Antwort auf David Bloor in Bezug auf die Funktion epistemischer Objekte schreibt, in: Perspectives on Science, 2005, vol 13, no.3, S. 406f.: Szientifische bzw. epistemische Objekte funktionieren Rheinberger zufolge „by virtue of their opacity, their surplus, their material transcendence, if you like, which is what arouses interest in them and keeps them alive as targets of research.“ Dabei setzt Rheinberger epistemische Objekte mit szientifischen Objekten gleich und versteht diese, ohne die oben nachdrücklich herausgestellte Unterscheidung von Objektaspekt und Epistemikaspekt vorzunehmen, direkt als „clearly material things“. Beide Aspekte sind meines Erachtens (zumal aus der Perspektive der hier vertretenen Auffassung der epistemischen Objekte als Zeichen- und Epistemische Objekte 155 wie philosophische Reflexion möglich macht, (b) den Möglichkeits-Raum zur Entdeckung von gänzlich Neuem, von radikal Neuem (in Wissenschaften, Philosophie und anderen Künsten) eröffnet und (c) einsichtig macht, dass unser Forschen und Reflektieren aus systematischen Gründen nicht zu einem „in der Sache“ definitiven und „für alle (möglichen) Personen allgemein verbindlichen Abschluss“, nicht zu einem Ende kommen. In der zeichen- und interpretationsphilosophischen Perspektive ist das auch in puncto epistemische Objekte vor allem aus drei Gründen nicht der Fall: (1) Die Liste der semantischen Merkmale der epistemischen-ObjektAusdrücke ist nicht definitiv und nicht allgemein verbindlich abschließbar. Stets sind Erweiterungen, Veränderungen, Modifikation, Revisionen, UmPräferenzierungen möglich. Einzig eine vollblütige Metaphysik träumt davon, zu einem solchen Abschluss, zum Ende kommen zu können. (2) Jede Konzeption epistemischer Objekte ist zeit- und geschichts- sowie kultur-gebunden. Aus der Zeit-, Kultur- und Geschichtsbedingtheit herausspringen zu wollen, ist lediglich ein metaphysischer Traum. (3) Die Bedeutung eines epistemischen-Objekt-Zeichens (z.B. des Zeichens „Atom“ oder „neuronales Assemblie“ oder „Bruttosozialprodukt“) wird durch die Interpretation mithilfe anderer Zeichen angegeben. Die Bedeutung eines epistemischen-Objekt-Zeichens besteht in seiner angemessenen Interpretation, – mithin aber wiederum in einem Zeichen. Geben wir uns mit diesem Interpretationszeichen unter bestimmten Zwecken und Hinsichten pragmatisch zufrieden – bis auf weiteres, d.h. bis jemand nach der Bedeutung auch dieses Interpretationszeichens fragt – dann sind wir pragmatisch in genau dem Sinne und Ausmaß „zum Ende“ gekommen, wie dies für die flüssige Kommunikation und für unsere Orientierung in der Welt so überaus hilfreich, unabdingbar ist. Jedoch bleibt jederzeit die Möglichkeit, dass auch nach der Bedeutung des Interpretationszeichens gefragt wird, – und so weiter, ohne ein absehbares definitives und allgemein verbindliches Ende. Der Ozean ist offen. Unsere Schiffe können neu und in neue Richtungen und in neuen Verbundsystemen auslaufen. Vor diesem Hintergrund wird leicht einsichtig, was es heißt, dass unsere Welten als Zeichen- und Interpretationswelten qualifiziert werden können.19 Der Sprung in eine völlig nicht-epistemische und gänzlich zeichen- und interpretations-freie, aber gleichwohl individuiert fertig daliegende Welt ist menschlichen Geistern verwehrt. Von dieser Möglichkeit sind wir nicht nur kontingenterweise, sondern systematisch abgeschnitten. Glücklicherweise _____________ 19 Interpretationskonstrukte) nicht unproblematisch. Doch soll eine nähere Diskussion dieser Punkte an dieser Stelle nicht erfolgen. Zum Folgenden vgl. G. Abel: Sprache, Zeichen, Interpretation, a.a.O., S. 143f. Günter Abel 156 möchte man hinzufügen. Denn eine nicht-epistemische Welt wäre nicht Welt von unserer Welt, und wir würden uns nicht auf sie verstehen. Was allerdings unsere zeichen- und interpretations-gebundene Wirklichkeit angeht, so können wir strenggenommen noch nicht einmal sagen, dass sie nur eine einzige und bestimmte Geschichte hat. Entscheidend wird schließlich, dass unsere Welt, unsere Wirklichkeit, anders erscheint, sobald man sie (in einem Wittgensteinschen Bild gesprochen) mit anderen Möglichkeiten umgibt. Setzt man noch hinzu, dass dies letztlich darauf hinausläuft zu sagen, dass das, was als wirklich gilt, nicht jeweils nur eine bestimmte, sondern alle Möglichkeiten in sich hat, dann trifft sich diese Sichtweise mit einer grundlegenden Auffassung der Quantenphysik. Denn dieser zufolge gilt, dass ein Objekt has not just a single history but all possible histories“, wobei sich dann in bestimmten Fällen die „probabilities of neighboring histories reinforce each other. It is one of these reinforced histories that we observe as the history of the object.20 Zurück zum Anfang des vorliegenden Beitrags und insbesondere zu den in Abschnitt I angesprochenen „gefährlichen Dingen“. Wie gefährlich also sind epistemische Objekte? Die Antwort auf diese Frage ist doppelter Natur. Zum einen können die zuletzt genannten vier Charakteristika helfen, ›epistemische Objekte‹ nicht länger als im engeren Sinne „gefährliche Dinge“ anzusehen. Entwarnung kann an das Britische House of Lords gegeben werden. Es ist nicht erforderlich, den MI 5 einzuschalten. Es handelt sich nur um epistemische Objekte. Zum anderen jedoch sind die mit den epistemischen Objekten verbundenen Prozesse – wie jede Theoriebildung und insbesondere jedes Philosophieren – vornehmlich im Sinne der vier Überschreitungen durchaus gefährlich zu nennen. Theoriebildung und Reflexion lassen nämlich die Dinge nicht so, wie sie bis dahin waren. Unser Weltbild und Weltverständnis können sich ebenso wie unser Selbstbild und Selbstverständnis verschieben, modifizieren und müssen, in Grenzfällen, sogar der radikalen Revision unterzogen, gar verabschiedet werden. Und das wiederum bringt neue Anforderungen für unsere Orientierung in der Welt, anderen Personen und uns selbst gegenüber mit sich, in theoretischer wie in praktisch-ethischer Hinsicht. In letzterer Hinsicht denke man nur an die Erfolge in den Forschungen der Medizin, der Biotechnologie, des Neuroenhancement und/oder der Nanotechnologien. Dass die mit diesen Forschungen verbundenen Transformationen unserer Wissensordnungen Konsequenzen für unser Welt-, Fremd- und Selbstverständnis haben, ist offenkundig und stellt uns vor bislang noch nicht dagewesene Herausforderungen. _____________ 20 St. W. Hawking: Black Holes and Baby Universes and Other Essays, New York 1993, S. 45. Freind oder feund? Einige sprachphilosophische Konsequenzen aus Nelson Goodmans Analyse des Induktionsproblems Christian Stetter Die Grenze zwischen berechtigten und unberechtigten Voraussagen (oder Induktionen oder Fortsetzungen) richtet sich danach, wie die Welt sprachlich beschrieben und vorausgesagt wurde.1 Artifizielle Prädikate wie „grot“ oder „Smarblume“ spielen in Goodmans Reformulierung und Lösung des Induktionsproblems eine Schlüsselrolle.2 Zunächst die Definitionen: grot df vor einem Zeitpunkt t geprüft und als grün befunden, sonst rot; Smarblume df vor einem Zeitpunkt t geprüft und als Smaragd befunden, sonst Kornblume.3 Diese Prädikate sind nach folgendem Prinzip konstruiert: Man fasst die Intensionen zweier „normaler“ sprachlicher Prädikate zu einem zusammen, hier von „grün“ und „rot“ zu „grot“ bzw. „Smaragd“ und „Kornblume“ zu „Smarblume“, um ihre Anwendung auf zwei durch einen Zeitpunkt t getrennte Zeitintervalle zu verteilen: Seien also „grot“ bzw. „Smarblume“ Objekte O1, O2, …, On, die vor t auf ihre Eigenschaften hin geprüft und für grün-seiend bzw. Smaragd-seiend befunden wurden, seien andere Objekte, etwa On+1, On+2, …, On+i, die in „normaler“ Redeweise als rot bzw. als Kornblume bezeichnet werden, dagegen vor t nicht auf ihre Eigenschaften hin geprüft worden,4 dann könnte man gemäß den oben gegebenen Definitionen jedes geprüfte grüne Objekt und jedes ungeprüfte Objekt On+k, von dem man vermutet oder weiß, dass es rot ist, „grot“ nennen, jeden geprüften Smaragd ebenso wie jedes Objekt On+m, von dem man vermutet, dass es eine Korn_____________ 1 2 3 4 Goodman: Tatsache, Fiktion, Voraussage, Frankfurt a. M. 1988, S. 152. Vgl. die Kapitel 2-4 (ebd.), denen die Special Lectures in Philosophy zugrunde liegen, die Goodman 1953 an der Universität London gehalten hat. Im Englischen Original: grue (green/blue) bzw. emerose (emerald/rose). Vgl. Goodman: Fact, Fiction, and Forecast, Cambridge, Mass. 1983, S. 74 f. Es ist gleichgültig, ob t in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft liegt. Christian Stetter 158 blume ist, „Smarblume“. Vor dem Zeitpunkt t bilden somit die Extensionen von „grün“ und „grot“, „Smarblume“ und „Smaragd“ Schnittmengen, nach t „rot“ und „grot“, „Smarblume“ und „Kornblume“. Diese Prädikate – ich nenne sie im weiteren abkürzend G-Prädikate – dienen Goodman dazu, bestimmte Aspekte des Induktionsproblems zu klären, die in der traditionellen Diskussion des Problems nicht oder nicht hinreichend gesehen worden waren – eben weil sie auf den ersten Blick dem gewohnten Sprachverständnis zuwider laufen. Denn die Basis für die Neufassung des Induktionsproblems ist – das diesen Überlegungen vorangestellte, Goodmans Text entnommene Motto deutet es an – ist ein sprachphilosophisches Argument. Darüber hinaus hat Goodman jedoch – dies ist meines Wissens bislang kaum beachtet worden – mit der Konstruktion dieser „Kunstprädikate“ implizit auf Eigenschaften von sprachlichen Prädikaten aufmerksam gemacht, die nicht die seltsame, aus zwei verschiedenen Morphemen zusammengesetzte sprachliche Form aufweisen wie die G-Prädikate, und hat damit – dies soll im weiteren gezeigt werden – ein sprachphilosophisches Grundproblem berührt, das der Philosophie kein Geringerer als Platon in seinem Dialog „Kratylos“ hinterlassen hat: die Frage nämlich, was es heiße, dass die Bedeutung eines Wortes in den Konventionen des Sprachgebrauchs verankert sei.5 Es wird sich zeigen, dass in diesem Zusammenhang auch die Physei-These des Herakliteers Kratylos, die mit den Etymologien, welche Sokrates in diesem Dialog durchdekliniert,6 ad absurdum geführt schien (und in Platons Schule wie in der Folge dann auch faktisch ad acta gelegt war), zumindest partiell zu neuen Ehren kommt, wenn auch nicht in der Weise, in der die These im „Kratylos“ diskutiert worden war. Bekanntlich ist Goodman zu seiner Reformulierung des Induktionsproblems dadurch geführt worden, dass seine Bemühungen um eine Lösung des Problems der irrealen Bedingungssätze in den 1940er Jahren zunächst gescheitert waren.7 Damit schien auch das Problem der Dispositionsprädikate _____________ 5 6 7 Wenn auch im Kratylos selbst die Frage unentschieden geblieben ist, ob den Wörtern ihre Bedeutung physei (aufgrund natürlicher Gründe) oder nomō (aufgrund sozialer Konvention) zukomme, so ist in Platons Schule doch zweifellos die Nomō-These favorisiert worden. Bester Beleg dafür ist Aristoteles’ Peri hermeneias (entstanden während Aristoteles’ Zugehörigkeit zur Akademie), wo kurz und bündig definiert wird, die Wörter bedeuteten das, was sie bedeuten, kata synthēkēn (16a S. 20 ff.). Vgl. Kratylos 391d-427c, dazu Stetter: Platons „Kratylos“, in: Hausmann / Siepmann (eds.): Vom Rolandslied zum Namen der Rose. Meisterwerke der Weltliteratur I, Bonn 1987, S. 172-192; und ders.: Die Grundlegung der Aristotelischen Zeichenkonzeption in der Platonischen Dialektik, in: Zeitschrift für Semiotik, Bd. 30 (2008), S. 29-47. Kapitel 1 in Goodman 1988, das ursprünglich 1947 als Aufsatz im Journal of Philosophy (44, S. 113-128) erschienen ist, berichtet ausführlich über das Scheitern dieser Versuche. Freind oder feund? 159 unlösbar.8 Beide Probleme, das der irrealen Bedingungssätze wie das der Dispositionsprädikate, hängen – wie Goodman in den Special Lectures gezeigt hat – aus internen Gründen mit dem Induktionsproblem zusammen: Aussagen über Dispositionen haben die ontologisch prekäre Konsequenz, die Realität mit ‚möglichen’ Eigenschaften zu bevölkern. Denn Dispositionen „zeigen“ sich stets nur unter besonderen Bedingungen, und es kann durchaus sein, dass diese für einen Gegenstand G, der zu D disponiert ist, nie eintreten. Manches Kupferkabel leitet nie Strom. Und so für beliebige Gs und Ds. Die Übersetzung einer Aussage, in der von einem Dispositionsprädikat Gebrauch gemacht wird, in einen irrealen Bedingungssatz überführt diese in einen Verbund zweier Aussagen, in denen der Vordersatz das Eintreten der spezifischen Bedingung und der Nachsatz das Sich-zeigen der betreffenden Eigenschaft an G in manifesten Prädikaten beschreibt. Damit wird die Rede über ‚mögliche’ Eigenschaften vermieden, eben um den Preis des Irrealis: Wenn ich zur Zeit t ohne Anmeldung den Garten meines neuen Nachbarn betreten hätte, dann wäre ich von dessen Hund gebissen worden. Der irreale Bedingungssatz simuliert sozusagen den Induktionsschluss, der im Dispositionsprädikat zwar nahegelegt, aber mit dem Zusprechen eines solchen eben gerade nicht vollzogen wird. Eine Warnung wie „Vorsicht, bissiger Hund“9 besagt zwar allgemein, dass das betreffende Tier H unter bestimmten Umständen zubeißt, vollzieht aber den eigentlichen Induktionsschritt nicht: die Fortsetzung der Hypothese „H beißt jeden, den es nicht kennt“ von einer Reihe bestätigter Fälle auf den nächsten anstehenden: „H wird Sie beißen, wenn Sie jetzt den Garten betreten.“ Nun ist es eine bekannte Tatsache, dass selbst das zuverlässigste, bestens gewartete Auto eines Morgens unerwartet streiken kann.10 Es führt jedoch zu nichts, wenn man das Problem der Dispositionsprädikate durch das der irrealen Bedingungssätze ersetzt, denn dieses ist mit noch mehr Komplikationen belastet als jenes. Denn der irreale Bedingungssatz behauptet nie nur, dass unter der und der Prämisse das und das sich effektiv ereignet hätte oder ereignen würde. Das macht nicht seinen vollen _____________ 8 9 10 Jede Behauptung, die einem Gegenstand G ein Dispositionsprädikat zuspricht, z. B. „brennbar“, kann in einen irrealen Bedingungssatz umformuliert werden, in dem dieses – erkenntnistheoretisch problematische – Prädikat durch Ereignisprädikate ersetzt wird: Wäre G, z. B. Papier, zum Zeitpunkt t auf 200 erhitzt worden, so hätte es sich entzündet. Warnungen sind schon vom Inskriptionstyp her auf die Verwendung von Dispositionsprädikaten ausgelegt. „bestens gewartet“ kann man als kaschiertes Dispositionsprädikat auffassen: so gewartet, dass alle Funktionen des Fahrzeugs auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft und diese somit gegeben sind. Christian Stetter 160 Sinn aus. Immer setzt die „irreale“ Behauptung voraus11 – dies macht das eigentlich Irreale an ihr aus –, dass zusätzlich bestimmte günstige Bedingungen gegeben wären, unter denen erst die hypothetisch vorausgesagte Folge aus der Prämisse faktisch zutreffen würde oder hätte zutreffen können – der Irrealis ist, wie sich an dieser Präzisierung zeigt, nie in den Realis zu verwandeln. Das Scheitern dieses Lösungsversuchs hat Goodman veranlasst, das Problem der Induktion grundsätzlich neu zu überdenken. Da das eine wie das andere Problem das der Induktion impliziert, musste dort der Grund für die Schwierigkeiten zu suchen sein. Der Aufbau der Special Lectures macht Goodmans Weg deutlich. Das braucht hier nicht im einzelnen referiert zu werden. Resultat dieses Weges ist eine Umorganisation der gesamten Problemlage. Alles wird schließlich auf die Frage zugespitzt, wie die Fortsetzung einer Hypothese auf einen noch nicht geprüften Fall gerechtfertigt werden kann, und die Antwort auf diese Frage wird aus einem Problem der Rechtfertigung der Gültigkeit dieser Fortsetzung transformiert in die Frage, ob der gegebene Induktionsschluss den Regeln einer bewährten Praxis der Induktion entsprochen habe oder entspricht. Aus der Frage nach der Rechtfertigung einer Aussage über Zukünftiges wird so die nach einer Definition des Unterschiedes zwischen gerechtfertigter Weise und nicht gerechtfertigter Weise fortgesetzten Hypothesen.12 Die ebenso ingeniöse wie irritierende Erfindung der G-Prädikate dient dazu, die für diese Unterscheidung einschlägigen Kriterien zu klären. Sie hat zunächst manches Missverständnis hervorgerufen.13 Hilary Putnam hat darauf hingewiesen, dass diese Prädikate es Goodman ermöglicht hätten, einen regelrechten Beweis für seine These zu führen, dass die Gültigkeit einer Induktion nicht formal gezeigt werden könne wie die einer Deduktion.14 Dies trifft zwar in gewisser Weise zu, doch evident ist die Beweisführung bei weitem nicht. Jedenfalls läuft Goodmans Neuansatz auf das Problem der Fortsetzung einer Hypothese und damit auf Folgendes hinaus: Das Induktionsproblem besteht nicht darin, eine Schlussfolgerung von Einzelfällen einer bestimmten Klasse von empirischen Sachverhalten auf die Gesamtmenge dieser Klasse als gültig auszuweisen, insbesondere auf diejenige Teilmenge von Fällen, von _____________ 11 12 13 14 Goodman spricht davon, dass der irreale Bedingungssatz dies behaupte, vgl. Goodman: Tatsache, Fiktion, Voraussage, a.a.O., S. 55 f. Dies scheint mir unzutreffend, allerdings für Goodmans weitere Argumentation unerheblich. Klar ist jedenfalls, dass jeder irreale Bedingungssatz voraussetzt, dass die erforderlichen günstigen Umstände im betreffenden Fall gegeben gewesen wären. Vgl. hierzu ebd., S. 52 ff. Vgl. ebd. S. 110 ff. Die Hypothese formuliert stets einen gesetzesartigen Zusammenhang zwischen Prämisse und Konsequenz, vgl. ebd. S. 97 ff. Vgl. hierzu auch Goodmans Vorwort zur 3. Auflage, in: ebd., S. 7 ff. Vgl. Putnams Vorwort zur 4. Auflage von Fact, Fiction, and Forecast, in: ebd., S. I ff. Freind oder feund? 161 denen man unterstellt, dass sie sich zukünftig ereignen werden, also etwa auf alle zukünftig zu startenden Autos, dass sie starten werden. Eine derartige Sicherheit der Prognose gibt es schlechterdings nicht, denn unsere Kenntnis empirischer Sachverhalte ist begrenzt. Vielmehr lautet das Problem der Induktion, wie es zu rechtfertigen ist – offenkundig ist es ja gängige Praxis –, eine mehr oder weniger gut bestätigte Hypothese auf einen neuen, noch nicht geprüften Fall anzuwenden. Die traditionelle Form der Induktion wird somit umgeformt in das Problem der Fortsetzung einer Hypothese, die sich an einer begrenzten Anzahl von Fällen bewährt hatte, auf einen noch nicht bestätigten Einzelfall.15 Das daraus sich ergebende Problem lautet: Wie ist dieser Induktionsschritt zu rechtfertigen? Goodmans Lösungsansatz kombiniert zwei Gedanken miteinander:16 Erstens verweist er darauf, dass sich auch die Gültigkeit eines deduktiven Schlusses D nicht deduktiv beweisen lässt. Jeder Beweis setzt die Form des Beweises bereits als gültig voraus.17 D kann daher nur dann – dann aber völlig zu Recht – als gerechtfertigt betrachtet werden, wenn er in Übereinstimmung _____________ 15 16 17 „Fortsetzung“ ist bei Goodman folgendermaßen definiert: Gegeben sei eine Hypothese H, dass sich aus einer Sachlage Sp (und einer Menge von kontingenten Begleitumständen Up) und einem auf diese einwirkenden Vorgang Vi stets eine Sachlage Sc ergibt; vorausgesetzt weiter, dass die Regelmäßigkeit dieser Abfolge Sp Vi Sc durch eine Reihe von Tests oder Experimenten bestätigt wurde. Dann besteht die Fortsetzung der Hypothese in dem explizit formulierten und akzeptierten Schluss darauf, dass sich aus einer zukünftigen Sachlage Sp’ und einem auf diese einwirkenden Vorgang Vi’ eine Sachlage Sc’ ergibt derart, dass Sp und Sp’, Sc und Sc’ und Vi und Vi’ – abgesehen von kontingenten Differenzen, die sich aus den schon zeitlich differierenden Umständen ihrer Realisierung ergeben –, als die gleichen Sachlagen bzw. Vorgänge betrachtet werden können. Abgekürzt: dass [Sp Vi Sc] [Sp’ Vi’ Sc’]. Vgl. hierzu Goodman: Tatsache, Fiktion, Voraussage, a.a.O., S. 110 ff. Hierzu eine Anmerkung zum Gebrauch des Wortes „gleich“ () in diesem Zusammenhang: Die Umstände, unter denen etwa zweimal das gleiche Fahrzeug auf der gleichen Strecke bei gleichem Tempo mit dem gleichen Druck auf die Bremse abgebremst wird, werden nie genau gleich sein – weder das Fahrzeug beim zweiten Mal genau dasselbe wie beim ersten Mal, noch das Tempo exakt dasselbe usw. Doch bei einer ausgereiften Fahrzeugserie wird man sagen können, dass ein Fahrzeug dieses Typs bei der und der Geschwindigkeit und dem und dem Gewicht bei dem und dem Bremsdruck und … dem und dem … nach so und soviel Metern zum Stehen kommt. Ingenieure lösen dieses logische Problem technisch u. a. durch die Definition von Fertigungstoleranzen. Vgl. Goodman: Tatsache, Fiktion, Voraussage, a.a.O., S. 84 ff. Dies hatte u. a. schon Peirce in seinen Analysen zum Verhältnis von logica docens ( Theorie) und logica utens ( Praxis) gezeigt. Vgl. hierzu CP 2.186 ff. Der Grundgedanke des Goodman’schen Lösungsansatzes ist dem übrigens analog: Dass nämlich die Lösung des Induktionsproblems in einem Spezialfall der Induktion zu suchen ist – in der Fortsetzung des Dispositionsprädikats „fortsetzbar“. Vgl. hierzu Goodman: Tatsache, Fiktion, Voraussage, a.a.O., S. 110 ff. Christian Stetter 162 mit einer akzeptierten Praxis des Vollzugs von Deduktionen vollzogen wurde, also gemäß dem, wie eben ein deduktiver Schluss in der Regel organisiert ist. Entsprechendes muss für die Induktion gelten. Die Pointe dieses Gedankens liegt darin, dass sich die Regeln für Deduktion bzw. Induktion daraus ergeben, dass einzelne Schlüsse als gültig akzeptiert werden, was zu entsprechenden Regelformulierungen führt. Diese werden anhand weiterer Schlüsse auf ihre Haltbarkeit überprüft und gegebenenfalls modifiziert: „Der Vorgang der Rechtfertigung besteht in feinen gegenseitigen Abstimmungen zwischen Regeln und anerkannten Schlüssen; die erzielte Übereinstimmung ist die einzige Rechtfertigung, derer die einen wie die anderen bedürfen.“ Zweifellos liegt hier ein Zirkel vor, aber eben ein nicht zirkulärer, sondern ein produktiver: Jeder erfolgreiche Durchgang bestätigt das Verfahren – eine Art von Induktion.18 Zweitens macht er geltend, dass die Rechtfertigung eines Induktionsschlusses nicht darin bestehen könne zu zeigen, dass die betreffende Prognose sich als richtig erweisen werde. Dies ist – wie oben schon erwähnt – unmöglich. Die Rechtfertigung kann daher nur in einer zutreffenden Beschreibung der akzeptierten Praxis der Induktion bestehen, sodass gezeigt werden kann, dass ein vorliegender Induktionsschluss den Regeln dieser Praxis genügt. An die Stelle des sogenannten Humeschen Problems19 tritt somit die „konstruktive Aufgabe“, die akzeptierte Praxis des Vollzugs von Induktionen so zu beschreiben, dass sich daraus Kriterien für die Unterscheidung von gültigen und nicht gültigen Induktionsschlüssen ableiten lassen:20 „Das Induktionsproblem ist kein Beweisproblem, sondern ein Problem der Defini_____________ 18 19 20 Ebd., S. 87. Goodman nennt dies einen „guten Zirkel“ (ebd.). Dies scheint mir in gewisser Weise durchaus zutreffend, aber zu schwach zu sein. Zwar trifft es zu, dass allgemeine Regeln der Deduktion sich nur durch ihre Übereinstimmung mit effektiv vollzogenen gültigen Schlüssen als gültig erweisen lassen. Jedoch lassen sich manche effektiv vollzogenen Schlüsse auch effektiv als gültig erweisen, z. B. die Allgemeingültigkeit des quantorenlogischen Schemas (x) Fx (x) Fx oder die des Schemas (y) [(x) Fx Fy] für jeden nichtleeren Bereich; für diese Schemata genügt die Explikation des Verständnisses der Ausdrücke „nichtleer“ bzw. „alle“; vgl. hierzu Quine: Grundzüge der Logik, Frankfurt a. M. 1969, S. 136 ff. und S. 182 ff. Ähnliches lässt sich für nicht unendliche Bereiche auch für induktive Schlüsse zeigen. Doch dies ist für die weitere Diskussion ohne Belang. Goodman “rehabilitiert” Hume, indem er zeigt, dass die geläufige Auffassung dieses sogenannten Problems auf dem Missverständnis beruht, ein Induktionsschluss sei dann gerechtfertigt, wenn demonstriert werden könne, dass und aus welchen Gründen er sich als richtig erweisen werde. Aber eben dies ist – wie schon bemerkt – unmöglich, und Hume war diesem Missverständnis auch nicht aufgesessen. Vgl. Goodman: Tatsache, Fiktion, Voraussage, a.a.O., S. 81 ff., Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, Frankfurt a. M. 2007, Abschn. 4 und 5. Ebd., 3.3, S. 89 ff. Freind oder feund? 163 tion des Unterschiedes zwischen gerechtfertigten und ungerechtfertigten Voraussagen.“21 Goodman zeigt anhand seiner „G-Prädikate“, dass sich dieses Fortsetzungsproblem, damit das Induktionsproblem generell,22 nicht formal lösen lässt. Die Rechtfertigung für die Fortsetzung einer so und so bestätigten Hypothese H auf einen zukünftigen Fall ergibt sich vielmehr daraus, dass die Beschreibungen der Sachlagen Sp und Sc und des Vorgangs Vi auf Prädikaten beruhen, die sich regelmäßig unter bestimmten Umständen bewährt hatten, indem sie sich auf ähnliche Sachverhalte als Deutungskategorien übertragen ließen,23 also nicht auf der logischen Syntax der betreffenden Schlüsse, sondern auf der spezifischen, auf ihrem kontingenten Gebrauch beruhenden Semantik der in diesen Schlüssen verwendeten Prädikate. Goodman nennt diese Qualität der Beschreibungsprädikate ihre „Verankerung“.24 Diese kann mehr oder weniger bewährt sein – je nachdem, wie erfolgreich ein Prädikat in der Vergangenheit fortgesetzt worden war.25 Dieser Begriff der Verankerung ist sozusagen der Grundstein, auf dem die von Goodman umrissene Theorie der Fortsetzung beruht. Um so merkwürdiger, dass er eher en passant eingeführt wird, als wäre er durch den Hinweis auf seine Funktion im Rahmen der Fortsetzung hinreichend erläutert.26 Goodman weist erläuternd darauf hin, dass eigentlich nicht das Prädikat, sondern seine Extension verankert werde.27 Doch auch dies bedürfte der Klä_____________ 21 22 23 24 25 26 27 Ebd. S. 88. Goodman zeigt – dies ist wohl die eigentliche Pointe seines Lösungsansatzes – im Anschluss an sein Konzept der Fortsetzung, dass (1) die Fortsetzung des Prädikats „fortsetzbar“ als Spezialfall eines Induktionsschlusses auffassen lässt, und dass (2) die Lösung dieses Spezialfalls die Lösung des allgemeinen Problems der Rechtfertigung von Induktionen ist. Denn jeder gültige Induktionsschluss beruht ja auf einer gerechtfertigten Fortsetzung eines Dispositionsprädikats. Vgl. ebd., 4.1, S. 110 ff. Die Bewährtheit von Prädikaten beruht somit – dies sei eigens festgehalten – streng genommen nicht auf regelmäßigem, sondern auf analogem Gebrauch, auch wenn der Zusammenhang zwischen Prämisse und Konsequenz als gesetzmäßig unterstellt wird. Denn es bleiben eben immer die irreduziblen günstigen Umstände, die gegeben sein müssen, damit die Hypothese erfolgreich fortgesetzt werden kann. Vgl. Goodman: Tatsache, Fiktion, Voraussage, a.a.O., S. 121 ff. In einer Erläuterung dieses Konzepts bemerkt Goodman, dass – genauer betrachtet – nicht die Prädikate, sondern ihre Extensionen verankert würden (ebd. S. 123). Dies ist zumindest missverständlich: Der Begriff meint offensichtlich das Austarieren der Denotationsrelation zwischen dem Prädikat und seiner Extension, was notwendig Konsequenzen auch für die Intension des Prädikats hat. Ebd., S. 120 ff. und 128 f. Es wäre ja in der Tat kein „guter“ Zirkel, wenn zum Verständnis des Wortes „Verankerung“ auf das Verständnis des Begriffs „erfolgreiche Fortsetzung“ rekurriert werden müsste. Ebd. S. 123. Christian Stetter 164 rung.28 Dass die Hypothese „Alle Smaragde sind grün“ erfolgreich fortgesetzt wurde, besagt zunächst ja nicht mehr, als dass ein neu gefundener Smaragd sich ebenfalls als grün erwiesen hatte, allgemein: dass eine Voraussage der Form „Der Gegenstand G wird sich unter den Bedingungen C1, C2, …, Cn so und so verhalten“ beim nächsten „anstehenden“ Fall eingetroffen war. Für „… wird sich … so und so verhalten“ steht je ein bestimmtes Prädikat: „… wird zubeißen“, „… wird sich bei … entzünden“, „… wird nach … Metern zum Stehen kommen“ usw. Das zweite Prädikat könnte bei einem chemischen Versuch verwandt werden, das dritte bei einem Fahrzeugtest, also einem technischen Versuch. Was heißt es nun, dass die Extension dieser Prädikate verankert wird? Zunächst nicht mehr, als dass das Resultat der betreffenden Versuche denen vorausgegangener Versuche gleich oder annähernd gleich war. Die bestätigte Extension wäre hier eine bestimmte Bandbreite von quantitativen Werten, also Werte, die nicht kleiner als … und nicht größer als … waren. Dass der neu gefundene Smaragd sich als grün erwies, bedeutete entsprechend, dass er nicht rot und nicht blau und nicht … war usw. Verankerung der Extension heißt also: Bestätigung einer Hypothese über die Extension des betreffenden Prädikats in Unterscheidung von der Extension anderer, mehr oder weniger ähnlicher Prädikate. Dass x unter den Umständen U einen Bremsweg von ca. 20 Metern hat, kann nur gegen „konkurrierende“ Maße wie etwa „… von ca. 5 Metern“ oder „… von ca. 30 Metern“ verankert werden, nicht aber gegen Angaben wie „… von ca. 5 Kilometern“ oder „… von ca. 5 kg“, die Extension von „grün“ gegen die von „gelb“ oder „blau“, nicht aber gegen die von „salzig“ oder „von Bach komponiert“ usw. „Verankerung“ heißt also: Austarieren, präzisieren, korrigieren der Denotationsrelation zwischen einem Prädikat P und seiner Extension in Unterscheidung – so könnte man sagen – von Prädikaten der gleichen oder einer ähnlichen Sphäre oder Ordnung logischer Subjekte.29 Je besser diese Relation in ihrem Gebrauch durch entsprechende Sprachoder Forschergemeinschaften oder ähnliche Populationen verankert ist, desto besser verankert ist das betreffende Prädikat. Dieser Gedanke liefert die Basis dafür, berechtigte von nicht berechtigten Fortsetzungen eines Prädikats zu unterscheiden.30 Bezogen auf „grün“ als Nachprädikat einer Hypothese, das auf „Smaragd“ als Vorprädikat angewandt wird, heißt dies, dass dieses Prä_____________ 28 29 30 Für sich genommen ist – wie sich im Weiteren zeigen wird – diese Bemerkung eher irreführend. Es geht vielmehr um die Verankerung der Denotationsrelation. Vgl. hierzu Goodman: Sprachen der Kunst, Frankfurt a. M. 1997, Kap. 1. Genauer müsste man hier von berechtigteren von weniger oder gar nicht berechtigten Fortsetzungen sprechen. Freind oder feund? 165 dikat hier im Gegensatz zu „grot“ offensichtlich oft erfolgreich fortgesetzt wurde.31 Jede Verankerung eines hypothetisch verwendeten Prädikats setzt dergestalt eine schon sprachlich beschriebene und kategorisierte Welt voraus. Über grün oder rot kann man nur dann streiten, wenn unstrittig ist, dass der betreffende Fall in einem Bezugnahmegebiet angesiedelt ist, das unter die Distinktion farbig: nicht farbig fällt und für den anstehenden Fall farbig als einschlägig vorausgesetzt ist. Damit haben wir die – in Fact, Fiction, and Forecast zwar berührte32, nicht aber explizit thematisierte – sprachphilosophische Basis von Goodmans Theorie der Fortsetzung erreicht. Kommen wir nun zum Thema zurück: Die allgemeine Formel für ein G-Prädikat P* lautet, so können wir zusammenfassen: P* beschreibt eine Klasse K* von Objekten O*, für die Folgendes gilt: Wenn gilt: Oi ist vor einem Zeitpunkt t geprüft, dann: Oi ist p1, andernfalls gilt: Oi ist p2, und die Aussage „x ist p2“ impliziert, dass x nicht p1 ist. p1 und p2 sind im Kontext des bislang referierten Induktionsproblems als Variablen zu verstehen für „normale“ natürlichsprachliche Prädikate wie „… ist rot“, „… ist ein Smaragd“, „… leitet elektrischen Strom“, „… ist 1,5 m lang“, „… wiegt 1 kg“ usw. Betrachten wir nun zwei andere, nach dieser Formel konstruierte Prädikate: freind df vor einem Zeitpunkt t geprüft und als freundlich befunden, sonst feindlich; feund df vor einem Zeitpunkt t geprüft und als feindlich befunden, sonst freundlich. Was unterscheidet sie von G-Prädikaten wie „grot“, „glau“33 oder „Smarblume“? Gemeinsam ist ihnen die Struktur der Extension: Sie fassen jeweils eine Menge von Objekten zu einer Klasse zusammen, deren Elemente sich darin unterscheiden, dass die einen vor einem Zeitpunkt t geprüft und für p1 befunden wurden, die anderen, für die dies nicht gilt, sind p2. Gemeinsam ist ihnen auch – dies wird nun relevant –, dass „freind“ und „feund“ wie „grot“ usw. ein und derselben Sprechergemeinschaft SGi als regelmäßig verwendetes _____________ 31 32 33 Die Frage, ob ein Prädikat auf einen neuen Fall anzuwenden ist, setzt ja dessen Prüfung voraus. Also ist für sämtliche bereits geprüften Smaragde die Extension von „grün“ und „grot“ gleich. Sie unterscheiden sich aber in ihrer Verankerung: Jede „erfolgreiche“ Benennung eines neu gefundenen Kristalls, das sich als Smaragd herausstellte, als grün-seiend hat die Relation zwischen dem Prädikat „grün“ und seiner Extension bestätigt und damit diese Anwendung von „grün“ einen Grad „fortsetzbarer“ gemacht – im Gegensatz eben zu „grot“; vgl. hierzu Goodman: Tatsache, Fiktion, Voraussage, a.a.O., S. 120 ff. Vgl. das diesem Aufsatz vorangestellte Motto. glau df vor einem Zeitpunkt t geprüft und grün, sonst blau. Christian Stetter 166 Vokabular zugeschrieben werden.34 Gemeinsam ist ihnen schließlich auch, dass dasselbe Vokabular – hier das der deutschen Sprache – als Definitionsvokabular verwendet wird.35 Sie unterscheiden sich aber darin von G-Prädikaten, dass dasselbe Objekt Ot36 von verschiedenen kompetenten Sprechern von SGi vor t nicht einmal „grün“, ein anderes Mal „rot“, oder einmal „grot“, ein anderes Mal „rün“37 genannt wird, sondern – solange jedenfalls die betreffende Sprachkompetenz „funktioniert“ und normale Wahrnehmungsbedingungen herrschen – entweder regelmäßig „grün“ oder regelmäßig „rot“ usw., während ein und dieselbe Person Pt von verschiedenen kompetenten Sprechern von SGi vor t, also nach Prüfung, durchaus einmal „freundlich“, einmal „feindlich“, oder einmal „freind“, einmal „feund“ genannt werden könnte. „rot“, „grün“, „Smaragd“, „Kornblume“ usw. sind in der deutschen Sprache bestens verankerte Prädikate, die auf ein stattliches Alter zurückblicken können.38 Wenn nun von zwei Sprechern des Deutschen der eine Ot als rot, der andere als grün bezeichnen würde, so würde man zu dem Schluss kommen, dass entweder die beiden doch von verschiedenen Objekten sprechen, oder dass einer von beiden farbenblind ist. Würde dasselbe mit „Smaragd“ und „Kornblume“ eintreten, so würde man wohl vermuten, dass einem von beiden entweder die Bedeutung von „Smaragd“ oder die von „Kornblume“ nicht bekannt ist. Weil eben für einen ‚kompetenten’ Sprecher des Deutschen ein und derselbe Gegenstand gleichzeitig nicht sowohl rot wie grün, nicht sowohl Smaragd wie Kornblume sein kann.39 Daher kann – so wäre man versucht, bei einem be_____________ 34 35 36 37 38 39 In Goodmans Analysen ist dies – aufgrund ihres Gegenstandes – als selbstverständlich unterstellt worden. „grot“, „Smarblume“ usw. werden als alternatives Vokabular ein und derselben Sprechergemeinschaft behandelt, der auch das „Normalvokabular“ zugeschrieben wird, das als Definitionsvokabular verwendet wird. Goodmans in Auseinandersetzung mit Carnap verwendetes Argument, man könne ebenso G-Prädikate wie „grot“ oder „Smarblume“ zur Definition unserer „normalen“ Prädikate „rot“, „grün“ usw. verwenden (vgl. Goodman: Tatsache, Fiktion, Voraussage, a.a.O., S. 103 ff.), ist zwar abstrakt zutreffend, widerspricht aber seiner eigenen Theorie der Verankerung. Ein vor t geprüftes Objekt. rün df vor einem Zeitpunkt t geprüft und als rot befunden, sonst grün. Wörter sind nach einem schönen Diktum W. von Humboldts die eigentlichen „Individuen“ der Sprachen; vgl. Humboldt: Grundzüge des allgemeinen Sprachtypus, herausgegeben von Christian Stetter, Berlin 2004, S. 81. Und die meisten von ihnen sind Jahrhunderte alt, viele noch weitaus älter. Es gibt natürlich Objekte, die teilweise rot, teilweise grün oder – wie eine Ampel – phasenweise entweder rot oder grün sind. Das ist hier nicht gemeint; die Rede ist von Gegenständen, die als Ganze entweder dauerhaft oder phasenweise nur eine Farbe aufweisen. Bei als Klassenbezeichnungen verwendeten Substantiven stellt sich das Problem normalerweise nicht: Ein Smaragd ist eben ein Smaragd, eine Kornblume eine Kornblume, und bei letzterer Sorte von Objekten nehmen wir sogar beträchtliche Freind oder feund? 167 währten, in der Sprachgemeinschaft gut verankerten Prädikat Pi zu verallgemeinern – ein und derselbe Gegenstand für verschiedene kompetente Sprecher der betreffenden Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt t nicht einmal Pi und einmal non-Pi sein. Für „rot“ wie „Kornblume“ mag dies zutreffen, und es trifft sogar für nicht verankerte Prädikate wie „grot“ oder „Smarblume“ zu. Es gilt jedoch weder für „freund“ und „feind“ noch für „feund“ oder „freind“.40 Denn obwohl „freund“ und „feind“ im Sprachgebrauch des Deutschen sicher so gut verankert sind wie „rot“ oder „Kornblume“, ist es doch nicht nur möglich, sondern kommt regelmäßig vor, dass ein und dieselbe Person Si für zwei verschiedene Sprecher des Deutschen, die im Gebrauch dieser Prädikate – so wollen wir annehmen – völlig übereinstimmen, vom einen als Freund, vom anderen als Feind wahrgenommen und so bezeichnet wird. Denn im Unterschied zu „rot“ oder „Kornblume“ bezeichnen „freund“ und „feind“ nicht interne Eigenschaften von Si,41 sondern Relationen zwischen Si und anderen Personen. Und diese Relationen können sich zudem im Verlauf der Zeit in ihr Gegenteil verkehren. Aus Freunden können bekanntlich Feinde werden und umgekehrt. Dies gilt für jedes Prädikat, das in einer Sprachgemeinschaft zur Interpretation einer Relation zwischen Personen oder Gruppen oder ganzen Populationen usw. verwendet wird. Ich bezeichne solche Prädikate im weiteren als relationale Vorurteilsprädikate bzw. V-Prädikate. Das in unserem Zusammenhang Bedeutsame liegt darin, dass Vorurteile die gleiche Zeitstruktur für ihre Extension aufweisen wie die G-Prädikate: Eine Meinung über einen Sachverhalt S gilt dann als Vorurteil, wenn sie nicht auf überprüfter Kenntnis von S beruht und bestätigten Erfahrungen widerspricht. Vorurteile haben ja die interne Eigenschaft, erfahrungsresistent zu sein: Es kommt häufig genug vor, dass Personen, die regelmäßig zum Türken einkaufen oder essen gehen, Muslime für gefährlich oder für nicht vertrauenswürdig halten.42 _____________ 40 41 42 Unterschiede des Zustandes hin, ohne das Prädikat zu wechseln: Eine frische wie eine völlig verdorrte Kornblume bleibt doch eine Kornblume.„Wie erkenne ich“, fragt Wittgenstein, „dass diese Farbe Rot ist?“, … und er antwortet: „Eine Antwort wäre: ‚Ich habe Deutsch gelernt.’“ (Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, Schriften Bd. 1, Frankfurt a. M. 1984, § 381.) Ich behandle „freund“ und „feind“ hier der Einfachheit halber als Adjektive. Für die substantivische Verwendung gilt das Folgende gleichermaßen. Ich verwende das Prädikat „intern“ hier in dem von Wittgenstein definierten Sinn: „Eine Eigenschaft ist intern, wenn es undenkbar ist, dass ihr Gegenstand sie nicht besitzt.“ (Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, Schriften Bd. 1, Frankfurt a. M. 1984, T 4.123). Bis vor wenigen Jahrzehnten gab es regelmäßig noch zwischen den Angehörigen verschiedener christlicher Konfessionen oder Landsmannschaften ähnliche Vorurteilsstrukturen; zum Teil existieren solche noch bis heute. Man könnte also für die Christian Stetter 168 Vorurteile sind ebenso verbreitete wie funktionale soziale Phänomene. Sie minimieren die Ungewissheit des Handelns in Konstellationen von Sachlagen, die man nicht überschaut, wo man unerfahren ist, wo also Informationen fehlen, um Handlungsalternativen rational abwägen zu können. Sie greifen bei V-Prädikaten entsprechend in dem Extensionsbereich der nicht vor t geprüften Sachverhalte.43 V-Prädikate exemplifizieren somit in ihrer Extensionsstruktur eine für alle Prädikate typische Eigenschaft, die in menschlichen Gesellschaften verwendet werden, um Konstellationen sozialen Handelns oder Verhaltens zu interpretieren und zu unterscheiden.44 Dabei kommt es immer auf den Standpunkt, die Interessenlage, das jeweilige System von Kategorien und Werten an. Das Vokabular mag traditionell und weit verbreitet sein. „freund“, „feind“, „nützlich“, „schädlich“ usw. sind im Sprachgebrauch des Deutschen jedenfalls bestens verankerte Prädikate – freilich nicht im Sinne von Goodmans Konzept der Verankerung von Prädikaten.45 Dessen Spezifik wird erst im Kontrast zu dem der V-Prädikate deutlich: Als Bezugnahmegebiet für „rot“, „grün“, „grot“, „rün“, „Smaragd“, „Kornblume“ usw. ist in Goodmans Überlegungen stets und ausschließlich ein Bereich von ‚natürlichen’ oder ‚technischen’ Sachverhalten unterstellt, deren Eigenschaften experimentell erforscht werden. Das ergibt sich aus dem Problem, das zu lösen ist: der Induktion. Deren Gegenstand sind – wie bereits bemerkt – Gesetzesaussagen.46 Dies gibt der Intension der in diesem Zusammenhang betrachteten Prädikate ein besonderes Gesicht, selbst so alltäglicher wie „rot“, „grün“, „rund“ oder „eckig“: In diesem Rahmen werden solche Prädikate – sofern sie zur Unterscheidung von Eigenschaften verwendet werden, die für die betreffenden Sachverhalte „kritisch“ sind – durch quantitative Werte definiert, die von „rot“ oder „grün“ etwa durch solche, die durch Spektralanalysen gewonnen werden, die von „Smaragd“ durch Angabe der besonderen kristallinen Eigenschaften usw. Das macht es dann möglich, die Extension der betreffenden Prädikate mit einer Genauigkeit zu bestimmen, die ihren Grund nicht mehr in der Wahrnehmungsfähigkeit menschlicher _____________ 43 44 45 46 hier als Beispiele mit einer gewissen Aktualität verwendeten Prädikate „Türke“ und „Muslim“ ebenso „Katholik“, „Protestant“, „Rheinländer“, „Schwabe“ usw. einsetzen. Insbesondere Vorurteile ersterer Art sind inzwischen sicher seltener geworden, aber solche oder ähnliche Vorurteilsstrukturen wird es immer geben. Wobei man hier für t „jeweilige Handlungs- oder Wahrnehmungsgegenwart“ setzen könnte. Das macht das Vorurteilsmäßige am Vorurteil aus. Ich fasse im Folgenden alle solche Prädikate, die zur Interpretation sozialer Sachverhalte im eben skizzierten Sinne verwendet werden, unter der Bezeichnung „VPrädikate“ zusammen. Insbesondere beziehen sie sich nicht auf gesetzesartige Zusammenhänge. Vgl. hierzu Goodman: Tatsache, Fiktion, Voraussage, a.a.O., S. 33 ff. und S. 97 ff. Freind oder feund? 169 Sinnesorgane hat, sondern in der Funktion und Präzision von Messapparaturen.47 „Verankerung“ heißt somit immer: Regelung und Austarierung der Relation zwischen dem Prädikat und seiner Extension im Rahmen des Gebrauchs dieses Prädikats, und zwar – wie wir gesehen hatten – stets im Unterscheid zu anderen Prädikaten derselben oder ähnlicher kategorialer Bereiche. Entscheidend ist für die Verankerung eines Prädikats P im Unterschied zu Prädikaten Q, R, S, … stets die möglichst genaue Grenzziehung zwischen noch P und nicht mehr P, sondern schon Q oder R usw. Bei V-Prädikaten wird diese Grenzziehung im Rahmen von natürlichsprachlichen Diskursen getroffen, in denen konkurrierende Meinungen über die Interpretation des fraglichen Sachverhalts aufeinandertreffen. Seien solche Auseinandersetzungen noch so rational: Sie werden – es gehe etwa darum, ob sich die Partei XYZ angesichts des Wahlausgangs noch an eine vor der Wahl gegebene Zusage halten müsse oder ob die politische Realität nun etwas anderes verlange – in aller Regel nicht durch den Nachweis entschieden, dass die eine Meinung zutreffend, die andere falsch sei. Im Bereich empirischer sozialer Fakten sind derartige Nachweise meist nicht zu führen.48 Eine Meinung wird sich durchsetzen – wie auch immer. Im Experiment ist dies anders: Die Denotation eines Prädikats wie „biegsam“ wird im Design des Experiments, in dem die Biegsamkeit bzw. Elastizität eines Metalls geprüft werden soll, durch Angabe der betreffenden physikalischen oder chemischen Eigenschaften des Metalls und durch die quantitativen Werte definiert, die sich etwa in einer Testreihe ergeben. Diese Werte gelten dann für die betreffenden Sprachspiele von Spezialisten innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen, jedenfalls solange sie nicht durch neuere Experimente korrigiert werden, was in der Regel heißt, dass die Toleranzgrenzen präzisiert werden. Für Laien gelten sie dann per se. Wir finden uns hier wieder vor dem uralten Widerstreit zwischen dem Wahren und dem Wahrscheinlichen, zwischen Logik und Rhetorik, wie er in Platons Dialogen ausgetragen worden ist.49 Über Prädikate wie „Freund“, „Feind“, „nützlich“, „schädlich“, „gerecht“, „sozial ausgewogen“ usw. wird in allen oder doch den meisten menschlichen Gesellschaften immer wieder neu debattiert und neu entschieden, öffentlich oder privat, frei oder unter Repres_____________ 47 48 49 Natürlich müssen deren Instrumente abgelesen werden, und auch hier liegen noch mögliche Fehlerquellen. Das vernachlässige ich im Weiteren, da es für das hier diskutierte Problem bestenfalls eine Nebenrolle spielt. Dies schon deswegen nicht, weil es mindestens voraussetzen würde, dass man sich über die Prämissen der Entscheidung einig wäre. Zudem fehlt in der Regel eine gesicherte Datenbasis. Die kann sich – wie man weiß – selbst bei statistisch erhobenen Fakten, etwa Umfragen vor einer Wahl, unerwartet verändern. Vgl. hierzu Stetter: Schrift und Sprache, Frankfurt a. M. 1997, Kap. 8 und 9. Christian Stetter 170 sion. Dass sich im offenen Diskurs der zwanglose Zwang des besseren Arguments durchsetze, darf und muss man zwar hoffen, doch setzt dies vieles voraus: Bildung und Einsicht der Diskursteilnehmer, Abwesenheit von Sachzwängen und divergierenden Interessen ebenso wie von drohender Gewalt usw., also eine ‚ideale’ Kommunikationssituation. Dass durch die Macht von Mehrheiten, von Ämtern und Funktionen, von Kapital, Medien oder militärischer Potenz entschieden wird, ist gesellschaftliche Realität, die in vielen Fällen durchaus legal, in manchen sogar legitim ist. Das braucht hier nicht weiter ausgebreitet zu werden. Es gibt der These, die Platon letztlich wohl doch als der Realität zumindest nahekommend akzeptiert hatte, dass nämlich die Bedeutung der Wörter sich aus der gesellschaftlichen Konvention herleite, dem Nomos, einen skeptischen oder auch zynischen Sinn: Der Nomos war das traditionale Recht,50 und das beruhte seinerseits auf Macht. Die Verankerung von V-Prädikaten im Sprachgebrauch öffentlicher wie privater Diskurse geschieht heute wie von zweitausend Jahren unter den Rahmenbedingungen von legitimer und legaler wie illegitimer und illegaler Macht. Mit den Prädikaten, die von Goodman im Zusammenhang des Induktionsproblems betrachtet werden, verhält sich dies partiell durchaus ähnlich: Auch sie erfahren ihre Verankerung in öffentlichen Diskursen, und auch dort wird es unterschiedliche Standpunkte geben, auch von Machtverhältnissen bestimmte Meinungsbildungen usw. Auch die Natur- oder Ingenieurwissenschaften sind institutionelle Prozesse.51 Doch spielen – wie bereits angedeutet – bei der Verankerung der in naturwissenschaftlich-technischen Diskursen verwendeten Prädikate Experimente und Tests eine Rolle, für die es im Bereich der hermeneutischen und sozialwissenschaftlichen Disziplinen kein Analogon gibt.52 Ein Prädikat zu verankern heißt, wie wir gesehen hatten, die Denotationsrelation zwischen dem Prädikat und seiner Extension im Gebrauch dieses Prädikats auszutarieren. Wesentlich ist dabei die Abgrenzung gegenüber anderen, „konkurrierenden“ Prädikaten. Was unter die Extension von Pi fällt, kann effektiv je nur durch Bestimmung einer Grenze entschieden werden, jenseits von der das betreffende Objekt eben als non-Pi anzusprechen ist. Die Frage ist nun, wie dieser Prozess des Austarierens vor sich geht. Bei V-Prädikaten lässt sich diese Frage kaum beantworten. Die philologische Beschrei_____________ 50 51 52 Das Wort ist abgeleitet vom Verb nemein: verteilen, zuteilen. Grundbedeutung: das Zugeteilte, dann: Brauch, Gesetz. Insbesondere letztere sind in ihrer Forschungspraxis oft von industriellen Auftraggebern abhängig. Daraus können sich sehr spezifische Konstellationen von Erkenntnis und Interesse ergeben. In den Sozialwissenschaften, namentlich in den Wirtschaftswissenschaften, werden auch Gesetzesaussagen getroffen, und zwar auf der Basis von statistischen Daten. Entsprechend „weich“ sind darauf gegründete Gesetzesannahmen. Freind oder feund? 171 bung einer „Wortgeschichte“, wie wir sie etwa im Grimmschen Wörterbuch finden, listet uns eine zeitlich geordnete Auswahl von Lemmata auf, die einem Wort als diachronischer Identität zugeordnet werden – eine Paradoxie sui generis, an der kein Geringerer als Saussure verzweifelt ist.53 Wir würden sie heute als Menge aufeinander folgender Kopien deuten: z. B. frouwâ (ahd.)… frouwe (mhd.) … vrouw (nl.) … frowe (fries.) … Frau. Doch die hier gegebenen Beispiele sind schriftlich dokumentierte Ausschnitte aus über Jahrhunderte, in vielen Fällen sogar über Jahrtausende sich erstreckende Kontinua oralen Sprachgebrauchs.54 Eine solche „Geschichte“ beschreibt Stationen eines kontinuierlichen Gebrauchs des betreffenden Wortes, während dessen es sich der Form wie der Bedeutung nach allmählich verändert – ohne dass dies aber den dieses Wort Gebrauchenden je bewusst würde. Es handelt sich um Ausschnitte eines Invisible-hand-Prozesses, der grob das Faktum beschreibt, nicht aber die Umstände, deren Resultat der Formen- wie Bedeutungswandel ist. Logisch betrachtet ist dieser Prozess grundsätzlich metaphorischer Natur. Er beruht auf Analogien. Wir können dem bestenfalls entnehmen, dass sich der Gebrauch einer Wortes im Laufe der Zeit durchaus ‚motiviert’ verändert, so eben auch der von Prädikaten. Doch hat dieser Prozess nichts Gesetzesartiges an sich. Der kritische Punkte in Platons Diskussion des Sprachproblems war die Zuverlässigkeit (bebaiotēs) von Prädikaten (onoma, nomen), in moderner Terminologie: die Invarianz der Relation zwischen Prädikat und Extension im Ge_____________ 53 54 Vgl. hierzu Stetter: Ferdinand de Saussure, in: Dascal / Gerhardus / Lorenz / Meggle (eds.): Sprachphilosophie. Ein internationales handbuch zeitgenössischer Forschung, Berlin-New York 1992, S. 510-523. Die logischen Mittel, diese Paradoxie aufzulösen, standen Saussure und den strukturalen linguistischen Schulen noch nicht zur Verfügung. Eine Lösung für dieses Problem habe ich – auf der Basis des von Leonard und Goodman (The Calculus of Individuals and its Uses, in: The Journal of Symbolic Logic, Vol. 5 (1940), S. 45-55) entwickelten Individuenkalküls – erstmals in Stetter 2005 (System und Performanz. Symboltheoretische Grundlagen von Medientheorie und Sprachwissenschaft, Weilerswist 2005, Kap. 7, S. 285 ff.) entwickelt. Ein „Jahrtausendbeispiel“ gibt uns das Wort „wissen“, das wir mit Sicherheit bis auf den altgriechischen „Stamm“ (v)id- (vgl. idea, …, oida: ich weiß, lat. vidi, …), also bis ins Indoeuropäische zurückverfolgen können. Dieser „Stammbaum“ lässt uns verstehen, wieso ich weiß, du weißt, er weiß usw. eigentlich Präterita, also Vergangenheitsformen sind, denn sie flektieren wie „normale“ Präterita: ging, gingst, ging, sah, sahst, sah usw. Die Bedeutung ist, wie der Vergleich mit dem Altgriechischen oder Lateinischen belegt: ich habe gesehen. Diese „Geschichte“ ist aber eine philologische Fiktion, denn es gibt kein logisches Subjekt, dem sie zugeschrieben werden könnte. „Das“ Wort wissen ist qua Typ nichts als eine offene Menge von Tokens, die Kopien voneinander sind, für die es kein Original gibt. Existenz ist nur diesen Kopien zuzuschreiben, Realität dem Typ nur qua Menge von Kopien. Freilich ist die Linguistik bis heute von einem Universalienrealismus kontaminiert, ihr aus der naiven Philologie des 19. Jahrhunderts stammendes Erbe, in dem sie sich so eingerichtet hat, dass sie es nicht einmal bemerkt. Vgl. hierzu Stetter: System und Performanz, a.a.O., S. 14 ff. und 317 ff. Christian Stetter 172 brauch durch verschiedene Populationen. Im Bezugnahmegebiet sozialer oder historischer Sachverhalte wird und kann dies nie gegeben sein. Deshalb herrscht dort die Nomō-These unangefochten, und sie tut dies – Platons Kritik zum Trotz – legitimerweise. Es gibt keine sozialen Sachverhalte unabhängig von den Deutungen der in sie involvierten Subjekte. Bei Prädikaten, die im Zusammenhang natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Forschung verwendet werden, ist dies anders: Hier kommt mit dem Experiment oder Test ein Faktor ins Spiel des Verankerns, der keineswegs von der Art eines Invisible-hand-Prozesses ist, denn er beruht auf dem Funktionieren von Artefakten, deren Konstruktion bekannt ist. Es ist das Kennzeichen eines Experiments, dass es ohne die Intervention menschlicher, d. h. sprachlicher Interpretation abläuft bzw. abzulaufen hat.55 Hier bekommt also die „Reaktion“ des Versuchsaggregats auf die vorgegebene Frage ein Eigengewicht, auch wenn Messinstrumente abgelesen und der Verlauf eines Experiments im Kontext gegebener Erkenntnisse zu interpretieren ist. Doch der Interpretation sind hier enge Grenzen gesetzt. Messinstrumente müssen korrekt abgelesen werden, ja man kann sogar das Ablesen, im weiteren Sinn die Kontrolle und Protokollierung der Ergebnisse von Experimenten selbst noch durch technische Prozeduren so unterstützen, dass selbst Fehlertoleranzen exakt bestimmbar werden. Die Versuchsapparatur kann zwar selbst nicht sprechen, aber sie kann auf die im Experiment gestellte Frage so oder so „antworten“ – oder auch die „Aussage verweigern“. Und dies eben ohne die Intervention menschlicher Subjekte. Insofern sind hier zweifellos natürliche Prozesse – auch wenn diese experimentell „zurechtgestellt“ sind – am Geschäft des Austarierens der Denotationsrelation für die betreffenden Prädikate beteiligt. Und – wenn man so will – kann man dies als eine moderne Variante der im „Kratylos“ verworfenen Physei-These betrachten. Allerdings fungiert diese nicht als Antithese zur Nomō-These, sondern stets in deren Rahmen. Auch wenn die „Äußerungen“ der Apparatur in technischen Prozessen so erfasst werden, dass sie kategorial wie quantitativ bestimmbar werden, so werden hier doch keine „natürlichen“ Kategorien er_____________ 55 In der generativen Linguistik hat man eine Methode des „Experimentierens“ mit künstlichen Beispielen entwickelt, um durch Grammatikalitätstests eine in der menschlichen Sprachanlage angelegte Grenze zwischen dem, das in einer menschlichen Sprache syntaktisch möglich ist, und dem Gegenteil herauszufinden. Chomsky hat dementsprechend von einem „galileischen“ Verfahren der generativen Linguistik gesprochen, das man den verstehenden Verfahren der Geisteswissenschaften entgegengesetzt hat. Doch lässt sich unschwer zeigen, dass solche „Tests“ eben nicht frei sind von sprachlicher Interpretation. Insofern ist die Rede von Experimenten hier in strengem Sinn unzutreffend. Vgl. hierzu Grewendorf: Sprache als Organ – Sprache als Lebensform, Frankfurt a. M. 1995, dazu Stetter: System und Performanz, a.a.O., Kap. 4. Freind oder feund? 173 fasst, wie sie etwa Rudolf Carnap vorgeschwebt haben mögen. Auch „Geschwindigkeit“, „Druck“ usw. sind in der alltäglichen Rede über den Umgang mit Artefakten verankert, die so alt ist wie die Gattung Mensch selbst.56 Andererseits zeigt dieser Zusammenhang, dass die traditionelle Auffassung, die Bedeutung sprachlicher Prädikate sei grundsätzlich konventioneller Natur, unzureichend ist. Entweder ist sie trivial, dann besagt sie nicht mehr, als dass die Bedeutung eines Wortes von den Regeln seines Gebrauchs abhängt, was darauf hinausläuft, dass es bedeutet, was immer es bedeutet – oder aber sie ist schlicht falsch. Kein Mensch kann auch nur eine einzige der vielen Regeln ändern, die insgesamt den Gebrauch der Wörter unserer Sprache bestimmen und denen unsere Rede genügen muss, wenn wir uns anderen wie uns selbst verständlich machen wollen.57 Sprachwandel ist grundsätzlich von der Art eines Invisible-hand-Prozesses, der sich „hinter dem Rücken“ der jeweiligen Sprachgemeinschaft vollzieht,58 ein quasi-natürliches Attribut ihres Sprachgebrauchs, auch wenn die „jeweilige Rede“ oder der Sprechakt durchaus intentional vollzogen sein mag – was allerdings auch nicht immer zutreffen wird. Ob eine „neuer“ Sprachgebrauch sich durchsetzt, eine „kühne“ Metapher, ein Regelverstoß „durchkommt“, das ist nie zu prognostizieren und hängt meist von Rahmenbedingungen ab, die den Sprechern in ihrem Redevollzug kaum oder gar nicht bewusst sein. So hat J.L.Austin etwa gezeigt, wie vielfältig die Gelingensbedingungen sind, denen schon die alltägliche Rede unterliegt.59 _____________ 56 57 58 59 Vgl. hierzu Leroi-Gourhan: Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1984. „Diktatorische“ Eingriffe in Sprachgebräuche, insbesondere in literale, gibt es und hat es immer wieder gegeben. Doch eine Regeländerung ist die Etablierung eines neuen Typs anstelle eines älteren. Dies bedarf immer der Akzeptierung und des Gebrauchs durch eine Sprachgemeinschaft. Und das entzieht sich aufgrund der Natur der Sache jedem reglementierenden Zugriff. Das Schicksal der sogenannten, 1996 von der Kultusministerkonferenz der Bundesländer beschlossenen Rechtschreibreform ist ein aktueller, relativ „harmloser“ Beleg dafür. Vgl. hierzu Keller: Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache, 2. Aufl., Tübingen-Basal 1994. Ich folge ihm allerdings nicht in der These, das Resultat eines Invisible-hand-Prozesses sei die kausale Folge von Handlungen (ebd. S. 91 f.). Denn schon „schwache“ Konzepte von Kausalität verkehren ja den Sinn des Invisible-handKonzepts in sein Gegenteil. Das sogenannte Arbitraritätsprinzip, das seit F. de Saussure als Grundaxiom der Linguistik gilt, hat – philosophisch betrachtet – eine ganz andere Funktion als die, die ihm innerhalb der Zunft zugemessen wird. Dort kann man es eigentlich vernachlässigen. Tatsächlich macht es zweierlei klar: Erstens, dass eine sprachliche Tatsache, also „mögliches“ Objekt linguistischer Analyse, nur ist, was „untrennbare“ Einheit von signifiant und signifié ist (woraus zum Beispiel folgt, dass Silben oder Phoneme keine solche Einheiten sind). Zweitens hat es eine Art fiktionalen Sinn: Es legitimiert in gewisser Weise die analytische Praxis des Linguisten, die den signifié nolens volens Christian Stetter 174 Denkt man Goodmans Gedanken der Verankerung sprachlicher Prädikate weiter, so wird man wohl für verschiedene Sprachspiele – zwei haben wir hier nur flüchtig betrachtet – unterschiedliche Formen der Bewährung oder eben Verankerung von Wörtern im Sprachgebrauch finden – vom spontanen Gebrauch über informelle Regelungsprozesse und Sprachplanungsverfahren bis hin zu formalisierten Verfahren, wie sie in der Praxis vieler Wissenschaften wie in institutionellen Prozessen wie Verwaltung, Rechtsprechung usw. zu finden sind. Was wir eine sprachliche Konvention nennen, erwiese sich so als die Momentaufnahme eines Bewährungsprozesses, der je nach dem, welches Spiel gespielt wird, so oder so gestaltet sein kann. _____________ zerstören muss, um den signifiant dann formal beschreiben zu können. Vgl. hierzu Stetter: Schrift und Sprache, a.a.O., Kap. 4. B Philosophie des Geistes Wie ist der Solipsist in der Fliegenglocke zur Ruhe zu bringen? Joachim Schulte Neulich im Wirtshaus bemerkte ich im Gespräch mit einem französischen Freund, wie oft in deutschen Landen das Sprichwort „In der Not frißt der Teufel Fliegen“ zu hören sei. Worauf der Franzose – ein wenig verdrießlich ob seiner geringen Meinung von der hiesigen Küche – erwiderte: „Und wahrscheinlich muß er seinen Schnaps aus dem Fliegenglas trinken!“ Aus einer autobiographischen Schilderung einer Künstlerreise ins Brandenburgische (um 1850) Die Formulierung der Titelfrage – „Wie ist der Solipsist in der Fliegenglocke zur Ruhe zu bringen?“ – klingt vielleicht unvertraut. Dennoch geht es im folgenden hauptsächlich um den §309 von Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen.1 Dieser anderthalbzeilige Paragraph gehört zu den bekanntesten Bemerkungen Wittgensteins und wird auch von Personen zitiert, die nie ein Buch unseres Philosophen in der Hand gehabt, geschweige denn in einem seiner Bücher gelesen haben. Aufgrund ihrer Kürze gehört diese Bemerkung zu einer Gruppe von Paragraphen, bei denen man besonders versucht ist, sie unabhängig von ihrem Kontext zu betrachten und zu interpretieren. Bei einigen dieser Aussprüche – wie z. B. §580 („Ein 'innerer Vorgang' bedarf äußerer Kriterien“) – fällt das nicht schwer. Bei anderen – wie z. B. §483 („Ein guter Grund ist einer, der so aussieht“) – gibt es eher Probleme, wenn man auf die Heranziehung des Kontexts verzichten möchte. Der §309 ist etwas länger und besteht immerhin aus zwei Sätzen – einer Frage und einer Antwort: „Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.“ Das klingt allgemein und zugleich persönlich genug, um diese Bemerkung in die Rubrik „Mahnsprüche und Sentenzen moralischen Inhalts“ zu stecken. Einen Sinn hat man sich leicht zurechtgelegt: Die „Fliege“ – das ist der ver_____________ 1 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen (1953), hier zitiert nach der Ausgabe in der Bibliothek Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2003. 178 Joachim Schulte wirrte Philosoph, und diesem will Wittgenstein helfen, indem er ihm zeigt, wie er aus dem Fliegenglas herauskommt. Die Frage, ob man diesen Sinn mit den Nachbarparagraphen in Verbindung bringen will oder sollte, scheint hier keiner dringenden Antwort zu bedürfen. Eine – freilich überwindbare – Schwierigkeit besteht darin, daß nur wenige Leser eine genauere Vorstellung von Fliegengläsern haben. Einige Kommentatoren haben jedoch erklärt, worum es sich handelt. Ein Fliegenglas ist ein unten offener und eingestülpter Glasballon. Die obere Öffnung wird wie bei einer Flasche mit einem Korken verschlossen. In die untere Einstülpung wird eine Lockflüssigkeit – z. B. Zuckerwasser oder Bier – geschüttet. Die Fliegen kommen von unten und fliegen tendenziell nach oben, da es sie zum Licht hinzieht. Nach längerem Hin und Her landen die Fliegen in der Flüssigkeit und ertrinken. Der Ausweg nach unten ist ihnen aufgrund ihrer Instinkte weitgehend verbaut. Der Zufall oder ein Fliegenfreund müßte ihnen zu Hilfe kommen, um sie auf diese Flugbahn zu leiten. Sobald man sich diese Kenntnisse angeeignet hat, kann man unseren Paragraphen etwas genauer ausdeuten. Gemeint ist offenbar, daß der mit der Fliege verglichene – verwirrte und auf Irrwege geratene – Philosoph vor allem deshalb in der Bredouille steckt, weil er nur den ihm besonders naheliegenden Wegen folgt. Eine Richtungsänderung kommt ihm nicht in den Sinn. Daher gelingt es ihm nicht, sich aus der Konfusion zu befreien. Wittgensteins Ziel wäre es demnach, den Verwirrten darauf aufmerksam zu machen, daß es diesen noch nicht gesehenen und nicht ausprobierten Weg gibt. I Fürs erste habe ich mir zwei Aufgaben vorgenommen: Erstens möchte ich kurz auf den Kontext unserer Bemerkung blicken, um festzustellen, ob dieser nicht doch in Betracht gezogen werden könnte oder sollte. Zweitens werde ich zu klären versuchen, auf welchem Weg der §309 an diese Stelle gekommen ist. Eine Skizze dieses Wegs wird, wie ich vermute, weiteres Licht auf den Sinn dieser Bemerkung werfen. Zunächst zum Kontext von §309: Der hintere Nachbar, also §310, ist, soweit ich sehe, nicht ohne weiteres und in spezifischer Form mit unserer Bemerkung in Verbindung zu bringen. Doch die vorherige Bemerkung – der, wie ich finde, völlig zu Recht gerühmte §308 – bietet plausible Anknüpfungspunkte. Im Mittelpunkt steht, vereinfacht gesprochen, der Gedanke, daß philosophische Probleme in puncto seelische Vorgänge und Zustände dadurch zustande kommen, daß wir uns durch das Reden von Vorgängen und Zuständen vorgeben lassen, wie wir über die relevanten Phänomene reden. Hier kann man, wenn man möchte, von grammatischen Analogien sprechen Solipsist in der Fliegenglocke 179 und sagen, das als Vorgang aufgefaßte Erinnern z. B. werde dadurch in unberechtigter Weise in die Nähe anderer Vorgänge gerückt. Ähnlich im Fall der vermeintlichen Zustände: Wer vom mentalen Zustand des Glaubens oder Wünschens redet, läßt sich leicht von nicht hinterfragten Parallelen mit anderen Zuständen (wie Krank- oder Betrunkensein) beeinflussen. Da der Gebrauch dieses Vokabulars der psychischen Zustände und Vorgänge meistens nicht reflektiert oder gar in Frage gestellt wird, können unsere Gedanken nur in bestimmte Richtungen gehen, nämlich in solche, die mit den Begriffen „Vorgang“ oder „Zustand“ vereinbar sind. „Der entscheidende Schritt im Taschenspielerkunststück“, schreibt Wittgenstein, „ist getan, und gerade er schien uns unschuldig“. Um von diesen Begriffsgleisen herunterzukommen, bedarf es einer Neuorientierung. Denn man muß sozusagen wieder zurück auf Feld 1 und das Wäglein der philosophischen Reflexion neu aufgleisen, um andere Begriffsnachbarschaften zu Gesicht zu bekommen. Eine solche Neuorientierung kommt nicht von selbst; und häufig wird sie nur durch einen Eingriff von außen ermöglicht. Diese externe Hilfe könnte ein philosophischer Therapeut wie Wittgenstein leisten, der zeigt, daß die bisher gegangenen Wege nicht die einzigen sind. Das Fliegenglas wäre demnach mit den durch Begriffe wie „Vorgang“ und „Zustand“ vorherbestimmten Begriffsgleisen zu vergleichen; und der Ausweg bestünde mindestens in der Einsicht, daß wir uns durch ein Vorurteil beeinflussen lassen, und vielleicht in der zusätzlichen Erkenntnis, daß andere Ansätze möglich sind. Diese Lesart ist, wie ich finde, ganz einleuchtend und gibt eine gute Basis ab für die These, der §309 sei deshalb an diese Stelle gekommen, weil er nicht nur vage dorthin paßt, sondern die vorige Bemerkung, also §308, in einer spezifischen und erhellenden Weise beleuchtet. Beide Bemerkungen sind – und hier bin ich bereits bei der zweiten Aufgabe, die ich mir eben gestellt habe – erst im letzten Akt des Entstehungsprozesses der Philosophischen Untersuchungen in das Buch aufgenommen worden. Zwischen 1938 und 1944 hatte Wittgenstein hauptsächlich Texte geschrieben, die später in die Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik aufgenommen wurden. Als er sich 1944 in Swansea aufhielt, notierte er eine große Zahl neuer Bemerkungen zu den Komplexen „Regelfolgen“ und „private Sprache“. Noch im selben Jahr diktierte er ein Typoskript, das aus den bereits seit 1937 vorliegenden §§1-189 und einer Auswahl von etwas über hundert neuen Bemerkungen bestand. Das ca. 300 Bemerkungen umfassende Maschinenskript wird als „Zwischenfassung“ der Philosophischen Untersuchungen bezeichnet.2 Und wenn man sich die uns interessierende Stelle in dieser Zwischenfas_____________ 2 Periodisierung („Frühfassung“, „Zwischenfassung“ usw.) nach der Kritischgenetischen Edition: Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, hg. von Joa- Joachim Schulte 180 sung anschaut, sieht man, daß dort die fünf Bemerkungen zwischen §304 und §310 fehlen. Sie sind erst bei der wahrscheinlich 1946 erfolgten letzten Überarbeitung des Texts hinzugekommen. Das heißt aber nicht, daß etwa §308 und §309 – also die Taschenspielerkunststück- und die Fliegenglas-Bemerkung – aus derselben Zeit oder gar aus demselben Manuskript stammen. Nein, so leicht hat Wittgenstein es uns nicht gemacht. Die Taschenspielerkunststück-Bemerkung wurde, soweit wir wissen, 1945 geschrieben. Die Fliegenglas-Bemerkung hingegen wurde am 8. September 1937 notiert, also in der sehr fruchtbaren norwegischen Zeit, in der Wittgenstein am 2. Teil der damaligen Philosophischen Untersuchungen arbeitete, d. h. dem der Philosophie der Mathematik gewidmeten Teil der sog. Frühfassung, aus dem dann postum der 1. Teil der Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik wurde. Auf den genauen Wortlaut dieser Fassung komme ich gleich zu sprechen. Bemerkenswert ist jedoch, daß dies nicht die erste Verwendung der Fliegenglas-Metapher war. Acht Tage früher gebraucht Wittgenstein im selben Manuskript das gleiche Bild. Im Großkontext geht es um Beweisfiguren, also anschauliche Formen von Beweisen. In diesem Zusammenhang kommt Wittgenstein auf ein puzzleartiges Geduldspiel zu sprechen, dessen Zusammensetzung der Betrachter ständig verkennt. „Es ist gleichsam“, schreibt Wittgenstein, … diese Lage aus der Geometrie ausgeschlossen. Als wäre hier ein "blinder Fleck" in unserm Gehirn. – Und ist es denn nicht so, wenn ich glaube, alle möglichen Stellungen versucht zu haben und an dieser, wie durch Verhexung, immer vorbeigegangen bin? Kann man nicht sagen: die Figur, die uns die Lösung zeigt, beseitigt eine Blindheit; oder auch, sie ändert deine Geometrie. Sie zeigt dir gleichsam eine neue Dimension des Raumes. (Wie wenn man einer Fliege den Weg aus dem Fliegenglas zeigte.) Ein Dämon hat diese Lage mit einem Bann umzogen und aus unserm Raum ausgeschlossen.3 Hier sind, verglichen mit dem bekannten Bild aus den Philosophischen Untersuchungen, drei anders akzentuierte Punkte zu betonen: Erstens wird der Erlebnischarakter der neuen Einsicht betont. Es ist, als wäre die Lösung durch eine Verhexung oder einen Teufelsbann ausgeschlossen gewesen. Dieser Bann muß wie durch einen Exorzismus gebrochen werden, um schließlich zu er_____________ 3 chim Schulte in Zusammenarbeit mit Heikki Nyman, Eike von Savigny und Georg Henrik von Wright, Frankfurt a. M. 2001. MS 118, S. 44v, 1. 9. 37 = Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, Werkausgabe, Band 6, Frankfurt a. M. 1984 u. ö., S. 56. Wittgensteins Manuskripte werden nach der elektronischen Bergen Edition zitiert (Oxford 2000). Die Zählung der Manuskripte (MS) und Typoskripte (TS) entspricht dem Katalog von G. H. von Wright, siehe von Wright: Wittgensteins Nachlaß, in: ders.: Wittgenstein, übers. von J. Schulte, Frankfurt a. M. 1986, S. 45-76. Orthographie und Zeichensetzung der Manuskript-Zitate wurden normalisiert. Solipsist in der Fliegenglocke 181 kennen, was eigentlich die ganze Zeit schon offen vor unseren Augen lag. Zweitens unterstreichen der Vergleich mit Verhexung und Teufelsbann sowie der Gebrauch solcher Wörter wie „Blindheit“, „Geometrie“ und „Raum“, daß das Nichtsehen der relevanten Möglichkeit nachgerade eine Sache der Notwendigkeit ist: Es hat sich nicht nur so ergeben, sondern es mußte so sein. Drittens erhält der Ausweg aus dem Fliegenglas ein bestimmtes Ziel. Der Weg führt in eine neue Dimension, die vorher wie weggeschnitten war. Das könnte man natürlich auch auf das Bild aus §309 übertragen, indem man beispielsweise sagt: Anfangs gab es für die Fliege nur die Dimensionen Osten, Westen, Norden. Durch den Eingriff des therapeutischen Philosophen ist die Dimension Süden hinzugekommen, und die Entdeckung dieser Dimension ermöglicht es der Fliege, in die Freiheit zu entkommen. Obwohl der Kontext dieser Fliegenglas-Bemerkungen zu vielen interessanten Betrachtungen Anlaß gibt, möchte ich es bei meinen wenigen Hinweisen belassen und zur Urfassung von §309 übergehen. Nur auf eine Verbindung möchte ich noch aufmerksam machen, denn wenige Zeilen nach der eben zitierten Stelle schreibt Wittgenstein in einer kodierten, also als persönlich markierten und damit aus dem Zusammenhang gelösten Notiz: Es ist für mich wichtig beim Philosophieren immer meine Lage zu verändern, nicht zu lange auf einem Bein zu stehen, um nicht steif zu werden. Wie, wer lange bergauf geht, ein Stückchen rückwärts geht, sich zu erfrischen, andre Muskeln anzuspannen.4 Das Bedürfnis nach Veränderung der Lage, der Körperhaltung, kann man natürlich auch mit der Möglichkeit einer durch diese Veränderung ermöglichten besseren Sicht – einer ganz neuen Perspektive – in Zusammenhang bringen. Es kommt also vielleicht nicht nur darauf an, die verkrampften Muskeln zu entspannen, sondern auch darauf, mehr bzw. Neues zu sehen. In diesem Sinne sagt Wittgenstein etwa im Blue Book,5 daß Verkrampfungen des Denkens gelöst werden können, indem man mit Hilfe spezieller Notationen dazu gebracht wird, Dinge zu sehen, die man vorher nicht gesehen hat. Die Urfassung von §309 lautet wie folgt: „Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Ich zeige der Fliege den Ausgang aus dem Fliegenglas.“ Wie wir sehen, ist der zweite Satz ein wenig anders formuliert, aber inhaltlich läuft er auf das gleiche hinaus wie die Fassung der Philosophischen Untersuchungen. Doch damit ist die Bemerkung in ihrer ursprünglichen Gestalt noch nicht beendet. Wittgenstein fährt fort: „Dieser Weg ist, in einem Sinne, unmöglich zu finden, und, in einem andern Sinne, ganz leicht.“ Dieser Zusatz, der auch in der nächsten, wenig später niedergeschriebenen Manuskriptfassung vorkommt, dort allerdings auch gestrichen wird, läßt _____________ 4 5 MS 118, S. 45r = Vermischte Bemerkungen, in: Werkausgabe, a.a.O., Band 8, S. 488. Wittgenstein: The Blue and Brown Books, hg. von Rush Rhees, Oxford (1958), 21969, S. 59. 182 Joachim Schulte sich auf zweierlei Weise mit den bisher angestellten Überlegungen verbinden und dementsprechend deuten. Zum einen könnte es sein, daß Wittgenstein, wie im Zusammenhang mit der wenig früher entstandenen ersten FliegenglasBemerkung, an eine Unmöglichkeit im Sinne des Fehlens einer ganzen Dimension denkt. Solange diese Dimension nicht im Blick, also gewissermaßen abgeschnitten ist, ist der Ausweg unmöglich zu finden, da er gar nicht gesehen werden kann. Sobald die fehlende Dimension jedoch restituiert ist, kann der Weg ganz leicht gefunden werden, denn jetzt ist er kaum noch zu übersehen. Eine zweite Lesart könnte sich auf unsere bereits angeführte Interpretation der Taschenspielerkunststück-Bemerkung beziehen: Wenn man eine These oder ein Problem mit Hilfe bestimmter Begriffe formuliert und andere ausschließt, können bestimmte Begriffsgeleise notwendig und andere unmöglich erscheinen. Wer also z. B. von einem geistigen Vorgang spricht, verpflichtet sich einerseits dazu, den mitgemeinten Ablauf gegebenenfalls zu spezifizieren, und wird andererseits bestimmte Darstellungsmöglichkeiten nicht sehen können, da ihm die vorgegebene Begriffsbahn im Wege steht. Sobald er jedoch einsieht, daß dies nicht der richtige oder zumindest nicht der einzige Weg der begrifflichen Erfassung ist, wird es ganz leichtfallen, neue Möglichkeiten der Deutung in Betracht zu ziehen. Wie gesagt, diesen gerade interpretierten Zusatz zur ursprünglichen Fliegenglas-Bemerkung hat Wittgenstein schon bald gestrichen. Den Grund kennen wir nicht, aber eine Möglichkeit wäre freilich die, daß Wittgenstein die Bemerkung vage halten wollte, so daß sie in ganz disparate Kontexte paßt. Das weitere Schicksal unserer Fliegenglas-Bemerkungen möchte ich hier nicht in allen Einzelheiten beschreiben. Aber die Hauptstufen sollen in groben Zügen angedeutet werden: Die Wege dieser beiden Bemerkungen trennten sich schon bald. Die erste, also die zum Geduldspiel-Kontext gehörende Bemerkung blieb diesem Kontext erhalten und wanderte bereits 1938 in ein Typoskript, auf dessen bearbeiteter Form der 1. Teil der postumen Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik basiert. Mit der weiteren Geschichte der uns vorliegenden Philosophischen Untersuchungen hat sie daher nichts mehr zu tun. Mit der zweiten Fliegenglas-Bemerkung hingegen, also dem späteren §309, passierte zunächst gar nichts. Sie blieb liegen, bis Wittgenstein vermutlich 1945 ein Typoskript diktierte oder anfertigen ließ, für das Einzelbemerkungen aus mehreren früheren Manuskriptbänden ausgewählt wurden. Diese „Bemerkungen I“ genannte Auswahl war zwar eine Auslese – d.h. es wurden zahlreiche Bemerkungen ausgeschieden –, aber sie war im großen und ganzen kein Versuch einer Neuordnung – oder allenfalls ein erster Schritt auf dem Weg zu einer Neuordnung. Anders verhält es sich mit einer wenig später hergestellten Auswahl aus den Bemerkungen I (TS 228). Dieses neue Ty- Solipsist in der Fliegenglocke 183 poskript, das als Bemerkungen II (TS 230) bezeichnet wurde, stellt erstens eine weitere Auslese und zweitens einen recht komplizierten Versuch einer Neuordnung dar. Eine große Zahl dieser Bemerkungen wurde erstens benutzt, um Lücken in der zweiten Hälfte der bereits genannten Zwischenfassung der Philosophischen Untersuchungen zu stopfen, und zweitens um den letzten Teil des Buchs (also §§422 bis 693) zusammenzustellen. Unser §309, der sowohl in den Bemerkungen I als auch in den Bemerkungen II vorkommt, wurde mithin zum Stopfen einer solchen Lücke verwendet. Es liegt in der unterschiedlichen Entstehungsgeschichte dieser beiden Typoskripte, daß uns die Position der Fliegenglas-Bemerkungen in den Bemerkungen I nicht sonderlich interessiert. Die Position in den Bemerkungen II jedoch, die ja einen eigenständigen Ordnungsversuch darstellen, kann durchaus aufschlußreich sein. In den Bemerkungen II steht der spätere §309 zwischen zwei Bemerkungen, die in den Philosophischen Untersuchungen nicht weit auseinander liegen, nämlich zwischen den späteren §§436 und 428. Der §428 beginnt mit den zitierten Worten „Der Gedanke, dieses seltsame Wesen“ und leitet in den Philosophischen Untersuchungen, wie man sagen könnte, das Kapitel „Harmonie von Gedanke und Wirklichkeit“ ein. §436 gehört zum selben Kontext und beginnt mit den Worten „Hier ist es leicht, in jene Sackgasse des Philosophierens zu geraten“. Beide Bemerkungen lassen sich mit unserer Fliegenglas-Bemerkung in Verbindung bringen. Hier beschränke ich mich auf die Betrachtung des Zusammenhangs zwischen der Sackgassen- und der Fliegenglas-Bemerkung. Der erste Absatz von §436 lautet: Hier ist es leicht, in jene Sackgasse des Philosophierens zu geraten, wo man glaubt, die Schwierigkeit der Aufgabe liege darin, daß schwer erhaschbare Erscheinungen, die schnell entschlüpfende gegenwärtige Erfahrung oder dergleichen, von uns beschrieben werden sollen. Wo die gewöhnliche Sprache uns zu roh erscheint, und es scheint, als hätten wir es nicht mit den Phänomenen zu tun, von denen der Alltag redet, sondern „mit den leicht entschwindenden, die mit ihren Auftauchen und Vergehen jene ersteren annähernd erzeugen“.6 Ein erster Zusammenhang zwischen diesem Absatz und unserer FliegenglasBemerkung liegt auf der Hand: Das Fliegenglas ist eine Art von Sackgasse, vielleicht eine besonders schlimme Art von Sackgasse, denn ohne fremde Hilfe kommt die Fliege nicht heraus. Die Illusion, durch die man in diese Sackgasse gerät, ist allerdings anderer Art als die Täuschungen, die bisher in Zusammenhang mit dem Fliegenglas erwähnt wurden: Es geht um Aspekte _____________ 6 Siehe Bemerkungen II, §177. Die in Anführungszeichen gesetzten Worte sind höchstwahrscheinlich kein echtes Zitat; in der ersten erhaltenen Manuskriptfassung (MS 146, S. 26) fehlen die Gänsefüßchen. Vgl. Anm. der Herausgeber (P. M. S. Hacker und Joachim Schulte) zu §436 in der neuen Blackwell-Ausgabe (2009) der Philosophischen Untersuchungen/Philosophical Investigations (S. 256). 184 Joachim Schulte der unmittelbaren Erfahrung, die wir mit Hilfe unserer normalen Sprache nicht erfassen zu können glauben. Festzuhalten ist jedenfalls, daß Wittgenstein hier eine charakteristische „Sackgasse des Philosophierens“ benennt. In den Philosophischen Untersuchungen hat diese Bemerkung einen zweiten Absatz, der aus einem kurzen Augustinus-Zitat (aus dessen Erörterung der Zeitproblematik) besteht. Dieser Absatz ist aber erst in der spätesten Fassung des Typoskripts mit dem ersten Absatz von §436 verbunden worden und hat auf diese Weise einen früheren zweiten Absatz ersetzt, der in den Bemerkungen II unserer Fliegenglas-Bemerkung unmittelbar vorhergeht. Dieser Absatz ist in unserem Zusammenhang von Interesse. Die Stelle lautet: Und da muß man sich daran erinnern, daß alle Phänomene, die uns nun so merkwürdig vorkommen, die ganz gewöhnlichen sind; die, wenn sie sich abspielen, uns nicht im geringsten auffallen. Sie kommen uns erst in der seltsamen Beleuchtung merkwürdig vor, die wir nun auf sie werfen, wenn wir philosophieren. Dieser nicht in die Philosophischen Untersuchungen aufgenommene Absatz bringt einen Aspekt ins Spiel, den Wittgenstein an mancher anderen Stelle betont: Phänomene, die uns verwirren, sind in Alltagszusammenhängen überhaupt nicht verwirrend. Rätselhaft werden sie für uns erst im Kontext des Philosophierens. Das kann mehrere Gründe haben. Hier haben wir das Gefühl, gewisse Phänomene der unmittelbaren Erfahrung seien zu fein und zu flüchtig, um mit dem scheinbar so groben Instrument der normalen Sprache erfaßt werden zu können. Dieses Gefühl wiederum kann seine Ursache darin haben, daß wir uns in völlig unnatürlicher Weise auf unsere Wahrnehmungserlebnisse konzentrieren. In anderen Fällen geraten wir, wie gesagt, deshalb in eine charakteristische Sackgasse des Philosophierens, weil wir auf Begriffsgleisen dahingleiten, die wir aufgrund unserer Vorurteile nicht in Frage stellen oder nicht in Frage stellen wollen. In diesen und ähnlichen Fällen, so die These des eben zitierten Absatzes, ist es das Philosophische unserer Betrachtungsweise, das uns in die Irre führt bzw. die Irreführung mit bewirkt. Was hier mit dem „Philosophischen“ gemeint ist, wird durch die gerade genannten Beispiele zwar veranschaulicht, aber wahrscheinlich noch nicht genügend geklärt. Ich werde am Schluß kurz darauf zurückkommen. Die Frage, die sich jetzt mit einer gewissen Dringlichkeit stellt, ist die, ob die Hilfe, durch die der Fliege aus dem Fliegenglas geholfen wird, Rückwirkungen auf dieses philosophische Moment hat oder haben sollte. Anders gefragt: Wird die Fliege, die auf den Ausweg aus dem Fliegenglas aufmerksam gemacht wurde, durch den anschließenden Befreiungsschlag zugleich von der Philosophie befreit? Oder kann der Ausweg auch dann funktionieren, wenn dieser Ausgangspunkt des Wegs in die Sackgasse bzw. ins Fliegenglas – also die Philosophie – nicht kassiert wird? Solipsist in der Fliegenglocke 185 II Das ist die Leitfrage für den zweiten Teil dieser Arbeit, in dem ich auf die allererste Erwähnung des Fliegenglases in Wittgensteins Schriften zu sprechen komme und in dem auch der Solipsist meines Titels endlich seinen Auftritt haben wird. Zum ersten Mal erwähnt wird das Fliegenglas in einem wahrscheinlich 1935 geschriebenen Manuskript. Dieses Manuskript ist größtenteils auf englisch verfaßt, da es Notizen zu den damals gehaltenen Vorlesungen über Sinnesdaten und Privatheit enthält. Eine von Rush Rhees stammende Nachschrift dieser Vorlesung ist veröffentlicht und gibt Auskunft darüber, wie das Manuskriptmaterial zum Einsatz gebracht wurde.7 Hier geht es mir aber nur um ein bestimmtes Zitat, das ausnahmsweise auf deutsch notiert wurde und wie folgt lautet: „Der Solipsist flattert und flattert in der Fliegenglocke, stößt sich an den Wänden, flattert weiter. Wie ist er zur Ruhe zu bringen?“8 Daß Wittgenstein hier nicht vom Fliegenglas, sondern von einer Fliegenglocke spricht, sollte uns nicht weiter stören. Der Unterschied in der Bezeichnung kann nicht erheblich sein, denn offenbar handelt es sich um das gleiche Gerät. Was uns ebenfalls nicht stören sollte, ist der Umstand, daß das Wort „flattern“ wohl nicht sonderlich geeignet ist, um die zappelnden oder torkelnden, jedenfalls ultranervösen Bewegungen der Fliege zu beschreiben. Wir wissen, was gemeint ist; und die Bemerkung ist eine flüchtig niedergeschriebene Notiz, die nicht weiterverwendet wurde. Warum der Solipsist, der in den Aufzeichnungen dieses Manuskripthefts nur wenige Male erwähnt wird, so nervös ist, ist nicht ganz klar. Eine Möglichkeit ist die, daß er, mit irreduzibel sozialem Vokabular konfrontiert, nicht weiß, was er antworten soll. Wenige Zeilen vorher heißt es nämlich: „Die Auffassung des Solipsismus erstreckt sich nicht auf Spiele. Der Andere kann Schach spielen so gut wie ich.“9 Eine zweite Möglichkeit ist folgende: Der Solipsist will aus der Unmittelbarkeit der Gesichtswahrnehmung Kapital schlagen und den Gedanken artikulieren, die von ihm bewohnte visuelle Welt sei einzigartig. Deshalb ist er beunruhigt, weil er nun vor dem Problem steht, wie diese Einzigartigkeit am besten auszudrücken wäre. Wie dem auch sei, hier möchte ich darauf aufmerksam machen, daß das verwendete Bild grundverschieden ist von dem, das wir aus den Philosophischen Untersuchungen kennen. Während es dort auf den _____________ 7 8 9 Rush Rhees: The Language of Sense Data and Private Experience (1984), in: James Klagge / Alfred Nordmann (eds.): Ludwig Wittgenstein: Philosophical Occasions 1912-1951, Indianapolis 1993, S.289-367. MS 149, S. 67 = Philosophical Occasions, a.a.O., S. 258. Ebd. 186 Joachim Schulte Ausweg aus dem Fliegenglas ankam, ist hier von einem Verlassen der Fliegenglocke nicht einmal andeutungsweise die Rede. Der Solipsist steckt offenbar in der Fliegenglocke fest. Helfen kann man ihm allenfalls, indem man ihn zur Ruhe bringt. Hier möchte man sich fragen, ob das überhaupt eine große Hilfe sein kann. Die Fliegenglocke ist auch im besten Fall kein angenehmer Aufenthalt. Es liegt nicht auf der Hand, daß man sich als ruhige Fliege besser darin fühlt denn als nervöse Fliege. – Aber wahrscheinlich hat es mit dem Hilfsangebot der Beruhigung eine andere Bewandtnis: Vermutlich muß das Bild anders interpretiert werden. Ruhe ist, wie wir wissen, nicht nur aus Wittgensteins Sicht ein wichtiges Ziel des Philosophierens. Aber vielleicht setzt Wittgenstein den Akzent anders als die meisten Philosophen, die von der Ruhe der Seele geschwärmt haben. Sehr bekannt ist die Formulierung aus dem §133 der Philosophischen Untersuchungen: Die eigentliche Entdeckung ist die, die mich fähig macht, das Philosophieren abzubrechen, wann ich will. – Die die Philosophie zur Ruhe bringt, so daß sie nicht mehr von Fragen gepeitscht wird, die sie selbst in Frage stellen. Es gibt, wenn ich das richtig sehe, drei grundverschiedene Möglichkeiten, diese vertrauten Zeilen zu deuten. Erstens könnte man die Ruhe, die hier unverkennbar als erstrebenswert präsentiert wird, als Resultat der Entdeckung auffassen, die dem Philosophen die Fähigkeit zur Preisgabe seines Metiers verleiht. Die Ruhe wäre dann eine begrüßenswerte Folge dieses radikalen Schritts. Zweitens wäre es möglich, das Wort „abbrechen“ nicht im Sinne des endgültigen Aufgebens zu lesen, sondern im Sinne von „unterbrechen“. So wie die Musik jetzt abbricht, um wenig später wieder einzusetzen, könnte man auch das Philosophieren abbrechen, um zu einem späteren Zeitpunkt – und vielleicht mit weniger Brio – erneut damit zu beginnen. Drittens könnte man das Zur-Ruhe-Bringen der Philosophie als Resultat einer anderen Entdeckung als der zuerst genannten auffassen. Es kann ja sein, daß Wittgenstein sagen will: „Hauptsache, wir kriegen Ruhe in die Philosophie. Es muß ja nicht gleich die ewige Ruhe sein. Das ist zwar – wie angedeutet – auch eine Möglichkeit, aber vielleicht gibt es noch andere.“ In Wittgensteins Schriften finden sich mehrere Stellen, die eher die zweite oder die dritte Lesart nahelegen. Ein Beispiel wäre die folgende, weniger bekannte Manuskriptstelle: Warum wirken die philosophischen Fragen so beunruhigend, irritierend? Oder soll ich sagen: Die philosophischen Fragen entspringen einer gewissen Aufgeregtheit, denn der Denkkrampf ist eben von Aufregung /Irritation/ begleitet. (Ähnlichkeit mit dem Nägelbeißen.) Solipsist in der Fliegenglocke 187 Man kann sagen: Der Philosophierende muß erst immer wieder trachten, zur Ruhe zu kommen.10 Egal, welche Lesart man bevorzugt, wichtig ist, daß die Berücksichtigung des Gesichtspunkts der Ruhe oder Beruhigung auf eine Interpretation der Fliegenglocken-Metapher verweist, die in eine andere Richtung führt als unser bisheriges Verständnis der Fliegenglas-Metapher aus den Philosophischen Untersuchungen. Dort steht das Fliegenglas für einen gefährlichen Ort, an den man durch das Philosophieren geraten ist und dem man eventuell durch die Hilfe des therapeutischen Philosophen entkommen kann. Hier dagegen ist es vielleicht so, daß die Fliegenglocke selbst durch das Philosophieren zustande kommt. Sie wäre dann kein unabhängig gegebener Ort, von dem es denkbar ist, daß jeder dorthin gelangen könnte, sondern eine Art Kerker, in den sich der aufgeregte Philosoph nicht hineinverirrt, sondern den er durch sein Philosophieren überhaupt erst in die Welt setzt und in den er von diesem Moment an eingesperrt ist. Um im Bild zu bleiben, bestünde der Ausweg nicht darin, daß er einen Fluchtweg entdeckt, sondern darin, daß sich seine geistige Verfassung ändert, bis er aufhört, eine Fliegenglocke aus sich herauszuspinnen, in der er dann umherzappeln muß. Anders gesagt: Die Beruhigung des Philosophen könnte dazu führen, daß die Fliegenglocke überhaupt verschwindet und ihn nicht mehr in seiner Bewegungsfreiheit hindert. Die beiden grundlegenden Rettungsmodelle dürften jetzt deutlich geworden sein: Erstens kann man sich aus dem Fliegenglas befreien, indem man einen Ausweg findet und die Falle hinter sich läßt. Zweitens kann man das Fliegenglas überhaupt zum Verschwinden bringen, indem man zur Ruhe gelangt und seine Freiheit findet oder wiederfindet. Nun sollten wir auf unseren Solipsisten zurückkommen, von dem Wittgenstein an der eben zitierten Stelle sagt, er flattere in der Fliegenglocke umher. Nicht von der Hand zu weisen ist die Frage, ob Wittgenstein nicht vielleicht auch in den Philosophischen Untersuchungen den Solipsisten im Sinn haben könnte, wenn er dort die Fliegenglas-Metapher verwendet. Oder, um es etwas vorsichtiger zu formulieren: Kann es sein, daß der Solipsist ein besonders geeigneter Kandidat für den Posten der Fliege im Fliegenglas ist? Eine Anfangsschwierigkeit besteht darin, daß die Figur des Solipsisten keine Konturen hat. Die Philosophiegeschichte kennt keinen Vertreter des Solipsismus. Moritz Schlick hat sicher recht, wenn er in der Allgemeinen Erkenntnislehre schreibt, daß „keines der historischen philosophischen Systeme den Solipsismus ernstlich vertreten“ hat.11 Es gibt freilich terminologische Tricks, die es ermöglichen, bestimmte theoretische Auffassungen psychischer _____________ 10 11 MS 119, a.a.O., S. 80 f. (= MS 117, S. 95). Moritz Schlick: Allgemeine Erkenntnislehre, hg. von Jans Jürgen Wendel und Fynn Ole Engler, Wien-New York 2009, S. 522. Joachim Schulte 188 Entitäten als „solipsistisch“ zu bezeichnen. So kennzeichnet beispielsweise Ernst Mach im ersten Kapitel von Erkenntnis und Irrtum eine solipsistische Position, von der er allerdings sogleich behauptet, daß sie „andere gleichberechtigte nicht ausschließt“.12 Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der junge Wittgenstein diese Stelle kannte; aber es ist müßig zu fragen, ob sie Eindruck auf ihn gemacht hat. Der Solipsismus, der, wie es in der Logisch-philosophischen Abhandlung (5.62) heißt, etwas Richtiges meint, hat mit Mach nicht viel zu tun. In einem gewissen Sinn könnte man sagen, der Wittgenstein des Tractatus sei der einzige namhafte Philosoph, der je eine Form von Solipsismus verfochten habe. Aber dieser Solipsismus, möchte ich behaupten, ist nicht nur von Mach weit entfernt, sondern auch von allem, was in Wittgensteins späteren Schriften mit „Solipsismus“ gemeint sein könnte.13 Wie gesagt, unsere von der Fliegenglocken-Bemerkung inspirierte Frage lautet: Ist der Solipsist ein plausibler Anwärter auf den Posten der Fliege im Fliegenglas? Da keine historischen Vorbilder in Frage kommen, müssen wir uns, um diese Frage zu beantworten, in Wittgensteins späteren Schriften umsehen. Vielleicht finden sich dort Hinweise, die es gestatten, der Figur des Solipsisten schärfere Umrisse zu verleihen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Philosophischen Untersuchungen! Hier gibt es nur drei Stellen, an denen das Wort gebraucht wird. In §24 wird allgemein darauf verwiesen, daß die Tragweite bestimmter Umformungsmöglichkeiten klarer wird, wenn über den Solipsismus gesprochen werden wird. Wie manche Kommentatoren gesehen haben, ist es höchst fraglich, ob die hier gemeinte Erörterung des Solipsismus im Buch vorkommt oder überhaupt existiert. Ansonsten ist vom Solipsismus nur in den §§402 und 403 die Rede. Die relevanten Sätze in §402 sind sehr allgemein: Denn so sehen ja die Streitigkeiten zwischen Idealisten, Solipsisten und Realisten aus. Die Einen greifen die normale Ausdrucksform an, so als griffen sie eine Behauptung an; die Andern verteidigen sie, als konstatierten sie Tatsachen, die jeder vernünftige Mensch anerkennt. Zweifellos eine pfiffige Bemerkung, aber sie hilft uns nicht, ein genaueres Bild des Solipsisten zu zeichnen. §403 enthält immerhin einen Hinweis. Der Solipsist ist hier jemand, der den Anwendungsbereich der Wörter für Psychisches für sich allein in Anspruch nimmt. Das liefe, wie Wittgenstein schreibt, auf eine Veränderung unserer Notation hinaus, aber es brächte dem So_____________ 12 13 Ernst Mach: Erkenntnis und Irrtum (11905, 51926), Darmstadt 1976, S. 9. Den Hinweis auf Mach verdanke ich Brian McGuinness: Solipsism, in: ders.: Approaches to Wittgenstein, London 2002, S. 131 f. Siehe den bereits genannten Artikel von McGuinness sowie meine eigene Interpretation in: 'Ich bin meine Welt', in: Ulrich Arnswald / Anja Weiberg (eds.): Der Denker als Seiltänzer, Düsseldorf 2001, S. 193-212. Solipsist in der Fliegenglocke 189 lipsisten keinen erkennbaren praktischen Vorteil. „Aber der Solipsist will ja auch keine praktischen Vorteile, wenn er seine Anschauung vertritt!“ Hinter diesem knappen Hinweis auf Veränderungen der Notation steht eine lange Vorgeschichte. Wittgenstein bezieht sich damit auf Versuche, die solipsistische Position zu formulieren, über die er sich bereits im Dezember 1929 ausführlich geäußert hat. Die Grundidee kommt an zahlreichen Stellen von Wittgensteins Schriften vor. Eine anschauliche Zusammenfassung bietet der folgende Passus aus Waismanns Gesprächsaufzeichnungen. Wittgenstein sagt: Man kann nun viele verschiedene Sprachen konstruieren, in welchen jedesmal ein anderer Mensch Mittelpunkt ist. Stellen Sie sich etwa vor, Sie wären ein Despot im Orient. Alle Menschen wären gezwungen, in der Sprache zu sprechen, in welcher Sie Zentrum sind. Wenn ich in dieser Sprache rede, so würde ich sagen: Wittgenstein hat Zahnschmerzen. Aber Waismann benimmt sich so wie Wittgenstein, wenn er Zahnschmerzen hat. In der Sprache, in der Sie Mittelpunkt sind, würde es gerade umgekehrt heißen: Waismann hat Zahnschmerzen, Wittgenstein benimmt sich wie Waismann, wenn er Zahnschmerzen hat. […] Eine von diesen Sprachen ist ausgezeichnet, nämlich die Sprache, in der ich der Mittelpunkt bin. Die Sonderstellung dieser Sprache liegt in ihrer Anwendung. Sie wird nicht ausgedrückt.14 Anders gesagt: In diesem System kann der solipsistische Despot seine Sonderstellung nicht explizit zum Ausdruck bringen. Er kann zwar eine Sprachreform durchsetzen, doch was er eigentlich sagen will, wird sozusagen von der Anwendung dieser Sprache verschluckt, denn die relevanten Aussagen sind alle ineinander übersetzbar. Was der Solipsist sagen will, könnte er mit Hilfe einer Formulierung wie „Nur was ich sehe, wird wirklich gesehen“ auszudrücken versuchen. Diesen und ähnliche Ausdrücke benutzt Wittgenstein zum Beispiel im letzten Viertel des Blue Book, um die Position des Solipsisten zu veranschaulichen. Hier und an mehreren anderen Stellen seiner Schriften ist das Ergebnis stets, daß solche Formulierungsversuche scheitern. Entweder ist die Äußerung des Solipsisten nichtssagend, oder er begeht Fehler, weil er durch den normalen Wortgebrauch irregeführt wird. So will er beispielsweise das Wort „ich“ zugleich persönlich und unpersönlich verwenden. Das Wort „wirklich“ leistet hier nichts, weil kein bedeutungsstiftender Gegensatz zu Gebote steht. Der solipsistische Gebrauch des Wortes „sehen“ beinhaltet, wie Wittgenstein im Blue Book sagt, eine Verwechslung des „geometrischen“ mit dem „physischen“ Auge. Und so weiter und so fort. Wittgensteins Ausführungen zum Gebrauch der Wörter „ich“, „wirklich“ und „sehen“, seine Bemerkungen über Kriterien der Personenidentität und Sinnesdaten werden im Blue Book jeweils an der Frage aufgehängt, ob Formu_____________ 14 Friedrich Waismann: Wittgenstein und der Wiener Kreis, hg. von Brian McGuinness, in: Wittgenstein: Werkausgabe, Band 3, a.a.O., S. 49 f. Joachim Schulte 190 lierungen wie „Nur was ich sehe, wird wirklich gesehen“ den Standpunkt des Solipsisten artikulieren können. Die Antwort ist stets negativ, was für den Solipsisten natürlich enttäuschend ist. Dabei dienen die Bemerkungen Wittgensteins, obwohl sie philosophisch überaus interessant sein mögen, nie der Widerlegung des Solipsisten. Sie zeigen nur, daß er nicht sagen kann, was er sagen will. Ein hübsches Beispiel ist die folgende Manuskriptstelle: Denke dir, ein Anderer, etwa ein Schmeichler, nähme dir den solipsistischen Gedanken vorweg und sagte dir: „Nur was du siehst, ist wirklich gesehen.“ Da würdest du verlegen sein und etwa sagen: „Ich hatte auch so einen Gedanken, aber es stimmt doch nicht ganz, wie du es sagst.“15 Das für den Solipsisten Peinliche besteht darin, daß der Schmeichler, sofern er sagen kann, was er sagen will, gleichzeitig zum Ausdruck bringt, daß die Dinge auch anders liegen könnten, denn dann könnten ICH und DU ihre Stellen vertauschen. Wenn er hingegen nicht sagen kann, was er sagen will, dann kann es der Solipsist auch nicht, denn sinnvoll sind ihre Sprachen nur insofern, als sie ineinander übersetzbar sind. Diese zusammenfassenden Bemerkungen genügen vielleicht, um dem Solipsisten gewisse Konturen zu verleihen, aber zugleich dürften sie zeigen, daß er im Grunde gar kein wirklich individuelles Gesicht bekommen soll. Er vertritt einen Typus, aber auch in dieser Rolle kann er durchaus im Fliegenglas zappeln. Der Grund für sein Zappeln – die auslösende Irritation – ist jetzt etwas genauer erkennbar geworden. Er liegt darin, daß der Solipsist glaubt, etwas Bestimmtes sagen zu wollen und sagen zu können, aber immer wieder erfahren muß, daß es ihm nicht gelingt. Hier möchte ich zwei Dinge betonen: Erstens wird der Solipsist an keiner Stelle direkt widerlegt. Das ist auch besser so. Denn wenn er sich widerlegen ließe, hätte er eine klar artikulierbare These, die er argumentativ vertreten könnte. Es wäre dann womöglich nicht mehr treffend, ihn mit einer im Fliegenglas zappelnden Fliege zu vergleichen. Mein zweiter Punkt wird in manchen Ohren weniger angenehm klingen: Wittgenstein läßt keinen Zweifel daran, daß der Idealist und der Realist nicht besser dran sind als der Solipsist. Dort, wo Wittgenstein summarisch von Realisten, Idealisten und Solipsisten spricht, werden sie stets auf dieselbe Ebene gestellt. Im Grunde genießt der Solipsist eine Vorzugsbehandlung, denn seinen gewundenen Wegen folgt Wittgenstein wenigstens manchmal, während der Idealist sehr viel blasser bleibt und der Realist gar keine philosophische Statur hat. Wittgenstein interessiert sich für diese Typen, nicht weil sie etwas an und für sich Aufschlußreiches zu sagen hätten, sondern weil sie zappeln und sagen wollen, was sie nicht sagen können. In einem gewissen Sinn können sie daher auch nicht unrecht haben, denn dazu müßten sie überprüfbare Urteile aus_____________ 15 MS 156b, a.a.O., S. 48r-48v. Solipsist in der Fliegenglocke 191 sprechen und nicht nur Vorurteilen Luft machen. An einer bedenkenswerten Manuskriptstelle aus der Zeit des Blue Book schreibt Wittgenstein: Wenn ich sage: „Nur was ich sehe, ist wirklich“, so bediene ich mich bereits, ohne es zu wissen, einer vom Gewöhnlichen verschiedenen Ausdrucksart. […] Ich bin schon der Versuchung, sie auf die solipsistische Weise zu gebrauchen, gefolgt. Und deshalb brauche ich eigentlich nichts mehr zu sagen, und was ich sage, ist wie das, was der Realist sagt, wenn er sagt: „Was ich sehe, ist ebenso wirklich wie was du siehst, nur daß eben ich es jetzt sehe und nicht du.“ Was eigentlich gar nichts sagt, außer daß es eine Sprachform betont. Der Solipsist sieht seine Position als unangreifbar an. „Es ist doch klar, daß meine Erfahrung die einzig wirkliche ist; es kann doch gar nicht anders sein.“ Gewiß nicht, wenn du die Sprache so gebrauchst. Du gebrauchst sie nämlich schon so, du plädierst nicht erst für diesen Gebrauch. Die Versuchung zu diesem Gebrauch ist da; und du bist ihr schon gefolgt. Es könnte doch – in gewissem Sinne – gar nicht sein, daß der Solipsist (Idealist oder Realist) unrecht hätte //daß ein so klar Überzeugter unrecht hätte//.16 Daß man sich gegen die Gleichbehandlung von Solipsisten und Realisten wehren möchte, kann daran liegen, daß man den Realismus des Alltags mit philosophischen Formen des Realismus verwechselt. Der Realismus des Alltags ist der Common sense, der, wie Wittgenstein betont, etwas völlig anderes ist als die Common-sense-Philosophie17. Der wirkliche Common sense ist vom (philosophischen) Realismus genauso weit entfernt wie vom Idealismus. Es gibt keine Common-sense-Lösung eines philosophischen Problems18. Common sense und Philosophie bewegen sich sozusagen in verschiedenen Dimensionen. Zu einem Meinungsstreit zwischen ihnen kann es nicht kommen. Abschließend möchte ich diese Skizze mit der Metapher des Fliegenglases in Verbindung bringen. Wenn philosophische Positionen wie Realismus, Idealismus und Solipsismus gleich pathologisch sind, drängen sich zwei Fragen auf. Erstens, von welchem Standpunkt aus soll die Therapie der zappelnden Fliege durchgeführt werden? Kann dies selbst wieder ein philosophischer Standpunkt sein? Ein neutraler Standpunkt? Oder der Standpunkt des alltäglichen gesunden Menschenverstands? Zweitens: Wohin führt der Ausweg der Fliege, die aus dem Fliegenglas befreit wird? In die Philosophie oder in die Welt des Alltags? Diese Fragen kann ich nicht beantworten, obwohl sie – als Fragen – dazu angetan sind, ein bestimmtes und gelegentlich wohl auch erhellendes Licht auf Wittgensteins Denken zu werfen. Ich glaube, er argumentiert nie von _____________ 16 MS 156a, S. 37r-38r. 17 Wittgenstein: Blue Book, a.a.O., S. 49. Ebd., S. 58. 18 Joachim Schulte 192 einem außerphilosophischen Alltagsstandpunkt aus. Das wäre ganz uncharakteristisch und nicht mit dem Gedanken zu vereinbaren, daß philosophische Probleme keine Common-sense-Lösung zulassen. Dagegen klingen einige Dinge, die er sagt, so, als führte mancher Ausweg aus dem Fliegenglas tatsächlich hinaus in die außerphilosophische Welt. Hier denke ich vor allem an Bemerkungen, die den ganzen Menschen in den Vordergrund rücken: Nur vom lebenden Menschen (und was ihm ähnlich ist) könne man sagen, es habe Empfindungen, sei bei Bewußtsein usw.19 Nicht der verletzten Hand spricht man Trost zu, sondern dem Leidenden20. Und so fort. Es gibt eine Reihe von Bemerkungen, die diese Tendenz haben. Diese Bemerkungen gehören zu dem Fliegenglas-Modell, das den Ausweg betont und das Fliegenglas intakt läßt. Der Ausweg kann hier wirklich aus der Philosophie herausführen. Sie ist das Fliegenglas, und die gerettete Fliege läßt die Philosophie ebenso hinter sich wie das Glas. Aber wir kennen ein weiteres Modell, in dessen Rahmen der Philosoph durch Zur-Ruhe-Kommen die Fliegenglocke loswird und zu zappeln aufhört. Der Standpunkt, den der Therapeut bezieht, ist kein neutraler oder externer Standpunkt, sondern der Standpunkt der Fliege. Die Therapie verfährt, wenn man so will, dialektisch: Der Fliege wird vorgeführt, was sie denkt, was sie in Anspruch nimmt und mit welchen Mitteln sie sich ausdrückt. Wenn sie auf diese Weise von – nicht aus, sondern von – der Fliegenglocke befreit werden kann, bleibt sie vielleicht Philosophin, wenn auch als beruhigte Vertreterin ihres Fachs. Darin liegt vielleicht etwas Utopisches – aber warum sollten utopische Gedanken Wittgenstein fremd gewesen sein?21 Er schreibt ja, es sei sein Ziel in der Philosophie, der Fliege aus dem Fliegenglas herauszuhelfen. Das könnte heißen, daß der Ausweg aus der Philosophie in die Philosophie hineinführt – eventuell in eine Philosophie ohne Fliegengläser. _____________ 19 20 21 Vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 281. Ebd., § 286. Zum utopischen Element in Wittgensteins Denken siehe den 4. Abschnitt meines Aufsatzes: Wittgenstein – Our Untimely Contemporary, in: Ilkka Niiniluoto / Risto Vilkko (eds.): Philosophical Essays in Memoriam Georg Henrik von Wright, in: Acta Philosophica Fennica, Vol. 77 (2005), S. 59-78. Handeln ohne Überlegen Andrea Kern 1. Die Fähigkeiten-These Daß jemand eine Fähigkeit gut beherrscht, kann man unter anderem daran erkennen, daß er bei dem, was er tut, nicht nachdenken muß.1 Jemand, der gut Tennis spielt, muß sich, wenn der Ball auf seine Seite geschlagen wird, nicht fragen, wo er den Ball als nächstes hinspielen soll oder wie er den Schläger dabei halten soll oder wie er seine Beine stellen soll, etc. Jemand, der gut Tennis spielen kann, kann vielmehr all das richtig machen, ohne daß er vorher Überlegungen darüber anstellen muß, was zu tun in dieser oder jener Situation richtig ist. Und ganz so liegen die Dinge in den meisten Bereichen unseres alltäglichen Tuns. Wenn wir uns morgens Kaffee kochen oder unsere Zähne putzen oder mit dem Fahrrad zur Universität fahren oder mit unserem Auto in einer Parklücke einparken, dann tun wir all das auf eine Weise, die nicht darauf beruht, daß wir Überlegungen darüber angestellt haben, wie man das, was wir nun tun wollen, richtig macht. Wir tun es einfach.2 Wenn diese Beobachtung richtig ist, dann hat dies offenkundig Konsequenzen für unser Verständnis dessen, was es heißt, ein rationales Wesen zu sein. Denn jemand, der sich morgens einen Kaffee kocht, seine Zähne putzt, mit dem Fahrrad zur Universität fährt oder mit dem Auto in einer Parklücke einparkt, ist nach unserem Verständnis wesentlich dadurch charakterisiert, daß er die Fähigkeit hat, rational zu sein. Und diese Fähigkeit, d.h. die Fähigkeit, rational zu sein, worin auch immer sie sonst noch besteht, hat gewiß etwas damit zu tun, daß man über das, was man tut, nachdenken kann und das, was man tut, aus Gründen tun kann, die einem sagen, was zu tun richtig ist. Wie aber kann beides zusammengehen? Wie kann es einerseits richtig sein, daß ein Großteil unseres Handelns dadurch charakterisiert ist, daß wir handeln, ohne zu überlegen, und es doch andererseits richtig sein, daß wir rationale Wesen sind? _____________ 1 2 So heißt es entsprechend bei Aristoteles: „[D]ie Kunstfertigkeit überlegt nicht mehr hin und her“, in: Aristoteles: Physik, übersetzt von H. G. Zekl, Hamburg 1987, 199b S. 28. Vgl. u.a. L. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a. M. 1977, § 211. Andrea Kern 194 Philosophen, die in der Tradition von Aristoteles stehen, wie etwa Gilbert Ryle oder Michael Thompson, und Philosophen, die in der Tradition von Wittgenstein stehen, wie Hans Julius Schneider oder John McDowell, eint der Gedanke, daß die Blindheit, mit der Menschen in weiten Bereichen ihres Lebens handeln, nicht nur nicht im Widerspruch zu ihrer Rationalität steht, sondern eine Bedingung derselben ist. Die Blindheit menschlichen Handelns ist ihnen zufolge nicht einfach ein kontingenter Aspekt des menschlichen Lebens, sondern ein notwendiges Element seiner Rationalität. Menschliches Leben könnte nicht rational sein, wenn es nicht (auch) blind wäre. Aristoteles drückt dies unter anderem so aus, daß er sagt, menschliches Handeln sei Sache einer „hexis“.3 Wittgenstein drückt das so aus, daß er sagt, menschliches Handeln sei Sache eines „Könnens“,4 einer „Gepflogenheit“, einer „Praxis“.5 Und Hans Julius Schneider hat diesen Gedanken zu der Behauptung radikalisiert, dass selbst das, was wir „Wissen“ nennen, als ein „Sonderfall des Könnens“ zu begreifen sei.6 Das gemeinsame Gegenbild, gegen das Philosophen beider Traditionen angehen, ist die Idee vom Menschen als einem Denker, der als Denker all seinem Tun zugrunde liegen soll. Hubert Dreyfus hat dieses Bild vom Menschen jüngst den „Mythos des Mentalen“ genannt.7 Stattdessen wollen die Autoren der beiden genannten Traditionen sagen, daß der Erwerb und Besitz von Fähigkeiten, vermittels derer der Mensch in der Lage ist, unmittelbar, d.h. ohne Überlegen zu handeln, konstitutiv dafür sind, daß er über die Dinge nachdenken und aufgrund von Überlegungen handeln kann. „Nicht das Wissen erklärt das Können“, so heißt es bei Schneider, „sondern auf der elementaren Ebene erklärt das Können die ersten Stufen des Wissens.“8 In grundlegender Instanz, so die Idee, ist der Mensch ein Subjekt, das die Fähigkeit hat, etwas zu tun, und nicht ein Subjekt, das über etwas nachdenkt. Nennen wir das im folgenden die Fähigkeiten-These. Was aber besagt sie genau? Und warum sollte sie richtig sein? Wie wir im folgenden sehen werden, ist genau dies alles andere als klar: So groß oftmals Einhelligkeit unter den Autoren der beiden genannten Traditionen mit Bezug auf die Fähigkeiten-These herrscht, so wenig Klarheit be_____________ 3 4 5 6 7 8 Aristoteles: Die Nikomachische Ethik, übersetzt von O. Gigon, München 1991 (1967), 1103a S. 16. L. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 150. Ebd., § 199. H. J. Schneider: Beruht das Sprechenkönnen auf einem Sprachwissen?, in: S. Krämer / E. König (eds.): Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen?, Frankfurt a. M. 2002, S. 135. H. Dreyfus: Overcoming the Myth of the Mental: How Philosophers can profit from the Phenomenology of Everyday Expertise, in: Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, vol. 79, no. 2 (Nov. 2005), S. 47. H. J. Schneider: Beruht das Sprechenkönnen auf einem Sprachwissen?, a.a.O., S. 135. Handeln ohne Überlegen 195 steht mit Bezug auf ihre Deutung. Ich werde im folgenden zeigen, daß wir (mindestens) vier Lesarten der Fähigkeiten-These voneinander unterscheiden können, bei denen es nicht um Unterschiede im Detail geht, sondern um Unterschiede in der Substanz der Theorie. Dabei werde ich die vier Lesarten so darstellen, daß zugleich das systematische Problem deutlich wird, auf das alle vier Lesarten versuchen zu antworten. Dabei werde ich zeigen, daß keine der drei ersten Lesarten in der Lage ist, dieses Problem zu lösen, und daher auch die Einwände, die hier jeweils wechselseitig gegen die einzelnen Lesarten vorgebracht werden, zu Recht bestehen. Ich werde dann eine vierte Lesart entwickeln, von der ich zeigen werde, daß sie in der Tat in der Lage ist, das systematische Problem, das der Fähigkeiten-These zugrunde liegt, zu lösen. Erst diese Lesart, so möchte ich behaupten, gibt der Fähigkeiten-These ihr ganzes Gewicht. 2. Rationalität und Regeln Rationalität ist das Vermögen, sein Handeln durch Gründe zu bestimmen, die einem sagen, was zu tun in einer bestimmten Situation richtig ist. Wer das Vermögen der Rationalität hat, ist in der Lage, nicht nur einfach das Richtige zu tun, sondern das Richtige deswegen zu tun, weil er es als das Richtige erkannt hat. Darin unterscheiden sich rationale Wesen von a-rationalen Wesen. A-rationale Wesen können das Richtige nur tun, doch sie können es nicht als das Richtige erkennen und deswegen tun, weil sie es als das Richtige erkannt haben oder es ihnen doch wenigstens als das Richtige erschienen ist. Nehmen wir einmal an, diese Erläuterung von Rationalität sei weitestgehend unkontrovers und bildet die gemeinsame Grundlage aller Theorien des Geistes. Was wir somit verstehen müssen, ist, was es heißt und wie es möglich ist, von einem Subjekt zu sagen, daß es etwas deswegen richtig macht, weil es das, was es macht, als das Richtige erkannt hat. Dies wirft genauer zwei Fragen auf: erstens die Frage, was es heißt und wie es möglich ist, daß ein Subjekt eine bestimmte Handlung als die Richtige erkennt; und zweitens die Frage, was es heißt und wie es möglich ist, daß eine solche Erkenntnis erklärt, weshalb jemand genau das tut, was er als richtig erkennt. Eine erste und in der Tradition der Philosophie nicht wenig verbreitete Vorstellung davon, wie dies möglich sein kann, sieht folgendermaßen aus: Um verstehen zu können, wie jemand eine bestimmte Handlung als die Richtige erkennen und aufgrund dieser Erkenntnis diese Handlung vollziehen kann, müssen wir annehmen, daß es Regeln gibt, die in allgemeiner Weise, d.h. unabhängig von einer bestimmten Situation, sagen, was zu tun richtig ist. Rationalität wäre dann unter anderem das Vermögen der Kenntnis dieser Regeln. Jemand, der das Vermögen der Rationalität besitzt, wäre als jemand 196 Andrea Kern zu verstehen, der ein Wissen um diese Regeln hat und sein Wissen um diese Regeln zur Grundlage seines Verhaltens machen kann, etwa zur Grundlage von Akten der Erkenntnis oder des Handelns. Um dies tun zu können, so die Idee, muß er die entsprechende Regel auf die jeweilige Situation, in der er sich befindet, anwenden, so daß man dann sagen kann, sein Handeln werde durch die Regel angeleitet oder auch durch die Regel begründet. Sich rational zu verhalten heißt nach dieser Auffassung, nach der Vorstellung einer Regel zu handeln, unter die man sein Verhalten subsumiert, indem man die Regel auf eine bestimmte Situation anwendet. Nennen wir das die rationalistische Vorstellung von Rationalität. Ein Bild dieser Art ist es, das häufig Kant zugeschrieben wird, insbesondere von jenen Autoren, die der Aristotelisch-Wittgensteinianischen Tradition zugehören und sich kritisch von diesem Bild absetzen möchten. Es eint die Autoren der Aristotelisch-Wittgensteinianischen Tradition, daß sie diese Vorstellung von Rationalität zurückweisen. Nun soll uns im folgenden nicht die Frage interessieren, ob es tatsächlich richtig ist, Kant mit dieser rationalistischen Vorstellung von Rationalität zu identifizieren. Was ich im folgenden lediglich zeigen möchte, ist, daß auch die sogenannte rationalistische Auffassung von Rationalität notwendigerweise auf die Idee einer Fähigkeit angewiesen ist, deren Ausübung nicht auf Überlegen beruht, sondern es dem Subjekt erlaubt, unmittelbar das zu tun, was es aufgrund dieser Fähigkeit tun kann. Das heißt, auch diese Auffassung von Rationalität, nach der Rationalität im Anwenden von situationsunabhängigen Regeln besteht, ist auf eine bestimmte Version der Fähigkeiten-These angewiesen, und zwar nicht nolens volens, sondern ganz ausdrücklich, wie wir das im folgenden u.a. bei Kant sehen können. Sich dies klar zu machen, ist deswegen von Bedeutung, weil damit deutlich wird, daß die kritische Pointe der Aristotelisch-Wittgensteinianischen Tradition nicht einfach darin bestehen kann – wie dies manchmal irrtümlicherweise angenommen wird –, daß sie überhaupt auf die Idee einer Fähigkeit rekurriert, um menschliches Verhalten zu erläutern. Ihre kritische Pointe muß vielmehr darin bestehen, wie sie von der Idee einer Fähigkeit in ihrer Erläuterung menschlichen Verhaltens Gebrauch macht. 3. Die „rationalistische“ Lesart der Fähigkeiten-These Nach der rationalistischen Auffassung besteht rationales Verhalten in der Anwendung von situationsunabhängigen Regeln auf konkrete Situationen. Ein Subjekt, das sich rational verhält, muß in der Lage sein, Regeln, deren Gehalt situationsunabhängig bestimmt ist, auf konkrete Situationen richtig anzuwenden. Das heißt, es muß in der Lage sein, zu unterscheiden, ob ein bestimmtes Verhalten in einer gegebenen konkreten Situation unter eine be- Handeln ohne Überlegen 197 stimmte gegebene Regel fällt. Wie aber kann das Subjekt dies richtig entscheiden? D.h. wie kann das Subjekt entscheiden, ob die gegebene konkrete Situation ein Fall einer bestimmten gegebenen Regel ist oder nicht? Daß wir hier eine echte Frage haben, mit Bezug auf die es etwas zu entscheiden gibt, liegt dabei nicht etwa daran, daß Regeln gelegentlich ungenau oder unklar sind, sondern daran, daß wir es mit einer prinzipiellen logischen Kluft zu tun haben: Es ist die Kluft zwischen allgemeiner Regel und konkretem Fall: Wie spezifisch eine Regel auch immer formuliert sein mag, d.h. wie genau und detailliert sie auch die Bedingungen beschreiben mag, unter denen sie zur Anwendung kommt, stets ist es so, daß die Frage, ob die Regel in einer konkreten Situation zur Anwendung kommt oder nicht, sich als eine echte Frage stellt. Dies liegt daran, daß eine Regel, deren Gehalt situationsunabhängig bestimmt ist, nichts von dem enthält und enthalten kann, was wir beschreiben, wenn wir eine konkrete Situation beschreiben, die in unendlich vielen Hinsichten individuell bestimmt ist. Die Merkmale, die wir beschreiben, wenn wir eine konkrete Situation als solche beschreiben, unterscheiden sich daher prinzipiell von dem, was wir beschreiben, wenn wir eine Regel beschreiben, deren Gehalt unabhängig von jeder konkreten Situation bestimmt ist. Wenn aber das so ist, dann heißt dies, daß weder die gegebene Regel als solche noch die gegebene Situation als solche eben diese Frage beantworten können: d.h. die Frage, ob eine bestimmte gegebene Situation unter eine bestimmte gegebene Regel fällt oder nicht. Die Frage, ob eine bestimmte konkrete Situation unter eine gegebene Regel fällt oder nicht, ist innerhalb der rationalistischen Auffassung menschlichen Verhaltens eine echte Frage. Daher muß diese Auffassung nun zeigen, wie das Subjekt diese Frage beantworten kann. In der Einleitung zu jenem Abschnitt der Kritik der reinen Vernunft, der den Titel „Von der transzendentalen Urteilskraft überhaupt“ trägt, erörtert Kant ausdrücklich dieses Problem. Kant bezeichnet hierbei den Verstand als das Vermögen der Regeln und fragt sich, wie ein Verstandessubjekt in der Lage ist, diese Regeln, über die es verfügt, in konkreten Situationen anzuwenden. Kants negative Auskunft, die zugleich eine positive Einsicht enthält, lautet: Die Frage der Anwendung der Regeln kann keine Sache der allgemeinen Logik sein. Denn wäre es eine Sache der allgemeinen Logik, dann müßte diese allgemein zeigen, wie man unter die Regeln des Verstandes subsumieren kann. Da sie dies aber nicht anders denn abermals durch eine Regel tun könnte, würde sie unser anfängliches Problem nur verschieben, nicht aber lösen. Denn auch von dieser Regel, deren Aufgabe es sein soll, uns zu zeigen, wie wir die Regeln des Verstandes anzuwenden haben, stellt sich die Frage, woher wir wissen können, wie wir sie anzuwenden haben, d.h. wie wir entscheiden können, ob etwas unter sie fällt oder nicht. Daraus folgt, so Kant, daß das Problem der Anwendung der Regeln nicht selbst Gegenstand einer Regel sein kann, da uns dies in einen unendlichen Andrea Kern 198 Regreß von Regeln führen würde, deren jede das Problem der Anwendung nur an eine weitere Regel verschieben, nicht aber lösen kann. Die positive Einsicht, die Kant daraus zieht, lautet, daß wir, um verstehen zu können, wie menschliches Verhalten rational im Sinne eines Anwendens von Regeln sein kann, es nicht genügt, den Menschen nur als ein Subjekt zu beschreiben, das über Regelwissen verfügt, sondern auch als ein Subjekt, das über eine Fähigkeit verfügt, die Kant „Urteilskraft“ nennt. Unter „Urteilskraft“ versteht Kant allgemein das Vermögen, unter Regeln zu subsumieren, d.h. zu unterscheiden, ob etwas unter einer gegebenen Regel stehe oder nicht.9 Wenn der Verstand das Vermögen der Regeln im Sinne eines Regelwissens ist, dann müssen wir, um verstehen zu können, wie die Verwirklichung dieser Regeln im menschlichen Verhalten möglich ist, auf die Idee einer Fähigkeit bezugnehmen, deren Besitz und Ausübung nicht durch Regeln vermittelt ist, sondern vielmehr auf „Übung“ beruht: eben die Fähigkeit zur Anwendung von Regeln. Jede allgemeine Regel, an welcher Stelle der Erläuterung wir auch immer sie einführen, erfordert, so Kant, eben darum, weil sie eine Regel ist, aufs neue eine Unterweisung der Urteilskraft, und so zeigt sich, „daß zwar der Verstand einer Belehrung und Ausrüstung durch Regeln fähig, Urteilskraft aber ein besonderes Talent sei, welches gar nicht belehret, sondern nur geübt sein will“.10 Um die Rationalität menschlichen Verhaltens zu erklären, genügt es also nicht, anzunehmen, daß der Mensch durch Regeln belehrt wird. Wir müssen darüber hinaus annehmen, daß er ein Vermögen hat, das vom Verstand wesentlich dadurch verschieden ist, daß es nicht durch Regeln belehrt, sondern nur „durch Beispiele und wirkliche Geschäfte“ geübt werden kann.11 So kann etwa ein Arzt, ein Richter oder ein Staatskundiger, wie Kant anführt, „viel schöne pathologische, juristische oder politische Regeln im Kopfe haben“, doch solange er bloß diese „Regeln im Kopfe“ hat, wird er nicht in der Lage sein, vermittels dieser Regeln das zu tun, was in der jeweiligen Situation das Richtige ist, sei dies in der Behandlung eines Kranken, in der Entscheidung eines Rechtsstreits oder in der Lenkung der Staatsgeschäfte.12 Denn dann kann er zwar „das Allgemeine in abstracto einsehen“, doch diese Einsicht als solche genügt nicht, um in einer bestimmten Situation das zu tun, was die Regeln von einem verlangen.13 Um in einer bestimmten Situation das zu tun, was die Regeln von einem verlangen, muß man die Regeln auf die Situation anwenden. Und um das zu tun, braucht man eine weitere Fähigkeit, d.h. eine Fähigkeit, die zu der Kenntnis der Regeln noch hinzukommen muß, weil sie in _____________ 9 10 11 12 13 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, Frankfurt a. M. 1968, B 171. Ebd., B 172. Ebd., B 173. Ebd. Ebd. Handeln ohne Überlegen 199 dem Vermögen der Regelkenntnis noch nicht enthalten ist: eben die Fähigkeit, zu unterscheiden, „ob ein Fall in concreto“ unter die Regel fällt oder nicht.14 Gemäß dieser Auffassung besteht die logische Rolle der Idee einer Fähigkeit, deren Ausübung nicht durch Überlegungen vermittelt ist, darin, zu erklären, wie ein Subjekt in der Lage ist, die Regeln der Rationalität, über die es als rationales Wesen verfügt, in der richtigen Weise auf verschiedene Situationen anzuwenden und damit seine Rationalität zu verwirklichen. Die Frage der Regelanwendung, da sie nicht durch eine weitere Regel geregelt sein kann, muß durch eine „Fähigkeit“ beantwortet werden, eben jene Fähigkeit, die Kant „Urteilskraft“ nennt. Für diese kann trivialerweise kein Anwendungsproblem bestehen, weil sie gerade durch das Anwenden von Regeln definiert ist. Der Gegenstand jener fraglichen „Fähigkeit“, auf die wir bezugnehmen müssen, um die Rationalität menschlichen Verhaltens erklären zu können, sind nach der sogenannten rationalistischen Lesart eben jene Regeln, in deren Verwirklichung nach dieser Auffassung Rationalität besteht und zu der diese Fähigkeit dient, indem sie deren Anwendung gewährleistet. 4. Die „anti-rationalistische“ Lesart der Fähigkeiten-These Es eint die Autoren der Aristotelisch-Wittgensteinianischen Tradition, daß sie die rationalistische Auffassung von Rationalität und die darin implizierte Lesart der Fähigkeiten-These zurückweisen. Strittig zwischen den verschiedenen Autoren ist jedoch, mit welchen Argumenten sie diese zurückweisen und wie die entsprechende positive Konzeption menschlichen Verhaltens auszusehen hat. Ich will im folgenden drei verschiedene Konzeptionen voneinander unterscheiden, die sich alle darin einig sind, daß die rationalistische Lesart falsch ist, doch die aus ihrer Kritik jeweils andere Konsequenzen ziehen. Betrachten wir zunächst die sogenannte „anti-rationalistische“ Position. Sie kritisiert die rationalistische Lesart im wesentlichen mit einem phänomenologischen Argument: Das phänomenologische Argument besagt, daß der rationalistischen Lesart ein falsches Verständnis der Phänomenologie unseres Handelns zugrunde liegt. Es ist offenkundig, so die Idee, daß menschliches Verhalten in seinen grundlegenden Zügen nicht in der Anwendung von Regeln besteht. Wenn wir handeln, etwa wenn wir Baseball oder Schach spielen, dann ist das, was wir hier tun, nicht durch Regeln geleitet, sondern beruht in den grundlegenden Fällen auf einer Fähigkeit, die Dreyfus im Anschluß an Aristoteles „phronesis” nennt: _____________ 14 Ebd. 200 Andrea Kern Phronesis shows that socialization can produce a kind of master whose actions do not rely on habits based on reasons to guide him. Indeed, thanks to socialization, a person’s perceptions and actions at their best would be so responsive to the specific situation that he could not be captured in general concepts. [...] So it seems clear that rules needn’t play any role in producing skilled behavior.15 Fälle wie der folgende scheinen schlagende Beispiele für diese Lesart zu sein: Jemand fährt jahrelang mit schlafwandlerischer Sicherheit exzellent Ski. Mühelos passiert er noch die schwerste Buckelpiste im eleganten Wedelschwung, kein Tiefschnee kann ihn aus der Bahn werfen, vielmehr gleitet er mit umwerfender Leichtigkeit durch die Schneemassen, ohne auch nur ein einziges Mal ins Stocken zu geraten. All dies gelingt ihm, ohne daß er dabei nachdenken muß, was jeweils zu tun ist. Ja mehr noch, seine Könnerschaft drückt sich gerade darin aus, daß er sein Skifahren nicht durch Überlegungen darüber anleiten muß, wie zu fahren ist, sondern dass er unmittelbar – ohne Überlegen – das Richtige tut. Eines Tages beschließt er, Skilehrer zu werden. Dies verlangt von ihm, daß er in der Lage ist, das, was er beim Skifahren tut, in einzelne Bewegungsabläufe zu zerlegen, um so seinen Schülern in einzelnen Schritten zeigen zu können, wie man Ski fährt, etwa, um ihnen zeigen zu können, daß man bei einem Drehschwung zunächst Innenskibelastung aufnimmt, dann anferst und dann ruckartig die Skier hinten hochreißt, etc. Er studiert also Ski-Lehrbücher, lernt sie auswendig und versucht nun, sein eigenes Skifahren durch das theoretisch Gelernte anzuleiten. Doch was geschieht nun? Er macht einen Fehler nach dem anderen auf der Piste, er belastet den falschen Ski, was er vorher nie tat, er neigt den Oberkörper beim Schwung fälschlicherweise hangabwärts, was er vorher nie tat, er überkreuzt auf einmal die Skispitzen, was ihm vorher nie passierte, er stürzt allenthalben, etc. Die bewußte Aufmerksamkeit auf die einzelnen Bewegungsabläufe, die Anleitung jedes einzelnen Schrittes durch eine bewußte Vorstellung davon, was nun an dieser Stelle zu tun richtig ist, hat offenkundig einen zerstörerischen Effekt: Es zerstört nachgerade seine Fähigkeit, Ski zu fahren. Nach der anti-rationalistischen Lesart zeigt ein solches Beispiel, daß die grundlegenden Vermögen, die unser Verhalten erklären, keine rationalen Vermögen sein können.16 Rationalität, so die Idee, ist nicht nur kein Bestandteil unserer grundlegenden Verhaltensvollzüge, sondern kann diese schlimmstenfalls sogar zerstören. Der Sinn der fraglichen Fähigkeiten, auf die wir bezugnehmen müssen, um menschliche Subjektivität in angemessener Weise zu begreifen, besteht folglich nicht darin, zu erklären, wie bestimmte Regeln angewendet werden können, wie die rationalistische Lesart dies meint. Die Fähigkeiten-These besagt nach dieser Lesart vielmehr, daß die grundlegenden _____________ 15 16 H. Dreyfus: Overcoming the Myth of the Mental, a.a.O., S. 51 u. 52. Siehe u.a. H. Dreyfus: The Return of the Myth of the Mental, in: Inquiry, vol. 50, no. 4 (August 2007), S. 361. Handeln ohne Überlegen 201 Fälle unseres Wahrnehmens, Erkennens und Handelns überhaupt nicht durch Regeln charakterisiert sind, sondern a-rational sind.17 Menschliches Verhalten hat nach dieser Lesart eine wesentlich a-rationale Grundlage. Rationalität charakterisiert den Menschen nicht bis auf den Grund seiner Existenz, sondern ist ein Vermögen, welches in einem seinerseits a-rationalen Vermögen gründet. Darin liegt nach dieser Lesart die Pointe der fraglichen Fähigkeiten: Sie erklären die Grundlage menschlichen Verhaltens auf eine Weise, die unabhängig von jedem Bezug auf Regeln der Rationalität ist. Nach der rationalistischen Lesart besteht die logische Rolle der fraglichen Fähigkeiten darin, zu erklären, wie menschliche Subjekte ihre Rationalität verwirklichen können, indem sie die Regeln der Rationalität auf konkrete Situationen anwenden. Nach der sogenannten „anti-rationalistischen“ Lesart besteht sie darin, so etwa Dreyfus, zu erklären, wie menschliche Subjekte überhaupt ein Weltverhältnis haben können, auf welches dann aufbauend Regeln der Rationalität zur Anwendung kommen können.18 Nach der anti-rationalistischen Lesart übt also ein Mensch, der über einen Baumstamm springt, ein und dieselbe Fähigkeit aus wie ein Tiger, der über einen Baumstamm springt. Die fraglichen Fähigkeiten sind keine spezifisch menschlichen, d.h. rationalen Vermögen, sondern beschreiben einen Aspekt des Menschen, der in derselben Weise jedes Tier charakterisiert. Nach der anti-rationalistischen Lesart müßte man sagen: Jedes Tier hat die fraglichen Fähigkeiten ganz wie der Mensch, nur, daß im Fall des Tieres diese Fähigkeiten das Weltverhältnis des Tieres vollständig bestimmen, während im Fall des Menschen die fraglichen Fähigkeiten die Grundlage dafür sind, daß der Mensch noch eine weitere Weise entwickeln kann, sich auf die Welt zu beziehen: nämlich eine rationale Weise, in der das Verhältnis zur Welt nicht nur durch Fähigkeiten, sondern überdies durch Regeln vermittelt ist. Nach der rationalistischen Lesart der Fähigkeiten-These ist das Verhältnis von Tier und Mensch ein anderes: Ihr zufolge beschreiben die fraglichen Fähigkeiten keine Vermögen, die dem Tier wie dem Menschen gemeinsam sind. Jene Fähigkeiten, von denen gemäß der Fähigkeiten-These behauptet wird, sie seien für die menschliche Subjektivität konstitutiv, sind hier als spezifisch menschliche Fähigkeiten verstanden. Wenn ein Tiger über einen Baumstamm springt, dann übt er dabei ein Vermögen anderer Art aus als der Mensch es tut, wenn dieser über einen Baumstamm springt. Der Mensch übt hierbei Rationalität aus, der Tiger nicht. _____________ 17 18 Siehe u.a. ebd. H. Dreyufs: Overcoming the Myth of the Mental, a.a.O., S. 59f. Andrea Kern 202 5. Die „anti-anti-rationalistische“ Lesart der Fähigkeiten-These Es gibt noch eine dritte Lesart der Fähigkeiten-These, die insbesondere unter Wittgensteinianern weit verbreitet ist. Die dritte Lesart versteht sich als eine Kritik sowohl der rationalistischen wie auch der anti-rationalistischen Lesart der Fähigkeiten-These. D.h. ganz wie die anti-rationalistische Lesart hält auch diese Lesart die rationalistische Lesart der Fähigkeiten-These für falsch, doch aus einem anderen Grund. Die anti-rationalistische Lesart hält die rationalistische Lesart für falsch, weil diese davon ausgeht, das grundlegende Weltverhältnis des Menschen sei durch Rationalität bestimmt. Nach der dritten Lesart ist die rationalistische Lesart hingegen falsch, nicht, weil sie Rationalität als Grundlage annimmt, sondern weil sie ein falsches Verständnis von Rationalität und damit auch der fraglichen Fähigkeiten hat. Die rationalistische Lesart, so hatten wir gesehen, versteht Rationalität als das Vermögen der Kenntnis situationsunabhängiger Regeln, die ein Anwendungsproblem offen lassen, von welchem sodann angenommen wird, daß die fraglichen Fähigkeiten es lösen. Die dritte Lesart versteht die Fähigkeiten-These hingegen so: Rationalität ist kein Vermögen von situationsunabhängig gegebenen Regeln, die man sich zunächst unabhängig von und vor dem einzelnen Verhaltensakt vorstellen kann und von denen dann zu fragen ist, wie sie in der jeweiligen Situation angewendet werden müssen. Rationalität ist vielmehr ein Vermögen von Regeln, deren Gehalt allein dadurch bestimmt wird, daß man sie in bestimmten Situationen in seinem Verhalten anwendet. Das Anwendungsproblem, das die rationalistische Lesart hat und mit der Idee der Fähigkeit zu lösen glaubt, gibt es daher nicht, da es den Gehalt der Regeln, die rationales Verhalten leiten, nur in Situationen der Anwendung überhaupt gibt.19 Die logische Rolle der fraglichen Fähigkeiten kann daher nicht die sein, zu erklären, wie Regeln, die unabhängig von ihrer Anwendung vorgestellt werden können, in je bestimmten Situationen angewendet werden müssen. _____________ 19 Einige Formulierungen bei John McDowell legen nahe, daß er ein Vertreter dieser Position ist. Denn sein Hauptaugenmerk liegt erstens darauf, zu betonen, daß die Regeln, die unser Verhalten leiten, nicht situationsunabhängig vorgestellt werden können, und zweitens darauf, zu betonen, daß es genügt, diese Regeln prinzipiell vorstellen zu können, ohne daß jedoch eine aktuelle Vorstellung dem Handeln vorhergehen muß. Die Betonung dieser beiden Aspekte jedoch, so werden wir gleich sehen, sind nicht ausreichend, um das obige Dilemma zu lösen. Dies schließt es jedoch nicht aus, daß sich McDowell auch als Vertreter der von mir am Ende vorgeschlagenen vierten Lesart der Fähigkeiten-These verstehen läßt. Mein Eindruck ist, daß McDowell deswegen nicht eindeutig einzuordnen ist, weil er nicht sieht, daß eine therapeutische Verwendung des Fähigkeiten-Begriffs nicht ausreichend ist, um das obige Dilemma zu lösen, sondern dass wir hierfür eine Theorie der Fähigkeiten benötigen. Vgl. dazu z.B. J. McDowell: What Myth?, in: Inquiry, vol. 50, no. 4 (August 2007). Handeln ohne Überlegen 203 Das, so haben wir oben gesehen, ist auch die Grundidee der antirationalistischen Lesart. Für die anti-rationalistische Lesart bedeutet dies jedoch, wie wir gesehen haben, daß die grundlegende Form menschlichen Verhaltens nicht nur nicht als die Verwirklichung von situationsunabhängigen Regeln verstanden werden kann, sondern überhaupt nicht als ein Verwirklichen von Regeln. Die grundlegende Form des Handelns ist weder als ein Vollzug zu verstehen, der durch die explizite Vorstellung einer Regel angeleitet wird, noch als ein Vollzug, der implizit durch die Vorstellung einer Regel angeleitet wird. Die dritte Lesart der Fähigkeiten-These möchte dagegen den Gedanken verteidigen, daß die grundlegende Form menschlichen Verhaltens ein Ausüben von Rationalität ist. Zugleich möchte sie jedoch auch jenem Aspekt dieses Verhaltens Rechnung tragen, der im Zentrum der anti-rationalistischen Lesart steht: nämlich daß in den grundlegenden Fällen dem Verhalten keine Vorstellung einer Regel vorhergeht, die dieses begründet. Wittgenstein drückt dies bekanntlich so aus, daß er sagt, die grundlegende Form des Regelfolgens sei ein „blindes“ Regelfolgen: „Ich folge der Regel blind“. 20 Die dritte Lesart der Fähigkeiten-These wendet gegen die antirationalistische Lesart folglich ein, daß sie auf einem Fehlschluß beruht: die anti-rationalistische Lesart glaubt, aus der unbestreitbaren Nicht-Reflexivität oder Blindheit menschlichen Verhaltens schließen zu müssen, daß dieses in seinen grundlegenden Fällen keine Ausübung von Rationalität sein kann. Die dritte Lesart bestreitet dies. Sie möchte behaupten, daß die Nicht-Reflexivität menschlichen Verhaltens seiner grundlegenden Rationalität keineswegs widerstreitet, sondern ein Ausdruck derselben ist. Wir wollen sie daher die antianti-rationalistische Lesart nennen. Die anti-anti-rationalistische Lesart glaubt also, daß sich die beiden folgenden Sätze miteinander vereinbaren lassen: (1) Menschliches Verhalten ist rational, d.h. es wird von Regeln geleitet. (2) Menschliches Verhalten ist blind, d.h. ihm geht keine Vorstellung von Regeln vorher. Ich werde im folgenden behaupten, daß eine angemessene Theorie menschlichen Verhaltens sich darin zeigt, daß sie in der Lage ist, beide Behauptungen miteinander zu vereinbaren. Wie ist es möglich, menschliches Verhalten als rational und blind zugleich zu verstehen? Die rationalistische Lesart der Fähigkeiten-These glaubt, daß die erste Behauptung notwendigerweise eine Leugnung der zweiten Behauptung zur Folge hat. Wenn menschliches Verhalten rational ist, dann folgt daraus, daß es nicht blind sein kann. Die antirationalistische Lesart glaubt genau dasselbe und sieht sich daher gezwungen, die erste Behauptung zu bestreiten, d.h. die Rationalität menschlichen Verhal_____________ 20 L. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 219. Andrea Kern 204 tens auf seiner grundlegenden Ebene Preis zu geben. Wenn menschliches Verhalten blind ist, dann folgt daraus, daß es nicht rational sein kann. Die antianti-rationalistische Lesart hat nun dagegen den Anspruch, beide Behauptungen miteinander zu vereinbaren. Sie möchte verständlich machen, wie ein Verhalten rational sein kann, ohne in der Vorstellung einer Regel zu gründen, die ihm vorhergeht und es begründet. Nach der anti-anti-rationalistischen Lesart können wir uns dies genau dann verständlich machen, wenn wir den Gedanken aufgeben, demzufolge Rationalität in einem Vermögen situationsunabhängiger Regeln besteht. Gibt man dieses Verständnis von Rationalität auf, dann, so die Idee, liegt auch keine Schwierigkeit darin, die Rationalität menschlichen Verhaltens mit seiner Blindheit zu verbinden.21 Doch stimmt das? Betrachten wir hierfür genauer, wie die anti-anti-rationalistische Lesart die Form menschlichen Verhaltens erläutert: Damit ein Verhalten rational sein kann, so die Idee, ist es nicht nötig, daß jemand, bevor er handelt, die Vorstellung einer Regel hat, die ihn in seinem Handeln leitet. Es genügt, daß er in der Lage ist, sein Handeln als eines zu rekonstruieren, das unter eine Regel der Rationalität fällt. D.h. der Handelnde muß die Regel, die sein Handeln leitet, nicht vor seinem Handeln vorstellen, sondern es genügt, daß er die Fähigkeit hat, die Regel, an die er im Moment seines Handelns nicht gedacht hat, nachträglich anzugeben. Nach diesem Verständnis von Rationalität besteht der logische Sinn der fraglichen Fähigkeiten darin, zu erklären, wie ein Verhalten, das „blind“ vollzogen wird, dennoch Ausdruck von Rationalität sein kann. Dies sollen die fraglichen Fähigkeiten deswegen erklären können, weil ihre Ausübung dadurch charakterisiert ist, daß sie unter eine Regel fällt, die der Handelnde zwar nicht vor dem Verhaltensakt aktual vorgestellt hat, doch die er nach dem Verhaltensakt vorstellen kann. Daß die Regel, unter die das Verhalten fällt, nicht aktual vor ihrer Anwendung vorgestellt werden muß, darin liegt die „antirationalistische“ Pointe des Rekonstruktions-Modells. Daß sie jedoch nachträglich vorgestellt werden können muß, darin liegt zugleich ihre „rationalistische“ Pointe gegenüber der anti-rationalistischen Auffassung. Nach der antianti-rationalistischen Lesart ist die grundlegende Form menschlichen Verhaltens also kein explizites, sondern ein implizites Regelfolgen. Der Anti-Rationalist findet diese Erläuterung nicht überzeugend. Nach seiner Auffassung ist das menschliche Verhalten in einem radikaleren Sinne „blind“. Der Anti-Rationalist bestreitet, daß die Fähigkeit zur Rekonstruktion von Regeln konstitutiv für menschliches Verhalten ist. Wenn wir handeln, dann handeln wir in den grundlegenden Fällen so blind, daß wir hier weder _____________ 21 Vgl. dazu u.a. J. McDowell, der schreibt: „I urge that even unreflective bodily coping, on the part of rational animals, is informed by their rationality”, in: What Myth?, a.a.O., S. 338. Handeln ohne Überlegen 205 vorher noch nachher Regeln „sehen“.22 Das zeigt das Beispiel des Skifahrers, der genau solange Skifahren konnte, wie er nicht in der Lage war, die Regeln seines Verhaltens anzugeben. Lassen wir den Einwand des Anti-Rationalisten einmal für einen Moment auf sich ruhen und fragen uns, ob denn die anti-anti-rationalistische Lesart, wenn schon nicht die Blindheit, so doch wenigstens die Rationalität des menschlichen Handelns erklären kann. Die anti-anti-rationalistische Lesart will sagen, daß die Rationalität meines Verhaltens dann gesichert ist, wenn ich in der Lage bin, die Regel, unter die es fällt, angeben zu können. Nun aber ist klar, daß ich die Regel, unter die mein Verhalten fällt, nur dann nachträglich angeben kann, wenn mein Verhalten tatsächlich unter eine Regel fällt. Wie aber kann dies erklärt werden? Für die rationalistische Lesart der Fähigkeiten-These ist unmittelbar klar, wie sie die Übereinstimmung meines Verhaltens mit einer Regel erklären kann: dadurch, daß ich mir die Regel vor dem Verhaltensakt vorgestellt und diesen dann durch diese Vorstellung bestimmt habe. Wie aber kann das anti-antirationalistische Modell diese Übereinstimmung erklären? Und mehr noch: Damit mein Verhalten rational ist, genügt es nicht, daß es einfach mit einer Regel übereinstimmt. Denn diese Übereinstimmung könnte auch zufällig sein. Und wenn sie nur zufällig ist, dann heißt dies, daß mein Verhalten nicht wirklich rational ist, sondern bloß so aussieht wie eines, das rational ist. Aristoteles erinnert uns an diesen wichtigen Unterschied, wenn er zwischen einem Verhalten unterscheidet, das nur zufälligerweise mit bestimmten (hier: grammatischen) Regeln übereinstimmt, und einem Verhalten, das deswegen mit diesen Regeln übereinstimmt, weil es seinen Grund in jenem Vermögen hat, das darin besteht, ein Verhalten gemäß dieser Regeln hervorzubringen. Er schreibt: [M]an kann etwas grammatisch Korrektes tun auch durch Zufall und wenn es einem ein anderer zeigt. Also ist man nur dann ein Grammatiker, wenn man etwas grammatisch Korrektes tut, und dies auf fachmännische Weise, das heißt: im Sinne der Grammatik, die man sich angeeignet hat.23 Angewendet auf unsere Diskussion können wir also erst dann sagen, daß ein Verhalten ein rationales Verhalten ist, und nicht einfach nur so aussieht wie ein rationales Verhalten, wenn dies bedeutet, daß mein Verhalten durch ein Vermögen erklärt wird, das darin besteht, rationales Verhalten hervorzubringen. Betrachten wir nun, wie das anti-anti-rationalistische Modell unser Verhalten erklärt: Das anti-anti-rationalistische Modell beschreibt unser Verhalten als das Resultat zweier Vermögen, die logisch miteinander verknüpft sein sollen: den _____________ 22 23 Vgl. etwa H. Dreyfus: The Return of the Myth of the Mental, a.a.O., S. 360. Aristoteles: Die Nikomachische Ethik, a.a.O., 1105a S. 22-27. 206 Andrea Kern „blinden“ Fähigkeiten und einem Vermögen der Rationalität im Sinne eines Vermögens der Vorstellung rationaler Regeln. Beide Arten von Vermögen müssen vorhanden sein, und zwar so, daß sie logisch miteinander verknüpft sind, wenn rationales Verhalten möglich sein soll. Zugleich aber soll es so sein, daß man beide Vermögen unabhängig voneinander ausüben kann. Das heißt, die „blinden“ Fähigkeiten sollen so verfaßt sein, daß man sie ausüben kann, ohne zugleich sein Vermögen der Rationalität im Sinne eines Vermögens der Vorstellung rationaler Regeln auszuüben. Dies soll die Blindheit unseres Verhaltens erklären. Nach dem anti-anti-rationalistischen Modell müssen wir also zwei Arten von Vermögen, und zwar in je unterschiedlicher Weise ins Spiel bringen, um unser Verhalten zu erklären. Während die „blinden“ Fähigkeiten unmittelbar unserem Verhalten zugrunde liegen und dieses erklären, ist das Vermögen der Rationalität nur mittelbar explanatorisch mit unserem Verhalten verknüpft. Das Vermögen der Rationalität kommt erst dann zum Zug, wenn die „blinden“ Fähigkeiten schon ausgeübt wurden, auch wenn gelten soll, daß letzteres nur möglich ist, wenn auch ersteres möglich ist. Die Ausübung des Vermögens der Rationalität ist der Ausübung der „blinden“ Fähigkeiten nachgeordnet, auch wenn das Vorhandensein der „blinden“ Fähigkeiten vom Vorhandensein des Vermögens der Rationalität abhängig sein soll. Wenn aber das so ist, dann heißt dies, daß das Vermögen der Rationalität nicht in der Lage ist, das zu erklären, was seine eigene Voraussetzung ist: nämlich daß mein Verhalten tatsächlich unter eine Regel fällt, deren Rekonstruktion dann Sache meines Vermögens der Rationalität ist. Denn wenn die Ausübung des Vermögens der Rationalität der Ausübung der „blinden“ Fähigkeiten nachgeordnet ist, dann kann das Vermögen der Rationalität nicht die Quelle meines Verhaltens sein. Das, was mein Verhalten erklärt, sind meine „blinden“ Fähigkeiten, nicht die Regel, kraft derer es rational ist. Daraus aber folgt, daß die Übereinstimmung meines Verhaltens mit einer Regel innerhalb dieses Modells nichts anderes als eine Sache des Zufalls sein kann. Das anti-anti-rationalistische Modell hat keine Erklärung für die Rationalität des Verhaltens. Wenn hier jemand etwas tut, das mit einer Regel übereinstimmt, dann geschieht dies zufällig. 6. Wittgensteins eigentliche „Einsicht“ Wir hatten oben behauptet, daß das eigentliche Argument für die antirationalistische Lesart darin besteht, daß sie bestreitet, daß man den Umstand, daß wir in den grundlegenden Fällen unser Verhalten blind vollziehen, damit vereinbaren kann, daß dieses Verhalten Ausdruck von Rationalität ist. Das anti-anti-rationalistische Modell hat den Anspruch, beides miteinander zu verbinden. Nun aber haben wir gesehen, daß dieses Modell vor der Schwie- Handeln ohne Überlegen 207 rigkeit steht, genau das nicht erklären zu können, was es zu erklären gilt: nämlich daß unser Verhalten tatsächlich rational ist. Machen wir uns klar: Das Dilemma, das wir oben beschrieben haben, besteht darin, daß wir nur die Wahl zu haben scheinen zwischen der Möglichkeit, entweder der Rationalität unseres Verhaltens Rechnung zu tragen, dann aber die Blindheit desselben bestreiten müssen – das ist das rationalistische Modell; oder aber der Blindheit unseres Verhaltens Rechnung zu tragen, dann aber die Rationalität desselben bestreiten zu müssen – das ist das antirationalistische Modell. Der Versuch des anti-anti-rationalistischen Modells, dieses Dilemma zu überwinden, so hat sich gezeigt, scheitert. Statt eine alternative dritte Möglichkeit zu eröffnen, sitzt dieses Modell, aus der Perspektive des Rationalisten wie des Anti-Rationalisten, auf beiden Hörnen des Dilemmas zugleich: Auf der einen Seite kann es die Rationalität unseres Verhaltens nicht erklären, sondern diese nur voraussetzen; auf der anderen Seite kann es der Blindheit unseres Verhaltens nicht wirklich Rechnung tragen, weil es vom Subjekt des Verhaltens verlangt, die Regeln seines Verhaltens, wenngleich nicht im Moment des Verhaltens vor Augen zu haben, so doch immerhin nachträglich rekonstruieren zu können. Damit zeigt sich, daß sich das obige Dilemma nicht dadurch auflösen läßt, daß man den Ort der Regeln – sie sind nicht außerhalb der Situation, sondern nur in der Situation gegeben – und den Zeitpunkt ihrer Vorstellung – sie werden nicht vor dem Verhalten, sondern erst nach dem Verhalten vorgestellt – verschiebt. Was wir benötigen, ist vielmehr eine Form der Erklärung, bei der zwei Dinge miteinander identisch sind: Eine Erklärung unseres Verhaltens durch die fraglichen Fähigkeiten mit einer Erklärung unseres Verhaltens durch das Vermögen der Rationalität. Wonach wir suchen, ist also eine Erklärung, die beides zusammenbringt. Für alle drei Lesarten der Fähigkeiten-These gilt dagegen, daß sie die fraglichen Fähigkeiten auf eine Weise verstehen, derzufolge diese keine vollständige Erklärung der Rationalität menschlichen Verhaltens liefern. Eine vollständige Erklärung haben wir in allen drei Lesarten erst dann, wenn wir diese Fähigkeiten mit einem weiteren Vermögen, nämlich dem Vermögen der Vorstellung von Regeln, verknüpfen. Im zentralen § 199 der Philosophischen Untersuchungen, auf den sich alle Autoren der Aristotelisch-Wittgensteinianischen Tradition beziehen, schreibt Wittgenstein: Es kann nicht ein einziges Mal nur ein Mensch einer Regel gefolgt sein. Es kann nicht ein einziges Mal nur eine Mitteilung gemacht, ein Befehl gegeben, oder verstanden worden sein, etc. – Einer Regel folgen, eine Mitteilung machen, einen Befehl geben, eine Schachpartie spielen sind Gepflogenheiten (Gebräuche, Institutionen). Und in § 202 heißt es dann: „Darum ist ,der Regel folgen’ eine Praxis.“ Was möchte Wittgenstein sagen, wenn er behauptet, das Folgen einer Regel sei eine „Gepflogenheit“, eine „Praxis“? Ich möchte im folgenden eine vierte Andrea Kern 208 Lesart der Fähigkeiten-These entwickeln, von der ich meine, daß sie die eigentliche Einsicht Wittgensteins zum Ausdruck bringt. Ich möchte zeigen, daß die eigentliche Einsicht Wittgensteins in dem Gedanken besteht, daß der Grundbegriff zur Erläuterung der Rationalität menschlichen Verhaltens nicht die Idee einer Regel ist, von der dann zu fragen wäre, wie sie angewendet werden kann, sondern die Idee einer bestimmten Art von Fähigkeit, die die Rationalität menschlichen Verhaltens vollständig erklärt. Das, was wir benötigen, um zu verstehen, wie menschliches Verhalten rational sein kann, sind nicht die Idee einer Regel plus die Idee einer „blinden“ Fähigkeit. Was wir vielmehr benötigen, ist die Idee einer bestimmten Art von Fähigkeit, kraft derer wir sagen können: Jemand, der solche Fähigkeiten ausübt, übt darin sein Vermögen der Rationalität aus. Die Arbeiten von Hans Julius Schneider weisen meines Erachtens in diese Richtung. Programmatisch schreibt Schneider hierzu: Die konsequente Durchführung des pragmatischen Ansatzes verlangt die Einsicht, dass die Zuschreibung einer Regelkenntnis auf der elementaren Stufe (...) nichts anderes heißt als die Zuschreibung der Handlungsfähigkeit.24 Das, was Schneider die „konsequente“ Durchführung des „pragmatischen Ansatzes“ nennt, werde ich im folgenden die Identitäts-Lesart der Fähigkeiten-These nennen, um den zentralen Unterschied zu den sogenannten „inkonsequenten“ Lesarten zu markieren. Denn die Rationalität menschlichen Verhaltens und seine Blindheit haben nach dieser Lesart nicht zwei verschiedene Quellen, sondern es ist ein und dieselbe Fähigkeit, die erklärt, weshalb menschliches Verhalten in seinen grundlegenden Fällen blind und rational zugleich ist. 7. Die Identitäts-Lesart der Fähigkeiten-These Wir hatten oben mit Aristoteles den Fall, in dem jemand etwas Regelgerechtes aus Zufall tut, von dem Fall unterschieden, in dem er dies deswegen tut, weil er eine bestimmte Fähigkeit erworben hat, kraft derer er etwas tut, was mit bestimmten Regeln übereinstimmt. Wenn jemand eine Fähigkeit hat, dann heißt dies, daß er durch etwas charakterisiert ist, das die Erfüllung bestimmter Regeln erklärt. Eine Fähigkeit, was auch immer sonst sie ist, ist eine bestimmte Form der Erklärung eines richtigen Verhaltens. Daß jemand im Besitz einer Fähigkeit ist, heißt, daß in den grundlegenden Fällen, in denen jemand etwas tut, das mit den Regeln der Fähigkeit übereinstimmt, dies durch die Fähigkeit erklärt wird. _____________ 24 H. J. Schneider: Beruht das Sprechenkönnen auf einem Sprachwissen?, a.a.O., S. 143f. Handeln ohne Überlegen 209 Wir hatten oben behauptet, Skifahren sei eine Fähigkeit. Wenn dies so ist, dann bedeutet dies, daß der Begriff des Skifahrens der Begriff einer bestimmten Form der Erklärung desjenigen Verhaltens ist, bei dem jemand das tut, was unter den Begriff des Skifahrens fällt. Wenn ein Skifahrer auf der Piste beim Rechtsschwung hinten anferst und die Skier ruckartig nach oben reißt, dann, so wollen wir sagen, geschieht dies nicht aus Zufall, sondern deswegen, weil er die Fähigkeit hat, Ski zu fahren, die dies erklärt. Stellen wir uns nun dagegen einmal vor, der Begriff des Skifahrens bezeichne keine Fähigkeit, sondern ein System von Verhaltensregeln. Als Beispiel haben wir hierfür die Beschreibung des Fahrens eines parallelen Kurzschwungs gewählt. In einem Standard-Lehrbuch wird das Fahren eines parallelen Kurzschwungs so beschrieben: Mit einem explosiven Strecken der Beine, bei dem man sich betont vom talseitigen Stock abstützt, wird der Schwung begonnen. Dabei ist Vorlage einzunehmen. Die Skienden werden hochgerissen. Dabei kann man sogar etwas anfersen. Nahezu zeitgleich werden die Beine, aber nicht der Rumpf, schnell schwungwärts gedreht. Mit Beginn der Schwungsteuerung wird sofort Außenskibelastung aufgenommen und das Außenbein anhaltend gedreht. Der Rumpf wird betont über den Außenski geneigt [...].25 Nun stellen wir uns vor, dies sei die Beschreibung eines Systems von Verhaltensregeln. Skifahren bestünde entsprechend darin, diese Regeln, sei es implizit oder explizit, anzuwenden. Nun fragen wir uns, ob diese Regeln vollständig erklären könnten, weshalb jemand etwas tut, das mit diesen Regeln übereinstimmt. Gewiß nicht. Denn stellen wir uns vor, Jim, der gerade tatsächlich anferst, den Oberkörper, aber nicht den Rumpf hangaufwärts dreht, kennt diese Regeln nicht. Wenn Jim diese Regeln nicht kennt, dann kann sein Verhalten auch nicht durch diese Regeln erklärt werden. Nur Regeln, die man kennt, kann man auch anwenden. Um Jims Verhalten durch die Regeln zu erklären, müßten wir also voraussetzen, daß Jim die Regeln kennt. Stellen wir uns also vor, Jim kennt diese Regeln. Würde dies vollständig erklären, weshalb er das tut, was er tut? Nun, stellen wir uns vor, Jim ist eigensinnig und möchte sich nicht vorschreiben lassen, wie er Skifahren soll. Er plant, nicht anzufersen und auch den Oberkörper nicht hangaufwärts zu drehen. Zufälligerweise aber liegt ein kleiner Stein genau in seiner Spur. Dies führt dazu, daß Jim – entgegen seinem Vorhaben – doch anferst, und zwar so, daß er zugleich den Oberkörper dabei etwas hangaufwärts dreht. Gewiß, Jim hat alles richtig gemacht: Er ist so Ski gefahren, wie man richtig Ski fährt. Und doch wird dies hier nicht durch die Regeln des Skifahrens erklärt, sondern durch einen gänzlich zufälligen Faktor, nämlich den auf der Piste liegenden Stein. Damit also die _____________ 25 Deutscher Verband für das Skilehrerwesen e.V. (ed.): Skilehrplan 1, S. 78. Vgl. dazu auch ausführlicher meine Ausführungen in A. Kern: Quellen des Wissens. Zum Begriff vernünftiger Erkenntnisfähigkeiten, Frankfurt a. M. 2006, S. 200ff. 210 Andrea Kern Regeln des Skifahrens dies erklären könnten, müßten wir nicht nur annehmen, daß Jim diese Regeln kennt, sondern wir müßten überdies annehmen, daß Jim diese Regeln als für sein Verhalten gültige Regeln anerkennt. Wenn Skifahren ein System von Verhaltensregeln wäre, dann sähe eine Erklärung der Tatsache, daß Jim anferst, etwa so aus: (a) Jim ferst an, weil er die Regeln des Skifahrens kennt und diese als für sein Verhalten gültige Regeln anerkennt. Regeln, so zeigt das Beispiel, können bestenfalls Elemente einer Erklärung sein, doch sie können keine vollständige Erklärung eines Verhaltens liefern. Wenn der Begriff des Skifahrens der Begriff eines Systems von Verhaltensregeln wäre, dann würde die Tatsache, daß jemandes Verhalten unter diesen Begriff fällt, für sich noch keine Erklärung dieser Tatsache enthalten, sondern eine solche Erklärung würde stets mehr verlangen: die Kenntnis der Regeln und deren Anerkennung. Anders dagegen ist dies, wenn der Begriff des Skifahrens der Begriff einer Fähigkeit ist. Folgen wir Aristoteles, dann hieße dies, daß jemand nur dann Ski fährt, d.h. etwas tut, das unter den Begriff des Skifahrens fällt, wenn er die Fähigkeit dazu hat. Denn der Begriff des Skifahrens hätte dann nicht nur einen deskriptiven Sinn, insofern er dazu dient, zu beschreiben, was jemand tut. Er hätte zugleich einen erklärenden Sinn. Wenn wir sagen, daß Jim Ski fährt, würden wir hiermit nicht nur beschreiben, was Jim gerade tut, sondern wir würden zugleich eine Erklärung dafür geben, weshalb er gerade hinten anferst, den Oberkörper, aber nicht den Rumpf hangaufwärts dreht, etc. Das, was erklärt, weshalb Jim gerade hinten anferst, etc., ist die Tatsache, daß er die Fähigkeit ausübt, Ski zu fahren. Wenn jemand diese Fähigkeit ausübt, dann ist es kein Zufall, wenn er hinten anferst, etc. Hinten anzufersen ist ein Element der Ausübung dieser Fähigkeit. Eine Erklärung dieser Tatsache sähe dann einfach so aus: (b) Jim ferst an, weil er Ski fährt. Der Begriff des Skifahrens wäre folglich ein Begriff, der, indem er beschreibt, was jemand tut, zugleich das, was derjenige tut, erklärt. Zu sagen, was jemand tut, und zu sagen, warum er das tut, was er tut, wäre hier ein und dasselbe. Was für eine Art von Erklärung ist das? Stellen wir uns vor, jemand fährt Ski und fällt plötzlich zu Boden. Wenn er zu Boden fällt, geschieht offenkundig etwas, das nicht mit dem Begriff des Skifahrens übereinstimmt, also auch nicht durch ihn erklärt werden kann. Doch ist es logisch mit ihm verknüpft: nämlich als ein Fall der Abweichung von diesem Begriff. Solche Fälle nennt Aristoteles Fälle der Privation. Wenn jemand einen Kuchen bäckt, dann geschieht hier auch etwas, das nicht mit dem Begriff des Skifahrens übereinstimmt, doch das, was hier geschieht, ist nicht Handeln ohne Überlegen 211 logisch mit dem Begriff des Skifahrens verknüpft. Anders dagegen, wenn jemand auf der Piste stürzt. Wenn wir ein Ereignis als einen „Sturz auf der Piste“ beschreiben – und nicht etwa sagen, daß sich hier jemand hinsetzt, oder einen Kopfsprung macht, oder seinen Rücken massiert – dann setzt dies voraus, daß wir es in den Zusammenhang der Fähigkeit, Ski zu fahren, einordnen, mit Bezug auf welche dieses Ereignis eine Privation darstellt: d.h. es ist ein Ereignis, dessen Beschreibung die Bezugnahme auf den Begriff des Skifahrens voraussetzt, ohne selbst unter diesen Begriff zu fallen und durch diesen erklärt zu werden. Wir können nicht sagen: „Jim stürzt auf der Piste, weil er Ski fährt“. Doch daß wir überhaupt sagen können, daß Jim auf der Piste stürzt, setzt voraus, daß wir ihn als jemanden beschreiben, der Ski fährt. Seine Fähigkeit, Ski zu fahren, erklärt nicht, weshalb er auf der Piste stürzt. Doch seine Fähigkeit, Ski zu fahren, ist eine logische Voraussetzung dafür, daß er als jemand beschrieben werden kann, der auf der Piste stürzt.26 Das, was erklärt, weshalb er stürzt, sind etwa Dinge wie ein Steinchen auf der Piste, ein ihm den Weg versperrender anderer Skifahrer, eine Eisplatte, etc. Mit Bezug auf seine Fähigkeit, Ski zu fahren, die den Fall erklärt, in dem er genau das tut, was mit der Fähigkeit übereinstimmt, sind die Faktoren, die den Fall der Privation erklären, kontingent. Es sind keine Faktoren, deren Vorliegen für die Fähigkeit notwendig sind. Es sind Faktoren, die kontingenterweise vorliegen und derart sind, daß sie das Subjekt an der Ausübung seiner Fähigkeit, die es andernfalls ausgeübt hätte, hindern. Fälle der Privation werden durch Hindernisse erklärt, Fälle der Übereinstimmung mit der Fähigkeit durch die Fähigkeit selbst. Aristoteles drückt das so aus, indem er sagt: [D]erselbe Begriff [eines Vermögens, A.K.] erklärt die Sache und die Privation, nur nicht auf dieselbe Art und Weise [...]. [D]enn der Begriff ist Begriff des einen an sich, Begriff des anderen aber gewissermaßen in akzidentellem Sinne. Nur durch Verneinung und Wegnahme erklärt der Begriff das Gegenteil.27 Nur durch „Verneinung und Wegnahme“ werden die Fälle der Abweichung erklärt, sagt Aristoteles. Wir können das so ausdrücken: Die Fälle der Abweichung werden dadurch erklärt, daß in einem solchen Fall genau jene Bedingungen „weggenommen“ sind, die im positiven Fall vorhanden sind und die Ausübung der Fähigkeit erlauben. Wir hatten oben gefragt, was für eine Art von Erklärung die Erklärung durch eine Fähigkeit ist. Die Möglichkeit von Fällen des Scheiterns macht deutlich, daß die Fälle, die die Fähigkeit erklärt, dadurch charakterisiert sind, daß sie mit einer Regel übereinstimmen, an de_____________ 26 27 Die These ist natürlich nicht so zu verstehen, daß es hier nicht auch alternative Fähigkeiten geben kann, die die logische Voraussetzung eines Stürzens auf der Piste sein können, etwa die Fähigkeit zu gehen. D.h. auch jemand, der nicht Skifahren kann, kann auf einer Piste stürzen, aber nur dann und nur deswegen, wenn und weil er eine andere Fähigkeit hat, zu der ein solcher Sturz eine Privation darstellt. Aristoteles: Metaphysik, übersetzt von F. F. Schwarz, Stuttgart 1970, 1046b S. 13-15. Andrea Kern 212 ren Erfüllung man auch scheitern kann. Die Fälle, die mit ihr übereinstimmen und durch diese erklärt werden, sind folglich als Fälle des Gelingens zu beschreiben: eben als Fälle, in denen die Ausübung einer Fähigkeit gelingt, die auch hätte scheitern können. Die Erklärung durch eine Fähigkeit ist also eine normative Erklärung. Sie erklärt das, was sie erklärt, dadurch, daß sie es als etwas darstellt, das so ist, wie es gemäß der Fähigkeit sein soll. 8. Fähigkeiten und Situationen Eine Erklärung durch eine Fähigkeit ähnelt in einer gewissen Hinsicht der Erklärung durch ein Gesetz: Sie erklärt etwas Einzelnes durch etwas Allgemeines. Nun gibt es freilich verschiedene Erläuterungen dessen, was ein Gesetz ist, von denen wir jedoch im Moment absehen können. Denn wichtig für uns nur ist, sich klar zu machen, daß eine normative Erklärung etwas nicht dadurch erklärt, daß sie das, was geschieht, als logisch notwendig darstellt. Sie erklärt etwas nicht dadurch, daß sie es als etwas darstellt, von dem logisch ausgeschlossen ist, daß etwas anderes hätte geschehen können. Im Gegenteil. Zum einen hatten wir ja eben gesehen, daß es nicht logisch ausgeschlossen ist, daß jemand, der Ski fährt, auf der Piste stürzt und also etwas tut, das nicht so ist, wie es hätte sein sollen. Eine Erklärung durch eine Fähigkeit ist eine normative Erklärung.28 Zum anderen sind Fähigkeiten mit den Situationen, in denen sie ausgeübt werden, nicht derart verknüpft, daß es für jede Situation gerade eine und nur eine Handlung gibt, die zu vollziehen richtig wäre. Wenn jemand Ski fährt, dann kann es in ein und derselben Situation eine Vielzahl von Handlungen geben, die mit der Fähigkeit, Ski zu fahren, in Übereinstimmung sind: in ein und derselben Situation kann es richtig sein, einen Parallelschwung zu machen, zu wedeln oder im Pflug die Piste hinunter zu fahren. Daß jemand, der wedelt, etwas tut, das gemäß der Fähigkeit des Skifahrens richtig ist, heißt nicht, daß in derselben Situation nicht auch etwas anderes hätte richtig sein können. Oder stellen wir uns einen Tennisspieler vor: Die Fähigkeit, Tennis zu spielen, enthält Regeln, die vorgeben, wie Tennis zu spielen ist. Doch richtig Tennis zu spielen, heißt nicht, daß es in jeder Situation eine einzige richtige Handlung gibt, die die Regeln der Fähigkeit vorgeben. Es kann in ein und derselben Situation richtig sein, den Ball mit der Vorhand zu nehmen oder mit der Rückhand, einen Ball Volley zu spielen oder ihn als Longline zu schlagen. Natürlich gibt es sehr viele Situationen, in denen es gemäß der Fä_____________ 28 Zur Normativität vernünftiger Fähigkeiten und der mit ihnen verknüpften Art von Erklärung vgl. ausführlicher meine Darstellung in A. Kern, Quellen des Wissens, S. 212 – 247. Handeln ohne Überlegen 213 higkeit, Tennis zu spielen, ein grober Fehler wäre, in einer solchen Situation den Ball mit der Rückhand zu nehmen, statt mit der Vorhand, etc. Und doch gilt auch für Roger Federer, daß es Situationen gibt, in denen er mehrere Möglichkeiten hat, seine Fähigkeit richtig auszuüben. Wenn man etwas tut, das gemäß der Fähigkeit richtig ist, dann ist das keine Sache der logischen Notwendigkeit. Selbst dann nicht, wenn es in der Situation tatsächlich nur eine einzige richtige Handlung gibt. Wenn Roger Federer weiß, daß ein Passierschlag in die rechte hintere Ecke des gegnerischen Feldes der einzig richtige Ball ist, den er jetzt zu schlagen hat, dann ist dies nichts, das er durch einen logischen Schluß herausbekommen hat. Roger Federer hat nicht geschlossen: Gegeben diese Regel – etwa, daß man, wenn der Gegner in seinem Feld vorne links steht, rechts an ihm vorbeischlagen soll –, gegeben, daß der Vordersatz erfüllt ist, folgt daraus, daß ich den Ball in die rechte hintere Ecke schlagen soll. Dies liegt daran, daß Regeln, die Fähigkeiten charakterisieren, wesentlich situationsabhängig sind, woraus folgt, daß man sie nicht als Teil eines logischen Schluß repräsentieren kann. Der Grund dafür ist der erklärende Charakter von Fähigkeiten. Wenn dasjenige Verhalten, das unter eine Fähigkeit fällt, dadurch definiert ist, daß es durch die Fähigkeit erklärt wird, dann bedeutet dies, daß man die Regeln von Fähigkeiten nur dadurch erläutern kann – etwa die Regeln des Skifahrens, Tanzens, oder Schwimmens –, daß man das beschreibt, was derjenige tut, der diese Fähigkeit ausübt. Wenn A-tun eine Fähigkeit ist, dann gehört es wesentlich zum A-tun, daß man es kraft der entsprechenden Fähigkeit tut. Zu sagen, worin eine bestimmte Fähigkeit besteht, verlangt, daß man sich auf bestimmte Fälle der Ausübung dieser Fähigkeit als Beispielfälle für die Fähigkeit bezieht, an denen man sich in einer solchen Beschreibung orientiert. Die grundlegende Erläuterung einer Fähigkeit besteht folglich in einem Satz der folgenden Art: Die Fähigkeit, A zu tun, besteht darin, das zu tun, was derjenige tut, der diese Fähigkeit exemplarisch ausübt. Daraus folgt, daß bestimmte Merkmale der Situation, eben jene, die für ihre Verwirklichung notwendig sind, ein wesentlicher Teil der Beschreibung von Fähigkeiten sind. Dies begründet den zentralen Gedanken, den ausnahmslos alle Vertreter der Aristotelisch-Wittgensteinianischen Tradition teilen, demzufolge die Regeln, die unser Verhalten leiten, nicht situationsunabhängig beschreibbar sind. D.h. bestimmte Merkmale der Situation sind nicht einfach äußerlich mit den Regeln verknüpft, sondern Teil der Beschreibung der Regeln selbst. Wenn wir die Regeln unseres Verhaltens als Regeln von Fähigkeiten verstehen, dann macht dies begreiflich, weshalb das so ist. Andrea Kern 214 9. Das Wissen um die Fähigkeit Man möchte an dieser Stelle vielleicht einwenden, daß der Aristotelische Gedanke, demzufolge der Begriff einer Fähigkeit durch eine Beschreibung von Fällen der Ausübung der Fähigkeit erläutert wird, offensichtlich nicht richtig ist, wie die obige Erläuterung des Fahrens eines parallelen Kurzschwungs beweist. Denn hier wird offenkundig nicht ein bestimmter Fall der Ausübung der Fähigkeit beschrieben, sondern es werden Regeln angegeben, die sagen, wie man Ski fährt. Doch dieser Einwand beruht auf einem Mißverständnis. Richtig ist, daß hier in der Tat nicht beschrieben wird, wie Jim gerade einen parallelen Kurzschwung macht. Vielmehr wird beschrieben, was man tut, wenn man einen Kurzschwung macht. Die Aristotelische These besagt nun folgendes: Wenn diese Beschreibung als die Beschreibung einer Fähigkeit zu verstehen ist (und eben nicht als ein System von Verhaltensregeln), dann bedeutet dies, daß die Bezugnahme auf Fälle der Ausübung dieser Fähigkeit eine Voraussetzung dieser Beschreibung ist. Dies schließt nicht aus, sondern ein, daß man die Fähigkeit auch so beschreiben kann, daß man von solchen Fällen ihrer Ausübung abstrahiert und das, was diesen Fällen gemeinsam ist, als Regel formuliert. Entscheidend ist hier der Gedanke, daß die Beschreibung der Regeln einer Fähigkeit abhängig ist von Fällen der Ausübung der Fähigkeit, d.h. sie ist gegenüber einer Beschreibung von Fällen der Ausübung der Fähigkeit logisch nachträglich. Aus diesem Grund, darauf hat Schneider in seinen Arbeiten nachdrücklich hingewiesen, ist es auch falsch, menschliches Verhalten als eine Form der Anwendung impliziter Regeln zu beschreiben. Wenn menschliches Verhalten in der Ausübung vernünftiger Fähigkeiten besteht, dann ist es weder eine Form der impliziten noch der expliziten Regelanwendung. Denn, wie Schneider exemplarisch mit Bezug auf die Sprache schreibt: Im Fall der Sprache [....] sind alle Regelformulierungen nicht nur nachträglich, sondern auch prinzipiell lückenhaft, weil sie nichts Vorgegebenes explizit machen, an dem sich ablesen ließe, wann der Prozeß des „nach außen Bringens“ abgeschlossen ist.29 Die Behauptung, daß der Begriff des Skifahrens der Begriff einer Fähigkeit ist, steht also nicht im Kontrast zu der Behauptung, daß es Regeln gibt, die sagen, wie man richtig Ski fährt, sondern gibt diesen Regeln ihren richtigen „Ort“: Sie besagt, daß nicht bestimmte Regeln die Grundlage des Verhaltens desjenigen sind, der Ski fährt, sondern die Fähigkeit, Ski zu fahren, die man, wenn man die Fähigkeit aus einer abstraktiven Perspektive betrachtet, in Gestalt von Regeln beschreiben kann. Darin liegt nach der Identitäts-Lesart der Fähigkeiten-These der richtige Kern der anti-rationalistischen Lesart: Daß wir in den grundlegenden Fällen unseres Verhaltens weder vorher noch nachher _____________ 29 Schneider: Beruht das Sprechenkönnen auf einem Sprachwissen?, a.a.O., S. 145. Handeln ohne Überlegen 215 eine Regel vorstellen, der wir gefolgt sind. Die anti-rationalistische Lesart mißdeutet jedoch diesen Umstand. Sie deutet ihn als Ausdruck dafür, daß unser Verhalten in seinen grundlegenden Fällen kein Ausdruck von Rationalität ist. Nach der Identitäts-Lesart hingegen ist das Verhalten desjenigen, der Ski fährt, ein Ausdruck von Rationalität. Wie ist das zu verstehen? Damit ein Verhalten rational ist, so hatten wir gesagt, muß es von Regeln geleitet sein. Die Identitäts-Lesart erlaubt es nun, diesen Gedanken begreiflich zu machen, ohne dabei annehmen zu müssen, daß das Subjekt sich hierbei eine Regel vorstellt. Um diesen Gedanken begreiflich zu finden, müssen wir lediglich annehmen, daß Skifahren nicht einfach irgendeine Fähigkeit ist, sondern eine selbstbewußte Fähigkeit. D.h. es ist eine Fähigkeit, deren Besitz einschließt, daß das Subjekt eine Vorstellung von der Fähigkeit hat. Dann können wir verstehen, wie jemand, der eine solche Fähigkeit ausübt, dabei von den Regeln dieser Fähigkeit geleitet werden kann, ohne annehmen zu müssen, daß er jemals einen Akt vollzieht, in dem er sich die Regeln dieser Fähigkeit vorstellt. Um dies zu verstehen, müssen wir uns klar machen, was es heißt, eine selbstbewußte Fähigkeit zu haben, und das heißt, wir müssen uns klar machen, welcher Art jene Vorstellung ist, die man von einer solchen Fähigkeit hat. Die Vorstellung, die man von einer selbstbewußten Fähigkeit hat, so haben wir gesagt, ist ein Aspekt der Fähigkeit selbst. Wenn Skifahren eine selbstbewußte Fähigkeit ist, dann heißt dies, daß jemand, der Skifahren kann, genau dadurch und genau deswegen, weil er Skifahren kann, eine Vorstellung davon hat, wie man Ski fährt. Seine Vorstellung davon, wie man Ski fährt, ist nichts Zusätzliches, das er sich überdies noch angeeignet hat, sondern diese Vorstellung hat er genau dadurch bekommen, daß er gelernt hat, Ski zu fahren. Wenn aber das so ist, d.h. wenn die Vorstellung der Fähigkeit etwas ist, das zur Fähigkeit selbst gehört, dann heißt dies, daß es diese Vorstellung der Fähigkeit auf genau dieselbe Weise gibt wie die Fähigkeit. Wie aber gibt es Fähigkeiten? Der Satz „Jim kann Ski fahren“ kann wahr sein, auch wenn Jim gerade nicht Ski fährt. Gewiß: Aussagen über Fähigkeiten können nur wahr sein, wenn es auch wahre Aussagen über Akte gibt, in denen diese Fähigkeiten hier und jetzt ausgeübt wird. Wenn Jim niemals Ski fährt, macht es keinen Sinn zu sagen, er habe die Fähigkeit, Ski zu fahren. Aussagen über Fähigkeiten und Aussagen über Akte, die unter sie fallen, sind offenkundig wechselseitig miteinander verknüpft. Doch im Unterschied zu Aussagen über einzelne Akte des Skifahrens, die sich stets auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehen, haben Aussagen über die Fähigkeit, Ski zu fahren, keinen Zeitbezug. Während es richtig ist, zu sagen, daß Jim heute, morgen oder gestern Ski fährt, hat Jim die Andrea Kern 216 Fähigkeit, Ski zu fahren, nicht gestern, heute oder morgen.30 Und genau dasselbe gilt dann auch für die Vorstellungen, die mit selbstbewußten Fähigkeiten verknüpft sind. Daß jemand, der Ski fahren kann, eine Vorstellung davon hat, wie man Ski fährt, heißt nicht, daß er hier und jetzt einen Akt vollzieht, in dem er seine Fähigkeit vorstellt. Die Vorstellung, die er von seiner Fähigkeit hat, ist genauso zeitlos wie die Fähigkeit selbst. Daß jemand eine zeitlose Vorstellung von seiner Fähigkeit hat, kann sich dabei auf vielfältige Weise zeigen. Nach dem, was wir in § 7 gesagt haben, muß dies jedoch stets bedeuten, daß er in der Lage ist, bestimmte Akte der Ausübung der Fähigkeit als Beispielfälle für die Fähigkeit zu erkennen. Daß jemand eine Vorstellung von seiner Fähigkeit hat, muß also stets bedeuten, daß er in der Lage ist, bestimmte Akte der Ausübung der Fähigkeit genau so unter die Fähigkeit zu bringen, daß er sie dabei als exemplarisch für die Fähigkeit erkennt. Wenn Skifahren eine selbstbewußte Fähigkeit ist, dann heißt dies, daß jemand, der Skifahren kann, genau dadurch, daß er Skifahren kann, auf Fälle der Ausübung der Fähigkeit als Beispielfälle für die Fähigkeit bezugnehmen und denken kann: „So fährt man Ski!“. Und genau darum hat jemand, der diese Fähigkeit ausübt, auch genau eine solche Vorstellung von sich: Jemand, der Ski fährt, fährt genau so Ski, daß er dabei weiß, daß das, was er tut, ein Beispiel für Skifahren ist. Wenn jemand etwas tut, das unter eine selbstbewußte Fähigkeit fällt, dann heißt dies, daß er eine Fähigkeit ausübt, die man nur so ausüben kann, daß man in dem, was man tut, zugleich weiß, was man tut. Handeln und Denken sind hier eins. Daß Handeln und Denken hier eins sind, heißt, daß Handeln und Denken hier keine zwei verschiedenen Akte beschreiben, die in irgendeinem Sinn aufeinander folgen, sondern zwei Seiten eines einzigen Akts sind. Schneider drückt diesen Gedanken so aus, indem er sagt: [D]ie Zuschreibung von Wissen als auch die Zuschreibung einer Orientierung an Regeln [sind] auf der elementaren Stufe als Zuschreibungen von Handlungskompetenzen zu verstehen.31 _____________ 30 31 Dies schließt nicht aus, daß jemand, der eine Fähigkeit hat, diese zu einem bestimmten Zeitpunkt erworben hat, und es ist damit auch nicht ausgeschlossen, daß er sie verlieren kann. Der Besitz von Fähigkeiten kann eine bestimmte Dauer haben. Als ich jung war, konnte ich Klavier spielen. Heute kann ich es nicht mehr. Ich müßte es erneut lernen. Doch wenn man eine Fähigkeit erwirbt, dann durch jemanden, der schon im Besitz dieser Fähigkeit ist, und in diesem Sinn ist die Fähigkeit also schon immer „da“. Und wenn man eine Fähigkeit verliert oder eine Fähigkeit gar „ausstirbt“, dann geschieht dies nicht durch etwas, das sich durch die Fähigkeit erklären ließe, sondern verlangt eine andere Erklärung: etwa, weil die Fähigkeit nicht mehr ausgeübt wurde, oder weil sie nicht mehr weitergegeben wurde. Fähigkeiten sind zeitlos in dem Sinne, daß es nicht zur ihrem Wesen gehört, einen Anfang oder ein Ende zu haben. H. J. Schneider: Beruht das Sprechenkönnen auf einem Sprachwissen?, a.a.O., S. 144. Handeln ohne Überlegen 217 Allerdings halte ich diese und ähnliche Formulierungen Schneiders für nicht ganz unproblematisch, da sie zweideutig sind:32 Man kann die Behauptung, daß die Orientierung an Regeln als Handlungskompetenz zu verstehen sei, einmal im Sinne der hier vorgeschlagenen Identitäts-Lesart auffassen. Dann soll damit gesagt werden, daß das Handeln kein Akt ist, der in einem ihm vorhergehenden Akt der Vorstellung einer Regel fundiert ist, sondern einer Fähigkeit entspringt, deren Ausübung selbstbewußt ist. Man kann diese Behauptung aber auch so verstehen, daß damit nicht gesagt werden soll, daß Denken und Handeln hier eins seien, sondern stattdessen, daß der grundlegende Fall des Handelns einer sei, bei dem das Subjekt nicht weiß, was es tut und warum es das tut, was es tut. Dann würde man sie im Sinne der antirationalistischen Lesart verstehen. Wenn ich Schneider richtig verstehe, ist das ganz gegen seine Absicht. Um dieses Mißverständnis zu verhindern, d.h. um den „pragmatischen Ansatz“ tatsächlich „konsequent“ durchzuführen, ohne in die Falle der anti-rationalistischen Lesart zu gehen, ist es so wichtig, den Begriff einer selbstbewußten Fähigkeit als Grundbegriff zu entwickeln. Denn dann können wir sagen: Wer eine selbstbewußte Fähigkeit ausübt, handelt nicht, ohne zugleich zu wissen, was er tut und warum er es tut: Er weiß, daß das, was er tut, ein Beispiel für eben jene Fähigkeit ist, die das, was er tut, erklärt. Wir hatten eingangs gesagt, daß der Begriff eines vernünftigen Tuns von uns verlangt, begreiflich zu machen, erstens, was es heißt und wie es möglich ist, daß ein Subjekt einen bestimmten Vollzug als den Richtigen erkennt, und zweitens, was es heißt und wie es möglich ist, daß eine solche Erkenntnis erklären kann, weshalb jemand genau das tut, was er als richtig erkennt. Wenn wir menschliches Tun als die Ausübung einer selbstbewußten Fähigkeit verstehen, dann können wir, so zeigt sich nun, beide Fragen zugleich beantworten. Selbstbewußte Fähigkeiten liefern uns sowohl eine Erklärung dafür, wie jemand erkennen kann, was zu tun in einer bestimmten Situation richtig ist, als auch dafür, wie jemand genau das tun kann, was er als richtig erkennt. Denn wenn menschliches Handeln in der Ausübung einer selbstbewußten Fähigkeit besteht, dann erklärt der selbstbewußte Charakter dieser Fähigkeiten, weshalb jemand, der eine solche Fähigkeit besitzt, in der Regel erkennt, was zu tun in einer bestimmten Situation richtig ist. Und weil die Erkenntnis dessen, was richtig ist, ihren Grund in nichts anderem als in der Fähigkeit selbst hat, erklärt dies zugleich, weshalb jemand, der genau dadurch das Rich_____________ 32 Vgl. dazu auch folgende Formulierung Schneiders: „Die Praxis des Vor- und Nachmachens, des Korrigierens und der Analogiebildung muss existiert haben, nicht aber ‚dahinterliegende’ Regeln und ein unartikuliertes Wissen von ihnen.“ (ebd., S. 146). Auch hier ist es zweideutig, ob Schneider nur bestreiten will, daß das Handeln in einem Regelwissen gründet, oder ob er bestreiten will, daß das Handeln mit einem Wissen um das Richtige verknüpft ist. 218 Andrea Kern tige erkennt, weil er eine bestimmte vernünftige Fähigkeit hat, in der Regel auch genau das tut, was er als richtig erkennt. Beides, sowohl das Erkennen wie auch das Handeln, haben dann also genau denselben Grund: eben die fragliche Fähigkeit, die ihr gemeinsamer Grund ist. Daraus folgt das, was wir oben schon ausgedrückt haben, als wir sagten, das Erkennen und das Handeln würden hier nicht zwei voneinander unabhängige Akte darstellen, von denen man die Frage aufwerfen kann, wie der eine Akt den anderen erklären kann. Erkennen und Handeln sind als zwei Seiten eines einzigen Aktes zu verstehen, die beide durch die fragliche Fähigkeit erklärt werden. Wir hatten oben gesagt, daß man nicht sagen könnte, was Skifahren wäre, wenn niemand jemals Ski gefahren wäre. Wir können das nun genauer ausdrücken: Was Skifahren ist, wissen in erster Instanz diejenigen, die Ski fahren. D.h. die erste Instanz, in der es das Wissen vom Skifahren gibt, ist diejenige, in der es unmittelbar praktische Konsequenzen hat, d.h. in der es diejenigen anleitet, die dabei sind, Ski zu fahren. Das Wissen ums Skifahren ist in den grundlegenden Fällen praktisches Wissen, d.h. ein Wissen, das eine handlungsleitende Rolle spielt. Dies besagt natürlich nicht, daß jemand, der nicht Ski fahren kann, nicht wissen kann, was Skifahren ist. Viele Fernsehzuschauer der winterlichen Weltcup-Rennen können nicht Skifahren, doch sie wissen natürlich genau, was das ist, was sie da anschauen, und sie können auch beurteilen, ob jemand gut oder schlecht Ski fährt. Die These, daß FähigkeitsWissen in erster Instanz praktisches Wissen ist, besagt nicht, daß das Wissen ums Skifahren nicht auch theoretisch sein kann, sie besagt jedoch, daß dieses theoretische Wissen ums Skifahren logisch abhängig ist davon, daß es praktisches Wissen vom Skifahren gibt. 10. Vernünftige Fähigkeiten Wir haben oben den Begriff einer bestimmten Art von Fähigkeit entwickelt. Nennen wir Fähigkeiten, die wesentlich selbstbewußt sind, vernünftige Fähigkeiten. Wenn wir über den Begriff einer vernünftigen Fähigkeit im oben erläuterten Sinn verfügen, dann können wir genau das begreiflich machen, was bislang wie ein Rätsel aussah: nämlich wie menschliches Verhalten in den grundlegenden Fällen blind sein kann, ohne dessen Rationalität bestreiten zu müssen. Wir können nun behaupten, daß die beiden Sätze (1) Menschliches Verhalten ist rational, d.h. es wird von Regeln geleitet. (2) Menschliches Verhalten ist blind, d.h. ihm geht keine Vorstellung von Regeln vorher. miteinander vereinbar sind. Denn der Begriff einer vernünftigen Fähigkeit erlaubt es uns, begreiflich zu machen, wie ein Verhalten von Regeln geleitet Handeln ohne Überlegen 219 sein kann, ohne daß ihm eine Vorstellung von Regeln vorhergeht. Dies heißt nicht, daß jemand, der eine vernünftige Fähigkeit hat, keine Vorstellung von dem hat, was er tun soll. Doch es heißt, daß die Vorstellung, die er hat, einen besonderen Charakter hat: Es ist eine Vorstellung seiner Fähigkeit, die selbst keinen Akt bezeichnet, sondern einen Aspekt seiner Fähigkeit. Die Vorstellung, die erklärt, wie er von den Regeln der Fähigkeit geleitet werden kann, ist keine Vorstellung, die er vor dem Handeln hat. Es ist auch keine Vorstellung, die er nach dem Handeln hat. Es ist vielmehr eine zeitlose Vorstellung, die er in seinem Handeln aktualisiert. Damit erklärt die Fähigkeit, Ski zu fahren, in einem Zug, weshalb das, was das Subjekt tut, rational in dem Sinne ist, daß das Subjekt hierbei von bestimmten Regeln geleitet wird, und zugleich blind in dem Sinne ist, daß es hierbei keinen Akt vollzieht, in dem es sich eine Regel vorstellt. Denn nun können wir sagen, daß rationales Handeln nicht darin besteht, daß der Skifahrer vor oder nach dem Drehschwung eine aktuale Vorstellung der Regel hat, unter die sein Handeln fällt, sondern darin, daß er eine zeitlose Vorstellung von eben jener Fähigkeit hat, die ihn in seinem Handeln leitet und die er in seinem Handeln aktualisiert. Wenn menschliches Verhalten tatsächlich so verfaßt ist, wie wir vorschlagen, d.h. in der Ausübung vernünftiger Fähigkeiten besteht, dann macht dies unmittelbar begreiflich, weshalb der Skifahrer, der eines Tages versucht, sich vor jedem Schwung die Regel vorzustellen, die diesen Schwung beschreibt, nicht mehr gut Ski fährt. Die Vorstellung des Skifahrens in Gestalt von Regeln, so haben wir gesehen, beschreibt keinen für die Fähigkeit des Skifahrens wesentlichen Akt. Sie beschreibt vielmehr einen Akt, der der Fähigkeit logisch nachträglich ist. Statt dazu beizutragen, die Fähigkeit zu bestimmen, setzt ein solcher Akt schon voraus, daß es die Fähigkeit des Skifahrens gibt. Und genau deswegen, weil ein solcher Akt gar nicht zur Fähigkeit als solcher gehört, läßt dies Spielraum für die Tatsache, daß ein solcher Akt – in bestimmten Situationen, bei bestimmten Menschen – nachgerade zerstörerisch auf die Fähigkeit wirken kann. Wer Skifahren kann, muß sich vor seinen Schwüngen keine Regel vorstellen, die ihm sagt, was er tun soll. Stellt sich jemand dann doch eine solche Regel vor, dann tut er etwas, was nicht zur Fähigkeit als solcher gehört. Und alles, was nicht zur Fähigkeit als solcher gehört, kann prinzipiell ein Hindernis für die Ausübung derselben sein. 11. Blind und rational Wenn wir unserem Vorschlag folgen, demzufolge jene Fähigkeiten, die die Blindheit menschlichen Verhaltens erklären, identisch mit vernünftigen Fähigkeiten sind, dann können wir sagen, daß menschliches Handeln von Grund 220 Andrea Kern auf sowohl rational als auch blind zugleich ist. Denn dann kann man weder sagen, die fraglichen Fähigkeiten seien eine Bedingung von Rationalität, noch, sie seien mit Rationalität logisch verknüpft. Der Grund dafür ist, daß Rationalität nach dieser Lesart gar kein von diesen Fähigkeiten verschiedenes Vermögen ist, das in einem wie auch immer gearteten Verhältnis zu diesen stehen könnte. Rationalität ist vielmehr ein Merkmal dieser Fähigkeiten selbst. Glaubt man hingegen, Rationalität sei ein von den fraglichen Fähigkeiten verschiedenes Vermögen der Vorstellung von Regeln, dann kann man die beiden obigen Sätze nicht miteinander verbinden. Es ist diese „rationalistische“ Prämisse, wie wir sie nennen wollen, die alle drei oben diskutierten Lesarten teilen und die eine Lösung des Dilemmas unmöglich macht. Der Begriff einer vernünftigen Fähigkeit, wie wir ihn oben entwickelt haben, sollte zeigen, wie wir diese Prämisse aufgeben können, ohne etwas von dem zu verlieren, was für unser Verständnis menschlicher Subjektivität wesentlich ist. Diltheys ursprüngliche Einsicht. Verstehen ist Verstehen von Ausdruck Matthias Schloßberger In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte der Versuch einer erkenntnistheoretischen Grundlegung der historischen und philologischen Wissenschaften zu der bekannten Unterscheidung von Erklären und Verstehen. Im philosophischen Sprachgebrauch bezeichnet der dem Begriff Erklären gegenübergestellte Begriff Verstehen seitdem eine besondere Form der Erkenntnis. Worin diese besondere Form der Erkenntnis bestehen soll, ist jedoch seit der Einführung der Unterscheidung umstritten. Ich möchte im folgenden zeigen, dass derjenige Autor, auf den die Unterscheidung maßgeblich zurückgeht, Wilhelm Dilthey, dem Begriff Verstehen einen Sinn gegeben hat, der im weiteren Verlauf der Geschichte des Begriffs zunächst durch die neukantianischen Alternativdeutungen, dann durch die Vereinnahmung seitens der Hermeneutik und der Geschichtswissenschaft und schließlich durch die sogenannte Erklären-Verstehen-Kontroverse der 70er Jahre und die Diskussion über die Unterscheidung von Ursachen und Gründen verdrängt wurde und dafür argumentieren, dass es gute Gründe gibt, an Diltheys ursprünglichem Begriff des Verstehens festzuhalten. In einem ersten Schritt werde ich den Beitrag von Diltheys Vorläufern diskutieren, in einem zweiten Schritt herausarbeiten, was der eigentliche Gehalt des Begriffs Verstehen bei Dilthey ist, um dann in einem dritten Schritt zu zeigen, dass dieser Gehalt auch bei vielen Autoren verloren gegangen ist bzw. nicht mehr erkannt wird, die gegenüber naturalistischen und positivistischen Versuchen einer Einebnung der Unterscheidung von Erklären und Verstehen die Besonderheit des Verstehens verteidigen. Für Dilthey ist Verstehen der Name derjenigen Form von Erkenntnis, die uns Seelisches erfahren lässt. Im Sinne dieser Begriffsbestimmung erfolgt die Unterscheidung von Verstehen und Erklären: „Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir.“1 An diese Unterscheidung schließt sich dann die _____________ 1 Wilhelm Dilthey: Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie (1894), in: ders.: Gesammelte Schriften, Band 5, Leipzig 1924, S. 139-240, hier S. 144. Matthias Schloßberger 222 Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften an. In den Naturwissenschaften erklären wir, in den Geisteswissenschaften verstehen wir. Von fundamentaler Bedeutung für die Intention von Diltheys Unterscheidung ist, dass es sich beim Verstehen und Erklären primär nicht um besondere Methoden handelt, sondern um verschiedene Zugangsweisen, die einmal den Naturwissenschaften, einmal den Geisteswissenschaften zugeordnet werden. Die „Unterscheidung in Natur- und Geisteswissenschaften“ ist „von dem Unterschiede des Inhaltes, nicht von dem der Erkenntnisweise, bestimmt“.2 Es ist ein sehr eingeschränkter Begriff von Natur, den Dilthey hier zu Grunde legt: Die Naturwissenschaften haben es in dieser Perspektive immer mit res extensa zu tun. Der Naturwissenschaftler interessiert sich lediglich für die Wirkungen, die Körper auf Körper haben. Diese Wirkungen sind unter gleichen Bedingungen immer dieselben, sie lassen sich daher als Gesetze beschreiben, die empirisch überprüft werden können. Die Vorgehensweise der Naturwissenschaften ist insofern verallgemeinernd, das Prinzip der Erklärung ist immer: Ursache und Wirkung, genannt Kausalität. Beschränkt man den Gegenstandsbereich einer Wissenschaft auf Körper, dann bleibt das Verständnis des Seelischen ausgeschlossen. Dass wir überhaupt die Erfahrung eigenen wie fremden Seelenlebens machen können, ist mit dem Begriffsapparat der Naturwissenschaften, die nur die Wirkungen von Körpern auf Körper kennen, nicht darstellbar, geschweige denn erklärbar. Diltheys Überlegungen setzten an diesem Problem an. Weil es in den historischen und philologischen Wissenschaften letztlich immer um das Verständnis fremden Seelenlebens geht, ist, so Dilthey, ein anderer Begriff von Wissenschaft nötig, denn es muss ja eine Bestimmung der besonderen wissenschaftlichen Methode erfolgen, wie fremdes Seelenleben verstanden werden kann. Dilthey machte es sich aus dieser Motivlage heraus zur Aufgabe, eine erkenntnistheoretische Grundlegung der Geisteswissenschaften zu leisten. Seine Frage lautete: Wie ist historische Erkenntnis möglich? Es war für ihn dabei selbstverständlich, dass es darum geht, das Fühlen, Wollen, Denken derjenigen Menschen zu verstehen, denen sich die historische Forschung zuwendet. Also musste seine Frage lauten: Wie können wir überhaupt etwas von fremdem Seelenleben wissen, was sind überhaupt die Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass wir etwas von den Überzeugungen, Absichten und Gefühlen Anderer wissen können? Dilthey hat sich diese Fragen vorgenommen und ist dann zu der Überzeugung gekommen, dass es ganz verschiedene Zugangsweisen sind, mit denen wir uns den zu erforschenden Gegenständen zuwenden können. Die Naturwissenschaften beschäftigen sich mit Physischem, die Geisteswissenschaften hingegen mit Psychischem. _____________ 2 Wilhelm Dilthey: Beiträge zum Studium der Individualität (1895/96), in: ders.: Gesammelte Schriften, Band V, Einleitung in die Philosophie des Lebens, a.a.O., S. 241-316, hier S. 252. Diltheys ursprüngliche Einsicht. Verstehen ist Verstehen von Ausdruck 223 In dieser Gegenüberstellung von Natur- und Geisteswissenschaften liegt etwas Problematisches, das Dilthey bereits selbst gesehen hat. In der Psychologie (verstanden als Wissenschaft vom Bewusstsein), die sich eigentlich mit dem Psychischen beschäftigt, wird das Psychische in der Regel wie etwas Physisches behandelt und erforscht. Umgekehrt gibt es Naturwissenschaften, wie die vergleichende Verhaltensforschung oder die evolutionäre Anthropologie, die verstehende Wissenschaften sind und sich nicht oder nur sekundär darum kümmern, wie sich z. B. das Arbeiten des Gehirns durch bildgebende Verfahren erklären lässt. Dilthey hat im Laufe seines Schaffens zahlreiche Versuche – genauer gesagt: neue Anläufe – unternommen, der Frage nachzugehen, wie wir etwas von fremden Seelenleben wissen können. Dabei favorisierte er in „Der Einleitung in die Geisteswissenschaften“ (1878) und anderen frühen Texten zunächst noch ganz von dem Paradigma der Naturwissenschaften ausgehend eine Lösung, die man als Analogieschluss vom fremden mir ähnlichen Körper auf seelische Vorgänge bezeichnen kann. Später erkannte er dann klar, dass diese Erklärung zirkulär ist. In den Arbeiten, die in den geplanten 2. Band der „Einleitung in die Geisteswissenschaften“ einfließen sollten, aber erst nach seinem Tod 1927 unter dem Titel „Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften“ von Bernhard Groethuysen herausgegeben wurden, entwickelte er die Idee, dass Verstehen keinen Umweg über die Wahrnehmung von Körpern gehen muss, sondern direkt am Ausdrucksverhalten ansetzt, und als unmittelbare, d.h. nicht von anderen ableitbare Erfahrung gedacht werden muss.3 Vorläufer: Verstehen bei Friedrich August Wolf und Johann Gustav Droysen Bevor es darum geht, wie in den Diskussionen nach Dilthey der Begriff Verstehen in der Regel in einem deutlich von Dilthey abweichenden Sinn verwendet wird,4 soll gezeigt werden, wie der Begriff „Verstehen“ bereits vor _____________ 3 4 Vgl. Matthias Schloßberger: Die Erfahrung des Anderen. Gefühle im menschlichen Miteinander, Berlin 2005, Kap. 3: Weder Einfühlung noch Analogieschluß, S. 77-108. Der Gedanke einer unmittelbaren Erfahrung des Anderen, die am Ausdrucksverhalten ansetzt, wurde nach Dilthey systematisch von Max Scheler weiterentwickelt, allerdings spielt der Begriff Verstehen bei ihm keine terminologisch bedeutende Rolle mehr. Vgl. die Materialsammlung, die Karl-Otto Apel zusammengestellt hat: Karl-Otto Apel: Das Verstehen. Eine Problemgeschichte als Begriffsgeschichte, in: Archiv für Begriffsgeschichte. Bausteine zu einem historischen Wörterbuch der Philosophie, Band 1, Bonn 1955, S. 142-199. Leider thematisiert Apel überhaupt nicht, was für strategische Annahmen hinter bestimmten Umdeutungen stehen, die der Begriff „Verstehen“ Matthias Schloßberger 224 Dilthey eine ausgezeichnete Bedeutung bekommen hat.5 Schon vor Droysens berühmter „Historik“ wurde in der Hermeneutik mitunter zwischen Verstehen und Erklären unterschieden, so z.B. bei Friedrich Ast6 und Friedrich August Wolf, allerdings in einer anderen Weise als später bei Droysen, dessen Unterscheidung der Unterscheidung von Geistes- und Naturwissenschaften korrespondiert. Friedrich August Wolf, an dessen Ausführungen ich mich ausschließlich halte, bestimmt das Wesen der Hermeneutik wie folgt: Die Hermeneutik oder Erklärungskunst lehrt uns, die Gedanken eines Andern aus ihren Zeichen zu verstehen und zu erklären. Man versteht Jemanden, der uns Zeichen giebt, dann, wenn diese Zeichen in uns eben dieselben Gedanken und Vorstellungen und Empfindungen, und in eben der Ordnung und Verbindung hervorbringen, wie sie der Urheber selbst in der Seele gegenwärtig hatte. Denkt man an spätere Versuche, den Begriff der Hermeneutik zu bestimmen, dann fällt eines auf: Es geht hier auch um das Problem des Fremdverstehens überhaupt, nicht bloß um eine Lehre, wie Sprache bzw. Schrift oder andere Kunstwerke auszulegen sind. Wolf unterscheidet zwischen Verstehen und Erklären, um diesen Unterschied zu markieren, d.h. den Unterschied zwischen dem Problem des Fremdverstehens überhaupt und der besonderen Fähigkeit, das verstandene Fühlen und Denken eines Anderen in einen Zusammenhang zu bringen und zu interpretieren: Wenn das Erklären der Zeichen so viel ist, als die Ideen und Empfindungen eines Andern aufzustellen, so kann es im Gemüthe selbst geschehen, oder durch eine wirkliche mündliche oder schriftliche Erklärung. Im ersten Fall versteht man, im zweiten Fall erklärt man. Jenes muss zum Grunde liegen; wir müssen vorher die Ideen deutlich fassen. Niemand kann interpretari, nisi subtiliter intellexerit. Allein auch nicht immer wird es der Fall seyn, dass der, welcher versteht, sich deutlich machen könne durch Erklärung. Deutlicher noch wird der Gedanke in folgender Passage, in der Wolf schreibt, die Hermeneutik fordere zweierlei: verstehen und erklären. Verstehen heisst, etwas gerade so fassen, wie es der Andere gefasst hat. Dies ist intelligere und geschieht es mit einer besonderen Feinheit, so heisst es subtilitas intelligendi. Zum subtilen, ganz gründlichen Verstehen muss ich den Gedanken völlig so auffassen, wie der Andere. Hiezu ist aber eine bloße Uebersetzung _____________ 5 6 erfahren hat, und kann so auch nicht sichtbar machen, welche Probleme und Fragestellungen sich verschoben haben bzw. verschwunden sind. Vgl. in allgemeiner Perspektive: Joachim Wach: Das Verstehen. Grundzüge einer Geschichte der hermeneutischen Theorie im 19. Jahrhundert, 3 Bände, Tübingen 1926-1933. Friedrich Ast: Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik, Landshut 1808. Diltheys ursprüngliche Einsicht. Verstehen ist Verstehen von Ausdruck 225 nicht ausreichend. Erklären heisst den einzig wahren Sinne eines Satzes mit seinen Gründen und Beweisen aufstellen.7 Was Wolf hier als Erklären beschreibt, fällt bei den meisten Autoren ebenfalls unter den Begriff Verstehen, wobei der Unterschied zwischen den beiden Phänomenen nicht nur begrifflich, sondern auch sachlich oft verloren geht wie später gezeigt wird. Nicht so bei Dilthey, bei ihm findet sich der Unterschied der Sache nach und wird auch begrifflich benannt, jedoch anders als bei Wolf. Dilthey spricht von elementarem und höherem Verstehen, um deutlich zu machen, dass wir zunächst verstehen müssen, dass da überhaupt ein Anderer ist, der etwas fühlt, um dann fragen zu können, warum er dieses und jenes fühlt. Um dies an einem Beispiel zu erläutern: Bevor wir verstehen können, dass ein kleines Kind traurig ist, weil es sein Spielzeug verloren hat, müssen wir verstanden haben, dass es traurig ist, denn nur dann können wir nach dem warum fragen. Eine andere Unterscheidung von Erklären und Verstehen findet sich bei Johann Gustav Droysen. Dilthey konnte in seinem Versuch einer erkenntniskritischen Grundlegung der Geisteswissenschaften bereits auf verschiedene Vorgaben zurückgreifen, die Droysen in seiner 1858 zum ersten mal erschienenen „Historik“ gemacht hatte. Vielleicht ist Droysen auch der erste gewesen, der an die Begriffe Erklären und Verstehen zwei zu unterscheidende Formen des Erkennens geknüpft hat: d.h. der erste, der die beiden Begriffe der Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften korrespondieren lässt. Allerdings unterscheidet Droysen noch drei Formen der Erkenntnis: Nach den Objekten und nach der Natur des menschlichen Denkens sind die drei möglichen wissenschaftlichen Methoden: die (philosophisch oder theologisch) spekulative, die physikalische, die historische. Ihr Wesen ist: zu erkennen, zu erklären, zu verstehen. Was bedeutet nun Verstehen für Droysen? Warum ist es das „Wesen der historischen Methode“ forschend zu verstehen? Zunächst fragt Droysen nach den Bedingungen, die vorausgesetzt werden müssen: „Die Möglichkeit des Verstehens besteht in der uns kongenialen Art der Äußerungen, die als historisches Material vorliegen.“ Die Rede von kongenialen Äußerungen verweist auf zweierlei: zum einen muss mir derjenige, den ich verstehe, irgendwie ähnlich sein, zum anderen müssen seine Äußerungen nachvollzogen werden. Was verstanden wird, muss selbst erlebt werden: Die Möglichkeit des Verstehens ist dadurch bedingt, dass die geistig-sinnliche Natur des Menschen jeden inneren Vorgang zu sinnlicher Wahrnehmbarkeit äussert, in jeder Aeusserung innere Vorgänge spiegelt. Wahrgenommen erregt die Aeusserung, sich in _____________ 7 Friedrich August Wolf’s Vorlesungen über die Alterthumswissenschaft, Erster Band, Vorlesung über die Encyclopädie der Alterthumswissenschaft, hrsg. von J. D. Gürtler, Leipzig 1831, die Zitate: S. 272, 274, 293. 226 Matthias Schloßberger das Innere des Wahrnehmenden projizierend, den gleichen inneren Vorgang. Den Schrei der Angst vernehmend, empfinden wir die Angst des Schreienden u. s. w.8 Verstehen bedeutet für Droysen nicht ein bloßes Wissen, was der Andere gedacht oder gefühlt hat, sondern einen Vorgang, in dem die Qualität des fremden Fühlens und Denkens selbst erlebt wird. Diese Form des Wissens, die einem quasi unmittelbar das fremde Bewusstseinserlebnis vergegenwärtigt, setzt Ähnlichkeit zwischen dem, der versteht, und dem, der verstanden wird, voraus. Ohne dies näher auszuführen, nimmt Droysen hier einen Gedanken in Anspruch, der zu seiner Zeit so etwas wie eine alltagsmetaphysisch geteilte Grundüberzeugung war. Wilhelm von Humboldt hat sie in seiner Abhandlung Über die Aufgabe des Geschichtschreibers (1822) so ausgedrückt: Jedes Begreifen einer Sache setzt als Bedingung seiner Möglichkeit in dem Begreifenden schon ein Analogon des nachher wirklich Begriffenen voraus, eine vorhergängige, ursprüngliche Übereinstimmung zwischen dem Subjekt und Objekt. Der hier formulierte hermeneutische Zirkel ist noch ganz anthropologisch zu verstehen: Menschen können sich verstehen, weil sie sich ähnlich sind: Wo zwei Wesen durch eine gänzliche Kluft getrennt sind, führt keine Brücke der Verständigung von einem zum andern, und um sich zu verstehen, muß man sich in einem andern Sinn schon verstanden haben.9 Auf der eine Seite erscheint Droysens These attraktiv, dass Verstehen mehr ist als bloßes Wissen von den Gedanken und Gefühlen Anderer: Wenn wir von einem Dritten erzählt bekommen, dass einem Anderen dieses oder jenes zugestoßen ist, und wir seinem Bericht vertrauen, so haben wir ein sehr abstraktes Wissen von dem, was dem Anderen zugestoßen ist, und dem, was er gefühlt und gedacht hat. Ganz anders verhält es sich, wenn wir vor dem Andern stehen und unmittelbar erleben, d.h. mit den eigenen Sinnen wahrnehmen, was er denkt und fühlt, oder wenn wir uns die Situation des nicht unmittelbar anwesenden Anderen so vergegenwärtigen, als ob wir unmittelbar von Angesicht zu Angesicht sein Schicksal erleben und an ihm teilnehmen würden. Zweifellos gibt es diesen Unterschied. Aber auf der anderen Seite erweist sich Droysens Beschreibung, wie wir das Fühlen und Denken des Anderen verstehen können, als problematisch: „den Schrei der Angst vernehmend“ fühlen wir nicht dieselbe Angst, wie derjenige, den es zu verstehen gilt. In den Fällen, in denen wir dieselbe bzw. eine ähnliche Angst fühlen, handelt es sich nicht um Verstehen, sondern um ein Form von Gefühlsansteckung, die noch _____________ 8 9 Johann Gustav Droysen: Historik: Historisch-kritische Ausgabe, hrsg. von Peter Leyh, Band 1: Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung der Vorlesungen (1857). Grundriß der Historik in der ersten vollständigen Fassung der Vorlesungen (1857/58) und in der letzten gedruckten Fassung (1882), Stuttgart-Bad Cannstatt 1977, die Zitate: § 14, S. 424, § 8-10, S. 423. Wilhelm von Humboldt: Über die Aufgabe des Geschichtschreibers [1822], in: ders.: Ausgewählte Schriften, Berlin 1917, S. 19-43, hier S. 32. Diltheys ursprüngliche Einsicht. Verstehen ist Verstehen von Ausdruck 227 nichts mit Verstehen zu tun hat, weil nur ein mehr oder weniger ähnliches Gefühl vorliegt, das aber nicht von der Erfahrung begleitet werden muss: dieses Gefühl ist eigentlich das Gefühl eines Anderen.10 Wie immer auch der genaue Sinn dieser Passage zu verstehen ist. Der Zusammenhang zwischen Ausdruck und Erlebnis, den Droysen beschreibt, ist ohne Zweifel vorhanden. Das Nachmachen der fremden Ausdrucksbewegung kann ein dem Gefühl des Anderen ähnliches Gefühl erzeugen. Eigentliches Verstehen aber würde verlangen, das Gefühl des Anderen zu erfahren im Bewusstsein des Anderen als Anderen. Ohne Droysen namentlich zu nennen, hat Nietzsche treffend das Problem von Droysens Beschreibung analysiert: Mitempfindung. – Um den Anderen zu verstehen, das heisst um sein Gefühl in uns nachzubilden, gehen wir zwar häufig auf den Grund seines so und so bestimmten Gefühls zurück und fragen zum Beispiel: warum ist er betrübt? – um dann aus dem selben Grunde selber betrübt zu werden; aber viel gewöhnlicher ist es, dies zu unterlassen und das Gefühl nach den Wirkungen, die es am Anderen übt und zeigt, in uns zu erzeugen, indem wir den Ausdruck seiner Augen, seiner Stimme, seines Ganges, seiner Haltung (oder gar deren Abbild in Wort, Gemälde, Musik) an unserem Leibe nachbilden mindestens bis zu einer leisen Ähnlichkeit des Muskelspiels und der Innervation). Dann entsteht in uns ein ähnliches Gefühl, in Folge einer alten Association von Bewegung und Empfindung, welche darauf eingedrillt ist, rückwärts und vorwärts zu laufen.11 Das Verstehen läuft leer und bleibt bei sich. Verstehen des Anderen verlangt mehr als bloße Mitempfindung oder Ansteckung. Dilthey: Erlebnis – Ausdruck – Verstehen In den „Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie“ (1894) stellt Dilthey zum ersten Mal die Bedeutung des Verstehens deutlich heraus. Verstehen ist für Dilthey Auffassen von Psychischem, von Eigenpsychischem wie von Fremdpsychischem – wobei die Rede vom Fremdpsychischen in einem umfänglichen Sinn gemeint ist und alles Lebendige umfasst, sofern es beseelt ist. Dilthey unterscheidet eine erklärende oder konstruktive Psychologie, die versucht, die Erscheinungen des Seelenlebens in Kausalzusammenhänge aufzulösen und dann Schritt für Schritt zu konstruieren, indem einzelne Elemente isoliert und in ihrer Wirkung aufeinander untersucht werden, von einer beschreibenden und zergliedernden Psychologie, die von den erlebten Zusammenhängen ausgeht, und von einem Ganzen ausgehend analysiert bzw. zergliedert. _____________ 10 11 Die Verwechslung von Gefühlsansteckung und Verstehen des Anderen ist klar herausgearbeitet bei: Max Scheler: Wesen und Formen der Sympathie, Bonn 1923, S. 112-115. Friedrich Nietzsche: Morgenröthe 142, in: KSA 3, München 1980, S. 133. Matthias Schloßberger 228 Eine Psychologie, so Dilthey, die alle Vorgänge des Seelenlebens erklären möchte, indem sie die Konstitution des Seelischen aus körperlichen Bestandteilen, die kausal aufeinander wirken, hervorgehen lässt, wird auf diesem Wege niemals zum Bewusstsein, niemals zum Erlebniszusammenhang kommen, weil sie in ihren Begriffen das, was sie erklären will und immer schon in Anspruch nimmt, nicht ausweisen kann: „Durch bloße Hypothesen wird aus psychischen Elementen und den Prozessen zwischen ihnen das Selbstbewußtsein abgeleitet.“ Da in den Begriffen der Naturwissenschaft, die nur die Wirkungen von Körpern auf Körper kennt, die Erfahrung von Geistigem bzw. Seelischem nicht fassbar ist, bietet sich für diese Erfahrung ein eigener Name an: Verstehen – und korrelierend der Begriff Geisteswissenschaften: Nun unterscheiden sich zunächst von den Naturwissenschaften die Geisteswissenschaften dadurch, daß jene zu ihrem Gegenstand Tatsachen haben, welche im Bewußtsein als von außen, als Phänomene und einzeln gegeben auftreten, wogegen sie in diesen von innen, als Realität und als ein lebendiger Zusammenhang originaliter auftreten.12 Mit anderen Worten: Die Erfahrung von Psychischem muss als ursprünglich gegeben angenommen werden. Sie lässt sich aus keiner anderen Erfahrung ableiten. Die Naturwissenschaft, so Dilthey in den „Beiträgen zum Studium der Individualität“ (1895), kann immer nur den Kausalzusammenhang von Körpern erklären, d.h. sie behandelt immer nur „die physische Repräsentation in Gehirn und Nervensystem“. Einen „lückenlosen Zusammenhang des ganzen physischen Geschehens nach Gesetzen“ kann sie nur durch die rein hypothetische Annahme erreichen, dass „alle seelischen Äquivalente nur Begleiterscheinungen sind, deren physische Äquivalente dem Naturlauf eingeordnet werden können“. Selbstverständlich sei mit dem Unterschied von Natur- und Geisteswissenschaften keine Unterscheidung zweier Klassen von Objekten gemeint. Es ist dasselbe Objekt, das wir einmal als physischen Körper, einmal als geistiges, beseeltes Objekt betrachten können. Im einen Fall erklären wir, im anderen Fall verstehen wir.13 _____________ 12 13 Dilthey: Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie, a. a. O., S. 143. Es ist ein fundamentales Mißverständnis von Diltheys Denken, wenn man wie z. B. Lessing in den Geisteswissenschaften die Wissenschaften vom Menschen (und des vom menschlichen Geist Geschaffenen) sieht und so die Abgrenzung zu den Naturwissenschaften als denjenigen Wissenschaften zieht, die sich mit allem beschäftigen, was unabhängig vom menschlichen Geist entstanden ist. Vgl. Hans-Ulrich Lessing: Der Zusammenhang von Leben, Ausdruck und Verstehen. Diltheys späte hermeneutische Grundlegung der Geisteswissenschaften, in: Gudrun Kühne-Bertram / Frithjof Rodi (eds.): Dilthey und die hermeneutische Wende in der Philosophie. Wirkungsgeschichtliche Aspekte seines Werkes, Göttingen 2008, S. 57-77, hier S. 73. Für Dilthey sind die Geisteswissenschaften die Wissenschaften vom Lebendigen überhaupt: Leben versteht Leben. Für Dilthey gilt: Wir verstehen auch andere Lebewesen nur, weil sie in ihrem Verhal- Diltheys ursprüngliche Einsicht. Verstehen ist Verstehen von Ausdruck 229 Sofern es nicht um die eigenen psychischen Gehalte, sondern um diejenigen von Anderen geht, hat Dilthey zunächst noch die Notwendigkeit gesehen, wie eingangs bereits angedeutet, den Umweg über die Wahrnehmung des fremden Körpers zu nehmen: Im Unterschied von den Naturwissenschaften entstehen Geisteswissenschaften, weil wir genötigt sind, in tierische und menschliche Organismen ein seelisches Geschehen zu verlegen. Von dem, was in unserer inneren Wahrnehmung uns gegeben ist, übertragen wir in sie auf Grund ihrer Lebensäußerungen ein Analogon.14 Dilthey argumentiert hier noch ganz von cartesianischen Prämissen ausgehend: Weil in der cartesianischen Tradition das Psychische mit dem identifiziert wird, was im Bewusstsein erlebt wird, muss das Verstehen des Fremdpsychischen von ganz anderer Art sein als das Verstehen des Eigenpsychischen: es muss indirekt und mittelbar sein. Vom cartesianischen Standpunkt der unmittelbaren Selbstgegebenheit des Psychischen ausgehend kann das Verstehen des Anderen nur durch ein Hineinverlegen der eigenen psychischen Gehalte in den Anderen, durch Einfühlung, oder – abstrakter – durch Analogieschlüsse geleistet werden. Eine Erklärung dieser Art steht bekanntlich vor großen Problemen. Denn es ist völlig unklar, was ein ego, das noch nicht die Erfahrung eines alter ego gemacht hat, dazu motivieren sollte, einen Körper qua Einfühlung oder Analogieschluss zu beseelen. Und selbst wenn dies auf wundersame Weise möglich wäre: würde die Erfahrung des Anderen in einem Hineinverlegen der eigenen psychischen Gehalte in den Körper des Anderen bestehen, so würden wir letztlich immer nur uns selbst verstehen, niemals aber den Anderen in seiner Individualität. Auch wenn Diltheys bisher diskutierte Arbeiten die aufgezeigten Probleme aufweisen, bleibt eine wichtige Leistung festzuhalten: Verstehen meint nicht nur, das, was ein Anderer fühlt oder denkt, zu verstehen, sondern ineins die Erfahrung des Anderen, den es zu verstehen gilt: Verstehen ist der Vorgang, „in welchem wir aus sinnlich gegebenen Zeichen ein Psychisches, dessen Äußerung sie sind, erkennen“. Ein Psychisches erkennen, heißt: die Erfahrung zu machen: da ist ein anderes ich, ein anderes Lebewesen, fremde Subjektivität. Bevor man sich der Aufgabe des hermeneutischen bzw. kunstmäßigen Verstehens stellen kann, d.h. der Auslegung und Interpretation von „dauernd fixierten Lebensäußerungen“,15 muss zunächst die Erfahrung des Anderen gemacht werden, muss die intersubjektive Sphäre der other minds erreicht werden. Bevor größere Zusammenhänge verstanden werden können, _____________ 14 15 ten einen Ausdruck zeigen. Verstehen ist also nur dann möglich, wenn die Struktur des Seelenlebens ähnlich ist. Dilthey: Beiträge zum Studium der Individualität (1895/96), a. a. O., S. 248 f. Wilhelm Dilthey: Die Entstehung der Hermeneutik (1900), in: ders.: Gesammelte Schriften Band VII, a.a.O., S. 317-338, hier S. 318 f. 230 Matthias Schloßberger müssen die einzelnen Gehalte verstanden werden. Bevor man die Frage stellt, warum einer traurig ist, muss man verstanden haben, dass er traurig ist. In der weiteren Geschichte der Hermeneutik im 20. Jahrhundert wurde Verstehen häufig als Verstehen von Sinn und Bedeutung bzw. als Verstehen von Gründen bestimmt. In einer so verstandenen Hermeneutik geht nicht nur eine wichtige Dimension von Diltheys Begriff des Verstehens verloren, sondern seine zentrale Bedeutung. In seiner erstmals 1927 aus dem Nachlass edierten Arbeit „Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften“ findet sich ein neuer Anlauf, in dem die cartesianischen Prämissen der früheren Arbeiten überwunden werden. Der entscheidende neue Gedanke besteht darin, Erlebnis und Ausdruck konsequent als zwei Aspekte eines Sachverhaltes zu verstehen. Dilthey sieht deutlich die Grenzen einer introspektiven Selbsterkenntnis, weil auch das Selbstverstehen am Ausdruck ansetzt. D.h. in der Regel sind Fremdund Selbstverstehen ganz ähnlich. Wir verstehen auch unsere eigenen Gemütsbewegungen nur, insofern sie im Verhalten erkennbar sind. Was wir einmal waren, so Dilthey, erfahren wir, wenn wir uns mit uns selbst wie mit einem Anderen beschäftigen. Dilthey spricht von einer Trias Erlebnis – Ausdruck – Verstehen um die These, dass alles Verstehen am Verhalten ansetzt, zu erläutern und sieht so den Gegenstandsbereich der Geisteswissenschaften klar definiert: So ist überall der Zusammenhang von Erleben, Ausdruck und Verstehen das eigene Verfahren, durch das die Menschheit als geisteswissenschaftlicher Gegenstand für uns da ist. Die Geisteswissenschaften sind so fundiert in diesem Zusammenhang von Leben, Ausdruck, Verstehen. Hier erst erreichen wir ein ganz klares Merkmal, durch welches die Abgrenzung der Geisteswissenschaften definitiv vollzogen werden kann. Eine Wissenschaft gehört nur dann den Geisteswissenschaften an, wenn ihr Gegenstand uns durch das Verhalten zugänglich wird, das im Zusammenhang von Leben, Ausdruck und Verstehen fundiert ist.16 Von der Urtatsache des Psychischen bzw. des Lebendigen ausgehend erschließen sich dann weitere Typen von Erfahrung, die nur innerhalb der Geisteswissenschaften behandelt werden können. Nur für Lebewesen gibt es Bedeutung, Werte, Gründe: Historisches Verstehen ist das Verstehen von Wirkungszusammenhängen. Es unterscheidet sich von den Kausalzusammenhängen der Natur insofern, als „nach der Struktur des Seelenlebens Werte erzeugt und Zwecke realisiert“ werden.17 Was meint Dilthey nun, wenn er von Ausdruck in dem ausgezeichneten Sinn der Trias von Erlebnis – Ausdruck – Verstehen spricht? Ausdruck meint hier nicht, dass ein Inneres nach Außen tritt, wenn man unter Innerem res _____________ 16 17 Wilhelm Dilthey: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, in: ders.: Gesammelte Schriften, Band VII, a.a.O., S. 79-188, hier S. 87. Ebd., S. 153. Diltheys ursprüngliche Einsicht. Verstehen ist Verstehen von Ausdruck 231 cogitans und unter Äußerem res extensa versteht. Innen und Außen sind hier allenfalls Metaphern für zwei Perspektiven auf eine Sache. Wäre dem nicht so, d.h. gäbe es ein X, für das mal dieser mal jener Ausdruck verwendet wird (z.B. in Abhängigkeit eines bestimmten kulturellen Umfeldes), dann wäre alles Ausdrucksverhalten nichts anderes als nonverbale Sprache. Natürlich gibt es Ausdrucksverhalten in nonverbalen Zeichensystemen, die genauso wie verbale Zeichensysteme funktionieren. Kopfschütteln bedeutet in manchen Kulturen „Ja“, in anderen „Nein“. Aber nicht jedes Ausdrucksverhalten lässt sich als Zeichensprache verstehen. Es gilt hier, nicht konventionellen und konventionellen Ausdruck zu unterscheiden.18 Wenn das Verstehen von Ausdruck den ursprünglichsten Modus von Intersubjektivität bezeichnet, d.h. wenn im Verstehen von Ausdruck die Erfahrung eines alter ego gemacht wird, dann hat dies weitreichende Konsequenzen für eine Theorie der Intersubjektivität, die nach allen möglichen Formen der Begegnung im Bewusstsein des Anderen als Anderen fragt: Der Sphäre intersubjektiven Verstehens qua Sprache ist für Dilthey eine Sphäre des intersubjektiven Verstehens von Ausdrucksverhalten vorgelagert. Jede Theorie der Intersubjektivität, die erst mit der Sprache ansetzt, wäre also zu allgemein, da sie die für Menschen typische Form der Intersubjektivität nicht ausweist. Schließlich könnte man sich auch Wesen denken, die qua Sprache kommunizieren, aber kein Ausdrucksverhalten zeigen. Allerdings wäre es schwer vorstellbar, wie es möglich sein soll, dass diese Wesen, wenn sie nicht immer schon sprechen können, eine Sprache lernen bzw. in eine Sprache hineinsozialisiert werden. Die fundamentale Bedeutung des Ausdrucks in Diltheys Theorie wird vielleicht noch deutlicher, wenn man die verschiedenen Formen des Verstehens analysiert. Dilthey unterscheidet ein elementares Verstehen und ein höheres Verstehen: Im elementaren Verstehen findet ein Rückgang auf das Ganze des Lebenszusammenhangs nicht statt. Sein Grundverhältnis „ist das des Ausdrucks zu dem, was in ihm ausgedrückt ist“.19 Ein Beispiel für einen Fall elementaren Verstehens ist der einfache Fall der Wahrnehmung eines Gemütszustandes: Im Lachen des Kindes sehe ich seine Fröhlichkeit. Es ist diese _____________ 18 19 Vgl. meinen Aufsatz: Über die Bedeutung der Kategorie des Ausdrucks für die Philosophische Anthropologie, in: Accarino / Schloßberger (eds.): Expressivität und Stil. Helmuth Plessners Sinnes- und Ausdrucksphilosophie (Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie, Band 1), Berlin 2008, S. 209-218, sowie meine Rekonstruktion: Die Erfahrung des Anderen, a. a. O. In den letzten Jahren gibt es von ganz verschiedenen Seiten ausgehend eine starke Renaissance des Themas. Vgl. für die Tradition der Philosophischen Anthropologie und der Lebensphilosophie: Norbert Meuter: Anthropologie des Ausdrucks. Die Expressivität des Menschen zwischen Natur und Kultur, München 2006; für die Tradition der Phänomenologie: Dan Zahavi: Expression and Empathy, in: M. Ratcliffe / D. Hutto (eds.): Folk Psychology Re-Assesed, S. 25-40. Wilhelm Dilthey: Das Verstehen anderer Personen und ihrer Lebensäußerungen (1910), in: ders.: Gesammelte Werke, Band VII, a.a.O., S. 207 f. Matthias Schloßberger 232 Erfahrung, in der der Andere überhaupt erst als alter ego wahrgenommen wird. Habe ich diese Erfahrung gemacht, kann ich das weitere Verhalten beobachten und nach den Gründen der Fröhlichkeit fragen. Ich kann das Verhalten eines Anderen in immer größeren Zusammenhängen bis hin zu einer ganzen Lebensgeschichte sehen. Höheres Verstehen setzt elementares Verstehen voraus: „Das Verfahren beruht auf dem elementaren Verstehen, das gleichsam die Elemente für die Rekonstruktion zugänglich macht“.20 Das Verstehen von Texten, das historische Verstehen ist höheres Verstehen, aber: es ist immer fundiert in elementarem Verstehen. Verstehen nach Dilthey Diltheys Unterscheidung von Erklären und Verstehen war ausgesprochen erfolgreich. Zwar ist sie immer wieder in Frage gestellt worden, aber letztlich haben – so mein Eindruck – diejenigen, die sie verteidigt haben, mit guten Gründen recht behalten. Allerdings ist, so möchte ich im folgenden zeigen, der eigentliche Sinn, den Dilthey dem Begriff Verstehen gegeben hatte, verloren gegangen. Eine erste Umdeutung fand bei den Neukantianern statt. Wilhelm Windelband hatte in seiner berühmten Rede „Geschichte und Naturwissenschaft“ noch vor Diltheys „Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie“, die im selben Jahr 1894 erschien, nach dem prinzipiellen Unterschied zwischen Natur- und Geisteswissenschaften gefragt. Einteilungsprinzip, so Windelband, sei der formale Charakter der jeweiligen Erkenntnisziele: Die einen suchen allgemeine Gesetze, die anderen besondere geschichtliche Tatsachen: in der Sprache der formalen Logik ausgedrückt, ist das Ziel der einen das generelle apodiktische Urteil, das der anderen der singulare, assertorische Satz. Diese Unterscheidung fixierte Windelband begrifflich, als er die naturwissenschaftlichen Disziplinen als nomothetische und die historischen als idiographische bezeichnete. Obgleich Windelband immer wieder erwähnt wird, wenn es um die Unterscheidung von Erklären und Verstehen geht, kommen beide Begriffe bei ihm überhaupt nicht vor.21 Heinrich Rickert nahm dann in seiner Methodenschrift „Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft“ eine Windelbands Unterscheidung nomothetisch/idiographisch aufgreifende neue Bestimmung der Begriffe Erklären und Verstehen vor, die explizit gegen Dilthey gerichtet war. Auch für ihn zeichnen sich die Naturwissenschaften dadurch aus, dass sie kausal erklärend Wirkun_____________ 20 21 Ebd., S. 212 Wilhelm Windelband: Geschichte und Naturwissenschaft (1894), in: ders.: Präludien, Zweiter Band, Tübingen 1924, S. 136-161, das Zitat S. 144. Diltheys ursprüngliche Einsicht. Verstehen ist Verstehen von Ausdruck 233 gen der Körperwelt untersuchen. Rickert versuchte jedoch die Unterscheidung von Natur und Geist (wie er in der Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaft zum Ausdruck kommt) durch die Unterscheidung Natur und Kultur bzw. Natur- und Kulturwissenschaft zu ersetzen. Dahinter steckte begriffspolitische Absicht. Rickert wollte den Begriff der Geisteswissenschaften nicht als Gegenbegriff zu dem der Naturwissenschaft gelten lassen. Gegen Dilthey wandte er ein, dass man das Psychische doch auch als Natur betrachten könne. So kam er zu dem Schluss, dass sich die verschiedenen Wissenschaften in einer Hinsicht unterscheiden, die sich nicht auf die Unterscheidung von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft abbilden lasse: Die Methodenlehre, so Heinrich Rickert, hat vielmehr zu beachten, daß die einen Disziplinen es mit der wert- und sinnfreien Natur zu tun haben, die sie unter allgemeine Begriffe bringen, die anderen dagegen die sinnvolle und wertbezogene Kultur darstellen und sich deshalb mit dem generalisierenden Verfahren nicht begnügen.22 In der Sphäre der Kultur haben die Objekte einen Sinn bzw. eine Bedeutung, in der Sphäre der Natur hingegen muss alles sinn- und bedeutungslos sein. In der Perspektive, in der die Naturwissenschaften ihre Objekte betrachten, gibt es keine Werte. Rickerts Unterscheidung war insofern sehr erfolgreich, als sie von Max Weber übernommen wurde und bis heute in den Sozialwissenschaften wirkungsmächtig ist.23 Im Grunde wurde bereits hier die in den 70er und 80er Jahren geführte Debatte um die Unterscheidung von Gründen und Ursachen vorweggenommen.24 Ein typisches Beispiel aus der Ursachen-versusGründe-Debatte zeigt die Ähnlichkeit der Problemlage: Wenn die Handlung einer Person erklärt werden soll, dann ist in der Perspektive einer Naturwissenschaft, die nur die Wirkungen von Körpern auf Körper kennt, allein die Abfolge bestimmter physiologischer Zustände des Körpers interessant. Ein Zustand verursacht kausal den nächsten etc. In dieser Perspektive können die Gründe, die eine Person zu einer Handlung veranlassen bzw. während einer Handlung diese vorantreiben oder unterbrechen, begrifflich nicht gefasst werden. Möglicherweise motivieren sie den Hirnforscher, nicht beliebige Hirnzustände zu untersuchen, sondern ganz bestimmte, z.B. diejenigen, die angenehmen oder unangenehmen Erlebnissen korrespondieren, aber die reine _____________ 22 23 24 Heinrich Rickert: Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Vorwort zur sechsten und siebten Auflage, Tübingen 1926, S. XI. Vgl. auch: ders.: Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften, 3. u. 4. verbesserte und ergänzte Auflage, Tübingen 1921. Max Weber: Ueber einige Kategorien der verstehenden Soziologie (1913), in: ders.: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1922, S. 403-450. Vgl. z.B. die Arbeiten von Davidson und von Wright: Donald Davidson: Handlung und Ereignis, Frankfurt a. M. 1985; Georg Henrik von Wright: Erklären und Verstehen, Königstein im Taunus 1974. 234 Matthias Schloßberger Sicht auf einen physiologischen Zustand, d.h. einen Körper, wird niemals mit einer Wertung, d.h. mit Sinn oder Bedeutung verbunden sein. Weil unser Fühlen, Wollen, Denken mit Sinn und Bedeutung verknüpft ist, sprechen wir von Gründen. Sobald wir die Perspektive des Selbst- oder Fremdverstehens verlassen und die unseren Handlungen korrespondierenden Körperzustände untersuchen, gibt es aber weder Sinn noch Bedeutung noch Gründe. Jeder Versuch, in einem körperlichen Zustand, z.B. demjenigen, der einem Handlungsentschluss korrespondiert, den Handlungsentschluss selbst zu sehen, ist zirkulär: Jeder Hirnforscher muss, bevor er untersucht, wie eine Folge von körperlichen Zuständen eine Handlung ergibt, eine Kenntnis von dieser Handlung haben. Diese Kenntnis muss vorgängig sein. Auf keinen Fall läßt sich diese Kenntnis verstehen, wenn man nur mit dem Prinzip von Ursache und Wirkung operiert. Den Grund einer Handlung zu verstehen ist etwas völlig anderes als die Kausalkette von physiologischen Zuständen zu rekonstruieren. Ein für Gründe blinder Hirnforscher könnte sehr wohl seiner Arbeit nachgehen, aber sie wäre für ihn selbst sinnlos, da er nicht wüsste, was er eigentlich macht. So richtig es ist darauf zu beharren, dass Gründe verstanden und Ursachen erklärt werden – im Vergleich mit Diltheys Begriff des Verstehens zeigt sich ein entscheidender Verlust. Die bloße Unterscheidung von Ursachen und Gründen bzw. von Natur und Kultur ist blind gegenüber der ontologischen Unterscheidung von Lebendigem und Nichtlebendigem. Wie im folgenden gezeigt werden soll, nehmen diejenigen, die den Begriff Verstehen nur für die Sphäre der Gründe, nicht aber für die Sphäre des Psychischen verwenden wollen, etwas in Anspruch, das sie nicht ausweisen können. Die Rede von Gründen verweist auf die Sphäre der Intersubjektivität, denn nur im intersubjektiven Gespräch kann sinnvoll von Gründen die Rede sein: Gründe sind immer Gründe von jemand. Wer von Gründen spricht, muss also zunächst klären, wie sich Intersubjektivität konstituiert, d.h. wie die Erfahrung des Anderen möglich ist. Diltheys Begriff des Verstehens erweist sich als attraktiv, weil er ebendies leistet. Verstehen ist Verstehen von Psychischem und bedeutet so immer auch die Erfahrung des Anderen zu machen. Einer der bekanntesten Versuche, einen vom Ursache-Wirkungs-Prinzip der Naturwissenschaften unterschiedlichen Typ von Erfahrung namens Verstehen in Frage zu stellen, stammte von Theodore Abel: Letztlich handle es sich beim Verstehen anderer Personen, so Abel, um eine Folge von Analogieschlüssen vom eigenen Verhalten auf das Verhalten Anderer: „The operation Verstehen is performed by analyzing a behaviour situation in such a way [...] that it parallels some personal experience of the interpreter.“ Abel gibt folgendes Beispiel: Es ist kalt und ich sehe, wie mein Nachbar von seinem Schreibtisch aufsteht, ins Freie geht und Holz hackt, um dann seinen Kamin zu heizen. Also gehe ich davon aus, dass mein Nachbar gefroren hat, weil ich in einer ähnlichen Situation ebenso gehandelt hätte. Abel sieht daher im Diltheys ursprüngliche Einsicht. Verstehen ist Verstehen von Ausdruck 235 Verstehen der Geisteswissenschaften keine Methode, die unserem Wissen etwas hinzufügen würde, das wir nicht schon aus eigener Erfahrung kennen würden: „The operation of Verstehen does not, however, add to our store of knowledge already validated by personal experience.“ 25 Karl-Otto Apel hat Versuche wie denjenigen Abels, die Tatsache eines eigenen Typs von Erfahrung namens Verstehen zu leugnen, scharf kritisiert: Die intersubjektive Verständigung, so Apel, kann durch keine Methode objektiver Wissenschaft ersetzt werden: Wir reden in einer intersubjektiv geteilten Sprache über die Dinge, die uns umgeben. Jeder Naturwissenschaftler, der die Gesetze der kausal geschlossenen Körperwelt untersucht, bedient sich der Begriffe einer intersubjektiv geteilten Sprache. Er nimmt also etwas in Anspruch, das er dem eigenen Selbstverständnis gemäß nicht in Anspruch nehmen kann.26 So treffend Apels Kritik ist, sie trifft noch nicht das eigentliche Missverständnis Abels. Wenn Abel annimmt, dass ein von Analogieschlüssen geleitetes Verstehen unserem Wissen nichts hinzufügt, dann übersieht er zwei grundsätzliche Probleme. Zum einen geht es nicht nur darum, dass wir unser Wissen in einer intersubjektiv geteilten Sprache kommunizieren, sondern es geht auch um die Bedingungen der Intersubjektivität selbst. Verstehen meint auch die Erfahrung des Anderen zu machen. Diese kann durch keinen Analogieschluss geleistet werden. Analogieschlüsse auf das Verhalten Anderer sind nur möglich, wenn der Andere schon als Anderer erkannt ist. Die ursprüngliche Erfahrung des Anderen kann aber nicht durch einen Schluss gemacht werden, jeder Versuch einer Erklärung in dieser Richtung ist in einem schlechten Sinn zirkulär. Zum anderen lässt sich aber auch das Selbstverstehen nicht im Sprachspiel der erklärenden Wissenschaften beschreiben. Jedes Erlebnis, das als physisches Ereignis beschrieben wird, ist, beschrieben als physisches Ereignis, nur noch ein physisches Ereignis. Auch ist zu bedenken, dass sich das Verstehen von Gemütszuständen – Diltheys elementares Verstehen – in einem hermeneutischen Zirkel vollzieht, der vom hermeneutischen Zirkel des Textverstehens verschieden ist. Unser Verstehen von Worten, die Gefühle bezeichnen, bewegt sich, so Charles Taylor, „unausweichlich in einem hermeneutischen Zirkel“: Ein Wort wie z.B. Scham verweist auf eine beschämende bzw. demütigende Situation. Es lässt sich nur unter Bezug auf Begriffe erklären, die wiederum nicht ohne Bezug auf Scham verstanden werden können. Um diese Begriffe zu verstehen, müssen wir uns mit einer bestimmten Erfahrung auskennen, wir müssen eine bestimmte Sprache verstehen, nicht nur die der Worte, sondern auch eine bestimmte Sprache der wechselseitigen Aktion und Kommunikation. _____________ 25 26 Theodore Abel: The operation called Verstehen, in: The American Journal of Sociology, 1948, S. 211-218, hier S. 218. Karl-Otto Apel: Transformation der Philosophie, Band II, Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft, Frankfurt a. M. 1973, S. 101-127. Matthias Schloßberger 236 Die Sprache der Gefühle einer uns fremden Kultur können wir nur verstehen, wenn wir uns in den Anderen hineinversetzen.27 Taylor will uns sagen: Um ein Gefühl wie Scham zu verstehen, müssen wir mit dem Gefühl bereits bekannt sein, wir müssen zumindest ein ähnliches Gefühl aus eigener Erfahrung kennen. Etwas vollkommen Fremdes können wir nicht verstehen. Soweit leuchtet Taylors Argument ein. Ob es jedoch sinnvoll ist, das Verstehen von Gefühlen als ein Sich-in-den-Anderen-Versetzen zu beschreiben, ist eher fragwürdig. Denn es ist nicht ganz klar, was diese Redeweise genau bedeuten soll: Versteht man die Redeweise wortwörtlich, dann findet nämlich gar kein Verstehen des Anderen statt. Versetze ich mich an die Stelle des Anderen, dann verstehe ich lediglich mich selbst an der Stelle des Anderen. Entscheidend ist hier aber ein anderer Gedanke: Der hermeneutische Zirkel, der vorliegt, wenn Gemütszustände verstanden werden, verweist auf das Verstehen einer Bedeutung, die jenseits der Bedeutung von kontingenten Zeichen in einer Sprache liegt. Die Bedeutung eines Wortes wird noch nicht allein durch seinen Gebrauch in der Sprache verständlich. Die Regeln einer Sprache bleiben unverständlich bzw. sinnlos ohne die Erfahrung, die sprachlich artikuliert werden soll. Insofern ist es problematisch, den Begriff des Verstehens einseitig an das Verstehen von Texten (Hermeneutik) bzw. von propositionalen Ausdrücken (sprachanalytische Philosophie) zu binden. In der berühmten Formulierung von Gadamer heißt es: „Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache“.28 Der Satz wäre richtig, wenn ihm ein Begriff von Sprache zu Grunde liegen würde, der die enge Definition der Sprache in Hermeneutik und analytischer Sprachphilosophie transzendiert und jene Sprache des Ausdrucks miteinbezöge, in der Zeichen und Bezeichnetes untrennbar verbunden sind. Die Traurigkeit und der trauernde Ausdruck lassen sich nicht voneinander trennen. Wir könnten uns nicht mehr verstehen, wenn es sich in allen Fällen des Ausdrucksverstehens so verhalten würde wie bei Gesten, die wie das Kopfschütteln, in der einen Kultur so und in der anderen anders kodiert sind. Zurecht wurde gegen die Idee des hermeneutischen Zirkels der Texthermeneutik eingewandt, dass es sich doch eigentlich um eine hermeneutische Spirale handle. Das Verstehen einer einzelnen Passage eines Textes setzt das Verstehen des ganzen Textes voraus und umgekehrt. Aber: wiederholte Lektüre führt zu einem immer neuen (vielleicht tieferen) Verstehen, weshalb es sich strenggenommen nicht um einen Zirkel, sondern um eine Spirale han_____________ 27 28 Charles Taylor: Erklärung und Interpretation in den Wissenschaften vom Menschen, Frankfurt a. M. 1975, S. 166 f. Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960, S. 450. Diltheys ursprüngliche Einsicht. Verstehen ist Verstehen von Ausdruck 237 delt.29 Ähnlich verhält es sich, wenn es um das Verstehen von Gemütszuständen geht: um den Anderen zu verstehen, muss ich das Gefühl, das ich verstehe, schon kennen. Dennoch verändert sich unser Verstehen ständig, wir lernen die Anderen zu verstehen und verstehen so immer etwas Neues, so wie wir auch lernen (müssen) uns selbst zu verstehen. Die sprachanalytische Philosophie und die jüngere Hermeneutik seit Gadamer haben viel zu dem Nachweis beigetragen, dass der naturalistische und positivistische Versuch, die Unterscheidung von Erklären und Verstehen einzuebnen, scheitert. Aber die starke (vielleicht zu einseitige Orientierung) an der Sprache hat dazu geführt, dass Problem der Intersubjektivität zu unterschätzen. Erst wenn wir die Erfahrung Anderer gemacht haben, können wir die intersubjektive Bühne der Sprache betreten und erst in der Sphäre der Sprache sind Gründe als Gründe verstehbar. Dilthey hatte dieses Problem klar erkannt, als er zwischen elementarem und höherem Verstehen unterschied. Erst müssen wir ein alter ego als alter ego erkennen, indem wir einen Gemütszustand verstehen,30 dann können wir seine Handlungen, seine Gründe, seine Aussagen verstehen. Erst machen kleine Kinder die Erfahrung: da vor mir ist ein Anderer, der dieses oder jenes fühlt, will, beabsichtigt, und erst dann können die Worte des Anderen als Worte des Anderen aufgefasst und verstanden und die Personalpronomina sinnvoll verwendet werden. _____________ 29 30 Vgl. Dieter Teichert: Erinnerung, Erfahrung, Erkenntnis. Untersuchungen zum Wahrheitsbegriff der Hermeneutik Gadamers, Stuttgart 1991, 154-158. Die Redeweise ‚den Gemütszustand eines Anderen zu verstehen‘ meint nicht, den sinnlichen Zustand eines Anderen zu verstehen. Wenn jemand Zahnschmerzen hat, dann verstehe ich nicht das sinnliche Gefühl (den „Schmerz“), sondern dass der Andere an seinen Zahnschmerzen leidet, d.h. dass er dieses sinnliche Gefühl als schmerzhaft erlebt. Die Sprache verschleiert diese Unterscheidung, weil wir, wenn wir von „Schmerzen“ sprechen, zwei verschiedene Sachen meinen: einmal das sinnliche Gefühl als sinnliches Gefühl, das andere mal das sinnliche Gefühl so wie wir es auffassen – angenehm oder unangenehm etc. Kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts. Nachdenken über Empfindungen und Gefühle im Anschluss an Wittgenstein Christoph Demmerling Im normalen Wachleben erleben wir immer irgendetwas und auch in Situationen, in denen wir nicht mit einer Vielzahl von Wahrnehmungen und Handlungsanforderungen konfrontiert sind, spüren wir etwas, beschäftigt uns etwas und geht uns etwas ‚durch den Kopf’. Handelt es sich dabei um Vorgänge, die auf einer inneren Bühne spielen, eingesperrt in die Seelenkammern einzelner Individuen? Diese Vorstellung und die mit ihr einhergehende Unterscheidung zwischen körperlichen und geistigen Phänomenen ist in der Geschichte der abendländischen Philosophie ebenso verbreitet wie im Rahmen der im Alltagsleben gängigen vortheoretischen Annahmen über die psychischen bzw. geistigen Zustände anderer Lebewesen. Um sich auf die körperliche Seite eines Menschen zu beziehen, benutzt man in der philosophischen, aber auch in der alltäglichen Rede häufig das Wort „außen“, mit dem Wort „innen“ hingegen bezieht man sich auf die Seele des Menschen oder seinen Geist. „Außen“ bedeutet soviel wie „in der Welt verkörpert“, „raum-zeitlich-lokalisierbar“, mit „innen“ hingegen bezieht man sich auf nicht (notwendigerweise) in der Welt Verkörpertes oder raum-zeitlich Lokalisierbares. Empfindungen, Gefühle, aber auch Gedanken gelten in diesem Sinne als Phänomene, die einer Innenwelt zugehören. Immer wieder wird im Rahmen der Innenweltvorstellung davon ausgegangen, dass es sich bei Gedanken und Gefühlen um subjektive Phänomene, ja sogar um private Zustände von Individuen handelt, auf die man zurückgreifen muss, wenn man sich die Verhaltensweisen und Handlungen von Individuen verständlich machen möchte. Der vorliegende Beitrag skizziert eine Alternative zu dieser mentalistischen Position, indem er sich mit verschiedenen Überlegungen auseinandersetzt, die Wittgenstein dem Zusammenhang von Sprache, Gefühl und Empfindung gewidmet hat. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde Wittgenstein eine ungebrochen ‚lingualistische’ Auffassung vertreten, der zufolge Gedanken, Gefühle oder Empfindungen sprachliche Fähigkeiten im Sinne notwendiger Bedingungen voraussetzen. Ein zweiter Blick macht indessen schnell deutlich, dass es ganz so einfach nicht ist und Wittgenstein keine Christoph Demmerling 240 krude Sprachabhängigkeitsthese vertritt. Er vertritt ebenfalls keine logisch behavioristische Sicht der Dinge, der zufolge Gedanken, Wünsche oder Gefühle auf das Sprachverhalten reduziert werden können, welches mit ihnen einhergeht.1 Psychische oder geistige Phänomene sind ein Teil der Wirklichkeit, auch wenn es sich nicht im selben Sinne wie bei raumzeitlich lokalisierbaren Objekten in der Außenwelt um Gegenstände handelt. Diese Phänomene sind nicht ‚in’ uns, weder im Geist noch im Gehirn, so wie die Gegenstände im Raum sind. Meine Auffassung lautet: Psychische und geistige Phänomene sind Weisen unseres Welt- und Selbstbezugs, die sich in Form von Symbolen sowie in leiblichen Vollzügen materialisieren. Mit diesen Weisen des Welt- und Selbstbezugs verhalten sich Personen zu sich und zu anderen, mit ihnen situieren Personen sich in der Welt. In einem ersten Schritt erläutere ich Wittgensteins Sicht des Verhältnisses von Sprache und innerer Erfahrung primär unter sprachphilosophischen Gesichtspunkten (I). Im zweiten Teil diskutiere ich mit den Arbeiten Hans Julius Schneiders einen Vorschlag aus der neueren Diskussion, der an Wittgensteins Verständnis des Inneren anknüpft. (II). Der letzte Abschnitt folgt der durch Schneiders Wittgenstein-Lektüre vorgegebenen Linie, plädiert aber für eine stärkere Berücksichtigung phänomenologischer Gesichtspunkte, die erforderlich sind, um ein zureichendes Verständnis derjenigen Phänomene zu entwickeln, die immer wieder einer Innenwelt zugeschlagen werden (III).2 Mein Interesse gilt dabei in erster Linie Empfindungen und Gefühlen. I. Das Problem einer privaten Sprache und die Unterscheidung von Innen und Außen Die bedeutendsten Ausführungen Wittgensteins zur Frage nach dem Verhältnis von Sprache und innerer Erfahrung finden sich im Zusammenhang mit seinen Überlegungen zur Unmöglichkeit einer Privatsprache. Wittgensteins _____________ 1 2 Eine behavioristische Lesart pflegt zum Beispiel die Rekonstruktion von Gottfried Seebaß: Das Problem von Sprache und Denken, Frankfurt a. M. 1981, S. 380 ff. Es ist nicht der erste Anlauf, den ich unternehme, um das Verhältnis zwischen der Sprache und den so genannten inneren Zuständen zu bedenken. Vgl. Christoph Demmerling: Denken – Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und inneren Zuständen, in: G.W. Bertram / D. Lauer / J. Liptow / M. Seel (eds.): Die Artikulation der Welt. Über die Rolle der Sprache für das menschliche Denken, Wahrnehmen und Erkennen, Frankfurt a. M. 2006, S. 31-47; ders.: Brauchen Gefühle eine Sprache? Überlegungen zur Philosophie der Psychologie, in: H. Landweer (ed.): Struktur und Funktion der Gefühle, Berlin 2007, S. 19-33; ders.: Implizit und Explizit. Überlegungen zum Verstehensbegriff im Anschluss an Heidegger und Brandom, in: B. Merker (ed.): Verstehen nach Heidegger und Brandom. Phänomenologische Forschungen, Beiheft 3, Hamburg 2009, S. 61-78. Überlegungen aus diesen Texten sind in modifizierter Form auch in den vorliegenden Aufsatz eingegangen. Kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts 241 Hauptbeispiel in diesem Zusammenhang sind Empfindungen wie Schmerzen. Das so genannte Privatsprachenargument hat eine kaum überschaubare Menge exegetischer Literatur hervorgebracht, zum Teil ganz unterschiedliche Deutungen erfahren. Inzwischen gehört es zu den Gemeinplätzen der Diskussion um Wittgenstein, dass die Literatur zum Argument eher in die Irre führt als orientiert.3 In Wittgensteins Überlegungen geht es unter anderem um die Frage, ob eine Sprache möglich ist, die nur von einer einzigen Person verstanden (und gebraucht) werden kann. Wittgenstein denkt hier nicht an den Fall, in dem eine Sprache zufälligerweise nicht geteilt wird (das wäre der Fall Robinsons, der auf seiner einsamen Insel einfach keine Gelegenheit hat, seine Sprache mit jemandem zu teilen in dem Sinne, dass Robinson aktuell keine Möglichkeit hat, mit jemandem ein Gespräch zu führen), sondern er denkt an den Fall, in dem eine Sprache aus prinzipiellen Gründen nicht geteilt werden kann, weil sich ihre Ausdrücke auf private Erlebnisse beziehen, auf Erlebnisse, die nur demjenigen bekannt sind, der diese Erlebnisse hat. In diesem Sinne ist eine Sprache genau dann privat, wenn die Bezugsgegenstände der Ausdrücke, die jemand verwendet, anderen nicht bekannt sind. Eine zentrale Passage, in der sich Wittgenstein mit dieser Thematik auseinandersetzt, ist der § 258 der Philosophischen Untersuchungen. Hier stellt er sich eine Person vor, welche über das Auftreten bestimmter ihrer Empfindungen ein Tagebuch führt. Eine ihrer Empfindungen bezeichnet diese Person mit dem als Namen verwendeten sprachlichen Zeichen „E“. Sobald die Empfindung auftritt, notiert die Person ein „E“ in ihrem Tagebuch. Tritt die Empfindung zum Beispiel am Montag, Mittwoch und Freitag auf, verzeichnet die Person am Montag, Mittwoch und Freitag ein „E“ in ihrem Tagebuch. Die Überlegung Wittgensteins läuft darauf hinaus, dass die betreffende Person über keine Kriterien verfügt, die es ihr erlauben, zu entscheiden, ob sie den Ausdruck „E“ in der richtigen Weise verwendet. Er schreibt: „Man möchte hier sagen: richtig ist, was immer mir als richtig erscheinen wird. Und das heißt nur, daß hier von ‚richtig’ nicht geredet werden kann.“4 Die Idee von einer privaten Sprache und von sprachlichen Ausdrücken, die nur einer unmittelbaren und inneren Erfahrung zugängliche Objekte bezeichnen und zu denen diejenigen, welche diese Erfahrung machen, einen _____________ 3 4 Vgl. dazu Stewart Candlish: Wittgensteins Privatsprachenargumentation, in: E. v. Savigny (ed.): Wittgensteins Philosophische Untersuchungen, Berlin 1998, S. 143-165, S. 143; eine knappe Skizze der Debatte um das Privatsprachenargument findet sich bei Thomas Blume: Wittgensteins Schmerzen. Ein halbes Jahrhundert im Rückblick, Paderborn 2002. Eine ausführlichere Übersicht über die Fragen und Argumente, welche die neuere Debatte bestimmen, enthält das Buch von Severin Schroeder: Das Privatsprachenargument. Wittgenstein über Ausdruck und Empfindung, Paderborn 1997. Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, Oxford 1953, § 258. Christoph Demmerling 242 privilegierten Zugang haben, ist ein maßgebliches Element im Rahmen der Innen-Außen-Vorstellung, mit der sich Wittgenstein vor allem in seinem letzten Lebensjahrzehnt immer wieder auseinandergesetzt hat. Die wesentliche Zielrichtung dieser Überlegungen besteht darin, deutlich zu machen, dass geistige oder psychische Phänomene nicht als Gegenstände oder Vorgänge im Inneren von Sprechern aufgefasst werden sollten, von denen die Verhaltensweisen der Sprecher als äußere Vorgänge künden. Wer die Auffassung ablehnt, dass sich im Inneren eines Menschen nur diesem einsichtige Prozesse und Vorgänge abspielen, ganz gleich, ob es sich um Gedanken, Wahrnehmungen bzw. Sinnesdaten, Gefühle oder Empfindungen handelt, gerät schnell in den Verdacht, eine behavioristische Position zu vertreten, der zufolge es keine inneren Erfahrungen gibt, sondern lediglich Verhaltensweisen und Handlungsdispositionen. Wittgensteins Überlegungen dürfen jedoch nicht in diesem Sinne verstanden werden, zumal man schnell deutlich machen kann, dass behavioristische Positionen allenfalls eine Hälfte des Innen-Außen-Bildes verabschieden, indem sie die Dimension des Inneren destruieren, während es Wittgenstein um die Destruktion des gesamten Bildes und aller mit ihm verbundenen Vorstellungen geht. Im Zusammenhang mit der Rede über geistige bzw. psychische Phänomene weist der Behaviorismus lediglich die Vorstellung von einer Innenwelt zurück, behält aber den Rekurs auf äußere Kriterien bei. Dem Behavioristen zufolge hat das Innere keine Funktion, es lässt sich auf Verhalten reduzieren und kann vollständig mit Hilfe physischer Prädikate beschrieben werden. Wittgenstein zeichnet ein differenzierteres Bild der Sachlage. In einer zentralen Passage aus den Philosophischen Untersuchungen lässt er jemanden sagen: „Aber du wirst doch zugeben, daß ein Unterschied ist, zwischen Schmerzbenehmen mit Schmerzen und Schmerzbenehmen ohne Schmerzen“ Die Antwort lautet: „Zugeben? Welcher Unterschied könnte größer sein!“ Darauf bemerkt der Gesprächspartner: „Und doch gelangst du immer wieder zum Ergebnis, die Empfindung selbst sei ein Nichts.“ Der Angesprochene schließlich bemerkt dazu: „Nicht doch. Sie ist kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts!“ Der Passus schließt mit der Bemerkung: „Das Ergebnis war nur, daß ein Nichts die gleichen Dienste täte, wie ein Etwas, worüber sich nichts aussagen läßt. Wir verwarfen nur die Grammatik, die sich uns hier aufdrängen will.“5 Wittgenstein richtet sich zum einen gegen mentalistische Konzeptionen des Inneren, denen zufolge sich Ausdrücke wie „Enttäuschung“ oder „Schmerz“ in dem Sinne auf Vorgänge im Inneren beziehen, in dem sich Ausdrücke wie „Tisch“ auf Gegenstände in der äußeren Welt beziehen. Deshalb sagt er, Schmerzen seien kein Etwas. Obwohl kein Etwas, sind Schmer_____________ 5 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 304. Kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts 243 zen auch kein Nichts, womit Wittgenstein sich gegen behavioristische Konzeptionen richtet, denen zufolge sich psychische Phänomene vollständig im Rückgriff auf Verhaltensweisen und Dispositionen erläutern lassen. Es ist nicht ganz leicht auszumachen, welcher Stellenwert dem Inneren in Wittgensteins Sicht beizumessen ist, wovon eine Vielzahl divergierender Interpretationen zeugt.6 Klarheit besteht einzig über den Weg, der Wittgenstein zufolge einzuschlagen ist, wenn man zu einem angemessenen Verständnis des Inneren gelangen möchte. Der Weg ist ein sprachkritischer Weg, da es darum geht, die Grammatik zu verwerfen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung von Empfindungsausdrücken aufdrängt. Was den Stellenwert des Inneren betrifft, so kann man immerhin soviel sagen: Innere Vorgänge wie Schmerzen, gleiches gilt für alle affektiven Phänomene, insbesondere auch für Gefühle, stellen – wie Wittgenstein manchmal sagt – natürliche und primitive Reaktionen dar, die in der Interaktion eines Organismus mit seiner Umwelt entstehen. Bei Wesen, die über eine Sprache verfügen und auf komplexe Weise mit anderen sprachfähigen Wesen interagieren, erhalten die betreffenden Reaktionen durch expressive und dialogische Artikulation sowie durch die Einbettung in eine sprachliche Umgebung als psychologische Prädikate einen Gehalt, der identifiziert und re-identifiziert werden kann. Dasjenige, was große Teile der Philosophie der Neuzeit in die Innenwelt von Subjekten verlegt haben, siedelt Wittgenstein in der Sprache an. Erst durch seine Verbindung mit Sprachspielen erhält das Innere seine charakteristische Kontur und Schärfe. Die Sprache verleiht dem Inneren Gehalt und Substanz, indem Bedeutsamkeitsbezüge hergestellt und aufgespannt werden. Man kann die grundsätzliche Zielrichtung, die hinter Wittgensteins Überlegungen steckt, als Versuch einer Externalisierung des Inneren charakterisieren. Es wird allerdings nicht in die Außenwelt verlagert oder in Verhaltensweisen aufgelöst, sondern in die Sprache verschoben. Für diese Strategie gibt es ein Vorbild in einem anderen Zusammenhang. Zu erinnern ist an die Psychologismuskritik Freges im Kontext der Frage, worin eigentlich die Geltung logischer Sätze besteht. Als „psychologistisch“ in einem allgemeinen Sinne gelten Positionen, denen zufolge die Art und Weise, in der Menschen die Welt erfahren, von subjektiven Denk- und Erfahrungsbedingungen abhängen, die sich im Prinzip mit den Mitteln der Psychologie empirisch untersuchen lassen. Im engeren Sinne werden alle Versuche die Logik in der Psychologie zu begründen als „psychologistisch“ bezeichnet. _____________ 6 Um nur wenige Arbeiten zu nennen, verweise ich auf Joachim Schulte: Erlebnis und Ausdruck. Wittgensteins Philosophie der Psychologie, München 1987; Hans-Johann Glock: Innen und Außen. ‚Eine ganze Wolke von Philosophie kondensiert zu einem Tröpfchen Sprachlehre’, in: E. v. Savigny / O. Scholz (eds.): Wittgenstein über die Seele, Frankfurt a. M. 1993, S. 233-252. Christoph Demmerling 244 Halten wir ein Zwischenergebnis fest: Eine mentalistische Position wird von Wittgenstein dezidiert abgelehnt. Und die auf den ersten Blick naheliegende Alternative des Behavioristen macht sich Wittgenstein ebenfalls nicht zu Eigen. Wittgensteins Hinweise auf die Rolle der Sprache bzw. von Sprachspielen legen nun nahe, die von ihm anvisierte Konzeption in einem ‚lingualistischen’ Sinne zu verstehen. Aber auch diese Etikettierung ist nicht hilfreich, da sie an der Sache vorbeigeht. Um die durch die Spuren von Mentalismus, Behaviorismus und Lingualismus eingefahrenen Bahnen zu verlassen, diskutiert der nächste Abschnitt einen Rekonstruktionsvorschlag der einschlägigen Überlegungen Wittgensteins, den Hans Julius Schneider in mehreren seiner Arbeiten entwickelt hat.7 II. Das Innere als Sprachspiel? Schneider hat verschiedene Anläufe unternommen, um einen Vorschlag zum Verständnis von Wittgensteins Position zu erarbeiten, sofern diese über eine bloße Kritik am Mentalismus hinausgeht. Wenn Menschen über psychische oder geistige Vorgänge reden, dann beziehen sie sich auf nichts, was in ihrer Innenwelt vor sich geht. Wenn sich die Wörter, die wir dafür benutzen, um uns vermeintlich auf etwas in der Innenwelt zu beziehen, nicht in einem wörtlichen Sinne auf Gegenstände beziehen, dann müssen sie anders verstanden werden und haben eine andere Funktion als jene des Gegenstandsbezugs. Ausgangspunkt der Überlegungen Schneiders ist Wittgensteins Kritik an einer Namenstheorie bzw. Abbildtheorie der Bedeutung. Eine solche Theorie habe Wittgenstein im Tractatus vertreten. Da Schneider im Unterschied zu vielen anderen Interpreten Wittgensteins der Auffassung ist, dieser habe sich gar nicht so sehr an Bildern und ihrer Funktion orientiert, sondern vielmehr an der musikalischen Notenschrift, spricht er von einem Notationsmodell der Sprache und schreibt: Wie die Ordnung der Noten in einer Partitur der Ordnung der Töne in einer Aufführung des zugehörigen Werkes entspricht, so soll die Ordnung der sprachlichen Ausdrücke im Satz der Ordnung der Gegenstände in der Welt entsprechen.8 _____________ 7 8 Ich beziehe mich in erster Linie auf Hans Julius Schneider: ’Den Zustand meiner Seele beschreiben’ – Bericht oder Diskurs?, in: W. R. Köhler (ed.): Davidsons Philosophie des Mentalen, Paderborn 1997, S. 33-51; ders.: Mentale Zustände als metaphorische Schöpfungen, in: W. Kellerwessel / T. Peuker (eds.): Wittgensteins Spätphilosophie. Analysen und Probleme, Würzburg 1998, S. 209-226; ders.: Reden über Inneres. Ein Blick mit Ludwig Wittgenstein auf Gerhard Roth, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 53/4 (2005), S. 743-759; ders.: Religion, Berlin 2008. Hans Julius Schneider: Religion, a.a.O., S. 67; zur Rolle des Notationsmodells in Wittgensteins Denken vgl. Hans Julius Schneider: Satz – Bild – Wirklichkeit. Vom Notations- Kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts 245 Im Rahmen dieses Modells besteht die wichtigste (um nicht zu sagen: die einzige) Funktion der Sprache darin, Gegenständen und Sachverhalten zu entsprechen. Orientiert man sich am Sprachgebrauch der empirischen Wissenschaften wie der frühe Wittgenstein, mag sich ein derartiges Modell aufdrängen. Wie der spätere Wittgenstein weist auch Schneider den Allgemeinheitsanspruch dieses Modells zurück, auch wenn es in Teilbereichen durchaus seine Berechtigung haben mag. Eine Antwort auf die Frage nach der Reichweite des Notationsmodells hängt von dem Gegenstandsbereich ab, in Bezug auf den es zur Anwendung kommen soll. Im Kontext eines (natur-)wissenschaftlichen Sprachspiels über raumzeitlich lokalisierbare Gegenstände in der Außenwelt bereitet es keine großen Schwierigkeiten, die Ausdrücke der Sprache als Namen für Gegenstände aufzufassen. Ganz anders stellt sich die Lage jedoch dar, sofern man sich über Themen der Ethik, Psychologie, Religion oder Mathematik verständigt. Auf diesen Gebieten wird – wie Schneider geltend macht – nicht einfach über etwas geredet, weil kein im einfachen Sinne wahrnehmbares Etwas im Sinne eines raumzeitlich lokalisierbaren Gegenstandes dingfest zu machen ist.9 Es ist überaus plausibel, zwischen der Art und Weise zu unterscheiden, in der wir die Sprache gebrauchen, wenn wir über die Außenwelt bzw. Gegenstände in der Außenwelt reden, und der Art und Weise, in der wir sie verwenden, wenn wir uns über Themen der Ethik, Psychologie, Religion und Mathematik verständigen. Die Redebereiche der Ethik, Psychologie, Religion und Mathematik sind zwar im Einzelnen sehr unterschiedlich, teilen sich aber das gemeinsame Merkmal, dass das Nichtgegenständliche eine größere Rolle spielt als im Kontext der Rede über die Außenwelt. Im Folgenden soll es vor allem um die Rede über Inneres gehen. Das Innere, so macht Schneider geltend, habe seinen Ort nur in Sprachspielen, wobei es allerdings falsch sei, es darum als „bloß verbal“ zu bezeichnen.10 Schneiders Versuch, den Gegensatz zwischen „sprachlich konstruiert“ und „nicht nur verbal“ zu überwinden, ist in systematischer Perspektive alternativlos. Es geht darum, den ja auch von Wittgenstein immer wieder akzentuierten Zusammenhang von Sprachspielen und Lebensformen einer feinkörnigen Explikation zuzuführen. Schneider stützt seine Überlegungen mit Hilfe einer Theorie der syntaktischen Metapher.11 Er bewegt sich damit ganz auf _____________ 9 10 11 system zur Autonomie der Grammatik im Big Typescript, in: S. Majetschak (ed.): Wittgensteins ‚große Maschinenschrift’. Untersuchungen zum philosophischen Ort des Big Typescripts (TS 213) im Werk Ludwig Wittgensteins, Frankfurt a. M. u.a. 2006, S. 79-98. Vgl. dazu vor allem Hans Julius Schneider: Religion, a.a.O., S. 65 ff. Vgl. Hans Julius Schneider: Mentale Zustände als metaphorische Schöpfungen, a.a.O., S. 225. Ausführlich entwickelt und diskutiert wird diese Konzeption in verschiedenen Aufsätzen Schneiders. Vgl. zum Beispiel Hans Julius Schneider: ’Syntaktische Metaphern’ und Christoph Demmerling 246 der sprachkritischen Linie Wittgensteins, der ja im § 304 der Philosophischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Rede von inneren Zuständen wie Schmerzen darauf hinweist, es gehe darum, die Grammatik zu verwerfen, die sich hier aufdränge. Ohne die Leistungsfähigkeit des Konzepts der syntaktischen Metapher im Allgemeinen in Zweifel ziehen zu wollen, bin ich nicht sicher, ob damit ein geeignetes Instrumentarium für ein angemessenes Verständnis der Rede über Inneres zur Verfügung gestellt wird. Um die Auffassung zu etablieren, dass eine angemessene Rekonstruktion des Inneren nur gelingen kann, wenn man demonstriert, wie Sprachspiel und Lebensform ineinandergreifen, scheint mir der Rekurs auf Einsichten aus der phänomenologischen Tradition aussichtsreicher zu sein als der Rückgriff auf eine Theorie der Metapher. Dass Empfindungen wie Schmerzen nicht bloß verbal sind, würde ich als Hinweis darauf verstehen, dass im Fall eines Schmerzes mehr relevant ist als die Verwendung von sprachlichen Ausdrücken. Im Fall von Schmerzen macht man eine Erfahrung, man spürt etwas von sich. Neben der bezugsorientierten Deutung von Substantiven sind es ja gerade solche Erfahrungen, aufgrund derer sich mentalistische Sichtweisen aufdrängen. Schneider hat eine nichtmentalistische Deutung von Ausdrücken für Inneres vor Augen, die sich nicht dem Vorwurf ausliefert, behavioristisch zu sein. Eine derartige Auffassung kann man im Grunde aber nur dann plausibel machen, wenn es gelingt, die Rolle beispielsweise des Spürens zu explizieren und in die eigenen Überlegungen zu integrieren. Denken wir beispielsweise an die Erfahrung eines stechenden oder ziehenden Schmerzes. Stechen oder Ziehen sind nicht im selben Sinne körperliche Phänomene wie die Entzündung eines Zahns oder die Dehnung eines Bandes. Stechen oder Ziehen könnte man auch als Bewusstseinsphänomene ansehen und sie somit als etwas Mentales auffassen. Aber auch das ist eine Auffassung, welche die Sache nicht trifft. Wer davon spricht, dass ein Schmerz sticht oder zieht, spricht über seine Erfahrung des Schmerzes, darüber wie sich ihm der Schmerz darstellt. Wer über Schmerzen spricht, der redet weder über physiologische Prozesse noch auch über geistige Phänomene. Schneider versteht Redeweisen wie die angeführten im Sinne eines Übergangs vom Körperlichen zum Seelischen.12 Der Begriff des Seelischen ist allerdings alles andere als ein eindeutiger Begriff. Gelegentlich wird er im selben Sinne verwendet wie die Ausdrücke „Geistiges“ oder „Inneres“. Er wird aber vereinzelt auch gebraucht, um in _____________ 12 ihre begrenzende Rolle für eine systematische Bedeutungstheorie, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 41/3 (1993), S. 577-486. Vgl. Hans Julius Schneider: ’Den Zustand meiner Seele beschreiben’ – Bericht oder Diskurs?, a.a.O., S. 40 ff. Kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts 247 einer ‚trialistischen’ Perspektive dualistische Verständnisse von Körper und Geist zu unterlaufen und auf Phänomene hinzuweisen, die sowohl eine körperliche wie auch geistige Seite haben.13 Schneiders Überlegungen würde ich in diesem Sinne verstehen. Ziehen oder Stechen sind – wie Empfindungen und Gefühle im Allgemeinen – Phänomene, die sowohl eine körperliche wie auch eine geistige Seite haben und deshalb aus dem dualistischen Klassifikationsschema herausfallen. Auf die Frage nach der Charakterisierung von Phänomenen, die eine körperliche und eine geistige Seite haben und nach einer in diesem Zusammenhang nützlichen Terminologie komme ich zurück. Im Zusammenhang von Überlegungen zum diskursiven Charakter der Rede über Inneres unterscheidet Schneider ganz grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten von Fällen: zum einen Fälle, in denen einem etwas einfällt, was auf eine bestimmte Weise auch vor dem Einfall bereits da ist: ein Name, eine Telefonnummer, eine Melodie.14 Anders verhält es sich, wenn jemandem eine neue Melodie einfällt oder eine neue Idee kommt. Diese Fälle machen deutlich, dass wir über Ereignisse wie Einfälle oder Empfindungen nicht nach Belieben verfügen können. Solche Ereignisse haben – und das gilt für Empfindungen in einem höheren Ausmaß als für Überzeugungen – häufig Widerfahrnischarakter. Sie geschehen uns und werden nicht, jedenfalls nicht zur Gänze aktiv herbeigeführt. Dass uns solche Ereignisse heimsuchen, lässt sich als ein Indiz dafür ansehen, dass sie nicht, jedenfalls nicht auf der ganzen Linie sprachlich erzeugt sein können. Folglich kann es sich nicht um Phänomene handeln, deren Existenz sich ausschließlich der Sprache verdankt. Denn etwas, was wir erzeugen, kann uns nicht widerfahren. Es sind zwar sprachliche Mittel, durch welche wir die angesprochenen Phänomene erfassen, was aber kein Grund ist, sie als etwas anzusehen, was durch die Sprache erzeugt wird. Schneider vertieft seine Überlegungen durch Analysen zur Auflösung des Leib-Seele-Problems im Anschluss an Wittgenstein.15 Die Wörter, mit denen wir uns vermeintlich auf etwas Inneres beziehen, erhalten ihren Sinn dadurch, dass wir sie im Rahmen einer sozialen Praxis dazu verwenden, um uns in verschiedener Hinsicht zu charakterisieren. Diese Gebrauchspraxis lässt semantische Verhältnisse einer bestimmten Art entstehen. Wenn jemand zum Beispiel davon spricht, dass ihn etwas bedrückt, er Schmerzen hat, löst dies ein bestimmtes Verhalten bei anderen aus. Es erfolgen Nachfragen, Bekun_____________ 13 14 15 Vgl. dazu die kurzen Bemerkungen bei Carl Friedrich Gethmann und Thorsten Sander: Anti-Mentalismus, in: M. Gutmann / D. Hartmann / M. Weingarten / W. Zitterbarth (eds.): Kultur, Handlung, Wissenschaft, Weilerswist 2002, S. 91-108, S. 94. Vgl. Hans Julius Schneider: ’Den Zustand meiner Seele beschreiben’ – Bericht oder Diskurs?, a.a.O., S. 44 f. Hans Julius Schneider: Reden über Inneres. Ein Blick mit Ludwig Wittgenstein auf Gerhard Roth, a.a.O.; ders.: Religion, a.a.O., S. 78 ff. Christoph Demmerling 248 dungen der Anteilnahme, wobei alle möglichen Reaktionen denkbar sind. Die Auslösung eines Verhaltens der Anteilnahme, überhaupt irgendeines Verhaltens, kann man so verstehen, dass man sagt, Bedrückung oder der Schmerz eröffnen einen sozialen Raum, innerhalb dessen auf eine bestimmte Weise miteinander umgegangen wird. Die Umgangsweisen können vielfältig sein, so ist nicht nur Anteilnahme, sondern auch Ignoranz denkbar. Aber es gibt eben Umgangsformen und Bekundungen, die besser zur Bekundung von Bedrückung oder Schmerz passen als andere, wobei die Reaktionen auf Bedrückungs- oder Schmerzbekundungen dann ihrerseits wieder bestimmte Reaktionen nach sich ziehen, so dass ein soziales Gewebe entsteht, in welches der Umgang mit den betreffenden Bekundungen eingelassen ist. Schneider akzentuiert die soziale Dimension, in die der Rückgriff auf das Innere von vornherein gestellt ist. Mit Hilfe einer sozialen Externalisierung des Inneren soll auch der in der neueren Philosophie verbreitete Perspektivendualismus bezogen auf Geist und Körper vermieden werden, da sich mit diesem immer wieder der Eindruck verbinde, das Bewusstsein sei ein Rätsel.16 Dieses Rätsel besteht darin, die postulierten Verbindungen zwischen einer unterstellten Innen- und Außenperspektive bzw. zwischen Bewusstsein und postulierten neuronalen Korrelaten im Rahmen verschiedener Varianten von Identitätstheorien nicht erklären zu können. Das vermeintliche Rätsel lasse sich auflösen, wenn man die Vorstellung von einem Innenraum beiseite schiebe und Sprachhandlungen an die Stelle eines solchen Raumes treten lasse. Nun ist es richtig, dass dadurch, dass Empfindungen in der Sprache verortet werden, viele Probleme des Innen-Außen-Bildes vermieden werden können. Aber die Explikation von Empfindungen als sozialen und sprachlichen Praktiken klammert die Dimension des Erlebens weitgehend aus, die zum Beispiel in den Diskussionen um den Begriff des phänomenalen Bewusstseins eine wichtige Rolle spielt und erst einmal auch nicht von der Hand zu weisen ist. Schneiders Kritik an der Vorstellung, es würde besondere phänomenale Gegenstände geben, ist sicher berechtigt. Es stellt sich jedoch die Frage, was wir erfahren, wenn wir etwas erleben. Selbst wenn man unterstellt, dass zu diesen Erfahrungen keine speziellen Gegenstände gehören, sondern sie einen Zusammenhang mit sozialen und sprachlichen Praktiken aufweisen, sind wir – und dies gilt insbesondere für Gefühle – auf eine besondere Weise involviert und betroffen. Die Erfahrung von etwas betroffen zu werden stellt _____________ 16 Die Rede vom Rätsel des Bewusstseins ist in der Philosophie zu einem Gemeinplatz avanciert. Zu den ernsthaften Hintergründen vgl. Peter Bieri: Was macht Bewußtsein zu einem Rätsel?, in: T. Metzinger (ed.): Bewußtsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie, Paderborn 1995, S. 61-77; vgl. auch Michael Pauen: Das Rätsel des Bewusstseins, Paderborn 1999. Kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts 249 für einen Ansatz, der auf die Sprache fixiert ist, eine Herausforderung dar, die es zu meistern gilt. III. Jenseits der Sprache? Einen Anknüpfungspunkt für das Unterfangen, die angeführte Herausforderung anzunehmen, bieten zwei neuere Arbeiten von Gunter Gebauer und Anna Stuhldreher.17 Diese Arbeiten gehören in den Kontext einer Rezeption der Philosophie Wittgensteins, die den gesamten Ansatz primär unter anthropologischen Gesichtspunkten betrachtet. Die Auseinandersetzung mit Wittgensteins Philosophie der Psychologie nimmt in diesem Zusammenhang einen besonderen Stellenwert ein. Aus ihr lassen sich Konturen zu einer Sicht auf Empfindungen und Gefühle herausarbeiten, die weder mentalistisch, noch behavioristisch oder sprachzentriert im Sinne des Lingualismus ist. Empfindungen und Gefühle stellen sich ein, ohne dass ihnen eine Absicht oder ein Plan unsererseits vorausgegangen wäre. Empfindungen und Gefühle sind in der Regel nicht das Ergebnis einer absichtlichen Handlung, auch wenn sie sich in Handlungszusammenhänge einbetten lassen, die ihnen eine bestimmte Kontur verleihen und durch welche sie diesen oder jenen Verlauf nehmen. Auch Wittgenstein akzentuiert den Umstand, dass Gefühle uns zunächst einmal auf eine mehr oder weniger naturhafte Weise ereilen. Empfindungen und Gefühle können als Reaktionen angesehen werden, mit denen sich Organismen zu ihrer Umwelt und insbesondere zu Veränderungen in ihrer Umwelt oder durch ihre Umwelt bedingt verhalten. Wer im Dunkeln Schritte oder andere nicht näher klassifizierbare Geräusche hört, fährt zusammen und hat Angst. Schritte und Geräusche rufen die Angst hervor. Die Angst ist kein Ergebnis planvollen und absichtlichen Handelns. Außerdem stellt sie sich unabhängig davon ein, dass wir über eine Sprache verfügen. Aus dem Umstand, dass die Angst vor der Sprache da ist, folgt aber nicht, dass sie im naturbelassenen ‚Keller’ eines Organismus anzusiedeln ist, auf welchen sich dann bei Wesen, die über eine Sprache verfügen, ein Stockwerk linguistischer Kompetenzen aufbaut.18 Richtig ist wohl, dass bei sprachlichen Wesen _____________ 17 18 Gunter Gebauer / Anna Stuhldreher: Das Sprachspiel der Emotionen, in: H. Landweer / U. Renz (eds.): Klassische Emotionstheorien. Von Platon bis Wittgenstein, Berlin-New York 2008, S. 613–634; Gunter Gebauer: Wittgensteins anthropologisches Denken, München 2009, S. 181 ff. Diese Vorstellung wird manchmal als „layer cake“-Modell bezeichnet; vgl. dazu Christoph Demmerling: Implizit und explizit. Überlegungen zum Verstehensbegriff im Anschluss an Heidegger und Brandom, a.a.O., S. 73. Zum Bild von Keller und Stockwerk und zur Kritik daran vgl. auch die kürzlich erschienene und für meine Überlegungen in jeder Hin- Christoph Demmerling 250 auch die Empfindungen, bei denen es sich um nichtsprachliche Phänomene handelt, in sprachliche Umgebungen eingebettet sind, durch welche sie als Ganze zu etwas anderem werden. Wittgenstein spricht an verschiedenen Stellen von Empfindungen als ‚primitiven’ Reaktionen.19 Primitiv sind Empfindungen in dem Sinne, dass sie keine Denktätigkeiten oder Handlungsaktivitäten voraussetzen, mit ihnen wird eben einfach auf etwas reagiert. Wittgenstein selbst charakterisiert diese primitiven Reaktionen als ‚vorsprachliche Verhaltungsweisen’: Was aber will hier das Wort „primitiv“ sagen? Doch wohl, daß die Verhaltungsweise vorsprachlich ist: daß ein Sprachspiel auf ihr beruht, daß sie das Prototyp einer Denkweise ist und nicht das Ergebnis des Denkens.20 Diese Bemerkung ist explizit gegen lingualistische Konzeptionen gerichtet: Empfindungen sind vorsprachliche Verhaltensweisen. Trotzdem hängen sie mit der Sprache zusammen, was durch die Ergänzung deutlich wird, welche darauf aufmerksam macht, dass Sprachspiele auf Verhaltensweisen beruhen. Zwischen Verhaltensweisen und Sprachspielen gibt es Verbindungen: vorsprachliche Verhaltensweisen sind Grundlagen von Sprachspielen, durch welche die Empfindung modelliert wird. Im Umfeld der zitierten Stelle spricht Wittgenstein sogar davon, dass es sich bei Sprachspielen, die an Empfindungen anknüpfen oder mit Empfindungen zusammenhängen, um den „Ausbau des primitiven Benehmens“ handelt.21 Diese Bemerkung lässt sich so verstehen, dass der Gebrauch einer Sprache zu einer Ausdifferenzierung des primitiven Benehmens führt. Die Rekonstruktion von Gebauer und Stuhldreher weist in diese Richtung, da sie darauf aufmerksam macht, inwiefern sich durch den Gebrauch der Sprache Gefühle und Empfindungen insofern verändern, als aus dem instinktiven Verspüren und Erfassen Muster gebildet werden, die dazu führen, den Gefühlen Gestalt und Kontur zu verleihen. Ohne dass der Begriff bei Gebauer und Stuhldreher eine Rolle spielen würde, bietet es sich an, in diesem Zusammenhang von einer Artikulation zu sprechen: Der Sprachgebrauch im Zusammenhang mit Empfindungen und Gefühlen verleiht diesen durch Gliederung eine Gestalt. Mit dem Begriff der Artikulation möchte ich auf folgenden Sachverhalt hinweisen: Mit der Sprache lernen wir nicht nur Laute zu artikulieren oder Zeichen zu gebrauchen, die uns dann primär dazu dienen, uns auf etwas in _____________ 19 20 21 sicht instruktive Arbeit von Matthias Jung: Der bewusste Ausdruck. Anthropologie der Artikulation, Berlin 2009, zum Beispiel 21. Vgl. dazu auch die Rekonstruktion von Gunter Gebauer / Anna Stuhldreher: Das Sprachspiel der Emotionen, a.a.O., S. 629 f.; Gunter Gebauer: Wittgensteins anthropologisches Denken, a.a.O., S. 182 ff., an deren Vorschlägen ich mich orientiere. Ludwig Wittgenstein: Zettel, in: Werkausgabe Band 8, Frankfurt a. M. 1984, 259-443, § 541. Vgl. ebd., § 545. Kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts 251 der Welt zu beziehen, sondern mit der Sprache erwerben wir die maßgeblichen Muster unseres Welt- und Selbstverständnisses. Muster, mit Hilfe derer sich uns die wesentlichen Aspekte der Welt und unserer selbst erschließen.22 Dadurch, dass wir etwas sagen und mit der Sprache Handlungen vollziehen, wird allererst der Rahmen eröffnet, innerhalb dessen wir uns auf etwas beziehen können. Dies wird auf besondere Weise deutlich, wenn wir über uns selbst sprechen, über jene Belange, die man gemeinhin in einer Seele oder Innenwelt verortet und die man – anders als raumzeitlich lokalisierbare Gegenstände in der Außenwelt – niemals direkt zu fassen bekommt oder wahrnehmen kann. Wenn jemand über seine Gefühle spricht, repräsentiert er nichts, was in ihm vorgeht, sondern er artikuliert etwas, was dadurch, dass es artikuliert wird, ausdrücklich gemacht werden kann. Indem man für ein Gefühl nach den passenden Worten sucht und sie findet, es in ein Muster oder eine Geschichte einbettet, verleiht man dem Gefühl einen identifizierbaren Inhalt, der mit anderen Inhalten in bestimmten Beziehungen steht bzw. in bestimmte Beziehungen gesetzt werden kann. Mit dem Artikulationsbegriff lässt sich deutlich machen, dass das Innere nicht einfach unmittelbar da und gegeben ist, dass es aber auch nicht in einem einfachen Sinne gemacht oder konstruiert ist. Als Artikulation bezeichne ich den Prozess, in dem einfache Empfindungen und Reaktionen mit den Mitteln der Sprache in einen Raum des Verstehens hineingestellt und zum Gegenstand von Explikationsbemühungen werden. So werden Gefühle verständlich. In diesem durch Artikulation eröffneten Raum gewinnen die spontanen und unwillkürlichen, einfachen Empfindungen und Regungen ihren Platz, indem sie als Bestandteile eines komplexen Welt- und Erlebniszusammenhangs erfahren werden. Freilich darf man sich den Prozess der Artikulation nicht durchgängig als eine aktive Leistung vorstellen. Im Fall von Wesen, die über eine Sprache verfügen, stellen sich Prozesse der Artikulation in vielen Fällen ‚unwillkürlich’ ein und die Strahlen der Sprache reichen bis in die einfachsten Empfindungen hinein, ohne dass diese darum selbst bereits etwas Sprachliches wären. Schmerzen zum Beispiel sind nichts Sprachliches, obwohl Schmerzen für sprachliche Wesen immer schon und von vorneherein in sprachliche Umgebungen eingebettet sind. Ich bezeichne diesen Umstand als apriorisches Perfekt der Artikulation. Im Sinne dieses apriorischen Perfekts gibt es für sprachliche Wesen kein Reich jenseits der Sprache, was aber nicht heißt, dass alle Phänomene im Leben sprachfähiger Wesen sprachliche Phänomene sind. Ohnehin ist die Sprache lediglich das prominenteste und expliziteste Medium der Arti_____________ 22 Mit diesem Begriff schließe ich an Überlegungen an von Charles Taylor: Bedeutungstheorien, in: ders.: Negative Freiheit, Frankfurt a. M. 1988, S. 53-117; zu den systematischen Möglichkeiten, welche der Begriff bietet, vgl. auch Matthias Jung: Der bewusste Ausdruck, a.a.O.; diese Arbeit enthält eine Vielzahl bedenkenswerter Überlegungen, setzt sich mit Wittgenstein in diesem Zusammenhang allerdings nur am Rande auseinander. 252 Christoph Demmerling kulation, aber auch Gestik und Mimik, Tanz und Musik, um nur einige auf der Hand liegende Beispiele zu nennen, können als Artikulationsmedien angesehen werden. Auf diffuse Weise bedeutsame Gehalte der Erfahrung, werden im Rahmen eines Artikulationsmediums aufgegriffen, wodurch sie explizit in eine semantische Dimension einrücken und explizierbar werden. Ein Beispiel mag an dieser Stelle dienlich sein. Aggressionsaffekte findet man bei sprachlosen ebenso wie bei der Sprache fähigen Wesen und es ist unstrittig, dass nicht nur erwachsene Menschen, sondern auch Tiere sich aggressiv verhalten können. Komplexe Differenzierungen der Aggression in Zorn, Ärger, Wut, Hass, Neid und Empörung werden jedoch erst durch die Einbettung der Aggression in eine sprachliche Umgebung eröffnet. Die Art der Aggression, die sich einstellt, wenn man etwa daran gehindert wird, eigene Pläne zu verfolgen (es stellt sich Ärger ein), unterscheidet sich von der Aggression, welche sich einstellt, wenn man der Auffassung ist, dass ein anderer hat, was man selber nicht hat, aber verdienen würde, während der andere es nicht verdient (hier ist die Rede vom Neid). Differenzierungen wie die zwischen Ärger und Neid oder anderen Aggressionsaffekten setzen differenzierte Einstellungen zur Welt, zu den Eigenschaften und Handlungen anderer Menschen voraus; Einstellungen, die sich ohne eine Sprache, mit Hilfe derer propositional strukturierte Gedanken formuliert werden können, nicht einnehmen lassen. Bereits mit dem Auftauchen von Aggressionsaffekten machen Lebewesen präkognitive und präreflexive Erfahrungen, in denen sich ihnen die Welt, oder besser: eine Situation in binnendiffuser Bedeutsamkeit präsentiert. Einzelne Aspekte der Situation können in diesem Zusammenhang noch nicht voneinander abgehoben werden. Etwas ist auf eine lediglich diffuse Weise bedeutsam, macht betroffen und zieht bestimmte Reaktionen nach sich. Hinsichten der Bedeutsamkeit und mit ihnen Aspekte der Situation können erst dort ausdifferenziert werden, wo ein Medium zu Verfügung steht, mit Hilfe dessen die Situation explizit gemacht werden kann wie beispielsweise mit den Mitteln der Sprache. Durch die Fähigkeit, etwas auf explizite Weise zu artikulieren, lassen sich vielfältige Bedeutsamkeitshinsichten von Situationen voneinander unterscheiden wie das Aggressionsbeispiel zeigt. Der Ärger bei der Verfolgung eigener Pläne aufgehalten zu werden (etwa anlässlich der Verspätung eines Zuges, der uns zu einer wichtigen Verabredung bringen soll), ist eine andere Art von Aggression als die Empörung über die Missachtung einer Norm durch jemand anderen (zum Beispiel anlässlich der mangelnden Loyalität eines Mitarbeiters). Wesen, die über eine Sprache verfügen, operieren immer schon mit solchen Differenzierungen und erfahren die qualitative Dimension der Aggression als etwas, was durch sprachliche Artikulation in einen Raum des Verstehens eingebettet ist. Kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts 253 Anlässlich des Beispiels ist zu konstatieren, dass viele Rekonstruktionen der Argumente Wittgensteins die Rolle der Sprache zu Recht akzentuieren. Die Analysen zu Empfindungen und Gefühlen im Kontext der Überlegungen Wittgensteins bleiben jedoch häufig unbefriedigend, weil die vielfältigen Aspekte sowie die unterschiedlichen Dimensionen des Erlebens nur unzureichend in Betracht gezogen werden. Wittgenstein war daran gelegen, das Verhältnis zwischen sprachlichen Ausdrücken und Empfindungen zu klären, die feinkörnige Beschreibung von Gefühlen stand nicht im Mittelpunkt seines Interesses. Die Rezeption der Philosophie Wittgensteins verläuft und verlief weitgehend unabhängig von der weit verzweigten Diskussion innerhalb der Philosophie der Gefühle. Möchte man für diese Debatte Kapital aus den Überlegungen von Wittgenstein schlagen, tut man gut daran, den sprachphilosophischen und gefühlstheoretischen Diskussionsstrang miteinander zu verbinden. Ich will an meine Bemerkungen zu Phänomenen erinnern, die man so beschreiben kann, als hätten sie sowohl eine körperliche wie auch eine geistige Seite. Statt von „seelischen Phänomenen“ zu sprechen, ziehe ich es vor, Phänomene der skizzierten Art als leibliche Phänomene zu bezeichnen. Den Begriff des Leibes verwende ich nicht als ein Synonym für den Ausdruck „Körper“. Betrachtet man etwas als Körper, dann betrachtet man dieses Etwas als einen Gegenstand in einer objektivierenden Perspektive, als etwas, was sich messen und wiegen lässt und einen bestimmten Platz in der physischen Welt einnimmt. Der Leib hingegen lässt sich als Medium personaler Existenz, als eine Voraussetzung für die Weltbezüge personaler Wesen ansehen. Alles, was uns angeht, sammelt sich im leiblichen Dasein. Wo Personen sind, ist der Leib immer schon da. Um von vornherein dem Missverständnis entgegenzutreten, es würde den Leib auf gleiche oder ähnliche Weise wie den Körper geben (es gibt keinen Leib neben dem Körper) schlage ich vor, den Ausdruck als Substantiv zu vermeiden und statt dessen vom leiblichen Spüren oder Befinden zu reden, denn nichts anderes ist „der Leib“. Er ist kein mystischer Doppelgänger, kein ätherischer Zwilling des Körpers. Gefühle sind leibliche Phänomene. Die Angst vor dem Geständnis, welche einem die Kehle zuschnürt, die nagenden Bisse des Neides sind leiblich gespürte Phänomene. Man kann nicht sagen, man habe Angst oder hege Neid, spüre das aber nicht und es gebe keine leibliche Manifestation dieser Gefühle. Gefühle sind Weisen des In-der-Welt-Seins oder des Sich-zur-WeltVerhaltens als Weisen des leiblichen Spürens. Es ist vor allem die phänomenologische Tradition innerhalb der deutschsprachigen Philosophie, in der häufig terminologisch zwischen „Leib“ und „Körper“ unterschieden wird. Bei näherem Hinsehen überrascht es, wie viele unterschiedliche, zum Teil einander ausschließende Leibphilosophien und -verständnisse der Leib-KörperUnterscheidung in der phänomenologischen Tradition verbreitet sind. Mein Christoph Demmerling 254 Vorschlag orientiert sich im Wesentlichen an den Überlegungen von Hermann Schmitz, der den Begriff des Leibes wie folgt einführt: Jedermann macht die Erfahrung, daß er nicht nur seinen eigenen Körper mit Hilfe der Augen, Hände u. dgl. sinnlich wahrnimmt, sondern in der Gegend dieses Körpers auch unmittelbar […] etwas von sich spürt: z.B. Hunger, Durst, Schmerz, Angst, Wollust, Müdigkeit, Behagen. Im Gegensatz zu den anderen modernen Sprachen besitzt die deutsche zwei Worte, die es leicht machen, den gemeinten Unterschied zu benennen: ,Körper’ und ‚Leib’.23 Leib, so eine Wendung, die man bei Schmitz oft finden kann, sei dasjenige, was man von sich selber spüre, ohne seine Sinne oder Hände zur Hilfe zu nehmen, wohingegen der Körper als dasjenige aufgefasst wird, was man von sich selbst sieht oder tastet und was im Prinzip auch von zweiten oder dritten Personen gesehen und getastet, gemessen und gewogen werden kann. Auch wenn diesem Vorschlag bestimmte Schwierigkeiten anhaften24, wird mit dem Leibbegriff bzw. mit der Kategorie des leiblichen Spürens ein Instrument zur Verfügung gestellt, welches es erlaubt, ein Verständnis unserer Rede über Inneres zu etablieren, das die dualistischen Voraussetzungen der Bewusstseinsphilosophie abstreift, ohne einer behavioristischen, mentalistischen oder lingualistischen Reduktion den Weg zu bereiten.25 Schmitz verfolgt im Grunde ein ganz ähnliches Ziel wie der mit Schneider gelesene Wittgenstein. Beide Ansätze lassen sich jedoch mit einem jeweils für sie spezifischen Problem konfrontieren. Mit phänomenologischen Analysen verbinden sich häufig verfehlte Unmittelbarkeitsansprüche, sprachanalytische Zugriffsweisen stehen immer wieder in der Gefahr am Ende, wenn auch ungewollt, bei einer lingualistischen Position zu landen. Vergegenwärtigen wir uns, wie Schneider den Status des Inneren charakterisiert: _____________ 23 24 25 Hermann Schmitz: System der Philosophie II.1. Der Leib, Bonn 1965, S. 5. Kritische Überlegungen zu Schmitz habe ich ausgearbeitet in Anna Blume / Christoph Demmerling: Gefühle als Atmosphären. Grenzen und Reichweite der neuen Phänomenologie, in: H. Landweer (ed.): Struktur und Funktion der Gefühle, a.a.O., S. 113-133; vgl. auch Christoph Demmerling: Gefühle, Sprache und Intersubjektivität. Überlegungen zum Atmosphärenbegriff der neuen Phänomenologie, in: K. Andermann / U. Eberlein (eds.): Gefühle als Atmosphären. Beiträge der Neuen Phänomenologie zur philosophischen Emotionstheorie, Berlin 2010 (im Erscheinen). Streng genommen ist die Erläuterung der Unterscheidung von Leib und Körper mit Hilfe der Differenzierung zwischen der Perspektive erster und der Perspektive dritter Personen ergänzungsbedürftig. Die Perspektive erster Personen kann über das eigenleibliche Spüren hinausgehen und sich auch auf die sinnlich vermittelte Wahrnehmung des eigenen Körpers erstrecken. So kann man Teile des eigenen Körpers sehen oder betasten. Außerdem lässt sich auch der Körper anderer als Subjekt leiblicher Vollzüge erfahren, wenn man ihn – zum Beispiel in der personalen Interaktion – nicht objektivistisch, sondern ‚quasi-erstpersönlich’ oder in der Perspektive zweiter Personen betrachtet. Diesbezügliche Überlegungen hoffe ich zu gegebener Zeit ausarbeiten zu können. Kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts 255 Das Seelische erkennen wir nicht, indem wir besondere Gegenstände aufsuchen, sondern indem wir schauen, wie die einschlägigen Sprachspiele funktionieren […] Zu betrachten wären demnach soziale Episoden, in die lebendige Menschen verstrickt sind. Eine genauere Untersuchung verlangt hier nicht das Isolieren eines phänomenalen Gegenstandes, sondern die Betrachtung von Geschichten, in denen Ausdrücke wie ‚Schmerz’ oder ‚Trauer’ gebraucht werden.26 Richtig ist, dass es in die Irre führt, besondere phänomenale Gegenstände zu postulieren, aber zum ‚Seelischen’ gehören nicht nur die Geschichten, in denen Ausdrücke für Empfindungen und Gefühle gelernt werden, sondern es handelt sich um Weisen des Weltbezugs, welche sich nicht nur sprachlich, sondern auch leiblich manifestieren und die Bedeutsamkeit einer Situation ausmachen.27 So ist es zum Beispiel für den Weltbezug von Gefühlen charakteristisch, eine qualitative Dimension aufzuweisen, wie neuere Vorschläge zum Verständnis affektiver Intentionalität zeigen.28 Die Überlegungen von Schmitz machen wie im Übrigen ja auch die Analysen von Wittgenstein oder Schneider deutlich, dass Gefühle antiindividualistisch aufzufassen sind und nicht als Gebilde, die in die Innenwelten oder Seelenkammern einzelner Subjekte eingesperrt sind. Gefühle sind nicht im Kopf, nicht im Gehirn, auch nicht im Herzen oder Bauch. Gefühle gehören auf eine bestimmte Weise in die Welt. Man kann die Gefühle anderer erkennen und die Gefühle anderer können auf die je eigene Befindlichkeit einwirken. Die überindividuelle Dimension von Gefühlen und auch der überindividuelle Zugang bzw. die Möglichkeit eines nicht-subjektiven Zugangs zu ihnen, hängt mit der Sprache zusammen. Der Zusammenhang zwischen Gefühlen, dem Zugang zu ihnen und der Sprache bedeutet aber nicht, dass die im Kontext von Gefühlen relevanten leiblichen Vollzüge auf Geschichten und sprachliche Unterscheidungen reduziert werden könnten. Ein entscheidender Schritt zu einem angemessen Verständnis der in die Innenwelt abge_____________ 26 27 28 Hans Julius Schneider: Religion, a.a.O., S. 90. Auch Schneider beschäftigt sich mit der Frage nach dem Leib. Aber das leibliche Spüren ist für Schneider primär unter dem Gesichtspunkt relevant, mit welchen sprachlichen Fortsetzungshandlungen sich an die verschiedenen Phänomene leiblichen Gewahrens anschließen lässt. Leibliches Gewahrsein wird als implizites Wissen von bestimmten Inhalten aufgefasst, welches sich nicht vollständig mit begrifflichen Mitteln zum Ausdruck bringen lässt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Rolle leiblicher Vollzüge damit ausreichend gewürdigt wird, wenn sie primär als Grundlage des Sprachhandelns aufgefasst werden. Vgl. Hans Julius Schneider: Die Leibbezogenheit des Sprechens. Zu den Ansätzen von Mark Johnson und Eugene T. Gendlin, in: Synthesis Philosophica 10 (1995), S. 81-95; ders.: Zwischen den Zeilen. Wittgenstein und Gendlin über die nicht-regelhafte Seite der Sprachkompetenz, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie (1997), 45/4, S. 415-428. Vgl. Jan Slaby: Gefühl und Weltbezug. Die menschliche Affektivität im Kontext einer existentialistischen Konzeption von Personalität, Paderborn, 2008; ders.: Affective intentionality and the feeling body, in: Phenomenology and the Cognitive Sciences 7 (2008), S. 429-444. Christoph Demmerling 256 drängten Phänomene könnte getan werden, wenn der Zusammenhang von leiblichen Vollzügen und sprachlichen Fähigkeiten eingehender expliziert würde. Die Erörterung dieses Zusammenhangs gehört zu den wichtigsten Aufgaben einer phänomenologisch aufgeklärten Sprachanalyse und einer sprachanalytisch aufgeklärten Phänomenologie. Sprachspiele, körperliche Verhaltensweisen und leibliches Spüren lassen sich nicht voneinander abspalten oder aufeinander reduzieren, sondern sind ineinander verwoben. Das leibliche Spüren und Erleben ist zunächst einmal ein materielles Phänomen jenseits von Diskursen, welches sich gegenüber der Sprache widerständig verhält. Aber leibliches Spüren und Diskurs greifen ineinander. Sprachspiel und Leiblichkeit gehören zusammen und der Artikulationsbegriff lässt sich als ein wichtiges Instrument zur Ausarbeitung dieses Zusammenhangs verwenden.29 Durch Artikulation wird etwas aufgegriffen, was auf eine bestimmte Weise da ist und doch nicht (ganz) da ist: eben kein Etwas und auch nicht ein Nichts. _____________ 29 Vgl. dazu auch die Arbeit von Matthias Jung: Der bewusste Ausdruck, a.a.O., für den der Begriff der Artikulation ebenfalls ein zentraler Schlüssel zum Verständnis der Zusammengehörigkeit von körperlichen und geistigen Prozessen ist. Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität E.T. Gendlins Philosophie des Impliziten und die Methode Thinking at the Edge („TAE“) Heinke Deloch Die Methode Thinking at the Edge wird eingesetzt, um Menschen gezielt dabei zu unterstützen, eigene, originäre Denkansätze zu entwickeln. Durch Einbeziehung des persönlichen Erlebens konkreter fachlicher Situationen werden systematisch neuartige Sichtweisen und Begriffsverwendungen entwickelt. Ähnlich der Vorgehensweise in therapeutisch unterstützten Veränderungsprozessen werden Widersprüche als mögliche Quelle der Veränderung gezielt gesucht. Dabei scheint die Methode Thinking at the Edge selbst auf einem Paradox zu gründen: sie fordert auf zu einem Denken, wo Worte noch fehlen – und hat zum Ziel, das noch Unsagbare zu sagen. Im Folgenden werde ich einige zentrale sprachphilosophische Annahmen vorstellen, die der Methode Thinking at the Edge zugrunde liegen. Die Bedeutung der Methode, so wie ich sie hier verstehe, liegt dabei nicht nur in der Möglichkeit, systematisch zu eigenständigem Denken anzuleiten. Sie kann darüber hinaus als Chance verstanden werden, unseren herkömmlichen Begriff des Denkens im Sinne logisch-rationaler Verstandesoperationen zu erweitern durch einen Begriff des experientiellen Denkens. Damit wäre Thinking at the Edge als eine Methode zu verstehen, die es erlaubt, eine neuartige Weise des Denkens zu erlernen, ein Denken, bei dem ich mich selbst als Denkende/r systematisch mit einbeziehe. i. Thinking at the Edge - eine Methode des experientiellen Denkens Die Methode Thinking at the Edge (deutsch: Denken, wo Worte noch fehlen, im folgenden abgekürzt mit TAE) wurde in den 90er Jahren von dem Philosophen und Psychologen E.T. Gendlin in Zusammenarbeit mit der Psychologin Mary Hendricks entwickelt. In den Folgejahren wurde TAE zu einer 14 258 Heinke Deloch Schritte umfassenden Methode weiter ausgearbeitet.1 Als Ausgangspunkt der Entwicklung von TAE kann der von E.T. Gendlin in diesem Zeitraum an der University of Chicago regelmäßig gegebene Kurs „Theory Construction“ betrachtet werden. Neben einer Einführung in Logik und Philosophie war es Ziel des Kurses, den Studentinnen und Studenten eine Unterstützung darin zu geben, eigenständige Forschungsbeiträge zu entwickeln. Mit TAE sollte es möglich werden, Dinge zu denken und zu sagen, die so bislang noch nicht gedacht und gesagt worden waren.2 Beim Thinking at the Edge geht es um eine Art des Denkens, die ich hier auch als experientielles Denken3 bezeichnen möchte. Wie ich noch zeigen werde, zeichnet sich dieses Denken durch seinen Bezugspunkt im eigenen Erleben aus. Das experientielle Denken unterscheidet Gendlin von dem vorherrschenden Begriff des Denkens in kleinsten, gleichförmigen Einheiten: What we call „thinking“ seems to require unitized things which are assumed to be either clearly identical or clearly separate, which can be next to each other but cannot interpenetrate, let alone have some more complex pattern.4 Gendlin nennt dieses Denkmodell das „klassische westliche Einheitenmodell“ („classical Western unit model“, ebd.) oder das „atomistische Einheitenmodell“. Es lässt sich bis hin zu Platon zurückverfolgen und findet beispielsweise _____________ 1 2 3 4 Beteiligt waren dabei Kye Nelson, Teresa Dawson, Nada Lou, vgl. M. Hendricks: From the Editor, in: The Folio 19 (2000-2004), S. ii. TAE eignet sich für die Erstellung und Begleitung wissenschaftlicher Arbeiten. In Deutschland wird die Methode in Workshops für Studenten und Dozenten gelehrt (derzeit an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung, Kehl und der LudwigMaximilians-Universität, München); sie wird auch verwendet, um einzelne wissenschaftliche Projekte zu begleiten. Besonders interessant ist die Methode auch für alle anderen Bereiche kreativen Arbeitens; etwa für Entwicklungsabteilungen in Unternehmen und für Gestaltende aller Art. Seit zwei Jahren wird die Methode auch im Bereich der Beratung eingesetzt, etwa für die Begleitung von Selbständigen bei der Entwicklung von Geschäftskonzepten. Mary Hendricks verwendet den Begriff „to think generatively“, was mit „fruchtbarem Denken“ übersetzt werden kann (Hendricks: From the Editor, a.a.O., S. vi). Kye Nelson bezeichnet es auch als grundlegendes Denken („thinking fundamentally“; dies.: Thinking fundamentally, unpublished paper). Ich bevorzuge den Begriff experientiell, da er die Erlebensqualität des Denkens hervorhebt und die Arbeit mit den körperlich spürbaren Anteilen als kennzeichnendes Merkmal der Methode TAE gelten kann. Der Begriff „experientiell“ (engl. "experiential“) wurde von Gendlin in den 60er und 70er Jahren verwendet, um seine Art der Psychotherapie als „experiential psychotherapy“ von anderen Formen der Psychotherapie zu unterscheiden. Den Begriff „experiential“ leitet Gendlin ab vom Begriff des „experiencing“, den er als englische Übersetzung von Diltheys Begriff des Erlebens gewählt hatte (vgl. dazu G. Stumm / J. Wiltschk / W. Keil: Grundbegriffe der Personzentrierten und Focusing-orientierten Psychotherapie und Beratung, Stuttgart 2003, S. 103). Gendlin: Introduction to ‘Thinking at the Edge’, in: The Folio 19 (2000-2004), S. 2. Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 259 einen klaren Ausdruck in dem von B. Russell eingeführten logischatomistischen Wissenschaftsbegriff. Dieser beruht auf der Vorstellung, die Realität könne erfasst und vollständig beschrieben werden durch Schaffung einer logisch perfekten Sprache. In einer solchen idealen Sprache „gäbe es für jedes einfache Objekt nur ein einziges Wort. Was nicht einfach ist, würde durch Kombinationen aus Wörtern für einfache Dinge ausgedrückt...“.5 Russell behauptet, eine solche Sprache würde es ermöglichen, die Verwirrungen unserer unscharfen alltagssprachlichen Unterscheidungen zu überwinden und „logische Atome“ zu identifizieren, die gleichzusetzen wären mit dem, „was es in der Welt wirklich gibt.“ (ebd., S. 184 und 250). Wie Gendlin darlegt, durchdringt das logisch-atomistische Denken unsere gesamte Sprache; auch unsere technischen Errungenschaften beruhten auf diesem Modell. Dennoch gebe es immer wieder Sachverhalte, die mit diesem Modell nicht gesagt und gedacht werden könnten, etwa dann, wenn vermeintlich verschiedene Gegenstände auf eine komplizierte Art miteinander identisch zu sein schienen. Anstatt jedoch zu versuchen, die verwickelten Zusammenhänge präzise zu entfalten, hörten wir normalerweise an einem solchen Punkt zu denken auf.6 Darüber hinaus beschreibe ein solches atomistisches Denken nur maschinenartige, unbelebte Prozesse adäquat, nicht aber lebendige.7 Zwar erlaube uns das „unitmodel“ durch logische Operationen zu erstaunlichen Einsichten und Möglichkeiten zu gelangen, dennoch helfe es uns nicht dabei, die zugrunde gelegten Einheiten selbst zu kreieren: „Logic is helpless to determine its own starting position.“8 Die einmal etablierten Kategorien würden außerdem als Abbilder der Realität begriffen, so dass ein „Darüberhinausdenken“ schwer falle. In vielen Fällen komme es gar zu einer Verwechslung der geschaffenen Konzepte mit der Realität selbst.9 Beim Denken gehe es in solchen Fällen nur noch um ein fruchtloses Kombinieren der eingeführten Begriffe, nicht aber um eine lebendige Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir leben (ebd.). Welcher Begriff von Wissenschaft und welche Vorstellung von Denken würden es uns jedoch ermöglichen, wieder zu einem frischen, einem lebendigen Denken zu gelangen? Will man nicht, wie Th. S. Kuhn ironisch bemerkt, darauf warten, dass die Hauptvertreter der etablierten Theorien aussterben und mit der jüngeren Generation neue Begriffe eingeführt werden, so ist es _____________ 5 6 7 8 9 Russell: Die Philosophie des logischen Atomismus, München 1976, S. 197. Vgl. Gendlin: Introduction, a.a.O., S. 2. Vgl. Gendlin / Johnson: Proposal for an international group for a first person science, New York 2004. Gendlin: Introduction, a.a.O., S. 7. Vgl. Gendlin: Focusing: The Body Speaks Form the Inside, Boston 2007. Heinke Deloch 260 erforderlich, die herrschende Denkweise durch ein neues Modell und andere Methoden des Denkens zu ergänzen.10 Die Frage, die Gendlin interessiert, und die der Methode TAE zugrunde liegt, ist: wie kommen wir dazu, Neues zu denken? Where does a scientist get a new hypothesis? They never tell you. (Audience laughter). Gendlin: Once in a while someone will write, "Oh, I developed the double helix from a dream." Or somebody will say, "I got this in the shower."11 Entgegen postmoderner Annahmen, dass alles, was wir denken können, allein ein Ergebnis unserer kulturellen und sprachlichen Sozialisation sei, stellt Gendlin die These auf, die Sprache selbst trage eine Kreativität in sich, die „mehr-als-logisch“ sei.12 Gendlin beruft sich in diesem Punkt auf Wittgensteins Sprachphilosophie, derzufolge das Funktionieren unserer Sprache sich nicht von festen Regeln einfangen oder vollständig beschreiben lässt, sondern Sprache vielmehr permanent in der Lage ist, neue Gebrauchsweisen zu entwickeln und die herrschenden logischen Strukturen zu durchbrechen.13 Das Sprechen selbst versteht Gendlin als körperlichen Prozess, wobei er den Körper als situativ begreift14. So ist beispielsweise die Wissenschaftlerin auch körperlich in ihre Forschungssituation eingebunden und dieses körperliche Involviertsein ermöglicht erst das Kommen ihrer Worte. Gendlin legt ein phänomenologisches Modell vor, das diese Verwicklung der Beobachterin mit dem Beobachtungsgegenstand konzeptualisiert.15 Die darin entwickelten grundlegenden Begriffe gehen vom Lebendigen aus. Sie sind prozesshaft und unterstellen keine separat gedachten Einheiten: “Instead of analyzing separated objects, one defines different kinds of experiential processes“16. Das Sprechen über die Forschungssituation wird dementsprechend nicht als ein Abbilden des Beobachteten gedacht, sondern, sofern es sich in Resonanz befindet mit dem Erleben der Situation durch die Forschende, als ein Vorantragen, Entwickeln der Forschungssituation als ganzer (vgl. dazu Abschnitt iii.). _____________ 10 11 12 13 14 15 16 Vgl. Th. S. Kuhn: The Structure of Scientific Revolution, Chicago 1962. Gendlin: Focusing, a.a.O. Gendlin: The New Phenomenology of Carrying Forward, in: Continental Philosophy Review 37 (2004), S. 128. Vgl. Gendlin: Introduction, a.a.O., S. 2; ders.: The New Phenomenology of Carrying Forward, a.a.O., S. 129; ders.: Thinking beyond Patterns: Body, Language, and Situations, in: den Ouden / Moen (eds.): The Presence of Feeling in Thought, New York 1991, A-1. Vgl. dazu Schneider: The Situatedness of Thinking, Knowing and Speaking: Wittgenstein and Gendlin, in: Levin (ed.): Language beyond Postmodernism. Saying and Thinking in Gendlin’s Philosophy, Evanston 1997. Gendlin: A Process Model, New York 1997. Gendlin / Johnson: Proposal, a.a.O., S. 1. Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 261 Die Methode TAE wurde entwickelt, um die oben erwähnte kreative Seite der Sprache, die es uns erlaubt, immer wieder neue Gedanken zu formulieren, auf systematische Weise zu unterstützen. Dies geschieht, indem auf das persönliche, oft nur schwer artikulierbare Erleben konkreter Problemsituationen Bezug genommen wird.17 Die Methode Thinking at the Edge ist besonders dann von Interesse, wenn bestehende Probleme nicht mehr innerhalb der vorherrschenden Paradigmen aufgelöst werden können bzw. wenn etablierte Paradigmen derart verfestigt sind, dass sie der Formulierung neuer Einsichten im Wege stehen (s.u.). Sie ist auch nützlich, wenn es darum geht, einen eigenen, originären Standpunkt angesichts der Vielfalt vorhandener Positionen zu artikulieren. Logisches und experientielles Denken werden dabei im Rahmen von Thinking at the Edge nicht als konträr aufgefasst; vielmehr werden sie als Vorgehensweisen betrachtet, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Abhängig von ihren unterschiedlichen Funktionen werden logisches und experientielles Denken im TAE-Prozess zu verschiedenen Zeitpunkten eingesetzt. So wird das experientielle Denken besonders intensiv im Anfangsstadium praktiziert, wenn es um die Entfaltung eines neuartigen Sprachgebrauchs geht, während das logische Denken erst später im Prozess für die Theoriebildung eingesetzt wird (zu den Phasen des TAE-Prozesses vgl. Abschnitt v-vii, die einzelnen Schritte sind nachlesbar in Gendlin: Introduction, a.a.O.). Diese Verknüpfung von experientiellem und logischem Denken macht die Besonderheit der Methode Thinking at the Edge aus. Angesichts dieser neuartigen Denkweise, die sogar den Anspruch erhebt, eine moderne Form des praktischen Philosophierens zu sein18, stellen sich unter anderem folgende Fragen: Unterliegen der Methode Thinking at the Edge Annahmen über einen dunklen, metaphysischen Bereich des Unsagbaren, das wie durch ein Wunder sagbar wird (vgl. Abschnitt ii)? In welchem Zusammenhang stehen Erleben und Sprache, so dass eine Bezugnahme auf das Erleben als Voraussetzung kreativen Sprechens gelten kann (iii)? Was ist unter einer solchen „Bezugnahme auf das Erleben“ zu verstehen (iv)? Wie werden diese philosophischen Annahmen in konkrete methodische Schritte umgesetzt (v-vii)? ii. Das Nicht-Sagbare Denken und Sagen: Ein absurder Versuch? Die Methode Thinking at the Edge setzt genau an jenem Punkt an, wo üblicherweise unsere Vorstellung vom Denken, aufhört: an jener Stelle, wo wir nicht mehr weiter wissen, d.h. wo wir auch nicht mehr klar sprechen kön_____________ 17 18 Vgl. Gendlin: Introduction, a.a.O., S. 4. Ebd., S. 4. Heinke Deloch 262 nen.19 Beim „Denken, wo Worte noch fehlen“ geht es gerade nicht darum, das Augenmerk auf das zu legen, was wir bereits wissen und sagen können, sondern auf das, was noch nicht gesagt werden kann. Das Wörtchen „noch“ kündigt dabei an, dass an diesem Punkt mehr gewusst, mehr gesagt werden könnte. Damit scheint die Methode von einem Bereich des Kognitiven zu handeln, der uns zwar irgendwie zugänglich ist, jedoch nicht sprachlich. Handelt es sich damit um einen Bereich, der, wie etwa Wittgenstein in seiner frühen Philosophie für das Mystische unterstellt, sich nur zeigen, über den man jedoch nicht sprechen könne?20 Würde aber die Annahme eines solchen kognitiven Bereichs des NichtSagbaren nicht einen Rückfall bedeuten hinter die sprachphilosophischen Einsichten des letzten Jahrhunderts? Wittgenstein selbst hatte sich in seinem späteren Werk gegen einen Mentalismus ausgesprochen, der unterstellt, das Seelische sei ein prinzipiell von unserer Sprache unabhängiger Bereich, der im besten Fall - sprachlich benannt werden könnte. In diesem Zusammenhang formuliert Wittgenstein ebenfalls seine Kritik an der Vorstellung, das Meinen sei ein unabhängig vom Sprechen stattfindender mentaler Vorgang, der sich auf einen ebensolchen, unabhängig vom Sprechen wahrnehmbaren mentalen Inhalt, das Gemeinte, beziehe. Mit seiner Untersuchung des Wortgebrauchs von „meinen“ zeigt Wittgenstein hingegen, dass das Gemeinte durch den Kontext der Äußerung und die sprachlichen Anschlusshandlungen identifizierbar wird.21 Demzufolge ist das, was gemeint ist, nicht als ein von _____________ 19 Wie Gendlin bemerkt dauerte es mehrere Wochen, bis schließlich die Studentinnen und Studenten seines Kurses verstanden hatten, dass die übliche Vorstellung des Denkens beim „Denken, wo Worte noch fehlen“, umgekehrt wurde und dass nicht dasjenige zählte, was klar gesagt werden konnte, sondern dasjenige, was lediglich unklar, vage, schwammig... geäußert werden konnte (ders.: Introduction, a.a.O., S. 1). 20 Vgl.: Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt a. M. 1984, 6.522. Seinen Versuch, eben das zu sagen, was sich nicht sagen lässt, veranschaulicht Wittgenstein mit dem Bild einer Leiter, die der Leser, nachdem er sie benutzt habe, wegwerfen solle. 21 Ob etwa jemand, der auf einen Gegenstand zeigt und zugleich einen Begriff äußert, die Form oder die Farbe des Gegenstands meint, ist nicht durch einen bestimmten inneren Vorgang gekennzeichnet, der in diesen Situationen vorliegt, sondern durch die Umstände der Wortverwendung: „d.h.... das, was vor und nach dem Zeigen geschieht...“ (Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a. M. 1984, §35) Die Vorstellung, das Meinen sei so etwas wie eine geistige Tätigkeit, die sich auf einen Gegenstand, das Gemeinte beziehe, rührt von einem Missverstehen der „Oberflächengrammatik“ dieser Wörter: „meinen“ wird grammatikalisch an der gleichen Stelle im Satz verwendet, wie andere Tätigkeitswörter auch, und die Rede von dem, was ich meinte, ist gegenständlicher Art. Wie H.J. Schneider ausführlich gezeigt hat, liegen hier syntaktische Metaphern vor, d.h. die Übertragung von Satzstrukturen (etwa der gegenständlichen Rede) auf Kontexte anderer – hier: nicht gegenständlicher – Art. Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 263 der Sprechsituation entkoppelter mentaler Gegenstand zu verstehen, sondern die Sprechsituation und das Geäußerte selbst sind Kriterium für das, was gemeint ist.22 John Searle, der sich im Rahmen seiner Sprechakttheorie auf Wittgensteins Sprachphilosophie stützt, folgert daraus, dass man „alles, was man meinen, auch sagen kann.“23 Nach Searles Prinzip der Ausdrückbarkeit ist alles, was irgendwie als sinnvoll begriffen werden kann, zugleich auch sagbar.24 Muss folglich die Methode des „Denkens, wo Worte noch fehlen“, als ein absurder Versuch betrachtet werden, das Unsägliche sagen zu wollen und auf diese Weise einer dunklen Metaphysik, die wir dachten, mit Hilfe der Sprachkritik hinter uns gelassen zu haben, Tür und Tor zu öffnen? Ist diese Vorgehensweise Ausdruck einer verbohrten Philosophie, die nicht einsehen will, dass die Grenzen unserer Sprache auch die Grenzen unserer Welt sind (Wittgenstein: Tractatus, a.a.O., 5.6)? Wer ihr folgt, müsste sich dann darauf gefasst machen, sich „Beulen“ zu holen, beim Anrennen gegen die (nicht akzeptierten) Grenzen unserer Sprache.25 Es ist an dieser Stelle also zu fragen: in welcher Hinsicht ließe sich sinnvollerweise von einer Situation des Denkens, wo Worte noch fehlen, sprechen? Die durch Wittgensteins Mentalismuskritik vermittelte, wichtige Einsicht besteht darin, dass Sprache nicht funktionieren könnte, wenn Bedeutungen etwas strikt Privates, für Dritte Unsichtbares und Unzugängliches wären. Zu fragen ist aber, wie die Aussage, Wortbedeutungen würden durch ihre Einbettung in sprachliche und nicht-sprachliche, soziale Handlungsweisen konstituiert, zu verstehen ist. Bedeutet dies wiederum, dass Bedeutungen etwas strikt Soziales haben? Und haben ein Wort, eine Tat, eine Situation immer nur genau diejenige Bedeutung, die ihnen durch die bestehende regelhafte Praxis verliehen wird? Mit anderen Worten: sind Bedeutungen immer schon durch _____________ 22 23 24 25 (Schneider: Mentale Zustände als metaphorische Schöpfungen, in: Kellerwessel / Peuker (eds.): Wittgensteins Spätphilosophie, Würuburg 1998). Wittgenstein drückt dies folgendermaßen aus: „Wo unsere Sprache uns einen Körper vermuten lässt, und kein Körper ist, dort, möchten wir sagen, sei ein Geist.“ (Wittgenstein 1984a: §36). Dazu gehören auch die weiteren Umstände der Sprechsituation, etwa die nachfolgende Klarstellung meiner Intention in Sätzen wie: „ich wollte damals sagen....“ (vgl. Wittgenstein 1984a: §660). Searle: Sprechakte, Frankfurt a. M. 1997, S. 34. Schneider zeigt: Searles Sprachphilosophie unterstellt dabei, das Gemeinte sei etwas, das schon vor der Äußerung fertig vorhanden war und worauf sich die Äußerung bezieht (Schneider 2003: 3). Dies sei jedoch eine „von Philosophen in Umlauf gebrachte Fiktion“, denn es sei nicht möglich, Bedeutungen unabhängig vom sprachlichen Ausdruck zu erfassen. „Über Bedeutung zu sprechen, heißt, wie schon gesagt, über Zeichen unter dem Aspekt ihres Gebrauchs zu sprechen.“ (ebd.). Vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 119. Heinke Deloch 264 ihre sozialen Kontexte vollständig festgelegt und damit allgemeiner Natur? Oder lässt sich auch sinnvoll von einer Ebene der noch unklaren, noch nicht festgelegten, ja vielleicht sogar individuellen Bedeutung sprechen?26 Blicken wir zunächst noch einmal zurück auf sein Frühwerk, in welchem Wittgenstein von einem Bereich des Kognitiven spricht, bzgl. dessen unsere Sprache zu kurz zu greifen scheint und wir nicht hinkommen mit unserer sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, unseren zur Verfügung stehenden sprachlichen Mitteln. Wittgenstein nennt diesen Bereich „das Mystische“ (Wittgenstein: Tractatus, a.a.O., 6.522). Dabei gilt für Wittgenstein zunächst all das als unaussprechlich, was sich nicht mit empirischen oder logischen, sprich: naturwissenschaftlichen Sätzen, ausdrücken lässt (ebd., 6.53). Hier gilt somit die strikte Alternative: „Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen“ und „... was jenseits der Grenze liegt, wird einfach Unsinn sein.“ (ebd., S. 9). Welche Lebensbereiche sind es, die hier unaussprechlich erscheinen? Wittgenstein geht es, wenn er im Tractatus vom Mystischen spricht, nicht um „logische Fragen in einem bloß technischen oder ‚akademischen’ Sinn“, sondern um „Tiefsinniges und Lebensbedeutsames“27. Insofern Fragen wie etwa die nach dem Sinn des Lebens nicht mit empirischen oder logischen Sätzen zu beantworten sind, scheint es verständlich, dass Wittgenstein derartige Überlegungen als unaussprechlich bezeichnen muss. Gehen wir jedoch von seiner späteren Philosophie aus, so lässt sich zeigen, dass jener Bereich des Lebensbedeutsamen durch Schaffung entsprechender sozialer Verwendungszusammenhänge genauso zur Sprache gebracht werden kann wie empirische Fragestellungen. Demnach wären beispielsweise Dichtung und Kunst, Gottesdienste und Psychotherapie als Praktiken und Zusammenhänge zu verstehen, die als Artikulationsformen des Lebensbedeutsamen dienen können. In welcher Weise lassen sich aber beispielsweise diese Praktiken verstehen als Versuche des „Denkens, wo Worte noch fehlen“? Sind sie nicht vielmehr Beweis für die Gültigkeit des Prinzips der Ausdrückbarkeit, demzufolge sich alles, was man meinen kann, auch sagen lässt? Wäre Searles Prinzip der Ausdrückbarkeit tatsächlich so zu verstehen, dass für jeden Ausdruck A ein alternativer, präziser Ausdruck E angegeben _____________ 26 27 Wir alle verstehen das Wort „Mutter“. Doch ist die Bedeutung des Wortes „Mutter“ vollständig durch unsere gesellschaftliche Gebrauchsweise dieses Begriffs festgelegt? Gibt es nichts, was darüber hinaus weist? Gibt es keinen Spielraum oder keine persönliche Färbung im Verständnis dieses Wortes? Natürlich, scheint man antworten zu wollen, bedeutet das Wort „Mutter“ für jeden auch etwas ganz Individuelles. Es könnte daher durchaus plausibel sein, zwischen einem Allgemeinverständnis dieser Begriffe und einem individuellen Verständnis zu unterscheiden. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als leugne Wittgenstein in seinem Spätwerk diese Ebene der individuellen Bedeutungen. Schneider: Das Prinzip der Ausdrückbarkeit, a.a.O., S. 1. Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 265 werden könnte, der mit A zusammen fällt, so wäre das Prinzip, wie Schneider bemerkt, tautologisch. Es würde dann heißen: Für die Bedeutung des Ausdrucks A und jeden Sprecher S ist, wann immer S die Bedeutung von A meint, ein Ausdruck E möglich derart, dass E ein exakter Ausdruck oder eine exakte Formulierung der Bedeutung von A ist. Dies aber würde bedeuten: Was immer sich in einem präzisen Sinne meinen lässt, das muss etwas sein, das bereits präzise formuliert wurde.28 Dies aber würde bedeuten, dass wir tatsächlich in unserer Sprache gefangen wären und es unmöglich wäre, jemals etwas Neues, etwas Eigenes oder Originelles zu sagen. Dies käme einer Negierung der schöpferischen Kraft unserer Sprache gleich. Ließe sich aber umgekehrt, sinnvollerweise behaupten, dass Bedeutungen einerseits durch regelhafte Verwendungsweisen von Wörtern konstituiert werden, gleichzeitig aber auch von einer Bedeutung gesprochen werden kann, die noch nicht ausdrückbar sei? Können wir also sinnvollerweise von einem Fall des Meinens sprechen, bei dem das Gemeinte eine noch unklare Bedeutung hat, d.h. wo uns eine Bedeutung, wie H.J. Schneider sagt, bloß „vage vorschwebt“ und wir „sprachlich herumfuchteln“ (ebd.)? Mit anderen Worten: Wie können wir, ausgehend von Wittgensteins Bedeutungsbegriff, sinnvollerweise von einer Situation sprechen, in der wir etwas sagen wollen, es aber noch nicht sagen können? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen Schritt zurück treten und auf das Verhältnis von Sprache und Welt blicken. Unsere Sprache, unsere Handlungsweisen, unsere Kultur geben uns einen Rahmen, innerhalb dessen wir Ordnung und Struktur erleben – und dennoch können sie nie das Leben als ganzes umfassen und regeln. Immer wieder entstehen neue Situationen, die eines neuen Umgangs bedürfen. Immer wieder werden wir uns daher bewusst, dass unsere sprachlichen und nicht-sprachlichen Regelsysteme von uns zu bestimmten Zwecken geschaffen sind, aber auch im Laufe der Zeit der Revision bedürfen – in dem Maße, wie sich die Lebensbedingungen und die gesetzten Zwecke verändern. Dies gilt für alle Bereiche des Lebens und Handelns, nicht nur für Fragen des „Lebensbedeutsamen“, sondern auch für empirische, logische und andere wissenschaftliche Fragestellungen. Alle Bereiche, die in Zusammenhang mit der menschlichen Kultur und den von Menschen geschaffenen Symbolsystemen stehen, unterliegen einem solchen „Zwang“ zur Veränderung.29 Jüngstes Beispiel dafür ist die Finanzkrise: wir sind gezwungen, andere Handlungsoptionen innerhalb unseres Wirtschaftssystems zu finden und aus _____________ 28 29 Ebd., S. 3. Vgl. Wittgenstein: Über Gewißheit, Frankfurt a. M. 1984, § 96-99. Heinke Deloch 266 diesem Grunde blicken wir zurück auf die Vergangenheit und ordnen vergangenes Denken und Handeln neu ein: die Kategorien der verlässlichen Investition, der sicheren Geldanlage, des Risikos, etc. sind demgemäß wieder neu zu definieren. Was zuvor als sicher und Erfolg versprechend galt, gilt nun als bedrohlich. Wir sind an einem Punkt, an dem die herkömmlichen Kategorien und Denkweisen zur Charakterisierung der aktuellen Situation und vor allem – für die Suche nach einem Weg hinaus aus dieser Situation, nicht ausreichen oder sich sogar als falsch erwiesen haben. Die neuen Inhalte, die hier artikuliert werden sollen, sind freilich noch nicht sprachlich verfasst. Das, was wir meinen, wenn wir versuchen, in derartigen Umbruchsituationen Worte zu finden, ist noch nicht klar sagbar. Eine Situation, in der wir mit dem herkömmlichen sprachlichen Ausdrucksweisen nicht mehr sagen können, was wir gerne sagen würden, nennt Gendlin „the edge“. Es handelt sich genauer gesagt, um die Schnittstelle zwischen dem, was bereits „expliziert“, d.h. gesagt und verstanden ist, und dem, was noch nicht gesagt und verstanden ist. Gendlin nennt dies auch „the implicit“ (das „Implizite“) oder „the implicit intricacy“ (die „implizite Verwickeltheit“) oder „the implied meaning“ (die „implizite Bedeutung“)30. Entgegen unserer üblichen Haltung, in Situationen des „Herumtastens“, die noch vagen Äußerungen zu entwerten, fordert Gendlin uns auf zu sehen und zu würdigen, was alles in einer solchen Situationen vorhanden ist: So bin ich als Person da, in mitten meiner Situation, und ich verbinde vielleicht eine gewisse Hoffnung mit dem Thema, um das es geht, vielleicht verfolge ich auch eine undeutliche Spur, etwas, das vielversprechend scheint... und es ist alles da, was ich jemals gelernt habe (ebd., S. 130). Dies alles ist vorhanden, nur nicht in einer Form, in der es unmittelbar durch logisches Denken weiter verarbeitet werden kann. Es zeigt sich in einer „Verwickeltheit“, einer komplexen Situation („unseparated multiplicity“, ebd., S. 138) – und dennoch ist dies nicht einfach eine Unordnung, ein Durcheinander. Gendlin spricht von einer sehr feinen Ordnung des Impliziten, die vielleicht noch nicht ganz klar ist, die sich aber entfalten ließe (ebd., S. 130.). Das Implizite, Neue, das sich mittels der vorhandenen Kategorien nicht sagen lässt, ist notwendigerweise an die Erlebensperspektive von Subjekten gebunden. Es ist zunächst als etwas Körperliches wahrnehmbar, etwa als eine Art Unbehagen, eine Nervosität, eine Euphorie... Und hier, in dieser Erkenntnis, findet sich bei Gendlin eine entscheidende Erweiterung des Wittgenstein’schen Bedeutungsbegriffs (vgl. auch Abschnitt iii). Gendlins These lautet: Aufgrund seiner vielfältigen Erfahrungen in einem Fachgebiet oder Lebensbereich hat das Subjekt ein körperlich spürbares Empfinden für das, was neben den bereits formulierten Erkenntnissen von Bedeutung ist, aber _____________ 30 Gendlin: The New Phenomenology, a.a.O., S. 131 und 132. Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 267 noch nicht gesagt werden kann. Gendlin nennt dieses unklare körperliche Empfinden „felt sense“ („sinnhaftes Gefühl“ oder „gespürte Bedeutung“): Worauf ich mich beziehe, ist die Schicht des Unbewussten, die wahrscheinlich als nächstes an die Oberfläche kommt. Dies wird zuerst körperlich gespürt, ist noch nicht bekannt oder geöffnet, noch nicht im „Vorbewussten“. Für diese Schicht hatte Freud keinen Begriff. Ebenso wenig gibt es dafür einen Begriff in der normalen Sprache. Wir nennen es nun einen „Felt Sense“.31 Gendlin illustriert dies am Beispiel eines Piloten, der einen Flug aufgrund der Wetterlage absagt, obwohl man laut Wetterbericht hätte fliegen können. Ohne dass der Pilot genau sagen könnte, warum er dem Wetter nicht traut, hat er doch ein ungutes Gefühl, eine Ahnung, dass es nicht gut wäre zu fliegen.32 Angenommen, das Wetter änderte sich tatsächlich, so wäre es von unschätzbarem Wert, wenn der Pilot artikulieren könnte, was genau ihn vom Fliegen abgehalten hat.33 Mit dem herkömmlichen Sprachgebrauch, den etablierten meteorologischen Kategorien ist dies nicht möglich. So erscheint die Einschätzung des Piloten als irrational, unverständlich. Die Artikulation des „Neuen“, das ihn davon abhält zu starten, würde es erfordern, eben jenem „unguten Gefühl“, jener Ahnung, d.h. jenem bislang nicht präzise artikulierbaren Bezugspunkt nachzugehen, der als solcher noch nicht verstanden ist. Das Finden von Worten, die bislang fehlen, wäre dabei nicht zu verstehen als ein Abbilden eines bislang verborgenen Wissens, sondern als Weiterführung oder sogar Weiterentwicklung dessen, was als bedeutungsvoll erlebt wird: New phrasing is possible because language is always implicit in human experiencing and deeply inherent in what experiencing is. Far from reducing and limiting what one implicitly lives and wants to say, a fresh statement is physically a further development of what one senses and means to say.34 _____________ 31 32 33 34 Gendlin: Focusing. Technik der Selbsthilfe bei der Lösung persönlicher Probleme, Salzburg 1987, S. 37. Gendlin: Introduction, a.a.O., S. 2. Es wird von verschiedenen Wissenschaftlern berichtet, dass ihrer Artikulation neuer Theorien ein solches Stadium des bewussten körperlichen Spürens vorher ging, z.B. Michael Brown, Nobelpreisträger in Chemie, oder Stanley Cohen, Nobelpreisträger in Medizin, vgl. Fensham & Marton: What happened to intuition on science education?, in: Research in Science Education 22 (1992), S. 114-122. Gendlin: Introduction, a.a.O., S. 5. Das, was implizit ist bzw. war, kann immer erst rückblickend identifiziert werden, nämlich dann, wenn es expliziert wurde und damit Teil des begrifflichen Denkens geworden ist. Gendlin begreift das Implizite daher auch als Teil einer internen Relation zwischen implying (Implizieren) und occurring (Eintreten). „Intern“ heißt dabei: beide Relata sind nicht unabhängig voneinander identifizierbar: so ist das, was eintritt, immer erst identifizierbar als Entfaltung von etwas Impliziten, das Implizite dagegen ist immer nur identifizierbar im Hinblick auf seine Äußerung, das Eingetretene (vgl. dazu auch Hendricks: From the Editor, a.a.O., S. iii). Heinke Deloch 268 Damit wird deutlich: Beim Thinking at the Edge geht es nicht um eine Gegenüberstellung von Empirischem und Metaphysischem oder von Sichtbarem und Unsichtbarem, sondern von dem mit dem herrschenden Sprachgebrauch Sagbaren und dem noch nicht Sagbaren. Mit letzterem sind bedeutungsvolle Erlebensanteile gemeint, die aufgrund der herrschenden Denk- und Sprachkonventionen bislang nicht adäquat in Worte gefasst werden können. Besonders deutlich wird dies in Umbruchoder Zukunftssituationen, in denen wir um Worte ringen für das, was wir aufgrund unserer komplexen Erfahrungen als bedeutsam erleben, was aber mit den etablierten sprachlichen Routinen bislang nicht sagbar ist.35 Es stellt sich nun die Frage, wie genau die Relation von Sprache und Erleben von Gendlin gedacht wird, so dass einerseits beide nie strikt zu trennen sind und doch aus dem Erleben heraus neue Bedeutungen entstehen können. iii. Zum Verhältnis von Bedeutung und Erleben bei Gendlin In seiner Dissertation Experiencing and the Creation of Meaning (Evanston 1962), untersucht Gendlin das Verhältnis von Sprache und dem eigenen, persönlichen Erleben. Beide, Sprache und Erleben, stehen, so Gendlin, in einem inneren Zusammenhang: Worte, Phrasen, Dinge, Menschen – alles, was im weitesten Sinne als Symbol fungieren kann, hat nur dann eine Bedeutung, wenn es in Beziehung zu unserem Erleben steht.36 In dieser Hinsicht ist die Bedeutung selbst eine Dimension des Erlebens. Dieser Zusammenhang wird auch mit dem Ausdruck „felt sense“ (zunächst als „felt meaning“ bezeichnet, ebd.) betont, der übersetzt werden kann mit „erlebte“ oder „gefühlte Bedeutung“ oder „erlebter“ bzw. „gefühlter Sinn“. Wenn Gendlin von „Erleben“ spricht, meint er keine begrifflich unterschiedenen Inhalte unserer Wahrnehmung, sondern unseren nie abreißenden Erlebensfluß, dem wir uns jederzeit innerlich zuwenden können (ebd., S. 3). Sprachliche – und andere - Symbolisierungen betrachtet Gendlin nicht als eigenständige und vom Erleben trennbare Vorgänge, wie es die Rede von den Funktionen der Symbolisierung und des Erlebens nahe legt. Er schlägt daher vor, von den symbolischen Funktio_____________ 35 36 Wie Gendlin zeigt, gilt dies genau genommen, immer dann, wenn wir von unserem persönlichen Erleben her sprechen, da dieses immer mehr, immer genauer, immer präziser ist, als sozial etablierte Redeweisen über Gefühle, Bedürfnisse, Erwartungen etc. (vgl. Gendlin: Process Model, a.a.O., S. 217f). „We cannot even know what a concept „means“ or use it meaningfully without the „feel“ of its meaning. No amount of symbols, definitions, and the like can be used in the place of the felt meaning. If we do not have the felt meaning of the concept, we haven’t got the concept at all – only a verbal noise.“ (Gendlin: Experiencing and the Creation of Meaning, Evanston 1962, S. 5f). Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 269 nen des Erlebens zu sprechen (ebd., S. 97). Als Symbol kann alles dienen, was die Rolle eines Symbols einnehmen kann (auch Personen, Dinge, Situationen...), also nicht nur Zeichen (ebd., S. 90). Die Bezugnahme auf das Erleben anhand von Symbolen betrachtet Gendlin nicht als Repräsentation oder Abbildung. Vielmehr sind die Symbolisierungen zu verstehen als mehr oder weniger stimmige „Antworten“ auf das Erleben, die dieses selbst – im Fall der Stimmigkeit – weiter voran tragen (Gendlin nennt dies „carrying forward“). Ebenso „antwortet“ das Erleben auf alles Symbolische, auch wenn dies nicht immer bewusst ist. Erleben und seine Symbolisierungen werden als Aspekte einer „responsive order“ verstanden.37 Indem er grundlegende phänomenologische Begriffe zur Beschreibung einer solchen „responsive order“ prägt, entwirft Gendlin eine Alternative zum atomistischen Wissenschaftsparadigma, das Untersuchungsgegenstände wie beispielsweise die menschliche Psyche in empirisch messbare Zustände und Vorgänge unterteilt und diese von den verwendeten sprachlichen Kategorien entkoppelt. Gleichzeitig entwirft Gendlin ein Gegenmodell zum postmodernen Verständnis eines den Untersuchungsgegenstand konstituierenden Charakters der Sprache. So versteht die „Philosophie des Impliziten“ Sprache immer schon als im Erleben inbegriffen, gleichwohl das Erleben als stets über die Sprache hinausgehend.38 Mit anderen Worten: Sprachliche Kategorien spielen zwar immer schon eine Rolle im Erleben, doch sie legen es nicht fest. Das Erleben ist immer reichhaltiger, immer mehr, als sich durch die Begriffe sagen lässt. Unsere begriffliche Auseinandersetzung mit der Welt kann deshalb nur als eine weitere Differenzierung unseres Erlebens gelten, das, insofern wir als lebendige Organismen in ständiger Auseinandersetzung mit der Welt befindlich sind, stets umfassender ist: Your body is not a machine, rather a wonderfully intricate interaction with everything around you, which is why it „knows“ so much just in being. ... The different cultures don’t create us. They only add elaboration. The living body is always going beyond what evolution, culture and language have already built.39 Gendlins phänomenologische Beschreibungen der Begriffe „Körper“ und „Umwelt“ sind prozessorientiert: der Körper ist kein von der Umwelt losgelöstes Ding, das durch kausale Wechselwirkungen in Interaktion gerät, sondern Körper und Umwelt werden als Aspekte desselben Prozesses gedacht. _____________ 37 38 39 Vgl. Gendlin: The New Phenomenology, a.a.O., S. 128. Vgl. Gendlin: Experiencing and the Creation of Meaning, a.a.O.; ders.: Thinking beyond Patterns, a.a.O., S. 4. Gendlin: Focusing, New York 2003, S. viiif. 270 Heinke Deloch Body and en (gemeint ist hier: En#2, d.h. Gendlins zweiter Begriff von „environment“) are one event, one process. For example, it is air-coming-into-lungs-and-blood cells. Either way it is one event, viewed as en or as body.40 In these definitions process is first. We don’t assume the „body“ and the „environment“ and then put them together.41 Veränderungen der Umwelt bedeuten insofern im selben Moment bereits eine Veränderung des Körpers. Dieser ist daher immer in Veränderung begriffen. Jede Lebenssituation zugleich trägt die Möglichkeit eines Entfaltungsschrittes in sich: „The body is always sketching and probing a few steps further. Your ongoing living makes new evolution and history happen – now.”42 Jedoch läuft dieser Entwicklungsprozess nicht notwendigerweise ab. Unsere begrifflichen Vorstellungen und kulturellen Muster können vielmehr zum Hindernis einer solchen natürlichen, organismischen Entwicklung werden. Verfestigen sich unsere Lebenszusammenhänge und –vorstellungen sowie unsere Vorstellungen von der Welt, so nehmen wir nicht mehr am aktuellen Veränderungsprozess teil.43 Gendlin nennt diesen „Zustand“ auch „pausing“: anstatt mit unserem Handeln und Denken unsere Situation voranzubringen, verharren wir in immer gleichen Handlungs- und Denkschleifen (Gendlin: A Process Model, a.a.O., VIIB f.)12.). Er betrachtet die meisten unserer heutigen hoch symbolischen Lebenszusammenhänge und Tätigkeiten als entkoppelt von organismischen Prozessen und deren Wahrnehmung.44 Fehlt dieser Bezug zum Erleben, so hantieren wir mit leeren Worthülsen und unser Denken verliert seine Lebendigkeit, bis es schließlich ganz verödet: „... that way thin_____________ 40 41 42 43 44 Gendlin unterscheidet vier verschiedene Umweltbegriffe (vgl. ders.: Process Model, a.a.O., Kap.1). Beide Zitate: Ebd., S. 1 und 5. Gendlin: Focusing, a.a.O. In der Psychotherapie wird dabei von strukturgebundenem Verhalten gesprochen; es handelt sich um Gewohnheiten, die wir aufgrund strikter Vorstellungen von uns selbst und unserer Umwelt ausüben, ohne sie an Veränderungen anzupassen oder negative Auswirkungen durch Verhaltensänderungen abzufangen. Rogers unterscheidet dabei verschiedene Stufen der Strukturgebundenheit, vom strikt strukturgebundenen Verhalten hin zur „fully functioning person“, die in gutem Kontakt zum eigenen Erleben steht und flexibel auf Veränderungen reagieren kann (Rogers: Klientenzentrierte Psychotherapie [1980], in: Rogers / Schmid (eds.): Person-zentriert, Mainz 1991). Gendlin spricht deshalb auch von „thinned actions“. Dies bedeutet, dass mit vielen unserer heutigen Tätigkeiten kein organismisches Erleben mehr einher geht (ders.: A Process Model, a.a.O., S. 228). Er meint damit Handlungen und Routinen unseres urbanen, bildungsbürgerlichen Lebens, von denen die meisten eher symbolischer denn körperlicher Natur sind (ebd., VIIIAb). Zwar können zeitgenössische kulturelle Verhaltensmuster als Verwicklungen vieler impliziter Handlungsmöglichkeiten betrachtet werden, jedoch geht mit ihnen meist kein individuelles, körperlich spürbares Wachstum einher. Obwohl wir also in einem Kontext reichhaltiger Möglichkeiten/Bedeutungsräume leben, sind unsere Handlungen, vom körperlichen Erleben her betrachtet, eher mager, oder, wie Gendlin sagt, „ausgedünnt“ (ebd., VIIB f.)12). Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 271 king dies“45. Leider ist es diese „ausgedünnte“ Version des Denkens, die heute an vielen Schulen und Universitäten praktiziert wird.46 Dies jedoch bedeutet nicht, dass ein lebeindiges Denken unmöglich geworden wäre: Überall, wo der Mensch über Erfahrung verfügt, ist er auch organismisch eingebunden. Im Falle hoch symbolischer Tätigkeiten, deren Einübung zum Teil sogar eine bewusste Ausblendung des persönlichen Erlebens verlangt, kann es jedoch einen längeren Prozess der Bewusstmachung erfordern, bis der Bezug zum Erleben wieder wahrgenommen und ihm auch vertraut werden kann47: One can easily think of thousands of doings and sayings that will not carry forward one's bodily being in the situation. It is difficult, and a new creation to do and/or say what is implied, and will carry forward (or "meet") the situation. Thus it is easy to see how definite this implying is, even when we don't yet know what to say or do.48 Ein lebendiges, die Situation voran tragendes Sprechen, geschieht also nicht von allein; es erfordert eine besondere Anstrengung. Gelingt es, so wird wieder zu einem körperlich spürbaren Prozess: die richtigen Worte fallen uns ein, frische Sätze kommen – im Sinne von Antworten auf die als bedeutungsvoll erlebte Situation. Indem die neu gefundenen sprachlichen Formulierungen ein neuartiges Verständnis der Situation ermöglichen, verändern sie diese im selben Moment und ermöglichen dadurch wiederum neue Explikationen. Aus diesem Grunde kann etwa das Erleben einer an ein bestimmtes Paradigma gebundenen Problemsituation zum Ausgangspunkt für eine frische, genauere Wahrnehmung der Situation und für die Entwicklung immer neuer begrifflicher Zusammenhänge und Prämissen werden, wie es im Rahmen der Methode TAE vorgesehen ist. Im folgenden wird geschildert, was genau unter einer Bezugnahme auf das Erleben in diesem Zusammenhang gemeint ist. _____________ 45 46 47 48 Gendlin: In having more than one shape, the truth is more, but it isn’t a shape, Transcript, Keynote Address, Psychology of Trust and Feeling Conference, Stony Brook, New York 2006. „Der Gegenstand „Kreativität“ ist innerhalb der akademischen Philosophie ein Sprengsatz. Sie ist sich dessen nur untergründig bewusst, aber alles, was philosophisch über das Phänomen Kreativität zu ergründen ist, läuft im Ergebnis auf eine Kritik exakt jener Methoden hinaus, mit denen gearbeitet wird.“ (S. Mahrenholz: Kritik des Denkens, Kreativität als Herausforderung für Erkenntnis und Rationalitätskonzepte, in: Abel (ed.): Kreativität, Sektionsbeiträge des XX. Deutscher Kongress für Philosophie, Berlin 2005, Bd. I, S. 53). Gendlin hat, im Rahmen seiner Forschung zu psychotherapeutischen Veränderungsprozessen, eine Technik hierfür entwickelt. Das „Focusing“ soll es jedem Menschen ermöglichen, gezielt auf sein eigenes Erleben Bezug zu nehmen und Symbolisierungen dafür zu finden. In 6 Schritten wird dabei gelernt, wie das Erleben in die Betrachtung konkreter Lebensfragen einbezogen werden kann (vgl. Gendlin: Focusing, a.a.O.). Gendlin: A Process Model, a.a.O., VIIB f.11. Heinke Deloch 272 iv. Die unmittelbare Bezugnahme auf das Erleben als Ausgangspunkt der Methode TAE Im Hinblick auf das Wechselspiel von Symbolisierungen und Erleben unterscheidet Gendlin 7 verschiedene funktionale Beziehungen.49 Eine dieser Relationen zwischen Symbolen und Erleben ist die „unmittelbare Bezugnahme auf das Erleben“ („direct reference“). Sie stellt zugleich den Ausgangspunkt des experientiellen Denkens und der Methode TAE dar. Als „Bezugnahme auf das Erleben“ versteht Gendlin einen Vorgang, bei dem die Aufmerksamkeit auf das eigene, körperliche Fühlen angesichts eines bestimmten Themas, einer Situation, einer Handlung oder eines Begriffes – genauer: angesichts jeglicher Form von Symbolisierung - gerichtet wird (ebd., S. 92). Um diese Aufmerksamkeit halten zu können, braucht es ein Symbol, das dieses bestimmte Fühlen hervorhebt oder kennzeichnet. Dieses Symbol kann, muss aber nicht sprachlicher Natur sein. Alltagssprachliche Äußerungen, mit denen wir oftmals eine Bezugnahme auf unser Erleben ausdrücken sind: „dieses da...“ oder „das, was ich tun wollte“ oder, „das, worum es mir geht...“. Die benutzten Symbole fungieren dabei wie ein hinweisender Zeiger auf das Gefühlte; sie bilden es nicht inhaltlich ab. Unsere vorläufigen Wörter und die Situation, sind wie ein Anker, der uns an jener Stelle festhält, die wir nicht verlieren wollen, wo wir noch mehr zu sagen, zu tun oder, allgemeiner, zu symbolisieren haben. Um einen Bezugspunkt im Erleben zu finden, an dem wir dieses „Mehr als...“ spüren können, werden beim experientiellen Denken Fragen bearbeitet, die auf das Erleben der konkreten Situation als komplexes Ganzes abheben, beispielsweise: „Wie erleben ich diese Situation, als Ganzes, körperlich?“50 Ein „felt sense“ ist angesichts eines bestimmten Themas in den meisten Fällen nicht einfach da. Mit den Fragen wird ein Rahmen geschaffen, der das Entstehen einer inneren Achtsamkeit unterstützt, so dass auch die meist eher undeutlichen körperlichen Reaktionen wahrnehmbar werden: A felt sense is usually not just there, it must form. You have to let it form by attending inside your body. When it comes, it is at first unclear, fuzzy... it can come into focus _____________ 49 50 Gendlin: Experiencing and the Creation of Meaning, a.a.O Vgl.: Gendlin: Focusing-orientierte Psychotherapie, München 1987, S. 37f. Da diese direkte Fragestellung nicht immer hilfreich ist, können weitere, vorbereitende Fragen gestellt, etwa: Wo in meinem Betätigungsfeld gibt es eine Situation, angesichts derer ich den Eindruck habe, dass etwas Wichtiges nicht gesagt werden kann? An welchen Punkten verspüre ich ein starkes Interesse, eine Neugier, einen Drang, etwas zu äußern, das ich bislang aber nur vage, diffus ausdrücken kann? Was liegt mir im Moment besonders am Herzen? Was beschäftigt mich besonders? (Deloch / Feuerstein: Konzeptentwicklung mit TAE, Arbeits- und Protokollblätter, Deutsche Focusing Gesellschaft, Gengenbach 2009, unveröffentliches Lehrmaterial). Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 273 and change. A felt sense is the body’s sense of a particular problem or situation... It feels meaningful, but not known. It is body-sense of meaning.51 Fragen Sie sich beispielsweise jetzt: „Wie geht es mir beim Lesen dieses Textes?“ und achten Sie dabei auch auf das, was körperlich spürbar ist. Das für das Bedeutungsverstehen relevante Erleben ist dabei nicht so einfach und klar erkennbar, wie z.B eine Kälteempfindung oder ein uns bekanntes Gefühl wie Wut oder Freude. Der „felt sense“ ist „leiser“, weniger deutlich, etwas, das wir nicht gleich mit einer bekannten Vokabel fassen und beschreiben können.52 Eine solche Vorgehensweise ist im akademischen und nicht-akademischen Alltag eher ungewöhnlich: so besteht die übliche Denkweise darin, komplexe Sachverhalte in verständliche, klar abgegrenzte Teilbereiche zu zergliedern und für diese durch begründetes Aneinanderreihen und Folgern Erkenntnisse zu formulieren. Beim herkömmlichen logisch-rationalen Denken gilt: Was immer gedacht und gesagt wird, soll klar ausgedrückt werden können, ansonsten wird man verdächtigt, „auf dem Holzweg“ zu sein. Beim experientiellen Denken geht es dagegen zunächst darum, einen Blickwinkel auf die (fachliche) Situation so einzustellen, dass die Komplexität und „Verwickeltheit“ des Themas als Ganzes in Augenschein genommen und die herrschende Verwirrung und Unklarheit sowie die vagen Ahnungen und Intuitionen als solche bewusst stehen gelassen werden. Dies ermöglicht eine gezielt herbei geführte kontemplative Pause, welche die gewohnten, schnellen Denkroutinen unterbricht: „It is a different activity, which makes a „pause“ in the usual activity. The different activity is sensing the whole thing, as a whole” (ebd., S. 229). Das unmittelbare Bezugnehmen auf das eigene Erleben hat dabei zwei scheinbar widersprüchliche Merkmale, die auch als „(fest-)halten“ („holding“) und „kommen lassen“ („letting“) beschrieben werden: es geht darum, die fachliche Situation als Ganze bewusst in der Aufmerksamkeit zu halten und zugleich ein sinnhaftes Gefühl für die fachliche Situation entstehen zu lassen: In direct referent formation one both keeps the situation the same, and one also lets it change. One keeps it the same by holding the relevance, the point, the sense of the whole thing, the same. It is this situation (and all that is involved in it), which I wish to sense as a whole. I hold on to this relevance. But also, I await the coming of a new kind of feel, the felt sense of the whole business. I can only let it come, I can’t make it. In letting it come, I allow my body-feel to stir, to move, to do whatever it does independently of my deliberate control, while I do employ my deliberate control to keep the situation, the relevance.53 _____________ 51 52 53 Gendlin: Focusing, a.a.O., S. 11. Zum Unterschied zwischen „felt sense“ und Emotionen vgl. ebd., S. 95ff. . Gendlin: A Process Model, a.a.O., S. 233. Heinke Deloch 274 Das nicht kategorisierende Verweilen bei der Situation als Ganzer und das Hinachten auf unklare, vage Empfindungen ist eine Tätigkeit, die ein großes Maß an Offenheit, Geduld und Experimentierfreude verlangt. Die Methode Thinking at the Edge ist daher nicht nur als Instrument zur Erzeugung neuartiger Ideen und Produkte zu verstehen, sondern kann als Teil einer didaktischen Bewegung betrachtet werden, die der Bildungsforscher G. Claxton charakterisiert durch ihr Bestreben, „positive Lerndispositionen“ zu entwickeln. Diese zielen ab auf das Lernen in einer bestimmten psychischen Verfasstheit, die beschrieben wird als „verinnerlicht, entspannt, offen, aufmerksam und vorsichtig vorantastend“.54 Interessant sind also nicht nur die Ergebnisse von TAE-Prozessen, sondern interessant ist auch die Art und Weise, wie diese Ergebnisse entstehen und wie die Subjekte den Entstehungsprozess erleben: Im Unterschied zu den üblichen Kreativitätstechniken wird Neuheit hier nicht erzielt durch zufällige Assoziationen und Zufallstechniken, sondern durch ein systematisches Rekurrieren auf die in einem bestimmten Gebiet gemachten Erfahrungen und das damit verbundene, auch unterschwellige Erleben. Indem dieses immer wieder eingeladen wird und gezielt Raum bekommt, können Sichtweisen, Haltungen, Ideen, Produkte... entwickelt werden, die in engem Zusammenhang zu den eigenen Erfahrungen stehen und diese für weitere Erkenntnisse und Entwicklungen nutzen. Die Methode TAE kann deshalb auch nur dort angewandt werden, wo bereits Erfahrungen in einem bestimmten Themen- oder Lebensbereich gemacht wurden: „what we enter is „thick“ from years of experience“.55 v. Mit Worten mehr sagen, als die Worte bislang sagen können: die 1. Phase des Thinking at the Edge Besteht einmal die oben beschriebene auf das Thema als Ganze gerichtete körperliche Aufmerksamkeit, so wird es möglich, Wörter zu finden, die eine treffende Neubeschreibung der aktuellen fachlichen Situation geben. _____________ 54 55 Claxton: Thinking at the edge: developing soft creativity, in: Cambridge Journal of Education 36 (2006), S. 360, siehe auch Martindale: Biological bases of creativity, in: R.J. Sternberg (ed.): Handbook of creativity, Cambridge, S. 137-152. Claxton macht darauf aufmerksam, dass derartige didaktische Ansätze auf eine epistemische Kultur hinwirken wollen, die vielerlei Aspekte beinhaltet: neben pädagogischen Fragen auch den Sprachgebrauch zwischen Studierenden und Lehrenden, formale und informelle Arten des Lobs und der Kritik, Managementpraktiken, etc. (ebd.). Kye Nelson: Starting TAE from a strong position, in: The Folio 19 (2000-2004), S. 27-33. Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 275 Im ersten Schritt des TAE-Prozesses werden Anweisungen gegeben56, auf körperliche Empfindungen, seien sie noch so vage oder unauffällig, zu achten und bei diesen zu verweilen. In einem weiteren Schritt werden aus diesem Zustand der Aufmerksamkeit heraus Wörter gesucht, die sich in Resonanz zur körperlichen Empfindung befinden. Ob eine solche Resonanz vorliegt, wird nicht argumentativ erklärt, sondern erspürt. Die so gefundenen Wörter werden benutzt, um eine neuartige, eigene Perspektive auf das gewählte Thema zu formulieren. Der entstandene Text wird anschließend zu einem Kernsatz verdichtet, aus dem ein Schlüsselbegriff ausgewählt wird. Beide gelten als „Platzhalter“ für die Verwickeltheit und Komplexität dessen, was ich angesichts des Themas zu sagen habe. Nun ist der gewählte Schlüsselbegriff, der im Folgenden durch weitere, genauere Begriffe paraphrasiert wird, meist keine sprachliche Neuschöpfung. Wie aber ist es möglich, mit alten Worten Neues zu sagen? Worin besteht die Besonderheit, die eingeforderte und angekündigte Kreativität? Jene Worte, die aus dem Erleben heraus geäußert werden, erscheinen, angesichts des gewählten Themas, oftmals als ungewöhnlich, irritierend, vielleicht sogar widersinnig. Sie in diesen Kontext einzubringen, gleicht einem metaphorischen Sprachgebrauch.57 Die Methode TAE zielt ab auf jenes kreative Potential des Sprechens, das uns ermöglicht, immer wieder neue Ausdrucksweisen zu finden, auch dann, wenn wir auf ein bereits vorhandenes Vokabular zurückgreifen.58 Es handelt sich um eine Fähigkeit, die wir uns nicht erst aneignen müs_____________ 56 57 58 Üblicherweise wird die Methode in Workshops vorgestellt und angeleitet. Dabei bilden jeweils zwei Personen eine Arbeitspartnerschaft und begleiten sich wechselseitig anhand von Arbeits- und Protokollblättern durch den Prozess. Dabei gibt es stets eine AktuerIn und eine BegleiterIn; die BegleiterIn liest die Anleitungen vor und protokolliert alles, was die AkteurIn sagt. Auf diese Weise entstehen erste Textfragmente in Form von Gesprächsprotokollen, die dann durch Eigenarbeit individuell präzisiert und ergänzt werden. Gendlin: Experiencing and the Creation of Meaning, a.a.O, Kap III, B, 1. Insofern jeglicher Sprachgebrauch eine Antwort auf eine neue Situation darstellt, hat Sprache immer kreative Aspekte, d.h. ist der Sprachgebrauch in den wenigsten Fällen einfach als mechanische Wiederholung zu betrachten. Schneider schlägt daher vor, die Unterscheidung von wortwörtlichem und metaphorischem Wortgebrauch zugunsten der Unterscheidung von „üblichen“ und „neuen“ Ausdrucksweisen aufzugeben (Schneider: Das Prinzip der Ausdrückbarkeit, a.a.O., S. 5f). Die Tatsache, dass wir manchmal Dinge sagen, die wir so bisher nicht sagen konnten, ist also kein Grund, anzunehmen, hier geschähe etwas Unzulässiges oder im dunklen Sinne Metaphysisches. Umgekehrt sollten wir jedoch dort aufmerksam werden, wo sprachliche Strukturen und Ausdrucksweisen rigide wiederholt werden, und eine natürliche Fortsetzung der kreativen sprachlichen Ausdrucksfähigkeit unterbleibt: In derartigen Situationen kann durch Einbeziehung unseres individuellen Erlebens, der natürliche, organismische Prozess der Entfaltung unseres Sprechens und Denkens wieder möglich gemacht werden. Heinke Deloch 276 sen, da sie in unserem menschlichen Leib verwurzelt ist: „This capacity of language is rooted in the human body as reflexively sensed from inside.“ Das Kombinieren der Worte beim Sprechen ist damit ein Akt, den wir in der Regel nicht vollständig bewusst steuern: Our body physically rearranges the same old words, so that they come to us already arranged in new phrases and sentences. This is so in all ordinary speech, not only in fresh thinking.59 Das Kommen der Worte vergleicht Gendlin mit dem Kommen der Tränen, des Schlafes, des Orgasmus (ebd.). Dies ist seiner Phänomenologie zufolge nicht verwunderlich, denn Gendlin begreift die Sprache als implizit in all unseren leiblichen Regungen, auch im Schlafen, in den Muskelbewegungen. Der Körper aber ist stets genauer, feiner, differenzierter als unsere sprachlichen Unterscheidungen: er kann auf einer neuartigen Verwendungsweise eines Ausdrucks bestehen, die bislang noch nicht gefunden wurde: „we often need to find our way beyond the cultural forms.“ (ebd.). Die Methode TAE lädt dazu ein, bewusst solche kreativen sprachlichen Schritte kommen zu lassen. Gendlin beruft sich dabei auf Wittgensteins Sprachphilosophie: ... Wittgenstein showed that the capacity of language far exceeds the conceptual patterns that inhere in it. He demonstrated convincingly that what words can say is quite beyond the control of any concept, pre-existing rule, or theory of language. ... Building on this, we have developed in TAE a new use of language that can be shown to most anyone who senses something that cannot yet be said.60 Auch wenn also Wortbedeutungen, wie Wittgenstein gezeigt hat, vor dem Hintergrund von Regeln zu verstehen sind, so bedeutet dies nicht, dass die Regeln den Gebrauch der Wörter vollständig beschreiben, geschweige denn festlegen. Wittgenstein selbst gibt Beispiele eines bedeutungsvollen Regelbruchs, d.h. des von der gewöhnlichen Verwendungsweise abweichenden Wortgebrauchs. So können wir, indem wir die Wörter gebrauchen, ihre Verwendungsweise abändern oder – wie Wittgenstein sagt – „we make up the rules as we go along“ (PU § 83). Die kreative Erweiterung des Sprechens sprengt also gerade nicht den Rahmen sinnvoller Rede. Vielmehr beruht unser Sprachvermögen auf derart kreativen Akten. Ein bewusster Regelbruch bzw. das Schaffen neuer Redewendungen, werden der einzelnen SprachverwenderIn jedoch oft erst dann möglich, wenn bewusst wird, dass es etwas Bedeutsames gibt, das mithilfe des herrschenden Sprachgebrauchs nicht ausgedrückt werden kann. Die etablierten Kategorien scheinen dann regelrecht zu verhindern, was gesagt werden soll. Die erste Phase der Methode TAE wird daher zusammenfassend be_____________ 59 60 Gendlin: The New Phenomenology, a.a.O., S. 128 und 132. Gendlin: Introduction, a.a.O., S. 2. Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 277 schrieben als „Breaking the language barrier“, d.h. es geht darum, die vorherrschenden Sprachgewohnheiten zu durchbrechen. Ziel ist, ausgehend vom eigenen Erleben des Themas neue Ausdrucksweisen zu finden, die auch quer liegen können zu den bestehenden sprachlichen Unterscheidungen. Harbert Rice umschreibt diese Aufgabe treffenderweise als „using words in order to get beyond words.“.61 Um sich von den herrschenden Kategorien zu lösen, werden in der 1. Phase des Prozesses neben einer Anleitung zum körperlichen Erspüren des Themas noch weitere Angebote gemacht: in Schritt 2 wird dazu aufgefordert, Widersprüche im gewählten Themenbereich zu finden (so kam eine Studentin zu dem Schluß: Zweisprachigkeit bedeutet, zwei Sprachen zu beherrschen und sie nicht zu beherrschen; eine andere Studentin kam zu dem Schluß: Ironie trennt und verbindet Menschen). In Schritt 3 und 4 werden die Anwender aufgefordert, für ihren Schlüsselbegriff neue, spezifischere Verständnisse zu entwickeln und sie von bestehenden Verwendungsweisen, vom herrschenden Diskurs, abzugrenzen (so führte die eben angeführte Studentin den Sprachgebrauch Zwischensprachigkeit ein und grenzte diesen Begriff vom etablierten Begriff der Zweisprachigkeit ab). Die neu entwickelten sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten sind nicht als willkürliche Definitionen zu betrachten. Vielmehr stehen sie in unmittelbarer Resonanz zum sinnhaften Gefühl des eigenen Anliegens. Dabei stellen sie weder ein Abbild dieses sinnhaften Gefühls dar, noch eine Nachahmung.62 Einerseits tragen sie die in dem Gefühl enthaltene Bedeutung in sich, andererseits entfalten sie diese weiter, präzisieren, ändern sie: In one important sense, then, the resulting symbolization does symbolize the original felt meaning. In another sense it specifies it, adds to it, goes beyond it, or reaches only part of it – in short, changes it.63 Im Falle eine stimmige Symbolisierung für das sinnhafte Gefühl gefunden wird und dieses sich verändert, ist diese Veränderung selbst körperlich spürbar. Gendlin bezeichnet eine solche Veränderung als „felt shift“; damit geht oftmals eine Erleichterung einher, wie z.B. ein Lachen, ein tiefes Durchatmen oder Tränen, die kommen. Die gefühlte Veränderung gilt als Zeichen für eine gelungene Symbolisierung des sinnhaften Gefühls und damit für eine gelungene Entfaltung im Sinne der lebensfördernden Richtung. Die während der _____________ 61 62 63 Vgl. Rice: Language Process Notes, New York 2008. „Comprehension is a process in which the product somehow includes or comrehends the original felt meaning, but is not any longer identical with it. The term comprehension, then, reminds us that in order to understand (...) we must encompass (...) the original felt meaning, by means of many more meanings. To encompass with many more meanings is to change, to specify, to form aspects, to create – as well as to stay true to – the original.“ (Gendlin: Experiencing and the Creation of Meaning, a.a.O, S. 121). Ebd., S. 120. 278 Heinke Deloch einzelnen Prozessschritte gefundenen Symbolisierungen sind oft in ihren Bedeutungen für Außenstehende wenig verständlich oder zusammenhängend: der Zusammenhang, der hier eine Rolle spielt, ist ein innerer, aus dem Erleben kommender. Besonders in den ersten beiden Prozessphasen werden oftmals auch poetische oder sehr phantasievolle Formulierungen erarbeitet. Erst in der dritten Phase geht es darum, begriffliche Zusammenhänge so transparent darzustellen, dass sie auch für Außenstehende verständlich werden. vi. In beispielhaften Episoden Muster finden: die zweite Phase des Thinking at the Edge Ausgehend von den neuen Begriffsverwendungen, die durch das experientielle Denken in der ersten Phase des Prozesses entwickelt wurden, können in den abschließenden Schritten (10-14) logische Beziehungen hergestellt werden. Bevor es jedoch um die logischen Zusammenhänge der Begriffe geht, wird in einer Zwischenphase (Phase 2) erarbeitet, welche neuartigen Zusammenhänge inhaltlich formuliert werden könnten. Diese Phase wird auch überschrieben als „Making Patterns from Facets“. Genauer geht es darum, ausgehend von Situationen, die für den Themenbereich als relevanten erlebt werden, neuartige Muster oder Zusammenhänge zu formulieren. Man könnte sagen, hier wird getestet, wie neue regelhafte Verwendungssituationen der als relevant erkannten Begriffe oder Ausdrücke aussehen könnten und ob die anhand von Einzelfällen identifizierten Zusammenhänge auch für andere Situationen stimmen. Die Vorgehensweise in dieser Phase besteht in drei Schritten: 1. das Sammeln von Fallbeispielen, die für das, was ich artikulieren möchte, als relevant erlebt werden64 (Schritt 6); das probeweise Aufstellen neuer Zusammenhänge zwischen einzelnen relevanten Aspekten der jeweiligen Fallbeispiele (Schritt 7) und das „Kreuzen“ der Beispiele und ihrer Muster. Dabei wird wie bei einem Perspektivwechsel von einem Fallbeispiel und das hier zutreffende Muster auf das nächste Fallbeispiel geblickt, mit dem Ziel, neuartige Zusammenhänge zu erkennen. _____________ 64 Als Fallbeispiel kann dabei alles gelten, was ich als paradigmatisch für das Noch-Zu Sagende erlebe; so wählte z.B. eine Philologin ein bestimmtes Gedicht eines Schriftstellers als Fallbeispiel, weil sich in dem Gedicht etwas für sie zeigte, was sie im Rahmen ihrer zu entwickelnden Konzeption begrifflich fassen wollte. Ein Pharmakologe wählte einen bestimmten Laborversuch als Fallbeispiel, in dem für ihn etwas sichtbar wurde, was im der etablierten Theorie keinen Platz fand. Eine Psycholinguistin wählte dagegen eine persönlich oftmals erlebte Alltagssituation, in der zwei Menschen ein unterschiedliches Verständnis von Ironie hatten, um eine Ambivalenz im Erleben von Ironie in Worte fassen zu können. Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 279 vii. Eine Theorie erschaffen: die dritte Phase des Thinking at the Edge Die in der zweiten Phase erarbeiteten Grundbegriffe und Zusammenhänge werden, nach einem Zwischenschritt des experientiellen Schreibens über das Thema, für die Theoriekonstruktion in der dritten Phase wieder aufgegriffen. Zunächst geht es darum, logische Beziehungen zwischen drei zu wählenden Hauptbegriffen herzustellen. Anschließend werden zwischen den neu geschaffenen begrifflichen Beziehungen durch einschränkende Bedingungen notwendige Relationen formuliert. Auf diese Weise entstehen klare Begriffsdefinitionen. Die Folgeschritte bestehen darin, auch alle anderen wichtigen Begriffe in die Theorie zu integrieren, indem sie, durch die Formulierung weiterer logischer Beziehungen (jeweils ausgehend von den gewählten Hauptbegriffen), in das Begriffsnetz aufgenommen werden. Dabei wird stets der jeweilige neue Begriff als eine Kombination der bislang eingeführten Begriffe ausgedrückt. Ziel ist dabei nicht die Erschaffung neuartiger strukturgebundener Denkweisen aufgrund rigider logischer Beziehungen, sondern das Formulieren von Zusammenhängen, die sich selbst immer weiter verändern: Entsprechend führt Gendlin einen neuen Begriff der „Form“ ein: The word „forms“ has changed in working here. ... In their old meaning the forms could only force consistency, or break and leave us in limbo. Hier ist dagegen ein prozessorientiertes, wachstumsorientiertes Verständnis von Formen gemeint: They (forms) can work implicitly without making what follows consistent with themselves. Instead, their implicit work can change them. ... Indeed, we can say of all formed things in advance, that they imply more than can be consistent with their seeming form or definition.65 Auch wenn das am Erleben orientierte Formulieren sprachlicher Zusammenhänge es ermöglicht, zu neuartigen Sichtweisen zu gelangen, so ist der Bereich des impliziten Wissens nicht als Ganzes explizierbar. Vielmehr entsteht mit jeder weiteren sprachlichen Differenzierung ein erlebbares „Mehr“ an Erkenntnis. Auch dieses ist nicht vollständig sprachlich einholbar, kann jedoch zum Ausgangspunkt weiterer sprachlicher Differenzierungen werden. Somit ermöglicht TAE, das Denken wo Worte noch fehlen, zwar einerseits, Dinge zu sagen, die so noch nicht gesagt werden konnten; gleichzeitig schafft es ein Bewusstsein für weitere Bereiche des Noch-Nicht-Sagbaren, die in späteren Schritten expliziert werden können. Es handelt sich somit um einen unabschließbaren Prozess, der immer weiter fortgesetzt werden kann. _____________ 65 Gendlin: Thinking beyond Patterns, a.a.O., S. 32. Heinke Deloch 280 Die Veränderung, das Wachstum der neu geschaffenen Theorie, ist folglich im Theoriebegriff selbst vorgesehen. Die Logik dient dabei der systematischen Erweiterung und immer weiteren Verfeinerung der Theorie und steht dieser nicht im Wege. Die Theorie selbst wird bei Gendlin zum momentanen Ausdruck eines Denkprozesses, sie ist selbst wandlungsfähig und prozessorientiert; Widersprüche, Unstimmigkeiten sind für die Theorie keine Bedrohung, sondern laden ein zu immer weiterer Verfeinerung und Präzisierung. Gendlins Theorieverständnis kann als zutiefst demokratisch bezeichnet werden: jedes in einem bestimmten Fachbereich erfahrene Individuum ist potentieller „Theorybuilder“ und wird ermutigt, seine eigenen Erfahrungen ernst zu nehmen und bestehende Denkansätze durch neue zu ergänzen. Für dieses Vorhaben braucht es einen geschützten Raum66, in dem zunächst die Wahrnehmung des eigenen Erlebens der fachlichen Situation ermöglicht werden kann. Ungehindert bestehender Kategorien soll es dem einzelnen ermöglicht werden, ausgehend vom individuellen Erleben relevante Begriffe zu prägen und bedeutungsvolle Zusammenhänge zu formulieren. Die einmal entstandene Theorie darf jedoch nicht den Status einer unerschütterlichen Wahrheit erlangen, sondern soll durch beständige Suche nach Widersprüchen und Ungereimtheiten immer weiter entwickelt werden. Das zunächst metaphysisch anmutende „Nicht-Sagbare“ entpuppt sich dabei als dasjenige, was wir individuell als bedeutungsvoll erleben und schrittweise entfalten können. Eine gesellschaftliche Relevanz freilich werden die neu formulierten Zusammenhänge erst dann haben, wenn auch andere sie als bedeutungsvoll erleben können. Die 14 Schritte der Methode TAE können als Hilfestellung dienen, um das Noch-Nicht-Sagbare innerhalb eines uns wohl bekannten Themas oder Arbeitsgebiets systematisch zu entfalten. Sie sind jedoch nicht notwendigerweise zu durchlaufen67: wurde erst einmal verstanden, worum es bei einem am Erleben orientierten Denken geht, so sind viele verschiedene, individuelle Vorgehensweisen möglich. _____________ 66 67 Ein solcher Raum ist nur dann vorhanden, wenn die anderen Teilnehmer eine personzentrierte Gesprächshaltung einnehmen, die es dem anderen ermöglicht, seine noch unfertigen Gedanken ungestört zu verfolgen. Eine solche Gesprächshaltung wird in den Workshops üblicherweise zunächst eingeübt (vgl. Deloch / Feuerstein: Konzeptentwicklung mit TAE, a.a.O). Vgl. Gendlin: Introduction, a.a.O. Das Nicht-Sagbare als Quelle der Kreativität 281 Übersicht: Die Schritte im TAE-Prozess68 Schritte 1-5: Aus dem Erleben der Idee Worte kommen lassen / Durchbrechen der Sprachbarriere 1. 2. 3. 4. 5. Bezug zum impliziten Wissen herstellen: die Idee greifbar machen Eine Formulierung jenseits der üblichen Logik finden Die Unzulänglichkeit des üblichen Wortgebrauchs feststellen Den eigenen Wortgebrauch spezifizieren Frei schreiben und neuen Kernsatz formulieren Schritte 6-9: In beispielhaften Episoden Muster finden 6. 7. 8. 9. Episoden sammeln Muster innerhalb der Episoden heraus arbeiten Episoden kreuzen Frei schreiben Schritte 10-14: Eine Theorie erschaffen 10. 11. 12. 13. 14. Zentrale Begrifflichkeiten suchen und miteinander verbinden Inhärente Verbindungen zischen den Begriffen suchen Feststehende Termini wählen und miteinander verschränken Die Theorie außerhalb des eigenen Themengebiets anwenden Die Theorie erweitern und im eigenen Themengebiet anwenden _____________ 68 Nach Gendlin / Hendricks: TAE Steps, in: The Folio 19 (2000-2004), S. 9-24. „Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich“ Hilfreiche Anregungen Wittgensteins für die moderne Handlungstheorie Ralf Stoecker Die letzten Jahre waren nicht leicht für die philosophische Handlungstheorie. Eines ihrer größten Rätsel, das Problem der Willensfreiheit, war zwar in aller Munde und wurde unter großer öffentlicher Anteilnahme hin und her gewälzt, aber nicht Philosophen waren die Protagonisten, sondern Naturwissenschaftler, Neurobiologen und Psychologen, die nicht selten für sich in Anspruch nahmen, das uralte Problem, an dem sich Generationen von Denkern die Zähne ausgebissen hatten, endlich gelöst zu haben, und zwar mit teilweise spektakulären Resultaten, insbesondere dem, dass wir ganz und gar unfrei und folglich auch für nichts, was wir tun, verantwortlich seien. Die Leichtigkeit, mit der diese Autoren von den angestammten philosophischen Diskussionsfeldern Besitz ergriffen, war demütigend für die Philosophie, umso mehr, als sie sich häufig keine große Mühe gaben, besonders differenziert und subtil zu argumentieren oder die einschlägige philosophische Literatur zur Kenntnis zu nehmen. So war es ein Akt der Ehrenrettung, dass sich eine Reihe von Philosophen ans Werk machten, die Schwächen, Fehler und Missverständnisse der vermeintlichen Lösungen des Freiheitsproblems offen zu legen. Die meisten philosophischen Stellungnahmen kommen aus dem Umfeld der materialistisch orientierten Philosophie des Geistes (beispielsweise von Ansgar Beckermann, Peter Bieri und Michael Pauen) und reihen sich ein in eine lange Tradition kompatibilistischer Lösungsvorschläge, die mindestens bis auf John Locke zurückgeht. Kennzeichnend für diese Stellungnahmen ist es gewöhnlich, dass sie den naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen ein großes Stück entgegenkommen, um dann am Ende trotzdem zu bezweifeln, dass die radikalen Schlussfolgerungen gerechtfertigt sind. Daneben gibt es aber eine andere, ebenfalls analytisch orientierte philosophische Tradition, die sich auf das Spätwerk Ludwig Wittgensteins und dessen Verständnis des Wollens, Denkens und Handelns beruft. Aus ihrer Sicht entsteht das Freiheitsproblem überhaupt erst, weil beide Seiten eine gemeinsame Voraussetzung teilen, die sie besser aufgeben sollten. Worin diese Voraussetzung besteht, hat in kaum zu überbietender Klarheit Hans Julius Schneider in seinem Ralf Stoecker 284 Artikel „Reden über Inneres“ deutlich gemacht.1 In einer ausführlichen Auseinandersetzung mit Bieris Explikation des Leib-Seelen-Problems, führt Schneider vor, inwiefern dieses Problem auf einem Missverständnis unserer Sprache beruht, unserer Praxis, den ‚Zustand meiner Seele zu beschreiben‘, wie Schneider es im Titel eines anderen Artikels nennt2, um anschließend deutlich zu machen, dass dieselben Überlegungen auch auf die Konzeption des Geistes bei Gerhard Roth zutreffen, einem der führenden neuen Freiheitsskeptiker.3 Wenn wir ein angemessenes Verständnis unseres „Innenlebens“ anstreben, so Schneider, dann sollten wir uns an Wittgenstein orientieren, denn dann entstehen manche der modernen Probleme gar nicht erst oder zumindest nicht in der Form, in der sie in den letzten Jahren diskutiert wurden. In meinem Beitrag möchte ich diesem Rat Schneiders folgen, allerdings nicht so sehr in Bezug auf „Inneres“, sondern auf den zentralen Gegenstandsbereich der Handlungstheorie. Die Frage, was Handlungen sind, bildet nicht nur den Kern der Handlungstheorie, sie ist auch nach wie vor umstritten. Ich möchte also versuchen, aus Wittgensteins Schriften Anregungen dafür zu gewinnen, wie man sie beantworten sollte. Da das „Innere“ für unsere Handlungen eine wichtige Rolle spielt, werde ich dabei auch Gelegenheit haben, Schneiders Adaption Wittgensteins zu rekapitulieren. 1. Jeder Versuch, Wittgenstein ernsthaft für eines der Themen der modernen Philosophie in Anspruch zu nehmen, steht vor der grundsätzlichen Schwierigkeit, dass manche Passagen in Wittgensteins Spätwerk ein eher düsteres, skeptisches Bild der Philosophie zeichnen, zum Beispiel die folgenden: Ich sitze mit einem Philosophen im Garten; er sagt zu wiederholten Malen „Ich weiß, daß das ein Baum ist“, wobei er auf einen Baum in unserer Nähe zeigt. Ein Dritter kommt vorbei und hört das, und ich sage ihm: „Dieser Mensch ist nicht verrückt: Wir philosophieren nur.“4 _____________ 1 2 3 4 Hans J. Schneider: Reden über Inneres, in: Hans-Peter Krüger (ed.): Gehirn als Subjekt?, Berlin 2007. In kurzer, thetischer Form hat Schneider seine Position schon Mitte der Neunzigerjahre in einem Kommentar zu Gerhard Roth skizziert: Wie kommt Geistiges zur Sprache?, in: Ethik und Sozialwissenschaften 6 (1995). Hans J. Schneider: ‚Den Zustand meiner Seele beschreiben’ – Bericht oder Diskurs?, in: Wolfgang Köhler (ed.): Davidsons Philosophie des Mentalen, Paderborn 1997. Schneider bezieht sich auf den Artikel: Worüber dürfen Hirnforscher reden – und auf welche Weise?, in: Hans-Peter Krüger (ed.): Gehirn als Subjekt, a.a.O. Ludwig Wittgenstein: Über Gewißheit, Frankfurt a. M. 1970, § 467 „Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich“ 285 Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgend eines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache geholt hat.5 Denn die philosophischen Probleme entstehen, wenn die Sprache feiert.6 Schon diese kleine Auswahl deutet darauf hin, dass Wittgenstein offenkundig der Meinung war, dass die Philosophie nur zu unsinnigen Ergebnissen führt, irgendwie hervorgerufen durch ein Missverständnis unserer Sprache. Wenn das aber seine Position war, dann fragt es sich, inwiefern er uns in der Philosophie, beispielsweise in der Handlungstheorie, weiterhelfen kann, oder ob wir bei ihm bestenfalls den Rat erwarten können, die Philosophie ganz sein zu lassen. Interessanterweise klingen nicht alle Aussagen Wittgensteins zur Philosophie so negativ: Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache.7 Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.8 Philosophie, so wie wir das Wort gebrauchen, ist ein Kampf gegen die Faszination, die die Ausdrucksformen auf uns ausüben.9 Der Philosoph behandelt eine Frage; wie eine Krankheit.10 In diesen Zitaten schwingt nichts davon mit, dass die Philosophen bloß Unsinn treiben. Im Gegenteil, der Philosophie kommt offenkundig eine positive, aufklärerische, therapeutische, ja sogar kämpferische Rolle zu. Sie kann Besessenheit heilen und rettungslos Verirrten wieder auf den rechten Weg helfen. Der Grund für diese Differenz ist offensichtlich. Wittgenstein unterscheidet zweierlei Philosophie: einerseits die herkömmliche, die vor seiner Zeit betrieben wurde, und andererseits die „Philosophie, so wie wir das Wort gebrauchen“, wie es oben in dem Zitat aus dem Braunen Buch heißt. Ganz explizit findet sich die Unterscheidung in einem Manuskript aus dem Nachlass: Der Mensch mit „gesundem Menschenverstand“, wenn er einen früheren Philosophen liest, denkt (und nicht ohne Recht): „lauter Unsinn!“ wenn er mich hört, so _____________ 5 6 7 8 9 10 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, in: Schriften 1, 4. Aufl., Frankfurt a. M. 1980, [PU] § 119. Ebd., PU § 38. Ebd., PU § 109. Ebd., PU § 309. Wittgenstein: Eine Philosophische Betrachtung – das sogenannte Braune Buch, in: Schriften 5, Frankfurt a. M. 1970 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., PU § 255. Ralf Stoecker 286 denkt er: „lauter fade Selbstverständlichkeiten!“. Wieder mit Recht. Und so hat sich der Aspekt der Philosophie geändert.11 Nur die alte Philosophie war also in den Zitaten zu Anfang dieses Abschnitts gemeint. Was Wittgenstein uns folglich anbietet ist der Übergang von der falschen, traditionellen zur richtigen, neuen Philosophie – auch wenn die Aussicht auf „fade Selbstverständlichkeiten“ zunächst wenig einladend erscheint. Am Beispiel der Handlungstheorie möchte ich im nächsten Abschnitt versuchen, diesen Übergang zu vollziehen. 2. Als eigenständige philosophische Disziplin ist die Handlungstheorie erst Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden, also nach Wittgensteins Tod. Allerdings war sie, nicht zuletzt wegen des maßgeblichen Einflusses von G.E.M Anscombe und Gilbert Ryle, stark durch Wittgenstein geprägt. Von Wittgenstein stammt auch ein typisches Beispiel für eine Handlung, das dann im folgenden immer wieder aufgenommen und diskutiert worden ist: Aber vergessen wir eines nicht: wenn ‚ich meinen Arm hebe‘, hebt sich mein Arm. Und das Problem entsteht: was ist das, was übrigbleibt, wenn ich von der Tatsache, daß ich meinen Arm hebe, die abziehe, daß mein Arm sich hebt?12 In gewisser Weise ist die Handlungstheorie viel handfester als die Philosophie des Geistes, denn normalerweise, wenn jemand etwas tut, geschieht auch etwas in der Welt, beispielsweise hebt sich ein Arm. Aber natürlich ist nicht alles, was geschieht, eine Handlung. Handlungen haben ein besonderes Merkmal, etwas Charakteristisches, dass sie von anderen Geschehnissen unterscheidet. Wenn man also wissen möchte, was Handlungen sind, liegt es nahe, nach diesem Unterscheidungsmerkmal zu suchen, demjenigen, „was übrig bleibt, wenn ich von der Tatsache, daß ich meinen Arm hebe, die abziehe, daß mein Arm sich hebt“. In der Handlungstheorie gab es eine ganze Reihe von Vorschlägen, worin dieses Spezifikum liegen könnte, aber spätestens seit den siebziger Jahren hat sich eine Position durchgesetzt, die sich auch schon auf das philosophische Handlungsverständnis vor Wittgenstein berufen konnte. Ihr zufolge ist es charakteristisch für Handlungen, dass sie auf bestimmte Weise zu Stande kommen. Es ist ihre Genese, die sie von anderen, ‚bloßen‘ Geschehnissen abhebt. Dabei lassen sich sehr grob zwei verschiedene Ansätze unterscheiden. Dem ersten Ansatz zufolge sind Handlungen etwas, das nicht einfach stattfindet, sondern das jemand tut, betreibt, wonach er trachtet, was er zu be_____________ 11 12 Manuskript 219, in: Wittgensteins Nachlass. The Bergen Electronic Edition, S. 6. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. a.a.O., PU § 623. „Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich“ 287 werkstelligen versucht. Wir greifen ein in die Welt, um sie zu verändern. Das Spezifische am Handeln ist also, dass wir etwas dafür tun um zu handeln. Doch dieser Vorschlag ist, wie Wittgenstein zeigt, nicht befriedigend, denn: „Wenn ich meinen Arm hebe, versuche ich meistens nicht, ihn zu heben.“13 Es stimmt einfach nicht, dass man immer etwas tun muss, um zu handeln, zum Beispiel dass man es immer versuchen muss: „’Ich will unbedingt dieses Haus erreichen.’ Wenn aber keine Schwierigkeit da ist, kann ich da trachten, unbedingt das Haus zu erreichen?“14 Man kann etwas nur dann versuchen, wenn einem Schwierigkeiten, Unwägbarkeiten oder ein Mangel an Fähigkeiten im Weg stehen. Wenn das Haus auf einem Berggipfel steht, man vor einem Kampfhund davonläuft oder einen Schlaganfall erlitten hat, dann kann man versuchen, das Haus zu erreichen, aber nicht dann, wenn man gesund und munter in der Gartenpforte steht und nur ein paar Schritte bis zur Haustür machen muss. Aber muss man nicht zumindest das Haus erreichen wollen? Das ist der Ausgangspunkt des zweiten und viel prominenteren Vorschlags, das Spezifikum des Handelns in der Handlungsgenese zu lokalisieren. Handlungen sind ihm zufolge dadurch charakterisiert, dass sie Ursachen im Innenleben des Handelnden haben, in seiner Psyche. Handlungen sind etwas, das geschieht, weil wir es wollen, weil wir es beabsichtigen, uns dazu entschlossen haben, usw. Dieses Handlungsverständnis zieht sich durch die Geschichte der Philosophie bis heute. So schreibt beispielsweise John Steward Mill in seinem System of Logic von 1874: „Now what is an action? Not one thing, but a series of two things: the state of mind called volition, followed by an effect.”15 Und zumindest auf den ersten Blick scheint es geradezu trivial zu sein, dass sich Handlungen durch ihre psychischen Antezedentien von anderen Ereignissen unterscheiden. Auch Wittgenstein sieht die Suggestivtät dieses Vorschlags: „Geschieht denn nicht die gewollte Bewegung des Körpers geradeso, wie jedes Ungewollte in der Welt, nur daß sie vom Willen begleitet ist?“16 Allerdings betont er, dass nicht irgendeine mentale Ursache ausreicht, um aus einem Geschehen eine Handlung zu machen. Insbesondere reicht es seines Erachtens nicht aus, dass dem Handelnden etwas an dem Geschehen liegt, dass er einen Wunsch hat, dass es geschieht: „Aber sie ist nicht nur vom Wunsch begleitet! Sondern vom Willen.“ Denn: Wünschen ist nicht tun. Aber, Wollen ist tun. […] Der Wunsch geht dem Ereignis voran, der Wille begleitet es. Angenommen, ein Vorgang würde meinen Wunsch beglei- _____________ 13 14 15 16 Ebd., PU § 622. Ebd., PU § 623. John Steward Mill: A System of Logic, New York 81874, S. 51. Wittgenstein: Tagebücher 1914-1916, in: Schriften 1, a.a.O., 4.11.1926. Ralf Stoecker 288 ten. Hätte ich den Vorgang gewollt? […] Schiene dieses Begleiten nicht zufällig im Gegensatz zu dem gezwungenen des Willens?17 Aus heutiger Sicht ist Wittgensteins Behauptung, dass Wünsche nicht das Spezifikum des Handelns bilden könnten, unorthodox. Die Standardkonzeption in der modernen Handlungstheorie, die maßgeblich auf das Werk Donald Davidsons zurückgeht, unterscheidet sich gerade darin von der traditionellen Sichtweise beispielsweise Mills, dass sie Handlungen nicht als das Resultat eines Willensaktes, sondern von Wünschen (Davidson spricht von „pro attitudes“) versteht, in Kombination mit Meinungen darüber, wie sich die Wünsche umsetzen ließen.18 Wittgenstein antizipiert in den zitierten Textpassagen allerdings auch drei Vorbehalte, die immer wieder gegen diese Standardkonzeption vorgebracht werden. Erstens scheint das Modell, demzufolge Handlungen durch Wünsche und Meinungen des Handelnden verursacht werden, diesen zur Passivität zu verurteilen. Er scheint bloß der Schauplatz einer kausalen Abfolge zu sein, die durch sein Inneres zu seinen Handlungen führt. So wie eine Reizung der Leber dazu führen kann, dass sich die Haut gelb verfärbt, so kann eben auch eine Reizung des mentalen Innenlebens zu äußeren Reaktionen führen. Hinsichtlich seiner Handlungen aber, möchte man meinen, muss eine Person eine aktivere Rolle spielen. Zweitens passt das zeitliche Nacheinander zwischen Wunsch und Verwirklichung schlecht dazu, wie wir gewöhnlich eine Handlung aus Wünschen erklären. Wir sagen beispielsweise nicht, jemand schalte den Fernseher an, weil er irgendwann zuvor die Nachrichten sehen wollte, sondern weil er sie jetzt sehen möchte. Es gibt also eine Spannung zwischen einerseits der Annahme, dass das für Handlungen charakteristische psychische Geschehen den Handlungen vorhergeht, sie bewirkt, und andererseits der Gleichzeitigkeit zwischen der Handlung und dem sie erklärenden Wunsch in unseren alltäglichen Handlungserklärungen. Nun könnte man versuchen, diese Spannung dadurch aufzulösen, dass man akzeptiert, dass der Wunsch zeitgleich mit der Handlung bestehen müsse. Dann aber stellt sich besonders deutlich das dritte Problem, das darin liegt, eine befriedigende Erläuterung der Beziehung zwischen Wunsch und Handlung zu geben, die verständlich macht, weshalb man Handlungen durch Wünsche erklären kann. Insbesondere dann, wenn es sich nicht einfach um aufeinanderfolgende Glieder einer Kausalkette handeln soll, fragt es sich, inwiefern die Wünsche trotzdem geeignet sind, ein Geschehen in der Welt erklärlich zu machen. Wie kann es kommen, dass die Welt so häufig unseren _____________ 17 18 Ebd. Vgl. Donald Davidsons: Actions, Reasons, and Causes, in: ders.: Essays on Actions and Events, Oxford 22001. „Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich“ 289 Wünschen entspricht (dass beispielsweise ein Arm hochgeht), ohne dass die Wünsche dies verursachen?! Der Wille hat gegenüber dem Wunsch den Vorteil, dass er, wie Wittgenstein es ausdrückt, ein Tun ist. Man kann ihn sich wie eine Art inneres Einwirken, wie ein Drängen vorstellen. Wir kennen das alle: Manchmal muss man sich dazu durchringen, etwas zu tun, man braucht dann Willenskraft, um zu handeln. Deshalb ist der Vorschlag, das Vorliegen eines Willens als Spezifikum des Handelns anzusehen, nicht dem ersten Vorwurf ausgesetzt, den Handelnden zum passiven Spielfeld eines kausalen Geschehens zu machen. Gerade das Beispiel des Ringens zeigt zudem auch, wie sich die zweite und dritte Schwierigkeit auflösen ließen. Man muss sich das Funktionieren des Willens nur so ähnlich wie ein Steuern vorstellen, das ja auch synchron mit dem Gesteuerten abläuft und sich außerdem durchaus kausal verstehen lässt. Allerdings steht auch diese Konzeption vor großen Schwierigkeiten. Erstens sind die üblichen Beschreibungen des Willens zutiefst metaphorisch; sie versehen den Handelnden mit einem inneren Doppelgänger, einem Homunkulus, der stark oder schwach ist und sich möglicherweise gegenüber anderen inneren Akteuren (den Trieben, dem schwachen Fleisch, dem inneren Schweinehund) durchsetzen muss. In Wirklichkeit gibt es diesen inneren Doppelgänger natürlich nicht. Also fragt es sich, was hinter dieser bildlichen Redeweise steckt. Die zweite Schwierigkeit geht auf Gilbert Ryle zurück, der die Annahme, dass ein Willensakt für Handlungen notwendig sei, für zirkulär hielt. Wenn man die Aktivitäten des Willens als etwas ansieht, was eine Person tut, so Ryle, dann muss man sich unmittelbar fragen lassen, ob dieses Tun selbst eine Handlung ist oder nicht. Ist es keine Handlung, dann ist es unverständlich, wie ein solches Tun trotzdem Handlungen generieren kann: Wie kann eine Person ein aktiver Handelnder sein, wenn sie dem eigenen Willen passiv ausgesetzt ist?! Sind die Aktivitäten des Willens aber selbst Handlungen, dann müssen auch sie wiederum gewollt sein, das heißt sie müssen selbst das Produkt anderer Willensaktivitäten sein, ad infinitum. Letztlich führen alle der hier nur sehr kurz skizzierten Antworten auf die Frage, was das Spezifische an Handlungen ist, in das Dilemma, entweder Handeln durch ein anderes Handeln erklären zu wollen, was irgendwie zirkulär und unbefriedigend ist, oder dem aktiven Charakter des Handelns nicht gerecht werden zu können. Ralf Stoecker 290 3. Bislang habe ich Wittgensteins Anmerkungen zum Verhältnis zwischen Wollen, Wünschen und Handeln primär dazu benutzt, auf einige der Standardschwierigkeiten in der modernen Handlungstheorie hinzuweisen. Noch steht allerdings das Versprechen oder zumindest die Hoffnung im Raum, bei Wittgenstein auch Hilfe für die Lösung dieser Probleme zu finden, so wie Hans Schneider dies für die Philosophie des Geistes gezeigt hat. Tatsächlich glaube ich, dass die Lösungen auch in ganz ähnliche Richtungen weisen. Wie gesagt, Wittgenstein unterscheidet zwischen der alten, therapiebedürftigen und seiner neuen therapeutischen Philosophie, deren Kunst darin besteht, die traditionellen Philosophen aus ihrem Bann, ihrer Verhextheit zu befreien, ihnen den Ausweg aus dem Fliegenglas zu weisen, den sie, verhaftet im alten Denken, nicht alleine finden können. Wittgenstein beschreibt dies an einer Stelle sehr anschaulich: Der erste Schritt ist der ganz unauffällige. Wir reden von Vorgängen und Zuständen und lassen ihre Natur unentschieden! […] (Der entscheidende Schritt im Taschenspielerkunststück ist getan, und gerade er schien uns unschuldig.)19 Auch Schneider20 beruft sich auf diesen immens wichtigen Paragraphen, in dem Wittgenstein in wenigen Sätzen nicht nur deutlich macht, warum er kein Behaviorist ist, sondern was so schief an den allermeisten Formulierungen des Leib-Seele-Problems bis heute ist: Sie problematisieren, wie sich Psychisches und Physisches zueinander verhalten, ohne zuvor zu klären, was das eigentlich ist, das hier psychisch und physisch ist, auf welchen Gegenstandsbereich sich diese Prädikate beziehen. Schneider kommt deswegen überzeugend zu dem Schluss: „An Roths Text zeigt sich, wie aktuell Wittgensteins Diagnose ist, es seien falsche Verdinglichung wie die Rede von den ‚Vorgängen und Zuständen‘, die uns in die Irre führten.“21 Auch in der Handlungstheorie lässt sich ein ähnlicher Taschenspielertrick konstatieren. Er hängt zunächst mit einem anderen Fehler zusammen, auf den Wittgenstein ebenfalls häufig hinweist: „Eine Hauptursache philosophischer Krankheiten – einseitige Diät: man nährt sein Denken mit nur einer Art von Beispielen.“22 Ich habe schon erwähnt, dass Wittgensteins Beispiel des Armhebens in der Handlungstheorie immer wieder aufgenommen wurde. Aber auch darüber hinaus gibt es in der Handlungstheorie eine Tendenz, sich auf eine bestimmte Art von Handlungen zu konzentrieren, auf aktive Handlungen, die eng mit _____________ 19 20 21 22 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., PU § 308. Schneider: Reden über Inneres, a.a.O., S. 232. Ebd., S. 237. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., PU § 593. „Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich“ 291 Körperbewegungen verbunden sind. Prominente Beispiele sind etwa: das Pumpen von Wasser (G.E.M. Anscombe), das Anknipsen eines Lichtschalters (Donald Davidson), das Erschießen eines Menschen (Alvin Goldman, Judith Jarvis Thomson). Wegen dieser einseitigen Beispiel-Diät vergisst man aber leicht, dass unser Leben auch noch aus ganz anderen Handlungen besteht: Handlungen des Geschehenlassens, z.B. wenn man jemanden an der Kasse vorlässt, des Unterlassens, z.B. wenn man die Fenster nicht putzt, mentale Handlungen, etwa wenn man sich einen Vortragstitel überlegt, umfassende Handlungen wie Philosophie studieren und kollektive Handlungen wie die, miteinander zu telefonieren. Diese vielfältigen Handlungen in das Prokrustesbett der Standardtheorie zu zwängen, ist nicht ganz leicht. Besonders deutlich ist dies beim Unterlassen und Geschehenlassen. Für Unterlassungen ist es beispielsweise charakteristisch, dass etwas nicht geschieht, also fragt es sich, inwiefern man eine Unterlassung trotzdem als ein Geschehen mit einer besonderen Genese ansehen kann, wie es die Standardkonzeption verlangt. Und wenn man etwas geschehen lässt, geschieht zwar etwas, was allerdings fehlt ist sozusagen der Anstoß durch den Handelnden. (Ich lasse die ältere Dame an der Kasse zwar vor, aber ich schiebe sie nicht vor.) Natürlich gibt es Versuche, diese Problemfälle in die Standardkonzeption zu integrieren, beispielsweise dadurch, dass man auch das Nichtgeschehen als eine Art von Geschehen auffasst, als ein ‚negatives Ereignis‘, und entsprechend das Nichthindern als eine Form kausaler Verursachung. Aber das sind verzweifelte Versuche („Heute ist dreierlei in meinem Garten passiert: ein Hase ist vorbei gehoppelt, kein Adler ist gelandet und das Gänseblümchen hat sich nicht in einen Tiger verwandelt“), die sich auf die einseitige Diät von Handlungs-Beispielen zurückführen lassen, in denen es immer nur darum geht, dass Menschen irgendwie an der Welt herummanipulieren. Nur so kommt man auf die Idee, auch dann, wenn es jemand beispielsweise unterlässt, die Scheiben zu putzen, müsse es ein Geschehen (nur eben ein schattenhaftes, negatives) geben, das diese Person irgendwie hervorruft. Viel attraktiver wäre es, wenn man statt dessen erklären könnte, warum es eine Handlung ist, wenn jemand es unterlässt, die Scheiben zu putzen, ohne auf solche dubiosen Entitäten wie negative Ereignisse zurückgreifen zu müssen. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, weshalb es einem in der Handlungstheorie so schwer fällt, mit diesen Beispielen fertigzuwerden. Wir sind einer Vorstellung verhaftet, die uns, wie Hans Schneider vorgeführt hat, auch in der Philosophie des Geistes leicht in die Irre führt: der allzu blauäugigen Annahme, dass es die vordringliche Aufgabe von Sätzen ist, auf irgendetwas in der Welt zu verweisen. Wittgenstein kommt auf diese Vorstellung im Rahmen seiner Diskussion von Schmerzen und Schmerzbenehmen zu sprechen (PU § 304). Sein imaginärer Gesprächspartner stellt ihn vor die Wahl, entwe- Ralf Stoecker 292 der zuzugestehen, dass es nicht bloß Schmerzbenehmen, sondern darüber hinaus auch Schmerzen gäbe (was die Philosophie vor die Probleme stellt, den besonderen subjektiven Charakter der Schmerzen zu erklären) oder zu behaupten, dass es nichts anderes als Schmerzbenehmen gibt, dass die Schmerzen über das Benehmen hinaus ‚nichts‘ seien (was ihn zum Behavioristen machen würde). Wittgenstein jedoch verweigert sich dieser Alternative: „Sie sind kein Etwas, aber auch nicht ein Nichts!“, und erklärt stattdessen, wie ein dritter Weg aussieht: Das Paradox verschwindet nur dann, wenn wir radikal mit der Idee brechen, die Sprache funktioniere immer auf eine Weise, diene immer dem gleichen Zweck: Gedanken zu übertragen – seien dies nun Gedanken über Häuser, Schmerzen, Gut und Böse, oder was immer.23 „Schmerz“ ist ein Substantiv, so wie „Haus“ oder „Maus“. Wir können es auch ganz ähnlich gebrauchen, zum Beispiel indem wir Attribute darauf anwenden („ein heftiger Schmerz“, „ein hässliches Haus“), Lokalisierungen vornehmen („Im Haus ist eine Maus, die hat einen heftigen Schmerz in der Pfote“), Identitätsaussagen treffen („Das ist dieselbe Maus wie vorhin“, „Das ist derselbe Schmerz wie gestern“) oder quantifizieren („Alle Schmerzen sind wie weggeblasen“, „Alle Häuser sind wie ausgestorben“). Also liegt es nahe, Schmerzen so wie Mäuse oder Häuser zum Inventar der Welt zu zählen. Und dann fragt es sich natürlich, wie die Schmerzen dort genau hineinpassen. Sind die Schmerzen in der Maus, wie die Maus im Haus ist? Wie kommt es, dass wir die Schmerzen in der Maus nicht so wahrnehmen können wie die Maus im Haus, selbst dann nicht, wenn wir in die Maus hineinschauen? Oder können wir die Schmerzen vielleicht doch wahrnehmen, weil es in Wirklichkeit Bestandteile des Gehirns sind? Und wieso muss die Maus nicht ebenfalls in sich hineinschauen und weiß trotzdem genau, dass sie Schmerzen in der Pfote hat? – All diese Standardrätsel aus der Leib-Seele-Debatte gehen, Wittgenstein zufolge, auf die Prämisse zurück, dass es der Sinn von Sätzen über Schmerzen ist, über die Existenz von Schmerzen zu berichten (‚Gedanken über Schmerzen zu übertragen‘), so wie es der Sinn von Sätzen über Mäuse sei, über deren Existenz zu berichten. Aber diese Prämisse ist falsch. Sprache, so Wittgenstein, funktioniert nicht nur auf diese eine Weise, woraus nicht etwa folgt, dass sie nur auf eine andere Weise, sondern dass sie auf ganz unterschiedliche Weise funktioniert. Akzeptiert man das aber, dann öffnen sich Wittgenstein zufolge vielfältige Möglichkeiten für die Auflösung traditioneller philosophischer Rätsel, die auf ein Missverständnis des Gebrauchs unserer Sprache zurückgeführt werden könnten. _____________ 23 Ebd., PU § 304. „Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich“ 293 4. Zumindest in Bezug auf die Philosophie des Geistes und Handlungstheorie gibt es meines Erachtens drei immer radikalere Optionen, Wittgensteins Strategie zu folgen und die notorischen Rätsel sprachkritisch aufzulösen, wobei ich nicht sicher bin, welche davon Schneider vorzieht.24 Erstens kann man Ontologie betreiben und zwischen verschiedenen Kategorien von Entitäten unterscheiden, auf die man sich sprachlich beziehen kann: Häuser, würde man dann sagen, sind konkrete materielle Gegenstände, Gut und Böse sind Abstrakta, und Schmerzen Ereignisse. Da es das traditionelle Kennzeichen unterschiedlicher Kategorien ist, dass eine Substitution eines Ausdrucks der einen Kategorie durch einen Ausdruck der anderen Kategorie in bestimmten Sätzen nicht nur zu falschen, sondern zu sinnlosen Aussagen führt (einen Kategorienfehler bildet), ließe sich auf diese Weise möglicherweise diagnostizieren, dass manche philosophische Fragen unsinnig sind. Vielleicht ist ja die Vermutung, der Schmerz sei im Gehirn der Maus, nicht sinnvoller als die Annahme, der Schmerz habe einen langen, grauen Schwanz. Auch in der Handlungstheorie hat es Debatten darüber gegeben, zu welcher Kategorie Handlungen gehören, insbesondere ob man sie eher als raumzeitlich lokalisierte Ereignisse oder als Sachverhalte auffassen sollte. Viel spannender finde ich aber die zweite durch Wittgenstein inspirierte Vorgehensweise: Vielleicht sollten wir uns ganz von der Vorstellung verabschieden, dass sich hinter jedem Substantiv im Satz irgendetwas verbirgt, egal von welcher Kategorie. Schneider nennt das schöne Beispiel der Redewendung, dass man jemanden „im Stich lässt“.25 Sie klingt so, als sei sie eine Ortsbeschreibung, aber natürlich ist die Rückfrage unsinnig, wo denn der Stich sei, in dem man jemanden gelassen hat. Auch wenn uns die Etymologie belehren kann, dass sich das Wort „Stich“ früher tatsächlich auf etwas, nämlich das Zustechen bei Ritterspielen, bezogen hat (ähnlich dem: im Regen stehen lassen), so hat es mittlerweile jede Eigenständigkeit verloren. Obwohl es sinnvoll ist zu sagen, man habe jemanden im Stich gelassen, bezieht sich das Wort „Stich“ in diesem Satz auf nichts. Unser psychologisches Vokabular wie auch unser Reden über Handlungen funktioniert zweifellos viel selbstständiger als das Wort „Stich“ in „im Stich lassen“. Aber es könnte trotzdem sein, dass man es am besten dadurch expliziert, dass man erläutert, was über jemanden gesagt wird, der beispielsweise Schmerzen hat oder eine Handlung vollzieht, und nicht dadurch, dass man etwas sucht, auf das sich die Substantive wie „Schmerz“ und „Handlung“ beziehen. Unterstützt wird diese Position durch die Feststellung, dass _____________ 24 25 Der einschlägige Aufsatz hier ist Schneider: Den Zustand meiner Seele beschreiben, a.a.O. Ebd., S. 37. 294 Ralf Stoecker wir normalerweise zwei verschiedene Möglichkeiten haben, uns über Seelisches zu unterhalten: mit Substantiierungen und ohne. Wir können sagen: „Er hat Schmerzen“ oder „Es tut ihm etwas weh", „Sie hat den Wunsch, nachhause zu gehen“ oder „Sie möchte nachhause gehen“. Wittgensteins und Schneiders Plädoyers laufen darauf hinaus, in der jeweils zweiten Redeweise und nicht in der ersten den Schlüssel zum Verständnis der Psyche zu suchen. Nicht Schmerzen und Wünsche sollten wir untersuchen, sondern dasjenige, was wir von einer Person sagen, wenn wir behaupten, ihr tue etwas weh oder sie wolle etwas. In der Handlungstheorie ist es noch viel einleuchtender, sich nicht auf die Substantivierungen zu konzentrieren, als in Bezug auf Schmerzen oder Wünsche, denn die allermeisten alltäglichen Handlungssätze kommen ohne ein Nomen für die Handlung aus. „Kain hat Abel getötet“ ist ein normaler Handlungssatz, ganz anders als „Kain hat einen Tötungsakt an Abel vollzogen“. Warum also sollte man sich den Kopf darüber zerbrechen, welche Geschehnisse Handlungen sind und inwiefern auch Unterlassungen eine geisterhafte Art von Geschehnissen sein können, wenn die kritische Reflexion unserer Sprachpraxis zeigt, dass es uns in Handlungssätzen gar nicht darum geht, über Handlungen als Entitäten in der Welt zu berichten?! Nach meiner Überzeugung passt also der Weg, den Wittgenstein für die Philosophie des Geistes gewiesen hat, auch für die Handlungstheorie. Wenn wir darüber reden, dass jemand handelt, dann ist es ein Missverständnis zu glauben, dass wir hier eine Beziehung herstellen zwischen einer Person und ihrer Handlung. Um es plakativ auszudrücken: Handlungen spielen für die Handlungstheorie keine Rolle. Damit aber stellt sich unmittelbar die Frage, worum es uns dann geht, wenn wir von jemandem sagen, er handele. Bislang haben wir nur ein negatives Resultat erreicht und scheinen zudem von einer positiven Explikation des Handelns weiter entfernt zu sein denn je. Denn schließlich ist es nach wie vor unbestreitbar, dass zumindest häufig, wenn auch vielleicht nicht immer, etwas geschieht, wenn jemand handelt. Insbesondere bewegt sich der Körper. Wenn diese Körperbewegung aber keine Handlung sein soll, in welchem Verhältnis steht sie dann zum menschlichen Handeln? Und wie steht es mit der auf den ersten Blick so selbstverständlichen Annahme, dass unsere Handlungen das Resultat psychischer Faktoren (Absichten, Entscheidungen, etc.) sind? Zum einen können Handlungen schwerlich Resultate sein, wenn es sie streng genommen gar nicht gibt, zum anderen hat Wittgensteins Strategie ja auch dazu geführt, dass die mentalen Antezendentien der Handlungen philosophisch zu bröckeln beginnen. Damit scheint aber nach der wittgensteinianischen Destruktion seelischer Entitäten durch Schneider und meiner analogen Elimination der Handlungen nichts mehr übrig zu sein, um unsere robusten, alltägli- „Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich“ 295 chen Redeweisen über Handlungen und ihre Gründe und Motive verständlich machen zu können. 5. Nach meiner Überzeugung befinden wir uns trotzdem auf dem richtigen Weg. Der erste Schritt besteht darin, sich die vermeintliche Destruktion der mentalen Handlungsantezedentien genauer anzuschauen. Wittgenstein und Schneider vertreten ja, wie gesagt, nicht die Ansicht, dass es unser Seelenleben gar nicht gibt, sie empfehlen nur, es als eine besondere Form der Charakterisierung von Personen aufzufassen. Natürlich ist es sinnvoll, von einem Menschen zu sagen, er wolle nachhause gehen, auch wenn man skeptisch gegenüber der Nominalisierung dieser Redeweise ist. Wittgenstein schreibt beispielsweise: Warum will ich ihm außer dem, was ich tat, auch noch eine Intention mitteilen? – Nicht, weil die Intention auch noch etwas war, was damals vor sich ging. Sondern weil ich ihm etwas über mich mitteilen will, was über das hinausgeht, was damals geschah.26 (PU 658) Dasselbe gilt auch für unser Handlungsvokabular. Auch hier müssen wir fragen, was darunter zu verstehen ist, wenn man von jemandem sagt, er handele – von Kain zum Beispiel, er habe Abel getötet –, obwohl wir uns dagegen verwahren, sofort zu der Frage überzugehen, worin die Handlung bestanden habe, Abel zu töten. Und abermals, scheint mir, lautet die Antwort: Wir sagen etwas über eine Person aus. Die entscheidende Frage ist jetzt aber natürlich, was es denn ist, das wir über die handelnde Person sagen. In den Reflexionen aus den Tagebüchern, aus denen ich schon zitiert habe, findet sich eine ebenso einfache wie spektakuläre Antwort auf diese Frage: „Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich.“27 Damit hat Wittgenstein meines Erachtens den Kern menschlichen Handelns getroffen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens bietet er eine Lösung für das Problem an, wie man das Geschehen, das häufig mit Handlungen verbunden ist, in eine Handlungstheorie einbinden kann, wenn man nicht mehr davon ausgehen möchte, dass dieses Geschehen die Handlung ist. Die Antwort lautet: Zu handeln ist relational. Wer handelt, steht in einer Beziehung zu etwas. Dieses Etwas ist allerdings keine Handlung, sondern (in erster Näherung) ein Geschehen, zum Beispiel eine Körperbewegung, häufig aber auch ein Geschehen außerhalb des Körpers. Wenn man sagt, dass Kain Abel _____________ 26 27 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., PU § 658. Wittgenstein: Tagebücher 1914-1916, a.a.O., 4.11.1916. 296 Ralf Stoecker umgebracht hat, dann setzt man damit Kain in Beziehung zu Abels Tod. Das kann allerdings nur ungefähr stimmen, sonst stehen wir wieder vor dem Problem, dass wir der Handlung, die Fenster nicht zu putzen, nicht gerecht werden können, weil es für sie ja gerade kennzeichnend ist, dass es kein entsprechendes Relatum gibt. An dieser Stelle wird das zweite Element in dem Zitat aus Wittgensteins Tagebüchern wichtig. Die Beziehung, die konstitutiv für das Handeln ist, ist die der Verantwortung. Zu handeln heißt verantwortlich zu sein. Normalerweise wird dieser Satz so verstanden, dass uns unser Handlungsverständnis darüber aufklären kann, wo die Grenzen unserer Verantwortung liegen. Man kann ihn aber auch in die Gegenrichtung lesen und versuchen, unser Handlungsvokabular aus unserer Praxis, Menschen verantwortlich zu machen, herzuleiten. Noch zu Lebzeiten Wittgensteins hat der Rechtsphilosoph H.L.A. Hart diesen Vorschlag unter der Bezeichnung „Askriptivismus“ in die Debatte eingeführt.28 Er passt auch ausgezeichnet zu der dritten, schärfsten Schlussfolgerung aus Wittgensteins These, die Philosophen würden die Vielfalt des menschlichen Sprachgebrauchs übersehen. Wenn Wittgenstein sagt, wir müssten radikal mit der Idee brechen, die Sprache funktioniere immer auf eine Weise, diene immer dem gleichen Zweck, dann gilt dies nicht nur für die Annahme, dass alle assertorischen Sätze Berichte über Gegenstände sind, sondern auch für die Voraussetzung, dass es in ihnen überhaupt darum geht, etwas mitzuteilen, auszusagen. Wenn man nun Wittgenstein im Sinne Harts liest, dann sind Handlungssätzen vielleicht gar keine Sätze über eine Person, sondern Sätze, die sich an diese Person richten. Tatsächlich schreibt Wittgenstein beispielsweise: „Aber wie weiß ich, daß diese Bewegung willkürlich war? – Ich weiß es nicht, ich äußere es.“29 Hart hat seine Position allerdings schon bald wieder revidiert. Zu überzeugend waren die kritischen Einwände, unter anderem auch die Feststellung, dass sich unsere Verwendung des Handlungsvokabulars nicht auf Kontexte beschränkt, in denen man tatsächlich jemanden verantwortlich macht. Woran man meines Erachtens aber festhalten kann, ist die Erläuterung des Handelns durch das Verantwortlichsein. Was heißt hier „Verantwortlichsein“? Ursprünglich und wortwörtlich bezeichnet es eine Verpflichtung, Antwort zu geben, Rechenschaft abzulegen. Man könnte auch sagen: Gründe dafür anzugeben, warum man etwas tut oder getan hat. Setzt man ein solches Vorverständnis von Verantwortung aber voraus, dann zeigt sich _____________ 28 29 H.L.A. Hart: The Ascription of Responsibility and Rights, in: Proceedings of the Aristotelian Society 44 (1948/49), vgl auch mein Action and Responsibility – a second look at ascriptivism, in: Christoph Lumer / Sandro Nannini (eds.): Intentionality, Deliberation and Autonomy, Aldershot. Wittgenstein: Zettel, in: ders.: Über Gewißheit, a.a.O., § 600. „Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich“ 297 in Umrissen eine Handlungskonzeption, die noch deutlicher Wittgensteins Mahnung entspricht, nicht einfach hinter die Sprache treten zu wollen: Wenn man von jemandem sagt, dass er handelt, dann macht man deutlich, auf welche Frage man von dem Handelnden eine Rechtfertigung, Begründung erwarten würde. Wer beispielsweise sagt, dass Kain seinen Bruder getötet hat, beschreibt Kain als jemanden, von dem Gründe zu erwarten sind, warum Abel tot ist (ungeachtet Kains Versicherung, er sei nicht seines Bruders Hüter). Aus Sicht der traditionellen Handlungstheorie sieht es jetzt so aus, als sei ich auf Umwegen wieder bei einer sehr konventionellen Sichtweise angelangt: Gründe, könnte man ergänzen, sind genau dann von Kain zu erwarten, wenn er die entsprechenden psychischen Einstellungen hat, wenn er die Absicht hatte, seinen Bruder zu töten, wenn er es gewollt hat. Und prompt entstehen wieder die Probleme, was es heißt, dass Kain diese Einstellungen hat, wie man sie an ihm verorten muss usw. Aus der Sicht von Wittgensteins Philosophie sollte man sich diesem argumentativen Rollback aber unbedingt verweigern. Gesprächspartnern Gründe für dieses oder jenes zu geben und umgekehrt Gründe auch einzufordern, ist erst einmal ein Teil einer sozialen Praxis. Es ist eine Praxis, mit der wir ständig rechnen. Wir wissen in der Regel genau, wofür man gegebenenfalls von uns Rechenschaft haben möchte, also orientieren wir uns daran. Wir haben es gelernt, diesen Diskurs, wie Schneider es nennt, nicht nur zu führen, sondern auch in unserem Verhalten zu antizipieren. Deshalb ist unser Handlungsvokabular explanatorisch so erfolgreich. Wir und die allermeisten unserer Mitmenschen richten uns in der Regel danach, jederzeit Rechenschaft für unser Tun abgeben zu können. Also können wir uns wechselseitig auch weitgehend darauf verlassen, dass unser Gegenüber sich so verhält, wie es in dieser Situation verantwortbar ist. Von inneren Ursachen und äußeren Wirkungen ist in dieser Skizze des menschlichen Handlungsvermögens nirgends die Rede. Stattdessen wird so etwas vorausgesetzt wie eine gemeinsame Praxis, sich über Gründe auszutauschen und sie wechselseitig einzufordern, eine soziale Praxis kommunikativer praktischer Vernunft. Vermutlich wäre es eine Überinterpretation Wittgensteins, ihm diese Position in den Mund zu legen, sie passt aber zumindest gut zu einem Bild, das er für die Handlungszuschreibung gefunden hat: Wie könnte man die menschliche Handlungsweise beschreiben? Doch nur, insofern man die Handlungen der verschiedenen Menschen, wie sie durcheinanderwimmeln, schilderte. Nicht, was einer jetzt tut, eine einzelne Handlung, sondern das ganze Gewimmel der menschlichen Handlungen, der Hintergrund, worauf wir jede Handlung sehen, bestimmt unser Urteil, unsere Begriffe und Reaktionen.30 _____________ 30 Ebd., § 567. Ralf Stoecker 298 Nach meinem Handlungsverständnis bilden die Praxis der kommunikativen praktischen Vernunft und unsere fest verwurzelte Disposition, uns in unserem Verhalten an ihr zu orientieren, das Muster, auf dessen Basis wir Menschen Handlungen zuschreiben als etwas, das Ausdruck dieser Disposition ist.31 7. Ich habe zu Beginn dieses Beitrags angekündigt, dass ich, ähnlich wie Hans Schneider dies in Bezug auf Empfindungen getan hat, versuchen werde, bei Wittgenstein Anregungen für eine philosophische Antwort auf die Grundfrage der Handlungstheorie zu finden. Auch wenn ich dieses Projekt hier nur sehr skizzenhaft durchführen konnte, ist hoffentlich deutlich geworden, wie vielversprechend es ist. Solange man sich nicht von dem Vorurteil ins Bockshorn jagen lässt, dass wir mit Handlungszuschreibungen über Handlungen reden, die auf besondere Weise von unserem Inneren hervorgerufen werden, erspart man sich eine ganze Reihe von traditionsreichen philosophischen Rätseln und ihren vermeintlichen Lösungen. Zum Abschluss meines Beitrags möchte ich aber gerne noch einmal zum Anspruch Wittgensteins zurückkehren, dass es Aufgabe seiner neuen Philosophie sei, die herkömmliche Philosophie als Missverständnis und Unsinn zu entlarven. Die Überlegungen Wittgensteins, die ich bislang in Anspruch genommen habe, lösen diesen Anspruch noch nicht ein. Ich teile zwar Wittgensteins Überzeugung, dass eine Reihe von philosophischen Problemen dadurch auflösbar sind, dass man geteilte Voraussetzungen der Kontrahenten aufdeckt, das aber war schon immer ein wichtiges Instrument philosophischen Fortschritts. Auch der kritische Blick auf die eigene Sprache ist Teil des philosophischen Handwerkszeugs. Dasselbe gilt nach meinem Eindruck auch für Schneiders Rekonstruktion von Wittgenstein. Auch er liest wie ich Wittgenstein als einen hilfreichen und kreativen Philosophen, nicht als denjenigen, der aller Philosophie ein Ende setzt. Wittgenstein wollte sicher mehr als nur bessere Antworten auf philosophische Fragen zu geben, ich muss aber gestehen, dass ich noch nicht hinreichend verstehe, worin dieses Mehr besteht. Vermutlich hat also die Therapie bei mir einfach noch nicht angeschlagen. Doch zum Glück hat Wittgenstein uns auch dafür einen Trost anzubieten: _____________ 31 Ich habe diese Idee in einer Reihe von Publikationen weiter ausgearbeitet, zum Beispiel: Wie erklären Handlungserklärungen?, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie 1 (2008), Acting for Reasons - a Grass Root Approach, in: C. Sandis (ed.): New Essays on the Explanation of Action, Macmillan 2009, Why Animals Can´t Act, in: Inquiry 52 (2009). „Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich“ 299 In der Philosophie darf man keine Denkkrankheit abschneiden. Sie muß ihren natürlichen Lauf gehen, und die langsame Heilung ist das Wichtigste.32 33 _____________ 32 33 Wittgenstein: Zettel, a.a.O., § 382. Eine frühere Version dieses Textes habe ich im Sommer 2009 auf der Tagung „Der Geist im Fliegenglas“ in Potsdam gehalten. Ich danke den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Tagung, vor allem aber Hans Schneider, für die kritische Diskussion Logisches und Psychologisches, Subjektives und Objektives in Bezug auf das Wesen der Zahl Zum ersten Grundsatz in den Grundlagen der Arithmetik Richard Raatzsch Die Schwierigkeit ..., die einfachen Grundsätze anzuwenden, macht einen an diesen Grundsätzen selbst irre. Wittgenstein Philosophische Bemerkungen, Nr. 133 1. Zur Größe Gottlob Freges gehört sein Vermögen, eigene Misserfolge zu erkennen und einzugestehen, und sei es in Bezug auf sein eigentliches Lebenswerk: „Meine Anstrengungen“, heißt es in einer Tagebuchnotiz vom 3. März 1924, „über das ins Klare zu kommen, was man Zahl nennen will, haben zu einem Misserfolge geführt.“ Frege verbindet dieses Fazit mit folgender Diagnose: „Man lässt sich gar zu leicht durch die Sprache irreführen und gerade in diesem Falle ist diese Irreführung ganz besonders schlimm.“1 In einer Hinsicht erstaunt diese Diagnose: im Alltag führt uns die Sprache selten in die Irre, und wo doch, ist die Rückkehr auf den rechten Pfad meist leicht. (Wäre es anders, gäbe es weder einen Alltag, noch seine Sprache.) Da Freges Anstrengungen nun nicht so zu einem Misserfolge geführt haben, wie es einem misslingen kann, jemandem etwas klar zu machen, was einem selbst (wie man glaubt) durchaus klar ist, und insofern Frege sich auch nicht erst von der Sprache irreführen ließ und dann keinen Erfolg hatte, sondern erfolglos war, indem er sich irreführen ließ, legt sich Folgendes als Form seines Misserfolgs nahe: Das Problem vorausgesetzt, beginnt man seine Klärungsarbeit mit etwas ganz Unproblematischem, Alltäglichem, nimmt weitere sog. Truismen hinzu … und hat irgendwann den Eindruck, man stecke fest. Weil es in diesem Fall aber auf den Eindruck in gewisser Hinsicht ge_____________ 1 Gottlob Frege: Tagebucheintragungen über den Begriff der Zahl, in: ders.: Nachgelassene Schriften und Wissenschaftlicher Briefwechsel, 1. Band: Nachgelassene Schriften, 2. Aufl., Hamburg 1983, S. 282-283. Richard Raatzsch 302 rade ankommt, steckt man auch tatsächlich fest. (Insoweit gibt es hier keine Differenz von Schein und Sein.) Diese Form weist wiederum auf den Ausweg aus der Sackgasse: die Rückkehr zum Ursprung, in der Hoffnung, das Entstehen der Irreführung schrittweise nachzeichnen zu können – womit sie natürlich verschwindet. Nur, wenn wirklich alles offen daliegt, wie soll es Frege dann nicht selbst (so) gesehen haben? – Erstens, weil, dass alles offen da liegt, nicht bedeutet, dass es auch überschaut wird. (Man verläuft sich nicht im Wald, weil dort irgendetwas verborgen wäre.) Zweitens, weil man nicht weit genug zurückgeht: zum Problem selbst. Drittens, weil man nicht schaut2, wie es sich verhält, sondern denkt, dass es so und so zugehen müsse, indem man sich etwa in seiner Untersuchung nach Grundsätzen richtet. (Wer einfach schaut, muss es nehmen, wie es kommt.) Nur, warum soll für Grundsätze nicht gelten, was für das gilt, was sie begründen sollen? – Dieser Frage soll im Folgenden in Hinsicht auf den ersten Grundsatz von Freges Grundlagen der Arithmetik und dessen Anwendung in Teilen dieser Schrift, v. a. deren § 26, nachgegangen werden. 2. Im § 26 geht es darum, dass die „Zahl ... kein Gegenstand der Psychologie (ist), sondern etwas Objektives“. Das ist u. a. deshalb bemerkenswert, weil wir Zahlen vor allem vom menschlichen Handeln her kennen, etwa vom Zählen, Rechnen oder Messen. So wird der erste Grundsatz aus der Einleitung zu den Grundlagen einschlägig, demzufolge (G1) „das Psychologische von dem Logischen, das Subjektive von dem Objektiven scharf zu trennen (ist).“3 Wenn Zahlen objektiv sind, dann sicher nicht so, wie ein Hut schwarz ist. Ein Hut kann braun sein, aber eine Zahl wäre keine Zahl, und nicht etwa eine andere (Art von) Zahl, wenn sie, statt objektiv zu sein, subjektiv wäre, vorausgesetzt, sie ist objektiv. Wenn, so fällt eine Zahl ihrer Natur nach unter das Objektive. Ihre Objektivität betrifft das, was sie ist, nicht ihr Wie. – Hier wird nun eine erste Schwierigkeit mit dem Grundsatz transparent. Sie betrifft seine Natur. Dass man das Objektive vom Subjektiven scharf zu trennen hat, sagt noch nicht, was die Zahl ist. Hierzu passt, dass ein Grundsatz, wie man diesen Ausdruck zunächst erklären dürfte, etwas ist, an dem man die ganze Untersuchung hindurch festhält, den man zu beachten hat, um mit Frege selbst _____________ 2 3 … um Wittgensteins Wortwahl aus § 66 der Philosophischen Untersuchungen (Kritischgenetische Edition, Frankfurt a. M. 2001) aufzugreifen; vgl. auch mein: Das Wesen der Welt sichtbar machen, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie (2004), S. 445-465. Frege: Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl, Stuttgart 1987, S. 23. Zum ersten Grundsatz in den Grundlagen der Arithmetik 303 zu sprechen. Wie wichtig ein Grundsatz ist, mag erst in seinem Beachten deutlich werden. Aber kann man ihm auch erst während der Untersuchung (s)einen Inhalt, oder Sinn, verleihen? Muss nicht die Einteilung in Subjektives und Objektives feststehen, bevor man die entsprechende Untersuchung zur Natur der Zahlen anstellt? Woran sollte man sonst festhalten, was anwenden oder beachten! – Nur, wenn es schon feststeht, was subjektiv resp. objektiv ist, und man den entsprechenden Grundsatz kennen muss, um ihn beachten zu können, muss man, soweit der Grundsatz einschlägig ist, auch schon wissen, was es mit den Zahlen auf sich hat. Es bedarf keiner Untersuchung mehr, und daher keiner Grundsätze. Anders gesagt, wenn Zahlen objektiv sind, müssen sie es auch sein. Dann aber bestimmen sie mit, was objektiv ist. Das Objektive hat dann gewissermaßen keine Chance, die Aufnahme der Zahlen in sein Reich zu verhindern. Das Objektive ist ebenso wenig vor einer Untersuchung der Natur der Zahlen gegeben, wie man einfach feststellen könnte, dass Zahlen objektiv sind. Denn sie sind es nicht einfach, sondern mit Notwendigkeit, wenn sie es überhaupt sind. Dass sie es sind, wenn sie es sind, kann sich so wenig „herausstellen“, wie sich herausstellen kann, dass sie es nicht sind, wenn sie es nicht sind. Man darf sich, mit anderen Worten, hierin nicht irren können. Genau genommen, kann man nicht einmal glauben, Zahlen seien (nicht) objektiv. Denn was heißt es, dies zu glauben, wenn es gar nicht wahr (falsch) sein kann, es aber für eine Überzeugung essentiell ist, dass man mit ihr falsch oder richtig liegen kann. Genau das aber ist nicht der Fall, wenn etwas nicht wahr, oder eben nicht falsch, sein kann. Die Ausdrücke „notwendige Wahrheit“ oder „unmögliche Wahrheit“ sind nicht so zusammengesetzt wie der Ausdruck „angenehme Wahrheit“. Eine unmögliche Wahrheit ist eher gar keine Wahrheit, als eine Form der Wahrheit unter vielen. (Das sieht man dem Ausdruck „unmögliche Wahrheit“ eher an als dem Ausdruck „notwendige Wahrheit“.) Mehr noch, man kann nicht einmal sagen, was man hier nicht einmal glauben kann. Denn angenommen, eine Sache habe eines der Merkmale nicht (Zahlen seien nicht subjektiv), die zu denen gehören, welche die Sache zu dem machen, was sie ist. Was hat dann jenes Merkmal nicht? Offensichtlich nicht das, was jenes Merkmal nicht hat. Denn das gibt es dann ja nicht, oder von ihm ist jedenfalls nicht die Rede. Aber natürlich auch nicht eine andere Sache. Dann aber kann man auch nicht sagen, eine Sache habe ein Merkmal, welches zu denen gehört, die sie zu der Sache machen, die sie ist. Wie will man dann sagen können, sie müsse dieses Merkmal haben, wenn daraus folgen soll, dass sie es hat? Denn das kann man eben nicht sagen. Aber zurück zu den Grundsätzen. Ginge es bei diesen nicht um Unterscheidungen in Bezug auf das, „was Zahl ist“, lägen die Dinge anders. Der Satz „Fasse Dich kurz!“ kann befolgt werden, ohne dass damit bereits Richard Raatzsch 304 entschieden wäre, was man möglichst kurz gefasst äußern wird. Aber ein Satz dieser Art ist kein Grundsatz im Grundlagen-Sinn. Was wirklich als Grundsatz in Frage käme, kommt gerade nicht in Frage. Es mag mit Schwierigkeiten verbunden sein, sich kurz zu fassen; aber die Schwierigkeiten, die damit einhergehen, Grundlagen-Grundsätze anzuwenden, sind von anderer Art: sie scheinen diesen Grundsätzen als solchen anzugehören. Ein Projekt jedenfalls, bei dessen Umsetzung es auf die Beachtung von Grundlagen-Grundsätzen ankommt, die als solche unabhängig von dem Projekt und seiner Realisierung sind, kann sich nicht darum drehen, herauszufinden, was etwas ist. Denn von seiner Natur wäre in den Grundsätzen schon die Rede. 3. Eine Variante dieser Schwierigkeit zeigt sich, wenn Frege von einer „gründliche(n) Untersuchung des Zahlbegriffs“ als einer Aufgabe spricht, die „Mathematik und Philosophie gemeinsam (ist)“4, und hinzufügt, die Tatsache, dass diese Aufgabe bisher nicht gelöst wurde, liege vor allem an dem Überwiegen psychologischer Betrachtungsweisen in der Philosophie, die selbst in die Logik eindringen. Mit dieser Richtung hat die Mathematik gar keine Berührungspunkte … 5 Was hat es hier mit dem Überwiegen psychologischer Betrachtungsweisen auf sich? Sind diese der Philosophie nicht äußerlich – ist also z. B. die Bedeutung des Wortes „Philosophie“ mit Hinweis auf tatsächliche, so benannte Aktivitäten bestimmbar, in denen dann psychologische Betrachtungsweisen überwiegen – dann kann jene Aufgabe nicht Mathematik und Philosophie gemeinsam sein und zugleich die Mathematik mit der Psychologie keine Berührungspunkte haben. Wenn jene Betrachtungsweisen dagegen der Philosophie selbst äußerlich sind, was wäre dann eine genuin philosophische Betrachtungsweise? Freges erläuternde Ausführungen legen zwar die zweite Alternative nahe. Denn es heißt, dass mit einer Betrachtung der „Vorstellungen und deren Wechsel … beim mathematischen Denken“ gar nichts „zur Begründung der Arithmetik“ beigetragen wird, dass „diese innern Bilder … für das Wesen der Sache vollkommen gleichgiltig und zufällig sind, ebenso zufällig wie eine schwarze Tafel und ein Stück Kreide“6. Aber welche Bedeutung kann es dann haben, dass auch dem „Mathematiker als solchem … diese inneren Bilder, ihre Entstehung und Veränderung gleichgiltig (sind).“7 Wenn es sich in beiden Fällen um dieselbe (Art der) Gleichgültigkeit handelt, wie unterscheiden sich dann Philosophie und _____________ 4 5 6 7 Vgl. Frege: Die Grundlagen der Arithmetik, a.a.O., S. 18. Ebd., S. 19. Ebd. Ebd. Zum ersten Grundsatz in den Grundlagen der Arithmetik 305 Mathematik? Ist die eine (Art der) Gleichgültigkeit aber von der andern verschieden, was sagt es dann, dass jene „innern Bilder“ sowohl für die Philosophie, als auch für die Mathematik belanglos sind? Warum soll es zwar die Mathematik nichts angehen, wohl aber die Philosophie? Nicht erst die Frage, was es denn dann verdiente, sondern schon die Frage, ob es sich um ein philosophisches oder ein mathematisches Problem handelt, ist zu beantworten, wenn es heißt, dass jene inneren Bilder „überhaupt nicht Vorstellungen der Zahl Hundert zu heißen verdienen“8 (ebd.). 4. Eine zweite Schwierigkeit im Zusammenhang mit dem ersten Grundsatz betrifft das Verhältnis der beiden Alternativen Psychologisches vs. Logisches und Subjektives vs. Objektives zueinander. Wie steht es, anders gesagt, um die Einheit des ersten Grundsatzes? Wer würde zum Beispiel prima facie sagen wollen, dass alles, was es geben kann, entweder zum Psychologischen oder zum Logischen gehört? Frege jedenfalls macht davon Gebrauch, dass es offensichtlich nicht der Fall ist; etwa wenn er nach der Auflistung der Grundsätze so fortsetzt: Um das Erste zu befolgen, habe ich das Wort ‚Vorstellung’ immer im psychologischen Sinne gebraucht und die Vorstellung von den Begriffen und den Gegenständen unterschieden. Die Frage nach der Einheit des ersten Grundsatzes stellt sich vor allem vor dem Hintergrund der beiden anderen Grundsätze: (G2) „Nach der Bedeutung der Wörter muss im Satzzusammenhange, nicht in ihrer Vereinzelung gefragt werden.“ (G3) „Der Unterschied zwischen Begriff und Gegenstand ist im Auge zu behalten.“9 Hier gibt es kein Problem der Einheit. Gegeben die dadurch nahe gelegte Zählweise, sollte man annehmen, dass Frege an Stelle seines ersten zwei Grundsätze angeführt hätte, wenn er die Frage betreffend die beiden Alternativen, die im ersten Grundsatz auftauchen, dahingehend hätte beantwortet haben wollen, dass es sich um zwei substantiell voneinander verschiedene Alternativen handelt. Die Lesart, welche die Einheit des ersten Grundsatzes, wie er dasteht, am stärksten macht, besteht natürlich darin, das Psychologische dem Subjektivem und das Logische dem Objektiven derart zuzuordnen, dass wir es nur mit einer Unterscheidung zu tun haben, die sich jedoch terminologisch verschieden fassen _____________ 8 9 Ebd. Ebd., S. 23. Richard Raatzsch 306 lässt. Wie man einerseits zwischen Lyrik und Prosa und andererseits zwischen dichtender und erzählender Literatur unterscheidet, ohne damit unbedingt einen sachlichen Unterschied zu verbinden, so könnte es sich auch im Fall von „Logisches – Psychologisches“ und „Subjektives – Objektives“ verhalten: man benutzt beide Paare als füreinander einsetzbar. Zu einer Deutung seines ersten Grundsatzes nach diesem Muster passt es, dass Frege eine zur Formulierung seines ersten Grundsatzes sozusagen quer stehende Formulierung dessen gibt, worum es in § 26 gehen soll: dass, zur Erinnerung und entsprechend betont, die Zahl „kein Gegenstand der Psychologie, sondern etwas Objektives“ ist – ähnlich dem, dass man, statt zu sagen, ein gewisser Text sei kein Fall von Lyrik, sondern von Prosa, sagt, er sei kein Beispiel für Lyrik, sondern eines für erzählende Literatur. So verstanden, reichte es also nicht hin, den Unterschied zwischen dem Psychologischen und dem Logischen einerseits und dem Subjektiven und dem Objektiven andererseits als einen zwischen zwei voneinander verschiedenen, aber miteinander zusammenhängenden Alternativen anzusehen. Wie man auch sagen könnte, der Unterschied zwischen Lyrik und Prosa hänge zwar zusammen mit dem zwischen gereimter und freier Sprache, sei aber dennoch nicht der gleiche Unterschied. Oder so, wie Frege selbst andeutet, dass es einen Zusammenhang zwischen seinem ersten und seinem zweiten Grundsatz gibt, wenn er kurz nach der Auflistung seiner Grundsätze im Anschluss an die oben zitierte kurze Bemerkung zum ersten Grundsatz schreibt, man sei bei Nichtbeachtung des zweiten Grundsatzes „fast genötigt, als Bedeutung der Wörter innere Bilder oder Taten der einzelnen Seele zu nehmen und damit auch gegen den ersten zu verstoßen.“10 Man verstößt also insofern gegen den ersten Grundsatz, indem man in der angegebenen Weise gegen den zweiten verstößt, als man so die Bedeutung der Wörter zu etwas Psychologischem macht, was sie nicht ist.11 Davon, dass man, indem man gegen den zweiten Grundsatz verstößt, nur gegen einen Teil des ersten zu verstoßen tendiere, ist dabei keine Rede. Also ist der erste Grundsatz einer; Inhalt und Zählweise stimmen überein. Wenn Frege jedoch sagt, man sei durch die Nichtbeachtung des zweiten Grundsatzes „fast genötigt ...“ (meine Hervorhebung), legt dies auch nahe, dass es eine andere Auffassung der Bedeutung gibt, die mit der Betrachtung der Wörter in ihrer Vereinzelung vereinbar ist. – Es liegt auf der Hand, was hier in Frage kommt: der Gegenstand, für den das Wort steht. _____________ 10 11 Ebd. Kann man die Bedeutung der Wörter als etwas Psychologisches, Subjektives auffassen, ohne sie damit auch schon in ihrer Vereinzelung, statt im Satzzusammenhang, zu betrachten? Was ist die Einheit der drei Grundsätze? – Sind sie, im Grunde, ein Satz? Zum ersten Grundsatz in den Grundlagen der Arithmetik 307 5. Eine mit dieser Idee oft verbundene Überlegung hat Frege bereits vor § 26 der Grundlagen erörtert, nämlich ob die Anzahl „eine Eigenschaft der äußeren Dinge“ sei. Wenn ja, dann wäre die Arithmetik in dem Maße eine empirische Wissenschaft, in dem diese durch die Beschäftigung mit derartigen Eigenschaften charakterisiert ist. Frege kommt zu dem Ergebnis, dass die Anzahl keine derartige Eigenschaft äußerer Dinge sein kann. Betrachten wir die Sache aus der Nähe. Freges Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass Zahlen sprachlich meistens in adjektivischer Form und in attributiver Verbindung ähnlich wie die Wörter ‚hart’, ‚schwer’, ‚rot’ erscheinen, welche Eigenschaften der äußeren Dinge bedeuten.12 Es liegt die Frage nahe, ob man die einzelnen Zahlen auch so auffassen müsse, und ob demgemäß der Begriff der Anzahl etwa mit dem der Farbe zusammengestellt werden könne.13 (GA 50) Das klingt unschuldiger als es wirklich ist. (1) Der Begriff der äußeren Dinge wird vorausgesetzt, und nicht erläutert. Zwar ließe sich aus den Beispielen, die Frege anschließend diskutiert, eine Definition der Art „Blätter, Steine, Spielkarten, Flächen (?), Bündel von Strohhalmen, Strohhalme und Ähnliches sind äußere Dinge“ abziehen. Aber warum sollte alles, was darunter fällt, in jeder wesentlichen Hinsicht gleich sein? Das ist gerade der Witz der Klausel „und Ähnliches“. (2) Im Unterschied wozu erscheinen Zahlen meistens in adjektivischer Form und attributiver Verbindung? Im Unterschied dazu, dass sie beides nicht sind? Das sagte noch nichts darüber, wie es sich bei ihnen in Hinsicht auf die Frage verhält, ob sie Eigenschaften äußerer Dinge sind. Wenn man nun aber sagt, das Erscheinen der Zahlen in adjektivischer Form und attributiver Verbindung entspräche insofern nicht ihrem Wesen, als das Erscheinen von „hart“, „schwer“ und „rot“ in dieser Form dies tut, dann hat man bereits die Antwort auf die Frage, um die es gehen soll, vorweggenommen. (3) Die Frage, ob man einzelne Zahlen auch so auffassen müsse, kommt dann insofern zu spät, als zunächst zu klären wäre, wie es in dieser Hinsicht um „hart“ usw. steht. Denn in dem Moment, in dem wir zwischen adjektivischer Verwendung und attributiver Verbindung einerseits und Bedeuten einer Eigenschaft eines äußeren Dinges andererseits unterscheiden, stellt sich die Frage auch schon für alles, was mit adjektivischer Form und attributiver Verwendung. _____________ 12 13 Die Härte eines Gegenstandes ist eine Eigenschaft anderer Art als seine magnetischen Eigenschaften, aber dennoch eine empirische Eigenschaft. Siehe unten die Ausführungen zum Äquator und überhaupt Moores Proof of an External World, in: Proceedings of the British Academy Vol. XXV (1939). Frege: Die Grundlagen der Arithmetik, a.a.O., S. 50. Richard Raatzsch 308 (4) Wenn sie sich aber für alle stellt, was soll es dann bedeuten, zu fragen, „ob man die einzelnen Zahlen auch so auffassen müsse“? Muss man denn die Härte, Schwere und Farbe so auffassen? Und wenn ja, wieso bedarf das dann keiner Untersuchung? – Weil man sie nicht anders auffassen kann? – Selbst wenn, so zeigte dies noch nicht, was es zeigen müsste, damit Freges Frage nahe läge. Es zeigte nur, dass wir zur Erklärung der Bedeutung des Ausdrucks „Eigenschaft eines äußeren Gegenstandes“ so etwas sagen könnten wie: „Die Härte eines Steines, und seine Schwere und Ähnliches sind solche Eigenschaften.“ Und wir würden die Intensität eines Gefühls, soweit es eine Eigenschaft ist, eher nicht so nennen (s. u.). Aber das legt eben nicht „die Frage nahe, ob man die einzelnen Zahlen auch so auffassen müsse“; und die Frage, „ob dementsprechend der Begriff der Anzahl etwa mit dem der Farbe zusammengestellt werden könne“, käme nur insofern auf, als es eine Frage danach ist, wie wir mit den entsprechenden Ausdrücken de facto umgehen.14 _____________ 14 Ein Wort zur Farbe. Bei Goethe heißt es in der Einleitung Zur Farbenlehre (in: ders.: Werke, Band 13: Naturwissenschaftliche Schriften, München 2002, S. 314-523): Wär nicht das Auge sonnenhaft, Wie könnten wir das Licht erblicken? (S. 324) Wenn das Auge sonnenhaft ist, hat das Licht insofern eine subjektive Eigenschaft, als es eine Eigenschaft des Subjekts hat. (Eine Eigenschaft des Auges ist insofern eine des Subjekts, als es nicht um sezierte Augen oder die eines Toten geht. „Subjekt“ bedeutet hier svw. „sehendes (oder sehfähiges) Lebewesen“.) Wenn dies auch in die andere Richtung gilt, geht Goethes Überlegung gegen die Idee, alles sei entweder subjektiv oder objektiv. (Goethe verweist hier selber auf die alte ionische Schule – Parmenides und Empedokles – nach der Gleiches nur von Gleichem erkannt wird, und einen „alten Mystiker“, womit Plotin gemeint sein soll; siehe: Plotin: Über das Schöne, in: ders.: Ausgewählte Schriften, Stuttgart 2001, S. 47-60, = Enneade I.) Auf dieser Voraussetzung aber beruht Freges erster Grundsatz oder er drückt sie doch aus. Allerdings geht er auch Schritte in die Richtung, in die auch Goethes Aperçu weist, etwa wenn auch er auf Farben zu sprechen kommt: „Man denkt gewöhnlich bei ‘weiß’ an eine gewisse Empfindung, die natürlich ganz subjektiv ist“ – dass sie ganz subjektiv ist, nicht etwa halb, und damit schon halb objektiv, deutet auf eine Aufweichung der Dichotomie von Subjektivem und Objektivem. Hier ist die Fortsetzung: „aber schon im gewöhnlichen Sprachgebrauche, scheint mir, tritt ein objektiver Sinn vielfach hervor. Wenn man den Schnee weiß nennt, so will man eine objektive Beschaffenheit ausdrücken, die man beim gewöhnlichen Tageslicht an einer gewissen Empfindung erkennt. Wird er farbig beleuchtet, so bringt man das bei der Beurteilung in Anschlag. Man sagt vielleicht: er erscheint jetzt rot, aber er ist weiß. Auch der Farbenblinde kann von rot und grün reden, obwohl er diese Farben in der Empfindung nicht unterscheidet. Er erkennt den Unterschied daran, dass andere ihn machen, oder vielleicht durch einen physikalischen Versuch. So bezeichnet das Farbenwort oft nicht unsere subjektive Empfindung, von der wir nicht wissen können, dass sie mit der eines andern übereinstimmt – denn offenbar verbürgt das die gleiche Benennung keineswegs – sondern eine objektive Beschaffenheit.“ (Frege: Grundlagen der Arithmetik, a.a.O., S. 58f.) Goethe verbindet seine Frage betreffend das Auge übrigens sofort mit folgendem Gedanken: Zum ersten Grundsatz in den Grundlagen der Arithmetik 309 Es gibt also eine Frage, aber in dieser geht es so wenig um die Grundlagen der Arithmetik in Freges Sinn, wie man die Grundlagen der empirischen Wissenschaften aufdeckt, wenn man sagt, Härte und Schwere nenne man auch „Eigenschaften äußerer Dinge“ und damit einen Unterschied etwa zur Intensität eines Gefühls machen will. Das wirft ein Licht auf den § 22, nach dem „die äußern Dinge ... keine strengen Einheiten dar(stellen).“ Als Argument wird Baumanns Ansicht angeführt, „sie stellen uns abgegrenzte Gruppen oder sinnliche Punkte dar, aber wir haben die Freiheit, diese selbe wieder als vieles zu betrachten.’“ Frege: In der Tat, während ich nicht imstande bin, durch bloße Auffassungsweise die Farbe eines Dinges oder seine Härte im geringsten zu verändern, kann ich die Ilias als Ein Gedicht, als 24 Gesänge oder als eine große Anzahl von Versen auffassen.15 Was kann ich so auffassen? Wenn man sagt, man fasse etwas so und so auf, muss jenes Etwas selbst, scheint es, unabhängig davon bestimmt sein. Denn was könnte es heißen, X als X aufzufassen? die Ilias als Ilias? (Kann die Ilias uns als Ilias gegeben sein?) Wenn die Ilias Ein Gedicht ist, bestehend aus 24 _____________ 15 Lebt nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt uns Göttliches entzücken? Das erinnert an Angelus Silesius, der aus dem Fürwahrhalten von „Gott existiert“ auf Gottes Existenz schließt, oder an Blake (The Marriage of Heaven and Hell, in: ders.: The Complete Poetry and Prose, Garden City 1982, S. 33-45), der, S. 38, meint: „Truth can never be told so as to be understood and not be believed“, und dabei natürlich an Wahrheiten über Gott denkt. Es fällt wiederum schwer, hier keine Verbindung zu Frege zu sehen, wenn man bei ihm liest: „Weder die Logik noch die Mathematik hat als Aufgabe, die Seelen und den Bewusstseinsinhalt zu erforschen, dessen Träger der einzelne Mensch ist. Eher könnte man vielleicht als ihre Aufgabe die Erforschung des Geistes hinstellen, des Geistes, nicht der Geister.“ (Frege: Der Gedanke. Eine logische Untersuchung, in: ders.: Logische Untersuchungen, 3. Aufl., Göttingen 1986, S. 30-53, S. 50). In Logik (Frege: Schriften zur Logik und Sprachphilosophie, Hamburg 1990, S. 35-73) S. 69 schließlich stellt Frege Gedanken Vorstellungen gegenüber und bezeichnet sie als nicht der einzelnen Seele gehörend, was er in Parenthese so erläutert: „sie sind nicht subjektiv“. Sie sind, heißt es weiter, nicht Produkt unseres Denkens und stehen jedem von uns in gleicher Weise gegenüber – also objektiv? Kurz danach heißt es, sie seien „unräumlich und im wesentlichen unzeitlich“. An der oben zitierten Stelle der Grundlagen setzt Frege nun in folgender Weise fort: „So verstehe ich unter Objektivität eine Unabhängigkeit von unserm Empfinden, Anschauen und Vorstellen, von dem Entwerfen innerer Bilder aus den Erinnerungen früherer Empfindungen, aber nicht eine Unabhängigkeit von der Vernunft; denn die Frage beantworten, was die Dinge unabhängig von unserer Vernunft sind, hieße urteilen, ohne zu urteilen, den Pelz waschen, ohne ihn nass zu machen.“ – Die Vernunft, nicht unsere? (Zu Goethe siehe Vendler: Philosophieren über die Farben: Goethe und Wittgenstein, in: Raatzsch (ed.): Philosophieren über Philosophie, Leipzig 1999, S. 221-240, und allgemein: Mark Johnston: Is the External World Invisible?, in: Philosophical Issues 7(1996), S. 185-198.) Frege: Grundlagen der Arithmetik, a.a.O., S. 51. Richard Raatzsch 310 Gesängen mit zahllosen Versen, dann kann man sie nicht so auffassen, wie Frege meint. Denn das liefe darauf hinaus, zu sagen, man fasse die Ilias als Ilias auf. Würde man dagegen sagen, die Ilias sei nicht Ein Gedicht, bestehend aus ...., dann würde der Satz, wonach man die Ilias so und so auffassen könne, dem Satz gleichen, man könne X, von dem man nicht weiß, was es ist, so und so auffassen. Natürlich kann man sagen, man könne die Ilias als Ein Gedicht, als 24 Gesänge oder als eine große Anzahl von Versen auffassen. Nur legt man sich damit nicht darauf fest, dass es einen Gegenstand gibt, von dem man nichts weiß, außer, dass man ihn so und so betrachten kann, denn alles, was man von ihm wissen könnte, wäre nur eine weitere Art, ihn zu betrachten (wie er uns gegeben ist). Sondern es heißt einfach, dass man sich, wenn man z. B. die Ilias als Ein Gedicht auffasst, auf eine unter mehreren Verwendungsweisen des Ausdrucks „Ilias“ festlegt. Wenn man etwa fragt, wann die Ilias entstanden sei, und zur Antwort erhält: an dem und dem Tag, von 9 bis 11 Uhr, dann am nächsten Tag von 6 bis 20 Uhr, dann zwei Tage später von ..., darf man vermuten, dass der Antwortende die Frage so verstanden hat: Wann sind die zahllosen Verse der Ilias entstanden? Und da es die Ilias nicht zusätzlich und unabhängig von jenen Versen gibt, kann man jene Frage auch dann so auffassen, ohne sich mehr als ungewöhnlich zu verhalten, wenn man weiß, dass „Ilias“ der Name Eines Gedichtes, bestehend aus 24 Gesängen, ist. Frege meint, dass dann, wenn ich jemandem einen Stein gebe mit den Worten: bestimme das Gewicht hiervon, so habe ich ihm damit den ganzen Gegenstand seiner Untersuchung gegeben. Wenn ich ihm aber ein Pack Spielkarten in die Hand gebe mit den Worten: bestimme die Anzahl hiervon, so weiß er nicht, ob er die Zahl der Karten oder der vollständigen Spiele oder etwa der Werteinheiten beim Skatspiele erfahren will. Damit, dass ich ihm den Pack in die Hand gebe, habe ich ihm den Gegenstand seiner Untersuchung noch nicht vollständig gegeben; ich muss ein Wort: Karte, Spiel, Werteinheit hinzufügen. Man kann auch nicht sagen, dass die verschiedenen Zahlen hier so wie verschiedene Farben neben einander bestehen.16 Aber hier trübt der Wechsel des Beispiels die Sicht. Wenn ich jemandem einen Stein in die Hand gebe mit der Aufforderung, hiervon die Anzahl zu bestimmen, wird er sich vermutlich wundern. Aber wird der Grund sein, dass er nicht weiß, was der Gegenstand seiner Bestimmung sein soll, oder eher der, dass man hier kaum von einer Aufgabe sprechen kann, die noch zu erfüllen wäre? Andererseits, wenn wir jemandem ein loses Pack Karten in die Hand gäben mit der Aufforderung, hiervon das Gewicht zu bestimmen, wären wir vielleicht nicht überrascht, wenn er fragte: „Wovon, von jeder einzelnen Karte, dem Pack ...?“ Es ist nicht einfach so, dass wir in dem einen Fall mit einem Wort wie „hiervon“ auskommen, in dem andern aber nicht, und dass _____________ 16 Ebd. Zum ersten Grundsatz in den Grundlagen der Arithmetik 311 dies zeigt, dass die Anzahl keine Eigenschaft äußerer Gegenstände ist. Wenn es um die Anzahl geht, kann ein Wort wie „hiervon“ ebenso ausreichen, wie es eines weiteren Wortes bedürfen kann, wenn es um das Gewicht geht. Es kommt auf die Situation an. Es muss keine „an sich ausgezeichnete“ Notation für die Anzahl geben, die es ggf. noch zu finden gilt, weil sie hinter dem verborgen ist, wie die Zahl sprachlich erscheint. Die Schwere ist das, als was sie sprachlich erscheint; ebenso die Anzahl. Das macht sie nur dann gleich, wenn die Art, auf die etwas sprachlich erscheint, darauf beschränkt ist, ob etwas adjektivisch verwendet ... wird. Ob sie aber darauf beschränkt sind, hängt von dem Begriff der Sprache ab, den man hier unterlegt. Wenn es heißt: Wenn ich einen Gegenstand mit demselben Rechte grün oder rot nennen kann, so ist das ein Zeichen, dass dieser einzelne Gegenstand nicht der eigentliche Träger des Grünen ist. Diesen habe ich erst in einer Fläche, die nur grün ist.17, dann lässt sich das so „übersetzen“: - Wenn, sagen wir, ein Blatt, auf der einen Seite grün und auf der andern rot ist, dann kann man mit dem gleichen Recht sagen, es sei rot und es sei grün. - Aber dieses Recht, mit dem man beides sagen kann, ist von anderer Art als das Recht, mit dem man von etwas sagen kann, es sei ganz und gar grün, oder es sei ganz und gar rot. - Von einem Blatt zu sagen, es sei grün und rot, kann eine Feststellung betreffend das Blatt sein; und insofern wir mit einer solchen Feststellung einem Gegenstand eine oder mehrere Eigenschaften zuschreiben und ein Gegenstand, dem Eigenschaften zugeschrieben werden, Träger dieser Eigenschaften ist, ist das Blatt der Träger des Grünen und des Roten. - Von einem Blatt zu sagen, es sei ganz und gar grün, kann eine Feststellung betreffend das Blatt sein; und ... ist das Blatt der Träger des Grünen. - Von einer Fläche zu sagen, sie sei grün und rot kann eine Feststellung betreffend die Fläche sein; und ... ist die Fläche der Träger des Grünen und des Roten. - Von einer Fläche zu sagen, sie sei ganz und gar grün, kann eine Feststellung betreffend die Fläche sein; und ... ist die Fläche der Träger des Grünen. - Von einer Fläche, die ganz und gar grün ist, zu sagen, sie sei der eigentliche Träger des Grünen, heißt nicht, eine Feststellung betreffend die Farbe der Fläche zu treffen; sondern es heißt, dass wir für einen Ausdruck wie „Fläche, die ganz und gar rot und grün ist“ keine Verwendung haben – von einem Träger ist hier keine Rede mehr, und der Ausdruck _____________ 17 Ebd., S. 52. Richard Raatzsch 312 „eigentlicher Träger“ bezeichnet nicht eine Unterart aus der Menge der Träger von Eigenschaften. Dass ein Stapel Karten aus 32 Karten bestehen kann, bedeutet dagegen nicht, dass ich einem „Gegenstand ... mit demselben Rechte verschiedene Zahlen zuschreiben kann“ wie einem Blatt verschiedene Farben. Ein Blatt besteht nicht im gleichen Sinn aus seinen beiden Seiten wie ein Stapel Karten aus 32 Karten. Wenn ich unter „Gegenstand, dem ich eine Zahl zuschreiben kann“, den Stapel Karten verstehe, dann kann ich ihm nicht mit gleichem Recht verschiedene Zahlen zuschreiben. Ein Stapel Karten ist – ein Stapel Karten. Während der „eigentliche Träger“ der Farbe gar kein Träger der Farbe ist, gibt es im Fall der Anzahl nicht einmal ein Bedürfnis für jene vermeintliche Rolle eines „eigentlichen Trägers“. 6. Wenn die Anzahl keine objektive Eigenschaft äußerer Dinge18 sein kann, könnte sie dann vielleicht eine subjektive Eigenschaft äußerer Dinge sein? Muss, wenn eine Ansicht – oder, wie Frege es nennt: Meinung19 (GA 18, siehe dazu unten) – falsch ist, nicht eine andere, wenn auch nicht gerade diese, richtig sein? Es sieht nun leicht so aus, dass es so scheinen könnte, dass Zahlen subjektive Eigenschaften äußerer Gegenstände in Abhängigkeit von unserer Auffassung derselben sind; als wäre es vielleicht korrekt, so gut wie jede Zahl so gut wie jedem Ding zuzuschreiben, wenn wir es nur entsprechend auffassen. Immerhin, ein Stiefel kann als bestehend aus zwei Stiefelhälften, drei Stiefeldritteln usw. betrachtet werden.20 Aber indem man von verschiedenen Arten von Zusammensetzung eines Gegenstandes spricht, wird es unterbestimmt, zu sagen, man könne (korrekter Weise) jede beliebige Anzahl jedem beliebigen Gegenstand zuschreiben. (Und wenn man von Stiefeldritteln spricht, spricht man schon von „zahlengetränkten“ Gegenständen.) Kann es dann aber auch nur beginnen, so zu scheinen, als könne man jedem Gegenstand jede Zahl zuschreiben? Dazu bedürfte es doch einer Lizenz zum Übergang vom Begriff des Gegenstandes (oder des Dinges) zum Begriff des Gegenstandes in dieser oder jenen Weise seines Zusammengesetztseins (seiner Betrachtung). Wenn es hier einen Schein geben kann, dann den, dass es sich insofern von selbst versteht, welche Anzahl einem Gegenstand zu_____________ 18 19 20 Wie steht es um „innere Gegenstände“? – Die Intensität eines Gefühls etwa ist, häufig jedenfalls, niemandes Willkür anheim gestellt. (Vgl. auch: Frege: Grundlagen der Arithmetik, a.a.O., S. 52 und Wittgensteins Philosophische Bemerkungen, in: ders.: Werkausgabe, Band 2, Frankfurt a. M. 1984, § 65, S. 94.) Sie bedarf jedoch eines Subjekts, insofern das Gefühl eines Trägers bedarf. Der Mensch aber ist nicht subjektiv; und jene Intensität nicht meine (oder deine). Frege: Die Grundlagen der Arithmetik, a.a.O., S. 18. Joan Weiner: Frege, Oxford 1999, S. 54. Zum ersten Grundsatz in den Grundlagen der Arithmetik 313 kommt, als man gar nicht auf die Idee verfällt, nach einer besonderen Art von Zusammengesetztsein des Gegenstandes zu fragen. Das Staunen gälte also dem Begriff des Gegenstandes resp. dem des Gegenstandes in dieser (statt jener) Zusammensetzung, und nicht der Natur des Zukommens einer Anzahl zu einem Gegenstand. Sobald die Art der Gegenständlichkeit klar ist, fällt die Anzahl sozusagen von allein an ihren Platz, gegeben, wie wir von Anzahlen reden. Das macht die Frage nach der (richtigen) Anzahl zwar noch nicht zu einer psychologischen. Es ist aber auch nicht mehr einfach belanglos, wie man einen „Gegenstand“ auffasst. (Nachdem man einen begrifflichen Unterschied zwischen Gegenständen und Gegenständen in dieser oder jenen Weise ihres Zusammengesetztseins eingeführt hat, redet man nicht mehr so reden wie.) Ein Satz Karten mag aus 52 Karten bestehen, egal, ob man ihn bestehend aus Sätzen von Spielkarten oder aus Karten ansieht. Aber dass es 52 Karten sind, ist (nur) die richtige Antwort im Vergleich dazu, dass jemand sagt, es wären 63 Karten. Und die Hinsicht, in der es richtig ist, dass es 52 Karten sind, ist verschieden von der, in welcher es falsch wäre, von zwei Satz Spielkarten zu reden. Für die Frage, wie viel Kartensätze es sind, ist „Es sind 52 Karten“ weder eine falsche noch eine richtige, sondern eine irrelevante oder gar keine Antwort. Man könnte hier ebenso gut antworten: „Churchill war Finanzminister“ oder „52!“ als Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens geben. Das heißt, „52!“ kann nur in dem Sinn die (richtige) Antwort sein, als erst die Hinsicht, in der nach einer Anzahl gefragt wird, festlegt, was die (richtige) Antwort sein kann, gegeben, wir von Anzahlen reden. Und nur wenn die Hinsicht, in der eine Sache betrachtet wird, ebenfalls nicht zu dem psychologisch Relevanten gehört, kann man sagen, die Psychologie sei irrelevant für Freges Suche nach richtigen Antworten und deren Begründung. Wenn die Art der Betrachtung, in Bezug auf welche „52“ die richtige und jede andere Zahl die falsche Antwort ist, jedoch nichts Psychologisches ist, was geht uns dann irgendeine solche Art der Betrachtung an? Was könnte sie uns (als „Geister“) je bedeuten? Die Psychologie hat nichts damit zu tun, wann welche Antwort betreffend Anzahlen korrekt ist. Aber wenn Hinsichten, in denen man die Dinge betrachten kann, zu dem gehören, was uns zugänglich sein muss, erlaubt erst sie, dass irgendeine Antwort betreffend die Anzahlen, korrekt oder nicht, möglich ist. So erscheint die Psychologie als Grundlage der Arithmetik! (Es ist also eine wichtige Tatsache, dass hier nicht einfach jeder „denkt, was er will“.) 7. Wenn wir nun unter dem Objektiven so etwas wie einen Stein und seine Eigenschaften verstehen, ein Stein geradezu ein Muster eines äußeren Gegenstandes ist, die Anzahl aber keine Eigenschaft der äußeren Gegenstände, dann kommt man, wie Frege zu Beginn von § 26 schreibt, in der Tat „leicht dazu“, „die Zahl für etwas Subjektives anzusehen.“ – Eigentlich ist dies eine Untertreibung. Denn was könnte die Anzahl Anderes sein als etwas Richard Raatzsch 314 Subjektives, wenn sie keine Eigenschaft der äußeren Gegenstände ist, und natürlich schon gar nicht selbst ein äußerer Gegenstand, äußere Gegenstände aber das sind, woran man zuerst denken darf, wenn man das Wort „Objektives“ zu erklären hätte? Die Frage stellen, heißt, sie beantworten: die Anzahl kann dann etwas Objektives sein, wenn das Objektive sich nicht in dem erschöpft, woran man zuerst denkt, wenn man .... Sie kann insofern objektiv sein, als sie das sein kann, woran man beim Versuch einer Erklärung in zweiter oder dritter oder wievielter Linie auch immer denkt – so lange man nur nicht an etwas denkt, an das man in erster, zweiter ... Linie denken würde beim Erklären der Bedeutung von „Subjektives“.21 Nur wovon genau sollen wir dann das Subjektive scharf trennen? Von dem, woran wir in erster Linie denken, wenn wir das Wort „Objektives“ hören? Oder von dem aus der zweiten Linie? Wenn die Anzahl gerade keine Eigenschaft der äußeren Dinge ist, aber zugleich auch nichts Subjektives, dann, scheint es, müsste der erste Grundsatz in seinem zweiten Teil eigentlich lauten: (G1*b) Es sind ...., das Subjektive und die verschiedenen Arten des Objektiven scharf voneinander zu trennen. Dann sollte freilich auch jene quer stehende Formulierung des Argumentationszieles des § 26 – dass die Zahl „kein Gegenstand der Psychologie, sondern etwas Objektives“ ist – neu formuliert werden. Denn der Ausdruck „etwas Objektives“ hat jetzt mindestens zwei Bedeutungen in dem Sinne, in welchem das Objektive mehrere Formen annehmen kann, deren Unterschied für die Anzahl so bedeutsam ist, dass sie ihrem Wesen nach von einer dieser Formen so verschieden ist wie von dem Subjektiven: sie fällt nicht unter sie. Dann aber fehlt auch im ersten Teil des ersten Grundsatzes eine Größe, wenn es sich bei diesem Grundsatz wirklich um einen Grundsatz handeln soll. Als dessen vollständige Formulierung bietet sich im Lichte der obigen Ausführungen natürlich an: (G1*) Es sind das Psychologische einerseits und das empirisch Wissenschaftliche sowie das Logische andererseits, das Subjektive auf der _____________ 21 Daraus, dass du in erster Linie an X denkst, folgt nicht unbedingt nichts darüber, woran ich in erster Linie zu denken hätte, wenn wir beide als normal gelten sollen. In der Wendung „woran man zuerst ... denkt“ kommt also das Wort „man“ wesentlich vor. Insofern ist die Art des Denkens sowohl mit dem verwandt, was Frege „Geister“ nennt, wie auch mit dem, was er, als Kontrast dazu, „Geist“ betitelt (vgl.: Frege: Der Gedanke, a.a.O., S. 50). Schneider spricht von einfachsten Fällen von Gegenstandsnamen auf der einen Seite und einem „Extrem auf der unplausiblen Seite“ und moniert, dass bestimmte Übertragungen nicht „einleuchten“. vgl. Schneider: Phantasie und Kalkül, Frankfurt a. M. 1999, S. 257. Zum ersten Grundsatz in den Grundlagen der Arithmetik 315 einen und die verschiedenen Arten des Objektiven auf der andern Seite scharf voneinander zu trennen. Diese Ergänzung kommt zwar dem entgegen, dass eine „gewisse Ähnlichkeit der Anzahl und der Farbe“ herrscht, die aber nicht darin besteht, „dass beide an äußern Dingen sinnlich wahrnehmbar, sondern darin, dass beide objektiv sind.“22 ( – und soweit das eine Ähnlichkeit ist! Sind alle Dinge einander darin ähnlich, Dinge zu sein?) Aber jene Ergänzung kommt dieser Bemerkung nur in dem Sinne entgegen, dass letztere zugleich wie eine Erläuterung dessen gelesen werden muss, was „objektiv“ jeweils heißen soll. 8. Die Ergänzung lässt zudem den unmittelbaren Fortgang des § 26 unverständlich werden. Denn wenn Frege an der zuletzt zitierten Stelle fortsetzt, indem er den Gedanken erwägt, „die Weise, wie die Zahl in uns entsteht, (könne) über ihr Wesen Aufschluss geben“, so dass es also auf „eine psychologische Untersuchung ... ankommen“ würde, dann stellt sich die Frage, was der Ausdruck „psychologische Untersuchung“ hier eigentlich besagen soll. Wenn ein Psychologe als solcher eine Untersuchung anstellen kann, wie die Zahl in uns entsteht, dann kann es sich bei dem Entstehen der Zahlen nicht um einen inneren Vorgang in dem Sinne handeln, in dem ein Vorgang ein innerer ist, wenn nur der, dessen innerer Vorgang es ist, ihn „in einer besonderen und ursprünglichen Weise“23 erkennen kann. – Das aber ist nach Frege ein Merkmal innerer Vorgänge. Wie es etwas weiter hinten im § 26 am Beispiel des Raumes als einer Erscheinung heißt, können (wir) nicht einmal wissen, ob er dem einen Menschen so wie dem andern erscheint; denn wir können die Raumerscheinung des einen nicht neben die des andern legen, um sie zu vergleichen. Da dies ebenso für gestrige und heutige Raumerscheinungen gilt, kann man, genau genommen, überhaupt keine Raumerscheinungen miteinander vergleichen, auch nicht die eigenen. Die Aus_____________ 22 23 Frege: Die Grundlagen der Arithmetik, a.a.O., S. 57. ... wie es in Der Gedanke (a.a.O., S. 39) heißt. Diese Weise, in der jeder sich gegeben ist, ist eine andere, als die, in der ein anderer einem gegeben ist. Im letzten Fall muss man offensichtlich hinzufügen: soweit er einem gegeben ist. (Er ist ja nicht: sein Körper; denn es müsste ja eben sein Körper sein. Siehe hierzu Kapitel 10 von Kennys Wittgenstein (London 1973) und die Aufsätze von Cook (Wittgenstein on Privacy, in: Philosophical Review 74(1965), S. 281-314 und Philipp (Philosophical Investigations 293: Private vs. Public Beetles, in: ders.: Logisch-philosophische Untersuchungen, Berlin-New York 1998, S. 393-404).) An anderen Stellen sieht Frege die Gegenposition zu der seinigen zum Solipsismus führen (siehe hierzu den Überblick bei Kusch: Psychologism. A case study in the sociology of philosophical knowledge, London-New York 1995, S. 30ff.). Nur, wenn der Solipsismus nicht falsch ist, sondern unsinnig, beginnt das wirkliche Problem bereits mit der Idee einer philosophischen Position. Wenn alles dafür spricht, dass ich den Solipsismus bekämpfe (oder welche Position auch immer), dann sollte ich auch die eigene Position aufgeben (vgl. dagegen Schneider: Phantasie und Kalkül, a.a. O., S. 12). 316 Richard Raatzsch drücke „seine Raumerscheinung“ und „frühere/spätere Raumerscheinung“ sind widersinnig. Von Raumerscheinungen ist gar keine Rede mehr. Was aber könnte es dann heißen, eine psychologische Untersuchung, von welchem inneren Vorgang, Ereignis, Zustand oder Ding auch immer, anzustellen? Die Anzahl ist, so gesehen, nicht deshalb kein Gegenstand psychologischer Untersuchungen, weil eine psychologische „Beschreibung der innern Vorgänge, die der Fällung eines Zahlurteils vorhergehen, ... nie, auch wenn sie zutreffender ist, eine eigentliche Begriffsbestimmung ersetzen“ kann, weshalb es nicht erstaunt, dass sie „nie zum Beweise eines arithmetischen Satzes (wird) herangezogen werden können; wir erfahren durch sie keine Eigenschaft der Zahlen“ – sondern weil schlicht nichts Gegenstand einer psychologischen Untersuchung sein kann. 9. Man könnte sich nun bei der Zurückweisung der „Ergänzung“ seines ersten Grundsatzes insofern auf Frege selbst stützen, als dieser schreibt: „Ich unterscheide das Objektive von dem Handgreiflichen, Räumlichen, Wirklichen.“ Die Erläuterung dieser Unterscheidung erfolgt wieder anhand von Beispielen: „Die Erdachse, der Massenmittelpunkt des Sonnensystems sind objektiv, aber ich möchte sie nicht wirklich nennen, wie die Erde selbst.“24 ( – Aber würde man in Bezug auf die Erdachse überhaupt von wirklich oder unwirklich sprechen? Wann würde man das tun?) Bevor wir auf die Folgen dieser Bestimmung des Begriffs des Objektiven eingehen, muss festgehalten werden, dass der entscheidende Punkt erhalten bleibt: in der Formulierung des Grundsatzes ist von weniger Arten von Dingen die Rede als später, wenn es um die Einhaltung oder Anwendung dieses Grundsatzes geht. Hier sind nun die Schwierigkeiten mit Händen zu greifen. Denn natürlich werden wir, nach dem, was oben als Muster des Subjektiven fungierte, nicht sagen, das Handgreifliche sei subjektiv. Wie steht es also in Hinsicht auf die Unterscheidung zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven um das „Handgreifliche, Räumliche, Wirkliche“? An dieser Stelle der Grundlagen besteht noch kein Grund für irgendeine andere Auffassung als die, dass das „Handgreifliche, Räumliche, Wirkliche“ etwas Objektives ist.25 Also kann die gerade zitierte spätere Formulierung auch nur als das verstanden werden, als was sie auch vorgebracht wird: als eine Festlegung. Dann aber ist auch der Grundsatz entweder nicht mehr einschlägig oder rückwirkend neu zu lesen. Ist er nicht mehr einschlägig, ist er schlicht kein Grundsatz dieser Untersuchung mehr; ist er neu zu lesen, wird es zum Rätsel, wie man ihm in Hinsicht auf die Frage zu folgen hat, ob die Anzahl eine Eigenschaft äußerer Dinge ist. _____________ 24 25 Frege: Die Grundlagen der Arithmetik, a.a.O., S. 57. Aber ist das Handgreifliche nicht, prinzipiell, zu greifen? Und zu greifen durch ein Subjekt? Zum ersten Grundsatz in den Grundlagen der Arithmetik 317 Man kann den ersten Grundsatz zwar in folgender Weise spezifizieren: (G1’) Es ist das Psychologische von dem Logischen, das Subjektive von dem Objektiven in dem Sinne, in dem die Erdachse und der Massenmittelpunkt des Sonnensystems objektiv sind, scharf zu trennen. Aber das ist nur eine scheinbare Änderung gegenüber (G1*), weil der Ausdruck „in dem Sinne, in dem ...“ schon darauf hinweist, dass (G1’) nur eine verkürzte Fassung der vollständigen Formulierung des Grundsatzes ist, die zugleich die Frage beantwortet, welches der Sinn ist, in dem die Erdachse etwas Objektives ist. Die vollständige Spezifizierung wird also so aussehen müssen: (G1’’) Es ist das Psychologische von dem Logischen, das Subjektive von dem Objektiven in dem Sinne, in dem die Erdachse und der Massenmittelpunkt des Sonnensystems objektiv, aber nicht handgreiflich, räumlich, wirklich sind, scharf zu trennen. Und dies ist in der Tat nur eine spezifischere Formulierung von (G1’). Der Unterschied besteht lediglich darin, dass die verschiedenen Formen des Objektiven, von denen in (G1’) die Rede ist, in (G1’’) näher bestimmt sind: einmal als Handgreifliches usw., und einmal als etwas, dass nicht handgreiflich ist. Was diesen letzteren Sinn von „objektiv“ angeht, wäre eine noch genauere Spezifizierung möglich, die aber auch nichts an der logischen Vielfalt des zweiten Teilsatzes von (G1*) ändert: (G1’’’) Es ist das Psychologische von dem Logischen, das Subjektive von dem Objektiven in dem Sinne scharf zu trennen, in dem die Erdachse und der Massenmittelpunkt des Sonnensystems objektiv, also nicht erdacht, nicht durch Denken entstanden, kein Ergebnis eines seelischen Vorgangs, aber auch nicht handgreiflich, räumlich, wirklich sind. Wenn es sich bei dem ersten Grundsatz jedoch wirklich um einen Grundsatz, und nicht um zwei handeln soll, dann muss die begriffliche, logische Mannigfaltigkeit des ersten Teilsatzes der des zweiten angepasst werden. Gegeben das, was Freges Ausführungen nahe legen, bringt uns dies wieder zu (G1*), und damit zurück zu dem Problem, vor dem wir oben schon standen: dass die Rede von einer psychologischen Untersuchung unverständlich wird und damit der Gegensatz, der die Natur der Untersuchung in den Grundlagen erläutern soll. 10. Natürlich – na ja! – ist der Äquator weder etwas Handgreifliches, wie eine Spielkarte, noch ein seelischer Vorgang, wie die Freude beim Spielen. Wie immer es also genannt werden mag, ist das einzig Wichtige nicht, dass wir es mit wirklichen Unterschieden zu tun haben, die zu beachten für das Problem der Natur der Anzahl von entscheidender Wichtigkeit sein kann? Sind nicht 318 Richard Raatzsch die Folgen der Unterscheidung bedeutsam, und nicht ihre Benennung. – Ja, und nein. Richtig ist, dass der Unterschied zwischen dem Äquator und, sagen wir, einem auf der Äquatoriallinie liegenden Stein in dem Sinne als Muster eines Unterschiedes zwischen den Seinsweisen der Dinge dienen kann, als wir viele verschiedene Dinge dadurch in eine übersichtliche Ordnung bringen können, dass wir sie entweder dem Äquator oder dem Stein zuordnen. Ist eine Spielkarte (eher) so etwas wie ein Stein oder wie der Äquator? – Wenn man mit dieser Frage überhaupt einen Sinn verbindet, dann, scheint es, wohl den Sinn, der als Antwort nahe legt: eher wie ein Stein. Jedenfalls drückt sich in dieser Antwort ein großer Teil unseres Umgangs mit Steinen, Spielkarten und dem Äquator aus. Steine nehmen wir, ebenso wie Spielkarten, in die Hand, wir betrachten sie, legen sie an einen anderen Ort, drehen sie um, wir werfen sie auf den Tisch u. v. a. m. Nichts davon findet sich in unserem Umgang mit dem Äquator. Dieser ähnelt dagegen unserem Umgang mit dem Massenmittelpunkt des Sonnensystems. Es kommt an dieser Stelle nicht darauf an, ob wir wirklich von unserem Umgang mit dem Äquator reden können. Denn wenn man bei dem Wort „Umgang“ immer an etwas wie unseren Umgang mit Steinen oder Spielkarten denkt, ist eben das Bemerkenswerte, dass es sowohl für den Äquator wie auch für den Massenmittelpunkt keinen Umgang gibt. Der Kontrast verschwindet nicht, er wird nur anders formuliert. Daher ist es aufschlussreich, dass sich nicht für alle Dinge sagen lässt, dass sie eher wie Steine resp. eher wie der Äquator sind. Das heißt, es gibt Dinge, die sich auf natürliche Weise weder dem einen noch dem andern Vorbild unterordnen bzw. die eine oder andere Reihe auf natürliche Weise fortsetzen. Gefühle etwa gehören hierher. Die Frage, ob ein Schmerz eher wie ein Stein oder eher wie der Äquator ist, hat vorderhand keinen klaren Sinn. Das spricht dafür, dass wir, um Jargon zu sprechen, neben dem Stein und dem Äquator für eine Musterkollektion des Seienden mindestens noch ein drittes Ding brauchen, sagen wir: Vorstellungen. – Ist ein Gefühl eher so etwas wie ein Stein, wie der Äquator oder wie eine Vorstellung? Wenn überhaupt etwas, dann ist es wohl so etwas wie eine Vorstellung. Und hier ist es nicht mehr weit zu der Idee eines Grundsatzes, den es zu beachten gelte. Aber jetzt wird es nicht nur zu einer ganz erstaunlichen Tatsache, dass es einer Untersuchung wie derjenigen Freges unter anderem deshalb bedarf, weil es so verschiedene Vorstellungen von den Grundlagen der Arithmetik gibt, sondern auch, weshalb man hoffen sollte, diesen Streit je entscheiden zu können. Wenn Frege sich in der Einleitung zu den Grundlagen das Ziel stellt, „jenen Wahn zu widerlegen, dass in bezug auf die positiven ganzen Zahlen eigentlich gar keine Schwierigkeiten obwalten, sondern allgemeine Über- Zum ersten Grundsatz in den Grundlagen der Arithmetik 319 einstimmung herrsche“26, muss man sich fragen, wieso dann die Mathematiker - nach Freges eigenen Worten – dahingehend übereinstimmen, dass sie Fragen wie die, was die Eins sei, schnellstmöglich hinter sich lassen wollen. Dort, wo es Übereinstimmung gibt, ist sie nicht erwünscht; dort, wo sie erwünscht ist, gibt es sie nicht. Es geht hier also um Übereinstimmung einer bestimmten Form oder in Bezug auf etwas Bestimmtes. Darum setzt Frege so grundsätzlich an, bei etwas, von dem man sagen möchte, das müsse ihm doch jeder zugeben, der die (deutsche) Sprache beherrscht. Wer würde nicht zugeben, dass Steine in einer Hinsicht Spielkarten ähnlicher sind als dem Äquator, aber diese drei sich leicht zu einer Gruppe zusammenschließen lassen, wenn man Empfindungen hinzuzieht? Nur, wenn der Ausgangspunkt allgemein geteilt wird, wie kommt es dann zu, zumindest scheinbar, gänzlich verschiedenen Begründungen der Arithmetik? Wenn es aber dazu kommt, wie kann dann noch man hoffen, den Streit jemals zu entscheiden? Worauf sonst könnte man sich denn noch stützen? 11. Frege jedenfalls benutzt seinen Verweis auf den Äquator, die Erdachse usw. einerseits und seelische Vorgänge andererseits, um einen Unterschied zwischen etwas Gedachtem und etwas Erdachtem plausibel zu machen: Man nennt den Äquator oft eine gedachte Linie; aber es wäre falsch, ihn eine erdachte Linie zu nennen: er ist nicht durch Denken entstanden, das Ergebnis eines seelischen Vorgangs, sondern nur durch Denken erkannt, ergriffen. Wäre das Erkanntwerden ein Entstehen, so könnten wir nichts Positives von ihm aussagen in bezug auf eine Zeit, die diesem vorgeblichen Entstehen vorherginge.27 Ja, man kann nicht über den Äquator stolpern, ihn nicht verstecken, nicht an eine andere Stelle legen, zerstören usw. Den Äquator sucht man nicht so, wie man etwa einen bestimmten Stein sucht. Das liegt nicht daran, dass der Äquator so gut versteckt wäre, wie ein Stein gut versteckt sein kann. Sondern die Aufforderung „Suche den Äquator; er sieht so aus“, begleitet von einem Bild, hat vorderhand keinen Sinn. Dass der Äquator eine gedachte Linie ist, bedeutet jedoch wiederum nicht, dass er etwas Psychologisches wäre in dem Sinne, in welchem man die Vorstellung einer Linie „etwas Psychologisches“ nennen könnte. Wie findet man den Äquator? – Zum Beispiel durch Anwendung allgemein akzeptierter Messverfahren. Nur, in dem Moment, in dem man _____________ 26 27 … weshalb er „einige Meinungen von Philosophen und Mathematikern über die hier in Betracht kommenden Fragen zu besprechen“ (Frege: Die Grundlagen der Arithmetik, a.a.O., S. 18) unternimmt. Frege betont, dass für „geradezu entgegengesetzte Aussprüche“ Gründe vorgebracht werden, „die sich nicht kurzerhand abweisen lassen.“ (Ebd.) Dass fast die Hälfte der Grundlagen von „Meinungen“ handelt, soll aber auch den Boden ebnen für die Anerkennung dessen, dass Freges eigene „Meinung nicht eine von vielen gleichberechtigten ist“ (ebd.). Frege: Die Grundlagen der Arithmetik, a.a.O., S. 57. Richard Raatzsch 320 diese hat, kann man auch irgendwo eine Linie ziehen, auf sie zeigen und (richtig oder falsch) sagen, das sei der Äquator. Wenn in Ekuador ein Strich auf den Boden gemalt ist und darunter steht „Äquator“, kann man nicht einfach entgegnen, das sei ein Fehler, da der Äquator nichts Handgreifliches sei. In einem (neuen) Sinn ist er es dann ja durchaus. Das heißt, wenn bekannt ist, wie mit etwas umgegangen wird, kann, je nachdem, was es ist, etwas hinweisend definiert werden, was, getrennt von dieser Verwendung, nicht sichtbar ist. Der Einwand, dass man den Äquator doch nicht hinweisend definieren kann, ist unvollständig. Er ist vollständig, und (un)berechtigt, wenn man „hinweisend definieren“ um bestimmte Vorbilder ergänzt. Da das Gleiche aber auch von dem gilt, verglichen mit dem es eher als nicht sichtbar erscheint, besteht der Kontrast an dieser Stelle darin, dass gleiche Elemente in verschiedenen Kontexten unterschiedliches Gewicht haben. Dass der Äquator nur eine gedachte, keine wirkliche Linie ist, bedeutet also nicht, dass dem Äquator eine gewisse fundamentale Eigenschaft – die, wirklich zu sein – nicht zukäme, weil ihm tatsächlich eine andere grundlegende Eigenschaft zukommt – die, gedacht zu sein. In diesem Sinne gibt es grundlegende Eigenschaften wirklich nicht. Die richtige Reaktion auf die These, der Objektivität der Nordsee tut es keinen Eintrag, dass es von unserer Willkür abhängt, welchen Teil der allgemeinen Wasserbedeckung der Erde wir abgrenzen und mit dem Namen ‘Nordsee’ belegen wollen28, besteht weder darin, dem zuzustimmen, noch, es zu bestreiten, sondern darin, zu fragen, wie es dann um die Sache steht, die wir mit dem Namen „allgemeine Wasserbedeckung der Erde“ belegen wollen, oder um die Sache, die am Ende der Kette derartiger Erklärungen steht, welche immer es sei. Denn soweit die Nordsee etwas Objektives ist, ist sie es, soweit es die allgemeine Wasserbedeckung der Erde ist. Sofern wir „Nordsee“ rein als Namen betrachten, könnte es auch der von etwas Subjektivem sein. In diesem Sinne hängt es durchaus von unserer Willkür ab, ob ein Name etwas Objektives oder etwas Subjektives benennt. Nur insoweit als die Benennung auf einen Teil der Wasseroberfläche der Erde beschränkt ist, benennt der Name „Nordsee“ etwas Objektives, vorausgesetzt, der Ausdruck „Teil der allgemeinen Wasserbedeckung der Erde“ benennt etwas Objektives. Ob Letzteres aber der Fall ist, hängt wiederum davon ab, in welcher Weise diese Benennung bestimmt ist. Wenn die Objektivität der Nordsee, im Unterschied zu unseren Benennungen, nicht von unserer Willkür abhängt, wir aber von der Nordsee nur im Zusammenhang mit unserer Benennungen Kenntnis haben, muss am Ende, scheint es, etwas stehen, bei dem es keine Möglichkeit einer anderen _____________ 28 Ebd., S. 57. Zum ersten Grundsatz in den Grundlagen der Arithmetik 321 Benennung mehr geben kann. Am Grunde muss etwas liegen, bei dem wir nicht mehr sagen können, wir hätten den Namen auch einer Sache anderer Art geben können. Dann aber kann es, wenn „Nordsee“ etwas Objektives benennt, gar nichts Subjektives geben. Denn die einzige Möglichkeit, auf die in diesem Fall gesichert ist, dass unsere Willkür beim Benennen in Bezug auf die Natur des Benannten irrelevant ist, besteht darin, dass, was immer wir mit einem Namen belegen wollen, es etwas Objektives ist. Da das Gleiche auch für alles Subjektive gilt, kann es, soweit beides einander ausschließt, entweder keines von beidem geben oder die Ausdrücke „es gibt Objektives“ und „es gibt Subjektives“ sind nur oberflächlich betrachtet von gleicher Art. Das erste Alternativglied bezeichnet keine wirkliche Möglichkeit. Es ist vielmehr Endzeile eines Argumentes, welches gerade voraussetzt, dass es beides gibt. Was die zweite Möglichkeit angeht, so liegt sie als Skizze eines ausgearbeiteten Arguments in klassischer Weise in Ludwig Wittgensteins Logischphilosophischer Abhandlung vor. In ihr ist von einem Unterschied zwischen Subjektivem und Objektivem keine Rede mehr. Dennoch gibt es einen Unterschied von gleicher logischer Multiplizität: den Unterschied zwischen dem Subjekt, als Grenze der Welt, und der Welt. Mit dieser Unterscheidung wird eine Reihe von Problemen umgangen, die mit dem Bild vom Subjektiven als dem Objektiven gegenüberstehend einhergehen. Aber es reicht nicht, zu sagen, dass „[a]lle Sätze unserer Umgangssprache … tatsächlich, so wie sie sind, logisch vollkommen geordnet (sind)“, was dann, da die wirkliche und die scheinbare logische Form der Sätze nicht übereinstimmen muss, bedeutet, dass sich dies nicht (in Sätzen der Umgangssprache – aber wie sollten wir auch andere einführen?) sagen lässt29. Denn soweit man dies sagt, betrachtet man die logische Ordnung als etwas den Sätzen der Umgangssprache selbst Vorgeordnetes, woran deren logische Geordnetheit zu messen wäre. Eher ist die natürliche Sprache selbst das Kriterium der logischen Ordnung – oder es gibt gar keines, weil Maß und Gemessenes zusammenfallen. Die Irreführung durch die Sprache beginnt nicht erst bei der Suche nach einer Lösung, sondern bereits bei der Formulierung der Probleme. Darum muss, wie es in den Philosophischen Untersuchungen heißt, „die Betrachtung … gedreht werden, aber um unser eigentliches Bedürfnis als Angelpunkt.“30. Dabei verweist die Reihe der Beispiele, an denen Wittgenstein diese Bewegung vorführt, nicht in dem Sinn auf etwas Allgemeines, der Frege bei seinem Streben, „über das ins Klare zu kommen, was man Zahl nennen will“, vorschwebte. Aber die neue methodische Bewegung nimmt auch nichts hinweg von Freges Verdienst, „jenen Wahn“ widerlegt zu haben, „dass in bezug auf _____________ 29 30 Wittgenstein: Logisch-philosophische Abhandlung. Tractatus logico-philosophicus. Kritische Edition, Frankfurt a. M. 1998, 5.5563, 4.0031, 6.53. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 108. Richard Raatzsch 322 die positiven ganzen Zahlen eigentlich gar keine Schwierigkeiten obwalten“. Im Gegenteil, erst diese neue Gedankenbewegung zeigt, wie fundamental Freges Untersuchung wirklich ist, wie viel man hinterfragen muss, also wie tief die Unklarheit reicht! Sie erst rückt Freges Verdienst ins richtige Licht! Aber dieses Licht geht eben nicht von Grundsätzen oder von einer Theorie aus, und auch nicht von ein bisschen Theorie.31 _____________ 31 Mein Dank gilt Raymond Geuss und Werner Wolff. C Religionsphilosophie Nach dem „Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee“ Holm Tetens Entweder will Gott die Übel in der Welt abschaffen und kann es nicht, dann ist er schwach; oder er kann es und will es nicht, dann ist er schlecht; oder er kann es nicht und will es nicht, dann ist er schwach und schlecht und in jedem Fall kein Gott; oder er kann es und will es, woher kommen dann die Übel? Und warum beseitigt er sie nicht? Selten hat ein Philosoph ein Problem so klar formuliert wie hier Epikur das Theodizee-Problem. Die Welt ist aus der Sicht der Menschen voller Übel. Wenn es einen gerechten, allwissenden, allmächtigen und allgütigen Gott gibt, wie kann er die Übel in der Welt zulassen? Wie immer in der Philosophie ist auch auf diese Frage viel Scharfsinn verwendet worden. Wie immer in der Philosophie haben die Philosophen auch diese Frage bis heute nicht einvernehmlich beantwortet. So spinnt sich die religionsphilosophische Debatte um die Theodizee immer weiter fort. Gerade einige analytisch orientierte Religionsphilosophen der Gegenwart übertrumphen sich wechselseitig mit immer noch raffinierteren Argumenten, warum die Eigenschaften Gottes nicht den Übeln in der Welt widersprechen. Ich will mich nicht diesen Argumenten widmen, kann ich doch nicht erkennen, wie sich die Prädikate Gottes mit der Tatsache der Übel in der Welt vereinbaren ließen. Wie scharfsinnig die Argumente gegen diese Unvereinbarkeitsthese auch immer daherkommen, am Ende scheinen mir alle philosophischen Versuche in der Theodizee misslungen zu sein. Diese Auskunft, von Kant zur Überschrift eines seiner brillantesten Aufsätze gewählt1, will ich hier nicht weiter begründen. Sie bildet vielmehr den Ausgangspunkt meiner nachfolgenden Überlegungen. Manch ein Philosoph ist geneigt, aus einer Endlosdebatte, als die sich die Theodizeeproblematik in der Philosophiegeschichte hinschleppt, die Konsequenz zu ziehen, es handele sich um ein Scheinproblem, von dem es sich zu verabschieden gelte. Aber hat derjenige, der glaubt, das Theodizee-Problem _____________ 1 Vgl. I. Kant: Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee, in: ders.: Werke. Herausgegeben von Wilhelm Weischedel, Frankfurt a. M. 1968, Band XI, S. 105-124. 326 Holm Tetens nicht mehr ernst nehmen zu können, einfach nur ein Problem weniger? Ist er vielleicht sogar nur ein Scheinproblem losgeworden und kann sich darüber so freuen, wie sich einst Carnap darüber freute, dass er die metaphysische Frage nach der Existenz der Außenwelt als Scheinproblem der Philosophie durchschaut zu haben glaubte, oder wie Gilbert Ryle darüber frohlockte, dass für ihn das cartesianische Rätsel der psycho-physischen Wechselwirkung in einem „Tröpfchen Sprachkritik“ (Wittgenstein) zu verdampfen schien? Wenn es doch nur so einfach wäre! Die Übel in der Welt sind wir nicht losgeworden. Sie plagen uns weiter. Sie sind allemal Stachel genug, um weiter über sie nachzudenken. Aber was bedeutet es, philosophisch über die Übel in der Welt nach dem Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee nachzudenken? Es bedeutet vor allem, dass das Theodizee-Problem nicht mehr den Rahmen für ein philosophisches Nachdenken über die Übel in der Welt abgibt, und das wirkt sich in vierfacher Weise aus. Anders als Hiob ist uns eine Instanz abhanden gekommen, bei der wir uns über die zum Himmel schreienden Ungeheuerlichkeiten dieser Welt beschweren könnten. Adressat für Klagen und Beschwerden über die Übel sind entweder wir selber oder sie verhallen im Leeren. Im begrifflichen Rahmen der Theodizee klagte man Gott nicht nur sein Leid. Man musste es ihm auch zutrauen, das Leid aufheben zu können. Damit aber konnte Gott tendenziell immer auch in die Pflicht und Verantwortung genommen werden. Gott als Verantwortlicher ist die zweite seiner Rollen, die in dem Gerichtsverfahren, genannt Theodizee, Gegenstand der Anklage ist. Auch diese Rolle eines transzendenten Verantwortlichen entfällt in der säkularisierten Moderne. Solange die Theodizee noch als aussichtsreich gelten konnte, winkte drittens die Möglichkeit, den Übeln, dem scheinbar Sinnlosen doch einen, wenn auch noch so verborgenen Sinn im Heilsplan Gottes zuschreiben zu können. Ohne den Kontext der Theodizee scheinen wir hingegen endgültig in unüberwindbare Erklärungsnöte zu geraten. Warum all diese Übel in der Welt? Leider verstärkt sich das Üble an den Übeln noch einmal, können wir sie uns nicht plausibel erklären. Man lese die Hiobsgeschichte einmal unter diesem Aspekt der Misslichkeiten einer solchen Erklärungsnot und den verschiedenen Versuchen von Hiob, seinen Freunden, Gott und dem Teufel, ihr abzuhelfen. Die Übel in der Welt im Kontext des Theodizee-Problems zu thematisieren, schloss viertens die Hoffnung ein, dass die Übel in der Welt trotz allem nicht das letzte Wort in der Sache sein mögen. Für diese Hoffnung stand der christliche Gott mit seinem Heilsplan und seiner Heilsgeschichte. Heißt es nun: Lass’ alle Hoffnung fahren dahin? Theodizee 327 Nach diesem vierfachen Verlust eines göttlichen Beschwerdeadressaten, eines göttlichen Verantwortlichen, einer göttlichen Erklärungsinstanz und eines göttlichen Hoffnungsträgers ist das Nachdenken über die Übel in der Welt nicht einfacher geworden. Das Scheitern einer Rechtfertigung Gottes angesichts der Übel in der Welt ist weit davon entfernt, nur ein Scheinproblem leichten Herzens verabschieden zu müssen. Was wir uns nach dem Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee mit Blick auf die Übel werden eingestehen müssen, dazu möchte ich hier einige grundsätzliche philosophische Überlegungen vortragen. 1. Die Übel und das Gute: ein Gemeinplatz Die Welt ist voller Übel. Ich werde es mir und dem Leser ersparen, diesen Satz weiter inhaltlich zu füllen und zu begründen. Begnügen werde ich mich mit dieser distanziert klingenden, lapidaren Feststellung. Nicht, dass es zu diesem Satz nicht viel zu sagen gäbe. Doch das Reden über die Übel in der Welt hält viele Fallen bereit, in die man nur allzu leicht hineintappt. Es ist durchaus schwer, angemessen über die Übel in der Welt zu reden, auch und gerade für einen Philosophen. Die Rede über die Übel in der Welt kann misslingen, weil sie wehleidig oder pathetisch oder auf Sensationen versessen oder zu zynisch oder zu ironisch oder zu kitschig ist. Bedarf der Satz „Die Welt ist voller Übel“ nicht trotzdem einer Begründung? Nun, wer ihn bestreitet, dem sei die Lektüre irgendeines Geschichtsbuches über einen beliebigen längeren Zeitabschnitt der bisherigen Menschheitsgeschichte empfohlen. Historiker, zumal gute Historiker legen es nicht darauf an, die Welt schlecht zu reden, sie wollen nur beschreiben, wie es „wirklich gewesen ist“ (Ranke). Dadurch werden sie zu unfreiwilligen und daher zu besonders zuverlässigen Chronisten des Schreckens in der Welt. Denn wer ein solches Geschichtswerk liest und sich nur mit minimaler Phantasie für einen Augenblick in die Lage derer versetzt, über deren Leben und Zusammenleben der Historiker berichtet, der wird schnell eines unfassbaren Ausmaßes an Sinnlosigkeiten, Leiden und Verbrechen ansichtig, die bis heute in der Geschichte der Menschen ihre ebenso breiten wie tiefen Furchen ziehen. Und von den Übeln im menschlichen Dasein, die nicht Eingang in die Darstellungen der Historiker finden, wissen die Schriftsteller und Dichter zu reden, und oftmals „unser kranker Nachbar auch“. Belassen wir es also bei dem schlichten Satz: Die Welt ist voller Übel. Ist dieser Satz nicht empörend einseitig, so einseitig, dass er geradezu falsch ist? Es gibt doch wohl nicht nur die Übel in der Welt. Genauso gibt es auch das Gute und Schöne. Und gibt es nicht das Gute und Schöne in mindestens ebenso überwältigender Fülle in der Welt wie die Übel? 328 Holm Tetens Wer sich über die Einseitigkeit des Satzes „Die Welt ist voller Übel“ empört, empört sich zu Recht. Aber unser Ausgangssatz über die Übel in der Welt leugnet natürlich nicht das Gute und Schöne in der Welt. Er lautete ja gar nicht: Die Welt ist ein einziges großes Übel; er lautete nur: Die Welt ist voller Übel. Man sollte es mit dem Satz „Die Welt ist voll des Guten und Schönen“ ebenso halten wie mit dem Satz „Die Welt ist voller Übel“. So wie wir in diesen Überlegungen nicht detailliert im Elend der Welt wühlen werden, genauso wenig werden wir das Gute und Schöne in der Welt ausschmücken. Auch das kann aus vielen Gründen so gründlich daneben gehen wie die Rede über die Übel in der Welt. Lassen wir es bei der schlichten Feststellung „Die Welt ist voll des Guten und Schönen“. Aber müssen wir die beiden Sätze nicht in einem Atemzug aussprechen, damit endlich ein wahrer Satz über die Welt herauskommt? Die Welt ist voller Übel, aber sie ist ebenso auch voll des Guten und Schönen. Das scheint ein wahres und gerechtes Urteil über die Welt zu sein. Es steht zu vermuten, dass die Leser dieses Aufsatzes erst jetzt zum ersten Mal einigermaßen zufrieden mit dem Gesagten sein dürften. Und zugleich vollkommen unzufrieden. Denn ist der Satz „Die Welt ist voller Übel, aber sie ist ebenso auch voll des Guten und Schönen“ nicht trivial, eine ungeheure Plattitüde? Was, so mag manch einer ungeduldig fragen, soll mit diesem Satz gewonnen sein? Was soll aus diesem Satz folgen? Philosophen sind nach David Lewis Experten für Gemeinplätze. Sie stellen Gemeinplätze in Frage. Das sei, so Lewis, ein gefährliches Unterfangen, bei dem eher die Philosophen als die Gemeinplätze ihr Ansehen verlören. Aber als Philosoph bin ich bereit mein Ansehen zu riskieren. Ich möchte den Satz „Die Welt ist voller Übel, aber sie ist auch voll des Guten und Schönen“ hinterfragen, denn dieser Satz ist so, wie er jetzt fahrlässig ungenau formuliert ist, falsch. Und sollte sich das als richtig erweisen, dann sind die Konsequenzen nicht trivial, vor allen Dingen für uns in der Moderne, die wir nach dem Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee leben. 2. Die antinomische Stellung des Menschen in der Welt Die Welt ist voller Übel, aber auch voll des Guten und Schönen. Der Satz ist die logische Konjunktion der zwei Sätze „Die Welt ist voller Übel“ und „Die Welt ist voll des Guten und Schönen“. Beiden Sätzen habe ich ausdrücklich zugestimmt. Wie kann ich daher die Konjunktion der beiden Sätze verwerfen? Das scheint logisch nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Scheitert die Kritik an unserem Gemeinplatz gleich zu Beginn, weil sie logisch widersprüchlich ist? Theodizee 329 Nun, mit Widersprüchen hat die Sache zu tun, ohne dass dabei die formale Logik aus den Angeln gehoben werden müsste. Von „Widersprüchen“ reden wir in erster Linie in Bezug auf Aussagen. Widersprüche zwischen Aussagen machen mindestens eine der beteiligten Aussagen falsch, selbst dann, wenn sich jede der Aussagen scheinbar beweisen lässt. In einem solchen Falle eines scheinbar beweisbaren Widerspruchs zwischen Aussagen reden die Logiker von einer Antinomie. Doch einige Philosophen scheuen sich nicht, den Antinomiebegriff von Aussagen auf das menschliche Leben zu übertragen. Zu ihnen zählen Sören Kierkegaard und Karl Jaspers. In seinem immer noch sehr lesenswerten und zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Buch „Psychologie der Weltanschauungen“2 und später noch einmal in seiner dreibändigen „Philosophie“ spricht Jaspers von der „antinomischen Struktur“ des menschlichen Daseins. Er tut dies im Zusammenhang mit einem weiteren Begriff, der ebenfalls in Jaspers „Psychologie der Weltanschauungen“ einen zentralen Platz einnimmt, den Begriff der Grenzsituationen. Jaspers schreibt: Situationen wie die, dass ich immer in Situationen bin, dass ich nicht ohne Kampf und Leid leben kann, dass ich unvermeidlich Schuld auf mich nehme, dass ich sterben muss, nenne ich Grenzsituationen. Sie wandeln sich nicht, sondern nur in ihrer Erscheinung; sie sind, auf unser Dasein bezogen, endgültig. Sie sind nicht überschaubar; in unserem Dasein sehen wir hinter ihnen nichts anderes mehr. Sie sind wie eine Wand, an die wir stoßen, an der wir scheitern. Sie sind durch uns nicht zu verändern, sondern nur zur Klarheit zu bringen, ohne sie aus einem Anderen erklären und ableiten zu können. Sie sind mit dem Dasein selbst.3 Wegen der Grenzsituationen hat das menschliche Dasein nach Jaspers eine „antinomische“ Struktur. Er beschreibt sie in den Worten: In jeder Grenzsituation wird mir gleichsam der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich kann das Sein als Dasein nicht greifen in bestehender Festigkeit. In der Welt ist keine Vollendung, wenn selbst die liebende Kommunikation als Kampf in Erscheinung treten muss. Welches Dasein auch immer als das eigentliche Sein sich geben möchte, es versinkt vor der das Absolute suchenden Frage. Die Fragwürdigkeit allen Daseins bedeutet die Unmöglichkeit, in ihm als solchem Ruhe zu finden. Die Weise, wie das Dasein überall in den Grenzsituationen als in sich brüchig erscheint, ist seine antinomische Struktur.4 Warum hat das Dasein eine antinomische Struktur, oder, wie ich im Folgenden lieber sagen möchte, inwiefern ist die Stellung des Menschen in der Welt antinomisch? Wir müssen in unserem Leben sowohl bestimmten Sachverhalten X, als auch bestimmten Sachverhalten X’ Rechnung tragen, aber Versu_____________ 2 3 4 Vgl. Karl Jaspers: Psychologie der Weltanschauungen. Berlin 1919. Karl Jaspers: Philosophie: Band II: Existenzerhellung, Berlin-Heidelberg-New York, S. 203. Ebd., S. 249. 330 Holm Tetens che, dies für die Sachverhalte X zu tun, kann immer wieder be- oder verhindern, den Sachverhalten X’ noch gerecht zu werden. Das Leben der Menschen vollzieht sich unter Bedingungen und in einer Weise, dass Lebensschritte in die eine Richtung unweigerlich uns früher oder später bei Strafe des Untergangs dazu zwingen, Schritte in die entgegengesetzte Richtung zu unternehmen, ohne dass dieser ständige Richtungswechsel je zum Stillstand gebracht werden könnte oder ohne dass sich je die richtige Mitte zwischen den begrifflichen Extremen ein für alle Mal finden ließe.5 Deshalb kann man die Stellung des Menschen in der Welt antinomisch oder auch aporetisch nennen. Wir wollen auch auf eine wohlvertraute Terminologie der Philosophie zurückgreifen: Schließt der angemessene Umgang mit dem Sachverhalt X erst einmal aus, auch den Sachverhalt X’ angemessen zu berücksichtigen, so wollen wir sagen, dass in unserem Leben die beiden Sachverhalte dialektisch aneinander gekoppelt oder gefesselt sind. Die antinomische Stellung des Menschen in der Welt tritt uns vor allem in Gegensatzpaaren entgegen. Solche existenziell bedeutsamen Gegensätze sind, unter vielen anderen, die folgenden: Möglichkeiten ausschließen oder offen halten, ein Bedürfnis befriedigen oder es frustrieren, Lust oder Unlust, mit anderen Personen im Konsens oder im Dissens leben, „Kampf oder liebende Kommunikation“ (Jaspers), Absichten verwirklichen oder Unbeabsichtigtes bewirken. Betrachten wir einige dieser Gegensatzpaare genauer, dann wird noch klarer, was mit der antinomischen Stellung des Menschen in der Welt gemeint ist. Möglichkeiten ausschließen/Möglichkeiten offen halten: Wer lebt, schließt immer Möglichkeiten aus, bestimmte sogar unwiederbringlich für sein weiteres Leben. Doch wie ließe sich im Ernst ohne einen Horizont von immer noch neuen und anderen Möglichkeiten leben? Wir drohen in zwei gegensätzliche Extreme abzustürzen. Man tanzt illusionärer Weise auf allen Hochzeiten und will sich niemals festlegen. Einen solchen Möglichkeitsillusionisten nennt Kierkegaard einen „Phantasten“. Nach Kierkegaard ist Verzweiflung, dass jemand nicht er selbst sein will. Der Phantast will verzweifelt nicht er selbst sein, er will sich nicht als jemanden akzeptieren, dem nicht (mehr) alles möglich ist. Doch ebenso droht auch das gegenteilige Extrem. Hält sich jemand für keine Möglichkeiten mehr bereit, begreift er sich nur noch als festgelegt und unveränderbar, ist er nach Kierkegaard zum starren, ja leblosen „Dogmatiker“ oder „Fatalisten“ geworden. Auch der Dogmatiker _____________ 5 Zur philosophischen Analyse der antinomischen Stellung des Menschen in der Welt vgl. auch Ursula Wolf: Die Philosophie und die Frage nach dem guten Leben, Reinbek bei Hamburg 1999, besonders Kapitel 4, S. 83-97. Theodizee 331 und Fatalist verfehlt sein Leben. Auch er will verzweifelt nicht er selbst sein, der immer noch Möglichkeiten hat, etwas aus sich und seinem Leben zu machen6. Konsens/Dissens mit anderen: Wir können gar nicht leben, ohne mit anderen zusammenzuarbeiten und uns mit anderen zu verständigen. Wir Menschen sind auf Gemeinschaft hin angelegte und angewiesene Lebewesen. Ständig muss der Mensch das Einverständnis mit anderen suchen und darf es trotzdem nicht ins Extrem treiben. Denn wer nur tut, denkt, will, was man tut, denkt, will, hört auf, eine unverwechselbare Person zu sein. Er wird zum gesichtslosen Rädchen in einer anonymen sozialen Maschinerie, ein totsicherer Weg, das eigene Leben schon vor seinem physischen Ende zu beenden. Im gegenteiligen Extrem isoliert sich jemand sozial von den anderen, legt es nur noch darauf an, sich von allen anderen abzugrenzen, ist sich scheinbar selbst genug. Wenn er am Ende niemanden mehr versteht und von niemandem mehr verstanden wird, ist er zum Idioten geworden, zum Einsamen, so die Bedeutung des griechischen Ursprungs unseres Wortes „Idiot“. Zwischen diesen Extremen muss jeder Mensch für sich die richtige Mischung zwischen Einverständnis mit anderen und Abgrenzung von anderen, zwischen Nähe und Distanz, zwischen Kooperation und Antagonismus, zwischen Konsens und Dissens mit anderen ausbalancieren, ein Kunststück, das alle artistischen Zirkusnummern dieser Welt weit in den Schatten stellt. Absichten verwirklichen/Unbeabsichtigtes herbeiführen: Menschen handeln typischerweise unter komplexen Bedingungen, die sich auf nichtlineare Weise verändern. Unter solchen Bedingungen aber hat menschliches Handeln immer unerwartete Nebeneffekte, wenn vielleicht auch nicht immer kurzfristig, dann auf jeden Fall mittel- und langfristig. Und viele dieser Nebeneffekte sind mit Sicherheit nicht nur unerwartet, sondern auch unerwünscht, ja können sogar den ursprünglichen Zielen der Handelnden völlig zuwiderlaufen. So kann die Naturwissenschaft erklären, was vielen Dialektikern schon immer an der Welt aufgefallen ist: In einer nicht-linear sich verändernden Welt ist immer damit zu rechnen, dass sich selbst die edelsten Absichten von Menschen am Ende in ihr Gegenteil verkehren und damit sich selbst zerstören können. Angesichts der Wetterkatastrophen, die ein Schmetterling mit seinem Flügelschlag auszulösen vermag, agiert selbst dieses winzige und harmlos wirkende Tier in der Welt wie ein Elefant im Porzellanladen. Wie sollte da dem alles andere als harmlosen Menschen eine solch unrühmliche Rolle in der Welt erspart bleiben! _____________ 6 Kierkegaards Analyse des Phantasten, der sich illusionär alle Möglichkeiten offen hält, und des Fatalisten, der nur noch Notwendigkeiten sieht, findet sich in: Sören Kierkegaard: Die Krankheit zum Tode. Übersetzt von Hans Rochol, Hamburg 2005, S. 33-40. 332 Holm Tetens Freilich, ich habe hier sofort die pessimistische Version der Dialektik zur Sprache gebracht. Viele Apologeten der Moderne erzählen hingegen mit Vorliebe die optimistische Variante der Dialektik. Die Logik gibt ihnen hierin erst einmal Recht. Wenn edelste Absichten sich zwar nicht notwendigerweise, aber doch häufig genug in ihr Gegenteil pervertieren, warum sollen sich moralisch unschöne oder gar unmoralische Absichten nicht in moralische Wirkungen verwandeln können? Diese frohe Botschaft vom dialektischen Umschlag üblen Handelns in Segnungen für die Gesellschaft verkündet jedes Lehrbuch der Ökonomie mit geradezu religiöser Inbrunst. Jeder denkt nur an sich und sucht seinen Vorteil, notfalls auch auf Kosten anderer, zu vermehren, aber, so die Verkündigung der Ökonomen, die segensreiche Einrichtung des Marktes sorgt dafür, dass am Ende die Wohlfahrt aller vermehrt wird. Den Alchemisten ist es nie gelungen, aus Dreck Gold zu machen. Dem Markt scheint es mühelos zu gelingen, Egoisten in Wohltäter zu verwandeln. Ich breche an dieser Stelle die Beispiele ab. Es dürfte wohl deutlich geworden sein, inwiefern die Stellung des Menschen in der Welt antinomisch ist. 3. Die Übel und das Gute: Ihre Dialektik Was haben die Betrachtungen zur antinomischen Stellung des Menschen in der Welt mit der angekündigten Kritik an dem Gemeinplatz „Die Welt ist voller Übel, aber auch voll des Guten und Schönen“ zu tun? Viele Leser haben sicher längst für sich im Stillen die Schlussfolgerung gezogen. Alles Wichtige im Leben der Menschen ist immer an einen Gegensatz dialektisch gebunden. Warum sollte der Gegensatz zwischen den Übeln und dem Guten und Schönen davon ausgenommen sein? Der Gemeinplatz „Die Welt ist voller Übel, aber auch voll des Guten und Schönen“ ist falsch, weil er die Übel und das Gute einfach so behandelt, als wären sie unabhängig voneinander. So fassen wir fast alle spontan den Gemeinplatz auf: Ja, es gibt die Übel in der Welt, aber zum Glück gibt es auch das Gute und Schöne, sie kompensieren die Übel in der Welt und schaffen den Ausgleich und die Entlastung, ohne die es uns gar nicht möglich wäre, in dieser Welt zu leben. So aufgefasst eignet sich unser Gemeinplatz daher vortrefflich, uns über die Übel in der Welt ebenso hinwegzutrösten wie uns zu beschwichtigen. Der Satz von der dialektischen Koppelung von Übeln und dem Guten und Schönen hat zwei Leserichtungen. Die erste Leserichtung bereitet uns wenig Probleme: Keine Übel ohne das Gute und Schöne in der Welt. Diese Leserichtung ist uns wohlvertraut, sie ist ungemein beliebt und erntet emphatischen Zuspruch. Das Gute, das besagt diese Leserichtung unseres Satzes unter anderem, kommt in der Welt nicht zuletzt als Kampf gegen die Übel vor, das Gute und Schöne ist oftmals nichts anderes als die Überwindung von Theodizee 333 Übeln in der Welt, die Übel rufen oft genug das Gute auf den Plan. Sicher, so ist es, und es wäre in der Tat schlimm, falls es nicht so wäre. Alle, außer hart gesottene Pessimisten, sind erleichtert, wenn sie die Leserichtung „Keine Übel ohne das Gute und Schöne in der Welt“ hören. Aber unser Satz hat nicht nur die Leserichtung: Keine Übel ohne das Gute und Schöne in der Welt. Die Leserichtung ist auch umzukehren. Diese Umkehrung wird sehr selten offen ausgesprochen, ist nicht beliebt, sondern stößt eher auf eisige Ablehnung: Es gibt nichts Gutes und Schönes in der Welt ohne die Übel. In unserer Welt bleiben das Gute und Schöne dialektisch an die Übel in der Welt gefesselt. Unser Gemeinplatz „Die Welt ist voller Übel, aber auch voll des Guten und Schönen“ entpuppt sich damit bestenfalls als die halbe Wahrheit. Er unterschlägt schlicht den prekären dialektischen Zusammenhang zwischen den Übeln und dem Guten und Schönen. An seine Stelle muss, so scheint mir, ein anderer Satz treten: Die Welt ist voller Übel, und das Gute und Schöne, das es auch in der Welt gibt, bleiben trotzdem untrennbar an die Übel in der Welt dialektisch gefesselt. Dieser Satz ist weit davon entfernt, ein billiger Gemeinplatz zu sein. Dieser Satz hat es in sich. Aber es hilft nichts, wer sich fragt, wie wir mit den Übeln in der Welt umgehen sollen, muss auf diesen Satz antworten, und nicht auf seichte Verharmlosungen wie „Ja, ja, die Welt ist voller Übel, aber zum Glück gibt es ebenso das Gute und Schöne in der Welt“. 4. Die wissenschaftlich-technische Zivilisation spielt Gott Ich möchte nun einige Konsequenzen andeuten, welche unser Satz „Die Welt ist voller Übel, und das Gute und Schöne, das es auch in der Welt gibt, bleiben untrennbar an die Übel in der Welt dialektisch gefesselt“ angesichts unseres vierfachen Verlustes eines göttlichen Beschwerdeadressaten, eines göttlichen Verantwortlichen, einer göttlichen Erklärungsinstanz und eines göttlichen Hoffnungsträgers hat. Oder kürzer gesagt: Ich will auf Konsequenzen unseres Satzes angesichts des Misslingens aller philosophischen Versuche in der Theodizee aufmerksam machen. Alle Konsequenzen haben damit zu tun, dass die Moderne oder besser: die wissenschaftlich-technische Zivilisation das fundamentale Glücksversprechen in die Welt gesetzt hat, eine immer bessere Welt sei machbar. Indem wir die Ergebnisse der Wissenschaften technisch anwenden und anschließend im Rahmen des Industriekapitalismus wirtschaftlich nutzen, ließen sich immer mehr Übel aus der Welt verbannen. Wenn man sich einmal die Sicht des Christentums zu Eigen macht, ist klar, wie dieses Kulturexperiment einer wissenschaftlich-technischen Welt- 334 Holm Tetens und Selbstbemächtigung des modernen Menschen zu beurteilen ist. Es ist die Todsünde der Hybris, es ist der Versuch des Menschen, sich an die Stelle Gottes zu setzen. Wenn sich die wissenschaftlich-technische Zivilisation anschickt, Gott zu spielen, muss sie freilich auch die vierfache Rolle Gottes in der TheodizeeDebatte als Beschwerdeadressat, Verantwortlicher, Erklärungsinstanz und Hoffnungsträger ausfüllen. Selbst wenn man nicht auf dem Boden des christlichen Glaubens steht, kann man sich fragen, ob die wissenschaftlichtechnische Zivilisation den vierfachen Verlust eines göttlichen Beschwerdeadressaten, eines göttlichen Verantwortlichen, einer göttlichen Erklärungsinstanz und eines göttlichen Hoffnungsträgers wettzumachen vermag, indem sie selber in diese vier Rollen schlüpft. Oder übernimmt sie sich dabei? Überfordert sie sich vielleicht gerade deshalb, weil sie dazu tendiert, die antinomische Stellung des Menschen in der Welt und die dialektische Koppelung des Guten und Schönen an die Übel zu ignorieren? 5. Über die Umwandlung physischer in moralische Übel Die moralischen Übel bringen Menschen in die Welt. Sie haben sie zu verantworten. Und es ist an den Menschen, sie wieder aus der Welt zu schaffen. Soweit das noch geht. Dass physische Übel in der Welt auftauchen, hat hingegen kein Mensch zu verantworten. So die saubere Definition der Philosophen auf dem Papier. Doch die Wirklichkeit der wissenschaftlich-technischen Zivilisation lässt diese Unterscheidung zwischen physischen und moralischen Übeln immer wieder Makulatur werden. Sobald man sich in die Position gebracht hat, etwas wissenschaftlich-technisch gegen physische Übel tun zu können, hat man sie in moralische Übel verwandelt. Sicher, gegenüber vielen der physischen Übel in der Welt bleiben wir Menschen machtlos. Vielleicht sollte man für sie den altehrwürdigen, aber in diesem Zusammenhang terminologisch hintersinnigen Ausdruck „metaphysische Übel“ neu beleben: Es sind die Übel, die nach der Physik kommen, sprich: die Übel, bei denen selbst Wissenschaft und Technik mit ihrem Latein am Ende sind. Freilich ist die Grenze fließend zwischen metaphysischen Übeln und dem Rest, bei dem wir uns nicht mit unserem Unvermögen und unserer Unzuständigkeit herausreden können. Was heute noch ein metaphysisches Übel ist, muss es morgen schon nicht mehr sein. Die wissenschaftlich-technische Zivilisation hat sich den Kampf gegen die Übel in der Welt auf ihre Fahnen geschrieben. Und mit ihren Erfolgen, die sie ohne Zweifel zu verbuchen hat, wächst der Erwartungsdruck, den Kampf gegen jedes Übel, wie aussichtslos er anfangs auch erscheinen mag, nie endgültig verloren zu geben. Man kann ja nie wissen, was wir in Zukunft wissen werden, wenn wir uns nur gehörig Theodizee 335 anstrengen. In ihrer Selbststilisierung ist es für die wissenschaftlich-technische Zivilisation daher moralische Ehrensache: Gegen jedes Übel in der Welt ist ohne Ansehen seiner Natur anzugehen, alles andere wäre eine moralische Bankrotterklärung. So kumulieren in der Moderne die moralischen Pflichten schneller als das Können. Dass sich mit der wissenschaftlich-technischen Zivilisation physische Übel beschleunigt in moralische verwandeln und sich damit die Anlässe zum moralischen Anklagen immer mehr ausweiten, entspricht aufs Genaueste den vor nichts Halt machenden Anklagen, die in den früheren Zeiten der Theodizee an Gott adressiert wurden. Die „Hypothese Gott“ glaubt die wissenschaftlich-technische Zivilisation erfolgreich losgeworden zu sein, den Drang ihrer Mitglieder, sich über die Übel in der Welt zu beschweren, und einen Verantwortlichen dingfest zu machen, der alles zum Besseren wenden kann, in früheren Zeiten der Theodizee für Menschen durchaus entlastend auf Gott abgelenkt, ist sie nicht losgeworden. Die unvorsichtigen Glücksversprechen der wissenschaftlich-technischen Zivilisation verkehren sich in ungezügelte Glücksansprüche, die sie nie wird einlösen können, gegen die sie sich aber auch nicht gut mehr zu wehren vermag. Daraus erwachsen der wissenschaftlich-technischen Zivilisation Legitimationsprobleme, die keineswegs harmloser sind als die Probleme, die in Zeiten der Theodizee die Existenz des christlichen Gottes in Zweifel zogen. 6. Über unsere Unfähigkeit, uns eine bessere Welt auch nur vorzustellen Immer haben sich Menschen eine perfekte, eine heile Welt gewünscht. Solche Erlösungswünsche sind mehr als nur verständlich. Doch was wünschen wir Menschen eigentlich, wenn wir uns eine perfekte Welt wünschen? Die Frage klingt merkwürdig. Eine perfekte Welt ist eine Welt ohne Übel. Was soll an dieser Vorstellung problematisch oder schwierig sein? Man nehme nur alle bekannten Übel in der Welt und denke sie sich weg, das ist dann die perfekte Welt. In der perfekten Welt gibt es keine Krankheiten, kein materielles Elend, keine Kriege, keine politischen Verbrechen, keine Naturkatastrophen, keine Umweltzerstörungen, keine soziale Isolation, keine nervtötende Arbeit, keine Meinungszensur, keine Langeweile…. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Natürlich, die perfekte Welt ist damit nur negativ beschrieben. Lässt sie sich auch positiv beschreiben? Ist sie nicht einfach die Welt, in der alles, was Menschen zu Recht schätzen, vorhanden ist? Jeder kennt Breughels Gemälde: Menschen liegen bequem unter schattigen Bäumen, von denen herab ihnen alle möglichen Leckerbissen wie reife Früchte in den Mund fallen. Das Ge- 336 Holm Tetens mälde trägt den Titel „Schlaraffenland“. Auch hat man schon gehört von dem Versprechen, dass sich die schönsten Jungfrauen liebreizend um die Märtyrer und Glaubenshelden dieser Welt kümmern werden. So soll es im Paradies zugehen. Andere Paradiesvorstellungen sind schicklicher: Glückselig bringen die Heiligen die Ewigkeit mit dem Anblick und der Lobpreisung Gottes zu. Man kann sich weitere Beispiele ersparen, denn schon bei diesen wenigen Beispielen weiß man nicht, ob man lachen, weinen, sich gruseln oder auch nur den Kopf schütteln soll. Wir scheinen offensichtlich nicht besonders begabt zu sein, uns die perfekte Welt positiv auszumalen. Alle Versuche, es doch zu tun, enden alsbald im Lächerlichen, Komischen, Halbseidenen, idyllisch Unwahren, Gruseligen oder einfach nur im Langweiligen. Wer bei sich auf ein gewisses Niveau achtet, belässt es dabei, die perfekte Welt bestenfalls negativ als eine Welt ohne Übel zu charakterisieren, wenn überhaupt. Sollten und müssen wir uns nicht sowieso damit bescheiden, uns statt der perfekten nur eine bessere Welt vorzustellen? Es lohnt sich, dem Misslingen von Vorstellungen einer perfekten oder auch nur einer besseren Welt ein wenig genauer nachzugehen. Am Anfang stehen scheinbare Trivialitäten. Wäre die Welt nicht deutlich besser, wenn es zumindest keine Krankheiten gäbe? Wäre die Welt nicht schon spürbar besser, gäbe es wenigstens keine Krankheiten wie Krebs, Aids oder Alzheimer? Solche Fragen suggerieren ihre emphatische Bejahung. Diesem uns schnell ermüdenden Frage- und Antwortspiel liegt immer dasselbe Muster eines trivial erscheinenden Arguments zugrunde: X ist ein Übel. Also wäre eine Welt ohne X eine bessere Welt. Krankheiten sind ein Übel. Also wäre eine Welt ohne Krankheiten eine bessere Welt. Dieses Schema ist zu einfach, um wahr zu sein. Es fehlt ein kleiner, aber entscheidender Zusatz. Vollständig muss das Schema heißen: X ist ein Übel. Eine Welt ohne X, in der ansonsten nichts schlechter geworden ist, ist besser als eine Welt mit X. Der kleine Zusatz entlarvt das Schema als ein bloßes Gedankenspiel. Wahr ist es nur so lange, wie wir uns die Übel in der Welt wegdenken. Sie wegzudenken ist freilich so, als ob wir sie einfach wegzauberten. In der Realität unserer empirischen Welt müssen wir jedoch die Übel immer erst mühsam wegarbeiten, so weit das überhaupt geht. Dabei greifen wir mehr oder weniger gravierend in den Lauf der Dinge ein. Die Welt ändert sich dadurch. Sie ändert sich aber nie nur zum Besseren. Immer haben unsere Handlungen unbeabsichtigte Nebenfolgen, auch solche, die für uns negativ sind. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum man die Stellung von uns Menschen in der Welt als antinomisch bezeichnen muss. Der Satz „Eine Welt ohne das Übel X, in der ansonsten nichts schlechter geworden ist, ist besser als eine Welt mit X“ ist trivialer Weise wahr. Nur redet er nicht über die Welt, in der wir tatsächlich leben. Von ihr handelt ein ganz anderer Satz: Die Welt, sobald in ihr das Übel X beseitigt worden ist, ist in dieser Hinsicht Theodizee 337 erst einmal besser, in anderen Hinsichten jedoch ist die Welt ohne das Übel X schlechter geworden. Dieser Satz blockiert im Allgemeinen einen Schluss von „X ist ein Übel“ auf den Satz „Also wäre die Welt ohne X besser“ als Fehlschluss. Trotzdem phantasieren wir uns ständig eine bessere Welt auf diese kurzschlüssige Weise zusammen. Es ist unerheblich, weil trivial, dass eine Welt ohne Krankheiten besser ist als eine Welt mit Krankheiten. Erheblich ist allein, dass der Versuch, Krankheiten in der realen Welt ein für alle Mal auszumerzen, mit Sicherheit früher oder später neue und möglicherweise sogar schlimmere Übel in die Welt hineinträgt, als wir durch die Beseitigung aller möglichen Krankheiten werden aufwiegen können. Wir in der wissenschaftlich-technischen Zivilisation sind vor allem fasziniert von den Fortschritten der Wissenschaft und Technik. Diese Zivilisation verfolgt das ehrgeizige Ziel, immer mehr Sachverhalte in der Welt wissenschaftlich und technisch beherrschen zu können. Aber die vollständig wissenschaftlich und technisch beherrschte Welt wäre der reinste Horror. Es bedarf noch nicht einmal viel Phantasie, um das einzusehen. Nun spricht nichts dafür, dass wir jemals alles in der Welt wissenschaftlich erklären und technisch beherrschen. Im Gegenteil, ein solches Endstadium der wissenschaftlichen Entwicklung lässt sich mit guten Gründen als unerreichbar ausschließen. Doch der wissenschaftlich-technische Fortschritt erzeugt nicht erst dann mehr Übel als er beseitigt, wenn wir schon fast alles wissenschaftlich und technisch in den Griff bekommen haben. Wäre es so, könnten wir Wissenschaft und Technik einfach fortschreiten lassen, bis sie sowieso irgendwann in ferner Zukunft auf „natürliche“ Grenzen stoßen werden. Doch längst bevor solche „natürlichen“ Grenzen erreicht werden, entfaltet die dialektische Koppelung von Übelbeseitigung und Übelerzeugung ihre prekäre Wirkung. Entscheidend ist an dieser Koppelung, dass wir in den allermeisten Fällen nicht genau oder gar nicht vorauszusehen und abzuschätzen vermögen, welche Übel man sich durch die Beseitigung eines anderen einkauft und ob das beseitigte Übel tatsächlich schwerer wiegt als die neu hinzukommenden. Ständig müssen wir uns fragen: Wie weit dürfen wir es treiben mit der Beseitigung bestimmter Übel, sodass das Ganze immer noch ein Weg zum Besseren bleibt? Ehrlicherweise müssen wir uns eingestehen: Wir wissen es in den allermeisten Fällen schlicht nicht oder jedenfalls nicht genau genug. 7. Das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee – ein Menetekel? Die Theodizee misslingt wegen des Widerspruchs zwischen den Gottesprädikaten und den Übeln, ein Widerspruch, der nicht mit noch so viel Scharfsinn ausgeräumt werden kann. Der Widerspruch spiegelt sich wider in den Span- 338 Holm Tetens nungen zwischen den vier Rollen, die Gott in der Theodizee-Debatte zugedacht werden. Diese Spannungen verschwinden nicht in dem Augenblick, wo die wissenschaftlich-technische Zivilisation in die vier Rollen schlüpft. Doch jetzt spiegelt sich in den Spannungen nicht mehr die Widersprüchlichkeit zwischen den Gottesprädikaten und den Übeln in der Welt, jetzt spiegelt sich darin die antinomische Stellung des Menschen in der Welt. Trotz dieses Unterschieds wiederholen sich strukturelle Aspekte der Theodizee-Debatte. Insofern ist das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee eine lehrreiche, wenn auch am Ende vermutlich eher bedrückende Analogie für uns, die Kinder der wissenschaftlich-technischen Zivilisation. Vermögen wir sie richtig zu deuten? Was ist spezifisch religiöse Transzendenz? Kritische Bemerkungen zu Hans Julius Schneider, Religion Thomas Rentsch Im folgenden will ich im Blick auf das Religions- und Transzendenzverständnis einige kritische Fragen an Hans Julius Schneider und sein Buch Religion1 richten. Ich habe das Buch mit großem Interesse und Gewinn gelesen. Da ich selbst in der Reihe Grundthemen Philosophie das Buch Gott2 vorgelegt habe, ergeben sich aber systematische Spannungen, die Anlass für Rückfragen sind und die sich eignen, einen konstruktiven und produktiven Dialog zu eröffnen, der uns in der Sache weiter bringen und zu Klärungen verhelfen könnte – in der guten Konstanzer Tradition. Im Interesse der Sache pointiere ich die kritischen Rückfragen. Ich bin mir bewusst, dass Hans Julius Schneider an vielen Stellen in seinem Text Anschlussmöglichkeiten eröffnet, um die Fragen in seinem Ansatz zu klären und zu beantworten. Welches sind meine zentralen Rückfragen? 1. Wird in Schneiders Ansatz der geschichtliche und kulturelle Entfaltungsund Verstehenskontext von Religionen und ihren Artikulationsformen nicht unterbestimmt? Insbesondere muss hier an die großen monotheistischen Buchreligionen: Judentum, Christentum, Islam gedacht werden, in denen die Sprache und die sprachliche Vermittlung und Gestaltung des Glaubens im Zentrum steht. Gerade, wenn man mit Wittgenstein denkt (wie Schneider und auch ich), muss die genuine und authentische sprachliche Form der Religion als eine (komplexe) Praxisform sui generis begriffen werden. Beten, Liturgie, Gesang, Rituale, Verkündigung, Verheißung, Vergebung, Zuspruch, Worte des Heils und der Gnade bilden als spezifische Praxis bereits einen wesentlichen Aspekt von Religion als Lebensform. Sie begleiten und prägen dem Anspruch nach gerade den Alltag der Glaubenden außerhalb der Synagoge, der Kirche, der Moschee. In diesen Sprachen – der Bibel, des Alten und Neu_____________ 1 2 Hans Julius Schneider: Religion, Berlin-New York 2008. Thomas Rentsch: Gott, Berlin-New York 2005. Thomas Rentsch 340 en Testaments, des Korans – sind die genuinen Wahrheits- und Geltungsansprüche des Glaubens enthalten und können immer wieder neu aktualisiert, belebt, interpretiert und lebenspraktisch ausgelegt werden, und so war und ist es geschichtlich auch. Gerade mit Wittgenstein müssen die innere Komplexität, der Reichtum und die semantische Irreduzibilität der religiösen Sprachen begriffen werden. In ihnen sind „Sprachspiel“ und „Lebensform“ aufs Engste verklammert. Diese Sprachspiele – z. B. die Predigten Jesu – eröffnen eine eigene Wirklichkeit, die man mit einem „internen Realismus“ rekonstruieren kann. Ihre „Referenz“ ist die authentische, glaubende Lebensform, in der sich im lebendigen Gebrauch die Bedeutung religiöser Grundbegriffe und Grundsätze bildet, zeigt und weiter vermittelt: die Bedeutung der Hoffnung, der Gnade, der Liebe, der Vergebung, der Ewigkeit – um einige zentrale Beispiele zu nennen. Die in Kirche und Gemeinde erworbene Sprachpraxis im christlichen Kontext ist unersetzlich, sie ist Ort der bewussten Artikulation der authentischen Transzendenzdimension. Sie verbindet die jetzt praktizierenden Christinnen und Christen mit der Praxis und den Wahrheits- und Geltungsansprüchen unbedingten Sinns, wie sie seit über zweitausend Jahren in vielen Ansprüchen und Ausgestaltungen weitergegeben wurden. Letztlich sind die jetzt Glaubenden über die Sprache und die genuin religiösen Praxisformen verbunden mit allen Generationen, die die religiösen Wahrheitsansprüche über die Jahrhunderte weitergegeben haben – bis hin zu den Religionsgründern. Recht verstanden ist die genuine religiöse Praxis der Buchreligionen insbesondere ein Ort der Freiheit, weil die Wahrheitsansprüche von jeder Generation und von jedem Einzelnen neu angeeignet werden müssen, sollen und dürfen. Nur so sind tiefgreifende innovative Transformationen begreifbar wie z. B. die philosophisch-rationale und rational-mystische Interpretation der jüdischen Tradition bei Spinoza, in der Aufklärung und im Kantianismus bei Hermann Cohen, die reformatorische Transformation des Christentums bei Luther, Calvin und Zwingli, aber auch bereits die philosophisch sehr weitreichende und produktive Reflexion der negativen Theologie bei Meister Eckhart und die Interpretation des Islam in der Mystik des Sufismus. Diese produktiven Aneignungsprozesse sind immer auch religionskritisch. Religionskritik ist ein zentrales movens und ein Kernbestand der Weltreligionen, die so auch immer wieder von sich aus Anknüpfungsmöglichkeiten für philosophische Vernunftreflexion eröffneten und weiterhin eröffnen. 2. Die Arbeitsdefinition von Religion3 scheint das bisher von mir Bemerkte einzuschließen. Aber das liegt nur daran, dass diese Definition sehr unspezifisch ist. Auch in Verbindung mit der von Schneider zentral akzentuierten „religiösen Erfahrung“ und mit dem ebenso zentralen Aspekt des „Wandels“ _____________ 3 Schneider: Religion, a.a.O., S. 13. Was ist spezifisch religiöse Transzendenz? 341 des Lebensverständnisses wird diese Unspezifiziertheit nicht überwunden. Auch, wenn ich in der Pubertät erwachsen und verantwortlich werde, ereignet sich mit mir und durch mich ein solcher Wandel, der zu einer „wahrhaftig(en) Einstellung zum Leben im Ganzen“ führen soll, und dies gerade mit zentralem Bezug auf „Geburt, Liebe, Sexualität, Schuld“ und – mit Blick auf das neu gewonnene, verantwortliche Erwachsensein – auch auf „Krankheit und Tod“. Pointiert gesagt: Die Arbeitsdefinition ist nicht im mindesten religionsspezifisch, sondern lässt sich völlig areligiös, säkular, atheistisch verstehen. So könnte ein sich sehr technisch-instrumentell verstehender Mediziner sich dieses Selbstverständnis als „wahrhaftige Einstellung zum Leben im Ganzen“ völlig problemlos zuschreiben. – Genau mit dieser aufgeklärtszientifischen Orientierung sieht und behandelt er sich selbst und seine Patienten – ohne jeglichen Religionsbezug. Ebenso könnte eine Psychiaterin oder Psychotherapeutin sich diese Einstellung problemlos aneignen – ohne jegliche Religiosität. Aber auch Künstler, Literaten oder Musikerinnen könnten diese wahrhaftige Einstellung durchaus sehr anspruchsvoll für sich reklamieren, gerade im Blick auf die von Schneider angesprochenen existentiellen Aspekte des Lebens. Sie könnten sie für sich wohlbegründet und reflektiert reklamieren, und dies ganz bewusst gerade ohne jeglichen Gottes-, Transzendenz- oder Religionsbezug. Und sehr viele Künstler tun ja genau dies in der säkularen Moderne und Postmoderne. Die Kunst und die ästhetische Erfahrung mit all ihrem Reichtum, ihrer Komplexität und Tiefe tritt an die Stelle der Religion und religiösen Praxis – ein in den westlichen Kulturen weit verbreiteter und fortschreitender Prozess seit (mindestens) weit über einem Jahrhundert. Diese Beispiele sollen zeigen, dass Schneiders Definition zu kurz greift und die spezifische Differenz von Religion nicht zu explizieren vermag. Ein technisch-pragmatisches, szientifisches Welt- und Selbstverhältnis ist nicht religiös. Anders, und religionskritisch formuliert: Wer seine Religiosität so versteht, der versteht sich und die religiöse Dimension falsch, z. B. durch ein technisches Gebetsverständnis oder ein magisches Wunderverständnis. Auch ein therapeutisches Verständnis verfehlt die religiöse Dimension. Die Wiederherstellung von Gesundheit und Wohlbefinden ist eine andere Ebene als diejenige, die den Kernbereich des Religiösen ausmacht. Sie bezieht sich auch noch auf das Ganze des Lebens, wenn Krankheit, Schuld, Leiden, Sterben und Tod es unabänderlich prägen. Ebenso ist ästhetische Transzendenz nicht religiöse Transzendenz. Sicher ist es z. B. heute so, dass viele Menschen zwar kein explizites Gottesverhältnis haben und leben (können), aber dennoch mit großer Authentizität und Intensität die geistliche Musik, die Messen und Kantaten z. B. Bachs hören. Sie sagen oft, dass sie hier eine Dimension ahnen und spüren, die über die Schönheit der Kompositionen hinausgeht – wenn sie diese Dimension auch nicht erreichen und begreifen können. Religi- 342 Thomas Rentsch öse Transzendenz, so sehr sie auch im Medium „symbolischer Prägnanzbildung“ (Ernst Cassirer) vermittelt wird, muss in ihrer spezifischen, genuinen existentiellen Dimension und mit ihren spezifischen, genuinen Wahrheitsund Geltungsansprüchen expliziert und begriffen werden. In der Religionsdefinition müsste ein Wahrheitsbezug berücksichtigt werden, ferner ein Bezug zur institutionalisierten, intersubjektiven Praxis, ein Bezug auch auf unhintergehbare, unbedingte praktisch-moralische Ansprüche und, ganz grundlegend, ein qualifizierter Transzendenzbezug. Ebenso müssten die religionskritischen Implikationen einer reflexiv geklärten Religion und einer authentischen Glaubensperspektive – gerichtet gegen Illusionen, entfremdete Projektionen, Aberglauben, magisches Denken und funktionalinstrumentelle Orientierungen – expliziert werden. Erst in einem solchen religiös aufgeklärten Kontext können religiöse Erfahrungen und Erlebnisse, die bei Schneider ein großes Gewicht haben, sinnvoll verortet werden. Die gelebten Formen von Transzendenzbezug sind außergewöhnlich reich, komplex und vielschichtig. Sie lassen sich, recht verstanden, nicht von einem einzigen, übergeordneten Standpunkt aus beurteilen und bewerten. Den Reichtum an sich eröffnenden Praxisformen gilt es zu begreifen, und damit auch die sich eröffnenden Freiheitsperspektiven religiöser Praxis. Sie zeigen sich im Blick auf die geschichtlich-kulturelle Entfaltung der Weltreligionen, die im übrigen andauert und in die Gegenwart und Zukunft weist – z. B. im Blick auf die Ökumene oder auch im Blick auf den christlich-islamischen Dialog. 3. Es bleibt bei Schneider unklar, in welchem Verhältnis die lokal-situativen Märchen (als Vergegenwärtigungs- und Bewältigungspraxis einer noch kindlich-ungeschiedenen Gefühlswelt) und lokal-situativen Schmerzempfindungen zu ganzheitlich-religiösen Erfahrungen stehen. Ein solcher Übergang ist in seiner Reichweite und Analogie meines Erachtens sehr begrenzt, wenn nicht sogar unmöglich und irreführend. Eine religionsphilosophische Weiterentwicklung von Bettelheims Märchenanalyse mit dem Terminus „Märchen aller Märchen“ bleibt ungenau, wiederum fehlt die spezifische Differenz: die Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament, die Geschichte Jesu im Neuen Testament, die Geschichte Mohammeds im Koran – diese Geschichten sind gerade keine Märchen, sondern – trotz archaisch-mythischer Elemente – sie beziehen sich im Kern auf geschichtliche Wirklichkeit, die zur höchst realen Gründung der Weltreligionen führt, und diese Gründung reicht wiederum höchst real und konkret bis in unsere Gegenwart – zu höchst realen und konkreten Lebens- und Praxisformen von Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. So ist zum Beispiel die Bergpredigt Jesu kein Märchen, sondern eine radikale Botschaft, die Verkündigung von Gnade, Vergebung und Feindesliebe mit unbedingtem praktischem Wahrheits- und Geltungsanspruch unter Einschluss des Wissens von der bzw. der Einsicht in die Unmöglichkeit, dieser Botschaft gänzlich zu entsprechen. Der transmoralische Status der Was ist spezifisch religiöse Transzendenz? 343 Botschaft wird sprachlich ebenso deutlich wie ihre Bezogenheit auf die existentielle Lebenswirklichkeit, die von Feindschaft, Hass und Demütigung geprägt ist. Die Situation der religiösen Sinnvermittlung und Sinnerfahrung ist in diesem zentralen Beispiel praktisch, begrifflich, existenzbezogen, sie besteht in unbedingten Wahrheits- und Geltungsansprüchen. 4. Auch in Wohlrapps Rezension4 bleibt die kritische Rückfrage nach der spezifischen Differenz des genuin Religiösen, nach dem Wesentlichen der Religion in Schneiders Ansatz. Gute, auch lebenstragende Erfahrungen gibt es auf vielen Ebenen der Lebenspraxis, in der Freundschaft, Partnerschaft, Familie, Liebe, in der Kunst, auf Reisen, in der Erinnerung an wertvolle Zeiten und Augenblicke. Aber all dies muss keinerlei religiöse Spezifik haben, all diese Erfahrungen können völlig profan, säkular verortet sein und gemacht werden. Deswegen bin ich der religionsphilosophischen Auffassung, dass im Kern und im Zentrum religiöser Orientierungen jeder Art ein spezifischer Transzendenzbezug sinnkonstitutiv ist. In seiner Wendung gegen James kritisiert Schneider einen religionsspezifischen Bezug zu „Transzendentem“ bzw. zu „Übernatürlichem“. Auch in meinen Rekonstruktionen kritisiere ich objektivistische, verdinglichende Transzendenzverständnisse. Ich versuche zu zeigen, dass eine Kritik an solchen verdinglichenden Verständnisse der Transzendenzdimension ein wesentlicher Aspekt der religionsspezifischen, religionsimmanenten Religionskritik selbst ist, sowohl im Bereich der religiösen Sprache und Verkündigung, als auch ganz explizit im Kontext der theologisch-begrifflichen Selbstreflexion der monotheistischen Weltreligionen (aber sicher auch in den asiatischen Traditionen). Im jüdischen Bereich steht im Zentrum das Bilderverbot, begleitet von einer oft radikalen Polemik gegen Formen des „Götzendienstes“. Im jüdischen, im christlichen und im islamischen Bereich bilden sich komplexe, anspruchsvolle, religionskritische Traditionen der negativen Theologie heraus (oft im Kontext der rationalen Mystik). Weite Teile der selbstbewussten religiösen Tradition, so lässt sich mit Blick auf Schneiders Ansatz sagen, bemühen sich um ein verdinglichungskritisches Verständnis von Transzendenz gerade in ihrer Nicht- bzw. Ungegenständlichkeit. Die von Wittgenstein übernommene Formulierung, bei den Wörtern für Seelisches gehe es nicht um ein Etwas, aber auch nicht um ein Nichts, die Schneider zu Recht auf religiöse Rede und insbesondere auf das Wort „Gott“ bezieht, artikuliert nur ganz knapp (und selbst schwer verständlich), was in den religiösen, kritisch-negativen Selbstreflexionen leitend ist: ein verdinglichungskritisches Transzendenzverständnis, das aber spezifisch religiöse kulturelle Praxisformen der meditativen, kontemplativen, sakramentalen, liturgischen, künstlerischen Vergegenwärtigung von Transzendenz gerade nicht _____________ 4 Harald Wohlrapp: Rezension zu Schneider, Religion, in: Philos. Rundschau 56 (2009), S. 65-70. Thomas Rentsch 344 ausschließt, sondern, recht verstanden, gerade freisetzt. Auf diese Weise eröffnet sich der hermeneutisch-kritische, rekonstruktive Zugang philosophischer Reflexion zu den kulturellen, sozialen, geschichtlich vielfältig ausgebildeten Praxis-, Sprach- und Lebensformen eigenen Rechts, die die Religionen auf der ganzen Welt in der Geschichte der Menschheit ausgebildet haben. Näherhin lässt sich das Spezifische authentischer religiöser Transzendenzbezüge aus philosophischer Perspektive meines Erachtens zunächst so näher explizieren und rekonstruieren, dass wir die Transzendenzdimensionen bzw. -aspekte der Welt (des Kosmos, des Seins überhaupt), der Sprache (des Logos, des Sinns von etwas überhaupt) und unserer selbst (die Transzendenz der Individualität, die intra- und interexistentielle Transzendenzdimension) formal-strukturell differenzieren.5 Diese Transzendenzdimensionen lassen sich vernünftig aufzeigen und aufweisen, ohne selbst auf religiöse Texte, religiöse Erfahrungen oder besondere Offenbarungsansprüche rekurrieren zu müssen. Dennoch sind sie der Hintergrund bzw. die Basis spezifisch religiöser Verhältnisse zur Welt, zum Sinn, zu sich selbst und zu den Mitmenschen. Religionsphilosophisch und vernunftbezogen können wir, anders gesagt, auf transrationale bzw. arationale Voraussetzungen unserer Welt- und Selbstverhältnisse und -verständnisse hinweisen. Dass es die Welt, dass es überhaupt etwas gibt, unter Einschluss unserer selbst, dass es Sprache, Sinnerfahrung, Wahrheits-, Geltungs- und Sinnansprüche überhaupt gibt, dass es uns als einzigartige Individuen gibt, die sich sich selbstbewusst erkennen, entfalten und in authentischen interpersonalen Verhältnisse der Freundschaft, der Partnerschaft, der gegenseitigen Hilfe und des Vertrauens leben können, – diese Dimensionen lassen sich als transrationale Transzendenzdimensionen verstehen, die keineswegs irrational sind und zu denen wir dennoch ein genuines Verhältnis explizit einnehmen können: ein Verhältnis des Staunens, des Wunderns, der Freude, des Glücks, der Dankbarkeit. Ein solches Verhältnis führte (und führt) zu genuinen religiösen Praxisformen. D. h.: Transzendenz kann und muss als eine Relation unsererseits zu den aufgezeigten Transzendenzdimensionen rekonstruiert und begriffen werden, eine Relation zu den uns entzogenen und unverfügbaren, dennoch unhintergehbaren und unverzichtbaren Sinnbedingungen unserer selbst und unseres Lebens. Ebenso, wie wir auf den Ebenen der Vernunft, des Verstandes und der sinnlichen Erfahrung Kriterien eines angemessenen, sinnvollen Umgangs mit diesen Ebenen herausarbeiten und von unangemessenen, unsinnigen, sinnlosen Formen des Umgangs unterscheiden können, so ist dies auch angesichts der transrationalen Transzendenzdimensionen möglich, nötig und erforderlich. So können wir zum Beispiel Formen von Aberglauben, Magie, Spiritismus, Fundamentalismus, Götzen-, Hexen- und Geisterglauben sinnkriterial ausgrenzen. Dem_____________ 5 Vgl. Rentsch: Gott, a. a. O., S. 48-78. Was ist spezifisch religiöse Transzendenz? 345 gegenüber ist es aus philosophischer Perspektive möglich, nötig und erforderlich, die Komplexität, Vielfalt und den Reichtum an genuinen und authentischen Ausdrucksformen hermeneutisch angemessen zu verstehen und zu interpretieren. An dieser Stelle der Rekonstruktion haben auch vernünftige Verständnisse der Rede von transrationalen Wundern, Geheimnissen und dem Heiligen ihren Ort. Es sei darauf hingewiesen, dass die aufgewiesenen Transzendenzdimensionen ebenso verkannt, übersehen, als banale Faktizität verstanden werden können, dass sie in der Perspektive von Resignation und Nihilismus, Zweifel und Verzweiflung wahrgenommen werden können. Gerade solche negativen Wahrnehmungen aber gehören zum Kern religiöser Tradition und Erfahrung. Ich erinnere mit Blick auf die Bibel nur an Hiob, an das Buch Kohelet und an Jesu’ Todesschrei der Gottverlassenheit am Kreuz. Das bedeutet: Auch ein naiv-hermeneutisches Lebensgefühl des Wohlbefindens, wie es uns viele populäre Glücksratgeber der Gegenwartsliteratur anbieten, erreicht keineswegs die ernsthafte Sinndimension und das authentische Lebensverständnis von Religionen. Gerade mit den aufgewiesenen Transzendenzdimensionen lassen sich Aspekte der Tiefe, der Unendlichkeit und der Ewigkeit verstehen, die im Zentrum von Religion stehen. Ebenso kann die Gleichursprünglichkeit der zentralen Transzendenzdimensionen des Seins der Welt, der Sprache und des Lebens zu einem Verständnis des Monotheismus verhelfen, das sowohl im wahrheitsorientierten Diskurs zwischen Philosophie und Religionen wie auch im ebenso wahrheitsbezogenen interreligiösen Diskurs erste Schritte zu einer gemeinsamen Verständigung ermöglicht.6 Ich fasse meine Rückfragen zusammen. 1. Wird in Schneiders existentiell orientierter Religionsphilosophie der geschichtliche und kulturelle Entfaltungs- und Verstehenskontext von Religionen unter Einschluss ihrer spezifischen Sprache und Praxis wie auch ihrer religionskritischen Potentiale nicht unterbestimmt? 2. Ist Schneiders Religionsverständnis nicht zu unspezifisch? Wie steht es mit dem Wahrheits-, dem Intersubjektivitäts- und Transzendenzbezug der Religionen? 3. Verfehlt die Analogie mit den Märchen nicht das Spezifische von Religion, und dies gerade im Blick auf unbedingte, praktische Geltungsansprüche? _____________ 6 Ebd., S. 78-94. 346 Thomas Rentsch 4. Religionen weisen einen spezifischen Transzendenzbezug auf, der von ihnen bewusst gestaltet, expliziert und reflektiert wird. Philosophie muss diesen Bezug wahrheitsorientiert aufnehmen und rekonstruieren. Wenn diese These stimmt, dann wird erst so die Ebene spezifisch religiöser Erfahrung philosophisch sinnkriterial zugänglich. Ich freue mich, mit Hans Julius Schneider über diese Rückfragen ins Gespräch zu kommen. Tradition und Reflexion Hans G. Ulrich Was Hans Schneider unter der Überschrift „Religion“ philosophisch luzid reflektiert, sind alltägliche Fragen und Gedanken – ob Religion eine höhere Art von Glückseligkeit zum Inhalt hat, ob Gott eine Person ist, wie Religion in Erfahrungen besteht, und viele Unter- und Teilfragen, die alltäglich sind in dem Sinne, daß sie vielfach dort tatsächlich begegnen, wo von Religion die Rede ist. Dort hält sich der Philosoph auf, der kundig in den ausgearbeiteten Diskursen und Denktraditionen der Philosophie und Religionsphilosophie die Fragen und Problemstellungen dort aufsucht, wo sie sich immer neu beharrlich gestellt haben und stellen, wie bei Gretchen und seiner Frage „Wie hältst Du’s mit der Religion“? Dennoch ist zu sehen, daß die alltäglich klingenden Fragen mit bestimmten „traditionellen“ philosophischen Auffassungen verbunden sind, mit denen sich diese philosophische Arbeit kritisch auseinandersetzt. William James erscheint als Beispiel dafür, wie eine „traditionelle“ Auffassung von religiöser Erfahrung1leitend bleibt, nämlich eine solche, die Erfahrung auf „etwas“ bezieht, das es außerhalb der Sprache „gibt“. Die Befangenheit in dieser traditionellen Auffassung wird, wie Hans Schneider anzeigt, durch einen „Befreiungsschlag“ aufgebrochen – durch den Befreiungsschlag Wittgensteins. Diese Problemdisposition gibt in vielerlei Hinsicht Anlaß, darüber nachzudenken, in welcher Weise unser Reden von Religion und unser Nachdenken darüber tatsächlich von einer traditionellen philosophische Auffassung von Sprache und Erkenntnis bestimmt ist, daß also die Befreiung von der traditionellen Auffassung weitgehend nicht stattgefunden hat. Jedenfalls wird dies schon einmal insofern gelten, als die Fragestellungen, die hier bearbeitet werden – wie die Frage, ob Religion ein höherer Glückszustand ist, oder, ob von Gott als Person zu reden ist – sich dort aufhalten, wo es erst noch zur Befreiung kommen muss. _____________ 1 Schneider: Religion, Berlin 2008, S. 50f. 348 Hans G. Ulrich Befreite Traditionen – Befreite Sichtweisen Wenn man weitgreifend, allgemein von den Traditionen christlichen Redens von Gott, die das biblische Reden in sich aufgenommen haben, spricht, die hier auch Gegenstand des philosophischen Nachdenkens werden, so stellt sich sofort die Frage, ob – generell gesagt – diese Traditionen selbst mehr oder weniger weitgehend von einer solchen traditionellen Auffassung bestimmt sind. Dieser Auffassung zufolge sind „Schöpfung“, „Sünde“, „Gott“ oder was immer „Gegenstände“, auf die sich die Rede bezieht. Die Frage ist, ob die Traditionen christlichen Redens damit in ihrer eigenen impliziten Disposition eine andere Auffassung in sich tragen, als die, die Wittgenstein befreiend in den Blick gerückt hat. Zu unterscheiden ist also, ob eine bestimmte Auffassung von diesen Traditionen der Befreiung bedarf – eben jene von Hans Schneider markierte – traditionelle Auffassung, oder ob diese Traditionen selbst der Befreiung aus einer ihnen eigenen Befangenheit bedürfen. Im letzteren Sinn hat man auch das Programm der „Entmythologisierung“ aufgefasst. Es sollte darum gehen, eine Tradition des Redens von Gott aus ihrer Befangenheit zu befreien, also ihrer Befangenheit im mythischen Reden. Doch das Programm der Entmythologisierung ist auch anders zu verstehen, nämlich als die Befreiung von einer Sicht, die die Traditionen einzig als mythologische wahrnimmt. Bultmanns Programm der Entmythologisierung jedenfalls verfolgt die letztere Aufgabe: es geht darum, die Texte nicht als mythische zu lesen, sondern auf das hin, was in ihnen (als Bestimmung und Beschreibung menschlicher Existenz) zu finden ist, weil eben dies in ihnen zur Sprache kommt und nicht etwas anderes, Mythisches. So betrifft die Entmythologisierung unsere Sicht auf die Texte. Diese Sicht muss entmythologisiert werden. Die historisch-kritische Methode in der biblischen Exegese richtet hier ihre Kritik auf die Sichtweisen der biblischen Überlieferung und sucht die der Überlieferung eigene Artikulation freizulegen. Das bedeutet, daß die zu befreiende Sicht auch in den Texten selbst zu finden ist. Doch diese sind nicht in toto und nicht primär Gegenstand der Kritik, sondern zugleich Anleitung dazu. Also noch einmal gefragt: worauf bezieht sich der Befreiungsschlag oder (weniger heftig) die sprachphilosophische Wende, die Wittgenstein herbeiführt? Bezieht die Befreiung sich auf die Sichtweise derer, die Religion so oder so verstehen, oder bezieht sie sich auf die Traditionen „religiöser“ Artikulation, die womöglich von einer ganz anderen Sichtweise bestimmt sind, als die vielfältig wechselnden Sichtweisen, auch die Sichtweisen einer Geistesgeschichte, die gewiß immer neu der Befreiung bedürfen, wenn wir denn danach suchen, was schließlich als angemessen für die Wahrnehmung und das Verstehen akzeptiert werden kann. Besondere Bedeutung bekommt diese Fragestellung hier dadurch, als die Veränderung von „Sichtweisen“, sofern sie das Tradition und Reflexion 349 Ganze des Lebens betreffen, - dem Verständnis des „Religiösen“ bei Hans Schneider entsprechend - den Zugang zur religiösen Erfahrung kennzeichnet. So sind wir nahe daran zu sagen, daß die Veränderung der Sichtweise durch die philosophische Wahrnehmung selbst ein religiöser Vorgang ist. Im Blick auf die theologische Aufgabe ist – von Paulus – gesagt worden: Lasst euch eure Lebensform verändern durch die Erneuerung eures Sinnes (tou/ noo,j), damit ihr erkunden könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. (Röm 12,2) Diese Veränderung der Sichtweise wird bei Paulus ins Passiv gesetzt: sie erscheint als Widerfahrnis, das impliziert, daß Menschen ihr Leben (als Ganzes) Gott überlassen und damit aufhören sich auf eine „Welt“ in ihren „Schemata“ zu beziehen, die ihr Leben nicht tragen können, die sozusagen „außen“ bleiben. „Und paßt euch nicht den Schemata dieser Welt an“. Dies aber wird gesagt aufgrund der Erfahrungen des Wirkens Gottes, also innerhalb dessen, was von Gott zu sagen ist: Deshalb sage ich euch erinnernd zum Trost, aufgrund der Erfahrungen des Gotteswirkens, paßt euch nicht den Schemata dieser Welt an. (Röm 12,1) Von der „Welt“ ist hier (im wörtlich genommenen Text) als von einer vergehenden Weltzeit (Äon) die Rede, eine Welt, die mit den Gotteserfahrungen obsolet wird. So wird hier von einer befreienden Verwandlung der Sichtweise gesprochen, die mit den Kennzeichen versehen ist, die Hans Schneider beschreibt. Wittgensteins Philosophie ist nicht zuletzt von Theologen als Befreiungsschlag gegenüber philosophischen und theologischen Auffassungen aufgenommen worden, als Befreiungsschlag, der die Traditionen christlichen Redens von Gott angemessen zu sehen hilft – das heißt befreit von Anschauungen, die diesem Reden nicht entsprechen und das Verstehen blockieren. Anders gesagt: die Tradition christlichen Reden von Gott läßt sich mit Wittgenstein so lesen, dass fragwürdige Problemstellungen und Lösungen wegfallen können. Die Befreiung von solchen Sichtweisen ist in der theologischen Arbeit vielfältig mitverfolgt worden. Das betrifft nicht nur die Arbeit am Verständnis von Sprache, sondern auch die theologische Arbeit daran, das christliche Reden von Gott, ausgehend von seiner biblischen Tradition, in einer Sichtweise nachzuvollziehen, die nicht von solchen „traditionellen“ Problemdispositionen belastet ist, wie sie sich in der Geistesgeschichte eingestellt haben. Die theologische Arbeit kann sich von dieser philosophischen in jeder Hinsicht bestärkt und gewiß auch in der einen oder anderen Hinsicht selbst befreit erfahren.2 Die Angemessenheit des Redens von Gott zu finden, wird jedenfalls dieser kritischen Arbeit bedürfen. Das heißt, daß die Traditionen christli_____________ 2 Siehe Hans Julius Schneider: Religion, Berlin-York 2008, S. 191, zur Aufgabe der Theologie. Hans G. Ulrich 350 chen Redens von Gott ihrerseits von Sichtweisen bestimmt sein können, die der kritischen Wahrnehmung bedürfen. Es heißt aber nicht (wie gesagt), daß nicht in diesen Traditionen Sichtweisen leitend sind, die dem entsprechen, was die Kritik sucht, also eine entsprechende Auffassung von Sprache. In der bisherigen theologischen Arbeit ist beides anzutreffen, eine kritikbedürftige Auffassung ebenso wie gegenläufige Auffassungen, und diese Differenzen werden innerhalb der Traditionen christlichen Redens selbst auch diskutiert. Beispielsweise haben die Streitgespräche, wie sie von Jesus überliefert sind oder die sich in den theologischen Reflexionen eines Paulus abbilden, immer wieder auch solche Differenzen zum Gegenstand. Das bestimmt die ganze Tradition des christlichen Redens von Gott, auch in seiner biblischen Gestalt. So beispielsweise in der Geschichte von einem blind Geborenen, den Jesus geheilt hat. Jesus wird gefragt: „Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er blind geboren ist?“ „Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm.“ Nachdem der Blinde von Jesus geheilt worden ist und nach einigem Hin und Her sagt schließlich Jesus: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, die nicht sehen, sehend werden, und die, die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde; weil ihr aber sagt: Wir sind sehend, bleibt eure Sünde. (Joh 9) „Blindheit“ und „Sehend-Werden“ werden zu Metaphern – um zu sagen, was es heißt, nicht Gott als Bewirker von Blindheit zu verstehen, der damit Sünde bestraft, sondern von Gott anders, also nicht blind, zu reden, nämlich nicht zu behaupten, man sei sehend in Bezug auf Gott, man wüßte, in welcher Logik Gott handelt. Die Geschichte zeigt, wie in den biblischen Texten die Rede von Gott zum Gegenstand wird, und zwar im Sinne angemessenen Redens, das im Horizont dessen verbleibt, was Menschen von Gott sagen können, von wo aus sie von Gott sprechen können. Dazu wird metaphorisches Reden gebraucht. Auch eine bestimmte Rede von einem allmächtigen Gott, auf deren Schwierigkeit Hans Schneider verweist, ist damit abgewiesen. Erfahrung als Kontext Philosophische Arbeit beginnt dort, wo jemand sagt „ich kenne mich nicht aus“. Ein Philosophisches Problem hat diese Form, wie Wittgenstein bemerkt.3 Hier braucht es Orientierung. Diese wird gewonnen durch Klärung. Es braucht Beschreibung, die in den Blick kommen läßt, was uns leiten kann, _____________ 3 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a. M., §123. Tradition und Reflexion 351 welche Unterscheidungen uns leiten können. Das ist durchweg eine Aufgabe der Kritik, die Sackgassen markiert, falsche Unterscheidungen auflöst und an ihrer Stelle andere zeigt, denen wir entlang gehen können. Klarheit zu gewinnen ist das Ziel, ihr dient die philosophische Kunst (ars), wie sie in dieser Tradition uns begegnet und einlädt, sich darauf einzulassen, wenn wir denn Klarheit suchen. Mit dieser Klarheit geht es nicht um eine solche Art von Aufklärung, die einen Standort außerhalb sucht, von dem aus beobachtet werden oder Licht auf die Realität geworfen werden kann, in der wir uns aufhalten. „Realität“, was real ist, wird in dieser Tradition – wie bei Hans Schneider – nicht auf diese Weise dingfest gemacht, sondern von innen her, von dort her ausgeleuchtet, wo wir uns befinden. So ist von „Erfahrung“ die Rede, nicht als etwas, was jemand als Besitz mit sich herumträgt, sondern als etwas, worin jemand sich aufhält, was ihn ausmacht, zu seinem „Sein“ gehört. Eine solche Unterscheidung zwischen Klärung und verschiedenen Formen der Aufklärung gehört mit vielen anderen zu den grundlegenden Klärungen, die hier nachzuvollziehen sind. Diese sind ihrerseits nicht als Wissensbestand festzuhalten, sondern dort zu bewähren, wo jene alltäglichen Fragen anstehen, sie sind in der eigenen Praxis des Reflektierens zu realisieren. Das heißt, sich in dieser Praxis des Klärens und Klarheit Suchens aufhalten. „Erfahrung“ ist das Medium, in dem sich auffinden lassen muss, was von „Gott“ zu sagen ist. Das ist in Übereinstimmung mit jenen biblischen Stimmen, die gleichermaßen an der Klärung des Redens von Gott arbeiten. So beschreibt der Prediger Salomo die Erfahrung, die einzig den Zusammenhang bildet, in dem „Gott“ zu verstehen ist. Es ist eine differenzierte Welt von Erfahrungen, in denen „Gott“ vorkommt. Es ist eine durch Erfahrung erschlossene Welt.4 Die Erfahrungen bilden den Verstehenszusammenhang, in den „Gott“ gehört, der Gott, der „die Ewigkeit“ den Menschen „ins Herz gelegt hat“ (Pred 3,11). Welche Erfahrung wird hier angezeigt? Die biblische Tradition der „Weisheit“5 hat eindrücklich vorgeführt, wie sich Menschen im Kontext von Erfahrungen zurechtfinden können und wie darin „Gott“ vorkommt, der „Gott“, der mit bestimmten Erfahrungen verbunden ist. Wer sich wie Hans Schneider (mit Wilhelm James) von der Erfahrung her dem Reden von Gott nähert, bewegt sich in dieser Tradition. Erfahrung wird immer neu in den Blick gerückt, als der einzige Ort, an dem von Gott zu sprechen ist. Gewiß bedarf es hier vieler weiterer Klärungen, aber der Einstieg bleibt so erst einmal deutlich abgegrenzt gegen alle Versuche, „Gott“ außerhalb menschlicher Erfahrung zu fassen. Auch Zarathustras Frage „Könntet ihr einen Gott denken?“ wäre erst einmal, vielleicht für immer, jedenfalls zurück_____________ 4 5 Das unterstreicht Friedrich Mildenberger: Biblische Dogmatik: eine biblische Theologie in dogmatischer Perspektive. Band 2: Ökonomie als Theologie, Stuttgart 1992, S. 86f. Gerhard von Rad: Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn 1970. Hans G. Ulrich 352 gestellt.6 Statt dessen gilt es den Erfahrungen nachzudenken, die im Reden von Gott artikuliert sind. Von Gott reden heißt von Gotteserfahrungen reden. Diese gehören zur Erfahrungswelt und können nicht als Erklärungen dienen, die hinter diese Erfahrungswelt zu blicken versprechen. Mit „Gott“ kann nicht etwa der Ursprung bestimmter Erfahrungen erklärt werden, statt dessen sind die GottesErfahrungen als das Reale zu nehmen, das in der Sprache präsent ist und das es zu verstehen gilt. Das stimmt mit jener theologischen Tradition überein, die die Aufgabe der Theologie darin gesehen hat, der Rede von Gott verstehend (und denkend) nachzugehen, und nicht etwa „Gott“ hinter dieser Rede zu suchen. Entscheidend ist dabei, daß in dieser Rede enthalten ist, daß Gott selbst geredet hat Dies ist eine Erfahrung, die zentral bleibt. Diese Gottesrede erscheint als Gottes Wort, das Menschen „geschenkt“7 worden ist. Gotteserfahrungen werden als vielfältige Erfahrungen von einem redenden Gott ausgesagt, als Erfahrungen des Hörens. Diese Realität zeigt sich im Leben derer, die von Gott reden. Sie ist an dieser Frucht, dem Hören, abzulesen. Es geht um den „Gott“, wie in der theologischen Tradition gesagt worden ist, der „die Herzen regiert“. Wie von dieser Erfahrung zu reden ist, ist eine Frage des „Ausdrucksmittel“. Dazu gehört, wie Hans Schneider bemerkt, auch die „Tradition“ in ihrer Differenzierung. Deshalb läßt sich über den realen oder illusionären Charakter auch einer religiösen Erfahrung nicht allein durch einen ,Blick nach innen’ entscheiden. Er wird sich vielmehr an der Lebensgeschichte des Betroffenen zeigen. Diese Entscheidung geschieht in einem sozialen Handlungszusammenhang, deren Teilnehmer über die entsprechenden sprachlichen Mittel verfügen. Solche Ausdrucksmittel wurden normalerweise über lange Zeiträume historisch entwickelt, und sie sind entsprechend differenziert. Es können aber auch neue Ausdrucksweisen spontan gefunden werden, die dann aus der Perspektive einer etablierten Tradition vielleicht unbeholfen oder auch erfrischend wirken.8 Neue Erfahrung und das eine Medium der Sprache Heißt dies, daß die Erfahrungen, die mit „Gott“ verbunden sind, anderen, zumal „religiösen“ Erfahrungen gleichzustellen sind? Sie sind einander gleich, gewiß, sofern es menschliche Erfahrungen sind und dementsprechend zur Sprache kommen. Aber sind es nicht dennoch „andere“ Erfahrungen, eben Erfah_____________ 6 7 8 Zur Frage nach der „Denkbarkeit Gottes“, siehe: Eberhard Jüngel: Gott als Geheimnis der Welt zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen 1977, S. 138-306. Hans J. Schneider: Religion, a.a.O., S. 181. Ebd., S. 186. Tradition und Reflexion 353 rungen „Gottes“, der zwar als „Person“ zur Sprache gebracht wird, aber doch „Gott“ und nicht Mensch ist, von dem wie von einer Person zu reden ist? Treten die Erfahrungen mit diesem Gott anderen Erfahrungen, auch Erfahrungen mit Menschen, gegenüber? Und: ist in diesem Sinne von „Widerfahrnis“ zu reden, von Erfahrungen gegen Erfahrungen? Geht es damit also um „neue Ausdrucksweisen“ von Erfahrungen, die vielleicht generell „religiös“ zu nennen sind und hier als Gotteserfahrungen artikuliert werden, oder geht es – in welchem Sinne – um neue Erfahrungen? Oder ist eben diese Unterscheidung einer traditionellen Sichtweise verhaftet, die nicht von einem einzigen Medium ausgeht – eben dem einen und einzigen Medium sprachlich artikulierter Erfahrungen, so verschieden dann innerhalb des Mediums diese Erfahrungen auch sind? Hier hat theologisches Nachdenken immer neu eingesetzt, nicht um die Anschauung von dem einen Medium Sprache zu bezweifeln, sondern um die Folgerungen für das Reden von Gott daraus zu ziehen. Dies geschieht auch nicht wegen der Abgrenzung dagegen, „Gott“ nicht aus den Erfahrungen abzuleiten, weil so ja verloren ginge, was Menschen zukommt, was ihnen „geschenkt“ wird. Vielmehr ist die Nötigung zu solchem Nachdenken damit gegeben, daß bestimmte Erfahrungen deshalb mit „Gott“ verbunden erscheinen, weil sie anders nicht artikuliert und somit anders auch nicht verstanden werden können. Von „Gott“ ist dann nicht deshalb die Rede, weil keine andere Zuordnung einer Erfahrung in die Erfahrungswelt möglich ist, wie es etwa die These von der Religion als Kontingenzbewältigung festhält, sondern von „Gott“ ist die Rede, weil die Erfahrung, um die es geht, genuin mit „Gott“ verbunden ist. Die Verbindung mit „Gott“ kommt dann nicht hinzu, damit auch diese Erfahrung irgendwo ihren Ort findet, vielleicht einen besonderen Ort. Das Neue als das Kontingente mag auf diese Weise seinen Ort finden, aber der Rede von „Gott“ ist dies nicht angemessen. Gotteserfahrung wird in ihrem Neusein und Anderssein anders präsent, nicht als ein Kontingentes, das eingeordnet werden muss. Es braucht Mittel, dieses Präsentwerden in der Sprache kenntlich zu werden, ohne sie zu verlassen. Hier kommt die Beschreibung der Sprache hilfreich, befreiend zur Geltung, die diesen Vorgang in der Sprache – im Sinne Wittgensteins - kenntlich macht: Ein Symbolsystem aus der Welt der Geister, das konventionell bereits so festgelegt wäre, dass wir mit seiner Hilfe das aus unserer bisherigen Erfahrung Undenkbare und Unsagbare einfach notieren könnten, haben wir nicht zur Verfügung. Wir sind darauf angewiesen, mach menschlichen Ausdrücken (zu) greifen, d.h. das Neue und Überraschende un- Hans G. Ulrich 354 ter dem Bilde des Bekannten zu sehen, also mit Analogien und Metaphern zu arbeiten, was ja im Bereich der natürlichen Sprache alles andere als ungewöhnlich ist. 9 Diese Auffassung ist in der Theologie an der Frage diskutiert worden, wie es möglich ist von Gott in der Sprache der Menschen zu reden. Leitend war die Einsicht, daß anders als in der menschlichen Sprache von Gott nicht zu reden ist10, daß aber zugleich in dieser Sprache Mittel gegeben sind, von Gott in eigener Weise zu reden, die Gottes-Erfahrungen und andere Erfahrungen in ihrem Unterschiedensein kenntlich sein läßt. Daraufhin ist das analogische Reden11, das Reden in Metaphern oder das Reden in Gleichnissen betrachtet worden, wie es denn ohnehin – was Hans Schneider hervorhebt – zur Sprache gehört und wie es aus dem biblischen Reden bekannt ist. Entscheidend ist dabei die Frage, wie mit diesen sprachlichen Mitteln „das Neue und Überraschende“ zur Sprache kommen zu lassen. Die Rede von Gott wird so pointiert mit der Rede von einem bestimmten Neuen, einer bestimmten neuen Erfahrung verbunden. Das ist aus der biblischen Tradition vertraut. Dort ist vielfach von einem Neuen die Rede, wenn von Gott die Rede ist. Die Differenz einer Gotteserfahrung zu anderen Erfahrungen wird als die Differenz von neu und alt artikuliert, freilich so, daß diese – immer noch – gleichzeitig da sind, innerhalb der einen menschlichen Sprache. In der einen menschlichen Sprache wird also gleichwohl von einer Differenz gesprochen, einer Differenz von „alt“ und „neu“, oder von einer „Weltzeit“ die obsolet wird, und einer „neuen“ Sicht (Röm 12,1-2), die genuin mit „Gott“ verbunden ist. Ein neues Lied Damit kommt zugleich in den Blick, daß dazu ein neues Reden gehört: „Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unsern Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen.“ (Psalm 40,4). Wie hier im Psalm ist das Neue ein sprachlich zu fassendes Neues, ein neues Lied, aber doch ein Lied, das wie die alten Lieder zu singen ist. Das Neue ist nicht so anders, daß es nicht in ein Lied zu fassen wäre, freilich wird es ein neues Lied, und das gibt die Sprache her, wenn man – wie Hans Schneider unterstreicht – analogisches Reden, Metaphern und Gleichnisse einbezieht. Diese Redeweisen sind geeignet, Neues zur Sprache zu bringen, durch sie _____________ 9 10 11 Hans J. Schneider: Das Unmögliche, das Undenkbare, das Unsagbar: Schritte zum Wunderbaren?, in: Dalferth / Stoellger / Hunziker (eds.): Unmöglichkeiten. Zur Phänomenologie und Hermeneutik eines modalen Grenzbegriffs, Tübingen 2009, S. 215-232, S. 232. Ein Schlüsseltext ist: Karl Barth: Das Wort Gottes und die Theologie, München 1925. Siehe dazu insbesondere Eberhard Jüngel: Gott als Geheimnis der Welt, a.a.O., S. 357383. Tradition und Reflexion 355 wird Neues sprachlich artikulierbar. Oder auch umgekehrt: an solchen Redeweisen wird kenntlich, daß von einem Neuen die Rede ist. So wenn beispielsweise im biblischen Reden von Gott gesagt wird, „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ (Psalm 23) Oder: „Gott Deine Güte reicht so weit der Himmel ist“ (Psalm 36,6). Von Menschen würde man dies nicht sagen. Von einem Neuen ist zu reden in der Unterscheidung vom „Bekannten“. In der Sprache aber muss das Bekannte zur Artikulation des Neuen dienen. Auch wenn Gotteserfahrung als neue Erfahrung erscheint, ist dies nichts Ungewöhnliches für die Sprache. Oder doch? Sinnvoll zu fragen wäre dies (in unserem bisherigen Kontext), wenn dieses Neue als ein anderes Neues selbst als Erfahrung artikuliert werden könnte: als eine eigene Erfahrung des Neuen, für die die Sprache aber doch keinen eigenen modus loquendi bereithält, sondern nur die bekannten Formen, wie die des analogischen Redens oder des Gleichnisses. In diesen Formen erscheint das Reden von Gott auch in den biblischen Texten. Oder gibt es doch einen eigenen modus loquendi – einen, der dann aber gleichwohl nicht aus der Sprache herausführt? Gewiß, wir haben für diese Fragestellung, eine Differenz, ein anderes Neues unterstellt, wenn von „Gott“ die Rede ist, in dem Sinne, daß eine „Erfahrung mit Gott“ von einer Erfahrung mit Menschen unterschieden ist, auch wenn von ihr in der Weise gesprochen wird wie von einer Erfahrung mit Menschen, also von Gott als Person, gleichnishaft, analogisch, oder wie immer diese sprachlichen Spielräume aussehen. Wie aber zeigen sich die Erfahrungen mit Gott und mit Menschen dann als verschieden? Was macht die Nötigung aus, von einem Gleichnis, einer Analogie zu sprechen – und nicht, wenn gesagt wird, „Gottes Auge wacht über dich“, mit der Frage nach Gottes Augenbrauen fortzusetzen, oder wenn gesagt wird „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“, mit einer Betrachtung darüber fortzusetzen, ob Gott Weideland hat? Der Psalm setzt fort: „Dein Stecken und Stab trösten mich“. Doch in jeder Hinsicht muss nicht fortgesetzt werden, die Differenz bleibt im Gleichnis bewahrt. Worin aber besteht diese Differenz? Wo setzt das Gleichnis, wo setzt das neue Lied ein? Ist die Differenz mit dem Unterscheiden von „religiösen“ von „nichtreligiösen“ Erfahrungen zu fassen? Auch wenn von Hans Schneider näher erläutert wird, daß „religiöse“ Erfahrungen solche sind, die das Ganze des menschlichen Lebens betreffen, so ist damit die Frage, inwiefern es bei den Gotteserfahrungen eben um solche geht, die notwendig mit „Gott“ verbunden sind, noch nicht beantwortet. Die Frage ist nicht nur, ob es möglich und mit anderem religiösen Reden „verträglich“ ist, von Gott in bestimmter Weise zu reden, z.B. von Gott als Person. Markiert nicht die Unterscheidung von „Gott“ und „Mensch“, daß die Rede von „Gott“ dort einsetzt, wo das mit ihm notwendig verbundene Neue erscheint – ein neues Lied nicht unter anderen vielen neuen Liedern, sondern ein anderes neues Lied. Hans G. Ulrich 356 Die Nötigung, im Zusammenhang bestimmter Erfahrungen von „Gott“ zu reden, kommt hier in den Blick. Da hilft gewiß, die philosophisch vermittelte Einsicht, daß das Reden von Gott als Person möglich, das heißt verständlich ist. Es hilft auch die Einsicht, daß das Vermeiden der Rede von Gott als Person, wie Hans Schneider bemerkt, kein „engeres Verhältnis zur religiösen Erfahrung“ dokumentiert „als der Ausdruck ‚Gott’“12. So würde aber auch die Kennzeichnung religiöser Erfahrung als auf das „Ganze des menschlichen Lebens“ bezogen nicht schon der Gottes-Erfahrung in ihrer Artikulation näher kommen, wenn denn dieses Kennzeichen überhaupt entscheidend ist. Wir bleiben also noch dabei zu fragen, was uns nötigt von „Gott“ zu reden, wo diese Rede genuin einsetzt und gehen damit über die Frage hinaus, wie verträglich das uns vertraute Reden von Gott als Person damit ist, daß wir in menschlicher Sprache von Gott reden. Diese Frage, wie die anderen von Hans Schneidere behandelten, sollten ja ohnehin als Zugangsfragen verstanden werden. Wie können wir von hier aus weitergehen? Begründete Hoffnung – Erfahrung einer neuen Hoffnung Der Einfall oder Einbruch eines Neuen, das genuin mit „Gott“ verbunden ist, das nicht mit Praktiken der (sprachlichen) Kontingenzbearbeitung zu fassen ist, hat immer wieder das theologische Nachdenken beschäftigt. Dies geschah aus einem bestimmten Grund: nicht um grundsätzlich, jenseits von Erfahrung, Gottes Einzigartigkeit gegenüber allen anderen Erfahrungen zu bewahren – keine solche Apologetik – , sondern um der nachvollziehbaren Präsenz der Erfahrung willen, die unverwechselbar mit „Gott“ geschenkt wird. Hier ist in den Traditionen christlichen Redens vom Glauben die Rede, und zwar vom Gottes-Glauben, also nicht allgemein von Glauben, sondern von dem Glauben, der einzig mit Gott verbunden ist. Im christlichen Reden ist dies ein Glaube, der von Gott selbst geschenkt wird, also nicht vom Menschen aufgebracht wird. Von diesem Glauben ist damit – im Unterschied zu anderen Glaubensweisen – gesagt worden, daß er seinen Grund nicht vor sich her trägt (ein Glaube „an“), daß er nicht auf „etwas“ verweisen kann, auf das er sich stützt, der aber deshalb nicht ohne Realität ist. Beschreibungen des Glaubens haben dies freilich oft mißverstanden. _____________ 12 Hans J. Schneider: Religion, a.a.O., S. 183. Tradition und Reflexion 357 Was Glauben heißt, ist durch die Beschreibung der Erfahrung einer „begründeten Hoffnung“ genauer gesagt worden.13 „Begründete Hoffung“ kennzeichnet die Gotteserfahrung, die das christliche Reden zur Sprache bringt. Gemeint ist eine Hoffnung, die den Grund, in dem sie verwurzelt ist und aus dem heraus sie spricht, nicht vorzeigen kann. Es ist die Erfahrung einer Hoffnung, die sich nicht auf irgend etwas stützt, das sie aufweisen kann, sondern die von dem getragen ist, was mit ihr als ein Neues erscheint und artikuliert wird. „Gott“ wird als Grund dieser Hoffnung genannt und damit wird die Erfahrung eines „Neuen“ mit Gott verbunden. So ist in der biblischen Tradition von der Hoffnung die Rede.14 Bekanntes, das, was wir „Hoffnung“ nennen, wird gebraucht, um von dieser bestimmten Hoffnung zu sprechen, die ihren Grund nicht irgendwo in der Welt und ihren Erfahrungen hat, sondern als „begründete Hoffnung“ zur Sprache kommt, indem sie nicht auf einen „Grund“ verweist, auch nicht auf eine „innere Überzeugung“ oder einen Seelenzustand. Es ist die Hoffnung, die davon getragen ist, daß sie „bestätigt“, bezeugt und gelebt wird. So wird von Abraham erzählt: „Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war.“ Eine neue Weise der Hoffnung – eine „Hoffnung wider die Hoffnung“. Das Analogische dieser Hoffnung – eine Hoffnung unter anderen – läßt diese Hoffnung eingefügt sein in bekannte Hoffnungserfahrungen. Doch davon gewinnt sie nicht ihre Bestätigung, nicht davon, daß sie sich auf etwas Bestimmtes richtet, das sie trägt und das sich irgendwie aufweisen läßt. Vielmehr wird die Hoffung bestätigt dadurch, wie sie im weiteren Leben trägt, gelebt und bestätigt wird. Mit ihr beginnt eine neue Geschichte. Darin bewährt sich diese Hoffnung. Mit solcher Bewährung sind wir im Kontext von Geschichten, die uns begegnen. Wir treffen auf Menschen, die von einer Hoffnung leben, die auf nichts setzen, was sie als Grund vor sich haben, auf nichts in der Welt, sondern auf eine weitere Bestätigung. Auf sie hin lebt diese Hoffnung. Da es eine Hoffnung ist, die ihren Grund nicht vorweisen kann, kann sie diesen nur dort finden, wo ihr dieser Grund entgegengebracht wird, wo ihr dieser Grund entgegenkommt, wo ihr dieser Grund widerfährt, wenn denn dieser Grund doch mit der Erfahrung zur Sprache kommen soll, weil sonst diese Erfahrung unartikuliert bleiben muss. Hier setzt die aus dem christlichen Reden nicht herauszulösende Geschichte von Jesus ein, der keine Bestätigung gesucht hat, der dementsprechend auch nicht von seiner Hoffnung gelassen hat, weil ihm diese Bestätigung versagt wurde. Nichts hat er unternommen, um seine Hoffnung auf _____________ 13 14 Siehe dazu Gerhard Sauter: Begründete Hoffnung. Erwägungen zum Begriff und Verständnis der Hoffnung heute, in: ders.: Erwartung und Erfahrung: Predigten, Vorträge und Aufsätze, München 1972, S. 69-107. Walther Zimmerli: Der Mensch und seine Hoffnung im Alten Testament, Göttingen 1968. 358 Hans G. Ulrich etwas zu stützen. Er ist in dieser begründeten Hoffnung geblieben, auch dort noch, wo er – wie erzählt wird – am Kreuz, zu seinem „Gott“ (mit Psalm 22) gebetet hat: „Warum hast Du mich verlassen?“ (Mat 27,46). Das ist noch ein Gebet aus diesem Hoffnungsgrund heraus, sonst hätte er zu beten aufgehört. Jesus erscheint hier nicht als „religiöses Genie“, das feste Gewißheiten hat, sondern als derjenige, der wie analogisch er auch spricht, aus einem Grund spricht, der nicht als seine innere Überzeugung erscheint, sondern als der Grund, aus dem einer so leben und sterben kann, als der Grund, aus dem einer sich nicht in welcher Not auch immer anders abstützt als das Geschehen „Gott“ zu überlassen. Dieses „solus Deus“, „Gott allein“, wird hier bezeugt. Dieses „Gott allein“ erscheint in der Ausschließlichkeit der Hoffnung, die auf ihn gerichtet ist. Diese Bekräftigung verbleibt nicht in der Abgrenzung, das heißt, daß von Gott dann nichts weiteres zu sagen wäre. Im Gegenteil setzt hier die Erzählung von der Erfahrung mit dieser Hoffnung ein. In dieser Erzählung, die den Fortgang dieser Hoffnung berichtet, erscheint dann die ganze Fülle dessen, was von Gott zu sagen ist. Begründung oder Bestätigung Dies alles betrifft die Einsicht darin, wie das Reden von Gott mit dem Verständnis von Sprache zusammenhängt. Hier wird die Unterscheidung sichtbar zwischen einem analogischen Reden von Gott (auch einem Reden von Gott in Metaphern), das erzählt wie Gott im Bekannten erscheint, in dem, was untrennbar zu Gott gehört, und einem Reden von Gott, das darin eine Begründung sucht, die sie vorweisen kann. Die Bestätigung begründeter Hoffnung in der erzählten Geschichte ist so auch unterschieden von der Bestätigung der Gotteserfahrung in den Früchten. Die Bestätigung begründeter Hoffnung in der Erzählung von Jesus Christus liegt darin, daß sich diese Erzählung um nichts anderes dreht als eben darum, die einzigartige Beziehung dieses Jesus zu Gott und Gottes zu Jesus darin präsent werden zu lassen, daß dieser Jesus in dieser begründeten Hoffnung lebt. Die Evangelien erzählen von einem Jesus, der als einer lebt, der von Gott getragen ist. Jesus unternimmt nichts, um sich anders zu vergewissern. Er vergewissert sich auch nicht Gottes. Er sucht keine Gottesgewißheit und er benennt das, was ihn trägt, auch nicht so. Er sucht nichts für sich, sondern läßt Gott freie Hand. Hier beginnt eine neue Rede von Gott, in der sich zeigt, was die alten Geschichten getragen hat. Es beginnt eine neue Rede von Gott, denn dieser Gott kann diesem Jesus am Kreuz nichts mehr gewähren, was in diesem Leben zu gewinnen ist, er kann nichts weiter schenken. So kann diese Geschichte nicht anders fortgeführt werden als in der Auferwe- Tradition und Reflexion 359 ckung zu einem neuen Leben. Diese Gotteserfahrung, wie sie in den Ostererscheinungen erzählt wird, bestätigt das Leben dessen, der sein Leben nicht hat sichern, retten oder mit Sinn erfüllen wollen. Das heißt, in begründeter Hoffnung zu leben. Von dieser Erzählung aus können andere Erzählungen von Gotteserfahrung verstanden werden, wie die Erzählung von Abraham oder die Erzählung von Hiob. In ihnen kann wiedererkannt werden, was Gotteserfahrung heißt, und dies gilt auch für eigene Gotteserfahrungen, wenn sie denn dieser Grammatik begründeter Hoffnung folgen.15 Die Rede von Gott artikuliert sich so in erzählbaren Geschichten. Sie bleibt innerhalb dessen, was die Sprache sagen läßt. Die Erzählungen werden so zu Gleichnissen für das Neue, sofern sie sich mit dem Neuen die Sprache teilen, und doch von einer neuen Wirklichkeit sprechen. Wer sich in dieser Wirklichkeit bewegt, in seiner Grammatik, der kann dann etwas sagen von seiner begründeten Hoffnung. Was in den Gleichnissen präsent wird, ist die Realität einer Gotteserfahrung. Das hat die philosophische Beschreibung verdeutlicht. Wir können dies wiederum in einer Erzählung bei Franz Kafka finden – in der Erzählung von den Gleichnissen: Viele beklagen sich, daß die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse seien, aber unverwendbar im täglichen Leben, und nur dieses allein haben wir. Wenn der Weise sagt: ‚Gehe hinüber’, so meint er nicht, daß man auf die andere Seite hinübergehen solle, was man immerhin noch leisten könnte, wenn das Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes Drüben, etwas, das wir nicht kennen, das auch von ihm nicht näher zu bezeichnen ist und das uns also hier gar nichts helfen kann. Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich nur sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist, und das haben wir gewußt. Aber das, womit wir uns jeden Tag abmühen, sind andere Dinge. Darauf sagte einer: ‚Warum wehrt ihr euch? Würdet ihr den Gleichnissen folgen, dann wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe frei.’ Ein anderer sagte: ‚Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist.’ Der erste sagte: ‚Du hast gewonnen.’ Der zweite sagte: ‚Aber leider nur im Gleichnis.’ Der erste sagte: ‚Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast du verloren.’16 Das „Hinübergehen“, von dem im Gleichnis die Rede ist, begegnet als die neue Wirklichkeit, die aber nur real ist, wo Menschen in dieser Erfahrung verbleiben und nicht heraustreten und darauf verweisen als auf ein „Gleichnis“. Im Gleichnis sich aufhalten, selbst ein Gleichnis sein – das kennzeichnet _____________ 15 16 Dietrich Ritschl hat in diesem Sinne vom „Wiedererkennen“ gesprochen: Dietrich Ritschl: Gotteserkenntnis durch Wiedererkennen, in: ders.: Bildersprache und Argumente. Theologische Aufsätze, Neukirchen-Vluyn 2008, S. 5-15. Franz Kafka: Von den Gleichnissen (1922), in: ders.: Beim Bau der Chinesischen Mauer. Ungedruckte Erzählungen und Prosa aus dem Nachlaß, hg. von Max Brod und Hans Joachim Schoeps, Berlin 1931, S. 36-37. Hans G. Ulrich 360 das neue Leben. So sind Menschen Gleichnisse geworden. Wo von ihnen erzählt wird, wird gleichnishaft gesprochen – und diejenigen, die es hören, sind selbst gefragt, in welcher Weise sie gleichnishaft leben. Der „zweite“ Disputant gehört zu jenen „traditionellen“ Philosophen, die Gleichnis und Wirklichkeit trennen, der „erste“ behaftet ihn dabei. Es kommt für ihn zu keiner Befreiung. Es hat manche intensive theologische Arbeit daran gegeben, die ganze Fülle dessen, was in der Tradition beginnend von der biblischen von Gott gesagt worden ist, auf diese Weise im erzählten Kontext begründeter Hoffnung zu fassen.17 Deshalb ist denn auch gesagt worden, die Theologie habe das Reden von Gott zum Gegenstand, das Reden von Gott, das in sich eine differenzierte Geschichte enthält, die alle Gotteserfahrungen auf die Bestätigung durch Gott allein hin artikulieren. In ihr findet sich die Geschichte von Jesus als Schlüsselgeschichte. Von ihr aus läßt sich die überlieferte Geschichte in allen ihren Geschichten verstehen. Alle weiteren Geschichten, die dieser Geschichte folgen, handeln dementsprechend von der Gotteserfahrung begründeter Hoffnung, oder sie enden vorher. So die Geschichte vom Reichen Mann, der Jesus in dieser Hoffnung nicht folgen kann (Mar 10,17-27). In diesen Geschichten ist gegeben, bezeugt und bestätigt, wie von Gott zu reden ist. Wie sollte jemand von „Gott“ sprechen, was auch immer seine Erfahrung ist, wenn nicht in solcher begründeten Hoffnung, die ihr Bestätigung erwartet. Der Raum der Sprache muss um dieser Bestätigung willen nicht verlassen werden. Im Gegenteil: die Bestätigung soll ja der eigenen Erfahrung gelten und diese nicht auf etwas Jenseitiges verweisen, sie auf eine andere Wirklichkeit vertrösten. Und doch erscheint die Bestätigung als ein eigenes, als ein externes Wort – wie die Aufforderung des Weisen in Kafkas Erzählung – extern gegenüber dem Leben in begründeter Hoffnung, aber nicht außerhalb des Erfahrungszusammenhangs. So wird das externe Wort in der Sprache artikuliert, in der jede Erfahrung artikuliert wird. Hier wird jedoch nicht eine Differenz zwischen einem „Innen“, vielleicht dem inneren Überzeugungszustand eines Menschen, und einem „außen“ aufgemacht, sondern es wird eine neue Wirklichkeit in der Sprache gleichnishaft präsent – eine wirkliche Erfahrung, eine artikulierte Erfahrung. So hat die theologische Tradition von einem „verbum externum“ gesprochen. Dies ist der Schlüssel zu ihrem Sprachverständnis. _____________ 17 Friedrich Mildenberger hat in seiner Biblischen Dogmatik dies durchgängig unternommen und zugleich in seiner theologischen Disposition, das heißt im Blick auf das damit verbundene theologische Verständnis von Sprache reflektiert. Die Biblische Dogmatik von Friedrich Mildenberger ist das bislang am weitesten ausgeführte Beispiel für diese theologische Aufgabe. Friedrich Mildenberger: Biblische Dogmatik, a.a.O. Tradition und Reflexion 361 Überlieferung und „religiöse“ Erfahrung An dieser Stelle schließen sich diese Beschreibungen an das an, was Hans Schneider nachvollziehbar gezeigt hat. Die Rede von Gott bleibt, so beschrieben, verbunden mit den Gotteserfahrungen, wie sie überliefert sind und mit der in dieser Überlieferungspraxis weitergegebenen Erfahrung. Sich mit der Gottesrede in dieser Überlieferung aufzuhalten, in der von ihr erschlossenen Erfahrung, bedeutet, daß keine wie auch immer gültige Erfahrung vorausgesetzt werden muss, die die Gottesrede trägt, sondern daß die Gottesrede genuin von dieser Erneuerung der Erfahrung spricht, wie sie in den Geschichten von begründeter Hoffnung erscheint. Das ist die bestimmte Erfahrung, die in dem Namen des Gottes beschlossen ist, der mit der Geschichte Jesu Christi und Israels verbunden ist. Ob man die Erfahrung begründeter Hoffnung eine „religiöse“ nennen will, um sie mit anderen „religiösen“ Erfahrungen zusammenzusehen oder zu vergleichen, kann insofern offen bleiben, als sich diese Gottes-Erfahrung nicht dessen vergewissern muss, daß sie alle die Kennzeichen teilt, die „religiösen“ Erfahrungen zukommen. Es ist aber gleichwohl entscheidend, wenn philosophisch gezeigt werden kann, daß religiöse Erfahrung aufgrund bestimmter Kennzeichen ihrer Artikulation, die auch die christliche teilt, einzig in der artikulierbaren Erfahrungswelt sinnvoll zur Sprache kommt. Es wird dann auch möglich, von dieser Gotteserfahrung der begründeten Hoffnung her auf andere Artikulationen von Erfahrungen oder „religiösen“ Erfahrungen zu blicken, um zu sehen, wie sie sich vergleichsweise anders artikulieren. Die philosophische Arbeit leistet damit ein gutes Stück Theologie, denn die Theologie kann nicht darauf setzen, daß es zwei Welten oder zwei Sprachen gibt, um von Gott zu reden.18 Sonst müßte sie davon handeln, auf welche „Welt“ sich denn der Glaube oder die Hoffnung verlassen soll, statt daß von der Hoffnung die Rede ist, die in der Welt wirklich geworden ist. Eben dies ist als Erfahrung in der Geschichte von Jesus enthalten, in der weitergeführt wird, was in den vorausgehenden Geschichten von Gott artikuliert ist. Die Aufgabe für die Theologie wird deshalb – im 1. Petrusbrief (1 Petr 3,15) – so formuliert: Seid allezeit bereit vor jedermann Rechenschaft zu geben, der von euch eine sinnvolle Artikulation (lo,gon) fordert von der die Hoffnung, die bei euch wirklich geworden ist. Daß bei dieser Aufgabe eine Philosophie wie die von Hans Schneider entscheidend hilft, nicht in fragwürdige Apologetik zu verfallen, ist die Bestäti_____________ 18 Siehe dazu den grundlegenden Beitrag von George A. Lindbeck: Christliche Lehre als Grammatik des Glaubens Religion und Theologie im postliberalen Zeitalter, Gütersloh 1994. 362 Hans G. Ulrich gung einer befreiende Erfahrung, die in dieser Philosophie zur Sprache kommt. ‚Many Forms of Nonpublic Reason’? Religious Diversity in Liberal Democracies Herta Nagl-Docekal Current conceptions of the liberal, democratic state commonly refer to the ‘fact of pluralism,’1 claiming that today in practically every country people hold very different views on the fundamental issues of the human existence. According to John Rawls, these views are, generally speaking, based upon “comprehensive doctrines, religious, philosophical, and moral”2. The core concern in addressing this diversity is its potential for conflict: the continuous encounter of individuals (or groups of people) maintaining different approaches to fundamental issues, and leading their lives in accordance with their convictions, has often resulted in tensions. As regards conflicts related to religious diversity, one familiar tool of prevention is the separation of religion and state. In fact, this concept of separation may be considered the very basis of the modern state. According to the liberal understanding, a central task of the democratic state is to provide a public sphere in which all citizens – regardless of their differences in faith or other basic convictions – share one secular language that allows them to discuss and determine “questions of fundamental political justice”3 by means of reasonable arguments4. _____________ 1 2 3 4 See, for instance, John Rawls: The Idea of Public Reason Revisited (1997), in: John Rawls: Collected Papers, Samuel Freeman (ed.), Cambridge, Mass.-London 1999, p. 573; Jürgen Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt a. M. 2005, p. 143. For an introductory assessment of Rawls’s thesis see: Wilfried Hinsch: Das Faktum der Pluralität, in his: Einleitung, John Rawls: Die Idee des politischen Liberalismus, Frankfurt a. M. 1992, p. 22-28. Rawls: Public Reason Revisited, op. cit., p. 573. Ibid., p. 575. According to Rawls, these questions “are of two kinds, constitutional essentials and matters of basic justice,” such as “basic economic and social justice and other things not covered by a constitution” (ibid.). Habermas points out: “Das Selbstverständnis des demokratischen Verfassungsstaats“ beruht auf einer Denkweise, “die sich allein auf öffentliche, ihrem Anspruch nach allen Personen gleichermaßen zugängliche Argumente beruft“ (Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 125). In his view, the basic idea is this: “Die Bürger sollen ... in Streitfragen eine rationale Verständigung suchen - sie schulden einander gute Argumente“ (ibid., p. 126). Herta Nagl-Docekal 364 Specifying this approach, Rawls introduces the conception of ‘public reason’. His definition of this notion focuses on a mode of reasoning that is based upon the principles of ‘liberty’ and ‘equality’5 – to which every citizen does consent under the condition of the “veil of ignorance”6. Other key elements of the modern state, such as the principles of ‘liberty of conscience’ and ‘liberty of religion,’ are conceived as being grounded in this shared sphere of ‘public reason’7. Investigating how these basic ideas have been further elaborated in the recent debate, this paper focuses on the ways in which ‘religion’ has been portrayed. I shall argue that to describe religious language as being “opaque”8 or based upon a specific logic that makes mutual understanding among the different religious confessions impossible, seems unwarranted and does entail a danger: Such an approach may – albeit unintentionally – support views maintaining the unavoidability of ‘clashes’. In more general terms, my point is that the liberal concept is in need of further differentiation with regard to religion. In the given context, however, I cannot do more than propose a line of reasoning which would, of course, require to be spelled out in detail. One element of my reflections will be the thesis that a re-reading of Kant’s and Hegel’s philosophies of religion might prove fruitful for the current debate. 1. Three spheres of reason Discussing the separation of – and possible relations between - religion and the liberal democratic state, both Rawls and Habermas operate with a distinction of three spheres of interpersonal communication: First, the sphere of deliberation among elected members of decision making bodies, judges, and all the other participants in what Rawls terms the “public political forum”9. _____________ 5 6 7 8 9 Rawls provides a differentiated elaboration of his conception of ‘public reason’ in: Lecture VI. The Idea of Public Reason, in: John Rawls: Political Liberalism, New York 1993, p. 212-254, and in part 1. The Idea of Public Reason, in: Public Reason Revisited, op. cit., p. 574-581. An in-depth reading of the various definitions of ’public reason’ we find in Rawls is provided in: Samuel Freeman: Rawls, London-New York 2007, p. 381-415, and: Charles Larmore: Public Reason, in: Samuel Freeman (ed.): The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge 2003, chapter 10. For an explanation of this term see: John Rawls: A Theory of Justice, Cambridge, Mass. 1971, p. 136-142. Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 125. Ibid., p. 150. For a precise listing of the groups of people who belong to this “forum” – and are strictly required to follow its rules of argumentation - see: Rawls: Public Reason Revisited, op. cit., p. 575. Rawls clearly distinguishes his notion of “the public political forum” Religious Diversity in Liberal Democracies 365 Here, any argument put forward, and any reason provided, must be framed in terms of ‘public reason,’ as defined by Rawls. Secondly, the braoder sphere of public opinion formation on issues concerning the social order which Rawls addresses under the heading “the wide view of public political culture,”10 and which Habermas characterizes with the term “informeller Meinungsstreit”11. Ideally, this political discourse is inclusive in two ways, as no person and no topic must be treated as a priori excluded. Accordingly, this sphere needs to be open to different modes of expression12. (The controversy between Habermas and Rawls on whether political statements formulated in religious language must be treated in terms of “the proviso” cannot be taken up here13.) Thirdly, the sphere of communication among the members of religious communities; this sphere is considered a part of the more comprehensive “background culture”14. The language of any religious community is described as being shaped in a specific way by references to what may be called ‘prophetic wisdom,’ ‘revelation,’ ‘holy scriptures,’ etc. Addressing this plurality of special languages, Rawls first states that the term ‘private language’ would be inadequate here and that, from the perspective of the community members, their discourse is ‘public’15. His main concern, however, is that religious doctrines are based upon reasons that have relevance for believers only. Therefore he subsumes the diversity of religions under the category of “many forms of nonpublic reason”16. For Rawls, religious teachings are shaped by their respective logics to such an extent that there exist “deep and unresolvable differences”17 among the diverse creeds. He emphasizes that “on such doctrines reasoned and uncoerced agreement is not to be ex_____________ 10 11 12 13 14 15 16 17 from wider concepts of public political debate that are used frequently, such as “the public square” (ibid.). Rawls: Public Reason Revisited, op. cit., p. 591-594. Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 11. According to Habermas, “kann der liberale Staat nicht [...] von allen Gläubigen erwarten, dass sie ihre politischen Stellungnahmen auch unabhängig von ihren religiösen [...] Überzeugungen begründen sollen“. (Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 133.) Rawls maintains that contributions based upon religious teachings “may be introduced in public political discussion at any time, provided that in due course proper political reasons … are presented” (Rawls: Public Reason Revisited, op. cit., p. 591); for a critical comment see Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 135137. Rawls: Public Reason Revisited, op. cit., p. 576; see also: Rawls: Political Liberalism, op. cit., p. 14. Rawls: Political Liberalism, op. cit., p. 321. Rawls: Public Reason Revisited, op. cit., p. 576. John Rawls: Kantian Constructivism in Moral Theory (1980), in: Rawls: Collected Papers, op. cit., (p. 303-358), p. 329. Herta Nagl-Docekal 366 pected,”18 and that their adherents cannot even come near a mutual understanding. Habermas goes even further in stressing the peculiarity of religious language, as he characterizes it as ‘opaque’ and representing ‘the intransparent other of reason’19. Current research focuses on the second of the three spheres just listed – more precisely, on the contributions to public political discourse made by religious individuals or representatives of churches or other religious communities. The core concern is that such contributions tend to make direct or inexplicit references to basic convictions of faith which are not shared by every citizen, and that, consequently, the general debate on political issues is marked by the intersection of ‘nonpublic reason’ and ‘public reason’. The leading research interest is in how to prevent or overcome conflicts that are likely to emerge, or have emerged, at this intersection. It is important to note that there are significant differences in the ways in which Habermas and Rawls specify this general problem. While Rawls suggests the possibility of (partial) agreement among different religious doctrines with regard to the basic values of the liberal state, Habermas frames the issue primarily in terms of the encounter of religious and non-religious citizens. Yet, with regard to both approaches problems arise concerning the way religion is portrayed. Let us first turn to Habermas’s most recent reflections on these matters. 2. An encounter of two groups of citizens (Jürgen Habermas) For Habermas, modernity is based upon the ‘secular’ conception of reality which has been introduced, in the history of philosophy, by the turn towards a ‘post-metaphysical’20 mode of thinking. In consequence of this turn, he notes, most people in modern societies have come to perceive their existence, as well as the world in general, in terms of this secular approach. (Concerning the term ‘secular,’ two terminological aspects need to be considered: First, as Rawls underlines, the term ‘secular reason’ must not be confounded with ‘public reason’; it rather has a broad, less precise meaning21. Secondly, _____________ 18 19 20 21 Ibid. Habermas uses the expression “das intransparente Andere der Vernunft“ for instance in: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 149. See: Jürgen Habermas: Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt a. M. 1988. Habermas provides a summary of his view in his essay On the Relations Between the Secular Liberal State and Religion, in: Hent de Vries / Lawrence E. Suillivan (eds.): Political Theologies. Public Religions in a Postsecular World, New York 2006, p. 251-260, in particular p. 252. Discussing Robert Audi’s approach, Rawls points out that the term ‚secular reason’ often is used “in the sense of a nonreligious comprehensive doctrine and in the sense Religious Diversity in Liberal Democracies 367 Habermas uses the term ‘secular’ in two different ways: in some contexts, he uses it in the wide sense of ‘non-religious,’ but often he employs it with specific reference to an agnostic or atheistic attitude22. Besides, in a number of text passages he seems to treat these two meanings as being synonymous. The following reflection is a case in point.) Habermas notes that one significant element of the secular attitude marking modernity has been – until fairly recently - to regard religious convictions as characteristically pre-modern, and to expect them to gradually vanish23. Presently, however, this expectation appears to have been misguided: We need to acknowledge, Habermas notes, “the continued existence of religion in a continuously secularizing environment,”24 and he suggests to adopt the term ‘post-secular society’ in order to indicate that today, typically, ‘secular citizens’ live along with ‘religious citizens’25. From this perspective, Habermas discusses in which way the public political debate – i.e., the second sphere distinguished above – ought to be configured today. Is it legitimate for religious citizens to use their special language as they participate in the general debate on issues concerning the social order? Habermas answers this question in a nuanced manner: While religious citizens must be granted to articulate their opinion in their own terms, a task of ‘translation’ (“Übersetzung”26) does arise: To make contributions in religious language accessible to fellow citizens – “to people of other faiths, as well as to nonbelievers”27 - their content needs to be transferred into the language of _____________ 22 23 24 25 26 27 of a purely political conception without the content of public reason”. Rawls: Public Reason Revisited, op. cit., p. 587. Thus he defines the ‘postmetaphysical’ mode of thinking as being based upon ‘agnostic premises’. Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 147. Habermas writes: “Nach säkularistischer Lesart können wir voraussehen, dass sich religiöse Anschauungen im Lichte der wissenschaftlichen Kritik auflösen werden und dass die religiösen Gemeinden dem Druck einer fortschreitenden kulturellen und gesellschaftlichen Modernisierung nicht standhalten können.“ Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 145. Habermas: Relations Between the Secular Liberal State and Religion, op. cit., p. 256. Ibid., p. 258. It would be challenging, but cannot be pursued here, to compare Habermas’s bipartite construction of the current condition with Taylor’s suggestion to distinguish three major players, including “the inner counter-enlightenment” (“immanente Gegenaufklärung”). See: Charles Taylor: Die immanente Gegenaufklärung: Christentum und Moral, in: Ludwig Nagl (ed.): Religion nach der Religionskritik, Vienna- Berlin 2003, p. 60-85. Jürgen Habermas: Die Grenze zwischen Glauben und Wissen. Zur Wirkungsgeschichte und aktuellen Bedeutung von Kants Religionsphilosophie, in: Herta Nagl-Docekal / Rudolf Langthaler (eds.): Recht – Geschichte – Religion. Die Bedeutung Kants für die Gegenwart, Berlin 2004 (p. 141-160), p. 150. Habermas: Relations Between the Secular Liberal State and Religion, op. cit., p. 258. Herta Nagl-Docekal 368 ‘secular citizens’28 – a process Habermas describes as “the secularising release of religiously encapsulated potentials of meaning”29. It is important to note that he expects the secular language to be capable of mediating by crossing two types of barriers - the barrier separating different religions as well as that between a religious and an agnostic conviction. Concerning the second boundary, Habermas contends that, regardless of their specific faith, all religious citizens are in the same situation of entering the secular context with ‘large metaphysical luggage’ (“mit großem metaphysischen Gepäck”30). He suggests that the ‘translation’ of statements made in their respective language should be carried out in a shared effort of believers and agnostic citizens31. The leading perspective is here that, as the results of public opinion formation eventually merge into the decision-making process of elected bodies, religious language definitely has to be left behind: In accordance with Rawls, Habermas maintains that ‘public reason’ proper – which defines sphere 1 – does require arguments that are exclusively based upon the logic of justification specified in contract theory32. Which concept of ‘religion’ does Habermas’s approach imply? Taking a closer look, we detect a number of problems. To begin with, it is important to note that Habermas views the secular language of modernity as being tantamount to ‘natural reason’ (“‘natürliche’ Vernunft”) and ‘common human reason’ (“gemeinsame Menschenvernunft”33). It is on the basis of this under_____________ 28 29 30 31 32 33 Habermas uses the term “säkulare Bürger”, for example, in: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 138 f. Habermas: Relations Between the Secular Liberal State and Religion, op. cit., p. 258. For critical assessments of this concept of ‘translation’ see the thirteen essays - based upon a variety of different approaches in contemporary philosophy and theology – in: Rudolf Langthaler / Herta Nagl-Docekal (eds.): Glauben und Wissen. Ein Symposium mit Jürgen Habermas, op. cit.. Hans-Julius Schneider was a participant of this symposium. See his essay: ‚Wertstofftrennung‘? Zu den sprachphilosophischen Voraussetzungen des Religionsverständnisses von Jürgen Habermas, ibid., p. 155-185. See also: Jürgen Habermas’s reply to these comments: Replik auf Einwände, Reaktion auf Anregungen, ibid., p. 366-414. Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 270. Habermas notes: “Liberal political culture may even expect its secularized citizens to participate in efforts to translate relevant contributions from a religious language into a publicly accessible one”. (Habermas: Relations between the Secular Liberal State and Religion, op. cit., p. 260.) In more general terms, Habermas insists that the difference of the two types of language does not legitimate a hostile attitude between believers and agnostics. He emphasizes: “Aber es macht einen Unterschied, ob man miteinander spricht oder nur übereinander” (Jürgen Habermas: Ein Bewußtsein von dem, was fehlt, in: Michael Reder / Josef Schmidt (eds.): Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jürgen Habermas, Frankfurt a. M. 2008, p. 26-36. See, for instance, Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 11 and p. 137. Ibid., p. 125. Religious Diversity in Liberal Democracies 369 standing that religion appears as ‘the in-transparent other of reason’: Where common reason is identified with secularism, religion presents itself as ‘abysmally obscure’ (“abgründig fremd”34). For Habermas, faith is grounded in ‘the dogmatic authority of an unimpeachable core of infallible truths of revelation,’35 and therefore the ‘existential certainties’ of religious convictions are marked by ‘discursive ex-territoriality’36. This view, I think, does not sufficiently acknowledge the hermeneutic character of religion. Significantly, Habermas’s theory is contradictory in this respect, since the suggestion to translate religious conceptions into secular language does – albeit implicitly – presuppose that religious language is not altogether obscure. The faithful, at least, are assumed here to understand clearly what they believe. There is plenty of evidence for this way of seeing them – religious instruction, for example: Obviously, it would be impossible to introduce young generations to religious teachings unless this could be done in a language they understand. From this perspective, Habermas’s way of identifying ‘common human reason’ with secularism lacks plausibility. Rather, our ordinary language appears to be more comprehensive than the secular understanding of reality. (I shall take up this issue again.) Besides, the question arises here whether, given his thesis of religion’s ‘discursive ex-territoriality,’ it seems to Habermas at all possible for a ‘secular citizen’ to convert to any form of religious faith. Can he account for the conversions of intellectuals that have actually happened in our time only by imputing a sacrificium intellectus? As Habermas seeks to corroborate his approach by referring to ‘infallible truths of revelation,’ we need to explore the meaning of the term ‘revelation’. Immanuel Kant provides a lucid interpretation: We can acknowledge a certain doctrine, he argues, as having been revealed only under the condition that our own reason does confirm it. Otherwise, it would be impossible for us to consider that doctrine as true37. “The final touchstone of truth is always reason,”38 Kant argues. Similarly, Hegel contends that in order to accept a given _____________ 34 35 36 37 38 Ibid., p. 137. Habermas notes: “Aber religiös verwurzelte existentielle Überzeugungen entziehen sich durch ihren ... Bezug auf die dogmatische Autorität eines unantastbaren Kerns von infalliblen Offenbarungswahrheiten einer vorbehaltlosen diskursiven Erörterung“ (ibid., p. 135). According to Habermas, “diskursive Exterritorialität eines Kerns von existentiellen Gewissheiten“ is a significant element in “religiösen Überzeugungen“ (ibid., p. 135). Kant argues: “... weil wir niemanden verstehen, als den, der durch unseren eigenen Verstand und unsere eigene Vernunft mit uns redet.“ Immanuel Kant: Der Streit der Fakultäten, in: Immanuel Kant: Werke in sechs Bänden, ed. Wilhelm Weischedel, VI (p. 261-393), p. 315. Immanuel Kant: What does it mean to orient oneself in thinking?, in: Immanuel Kant: Religion within the Boundaries of Mere Reason and Other Writings, ed. Allen Wood and George di Giovanni, Cambridge, UK- New York 1998, (p. 1-14), p. 9. 370 Herta Nagl-Docekal teaching as ‘the truth,’ it needs to be verified through our own thinking39. For Kant, it is specifically our ‘pure moral reason’ that is capable of incorporating into our personal conviction conceptions which are perceived as being based on ‘revelation’40. But - one might wish to argue - does not religion describe itself as obscure, for instance, in characterizing its very core as a ‘mystery’? The Christian concept of the ‘Holy Trinity’ might be seen as a case in point. We need to consider, however, that some kind of explanatory narrative, or metaphoric imagery, must be attached to a mystery to prevent it from being devoid of any meaning. To be sure, such narratives do not dissolve the mode of mysteriousness; but we have to take into account that religious mysteries are ‘determinate mysteries’41. Kant explains – along his general line of reasoning - that, in order to make sense for us, religious mysteries must correspond with our moral reason42. Furthermore, we need to consider that religious truths – as they are expressed in narrative language - are tied to history. From this perspective, Habermas’s way of referring to ‘dogmatic authority’ seems over-simplified. What hermeneutic research on ‘tradition’ has found in general does also apply to religious traditions: They can only persist through centuries if the believers manage – over and over again - to re-interpret the core convictions of their faith in a way that renders them accessible, and convincing, in view of their respective contemporary condition. As Kant emphasizes, the belief in a certain traditional expression is dead in itself (“der Glaube an einen bestimmten Geschichtssatz ist tot an ihm selber“43). In this context, Kant introduces the notion of ‚hermeneutica sacra,’ i.e., the ‘art of biblical interpretation’44. Even _____________ 39 40 41 42 43 44 Hegel claims that there exists “die unendliche Forderung, dass der Inhalt der Religion sich auch dem Denken bewähre ... dies Bedürfnis ist nicht abzuwenden.“, in: Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Religion II, G.W.F. Hegel: Werke, Frankfurt a. M. 1971 ff., Bd. 17, p. 333. Maeve Cooke, rejecting Habermas’s way of separating religious and secular truth, suggests to re-consider that for Hegel there is only one ‚truth’. Maeve Cooke: Keine Wahrheit außer Wahrheit. Religion und Staat in Hegels Rechtsphilosophie im Lichte der gegenwärtigen Diskussion, in: Herta Nagl-Docekal / Wolfgang Kaltenbacher / Ludwig Nagl (eds.): Viele Religionen – eine Vernunft? Ein Disput zu Hegel, Vienna – Berlin 2008, p. 176-192. Kant contends that “die Göttlichkeit einer an uns ergangenen Lehre also durch nichts als durch Begriffe unserer Vernunft, sofern sie rein-moralisch und hiermit untrüglich sind, erkannt werden kann.“ (Kant: Streit der Fakultäten, op. cit., p. 315). Gehrke points out that the term ‘Geheimnis’ has been used in various ways. He distinguishes “das bestimmte Geheimnis” from two other definitions of this term. Helmut Gehrke: Theologie im Gesamtraum des Wirklichen, Vienna-Munich 1981, p. 230-236. Immanuel Kant: Religion within the Boundaries of Mere Reason, in: Kant: Religion within the Boundaries of Mere Reason And Other Writings, op. cit., p. 140. For Kant’s interpretation – by means of moral philosophy – of “the Holy Trinity” see: ibid., p. 141-144. Kant: Streit der Fakultäten, op. cit., p. 337. Ibid., 336 and 302. Religious Diversity in Liberal Democracies 371 ‘original texts’ – like so-called ‘holy scriptures’ – are marked by this hermeneutic character as they usually involve a double temporality: someone reports, and explains, to his fellow humans what has earlier happened, or been conveyed to him or her45. Similarly, dogmatic sentences claiming to establish certain teachings in a trans-historical manner can, in fact, never fully achieve this goal, as they also call for interpretation – and have, indeed, often found a variety of readings. - In short, the thesis stating the ‘discursive ex-territoriality’ of religion seems to lack validity. 3. Ordinary versus “secular” language For Kant and Hegel ‘common human reason’ is not identical with the ‘secular’ mode of thinking. This view also informs Hegel’s reflections on the roots of ‘our time,’ as he points out that secularism has not been the only feature of the emerging modernity. Martin Luther, he argues, has made it clear - for Christianity - that traditional religious conceptions are in need of, and open to, being re-appropriated by means of our reason46. Yet this option of a reasonable re-reading has, Hegel further shows, been marginalized: In view of modern science, a naturalistic ideology has evolved which does not leave room for any ‘knowledge of God’47. Rather, this empiricist approach has resulted in a sweeping rejection of religion as ‘superstition’48. - From this angle, we detect a tension in Habermas: While he has been an articulate critic of the empiricist reductionism himself (as, for instance, in his recent book Zwischen Naturalismus und Religion), his ‘secular’ perspective on religion seems to be based on just that approach. In Hegelian terms, Habermas’s portrayal of _____________ 45 46 47 48 Kant points out that, for instance, the Apostles had to choose a method of teaching (“Lehrmethode”) which was “kat’ anthropon”, i.e., appropriate to the mode of thinking of their time (Streit der Fakultäten, op. cit., p. 302). For a lucid explanation of ‚the dialectis of interpretation’ see Wilhelm Lütterfelds: Zur Dialektik von schriftlichem Original und verstehender Auslegung, in: Klaus Dethloff / Rudolf Langthaler / Herta NaglDocekal / Friedrich Wolfram (eds.): Orte der Religion im philosophischen Diskurs der Gegenwart, Berlin 2004, p. 29-42. Hegel explains his view of Martin Luther - with specific reference to the ‘sola fide’ principle - in: Religion II, op. cit., p. 327-333. Hegel observes that – as a result of the empiricist attitude – god “ist ein Jenseits für das Erkennen”, in: Hegel: Religion II, op. cit., p. 334. With regard to “our time” he notes: “Jetzt ist das Höchste, nichts von Gott zu wissen.” (G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Religion I, in: Werke, op. cit., Bd. 16, p. 335) See the chapter “The struggle of enlightenment with superstition” in: G.W.F. Hegel: The Phenomenology of Mind, translated by J.B. Baille, New York 1967, p. 561-589. Herta Nagl-Docekal 372 religion as ‘obscure’ is informed by the ‘rationalist enlightenment’ (“verständige Aufklärung”49). This dilemma can be avoided, I think, by taking a closer look at ordinary language. Using our common mode of expression, we are capable of articulating experiences which transcend the empirically given. A case in point is the sphere of aesthetics. As Michael Theunissen maintains, our aesthetic experiences show that we are able to simultaneously exist, while remaining within the world, also beyond the world. Referring to Goethe, he emphasizes that we are able to accomplish this kind of duality ‘in our ordinary real life’50. Kant explores this human capacity primarily with regard to morality. As he notes, the moral principle is to be understood as “an obscurely thought metaphysics that is inherent in every man because of his rational disposition”51. Taking up this view, Otfried Höffe rejects Rawls’s as well as Habermas’s program of a “post-metaphysical philosophy,” arguing that our morality per se has a metaphysical character52. In the present context two elements of our capacity to transcend the empirical sphere, as analysed by Kant, are of particular relevance: Firstly, as moral subjects we rely upon the assumption that human beings are free to act according to the moral law, although no empirical proof _____________ 49 50 51 52 Hegel: Religion II, op. cit., p. 338. Further evidence of this problem lies in the fact that Habermas emphasizes his agreement with Detel’s suggestion to reduce the possible plausibility of religion to cultural practices coping with human suffering. Habermas (Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 152) refers here to Detel’s reflection: “Ob es einen göttlichen Geist ohne physische Grundlage geben kann, der Sprachen (Gebete) verstehen und als Richter fungieren kann, sind Vorstellungen, die heute einfach nicht mehr Sache des Glaubens, sondern des Wissens sind ... Die Antwort auf diese Fragen ist eindeutig negativ .... Das bedeutet keineswegs, dass z.B. Rituale zur Bewältigung der Todesangst, die heute in verschiedenen Kirchen gepflegt werden, an Bedeutung verlieren.“, in: Wolfgang Detel: Forschungen über Hirn und Geist, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 52 (2004), p. 918. Michael Theunissen: Religiöse Philosophie, in: Klaus Dethloff / Rudolf Langthaler / Herta Nagl-Docekal / Friedrich Wolfram (eds.): Orte der Religion im philosophischen Diskurs der Gegenwart Orte der Religion in der Philosophie der Gegenwart, op. cit., (p. 101-120), p. 106. Theunissen refers here to Goethe’s comment on Johann Christian Guenther: “... er besaß alles, was dazu gehört, im Leben ein zweites Leben durch Poesie hervorzubringen, und zwar in dem gemeinen wirklichen Leben.“ Johann Wolfgang von Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit (1811-13), in: Goethes sämtliche Werke, Stuttgart 1893-96, 20, p. 289. Immanuel Kant: The Metaphysics of Morals, translated by Mary Gregor, Cambridge, UKNew York 1991, p. 182. Höffe notes: “Metaphysisch ist nicht die Philosophie der Moral, sondern die Moral selbst.“, in: Otfried Höffe: Kategorische Rechtsprinzipien. Ein Kontrapunkt der Moderne, Frankfurt a. M. 1995, p. 9.) Discussing Rawls, Jean Hampton reaches a similar conclusion, in: Jean Hampton: Should political philosophy be done without metaphysics?, in: Chandran Kukathas (ed.): John Rawls. Critical assessments of leading political philosophers, London-New York 2003, vol. IV 432-455. Religious Diversity in Liberal Democracies 373 for human freedom can be provided. Secondly, as we are confronted with the un-surmountable finiteness of our existence – which we experience in our inability to reconcile our moral efforts with our longing for happiness – our (pure moral) reason firmly assumes that, against all odds, our moral struggle will, in the end, make sense and we will find happiness. Otherwise, Kant argues, to be a finite moral subject would mean to be captivated in a contradictory, absurd position. In this context, as is well known, Kant elaborates his conception of the “postulates of pure practical reason,”53 claiming that any given religion is rooted in these postulates. One achievement of this theory is to provide us with an explanation for the fact that any culture examined by historical and anthropological research has been shaped by some form of religious cult. As he explains how religion is grounded in practical reason, Kant maintains that the core elements of religious faith are embedded in every human being, including those who regard themselves as ‘agnostics’ or ‘atheists’54. From this perspective, the barrier Habermas assumes to exist between religious and non-religious citizens may turn out to be less strict than he supposes it to be. As it seems, those who do not see themselves as believers do, nevertheless, have a basic understanding of what religion is all about55. However, to follow Kant’s conception of the postulates in this manner does not imply that there be no difference between religious and non-religious languages - which, as Habermas correctly points out, do encounter each other in the sphere of public political debate. Rather, what I am suggesting is to assess this difference in an other manner – which will be explained shortly. _____________ 53 54 55 Immanuel Kant: Critique of Practical Reason, translated by Lewis White Beck, Indianapolis 1956, p. 114-146 (Book II, Chapter II). A lucid explanation of Kant’s concept of the postulates is provided in: Peter Byrne: Kant on God, Aldershot, UK-Burlington, VT 2007, p. 84-93. Kant explains that, while we may decide to be atheists in terms of theoretical “speculation,” cherishing such an attitude in “praxi” would prove impossible. Immanuel Kant: Vorlesung zur Moralphilosophie, ed. Werner Stark, Berlin 2004, p. 125. Strikingly, Habermas at one point notes that nonbelievers, in listening to what believers have to say, may recognize some of their own, sometimes buried intuitions (“[sie können] eigene, manchmal verschüttete Intuitionen wiedererkennen”. Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion, op. cit., p. 137). But he fails to examine how these shared intuitions may be accounted for. Herta Nagl-Docekal 374 4. A philosophical perspective on the diversity of religions Kant’s conception of the postulates also sheds doubts on the common thesis that there exist ‘unresovable differences’ among the various given religious doctrines. Kant suggests to view the plurality of confessions – that have each emerged from specific cultural and historical conditions – as different articulations of one and the same core conviction rooted in human reason56. Hegel reaches, albeit from a different systematic background, a similar conclusion. Based upon his conception of ‘spirit,’ he explains the diversity of religions in terms of his philosophy of world history, maintaining that all religions are intertwined as each has participated in mankind’s continued search for, and elaboration of, final truth57. As is well known, Hegel, in this context, presents the diversity of world religions in a hierarchical order which, today, certainly must be called into question. However, this problem notwithstanding, we find in Hegel as well as in Kant the well-founded thesis that the given religious teachings allow for an interpretation that brings to light their shared concern – which is not only a matter of doctrine but also of existential, i.e., of moral consequence. Furthermore, we may learn from both authors that modern conditions make it a pressing task for believers to engage in such rereadings58. As Kant and Hegel teach us, the enlightenment – which has shaped the modern conditions prevailing in most parts of the globe today has brought about an irreversible turn, confronting everyone with the task to use their ‘own understanding’ in the different spheres of life, including that of religion.59 In view of what has been said above on the hermeneutic character of religion, we may apply to any religious tradition existing today what Hegel describes as Luther’s call for a ‘thinking appropriation’ of the content of faith. Of course, Kant and Hegel draw a clear dividing line between religious doctrines, as such, and institutions like churches. Both authors address the problem that new readings of ‘canonical’ texts typically are - at first - met with _____________ 56 57 58 59 Kant maintains that, “long before” popular faith in its diversity has originated, “the predisposition to moral religion lay hidden in human reason”. Immanuel Kant: Religion within the Boundaries, op. cit., p. 119. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Religion II, op. cit. See: Herta Nagl-Docekal: Eine ‘entgleisende Modernisierung’. Aufklärung und Religion bei Habermas und Hegel, in: Herta Nagl-Docekal / Wolfgang Kaltenbacher / Ludwig Nagl (eds.): Viele Religionen – eine Vernunft?, op. cit., p. 155-176. This task is explained most poignantly in: Immanuel Kant: An Answer to the Question: What is Enlightenment?” (1784), in: Immanuel Kant: Perpetual Peace and Other Essays on Politics, History and Morals, translated by Ted Humphrey, Indianapolis 1983, p. 41-48. Religious Diversity in Liberal Democracies 375 fierce resistance from representatives of encrusted institutions60. Yet, we also need to consider that this form of resistance has, in the long run, not prevented any religious tradition from renewing itself. Today we may witness such innovative readings being suggested within various religious communities, for instance, as the ‘holy scriptures’ of different confessions are being reinterpreted with regard to their approach to gender relations. 5. John Rawls’s conception of religious citizens John Rawls describes the political discourse of the general public (i.e. the second sphere distinguished above) in a way that differs significantly from Habermas’s assessment. In his view, non-religious persons as well as citizens of faith typically are oriented on ‘comprehensive doctrines’. Commenting on Habermas, he emphasizes that everyone carries ‘large luggage’ into the public discourse. Thus, for Rawls, the issue is not the encounter of two groups of citizens (religious versus ‘secular’ citizens); rather, he focuses on the individuals facing different claims. Is it possible, he asks, “for citizens of faith to be wholehearted members of a democratic society”61 without having to struggle with an inner conflict? Rawls approaches this question in the following manner: While insisting that arguments concerning questions of fundamental political justice must be formulated in terms of ‘public reason,’ he states that this demand is not (necessarily) at odds with claims of faith. Religious people may, as their political statements refer to the principles of ‘liberty’ and ‘equality,’ regard these principles, at the same time, as God-given commandments62. Rawls describes this possible congruence primarily with reference to JewishChristian conceptions but, in fact, includes other religions as well63 and suggests that, generally speaking, the manifold religious doctrines do agree on these two principles of justice. As is well known, he expresses the hope that there exists an “overlapping consensus”64 among teachings that otherwise _____________ 60 61 62 63 64 See, for instance, Hegel’s description of how churches tend to consider modern philosophy as their enemy: Hegel: Religion II, op. cit., p. 340; and Kant’s critical remarks on the “spiritual power” which can prohibit “even to think otherwise than it prescribes” (Kant: Religion within the Boundaries, op. cit., p. 136.). The way Kant presents this tension in The Conflict of the Faculties is analysed in: Reinhardt Brandt: Universität zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Kants ‘Streit der Fakultäten’, Berlin 2003, p. 109-118. Rawls: Public Reason Revisited, op. cit., p. 588. Ibid., p. 590. In a footnote (ibid., p. 590), Rawls refers to Abdullahi Ahmed An.Na’im: Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Syracuse 1990) as a case in point. For a definition of this term see: John Rawls: Justice as Fairness: Political not Metaphysical, in: Rawls: Collected Papers, op. cit., (p. 388-414), p. 390. Herta Nagl-Docekal 376 may be incongruous with one another. Significantly, Rawls stresses that this consensus must not be understood as a compromise (for which all parties involved have abandoned some elements of their conviction), but rather as being based upon shared convictions65. Unfortunately, we do not find in Rawls a consistent theoretical basis for these views. First of all we are confronted with a contradiction: As mentioned before, Rawls characterizes religion as being shaped by a specific mode of reason, suggesting that, consequently, different religious convictions are bound to be incapable of mutual understanding. This point of view is, I think, hardly compatible with the assumption of an ‘overlapping consensus’. But let us set aside this contradiction for a moment. We still face an open question: How could the assumed overlapping be accounted for? It seems unlikely that the consensus may be attributed to sheer chance – specifically, since Rawls maintains that the diverse religions do not vary in their overlapping with others, but do all agree on one and the same conception of ‘liberty and equality’. Obviously, Rawls draws upon an understanding of religion which implies that different doctrines share basic convictions. He fails, however, to explicitly spell out this conception. At this point, I think, the relevance for the current debate of Kant’s and Hegel’s reflections on religion becomes fully evident. Both authors explain why the diverse religious traditions do agree on basic moral conceptions. Also, as has been shown above, they both highlight the compatibility of religious doctrine with the modern state. It is important to note, however, that the focus here is on the idea of the modern state, and not on how to reconcile religious traditions with the states as they have been shaped in ‘our time’. Quite to the contrary, both Kant and Hegel expect the ‘thinking appropriation’ of religious doctrines which they are pleading for to open up a critical perspective on current conditions. For instance, with regard to the fact addressed by Hegel as well as by Habermas that a reductivist naturalistic view does, to a large extent, shape contemporary ways of life, the conception of human dignity which is anchored in religion does provide a viable basis for an alternative approach to the pressing issues of our lives. In more general terms, I think that the way in which Kant constructs the encounter between the ‘ethical commonwealth’ and the given states66 would deserve to be reexamined with great care today. In this context, it would also be important to _____________ 65 66 “Each comprehensive doctrine,” he explains, “from within its own point of view, is led to accept the public reasons of justice specified by justice as fairness”. (Rawls: Justice as Fairness, op. cit., p. 411) Kant: Religion within the Boundaries, op. cit., p. 106-110. For a brief exposé of this issue see: Herta Nagl-Docekal: Eine rettende Übersetzung? Jürgen Habermas interpretiert Kants Religionsphilosophie, in: Rudolf Langthaler / Herta Nagl-Docekal (eds.): Glauben und Wissen, op. cit., p. 93-119. Religious Diversity in Liberal Democracies 377 critically discuss Rawls’s reading of Kant’s conception of the ‘highest good,’67 as he tends to interpret this conception predominantly in terms of a political perspective on the future.68 _____________ 67 68 John Rawls: Lectures on the History of Moral Philosophy, Cambridge, Mass.- London 2000, chapter X Kant. An earlier version of this paper was read at the XXII. World Congress of Philosophy, Seoul 2008, and was published in the proceedings: Hans Lenk (ed.): Comparative and Intercultural Studies. Proceedings of the IIP Conference (Entretiens) Seoul 2008, Berlin 2009, p. 79-92. Eine pragmatische Definition der Religion Harald Wohlrapp Einleitung Religion hat gleichsam eine praktische und eine theoretische Seite. Auf der praktischen haben wir die jeweiligen Kulthandlungen, Beten, Feiern, Opfern, auf der theoretischen die Texte über das Heilige, die Götter, Gott. Wird allgemein gefragt, was Religion ist, dann setzt das Nachdenken gewöhnlich an der theoretischen Seite an: Dort haben wir mit Aussagen zu tun, die den sog. gesunden Menschenverstand überschreiten und deshalb einen „Glauben“ erfordern sollen. Eine (begriffliche oder philosophische) Bestimmung der Religion besteht dann oft darin, das Spezifische eines solchen Glaubens zu erfassen, etwa indem er ins Verhältnis zur alltäglichen Erfahrung, zum wissenschaftlichen Wissen und zur philosophischen Überlegung gesetzt wird. Werden jedoch die Inhalte des religiösen Glaubens in näheren Augenschein genommen, dann zeigt sich sogleich, dass „die Religion“ in verschiedenen Gestalten auftritt. Die Verschiedenheiten sind groß, so groß, dass es fraglich ist, ob sich überhaupt ein einheitlicher Begriff von Religion bilden lässt. Die Schwierigkeit ist ja nicht einfach die einer Abstraktion auf einen Oberbegriff, wie wenn man etwa zu klären hätte, in welchem Sinne der holsteinische Kohl und die japanischen Bambussprossen als „Gemüse“ anzusehen wären, sondern bei den Religionen reklamiert jede einzelne Spezies, dass sie den Begriff darstellt. Es ist als wenn ein Holsteiner Bauernkind den Weißkohl als „das Gemüse“ ansehen würde und z.B. Bambus und Fenchel nur mit einiger Skepsis als entfernte Verwandte dieses Gemüses zu akzeptieren bereit wäre. Verschärft wird das Problem dadurch, dass die verschiedenen Arten von Religion gar nicht nebeneinander, sondern über- und gegeneinander stehen, also sich in ihren Geltungsansprüchen nicht etwa ergänzen, sondern voneinander abgrenzen und widersprechen. Ich werde darauf im Text eingehen, aber erst relativ spät, wo es um den „Interreligiösen Dialog“ geht. Dort wird auch überlegt, weshalb die Religionen Gefahr laufen, zu dogmatischen Systemen zu erstarren – und wie dem evtl. abzuhelfen wäre. Um aber solche Probleme überhaupt richtig anzugehen, dazu müsste m.E. ganz anders angesetzt werden, nämlich nicht kognitivistisch, sondern Harald Wohlrapp 380 pragmatisch. Pragmatisches Denken wird gemeinhin als nutzenbezogenes oder machbarkeitsorientiertes Denken verstanden, doch das ist nur eine Schwundstufe des philosophischen Pragmatismus, wie er z.B. im Deutschen Idealismus (Kant, Hegel) vorgeprägt und von Marx, Nietzsche, Peirce, Dingler und anderen weiterentwickelt worden ist1. Für eine erste Annäherung mag vielleicht die Charakterisierung als „handlungsbezogenes Denken“ genügen. Wenn nun in dieser Weise die Religion bzw. die Religionen thematisiert werden, dann bedeutet das aber nicht, dass bei den speziellen Kulten und Riten angesetzt würde. Diese sind sekundär, sie setzen bloß die (kognitiven) Glaubensinhalte ins Handeln und Fühlen um. Vielmehr bedeutet ein pragmatisches Denken hier, die Religion als einen Bereich in den Blick zu nehmen, der im allgemeinen menschlichen Handeln, also der Bewältigung des Lebens in der Welt (auf der Erde) mit einer gewissen Notwendigkeit auftritt bzw. von Wichtigkeit ist. Ich möchte vorweg kurz skizzieren, was Sie erwartet. Der Aufsatz hat drei Teile. Im ersten Teil wird das „Grundvertrauen“ als pragmatische Grundlage des Selbstbewusstseins definiert. Dieses ist die Substanz sowohl des religiösen Glaubens als auch des säkularen Selbstvertrauens, welches die Religion seit der Aufklärung ersetzt haben soll. Diese Basis ist und bleibt fragil. Deshalb bedarf sie der Stabilisierung und Kultivierung, die heute auf zwei großen Wegen betrieben wird. Zum einen säkular (Wissenschaften, Vergrößerung der Handlungskompetenz), zum anderen religiös. In der religiösen Kultivierungsbahn lassen sich zwei Spuren ausmachen. Die eine ist die „Intensivierung“, das wird traditionell „Mystik“ genannt. Die andere ist die „Institutionalisierung“, ihr Ergebnis sind die verfassten Religionsgemeinschaften („Kirchen“). Diese beiden Spuren, ihr Glanz und ihr Elend sind die Gegenstände des zweiten und dritten Teils meines Aufsatzes. Am Ende gibt es als „Ausblick“ einen kleinen Hinweis unter dem Titel „Distanzierung“ – und der _____________ 1 „Pragmatismus“ ist z. Zt. keine wirklich aussagekräftige Bezeichnung in der Philosophie. Es steht uns noch bevor, eine Denkweise zu entwickeln, die sich nicht äußerlich und instrumentalistisch, sondern reflexiv auf das menschliche Handeln bezieht – und zwar auf das Handeln als ganzes, nicht bloß als sprachliches. Was heute in der nordamerikanischen Philosophie „pragmatisch“ heißt (z.B. Davidson, Putnam, Quine, Rorty), das bleibt meistens noch hinter dem Denken des Protagonisten Peirce zurück, dessen Pragmatismus selber vieldeutig war und getrübt von ontologischen Vorurteilen. Für Ansätze zu einem umfassenden, wissenschaftlich und philosophisch einschlägigen Pragmatismus vgl. Janich: Kultur und Methode, Frankfurt a. M. 2004, StekelerWeithofer: Wer ist Herr, wer ist Knecht? Der Kampf zwischen Denken und Handeln als Grundform des Selbstbewusstseins, in: Vieweg / Welsch (eds.): Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein kooperativer Kommentar zu einem Schlüsselwrk der Moderne, Frankfurt a. M. 2008, und Wohlrapp: Der Begriff des Arguments. Über die Beziehungen zwischen Wissen, Forschen, Glauben, Subjektivität und Vernunft, 2. Aufl., Würzburg 2009, dort Kap. 1.1. bis 1.3. Eine pragmatische Definition der Religion 381 enthält die eigentliche, bzw. m.E. unbedingt vertretbare Aussage zu dem, was das Wesen der Religion ausmacht. Teil 1: Grundvertrauen als pragmatische Basis des Selbstbewusstseins Die These des ersten Teils besagt, dass sich, was Religion ist, bestimmen lässt, wenn über die Grundlagen der Subjektivität nachgedacht wird, genauer: wenn geklärt wird, wie das Selbstbewusstsein bzw. das „Selbstverhältnis“ zustande kommt und wie es stabilisiert werden kann. 1.1. Drei Stufen des Gelingens im Handeln: Zweck, Wert, Sinn Wie gesagt soll die Bestimmung der Religion beim Handeln im Sinne der allgemeinen Weltbewältigung ansetzen. Ohne mich nun in die weitläufigen Diskussionen über den Handlungsbegriff zu werfen, möchte ich darauf hinweisen, dass „Handeln“ zur Grundbedingung des Menschen gehört2. Handeln unterscheidet sich von bloßem Verhalten dadurch, dass es eine Ausrichtung aufs Gelingen hat. Wenn wir also (in dieser verschärften Bedeutung) „handeln“, dann tun wir nicht nur irgendetwas, sondern wir bemühen uns darum, es „richtig“ zu tun. Solches Bemühen ist nicht etwa nur ausnahmsweise erfolgreich, sondern dass wir Menschen etwas können (Flugzeuge fliegen wirklich, Meldeämter stellen wirklich Pässe aus, Computer können wirklich Daten verarbeiten), das zeigt, dass Handeln nicht ewiges Ausprobieren von Hypothesen ist, die evtl. an der nächsten Ecke falsifiziert werden. Im Nachdenken darüber, worin die Richtigkeit des Handelns bestehen kann, lassen sich drei Stufen unterscheiden: Zweck, Wert, Sinn3. (a) Erstens besteht Richtigkeit darin, dass ein anvisierter Zweck erreicht wird. Das ist klar und wichtig, aber es genügt nicht. Das Handeln selber ist hier ja leer, es ist bloßes Mittel zu etwas anderem, jenseits der Handlung Liegenden, eben dem Zweck. Wer nur Zwecke verfolgt, lebt eigentlich gar nicht. Zweckrationalität ist höchstens der Anfang der Vernunft. _____________ 2 3 Vgl. Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Berlin 1940. Wir können Gehlen mit seiner Grundauffassung vom „handelnden“ Menschen Recht geben, ohne seine Voraussetzung zu teilen, dieses Handeln sei dadurch provoziert, dass der Mensch „Mängelwesen“ ist. Diese Unterscheidungen sind im freien Anschluss an Max Weber konzipiert, vgl. Weber: Soziologische Kategorienlehre, in: ders.: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Neu Isenburg 2005, Kap I, II, §2. 382 Harald Wohlrapp (b) Zweitens besteht die Richtigkeit des Handelns darin, dass es uns erfüllt und befriedigt (das muss nicht „Spaß“ sein, kann aber). Dies möchte ich den „Wert“ des Handelns nennen. Bei interaktiven Praxen gehört dazu, dass die Gruppe, Gemeinschaft, Gesellschaft durch „wertvolles“ Handeln halbwegs gedeihlich zusammenlebt. Ist also das Handeln nicht vereinzeltes, isoliertes Tun, dann betrifft die Stufe des Wertes alles, was sonst als Moral und Ethik diskutiert wird. (c) In der ersten Stufe gelingt also das Handeln im Hinblick auf die äußere, beeinflussbare Welt, in der zweiten im Hinblick auf den Innenraum der psychischen und sozialen Verhältnisse. Es ist noch eine dritte Stufe anzusetzen. Hier geht es um das Gelingen „im Ganzen“. Der Ausdruck „das Ganze“ ist nur ein Behelf, um anzudeuten, dass das Handeln gewöhnlich in den Grenzen einer bestimmten Situation beurteilt wird. Wird nach dem „Sinn“ eines Handelns gefragt, dann können wir das so verstehen, dass diese situativen Grenzen überschritten werden sollen. Betrachten wir ein ganz schlichtes Beispiel, das Überqueren einer Straße. Zweck ist, auf die andere Seite zu kommen, vielleicht habe ich dort gerade jemanden gesehen, den ich begrüßen will. Die Wertseite würde mich auf die Handlung selber fokussieren. Es würde darum gehen, nicht blind loszurennen, sondern schön aufzupassen, auch die STVO zu beachten usw. Die Sinnebene käme in den Blick durch eine Frage der Art: Was tue ich hier „eigentlich“ – ich als endliches Wesen? Würde ich das auch tun, wenn ich es vom Ende meines Lebens her betrachte? Dabei wäre also „das Ganze“ als das Ganze meines Lebens angesetzt und ich als Urteilsinstanz. Das könnte aber auch noch erweitert werden: ich könnte mein Leben als Teil des Lebens meines Volkes oder der Menschheit ansehen, als Teil des Laufs der Welt. Und ich könnte erweiterte Urteilsinstanzen ansetzen: unsere Nachkommen, die Geschichte. Offenbar gibt es aber in diesem Augenblick (wo die Frage da ist) keine regelrechten Beurteilungen zu dieser „letzten“ Richtigkeit. Und das ist eben Eigenart der Sinnfrage: Wir haben ein Bedürfnis nach Sinn, d.h. nach einer höheren oder weitergehenden Richtigkeit dessen, was wir treiben und ausrichten, obwohl zugleich klar ist, dass wir eine solche nicht besorgen können. Genau genommen können wir nicht einmal sagen, was „Richtigkeit“ im Hinblick auf „das Ganze“ bedeutet. Wir haben nur gleichsam begriffliche Anfänge dazu: Wahrheit, Schönheit, Geordnetheit, Geborgenheit, Liebe, und wir können versuchen, diese ein bisschen weiterzudenken – über das hinaus, was wir bislang davon verstehen. Eine pragmatische Definition der Religion 383 1.2. Das Grundvertrauen Das angesprochene Bedürfnis wird virulent, wenn der Sinn fehlt. Das Fehlen kann ins Bewusstsein treten, wenn das Handeln in den ersten beiden Ebenen dramatisch scheitert, also etwa grundlegende Ziele verfehlt werden, eigentliche Befriedigung ausbleibt, Moral hohl wird. Derartiges Scheitern kann durch äußere Widerfahrnisse ausgelöst sein, aber u.U. auch in einem äußerlich glanzvollen und erfolgreichen Leben empfunden werden. Wenn jedoch der Sinn nicht fehlt, dann haben wir, was ich das „Grundvertrauen“ nenne. Es ist eine tiefe Zuversicht, dass das, was geschieht und auch das, was ich selber darin anrichte, „in Ordnung“ ist – wenn auch, wie gesagt, in einer Ordnung, die meinen aktuellen Überblick übersteigt. Das Grundvertrauen hat eine emotionale und eine kognitive Komponente. Emotional ist es eine Gefühlsbasis mit Qualitäten wie Ruhe, Sicherheit, Offenheit, Heiterkeit. Kognitiv ist es das Herstellen eines Bezugs zum „Ganzen“, bzw. eines Bereichs jenseits der Grenzen der jeweiligen Situation mit ihren Zielen und Kontrollmöglichkeiten. Wie können Menschen ein solches Grundvertrauen haben und bewahren? In der Regel dadurch, dass in der kognitiven Schicht irgendwelche Kräfte oder Mächte anvisiert werden, deren Potenz für jene weitergehende Richtigkeit bürgt: Der Clan, der König, die Volksgemeinschaft, ein hohes, göttliches Lebewesen (Krokodil, Affe, Elefant), die Gemeinschaft der Heiligen, die Heerscharen der Boddhisattvas, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wenn sich das Grundvertrauen beim Handeln und Leben auf eine solche Weise konkretisiert hat (d.h. wenn die kognitive Schicht mit irgendeiner Instanz ausgefüllt ist, die Sicherheit bietet), dann nenne ich es einen „Glauben“. Dieser pragmatische Begriff des Glaubens bezeichnet also primär nicht ein Fürwahrhalten, sondern primär geht es um eine Zuversicht im Handeln, die erst sekundär mit doxastischen oder fiduzialen Inhalten überhöht ist. Das Grundvertrauen ist die Basis des Selbstbewusstseins. Es ist das, was uns trägt, wenn die Handlungen in der Zweck- und/ oder Wertebene danebengehen, wenn wir von Unglück, Krankheit, Todesfurcht gebeutelt werden oder von Taten erfahren, die zum Himmel schreien. Zugleich ist klar, dass das Grundvertrauen durch eben solche