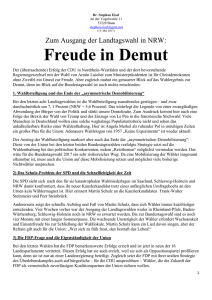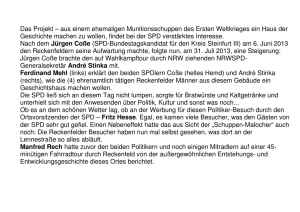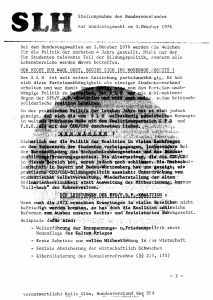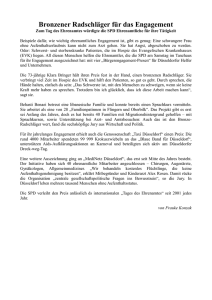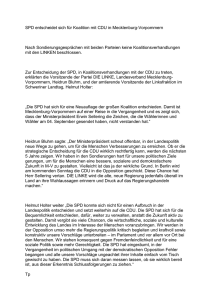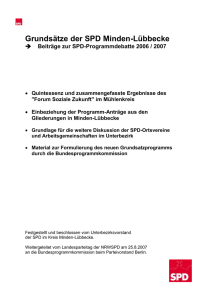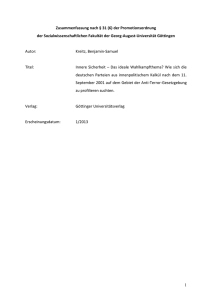Auf der Suche nach Mehrheiten? - Forschungsjournal Soziale
Werbung

88 | Strategieschwerpunkt Auf der Suche nach Mehrheiten? Anmerkungen zur Lage der SPD ein Jahr vor der Bundestagswahl 2013 Gerd Mielke Ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl werden allmählich die Konstellationen sichtbar, auf die sich die Parteien im kommenden Wahlkampf werden einstellen müssen. Dabei prägen Widersprüchlichkeiten das Bild. Auf der einen Seite ist es zu einem förmlichen Zusammenbruch der 2009 noch so imposanten Regierungsmehrheit gekommen. Schon seit dem Sommer 2010 ist die schwarzgelbe Koalition in allen Umfragen auf knappe 40 Prozent abgeschmolzen. Alle Landtagswahlen seit 2009 erbrachten für SchwarzGelb herbe Niederlagen. Die vor wenigen Jahren noch so imposante Riege christdemokratischer Landesfürsten dünnte dramatisch aus; christdemokratische Ministerpräsidenten sind nur noch dort im Amt, wo sie sich auf die Hilfe der SPD in Großen Koalitionen stützen können. Auf der anderen Seite hat die Schwäche von Angela Merkels Regierungsbündnis bisher noch keine Wechselstimmung aufkommen lassen. Zwar zeichnet sich seit längerem in den Umfragen eine stabile Mehrheit von rund 60 Prozent der Wähler ab, die sich für eher linke Parteien entscheiden und also SPD, Grüne, Linke oder die Piraten wählen, aber die SPD als größte Oppositionspartei konnte bislang aus dieser Mehrheit keine handlungsfähige politische Mehrheit gegen Schwarz-Gelb schmieden. Wie die Union haben sich auch die Sozialdemokraten noch nicht von ihrem verheerenden Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl erholt; nur selten kamen sie seither an die 30-Prozent-Marke heran. Die SPD hat zwar bei den Landtagswahlen seit 2009 kontinuFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 3 | 2012 ierlich Boden gut gemacht und eine ganze Reihe von Staatskanzleien zurückerobert. Allerdings lassen diese sozialdemokratischen Siege bislang noch keine Erfolg versprechende Strategie für einen Sieg und für einen Politikwechsel bei der anstehenden Bundestagswahl erkennen. Die absolute Mehrheit in Hamburg, die rot-grünen Mehrheiten in Bremen, Mainz und Düsseldorf, die Großen Koalitionen in Schwerin und Berlin oder gar das rot-grüne Bündnis mit dem SSW in Kiel folgen jeweils unterschiedlichen landespolitischen (Koalitions-)Logiken, die nur mit erheblichen Abstrichen auf die Bundesebene übertragen werden können. Was muss also geschehen? Drei Fragen sind zu klären: In welche Konfliktstruktur wird auch die Bundestagswahl 2013 eingelagert sein? Wie lässt sich Wählerschaft auf der linken Hälfte des Parteienspektrums mobilisieren? Und schließlich drittens: Welche Mehrheit will die SPD ansteuern? 1 Bei der Darstellung tagespolitischer Streitfragen wird fast immer ausgeblendet, dass dem deutschen Parteienwettbewerb eine erstaunlich stabile Konfliktstruktur unterliegt. Die Kompetenzprofile der Parteien, vor allem aber die Erwartungen der Wählerschaft sind auf zwei elementare Gegensätze hin ausgerichtet, die seit vielen Jahrzehnten ein Koordinatensystem bilden, in dem sich die Wähler sehr genau zurechtfinden. Das ist zum einen der beherrschende, sozio-ökonomische Gegensatz zwischen Marktfreiheit und Wohlfahrtsstaatlichkeit, zum andern der Auf der Suche nach Mehrheiten? etwas schwächer ausgeprägte, kulturelle Gegensatz zwischen einer libertären, der Moderne zugewandten und einer traditionellen bzw. autoritären Geisteshaltung. Diesen beiden Konfliktachsen lassen sich fast alle tagespolitischen Streitfragen zuordnen, und die Wähler interpretieren sie auch vor diesem Hintergrund. Die historisch gewachsenen Spannungslinien werden auf diese Weise bis in die Gegenwart hinein – so nennt es die Wahl- und Parteienforschung – aktualisiert (dazu Mielke 2001). Die Parteien haben ihr Profil im Blick auf diese beiden Konfliktachsen gewonnen. Bei dem Gegensatz zwischen Marktfreiheit und Wohlfahrtsstaatlichkeit werden die beiden extremen Positionen von der FDP und der Linken eingenommen; Union und SPD liegen dazwischen, sie sind aber dennoch jeweils deutlich dem marktliberalen oder dem wohlfahrtsstaatlich ausgerichteten Lager zuzuordnen. Auf der kulturellen Konfliktachse stehen sich an den Extremen die Union und die Grünen gegenüber, die SPD, die Linke und die FDP nehmen hier eher gemäßigte Positionen ein. Auch die Piraten werden übrigens ganz klar vor diesem Hintergrund wahrgenommen. Mit ihren Forderungen nach umfassender Transparenz und Teilhabe knüpfen sie an ein Leitmotiv an, das auch die Grünen in den ersten Jahren ihres Aufstiegs unter dem Stichwort der „Basisdemokratie“ ins Spiel brachten. Die Konflikte um den Umbau des deutschen Wohlfahrtsstaats, die in den Kontroversen um Hartz IV oder die Gesundheitsreformen zum Ausdruck kommen, bilden mithin im Kern eine stärkere Annäherung der SPD vom Pol der staatlich abgesicherten und garantierten Wohlfahrtsstaatlichkeit an den Pol der Marktfreiheit ab. Die Debatten um die Integration der Zuwanderer oder um ein verändertes Frauen- und Familienbild drehen sich auf der anderen Konfliktachse um eine eventuelle Annäherung der Unionsparteien an den libertären, auf die Moderne ausgerichteten Pol. Ganz offensichtlich haben sowohl die SPD unter Gerhard Schröder, Franz Müntefering | 89 und ihren Nachfolgern an der Parteispitze als auch die Union unter Angela Merkel und ihrer Führungsriege die Probleme unterschätzt, die sich bei den Positionsverschiebungen ihrer Parteien in diesem politischen Koordinatensystem ergeben würden. Was den Führungseliten von SPD und Union als plausible oder „alternativlose“ Reformpolitiken erschien, wurde von weiten Teilen der Anhängerschaft als Preisgabe von Traditionsbeständen und als Identitätsverlust empfunden und löste Entfremdung und Stimmenverluste aus. So büßte die SPD ihre noch 1998 so großartige Position im Parteiensystem Zug um Zug ein und wurde am Ende durch den Aufstieg der Linken und die Schlappe bei der Bundestagswahl 2009 bestraft. Die Union durchläuft diesen Prozess eines durch „Reformen“ ausgelösten Niedergangs seit Merkels Kanzlerschaft; ein Ende ist noch nicht abzusehen. Eine Renaissance der SPD setzt eine zumindest teilweise und vor allem auch in der Wählerschaft erkennbare Korrektur der „Reformen“ voraus. Auf diese Weise könnte die SPD die Schrammen an ihrem Markenkern einer staatlich garantierten Politik der sozialen Gerechtigkeit wenigstens in Ansätzen ausbessern. Es käme also für die SPD darauf an, ihre Hegemonie als Partei der Wohlfahrtsstaatlichkeit zurückzuerobern und wieder zum verlässlichen Bezugspunkt der Wähler zu werden. Hierfür wäre eine gezielte Akzentuierung des Verteilungs- und Wohlfahrtsstaatskonflikts notwendig, allein auch schon um zu verhindern, dass Nebenkriegsschauplätze und nachrangige Konflikte, wie die im diskursiven Umfeld der Piraten, die politische Arena beherrschen. Eine derartige Kurskorrektur ist jedoch ein schwieriges Manöver; allein auf die Schwäche von Schwarz-Gelb zu hoffen, wird für eine Kompensation der Verluste während des letzten Jahrzehnts nicht ausreichen. Die Wählerwanderungsbilanzen bei den letzten Landtagswahlen zeigen, dass selbst angesichts der massiven Ansehensverluste der Linken in den letzten beiden Jahren nur ein Teil FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 3 | 2012 90 | der dorthin abgewanderten Wähler wieder zur SPD zurückkehrt. Die Mehrheit bleibt auf Distanz und verharrt in skeptischer Wahlenthaltung. Ein wesentlicher Grund für die schleppende Erholung der Sozialdemokraten liegt in den unklaren Signalen, die von dem derzeitigen SPD-Führungstrio ausgehen. Während der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel zumindest um eine rhetorische Mobilisierung gegen das Regierungslager bemüht ist, halten sich Peer Steinbrück und Frank-Walter Steinmeier nobel zurück. Beide sind Exponenten der „Reformpolitik“ der Schröder-Jahre; und sie verkörpern den während der Großen Koalition an der SPDSpitze etablierten Konsens mit der Merkel-Linie eines durch vermeintliche Sachzwänge getarnten Neo-Liberalismus. Eine auch nur symbolische Distanzierung von Hartz IV und der Agenda-Politik und damit ein Startsignal für eine breite und gezielte linke Bündelung gegen den Politikansatz von Schwarz-Gelb, also für eine Strategie, die Francois Hollande und seine Sozialisten in Frankreich mit Erfolg umgesetzt haben, ist von Steinbrück und Steinmeier eher nicht zu erwarten, käme diese Distanzierung doch immer auch einer Selbstkritik gleich. So verfügt die SPD derzeit nur sehr bedingt über eine Parteiführung, mit der sie die Unzufriedenheit der Mehrheit von Wählergruppen mobilisieren und bündeln könnte. Sie steht also vor einem Dilemma: Einerseits hängen die Mobilisierungschancen entscheidend von einer Profilierung auf dem Themenfeld staatlich gestützter sozialer Gerechtigkeit ab, andrerseits gibt es in dem Führungstrio gegen eben diese politische Linie erhebliche Vorbehalte. Die Aufhebung dieser Mobilisierungsblockade wird zudem durch das Sperrfeuer der geballten Medien-Artillerie verhindert. Eine Phalanx konservativer und liberaler Leitartikler wacht über die Fortführung der „Reformpolitik“ der Schröder-Jahre und gibt entsprechend Steinbrück und Steinmeier medialen Feuerschutz. Hier findet – übrigens auch diesmal in konsequentem Gegensatz zu der großen Mehrheit in der Bevölkerung – die beFORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 3 | 2012 Gerd Mielke geisterte mediale Zustimmung für die „Reformen“ Gerhard Schröders, durch welche die Sozialdemokraten am Wählermarkt so schwer in Bedrängnis gerieten, ihre ungebremste Fortsetzung (dazu auch Spreng 2010). 2 Auch bei der kommenden Bundestagswahl wird wohl die „asymmetrische Demobilisierung“ eine wichtige Rolle im Wahlkampf spielen. Mit diesem Stichwort wurde 2009 die Wahlkampfstrategie Angela Merkels und der Union beschrieben, die jede Polarisierung und Konfrontation vermied und so „auf Samtpfoten an die Macht“ gelangte. Dahinter verbirgt sich ein in der Wahlforschung seit langem bekannter, in den letzten Jahren allerdings zu neuer Bedeutung gelangter Sachverhalt. Wahlen können immer auch durch Wahlbeteiligungsunterschiede in der Wählerschaft entschieden werden, weil die Wahlbeteiligung nicht zufällig über die einzelnen Wählersegmente streut, sondern in den unterschiedlichen Parteianhängerschaften großen, mit dem Sozialstatus verbundenen Schwankungen unterliegt. Viele Studien zeigen: Wahlbeteiligung (hierzu v.a. Steinbrecher/Rattinger 2011) hängt in hohem Maß vom persönlichen Interesse und der Informiertheit sowie von dem Gefühl der Wähler ab, dass Parteien und Politiker auf die Einflussversuche durch die Bürger reagieren. Diese individuellen Gefühle für politische Wirksamkeit sind wiederum stark von Faktoren wie formaler Bildung und Sozialstatus abhängig; deshalb gehen Wähler mit formal höherer Bildung und entsprechend höherem Sozialstatus in der Regel eher zur Wahl als Wähler aus der unteren Hälfte der Statuspyramide. Verlaufen also Wahlkämpfe eher lautlos und schleppend, ohne Polarisierung und Mobilisierung, geht es also vermeintlich „um nichts“, so sinkt die Wahlbeteiligung ab, und es profitieren davon in aller Regel die Parteien, deren Anhänger den Schichten mit höherer Bildung und höherem Sozialstatus zuzurechnen sind. Dies erklärt Auf der Suche nach Mehrheiten? im eigentlichen Wortsinne die Statusvorteile bürgerlicher Parteien etwa bei Kommunal-, Landtags- oder Europawahlen: Ihre Wähler gehen – fast – immer zur Wahl. Aus dieser Regel folgt auch, dass Parteien mit einer großen Anhängerschaft in der unteren Hälfte der Statuspyramide – also auch die SPD – in Wahlkämpfen besonders stark auf Polarisierungs- und Mobilisierungsstrategien angewiesen sind, um ihr Wählerpotential auch tatsächlich an die Urnen zu bringen. Mithin führt mangelnde Polarisierung zu der besagten „asymmetrischen Demobilisierung“. 3 Hatte 2009 ganz offensichtlich die Union diese Strategie der „asymmetrischen Demobilisierung“ gezielt eingesetzt, so drohen für die SPD im kommenden Bundestagswahlkampf die Gefahren einer unfreiwilligen Demobilisierung der eigenen Anhängerschaft vor allem durch die koalitionspolitischen Perspektiven. Hier befindet sich die SPD in einer misslichen Lage; denn aus dem Spektrum von insgesamt vier linken Parteien – SPD, Linke, Grüne und Piraten – hat sie allein die politische Zusammenarbeit mit den Grünen ins Auge gefasst. Die beiden anderen werden als politische Partner nicht in Betracht gezogen. Damit scheidet nach den letzten Umfragen ein Stimmenanteil von circa 1215 Prozent der Wähler aus den sozialdemokratischen Koalitionsüberlegungen gegen Schwarz-Gelb aus. Mit anderen Worten: Eventuelle Fehlschläge, die zu anderen linken Parteien gewanderten Wähler direkt zurück zu gewinnen, können nicht über Koalitionen kompensiert werden. Allerdings ist eine rot-grüne Mehrheit nach den demoskopischen Befunden des letzten Jahres nicht sehr wahrscheinlich; die Piraten haben hier eine neue Vetomacht erlangt. Ent- | 91 sprechend werden nun andere, über die Lagergrenzen hinweg reichende Bündnisse ventiliert: eine erneute Große Koalition oder eine so genannte „Ampel-Koalition“ mit den Grünen und der FDP. Beide Koalitionsvarianten haben freilich ihre Tücken. Das innerparteiliche Trauma der letzten Großen Koalition mit ihrem bitteren Ende der schlimmen Wahlniederlage wirkt bei den Sozialdemokraten noch nach; die Aussicht auf vier weitere Jahre als Juniorpartner Angela Merkels wird die Wahlkampfmoral gewiss nicht befeuern. Aber auch die „Ampel“ ist derzeit kein reizvolles Modell, selbst wenn die Liberalen die Fünf-Prozent-Hürde überspringen sollten, was durchaus fraglich erscheint. Die FDP ist mit ihrer Ausrichtung marktradikalen Zuschnitts seit dreißig Jahren der ideologische Gegenpol schlechthin zur SPD, und entsprechend ist die Ausstrahlungskraft dieser Koalitionsperspektive gering. Ein Jahr vor der Bundestagswahl herrscht also eine gewisse Unübersichtlichkeit. Wie will die SPD sich in die Konfliktstruktur des deutschen Parteiensystems einordnen? Wie kann sie der Gefahr der Demobilisierung ihrer Anhänger entgegenwirken? Und wie kann sie verhindern, dass unklare Mehrheits- und Koalitionsperspektiven die Siegeszuversicht dämpfen? Fest steht jedenfalls: Die große gesellschaftliche Mehrheit jenseits von Schwarz-Gelb will sich bislang nicht in eine handlungsfähige politische Mehrheit unter SPD-Führung schmieden lassen. Es steht den Sozialdemokraten noch ein hartes Jahr bevor; man muss sich etwas einfallen lassen. Gerd Mielke ist Professor am Institut für Politikwissenschaft der Johannes GutenbergUniversität Mainz. Kontakt: mielke@politik. uni-mainz.de FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 25. Jg. 3 | 2012