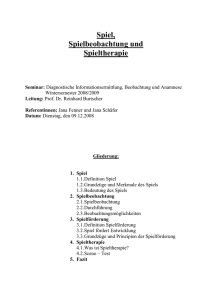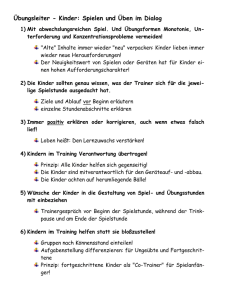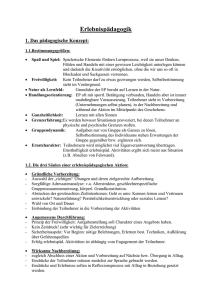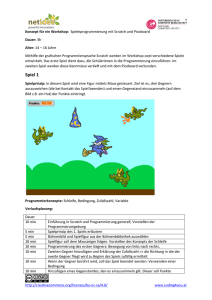77603 Schäfer_Spiel S. 001_187.indd
Werbung
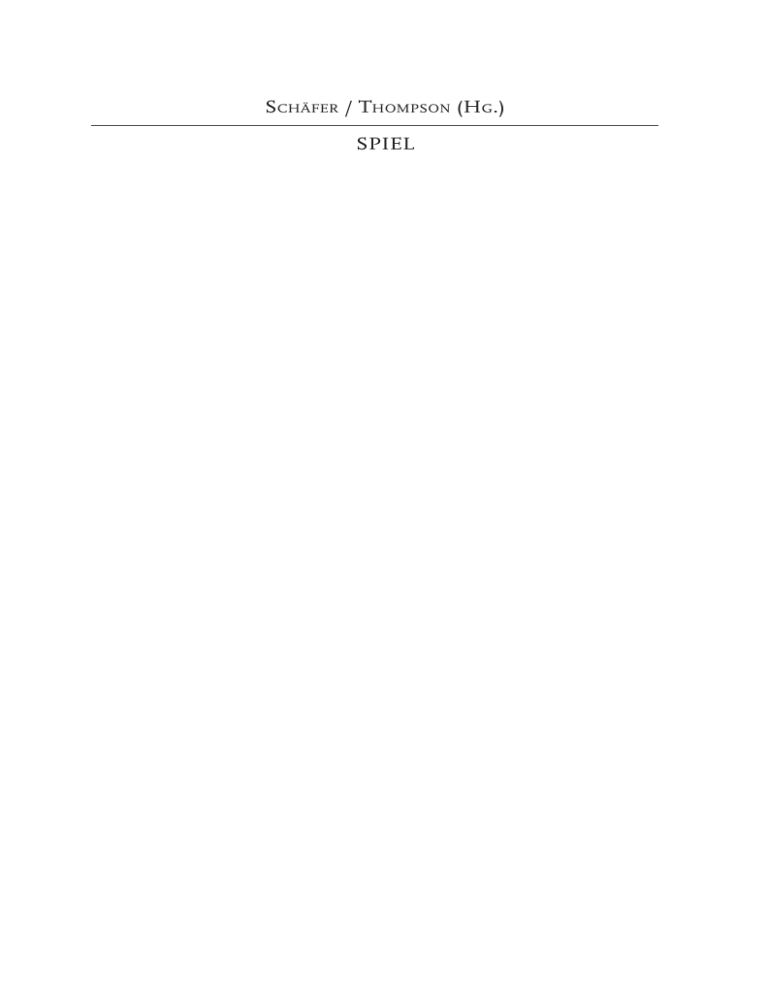
SCHÄFER / THOMPSON (HG.) SPIEL Pädagogik – Perspektiven FERDINAND SCHÖNINGH ALFRED SCHÄFER / CHRISTIANE THOMPSON (HG.) SPIEL FERDINAND SCHÖNINGH Umschlagabbildung: Pieter Bruegel der Ältere, „Die Kinderspiele“ (1560, Bildausschnitt) Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Umschlaggestaltung: Anna Braungart, Tübingen Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem und alterungsbeständigem Papier 嘷 ∞ ISO 9706 © 2014 Ferdinand Schöningh, Paderborn (Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn) Internet: www.schoeningh.de Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages nicht zulässig. Printed in Germany. Herstellung: Ferdinand Schöningh, Paderborn ISBN 978-3-506-77603-7 Inhaltsverzeichnis Spiel – eine Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfred Schäfer, Christiane Thompson 7 I. Das Spiel als ‚unwirkliche Wirklichkeit‘ . . . . . . . . . . . . . II. Vom Kult zur ‚Versöhnung im schönen Schein‘ . . . . . . III. Zur Entgrenzung des Spielerischen in der fortgeschrittenen Moderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zu den Beiträgen dieses Bandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 17 Sich verausgabende Spieler und andere vereinnahmende Falschspieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Das Spiel zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit in ästhetischen Lebensformen Gabriele Weiß I. Das Spielfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Spielende Figuren: Spieler und Spielverderber . . . . . . . III. Der Falschspieler zwischen Spieler und Spielverderber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Entgrenzte Grenze – das Leben als Spiel . . . . . . . . . . . . V. Im Spiel der Möglichkeiten ohne Verwirklichung . . . . VI. Spielverderber, Falschspieler und Spieler im Unterricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunst und Spiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Der Übermensch und das spielende Kind Carl-Peter Buschkühle I. II. III. IV. V. Kultur des Spektakels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunst auf dem Weg zur Oberfläche . . . . . . . . . . . . . . . . Kunst und andere Spiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Das Spiel der Kunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Das Spiel des Künstlers und das künstlerische Denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 28 35 35 41 45 47 53 57 63 66 69 76 79 83 6 INHALTSVERZEICHNIS VI. Polares Wechselspiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Kunst und Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Spielerisches Lernen im künstlerischen Projekt . . . . . . 85 86 88 Rituale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spiel, Mimesis, Performativität Christoph Wulf 99 I. II. III. IV. V. VI. VII. Spiel und Ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rituale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historische Perspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rituale in der gegenwärtigen Gesellschaft . . . . . . . . . . . Die Berliner Ritual- und Gestenstudie . . . . . . . . . . . . . . Rituale als performative Handlungen . . . . . . . . . . . . . . . Mimetisches Lernen praktischen Wissens in Ritualen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Zentrale Funktionen von Ritualen . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 103 104 105 107 111 115 118 124 Die Ludifizierung des Sozialen durch Digitale Räume . . . . . . 129 Jens Holze, Dan Verständig I. II. III. IV. V. Einleitendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Der Spielbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Das Spiel in der Moderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spiel – analog und digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 130 138 145 153 Kultur – Spiel – Subjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Zur Konstitution von Kultur in und als Spiel Steffen Wittig I. Die formalen Kennzeichen des Spiels . . . . . . . . . . . . . . 159 II. Der „heilige Ernst“ des Spiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 III. Kultur als Spiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Autorinnen und Autoren des Bandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Spiel – eine Einleitung ALFRED SCHÄFER | CHRISTIANE THOMPSON Im Herbst 1996 erlangte ein neues Elektronikspielzeug unvorhergesehene und weltweite Popularität: das so genannte „Tamagotchi“, ein „virtuelles Küken“, das nach dem Schlüpfen der Hege und Pflege seines Besitzers bzw. seiner Besitzerin bedarf. Das Tamagotchi ist ein Spielzeug mit den Eigenschaften von Lebewesen. Es zeigt Bedürfnisse wie Hunger und Durst, es verlangt nach Zuwendung und entwickelt eine „eigene Persönlichkeit“. Sollten die Bedürfnisse des Kükens nicht befriedigt werden, „stirbt“ es. Mit der Reset-Taste wird ein „neues“ Küken „geboren“ und das Spiel kann von vorn beginnen. Ein Spieltag entspricht einem Lebensjahr des Tamagotchi. Ursprünglich von einer japanischen Spielzeugfirma für die Zielgruppe der Kinder – und insbesondere der Mädchen – ab 8 Jahren entwickelt, entgrenzte sich sehr schnell die Gruppe der Spielenden: Das digitale Ei mobilisierte die umfassendste Spielergruppe von „499 Jahren“ und das obwohl das Spiel einen hohen und unkontrollierbaren Zeiteinsatz erforderte. Das Neue am Tamagotchi war die Entgrenzung des Spielzeitraums, da sich das Spiel in der Echtzeit des Lebens seiner Besitzer und Besitzerinnen vollzieht. Mit einem Tamagotchi piept es an allen erdenklichen Orten: Am Arbeitsplatz und zu Hause, in Schulen und Kindergärten waren die Spielenden gefordert, ihr Tamagotchi medizinisch zu versorgen, es zu disziplinieren oder seine „Häufchen“ zu entfernen. Am Beispiel des Tamagotchi lassen sich sehr gut die Diskussionen nachvollziehen, welche um die Bedeutung des Spiels in gegenwärtigen Gesellschaften und damit auch um ihre pädagogische Bedeutung geführt werden. Spielen und insbesondere digitalen Spielen wird nachgesagt, dass sie die Gefahr eines Wirklichkeitsverlusts mit sich bringen. Solche Vorwürfe wurden in Bezug auf die Tamagotchis wiederholt artikuliert: Die Spielenden würden immer mehr aus den realen Lebenvollzügen herausgelöst und damit letztlich unfähig zu sozialen Kontakten. Die Gefahr einer gestörten sozialen Entwicklung 8 ALFRED SCHÄFER | CHRISTIANE THOMPSON von Kindern und Jugendlichen brachte der Kölner Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Ulrich Schmitz so auf den Punkt: „Für die Kinder selbst, je jünger sie sind, führt der Besitz eines Tamagotchi zu einem viel zu frühen Abschied von Hoffnungen, Träumen, Mythen, Sagen und Legenden, die durch den Einsatz kalter Technik abgelöst werden.“1 In dieser Äußerung wird das Tamagotchi als Zerstörer jenes Schonraums verstanden, auf den eine romantisch verstandene Kindheit gegenüber einer entzauberten und technisierten Gesellschaft angewiesen ist. Egal nun ob die simulierte digitale Welt des Tamagotchi als Zeichen der heutigen Zeit oder ob diese als Gegensatz zur wirklichen Welt konzipiert wird: Immer geht es bei den hier artikulierten Befürchtungen um die Gefahr, ein angemessenes Verhältnis zur Realität zu verlieren und sich in einer „Scheinwelt“ einzurichten. Das Verhältnis von Spiel und Gesellschaft wird aber auch so artikuliert, dass das Spiel eine ergänzende oder kompensatorische und also positive Funktion erfüllt. So wird im Spiel eine Vorbereitung auf das eigentliche Leben gesehen. Das Tamagotchi zum Beispiel ermögliche Kindern zu lernen, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen.2 Ein anderes Motiv kann das der Erholung oder der Kompensation gegenüber dem harten (schulischen) Alltag sein. Möglicherweise trägt ja der Einsatz von Spielen (in und außerhalb des Unterrichts) dazu bei, dass Schüler und Schülerinnen motivierter oder auch effektiver lernen? Artikuliert wird auch die Vermutung, dass sich Kindern und Jugendlichen aufgrund der Affektion und Involviertheit in Spielen eher die Bedeutsamkeit von Gelerntem als etwas erschließt, das für sie selbst wichtig ist. Spiele erscheinen demnach als didaktisches Instrument oder gar als Form des Pädagogischen. Dass es sich beim Spiel um ein eminente „Form“ des Pädagogischen handelt, ist häufig im Kontext der Kindheit und frühen Kindheit geäußert worden. Friedrich Fröbel, auf den Praxis und Selbstverständnis der „Kindergärten“ zurückgehen, sah im Spiel jene Lernform, welche die Kindheit auszeichnet: „Spielen, Spiel ist die höchste Stufe der Kindesentwicklung, der Menschenentwicklung dieser Zeit; denn es ist freitätige Darstellung des Inneren, die Dar1 2 Zitiert nach einem Artikel von Christiane Schulzki-Haddouti in ihrem Artikel „Tamagotchi reinkarniert“ im Online-Magazin „Telepolis“ (vgl. http://www.heise. de/tp/artikel/1/1281/1.html, Zugriff am 30. September 2013). So wird das z.B. in einem Blogeintrag über „Hamsterfreunde“, einem Spiel von Nintendo, von einem Nutzer angepriesen (http://www.ciao.de/Petz_Hamsterfreunde_Nintendo_DS__Test_8541087, Zugriff am 12. Dezember 2013). SPIEL – EINE EINLEITUNG 9 stellung des Inneren aus Notwendigkeit und Bedürfnis des Inneren selbst, was auch das Wort Spiel selbst sagt“ (Fröbel in Lange 1863, S. 33f.). Nach Fröbel erschließen sich (kleine) Kinder die Welt spielerisch, gemäß der ihnen natürlich zukommenden Weise.3 Eine zunehmend leistungs- und outputorientierte Lernvorstellung mit vorabdefinierten Zielen und Kompetenzdimensionen muss dann als Einschränkung des kindlichen Wesens und seiner Entwicklung im und durch Spiel gesehen werden. Zugleich wird jedoch auch eine Vereinbarkeit von Spiel und Leistungsorientierung in Aussicht gestellt. Die Befriedigung, die das Kind aus dem freien Spiel ziehe, könne womöglich durch jene ergänzt werden, die aus der Bewältigung von Aufgaben und einem gesteigerten Können erwachse. Außerdem solle man nicht so tun, als sei die Einrichtung der Kindergärten durch Fröbel frei von einer pädagogischen Instrumentalisierung des Spiels. Dessen Spielgaben4 seien immerhin so etwas wie die Hinführung zum Einblick in einen göttlich verbürgten Kosmos, in dem das Spiel selbst schon einen Ort habe. Gegenüber einer solchen metaphysischen Instrumentalisierung des Spiels sei doch die Orientierung an gesellschaftlichen und individuellen Kompetenzprofilen eher zu befürworten.5 Ohne an dieser Stelle auf die vielfältigen Positionierungen des Spiels im gesellschaftlichen Leben im Hinblick auf die Reichweite und Legitimität der Argumente eingehen zu können, lässt sich zunächst feststellen, dass die pädagogische Bedeutsamkeit des Spiels und dessen Abstützung durch metaphysische, anthropologische, entwicklungstheoretische und gesellschaftsbezogene Argumente letztlich immer auf funktionale Gesichtspunkte rekurriert. Immer wieder rückt das Spiel in die Position eines Instruments ein, durch das der Wert des Spiels begründet wird. Es sollen pädagogische 3 4 5 Eine andere argumentative Lagerung der Bedeutung des Spiels für die Bildung des Selbst hat George Herbert Mead (1968) entworfen. Aus seiner sozialbehavioristischen bzw. pragmatistischen Sicht wird dem Kind über Rollenspiele und komplexere Spiele möglich, die Vorstellungen der anderen für sich darzustellen, zu organisieren und sich hierzu zu verhalten. Fröbel bestimmte pädagogisch bedeutsame „Spielgaben“, wie z.B. den Ball, der in seiner Geformtheit als Symbol des Alls gilt (vgl. Ballauff 1973, S. 117). Das Tamagotchi mit seiner Eierform wird nicht zu den pädagogischen Spielgaben gerechnet. Eine andere Perspektive auf die Bedeutung des Spiels geben Jens Holze und Dan Verständig in ihrem Beitrag. Sie heben aus einer modernisierungstheoretischen Perspektive die Möglichkeit der Selbstregulation von Spielen in einer von Ungewissheit und Kontingenz geprägten Gesellschaft hervor. Dabei zeichnen sich die Spiele in digitalen Räumen durch höhere Freiheitsgrade im Vergleich zu ‚traditionellen‘ Spielen aus. 10 ALFRED SCHÄFER | CHRISTIANE THOMPSON Ziele erreicht werden, die über das Spiel hinausgehen. Das Spiel selbst hat keinen pädagogischen Wert. Dieser muss ihm verliehen werden. Und dies geschieht entweder so, dass man ihm eine funktionale Bedeutung für Selbst- oder Identitätsbildungsprozesse zuschreibt oder dadurch, dass es als Instrument oder Form in eine pädagogische Vermittlungspraxis bzw. Entwicklung eingebaut wird. Gegen die funktionale Perspektive ist immer wieder ins Feld geführt worden, dass dem Spiel ein Eigenwert zukommt. Weit über kindliche Prozesse der Weltaneignung hinaus ist dem Spiel – seit Friedrich Schiller – eine gegenüber dem Ernst der gesellschaftlichen Wirklichkeit eigene Bedeutsamkeit zuzugestehen.6 Diese liegt nicht zuletzt darin, dass hier die „Wirklichkeitsgewissheit“ der gesellschaftlichen Welt aufgehoben ist, ohne dass das Spiel dadurch nur „unwirklich“ würde. Die faszinierende Welt des Spiels, welche die Spielenden in ihren Bann zieht, verfügt – bei aller Freiheit von den Imperativen gesellschaftlicher Wirklichkeit – über Regeln, die einen autonomen und intakten Wirklichkeitsraum verbürgen. Dass dieser Wirklichkeitsraum zugleich auch „unwirklich“ bleibt, zumindest wenn man ihn an den gesellschaftlich durchgesetzten Wirklichkeitsvorstellungen7 misst (siehe z.B. die Konsequenz und Verantwortlichkeit des Handelns), hat der Philosoph Eugen Fink als die philosophische Herausforderung des Spiels bezeichnet: Das Unwirkliche des Spiels stellt ein „seltsames Ineinander von ‚Sein‘ und ‚Schein‘“ dar (Fink 1960, S. 32). Damit wird das Konzept der Wirklichkeit wie auch das der Wahrheit von Aussagen über die Wirklichkeit in Frage gestellt. Umgekehrt eröffnet sich die Frage, wie „Unwirkliches“ entsteht, wie in einer sozialen Praxis „Schein“ hergestellt werden kann – ein Schein, der nicht nur eine subjektive Illusion ist, sondern eine wirkliche Verbindlichkeit mit sich bringt. Diese ersten spieltheoretischen Überlegungen lassen sich in der folgenden These verdichten: Spiele sind Wirklichkeiten, in denen es – bei aller inhaltlichen Verschiedenheit – um die Wirklichkeit der Wirklichkeit geht. Das Spiel steht, anders gesagt, in einem eigentüm6 7 Carl-Peter Buschkühle wird in seinem Beitrag zum vorliegenden Band für den Bereich des Kunstunterrichts eine Möglichkeit andeuten, in der sich (im Anschluss an Joseph Beuys) die spielerische Freiheit künstlerischen Schaffens mit einer pädagogischen Intention verbinden soll. Ein gutes Beispiel für diese unwirkliche Wirklichkeit ist der Tod des Tamagotchis, der in der Logik des Spiels wirklich, in der Logik gesellschaftlicher Deutungszusammenhänge von Leben und Tod unwirklich ist. Die Ambivalenz der unwirklichen Wirklichkeit des Spiels setzt sich dann fort in der Einrichtung eines ‚Tamagotchi-Friedhofs‘ im Netz, auf dem die „hinterbliebenen“ Spielenden ihren Tamagotchis eine Gedenkseite einrichten. SPIEL – EINE EINLEITUNG 11 lichen Verhältnis zu den selbstverständlichen Gewissheiten der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Im Folgenden soll im ersten Teil diese These erläutert werden, und es sollen die Implikationen dieser These ausgearbeitet werden (I.). Von hier aus, dem eigentümlichen Verhältnis des Spiels zur Wirklichkeit, lässt sich entwickeln, wie und wieso das Spiel mit kultischen Handlungen in Beziehung gesetzt wird und es den Rang einer ästhetisch-subversiven Praxis erhält (II.). Der dritte Teil der Einleitung widmet sich dann der Frage, inwieweit sich das Spielerische denn in den gegenwärtigen Kontingenzkulturen ‚entgrenzt‘ habe (III.). Für diese These mögen nicht nur bestimmte Theorieentwicklungen sprechen, die den Anteil des Imaginären an unseren Wirklichkeitsvorstellungen betonen.8 Möglich ist auch der Verweis auf aktuelle Entwicklungen wie die Finanz- und Wirtschaftskrise, die letztlich durch ein Börsenspiel hervorgerufen wurde. Wie aber dieses Spiel im Verhältnis zur Idee ästhetischer Subversion zu sehen ist und insgesamt gesellschaftlich einzuschätzen ist, stellt eine offene und herausfordernde Frage dar. Die Einleitung schließt mit einer Zusammenfassung der Beiträge des Bandes (IV.). I. Das Spiel als ‚unwirkliche Wirklichkeit‘ In Spielen finden sich vielfältige Bezüge auf das, was gesellschaftlich mit Zustimmung als wirklich im Sinne von ernsthaft, verantwortlich und mit Konsequenzen verbunden verstanden wird. Spiele werden den Bezug auf diese Wirklichkeit nicht los. Im Verhalten gegenüber dem Tamagotchi realisieren sich Vernachlässigung oder Fürsorge in Entsprechung zu gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten. Dieses Ineinanderfallen von Spielverhalten und gesellschaftlichen Verhaltungen ist in Rollenspielen, in denen soziale Funktionen nachgespielt werden, besonders augenfällig. Andere Spiele beziehen sich auf die effektive Bewältigung von Aufgaben, wobei der Wettstreit oder das Glück leitend ist – oder aber auch deren Kombination.9 8 9 Diese These einer Entgrenzung und damit einer gewissen Nivellierung des utopischen Potentials des Spiels vertritt Neuenfeld (2005) in einer historischen Rekonstruktion, die von Kant, Schiller und Novalis ausgehend über die Sprachspieltheorie Wittgensteins bis hin zum dekonstruktiven Spiel der Bedeutungen bei Derrida führt. Der französische Philosoph und Soziologe Roger Caillois spricht in einer berühmten Unterscheidung von vier Spieltypen, darunter agon (Wettkampf) und alea (Zufall). Vgl. Caillois 1982, S. 21ff. 12 ALFRED SCHÄFER | CHRISTIANE THOMPSON Wieder andere Spiele laden zum Eintritt in ein fiktives Universum ein, das historische oder auch Zukunftsszenarien umfassen kann: Man spielt Rollen als Ritter, Fabelwesen u.ä.10 Die Wirklichkeitsbezüge des Spiels können also aus den unterschiedlichsten Szenarien stammen. Sie können sich auch auf systemische Bedingungen unseres Zusammenlebens richten: Das Spiel „Monopoly“ ist nur ein prominentes Beispiel hierfür. Das von Frederic Vester 1980 erfundene Umweltspiel „Ökolopoly“ lehnt sich in der Namensgebung an das Vorherige an, thematisiert aber die komplexen Vernetzungen von „Produktion“, „Umweltbelastung“, „Lebensqualität“ etc. in modernen Gesellschaften. Das Fiktive des Spiels liegt nun nicht primär in einer verzerrten Wahrnehmung der entsprechenden Wirklichkeiten. So als wäre diese Wahrnehmung einfach unterkomplex, mit Klischees beladen oder inkohärent, als würde sie sich beispielsweise aus medialen Inszenierungen, wie z.B. Comics oder Filmen speisen. Dies ist sicherlich auch der Fall, gilt aber genauso in der ‚wirklichen Welt‘. Wie vielfältig gezeigt worden ist, setzt sich in einer durch Massenmedien bereicherten Welt die Alltagssicht aus Versatzstücken, Klischees, Typisierungen, Bildern und Halbwissen zusammen.11 Dann kann sich daran nicht das Fiktive des Spiels binden. Ein gehöriges Maß an Einbildungskraft ist im Spiel wie in der Wirklichkeit erforderlich. ‚Unwirklich‘, ‚unernst‘ oder fiktiv scheint das Spiel eher dadurch zu sein, dass die Wirklichkeit selbst nicht zu einem strukturierenden Moment des Spiels wird. Spiele folgen also nicht der Logik jener vorgestellten Wirklichkeit, auf die sie sich beziehen. Das, was in dieser Referenz-Wirklichkeit als notwendig gilt, als unabdingbar, wenn das System oder bestimmte Rollenkonstellationen funktionieren sollen, muss hier nicht gelten. Wenn das Tamagotchi stirbt, ist das eher undramatisch. Mit den Notwendigkeiten der Wirklichkeit, auch der 10 11 Caillois bezeichnet diese Spiele als mimicry (vgl. ebenda S. 27f.). Seine vierte Gruppe von Spielen bildet „ilinx“, das Erlangen eines rauschhaften Zustands, für den durchaus auch Stimulantien wie Drogen eingenommen werden können. Das Eingenommen- und Hineingezogen-Werden ins bzw. vom Spiel ist ein generelles Bestimmungsmoment im Spiel (vgl. Pfaller 2007). Adorno (2003) hat in seinen kulturkritischen Schriften die Affektgeladenheit von Bildern und deren Undurchdringlichkeit für das Denken zum Thema gemacht. Bezogen auf den Tourismus hat Rojek (1997) hat aufgezeigt, dass und wie die Sicht auf besuchte Orte und Menschen sich aus Verweisen, Versatzstücken von Bildern, mythischen Referenzen, Stereotypen und Allerweltsformeln zusammensetzen, aus denen (kontextrelativ) ein Bild der Welt aufgebaut wird. Solche Bilder sind immer interessiert, sie dienen der Selbstaffektion ebenso wie der Bestätigung eines kognitiven Souveränitätsgestus. SPIEL – EINE EINLEITUNG 13 Differenz von Leben und Tod, kann gespielt werden: Im Spiel bilden sie eher einen Bezugspunkt, der relativ frei ausgestaltet, re-interpretiert oder auch verändert werden kann. Instrumentelle Logiken mit entsprechenden Erfolgskriterien oder auch zu erfüllende soziale Konventionen werden im räumlich und zeitlich eingegrenzten Spielraum zum Gegenstand freier Verfügung. Die Logik einer stringenten Abfolge ist außer Kraft gesetzt. Mit dem Drücken der Reset-Taste schlüpft ein neues digitales Küken, das man nun anders erziehen kann. Es ist demnach möglich, immer wieder neu anzufangen und die Ausgangsbedingungen zu variieren. Es sind solche Freiheitsspielräume, die auch eine weitere ‚Ernsthaftigkeit‘ der sozialen Wirklichkeit suspendieren. Dass Spiele „außerhalb der unmittelbaren Befriedigung von Notwendigkeiten und Begierden stehen, dass sie diesen Prozess vielmehr unterbrechen“, hat der niederländische Kulturwissenschaftler Johan Huizinga in seiner bedeutsamen Studie „Homo ludens“ herausgestellt (Huizinga 2004, S. 17). Gemeint ist allerdings nicht nur die Unterbrechung von Bedürfniskreisläufen unter dem Diktat der Lebenserhaltung, sondern auch die Suspension moralischer Konsequenz und Verantwortungszuschreibung. Zwar können moralische Maßstäbe in Spielverläufe einbezogen werden. Diese bleiben aber insofern vermittelt bzw. eingeklammert, als sie etwas darstellen, über dessen Bedeutung aus der Logik des Spiels bzw. seines Ablaufs noch einmal eine Verständigung möglich ist. Spielerische Wirklichkeiten sind gemessen am Ethos gesellschaftlicher Verantwortungszuweisung und moralischer Autonomie-Vorstellungen als solche eher a-moralisch.12 Der Begriff des Amoralischen ist demnach nicht mit dem Unmoralischen zu verwechseln. Nicht die Negation moralischer Regeln ist das Spezifische, sondern ihre Einklammerung und Aussetzung, so dass sich Freiheitsgrade für Selbstpositionierungen ergeben. Spiele sind dabei nicht frei in einem chaotischen Sinne. Die Freiheit des spielerischen Handelns unterliegt selbst Regeln. Es sind die Regeln, die den Raum des Spiels von anderen Wirklichkeiten abgrenzen. Sie schaffen einen Binnenraum des Spiels gegenüber den Forderungen des Alltags – einen Raum, innerhalb dessen der gesellschaftliche Druck wegfällt und der einer Beschäftigung Platz macht, 12 Der Beitrag von Steffen Wittig im vorliegenden Band hebt dieses Verhältnis des Spiels zur gesellschaftlichen und ‚ernsten‘ Wirklichkeit hervor. Huizinga betont: „Das Spiel liegt außerhalb der Disjunktion Weisheit-Torheit, es liegt aber auch ebenso gut außerhalb der von Wahrheit und Unwahrheit und der von Gut und Böse“ (Huizinga 2004, S. 15). 14 ALFRED SCHÄFER | CHRISTIANE THOMPSON die ihren Zweck in sich selbst hat. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Spielwelten von der „Hektik des Alltags“ abgegrenzt werden und als „Oase des Glücks“ bezeichnet werden (Fink 1957, S. 23). In seiner Studie diskutiert Johan Huizinga den Geltungscharakter jener Regeln, welche die Grenzen zwischen zweckbestimmter Außenwelt und zweckfreiem Binnenraum abstecken. Den Regeln des Spiels kommt unbedingte Geltung zu: Teilnehmende, die sich nicht an die Regeln halten, können als Spielverderber ausgeschlossen werden; denn sie provozieren mit ihrem Tun eine Auflösung der Grenzen und damit des Spiels selbst. Es sind die Regeln, welche die Konstitution der Beteiligten als Spielende ermöglichen. Dabei gilt indes, was für alle anderen sozialen Wirklichkeiten gilt: Auch noch die strengsten Regeln regeln nicht die Bedingungen ihrer Anwendung.13 Es eröffnen sich Spielräume, anhand derer darüber gestritten werden kann, ob man der Regel überhaupt und wenn, ob man ihr denn auf eine adäquate Weise gefolgt sei. Die geordnete Welt des Spiels schließt den Streit nicht aus. Wichtig dabei ist es zu sehen, dass sich dieser Streit nicht zuletzt um die Wirklichkeit des Spiels dreht. Wenn dieser Streit eskaliert, kann die Wirklichkeit des Spiels enden. Man kann auseinander gehen oder neu anfangen. Die Unwirklichkeit des wirklichen Spiels lässt sich vor diesem Hintergrund auf eine doppelte Weise bestimmen. Auf der einen Seite erscheint das Spiel zwar im Hinblick auf die ernsthafte gesellschaftliche Wirklichkeit als unwirklich, aber zugleich ist diese gesellschaftliche Wirklichkeit, die Ernsthaftigkeit gegenwärtiger, vergangener oder zukünftiger Lebensverhältnisse als das anwesend, auf das sich die spielerische Übersetzung bezieht. Im Unernst des Spiels ist der Ernst des Lebens als abwesender anwesend. Auf der anderen Seite sucht die Unwirklichkeit des Spiels aber auch noch dessen immanente Wirklichkeit heim. Die Befreiung von den Notwendigkeiten und Begierden, den Interpretationsschablonen und Normalisierungen des täglichen Lebens verweist ebenso wie die angesprochene A-Moralität des Spiels darauf, dass die Spielwirklichkeit auf eine Begründung angewiesen ist, die das Spiel aus sich selbst heraus nicht leisten kann. Die Unbedingtheit der Regeln mag dafür ebenso als Indikator 13 Im Beitrag von Gabriele Weiß zu diesem Band werden die Spielenden in einem Spannungsfeld situiert, in dem sich dem Spiel verfallene Spieler und der Spielverderber gegenüberstehen. Damit ist das Verhältnis des Spielenden zur Ordnung des Spiels so ausgelotet, dass seine Freiheitsspielräume zur Geltung kommen können. Weiß ruft als dritte Figur den Falschspieler auf, der sich einerseits an die Regeln hält, diese aber andererseits auch zu seinen Gunsten manipuliert. SPIEL – EINE EINLEITUNG 15 gelten wie auch die damit verbundene Möglichkeit, das Spiel jederzeit zu beenden. In der ersten Perspektive auf die unwirkliche Wirklichkeit des Spiels scheint dessen Unwirklichkeit letztlich nicht vollkommen abgelöst von einer Wirklichkeit denkbar zu sein.14 Die zweite Perspektive markiert demgegenüber den Punkt, dass die immanente Wirklichkeit des Spiels auch im Spielen selbst vom Akzent der Unwirklichkeit heimgesucht wird. Im Spiel werden nicht nur die gesellschaftliche Wirklichkeit und deren Standards überschritten; das Wirkliche wird auch in der Wirklichkeit des Spiels zum Problem. Und dies liegt nicht zuletzt daran, dass im Spiel die gängigen Maßstäbe für das, was als wahr und richtig gelten soll, zwar aufgerufen und gleichzeitig doch zur Disposition gestellt werden. Wenn im Spiel eigene Wahrheiten und Kriterien für das Richtige vorhanden sind, die als solche die Wirklichkeit des Spiels verbürgen sollen, so weiß doch jeder Spielende, dass eben diese Kriterien nur unwirkliche Kriterien sind – solche für eine ‚Spielwelt‘. Dass die Kriterien des Spiels nur für eine ‚Spielwelt‘ gelten, hat Dietmar Kamper dahin geführt, das Problem der Aufstellung von Spielregeln im Lichte der Begründung der sozialen Wirklichkeit des Spiels zu betrachten: „Da es für das Erfinden von Regeln keine Regeln gibt, hängt das Spiel buchstäblich in der Luft, ist es ein ‚Grund im Abgrund‘, der den Menschen die Dinglichkeit der Dinge zwischen der bloßen Wahrnehmung und dem schönen Schein erst nachträglich sichert“ (Kamper 1991, S. 116). Es existiert demnach keine Referenz, von der aus Spielelemente oder Spielzüge ihren selbstverständlichen Ort hätten. Auch wenn Spielentwickler sich bei ihrer Tätigkeit an Erfahrungen und Maßgaben orientieren, so stellt sich das Erfinden eines Spiels als komplexe versucherische Praxis dar, in der Elemente, Züge, Ziele etc. immer wieder verschoben werden. Der von Kamper genannte Abgrund kann aber auch nachträglich aufscheinen, z.B. wenn im Spiel festgestellt wird, dass die Spielenden bislang unterschiedlichen Regeln gefolgt sind. Die Existenz einer fremden Regel verunsichert die Spielwirklichkeit oder kann diese sogar auflösen. Die Spielwirklichkeit bringt eine Suspension der Geltung der sozialen Wirklichkeit mit sich. Und dies hat nicht den Grund, dass Spiele sich kritisch auf die soziale Wirklichkeit beziehen müssten, wie 14 Von verschiedenen Autoren sind die Analogieformen zwischen (früher) vorherrschenden Arbeitsorganisationen einer Gesellschaft und ihren beliebtesten aktuellen Spielformen hervorgehoben worden (Pfaller 2007). Damit wird ebenfalls die Spur von Bezug und Abgrenzung zwischen Wirklichkeit und Spiel aufgenommen. 16 ALFRED SCHÄFER | CHRISTIANE THOMPSON das in dem jüngst entwickelten Computerspiel „Phone Story“15 unternommen wird. Unabhängig davon, ob Spiele sich affirmativ oder kritisch auf die soziale Wirklichkeit beziehen, suspendieren sie Letztere, indem sie Möglichkeitsräume entwerfen, die die Geltungskraft des Gegebenen einklammern. Die Möglichkeitsräume nehmen also die Geltung der eigenen Wirklichkeitsbedingungen des Spiels im Hinblick auf die gesellschaftliche Wirklichkeit zurück: Spiele reflektieren die Kontingenz, die Grundlegungsproblematik sozialer Ordnungen und korrespondierender Selbstverständnisse. Die Reflektion dieser Kontingenz ist indes nicht als kognitiver Vorgang zu begreifen. Es handelt sich vielmehr um einen praktischen16 Vollzug: durch das Hervorbringen (mimetischer) Übersetzungen (vgl. Gebauer 1997), Verschiebungen, durch die Irrealisierung ihrer gesellschaftlichen Bezüge und durch einen Vollzug, in dem sich Virtuelles und Reales die Waage halten. Das Spiel lässt sich also im doppelten Sinn als eine ‚unwirkliche Wirklichkeit‘ kennzeichnen. Auf der einen Seite hat das Spiel eine eigene Wirklichkeit, die gleichsam mitlaufend von ihrer Unwirklichkeit heimgesucht wird. Auf der anderen Seite stellt sich die Spielwirklichkeit (mit Blick auf ihr Verhältnis zur sozialen Wirklichkeit) als eine Unwirklichkeit dar, die für die Spielenden wirklich ist und bleibt. Nähe und Distanz, Bindung und Lösung der Spielenden scheinen unter diesen Voraussetzungen, so verwirrend dies ist, gleichzeitig notwendig zu sein, damit die unwirkliche Wirklichkeit des Spiels zustande kommt. Die verbindliche Wirklichkeit des Spiels muss von den Spielenden hervorgebracht werden, obwohl sie um dessen Unwirklichkeit wissen. Auch wenn diese Wirklichkeit erst im praktischen Vollzug konstituiert wird, so ist doch auch dem praktischen Vollzug selbst die Wahrnehmung eines bloßen ‚Als-ob‘ eingeschrieben. Im Spiel bildet sich eine Wirklichkeit – trotz Täuschung, Illusion, ‚schönem Schein‘. Darin liegt auch eine Bindungskraft an das Spiel, welche die Spielenden in ihren Bann zieht: Das Spiel „fesselt. Es bannt, das heißt: es bezaubert“ (Huizinga 2004, S. 19, i. O. kursiv). Das Spiel versetzt die Spielenden in eine andere Welt. Obwohl sie „selbst zugleich wissend und betrogen“ (ebd., S. 33) sind, obwohl sie um den eigenen Anteil an der Herstellung des Zaubers wissen, dem 15 16 Dieses Spiel kritisiert die Produktionsbedingungen von Apple-Smartphones. Arbeiter, die sich vom Fabrikdach stürzen, sind im Spiel mit einem Sprungtuch aufzufangen – eine Anspielung auf Selbstmorde von ausgebeuteten Arbeitern und Arbeiterinnen in einer Zulieferfirma von Apple im chinesischen Shenzhen. Der praktische Vollzug, das körperliche Einbezogensein, bildet einen wichtigen Einsatzpunkt des Beitrags von Christoph Wulf in diesem Band. SPIEL – EINE EINLEITUNG 17 sie erliegen, erscheint den Spielenden die unwirkliche Wirklichkeit des Spiels „wirklicher als die Wirklichkeit“ (Gebauer/Wulf 1998, S. 203). Huizinga spricht daher von der Wirklichkeit des Spiels als einer sakralisierten, einer heiligen Wirklichkeit. Indem es sich auf die soziale Wirklichkeit zugleich bezieht und diese in ihrer Bedeutung relativiert, bringt das Spiel einen Raum hervor, der eine Wahrheit verspricht, die in der sozialen Wirklichkeit nicht zu erreichen ist. Die Verzauberung durch das Spiel lässt zwar Zweifel zu; dennoch führt das nicht dazu, dass die Spielenden das Versprechen der Transzendenz des Bestehenden im Vollzug des Spiels in Frage stellen. Von hier aus wird verständlich, wieso das Spiel in die Nähe zu kultischen oder religiösen Handlungen gerückt wird, so zum Beispiel in der bekannten Studie von Huizinga (Huizinga 2004, S. 27ff.). Spielerische Handlungen werden mit einem „heiligen Ernst“ (ebd.) ausgeführt, der die Spielenden ergriffen hat. Der folgende Abschnitt versucht, der Spur einer kultischen Inszenierung ein Stück weit zu folgen, um diese dann mit der ästhetischen Spieltheorie in Verbindung zu bringen. II. Vom Kult zur ‚Versöhnung im schönen Schein‘ Wie ist der heilige Ernst, die Verzauberung der Spielenden und ihre affektive Bindung bzw. Einbindung, möglich, wo die Spielenden doch um den imaginären Charakter des Spiels wissen? In seiner Huizinga-Interpretation gibt Robert Pfaller die folgende Antwort: Es ist gerade das Wissen der Spielenden um den imaginären Charakter des Spiels, um seine jede ‚realistische‘ Erklärung und Begründung überschreitende Dimension, die zu einer affektiven Bindung führt. Gerade weil man weiß, dass die Spiel-Wirklichkeit keine Wirklichkeit darstellt, entsteht die Möglichkeit einer Bezauberung durch eine Illusion, die unter rationalen Gesichtspunkten unmöglich ist – aber vielleicht doch nicht ganz (Pfaller 2002, S. 54).17 Es ist das ‚bessere Wissen‘, das die Illusion in die Schwebe zwischen Unmöglichkeit und Möglichkeit versetzt (ebd., S. 44). An diesem Punkt liegt es nahe, auf die Ritualtheorie Victor Turners einzugehen. Im Anschluss an van Gennep (1986)18 unterscheidet 17 18 Pfaller entwickelt seine Perspektive im Anschluss an den Psychoanalytiker Octave Mannoni. Die einschlägige Studie „Übergangsriten“ von Arnold van Gennep erschien zuerst 1909. 18 ALFRED SCHÄFER | CHRISTIANE THOMPSON Turner (1969) drei Phasen von Ritualen, die sich am ehesten an Übergangsritualen zeigen lassen. In einer ersten Phase erfolgt eine (häufig gewaltsame) Loslösung der Novizen, die etwa in einen Initiationsprozess eintreten, aus ihrer gewohnten Umgebung. Sie verlassen das soziale Ordnungsgefüge und damit die Ordnung selbstverständlicher Beziehungen. Sie werden an einen räumlich separierten Ort gebracht. Hier beginnt die zweite Etappe des Übergangsprozesses, von Turner „Schwellenphase“ oder „liminale Phase“ genannt. In diesem vom Alltag getrennten Raum haben die sozialen Regeln, die Erwartungsbeziehungen, die Pflichten und Bedingungen sozialen Respekts keine Geltung mehr. Sie bilden demgegenüber einen Bezugspunkt, der subvertiert wird. Man verlangt von den Novizen, dass sie sich über diese Regeln hinwegsetzen, gegen sie verstoßen. Zugleich handeln auch diejenigen, die als Eingeweihte diesen Prozess strukturieren, auf eine Weise, die keinerlei Erwartungssicherheit aufkommen lässt. Alles kommt darauf an zu zeigen, dass jede verlässliche, jede rational auszurechnende Ordnung aufgehoben ist: An diesem Ort zählen die sozial akzeptierten Begründungen nicht mehr. Dies ist der Ort, an dem die Novizen mit dem Heiligen in einen meist furchterregenden Kontakt kommen. Eben dieses Heilige verleiht ihnen eine neue Identität – eine Identität, die etwas anderes ist als jene soziale Identität, die man im sozialen Gefüge innehat.19 Die Novizen werden schließlich etwa lernen, Masken zu tragen, die von Initiierten gefertigt wurden, und damit das Heilige auch im Rahmen kultischer Veranstaltungen zu re-präsentieren. In der dritten Phase kehren die nun Initiierten in die soziale Gemeinschaft zurück. Betrachtet man nun etwa kultische Inszenierungen, in denen das Heilige, die jenseitigen Mächte, in der Form von Masken re-präsentiert wird bzw. werden, so könnte zunächst die Vermutung aufkommen, dass es sich bei diesen Veranstaltungen allein um eine Inszenierung für jene handelt, die um das Geheimnis des Kults nicht wissen. Das Geheimnis besteht in dieser Lesart nur darin, dass die Masken von Menschen gemacht sind: Die anderen – Frauen und Kinder etwa – wissen darum nicht und sie können getäuscht werden. Ihre Angst wird zum Mittel sozialer Kontrolle. In dieser Sichtweise wissen die Männer um die Illusion des Kultspiels, glauben aber selber nicht daran.20 19 20 Vgl. hierzu auch die Darstellungen bei Herdt/Keesing 1982; Schäfer 1999 und 2004; Tuzin 1980. Huizinga diskutiert diese Sichtweise und verweist darauf, dass die ethnologische Forschung eine solche Vorstellung schon lange verabschiedet habe (vgl. Huizinga 2004, S. 28ff.). SPIEL – EINE EINLEITUNG 19 Dies ist nun aber gerade nicht der Fall. Obwohl die Männer darum wissen, dass sie die Masken selbst gefertigt haben, dass es sich also letztlich nur um ein von ihnen bearbeitetes Stück Holz oder ein gefertigtes Kostüm handelt, bildet der Maskentanz auch für sie mehr als eine spaßhafte Repräsentation der heiligen Kräfte. Sie gehen davon aus, dass sie diese Kräfte, die sich jeder sozialen Ordnung entziehen, nicht einfach nur zur Darstellung bringen. In der von ihnen getanzten Maske kommt dieses Imaginäre nicht nur zur Erscheinung, sondern es ist in dieser Erscheinung präsent. Es ist diese Präsenz des Imaginären, die in ihrem Auftritt wirksam ist, die einen „heiligen Ernst“ hervorruft. Der heilige Ernst beruht letztlich darauf, dass die Unterscheidung zwischen dem, was man selbst als ‚Wissender‘ zum Gelingen des Auftritts beiträgt, und dem, was gleichsam ‚durch die eigene Darbietung hindurch‘ sich vollzieht, die eigentliche Bedeutung dieses Gelingens hervorbringt. Der heilige Ernst ist dann gerade an das Wissen um die Paradoxie einer Repräsentation gebunden, die nach sozialen Regeln (also wirklich) verläuft, in der aber gleichzeitig das präsent bleibt, was nach sozialen Regeln unmöglich und unfassbar ist.21 Als Träger einer Maske, als Spieler einer heiligen Rolle, ist man nicht einfach man selbst als jemand, der in der sozialen Wirklichkeit zu verorten ist; zugleich geht der Spieler aber auch nicht einfach in der ‚illusionären‘ Rolle auf. Die Maske, die der Spieler trägt, ist nicht das eigene Selbst, und zugleich lässt sich nicht sagen, dass sie nicht doch das eigene Selbst ist.22 Es ist das Wissen des Eingeweihten, das die Aufführung in einer Schwebe zwischen Glauben und Nicht-Glauben, zwischen Realität und Illusion hält. – Gerade dadurch wird ein heiliger Ernst hervorgebracht, der in dieser Form von den NichtEingeweihten, den im Alltag Befangenen nicht geteilt werden kann. Die Sakralisierung, die den heiligen Ernst herbeiführt, beruht auf dem Wissen um eine Illusion, deren ‚unwirkliche Wirklichkeit‘ nicht auszuschließen ist. Dabei muss es sich nicht um Geister oder unmögliche Wirklichkeiten handeln: Auch Wahrscheinlichkeitsrechnungen (vgl. Esposito 2007) oder hochkomplizierte mathematische Modelle, wie sie etwa in die Börsenspekulation eingehen, haben diesen Effekt. Auf der Grundlage des bereitgestellten Wissens kann die vermeintlich gegebene Wirklichkeit im Namen einer illusionären, einer ‚unwirklichen Wirklichkeit‘ in die Schwebe gebracht wer21 22 Vgl. zu dieser Paradoxie der Repräsentation am Beispiel eines Voodoo-Maskenkultes Schäfer 2004, S. 123ff. Margaret Thompson Drewal fasst dies in die Formel, die Maske sei „not me, not not me“ (Drewal 1992, S. 90). 20 ALFRED SCHÄFER | CHRISTIANE THOMPSON den, so dass mit durchaus heiligem Ernst entsprechende Einsätze gemacht werden können. Mit diesen Einsätzen versucht man im Hinblick auf die ‚unwirkliche Wirklichkeit‘ des Vermuteten, des Erhofften und Befürchteten einen Stand zu gewinnen, von dem man weiß, dass er (trotz aller rationalen Risikokalkulation) nicht von einem selbst abhängt – aber vielleicht doch ein wenig. Huizinga geht nun davon aus, dass zwar alle spielerischen Handlungen, die mit der (gebrochenen) Hingabe an das Spiel erfolgen, ‚heilige Handlungen‘ sind, dass aber aus dieser formalen Gleichheit mit kultischen Handlungen nicht folgt, dass alle Spiele als kultische Handlungen zu verstehen sind (Huizinga 2004, S. 28). Für ihn liegt das Spiel seinen kultischen Ausformungen voraus und vermag diese zu übersteigen. Victor Turner hat diese Entwicklung als eine der Ästhetisierung des Kultischen gefasst: An die Stelle der angedeuteten liminalen Phase sei unter modernen Bedingungen ein liminoides Spiel mit den Grenzen von Wirklichem und Unwirklichem getreten, wie Turner an den Entwicklungen des modernen Theaters zeigt (Turner 1995). Wenn man die Gemeinsamkeit von liminalem und liminoidem Zustand darin sieht, dass es sich um eine distanzierte ‚Entwirklichung‘ des Subjekts handelt, dann lässt sich der Unterschied wohl am ehesten daran festmachen, dass sich der ‚Zauber‘ der liminoiden Phase in einer Dezentrierung des sozialen Selbst zeigt. Es geht, konkret formuliert, darum, souveräne Verfügungsfantasien zu überwinden und sich der Wirklichkeit eines unwirklichen Geschehens zu überlassen.23 Die Überwindung der sozialen und gleichzeitig anthropologischen Bestimmtheit des Selbst bildet schon bei Schiller den Bezugspunkt für eine Theorie des Spiels, die dieses Selbst zu einer unwirklichen Wirklichkeit und gerade darin zu seiner eigentlichen Wahrheit führen soll. In seinen „Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen“ geht Schiller von einem anthropologischen Modell aus.24 In diesem wird der Mensch durch zwei unterschiedliche ‚Triebe‘ bestimmt, deren Logiken sich wechselseitig ausschließen. Dies führt einerseits dazu, dass die jeweilige Befolgung einer dieser Logiken zur Vereinseitigung und damit zum Verfehlen des vollen Menschseins führt. Andererseits ist es für den Menschen ausgeschlossen, aus eigener Kraft – etwa durch die Kraft der Reflexion oder der Vernunft – die Dualität seiner beiden Antriebe zu versöhnen. 23 24 Turner verweist hier auf das von Mihaly Csikszentmihalyi (1974) untersuchte „Flow-Erlebnis“ (vgl. Turner 1995, S. 88.). Schiller 1973. Vgl. dazu Schäfer 2009, S. 264-282, und Ensslin 2006.