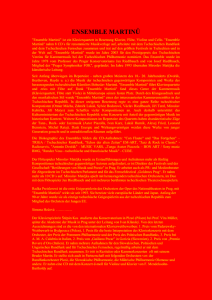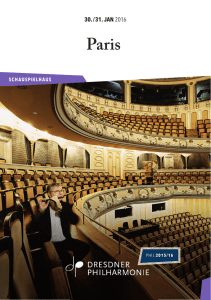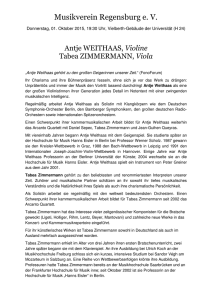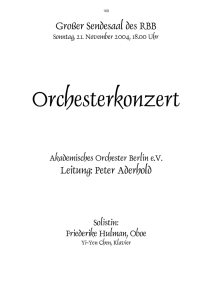III. AUF DER SUCHE NACH DEM „WIRKLICHEN THEATER“
Werbung

III. AUF DER SUCHE NACH DEM „WIRKLICHEN THEATER“ Hry o Marii (1933-34) DIE KRISE ALS WENDEPUNKT Waren die ersten Pariser Jahre durch Martinůs Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Strömungen geprägt, sei es die Zeitoper, sei es die Jazzmusik oder der Dadaismus RibemontDessaignes, so wurde nach 1930 das genau gegenläufige Moment der Distanzierung von äusseren Einflüssen zum bestimmenden Merkmal seines Schaffens. Nachdem er sich zunächst im Pariser Chaos zu orientieren und die einzelnen Richtungen auf ihre Tauglichkeit für seine Zwecke zu prüfen hatte, setzte er sich zu Beginn der 1930er Jahre – und somit kurze Zeit nach Abschluss der Zeitoper Les trois Souhaits – intensiv mit der eigenen Musikauffassung auseinander, worauf er die Mittel einschränkte, und die Kompositionen sauberer, die Form klarer und der Stil eher kammermusikalisch als symphonisch wurden1. Untrennbar mit der abnehmenden Beeinflussung durch zeitgenössische Tendenzen verbunden ist Martinůs wachsende Unzufriedenheit mit den in Paris aufgeführten neuen Werken. Hatte er zu Beginn seines Pariser Aufenthaltes nahezu hymnische Texte über die Vielfalt des Pariser Musiklebens verfasst, nahm im Lauf der Jahre die Begeisterung – und damit seine publizistische Tätigkeit – stetig ab, bis sie um 1933 einen ersten Tiefpunkt erreichte2. In einer polemischen Abhandlung über die Pariser Konzertsaison von 1932/33 brachte er seine überaus kritische Sicht auf den gegenwärtigen Stellenwert der Kunst und die daraus erwachsenden Folgen zum Ausdruck3. Die politische und wirtschaftliche Unsicherheit der damaligen Lage – eine unmittelbare Folge der Weltwirtschaftskrise – fand seiner Ansicht nach eine Entsprechung in der Situation der Kunst: Indem die moralischen Werte und die damit verbundene Verantwortung des Komponisten aber auch des Publikums einem Werk gegenüber gelockert würden, verkäme die Musik zunehmend zu einem zwar dekorativen, jedoch alltäglichen Ereignis, was ein rasch erlöschendes Interesse nach einmaligem Hören mit sich brächte. Dieses flüchtige Interesse könne allein durch immer Neues am Leben erhalten werden, weshalb unvermeidlicherweise die ganze 1 Zitat Martinů, Bilance vlastní tvorby do r. 1935 [Bilanz des eigenen Schaffens bis 1935] (1935), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 329. 2 Martinůs Artikel für tschechoslowakische Zeitschriften und Zeitungen (Listy Hudbní matice; Lidové noviny; Tribuna; Národní a Stavovské Divadlo; Přítomnost; Dalibor; Hudební rozhledy), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 19-109. 3 Martinů, Hudba v Paríži [Musik in Paris] (1933), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 54-56. 107 Vergangenheit verworfen und nach einem Neubeginn mit völlig neuen Materialien gesucht werden müsse. Der Bourgeois erweise sich als unersättlich, womit sich das Prinzip des épater le bourgeois gegen den Künstler wende, denn als richtigem Reaktionär würde dem Bourgeois auch das Originelle zu langweilig4. Es fiele den widrigen Verhältnissen zum Opfer, und zurück bliebe notgedrungen eine Lücke, die ebenso wie das Konzertprogramm mit Werken gefüllt werden müsse. Da keine grosse Auswahl zur Verfügung stünde, würde man sich für die Erstbesten entscheiden, wofür in den Augen Martinůs die Pariser Saison von 1932/33 den Beweis lieferte. Obwohl er keine hohe Meinung von der Qualität der erklingenden Kompositionen hatte, schätzte er dies nicht als eigentliches Problem, sondern als blosse Folge der veränderten Funktion von Kunst ein. Die neue junge Schule ersetzt sehr bequem einige spezifische Werte der grossen französischen Tradition. Sie ersetzt Leichtigkeit (légerté) durch Einfachheit (facilité). Sie ersetzt ebenso die berühmte französische Klarheit (clarté) durch ziemlich gewöhnliche Banalitäten. Was den guten Geschmack betrifft, der einer der Vorzüge der französischen Kultur darstellt, so ist dieser nur schwer auszutauschen, aber selbst der wurde ersetzt. [...] Die Gefahr liegt weniger in den Werken selbst, als vielmehr in deren Bewertung und Klassifizierung. Das Werk wird zur blossen gesellschaftlichen Ergänzung und als alltägliches Ereignis richtet es keinen grossen Schaden an 5. Nicht Neues um des Neuen willen zu komponieren, sondern die moralische Verpflichtung wahrzunehmen, indem er die Musik wieder auf die ihr eigenen Grundlagen zu stellen trachtete – dies veranlasste Martinů zu einer langjährigen Auseinandersetzung mit dem barocken Concerto grosso, die schliesslich im Konzert für Streichquartett mit Orchester, im Concerto grosso, den Tre Ricercari sowie im Konzert für zwei Streichorchester, Klavier und Pauke gipfelte. Das Streben nach einer definitiven Organisation des Ganzen und aller seiner Elemente zu einem lebendigen, gesunden Organismus fand er in den Concerti grossi Corellis verwirklicht, nicht jedoch in den Symphonien des späteren 19. Jahrhunderts, die auf einer dynamischen Kulmination emotionaler Elemente beruhten und deren Themen auf Kosten der organischen Ordnung zu schier ungeheuren Dimensionen ausgedehnt würden6. In Martinůs Aussage Ich war nie Avantgardist spiegelt sich seine Überzeugung, dass sämtliche für die Musik relevanten Fragen im Lauf der Geschichte längst gestellt worden seien, und es nun 4 Ebd., S. 55. Ebd., S. 56. 6 Martinů, Bilance vlastní tvorby do r. 1935 [Bilanz des eigenen Schaffens bis 1935] (1935), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 329. 5 108 darum ginge, diese in einer Art Synthese der vergangenen Epochen neu zu beantworten7. Wenngleich die beginnende Beschäftigung mit dem Concerto grosso keinen direkten Zusammenhang zur Bühnentrilogie – deren Entstehung in diese Zeit fällt – aufweist, so lässt sich daraus doch auf eine zunehmende Distanzierung von äusseren Einflüssen schliessen, die wiederum für die Komposition der drei Werke relevant erscheinen muss. Denn wollte er mit den Concerti grossi erklärtermassen an die ‚Grundlagen der Musik‘ rühren, so plante er mit der zwischen 1931 und 1936 entstandenen tschechischen Bühnentrilogie Špalíček, Hry o Marii und Divadlo za bránou eine Rückkehr zum wirklichen Theater, indem er die Gattung Oper von der angesammelten Schlacke – den Folgen einer psychologisierten Handlung – zu befreien beabsichtigte8. Bis zu welchem Punkt die Entscheidung, die Trilogie explizit für ein tschechisches Publikum zu schreiben, auf einer bewussten Absicht beruhte und nicht eine Folge der sich anbietenden Möglichkeiten war, muss offen gelassen werden. Jedenfalls liegt die Vermutung nahe, dass die Entscheidung für die Tschechoslowakei ebenso praktisch bedingt war wie diejenige für das flexiblere Brünner Theater anstelle des Prager Nationaltheaters9. War bereits die Aufführung der Hry o Marii in Prag mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden, so musste die Adaption einer Trilogie Martinůs für eine französische Bühne geradezu utopisch erscheinen. Während die Umstände, die zu einer Aufführung in der Tschechoslowakei und nicht in Frankreich führten, für eine Beurteilung der Trilogie nur von sekundärem Interesse sind, wiegt ungleich schwerer, dass Martinů die drei Werke im Bewusstsein verfasste, ausschliesslich für ein tschechisches Publikum zu arbeiten, impliziert dies doch eine Reaktion auf die Eigenheiten der betreffenden Operntradition. Dementsprechend bestand seine erklärte Absicht darin, das tschechische Publikum an das moderne Musiktheater heranzuführen, was ihm deshalb vordringlich erschien, weil er der Überzeugung war, dass das dortige Opernrepertoire aufgrund seltsamer – politischer oder kultureller – Umstände beträchtliche Lücken aufwies10. So plante Martinů, der fehlgeleiteten Rezeption in der damaligen Tschechoslowakei dadurch entgegenzuwirken, dass überhaupt erst ein Publikum für neues Musiktheater 7 Zitat ebd., S. 329; Zitat Martinů, O současné hudbě [Über die zeitgenössische Musik] (1925), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 78. 8 Zitat Martinů, Poznámky k cyklu Hry o Marii [Anmerkungen zum Zyklus Hry o Marii] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 206; vgl. Autobiografie (1941), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 322324. 9 Vgl. Eva Vítová, Zur Tradition der Inszenierung von Bohuslav Martinůs Opern auf der Bühne des Staatstheaters in Brno, in: Brabcová, Bohuslav Martinů (1990), S. 285 f. Siehe auch Brief von Martinů an Frantíšek Muzika, vom 30. April 1934 aus Paris, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 187. 10 Zitat Martinů, Autobiografie (1941), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 321. 109 geschaffen werden sollte, eine Intention, die sich direkt in Martinůs Bühnentrilogie niederschlug11. Ausgehend vom damaligen Stand der tschechischen Opern, die sich nurmehr auf Szenen aus dem Dorfleben oder mehr oder weniger märchenhafte Themen beschränken würden (etwa Rudolf Karel: Smrt kmotřička; Jaromír Weinberger: Švanda dudák), beabsichtigte er, innerhalb der drei Werke die verpasste Theatergeschichte nachzuholen: Die erste Entwicklungsstufe bildete das Ballett Špalíček für Solostimmen, Chor und Orchester von 1932, die zweite der Opernzyklus Hry o Marii von 1934 und den Abschluss die mit Commedia dell’Arte-Elementen durchsetzte Ballett-Oper Divadlo za bránou aus dem Jahr 193612. Zusätzlich unterstrichen wurde die didaktische Absicht durch den Umstand, dass Martinů zu keinem anderen seiner Werke so viele Kommentare publizierte wie zu dieser Trilogie im allgemeinen und zu den Hry o Marii im besonderen13. Diesen Erläuterungen entsprechend sah er das zu beseitigende Unverständnis des Publikums darin begründet, dass sich die zeitgenössische Oper zunehmend zur Angelegenheit für Spezialisten entwickelt und dabei ihre auf das Theater zurückgehenden Wurzeln vernachlässigt habe14. Sich dem ‚Theater‘ wieder anzunähern und das Interesse des Publikums zurückzugewinnen, dies sind die beiden bestimmenden und einander gegenseitig bedingenden Ziele, die der Konzeption der drei Bühnenwerke zugrunde liegen. Indem sich das Libretto von Špalíček aus Volksliedtexten und Märchen zusammensetzt, wird es zugleich zwei Ansprüchen gerecht: Zum einen knüpfte es unmittelbar an die Situation der tschechischsprachigen Oper an, die sich weitgehend auf märchenartige Stoffe konzentriert hatte, und zum anderen erleichterte die Verwendung des tschechischen Allgemeinguts die Rezeption, weshalb sich das Publikum verstärkt mit der Musik auseinandersetzen konnte. Die Hry o Marii führen insofern weiter, als sie einerseits den Schritt vom Ballett zur Oper vollziehen und andererseits nicht mehr auf allgemein bekannten Texten, sondern auf vier zyklisch angeordneten Legenden basieren. Nach Špalíček und Hry o Marii bildet schliesslich das Bühnenwerk Divadlo za bránou insofern einen zusammenfassenden Abschluss der Trilogie, als es sowohl eine an Špalíček gemahnende Hinwendung zum Ballett als auch eine die Hry o Marii fortsetzende Verwendung von Volksliedtexten aufweist und als neu 11 Zitat ebd., S. 320. Ebd., S. 321. Zu Martinůs kritischer Beurteilung des Prager Nationaltheaters siehe Martinů, Životnost opery [Die Lebensfähigkeit der Oper] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 203 f. 13 Unveröffentlichte Entwürfe und publizierte Aufsätze Martinůs zu Špalíček, Hry o Marii und Divadlo za bránou, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů (1979), S. 182-243. 14 Martinů, O divadle středověku [Vom Theater des Mittelalters] (1934), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 186. 12 110 hinzutretendes Element Anleihen bei der Commedia dell’Arte nimmt. Trotzdem erinnert diese Ballett-Oper nur bedingt an die Commedia dell’Arte, was wohl nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass Martinů mit dieser nicht viel anzufangen wusste und stattdessen verstärkt auf ein volkstümliches Spektakel abzielte15. Da den Hry o Marii weder der Übergangscharakter des Špalíček, der immerhin bei dem – in den Augen Martinůs – lamentablen Zustand der tschechischen Oper anzuknüpfen hatte, noch das bereits Abschliessende des Divadlo za bránou anhaftet, bilden die mittelalterlichen Spiele zweifellos das Kernstück der Trilogie16. DAS „WIRKLICHE THEATER“ AUF DER OPERNBÜHNE Ich glaube an die Lebensfähigkeit und Zukunft der Oper sowie des Theaters, wenn sich diese von ihren mehr oder weniger ästhetischen und falschen Überlagerungen zu befreien vermögen, und ich wage den ersten Schritt auf diesem Weg, d. h. ich will mich wieder dem Theater und dem Publikum annähern17. Bemerkenswerterweise machte Martinů auf seiner rückwärts gerichteten Suche nach einer Zeit, in der Theater noch wirkliches Theater gewesen war, bereits im Mittelalter Halt und verzichtete auf einen Sprung in die Antike18. Da er in keiner Weise eine Retrospektive der Theatergeschichte anstrebte, sondern in erster Linie den Publikumskontakt wiederherstellen wollte, wählte er das unmittelbar im Volk verwurzelte, mittelalterliche Theater zum Ausgangspunkt. Dem schwindenden Publikumsinteresse entgegenzuwirken, indem nun nicht mehr das ‚Bildungsbürgertum‘, abgestumpfte unnaive Menschen, sondern neu das ‚Volk‘ schlechthin angesprochen werden sollte, hatte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts Max Reinhardt zu seinen Arena-Inszenierungen bewogen, die er ab 1910 zunächst an wechselnden Theatern und schliesslich im eigenen Berliner ‚Zirkus Schumann‘ verwirklichte19. Wie 15 Zitat Martinů, Brief von Martinů an Jindřich Honzl, vom 14. Mai 1935 aus Paris, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 230. 16 Martinů, Divadlo za bránou (1936), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 242: Ich denke, dass ich mit den drei Bühnenwerken, die alle im Brünner Theater aufgeführt wurden, meine Aufgabe erfüllt habe, so dass ich mich jetzt anderen Zielen zuwenden kann. 17 Martinů, Poznámky k cyklu Hry o Marii [Anmerkungen zum Zyklus Hry o Marii] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 206. 18 Zitat ebd., S. 206. 19 Zitat Reinhardt nach Fischer-Lichte, Kurze Geschichte des deutschen Theaters (1993), S. 276. Vgl. auch Reinhardt, Rede über den Schauspieler (1930), in: Ders., Schriften, S. 325: Das bürgerliche Leben ist eng begrenzt und arm an Gefühlsinhalten. Es hat aus seiner Armut lauter Tugenden gemacht, zwischen denen es sich schlecht und recht durchzwängt. [...] Wir haben uns auf eine Reihe allgemeingültiger Ausdrucksformen 111 naheliegend der Schritt vom intendierten Massentheater zum mittelalterlichen Theater als Vorbild im Grunde war, zeigt etwa Reinhardts triumphale Produktion von Carl Vollmoellers Mysterienspiel Mirakel mit Musik von Engelbert Humperdinck oder der zur Salzburger ‚Institution‘ gewordene Jedermann Hugo von Hofmannsthals20. Hofmannsthal sah in den dramatischen Gebilden der grossen simplen Art ein Theater, das wahrhaftig aus dem Volk hervorgestiegen sei, eine Auffassung, die in ähnlicher Weise Martinů dazu bewog, mittelalterliche Mysterien und Mirakel zum Vorbild für die Hry o Marii zu erklären, infolgedessen darin Oper und Volkstheater zwangsläufig ineinander übergehen21. Obwohl auch in Russland bereits vor dem Ersten Weltkrieg – parallel zu Reinhardts Arbeiten in Deutschland – mit Vladimir Majakovski, Boris Wachtangow und Alexander Tairow namhafte Regisseure die mittelalterlichen Mirakelspiele für das zeitgenössische Theater entdeckten, findet sich trotz zahlreicher Analogien ein grundsätzlicher Unterschied gerade darin, dass etwa Tairow kein Volkstheater anstrebte, sondern stattdessen die Unabhängigkeit vom grossen Publikum suchte22. Zeugen die Entwicklungen in Deutschland und Russland von einem wachsenden Interesse am Theater des Mittelalters, eine ‚Renaissance‘, die nicht auf ein alleiniges Zentrum zu reduzieren ist, sondern vielmehr der Stimmung der Zeit zu entsprechen schien, gilt es nun, mit der betreffenden Theatersituation in Frankreich die direkteren Einflüsse auf Martinůs Konzeption der Hry o Marii aufzuzeigen. Der Pariser Kontext ist dabei weniger im Kreis um Jean Cocteau zu suchen, der immerhin die Publikumswirksamkeit als Qualitätskriterium für Bühnenwerke angeführt hatte, als vielmehr bei den am Mittelalter orientierten Theaterschaffenden, nämlich Gaston Baty und Henri Ghéon, aber auch dem Theatertheoretiker Lucien Dubech23. geeinigt, die zur gesellschaftlichen Ausrüstung gehören. Diese Rüstung ist so steif und eng, dass eine natürliche Regung kaum mehr Platz hat. Reinhardt, Schriften, S. 143, 330 f. [Das Theater der Fünftausend (1911)]; Funke, Max Reinhardt (1996), S. 57-60. 20 Reinhardt, Denkschrift zur Errichtung eines Festspielhauses in Hellbrunn (1916), in: Ders., Schriften, S. 177: [...] Später hat die Kirche des Mittelalters mit ihren Mysterien und Passionsspielen die Wiege des heutigen Theaters gebaut [...]. Vgl. Martinů, [Unveröffentlichter Aufsatz] (1934), in: Divadlo Bohuslava Martinů, S. 205: [...] ich suchte Vorlagen, die einst selbst Theater waren. So musste ich auf das mittelalterliche Theater, die Mirakel und Mysterien stossen [...]. 21 Zitat Hofmannsthal, Das Spiel vor der Menge (1911), in: Ders., Gesammelte Werke, Prosa III, S. 63. 22 Vgl. Paul Pörtner, Vorwort zu Tairow, Das entfesselte Theater (1989), S. 21. Zur Bedeutung des mittelalterlichen Spiels bei Majakovskij siehe Schwarz, Drama der russischen und tschechischen Avantgarde als szenischer Text (1980), S. 226 f.; zu Wachtangow, Tairow, Baty u.a. siehe auch die Texte zum Theater des tschechischen Regisseurs Jindřich Honzl, Martinůs Wunschregisseur für die Hry o Marii (Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 60 und S. 187), Honzl, Sláva a bída divadel (1937) sowie dessen russische Theatergeschichte Moderní ruské divadlo (1928). 23 Diesem Postulat wurde vom ‚Groupe des Six‘ im Grunde nur Arthur Honegger mit Le Roi David und der Operette Les Aventures du Roi Pausole gerecht. Vgl. Rosteck, Poulenc und Milhaud (Druck in Vorbereitung). 112 Dass Martinůs Kenntnisse vom Theater des Mittelalters hauptsächlich auf den Schriften Batys und Dubechs beruhten, scheint ausser Frage zu stehen, räumte doch der Komponist selbst ein, unter anderem aus dessen [Batys] Schriften seine Informationen bezogen zu haben24. In welchem Masse er sich bei seiner Arbeit an den Hry o Marii auf die Aussagen des Regisseurs abstützte, zeigt etwa Martinůs Aufsatz O divadle středověku [Vom Theater des Mittelalters], der über weite Teile hinweg als Paraphrase des Kapitels Le Théâtre de la chrétienté aus der von Baty zusammen mit René Chavance verfassten Theatergeschichte Vie de l'art théâtrale anmutet25. Nicht nur Batys und Chavances Abhandlung war genau zu demjenigen Zeitpunkt erschienen, als sich Martinů mit seiner Trilogie zu befassen begann, nämlich in den Jahren 1931 und 1932, sondern auch die ersten beiden Bände von Dubechs fünfteiliger Histoire générale illustrée du Théâtre, eine Theatergeschichte, die trotz der zahllosen Umzüge Martinůs während zwei Jahrzehnten zu dessen Bibliothek gehören sollte26. Für die Konzeption der Hry o Marii ist insbesondere der erste Teil des zweiten Bandes, Le Théâtre des miracles et des mistères, von Bedeutung. Dort legte Dubech ausgehend vom Drame liturgique des 12. Jh. die Verschiebung über die bereits profanen Miracles des 14. Jh. bis zu den Mistères des 15. Jh. dar, indem er die Entwicklung explizit einem kontinuierlichen Qualitätszerfall gleichsetzte27. Aucun théâtre n'a été plus éloigné du tréteau de quatre planches des classiques – mit diesem vernichtenden Urteil sprach Dubech den Mysterien jeglichen künstlerischen Wert ab und qualifizierte sie als rein theatergeschichtlich relevante Erscheinung ab, während Baty zwar ebenfalls die literarische Qualität der Texte relativierte, aber dennoch nicht auf einem direkten Vergleich des mittelalterlichen Mysteriums mit der antiken griechischen Tragödie verzichten mochte28. Obwohl Dubech und Baty in ihrer jeweiligen Schilderung der mittelalterlichen Theatergeschichte unzählige Parallelen aufweisen, indem sie nicht nur dieselbe Terminologie verwendeten, sondern darüber hinaus wiederholt identische Beispiele zitierten, bewog die auf den entgegengesetzten Extremen beruhende Wertung der späteren Mirakel und insbesondere der Mysterien Dubech dazu, die Kritik an der Gattung direkt mit einer grundsätzlichen Infragestellung von Batys praktischer Theaterarbeit zu verknüpfen. 24 Zitat Martinů, O divadle středověku [Vom Theater des Mittelalters] (1934), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 184. 25 Ebd., S. 183-186; Baty/Chavance, Vie de l’art théâtral (1932/1979), S. 71-86. 26 Vgl. Březina, Discovering Bohuslav Martinů's estate (1995), S. 2. 27 Dubech, Histoire générale illustrée du Théâtre, Bd. 2 (1931), S. 1-105. 28 Zitat ebd., S. 96. Baty/Chavance, Vie de l’art théâtral (1932/79), S. 86: On ne saurait, certes, comparer les textes d'Ardnoud Greban à ceux d'Eschyle, mais si la réalisation littéraire apparaît inférieure, la conception théâtrale est aussi belle. 113 Mais la vraie place des mistères n'est pas dans l'art en général, elle est dans l'histoire du théâtre. Si important qu'ait pu être leur rôle dans les domaines voisins, leur valeur littéraire et dramatique paraît mince ou nulle. C'est un reproche grave et même essentiel. Mais nous avons eu des raisons de dire qu'ils ne méritaient pas l'enthousiasme de certains zélateurs, entre autres de M. Gaston Baty 29. Mit dieser Kritik zielte Dubech auf Batys Ideal vom théâtre intégral, wonach es galt, an vergangene Epochen anzuknüpfen, um zerbrochene Traditionen wieder zusammenzufügen, ein Ziel, das dieser ab 1930 als Intendant des ‚Théâtre Montparnasse‘ konsequent umzusetzen begann. Unter dem théâtre intégral verstand Baty ein dem Realismus diametral entgegengesetztes Theaterkunstwerk, das sich in der angestrebten Totalität der szenischen Mittel – Bühnenbild, Beleuchtung, Kostüme, Musik, Bewegung und statuarische Präsenz – an den christlichen Mysterienspielen orientierte30. Wenn sowohl Martinů als auch der von ihm als einer der besten Pariser Bühnenschaffenden bezeichnete Baty die Mysterienspiele des 15. Jahrhunderts zu einem Höhepunkt der Theatergeschichte erklärten, so tat dies ersterer aus praktischen, letzterer jedoch aus religiösen Gründen. Martinů betonte wiederholt, dass ihn primär die konsequente Anlage als Volksspektakel und das dadurch hervorgerufene Publikumsinteresse faszinierte, das im ausgehenden Mittelalter Zehntausende zur Aufführung gelockt hatte31. Da er bei den Hry o Marii beabsichtigte, auf mittelalterliche Legenden zurückzugreifen, die einst als Theatervorlagen gedient hatten, kam er nicht um eine religiöse Thematik umhin, fussten doch sämtliche überlieferten volksfestartigen Spiele des 12. bis 15. Jahrhunderts auf liturgischen oder zumindest geistlichen Vorlagen – die gattungsimmanente Verquickung von Theater und Kirche sowie die Angst, dass diese die Religion der Lächerlichkeit preisgäbe, hatte 1676 schliesslich zu einem Verbot der Mysterienaufführungen in Frankreich geführt32. Texte und Inhalte sind zwar religiös, aber meine Absicht war, „Theater“, d. h. Volkstheater zu machen. Es ist somit nicht eine Bearbeitung im religiösen, sondern im volkstümlichen, populären Sinn. Es sind bloss Theatertexte des Mittelalters, weshalb die religiösen Inhalte 29 Dubech, Histoire générale illustrée du Théâtre, Bd. 2 (1931), S. 102. Im Jahr 1927 schloss sich Gaston Baty mit den drei Regisseuren Charles Dullin, Louis Jouvet und Georges Pitoëff zum ‚Cartel‘ zusammen, das dem vorherrschenden Realismus ein theatralisches Theater entgegensetzen wollte. Vgl. Simon, Gaston Baty (1973), S. 159-170 sowie Gronau, Das Theater Montparnasse unter der Direktion von Gaston Baty (1970), S. 30. 31 Zitat Martinů, O divadle středověku [Vom Theater des Mittelalters] (1934), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 184. Vgl. ebd., S. 186. 32 Siehe Histoire générale illustrée du Théâtre, Bd. 2 (1931), S. 100. 30 114 vorgegeben sind. Ansonsten suche ich überall den theaterhaften Nutzen mit der Annäherung des Ausdrucks an die volkstümliche Überlieferung der Legenden33. Indem sich Martinů von einer religiösen Absicht distanzierte, entsprach er gewissermassen der durch die Wagner-Opposition in Paris bedingten Skepsis gegenüber jeglicher musikalischen ‚Kunst-Religion‘, fand doch eine zum literarischen Schaffen parallel verlaufende Hinwendung zu religiösen Themen nur in Einzelfällen statt, etwa bei Arthur Honeggers Le Roi David oder Francis Poulencs Litanies à la Vierge Noire34. Verstand Martinů das religiöse Moment als Mittel zum Zweck, überhaupt mittelalterliche Vorlagen verwenden zu können, bildeten die Lehren des Franz von Assisi und des Thomas von Aquin mit ihrer Totalität der katholischen Weltsicht die Grundlage von Batys Theaterkonzeption. Analog dem theologischen Weltbild Thomas von Aquins, das Geist, Materie, Vernunft und Glauben als wesensmässige Einheit begreift und in einem hierarchischen System ordnet, vereint das mittelalterliche Theater in Batys Augen die bis dahin voneinander isolierten Künste – Literatur, Tanz, Musik, Malerei und Bildhauerei – zu einer vollkommenen Theaterform35. Es war Batys eigentliches Ziel, diese Theaterform wiederzugewinnen, die ebenso wie die harmonische Totalität des Thomismus drei fatalen Entwicklungen zum Opfer gefallen sei, nämlich der Reformation, dem Humanismus und der Renaissance36. In Batys Augen stellt sich die Entwicklung folgendermassen dar: Entsprechend der im 15. Jahrhundert einsetzenden Aufspaltung des Menschen in Seele, Geist und Körper, die eine fragmentarische Weltsicht mit sich brachte, wurde die mittelalterliche Totalität auch in der Kunst zersetzt, so dass allein das Interesse an der äusseren Form, nicht aber die Idee der transzendenten Realität erhalten blieb37. Während sich das Theater der französischen Klassik an den Intellekt wandte und zu einer ausschliesslichen Angelegenheit des esprit wurde, blieb die ‚antikatholische‘ Ästhetik – die vollständige Trennung von Geist und Körper – auch im 33 Martinů, [Interview anlässlich der Uraufführung der Hry o Marii] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 200; siehe auch Brief Martinůs an František Muzika, vom 30. April 1934 aus Paris, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 187. In Martinůs Kompositionen treten wiederholt religiöse Themen auf, so etwa mit der Legende der Svatá Dorota [heilige Dorothea] im Špalíček (1931-32), in den beiden tschechischen Rhapsodien (1918 und 1945), der Polní mše [Feldmesse] (1939) und schliesslich in der Griechischen Passion (1959), seiner letzten Oper. Trotz der wiederkehrenden Auseinandersetzung mit geistlichen Themen war Martinůs Verhältnis zur Religion kein starres: Seine Position fern von jeglichem kirchlichen Formalismus spiegelt sich unter anderem darin, dass er abgesehen von zwei frühen Gelegenheitsstücken keine im engeren Sinne geistliche Musik geschrieben hat (Offertorium und Ave Maria; beide 1912, verschollen). 34 Pistone, La musique contemporaine et le sacré (1992), S. 20. 35 Vgl. Meiler, Kunst und Kult im Werk von Gaston Baty (1984), S. 35-37. 36 Siehe Baty, Le Masque et l’Encensoir (1926), S. 260. 37 Ebd., S. 259. 115 18. und 19. Jahrhundert unter anderen Vorzeichen erhalten. In jedem Fall resultierte hieraus die Vormachtstellung der Sprache im Theater, die alle anderen szenischen Elemente zur nahezu überflüssigen Dekoration werden liess – die Romantik wechselte bloss die Requisiten aus, ohne am klassischen Grundsatz zu rütteln, der weiterhin hiess: Sire le Mot38. Während die hypertrophie de l’élément verbal laut Baty das universelle mittelalterliche Theater zunichte gemacht hatte, stellte sie in den Augen Martinůs den Grund für den beklagenswerten Zustand der Oper als einem rezitativischen, vom Text tyrannisierten Musiktheater dar39. Als Reaktion darauf beabsichtigten beide, in ihrer jeweiligen Bühnenarbeit die szenischen Elemente als dem Text ebenbürtig zu behandeln: Bühnenbild, Beleuchtung, Kostüme, Musik und Bewegung sollten innerhalb ihrer Ausdrucksmöglichkeiten das ihre zum Theaterereignis beitragen40. Im Unterschied zum Regisseur Baty, der sich mit seinem Theater um eine gattungsimmanente Adaption der Mysterienspiele bemühte, mussten sich für den Komponisten Martinů bei den Hry o Marii geradezu unlösbare Probleme stellen, galt es doch, die Spiele für eine Opernbühne nutzbar zu machen. L’équilibre que la tragédie avait rompu au profit de la littérature, l’opéra le rompt à son tour au profit de la musique et du spectacle. Nulle part ne subsistait l’harmonie des mistères41. Alle Künste in der höchsten Kunst zu vereinen, strebte Baty mit seinem Ideal einer mystique du théâtre an, das die Bühne zu einem Ort der Offenbarung göttlicher Harmonie werden lässt42. Eine Dominanz der Musik, wie sie der Oper eignet, schliesst dagegen von vornherein ein Gleichgewicht zwischen den einzelnen szenischen Elementen und damit die Voraussetzung für das angestrebte Abbild der göttlichen Totalität aus. Schliesslich haben die einzelnen Künste ihre Eigenständigkeit aufzugeben und nur die jeweils benötigten Mittel zum Ganzen beizusteuern, weshalb es sich nicht um eine blosse Addition der Ausdruckselemente handelt, sondern um einen eigentlichen Verschmelzungsprozess mit dem Zweck, à marier de nouveau tous les élément de la synthèse théâtrale, à retrouver l’ordre et l’équilibre qui ont fait les chefs-d’œuvres de jadis43. Martinů begegnete der Unmöglichkeit einer Mysterien-Oper in zweierlei Hinsicht: Erstens betont er, im Unterschied zu Baty keine vollständige Synthese der 38 Ebd., S. 279-319. Zitat ebd., S. 316; Zitat Martinů, Přežila se opera? [Hat sich die Oper überlebt?] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 225. 40 Vgl. Gronau, Das Theater Montparnasse unter der Direktion von Gaston Baty (1970), S. 25. 41 Baty, Le Masque et l’Encensoir (1926), S. 299 f. 42 Zitat ebd., S. 233. 43 Zitat Baty/Chavance, Vie de l’art théâtral (1932/1979), S. 293 f.; vgl. auch Meiler, Kunst und Kult im Werk von Gaston Baty (1984), S. 53. 39 116 szenischen Elemente anzustreben, und zweitens bezeichnete er die Hry o Marii nicht als Oper, sondern als Spiele44. Obwohl Martinů in gleichem Masse wie Baty beabsichtigte, die im Theater eingesetzten unterschiedlichen Mittel nicht als Verdoppelung der Sprache, sondern den Bedingungen des Dramas entsprechend zu verwenden, lehnte er eine Verschmelzung der Künste entschieden ab45. So suchte er eine Verbindung von Musik, Literatur, szenischen Aspekten, Bühnenbild, Gestik und Tanz, die deren Eigenständigkeit bewahren, aber auch die Freiheit gewähren sollte, im gegebenen Moment die jeweils am besten geeignete Kunst hervortreten zu lassen46. Während die Aufwertung der szenischen Elemente die Bedeutung der Sprache beträchtlich mindert, bewahrt der Verzicht auf eine Synthese die Musik davor, zu einem blossen Bühnenmittel zu verkommen. Trotz der Vorrangstellung, die Martinů der Musik einräumte, setzte er ihrer überragenden Dominanz wiederum insofern Schranken, als er auf einer Differenzierung zwischen symphonischer Musik und Oper beharrte. Wir müssen von der Diktatur der Szene loskommen, und was uns bleibt, ist die Diktatur der Musik. Gern und viel wird von der symphonischen Arbeit in der Oper gesprochen. Dieser Terminus bezieht sich auf den Stil symphonischer Musik überhaupt und kann zu vielen Missverständnissen führen. Wollen wir Theater machen, müssen wir Musik fürs Theater schreiben und weder symphonische noch kammermusikalische. Diese beiden Richtungen haben ihre eigenen Grundsätze, die Formation der Themen und des inneren Organismus sind völlig unterschiedlich vom Schaffen fürs Theater, wo sozusagen bei jedem Schritt das literarische oder das szenische Element in die Entwicklung eingreift. [...] Das Symphonische in der Konzertmusik und der symphonische Strom im Theater sind zwei unterschiedliche Dinge47. Indem Martinů trotz der Aufwertung sämtlicher szenischen Elemente der Musik den Status einer ‚prima inter pares‘ einräumte und zugleich das wirkliche Theater zum Ziel erklärte, plazierte er das Werk auf dem Grat zwischen Oper und Mysterienspiel. Damit distanzierte er sich explizit von jeglichem Bestreben, psychologische Differenzierungen in der Musik wie- 44 Zitat Martinů, [Interview anlässlich der Uraufführung der Hry o Marii] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 200. 45 Martinů, Poznámky k opeře mirakl panny Marie [Anmerkungen zur Oper Mirakel der Jungfrau Maria] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 195. Martinů äusserte wiederholt den Wunsch, das Konzept für die Inszenierung bereits während der Komposition mit dem Regisseur und Bühnenbildner zu erarbeiten, um so eine möglichst ideale Verbindung der einzelnen Elemente zu begünstigen. Siehe Martinů, [Interview anlässlich der Uraufführung der Hry o Marii] (1935) in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 200. 46 Martinů, Před premiérou Her o Marii [Vor der (Prager) Premiere der Hry o Marii] (1936), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 202. 47 Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Premiere] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 218. 117 derzugeben, was er als eigentliches Problem der zeitgenössischen Oper erachtete48. Da die Musik nicht fähig sei, Aussermusikalisches sinnfällig zu transportieren, hatte dies laut Martinů zur Folge, dass in besagten Opern das Libretto ständig Erklärungen hinsichtlich psychologischer Zustände zu liefern hatte, deren Verständlichkeit für die Rezeption der Werke unabdingbar war, infolgedessen den Komponisten kaum etwas anderes übrig blieb, als die Texte rezitativisch zu setzen. Weil jedoch die Gesangspartien in erster Linie deklamiert werden sollten, trugen sie kaum zum musikalischen Ausdruck des Geschehens bei, weshalb die Intensität der Gefühlswallungen nurmehr durch die Orchesterdynamik wiedergegeben werden konnte49. Dieser Praxis entgegenzuwirken und den Schwerpunkt des Werkes aus dem Orchestergraben zurück auf die Bühne zu holen, was mit einer Aufwertung der Singstimme verbunden ist, liegt den Hry o Marii als musikalische Intention zugrunde. Im Fall der Hry o Marii bedeutet das Bestreben, die Bühne und ihre szenischen Elemente zu betonen, das Theater jederzeit als solches erkennbar zu machen, was nicht zuletzt mit der antiillusionistischen Idee verbunden ist, das Publikum wachzurütteln50. Zu diesem Zweck trägt nicht zuletzt das in hohem Masse inkohärente Libretto bei – ein zentrales Charakteristikum der Hry o Marii –, das direkt Martinůs Auffassung von der nicht auf Entwicklungen, sondern vielmehr auf Unwahrscheinlichkeiten basierenden Logik des Theaters entspricht51. Allein das jeweilige Auftreten Marias, sei es in einer Haupt-, sei es in einer Nebenrolle, bildet ein verbindendes Merkmal im Libretto der Hry o Marii, die aus einem Zyklus von vier eigenständigen Einaktern bestehen, wobei insofern eine latente Zweiteiligkeit erkennbar ist, als der erste Akt als Prolog zur ganzen Oper sowie der dritte als eine Art Pastorale zwischen den beiden grossen Akten angelegt ist52. Mit ihrem Titel rekurriert die Oper auf die Miracles de Notre Dame, eine Referenz an die früheste Form der liturgisch unabhängigen, mittelalterlichen Spiele, die sich nicht nur in der wiederholten Erscheinung Marias, sondern auch in der Konzeption des zweiten und vierten Aktes als Mirakel niederschlägt53. 48 Martinů, [Interview anlässlich der Uraufführung der Hry o Marii] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 203. 49 Martinů, Přežila se opera? [Hat sich die Oper überlebt?] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 226-229. 50 Zitat Martinů, Poznámky k opeře mirakl panny Marie [Anmerkungen zur Oper Mirakel der Jungfrau Maria] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 195. 51 Ebd., S. 195. 52 Zitat Martinů, Hry o Marii (1935-36), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 210. Siehe auch Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 222. 53 Vgl. Martinů, O divadle středověku [Vom Theater des Mittelalters] (1934), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 184 sowie Martinů, Poznámky k cyklu Hry o Marii [Anmerkungen zum Zyklus Hry o Marii] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů S. 208, Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, 223. 118 Der erste Akt der Hry o Marii basiert auf dem vermutlich aus dem 11. Jahrhundert stammenden Mysterienspiel Sponsus: Oc est de mulieribus – les vièrges sages et les vièrges folles, das nicht zuletzt deshalb von theatergeschichtlicher Relevanz ist, als es bereits in Abbé Jean Lebeufs 1741 erschienen Abhandlung über geistliche Gesänge Erwähnung fand – und auch fast 200 Jahre später von Dubech angeführt werden sollte –, nämlich als ältestes Beispiel für die Hinwendung der ursprünglich liturgisch verankerten lateinischen Spiele zum Profanen54. Die Profanisierung fand einerseits in der Ablösung von der Messe und andererseits in der Verwendung eines gemischtsprachlichen, abwechselnd in Latein und Langue d’oc geschriebenen Textes statt, nicht aber im nach wie vor geistlichen Inhalt, beruht doch das mehrfach aufgegriffene, bearbeitete und im 12. Jahrhundert in Saint-Martial de Limoges niedergeschriebene Spiel auf dem Matthäusevangelium (25. Kapitel, Verse 1-13)55. Die Wahl des ältesten bekannten mittelalterlichen Mirakelspiels für die Eröffnung der Hry o Marii mutet gleichsam als höchste Konsequenz von Martinůs proklamierter Rückkehr zu den Wurzeln des (mittelalterlichen) Theaters an, wenngleich die von ihm zu diesem Zweck beim Schriftsteller, Poetisten und späteren Surrealisten Vítězslav Nezval in Auftrag gegebene tschechische Übertragung wiederum eine Verbindung mit der Avantgarde der Zwischenkriegszeit zu knüpfen vermag56. Nicht dass die Panny moudré a panny pošetilé [Die klugen und die törichten Jungfrauen] über eine blosse Übersetzung hinausreichen würden – der ursprüngliche Text blieb unverändert erhalten und wurde bloss am Ende durch ein Zitat aus dem Evangelium ergänzt –, sondern dass Nezval dieses texttreue Vorgehen mit seiner Literaturvorstellung in Einklang zu bringen vermochte, zeigt die damalige Aktualität der mittelalterlichen Vorlage57. Schliesslich hatte Martinů dem Schriftsteller im Begleitbrief zur ersten Handlungsskizze sogar angeboten, dass dieser trotz der bereits getroffenen Abmachung von der Zusammenarbeit zurücktreten könne, falls ihm die Arbeit völlig fremd und ‚daneben‘ erscheinen sollte58. 54 Abbé Jean Lebeuf, Dissertations sur l’Histoire ecclésiastique et civile de Paris (1741), Bd. 2, S. 65; siehe auch Michel/Monmerqué, Théâtre français au Moyen-Age (1839), S. 1; Dubech, Histoire générale illustrée du Théâtre, Bd. 2 (1931), S. 31 f.; Martinů, O divadle středověku [Vom Theater des Mittelalters] (1934), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 184. Zu Sponsus (L’Epoux) siehe auch Lioure, Le théâtre réligieux en France (1983), S. 9 f. 55 St. Martial Nr. 100 / Bibl. du Roi Nr. 1139: Oc est de mulieribus, sponsus: les vièrges sages et les vièrges folles, in: Michel/Monmerqué, Théâtre français au Moyen-Age (1839), S. 1-9. 56 Nezval, Veselá Praha, překlady libret, pásma, písně [Fröhliches Prag, Librettoübersetzungen, Balladen, Lieder], in: Ders., Dílo, Bd. 21, S. 87-90. 57 Zitat Martinů, Hry o Marii (1935-36), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 210. 58 Zitat Martinů, Brief von Martinů an Nezval, mit beigefügter Handlungsskizze der ersten beiden Akte der Hry o Marii, undatiert [zwischen November 1932 und August 1933], Muzeum Bohuslava Martinů in Polička (CZ), ohne Signatur (2+10 Seiten), zuvor: Nachlass Vítězslav Nezval (im Památník národního písemnictví). 119 Mariken z Nimègue, der zweite Akt der Hry o Marii geht auf die umfangreiche flämische Legende Mariechen van Niemweghen aus dem 15. Jahrhunderts zurück, die ihrerseits auf einer verschollenen spanischen Vorlage basiert. Im Gegensatz zum Libretto des ersten Aktes war es hierbei jedoch Martinůs Anliegen, nur das für die Handlung Unerlässliche beizubehalten, was in Anbetracht dessen, dass die Aufführung des flämischen Mirakels einst 3-4 Tage gedauert hatte, geradezu zwingend war59. Die Einrichtung dieses Textbuches nahm der französische Schriftsteller Henri Ghéon vor, der zwar heute vollständig in Vergessenheit geraten ist, jedoch mit der von ihm zusammen mit Henri Brochet 1925 gegründeten Schauspieltruppe Compagnons de Notre-Dame laut Raymond die ‚Renaissance‘ des Mittelaltertheaters in Frankreich überhaupt eingeleitet hatte60. Der Sohn einer praktizierenden Katholikin und enge Freund André Gides hatte sich bis zum Ersten Weltkrieg als Atheist verstanden, fand jedoch durch das Grauen des Krieges, den er als Freiwilliger an der Front erlebt hatte, zum Katholizismus zurück – Après l’enthousiasme de la guerre, j’en réalise à présent toute l’horreur61. Von da an versuchte er, seine ersten dreissig gottlosen Lebensjahre zu sühnen, weshalb er sich bis zu seinem Tode mit missionarischem Eifer hauptsächlich dem geistlichen Theater unter Rückgriff auf mittelalterliche Spiele widmete – in welchem Mass sich neben Baty auch Ghéon am Thomismus orientierte, zeigt etwa dessen Stück Triomphe de Saint Thomas d’Aquin62. Dennoch ist die Einschätzung Raymonds, Ghéon zum alleinigen Ursprung der Mittelalterbegeisterung des französischen Theaters der Zwischenkriegszeit zu erklären, nicht nur in Anbetracht der zeitgleichen Tätigkeit des ebenfalls dem Thomismus verpflichteten Baty oder dem Theater Paul Claudels zu relativieren, sondern auch insofern, als D’Annunzio mit der Uraufführung des Martyre de Saint-Sébastien im Théâtre du Châtelet 1911 den oben Genannten um Monate zuvorgekommen war63. Wenngleich Ghéon nicht als eigentlicher Entdecker des mittelalterlichen Mysteriums im 20. Jahrhundert gelten kann, so zeugt dennoch das überwältigende Publikumsinteresse, das etwa 1938 in Lourdes 80'000 Zuschauer in seine Vorstellung strömen liess, von einem ausserordentlich erfolgreich umge- 59 Zitat Martinů, Hry o Marii (1935-36), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 210; Zitat Martinů, Před premiérou Her o Marii [Vor der (Prager) Premiere der Hry o Marii] (1936), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 201. Zur flämischen Vorlage siehe Coigneau, Mariken van Nieumeghen (1996); Cordan, Jedermann, Lanselot und Sandrein (1950), S. 77-126. 60 Raymond, Henri Ghéon (1939), S. 64-68. 61 Brief Ghéons an André Gide, zitiert nach Raymond, Henri Ghéon (1939), S. 44. Vgl. auch Gugelot, Henri Ghéon ou l’histoire d’une âme en guerre (1992), S. 67-93. 62 Zu Ghéons Triomphe de saint Thomas d’Aquin (1923) siehe ebd., S. 75-80. Vgl. auch Bossut Ticchioni, "La vie profonde de Saint François d’Assise” de Henri Ghéon (1985), S. 77-88 sowie Bossut Ticchioni, Le Moyen Age de Ghéon (1983), S. 539-568. 63 Vgl Lioure, Le Théâtre religieux en France (1983), S. 26, 92. 120 setzten Anliegen, einer prise de contact plus directe avec le public64. Da Ghéon und Martinů im Bestreben, das Publikum zurückzugewinnen, vollständig übereinstimmten, und der Komponist mit grosser Wahrscheinlichkeit beabsichtigte, diesen Opernakt als Einakter in Frankreich zur Aufführung zu bringen, lag es vor dem Hintergrund der intendierten Bearbeitung mittelalterlicher Vorlagen nahe, mit Ghéon genau denjenigen Schriftsteller zu gewinnen, der den grössten Publikumszulauf zu erzielen vermochte65. Ghéons Interesse an einer Zusammenarbeit mit Martinů, die in Anbetracht der damit verbundenen Aufwertung der Musik nicht in völligen Einklang mit dem thomistischen Ideal zu bringen ist, lässt sich wiederum mit der christlich motivierten Kunstauffassung des Theaterautors erklären, wonach letztlich jede künstlerische Aktion als eine göttliche zu verstehen ist: Un artiste sert toujours Dieu, même quand il le blasphème ou le nie, par le petit rayon qu’il capte de la beauté Divine et qu’il fait descendre sur nous66. Dass für die tschechischen Hry o Marii schliesslich der Schriftsteller Vilém Závada die Übersetzung aus dem Französischen ins Tschechische vornahm, brachte zwar keine inhaltliche, jedoch (wie weiter unten gezeigt werden soll) eine deutliche Abkehr vom distanzierten Sprachstil Ghéons mit sich. Während die Libretti von Panny moudré a panny pošetilé und Mariken z Nimègue auf bearbeitete Legenden zurückgehen und, trotz der nur bedingt wörtlichen Übersetzung sowie den starken Kürzungen im zweiten Akt, einen klaren Handlungszusammenhang aufweisen, ist ein solcher sowohl bei Narození páně [Die Geburt des Herrn] als auch bei Sestra Paskalina [Schwester Paskalina] kaum mehr gegeben. Im Unterschied zu den ersten beiden Akten der Hry o Marii, für welche Martinů Schriftsteller herangezogen hatte, richtete der Komponist die übrigen Libretti des Zyklus selbst ein, wobei er unterschiedliche Volksliedtexte sowie geistliche Texte zu mehr oder weniger sinnfälligen Erzählungen zusammensetzte. Obwohl Martinů selbst in seinem Vorwort zum Klavierauszug der Sestra Paskalina erklärte, die Volksliedtexte der Sammlung František Bartoš’ entnommen zu haben, und dies in Anbetracht dessen, dass er bereits für die Staročeské říkadla [Alttschechische Sprüche] sowie für Špalíček aus dieser Quelle geschöpft hatte, durchaus glaubhaft anmuten könnte, ist die vorrangige Bedeutung Bartoš’ für das Libretto in Zweifel zu ziehen67. Dies jedoch nicht aufgrund des späten Aufsatzes Martinůs über Janáček, worin er beschreibt, in welchem Masse ihm die in den 1950er Jahren entdeckte Sammlung Bartoš’ geradezu als Offenbarung erschienen sei. Es steht 64 Zitat Ghéon nach Raymond, Henri Ghéon (1939), S. 57. Martinů, Poznámky k cyklu Hry o Marii [Anmerkungen zum Zyklus Hry o Marii] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 206. 66 Ghéon, zitiert nach Sistig, Ghéon et la musique (1997), S. 311. 67 Martinů, Hry o Marii, Vorwort zu Sestra Paskalina, Klavierauszug, S. 217. 65 121 ausser Frage, dass er damit die grossen, in Zusammenarbeit mit Leoš Janáček entstandenen Publikationen gemeint haben könnte, besass er doch eine Ausgabe davon bereits im Jahr 1930 – welche Publikation genau zur Offenbarung geführt hat, muss folglich offen gelassen werden68. Auch wenn ein Konvolut Bartoš’ gemäss Martinůs eigener Aussage für das Libretto der Sestra Paskalina zumindest eine Rolle gespielt haben könnte, so ist dennoch davon auszugehen, dass die mährische Volksliedsammlung František Sušils als primäre Vorlage für die letzten beiden Akte diente69. Wie bedeutend die im Jahr 1860 abgeschlossene Ausgabe des Pfarrers Sušil trotz aller nachfolgenden Sammlungen für die tschechische Musik geblieben ist, spiegelt sich gleichermassen in Dvořáks Auseinandersetzung damit, wie in der Hochachtung Janáčeks vor dem verdienstvollsten Sammler und in Martinůs uneingeschränktem Votum, wonach er die Sammlung Sušils für die beste hielt70. Obwohl aufgrund der zahlreichen Überschneidungen von Sušils und Bartoš’ Repertoire – sowie in geringerem Masse der böhmischen Sammlung Karel Jaromír Erbens – nicht in jedem Fall eindeutig auf die der Oper zugrundeliegenden Quellen geschlossen werden kann, liegt es dennoch auf der Hand, dass Sušils Konvolut gerade für den dritten Akt von primärer Bedeutung war71. So schrieb Martinů etwa an František Muzika, den Bühnenbildner der Uraufführung, dass der zentrale Text des Librettos von Narození páně, das dem Titel entsprechend von der Geburt Jesu handelt, in Sušils mährischem Lied Porod panny Marie [Die Geburt der Jungfrau Maria] zu finden sei72. Ausserdem räumte der Komponist selbst ein, dass er durch den Umstand, die Oper in Paris geschrieben zu haben, auf diejenigen Texte zurückgreifen musste, die ihm überhaupt zur Verfügung standen, nämlich vor allen Dingen [auf] die Sammlung mährischer Lieder von Sušil73. 68 Zitat Martinů, O Janáčkovi [Über Janáček] (1955), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 354. Martinů hatte die Sammlung Bartoš’ 1930 in Polička vergessen, weshalb er um deren Sendung nach Paris bat (Brief vom 28. 12. 1930 aus Paris, in: Muzeum Bohuslava Martinů, Polička, CZ): Ich bitte Euch, mir die Sammlung mährischer Lieder von Bartoš zu senden, es ist ein dickes Buch, ich glaube, es unten beim Klavier liegen gelassen zu haben [...]. Bartoš und Janáček publizierten zusammen folgende Volksliedsammlungen: Kytice moravských písni [Ein Strauss mährischer Volkslieder] mit 174 Liedern, 1890, 2. Aufl. 1893, 3. erw. Aufl. (195 Lieder) 1901; Nová sbírka moravských písni [Eine neue Sammlung mährischer Volkslieder] mit 2057 Liedern, 1899-1901. Zu Janáčeks Betätigung als Volksliedsammler siehe Saremba, Leoš Janáček (2001), S. 112-126; Tyrrell, Czech Opera (1988), S. 244-246. 69 Sušil, Moravské národní písně. 70 Zitat Janáček, in: Bartoš/Janáček, Národní písně moravské, Předmluva [Vorwort] (1901), (ohne Seitenzahl); Zitat Martinů, in: Martinů, O Janáčkovi [Über Janáček] (1955), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 354. Zur Rezeption von Sušils Sammlung siehe Tyrrell, Czech Opera (1988), S. 209 f. sowie Štefková, Das „Prinzip der Sprechmelodie“ Leoš Janáčeks (2003), S. 146. 71 Erben, Prostonárodní české písně a říkadla. 72 Beilage zum Brief Martinůs an František Muzika, vom 29. 5. 1934 aus Paris, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 190. 73 Zitat Martinů, [Unveröffentlichter Aufsatz] (1934), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 206. 122 Tabelle 1: Narození páně (Hry o Marii, III. Akt) Vorlage Quelle [Preludio] Porod panny Marie [Die Geburt der Jungfrau Maria] Sušil Nr. 25, alle Strophen Zvěstování panně Marii [Mariae Verkündigung] Sušil Nr. 31, alle Strophen Křestění Ježíšovo [Die Taufe Jesu] Sušil Nr. 24, Strophen 1-5, 8-9 Gloria in excelsis Deo [...] Co to znamená v Betléme Erben, Hra s Jesličkami, píseň I, II [Krippenspiel, nového? [Was gibt es Neues in Betlehem?] Lieder I, II], S. 45 Während der dritte Akt der Hry o Marii die Geburt Jesu in einer volkstümlichen, bibelfernen Version wiedergibt, und dies nicht nur ein- sondern viermal, bildet das 24. Mirakel des Rosarius aus dem 14. Jahrhundert das Grundgerüst der Handlung des vierten Aktes. Vermutlich weil die Handschrift mit De la nonnain tresoriere qui rend ses cles a l´ymage Nostre Dame et ala jouer au monde, et pu revint einen unpraktikablen Titel aufwies, verzichtete Dubech in seiner Theatergeschichte ganz auf einen solchen und beliess es bei einer kurzen Handlungszusammenfassung: [...] cette religieuse qui s'enfuit avec un chevalier, malgré les avertissements de Notre-Dame, et revint au bout de trente ans74. Indem Martinů den letzten Akt schliesslich Sestra Paskalina benannte, machte er nicht nur die Anlehnung an Julius Zeyers gleichnamige tschechischsprachige Bearbeitung des betreffenden Mirakels explizit, die dem Komponisten fürchterlich konfus erschien, sondern distanzierte sich zugleich von Maurice Maeterlincks Soeur Beatrice, ein auf demselben mittelalterlichen Spiel basierendes Theaterstück75. Trotz der Titelwahl ist die Nähe des Librettos zu Zeyers Dichtung nur eine scheinbare, denn wenn sich bereits die präexistenten Texte, die das Libretto bilden, einer engeren Anlehnung an eine konkrete Vorlage widersetzen, so muss eine solche in Anbetracht dessen, dass Martinů ein weiteres Mirakel in das Spiel integrierte, geradezu undenkbar erscheinen. 74 75 Rosarius, Miracle XXIV (livre 2, chapitre 7) in: Kunstmann, Miracles de Notre-Dame. Tirés du Rosarius, S. 105-111. Es ist durchaus möglich, dass Martinů durch Dubechs Theatergeschichte auf die Vorlage aufmerksam wurde. Vgl. Dubech, Histoire générale illustrée du Théâtre, Bd. 2 (1931), S. 48. Zitat Martinů, Brief von Martinů an František Muzika, vom 30. April 1934 aus Paris, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 187. Zeyer, Sestra Paskalina, in: Ders., Spisy, Bd. 12 (1903), S. 57-129; Maeterlinck, La Sœur Béatrice (1901), in: Ders., Théâtre, Bd. 3 (1902), S. 177-225. Dass Martinů Maeterlincks Sœur Béatrice kannte, steht ausser Frage, da er selbst das Theaterstück wiederholt erwähnte. Siehe Martinů, Před premiérou Her o Marii [Vor der (Prager) Premiere der Hry o Marii] (1936), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 201; Martinů, [Unveröffentlichter Aufsatz] (1934), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 205. 123 Sestra Paskalina, eine Legende. Diese kennen Sie bestimmt von Zeyer; noch habe ich sie nicht ganz fertiggestellt. Es ist die Geschichte einer Nonne, die aus dem Kloster floh, nach vielen Jahren dahin zurückgekommen ist und erkennt, dass Maria während ihrer ganzen Abwesenheit ihren Platz eingenommen hat. – Ich habe dies mit einem anderen Mirakel verbunden, in dem auf der Bühne ein Gericht zusammenkommt und Maria verhindert, dass das Feuer Paskalina berührt [...] 76. Während Maeterlinck vergleichbar mit Zeyers Legende gänzlich darauf verzichtete, die 25 Jahre szenisch zu schildern, die Beatrice nach ihrer Flucht mit Prince Bellidor fern vom Kloster verbracht hatte, und das dreiaktige Drama ausschliesslich im Kloster spielen liess, widmete Martinů die zweite Szene – in Anlehnung an das andere Mirakel – den Erlebnissen der Nonne. Dem Volksliedtext Zabila panička pána [Es tötete die Frau den Mann] gemäss kommt es zunächst zur Anklage wegen Mordes an ihrem Gatten, zum Todesurteil sowie dessen Vollstreckung, worauf mehrere geistliche Texte in Latein und Tschechisch folgen, während Maria verhindert, dass die Flammen des Scheiterhaufens Paskalina auch nur berühren. Ohne mit einem Wort auf dieses Wunder einzugehen, setzt schliesslich die dritte Szene mit der Rückkehr der Titelheldin ins Kloster ein, was analog zu den Legenden Maeterlincks und Zeyers zu einer Konfrontation der reuigen Paskalina mit den nichtsahnenden Nonnen führt, hatte doch Maria all die Jahre die Gestalt der Flüchtigen angenommen und diese vertreten. Im Unterschied zu seinen Vorgängern verzichtete Martinů darauf, den Konfliktgehalt dieses Aufeinandertreffens auszuschöpfen und entschied sich für eine neue Wendung der Geschichte, die in Ansätzen bereits bei Maeterlinck zu finden ist und dazu führt, dass Paskalina durch die Rufe ihrer Mitschwestern gleichsam aus dem Schlaf gerissen wird. Während bei Maeterlinck zwar mehrfach das Moment des Traumes angedeutet wird – etwa in der Szenenanweisung comme sortant d’un songe – , dies jedoch ohne Auswirkungen auf den Handlungsverlauf bleibt, spiegelt sich das Moment des Erwachens im Libretto darin, dass Paskalina an einer vergleichbaren Stelle ebenfalls zu erwachen scheint (jako když se probudí – als würde sie erwachen), darüber hinaus nun aber auch als Erwachende agiert77. So beantwortet sie ihre eigene Frage Kdo volá? [Wer ruft?] mit einer Antwort, die vom Vergessen der vergangenen 25 Jahre zeugt: Ach, již vím. Je čas jíti, sestri čekají, den je blízko [Ach, ich erinnere mich wieder. Es ist Zeit zu gehen, die Schwestern warten, der Tag ist nah]78. Obwohl sich dem 76 Beilage zum Brief Martinůs an František Muzika, vom 29. 5. 1934 aus Paris, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 190. 77 Maeterlinck, Sœur Béatrice (1901), in: Ders., Théâtre, Bd. 3 (1902), S. 213; Martinů, Hry o Marii, Sestra Paskalina, 3. Szene, T 12 nach Z 77. 78 Ebd., 3. Szene, T 1 nach Z 78. 124 Zuschauer damit die Möglichkeit anbietet, das Geschehene als Traum zu verstehen, wird diese Erklärung insofern wieder konterkariert, als die Statue der Maria mit dem Gewand Paskalinas bekleidet vom Sockel heruntersteigt und Paskalina Schlüssel sowie Kleider übergibt: Ob die Titelheldin zurückgekommen oder bloss erwacht ist, lässt sich – durchaus im Sinn des Komponisten – weder aus dem Libretto noch aus den szenischen Anweisungen erschliessen79. In sprachlicher Hinsicht ist die Frage nach einem direkten Einfluss der Theaterstücke Zeyers und Maeterlincks oder etwa der mittelalterlichen Vorlage auf das Textbuch insofern obsolet, als Martinů bei der Einrichtung des Librettos in vergleichbarer Weise wie im dritten Akt verfuhr: Das Spiel der Sestra Paskalina schöpfte ich einerseits aus Zeyer und andererseits aus fremdem Material, das ich in Frankreich gefunden habe. Nichtsdestotrotz bewahrte ich von beiden Quellen nur das Gerüst, denn das Spiel ist durch und durch von mährischer Volkspoesie durchdrungen80. Indem Martinů die überlieferte Legende nahezu ausschliesslich in Formulierungen fasste, die er aus der Volksliedsammlung Sušils sowie aus liturgischen und geistlichen Vorlagen schöpfte, gelangte er aufgrund der dadurch bedingten Aneinanderreihung von Liedern und geistlichen Texten zu einer dem mittelalterlichen Mirakel gewissermassen analogen Form. Un miracle, dit Petit de Julleville, c'est la mise en scène d'un fait merveilleux produit par l'intervention sensible d'un saint ou plus souvent de la sainte Vierge. Ce genre tient donc par des liens étroits à la religion, mais il est traité librement par l'auteur qui puise dans les apocryphes, les chansons de geste et les auteurs latins. Il comporte toujours un sermon, amené plus ou moins habilement au cours de l'action […]. La musique religieuse y tient une place considérable et la pièce se termine par un Te Deum ou par un cantique81. 79 Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 221. 80 Zitat Martinů, Poznámky k cyklu Hry o Marii [Anmerkungen zum Zyklus Hry o Marii] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 207. 81 Dubech, Histoire générale illustrée du Théâtre, Bd. 2 (1931), S. 40. 125 Tabelle 2: Sestra Paskalina (Hry o Marii, IV. Akt) Handlung Vorlage Quelle Preludio 1. Szene Paskalino! Kdo volá? [Paskalina! [Martinů] Die schlafende Paskalina erwacht Wer ruft?] kurz, erinnert sich an den Traum vom Ritter und schläft wieder ein Tanec stínů [Tanz des Schattens] Tanec démona [Tanz des Dämons]: - Frauenchor: Ave Maria, gratia - Ave Maria Der Ritter erscheint, Paskalina steht plena auf (Paskalina als Doppelrolle), - Paskalina: Maria, matko Milošti - [Gebet] betet zu Maria und flieht. Maria plná [Maria, barmherzige Mutter] nimmt ihren Platz ein Mezihra [Zwischenspiel] Na mšu svatú zvonijú [Sie läuten zur Sušil Nr. 20 Heiligen Messe] Vykladač hry [Sprecher] 2. Szene Oddávki: „A před rájem” [Trauung: Sušil Kap. IX, Nr. 3 Paskalina kehrt nach Hause zurück, „Und vor dem Paradies“] findet ihren Mann ermordet vor Paskalina wird des Mordes ange- Zabila panička pána [Es tötete die Sušil Nr. 98 klagt und zum Tode verurteilt Frau den Mann] Das letzte Gebet vor der Hinrich- Ach, Bože můj všemohoucí [Ach, Sušil Kap. IX, Nr. 8 tung mein allmächtiger Gott] Ave Maria Matičko Ave Maria Bozi neopoustej mně [Gebet] [Mutter Gottes verlasse mich nicht] Paskalina wird zum Scheiterhaufen Requiem aeternam Requiem geführt Der Scheiterhaufen brennt [Tanz], Quia inclinavit aurem suam [...] Liber Psalmorum: Psalm 114 Maria erscheint und hält die Flammen von Paskalina fern 3. Szene Smílováni! Paskalino! Kdo volá? [Martinů] Paskalina kehrt ins Kloster zurück, [Erbarmen! Paskalina! Wer ruft?] die Nonne Marta erklärt ihr, dass sie immer da gewesen sei; Paskalina scheint zu erwachen 126 Maria übergibt Paskalina Kleider Ave Maria Ave Maria sowie Schlüssel und entschwindet Die Nonnen singen, in ihrer Mitte Kyrie eleison – Benedictus – Dona Ordinarium missae bricht Paskalina tot zusammen nobis pacem Die Motivation für die formalen Ähnlichkeiten der Sestra Paskalina mit dem Bau mittelalterlicher Mirakel ist weniger in einer Bemühung um eine traditionsgerechte Adaption als vielmehr darin zu sehen, dass Martinů bestrebt war, jegliche Art von Psychologisierung von vornherein zu vermeiden. Bedingt durch den Verzicht auf verbindende Texte, kommt es zu einer Unlogik, die keinerlei psychologischer Entwicklung der handelnden Personen gerecht werden könnte82. Indem Martinů präexistente Texte aus ihrem Entstehungskontext herauslöste, um sie als Zitate in den Opernakt zu integrieren, unterband er sogar eine unbewusste Beeinflussung der Wortwahl durch das jeweilige psychologische Potential der Handlung. Dass dadurch dem Publikum ein aktiveres Rezeptionsverhalten abverlangt wird, ist weniger als ‚notwendiges Übel‘, denn als durchaus willkommene Auswirkung zu verstehen. Ich leugne nicht, dass diese „Einrichtung des Librettos“ grössere Anforderungen an das Publikum stellt, jedoch zugleich dessen Aufmerksamkeit erhöht. Meine Libretti (seit Špalíček) weisen keinen direkten realistischen Handlungszusammenhang auf. Auch der Text nicht, denn es sind ausgewählte „Worte“, Texte, die nur ungefähr der gegebenen Situation entsprechen oder oft auch nicht, und allein durch die Aktion, die Handlung, zu einem Ganzen verbunden werden. Es sind Texte der Volkspoesie, die de facto keinen Zusammenhang miteinander aufweisen. In Paskalina ist nur ein Satz in Prosa hinzugefügt, alles andere sind entweder volkspoetische oder geistliche Zitate83. Neben den Brüchen, die durch ein solches Verfahren unweigerlich zu einem Hauptmerkmal des Librettos werden, beschneidet auch die nur ungefähre Übereinstimmung der vorgegebenen Texte mit der Handlung die Bedeutung der Sprache. Während dies bei Narození páně, das grösstenteils auf dem Volksliedtext Panenka Marie po světě chodila [Die Jungfrau Maria ging durch die Welt] beruht, nur bedingt ins Gewicht fällt, sind die Folgen bei Sestra Paskalina ungleich einschneidender, machte es doch die Aneinanderreihung zahlreicher Volksliedsowie liturgischer Texte geradezu unmöglich, die bereits in der Vorlage inkohärente Legende 82 83 Zitat Martinů, Hry o Marii (1935-36), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 209. Martinů, [Handschriftliche Notizen zur Oper] (1943), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 197 f. 127 annähernd einsichtig wiederzugeben. Allein der auftretende Sprecher, der über dem Geschehen stehend eine auktoriale Rolle spielt, indem er erklärt, warnt und moralisiert, stellt ein Mittel dar, zu einem übergreifenden Zusammenhang zwischen den weitgehend eigenständigen Teilen beizutragen. Mit diesem Einsatz eines an Strawinskys Le Speaker in Oedipus Rex gemahnenden Sprechers in den beiden Mirakeln Mariken z Nimègue und Sestra Paskalina, greift Martinů zugleich den Brauch der mittelalterlichen Mysterienspiele auf, das Publikum über kommende Geschehnisse aufzuklären, entsprechend Dubechs Beobachtung: Nous avons remarqué que le moyen-âge mettait autant de soin à annoncer les coups de théâtre, que les modernes à les ménager84. Dass durch die Auftritte eines Sprechers über das verbindende Moment hinaus auch der fiktive Charakter des Geschehens in Erinnerung gerufen wird, der einerseits einen Realitätsbezug von Beginn an ausschliesst und andererseits die Distanz zwischen Bühne und Zuschauerraum wahrt, entspricht direkt Martinůs Intention85. Seinem Leitgedanken gemäss, sich mit den Hry o Marii dem wirklichen Theater anzunähern, ging es ihm in dieser Oper nicht darum, eine Illusion der Wirklichkeit zu schaffen, sondern vielmehr die Fiktion des ‚Theaters‘ hervorzuheben – die Phantasie des Zuschauers sollte angeregt werden. Dementsprechend gipfelte die Absicht, permanent zu betonen, dass es sich beim Gesehenen um eine wirklichkeitsferne Vorstellung im Theater handelte, mit dem ‚Spiel des Maškaron‘ in Mariken z Nimègue in einem regelrechten ‚Theater im Theater‘86. Auch manifestierte sich das ‚Theatralische‘ der Oper in szenischen Momenten, etwa den Rollenverdoppelungen oder in der inszenatorischen Idee, sämtliche für den Akt benötigten Bühnenbilder von Beginn an auf der Bühne zu präsentieren. Durchaus in Anlehnung an die mittelalterliche Inszenierungspraxis, die ohne jegliche Rücksicht auf reale Distanzen bis zu einem Dutzend verschiedener Szenen aneinander reihten, sei es Rom oder Jerusalem, sei es der Himmel oder die Hölle, sah auch Martinů in allen vier Akten die Verwendung simultaner Bühnen vor87. So hatte 84 85 86 87 Zitat Dubech, Histoire générale illustrée du Théâtre, Bd. 2 (1931), S. 85. Siehe auch Martinů, O divadle středověku [Vom Theater des Mittelalters] (1934), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 185: Die wichtigste Rolle in diesen Spielen hatte der „Spielleiter“ („meneur du jeu“). Aus einem frühen Handlungsabriss von Mariken z Nimègue, der in mehrfacher Hinsicht inhaltlich von der Oper abweicht, ist ersichtlich, dass Martinů von Beginn an einen Sprechpart in die Oper einzuführen plante. Siehe Anhang zum Brief von Martinů an Vítězslav Nezval, undatiert [zwischen November 1932 und August 1933], Muzeum Bohuslava Martinů in Polička (CZ), ohne Signatur (2+10 Seiten), zuvor: Nachlass Vítězslav Nezval (im Památník národního písemnictví) Zitat Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 223. Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 222. Zur Verwendung simultaner Bühnen im mittelalterlichen Theater siehe auch Dubech, Histoire générale illustrée du Théâtre, Bd. 2 (1931), S. 92-95 sowie Baty/Chavance, Vie de l’art théâtral 128 beispielsweise das Bühnenbild für Mariken z Nimègue dreiteilig zu sein, wobei sich in der Mitte der Platz für die letzten beiden Szenen – das ‚Spiel des Marscaron‘ sowie den Tod Marikens –, links davon der Wald für die ersten beiden und rechts das Gasthaus für die dritte Szene befinden sollte. Während sowohl der Auftritt eines Meneur du jeu als auch die Verwendung von simultanen Bühnen direkt mittelalterlichen Gepflogenheiten verpflichtet scheinen, geht die Art der Rollenverteilung über das historische Vorbild hinaus und zielt verstärkt auf eine distanzierte Rezeptionshaltung des Publikums. Dies wird dadurch bedingt, dass nicht nur der Chor wechselnde Funktionen inne hat, die ihn entweder die Handlung kommentieren lassen oder als aktiven Teilnehmer darin einbeziehen – bisweilen sogar die Hauptpersonen substituierend –, sondern dass auch die solistischen Rollen wiederholt doppelt, durch Sänger und Tänzer, zu besetzen sind88. So werden etwa in Mariken z Nimègue mit Mariken und dem Teufel beide Hauptrollen zusätzlich durch Tänzer verkörpert, wobei der jeweilige Austausch der Darsteller in keiner Weise verdeckt werden soll; ähnlich wie bei Brechts Theorie des ‚epischen Theaters‘ werden damit die Bühnenmittel als solche entschleiert, um die Distanz des Zuschauers zum Geschehen aufrechtzuerhalten89. In den ‚epischen‘ Momenten der Textanlage erschöpfen sich allerdings die Gemeinsamkeiten zwischen Martinůs Idee vom wirklichen Theater und Brechts bereits zum ‚Lehrstück‘ hin tendierendem, politisch-didaktischem ‚epischen Theater‘90. Schliesslich musste Martinů mit seiner Absicht, einen Beitrag zur Opernerneuerung zu leisten, in den Augen Brechts unweigerlich zu denen gehören, die verzweifelt versuchten, dieser Kunst [der Oper] hinterher einen Sinn zu verleihen, einen „neuen“ Sinn, wobei dann am Ende das Musikalische selber dieser Sinn wird; [...] Fortschritte, welche die Folge von nichts sind und nichts zur Folge haben, welche nicht aus den Bedürfnissen kommen, sondern nur mit neuen Reizen neue Bedürfnisse befriedigen, also eine rein konservierende Aufgabe haben91. Obwohl (1932/1979), S. 78; Martinů, O divadle středověku [Vom Theater des Mittelalters] (1934), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 185. 88 Zur Rolle des Chors siehe Martinů, Před premiérou Her o Marii [Vor der (Prager) Premiere der Hry o Marii] (1936), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 201. 89 Vgl. Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 223 f. 90 Zu Brechts ‚epischem Theater‘ und dessen Zusammenhang mit dem ‚Lehrstück‘ siehe u.a. Steinweg, Lehrstück und episches Theater (1995), S. 32-54. Auch bei Gaston Baty finden sich hinsichtlich der ‚epischen‘ Elemente zahlreiche Parallelen zu Brecht. Allerdings ist bezeichnend, dass Baty zwar mit der französischen Erstaufführung von Brechts Dreigroschenoper am 13. Oktober 1930 das ‚Théâtre Montparnasse‘ eröffnete, dabei jedoch bestrebt war, den sozialkritischen Anspruch soweit wie möglich zu mindern und das Stück stattdessen in eine traumartige Sphäre zu verlegen. Siehe Hüfner, Brecht in Frankreich 1930-1963 (1968), S. 7-10. 91 Zitat Brecht, Anmerkungen zur Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ (1930), in: Ders., Ausgewählte Werke, Bd. 6, S. 110. 129 Martinů mit seinen Hry o Marii zu den Besseren zählt, die wie Strawinsky den Inhalt überhaupt verneinen und ihn in lateinischer Sprache vor oder vielmehr weg tragen, kann dies in Brechts Augen nichts an der Sinnlosigkeit des Unterfangens ändern92. Tatsächlich beabsichtigte Martinů mit den Hry o Marii ebenso wenig, wie er die religiös-missionarischen Ambitionen Ghéons oder Batys teilte, mit Brecht politisch-didaktische Ziele zu verfolgen, weshalb er die traditionelle Oper auch nicht aus kulinarischen, sondern vielmehr aus rein theaterbedingten und musikalischen Gründen von deren Konventionen zu befreien trachtete93. So galt es laut Martinů etwa in szenischer Hinsicht, theatralisch konventionelle Gesten zu vermeiden, die nur die Sprache verdoppeln würden, niemals aber die Handlung verkörpern könnten. Er sah nicht nur vor, mit der doppelten Besetzung durch Sänger und Tänzer einer leeren ‚Operngestik‘ entgegenzuwirken, sondern plante darüber hinaus, jegliche konventionalisierte Mimik und Gestik des traditionellen Balletts unmöglich zu machen, indem er etwa wie Strawinsky in Oedipus Rex für die Tänzer Masken vorschrieb, aber auch den Bewegungsradius stark einzuschränken gedachte – dass Martinů sich hierbei das tschechische Ballett auf der Höhe der ‚Ballets russes‘ wünschte, liegt auf der Hand94. Also soweit wie möglich die Bewegung über die Bühne (ausser in den dramatischsten Momenten) und das übliche Tanzen, also die Auslegung, das Ausdrücken der Handlung vermeiden. Die Handlung ist allen klar, weshalb es darum geht, sie in einer Art Vision der Gesten und Bewegung zu verkörpern95. Der Tanz stellte für Martinůs Zwecke ein nützliches Mittel dar, die theatralische und fast „mechanische“ Gestik der Sänger zu vermeiden, bedeutete jedoch darüber hinaus, dass die schauspielerischen Aspekte der Oper weitgehend einer Choreographie unterworfen wurden, weshalb sämtliche Bewegungen auf der Bühne gleichsam als Tänze im Sinn eines szenischen Bildes erscheinen mussten96. Indem die Handlung ihre Bedeutung als bestimmender Referenzpunkt für die Inszenierung zugunsten szenischer Bilder verliert, kommt es zu einer durch Brüche gezeichneten Abfolge von Darstellungen, bei der sich zum dynamischen 92 Zitat ebd., S. 110. Zitat ebd., S. 104. 94 Vgl. Brief von Martinů an Ivo Váňa-Psota, Tänzer der Ballets russes, undatiert [wenige Monate vor der Uraufführung der Hry o Marii (23. 2. 1935)], in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 215: […] die Hry o Marii, eine neue Opernform, wo das Ballett und die Pantomime gleichzeitig mit der Oper stattfinden, aber in einer Funktion und auf einem Niveau, wie es die Leistungen des russischen Balletts zeigen. 95 Brief von Martinů an die Tänzerin Zora Šemberová betreffend deren Interpretation der Mariken bei der Uraufführung, vom 29. August 1934 aus Paris, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 193. 96 Zitat Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 222. 93 130 Moment der Aneinanderreihung zwingend der statische Charakter der einzelnen Bilder gesellt. Schlug sich dies in der Konzeption Jenčíks, des Choreographen der Prager Erstaufführung, insofern nieder, als er sich an der Statik gotischer Architektur orientierte – namentlich des Strassburger Münsters –, die er in kinetische Umrisse übersetzen wollte, so zeugte analog dazu Martinůs Intention, jegliche individuelle Gestik innerhalb des Chores zu unterbinden, vom Willen, die statische Wirkung zu betonen97. Die zeitliche Ausdehnung von eigentlichen Momentaufnahmen als Massstab für die szenische Umsetzung findet ihre Berechtigung in der Anlage der Oper, die insbesondere in den beiden letzten Akten, jedoch durchaus auch im statischen ersten Akt sowie dem für den zweiten Akt stark gekürzten Mirakel, vielmehr als Aneinanderreihung von Zuständen, denn als kohärente Handlung zu verstehen ist. Die Konsequenz von Martinůs Intention tritt in den volkstümlichen und geistlichen Zitaten des vierten Aktes am deutlichsten zutage, wird doch der Text auf ein Minimum reduziert, das es kaum zulässt, das eigentliche Geschehen annähernd einsichtig zu vermitteln – die „logische“ Logik der dramaturgischen Arbeit wird vorsätzlich preis gegeben98. Unter theaterästhetischen Gesichtspunkten lässt sich die Betonung des Statischen und der damit verbundene Verzicht auf eine sich entwickelnde Handlung sowohl in Einklang mit der beabsichtigten Distanz zum Bühnengeschehen im Geiste des ‚epischen Theaters‘ bringen, als auch zum mittelalterlichen Theater, was durchaus als eine Rückkehr zum wirklichen Theater verstanden werden kann99. Da jedoch für den Komponisten Martinů etwa im Unterschied zum Regisseur Baty unmöglich in Frage kommen konnte, die Musik als blosses Bühnenmittel in einer Synthese zugunsten eines thomistisch ganzheitlichen Theaters aufgehen zu lassen, ist bei der Bewertung der Hry o Marii nicht ausser acht zu lassen, dass die Musik sich zwar dem ‚Theater‘ zu fügen hatte, ihr aber dennoch die Rolle der ‚prima inter pares‘ zukam. Der brutale Umgang mit der Handlung stellte für Martinů über die Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Theateravantgarde hinaus zugleich die Voraussetzung dafür dar, den Weg zu einer ‚musikalischen Poesie‘ hin zu ebnen100. 97 Josef Jenčík, Tanecní výpln Her o Marii [Die tänzerischen Teile der Hry o Marii] (1935-36/1946), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 213; Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 221. 98 Zitat ebd., S. 221. 99 Zitat Martinů, Poznámky k cyklu Hry o Marii [Anmerkungen zum Zyklus Hry o Marii] (1936), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 206 100 Zitat Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 221. 131 MUSIK ALS POESIE Martinůs Überlegungen hinsichtlich einer Erneuerung der Oper zielten letztlich allesamt darauf hin, die Funktion der Musik im Theater neu zu überdenken und ihr eine von der Sprache weitgehend unabhängige Position einzuräumen, allerdings keine allein beherrschende, wäre doch eine solche nicht mit dem wirklichen Theater vereinbar. Die Musik von der Sprache zu lösen, erschien ihm insofern vordringlich, als sich die zeitgenössische Oper seiner Meinung nach vollständig auf literarische Vorlagen abstützte, infolgedessen die Mittel des gesprochenen Dramas zu solchen des Musiktheaters geworden seien – dazu zählte Martinů ebenso die Leidenschaft des psychologischen Dramas wie den dramatischen Akzent des Schauspiels und die Annäherung an die Realität –, weshalb die Gattung ihre Handlungsfreiheit verloren und nicht etwa zum Musikdrama, sondern zum vertonten Schauspiel verkommen sei101. In modischen Literaturopern wird der Komponist vom Text tyrannisiert, muss er sich doch bemühen, den kleinsten Gefühlsregungen der dramatischen Vorlage musikalisch gerecht zu werden, und folglich etwas ausdeuten, was nicht in den Möglichkeiten der Musik liege102. Da die psychologischen Verwicklungen des Schauspiels musikalisch nicht wiedergegeben werden könnten und somit allein durch das Libretto vermittelt werden müssten, würde die Verständlichkeit des gesungenen Textes zum alles bestimmenden Moment. Der Schritt vom Gesang zur Deklamation und zum durchgehenden Rezitativ erschien Martinů vor diesem Hintergrund geradezu unvermeidlich, und dennoch sähen gewisse ästhetische Schulen darin den richtigeren Ausdruck, der eine dramatischere Vertonung des Wortes ermögliche und dabei die innersten seelischen Bewegungen auszudeuten vermöge103. Dem hielt er einerseits entgegen, dass durch die Betonung des Wortes und dessen Gehalt die musikalische Lyrik zwangsläufig der dramatischen und dynamischen Bewegung zum Opfer fallen müsse, sowie andererseits, dass die menschliche Stimme nur begrenzt zu dramatischer Intensität fähig sei. Jenseits der Grenze des physiologisch Möglichen müsse der Gesang durch das Orchester „verdoppelt“ werden, was unweigerlich bedinge, dass der Sänger seine Stimme bis zum Geschrei, zum schieren Lärm forciere, um sich angesichts des Orchesterapparates überhaupt Ge- 101 Zitat Martinů, Poznámky k opeře mirakl panny Marie [Anmerkungen zur Oper Mirakel der Jungfrau Maria] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 193 f. 102 Zitat Martinů, Přežila se opera? [Hat sich die Oper überlebt?] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 225. 103 Zitat ebd., S. 226 f. 132 hör zu verschaffen104. Den permanent hohen Geräuschpegel führte Martinů nicht zuletzt darauf zurück, dass die Musik gar nicht dazu in der Lage sei, sämtliche emotionalen Schattierungen auszudrücken, weshalb regelmässig Unruhe erzeugt werde, die in Wirklichkeit nichts bedeute: Selbst im Schauspiel erzielt man dramatische Spannung nicht dadurch, dass man alle bis zur Heiserkeit schreien lässt105. Da das Orchester für die Ausdeutung des Gefühlslebens unabdingbar wurde, verlagerte sich gemäss Martinů die Handlung zunehmend weg von der Bühne und hin in den Orchestergraben, was insofern das Ende des Theaters bedeuten musste, als das Ergebnis einem musikalischen Konzert gleichkam, das von den Zufällen der szenischen Handlung gelenkt wurde106. Dass sich der musikalische Verlauf folglich notgedrungen nach der emotionalen Entwicklung des Librettos, nicht aber nach eigenen Grundsätzen zu richten hatte, brachte eine musikalische Form mit sich, die zwar gleichsam mit Musik angefüllt sei, der jedoch eine literarische anstatt einer musikalischen Logik zugrunde liege107. Martinů polemisierte damit gegen eine unreflektierte Leitmotivik, die in der Wagnernachfolge zum alleinigen Mittel dafür geworden sei, in einer eigentlich sehr billigen Weise eine grossformale Einheit zu erlangen108. Die Idee, dass die musikalisch schrittweise nachvollzogene Entwicklung des Textbuches einen symphonischen Strom ermögliche, verwarf er gänzlich mit dem Argument, wonach reine musikalische Formen im Musiktheater nur an textfreien Stellen denkbar seien, etwa in der Ouvertüre oder in Zwischenspielen109. Entsprechend wehrte er sich gegen eine Gleichsetzung der Verwendung von Leitmotiven mit der thematischen Arbeit in reinen Instrumentalwerken, entspringe letztere doch der inneren Organisation des Ganzen, erstere dagegen äusseren Umständen110. Die Absage an eine symphonische Anlage der Musik auf der einen sowie die beschnittene Rolle der Sprache auf der anderen Seite, mögen auf den ersten Blick nahezu als Widerspruch erscheinen, sind jedoch durch Martinůs Grundsatz motiviert, wonach es in der Oper gelte, Musik, Wort, Gestik, Ausstattung usw. zu einem alleinigen Zweck zu verbinden, 104 Zitat Martinů, Poznámky k opeře mirakl panny Marie [Anmerkungen zur Oper Mirakel der Jungfrau Maria] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 194. 105 Zitat Martinů, Přežila se opera? [Hat sich die Oper überlebt?] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 227. 106 Zitat Martinů, Poznámky k opeře mirakl panny Marie [Anmerkungen zur Oper Mirakel der Jungfrau Maria] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 194. 107 Zitat Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 216. 108 Zitat Martinů, Přežila se opera? [Hat sich die Oper überlebt?] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 228. 109 Zitat ebd., S. 228. 110 Zitat ebd., S. 228. 133 nämlich zu demjenigen der Bühne111. Gerade weil er sich an zeitgenössischen Theaterströmungen orientierte, die ihrerseits von logisch voranschreitenden Entwicklungen Abstand nahmen – indem sie etwa das mittelalterliche oder das ‚epische‘ Theater proklamierten –, musste die Frage einer psychologischen Ausdeutung des Librettos obsolet erscheinen. Das statische Moment des Textbuches bildete die Voraussetzung für einen folgerichtigen Verzicht darauf, das Geschehen musikalisch ,auszudrücken‘ [vyjádřit], also die Musik einem psychologischen Drama zu unterwerfen. Das ganze System der psychologischen Charakterisierung führt mehr oder weniger zu einem Theater-Roman und weniger zum Theater. Lassen wir den Standpunkt zu, den ich denjenigen der Situation, der Attitude, nenne, verlieren wir zwar den „charakteristischen“ Bezug, nähern uns dafür aber der Handlung an (ich meine damit kein Getümmel, keine „dramatische“ Aktion) und gewinnen eine grosse Freiheit in der Disposition der musikalischen Form. Wir gewinnen auch die Freiheit der Richtung und Disposition der musikalischen und szenischen Form, wenn wir nicht die Entwicklung des psychologischen Dramas (in der [realen] Zeit) und die Charakterisierung, das „Ausdrücken“ „verfolgen“ müssen 112. Eröffnete der Verzicht auf eine sinnfällige Entwicklung des Dramas gleichermassen die Freiheit der musikalischen als auch der szenischen Form, so lag es in der Natur des Komponisten, das Libretto in der Weise zu entwerfen, die die meisten musikalischen Möglichkeiten eröffnete – eine Entscheidung, die selbst Wagner bei seiner Arbeit getroffen habe113. Da Martinů die Handlung nicht auf das einzelne notierte Wort abstützte, sondern es bei einem blossen Handlungsschema beliess, das für das Verständnis des Geschehens ausreichen musste, kam den gesungenen Texten in den Hry o Marii die handlungstragende Funktion weitgehend abhanden114. Martinů plante, die Oper vielmehr gemäss einem musikalischen Plan und nicht nach einem literarischen einzurichten, wobei jedoch das Ziel, eine grösstmögliche Einheit und ein Gleichgewicht des Werkes zu erlangen, die Suche nach einer bloss punktuell wirksamen „Stimmung“ [sic!] von Beginn an ausschloss115. Indem etwa in den beiden letzten Akten einerseits die überlieferten Volksliedtexte einen unveränderten sprachlichen und andererseits die Musik einen in sich geschlossenen Bau aufweisen, hat 111 Zitat ebd., S. 228. Martinů, [Handschriftliche Anmerkungen] (1943), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 197. 113 Zitat Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 218. 114 Zitat ebd., S. 218 f. 115 Zitat Martinů, [Unveröffentlichter Aufsatz zu den Hry o Marii] (1934), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 205; Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 218 f. 112 134 Martinů zwar einer musikalischen Textausdeutung entgegengewirkt, nicht aber der angestrebten Übereinstimmung der musikalischen mit der sprachlichen Poesie, getreu dem Grundsatz: Die Musik ist nicht frei, wenn sie den Text begleitet, jedoch wenn sie die Poesie des Textes ausdrückt116. Somit ist der Berührungspunkt zwischen Libretto und Musik nicht im direkten Wort-Ton-Verhältnis zu suchen, sondern vielmehr in der jeweiligen Grundstimmung, die Wort und Ton mit den ihnen gegebenen Möglichkeiten vermitteln. Dass damit jegliche musikalische Personen- zugunsten einer Situationencharakterisierung hinfällig wird, liegt auf der Hand und stellt die Einheit der handelnden Personen grundsätzlich in Frage. Der Verzicht auf psychologisch konsistente Figuren, der bereits durch das „unlogische“ Libretto sowie die Rollenverdoppelungen gegeben ist, findet sich somit auch auf der musikalischen Ebene, die gleichermassen dazu beiträgt, dass das theatralische Geschehen nicht mehr an Personen gebunden ist, sondern sich gleichsam über die ganze Bühne ausbreitet117. Das statische Moment der Hry o Marii tritt insbesondere bei den beiden kurzen Akten I und III deutlich hervor, die quasi als Vorspiele zu den zwei Mirakeln angelegt sind, und mit der nahezu vollständigen Absage an eine dramatische Handlung vielmehr als volkstümliche szenische Oratorien denn als eigentliche Opernakte anmuten118. Dient der erste Akt gleichsam als Ersatz für eine Ouvertüre, die den Boden für das Mirakel im zweiten Akt bereiten soll, indem zwar keine direkte motivische Verbundenheit hergestellt, jedoch der musikalische Charakter der gesamten Oper exponiert wird, so fungiert der dritte Akt als Angel- und Ruhepunkt zwischen den beiden grossen Spielen. Nicht allein aufgrund der undramatischen Libretti, die im ersten Akt durch die epische Erzählweise sowie im dritten durch die inkohärente Aneinanderreihung von Volksliedtexten bedingt sind, werden in den kurzen Akten die szenischdramatischen Aspekte in mehrfacher Hinsicht markant beschnitten, sondern darüber hinaus auch dadurch, dass jegliche Individualität durch die dominierende Rolle des Chores von Beginn an untergraben wird. Solistische Gesangspartien, die sich durch eine ausschliessliche Bindung an eine Figur auszeichnen, sind spärlich gestreut. So betrifft dies in Panny moudré a panny pošetilé nur den Erzengel Gabriel, weder dagegen den durch zwei Baritone besetzten Kaufmann, noch die Titelheldinnen, deren kluge Hälfte in naheliegender Weise von einem Frauenchor verkörpert wird, die törichten Jungfrauen dagegen ausschliesslich mithilfe einer 116 Zitat Martinů, Poznámky k opeře mirakl panny Marie [Anmerkungen zur Oper Mirakel der Jungfrau Maria] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 195. 117 Zitat Martinů, Hry o Marii (1935-36), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 209. 118 Zitat Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 223. 135 statischen Sopranrolle inmitten von stummen Tänzerinnen zu Wort kommen. Eingebettet sind die solistischen Auftritte in einen Chorsatz, der einerseits das eigentliche Fundament des Aktes bildet sowie andererseits denselben umrahmt: Nach einem kurzen Orchestervorspiel (I, bis T 14 nach Z 3) fordert der an der Rampe positionierte gemischte Chor mit einer Fuge die Jungfrauen auf, bis zur Ankunft Jesu zu wachen – am Ende richtet sich der Chor mit derselben Aufforderung direkt an das Publikum, nunmehr in einen homophonen Choral in strahlendem A-Dur gefasst (siehe Notenbeispiel 38). Auch im dritten Akt, den Narození páně, kommt dem Chor eine tragende Bedeutung zu, im Unterschied zum ersten dagegen weniger in der Funktion, das Geschehen über die ganze Bühne auszubreiten – dies bewirkt hier das Libretto –, sondern vielmehr kommentierend, sind doch mit Maria, einem Wirt, einem Schmied und dessen Tochter die handelnden Personen an gleichbleibende Sänger geknüpft. Der erste Akt wird durch die klaren Wechsel zwischen einzelnen Chorsätzen und kurzen Orchesterzwischenspielen untergliedert, wobei sich im mittleren Teil einige Soli unter diese Anordnung mischen, die gerade beim Auftritt des Erzengels Gabriel aber auch demjenigen Jesu insofern musikalische Höhepunkte bilden, als sich diese vom bis anhin weitgehend a cappella erklingenden Chor deutlich unterscheiden. Erst kurz vor der Erscheinung Jesu wird der gemischte Chor vom Orchester in einem weitgehenden Unisono begleitet (I, T 1 nach Z 26 bis T 8 nach Z 28 sowie T 2 nach Z 34 bis T 14 nach Z 36); in welchem Mass die Verbindung der zuvor unvereinbaren instrumentalen und vokalen Gruppen als Sinnbild für die Erlösung fungiert, zeigt sich insbesondere am Ende, wenn sich der Chor mit dem Choral Bdetež tedy [Wachet also] direkt an ein Publikum wendet, das die Erlösung noch nicht erfahren hat (I, T 1-12 nach Z 37) – das Orchester verstummt vorübergehend und bestätigt erst nach dem Choral das Gesagte mit der Tonika A-Dur (I, T 1-7 nach Z 38). Notenbeispiel 38: Hry o Marii, I. Akt, T 15 nach Z 36 bis T 7 nach Z 38 Obwohl Orchester und Chor alternierend erklingen, erzeugt die Verwendung desselben Motivs eine enge Verbundenheit zwischen den kurzen Teilen, greift doch der Chor den fanfarenartigen Einleitungstakt in bekräftigendem Unisono wörtlich auf, bevor er das Motiv in akkordischem Satz leicht variiert noch zweimal erklingen lässt. Während der Chor im ganzen Akt wiederholt Orchestermotive aufnimmt, um diese weiterzuführen und damit grössere Verbindungen zu schaffen, findet innerhalb des Orchestersatzes eine Strukturierung dadurch statt, dass erneut erklingende Motive nicht nur Zusammenhang stiften, sondern als wiederkehrende 136 Teile zugleich einzelne Abschnitte markieren. Das Zusammenspiel von Rückgriffen auf bereits Bekanntes einerseits sowie freiem Umgang mit demselben bestimmt nicht allein die Motivik, sondern in gewisser Weise auch die grossformale Anlage, da sich die im Vorspiel deutlich hervortretende ABA’-Form frei abgewandelt im Opernakt wiederfindet. Notenbeispiel 39a: Hry o Marii, I. Akt, Vorspiel, [Beginn des A-Teils] T 1-6 nach Z 0 Notenbeispiel 39b: Hry o Marii, I. Akt, Vorspiel, [Beginn des B-Teils] T 1-4 nach Z 1 Den Rahmen des Vorspiels bilden die beiden von Streichern gespielten Teile A (I, T 1-15 nach Z 0) und A’ (T 1-14 nach Z 3), deren ersten Hälfte jeweils durch das Voranschreiten im Rahmen eines an e-Phrygisch gemahnenden reinen a-Moll einen modalen Charakter erhalten, zusätzlich verstärkt durch die prägnanten Oktavparallelen, worauf in beiden Fällen eine ausgeweitete Kadenz folgt, im A-Teil bis zum Halbschluss auf der Dominante – die im A-Dur des B-Teils ihre Auflösung findet (I, T 1 nach Z 1) –, am Ende von A’ dagegen direkt in die neue Tonika A-Dur mündend. Diesem ruhigen, weiter unten näher zu erläuternden, ‚volksliedhaften‘ Charakter insbesondere zu Beginn der beiden äusseren Abschnitte steht ein kontrastierender Mittelteil gegenüber, der zwar in den Flöten und Klarinetten das kantable Moment weiterzuführen scheint, jedoch nun nicht mehr von einem homophonen Streichersatz, sondern ausschliesslich vom Klavier mit ungleich schnelleren, vielmehr präludienartigen denn ‚volksliedhaften‘ Akkordbrechungen begleitet wird. Zusätzlich verstärkt wird diese Unruhe stiftende Wirkung durch eine unstete Harmonik, die von A-Dur ausgehend bereits in Takt 6 nach Ziffer 1 über F-Dur und D-Dur bei C-Dur angekommen ist, um schliesslich im weiteren Verlauf aufgrund chromatischer Verschiebungen von einer Akkordbrechung zur nächsten die Frage nach einer bestimmenden Tonart vorübergehend obsolet erscheinen zu lassen – erst ab Takt 7 nach Ziffer 2 wird mit G-Dur wieder eine Tonart bestätigt. Analog zum Vorspiel liegt dem ganzen ersten Akt eine dreiteilige Bogenform zugrunde, die jedoch nicht in einer ähnlich expliziten Weise umgesetzt wird, sondern bloss als latentes Grundschema durch das Geschehen hindurchschimmert, dies jedoch um so stärker, als sie sowohl in der Vertonung als auch in der Gliederung des Librettos ihre Entsprechung findet. Im unmittelbar nach dem Vorspiel in Takt 1 nach Ziffer 4 einsetzenden ersten Teil rät der Chor den Jungfrauen, bis zur Ankunft Jesu zu wachen, da sie nur dann vor der Hölle 137 errettet würden, wobei die Aufforderung in einen durch Orchestereinwürfe klar untergliederten Chorsatz gefasst ist, der regelmässig zwischen Fuge und homophonem Satz wechselt. Seinen Abschluss findet der erste Teil in einer – bis auf die hier fehlenden Takte 6-7 nach Ziffer 0 – wörtlichen Reprise des A-Teils des Vorspiels (I, T 1-13 nach Z 12), eine offenkundige Anlehnung an die zu Beginn exponierte Bogenform, die zusätzlich dadurch explizit gemacht wird, dass der (in T 1 nach Z 13) direkt anschliessende zweite Teil wiederum mit einer Reprise des B-Teils des Vorspiels ansetzt, über der der Erzengel Gabriel die Geburt Jesu verkündet. Vergleichbar mit dem unsteten Mittelteil des Vorspiels wird auch hier nun das Gleichgewicht geradezu gestört, wobei dies auf der Ebene des Librettos durch eine ungleich dialogischer gestaltete Anordnung bedingt wird, der auf der musikalischen Seite eine grössere Variation von chorischen, solistischen und instrumentalen Teilen sowie deren Durchmischung entspricht. Ungleich deutlicher als die solistischen Passagen Gabriels, die in der Stimmführung an die vorangegangenen homophonen Teile von Chor und Orchester gemahnen (I, T 1 nach Z 13 bis T 22 nach Z 15), bringt der Auftritt der törichten Jungfrauen einen neuen musikalischen Charakter mit sich, wird doch das sich ständig steigernde Herumirren der Tänzerinnen von einer psalmodisch anmutenden Klage des Solosoprans und den Altistinnen des Chores begleitet (Notenbeispiel 40). Notenbeispiel 40: Hry o Marii, I. Akt, T 1 nach Z 16 bis T 9 nach Z 17 Verleiht das zugrundeliegende reine f-Moll dieser Klage bereits einen modalen Charakter, so wird dieser durch die Betonung der Unterquart c’ zusätzlich hypomodal gefärbt, eine Anlehnung an die Psalmodie, die bezeichnenderweise nur im Augenblick der Selbstbezichtigung als törichte [pošetilé] Jungfrauen durch chromatische Ausweichungen kurzzeitig aufgegeben wird (I, T 3 nach Z 17). Während bereits in den folgenden zwei Passagen der törichten Jungfrauen das psalmodische Moment aufgrund einer dezenten Ausharmonisierung durch den Frauenchor leicht an Bedeutung verliert (I, T 1-8 nach Z 18 sowie T 1-4 nach Z 19), passt sich die Stimmführung des Solosoprans in dem Moment endgültig derjenigen des Erzengels Gabriel an, in dem sie zu der Erkenntnis gelangen, dass sie die Ankunft Jesu zu verpassen drohen (Notenbeispiel 41). Zusätzlich untermauert wird diese Befürchtung dadurch, dass der kommentierende Chor, der das Scheitern der törichten Jungfrauen vorwegnimmt, erstmals gleichzeitig mit der klagenden Sopranistin erklingt, ein Omen, das im Akkordtremolo des Klaviers – das später die Stimme Jesu begleiten wird – seine Bestätigung findet. 138 Notenbeispiel 41: Hry o Marii, I. Akt, T 5-11 nach Z 19 Der gänzlich dem Herumirren der törichten Jungfrauen gewidmete Mittelteil des ersten Aktes endet folgerichtig genau in dem Augenblick, als diese mit dem Ölverkäufer verhandeln und dabei die Ankunft Jesu verpassen. Markiert wird der Beginn des dritten Abschnittes durch eine kurze variierte Reprise der ersten fünf Takte des A-Teils des Vorspiels (Notenbeispiel 39a), unmittelbar nach dem Entschwinden der erlösten klugen Jungfrauen (I, T 1-6 nach Z 29), diesmal in klarem F-Dur, das jedoch durch die plagale I-IV-Kadenz ebenfalls eine leicht modale Färbung erfährt. Darauf erklingt die Stimme Jesu hinter der Bühne, der die törichten Jungfrauen verdammt, wobei das Orchester die vierfach im Unisono besetzte Gesangslinie ausschliesslich durch Akkordtremoli der Streicher und des Klaviers untermalt, um jedoch jeweils nach dem Verstummen der Stimme sogleich wieder auf den A’-Teil des Vorspiels zurückzugreifen (I, T 18-21 nach Z 30 sowie T 14-16 nach Z 31). Nach einem kurzen Zwischenspiel der Streicher findet der Chor schliesslich wieder zu Fugen und Chorälen und damit zu seiner Gesangsweise aus dem ersten Teil des Aktes zurück, nun aber durch das Orchester verdoppelt, hat doch der Auftritt Jesu Chor und Instrumente vereint. Dass alles dennoch nur eine Vorstellung im Theater gewesen ist, macht ganz am Ende der Chor unmissverständlich klar, indem er sich mit der Aufforderung ans Publikum wendet, ständig zu wachen, da die Stunde der göttlichen Erscheinung nicht bekannt sei – die Erlösung war nur ein Spiel. Somit ist das Ende in inhaltlicher Hinsicht nicht viel mehr als ein Rückfall zum Aktbeginn, sind doch nur die Adressaten andere geworden, die Botschaft dagegen ist dieselbe geblieben; ein Zirkel, der sich in einer Bogenform wiederfindet, weshalb die musikalische Anlage nicht nur eine textbezogene Begründung erhält, sondern durch die ABA’-Form des Vorspiels zugleich einen rein musikalischen Referenzpunkt aufzuweisen hat. Insbesondere wegen der durch Fugen und Choräle geprägten Chorsätze, die mehrfach durch solistische Passagen ergänzt werden, nähert sich der Eröffnungsakt kirchenmusikalischen Traditionen an. Dass der Verzicht auf Violinen oder die zunächst antiphonal angeordneten Einsätze von Orchester und Chor beispielsweise entfernt an den Beginn des Deutschen Requiems von Johannes Brahms erinnern könnten, trägt als Traditionszusammenhang, der über die Gattung Oper hinausreicht, zum oratorischen Charakter des ersten Aktes der Hry o Marii bei. Im Gegensatz zu Panny moudré a panny pošetilé tritt das kirchenmusikalische Moment bei Narození páně ungleich weniger in Erscheinung, was hauptsächlich auf eine 139 liedhaftere Anlage der Chorsätze zurückzuführen ist – eine kurze Fuge findet sich bezeichnenderweise nur im Orchesterpart (III, T 1-8 nach Z 24). Dieser Akt ist nun nicht mehr in einer Bogenform angelegt, sondern entspricht auf der musikalischen Seite der formalen Gestalt des Librettos insofern, als die vier Volksliedtexte jeweils als einzelne Teile vertont und meist durch Orchesterzwischenspiele voneinander abgetrennt sind. Nach einem kurzen instrumentalen Vorspiel setzt mit Porod panny Marie [Die Geburt der Jungfrau Maria] sogleich die Vertonung des für diesen Akt zentralen Volksliedes ein, das sich einerseits durch den ungleich grösseren Umfang als auch die bisweilen dialogischen Passagen deutlich von den nachfolgenden Texten abhebt. Auf die ersten drei chorischen, kommentierenden Strophen, die jeweils am Strophenende durch Orchestereinwürfe mit Varianten der im Vorspiel exponierten Motive abgelöst werden, folgt bereits in der vierten Strophe der erste Einsatz Marias, deren Solo zunächst parallel zum Frauenchor geführt wird (III, T 4-8 nach Z 9). Obwohl im weiteren Verlauf die solistischen Partien keinesfalls in vergleichbarer Weise im Chor aufgehen, so bleibt dennoch der einfache liedhafte Charakter erhalten, weshalb selbst Augenblicke grösserer dramatischer Spannung weniger in den Singstimmen, sondern fast ausschliesslich im Orchester zum Ausdruck gebracht werden. So finden sich etwa analog zum ersten Akt auch hier akkordisch gesetzte Tremoli in den Streichern, die zwar nicht den Auftritt Jesu begleiten, jedoch die Angst Marias wiedergeben, nachdem diese von der Bedrohung ihres Kindes erfahren hat (III, T 9 nach Z 11 bis T 26 nach Z 12). Erst am eigentlichen Höhepunkt, nämlich am Ende des Liedes, als der Schmied von seiner durch das Jesuskind geheilten Tochter erfährt, dass er der Mutter Gottes die Unterkunft verwehrt hatte, weicht der bis anhin liedhaft geprägte Satz einem choralartigen Schluss, der jedoch vom Bass des Schmiedes sowie vom Orchester, nicht jedoch vom Chor vorgetragen und nach dem Verstummen des Schmieds rein instrumental zu einem leise verklingenden Ende geführt wird (III, T 1 nach Z 19 bis T 23 nach Z 20). Im darauffolgenden nächsten kurzen Lied, das ungeachtet des bereits Vorgetragenen die Niederkunft Marias in einer anderen Überlieferung nochmals behandelt, spiegelt sich in stark geraffter Weise eine vergleichbare Form, da das solistisch von der Tochter des Schmiedes gesungene Lied nach den ersten vier Strophen zusammen mit dem Orchester genau dann in einen homophonen choralartigen Satz mündet, als die Sopranistin die Erkenntnis verkündet, wonach es sich beim Neugeborenen wahrhaftig um Pán Kristus [Herrn Christus] handle (III, T 5-19 nach Z 23). Nach einem kurzen Orchesterzwischenspiel, das mit der einzigen Fuge des ganzen Aktes ansetzt, kommt es zum liedhaftesten Abschnitt, was zum einen durch die einfachen, kurzen sowie klar gegliederten Ensemblepassagen und zum 140 anderen durch den parallel zu den vier Solisten eingesetzten Kinderchor bedingt wird (Notenbeispiel 42). Notenbeispiel 42: Hry o Marii, III. Akt, T 1-2 nach 25 Nachdem hier bereits zum dritten Mal von der Geburt Jesu berichtet worden ist, diesmal ergänzt durch die Taufe im Jordan, beginnt mit dem vierten Volksliedtext zugleich der letzte Teil des Aktes, nun mit einem zweistimmigen, rezitativisch anmutenden Gesang, was an die von Erben in seiner Sammlung angegebenen Vorschrift erinnert, wonach einzelne Dialoge des Krippenspiels rezitativisch vorzutragen seien (III, T 1-11 nach Z 28)119. Darauf folgt ein homophoner Chorsatz, der zwar zunächst als einfaches Lied ansetzt, jedoch spätestens bei der finalen Lobpreisung Gottes zu einem Choral wird und als solcher auch nach dem Verstummen des Chores vom Orchester weitergeführt wird, bis dieses den Akt – vergleichbar mit dem Ende des Volksliedtextes Porod panny Marie zu Beginn desselben Aufzugs (III, T 23 nach Z 20) – nach einem Decrescendo im Pianissimo ausklingen lässt. Damit findet ein Akt seinen Abschluss, der mit der Geburt Jesu einen inhaltlichen Kern aufweist, um den die musikalische Umsetzung kreist, verschiedene Möglichkeiten darlegend, das Ereignis zu rezipieren. Die in der Zeit verlaufende Aneinanderreihung von nicht nur gleichzeitigem Geschehen, sondern faktisch ein und derselben Geschichte, bedingt eine grösstmögliche Ausdehnung dieser Momentaufnahme, die gerade als solche die Einheit des Aktes gewährleistet, wenngleich die disparaten Volksliedtexte eher einen losen ‚Liederzyklus‘ vermuten liessen. Während also im ersten Akt die Vertonung darauf ausgerichtet war, das ‚Immergleiche‘ – das Wachen bis zur Erlösung – in eine zwar fragmentarische, jedoch deutlich erkennbare Handlung zu fassen und mithilfe der frei gestalteten Bogenform das Ende als erneuten Anfang zu markieren, ging es im dritten Akt darum, die verschiedenen Facetten des ‚Immergleichen‘ – die Geburt Jesu – in einer offenen, musikalisch vielfältigen Form zum Ausdruck zu bringen. Martinůs Absicht, die Dramatik zu besänftigen und das Geschehen in musikalische Formen einzugliedern, setzte mit der damit verbundenen Suche nach einer zwar dramatischen, aber disziplinierten, geradezu statischen Szene im ersten und stärker noch im dritten 119 Vgl. Erben, Prostonárodní české písně a říkadla, S. 45. 141 Akt den weitgehenden Verzicht auf ein dramatisches Geschehen förmlich voraus120. Dass damit nicht zwangsläufig eine Negation der Bühne einhergeht, liegt in der theaterästhetischen Ausrichtung der Oper begründet, ist diese doch von der Absicht geprägt, die Distanz zum Geschehen und das Wissen um das Spiel im Theater zu betonen121. Sowohl in Panny moudré a panny pošetilé als auch in Narození páně wird das Prinzip zwar insofern auf die Spitze getrieben, als von einer Handlung des Spiels kaum mehr die Rede sein kann, jedoch liegt der Grund dafür vielmehr in einer Überhöhung der epischen Momente, denn in einer intendierten Abkehr vom Theater. Anstelle des Librettos, ist es die Aufgabe der Musik, die Bruchstücke zu einem sinnfälligen Ganzen zusammenzufügen: Geleitet von der Idee, die Musik müsse den Inhalt absorbieren, nicht abbilden, gelangte Martinů in Panny moudré a panny pošetilé sowie Narození páně nach eigenen Worten zu volkstümlichen szenischen Oratorien, eine Aussage, die dahingehend differenziert werden kann, dass der erste Akt stärker zu einem Oratorium, der dritte dagegen eher zu ‚volkstümlichen Szenen‘ hin tendiert122. Im Unterschied zum ersten und dritten Akt, die beide durch den Verzicht auf eine eigentliche dramatische Handlung mit dem daraus resultierenden statischen Charakter eine geradezu ideale Voraussetzung für einen bestimmenden musikalischen Plan boten, war eine solche bei den beiden Mirakeln im zweiten und vierten Akt nicht in demselben Mass gegeben. Dafür ermöglichte die Verwendung eines Sprechers in Anlehnung an den mittelalterlichen Meneur du jeu, die gesungenen Texte einer handlungstragenden Funktion weitgehend zu entheben, weshalb sich die beiden Mirakelspiele trotz der ungleich grösseren Dramatik dennoch dem statischen Moment der beiden kurzen Akte annähern, werden doch die Zusammenhänge des ablaufenden Geschehens hauptsächlich zwischen den Szenen vermittelt. Die bewusste ‚Entdramatisierung‘ der Oper durch einen Sprecher prägt insbesondere den zweiten Akt, Mariken z Nimègue, dem mit dem Libretto von Henri Ghéon in der Übersetzung von Vilém Závada das mit Abstand dramatischste Textbuch der Hry o Marii zugrunde liegt, so dass es gerade bei diesem Mirakel verstärkt darum gehen musste, die ‚literarische‘ Dramatik von den zu vertonenden Szenen zu trennen. Sogleich zu Beginn des Aktes, zwischen dem kurzen Orchestervorspiel und der ersten Szene, wendet sich der Sprecher in einer für das ‚epische Musikthea- 120 Zitat Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 219. 121 Zitat Martinů, Poznámky k opeře mirakl panny Marie [Anmerkungen zur Oper Mirakel der Jungfrau Maria] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 195. 122 Zitat ebd., S. 207; Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 223. 142 ter‘ typisch anmutenden Weise direkt ans Publikum, womit er einerseits einer illusionistischen Rezeptionshaltung entgegenwirkt und andererseits sich selbst – und nicht die gespielten Szenen – zur zentralen Erzählinstanz stilisiert. Principál (II, unmittelbar vor Ziffer 6): Račte vstoupit dovnitř, pánové a dámy, [Treten Sie bitte ein, meine Damen und Herren, začíná se hráti nové představení: die neue Vorstellung beginnt: chmurná tragédie dobrodružné panny. die düstere Tragödie der heldenhaften Jungfrau. Drama o Mariken, rodem z Nizozemi. Das Drama der Mariken, gebürtig aus den Niederlanden. Sam Luciper z pekla se s ní oženil Luzifer aus der Hölle selbst vermählte sich mit ihr a celých sedm roku manzelsky s ní zil. und lebte ganze sieben Jahre als Gatte mit ihr zusammen.] [...] Da dem Sprecher die Aufgabe zukommt, die Handlung zu vermitteln, nimmt er eine zum Publikum hin gerichtete Position ein, wozu sich allerdings eine der Bühne zugewandte Funktion gesellt, versucht er doch mehrfach, auf das Verhalten Marikens Einfluss zu nehmen. Wenngleich diese Interventionen wie etwa bei seiner Warnung vor dem Teufel in der ersten Szene (II, unmittelbar nach T 5 nach Z 9; T 9-21 nach Z 12) ohne Wirkung bleiben, ermöglichen sie dennoch eine engere Anbindung des Bühnengeschehens an die Person des Sprechers und damit an die durch ihn ‚verkörperte‘ dramatische Handlung. In diesem Moment der Vermittlung spiegelt sich die für Mariken z Nimègue bestimmende Vorgehensweise, wonach es einerseits darum ging, das Bühnengeschehen gleichermassen wie die Musik vor einer Bebilderung der Handlung zu bewahren, andererseits jedoch der dramatischen Entwicklung des bereits stark gekürzten Mirakels weitgehend gerecht zu werden: Ich lasse diejenigen Teile aus, die mich zu einem überflüssigen musikalischen Erzählen führen würden, erkläre sie kurz mit Worten [...] und verwende die Teile, in denen ich vorteilhaft Musik einsetzen kann, ohne den Rhythmus des Dramas zu stören123. Dieses Vorgehen ermöglichte, die zu vertonenden Teile auf die zentralen Augenblicke der Legende zu beschränken, nämlich das erste Zusammentreffen Marikens mit dem Teufel, Marikens Hingabe an denselben, den mehrfachen Mord im Wirtshaus, das ‚Spiel des Maškaron‘, Marikens Bruch mit dem Teufel und dessen Rache an ihr sowie ihre Erlösung nach dem Tod. Obwohl die Wahl der ereignisreichsten Momente für die vertonten Szenen einem 123 Zitat Martinů, Poznámky k opeře mirakl panny Marie [Anmerkungen zur Oper Mirakel der Jungfrau Maria] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 195. 143 Bestreben nach einer statischen Anlage als Voraussetzung für die Eingliederung in musikalische Formen entgegenwirken muss, ist das dramatische Gewicht insofern beschnitten, als die einzelnen Szenen nicht logisch aneinander anschliessen, sondern als unabhängige Teile einzig durch den Auftritt des Sprechers miteinander in Verbindung gebracht werden können124. Hinzu kommt, dass die auf ein Mindestmass beschränkten Dialoge keinerlei grössere dramatische Auseinandersetzung begünstigen, was bereits in der ersten Szene deutlich zutage tritt, wenn sich Mariken nach der Aufforderung des Teufels, mit ihm zusammenzuleben, nicht etwa an diesen wendet, stattdessen aber, nach einer Warnung des Sprechers, Gott um Erbarmen bittet (Notenbeispiel 43). Notenbeispiel 43: Hry o Marii, II. Akt, 1. Szene, T 1-5 nach Z 13 Anstelle eines sich steigernden Duettes zwischen Mariken und dem Teufel kommt es mit der Anrufung Gottes zu einem unvermittelten Stimmungswechsel, der das dramatische Geschehen insofern suspendiert, als die Zeit plötzlich aufgehoben scheint. Obwohl sich Marikens Erregung in einer vergleichsweise bewegt rhythmisierten Gesangslinie sowie in der pochenden Orchesterbegleitung spiegelt, so tritt in letzterer dennoch ein gewisser Stillstand zutage, als das Orchester ebenso wie der Frauenchor in einer zwar unruhig wirkenden, jedoch nicht eigentlich vorwärtsstrebenden Weise gesetzt ist. Im Verzicht auf eine dramatische Zuspitzung zugunsten einer gleichsam jenseits des Geschehens liegenden Ebene ist dabei nicht allein ein bewusst vermiedener, psychologisch motivierter Höhepunkt zu sehen, sondern zugleich eine Betonung des statischen Moment; bezeichnenderweise endet dieses kurze Bittgebet auf nichts anderem als einem blossen Pochen auf den Oktaven B’-B-b in Klavier und tiefen Streichern (II, 1. Szene, T 21 nach Z 13), das explizit auf den Beginn der Anrufung rekurriert (vgl. Notenbeispiel 43). Da sich dieses Vorgehen, das eine verstärkte statische Wirkung anstelle einer vorwärtsstrebenden musikalischen Entwicklung mit sich bringt, an sämtlichen Stellen findet, die in irgendeinem Zusammenhang mit einer göttlichen Erscheinung stehen – dies durchaus auch in den übrigen Akten –, läge es nahe, in der beschnittenen Bedeutung der dramatischen Zeit ein Abbild der göttlichen und absoluten Ewigkeit zu sehen. Während für diese Deutung spräche, dass beispielsweise die Erlösung Marikens in einem Aleluja des Frauenchors zum Aus124 Zitat Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 219. 144 druck kommt, das infolge seiner ABA’-Form ebenfalls auf den Beginn zurückverweist (II, 5. Szene, T 1 nach Z 65 bis 14 nach Z 69), kann die ausschliessliche Verknüpfung eines betont statischen Charakters mit der göttlichen Zeitlosigkeit in Anbetracht des grundsätzlichen Bemühens einer ‚Entdramatisierung‘ der Oper nicht aufrecht erhalten werden. Als Gegenbeispiel lässt sich etwa die Darstellung der vom Teufel dominierten Teile anführen: Dem erfolgreichen Kampf um Marikens Seele ist die ganze zweite Szene gewidmet, die in zwei Teilen angelegt, zunächst die zunehmende Macht des Teufels über die Verlorene in rein tänzerischer Besetzung über einem sich steigernden Orchestersatz – wiederholt von warnenden Choreinwürfen überlagert – darstellt, worauf im zweiten Teil Mariken selbst mit einem in einen Walzer gefassten Arioso zu Wort kommt. Allein wortlosen tänzerischen sowie instrumentalen Mitteln bleibt es vorbehalten, das innere Ringen der Protagonistin in Form einer steten Steigerung zum Ausdruck zu bringen (II, 2. Szene, T 1 nach Z 14 bis T 23 nach Z 27). Der eigentliche Höhepunkt dieses Tanzes findet sich in einem langsam voranschreitenden homophonen Satz, zweifellos den Sieg des Teufels verkündend, welcher vor dem Hintergrund der – der katholischen Weltsicht verpflichteten – Legende unmöglich als ‚Erlösungsmusik‘ gedeutet werden kann. Wie wenig die Satzweise als Charakteristikum des Göttlichen letztlich taugt, tritt bei eben diesem Triumph Luzifers deutlich hervor, ist doch der Frauenchor als Symbol für Gottes Stimme nicht vom männlichen Teufelschor zu unterscheiden – nach anfänglichem Tritonus im Männerchor (T 1-5 nach Z 26) fügen sich die beiden konträren Gruppen sogar derselben Harmonik. Notenbeispiel 44: Hry o Marii, II. Akt, 2. Szene, T 17-23 nach Z 27 Nach diesem ersten Teil der zweiten Szene, der die Eroberung Marikens durch den Teufel in einen Tanz fasste und zwar die Spannung des Geschehens in einer ständigen Steigerung auszudrücken vermochte, jedoch keinen detaillierten Blick auf das Seelenleben der Protagonistin erlaubte, tauscht die Sängerin der Mariken schliesslich wieder die Tänzerin derselben Rolle aus. Dass sie dies genau in demjenigen Augenblick tut, als Marikens spannungsreiche zwiespältige Lage mit der Hinwendung zum Teufel zu einer Auflösung gefunden hat, mutet vor dem Hintergrund eines zu vermeidenden Ausdrückens psychologischer Spannungen durch Musik als geradezu logische Konsequenz an. Die Sängerin lehnt sich zwar aufgrund der Anlage ihres Solos als Walzer mit der Idee des Tanzes an das vorherige dramatische Geschehen an, befindet sich selbst jedoch bereits in einem ungestörten und damit undramatischen Zu145 stand seliger Verliebtheit, der sie wie in Trance dem věk štěstí zlatý [dem Zeitalter goldenen Glücks] entgegen schweben lässt (II, 2. Szene, T 12 nach Z 29 bis T 17 nach Z 32). Indem die einzelnen Szenen direkt mit konkreten Momenten der Legende verknüpft sind und sich nicht nur als Folge der Unterbrechungen durch den Sprecher, sondern auch durch die jeweils unterschiedliche motivische Grundlage der musikalischen Umsetzung deutlich voneinander abheben, wirkt der zweite Akt, Mariken z Nimègue, klar untergliedert. Diese Anlage ermöglichte einerseits, die Dramatik des Geschehens in einem hohen Masse zu erhalten, sowie andererseits dem Sinn von Martinůs ‚Poesie‘-Begriff entsprechend, eine allzu enge Bindung der Musik an die psychologische Komponente der Handlung zu vermeiden. Während Martinů in Mariken z Nimègue eine dramatische, aber disziplinierte, geradezu statische Szene dadurch erreichte, dass er die Handlungsebene weitgehend von den vertonten Szenen abspaltete und fünf in sich geschlossene Teile mit verbindenden Sprechtexten schuf, ging er in Sestra Paskalina insofern einen Schritt weiter, als er bis auf einen einzigen Auftritt des Sprechers am Ende der ersten Szene auf jegliche Erläuterungen zum Geschehen verzichtete125. Der Inhalt des vierten Aktes, der sowohl in der Ausprägung als Mirakel als auch hinsichtlich seines Umfangs das Pendant zu Mariken z Nimègue darstellt, ist ohne vorheriges Wissen um die Handlung kaum mehr zu erschliessen, was durch eine Inkohärenz bedingt wird, die ihre Berechtigung darin findet, dass die Legende in eine traumartige Atmosphäre gerückt wird126. Der Vorteil dieser angebotenen Deutung der Erlebnisse Paskalinas als Traum liegt nicht darin, eine Erklärung für die phantastischen Begebenheiten zu liefern und diese dadurch letztlich zu glätten, sondern in der Möglichkeit, die Freiheiten einer durch den Traum begründeten Dramaturgie zu nutzen. Analog zum Zitatcharakter des in hohem Masse inkohärenten Librettos, das als Ausdruck von ‚Traumfetzen‘ rückwirkend seine Legitimation erhält, wird auch die Musik der Verantwortung enthoben, einen zwingend logischen Verlauf zu nehmen. Im Gegensatz zu Mariken z Nimègue, wo dem Sprecher die Funktion zukam, die dramatischen Entwicklungen aus den Szenen zu absorbieren, ermöglicht der in Sestra Paskalina latent durchschimmernde Traum, auf eine ähnliche Kompensation fehlender logischer Zusammenhänge zu verzichten. 125 126 Zitat ebd., S. 219. Die Inszenierung sollte die Traumatmosphäre zusätzlich unterstützen: [...] vermeiden Sie eine grosse Mystik und machen Sie es wie einen Traum. Brief von Martinů an František Muzika, vom 17. November 1934 aus Paris, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 191. 146 Dass die Irrealität des Traumes die Dramaturgie gleichermassen wie die Musik des Drucks nach einer ‚realen‘ Logik enthebt, tritt sogleich in der ersten Szene deutlich zutage, kommt es hierbei doch zu einer Konfrontation des ‚realen‘ Klosterlebens mit den Phantasien Paskalinas. Der Beginn des Spiels, die Exposition, ist das Umfeld des Traumes, der Halluzination, in die das hinter der Bühne gesungene, morgendliche Ave Maria der Schwestern eingreift. Es [das Spiel] erhält dadurch einen doppelten Rahmen, nämlich das präzise und konkrete Motiv der Realität, des erwachenden Tages und des beginnenden Lebens hinter der Bühne, mit einer konzise ausgeführten Musik – und: die erlöschende Nacht, auf der Grenze zwischen Traum und Erwachen, mit einer unvollständigen, nicht zu Ende erzählten, unrealen Musik127. Indem das mehrfach gesungene Ave Maria der Nonnen einen quasi realen Bezugspunkt bietet, der als solcher von Beginn an festgelegt ist, da Paskalina in ihrem ersten Auftritt unmittelbar nach dem kurzen Orchestervorspiel zur Sprache bringt, eben erst erwacht zu sein, und sich an ihren Traum erinnert, ist der folgende Tanec stínů [Tanz der Schatten] sowie Tanec démona [Tanz des Dämons] eindeutig der Fortsetzung ihres Traumes zuzuordnen – schliesslich ist sie erneut eingeschlafen (IV, 1. Szene, T 7 nach Z 3). Der Traum spiegelt sich in einer rein instrumentalen, rhapsodischen Vertonung, deren Zusammenhang nicht zuletzt durch das wiederholte Aufgreifen derselben Motive in mehr oder weniger variierter Form zustande kommt, sei es das Motiv, das beim ersten Auftritt des tanzenden Dämons erklingt (Notenbeispiel 45), sei es dasjenige, das die zweimalige stumme Erscheinung des Ritters begleitet (Notenbeispiele 46 a, 46 b). Notenbeispiel 45: Hry o Marii, IV. Akt, 1. Szene, T 1-3 nach Z 6 Notenbeispiel 46a: Hry o Marii, IV. Akt, 1. Szene, T 1-2 nach Z 7 Notenbeispiel 46b: Hry o Marii, I. Akt, 1. Szene, T 1 nach Z 16 127 Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 219. 147 Während sich der Antagonismus zwischen Traum und Wirklichkeit zu Beginn von Sestra Paskalina in der klaren Unterscheidung zwischen einer nicht zu Ende erzählten, da rhapsodisch angelegten Musik und dem strukturierten Choral der Nonnen wiederfindet, entzieht sich der weitere Verlauf des Aktes bereits gegen Ende der ersten Szene einer ähnlich eindeutigen Positionierung. So ist beim Gebet Paskalinas, das auf den Tanz des Dämons folgt, nicht mehr zu entscheiden, ob sich die Schlafende im Traume beten sieht, oder sie womöglich mittlerweile erwacht, tatsächlich Maria um Hilfe anfleht. Selbst die Musik liefert keinen Anhaltspunkt mehr, da die freie Form der Vertonung vollständig auf die Begleitfunktion zurückgeführt werden kann, die sie hier in Anbetracht der engen Anlehnung des Orchesters an die Singstimme innehat (IV, 1. Szene, T 1 nach Z 17 bis T 10 nach Z 20). Obwohl nach dem Gebet wiederum ein Ave Maria hinter der Bühne erklingt (Notenbeispiel 47), kann dieses nicht mehr als Beleg dafür genommen werden, dass Paskalinas Gebet nicht ebenfalls auf der ‚realen‘ Ebene stattgefunden hätte, liesse sich doch der räumliche Abstand nun tatsächlich als solcher deuten. Notenbeispiel 47: Hry o Marii, IV. Akt, 1. Szene, T 1 nach Z 22 Erst in der dritten Szene eröffnet sich mit dem wieder erklingenden Choral erneut die Gewissheit um eine ‚reale‘ Handlungsebene, da sich der Aktbeginn ansatzweise zu wiederholen beginnt, und die zurückgekommene – oder zum zweiten Mal erwachende – Paskalina des Klosterlebens gewahr wird, so dass zumindest die folgende Erscheinung Marias sowie der gesamte Aktschluss nicht mehr als Traumerscheinung zu interpretieren sind (IV, 3. Szene, ab T 1 nach Z 78). Im Gegensatz zur Rahmenhandlung entbehrt der dazwischen dargebotene, latente Traum jeglicher Anhaltspunkte für eine mögliche Einschätzung der Ereignisse, und dies um so mehr, als sich nach dem Gebet Paskalinas in der ersten Szene die Musik analog zum Libretto weitgehend vom Geschehen ablöst. Ihre Erlebnisse jenseits der Klostermauern – ob ‚real‘ oder nicht, bleibe dahingestellt – gliedern sich wiederum in zwei Teile, wovon der erste mit der Verurteilung der vermeintlichen Mörderin zum Tode sein Ende findet, und der zweite, beginnend mit einem weiteren Gebet Paskalinas (IV, 2. Szene, ab T 1 nach Z 50), durch die ins Schicksal eingreifende Maria geprägt ist. Während das lasterhafte Leben Paskalinas – der eigentliche Inhalt der Mezihra [Zwischenspiel] im ersten Teil der ‚Traumsequenz‘ – aufgrund des Volksliedtextes Na mšu svatú zvonijú [Sie läuten zur Heiligen Messe] zumindest erahnt 148 werden kann, wird doch darin ausschliesslich eine Frau beschrieben, die die Messe verpasst, steht der zweite Volksliedtext zu Beginn der zweiten Szene, A před rájem [Und vor dem Paradies], in keinem inhaltlichen Zusammenhang, da Paskalina das Lied auf dem Weg nach Hause vor sich hin trällert, wo sie ihren Mann vom Teufel ermordet vorfinden wird. Obwohl das Lied in der Situation der für sich singenden Paskalina klar verankert ist, müssen sich die Konturen des Volksliedtextes inmitten zweier anderer – Zabila panička pána [Es tötete die Frau den Mann] wird unmittelbar folgen –, die zudem sämtliche in durchaus liedhafter Weise vertont sind, unweigerlich verlieren, was in der Indifferenz bezüglich der jeweiligen Handlungsebene als Ausdruck davon zu sehen ist, in welchem Masse die Musik unabhängig von der Fabel verläuft. Erinnert die Art und Weise der musikalischen Umsetzung dieser drei Chorund Sololieder an die Anlage des volkstümlichen szenischen Oratoriums im vorangegangenen dritten Akt, so unterscheidet sich die zugrunde liegende Handlung insofern grundsätzlich von Narození páně, als ihr in Sestra Paskalina eine vorwärtsstrebende Linearität, nicht aber ein viermaliges Kreisen um dasselbe Ereignis anhaftet. Unterstützt vom einzigen Einsatz des Sprechers, der am Ende der Mezihra das bereits Geschehene sowie die folgenden Ereignisse in wenigen Sätzen zusammenfasst, ist die Fabel allein durch die szenische Darstellung wiederzugeben, verweigert doch die Musik gleichermassen wie das Libretto jegliche Konzessionen an das dramatische Geschehen. Spiegelt sich darin die theaterästhetische Prämisse, dass jedes Bühnenmittel in weitgehend eigenständiger Weise zum ‚Theater‘ beizutragen hat, das wiederum der Verknüpfung aller Elemente entspringt, so ist dennoch unverkennbar, dass es Martinů weniger darum ging, die Musik vom Libretto, als vielmehr die Fabel von der ‚Hypertrophie des Textes‘ zu befreien. Da das Textbuch seine handlungsbestimmende Qualität eingebüsst hat, steht schliesslich einer engen Verbindung mit der Musik nichts mehr im Wege, was sich in einer Polarität der auf der Bühne schauspielerisch dargebotenen Handlung einerseits sowie der eng mit dem Libretto verbundenen Vertonung andererseits niederschlägt. Dieses weitgehend unabhängige Verhältnis zwischen schauspielerischer Darstellung sowie Wort und Ton bestimmt die gesamte ‚Traumsequenz‘ und lässt letztlich die Musik zur bestimmenden Instanz für die zeitliche Ausdehnung der Szene werden; nur in diesem Sinn, nicht aber als Ausdruck einer marginalisierten Rolle der Inszenierung, ist Martinůs Aussage zur zweiten Szene der Sestra Paskalina zu verstehen: Die Handlung [...] spielt sich auf der Bühne als Ornament zur Musik ab, nicht wie in der romantischen Oper, wo die Musik das Ornament zur Bühne war128. 128 Zitat ebd., S. 220. 149 Ist der erste Teil der ‚Traumsequenz‘, der mit dem Gebet Paskalinas in der ersten Szene ansetzt und insgesamt drei Volksliedtexte umfasst, von einer durchweg liedhaften Vertonung geprägt, so bildet das zweite Gebet Paskalinas unmittelbar vor deren Hinrichtung den Auftakt zum zweiten Teil, der mit dem nun vorherrschenden kirchenmusikalischen Charakter wiederum in Einklang mit dem Libretto steht, findet in diesem doch ein vergleichbarer Wechsel zu kirchenlateinischen Texten statt. Darin zeigt sich gleichsam eine gesteigerte Form von Martinů Ablehnung, die Handlung ‚auszudrücken‘, denn während von den vorangegangenen Volksliedtexten hauptsächlich Zabila panička pána [Es tötete die Frau den Mann] in einem zwar freien, jedoch inhaltlich deutlich erkennbaren Zusammenhang zum Geschehen stand, verweigert sich der zweite Teil der ‚Traumsequenz‘ nun sogar einer epischen Erzählhaltung. Die Hinrichtung selbst wird von lateinischen Texten begleitet, deren Poesie die für die Szene notwendige Tragik beinhaltet. Dieses Eingreifen der Musik, das in keiner direkten Beziehung zur Handlung steht, ermöglicht nicht nur eine absolute innere musikalische Logik, sondern auch eine grössere dramatische Spannung, gesteigert durch die Ungleichheit von Element und Situation129. Diese Ungleichheit von Element und Situation gründet nicht auf einem zusammenhanglosen Nebeneinander von Handlung und Musik, sondern ist dahingehend zu interpretieren, dass keine direkte Beziehung im Sinn einer psychologischen Ausdeutung des Geschehens durch die Vertonung angestrebt wird. Dass das Handlungsgerüst als solches selbst von der Musik nicht aufgelöst wird, zeigen etwa die eindeutig dem musikalischen Verlauf zugeordneten szenischen Anweisungen, die durchaus in Einklang mit der musikalischen Entwicklung zu bringen sind, seien dies die drohenden Akkordrepetitionen, wenn der Henker die brennende Fackel ergreift (IV, 2. Szene, T 13-17 nach Z 57), sei dies das aufflammende Feuer, das in chromatisch erweiterten Sekund- und Terzgängen durchscheint (IV, 2. Szene, T 1 nach Z 58 bis T 16 nach Z 59). Spiegelt sich die Dramatik der beginnenden Hinrichtung in einem Crescendo von Chor und Orchester, das im Fortissimo auf einem wortlosen Oh! des Chors über einem, durch ein Sforzato zusätzlich hervorgehobenen, Ces-Dur-Akkord des ganzen Orchesters kulminiert (IV, 2. Szene, T 25-28 nach Z 64), so mutet der kurz darauf erklingende, unerbittliche Choral geradezu als Sinnbild für das unausweichliche Ende Paskalinas an (IV, 2. Szene, T 15-25 nach Z 66). Während der tradierte Wortlaut des Requiems jegliche 129 Ebd., S. 211. 150 Eingeständnisse im Sinn eines Kommentars zur Handlung ausschliesst, nähert sich der Totengesang insofern den Ereignissen an, als sich die Vertonung zur getanzten Hinrichtung nicht indifferent zum Geschehen verhält, sondern – sozusagen als Ballettmusik – wiederholt an dramatischen Wende- und Höhepunkten partizipiert. Diese weitgehende Analogie der szenischen und musikalischen Dramaturgie, die durchaus mit dem statischen Moment eines Requiems vereinbar ist, findet mit dem Auftritt Marias zu einem rein instrumentalen Abschluss, der zwar aufgrund der stumm agierenden Matka Boží [Mutter Gottes] keine sprachliche, jedoch bedingt durch die Motivik des Instrumentalsatzes eine musikalische Semantik erkennen lässt. Schliesslich greift das Orchester auf das Motiv von Paskalinas Gebet zurück, in das die zum Tode Verurteilte – zu Beginn des zweiten Teils der ‚Traumsequenz‘ – ihr Flehen gefasst hat (Notenbeispiel 48). Notenbeispiel 48: Hry o Marii, IV. Akt, 2. Szene, T 1-4 nach Z 50 Maria errettet Paskalina vor den Flammen des Scheiterhaufens und reagiert damit auf den längst verklungenen Hilferuf, der vom Orchester erneut ins Gedächtnis gerufen wird und insofern der Situation angepasst wirkt, als die Solotrompete den Part der Betenden übernimmt, die Streicher ihre fortschreitenden Akkorde nun mit Tremoli spielen – in der Oper längst als unbestimmtes Symbol für eine göttliche Erscheinung etabliert – und die Erlösung sich in einem hellen D-Dur anstelle des früheren Des-Dur niederschlägt (IV, 2. Szene, T 1-18 nach Z 68). Mit diesem sprechenden Gebetsmotiv, das zunehmende Variationen erfährt, endet kurz darauf die ‚Traumsequenz‘ und damit die zweite Szene, ohne dass irgendeine der beteiligten Personen ein einziges Wort über das vollbrachte Wunder verloren hätte (IV, 2. Szene, T 1 nach Z 71 bis T 13 nach Z 72). Dass das Gebetsmotiv nicht auf den ‚Traum‘ beschränkt bleibt, sondern auch auf die dritte Szene und damit auf die ‚Wirklichkeit‘ übergreift, konterkariert die – durch die Anlehnung an die erste Szene bei der Ankunft Paskalinas im Kloster – angebotene Möglichkeit, das Geschehene als Traum zu interpretieren. Demzufolge findet die Frage, ob es sich beim Dargebotenen um reale oder bloss imaginierte Ereignissen handelt, weder auf der Ebene des Librettos noch auch auf derjenigen der Musik eine eindeutige Antwort. Schliesslich erklingen nach der kurzen Reminiszenz an den Aktbeginn mit der mutmasslich Erwachenden und dem darauf folgenden Ave Maria der Nonnen (IV, 3. Szene, T 1 nach Z 73 bis T 8 nach Z 78), nicht nur Teile aus dem Ordinarium Missae, die in vergleichbarer Weise wie das 151 Requiem der zweiten Szene der Handlung entgegengestellt werden, auch entwickelt sich darüber hinaus das Gebetsmotiv im Lauf der Messgesänge zum eigentlichen Fundament des Satzes. Obwohl bereits im Orchestervorspiel zum Kyrie mehrere freie Varianten an das Motiv anzuklingen scheinen, nimmt der Kopf des Gebetsmotivs bezeichnenderweise erst im Augenblick von Paskalinas Tod seine ursprüngliche Gestalt an – nun in G-Dur (T 1-3 nach Z 87) –, zunächst in den antiphonal gesetzten Orchesterteilen als Gegenstück zum Dona nobis pacem des Chores und zuletzt als dessen gleichzeitig erklingende, instrumentale Bekräftigung (T 121 nach Z 90). In Anbetracht dessen, dass das Gebetsmotiv in seiner mehr oder weniger wörtlichen Form geradezu ausschliesslich mit dem Eingreifen Marias in Paskalinas Schicksal verbunden ist, und die übrigen Varianten nicht genügend distinkt erscheinen, um sie dem Motiv eindeutig zuordnen zu können, ist Martinůs folgende Aussage zu relativieren: Das Motiv des letzten Gebets Paskalinas auf dem Scheiterhaufen wird bis zum Ende des Spiels ausgebreitet und kümmert sich um keine Komplikationen der Handlung130. Gerade in der Verwendung des Gebetsmotivs spiegelt sich das für die Hry o Marii bestimmende Verhältnis zwischen Musik und Bühne, nämlich darin, dass einerseits das Handlungsschema als Bestandteil des musikalischen Plans gleichsam als Gerüst der Vertonung fungiert, andererseits jedoch die musikalischen Zusammenhänge weitgehend unabhängig von denjenigen des szenischen Geschehens verlaufen. Können beispielsweise die einzelnen Stationen von Paskalinas wundersamer Rettung in einen direkten Zusammenhang mit der Motivik gebracht werden, so verläuft die Form der motivisch determinierten Abschnitte dagegen weitgehend unabhängig von den Ereignissen, wodurch das dynamische Moment des Handlungsgerüsts eine gleichsam statische musikalische Füllung erhält. Dass die ausschliesslich punktuell durch die Handlung beeinflusste Musik die Inkohärenz des Librettos – auch bedingt durch die marginale Rolle des Sprechers – insbesondere bei Sestra Paskalina nicht zu kompensieren vermag, ist als Ausdruck von Martinůs Maxime zu verstehen: Kurz gesagt, es geht mir um die Poesie des ganzen Werkes, und nicht um irgendwelche dramatischen Details [...]131. In der stark beschnittenen Logik unterscheidet sich der letzte Akt nicht grundsätzlich von den vorangegangenen, denn obwohl die traumartige Atmosphäre Sestra Paskalinas eine verstärkten Inkohärenz begünstigt, ermöglicht in den übrigen Akten die Anlage als wirklichkeitsfernes Spiel, als ‚Oratorium‘ oder ‚volkstümliche Szenen‘ einen weitgehenden Verzicht auf den üblichen „logischen“ Fortgang. 130 131 Zitat ebd., S. 211. Zitat ebd., S. 210. 152 Da es sich nicht um Wirklichkeit oder Wahrscheinlichkeit handelt, verfolge ich nicht den üblichen „logischen“ Fortgang und erreiche dadurch die Freiheit, mit den Elementen gemäss meiner eigenen musikalischen und szenischen Auffassung zu verfahren132. Indem Martinů den Anspruch auf eine logische Entwicklung sowohl im Libretto als auch in der Musik preisgab, bezweckte er, mehrere zentrale Momente der romantischen Oper – gleichbedeutend mit dem Musiktheater nach Wagner –, zu überwinden, die er als längst überlebt erachtete, nämlich das musikalische „Durchleben“ [„prožití“] psychologischer Gegebenheiten mithilfe einer ‚leeren‘ Leitmotivik, vorgegeben durch ein ‚romanhaftes‘ Libretto133. Da der Komponist aus diesem Grund die handlungstragende Rolle des Wortes stark beschnitt, bereitete er zugleich den Boden dafür, mit dem Rezitativ auf das vierte überlebte Moment der nachwagnerschen Oper – sprich: ‚Literaturoper‘ – verzichten zu können, erachtete er doch deren überwiegend rezitativischen Gesangspartien als negative Folge der unumgänglichen Verständlichkeit134. Martinů verwarf das in den vielgeschmähten Literaturopern seiner Zeit vorherrschende Rezitativ aus demselben Grund wie jeglichen psychologisierenden Anspruch an die Vertonung, und zwar um zu vermeiden, dass die Lyrik der Musik dem dramatischen und dynamischen Element zum Opfer falle, eine um so grössere Gefahr für den Gesang, als dieser schneller als das Orchester an die Grenzen dramatischer Steigerung stosse135. Mit Blick auf die sängerischen Partien galt es, die moderne Mache, die im Rezitativ ertrinkt, gemäss Martinů einerseits wegen den physiologischen Gegebenheiten der menschlichen Stimme zu umgehen, andererseits aufgrund der Unvereinbarkeit des Klanges gesprochener mit demjenigen gesungener Sprache136. Die gesprochene Sprache hat im Grunde bereits eine eigene Musikalität und eine Vielfalt rhythmischer und farblicher Nuancen, deren die Musik in dieser Art nicht fähig ist. Die musikalische Phrase ist bereits stilisiert, auf anderen Grundlagen gebaut, beinhaltet aber noch etwas anderes als die gesprochene Sprache. Zum Bau des Satzes kommt derjenige der Musik hinzu 137. 132 Martinů, Poznámky k opeře mirakl panny Marie [Anmerkungen zur Oper Mirakel der Jungfrau Maria] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 195. 133 Zitat Martinů, Přežila se opera? [Hat sich die Oper überlebt?] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 224-230. 134 Vgl. ebd., S. 226. 135 Vgl. ebd., S. 227.. 136 Zitat Brod, Leoš Janáček (1925), S. 38. 137 Martinů, Přežila se opera? [Hat sich die Oper überlebt?] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 226. 153 Obwohl sich Martinů insofern deutlich von der rezitativischen Deklamation distanzierte, als er der Auffassung war, dass sich die gesungene Phrase zwar durch ein gewisses Defizit hinsichtlich farblicher Schattierungen von der gesprochenen unterscheide, jedoch zusätzlich durch eine rein musikalische Komponente bereichert werde, strebte er dennoch in hohem Masse die Verständlichkeit des gesungenen Wortes an, was zwingend mit Konzessionen an die Sprachstruktur verbunden war. Während er von den Sängern erwartete, dass diese sich selbst um Stimmschönheit bemühten und die Grenze zum Geschrei nicht überschritten, bereitete er den Weg für eine verständliche Deklamation, indem er sich bei der Vertonung der Gesangspartien an der Prosodie der tschechischen Sprache orientierte138. Das Tschechische stellt aufgrund seines Systems zweier unterschiedlicher Akzente eine besondere Herausforderung an eine prosodisch getreue Vertonung dar, da es gilt, nicht nur dem qualitativen Erstsilbenakzent, sondern zugleich dem unregelmässig auftretenden, rein quantitativen Längenakzenten gerecht zu werden. Welche Schwierigkeiten mit einer adäquaten musikalischen Umsetzung tschechischer Texte verbunden sind, zeigt die Entwicklung der tschechischen Oper im 19. Jahrhundert: Nicht nur wurde in der ersten Jahrhunderthälfte wiederholt der Längen- zugunsten des Erstsilbenakzentes preis gegeben – oder umgekehrt –, da es an einer verbindlichen Verslehre mangelte. Auch das Problem, wegen des Erstsilbenakzentes letztlich nur in trochäischen und daktylischen Versfüssen schreiben zu können, und somit auf Auftakte verzichten oder diese künstlich erzeugen zu müssen, führte zu einer intensiven Auseinandersetzung mit deklamatorischen Fragen139. Bedřich Smetana läutete spätestens mit seinen Opern über Libretti von Eliška Krásnohorská insofern eine neue Ära ein, als er einerseits dem Erstsilbenakzent Tribut zollte, ihn jedoch durch die Art der Rhythmisierung sowie der Stimmführung zu bändigen wusste, und andererseits dem polternden Charakter von bloss trochäischen und anapästischen Versfüssen mit metrischer Vielfalt entgegenwirkte. Obwohl Janáček mit Jenůfa bereits kurz nach der Jahrhundertwende den Schritt zum Prosalibretto wagte, wodurch das Problem der kaum zu leistenden Vereinbarkeit der tschechischen mit der klassischen Verslehre obsolet wurde, blieb der Vorstoss des Mähren für die tschechische Oper zunächst ohne grössere Auswirkungen. Schliesslich war die Prager Musikwelt des frühen 20. Jahrhunderts fest in der Hand von Zdeněk Nejedlý – dem geistigen Nachfolger Otakar Hostinskýs –, in dessen Augen die einzig richtige Opernform nur eine logische Fort138 Martinů, Poznámky k opeře mirakl panny Marie [Anmerkungen zur Oper Mirakel der Jungfrau Maria] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 194; Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 222. 139 Zu metrischen Fragen in der tschechischen Oper des 19. Jahrhunderts siehe u.a. Tyrrell, Czech Opera, S. 253298 sowie Vyslouzil, Zum Wort-Ton-Verhältnis bei Dvořák und Janáček (1981), S. 81-100. 154 setzung von Smetanas Werk sein konnte, was er im Schaffen Zdeněk Fibichs, nicht aber in demjenigen Janáčeks verwirklicht sah140. Auf diese, durch die Ästhetik Nejedlýs bestimmte Situation der tschechischen Oper spielte Martinů an, wenn er seiner Aussage, das Libretto mit natürlicher Aussprache deklamieren zu wollen, als Klammerbemerkung anfügte: (also nicht nach dem bei uns beliebten System der „richtigen“ Deklamation) 141. Entgegen der in Prag vorherrschenden Auffassung – dafür in weitgehendem Einklang mit Janáček – sah Martinů die natürliche Aussprache in der volkstümlichen Sprache verwirklicht, was ihn als quasi logische Folge dazu führte, mit den Volksliedtexten im dritten und vierten Akt der Hry o Marii auf Verse zurückzugreifen, die „von selbst klingen“ würden142. Jedoch berief sich der Komponist nicht allein bei seinem Umgang mit der tschechischen Sprache, sondern sogar bei seiner Polemik gegen das Rezitativ zugunsten einer gesungenen Phrase auf das Volkslied, weshalb dieses nicht mehr nur die angestrebte Verständlichkeit des Librettos gewährleisten sollte, sondern darüber hinaus zum Ideal des musikalischen Baus stilisiert wurde. Bemerkenswerterweise befriedigt uns die gesungene Phrase völlig (Volkslied). Hier überhöht der musikalische Bau das Wort und füllt es mit eigenen [musikalischen] Mitteln aus, während das Rezitativ stets nur eine Imitation des Wortes bleibt143. Indem sich Martinů sowohl in sprachlicher als auch in musikalischer Hinsicht auf das Volkslied bezog, umging er das am Rezitativ diagnostizierte Problem einer ausschliesslich der Prosodie der Rede entsprungenen Gesangslinie, erfuhr doch die von ihm gewählte textliche Vorlage nun zugleich eine musikalische Rechtfertigung. Welcher Art der Einfluss der Volksmusik auf die Hry o Marii über den blossen Wortlaut der Libretti der letzten beiden Akte hinaus ist, soll sich im Folgenden weisen, wobei die bestimmenden Charakteristiken weniger im – dem westlichen verwandten – böhmischen Volkslied Erbens, als vielmehr im stark slowakisch und polnisch beeinflussten, mährischen Volkslied der Sammlungen Sušils sowie Bartoš’ und Janáčeks zu suchen sind. Dass Martinů jedoch die tradierten Melodien nicht wörtlich in die Oper übernommen hat, und folglich die Analogien zwischen den Volksliedern und deren Pen- 140 Vgl. Karbusický, Die missverstandene Eigenart der Operndramatik Janáčeks (1997), S. 24-30; Tyrrell, Czech Opera (1988), S. 11. 141 Zitat Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung] (1934-35), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 222. 142 Zitat ebd., S. 222. 143 Martinů, Přežila se opera? [Hat sich die Oper überlebt?] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 226. 155 dant in den Hry o Marii auf einer allgemeineren Ebene zu suchen sind, zeigt etwa ein Vergleich von Zvěstování panně Marie, das vermutlich in der Überlieferung Sušils als Vorlage für das zweite Lied des dritten Aktes gedient hat; das aus sechs Strophen bestehende Volkslied erzählt von der Verkündigung Mariae bis zur Niederkunft, und dies bekanntlich, nachdem bereits im unmittelbar vorangegangenen Volkslied Porod panny Marie von der Geburt Jesu berichtet wurde. Notenbeispiel 49a: Sušil Nr. 31, Zvěstování panně Marie [Mariae Verkündigung] Notenbeispiel 49b: Hry o Marii, III. Akt, T 1 nach Z 21 bis T 23 nach Z 23 Obwohl keineswegs von einer direkten Übernahme des Volksliedes aus Sušils Sammlung in die Oper gesprochen werden kann, ist dennoch in vielerlei Hinsicht eine intensive Auseinandersetzung Martinůs mit der Volksmusik erkennbar. So findet sich beispielsweise in der Adaption die strophische Gliederung der Vorlage in einer freieren Form wieder: Die zweiteilig gebauten Strophen sind durch kurze instrumentale Nachspiele, die jeweils zur ersten Stufe führen, deutlich voneinander unterteilt und greifen gar in der dritten und vierten Strophe die – allein durch sprachbedingte Taktänderungen verschleierte – wörtliche Wiederholung eines Strophenliedes auf. Darüber hinaus stellen – wie bei den Hry o Marii überhaupt – auch bei diesem Beispiel die rhythmisch-metrisch konsequent berücksichtigten Sprachakzente des Tschechischen ein augenfälliges Charakteristikum von Martinůs Vertonung dar, wird doch das Vorgehen bereits in der ersten Strophe exemplarisch festgelegt. Während die qualitativen Erstsilbenakzente auf die erste Zählzeit eines Taktes fallen, was bedingt, dass ein Wort einem Takt entspricht, unterscheiden sich die mit einem Längenzeichen versehenen quantitativen Akzente durch einen doppelt so langen Notenwert von den ansonsten in Vierteln voranschreitenden Silben. Wie unmittelbar sich die Rücksicht auf die tschechische Prosodie – motiviert durch den Willen zur Verständlichkeit – letztlich in einem taktweise begründeten Wort-Ton-Verhältnis niederschlägt, spiegelt sich in den dicht aufeinander folgenden Taktwechseln der tschechischsprachigen Teile um so deutlicher, als sich das Metrum etwa im lateinischen Requiem des vierten Aktes ungleich weniger kleingliedrig erweist. Mit der auffallend flexiblen Metrik verfuhr Martinů in seiner Vertonung der tschechischen Texte zwar ungleich sprachorientierter, als es die Volkslieder der Sammlung Sušils vorgaben, wo keiner156 lei Rücksichtnahme auf die prosodische Struktur der tschechischen Sprache ersichtlich ist, näherte sich jedoch in auffallender Weise der Notationsweise Janáčeks an, der dem freien Sprachfluss des mährischen Liedes mithilfe von situationsbedingten Taktwechseln zu entsprechen suchte. Indem Martinů das Metrum gleichsam aus dem Wort gewann, wurde er einem bereits von Janáček diagnostizierten Charakteristikum gerecht: Die Rhythmisierung des mährischen Volksliedes ist insofern einzigartig, als sich die Rhythmen frei in der Zeit ausbreiten und allein durch das Wort, nämlich durch die silbentragenden Töne, an die Zeit gebunden sind144. Obwohl Martinů niemals selbst mit wissenschaftlichen Ansprüchen Feldstudien zur Erforschung der im Verschwinden begriffenen Volksmusik anstellte, zeigte er dennoch zeitlebens ein reges Interesse am Wesen des tschechischen und hauptsächlich des mährischen Volksliedes. Der freie Umgang mit den von Sušil und Erben überlieferten Melodien in Martinůs Hry o Marii könnte daher insofern erstaunen, als der Komponist schliesslich die Texte der Volkslieder weitgehend wortgetreu in das Libretto übernommen hatte. Auch wenn eine Aneinanderreihung harmonisch gesetzter, volksmusikalischer Zitate keinesfalls mit Martinůs Musikauffassung vereinbar gewesen wäre, so spiegelt sich in diesem Missverhältnis von Texttreue in sprachlicher und äusserst freier Handhabung in musikalischer Hinsicht dennoch ein Funken seiner Skepsis gegenüber der Authentizität der Überlieferung. Noch zehn Jahre nach der Komposition der Hry o Marii konstatierte er, dass das Interesse an den Volksliedern zu jung sei, um bereits Grundlegendes hervorgebracht zu haben, was ihm in bezug auf die Musik um so gravierender erschien, als sich das Interesse der Sammler in erster Linie auf die literarische und nicht auf die musikalische Seite richtete145. Martinů beklagte nicht nur zeitlebens, dass ein geeignetes Notensystem fehle, das es ermöglichen würde, die rhythmischen und melodischen Eigenheiten festzuhalten, sondern auch das mangelnde Interesse an der eigenartigen Harmonisierungspraxis, die – längst verdrängt von der gängigen Harmonielehre – einen wesentlichen Teil zum Charakter der mährischen Volksmusik beigetragen habe146. Dieses in musikalischer Hinsicht vernichtende Urteil traf mit einer einzigen Ausnahme sämtliche bis in die 1950er Jahre unternommenen musikethnologischen Anstrengungen, pries Martinů doch allein Janáčeks umfangreiche Einleitung zur Sammlung Bartoš’, deren musikalische Teile allesamt von Janáček stammen, als einzigartige Analyse des mährischen 144 Zitat Janáček, O hudební stránce národních písní moravských [Über die musikalische Seite der mährischen Volkslieder] (1901) in: Bartoš/Janáček, Národní písne moravské, S. XXIX. 145 Vgl. Martinů, Ridgefieldský deník [Tagebuch aus Ridgefield] (1944), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 171. 146 Martinů, O Janáčkovi [Über Janáček] (1954-55), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 354 f. 157 Volksliedes147. Janáčeks Vorrede stellt einen bemerkenswerten Versuch dar, die charakteristischen Merkmale der rund zweitausend gesammelten Lieder nicht nur festzuhalten, sondern mithilfe einer statistischen Auswertung zugleich zu gewichten. Trotz des empirischen Vorgehens schimmert in diesem Kommentar Janáčeks Motivation durch, die Volksmusik – und letztlich die Musik schlechthin – von der immanenten Musikalität der Sprache abzuleiten, indem er ausgehend von der in ländlichen Gebieten gesprochenen Sprache den mutmasslichen Weg zum instrumental begleiteten Tanzlied nachzeichnete, um Schlüsse betreffend der Wahrheit im Volkslied ziehen zu können148. Da Janáčeks Auffassung, wonach sich psychologische sowie physiologische Gegebenheiten unweigerlich in einer ‚wahren‘ musikalischen Struktur niederschlagen müssen, Martinůs Bestreben nach einer von psychologischem Durchleben befreiten Musik geradezu diametral entgegenläuft, kann zwar nicht von einer grundsätzlichen Beeinflussung in musikästhetischer Hinsicht, jedoch zumindest von Spuren der angeführten Merkmale ausgegangen werden. Während sich in der überwiegend vom Wort abgeleiteten Metrik der Hry o Marii eine Parallele zu Janáčeks praktischer Auseinandersetzung mit dem Volkslied findet, treten wiederum mehrere harmonische Charakteristiken auf, die in Zusammenhang mit den theoretischen Erläuterungen des Älteren gebracht werden können. So erklingt bei Stála panenka Maria (Notenbeispiel 49 b) über dem Orchester eine Gesangsstimme, die sich durch die vollständige Vermeidung von Leittönen an die überwiegend diatonische Anlage mährischer Volkslieder anzulehnen scheint – Die Melodien unserer Lieder sind geschmeidig, fliessend, und ihre Bestandteile sind nicht nur irgendwelche „harmonischen Töne“ 149. Das Orchester dagegen bestärkt den diatonischen Klang durch einen einfach gehaltenen Satz, der neben den Hauptstufen insbesondere der zweiten Stufe einen wichtigen Stellenwert einräumt. Bereits im Vordersatz der Orchestereinleitung, der aus einem blossen Wechsel von Tonika und zweiter Stufe im Sekundakkord besteht, wird die hier charakteristische II-I-Verbindung etabliert. In besonders typischer Ausformung tritt die Wendung in Takt 16 nach Ziffer 21 auf, indem die zweite Stufe als Nonakkord durch eine vierte Stufe eingeleitet wird und ebenso mit einem absteigenden grossen Sekundschritt in der Singstimme verbunden ist wie in Takt 23 nach Ziffer 21, wo die II6-I-Verbindung (in G-Dur) zur Hervorhebung des zentralen Wortes Anděl [Engel] dient. Meist in direkter Nachbarschaft zur Tonika, erinnert diese Verwendung der 147 Zitat ebd., S. 354; Janáček, O hudební stránce národních písní moravských [Über die musikalische Seite der mährischen Volkslieder] (1901) in: Bartoš/Janáček, Národní písne moravské, S. I-CXXXVI. 148 Zitat ebd., S. CV-CXXVII. 149 Zitat ebd., S. XXXIII. 158 zweiten Stufe an die plagalen Wendungen der mährischen Volksmusik im allgemeinen und an die ‚Mährische Kadenz‘ im besonderen, die von Janáček am Ende seiner symphonischen Dichtung Taras Bulba aus dem Jahr 1918 erstmals in die Kunstmusik eingeführt wurde und nicht zuletzt in Martinůs Oper Juliette eine wichtige Rolle spielen sollte150. Obwohl aufgrund ihrer diatonischen Gestalt den mährischen Liedern allerlei „alte“ Tonarten zugeschrieben werden, als besonderes Zeichen ihres Alters, verurteilte Janáček vehement jegliche modale Deutung der von den Volksliedsammlern ausschliesslich einstimmig niedergeschriebenen Melodien und verwies stattdessen auf die Praxis der Volksmusiker, den Gesängen ein grundsätzlich funktionalharmonisches, instrumentales Fundament zu unterlegen151. Da mit den Geigen, dem Kontrabass und dem Cymbal die wichtigsten Instrumente der mährischen Volksmusik in Quinten gestimmt werden, habe dies zur Folge, dass im Akkordaufbau der Volksmusik keine Eigenarten zu finden sind, was jedoch der laut Janáček wichtigsten harmonischen Besonderheit keinen Abbruch tut, nämlich der unvermittelten Verbindung der Toniken, die ihre Wurzeln im improvisierten Zusammenspiel habe152. Während die in diesem Zusammenhang von Janáček nachdrücklich hervorgehobene „mährische Modulation“ – eine Ausweichung zur Tonart der VII. Stufe – in Martinůs Hry o Marii keine herausragende Rolle spielt, kann der Orchesterpart der Oper dennoch in einen Zusammenhang mit den Beschreibungen Janáčeks gebracht werden, erhält doch der funktionalharmonische Satz durch die dicht aufeinanderfolgenden Modulationen und Rückungen sein charakteristisches Gepräge. Vor diesem Hintergrund – und in Analogie zur intendierten Rückkehr zum wirklichen Theater – liesse sich die musikalische Umsetzung der Hry o Marii durchaus als Annäherung an die mährische Volksmusikpraxis im Geiste Janáčeks deuten, und dies um so mehr, als Martinů selbst in seinem späten Artikel Über Janáček die (mährische) Volksmusik als Ursprung der tschechischen Kunstmusik bezeichnet hat; eine Aussage, die jedoch wegen des als Huldigung angelegten Charakters des Textes zu relativieren ist und geradezu als Paraphrase der These wirkt, die Janáčeks in der Einleitung formuliert hatte: Kunstmusik sei der Tanzmusik, letztere wiederum dem Volkslied entsprungen153. Nicht nur, weil diese späte Einschätzung Martinůs durch die Sehnsucht nach der unerreichbaren Heimat gefärbt scheint, sondern auch in Umkehrung von Janáčeks Argument, dass die Rückungen im mährischen Volkslied gerade deshalb von besonderem Interesse seien, weil sie eine moderne Kompo150 Janáček, Taras Bulba (1918), T 228-230. Vgl. auch Kapitel IV, S. 254 f. Zitat Janáček, O hudební stránce národních písní moravských [Über die musikalische Seite der mährischen Volkslieder] (1901) in: Bartoš/Janáček, Národní písne moravské, S. LXXX. 152 Zitat ebd., S. CXXX. 153 Martinů, O Janáčkovi [Über Janáček] (1954-55), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 354. 151 159 sitionsform darstellen würden154, kann von einer tatsächlichen Rückkehr zur Folklore in den Hry o Marii keine Rede sein. Martinů näherte sich zwar insofern der praktischen mährischen Volksmusik an, als er sich zum einen mit der konsequenten Berücksichtigung der prosodischen Eigenheiten der tschechischen Sprache über die musikalisch metrische Einengung in der Überlieferung Sušils und sich zum anderen mit einem – hinsichtlich der zahlreichen Rückungen und Modulationen – der volkstümlichen Praxis nahestehenden Orchestersatz über die beklagte schulharmonische Behandlung von Volksliedern hinwegsetzte, verzichtete jedoch auf jegliche explizite Bezugnahme. Schliesslich lässt sich die Sprachbehandlung gleichermassen mit dem Ruf nach Verständlichkeit deuten, wie die freie harmonische Fortschreitung nicht nur mit der volkstümlichen Praxis in Verbindung zu bringen ist, sondern auch mit seinen Erfahrungen der 1920er Jahre. MARIKEN Z NIMÈGUE – VOM FRANZÖSISCHEN EINAKTER ZUM TSCHECHISCHEN OPERNAKT Dass Martinů die Hry o Marii auf ein tschechischsprachiges Libretto verfasste, kann wohl kaum erstaunen, hatte er die Oper doch von Beginn an für ein tschechoslowakisches Theater konzipiert. Scheint die Sprachwahl vor dem Hintergrund der in Brünn geplanten Uraufführung naheliegend gewesen zu sein, mutet es dagegen ungleich überraschender an, dass der Komponist ein halbes Jahr vor der Fertigstellung der Hry o Marii allein deren zweiten Akt, Mariken z Nimègue, zunächst in französischer Sprache vertonte. Weder wurde dieser Einakter jemals aufgeführt noch publiziert – die Fassung ist allein in einer Reinschrift Martinůs erhalten155. Über die Gründe, die zur Komposition der französischen Erstfassung geführt hatten, kann nur spekuliert werden, nicht nur weil das Werk vollkommen in Vergessenheit geraten ist, sondern da auch die Quellenlage kaum Hinweise zu geben vermag. Selbst Martinů waren die Umstände der Entstehung längst entfallen, als ihm der Einakter kurz vor seinem Tod in die Hände geriet, so dass sogar der Komponist diesbezüglich nur noch Mutmassungen anstel- 154 155 Zitat Janáček, O hudební stránce národních písní moravských [Über die musikalische Seite der mährischen Volkslieder] (1901) in: Bartoš/Janáček, Národní písne moravské, S. LXXXII. Martinů begann die Vertonung der französischen Mariken de Nimègue im Mai 1933 und beendete sie im darauffolgenden Juli, ein Jahr vor der Fertigstellung der tschechischen Hry o Marii. Die von ihm selbst mit schwarzer Tinte angefertigte Reinschrift unterschrieb und datierte er am Ende der Partitur mit Paris 28/Juillet, B. Martinů. Das 174 Seiten umfassende Manuskript liegt in der Paul Sacher-Stiftung in Basel. 160 len konnte. Seine Vermutung zielte dahin, dass die französische Fassung als provisorische Version zu verstehen sei, deren französischer Text nachträglich durch einen tschechischen hätte ersetzt werden sollen156. Vermutlich war die Oper beendet, bevor ich die Adaption von Závada bekommen habe. [...] Der Text ist eine freie Adaption Ghéons, und offensichtlich hat sich alles verändert, als ich den Text unter die Noten schreiben wollte. [...] So hat dies wahrscheinlich alles Závada mit seinem wunderschönen tschechischen Text verschuldet157. Diese rein kompositionspraktische Erklärung ist nicht zuletzt wegen Martinůs prekärer finanzieller Situation, die seine gesamte Pariser Zeit prägte, in Zweifel zu ziehen, infolgedessen ihn nur die Aussicht auf eine Aufführung in Frankreich dazu veranlasst haben konnte, die französische Version in einer endgültigen Form zu verfassen158. Ansonsten hätte er sich wohl kaum die Zeit genommen, nicht nur den Akt über ein bloss vorläufiges Libretto vollständig durchzuarbeiten, sondern darüber hinaus sogar eine Reinschrift anzufertigen. Auch wäre Martinů fraglos im Stand gewesen, selbst eine vorläufige Übersetzung ins Tschechische vorzunehmen, zumal dies mit dem nicht zu unterschätzenden Vorteil verbundenen gewesen wäre, dass der Text bereits den tschechischen Sprachrhythmus aufgewiesen hätte, der sich grundlegend vom französischen unterscheidet159. Dass er mit Henri Ghéon bloss für die Mariken z Nimègue und nicht für alle Teile der Hry o Marii einen erfolgreichen französischen Theaterautoren als Librettisten herangezogen hatte, kann als weiterer Hinweis auf eine intendierte Inszenierung des Einakters in Frankreich verstanden werden. Daneben sprechen schliesslich auch diejenigen Bleistiftnotizen im Autograph, die nicht von Martinů stammen, insofern für eine geplante Aufführung, als sämtliche fremden Einträge choreographische Fragen zu den Tanzszenen betreffen, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass sich neben Martinů bereits Tänzer, Regisseure oder Dirigenten mit aufführungspraktischen Fragen auseinandergesetzt haben. 156 Die in der Sekundärliteratur nur spärlich enthaltenen Anmerkungen zur französischen Fassung gehen stillschweigend ebenfalls von dieser Hypothese aus. Siehe Šafránek, Bohuslav Martinů (1964), S. 176; Halbreich, Bohuslav Martinů (1968), S. 290 sowie Erismann, Martinů (1990), S. 127. 157 Brief Martinů an Miloš Šafránek vom 22. März 1959, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 62 158 In welchem Masse Martinů auf Aufführungen seiner Werke angewiesen war, zeigt sich etwa auch darin, dass bereits die Verschiebung der Uraufführung der Hry o Marii um wenige Monate finanzielle Schwierigkeiten mit sich brachte. Siehe Brief von Martinů an František Muzika, vom 17. November 1934 aus Paris, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 191. 159 Wie wenig praktikabel der Austausch des französischen durch das tschechische Libretto schliesslich war, zeigt etwa folgende Aussage: Ich habe von Závada den Text der Mariken erhalten, er ist sehr schön, jedoch muss ich die Sache für den tschechischen Text ziemlich stark ändern. Brief von Martinů an Jindřich Honzl, vom 5. März 1934 aus Paris, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 60. 161 Geht man nun davon aus, dass Martinů die französische Version der Mariken de Nimègue als Einakter für eine französische Bühne geschrieben hatte und erst nach dessen Fertigstellung die tschechische Fassung als Opernakt in die Hry o Marii integrierte, können die Unterschiede zwischen den beiden Akten vermutlich nicht allein auf die sprachliche Ebene zurückgeführt werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass neben der unterschiedlichen Funktion als Einakter beziehungsweise als Opernakt, auch die voneinander abweichenden Traditionen und Aufführungsbedingungen in Frankreich und der damaligen Tschechoslowakei für die jeweilige Gestalt der beiden Werke von Bedeutung gewesen waren. Anhand von Änderungen, die Martinů an der französischen Fassung vornahm, um sie in die tschechischen nationalen Spiele eingliedern zu können, soll denjenigen Aspekten nachgespürt werden, die eine verstärkte Hinwendung zu einem wie auch immer gearteten ‚tschechischen‘ Moment zeigen, beginnend mit einem Vergleich der beiden Libretti und einer anschliessenden Gegenüberstellung der jeweiligen musikalischen Umsetzung160. Das in fünf Szenen untergliederte Libretto der Mariken de Nimègue – bekanntlich eine freie Adaption des gleichnamigen flämischen Mirakelspiels durch den französischen Schriftsteller Henri Ghéon – erzählt die Geschichte der Mariken, die sich nach einer Fahrt in die nahe gelegene Stadt im Wald verirrt und in ihrer Verzweiflung Gott und den Teufel anruft, worauf letzterer in Erscheinung tritt. Nach den mahnenden Worten des Sprechers setzt die zweite Szene in Form eines wortlosen Tanzes der beiden (nun als getanzte Rollen) ein, der die zunehmende Hinwendung Marikens zum Teufel offenkundig macht. Während der Sprecher darauf hinweist, dass mittlerweile sieben Jahre verstrichen seien, wechseln die Sänger nun wiederum die Tänzer aus. Nachdem Mariken in der dritten Szene mit ihrem lasziven Auftritt zur Freude des Teufels einen Mord provoziert und ihrerseits den Mörder erstochen hat, wendet sich in der nächsten Szene das Blatt. Das Mariken längst bekannte Spiel von Maškaron, dargeboten von einer fahrenden Schauspieltruppe, erinnert sie unvermittelt an ihr vergessenes früheres Leben und führt sogleich zum Bruch mit dem Teufel. Tobend vor Wut ergreift dieser Mariken, um sie vom Himmel auf die Erde herunterzuwerfen, worauf sie (in der nahtlos anschliessenden fünften Szene) stirbt und erlöst zu Gott findet, symbolisiert durch einen hellen Lichtstrahl161. 160 Zitat Martinů, Divadlo za bránou [Das Vorstadttheater] (1936), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 242. 161 Gott nicht selbst auf der Bühne auftreten zu lassen, könnte eine Vorsichtsmassnahme Martinůs aus Gründen der Zensur gewesen sein. Schliesslich zeugt seine Nachfrage beim Regisseur Jindřich Honzl von diesbezüglichen Bedenken; siehe Brief von Martinů an Honzl, vom 5. 3. 1934 aus Paris, in: Šafránek, 162 Ghéon verzichtete bei der Einrichtung des französischen Librettos weitgehend auf ein metrisches Muster, weshalb das Textbuch hauptsächlich aus freien Versen mit freier Kadenz besteht und nur in unregelmässiger Folge Endreime, meist bloss in Form von Assonanzen, aufweist. Sogar der Meneur du jeu, dessen Monologe im Gegensatz zu den Gesangspartien ungleich mehr durch Endreime geprägt sind, vermag kein bestimmendes Modell zu etablieren, tritt doch bereits bei seinem ersten Auftritt sogleich in der dritten Zeile eine Waise auf, die das Scheitern jeglichen Reimschemas – spätestens nach dem zweiten Paarreim in der sechsten Zeile – vorwegnimmt. Während der Text des Sprechers zumindest ansatzweise einem metrischen Muster verpflichtet zu sein scheint, indem erst ein solches evoziert werden muss, bevor es überwunden werden kann, ist eine vergleichbare Vorgehensweise in den Gesangspartien nicht zu erkennen. Die einzigen Ausnahmen hiervon bilden Marikens Tanz in der zweiten Szene, den diese in zwar ekstatischen, jedoch paarreimend angeordneten Versen besingt, sowie das durchgehend in Endreimen angelegte Trinklied des Betrunkenenchors in der dritten Szene – ein Moment, das in beiden Fassungen übereinstimmt162. 3. Szene: Chor163: 1. Fassung 2. Fassung [Übersetzung der 2. Fassung] [...] [...] [...] On perd aux dès, gagne à l’amour, tam se v kartách prohrává, dort verliert man im Kartenspiel, on a des filles pour le jour, nebo v lásce vyhrává! oder gewinnt in der Liebe! et des matronnes pour la nuit, Kdo má doma starou bábu, Wer zuhause eine Alte hat, et du couteau on joue aussi, namluví si mladou žábu reisst einen jungen Frosch auf, à l’Arbre d’Or! A l’Arbre d’Or! v baru u Zlatého háje! in der Bar zum Goldenen Hain! Diese in der ersten Fassung durch den Octosyllabe bestimmte Textstelle sticht nicht nur deshalb heraus, weil sie als einzige im französischen Libretto eine festgelegte Silbenzahl aufweist, sondern auch wegen des Rückgriffs auf ein Versmass, das ein vorrangiges Charakteristikum der mittelalterlichen französischen Dichtung darstellt164. Analog zur Textvorlage, worin sich der Betrunkenenchor durch paarige Endreime sowie durch den strikten Achtsilber Divadlo Bohuslava Martinů, S. 60 f.: Aber jetzt stellt sich die Frage, ob dies auf der Bühne umzusetzen ist und durch die Zensur kommen würde, kurz: ob sie es erlauben würden. Sie [Honzl] selbst haben mir gesagt, dass solche Dinge mit Gott auf der Bühne verboten sind. Aber wenn es sich direkt um ein mittelalterliches Drama handeln würde, könnte dies wohl möglich sein. 162 Martinů, Mariken de Nimègue, 2. Szene, Mariken: Oh! Le joli jeu! Je suis une balle ¦ et je rebondis dès que je défaille. [etc.], Autograph, S. 66-75. 163 Martinů, Mariken de Nimègue, 3. Szene, Betrunkenenchor, Autograph S. 78-80; Martinů, Hry o Marii, Mariken z Nimègue, T 5 nach Z 34 bis T 13 nach Z 36. 164 Vgl. Backès, Les Vers et les formes poétiques dans la poésie française (1997), S. 47; Françillon, Petit Lexique de termes techniques (1989), S. 8. 163 von den übrigen Passagen unterscheidet, wird der Gesang der Betrunkenen durch die Anlage des Trinkliedes als variiertes Strophenlied in der Art eines eigenständigen, in sich geschlossenen Stückes hervorgehoben. Da die tschechische Fassung des dritten Auftritts weder in der Textlänge noch in der Rollenabfolge mit dem französischen Libretto übereinstimmte, war es Martinů bei der Vertonung von Závadas Text nicht möglich, die Musik der ersten Fassung zu übernehmen, weshalb er die Szene durchgehend neu vertonte. Der den Auftritt eröffnende, fugierte Chor Au Cabaret de l’Arbre d’Or basiert in der französischen Fassung auf einer rastlosen Motivik mit aufwärts gerichteten Sekundgängen in Achteln, während das tschechische Pendant V baru u zlatého háje (In der Bar Zum goldenen Hain) mithilfe eines einfacheren Chorsatzes stärker den plumpen Charakter der Trinker betont. Notenbeispiel 50a: Mariken de Nimègue [1. Fassung], 3. Szene, T 3-13 nach Z 31 Notenbeispiel 50b: Hry o Marii, II. Akt, 3. Szene, T 5-11 nach Z 34 Auch wenn der Tanz Marikens sowie der Betrunkenenchor mit ihren strikten Reimschemata klare Ausnahmen bilden, so vermittelt das französische Libretto trotz freier Verse, dem weitgehenden Verzicht auf Endreime und den vorherrschenden freien Kadenzen nur bedingt einen Prosacharakter, erhält doch der Text durch die Verwendung einfacher Stilmittel einen betont lyrischen Anstrich. Dies geschieht zum einen durch Binnenreime in reiner Form oder als Assonanzen sowie durch vereinzelte Alliterationen (beispielsweise épée pour les punir165), und zum anderen durch zahlreiche Wiederholungen einzelner Worte oder ganzer Satzteile. Sogleich am Anfang der ersten Szene prägen Epanalepsen – meist als Anaphern angelegt – in unüberhörbarer Weise die Arie Marikens, die jeden Satz mit dem Personalpronomen je beginnen lässt. Mariken (Mariken de Nimègue, 1. Szene) 166: Je ne sais ou je suis, j’ai peur, j’aurais mieux fait, ah, pauvre fille, de rester en tirant l’aiguille, auprès de ma fenêtre! J’ai trop regardé les boutiques et les dames sur les remparts, j’ai péché, j’ai péché par la coquetterie et je suis bien punie! 165 166 Martinů, Mariken de Nimègue, 4. Szene (Dieu), Autograph, S. 115. Martinů, Mariken de Nimègue, 1. Szene (Mariken), Autograph, S. 2. 164 Überwiegend in den Gesangspartien, weniger ausgeprägt dagegen in der Rolle des Sprechers, stellt der einfache Satz, oder eine Inversion desselben im Fall eines Imperativs oder einer Frage, das dominierende syntaktische Muster dar, weshalb die anaphorischen Parallelismen geradezu das rhythmische Grundmuster des Librettos bestimmen. Analog zum syntaktischen Bau der in der Regel aus parataktischen Sätzen bestehenden Dialoge, spiegelt sich die konsequente Reduktion der sprachlichen Mittel auf der Ebene des Vokabulars darin, dass der Wortschatz auf einfachste standardsprachliche Ausdrücke beschränkt bleibt. Abgesehen vom Betrunkenenchor, der sich durch umgangssprachliche Wendungen wie on sautera la banque oder une grappe de plus beau jus deutlich von der vorherrschenden neutralen Sprache abhebt, vermittelt die Wortwahl eine klare Distanz zum Inhalt, vermögen doch die Formulierungen aufgrund ihrer Geläufigkeit nicht, dem Text eine zusätzliche Färbung zu verleihen167. Indem Ghéon die Reduktion der sprachlichen Mittel zum vorherrschenden Merkmal des französischen Librettos machte, orientierte er sich zwar einerseits an der einfachen Sprache der spätmittelalterlichen Mysterien, näherte sich jedoch zugleich dem zeitgenössischen ‚epischen‘ Ideal an, wonach es galt, mithilfe der daraus resultierenden Distanz zum Geschehen nicht etwa an das Gefühl des Publikums, sondern vielmehr an dessen Ratio zu appellieren168. Denn lässt sich die auf grösstmögliche Einfachheit zielende Sprache aufgrund der dadurch bewirkten Distanz im Sinne Brechts als Moment des ‚epischen Theaters‘ deuten, so scheinen sich die rhythmisierenden Wiederholungen durch die Betonung der sprachimmanenten Gestik geradezu am epischen Ideal einer ‚gestischen‘ Sprache zu orientieren169. Bei der Übersetzung des französischen Librettos ins Tschechische hielt sich der Schriftsteller Vilém Závada nicht nur eng an den Handlungsablauf, sondern auch an den Textumfang, die Regieanweisungen sowie die Rollenabfolge, nahm jedoch konsequente Änderungen am Sprachstil vor. Obwohl auch das tschechische Libretto der Mariken eine dem ‚epischen Theater‘ nahe Form aufweist, findet diese ihre Entsprechung auf der sprachlichen Ebene nun nicht mehr in einer Distanz erzeugenden, ‚gestischen‘ Sprache. Während sich Ghéon weitgehend auf die französische Standardsprache beschränkte, ist das tschechische Libretto Vilém Závadas durch eine Vielfalt der Ausdrücke und Wendungen geprägt, die der breiten Palette 167 Martinů, Mariken de Nimègue, 3. Szene (Betrunkenenchor), Autograph, S. 83. Zitat Brecht, Anmerkungen zur Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ (1930), in: Ders., Ausgewählte Werke, Bd. 6, S. 107. 169 Vgl. Heinze, Brechts Ästhetik des Gestischen. Versuch eine Rekonstruktion (1992); Ritter, Das gestische Prinzip bei Bertold Brecht (1986). 168 165 zwischen einer gehobenen literarischen sowie einer niederen bis vulgären Sprache entstammen und ungeachtet der unterschiedlichen Stilebenen miteinander kombiniert werden. Závada distanzierte sich nicht nur durch das grundsätzlich anders geartete Vokabular, sondern auch durch die metrische Gebundenheit der Sprache deutlich von der französischen Vorlage, da er im Gegensatz zu dieser, die nur gelegentlich beim Meneur du jeu Endreime aufwies, den Text einem Reimschema unterwarf. Obwohl wiederholt von Kreuzreimen, reimlosen Einzelversen, sogenannten Waisen, und längeren Prosaeinschüben durchbrochen, prägt der Paarreim als Modell gleichermassen den Part des Sprechers sowie der Sänger, und dies in einem Masse, dass oft sogar die Dialoge der jeweiligen Gegenspieler zusammengehörige Reime aufweisen. Die vorrangige Stellung des Paarreims ermöglichte nicht zuletzt, durch eine Abweichung von demselben den Text zusätzlich zu strukturieren: So markiert beispielsweise das einmalige Auftreten eines Kreuzreims im Part des Principál (das tschechische Pendant zum Meneur du jeu) einen Neubeginn, der die einzelnen Szenen verstärkt voneinander abhebt. Dieses Vorgehen findet sich neben dem ersten Auftritt des Sprechers auch in der Einleitung zur vierten Szene, wo nach der 25 Zeilen währenden Beschreibung von Marikens lasterhaftem Leben durch den Principál ein in den Zeilen 26 bis 29 eingefügter Kreuzreim die Einleitung zur Mezihra (Zwischenspiel) kennzeichnet170. Da die daran anschliessende Mezihra – ein kurzer Dialog zwischen Mariken und dem Teufel – in Prosa gehalten ist, sticht die Stelle aufgrund der ansonsten dominierenden Endreime deutlich hervor, weshalb sich hier im Gegensatz zur französischen Version zum inhaltlichen Exkurs, der den Alltag des Paares demonstriert, ein stilistischer gesellt. Obwohl auch im tschechischen Libretto einfache Sätze überwiegen, treten ungleich mehr Hypotaxen als im französischen auf, weshalb sich Závadas Text neben der grösseren Vielfalt im Vokabular auch durch eine komplexere Syntax auszeichnet. Büssen infolgedessen die in Ghéons Libretto dominierenden anaphorischen Parallelismen an Bedeutung ein, so zeigt sich selbst bei einfachen Sätzen insofern ein grundlegender Unterschied, als sie im tschechischen Text grösstenteils elliptisch gebaut sind. Zusätzlich betont wird der abwechslungsreiche Sprachstil Závadas durch grammatikalische Eigenheiten, die mitnichten einem gängigen tschechischen Usus verpflichtet sind: Darunter fällt ebenso die Verwendung des Genitivs anstelle des Akkusativs bei substantivischen Reihungen, wie die charakteristischen Wechsel zwischen einfacher, meist elliptischer Syntax, und literarischen sowie bisweilen archaischen Konstruktionen. Letztere treten etwa in Form der für die tschechische Sprache 170 Martinů, Hry o Marii, Mariken z Nimègue, 3. Szene, Monolog des Principál, unmittelbar vor Z 48. 166 unüblichen Postposition des Adjektivs auf, und werden nicht bloss beiläufig eingeführt, sondern deutlich hervorgehoben – im folgenden Beispiel geschieht dies durch das insgesamt dreifache Auftreten als Parallelismus. Sbor (3. Szene) 171: [Chor: Taková rozkoš vášnivá Eine solch frevelhafte Wollust jako oheň palčivá, wie Feuer brennend, vždycky špatne končivá, immer schlecht endend, pamatuj si, Mariken. erinnere dich, Mariken.] Das von unterschiedlichen Sprachstilen herrührende Vokabular, die häufige Verwendung von Assonanzen und Reimen sowie die zwischen einfachen und komplexen Sätzen changierende Syntax mit bisweilen archaischen Wortstellungen legen eine Zuordnung des tschechischen Textbuchs zum ‚böhmischen Poetismus‘ nahe172. Demnach sind die charakteristischen Rückgriffe auf alle vorhandenen und vergangenen Stile im tschechischen Libretto als durch die poetistische Idee motiviert zu verstehen, wonach mithilfe aller verfügbaren Ausdrucksmittel der poetische Gehalt der Welt spontan dargestellt werden soll. In der vielfältigen, bewusst stilübergreifenden Verfahrensweise, die ein konstitutives Strukturmerkmal darstellt, spiegelt sich die Devise des böhmischen Poetismus in der Ausprägung Vítězslav Nezvals: Phantasie statt Logik. Da Závada in seiner Übersetzung zwar die grossformale Anlage des Librettos beibehalten, jedoch konsequent eine stilistische Neuorientierung in Anlehnung an die Ideale des böhmischen Poetismus vorgenommen hat, ist das Textbuch der tschechischen Mariken nicht etwa als blosse Übertragung aus dem Französischen, sondern vielmehr als genuin böhmische Dichtung zu verstehen. Die zwei Fassungen der Mariken weisen analog zum Libretto eine in weiten Teilen übereinstimmende formale Gestalt auf: An die Ouvertüre schliessen je fünf Szenen an, die sich sowohl aus ariosen als auch rezitativisch angelegten Solopartien, den Monologen des Sprechers, den Chorsätzen und aus rein instrumental gehaltenen, tänzerischen Teilen zusammensetzen. Während sich der tschechische Opernakt in der ersten, zweiten und dritten Szene deutlich vom französischen Einakter unterscheidet, erweisen sich die beiden Versionen nicht nur in der vierten und fünften Szene, sondern sogar in der Ouvertüre als weitgehend identisch 171 172 Martinů, Hry o Marii, Mariken z Nimègue, 3. Szene, T 3-9 nach Z 43. Zum böhmischen Poetismus siehe u.a. Müller, Der Poetismus (1978); Brousek, Der Poetismus (1975); Illig, Jan Mukařovský und die Avantgarde (2001) [v.a. S. 72-83] sowie Drews, Die slawische Avantgarde und der Westen (1975). 167 (siehe Tabelle 3). Dass die Ouvertüre der tschechischen Fassung erstaunlicherweise genau dieselbe wie diejenige der ersten Version geblieben ist, mag insofern überraschen, als sie die Motive des folgenden Einakters vorwegnimmt und durch die nahezu unveränderte Übernahme in die tschechische Fassung deren motivische Änderungen unberücksichtigt lässt, was in den Hry o Marii zwingend auf Kosten der motivischen Verbundenheit zwischen Ouvertüre und Opernakt geschehen muss173. Die in der tschechischen Ouvertüre vorgenommenen Änderungen betreffen mit Ausnahme eines neu eingefügten Taktes (T 6 nach Z 5, ab 4. Viertel), der vorübergehend die charakteristische Zweiteiligkeit der vorherrschenden Periodik stört, hauptsächlich die Orchestrierung. Schliesslich galt es, entsprechend der ungleich grösseren Orchesterbesetzung in der tschechischen Mariken, die kammermusikalische Instrumentierung der französischen Fassung den neuen Bedingungen anzupassen: Während die neu eingesetzten Flöten mit dem Part der 1. Oboe sowie der 1. Klarinette die Stimmführung der Holzbläser übernehmen, sind zum einen die ebenfalls neu vorgesehenen Hörner meist parallel zur 3. Klarinette gesetzt und sind zum anderen die hinzugekommenen Fagotte eng an die tiefen Streicher sowie an die tiefen Holzbläser gebunden. Obwohl die beiden Ouvertüren musikalisch weitgehend identisch sind, tendiert die zweite Fassung infolge der neuen Instrumentierung zu einem konsequenteren Blocksatz, was zugleich bedingt, dass die Holzbläser in der Regel nicht mehr solistisch, sondern in voller Besetzung erklingen174. Aufgrund der vollen Holz- und Blechbläserbesetzung bilden die Blasinstrumente in der tschechischen Fassung ein klares Gegengewicht zu den Streichern, was als Reaktion auf den lauteren Streicherklang tschechischer Orchester verstanden werden kann175. Schliesslich konnte nur eine Verstärkung des Bläserapparates das gewünschte Gleichgewicht zwischen den Instrumentengruppen gewährleisten, da der Streicherpart weitgehend unverändert in die zweite Fassung übernommen wurde. Dass Martinů eine solche Balance anstrebte, zeigt nicht zuletzt die geringfügige Änderung in den letzten fünf Takten der Ouvertüre: Während in der französischen Fassung die Schlusstakte von den Bläsern und 173 Zitat Martinů, Brief Martinůs an Miloš Šafránek, vom 22. März 1959, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 62. 174 Die verstärkte Tendenz zum Blocksatz der tschechischen Fassung im Vergleich zur französischen tritt in den T 12-16 nach Z 0 besonders deutlich zutage, werden doch Bläser und Streicher in der tschechischen Fassung nun neu rein alternierend eingesetzt. 175 Ausgelöst durch die weitverbreitete Bewunderung der französischen Holzblasinstrumente aufgrund von deren durchsichtigem Klang (vgl. Vignal, Französische Orchestertradition (1992), S. 80), fand im Prag der 1920er Jahre eine rege Diskussion darüber statt, ob man die tschechischen Blasinstrumente durch französische ersetzen sollte. Da Martinů befürchtete, dass die ungleich leiseren französischen Blasinstrumente im tschechischen Streicherklang untergehen würden, stellte er sich explizit gegen diesen Vorstoss. Martinů, O dechových nástrojích francouských [Von den französischen Blasinstrumenten] (1924), in: Šafránek, Domov hudba a svet, S. 39-40. 168 dem Klavier (über einem Orgelpunkt von Celli und Kontrabässen) dominiert werden, sind die tieferen Streicher hier parallel zu den Bläsern gesetzt – die Ouvertüre endet neu im Mischklang der vollen Besetzung. Dass ausgerechnet in der ‚sprachunabhängigen‘ Orchesterbesetzung grundlegende Unterschiede zwischen den beiden Fassungen zu finden sind, mag überraschen – die Auswirkungen betreffen primär die Ouvertüre sowie die ersten drei Szenen, nicht aber die beiden letzten, wo Martinů vermutlich wegen der hervorragenden Bedeutung der Chöre von einer Uminstrumentierung abgesehen hat. Während die tschechische Fassung abgesehen vom Klavier die übliche Besetzung eines grossen Orchesters vorschreibt, unterscheidet sich die französische Version insofern von der späteren, als darin die Oboen und Klarinetten dreifach statt nur doppelt angegeben sind, dagegen aber vollständig auf Flöten, Fagotte und Hörner verzichtet wird176. Obgleich Martinů 25 Jahre nach deren Entstehung die ungewöhnliche Besetzung der französischen Mariken nur mit dem englischen Wort Funny zu kommentieren vermochte – die tschechische Version verwendet ein grosses Orchester mit Klavier –, könnte gerade die Bestimmung für eine Aufführung in Frankreich den Ausschlag für die abweichende Orchestrierung gegeben haben177. Bereits wenige Monate nach seiner Ankunft in Paris veröffentlichte Martinů einen dezidierten Artikel in den Listy hudební matice über den französischen Orchesterklang hinsichtlich von dessen Vorzügen und Schwächen im Vergleich zu tschechischen Orchestern, wobei das tschechische Pendant wohl primär in der Tschechischen Philharmonie zu sehen ist, der er selbst einige Jahre als zweiter Geiger angehört hatte178. Dass er insbesondere am schlanken Klang der französischen Oboen und Klarinetten Gefallen fand, jedoch den Flöten mit dem undenkbaren Tremolo nichts abgewinnen konnte, scheint in direkter Weise seinen Niederschlag in der Orchestrierung der Mariken de Nimègue gefunden zu haben, die erstere sogar dreifach besetzt, von letzteren dagegen vollständig absieht179. Mit Rimsky-Korsakows einflussreicher Orchestrierungslehre liesse sich zudem argumentieren, dass die meist in hoher Lage gesetzten Oboen mit ihrer Tonqualität als naiv-lustig in Dur 176 Orchesterbesetzung des französischen Einakters Mariken de Nimègue: 3 Oboen, 3 Klarinetten, 2 Trompeten, 2 Posaunen, Klavier, Schlagzeug, Streicher. Orchesterbesetzung des tschechischen Opernaktes Mariken z Nimègue: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, Klavier, Schlagzeug, Streicher. 177 Zitat Martinů, Brief von Martinů an Miloš Šafránek, vom 29. März 1959, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 62. 178 Zu Martinůs Anstellung als 2. Geiger in der Tschechischen Philharmonie von 1920-23 siehe Mihule, Martinů (2002), S. 85-108; Šafránek, Bohuslav Martinů (1964), S. 84; Šafránek, Domov, hudba a svět (1966), S. 37; Erismann, Martinů (1990), S. 62-64. 179 Zitat Martinů, O dechových nástrojích francouských [Von den französischen Blasinstrumenten], in: Šafránek, Domov hudba a svet, S. 40. 169 durchaus eine Affinität zu mittelalterlichen Spielen vermitteln, weshalb ihnen innerhalb der Holzbläser die dominierende Rolle zugefallen sein könnte180. Finden sowohl zwei Trompeten als auch zwei Posaunen Verwendung – eine Reduktion gegenüber der tschechischen Fassung, die vermutlich mit dem kleineren Orchester zusammenhängt –, so scheint ähnlich wie bei den Flöten auch bei den Hörnern Martinůs Geschmacksurteil hinsichtlich französischer Instrumente für einen Verzicht ausschlaggebend gewesen zu sein. Dass er es vorzog, den vollen Klang und die Signalwirkung der Hörner gänzlich preis zu geben, zeigt das Ausmass seiner Abneigung: Am wenigsten sympathisch ist das Horn, das zur Hälfte dem Atem, zur Hälfte der Gestik zugehörig ist, es ist am Ende weder das eine noch das andere181. Sowohl in der französischen als auch in der tschechischen Fassung der Mariken stellt der Blocksatz das grundsätzliche Prinzip der Orchestrierung dar, das mit den klaren Wechseln zwischen Tutti und Streichern sowie zwischen Streichern und Bläsern zur intendierten Durchsichtigkeit des Satzes beiträgt. Gerade wegen der unvollständigen Besetzung der einzelnen Instrumentengruppen und dem dadurch verstärkten Spaltklang entspricht der französische Einakter der angestrebten Transparenz weit mehr als der tschechische Opernakt. Zugleich spiegelt sich in der reduzierten Orchesterbesetzung deutlich Martinůs Auffassung, wonach französische Orchester hauptsächlich für Kammermusik prädestiniert seien, infolgedessen die Orchestrierung der französischen Fassung vielmehr kammermusikalischen Idealen als der Operntradition entspricht182. Im Gegensatz dazu erkannte Martinů die Stärken tschechischer Orchester gerade in deren voller Besetzung, nicht aber in kleinen Formationen, was wohl den Ausschlag dazu gab, in der tschechischen Mariken – und in den Hry o Marii überhaupt – die ungewöhnliche Besetzung der französischen Fassung zugunsten eines (abgesehen vom Klavier) konventionellen grossen Orchesters zu verwerfen. Während die weitreichenden Unterschiede in der Orchesterbesetzung nicht zwingend zu erwarten waren, vermögen Änderungen in den Gesangspartien als Folge der Übersetzung ins Tschechische ungleich weniger zu überraschen. Bedingt durch die gänzlich unterschiedliche Prosodie der beiden Sprachen, konnte der Wechsel vom syllabischen französischen zum syllabotonischen tschechischen Libretto für die Vertonung nicht ohne Folgen bleiben, und dies um so mehr, als für Martinů neben der Stimmschönheit und einer natürlichen Melodik die 180 Zitat Rimsky-Korsakov, Grundlagen der Orchestration (russische Erstausgabe 1891; hier: 1922), S. 22. Zitat Martinů, O dechových nástrojích francouských [Von den französischen Blasinstrumenten], in: Šafránek, Domov hudba a svet, S. 40. 182 Vgl. ebd., S. 40. 181 170 Verständlichkeit das zentrale Anliegen an die Gesangspartien darstellte, weshalb es galt, den Akzentuierungen der jeweiligen Sprache gerecht zu werden183. Für die französische Fassung der Mariken bedeutete dies, dass Martinů eine Sprachrhythmik zu berücksichtigen hatte, die als Folge der syllabisch bestimmten französischen Verslehre die Silbenzahl uneingeschränkt in den Vordergrund stellte, weshalb selbst bei einer prosodisch getreuen Textbehandlung die Betonung der Hebungen sekundär erscheinen musste184. Obwohl das französische Libretto überwiegend aus freien Versen besteht, hielt sich Martinů in der Vertonung insofern an die syllabische Auffassung der französischen Verslehre, als er von einer Aufwertung im Sinn einer zusätzlichen Betonung der Hebungen absah. Stattdessen suchte er dem Wortakzent dadurch zu entsprechen, dass er diesen in der Regel auf eine betonte Zählzeiten setzte – nur selten dagegen durch eine quantitative Umsetzung in Form eines längeren Notenwertes –, was zwingend eine grundsätzlich auftaktige Melodik der Singstimmen mit sich brachte. Obwohl dieses Vorgehen in Anbetracht des fehlenden Versmasses den Prosacharakter der Textvorlage in musikalischer Weise zusätzlich verstärken müsste, fällt dies nur bedingt ins Gewicht, da Martinů trotz der übernommenen Wortakzente bemüht war, betonte und unbetonte Silben als quantitativ gleichwertige zu vertonen, was insbesondere bei stummen Silben zum Tragen kam. Indem der Komponist durchaus in Anlehnung an die französische Verslehre das e muet respektierte, verzichtete er nicht nur auf eine eindeutige Zuordnung des prosaähnlichen Textes zur Prosa, sondern machte darüber hinaus das e muet zu einem konstitutiven Element der Melodik. Notenbeispiel 51: Mariken de Nimègue [1. Fassung], 4. Szene (Dieu) Wenngleich die Betonung des e muet der überkommenen Verslehre entspricht, stellt der eigenwillige Umgang damit eine Besonderheit der Textbehandlung in der französischen Mariken dar, denn während Martinů bisweilen – zumeist im Wortinnern – auf eine Aufwertung der stummen Silbe verzichtete, tendierte er andernorts zu deren Überbetonung. So verstösst etwa bei obigem Beispiel das erklingende e muet bei famine aufgrund des unmittelbar nachfolgenden Vokals eindeutig gegen die metrischen Regeln; allerdings vermittelt 183 Zu Martinůs Ideal der Stimmbehandlung siehe Martinů, Autobiografie (1941), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 323 sowie Martinů, K brněnské premiéře [Zur Brünner Uraufführung], in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 222. 184 Vgl. Mazaleyrat, Eléments de métrique française (1990), S. 36-73; Deloffre, Le Vers français (1973), S. 1517; Françillon, Petit Lexique de termes techniques (1989), S. 1. 171 in diesem Fall die Verbindung der stummen Silbe mit einem abwärts gerichteten Oktavsprung den Eindruck eines Endreims (la peste, la famine), der zwar nicht der traditionellen Metrik, jedoch in inhaltlicher Weise durchaus der Aufzählung entspricht. Obwohl das französische Libretto in der Textanlage nicht mit den mittelalterlichen Spielen übereinstimmt, drängt sich in Anbracht der mittelalterlichen Vorlage dennoch die Vermutung auf, dass Martinů mit der wiederholten Überbetonung stummer Silben bewusst auf eine prosodische Besonderheit des mittelalterlichen französischen Theaters rekurrierte. Schliesslich gilt die grundsätzliche Betonung des e muet als wichtiges, im Mittelalter neu eingeführtes Charakteristikum, was von Dubech vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Verslehre mit folgenden Worten beklagt wurde: Une remarque indispensable, c’est que l’e muet entre dans la mesure des vers, ainsi qu’on a peut-être eu l’occasion de le constater. L’impression à nos oreilles est fort désagréable185. Dass sich Martinů in der französischen Fassung der Mariken auf die syllabisch geprägte, mittelalterliche Deklamationspraxis stützte, und durch die weitgehend konsequente Umsetzung bisweilen eine zu starke Akzentuierung unbetonter Silben und damit eine Nivellierung der Betonungen herbeiführte, spiegelt sich nicht zuletzt in einer – im Vergleich zur tschechischen Fassung – gleichmässigeren, ansatzweise monotonen Rhythmik. Entspricht die bisweilen eintönige Sprachbehandlung in der französischen Mariken durchaus den Gepflogenheiten der mittelalterlichen Rezitation, so zeichnet sich die tschechische Fassung durch eine subtile Umsetzung qualitativer und quantitativer Akzente aus186. Martinů vertonte die relativ freien, zwischen Trochäen und Daktylen changierenden Verse des tschechischen Librettos gemäss der Intonation der einzelnen Worte, also ausschliesslich der ungebundenen Rede der Prosa, nicht aber einer Verslehre gehorchend. Dies brachte eine ungleich prägnantere Rhythmik mit sich, die zwar nicht mehr mit einer mittelalterlichen Praxis in Verbindung gebracht werden kann, stattdessen jedoch mehrfach zu prosodisch begründeten Rhythmen führte, die als Vokalmotive die Melodik zu prägen vermochten. Die gelöstere Textbehandlung in der tschechischen Fassung im Vergleich zur tendenziell starrer anmutenden französischen tritt gerade in den nicht taktmetrisch gebundenen Rezitativen der Mezihra (Zwischenspiel) klar zutage, wo die Prosodie des Librettos das allein bestimmende Moment der Vertonung darstellt (siehe Notenbeispiel 52). Während die Gesangsstimmen in der französischen Version überwiegend in Achteln voranschreiten und spätestens mit der völligen Silbengleichsetzung 185 186 Zitat Dubech, Histoire générale illustrée du Théâtre, Bd. 2 (1931), S. 91. Vgl. Deloffre, Le Vers français (1973), S. 56: On peut conclure que la diction poétique ancienne était simple, monotone [...]. 172 bei cette date jegliche Dynamik einbüssen, wirkt die tschechische Fassung nicht nur wegen der neu eingeführten Vorhalte, sondern vor allem aufgrund der lebhafteren Rhythmisierung ungleich spannungsreicher. Notenbeispiel 52: Mariken de Nimègue [1. Fassung] und Hry o Marii, II. Akt, 4. Szene, nach Z 48 (Mariken) Die prinzipiellen Unterschiede zwischen der Prosodie des (mittelalterlichen) Französischen sowie derjenigen des Tschechischen führten insbesondere in den ersten drei Szenen, die einen raschen Handlungsablauf und viel Text aufweisen, zu beträchtlichen Änderungen in der Stimmführung und damit im Charakter der Gesangspartien. In den letzten beiden Akten dagegen, die über weite Teile vom Chor bestritten werden, der nur gelegentlich handlungsrelevante Aussagen zu machen hat und oft in ostinaten Satzfragmenten verharrt, stimmen die beiden Fassungen über weite Teile miteinander überein. Als Erklärung für die nahezu unveränderten Solistenpartien kann daher angeführt werden: Nur in der zweiten Hälfte, in der die Melodien (in den Singstimmen) frei und lang sind, sind sie [die Melodien] geblieben, die Adaption des Textes war vermutlich einfacher187. Obwohl die freier gesetzte Melodik in der vierten und fünften Szene eine weitgehend unveränderte Übernahme der Gesangspartien zweifellos begünstigt haben mag, ist dennoch offenkundig, dass Martinů gerade in diesen beiden Szenen bemüht war, den tschechischen Text der rhythmischen Struktur der französischen Fassung so weit wie möglich anzunähern. Dabei war unabdingbar, die für die französische Mariken charakteristische Auftaktigkeit zu bewahren, was in der tschechischen Fassung um so mehr ins Gewicht fallen musste, als die grundsätzliche Erstsilbenbetonung der tschechischen Sprache eine auftaktige Melodik zur Ausnahme werden lässt (siehe Notenbeispiel 53). Als Mittel bot sich hierbei die Unterbetonung betonter Silben von inhaltlich sekundärer Bedeutung an (jíž me; se; jíž se; jako), die auf unbetonter Zählzeit den bedeutungstragenden Worten (oči; otvírají; plní; v ráji) vorangestellt wurden, was zwar künstliche, jedoch kaum als solche erkennbare Auftakte ermöglichte188. 187 188 Zitat Martinů, Brief Martinůs an Miloš Šafránek vom 22. März 1959, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 62. Damit griff Martinů ein Mittel auf, das insbesondere im 19. Jahrhundert dazu diente, in Anlehnung an Shakespeare und Schiller in Blankversen zu schreiben, obwohl diese im Grunde der Prosodie des Tschechischen entgegenlaufen; siehe etwa den Beginn von Smetanas Braniboři v Čechách [Die Brandenburger in Böhmen] (1865). Vgl. Tyrrell, Czech Opera (1988), S. 256-258. 173 Notenbeispiel 53: Mariken de Nimègue [1. Fassung] und Hry o Marii, II. Akt, 5. Szene, T 15 nach Z 63 bis T 4 nach Z 64 (Mariken) Hinsichtlich Martinůs Umgang mit dem prosodisch grundsätzlich anders gearteten tschechischen Libretto lässt sich festhalten, dass er gerade in der vierten und fünften Szene von der Möglichkeit profitierte, grosse Teile der französischen Fassung zu übernehmen, in den ersten drei jedoch davon Abstand nahm, da die ungleich schwierigere Ausgangslage eine adäquate Umsetzung der tschechischen Prosodie nur schwerlich zugelassen hätte. Allein beim Namen der Titelheldin verzichtete Martinů auf eine prosodische Anpassung an die slawische Sprache, wird sie doch keineswegs mit der tschechischen Erstsilben-, sondern ausschliesslich mit der französischen Endsilbenbetonung gerufen, so dass das anapästisch rhythmisierte Mariken als einzige Reminiszenz an die französische Sprache der Erstfassung in den tschechischen Opernakt Eingang gefunden hat, und dies mit einer Konsequenz, die das Vokalmotiv sogar wiederholt den Orchestersatz prägen lässt. Notenbeispiel 54: Mariken de Nimègue [1. Fassung], 3. Szene, T 143-147 (Chor) Führten neben der Übersetzung des Librettos aus dem Französischen ins Tschechische auch die unterschiedlichen Klangideale der Prager und Pariser Orchester zu zahlreichen Änderungen in der tschechischen Mariken z Nimègue, so finden sich sowohl in der zweiten als auch in der vierten Szene Differenzen, die durch keinen der beiden genannten Gründe zu erklären sind. Dabei ist auffallend, dass diese Abweichungen in der tschechischen Fassung überwiegend auf eine prägnantere Motivik hinzielen und zugleich eine stärkere, musikalisch bedingte Verbundenheit innerhalb der einzelnen Szenen begünstigen. In besonderem Masse wird dies in Marikens Tanz in der zweiten Szene deutlich, der aufgrund des rein instrumentalen Satzes die grundlegende Neuvertonung für die Eingliederung in die tschechischen Hry o Marii nicht erwarten liesse – schliesslich werden die Tänzer erst im zweiten Teil der Szene durch die Sänger ausgetauscht. Der erste Teil dieser in beiden Fassungen zweiteiligen Szene, stellt ein eigentliches auskomponiertes Crescendo dar, das auf dem dynamischen Höhepunkt abrupt abbricht, um unmittelbar darauf in den zweiten Teil überzugehen, worin Mariken ihr Leben mit dem Teufel besingt. Die Steigerung kommt in der französischen Fassung einerseits durch eine stufenweise Beschleunigung sowie andererseits durch eine kontinuierlich an Dichte ge174 winnende Instrumentierung zustande, zu der sich ein zunehmend perkussiver Charakter des Satzes gesellt. Bei der letzten Temposteigerung (frz. Mariken, 2. Szene, Vivo in T 14 nach Z 22) setzt der im Orchester plazierte Männerchor mit dem ostinaten Ruf Mariken! ein, dies zunächst alternierend mit dem Orchester singend, jedoch entsprechend dem dynamischen Höhepunkt bereits in dem kurz darauf anschliessenden Tutti in rhythmisiertes Schreien übergehend (frz. Mariken, 2. Szene, T 1 nach Z 23). Einen halben Takt vor der Fermate, die den ersten Teil abschliesst, setzt mit einem leisen D-Dur-Sekundakkord (ohne Quarte) ein fünfstimmiger Frauenchor ein, der mit seiner ruhigen, ätherisch anmutenden Stimmung einen klaren Gegenpol zum dröhnenden Fortissimo bildet, und erst im Augenblick des unvermittelten Verstummens von Orchester und Männerchor überhaupt zur Geltung kommt (frz. Mariken, 2. Szene, 1 T vor Z 25), um schliesslich das letzte Wort zu behalten. In klanglicher Hinsicht kommt dies einer Antizipation des Aleluja-Chorals des Frauenchors aus der fünften Szene gleich – das Sinnbild der Erlösung –, die nicht in die tschechische Fassung Eingang gefunden hat, übernehmen darin doch ausschliesslich die Violinen die Rolle, die beiden Teile der zweiten Szene durch einen subtilen Klanggrund miteinander zu verbinden – Marikens Hingabe an den Teufel erfährt hier keinerlei erlösendes Moment mehr. Während der Tanz Marikens in beiden Versionen als auskomponiertes, sich ekstatisch steigerndes Crescendo angelegt ist, das in der französischen Fassung in ein rhythmisiertes Schreien des Männerchors über einem perkussiv pochenden Orchester mündet, zeichnet sich der analoge Höhepunkt in der tschechischen Mariken durch eine ungleich grössere Melodik aus. Im Unterschied zur französischen Fassung führt die tschechische bereits zu Beginn des Tanzes ein neues Motiv ein (Notenbeispiel 55), das auf dem abschliessenden Höhepunkt des Crescendos sowohl den Orchester- als auch den Chorsatz bestimmt und weitgehend auf die Perkussivität der französischen Version verzichtet (tsch. Mariken, 2. Szene, T 1-22 nach Z 27). Notenbeispiel 55: Hry o Marii, II. Akt, 2. Szene, T 3-10 nach Z 15 Durch die vorrangige Stellung, die das neue Motiv hier inne hat, kommt es nicht nur zu einer ungleich kantableren Stimmung, sondern auch zu einer prägnanten Melodik, die den Tanz als Ganzes weit mehr abrundet und zu einer zusammenhängenden Einheit formt. Denn während in der ersten Version die Ekstase in einer durch die Perkussivität bedingten Fragmentierung 175 des Satzes endet, findet die zweite Fassung mit der Parallelführung aller Instrumente sowie dem vokalisierenden Chor zu einer emphatischen, einheitlichen Bewegung. Die Bedeutung des in der tschechischen Fassung neu eingeführten Motivs als zusammenfassendes Moment zeigt sich nicht nur im ersten Teil der zweiten Szene, dem Tanz Marikens (Tänzerin), sondern auch im daran anschliessenden zweiten, der Arie Marikens (Sängerin), wo der im 4/4-Takt stehende und durch Tänzer optisch dargestellte Tanz in einen akustischen im Walzertakt übergeht. Während beide Fassungen den verfremdeten Walzer durch eine allmähliche Reduktion der Instrumentation, Dynamik und Motivik ausklingen lassen, bleibt in der französischen Version allein ein Ostinato des anapästischen Mariken-Motivs (vgl. Notenbeispiel 54) in den Streichern zurück. Im Unterschied dazu greift die tschechische Mariken das im ersten Teil der Szene neu eingeführte Motiv wieder auf (siehe Notenbeispiel 55), das nun zwar durch den 3/4-Takt leicht verzerrt erklingt, aber dennoch eine explizite Verbindung zwischen dem getanzten und dem gesungenen Tanz schafft (tsch. Mariken, 2. Szene, T 1-14 nach Z 33). Obwohl die zweite Szene auch in der französischen Fassung mit einem bereits bekannten Motiv ihren Abschluss findet und damit in indirekter Weise auf die Titelheldin verweist, ist das verbindende Moment in der tschechischen Fassung ein stärkeres, da der Tanz durch das innerhalb dieser Szene generierte Motiv zu einer musikalisch bedingten Geschlossenheit findet. Verhilft in der tschechischen Fassung von Marikens Tanz das neu eingeführte Motiv zu einem verstärkten musikalischen Zusammenhang, so übernimmt in der vierten Szene die ‚Jahrmarktsmusik‘, die in beiden Versionen die Szene eröffnet, eine vergleichbare Funktion (tsch. Mariken, 4. Szene, T 1 bis 15 nach Z 50). Denn während diese im französischen Einakter ausschliesslich in der Orchestereinleitung zur vierten Szene erklingt, kommt es in der tschechischen Mariken zu zwei Reprisen des Bläservorspiels – dem nahezu einzigen musikalischen Unterschied zwischen den beiden Fassungen (siehe Tabelle 3) –, die neu eine klare formale Gliederung des Auftritts bewirken (tsch. Mariken, T 9-16 nach Z 54: Reprise der ersten 8 T des Vorspiels; T 1-7 nach Z 58: Reprise des zweiten Teil des Vorspiels). Die Wiederholungen der prägnanten ‚Jahrmarktsmusik‘ bewirken nicht nur einen übergreifenden musikalischen Bogen, sondern ermöglichen darüber hinaus, das ‚Spiel des Maškaron‘ sowie den Streit zwischen Mariken und dem Teufel deutlich voneinander abzuheben. Während die beiden Ebenen in der französischen Fassung zunehmend verwischen, wird in der tschechischen eine Unterscheidung derselben durch die ‚Jahrmarktsmusik‘ ermöglicht, die spätestens durch die Reprise am Ende des ‚Spiels des Maškaron‘ gleichsam zum Rahmen der Szene avanciert (tsch. Mariken, T 9-16 nach Z 54: Reprise der ersten 8 T des Vorspiels). Dass zu176 dem der kurze Dialog zwischen Mariken und dem Teufel, der unmittelbar auf die erste Reprise der ‚Jahrmarktsmusik‘ folgt (tsch. Mariken, 4. Szene, 5 T vor bis 2 T nach Z 55), in der tschechischen Fassung nun über einer Reprise des Orchesterparts der Mezihra geführt wird, ist als weiterer Ausdruck der Absicht zu verstehen, die beiden Handlungsebenen nicht nur klar voneinander zu trennen, sondern ihnen mithilfe von musikalischen Rückgriffen ein charakteristisches Idiom zu verleihen. Gegenüber dem Zusammenhang stiftenden, musikalischen Moment der prägnanteren Motivik steht die Montage als bestimmendes Prinzip des Librettos sowohl der französischen als auch der tschechischen Mariken, das in beiden Vertonungen seine Entsprechung in der Aneinanderreihung eigenständiger Stücke unter Verwendung verschiedener Gattungen findet, vom Choral über den Walzer bis hin zum Marsch. Indem nun in der tschechischen Mariken eine grössere musikalische Verbundenheit zutage tritt, vermag diese ein deutlicheres Gegengewicht zur montageartigen Anlage zu verleihen, als es die Vertonung der französischen Fassung ermöglichen würde. Dies ist insofern von Bedeutung, als die tschechische Mariken bloss einen Opernakt von vieren darstellt und damit ungleich mehr auf einen inneren Zusammenhang angewiesen ist als der französische Einakter, birgt doch die montierte Anlage der vierteiligen Hry o Marii die Problematik in sich, auseinander zu brechen. Insgesamt lassen sich die Unterschiede zwischen den beiden Fassungen in drei Kategorien zusammenfassen, nämlich die sprachstilistische Neuorientierung des Librettos, aufführungspraktische Bedingungen und die Einbindung der zweiten Fassung in eine vierteilige Oper. Ebenso wie die Anpassung der Singstimmen an die tschechische Prosodie scheint auch die unterschiedliche Orchestrierung insofern pragmatisch begründet zu sein, als die Abweichungen in den Gesangsstimmen wie auch in der Orchestrierung auf unvermeidliche Differenzen zurückgeführt werden können, sei es die Prosodie des Französischen und Tschechischen, sei es der unterschiedliche Orchesterklang. Ähnlich praktisch bedingt wirken die rein musikalischen Änderungen, die Martinů bei der Umwandlung des französischen Einakters in den tschechischen Opernakt vornahm und die damit in Zusammenhang gebracht werden können, dass die montageartige Anlage der Hry o Marii einer grösseren Einheit entgegenwirkt, weshalb es galt, die fehlende textliche Kohärenz mit einer musikalischen zu kompensieren. Im Unterschied dazu stellt die poetistisch gefärbte Übersetzung Závadas eine nicht zwingende Änderung dar und steht als einzige in einem direkten Zusammenhang zu einem nationalen Merkmal – ‚national‘ insofern, als der böhmische Poetismus als erste Ausprägung einer ge- 177 nuin tschechischen modernen Literatur gilt189. Das neu in die zweite Fassung eingeführte ‚nationale‘ Moment ist somit ausschliesslich im Libretto zu finden, wirkt doch die Musik der tschechischen Fassung nicht ‚tschechischer‘ als diejenige der französischen Version. 189 Vgl. Müller, Der Poetismus (1978), S. 22. 178 Tabelle 3: Die beiden Fassungen von Bohuslav Martinůs Mariken z Nimègue [Die Schattierungen zeigen diejenigen Stellen an, die weitgehend unverändert in die zweite Fassung übernommen wurden.] Handlung Französische Fassung Tschechische Fassung Kommentar (1. F.) (2. F.) T 1-81 T 1-82 Weitgehend identisch Monolog: Principál Identisch Ouvertüre 1. Szene: Im Wald Der Sprecher erzählt Monolog: Meneur du Jeu die Vorgeschichte Mariken verirrt sich im T 1-46: Arie: Mariken Wald T 1-54: Arie: Mariken Inhaltlich weitgehend identisch: musikalisch zwar auf demselben Hauptmotiv basierend, jedoch deutlich von einander abweichend Warnung des Sprechers Monolog: Meneur du Jeu Monolog: Principál Identisch Der Teufel will Mari- T 47-78: Duett: Teufel, T 55-106: Duett: Teufel, Inhaltlich identisch, musikalisch ken davon überzeugen, Mariken Mariken deutlich von einander abweichend bei ihm zu bleiben Warnung des Sprechers T 79: Meneur du Jeu, Chor: T 107: Principál, Chor: Metrisch ungebunden, in beiden Mariken! Mariken! Fassungen identisch T 80-84: Instrumentales Fehlt in 2. F. Zwischenspiel, mit motivischem Rückgriff auf das im Vorspiel des ersten Szenes exponierte Hauptmotiv. Anrufung Gottes durch T 85-106: Choral: Mariken, T 108-128: Choral: Mari- Durch Überlappung in 2. F. um 1 Mariken Frauenchor ken, Frauenchor T kürzer, ansonsten identisch 2. Szene: Der Tanz des Teufels mit Mariken Tanz des Teufels mit T 1-272: Orchester mit Mariken Choreinwürfen ab T 255. (Mariken, Teufel: kurzzeitiger Austausch der Sänger durch Tänzer) Mariken, vom Tanz mit dem Teufel berauscht Mariken besingt ihren T 273-370: Arie: Mariken Tanz Zusammenfassender Monolog: Meneur du Jeu Bericht über die sieben Jahre, die Mariken zusammen mit dem Teufel verbracht hat T 1-335: Orchester mit Choreinwürfen ab T 162. (Mariken, Teufel: kurzzeitiger Austausch der Sänger durch Tänzer) In beiden Fassungen weist der Tanz eine deutlich Steigerung in Tempo und Dynamik auf; musikalisch jedoch stark von einander abweichend. Der 2. F. liegt neu ein melodisch deutlich hervortretendes Hauptmotiv zugrunde. T 336-350: Choral des Fehlt in 1. F., neu in 2. F. hinzuFrauenchors, der die Rolle gefügt Marikens übernimmt und deren Text in der 1. Person singt. T 351-468: Arie: Mariken Text weitgehend identisch, musikalisch deutlich verschieden Monolog : Principál Identisch 179 3. Szene: Im Gasthaus Im Gasthaus T 1-46: Betrunkenenchor T 1-56: Betrunkenenchor Inhaltlich weitgehend identisch, musikalisch verschieden T 47-194: Teufel, zwei T 57-255: Teufel, Trinker, Inhaltlich weitgehend identisch, Trinker, Mädchen, Chor Mädchen, Chor (sowie musikalisch verschieden (sowie getanzte Rolle der getanzte Rolle der Mariken) Mariken) Monolog: Meneur du Jeu Monolog: Principál Identisch Mariken verleitet einen Trinker zum Mord, worauf sie ihrerseits den Mörder ersticht Monolog des Sprechers: Warnung und anschliessende Überleitung zum Zwischenspiel Zwischenspiel: Dialog [T 1-21] Metrisch unge- [T 1-21] Metrisch unge- Weitgehend identisch, in beiden Marikens mit dem bunden, Duett: Mariken, bunden, Duett: Mariken, Fassungen je zweimal durch dieTeufel Teufel Teufel selbe ‚Jahrmarktsmusik‘ durchbrochen. 4. Szene: ‚Das Spiel von Maškaron‘ Das ‚Spiel von Maškaron‘ ‚Spiel von Maškaron‘: Während Maškaron versucht, Gott gegen die Menschen aufzuwiegen, besänftigt die Mutter Gottes ihren Sohn T 1-15: ‚Jahrmarktsmusik‘ auf Bühne T 16-102: ‚Spiel von Mascaron‘: Terzett: Mascaron, Gott, Mutter Gottes; Chor T 1-15: ‚Jahrmarktsmusik‘ auf Bühne T 16-102: ‚Spiel von Maškaron‘: Terzett: Maškaron, Gott, Mutter Gottes; Chor T 103-110: ‚Jahrmarktsmusik‘ Indem Mariken am T 104-161: Terzett: Mutter T 111-173: Terzett: Mutter Dialog zwischen der Gottes, Mariken, Teufel; Gottes, Mariken, Teufel; Mutter Gottes und Chor Chor ihrem Sohn teilnimmt, findet sie zu Gott zurück T 174-180: ‚Jahrmarktsmusik‘ Der Teufel wirft Mari- T 162-202: Orchester mit T 181-221: Orchester mit ken vom Himmel auf gleichzeitigem Monolog gleichzeitigem Monolog die Erde herunter des Meneur du Jeu, der die des Principál, der die GeGeschehnisse beschreibt schehnisse beschreibt Mariken nähert sich T 203-216: Nachspiel des T 222-235: Nachspiel des Jesus Orchesters (sowie getanzte Orchesters (sowie getanzte Rolle der Mariken) Rolle der Mariken) Identisch Orchestersatz in beiden Fassungen identisch, Singstimmen leicht verschieden In 2. F. neu hinzugefügt T 104-110 der 1. F. nicht in 2. F. übernommen, ab T 111 wieder identisch weiter In 2. F. neu hinzugefügt Orchestersatz in beiden Fassungen identisch, Singstimmen leicht verschieden Identisch 5. Szene: Der Tod Marikens Die sterbende Mariken T 1-31: Arie: Mariken preist Gott T 1-31: Arie: Mariken Orchestersatz in beiden Fassungen identisch, Singstimmen leicht verschieden Alleluja des Frauen- T 32-118: Choral : Frauen- T 32-125: Choral : Frauen- Weitgehend identisch. Abweichors chor chor chung: T 66-70 der 1. F. entsprechen T 66-77 in der 2. F. 180 ZWISCHEN POETISMUS UND ‚BEKENNTNISOPER‘ Als grundsätzlich ideologische Richtung, die dem reinen Ästhetizismus abgeschworen hatte und stattdessen für die Verankerung einer gesellschaftlich relevanten Lebenskunst in der zu poetisierendenden Welt plädierte, ist der böhmische Poetismus durch unterschiedliche Ansätze geprägt, die Funktion von Kunst neu zu bestimmen190. Dies geschah nicht zuletzt deshalb im Geiste des Kommunismus, weil sich die Exponenten des Poetismus weitgehend auf die Mitglieder der bereits 1920 gegründeten, kommunistischen Gruppe Devětsil – der tschechische Name für das stinkende Kraut ‚Pestwurz‘ – beschränkten, eine politische Ausrichtung, die sich mehr oder weniger explizit in der Haltung gegenüber der Funktion von Kunst sowie in den unterschiedlichen Manifesten niederschlug191. Gerade bei den beiden wichtigsten Vertretern des Poetismus zeigt sich eine stark differenzierende Auffassung hinsichtlich der Rolle der Kunst, denn während Karel Teige bemüht war, mit der ‚Poesie‘ den Geist des Menschen zu reinigen und ihn damit auf eine zukünftige sozialistische Gesellschaft vorzubereiten, suchte Vítězslav Nezval nicht einer gesellschaftlichen Utopie wegen, sondern um die verkümmerte Phantasie anzuregen, nach dichterischen Techniken192. Der Poetismus ist die Methode, wie man die Welt ansieht, damit sie zum Gedicht wird. Er besteht nicht aus Themen, die ihm seine Gegner zuschreiben. Es gibt überhaupt keine Themen 193. Bedingt durch den Verzicht auf eine ausschliesslich ideologische Zielsetzung, dem die Auffassung einer weitgehend autonomen Welt der ‚Poesie‘ zugrunde lag, wollte Nezval die Verbindung zum Leben in einer vagen Weise dadurch aufrechterhalten, dass er statt auf eine Revolution auf eine Sensibilisierung des Menschen zielte. Dem Künstler räumte er die grösstmögliche Freiheit ein, war es doch dessen Aufgabe, mithilfe der Phantasie die beherrschende Logik zu überwinden, was zwingend in immer neuer Weise geschehen musste, denn jede, auch die zunächst ungewöhnlichste Art der Dichtung wird zur Konvention, sobald sie zu oft 190 Zitat Illing, Jan Mukařovský und die Avantgarde (2001), S. 79; siehe auch Vlašin, Slovník literární teorie (1984), S. 278. 191 Zu ‚Devětsil‘ siehe u.a. Brousek, Der Poetismus (1975), S. 57-75; Drews, Die slawische Avantgarde und der Westen (1975), S. 84-97; Müller, Der Poetismus (1978), S. 26-28. 192 Vgl. Müller, Der Poetismus (1978), S. 37-38, 69; Drews, Die slawische Avantgarde und der Westen (1975), S. 87, 95. Zu Karel Teige siehe u.a. Srp, Karel Teige 1900-1950 (1994). 193 Nezval, Kapka inkoustu [Ein Tintentropfen] (1928), in: Dílo XXIV, S. 179. 181 gebraucht worden ist194. Nezvals Poetismus kreiste hauptsächlich um die Sprache, deren Dynamik er dadurch freizusetzen beabsichtigte, dass er das Wort als Zeichen auf dieselbe Stufe wie die Realität als Bezeichnetes stellte – die Worte, die die Wirklichkeit abbilden, sind in der Tat selbst die Wirklichkeit –, infolgedessen sprachliche Veränderungen unweigerlich die Wirklichkeit beeinflussen195. Der Forderung nach Phantasie entsprechend, spielte die Assoziation als Alchimistin, schneller als das Radio, in Nezvals Schaffen eine vorrangige Rolle, die darüber hinaus nicht nur die Bedeutung der Metapher sowie der Assonanz, sondern auch diejenige des Reimes untermauerte, da dieser wundersame Freundschaften zwischen Worten herzustellen vermöge196. Hinsichtlich des Textbuches der Hry o Marii ist ein Bezug zum späten Poetismus nicht nur durch die Mitarbeit Nezvals, dem Librettisten des ersten Aktes, sowie des Poetisten Vilém Závada, dem Übersetzer des zweiten Aktes, gegeben, sondern auch durch die freie Bearbeitung mittelalterlicher und volkstümlicher Quellen, kann diese doch als Absicht gedeutet werden, den poetischen Gehalt der Welt durch Rückgriffe auf alle vorhandenen und vergangenen Stile auszudrücken197. Dennoch ist streng genommen eine eindeutige Zuordnung des Librettos zum Poetismus nicht zu leisten, da die Hry o Marii einerseits unmöglich mit Teiges gesellschaftspolitischer Intention in Einklang zu bringen sind, und andererseits Nezvals Innovationsprinzip jegliche verbindliche Kriterien von vornherein obsolet erscheinen lässt. Mit dieser Einschränkung lässt sich das Textbuch in vielerlei Hinsicht poetistisch deuten, findet sich doch ein zumindest latenter Zusammenhang zwischen dem Poetismus und der Oper Hry o Marii auch im Bestreben, mit dem wirklichen Theater zum Publikum zurückzufinden, was als Ausdruck einer intendierten Rückkehr der Kunst ins Leben verstanden werden kann. Im Gegensatz dazu muss eine Zuordnung der Musik zum Poetismus ungleich problematischer anmuten, obwohl etwa Martinůs Ideal einer musikalischen Poesie zu einem poetistischen Etikett verleiten könnte, denn während es sowohl Teige als auch Nezval um eine untrennbar mit der Wirklichkeit verbundene Poesie der Welt ging – sei es als gesellschaftlicher Zustand, sei es in der Gleichsetzung vom Wort mit der Realität –, strebte der Komponist eine solche innerhalb rein musikalischer Grenzen an, also weitgehend unabhängig von aussermusikalischen Gege- 194 Zitat Nezval, Přednáška o avantgardní literatuře [Vortrag über die avantgardistische Literatur] (1930), in: Ders., Dílo XXIV, S. 224; zur Bedeutung der ‚Innovation‘ für Nezvals Kunstauffassung siehe Müller, Der Poetismus (1978), S. 73. 195 Zitat Nezval, Chtěla okrást lorda Blamingtona [Sie wollte Lord Blamington bestehlen] (1930), in: Ders., Dílo XXIV, S. 264. 196 Zitat Nezval, Papoušek na motocyklu [Der Papagei auf dem Motorrad] (1924), in: Ders., Dílo XXIV, S. 14 f. 197 Zu Vilém Závada siehe u.a. Brousek, Der Poetismus (1975), S. 117, 261 f. 182 benheiten198. Da es sich beim Poetismus im Grunde um eine ideologisch motivierte Richtung handelt, ist ein mündliches Bekenntnis dazu gerade in der Musik unabdingbar, ist doch der Ton im Unterschied zum Wort zu keiner expliziten inhaltlichen Bezugnahme fähig. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass Nezval in seinem Aufsatz über E. F. Burian ausgerechnet diejenigen Momente hervorhebt, die in hohem Masse der Musikauffassung Martinůs entsprechen, nämlich die Reinigung der Musik von Aussermusikalischem und dem Verzicht auf Tonmalereien und Leitmotive – der grundlegende musikästhetische Unterschied zwischen den beiden Komponisten ist weniger im Idiom als vielmehr in Burians Bekenntnis zum Poetismus zu finden199. Martinů strebte nicht deshalb nach einer ‚Poesie‘, um in einer allgemeinen Weise die Phantasie des Menschen anzuregen – geschweige denn als Vorbote einer zukünftigen sozialistischen Gesellschaft –, sondern um die Musik zu ihren ‚Grundlagen‘ zurückzuführen; eine Ausrichtung, die bedingt, dass die Hry o Marii allein mit den künstlerischen Momenten eines Nezvalschen Poetismus in Verbindung gebracht werden können, nicht aber mit dem ideologischen Kern einer Bewegung, die schliesslich im tschechischen Surrealismus aufgehen sollte200. Dass ihn dagegen das Ideal einer ‚poetischen‘ Musik nicht davon abgehalten hat, sich bei den Hry o Marii am zeitgenössischen Theater zu orientieren, liegt in dessen hoher Kompatibilität mit seiner Musikauffassungen begründet, ermöglichte doch die Betonung des ‚Spiels im Theater‘ eine Vertonung fern jeglicher Psychologisierung. Da Martinů auf eine ‚Entdramatisierung‘ der Oper zielte, worunter er einen Verzicht auf die „dramatische“ Aktion zugunsten der Situation, der Attitude verstand, lag es zudem nahe, die abendfüllende Oper aus Einaktern zusammenzufügen, die den Vorteil in sich bergen, nicht ein Drama im Kleinen, sondern nur ein Teil des Dramas zu sein201. Anstelle einer sich entwickelnden Handlung bestimmen aneinandergereihte szenische Momente insofern die gesamte formale Anlage der Hry o Marii, 198 Einen direkten Vergleich zwischen Nezval und Martinů stellte etwa Erismann an: Tout l’univers de Martinů est ici résumé mais aussi sa manière d’agir, de concevoir le rôle de l’artiste et la portée de l’œuvre d’art. Erismann, Martinů (1990), S. 92. Siehe auch Stöck, Der Einfluss von Surrealismus und Poetismus auf Martinůs Oper ‚Julietta‘ (2000), S. 680, 683. 199 Zitat Nezval, E. F. Burian (1925), in: Ders., Dílo XXIV, S. 84-87; zu E. F. Burian siehe dessen Schriften von 1925-1938: Paclt, E. F. Burian (1981). Zum musikalischen Poetismus siehe u.a. Smetana, Dějiny české hudební kultury, Bd. 2 (1981), S. 439-441; zum ‚Osvobozené divadlo‘ [Das Befreite Theater], dem poetistischen Theater in Prag, siehe Pelc, Zpráva o Osvobozeném divadle [Nachricht vom Osvobozené divadlo] (1982) sowie Pelc, Meziválečná avantgarda a Osvobozené divadlo [Die Avantgarde der Zwischenkriegszeit und das Osvobozené divadlo] (1981); zu Jaroslav Ježek, dem wichtigsten Komponisten des ‚Osvobozené divadlo‘ siehe Holzknecht, Jaroslav Ježek & Osvobozené divadlo (1957). 200 Schamschula, Tschechische Literatur: Aufbruch des Internationalismus (1983), S. 545. 201 Zitat Martinů, [Handschriftliche Notizen zur Oper] (1943), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 197; Zitat Szondi, Theorie des modernen Dramas (1963), S. 92. 183 als nicht nur die vier Akte blosse Ausschnitte aus Dramen darstellen, sondern sogar innerhalb der einzelnen Szenen das Geschehen weitgehend aus den vertonten Teilen absorbiert wurde – etwa durch die Verwendung eines auktorialen Sprechers im zweiten, die wiederholte Erzählung desselben Ereignisses im dritten, oder die Traumatmosphäre im vierten Akt. Indem Martinů – ganz im Geiste des zeitgenössischen avantgardistischen Theaters – nicht die logische Entwicklung, sondern bloss das Gerüst einer Handlung berücksichtigte, erreichte er, entsprechend dem eigentlichen Ziel seines Vorgehens, ein grösstmögliches Mass an musikalischer Freiheit. Der kausale Zusammenhang zwischen Musikauffassung und theaterästhetische Ausrichtung wonach der Ausgangspunkt für die neue Opernform das eigene musikalische Problem war, liegt darin begründet, dass es ihm primär darum ging, die Musik in die ihr eigene Sphäre zurückzuführen, und erst als weiteren Schritt zum wirklichen Theater zu finden202. Während Martinů bei Les trois Souhaits Ribemont-Dessaignes’ Dadaismus vom Libretto in die Vertonung hineingetragen und auf der Folie der ‚Zeitoper‘ sowohl die Gattung Oper als auch die Musik mehr negiert als neu definiert hatte, strebte er mit der Trilogie Špalíček, Hry o Marii und Divadlo za bránou explizit eine Erneuerung des Musiktheaters an. Martinů besann sich vor dem Hintergrund der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit infolge der Weltwirtschaftskrise auf die künstlerische und moralische Verpflichtung als Komponist, beklagte er doch die fehlgerichtete Rezeptionshaltung eines Publikums, das die Musik längst zu einem alltäglichen Ereignis hat verkommen lassen203. Hinsichtlich des Anspruchs auf ‚höchste Kunst‘, als Ausdruck einer vom Komponisten wahrgenommenen gesellschaftlichen Verantwortung, lassen sich die Hry o Marii durchaus in die Reihe der nach 1930 entstandenen Bekenntnisopern einordnen, die trotz unterschiedlichster Idiome allesamt von einer neuen Suche nach bleibenden Werten zeugen – sei es Paul Hindemiths Mathis der Maler, Ernst Kreneks Karl V. oder Arnold Schönbergs Moses und Aron204. Während einerseits die Hry o Marii mit Blick auf das gewandelte kompositorische Selbstverständnis Martinůs eine Bezeichnung als ‚Bekenntnisoper‘ nahe legen, wodurch das Werk Teil einer übergreifenden ideengeschichtlichen Wende um 1930 wird, so sagt jedoch andererseits dieser Terminus nichts über die eigentliche Beschaffenheit der Oper aus. Wie vage der Begriff als reiner Ausdruck einer Geisteshaltung hinsichtlich einer Definition verbindlicher Merkmale letztlich ist, zeigt sich etwa bei der Rolle von Mythos und Geschichte 202 Zitat Martinů, Poznámky k cyklu Hry o Marii [Anmerkungen zum Zyklus Hry o Marii] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 206. 203 Zitat Martinů, Hudba v Paříži [Musik in Paris] (1933), in: Šafránek, Domov, hudba a svět, S. 56. 204 Danuser, Die Musik des 20. Jahrhunderts (1984), S. 234-246. 184 sowie deren nationaler Färbung. Obwohl keine weltanschauliche Botschaft vonnöten ist, sondern vielmehr der persönliche Entwurf einer umfassenden künstlerisch-dramatischen Äusserung eine ‚Bekenntnisoper‘ ausmacht, stellte Danuser dennoch eine typische Verquickung von religiösen und nationalen Elementen fest, eine Charakterisierung, die mit Blick auf die katholische Thematik der nationalen Spiele vollumfänglich auf die Hry o Marii zuzutreffen scheint205. Wie wenig diese hervorgehobenen Merkmale als Erklärung für das Werk taugen, zeigt sich einerseits darin, dass die religiöse Thematik bei der Wahl mittelalterlicher Theaterstoffe als ‚conditio sine qua non‘ unvermeidlich ist, sowie andererseits in der fragwürdigen ‚Nationalität‘ der Oper. Selbst wenn man berücksichtigt, dass Martinů sich ernsthaft bemüht hatte, tschechische Vorlagen für die Hry o Marii zu finden, was durch seinen Aufenthalt in Paris erheblich erschwert wurde, zeugt die Wahl der durch ihre Verbreitung geradezu europäisch anmutenden Legenden nur bedingt von der Absicht, nationale Spiele zu verfassen206. Allein die verwendeten Volksliedtexte in den letzten beiden Akten sowie das poetistisch gefärbte Libretto verweisen auf eine spezifisch tschechische Ausprägung, die jedoch durch ihre Einbettung in die an Gaston Baty orientierte Konzeption viel vom offenkundig ‚Tschechischen‘ einbüsst. Selbst die verschiedenen musikalischen Analogien zu Charakteristiken der mährischen Volksmusik – in der Überlieferung Janáčeks – können nicht sinnvoll als Hinweis auf eine intendierte ‚Nationalmusik‘ gedeutet werden, sind sie doch vielmehr das klingende Resultat der Absicht, die Oper im Volkston zu verfassen, und damit gleichsam das musikalische Pendant zum angestrebten Volkstheater207. 205 Zitat Danuser, Ebd., S. 234; Zitat Martinů, Divadlo za bránou [Das Vorstadttheater] (1936), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 242. 206 Zitat Martinů, Divadlo za bránou [Das Vorstadttheater] (1936), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 242. Bezüglich Martinůs Suche nach tschechischen Vorlagen siehe Martinů, Poznámky k cyklu Hry o Marii [Anmerkungen zum Zyklus Hry o Marii] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 207. Bei seiner Suche nach tschechischen Legenden stiess Martinů bloss auf zwei verwendbare Quellen, nämlich Tři Marie [Die drei Marien] sowie Mastičkář [Der Quacksalber], die ihm jedoch für seine Zwecke nicht genügend praktikabel erschienen. Zu diesen mittelalterlichen Quellen siehe auch Milena ČesnákováMichalcová, Mysterienspiele in Böhmen und in der Slowakei, in: Csobádi, Welttheater, Mysterienspiel, rituelles Theater (1992), S. 153-162. 207 Zitat Martinů, Brief Martinůs an František Muzika, vom 30. April 1934 aus Paris, in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 187; Zitat Martinů, [Interview anlässlich der Uraufführung der Hry o Marii] (1935), in: Šafránek, Divadlo Bohuslava Martinů, S. 200. 185 186