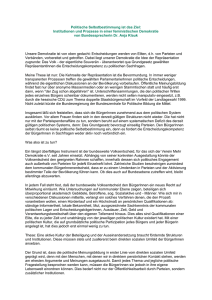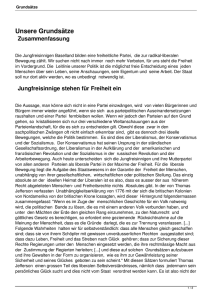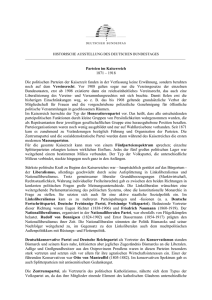Woher? Wohin? Die Zukunft der Parteiendemokratie
Werbung
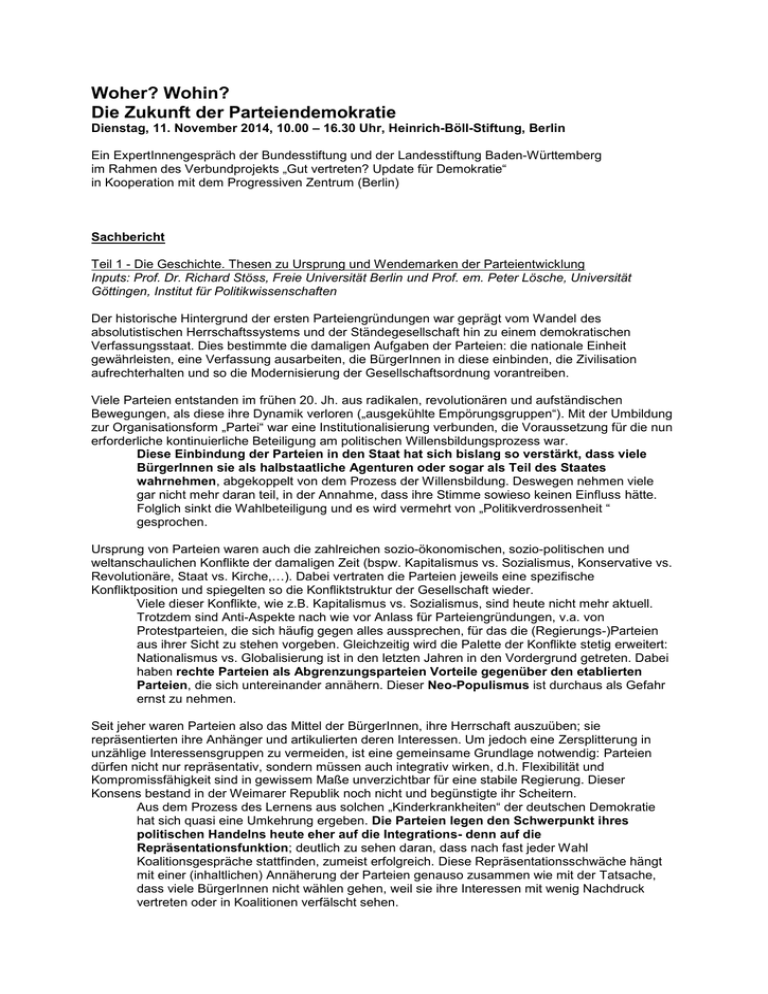
Woher? Wohin? Die Zukunft der Parteiendemokratie Dienstag, 11. November 2014, 10.00 – 16.30 Uhr, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin Ein ExpertInnengespräch der Bundesstiftung und der Landesstiftung Baden-Württemberg im Rahmen des Verbundprojekts „Gut vertreten? Update für Demokratie“ in Kooperation mit dem Progressiven Zentrum (Berlin) Sachbericht Teil 1 - Die Geschichte. Thesen zu Ursprung und Wendemarken der Parteientwicklung Inputs: Prof. Dr. Richard Stöss, Freie Universität Berlin und Prof. em. Peter Lösche, Universität Göttingen, Institut für Politikwissenschaften Der historische Hintergrund der ersten Parteiengründungen war geprägt vom Wandel des absolutistischen Herrschaftssystems und der Ständegesellschaft hin zu einem demokratischen Verfassungsstaat. Dies bestimmte die damaligen Aufgaben der Parteien: die nationale Einheit gewährleisten, eine Verfassung ausarbeiten, die BürgerInnen in diese einbinden, die Zivilisation aufrechterhalten und so die Modernisierung der Gesellschaftsordnung vorantreiben. Viele Parteien entstanden im frühen 20. Jh. aus radikalen, revolutionären und aufständischen Bewegungen, als diese ihre Dynamik verloren („ausgekühlte Empörungsgruppen“). Mit der Umbildung zur Organisationsform „Partei“ war eine Institutionalisierung verbunden, die Voraussetzung für die nun erforderliche kontinuierliche Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess war. Diese Einbindung der Parteien in den Staat hat sich bislang so verstärkt, dass viele BürgerInnen sie als halbstaatliche Agenturen oder sogar als Teil des Staates wahrnehmen, abgekoppelt von dem Prozess der Willensbildung. Deswegen nehmen viele gar nicht mehr daran teil, in der Annahme, dass ihre Stimme sowieso keinen Einfluss hätte. Folglich sinkt die Wahlbeteiligung und es wird vermehrt von „Politikverdrossenheit “ gesprochen. Ursprung von Parteien waren auch die zahlreichen sozio-ökonomischen, sozio-politischen und weltanschaulichen Konflikte der damaligen Zeit (bspw. Kapitalismus vs. Sozialismus, Konservative vs. Revolutionäre, Staat vs. Kirche,…). Dabei vertraten die Parteien jeweils eine spezifische Konfliktposition und spiegelten so die Konfliktstruktur der Gesellschaft wieder. Viele dieser Konflikte, wie z.B. Kapitalismus vs. Sozialismus, sind heute nicht mehr aktuell. Trotzdem sind Anti-Aspekte nach wie vor Anlass für Parteiengründungen, v.a. von Protestparteien, die sich häufig gegen alles aussprechen, für das die (Regierungs-)Parteien aus ihrer Sicht zu stehen vorgeben. Gleichzeitig wird die Palette der Konflikte stetig erweitert: Nationalismus vs. Globalisierung ist in den letzten Jahren in den Vordergrund getreten. Dabei haben rechte Parteien als Abgrenzungsparteien Vorteile gegenüber den etablierten Parteien, die sich untereinander annähern. Dieser Neo-Populismus ist durchaus als Gefahr ernst zu nehmen. Seit jeher waren Parteien also das Mittel der BürgerInnen, ihre Herrschaft auszuüben; sie repräsentierten ihre Anhänger und artikulierten deren Interessen. Um jedoch eine Zersplitterung in unzählige Interessensgruppen zu vermeiden, ist eine gemeinsame Grundlage notwendig: Parteien dürfen nicht nur repräsentativ, sondern müssen auch integrativ wirken, d.h. Flexibilität und Kompromissfähigkeit sind in gewissem Maße unverzichtbar für eine stabile Regierung. Dieser Konsens bestand in der Weimarer Republik noch nicht und begünstigte ihr Scheitern. Aus dem Prozess des Lernens aus solchen „Kinderkrankheiten“ der deutschen Demokratie hat sich quasi eine Umkehrung ergeben. Die Parteien legen den Schwerpunkt ihres politischen Handelns heute eher auf die Integrations- denn auf die Repräsentationsfunktion; deutlich zu sehen daran, dass nach fast jeder Wahl Koalitionsgespräche stattfinden, zumeist erfolgreich. Diese Repräsentationsschwäche hängt mit einer (inhaltlichen) Annäherung der Parteien genauso zusammen wie mit der Tatsache, dass viele BürgerInnen nicht wählen gehen, weil sie ihre Interessen mit wenig Nachdruck vertreten oder in Koalitionen verfälscht sehen. Nach dem 2.Weltkrieg und mit zunehmender wirtschaftlichen Erholung und Wohlstandsverbreitung entstand das Phänomen Volkspartei. Innerhalb der sich ausbildenden Konsensgesellschaft wurde eine umfassende Integration möglich, d.h. es konnten viele BürgerInnen mit ähnlichen Interessen hinter einer Partei versammelt werden. Ziel dieses Parteientyps war es, die Masse der Gesellschaft als WählerInnen zu gewinnen und zu halten, sodass das einzelne Parteimitglied letztlich an Bedeutung verlor. Daraus ergibt sich folgende Paradoxie: früher waren die BürgerInnen auf die Partei angewiesen zur Vertretung ihrer Interessen, heute sind die Parteien auf die BürgerInnen angewiesen zur Erhaltung ihrer Macht. Abgesehen von der kompletten Umkehrung des ursprünglichen Parteigedankens liegt hier der Ausgangspunkt für die Entwicklungen in den nächsten Jahrzehnten. Des Weiteren erwies sich die vielgerühmte Stabilität des 2½-Parteiensystems, wie es in den 50er Jahren noch bestand, als Irrtum; es gründeten/ spalteten sich Parteien. Die Zersplitterung des deutschen Parteiensystems ist angesichts der Geschichte und auch der heutigen Situation jedoch durchaus als Normalität anzusehen. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der Volkspartei zunehmend um ein Auslaufmodell handelt, auch weil die Pluralisierung in der Gesellschaft schneller denn je voranschreitet. Wie sich am Beispiel der anhaltenden Stimmen- und Mitgliederverluste der SPD zeigen lässt, wird es für die Parteien stetig schwieriger, über ihr Milieu hinaus WählerInnen zu binden. In den 70er Jahren kam der Begriff „Kartellpartei“ auf. Im Zuge der zunehmenden Hinwendung der Parteien zum Staat wurde die Repräsentationsfunktion vernachlässigt und die Parteien näherten sich untereinander programmatisch an. Aufgrund mangelnder inhaltlicher Unterscheidungsmerkmale entschieden die WählerInnen anhand der aufgestellten Kandidaten und richteten sich dabei meist nach ihrer persönlichen Stimmung. Daraus ist heute die professionalisierte Wählerpartei entstanden, die sich Statistiken und Umfragen bedient, um mit ihrem Programm möglichst viele BürgerInnen anzusprechen. Einerseits steht dies im Widerspruch zu der im Zusammenhang mit der Volkspartei beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklung, andererseits resultiert daraus eine fortschreitende inhaltliche Vereinheitlichung der Parteien, die wiederum für noch geringere Attraktivität (und Wahlbeteiligung) sorgt: die Wählerstimme kann keinen richtungsweisenden inhaltlichen Einfluss mehr ausüben und scheint so sinnlos. Dagegen sind in den letzten Jahren zahlreiche alternative Partizipationsmöglichkeiten (z.B. Petitionsplattformen, NGOs, Lobbyverbände,…) entstanden, die den Parteien als Mediatoren – Mittler zwischen BürgerInnen- und Politikebene – Konkurrenz machen. Daran zeigt sich auch, dass sich die Form der Bürgerbeteiligung gewandelt hat und spontaner geworden ist, was auch Grund für die abnehmende Bereitschaft ist, Parteimitglied zu werden. Umso wichtiger für die Parteien ist heute die Präsentation des Kandidaten, weswegen nicht nur im Wahlkampf mittlerweile PR- und Umfragenexperten zum Einsatz kommen. Abgesehen davon hat sich die Benennung des politischen Personals als Hauptaufgabe der modernen Partei („A party is to elect“) herauskristallisiert. Fazit: Die historisch gegebenen, anfänglichen Aufgaben haben Parteien bislang in ausreichendem Maße erfüllt. Die heute bestimmende Elitenauswahlfunktion ist eine Aufgabe, die wahrzunehmen allein Parteien in der Lage sind und die sie in unserem politischen System unersetzlich machen. Es ist also nicht das Ende der Partei gekommen – zumindest noch nicht – es haben sich ihre Funktionen und Organisationsformen lediglich entsprechend der geschichtlichen Entwicklung verschoben. Es ist eine allgemeine Schwerpunktverlagerung von den BürgerInnen hin zum Staat zu erkennen, die mit Konturenverlust, einer Entkoppelung vom Willensbildungsprozess und der altbekannten Demokratieverdrossenheit einhergeht. Doch eine ungebremste Kritik an den Parteien, wie sie häufig geäußert wird, oder auf Einflusslosigkeit begründete Passivität, wie sie bei fast jeder Wahl zu Tage tritt, ist unangemessen und wenig konstruktiv. Denn die Aufrechterhaltung der Demokratie ist nicht allein von den Parteien zu leisten; ihre Stärke hängt in entscheidendem Maße von der Zivilgesellschaft, die dahinter steht, ab! Eine einfache Aufforderung zu mehr Partizipation hat dabei nur einen geringen Effekt. Vielmehr ist die Weiterbildung dieser Zivilgesellschaft notwendig, um den Partizipationswillen von unten neu zu beleben. Nichtsdestotrotz liegt es auch bei den Parteien, durch Weiterentwicklung und Anpassung aktiv zur Verbesserung ihrer Situation beizutragen. Teil 2 - Die Idee. Zur neuen Aktualität des Parteigedankens Inputs: Dr. Thomas Biebricher, Goethe-Universität Frankfurt/M., Institut für Politikwissenschaften und Peter Siller, Leiter Abteilung politische Bildung Inland, Heinrich-Böll-Stiftung Der Überlegung, was heute Aufgaben von Parteien sind, was in ihrem Verantwortungsbereich liegt und was für Erwartungen an sie gestellt werden (normative Herangehensweise), muss eine entscheidende Eigenschaft der Partei zugrunde gelegt werden: Als institutionalisierter Konflikt bzw. Differenz (siehe Teil1) kann keine von ihnen behaupten, das Ganze zu vertreten. Nicht umsonst kommt das Wort „Partei“ von lat. pars = Teil, Anteil, Richtung. Daraus lässt sich eine Mittlerfunktion der Parteien ableiten. Ihre Aufgabe ist es, nicht einfach die Interessen der von ihr vertretenen BürgerInnen in die Politik zu übertragen, sondern diese partikularen Interessen aus der Zivilgesellschaft aufzugreifen und in eine gesamtgesellschaftliche Vision, in eine partikulare Ausformung des Gemeinwohls zu transformieren. Dieses Allgemeine stellt sich jedoch nur im Wettstreit der verschiedenen Ansichten vom Allgemeinen, von Gemeinwohl und Gerechtigkeit heraus. Aufgabe der Parteien ist es demnach auch, diesen Streit zu organisieren und auszutragen. Momentan passiert dies nur unzureichend; dadurch, dass die Repräsentationsleistung zu schwach und die Integrationsleistung zu stark ausfallen, ergibt sich ein unspezifisches Parteienbild. Da die BürgerInnen ihre Interessen nur unzureichend repräsentiert sehen, generiert sich vor diesem Hintergrund innerhalb der Gesellschaft eine Skepsis gegenüber den Parteien, ihrer Mittlerrolle und Fähigkeit zur Gemeinwohlbildung. Die aktuelle Kritik am Parteiensystem rührt auch daher, dass ein „Kompromiss“ – und eine Koalition ist nichts anderes – im Deutschen negativ mit „Schwäche“ konnotiert ist infolge der zahlreichen undemokratischen Phasen im Lauf der Geschichte bzw. der fehlenden demokratischen Tradition. Notwendig ist nun eine innerparteiliche Diskussion über Gemeinwohlvorstellungen, auch wenn Streit im positiven Sinne schwierig ist und sich oft zwischen Rechthaberei und Harmoniebedürfnis verliert. Doch der Orientierungsdiskurs muss sich ereignen, um neue Ideologiebildung und Profilierung der Parteien zu ermöglichen. Denn Parteien bedeuten Pluralität, verschiedene Angebote an weite Teile der Gesellschaft und ihre umfassende Revision, vor allem in einer Zeit des schnellen Partikularismus. Der Gedanke, dass Parteien dem Gemeinwohl einer Gesellschaft verpflichtet sind, findet sich bereits im Parteiengesetz von 1958. Doch es ist strittig, ob dies realistisch ist: Wenn man davon ausgeht, dass das Gemeinwohl – insbesondere in einer sich schnell partikularisierenden Gesellschaft – nie für alle in zufriedenstellendem Maße erreicht werden kann, würde folglich die Aufgabe einer Partei lediglich darin bestehen können, sich mit ihren Vorstellungen am politischen Willensbildungsprozess zu beteiligen und eine Mehrheit in der Bevölkerung zu gewinnen. Diese geschichtliche Unklarheit aus der Zeit der Weimarer Republik über den Ausgleich zwischen Repräsentation und Integration tritt deutlich als noch immer aktuelle Kontroverse hervor, der sich die Parteien stellen müssen. Eine Partei darf also weder den Anspruch erheben, alle zu repräsentieren, als auch eine reine Klientelpartei zu sein. Generell gibt es keinen Widerspruch zwischen einer Orientierungspartei und einer Konzept-, Programm- oder Personenpartei; es geht darum, den Geltungsanspruch mit einem weltanschaulichen Orientierungsangebot zu verbinden. Diese Synthese von Einzelinteressen und Universalität – letztere bleibt ohnehin stets kontrovers – stellt sich als ein Balanceakt dar. Zwischen Abgrenzung von anderen Parteien, die mit Polarisierung und Einseitigkeit verbunden ist und von den WählerInnen auch dementsprechend empfunden wird und inhaltlicher Annäherung durch Ausrichtung an dem/der DurchschnittswählerIn, die in ebenso verheerender Vereinheitlichung mündet, gelingt es den Parteien heute nicht, diese Gegensätze in ausreichender Form auszutarieren. Die Parteien von heute sind anscheinend nicht so aufgestellt, dass Probleme gelöst werden können und um diesen Ausgleich zu schaffen. Es drängt sich die Frage auf, ob wir in nächster Zeit das Ende der Parteien-Ära erleben. Selbst Intellektuelle rufen zunehmend zum Nichtwählen auf; in Lehrbüchern für StudentInnen im Bereich Politik wird die Parteiendemokratie tendenziell einschlägig problematisiert, sodass schon die heranwachsende Bildungselite in Sachen Demokratiebegeisterung und Wahlbeteiligung eigentlich kein Vorbild für die Gesellschaft sein bzw. werden kann. Hinzu kommt, dass sich das moderne Wahlverhalten zunehmend dem Konsumverhalten angleicht, also dass die WählerInnen sich nicht mehr festlegen, auch kurz vor der Wahl noch unentschlossen sind und beliebig die Partei wie auch die Marken, z.B. im Supermarkt, wechseln. Dennoch ist es nicht angebracht, eine gänzlich kulturpessimistische Sicht auf dieses Thema zu vertreten, da kein grundsätzlicher Rückgang von bürgerlichem Engagement zu verzeichnen ist. Dieses findet lediglich an anderer Stelle statt, bspw. in Vereinen – die Vereinsgründungen nehmen zu. An dieser Stelle ließe sich überlegen, ob es funktionelle Äquivalente für das Modell „Partei“ gibt und inwiefern sich diese eignen bzw. den identifizierten Aufgaben gerecht werden können. Eine NGO vertritt zwar einen Standpunkt und hat ihre Mittel und Wege, um auf sich aufmerksam zu machen, doch sie hat nicht die wichtige Fähigkeit der Inklusion bzw. Integration, d.h. es gelingt ihr nicht, über ihr Milieu hinaus breitere Kreise der Zivilgesellschaft an sich zu binden. Bewegungen wie Occupy Wall Street im Jahr 2011 haben den Parteigedanken auf radikaler Ebene aktualisiert. Ihr Potential, breite Massen zu mobilisieren und deren Interessen deutlich und z.T. wirksam gegenüber der Politik zu vertreten, ohne dass so deutliche hierarchische Strukturen entstehen wie sie innerhalb einer Partei existieren, könnte solche Strömungen durchaus als ParteienErsatz befähigen. Ein Punkt, der an Parteien kritisiert wird, ist, dass diese einer direkten Partizipation im Wege stünden. Nun hat auch die unabhängige Zivilgesellschaft selbst die Möglichkeit, ihre Belange in Form von direkter Demokratie zu transportieren. Bürgerentscheide wie im Fall von Stuttgart 21 zeigen allerdings, dass es sich hierbei meistens um wenig konstruktive Verhinderungsarbeit handelt. Was zusätzlich sowohl den zuvor genannten Bewegungen als auch der direkten Demokratie fehlen, sind Kreativität, Produktivität und v.a. Kontinuität in der Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess, wie sie die Arbeit von Parteien prägen (sollten). Sicherlich tragen die o.g. Beispiele zur unbequemen Situation der Parteien bei bzw. sind Ergebnis der Suche der BürgerInnen nach anderen Partizipationsmöglichkeiten. Wenn die Parteien nun aber nicht befürchten müssen, von ihnen verdrängt zu werden, können sie doch in gewissem Maße profitieren: indem sie Stellung beziehen zu den Themen der NGOs und den punktuellen, Interessens- bzw. Begeisterungsausbrüchen der Bewegungen und Bürgerbegehren und diese in den modernen Parteigedanken integrieren, gelingt eine Profilierung mit gleichzeitiger Wiederherstellung der Bürgernähe, da diese ihre Anliegen in der Politik vertreten sehen. Verbunden damit ist dringender Diskussionsbedarf (Streit, s.o.), sowohl inner- als auch zwischenparteilich. Die grundlegende Aufgabe, einen Ausgleich zwischen Repräsentation und Integration zu finden, bleibt bestehen! Teil 3 - Die Rolle. Funktionswandel der Parteien in einer veränderten Gesellschaft Input: Prof. Dr. Ulrich Eith, Seminar für Wissenschaftliche Politik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Schon in der Vergangenheit haben sich die Parteien den sich wandelnden Aufgaben angepasst; durch interne strukturelle Veränderungen ist immer ein funktional adäquater Parteityp entstanden. Die heutigen, schnell voranschreitenden gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen stellen die Parteien einmal mehr vor die Herausforderung, sich in unserer Demokratie zu behaupten, vor allem vor dem Hintergrund einer verstärkten Forderung der Zivilgesellschaft nach direkter Mitbestimmung in Form von Bürgerentscheiden. Seit jeher war die Demokratie in Deutschland eine Parteiendemokratie. Parteien stehen ursprünglich für ideologische Standfestigkeit und werden als Interessensvertretung gewählt. Nach dem 2. Weltkrieg kamen Aspekte einer Verhandlungsdemokratie hinzu: im Bundesrat, wo häufig andere Mehrheiten vorherrschen als im Bundestag und auch in den heute meist obligatorischen Regierungskoalitionen muss ständig diskutiert, aufeinander zugegangen und eine Einigung gefunden werden; Vetoplayer müssen eingebunden werden. Der Erfolg dieses Systems hängt entscheidend von Kompromissfähigkeit und Flexibilität der Parteien ab. Mit der rasanten Verbreitung der Massenmedien – zunächst gedruckt (Zeitung, Zeitschriften, Plakate, Flugblätter), später auch digital (Radio, Fernsehen, Internet) – hielten diese unweigerlich Einzug in die Politik. In dieser Mediendemokratie ist die Präsenz in den Medien unentbehrlich für den politischen Erfolg, sodass die Parteien in ihrer Strategie einen Schwerpunkt darauf legen. Die Medien ermöglichen es den Parteien, sich in Form von Umfragen und Statistiken über Probleme und Belange der BürgerInnen, aber auch über ihre Beliebtheit zu informieren und sich ggf. inhaltlich entsprechend auszurichten. Besonders während des Wahlkampfs sind die Medien dann das Mittel schlechthin, um die so entstandene parteiprogrammatische Ideologie zu transportieren und die KandidatInnen in möglichst positivem Licht der Öffentlichkeit zu präsentieren. Eine weitere Entwicklung im deutschen Demokratiesystem findet aktuell statt: Die Bevölkerung verlangt vermehrt danach, im Rahmen einer Beteiligungs- bzw. Mitbestimmungsdemokratie ihre Stimme direkt und nicht erst über den Umweg „Parteien“ auf die politische Ebene zu tragen und über konsultative Beratungs- und Entscheidungsprozesse ihren Einfluss auszuüben. Noch in den 50er und 60er Jahren galt wählen gehen als Bürgerpflicht, die zu erfüllen mit der Aufrechterhaltung der Bürgerehre und mit der gewissenhaften und selbstbewussten Einnahme seines Platzes in der Gesellschaft zusammenhing. Diese einst stark normativ aufgeladene Verbindung ist schwächer geworden, weil die Demokratie weitläufig als Lebensform verstanden wird, in der die Mitbestimmung selbstverständlich ist. Mit der Änderung sowohl von Demokratie- und Politikverständnis, der BürgerInnen- als auch der PolitikerInnenrolle, also der gesamten politischen Kultur, stellen sich die Anforderungen an die Parteien uneinheitlich dar. Für sie bilden die passive Erwartung einer effektiven Lösung und die aktive Mitgestaltung dieser die beiden Seiten der Medaille ihres Erfolgs in der heutigen Gesellschaft, die es beide wahrzunehmen gilt. Momentan sind die Parteien jedoch nicht diejenigen, die den Prozess voranbringen, sondern die, die sich mehr schlecht als recht daran anzupassen versuchen. Für Politiker – in Regierung und Opposition gleichermaßen – bedeutet dies, dass sie sich nicht nur an ihren Beliebtheitswerten und anderen statistisch-theoretischen Zahlen orientieren dürfen, sondern sich konkret für bestimmte Themen einsetzen müssen. Die Unzufriedenheit der BürgerInnen mit den Parteien als Interessensvertreter wurde bereits als Ursache für das stärkere Aufkommen von Bürgerentscheiden identifiziert. Wenn diese der Mobilisierungsgrund ist, stellt sich für die Parteien auch die Frage nach der eigenen Mobilisierungsfähigkeit. Auch wenn der derzeitige „Boom“ der direkten Demokratie nur eine Modeerscheinung, ein kurzzeitig breit unterstützter Problemlösungsversuch sein mag, bietet sich hier eine Chance für Parteien: wenn sie sich den Bürgerbegehren selbstbewusst stellen, wenn sie bei in der Bevölkerung auftretenden Kontroversen (z.B. Stuttgart 21) Position beziehen, besteht die Möglichkeit, Sympathien und sogar Parteibindungen zurückzugewinnen. Auch eine Verstärkung der innerparteilichen Mitbestimmung trägt dazu bei, dass sich die Mitgliedschaft in einer Partei wieder lohnt; diese erscheint nicht mehr als reine Karrieristen-Organisation. Auf Parteien haben solche Volksentscheide noch weitere Auswirkungen. Zum einen werden sie vom Legitimationsdruck entlastet, denn für eine Entscheidung, die das Volk getroffen hat, können sie nicht verantwortlich gemacht werden. Genauso ergibt sich für die Parteien, die in Vorhinein die Meinung der Mehrheit vertreten haben und diese nun umsetzen, ein Legitimationsgewinn, da mit bewiesener Sicherheit ein Großteil der Bevölkerung dahinter steht. Außerdem wird die Politik über Volksinitiativen um neue Themen bereichert („Gaspedal“); allerdings ist es häufig der Fall, dass von PolitikerInnen mühsam errungene Kompromisse abgelehnt und zunichte gemacht werden („Bremspedal“). Wenn die Zivilgesellschaft ihr Recht auf Partizipation so deutlich von den Parteien einfordert, muss sie aber auch die entsprechende Rolle mit allen Verantwortungen einnehmen und ihre Möglichkeiten aktiv nutzen. Doch es wird bei jeder Wahl offensichtlich, dass die Wahrscheinlichkeit der politischen Beteiligung mit dem sozialen Status zusammenhängt. Aufgrund von Uninformiertheit bspw. fallen untere Gesellschaftsschichten häufig heraus, was auch in einer Beteiligungs- bzw. Mitbestimmungsdemokratie wiederum Parteien und ein repräsentatives System erforderlich macht. Des Weiteren dürfen in einer Beteiligungs- bzw. Mitbestimmungsdemokratie Parteien keinesfalls kampagnenfähig sein. Am Beispiel der Schweiz lässt sich die Problematik verdeutlichen: durch Missbrauch, also unter Androhung einer Volksinitiative gegen eine Entscheidung der Regierungsparteien kann eine einzelne, kleine Oppositionspartei die gesamte Politik lahmlegen. Wird sie nun in die Regierung aufgenommen, um dies zu verhindern, folgen die anderen Oppositionsparteien schlimmstenfalls ihrem Beispiel. Es käme zu einer Allparteienregierung und letztlich auf dasselbe hinaus – die Lähmung des Politikapparats. Ob direkte Demokratie nun „funktioniert“ oder nicht, darf nicht vom Ergebnis der Abstimmungen abhängig gemacht werden; vielmehr basiert die Einschätzung auf den allgemeinen Vorstellungen von bzw. Erwartungen an Demokratie in einer Gesellschaft, die aber einem stetigen Wandel unterworfen sind. Die Parteien müssen sich auf diesen Prozess der Veränderung einlassen, sich über ihre Basis, ihre Ziele, ihre Rolle und ihre Organisationsform klar werden und sich aktiv daran beteiligen, indem sie ebendiese Formen von Demokratieverständnis aufgreifen, diskutieren und weiterentwickeln. Teil 4 - Die Perspektiven. Gedanken zur Partei 2040 Input: Hanno Burmester, Policy Fellow, Progressives Zentrum, Berlin Die aktuelle Situation der Parteien in Deutschland macht nicht unbedingt optimistisch. Das öffentliche Vertrauen in sie befindet sich auf einem Tiefpunkt (Legitimationskrise), dabei sind die Parteien doch auf gerade diejenigen angewiesen, die diese Umfrageergebnisse erzeugen. Man könnte also sagen, das Fundament sei erodiert und somit gebe es in Bezug auf die Existenz von Parteien keinen Verlass mehr auf historische Kontinuität. Um dennoch fortzubestehen, dürfen sich die Parteien keinesfalls von den gesellschaftlichen Entwicklungen entkoppeln. Im Gegenteil; Veränderungsgedanken müssen Teil ihrer politischen Logik sein. Schon Willy Brandt sagte seinerzeit: „Die beste Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie mitzugestalten.“ Abwarten ist eine schlechte, passive Art, auf Veränderungen zu reagieren, denn es bedeutet das Ignorieren seiner eigenen Führungsverantwortung. Es kommt für die Parteien darauf an, ihre Veränderung nach eigenen Werten und Zielen zu steuern. Trotzdem sollten die vorherrschenden Trends innerhalb der Gesellschaft dabei nicht ganz außer Acht gelassen werden. Durch den technologischen Fortschritt und die Digitalisierung haben sich zum einen Arbeits-, Informations-, Kommunikations- und Partizipationsformen stark gewandelt, ebenso die Erwartungsprofile der BürgerInnen an Parteien und PolitikerInnen. In einer Zeit der gesellschaftlichen Fragmentierung und der Individualisierung wird es außerdem immer schwieriger, „eine Partei für alle“ sein zu wollen. Der demographische Wandel stellt an die Parteien zusätzlich die Anforderung, auch in den zunehmend dünner besiedelten ländlichen Gebieten präsent zu sein und die schrumpfende ländliche Bevölkerung weiterhin zu vertreten. Angesichts des stetig wachsenden Anteils der Alten an der Gesamtbevölkerung gilt es auch, Begegnungsstelle der Generationen statt Kampfplatz zu sein. Zum anderen erfährt Weiterbildung momentan einen erheblichen Bedeutungszuwachs, sodass sich die Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten auch an die Parteien richtet und im Bereich Ehrenamt, der innerhalb von Parteien wichtige Tätigkeiten umfasst, eine Professionalisierung abzeichnet. Bei der Analyse der Gründe für einen Parteieintritt stellt der Wunsch nach Selbstbestimmtheit und vor allem Selbstwirksamkeitserfahrungen eine wichtige Motivationsquelle dar. Letztere machen viele bereits im Beruf, der zudem oft ein besseres Umfeld bzw. bessere Voraussetzungen dafür bietet. Die Mitgliedschaft in einer Partei bedeutet dann in erster Linie soziale Einbindung und Geselligkeit. Wenn jedoch die Selbstwirksamkeitserwartung von der Partei erfolgreich erfüllt wird, d.h. wenn die BürgerInnen sehen, was und wie ihr Handeln verändert, wenn sie sichtbare Ergebnisse und ein Feedback erhalten, lässt sich ihr Potential deutlich besser ausschöpfen. Ein Eintritt in eine Partei der heutigen Form hat erst einmal keine spürbaren Auswirkungen. Es findet keine persönliche Begrüßung statt, der Mitgliedbeitrag bedeutet zunächst einen finanziellen Verlust und für ein einfaches Mitglied sind die Partizipationsmöglichkeiten beschränkt. Die fehlenden Selbstwirksamkeitserfahrungen führen nach kurzer Zeit zu einem Austritt oder zu einer passiven Mitgliedschaft. Zudem bieten andere Organisationen wie z.B. Greenpeace die Möglichkeit, weitaus schneller in die aktive Arbeit eingebunden zu werden, da die Abläufe spontaner, offener und weniger hierarchisch gestaltet sind. Das Konzept einer zukunftsfähigen, bürgernahen und lebendigen Partei könnte folgendermaßen aussehen: bei Eintritt in die Partei wird das Neumitglied automatisch in das parteiinterne Social Media Network aufgenommen und hat sofort Kontakt zu den anderen Mitgliedern. Mithilfe eines Fragebogens wird ein persönliches Profil der/des Beigetretenen erstellt, das unter anderem die berufliche Tätigkeit und Interessen umfasst. Aus diesen Informationen lassen sich dann Vorschläge für Einsatzgebiete in der Partei ableiten. Ein aktives Mitglied, durch einen Interessensabgleich bestimmt, fungiert als persönliche/r MentorIn und AnsprechpartnerIn. Es läuft ein ständiger virtueller Austausch, sowohl innerhalb der „Basis“ als auch mit den Abgeordneten, sodass auch diese „höhere politische Ebene“ sich nicht entkoppelt. Hier kann sich jeder beteiligen und sein Know-How einbringen. Die Ergebnisse werden schließlich in Programmanträge eingebracht. Über eine Parteiapp findet quasi jederzeit ein Parteitag statt; es werden in kürzeren Zeitabständen Abstimmungen vorgenommen und das Informationsangebot ist umfassend, aktuell und für alle zugänglich. Innerhalb der Ortsgruppe wechseln die Tagungsstätten („Begegnungsräume“) der Ortsvereinssitzung, Bekanntgabe erfolgt im Kalender des lokalen Parteinetzwerks. Die Landespartei bietet den Mitgliedern Möglichkeiten zur Weiterbildung und Vergünstigungen wie z.B. kostenlose Kinderbetreuung. Diese Organisationsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Kompetenzen und das Engagement jedes Mitglieds wahrgenommen und genutzt, aber auch gefordert werden. Individuelle politische Belange können genauso berücksichtigt werden wie die private und fachliche Stellung. Eine aktive Einbindung in die Prozesse schafft Nachverfolgbarkeit, Transparenz und tiefergehendes Verständnis und erleichtert neben der medialen Anbindung zusätzlich die Beteiligung. Vom Stand der Technik her ist die Realisation dieses Entwurfs durchaus möglich. Der Aufbau einer derartigen Infrastruktur ist allerdings mit erheblichen Mehrkosten verbunden und verlangt das breite Engagement, das zurzeit eben nicht vorhanden ist (Henne-Ei-Problem). Auch für die Aufrechterhaltung dieses auf eine umfangreiche Betreuung der Mitglieder ausgerichteten Systems wird Personal benötigt, unter anderem Fachleute für IT und Kommunikation. Damit die Finanzen hier nicht übermäßig belastet werden, braucht es dringend ehrenamtliche Arbeit – in diesen Positionen stark professionalisiert. Wer organisiert also die Organisation? Bei aller Konzentration auf das Wohlergehen der Mitglieder dürfen die Inhalte auch nicht aus den Augen verloren werden. Des Weiteren ist strittig, ob bspw. die aufgeweichte Hierarchie noch dazu dienlich ist, die als Hauptaufgabe der Parteien identifizierte Elitenauswahlfunktion zu erfüllen. Innerhalb der heutigen Parteistruktur muss ein Mitglied für den Aufstieg meist breiten Einsatz zeigen, muss Rückschläge und Misserfolge hinnehmen und muss um innerparteiliches Gehör und Unterstützung hart kämpfen. Diese sogenannte „Ochsentour“ kann zum Kompetenzerwerb und zur Charakterbildung beitragen, die SpitzenpolitikerInnen später benötigen. Unabhängig davon besteht für die Parteien die Notwendigkeit, ihr Selbstverständnis zu überarbeiten, hin zu einem Nebeneinander von Begegnung und Konflikt, zu mehr innerparteilicher Verknüpfung und Zusammenarbeit und insbesondere zu mehr Selbstwirksamkeitserfahrungen.