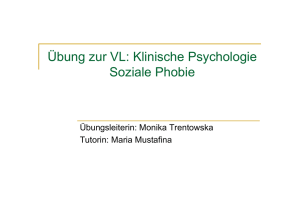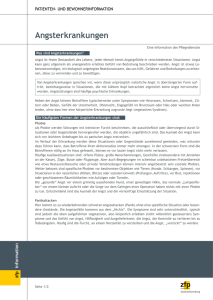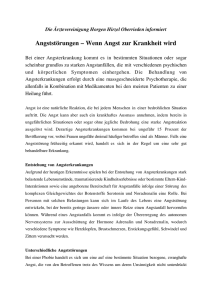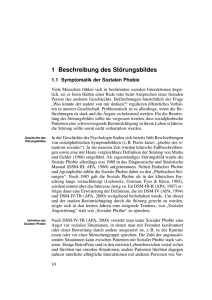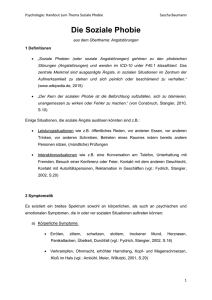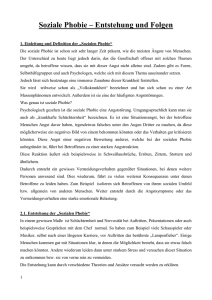„Die Grenzen sind die Anderen“
Werbung
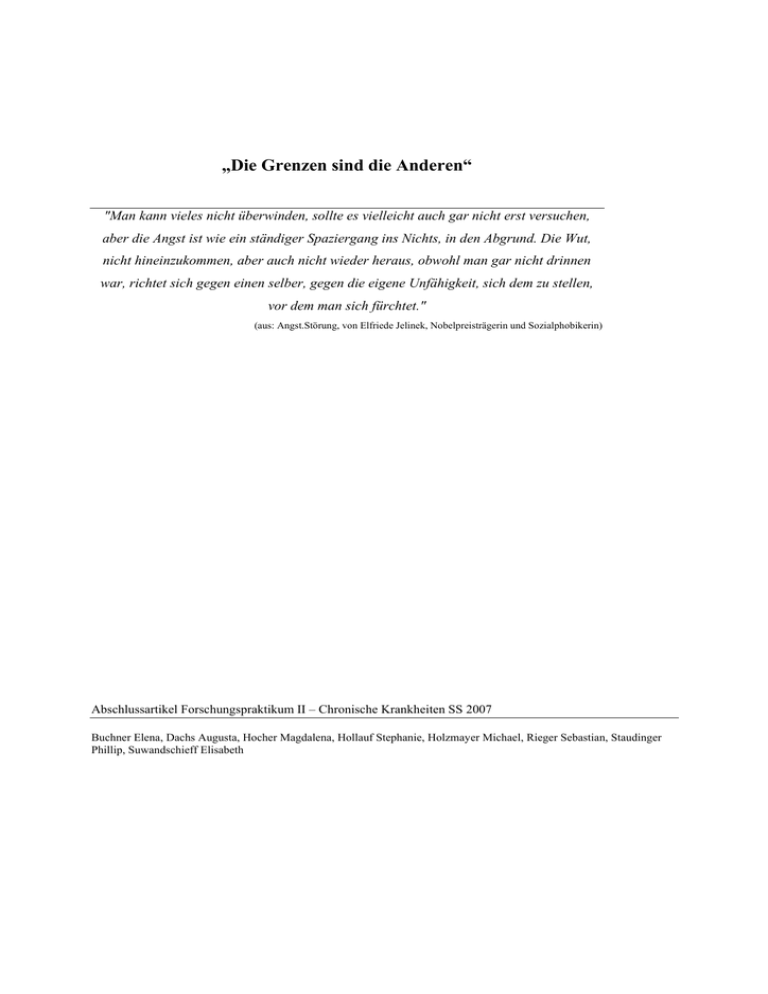
„Die Grenzen sind die Anderen“ "Man kann vieles nicht überwinden, sollte es vielleicht auch gar nicht erst versuchen, aber die Angst ist wie ein ständiger Spaziergang ins Nichts, in den Abgrund. Die Wut, nicht hineinzukommen, aber auch nicht wieder heraus, obwohl man gar nicht drinnen war, richtet sich gegen einen selber, gegen die eigene Unfähigkeit, sich dem zu stellen, vor dem man sich fürchtet." (aus: Angst.Störung, von Elfriede Jelinek, Nobelpreisträgerin und Sozialphobikerin) Abschlussartikel Forschungspraktikum II – Chronische Krankheiten SS 2007 Buchner Elena, Dachs Augusta, Hocher Magdalena, Hollauf Stephanie, Holzmayer Michael, Rieger Sebastian, Staudinger Phillip, Suwandschieff Elisabeth ABSTRACT........................................................................................................................................................... 3 EINLEITUNG ....................................................................................................................................................... 3 DIE MEDIZINISCH-PSYCHIATRISCHE SICHTWEISE ................................................................................................ 4 SOZIOLOGISCHE LITERATUR/ANKNÜPFUNGSPUNKTE ......................................................................................... 5 DIE FRAGESTELLUNG .......................................................................................................................................... 6 DIE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ....................................................................................................................... 7 ERGEBNISSE ....................................................................................................................................................... 9 1.1 NÄHE UND DISTANZ ...................................................................................................................................... 9 1.2 DISKUSSION ................................................................................................................................................ 10 2.1 IDEALE ........................................................................................................................................................ 11 2.2 DISKUSSION ................................................................................................................................................ 12 3.1 UMGANGSSTRATEGIEN ............................................................................................................................... 12 3.2 DISKUSSION ................................................................................................................................................ 14 SCHLUSS ............................................................................................................................................................ 15 ANHANG............................................................................................................................................................. 19 LITERATUR....................................................................................................................................................... 19 Abstract Die Soziale Phobie ist ein relativ junges Krankheitsbild, von dem in den letzten Jahren immer mehr Menschen betroffen zu sein scheinen. Zwar existiert eine Reihe von medizinischpsychologischen Erklärungsansätzen über die Entstehung dieser Angsterkrankung, die soziologische Perspektive wurde bisher allerdings wenig berücksichtigt. In diesem Artikel werden die Ergebnisse einer qualitativ - empirischen Studie vorgestellt, welche - ausgehend vom soziologischen Begriff des Copings - die alltäglichen Umgangsstrategien der Betroffenen mit ihrer Erkrankung untersucht. Der Fokus liegt auf jenen Arten des Umgangs, die sich dem sozialen Handeln zuordnen lassen. Dabei wird deutlich, dass das Leben mit der Sozialen Phobie von einem Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz, sowie von Idealvorstellungen in Bezug auf soziale Interaktionen geprägt ist. In Bezug dazu werden die Strategien gesetzt, welche die Betroffenen im Umgang mit der Erkrankung anwenden. Abschließend werden jene Punkte besprochen, die während der Forschung als neue Fragestellungen entstanden und Thema nachfolgender Analysen sein könnten. Einleitung Angsterkrankungen haben in den letzten Jahren verstärkt mediale Aufmerksamkeit erhalten, wenn es darum ging, zu versuchen, Konstanten in der psycho-sozialen Verfassung "westlicher" Gesellschaften erfassen zu können. Sie werden zu den häufigsten chronischen Erkrankungen gezählt und sind damit auch von nicht geringer gesellschaftspolitischer Brisanz - sowohl in ihren Ursachen als auch in ihren sozialen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Unter den Angsterkrankungen zählt die Soziale Phobie zu den häufigsten, aber auch unbekanntesten Angsterkrankungen. In den USA leiden etwa 13 Prozent der Bevölkerung einmal im Leben daran, in Deutschland geschätzte zwei Millionen Menschen. Zahlen für Österreich fehlen bis dato (vgl. http://derstandard.at). Soziale Ängste existieren wohl schon so lange, als es auch Menschen gibt. Ob sie in der Häufigkeit ihres Auftretens zugenommen haben und dies mit verschärften Wettbewerbs- und Existenzbedingungen zusammenhängt (vgl. www.diezeit.de), oder ob es sich auch zum Teil um ein Diskurshoch handeln könnte, wird in dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Fest steht, dass die soziale Phobie für die Betroffenen einen hohen Leidensdruck bedeuten kann. Wir haben uns also in den folgenden Ausführungen dazu entschieden, diese Metaebene als Kontextwissen zu betrachten, und primär versucht, zu eruieren, wie Menschen konkret in ihrem Alltag mit der Erkrankung "Soziale Phobie" umgehen. Begibt man sich innerhalb der soziologischen Disziplin auf die Suche nach Arbeiten, die sich mit dem Thema Angst auseinandersetzen, so wird man unter Umständen am Feld der Emotionssoziologie fündig werden. Paradoxerweise 3 existieren aber genau zu eben jener Form der Angst, die um eines der Kerngebiete der Soziologie, nämlich der sozialen Interaktion kreist, keine empirisch-soziologischen Untersuchungen. Gerade aber die soziologische Sicht auf die Soziale Angst könnte das primär vorhandene medizinisch-psychologische Wissen rund um die Soziale Phobie um eine neue Perspektive erweitern. An diesem Gedanken will die vorliegende Forschungsarbeit unter anderem anknüpfen. Angst oder Schüchternheit in sozialen Situationen ist ein menschliches Phänomen, das den meisten Menschen nicht unbekannt ist. Wenn die Ängste jedoch so stark werden, dass Menschen sich selbst einschränken und in ihrem beruflichen und sozialen Leben massiv beeinträchtigt werden, so kann von einer sozialen Phobie gesprochen werden (Stangier et al. 2003). Dabei handelt es sich um massive Ängste vor sozialen Situationen und der Befürchtung, in diesen Situationen zu versagen. Die medizinisch-psychiatrische Sichtweise Der Begriff Soziale Phobie tauchte im medizinisch-psychologischen Diskurs erstmals 1966 auf. Erst mit Beginn der 1980er Jahre wurde er allerdings erstmals als eigenständige Erkrankung in das „Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen der amerikanischen Psychiatrie“ (DSM) aufgenommen. Bis zu seiner endgültigen Etablierung 1992 durch die Aufnahme in die „Internationale Klassifikation psychischer Störungen“ (ICD) der Weltgesundheitsorganisation verging ein weiteres Jahrzehnt (Stangier/Fydrich 2002). Die folgende Kurzdarstellung des Krankheitsprofils der "Sozialen Phobie" spiegelt vor allem Informationen aus dem medizinisch-psychologischen Feld wieder, die sowohl im Rahmen von vorbereitenden Literaturrecherchen als auch einer ersten empirischen Vorerhebung im Zuge von ExpertInneninterviews generiert wurden. Die von uns befragten ExpertInnen beschreiben die soziale Phobie als eine spezielle Angststörung, welche oft gemeinsam mit anderen (Angst-)Störungen auftritt. Die Diagnose bzw. die Diagnostizierung ist demnach äußerst schwer. Die Richtlinien für die medizinische Diagnostizierung einer Sozialen Phobie orientieren sich an den Kriterien des ICD 10 (siehe Anhang). Die soziale Phobie kann sowohl generalisiert auftreten, das heißt, sich auf soziale Interaktionsituationen im Allgemeinen beziehen, als auch auf spezifische, Angst auslösende Situationen (ein klassisches Beispiel wäre etwa Prüfungsangst) bezogen sein. Gemeinsam ist den Personen, welche unter sozialer Phobie leiden, das starke Bewusstsein darüber, dass ihre Ängste überzogen bzw. unbegründet sind. Allerdings können sie trotz dieses Bewusstseins ihre Angst nicht oder nur schwer kontrollieren. 4 Personen mit sozialer Phobie leiden auch häufig unter körperlichen Angstsymptomen wie Beklemmungsgefühlen, erhöhtem Puls, Schweißausbrüchen usw. Vor allem die Pubertät scheint ein ausschlaggebendes Alter für die Bildung einer sozialen Phobie zu sein. Die Behandlungsformen sind vielfältig, sehr häufig jedoch wird mit verhaltens- bzw. konfrontationstherapeutischen Ansätzen gearbeitet. Ziel von kognitiven Verhaltenstherapien ist es, den Betroffenen zu verdeutlichen, dass sie nicht unter permanenter Beurteilung stehen. Auch die Möglichkeit einer medikamentösen Behandlung mit z.B. Serotonin besteht. Jene wird allerdings nur als Vorstufe zu einer späteren Verhaltens- bzw. Konfrontationstherapie gesehen. Soziologische Literatur/Anknüpfungspunkte Das medizinisch- psychologische Wissen stellt sich im soziologischen Forschungskontext als nützlich dar, um das Forschungsfeld "Soziale Phobie" klarer zu umreißen und einzugrenzen. Um die alltäglichen Probleme und Sichtweisen der Betroffenen selbst zu verstehen, muss der Blickwinkel jedoch verschoben werden: Aus soziologischer Sicht nämlich kann der medizinisch-psychologische Terminus "Soziale Phobie" nicht als eine Krankheit im Sinne einer natürlichen, unveränderbaren Einheit gesehen werden, die nur individuell-medizinischpsychologischer Behandlung bedarf. Vielmehr wird das Erscheinungsbild und Erleben Sozialer Phobie im Rahmen dieser Forschung auch als ein Prozess sozialer und kultureller Praktiken verstanden (Nettleton 2006). Daran anschließend wollen wir berücksichtigen, dass die Soziale Phobie auch eine Art Label darstellt, dem sich eine Person selbst aktiv zuordnet oder durch AkteurInnen aus dem Medizin-und BeraterInnensystem zugeordnet wird. Aus soziologischer Perspektive stehen daher auch nicht individuelle psychologische Defizite der Betroffenen im Vordergrund, sondern die Beschreibung der Qualität ihrer alltäglichen Interaktionen bzw. der Strategien und Handlungen, die jene in der Auseinandersetzung mit Ihrer Erkrankung setzen. In verschiedensten soziologischen Forschungsarbeiten wurde dieser Prozess auch häufig mit dem Begriff Coping umschrieben. Coping könnte dabei als jene Formen des Umgangs mit einer Erkrankung betrachtet werden, die einen Schaden aus krankheitsbedingten problematischen Erfahrungen verhindern oder vermindern helfen soll (vgl. Pearlin/Schooler 1978, zit. nach Bergerhoff/Novak 1988). Allerdings will der soziologische Copingbegriff den Umgang mit der Erkrankung nicht als einen primär intrapsychischen Prozess betrachten, sondern jene Momente, die gesellschaftlich bestimmt werden, stehen im Vordergrund (Pearlin/Schooler 1978, zit. nach Marten-Mittag 2004).So zeigen beispielsweise Adams und Lindemann (1974) auf, dass nicht nur die eigenen Strategien der Betroffenen für das Gelingen von Coping wichtig sind, sondern auch die 5 vorhandenen Bezugsgruppen sowie die Rollenidentifikationen. Sie weisen weiters darauf hin, dass Copingstrategien in Zusammenarbeit mit anderen erstellt werden und dabei eine Reihe von Aufgaben sowohl durch das Individuum als auch dessen Umwelt erfüllt werden müssen. Ein weiterer Ansatz des Coping, der von Gerhardt (1986) entwickelt wurde, differenziert zwischen psychologischem und sozialem Coping. Soziales Coping zeichnet sich dadurch aus, dass versucht wird, die Umwelt durch aktives Handeln zu verändern und nicht, wie beim psychologischen Coping, die Eindrücke aus der Umwelt. Das Ziel, dass im Rahmen des sozialen Copings verfolgt wird, ist die Bewahrung bzw. Rekonstruktion von Teilnahmemöglichkeiten in allen Lebensbereichen - beruflich wie privat. Auch bei Bergerhoff und Novak (1988) spielt der Begriff des Handelns eine große Rolle. Sie sehen Coping als Prozess aus Handlungen, welche die Beziehung zwischen AkteurIn und Umwelt verändert. Ob und wie Handlungen ausgeführt werden hängt von der Person, der Krankheit und der Umgebung der Erkrankten ab. Dabei wirken Faktoren wie zum Beispiel die Motivation der betroffenen Person, die subjektive Einschätzung des Patienten in Bezug auf den Coping-Prozess und die sozialen Unterstützungen von anderen Personen ein. Als unumstritten wichtiger Aspekt stellen sich infolgedessen hierbei die Netzwerke der Erkrankten heraus, also die Qualität des Geflechtes von sozialen Beziehungen, das die betroffenen Personen zu ihrer Umwelt pflegen. Die Fragestellung Wie aus den eben dargestellten theoretischen Anknüpfungspunkten für die vorliegende Forschungsarbeit sichtbar wurde, lässt sich Coping aus soziologischer Sicht also immer als Handeln begreifen, das in Bezug zu anderen Menschen stehen muss. Unsere erste wichtige These, die untersucht werden sollte, lautete daher: Die Bewältigung einer sozialen Phobie ist immer in einer sozialen Interaktion verortet. Wie aber kann gerade bei einer Erkrankung wie der sozialen Phobie, deren besondere Problematik eben genau das Handeln in Bezug auf Andere darstellt, Coping dann umgesetzt werden? Betrachtet man die theoretische Literatur, so scheinen auch soziale Netzwerke ein besonders wichtiger Faktor in Bezug auf das Coping zu sein. Eine zweite wichtige These trifft daher die Vermutung: Menschen mit sozialer Phobie haben Netzwerke, um mit ihrer Erkrankung umgehen zu können. Wie aber können Netzwerke gebildet und aufrechterhalten werden, wenn die Angst vor der Interaktion mit anderen Menschen eine der Hauptschwierigkeiten von Menschen mit sozialer Phobie darstellt? Aus all diesen scheinbaren Widersprüchen ergab sich für das Forschungsvorhaben eine zentrale Fragestellung: 6 Wie realisiert sich Coping als soziales Handeln bei Menschen mit Sozialer Phobie? Dabei interessierte uns in diesem Zusammenhang aber auch: Wie erleben Menschen mit Sozialer Phobie ihre Netzwerke in Hinblick auf das Coping? Diese Fragen bildeten das Hauptaugenmerk unseres Forschungsvorhabens. Um sie zu untersuchen, entschied sich das ForscherInnenteam, ein qualitatives Untersuchungsdesign zu entwerfen, das primär auf "Texten" aus dem Feld, also Interviewmaterial mit Betroffenen selbst, basieren sollte. Die empirische Untersuchung Das Forschungsfeld Insgesamt wurden neun leitfadenorientierte qualitative Interviews geführt. Dabei handelt es sich zum einen um Interviews mit zwei medizinisch-psychiatrischen ExpertInnen auf dem Gebiet dieser Erkrankung, welche einer Einrichtung angehören, die eine für die soziale Phobie spezialisierte Ambulanz anbietet. Zum anderen wurden sieben Personen, die sich selbst als Soziale PhobikerInnen bezeichnen, für unsere Untersuchung gewonnen. Zu Beginn stellte sich die Kontaktaufnahme mit Betroffenen als äußerst schwieriges Unterfangen dar. Ein Grund dafür könnte die mit dem Krankheitsbild verbundene mangelnde öffentlichen Präsenz und Sichtbarkeit der Betroffenen sein. Der Kontakt gelang aber schließlich dennoch. Zwei Betroffene konnten aus dem Bekanntenkreis eines Gruppenmitglieds gewonnen werden, eine Interviewpartnerin kontaktierte uns aufgrund eines Postings in einem Sozialphobie-spezifischen Forum und vier weitere Interviewte sind Mitglieder einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit sozialer Phobie. Zwei Selbsthilfegruppen wurden sowohl telefonisch als auch per E-Mail von uns angesprochen, woraufhin sich eine Gruppe als sehr kooperationsfreudig zeigte und uns den Zugang ermöglichte. Das Forschungsvorhaben wurde an Ort und Stelle vorgestellt, woraufhin sich einige der Betroffenen zu einem Gespräch bereit erklärten. Mit Ausnahme einer Person sind alle InterviewpartnerInnen berufstätig bzw. noch in Ausbildung, waren oder sind in therapeutischer Behandlung, und nehmen auch an einigen gesellschaftlichen Aktivitäten (Selbsthilfegruppe, Ausbildung, Beruf, Veranstaltungen etc.) teil – sind also nicht auf extreme Weise durch die soziale Phobie eingeschränkt. Lediglich eine Person ist aufgrund ihrer Erkrankung nicht im Stande das Haus zu verlassen. Da sich die Mehrheit der InterviewpartnerInnen in einer relativ homogenen Gruppe befindet 7 und das Rückspielen/Darstellung unserer Ergebnisse vorweg auch zugesichert wurde, ist aus unserer Perspektive zu bedenken, dass die in den Interviews angesprochenen Ansichten in Bezug auf die Selbsthilfegruppe einerseits in ein vielleicht gesteigert positives Licht gerückt wurden, andererseits genau das Gegenteil der Fall sein mag. Deshalb wurden diese Aspekte von Vornherein für unsere Analyse und Interpretation mitbedacht. Erhebung und Analyse Das vorliegende Forschungsprojekt wurde ausschließlich unter der Verwendung von qualitativ-zyklischen Methoden erarbeitet. Im Zentrum der Forschung stehen narrative Interviews, die mit betroffenen SozialphobikerInnen durchgeführt wurden. Der Vorteil dieser Erhebungsmethode liegt in ihrer Offenheit. Die interviewte Person selbst wird zum „sprechenden Buch“ und führt den/die InterviewerIn sowohl zu manifesten Sachverhalten, die im Forschungsfeld direkt und konkret thematisiert werden, als auch zu latenten, also möglicherweise verborgenen Inhalten, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, und erst im Zuge der Textinterpretation thematisiert werden können. Im Rahmen der Interviews wurden den Betroffenen auch so genannte Netzwerkkarten zur Anregung von Erzählungen über soziale Kontakte vorgelegt. Zusätzlich zu den Betroffeneninterviews haben wir – um fachspezifisches Wissen zu erlangen – auch zwei ExpertInnen befragt, die sich in besonderer Weise mit der Erkrankung Soziale Phobie beschäftigen. Ebenso diente die Analyse von Gesprächsbeiträgen in Threads, die einem Internet-Selbsthilfeforum zum Thema „Sozial Phobie“ entnommen wurden, als Rahmung der Forschung. Beides bildete eine wichtige Verständnisbasis für unser Forschungsvorhaben. Vor allem die ExpertInneninterviews erwiesen sich bei der Auswahl der Fragen für die narrativen Interviews als sehr hilfreich und bei der Thesengenerierung in der Analysephase unterstützend. Das gesamte Interviewmaterial wurde schließlich einer hermeneutischen Textanalyse unterzogen, wobei konkret folgende methodischen Entscheidungen umgesetzt wurden: Sowohl narrative Interviews als auch Internetthreads wurden mit Feinstrukturanalyse (nach Froschauer/Lueger 2003) bearbeitet. Diese Analysemethode bot einen idealen Einstieg in den ersten Analysezyklus, da sie einerseits durch ihre genaue und tiefgängige Herangehensweise dabei half, ein erstes Orientierungswissen über das Feld zu generieren. Andererseits sicherte sie durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Material auch die Qualität der Analyse ab. In einem zweiten Zyklus wurde das Interviewmaterial mit Hilfe der Systemanalyse in Bezug auf die zentralen Fragestellungen analysiert und mit Fokus auf die bereits generierten Thesen sukzessive überprüft. Besonderes Augenmerk wurde dabei darauf gelegt, welche Textstellen vorhandene Thesen bestätigen oder aber sie in Frage stellen konnten. Auch die 8 ExpertInneninterviews, die zu Beginn des Forschungsprojektes durchgeführt wurden, wurden hermeneutisch, und zwar mittels Themenanalyse bearbeitet und dienten während des gesamten Analyseprozesses als theoretische Rahmung und notwendige Kontextinformation. ERGEBNISSE Die folgenden Ergebnisse stellen nur einen Teil dessen dar, was in unserer Forschung erarbeitet wurde. Wir haben sie ausgesucht, weil sie uns am Interessantesten erschienen und sie in sich eng zusammenhängen. 1.1 Nähe und Distanz Ein markanter roter Faden, der sich durch alle geführten Interviews gezogen hat war die ausdrückliche Scheu der Betroffenen sich eindeutig zu positionieren. Dieser Aspekt manifestiert sich auf drei verschiedenen Ebenen, welche im Folgenden dargestellt werden. Die erste, verbale Ebene, betrifft die Interviews selbst: Im Rahmen der Gespräche erfuhren wir zwar oft konkrete Meinungen und Berichte, von denen aber auch rasch– in den nächsten Sätzen – wieder Abstand genommen wurde. Auf Positionierung in Gesprächen folgt also zugleich Relativierung und Distanzierung. Von dieser Erkenntnis kann schließlich auf die zweite, interpersonelle Ebene geschlossen werden. Zu diesem Zweck wurde das Interviewmaterial unter dem Blickwinkel der Ausformung zwischenmenschlicher Beziehungen betrachtet. Wie gestaltet sich das Verhältnis von SozialphobikerInnen zu anderen Personen? Dabei ist sehr markant, dass sich die betroffenen Personen im Umgang mit anderen Personen ein spezielles Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz aufrechterhalten. Einen Grund dafür wird aus dem Material selbst ersichtlich: SozialphobikerInnen haben das Gefühl, je enger der Kontakt zu einer anderen Person wird, desto eher Gefahr zu laufen, sich einer Bewertung eben genau durch diese Person auszusetzen. Diese Erkenntnis führt zu einer dritten, taktischen Ebene der Distanzierung, in der eine konkrete Strategie entworfen wird, durch dieses Nähe-DistanzVerhältnis den Umgang mit anderen Menschen zu regulieren. Wir hatten zu Beginn der Forschung die Vorstellung, Netzwerke von SozialphobikerInnen seien der Spezifika ihres Leidens wegen klein, aus wenigen Personen bestehend, deren Beziehung zu der/dem Betroffenen dafür sehr intensiv sei. Diese Erwartung hat sich nicht bestätigt. Die Betroffenen wurden gebeten, selbst Netzwerkkarten auszufüllen. In deren Analyse zeigte sich, dass kaum eine der erwähnten Personen ihnen nahe, als Unterstützung 9 eingeordnet wird. Tatsächlich kommen Kontakte, in denen die Beziehung zu den Befragten dafür oberflächlicher ist, häufiger vor. Diese Bezugspersonen, die SozialphobikerInnen durchaus haben, können oft wechseln da es nicht einfach ist, die Beziehungen so aufrechtzuerhalten, dass sie einerseits nicht zu eng werden und andererseits nicht zu weit auseinanderklaffen. Es herrscht daher ein ständiges Spannungsspiel zwischen Nähe und Distanz von SozialphobikerInnen zu deren Mitmenschen. Die Angst vor zu viel Bewertung führt dazu, dass die Grenze in Beziehungen zu Mitmenschen auch räumlich bewahrt wird. Es kam dabei zur Sprache, dass zwar durchaus Kontakt benötigt wird, allerdings nur über einen begrenzten Zeit- und Frequenzraum. Sobald eine zu hohe Regelmäßigkeit und Nähe zustande kommt, wird wieder auf Abstand geschaltet. Solche Wechsel zwischen Nähe und Distanz können sich über Jahre hinziehen, was schließlich bei festen PartnerInnenschaften zum Verhängnis werden kann. 1.2 Diskussion Es ist klar erkennbar, dass SozialphobikerInnen teilweise durchaus den Wunsch haben, längerfristige Beziehungen zu führen, dies jedoch oft daran scheitert, dass Betroffene nicht genügend Nähe zulassen können. SozialphobikerInnen erleben daher FreundInnenschaften dann positiver und gelassener, wenn der Kontakt zu diesen FreundInnen seltener und unregelmäßiger ist. Gleichzeitig kann diese Oberflächlichkeit aber auch beklagt werden. Auf den Versuch anderer Personen, Nähe und Regelmäßigkeit zu schaffen, etwa durch die Bitte um bestimmte Verpflichtungen, kann innerliche Distanzierung folgen, da es als schwer empfunden wird, den als hoch erlebten Ansprüchen im Alltag auch kontinuierlich gerecht zu werden. Dabei kann es den Betroffenen oft schwer fallen, sich für Nähe oder Distanz zu entscheiden und dieser Entscheidung auch konsequent zu folgen. Dies ist durch den Wunsch bedingt, sich in Interaktionen mehrere Optionen offen zu halten, um einer Bewertung in Beziehungen leichter entgehen zu können. Wir konnten selbst beobachten, wie die Befragten in Interviews ihre Aussagen ständig relativieren. Unsere Interpretation ist, dass sich SozialphobikerInnen durch einen gewissen Freiraum von Optionen einen Handlungsspielraum offen halten. Aus dem Material lässt sich ganz klar erkennen, dass es das Bestreben der Betroffenen ist dieses Wechselspiel in allen Lebensbereichen durchzusetzen und dass dies mit einem großen Aufwand an Strategien verbunden ist. Der Alltag ist von ständigem Stress durchzogen. Für dieses Kontaktmanagement spielen bestimmte Stereotypen eine wesentliche Rolle. Die Betroffenen haben genaue Vorstellungen, teils stark überformt, wie soziale Interaktionen 10 stattfinden sollen, sehen sich selbst aber als sozial inkompetent und schrecken letztlich vor der Erfüllung dieser Vorstellungen zurück. Das Resultat solcher Verhaltensweisen ist klar: die Betroffenen gehen auf Distanz. 2.1 Ideale Wenden wir uns nun genauer diesen Stereotypen zu. Die Vorstellungen von Interaktionen, Beziehungen und sozialen Situation, mit all ihren Implikationen, sind gleich bleibend stark bei allen befragten Personen vertreten gewesen. Die Stereotypen dienen als Handlungsmöglichkeiten, genauer: als Planung von Situationen und dem damit korrespondierendem, „korrektem“ Verhalten. Betroffene malen sich also aus, was, wie, wann getan werden muss um eine „reibungslose“ Interaktion zu ermöglichen. Aus diesen Rastern ergeben sich recht starre Bilder der Realität und sehr eingeschränkte, unflexible Handlungsoptionen. Dies wiederum führt dazu, dass ihre gesetzten Handlungen nicht ihren Erwartungen entsprechen und sie sich als wenig bis gar nicht kompetent wahrnehmen. Soziale PhobikerInnen befinden sich im permanenten Vergleich mit anderen, wobei die Grenze ihre eigene Krankheit ist. Der Titel unserer Arbeit, „Die Grenzen sind die anderen“ basiert genau auf dieser Erkenntnis. Denn die Unterscheidung wird von den Betroffenen selbst getroffen, indem sie andere als normal und sich selbst als nicht normal wahrnehmen und schildern. Ihre ganze Wahrnehmung ist auf mögliche Bewertungen angelegt und dafür sensibilisiert. Sie beobachten ihr Umfeld sehr genau, fühlen sich selbst dadurch aber auch immer beobachtet. Sie schließen also von sich auf andere und gehen davon aus, dass ihre gefühlte „Inkompetenz“ den anderen Personen ständig auffällt und sie somit ständig negativ bewertet werden. Auch dies ist ein Rückschluss denn sie bewerten andere permanent, eben als „normal“, „kompetent“ usw. Die Ideale werden nicht als solche wahrgenommen sondern als „normal“. Demzufolge idealisieren betroffene Personen das „Normale“. Für die Betroffenen sind die Idealvorstellungen Realität, sie meinen diese überall zu erkennen und bestätigen sich in ihrer eigenen Konstruktion. Die Abwertung der eigenen Person und die idealisierten Vorstellungen über z.B. FreundInnenschaften und Beziehungen, führt weiters zu der Angst den Ansprüchen dieser zwischenmenschlichen Beziehungen nicht gerecht zu werden bzw. für andere nicht gut genug zu sein. FreundInnenschaften und Beziehungen werden daher bald wieder abgebrochen oder gar nicht erst eingegangen. Um den erlebten Ansprüchen in FreundInnenschaften und 11 Beziehungen gerecht zu werden, können Menschen mit Sozialer Phobie dazu neigen, sich anzupassen. Sie verstellen sich also, um den angeblichen Anforderungen gerecht zu werden. Durch dieses Anpassen, haben die Betroffenen das Gefühl die eigenen Bedürfnisse in den Schatten zu stellen, was dazu führt, dass FreundInnenschaften und Beziehungen als nicht befriedigend angesehen und ein Unwohlsein bei den Betroffenen ausgelöst werden kann. 2.2 Diskussion Die Betroffenen haben unmögliche bzw. unrealistische Erwartungen nach denen sie Situationen beurteilen. Sie treten also mit idealisierten Vorstellungen an die soziale Welt. Dies führt zu zweierlei Ergebnissen, einerseits werden die Kompetenzen der sie umgebenden Menschen maßlos überschätzt und andererseits die eigenen vollkommen negiert. Allerdings liegt dies primär an der Beschaffenheit dieser Ideale, denn durch die überformte Vorstellung des richtigen Handelns, Umgangs mit anderen, oder auch Situationen usw. schaffen sie eine Unmöglichkeit ihren eigenen Erwartungen zu entsprechen. Eine mögliche Erklärung dafür finden wir bei Erving Goffman. Jener beschreibt, dass die "DarstellerInnen" in sozialen Interaktionen immer dazu tendieren würden, die Werte, die hinter ihrem Verhalten stehen, die Bedeutungen ihrer Handlungen sowie die Erwartungen der ZuschauerInnen dramatisch zu steigern. Das Verhalten der InteraktionspartnerInnen bekommt so eine besonders große Bedeutung (Abels 2004: 175 1 ). Menschen mit sozialer Phobie scheinen demnach nicht das eigene, wie Goffman das meint, sondern vor allem das Verhalten ihrer InteraktionspartnerInnen zu idealisieren. 3.1 Umgangsstrategien Nachdem wir jetzt zwei wichtige Phänomene beschrieben haben, welche die Komplexität der sozialen Phobie in großem Maße bestimmen, möchten wir auf das Coping der Betroffenen zu sprechen kommen. Es gibt eine Vielzahl von Umgangsstrategien wie zum Beispiel Medikamente (besonders verstärkt auch bei den Begleiterkrankungen eingesetzt), Körperübungen, verschiedene kognitive Therapieformen usw. Da die von uns Befragten zum Teil sehr unterschiedliche Erfahrungen im Umgang gesammelt haben, verschiedene Therapieformen durchlaufen wurden, kann „die“ Umgangsstrategie nicht vorgestellt werden, da es sie nicht gibt. Welche Strategie tatsächlich Erfolg mit sich bringt, können wir nicht sagen. Wir wollen die einzelnen Strategien auch nicht bewerten. 1 Goffman erläutert diesen Gedanken in "Wir alle spielen Theater" (1959). 12 In den Erzählungen der Betroffenen wird bei emotionalen Thematiken vermehrt generalisiert. Da Person und Krankheit dabei voneinander getrennt werden, könnte man schon das als eine Art Umgang betrachten. Die ständigen Relativierungen, also das „Nicht-festlegen-Wollen“ der Betroffenen, stellen einen verbalen Ausdruck der Bewertungsangst der Betroffenen dar. Es handelt sich um Vermeidungen, da eine permanente Abschwächung von Aussagen und ein hin und her zwischen verschiedenen Optionen das „Festnageln“ auf eine Aussage/ Meinung nicht ermöglichen, womit aktiv Bewertungen vermieden, umgangen werden. Die vermiedene Bewertung ist auch kennzeichnend für die abwechselnde Nähe und Distanz in Beziehungen von Betroffenen. Da die Angst vor Beurteilung allgegenwärtig ist, kann eine bewusst vorgenommene Distanzierung zu gegebenen Zeitpunkten Druck von den Betroffenen nehmen, zum Beispiel einem idealen Freund, einer idealen Freundin zu entsprechen. Die Betroffenen versuchen mittels stereotyper Vorstellungen ihre Interaktionen voraus zu planen. Durch dieses Vorausplanen konfrontieren sie sich mit ihren Ängsten. Der nächste Schritt würde den Vollzug der tatsächlichen Handlungen darstellen. Da aber Interaktion nicht 1:1 planbar ist, erweisen sich diese idealtypischen Schablonen in der tatsächlichen Situation nur begrenzt brauchbar. Das Vorbereiten bestätigt die enorme Reflexivität der Betroffenen. In Erwartung einer Situation potentieller Angst planen sie daraufhin die bevorstehende Interaktion, wie sie ablaufen könnte, im Idealfall auch sollte. Womöglich mag dies für Small Talk funktionieren. Werden Kontakte aber näher, die Interaktion intensiver, die Beziehung somit komplexer, wäre die vorausgeplante Schablone nur mehr ein Bruchteil der Begegnung und würde im weiteren Verlauf aktive Improvisation von den Betroffenen abverlangen, was aber in den meisten Fällen zu Gunsten der Distanz vermieden wird. Ein kreatives Beispiel für eine konfrontierende Umgangsstrategie einer betroffenen Person ist tatsächlich das Improvisationstheater. Der Unterschied zum gedanklichen Vorausplanen der Interaktion liegt in der Echtheit der Face-to-Face Kommunikation. Druck entlastend für Betroffene ist die Gewissheit, dass sich die Übung in einem sicheren, geschützten Raum abspielt und eben dem Training dient, und noch nicht auf Anhieb funktionieren muss und kann. Es wird erlernt mit der alltäglichen Kommunikation umzugehen, Krisensituationen in den Griff zu bekommen usw., also in diesem Sinne eine Vorbereitung auf alltägliche Interaktion. Durch die erworbene Kompetenz zu improvisieren, werden die idealtypischen Schablonen variabler, flexibler und entsprechen mehr einer tatsächlichen Kommunikationssituation. Die improvisierende Person soll nicht 13 lernen wie Interaktion funktioniert, sondern wird mit möglichen Alternativen konfrontiert und erlernt darauf flexibel zu reagieren und zu handeln. Eine bedeutende Rolle im Ablegen der Idealtypen scheinen unbeteiligte Dritte zu haben, die den Betroffenen bewusst machen wie überformt ihre Vorstellungen und Annahmen sein mögen, wie stark sie von Tatsächlichkeiten abweichen mögen. In diese Rolle können sowohl nahe stehende Personen schlüpfen, wenn diese vorhanden sind, aber auch externe BetrachterInnen der Situation, zum Beispiel in Form professioneller AkteurInnen aus dem medizinisch-psychiatrischen Feld. Doch oft mag die Unterstützung Außenstehender lediglich ein Input für Betroffene sein. Sie können das Problem nicht lösen, sondern nur der Betroffene kann seine Einstellung auch wirklich ändern. Dritte können die Wahrnehmung zumindest in Richtung Erkenntnis modifizieren, Defizite anderer Menschen verdeutlichen und eigene Fehler aufzählen. 3.2 Diskussion Unter dem Stichwort Umgang haben sich zwei Pole herauskristallisiert, die im analysierten Material vorherrschend waren und von den Betroffenen auf unterschiedlichste Weise, also mit unterschiedlichen Ausprägungen, charakterisiert wurden. Dabei handelt es sich um Vermeidung und Konfrontation. Unter Vermeidung versteht sich das „Umgehen“ von Angst auslösenden, problematischen Situationen, Konfrontation das exakte Gegenteil, nämlich sich den Situationen auszusetzen, wie es in der Konfrontationstherapie gehandhabt wird, was auch von Seiten der ExpertInnen als die womöglich effektivste Methode zum verbesserten Umgang mit prekären Situationen angepriesen wird, aber auch von den damit erfahrenen Betroffenen bestätigt wird. Konfrontation hat verschiedene Ausprägungen und Grade. Sie kann vom Einkaufen von Lebensmitteln bis hin zum Mitwirken in einem Improvisationstheater reichen, wobei dazwischen sehr viele Abstufungen liegen. Konfrontation ist aber eine bewusste Entscheidung der Betroffenen, die von Situation zu Situation getroffen wird oder nicht. Außerhalb der Konfrontationstherapie liegt es an den Betroffenen ob sie sich dafür oder dagegen entscheiden. Die Auseinandersetzung mit anderen Betroffenen stellt sich als sowohl vermeidend als auch konfrontierend heraus. Einerseits ist es äußerst hilfreich andere Betroffene kennen zu lernen, da ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entsteht und Probleme ausgiebig diskutiert werden können. Selbsthilfegruppen geben Raum für Vorbereitung, lassen Zweifel kleiner werden und sollen den Betroffenen Halt geben. Auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass die 14 gesellschaftliche Realität nun mal nicht in den Räumen der Selbsthilfegruppe endet, und auch von den Betroffenen selbst angestrebt wird mit schwierigen sozialen Situationen klar zu kommen, was im sicheren Raum einer Selbsthilfegruppe nicht unbedingt der Fall sein mag, Hier könnte eher von Vermeidung die Rede sein, die aber dennoch hilfreich sein kann. Auch das Besprechen von Problemen mit anderen Betroffenen scheint eine zwiespältige Funktion zu haben. Beschreibungen handeln oft von sehr stark negativ gefärbten Kommunikationen, da Erzählungen sehr problembehaftet sind und oft nicht darüber hinausgehen, und somit auch deprimierend sein können. Gerade darin mag aber auch ein gewisses Erkenntnispotential liegen, nämlich dass festgestellt wird, dass andere Betroffene viel größere Probleme haben, wodurch der eigene Zustand aufgewertet und der Blick auf andere, die Selbsteinschätzung/-kritik relativiert wird. Schluss Abschließend wollen wir noch einmal die für uns wichtigsten Punkte dieser Ergebnisse kurz wiederholen und auf deren Zusammenhang eingehen. Wir werden Fragen ansprechen, die während der Forschung aufgekommen sind und einen Ausblick über mögliche Folgeuntersuchungen geben. Die Probleme, die SozialphobikerInnen mit Personen und Beziehungen haben äußern sich in dem, was wir als Wechselspiel von Nähe und Distanz bezeichnet haben. Damit verbunden steht ein enormer Arbeitsaufwand, um den Alltag zu verwalten und Situationen zu entgehen, die als angstvoll erlebt werden. Die Betroffenen stehen unter Stress. Hinter diesen Ausprägungen sehen wir Idealvorstellungen von Personen, Situationen und Handlungen. Die Betroffenen grenzen sich über die Vorstellungen von anderen Menschen ab und empfinden sich selbst als „nicht normal“. Der Umgang mit der Angst findet dann grob gesagt entweder als Vermeidung dieser oder als Konfrontation damit statt. Obwohl sich diese Forschung mit Coping befasst hat, haben wir niemals einen therapeutischen Anspruch gehabt. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, Empfehlungen für eine mögliche Heilung abzugeben oder auch nur zu beurteilen, welche Umgangsstrategien mehr oder weniger sinnvoll sind. Es ist aber eine Spielart der Soziologie, das Besondere zu beobachten, um Schlüsse über das Allgemeine ziehen zu können. Schüchternheit und das Wissen um die Erwartungen anderer tragen alle Menschen in sich, wer sich der sozialen Phobie zuordnet, fühlt sich durch sie aber in seinen Handlungsoptionen eingeschränkt und belegt soziale Situationen mit Angst. 15 Woher kommen die Ideen davon, wie ein gutes Gespräch auszusehen hat? Wann eine Freundschaft oder Partnerschaft gut ist? Wer sich „normal“ verhält? Sicher spielen die Medien dabei eine wichtige Rolle. Bücher, Film und Fernsehen leben uns vor, wie Beziehungen auszusehen haben und machen es sich vielleicht bei entscheidenden Details zu einfach. Realität ist komplexer als Fiktion. Aber wie soll jemand, der nach eigenem Empfinden noch nie „richtige“ Freundschaft erlebt hat, es besser wissen? Wenn die Erzählungen der Medien öfter und regelmäßiger erlebt werden, als eigene Erfahrungen? In den Interviews wurde sehr stark die Bedeutung der Familie sichtbar. Oft sind es die Eltern die, egal ob sie direkt verantwortlich gemacht werden oder nicht, ihren Kindern vermitteln nicht „normal“ zu sein und es doch wie die anderen zu machen. Auch bei Freunden und Bekannten kommt das vor. Besonders stark ist dieser Einfluss natürlich dann, wenn die betroffene Person nicht als krank verstanden oder akzeptiert wird und Fehlleistungen als Unwillen, Faulheit oder Feigheit interpretiert werden, anstatt mit Nachsicht einem Patienten gegenüber zu reagieren. Man darf die Idealvorstellungen der Betroffenen nicht nur als Hemmung und Problemursache sehen. Sie erfüllen eine wichtige Funktion. Wie bereits erwähnt, haben alle Menschen Vorstellungen von den sozialen Erwartungen anderer und über den Ablauf der Interaktionen und Riten des Alltags. Für die Betroffenen kann Abweichung von diesen stereotypen Mustern Angst bedeuten. Trotzdem ermöglichen die Muster es ihnen, überhaupt handlungsfähig zu sein und sich der Interaktion mit anderen Menschen zu stellen. Sie stellen den Versuch dar, mit anderen Menschen zu kommunizieren und die bevorstehende Konfrontation durch Planung abzusichern. Manche Interaktionen lassen sich besser oder schlechter planen als andere. Manche der Befragten schienen mit flüchtigen Bekanntschaften und Small-Talk leichter umgehen zu können, als mit „tieferen“ Gesprächen. Ein interessanter Ansatzpunkt für weitere Forschung wäre es, gezielt die Rolle des Small-Talk für SozialphobikerInnen zu untersuchen. Unsere These lautet: Small-Talk als ein Alltagsritual der oberflächlichen Fragen und Antworten ist leichter als Muster zu erlernen und umzusetzen, als andere Arten der Interaktion. Fragen zur Nützlichkeit der Selbsthilfegruppe wurden mit zwiespältigen Meinungen quittiert. Auch hier könnte eine folgende Forschung den Fokus setzen: Ist eine Selbsthilfegruppe für SozialphobikerInnen eine Umgangsstrategie? Oder etwas anderes? Es ist möglich, dass die 16 klassische Selbsthilfegruppe bei der sozialen Phobie Schwierigkeiten hat. Was, wenn ein wichtiges Element wie der gemeinsame Erfahrungsaustausch von Mitgliedern nicht vollständig betrieben wird, weil die Angst vor der Bewertung der anderen auch hier im Vordergrund steht? Vielleicht gelingt es aber auch – obwohl die einzelnen Ausprägungen der Krankheit sich von Person zu Person unterscheiden – eine Identität als durch ein Problem geeinte Gruppe zu finden. Die Analyse des bisherigen Materials kann keine klare Antwort geben. Die Rolle des Internets war ein sehr großer Punkt, dessen Bedeutung während der Forschung immer wieder sichtbar wurde, der aber trotzdem nie so recht zum Fokus unserer Betrachtungen werden konnte. Fast alle der Befragten gaben an, zu irgendeinem Zeitpunkt, Informationen zur Krankheit aus dem Internet bezogen zu haben. Auch von der Seite der ExpertInnen wurde betont, wie viele PatientInnen, wenn sie sich selbst zur Behandlung melden, schon mit entsprechendem Vorwissen durch das Netz erscheinen. Die Selbstdiagnose scheint ein sehr häufiger erster Schritt hin zu diesem Krankheitsbild zu sein und das Internet ein besonders wichtiges Werkzeug. Man kann über einen Zusammenhang spekulieren, wenn medizinische Institutionen seit zehn, fünfzehn Jahren spezielle Einrichtungen für die Sozialphobie anbieten – genau der Zeitraum, in dem der Zugang zum Internet sich in unserem Land zu verbreiten begann. Vielleicht ließe sich hier verfolgen, wie Symptome, die es wohl schon immer gegeben haben mag, durch eine neue Technik zur Informationsverteilung ein Krankheitsbild „finden“. Die Implikationen für eine Betrachtung des Themas der sozialen Konstruktion von Krankheit sind eindeutig: Hat die Information und Beratung im Internet auf einen Bedarf reagiert oder wechselseitig auch die Zuweisung zur Krankheit vorangetrieben? Interessant wäre auch, wie SozialphobikerInnen das Netz verwenden. Die Kommunikation im Internet scheint es zu erleichtern, mit Angst belegten sozialen Situationen auszuweichen. Es gibt mehr Kontrolle darüber, wie viel man von sich selbst preisgibt. Immer mehr Dienstleistungen lassen sich mittlerweile auch rein über Computer in Anspruch nehmen. Führt das Internet also zu einer verstärkten Vermeidung und Abkapselung in der eigenen Wohnung? Oder ist es ein Portal zu neuen Kontakten? Und was ist mit jenen Betroffenen, die selbst Seiten und Foren erstellen, um die Informationen noch zugänglicher zu machen – was bedeutet diese Arbeit für sie? Der Begriff des sozialen Netzwerks war für unsere Forschung sehr wichtig, ging es doch um eine Krankheit, die speziell den Kontakt mit anderen Menschen erschwert. Gleichzeitig kann 17 man Netzwerke als Aspekt sozialer Unterstützung für Menschen mit chronischen Leiden und damit für Coping bedeutsam einordnen. (Marten-Mittag 2003: 30) Augenscheinlich schien hier eine interessante Diskrepanz möglich. Die Verwendung des Begriffs bereitete durchaus Schwierigkeiten. Definitionen halten ihn meistens sehr offen, so dass nicht immer klar ist, wo man schon von einem Netzwerk sprechen kann und wo nicht. Und ist die bloße Existenz eines Geflechts aus Beziehungen schon der Garant für soziale Unterstützung? Es wäre stets interessant gewesen, die Netzwerke der Betroffenen genauer zu untersuchen und einen Vergleich anzustellen. Leider hätte dies unsere Ressourcen überbeansprucht. Trotzdem kann man es als weitere Untersuchungsmöglichkeit festhalten: Mittels einer Netzwerkanalyse das Beziehungsgeflecht von Menschen, die sich der Sozialphobie zuordnen, mit jenen zu vergleichen, die das nicht tun und Dichte, Intensität und sonstige Merkmale auf mögliche Unterschiede zu untersuchen. 18 Anhang Soziale Phobie nach den Definitionskriterien des ICD-10 der WHO: A: Entweder (1) oder (2): (1) deutliche Angst, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich oder beschämend zu verhalten, (2) deutliche Vermeidung, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder von Situationen, in denen die Angst besteht, sich peinlich oder beschämend zu verhalten. Diese Ängste treten in sozialen Situationen auf, wie Essen und Sprechen in der Öffentlichkeit, Begegnungen von Bekannten in der Öffentlichkeit, Hinzukommen oder Teilnahme an kleinen Gruppen, wie z.B. bei Parties, Treffen oder in Klassenräumen. B: Mindestens zwei Angstsymptome in den gefürchteten Situationen mindestens einmal seit Auftreten der Störung sowie zusätzlich mindestens eines der folgenden Symptome: (1) Erröten oder Zittern, (2) Angst zu erbrechen, (3) Miktions- oder Defäktionsdrang bzw. Angst davor. C: Deutliche emotionale Belastung durch die Angstsymptome oder das Vermeidungsverhalten. Einsicht, dass die Symptome oder das Vermeidungsverhalten übertrieben und unvernünftig sind. D: Die Symptome beschränken sich vornehmlich auf die gefürchtete Situation oder auf die Gedanken an diese. E: Die Symptome des Kriteriums A sind nicht bedingt durch Wahn, Halluzinationen oder andere Symptome der Störungsgruppen organische psychische Störungen, Schizophrenie und verwandte Störungen, affektive Störungen oder eine Zwangsstörung und sind keine Folgen einer kulturell akzeptierten Anschauung. (WHO 1991, zit. nach Stangier/Fydrich 2002: 15) Literatur Abels, Heinz, 2004: Interaktion, Identität, Präsentation. Kleine Einführung in interpretative Theorien der Soziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Adams, J.B., B. Lindemann, 1974: Coping with Long-Term Disability, in: G.V. Coelho/D.A. Hamburg/J.B. Adams (Hg.): Coping and Adaption, New York, p. 127-128. Angermeyer, M., H. Freyberger (Hg.), 1982: Chronisch kranke Erwachsene in der Familie. Stuttgart: Enke Bassler, M. 1995: Zur psychoanalytischen Behandlung von Angststörungen, 137-145 in: Nissen Gerhard (Hg.) 1995: Angsterkrankungen. Präventionen und Therapie, Bern: Verlag Hans Huber. Bergerhoff, Petra und Peter Novak, 1988: Coping als soziales Handeln. Versuch einer soziologischen Ortsbestimmung. S.69-87 in: Kächele, Horst und Wolfgang Steffens (Hg.): Bewältigung und Abwehr. Beiträge zur Psychologie und Psychotherapie schwerer körperlicher Krankheiten. Berlin: Springer-Verlag. Diaz-Bone, Rainer (2007): Gibt es eine qualitative Netzwerkanalyse? In: Forum Qualitative Sozialforschung, Vol.8, Nr.1, Art. 28, http://www.qualitative-research.net/fqs/ (Stand 6.8.2007) Esser, Hartmut, 1980: Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Integration von Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten. Eine handlungstheoretische Analyse. Darmstadt/Neuwied: Luchterhand. 19 Friedmann, Alexander, 1998: Kulturspezifische Sozialphobie. S 54-66 in: Katschnig, Heinz, Ulrike Demal und Jörg Windhaber (Hg.), 1998: Wenn Schüchternheit zur Krankheit wird... Über Formen, Entstehung und Behandlung der Sozialphobie. Wien: Facultas. Froschauer, Ulrike und Manfred Lueger, 2003: Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme. Wien: WUV- Universitätsverlag. Gerhardt, Ute, H. Friedrich, 1982: Familie und chronische Krankheit. Versuch einer soziologischen Standortbestimmung, in Angermeyer, p. 1-25. Gerhardt, Ute, 1986: Patientenkarrieren. Eine medizinsoziologische Studie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Goode, Erica, 1998: Old as Society, Social Anxiety Is Yielding Its Secrets. The New York Times, October 20, 1998, http://query.nytimes.com (Stand 29.11.2006) Gukenbiehl, Hermann L., 2001: Handeln, soziales, in: Schäfers, Bernhard (Hg.): Grundbegriffe der Soziologie. Opladen: Leske + Budrich. Helfferich, Cornelia (2002): Erzählung und „Bewältigung“. Soziale Regeln des angemessenen Umgangs mit Belastung im Alltag und ihren Bedeutung in Lebensgeschichten chronisch kranker Frauen, in ÖZS, Jg. 27, Heft 4: 42-62 Hollstein, Betina und Florian Straus (Hg.), 2006: Qualitative Netzwerkanalyse. Konzepte, Methoden, Anwendungen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Jelinek, Elfriede, 2006: Angst.Störung, www.elfriedejelinek.com (Stand 14.7.2007) Katschnig, Heinz, Ulrike Demal und Jörg Windhaber (Hg.), 1998: Wenn Schüchternheit zur Krankheit wird... Über Formen, Entstehung und Behandlung der Sozialphobie. Wien: Facultas. Kächele, Horst und Wolfgang Steffens (Hg.), 1988: Bewältigung und Abwehr. Beiträge zur Psychologie und Psychotherapie schwerer körperlicher Krankheiten. Berlin: Springer-Verlag. Konopitzky, Natasa, 2007: Sozialphobie- unbekannte aber häufigste Angsterkrankung, http://derstandard.at/druck/?id=2773532 (Stand 14.7.2007) Lalouschek, Johanna, 2005: Inszenierte Medizin. Verlag für Gesprächsforschung, http://www.verlag-gespraechsforschung.de (Stand 24.11.2006) 20 Linden, M. 1995: Verhaltenstherapie bei Angsterkrankungen, 146-154 in: Nissen Gerhard (Hg.) 1995: Angsterkrankungen. Präventionen und Therapie, Bern: Verlag Hans Huber. Lueger, Manfred 2000: Grundlagen qualitativer Feldforschung. Wien: WUV- Universitätsverlag. Magee, W.J., Eaton, W.W., Wittchen, H.U., McGonagle, K.A. & Kessler, R.C. 1996: Agoraphobia, Simple Phobia, and Social Phobia in the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry, 53, 159-168. Marten-Mittag, Birgit, 2004: Bewältigung chronischer Krankheiten am Beispiel der Leberzirrhose. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=976411342&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=976411342.pdf (Stand: 8. 11. 2006) Meuser Michael, und Ulrike Nagel, 2005: ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. S. 71-93. In: Bogner, Littig, Menz (Hg.): Das Experteninterview. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Nettleton, Sarah, 2006: The Sociology of Health and Illness. Second Edition. Cambridge: Polity Press. Schäfers, Bernhard (Hg.), 2001: Grundbegriffe der Soziologie. Opladen: Leske + Budrich. Schüle, Christian, 2007: In den Fängen der Angst, http://images.zeit.de/text/2007/17/Dossier-Angst (Stand 15.7.2007) Stangier, Ulrich, und Thomas Fydrich, 2002: Das Störungskonzept der Sozialen Phobie oder der Sozialen Angststörung. S. 10-33 in: Ulrich Stangier und Thomas Fydrich (Hg.), Soziale Phobie und Soziale Angststörung. Psychologische Grundlagen, Diagnostik und Therapie, Göttingen/Bern/Toronto/Seattle: Hogrefe-Verlag. Stangier, Ulrich; Heidenreich, Thomas; Peitz, Monika, 2003: Soziale Phobien. Ein kognitiv – verhaltenstherapeutisches Behandlungsmanual, Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag. WHO [Weltgesundheitsorganisation], 1991: Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V, Hrsg. von H. Dilling, W. Mombour und M. Schmidt. Bern: Hans Huber. 21