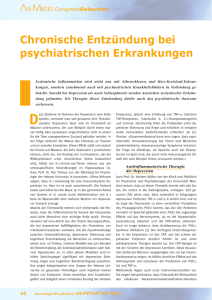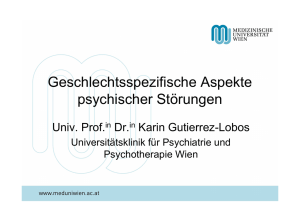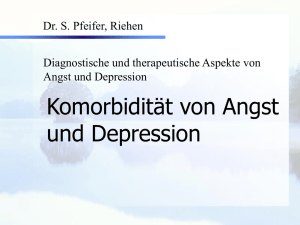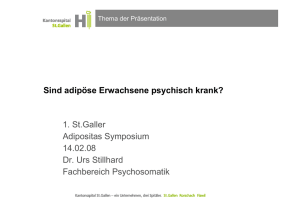Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen
Werbung
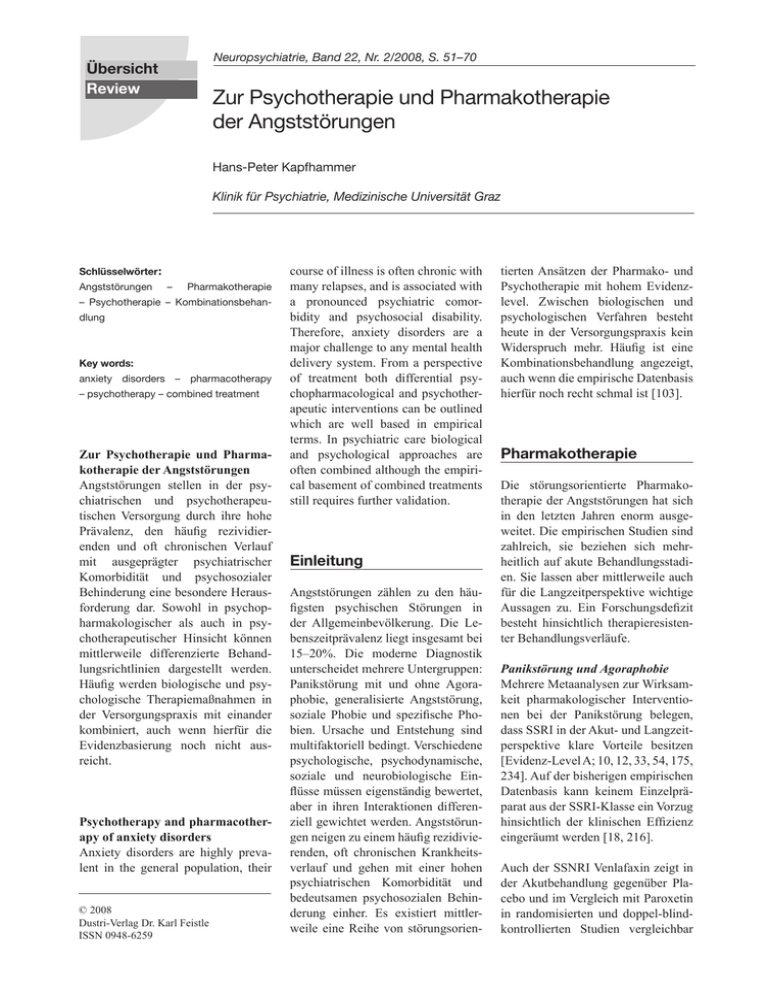
Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 2/2008, S. 51–70 Übersicht Review Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen Hans-Peter Kapfhammer Klinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Graz Schlüsselwörter: Angststörungen – Pharmakotherapie – Psychotherapie – Kombinationsbehandlung Key words: anxiety disorders – pharmacotherapy – psychotherapy – combined treatment Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen Angststörungen stellen in der psy­ chiatrischen und psychotherapeu­ tischen Versorgung durch ihre hohe Prävalenz, den häufig rezividier­ enden und oft chronischen Verlauf mit ausgeprägter psychiatrischer Ko­mor­bidität und psychosozialer Behinderung eine besondere Heraus­ forderung dar. Sowohl in psychop­ harmakologischer als auch in psy­ chotherapeutischer Hinsicht können mittlerweile differenzierte Behand­ lungsrichtlinien dargestellt werden. Häufig werden biologische und psy­ chologische Therapiemaßnahmen in der Versorgungspraxis mit einander kombiniert, auch wenn hierfür die Evidenzbasierung noch nicht aus­ reicht. Psychotherapy and pharmacotherapy of anxiety disorders Anxiety disorders are highly preva­ lent in the general population, their © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 course of illness is often chronic with many relapses, and is associated with a pronounced psychiatric comor­ bidity and psychosocial disability. Therefore, anxiety disorders are a major challenge to any mental health delivery system. From a perspective of treatment both differential psy­ chopharmacological and psychother­ apeutic interventions can be outlined which are well based in empirical terms. In psychiatric care biological and psychological approaches are often combined although the empiri­ cal basement of combined treatments still requires further validation. Einleitung Angststörungen zählen zu den häu­ figsten psychischen Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Die Le­ benszeitprävalenz liegt insgesamt bei 15–20%. Die moderne Diagnostik unterscheidet mehrere Untergruppen: Panikstörung mit und ohne Agora­ phobie, generalisierte Angststörung, soziale Phobie und spezifische Pho­ bien. Ursache und Entstehung sind multifaktoriell bedingt. Verschiedene psychologische, psychodynamische, soziale und neurobiologische Ein­ flüsse müssen eigenständig bewertet, aber in ihren Interaktionen differen­ ziell gewichtet werden. Angststörun­ gen neigen zu einem häufig rezidivie­ renden, oft chronischen Krankheits­ verlauf und gehen mit einer hohen psychiatrischen Komorbidität und bedeutsamen psychosozialen Behin­ derung einher. Es existiert mittler­ weile eine Reihe von störungsorien­ tierten Ansätzen der Pharmako- und Psychotherapie mit hohem Evidenz­ level. Zwischen biologischen und psychologischen Verfahren besteht heute in der Versorgungspraxis kein Widerspruch mehr. Häufig ist eine Kombinationsbehandlung angezeigt, auch wenn die empirische Datenbasis hierfür noch recht schmal ist [103]. Pharmakotherapie Die störungsorientierte Pharmako­ therapie der Angststörungen hat sich in den letzten Jahren enorm ausge­ weitet. Die empirischen Studien sind zahlreich, sie beziehen sich mehr­ heitlich auf akute Behandlungsstadi­ en. Sie lassen aber mittlerweile auch für die Langzeitperspektive wichtige Aussagen zu. Ein Forschungsdefizit besteht hinsichtlich therapieresisten­ ter Behandlungsverläufe. Panikstörung und Agoraphobie Mehrere Metaanalysen zur Wirksam­ keit pharmakologischer Interventio­ nen bei der Panikstörung belegen, dass SSRI in der Akut- und Langzeit­ perspektive klare Vorteile besitzen [Evidenz-Level A; 10, 12, 33, 54, 175, 234]. Auf der bisherigen empirischen Datenbasis kann keinem Einzelprä­ parat aus der SSRI-Klasse ein Vorzug hinsichtlich der klinischen Effizienz eingeräumt werden [18, 216]. Auch der SSNRI Venlafaxin zeigt in der Akutbehandlung gegenüber Pla­ cebo und im Vergleich mit Paroxetin in randomisierten und doppel-blindkontrollierten Studien vergleichbar Kapfhammer gute Effekte und scheint sich auch in der Langzeitperspektive zu bewähren [34, 66, 180]. Für das gleichfalls dual wirksame Milnacipran gibt es nur er­ mutigende Daten aus einer offenen Studie [26]. Clomipramin und Imi­ pramin ebenso wie MAO-Hemmer (Phenelzin, Tranylcypromin) besit­ zen ebenfalls eine gute antipanische Wirkung, ihre bedeutsamen Neben­ wirkungen benachteiligen sie aller­ dings gegenüber SSRI und SSNRI [111, 178]. Hochpotenz-Benzodiaze­ pine (z.B. Alprazolam, Clonazepam) haben einen anerkannten Stellenwert [169, 226]. Die drei Substanzklassen SSRI/SSN­ RI, TZA/MAO-Hemmer und Hoch­ potenz-Benzodiazepine erreichen etwa bei 50-80 % der Panikpatienten eine Therapie-Response (Redukti­ on der Anzahl der Panikanfälle bzw. der globalen Angstsymptomatik um mindestens 50%) [154]. Die Benzo­ diazepine wirken schneller, besitzen ein günstiges Nebenwirkungsprofil, mögliche Probleme der Langzeit­ applikation müssen aber beachtet werden, auch haben sie bei einer zusätzlich zur Panikstörung häufig vorliegenden depressiven Sympto­ matik im Vergleich zu SSRI/SSNRI und TZA/MAO-Hemmer Nachteile [234]. In einer pragmatischen Perspektive kann empfohlen werden: • 1. Wahl: SSRI ± initial Benzo diazepine (z.B. Escitalopram 5 – 20 mg/die, Paroxetin (10 mg/die, allmähliche Höherdosierung auf 50 mg/die) • 2. Wahl: Clomipramin (150 mg/ die), Imipramin (150 mg/die), Phenelzin (30 – 60 mg/die), Al­ prazolam (3 – 6 mg/die) • 3. Wahl: Clonazepam (0.5 – 3 mg/ die), Lorazepam (2 – 6 mg/die) Gabapentin (500 – 1000 mg/die) SSRI weisen gegenüber Benzodia­ zepinen einen verzögerten Wirkein­ tritt von einigen Wochen auf. Panik­ patienten sind in der Anfangsphase 52 oft überempfindlich gegenüber den SSRI-Nebenwirkungen. Sie tole­ rieren Symptome von Herzklopfen, Schwitzen, Zittern, ängstliche Un­ ruhe, die initial sogar verstärkt sein können, nur schlecht. Im Hinblick auf Therapiemotivation und Compliance empfiehlt sich deshalb anfangs häu­ fig eine Kombination von SSRI und Benzodiazepin. Goddard et al. [75] zeigten in einer 12-wöchigen Studie, in der offen mit Sertralin behandelte Patienten in einer doppel-blinden, Placebo-kontrollierten 4-wöchigen Behandlungsphase zunächst entwe­ der Clonazepam oder Placebo erhiel­ ten, dann in einer Phase über 3 – 4 Wochen schrittweise von Clonaze­ pam vs. Placebo reduziert und dann ganz abgesetzt wurden und über vier weitere Wochen mit Sertralin alleine behandelt wurden, eine Überlegen­ heit dieser SSRI-BenzodiazepinKombinationsstrategie vor allem im Hinblick auf eine niedrigere Dropout Rate auf. In einer mittelfristigen Perspektive von 3 Monaten scheint der Outcome einer SSRI-Monothe­ rapie gegenüber einer Kombinations­ strategie allerdings nicht ungünstiger zu sein [182]. Dies zeichnet sich auch in einer naturalistischen Langzeitbe­ obachtung ab [211]. Eine initiale Benzodiazepinkomedi­ kation bei einer Panikstörung zielt neben einer besseren Verträglichkeit der SSRI-Therapie auch auf eine wirksame Kontrolle der Panikanfäl­ le, bis die serotonerge Medikation ihre Effekte entfalten kann. Patienten variieren beträchtlich hinsichtlich ih­ res therapeutischen Ansprechens und ihrer Verträglichkeit der Medikation. Deshalb ist ein experimentierendes Höherdosieren des Benzodiazepins und des gewählten SSRI bis zum Er­ reichen eines maximalen Effekts bei minimalen Nebenwirkungen nicht zu umgehen. Dosissteigerungen können alle drei bis vier Tage vorgenommen werden. Therapeutisches Ziel einer solchen Kombinationsbehandlung muss sein, neben einer Kontrolle der Panikanfälle, einer Reduktion der antizipatorischen Angst und des phobischen Vermeidungsverhaltens auch ein allgemeines Wohlbefinden und die soziale Adaptation im Auge zu behalten. Patienten ohne eine aus­ reichende Dosierung sowohl des An­ tidepressivums als auch speziell des Benzodiazepins erreichen keine Sym­ ptomremission, tragen aber trotzdem ein beträchtliches Risiko von Absetz­ effekten. Sie zeichnen sich durch ein anhaltendes ängstliches Unwohlge­ fühl aus. Eine Kontrolle der Angstsymptome durch diese Kombinationsstrategie wird für zahlreiche Patienten zwi­ schen 4 bis 8 Wochen erzielt, so dass dann eine sukzessive Reduktion des Benzodiazepins unter Beibehaltung des SSRI gewagt werden kann. Für Patienten mit einer Teil-Response oder Nicht-Response auf eine anti­ depressive Therapie kann auch eine langfristige Zusatzmedikation von Benzodiazepinen hinsichtlich mögli­ cher Vorteile und Nachteile kritisch erwogen werden. Eine Langzeitmedikation mit ei­ nem SSRI muss im Hinblick auf die hohe Chronizität und den in seiner symptomatischen Intensität fluktu­ ierenden Verlauf einer Panikstörung bezogen werden. Derzeit verfügbare Langzeitdaten erlauben noch keine zuverlässige Beurteilung, wie lange im Einzelfall eine SSRI-Medikati­ on wirklich verordnet werden sollte. Da unter natürlichen Behandlungs­ bedingungen viele Patienten mit Pa­ nikstörung trotz über mehrere Jahre beibehaltener SSRI-Medikation nicht vollständig symptomfrei sind, scheint eher die erreichte Remissionsqualität die entscheidende Determinante als die Gesamtdauer der Behandlung da­ für zu sein, in welchem Ausmaß nach einem allmählichen Absetzen von den SSRI wieder mit einem Rezidiv zu rechnen ist [184]. Klinisch gilt es ferner zu beachten, dass ein Absetzen von SSRI, vor allem bei zu schnellen Reduktionsschritten ein SSRI-Ent­ zugssyndrom verursachen kann, das Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen speziell unter Paroxetin hartnäckig persistieren kann [24, 115]. Längere Krankheitsdauer, stärkere Intensität der Paniksymptome, ausge­ prägteres phobisches Vermeidungs­ verhalten, Komorbidität mit depres­ siven und anderen Angststörungen, speziell mit Generalisierter Angststö­ rung sowie mit Persönlichkeitsstö­ rungen reduzieren die Wahrschein­ lichkeit, auf eine antipanische Medi­ kation positiv anzusprechen, signifi­ kant [57, 139, 213]. Bei mangelnder Therapie-Response oder Therapiere­ sistenz gegenüber den üblicherweise favorisierten Substanzklassen ist ein Versuch mit Mirtazapin, Reboxetin, Bupropion, Valproat, Gabapentin, oder Inositol möglich. Zu diesen Prä­ paraten liegen allerdings erst vorläu­ fige positive Hinweise vor. Proprano­ lol oder Buspiron haben sich bei der Panikstörung dem Placebo als nicht überlegen erwiesen. Kombinationen oder Augmentationen, speziell SSRI/ SSNRI mit Benzodiazepinen oder atypischen Neuroleptika werden dis­ kutiert [16, 68, 99, 162, 210, 238]. Generalisierte Angststörung Die empirische Literatur zur Wirk­ samkeit pharmakologischer Interven­ tionen bei der Generalisierten Angst­ störung führt zu einer recht ähnlichen Einstufung der verfügbaren Sub­ stanzgruppen wie bei der Panikstö­ rung. Die Effizienz von serotonerg wirksamen Päparaten wie SSNRI [Venlafaxin – 4, 73, 108, 120, 166; Duloxetin – 84] und SSRI [Paroxetin – 183, 192; Sertralin – 3, 35; Escita­ lopram – 13, 53] wurde in randomi­ sierten, doppel-blined und Placebokontrollierten Studien nachgewiesen (Evidenz Level A). Das insgesamt günstigere Nebenwirkungsprofil gibt ihnen im Vergleich zu Trizykli­ ka (Imipramin) den Vorzug, die sich aber ebenfalls als gut wirksam erwie­ sen haben [14, 204, 206]. Angesichts einer häufig assoziierten depressiven Symptomatik, speziell auch in der Präsentationsform von hartnäckigen somatoformen Beschwerden kommt den SSRI und vor allem den SSNRI noch eine zusätzliche Bedeutung zu [113, 191]. Generalisierte Angstsyndrome stell­ ten traditionellerweise einen Hauptin­ dikationsbereich für den Einsatz von Benzodiazepinen dar (Evidenz-Level A). Zahlreiche kontrollierte Studien belegen die statistische Überlegenheit von Benzodiazepinen gegenüber Bar­ bituraten, Meprobamat und Placebo in der anxiolytischen Wirksamkeit [61]. Die gute und zuverlässige Effizienz von Benzodiazepinen wird nochmals in einer Metaanalyse bestätigt [156]. Rickels [193] kommentiert allerdings, dass nur ca. 65 bis 75% der Patienten unter Benzodiazepinen eine mäßige bis gute Besserung erfahren. Patien­ ten mit stark ausgeprägten kognitiven und somatischen Angstsymptomen, jedoch mit nur geringer depressiver Verstimmung und wenigen inter­ personalen Problemen sprechen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit positiv auf die Gabe eines Benzodi­ azepins an. In einer randomisierten Vergleichsstudie von Imipramin, Par­ oxetin und Chlordesmethyldiazepam bei nicht-depressiven Patienten mit einer generalisierten Angststörung zeigte sich das Benzodiazepin nach zwei Wochen überlegen, erwies sich aber nach acht Wochen insgesamt als weniger wirksam als die beiden An­ tidepressiva (195). In einer allgemei­ nen klinischen Bewertung wird heute in der Indikationsstellung der Genera­ lisierten Angststörung den selektiven Serotoninwiederaufnahmern (Citalo­ pram, Escitalopram, Paroxetin, Ser­ tralin) und dem SSNRI Venlafaxin (speziell auch in der Retardform XR) der Status von Mitteln der 1. Wahl vor den Benzodiazepinen eingeräumt [169]. SSRI und SSNRI reduzieren vor allem die psychischen Sympto­ me einer generalisierten Angststö­ rung wirksamer als Benzodiazepine. Sie besitzen klare Vorteile bei einer häufig komorbiden Major Depression sowie bei gleichzeitig vorliegendem Alkohol- und Drogenmissbrauch [15, 56]. Trotzdem werden diese Antide­ 53 pressiva sehr häufig auch weiterhin mit Benzodiazepinen kombiniert. In einer Meta-Analyse über 9 Studien zeigte sich bei Patienten mit kombi­ nierten Angst- und depressiven Sym­ ptomen ein solches Vorgehen als si­ gnifikant überlegen [72]. Dem zwischenzeitlich favorisierten Buspiron, einem 5-HT1A-Agonisten kommt nach wie vor eine Bedeutung als Mittel der 2. Wahl zu [EvidenzLevel A; 42]. Durch sein fehlendes Abhängigkeitspotential versprach es bei Markteinführung eine interes­ sante Alternative zu den Benzodiaze­ pinen. Buspiron scheint aber gerade von Patienten mit längerfristiger Benzodiazepineinnahme nicht aus­ reichend angenommen zu werden. Es zeigt eine Wirklatenz von 10 – 14 Tagen. Nicht selten wird eine gewisse Unruhe und erhöhte Nervosität initial beobachtet, die sich aber allmählich gibt. In Wochenschritten sollte um je 5 mg höher dosiert, eine Dosierung um 30 mg/die angestrebt, zuweilen auch die Höchstdosis von 60 mg/ die eingesetzt werden. Eine klinisch wirksame Dosierung sollte nicht vor 6 Monaten reduziert werden. Bei Wiederaufflammen von Angstsymp­ tomen muss eine Langzeitmedikation erwogen werden. Bei leichteren Fällen kann unter die­ sen Indikationsvoraussetzungen auch der Einsatz von Opipramol [157] oder Hydroxyzin [129] versucht werden. Pregabalin könnte künftig ebenfalls eine interessante Option darstellen [17], das sich gegenüber Placebo als überlegen und sowohl Venlafaxin als auch Alprazolam als ebenbürtig er­ wiesen hat [158, 179, 190]. In einer pragmatischen Perspektive kann empfohlen werden: • 1. Wahl: Venlafaxin XR (75 – 150 mg/die, SSRI (z.B. Escitalopram: 10 mg/die) • 2. Wahl: Imipramin (150 mg/die), Buspiron (15 – 30 mg/die) • 3. Wahl: Benzodiazepine (z.B. Diazepam: 5 – 30 mg/die), Opi­ Kapfhammer pramol (50 – 200 mg/die), Prega­ balin (300 – 600 mg/die) Auf eine initial mögliche Intensivie­ rung der Angstsymptomatik unter SSRI und SSNRI ist zu achten, even­ tuell kurzfristig mit Benzodiazepinen zu koupieren. Bei guter Response sollte wiederum die Medikation in der therapeutisch wirksamen Dosie­ rung für mindestens ein halbes Jahr aufrechterhalten werden. Die hohe Chronizität und klinische Komplexi­ tät der Generalisierten Angststörung macht es wahrscheinlich, dass selbst bei guter Stabilisierung und dann vorsichtigen Reduktionsschritten häu­ fig wieder Angstsymptome auftre­ten. Überlegungen zu einer Langzeit­ behandlung sind dann anzustellen [191]. Bei sehr stark ausgeprägter, umfas­ send behindernder Ängstlichkeit sowie einem Versagen zuvor erprob­ ter pharmakologischer Optionen ist auch ein längerfristiger Einsatz von Benzodiazepinen zu rechtfertigen [104]. Eine Indikation hierfür muss auf dem sorgfältigen Vergleich des subjektiven Wohlbefindens, der be­ ruflichen Leistungsfähigkeit und der Lebensqualität eines Patienten unter und ohne zusätzliche Benzodiazepine beruhen. Eine regelmäßige ärztliche Überwachung des Therapieprozesses ist unabdingbar. Eine möglichst voll­ ständige Kontrolle der generalisierten Angst muss angestrebt werden. Eine wirksame Dosierung ist ebenfalls nicht vor 6 Monaten zu reduzieren. Bei einer partiellen oder aber NonResponse ist zunächst eine Überprü­ fung der Diagnose angeraten. Vor allem der hohe symptomatologische Überlappungsbereich zwischen Ge­ neralisierter Angststörung und Ma­ jor Depression ist zu beachten und erfordert eine Kombination mit an­ tidepressiv wirksamen Substanzen. Eine detaillierte Aufklärung über die möglichen Risiken einer Langzeitme­ dikation mit Benzodiazepinen ist in jedem Fall durchzuführen [2]. 54 Hohe Chronizität und Komplexität der Generalisierten Angststörung bewirken, dass monotherapeutische Ansätze häufig nur zu mäßigen Er­ gebnissen führen und vielfältige pharmakologische Kombinationen und Augmentationsschritte nahe le­ gen. Atypischen Neuroleptika kommt künftig unter dieser Indikationsstel­ lung möglicherweise eine stärkere Bedeutung zu [28, 145, 165]. Trotz eines gewissen Erfahrungswissens existieren empirisch überprüfte Pfa­ de für eine Behandlungsrationale bei mangelnder Therapieresponse oder Therapieresistenz aber noch nicht [93, 204, 206]. Soziale Phobie Auch die pharmakologische Be­ handlung der sozialen Phobie stützt sich im Wesentlichen auf die SSRI [Paroxetin – 6, 11, 122, 126, 217, 218, 219; Sertralin – 107, 121, 233; Fluvoxamin – 9, 220, 237; Escitalo­ pram – 105, 221] und SSNRI [Ven­ lafaxin – 5, 124, 189, 222]. Sowohl für SSRI als auch für Venlafaxin be­ steht ein Wirknachweis auf Evidenz Level A [87]. In etwa zwei Drittel der Patienten kann unter dieser Me­ dikation mit einer Therapie-Response (Reduktion der sozialen Angst um ≥ 50%) gerechnet werden. Für den 5HT1A-Agonisten NaSSA Mirtazapin liegt mittlerweile ebenfalls eine ran­ domisierte, doppel-blinde und Place­ bo-kontrollierte Studie mit positiven Resultaten vor [161]. Die Daten mittels Trizyklika waren nicht überzeugend [212]. Das pharmakologische Wirkprinzip der MAO-Hemmer stellte sich in vier placebo-kontrollierten Studien für den nicht-selektiven und irrever­ siblen MAO-Inhibitor Phenelzin als sehr aussichtsreich dar [74, 88, 125, 240]. Der zunächst in offenen Stu­ dien viel versprechende selektive MAO-A-Hemmer Moclobemid zeig­ te in kontrollierten Studien allerdings nur bescheidene Effekte gegenüber Placebo [106, 168, 205]. Günstiger schnitt der andere RIMA Brofaromin in Placebo-kontrollierten Studien ab [60, 130, 236]. Wegen der vereinzelt schwerwiegenden Nebenwirkungen speziell bei den irreversiblen Sub­ stanzen werden MAO-Hemmer heute als Präparate der 2. Wahl angesehen [163]. Die Gabe von Benzodiazepinen kann gerechtfertigt sein. Drei Placebokontrollierte Studien bewiesen einen diskret überlegenen Einsatz unter dieser Indikationsstellung [Alprazo­ lam - 74; Clonazepam - 55; Broma­ zepam - 239]. Kontrollierte Studien mit Gabapentin [176] und Pregabalin [177] machen einen Versuch mit einem dieser Stim­ mungsstabilisatoren lohnenswert. Für Betablocker (z.B. Atenolol) gibt es nur einige positive Wirkhinwei­ se bei Patienten mit umschriebenen leistungs- oder aufführungsbezoge­ nen sozialen Ängsten, nicht aber bei der generalisierten sozialen Phobie [125]. In einer pragmatischen Perspektive kann empfohlen werden: • 1. Wahl: SSRI (z.B. Paroxetin: 20 – 50 mg/die), Venlafaxin XR (75 – 150 mg/die) • 2. Wahl: Phenelzin (30 – 60 mg/ die) • 3. Wahl: Clonazepam (0.5 – 3 mg/die), Gabapentin (500 – 1000 mg/die), Pregabalin (300-600 mg), Moclobemid (600 mg/die), Olanzapin (2.5 – 5 mg/die) Auch wenn sich die Palette der bis­ her erprobten Substanzen bei der sozialen Phobie in den letzten Jah­ ren ausgeweitet hat und sich eine ge­ wisse Hierarchie ihrer Effektstärken abzeichnet [23, 25, 123, 163], kann nicht übersehen werden, dass eine bedeutsame Subgruppe von Patien­ ten nicht zufrieden stellend anspricht. Diese Rate liegt beispielsweise für die SSRI bei ca. 50 %. Ungünstige Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen Prädiktoren sind vermutlich in ganz analoger Weise wie bei der Panikstö­ rung zu charakterisieren [57, 232]. In einer Orientierung an den Erfah­ rungen bei der Panikstörung scheint eine Kombination von SSRI (Paro­ xetin) und Benzodiazepin (Clonaze­ pam) bei Patienten mit einer gene­ ralisierten sozialen Phobie aber zu keiner rascheren Symptomkontrolle zu führen [208]. Bei mangelnder Therapie-Response oder Therapie-Resistenz bestehen ei­ nige weitere, wenngleich nicht unter kontrollierten Bedingungen validier­ te pharmakologische Optionen. Eine Umstellung von SSRI auf Venlafaxin oder einen irreversiblen MAO-Hem­ mer kann weiterführen [1, 8], eine Augmentation mit Buspiron [233], Tiagabin [109] oder Pindolol [223] Erfolg versprechend sein. Spezifische Phobien Es besteht zurzeit noch die klinische Überzeugung, dass unkomplizierte spezifische Phobien durch psychothe­ rapeutische Verfahren zu behandeln und primär keine psychopharmakolo­ gische Interventionen indiziert seien [49, 81]. Psychotherapie Panikstörung und Agoraphobie In keinem klinischen Feld ist der Pharmakotherapie eine stärkere Konkurrenz durch die Psychothera­ pie erwachsen als in der kognitiven Verhaltenstherapie von Panik- und agoraphobischen Störungen [76]. Die meisten Ansätze beinhalten sowohl kognitive als auch behaviorale Ele­ mente. Kognitive Techniken schei­ nen bei Patienten mit Panikattacken ohne ausgeprägtes agoraphobisches Vermeidungsverhalten überlegen zu sein, eine Exposition ist aber bei deutlicher oder schwerer agoraphobi­ scher Vermeidung das entscheidende Therapieelement [235]. Neben der Herstellung einer offenen, toleranten und verständnisvollen the­ rapeutischen Beziehung beinhaltet ein kognitiv-behavioraler Ansatz zu­ mindest 5 grundlegende Therapie­ komponenten [19]: • Aufklärende Informationen über die Natur einer Panikstörung, speziell des bei einer Attacke ty­ pischen Circulus vitiosus: Patien­ ten lernen anfangs verstehen, dass Paniksymptome harmlos sind, aus physiologischen Veränderungen des natürlichen Furchtsystems re­ sultieren, das zwar phylogenetisch auf eine Flucht vor Gefahren zielt, aber auch durch heftige Emotio­ nen, stressbeladene Situationen sowie durch eine Reihe unspezi­ fischer körperlicher Stimuli wie z.B. übermäßigen Alkohol- oder Koffeinkonsum aktiviert werden kann. Sie werden angehalten, ein objektives Bewusstsein sich selbst gegenüber zu entwickeln, ein Selbst-Monitoring hinsicht­ lich Auslöser, Symptome und si­ tuativem Kontext eines Panikan­ falls zu zeigen. Sie werden dafür sensibilisiert, was sie körperlich spüren, was sie dabei denken und wie sie sich verhalten. • Erwerb von Fertigkeiten zur Symptombewältigung wie Entspan­ nungsübungen und Zwerchfell­ atmung: Günstig sind hier Tech­ niken wie die „progressive Mus­ kelrelaxation nach Jacobson“, die durch ein kurzes An- und Ent­ spannen einzelner Muskelpartien unterschiedliche Spannungszu­ stände wahrzunehmen helfen und allmählich situationsübergreifend eine wirksame Erregungsmodula­ tion vermitteln. Von isolierten Übungen des auto­ genen Trainings ist bei dieser In­ dikation abzuraten, da sie die oh­ nehin übersensibilisierte viszerale Wahrnehmung noch stärker un­ kontrollierbar eskalieren lassen. Etwa 2 Drittel der Panikpatienten berichten über Paniksymptome bei Hyperventilation. Eine Schu­ 55 lung des Atemrhythmus mit dem Ziel, die Frequenz der Atemex­ kursionen zu reduzieren, kann bei einer sich anbahnenden Pa­ nikattacke ein wertvolles Gegen­ regulativ sein, das zu wichtigen Gefühlen der Selbstkontrolle und -effizienz beiträgt. • Eine kognitive Restrukturierung betrifft in der innerseelischen Be­ wertung des Panikerlebnisses v. a. eine Modifikation des dysfunktio­ nalen Denkstils: Panikpatienten neigen dazu, ihre Angstanfälle als unausweichliche, nicht kontrol­ lierbare Katastrophen ihrer kör­ perlichen Integrität zu beurteilen und automatisch mit schwerwie­ genden Erkrankungen wie Herz­ infarkt, Gehirntumor usw. zu as­ soziieren. In der Therapie werden sie systematisch herausgefordert, eben diese Bewertungen zu hin­ terfragen, empirisch-pragmatisch auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, nach Alternativerklä­ rungen zu suchen und verfügbare Hilfestellungen in Anspruch zu nehmen. Entscheidend bei dieser am „Sokratischen Dialog“ orien­ tierten Gesprächsführung ist die Vermittlung der Erkenntnis, dass Überzeugungen nicht notwen­ digerweise deswegen wahr sein müssen, weil sie mit einer hohen persönlichen Plausibilität gedacht werden, dass feste Grundannah­ men über die Bedeutung von Er­ eignissen nicht notwendigerweise durch objektive Fakten gestützt sein müssen. • Eine interozeptive Exposition zielt auf die Löschung der Furcht vor Angstsymptomen in einem schrittweise Sich-Aussetzen eben diesen besonderen körperlichen Sensationen gegenüber: Ein for­ ciertes Atmen oder ein schnel­ les Sich-Drehen um die eigene Körperachse rufen in der Regel eine Reihe von Paniksensationen hervor, denen ein kontrolliertes Zwerchfellatmen und begleitende Kapfhammer kognitive Strategien erfolgreich entgegenwirken können. Eine wiederholte Expositionserfahrung führt zur Erkenntnis, dass die­ se Symptome ungefährlich sind, dass es möglich ist, sich ihnen auch ohne Angstreaktion ausset­ zen zu können. • Eine in-vivo-Exposition strebt eine Reduktion des agorapho­ bischen Vermeidungsverhaltens an: Erstes therapeutisches Ziel bei der Agoraphobie ist es, einem Patienten zu vermitteln, dass die Vermeidung einer Angst auslö­ senden Situation zwar eine gewis­ se Kontrolle des Angsterlebens erlaubt, aber gerade durch die inhärente Erregungsreduktion das Angstverhalten negativ verstärkt und zudem der soziale Spielraum mit seinen positiven Verstärker­ quellen sukzessiv eingeengt wird. Deshalb ist die Methode der Wahl, den Patienten zu motivieren, sich eben mit diesen angsterfüllten Si­ tuationen wieder zu konfrontieren und die erlebte Angst zu meistern. Je nach angestrebter Intensität der Angstreizexposition werden meh­ rere Verfahren unterschieden: – Bei der Reizüberflutung, dem „flooding“, wird der Patient unmittelbar der Situation mit maximaler Angstauslösung ausgesetzt. Er wird angehal­ ten, bei aufsteigender Angst oder Panik den Ort nicht zu verlassen, das Erregungsni­ veau zu tolerieren, bis eine physiologisch bedingte Habi­ tuation eintritt und es schließ­ lich regelhaft zu einem Ver­ siegen der Angstreaktionen kommt. Eine vertrauensvolle Beziehung zum Therapeuten, eine sorgfältige psychoedu­ kative Vorbereitung auf die wahrscheinlichen Abläufe in der Angst auslösenden Situa­ tion sowie eine begleitende kognitive Umstrukturierung in der Beobachtung, die Angst tatsächlich kontrollieren zu 56 können, ohne dass die zuvor befürchteten katastrophalen Konsequenzen eintreten, sind Hauptelemente dieser Thera­ piemethode. – In Abwandlung dieses Angst­ managementtrainings ist auch eine abgestufte Exposition möglich. In einer Hierarchie aufeinander bezogener Angst auslösender Situationsele­ mente nähert sich ein Patient schrittweise dem maximalen Angststimulus an. Hierbei setzt er sich erst dann der nächst höheren Angststufe aus, wenn er sich in der vor­ her aufgesuchten Szene völlig angstfrei und sicher fühlt. Empirische Ergebnisse der kognitivbehavioralen Therapie Strukturiert durchgeführte kognitivbehaviorale Therapien bei Panik­ störungen mit durchschnittlich ca. 15 Sitzungen führen zu einer hohen Erfolgsquote, die bei über 70% liegt [19, 21, 47; Metaanalyse: 79]. Diese Therapiegewinne lassen sich auch noch in einer Kontrolluntersuchung nach 2 Jahren in ca. 80% nachweisen [48]. Ganz ähnliche Resultate liegen für 1-Jahres-Follow-up-Studien vor [21, 133]. Dieser Therapieansatz ist auch Erfolg versprechend bei Pa­ tienten, die von einer supportiven Psychotherapie nicht profitieren [21] oder auf eine pharmakologische Mo­ notherapie nicht ausreichend anspre­ chen [181]. Psychotherapiestudien, die auf mögliche Mechanismen der Vermittlung therapeutischer Effekte einer kognitiven Verhaltenstherapie fokussierten, wiesen der kognitiven Mediation tatsächlich eine zentrale Rolle zu [95]. Körperbezogene Ka­ tastrophenkognitionen zeichnen die Panikstörung zwar differenziell vor anderen Angststörungen aus, und doch ist eher die Intensität von so­ zialen Katastrophenkognitionen wie z.B. soziale Beschämungs- oder De­ mütigungserwartung, die vorrangig eine soziale Phobie charakterisieren, mit einem ungünstigen Behandlungs­ verlauf assoziiert [92, 215]. Unter kognitiver Verhaltenstherapie verän­ dern sich im weiteren Verlauf auch die Abwehr- und Copingstrategien in Richtung höherer Strukturierung [90]. Metaanalytische Studien legen nahe, dass Patienten sich diesem Therapieansatz gegenüber sehr treu verhalten, die Drop-out-Quote im Vergleich zu anderen Behandlungs­ verfahren also relativ niedriger ist und eine Kosten-Nutzen-Kalkulation insgesamt günstiger ausfällt [174]. Unter Versorgungsgesichtspunkten erscheint ferner relevant, dass ko­ gnitive Verhaltenstherapie auch über Internetzugang erfolgreich eingesetzt werden kann [40]. Selbst wenn die in einigen Therapie­ studien eingeschlossenen Patienten sehr homogen in ihren klinischen Variablen waren, und manualisierte Standardverfahren der Kognitiven Verhaltenstherapie vorteilhaft einge­ setzt werden konnten, auch dann wa­ ren Therapeutenmerkmale wie Erfah­ rung oder therapeutische Kompetenz für den Outcome von Relevanz [98]. Eine Expositionstherapie bei Agora­ phobien besitzt ebenfalls eine sehr hohe Effizienz [135]. Fava et al. [64] berichteten über eine Langzeit-Fol­ low-up-Studie an 110 Patienten, die mit einer verhaltenstherapeutischen Expositionsmethode behandelt wor­ den waren. 93 Patienten hatten einen Behandlungszyklus von 12 halbstün­ digen Selbst-Expositionen absolviert. 81 Patienten erzielten eine völlige Remission ihrer panischen und ago­ raphobischen Symptome. 76 blieben auch nach 5 Jahren und 67 nach 7 Jahren noch symptomfrei. Die Be­ handlungsergebnisse mehrerer Stu­ dien sprechen dafür, dass ein direktes „flooding“ gegenüber einer abgestuf­ ten Exposition, diese Verfahren eines „Angstmanagementtrainings“ wie­ derum gegenüber einem „Angstmei­ dungstraining“ z.B. durch systemati­ sche Desensibilisierung als überlegen anzusehen sind. Es muss aber bedacht werden, dass ca. 20–25 der Patienten Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen aus unterschiedlichen Gründen eine Expositionsmethode ablehnen bzw. eine mangelhafte Compliance in den therapeutisch verordneten Hausauf­ gaben zeigen [59]. Es ist unklar, ob eine zusätzliche Kombination einer Exposition in vivo mit einem kogni­ tiven Ansatz zu einem größeren Ge­ samtbenefit führt, wenngleich eine bedeutsame Effektstärke letzterer Wirkkomponente erwiesen ist [230, 234]. Empirische Ergebnisse psychodynamischer Verfahren Viel versprechende Ergebnisse aus offenen Studien eines panikfokussier­ ten psychodynamischen Therapiean­ satzes (PFPP) [37, 38, 110, 148, 149, 152, 153] wurden mittlerweile auch in einer randomisierten und kontrol­ lierten Studie gut bestätigt [150]. Für dieses psychodynamische Vorgehen könnte sich bei Panikpatienten mit koexistenter Persönlichkeitsstörung eine spezielle Indikation ergeben [147]. Im Vorfeld von fast allen un­ tersuchten Panikpatienten waren be­ deutsame psychosoziale Stressoren zu identifizieren, die von einer hohen individuellen Konfliktträchtigkeit und subjektiven Bedeutsamkeit wa­ ren, entgegen der häufig akzeptierten ersten Einschätzung dieser Patienten, die Angstanfälle ereigneten sich völ­ lig unvermittelt und ohne Anlass. Als Kernkonflikt kristallisierte sich sehr häufig ein Zyklus aus bedrohter Bindung, Verlassenheitsangst, Gefüh­ len der Hilflosigkeit und Ohnmacht, ärgerlicher Vorwürflichkeit und furchtsamer Abhängigkeit heraus, der erfolgreich in strukturierten psy­ chodynamischen Kurzinterventionen bearbeitet werden konnte [151]. Ein psychodynamischer Ansatz kann zu einer weiteren Reduktion des Rück­ fallrisikos im Vergleich zu einer me­ dikamentösen Behandlung mit Clo­ mipramin alleine beitragen [244]. Für eine Kombination von verhaltens­ orientierter Exposition und psycho­ dynamischer Einsichtsarbeit plädier­ te bereits S. Freud [70]. Shear et al. [209] legten zu diesem kombinierten Vorgehen erste Daten vor. Hoffmann u. Bassler [94] berichteten über Er­ fahrungen mit einer Manual-gestüt­ zen Fokaltherapie. Auch in anderen Studien gefunde­ ne bedeutsame psychosoziale und interpersonale Problemfelder in der Auslösesituation von Panikattacken könnten ferner eine Indikation für die Interpersonale Psychotherapie anzei­ gen [207]. Erste positive Ergebnisse zum Einsatz einer interpersonalen Psychotherapie liegen aus einer offen durchgeführten Studie vor [128]. Generalisierte Angststörung Der oft fehlende konkrete Situati­ onsbezug bei einer frei flottierenden Grundängstlichkeit macht verständ­ lich, dass ein Behandlungsplan zu­ meist multimodale Elemente vereint. Wichtig ist wiederum eine detaillierte Aufklärung über das Wesen dieser Angststörung, die sich auf den un­ terschiedlichen physiologischen, ko­ gnitiven und Verhaltensebenen in ty­ pischer Weise artikuliert. Ein Angst­ bewältigungstraining setzt vorteilhaft an einer Beeinflussung der musku­ lären Verspannung und der vielfälti­ gen autonomen Überreaktionen an. Entspannungstechniken wie die pro­ gressive Muskelrelaxation, aber auch Biofeedback-Übungen haben hier ihren Stellenwert. Für den Erwerb von günstigeren Bewältigungsstrate­ gien gegenüber den vermeintlich als unkontrollierbar erlebten Umwelter­ eignissen scheint die systematische Modifikation des negativen Gedan­ kenkreisens mit der permanenten Ka­ tastrophenantizipation von grundle­ gender Wichtigkeit zu sein. Ein brei­ tes Spektrum von kognitiven Tech­ niken hat sich hier bewährt [22]. Ein Problemlösungstraining für definierte soziale Herausforderungen, ein sozi­ ales Selbstsicherheitstraining sowie eine sukzessive Wiederaneignung der unterschiedlichen Lebensbereiche sind wichtige weitere Bausteine eines individuellen Therapieplans. Liegen 57 bei einem Patienten zusätzlich um­ schriebene Vermeidungsverhaltens­ weisen vor, so muss sich konsequent eine Expositionsphase im Behand­ lungsablauf anschließen. Empirische Ergebnisse der kognitivbehavioralen Therapie Kontrollierte Therapiestudien zur ge­ neralisierten Angststörung beziehen sich bisher mehrheitlich auf kombi­ nierte kognitiv-behaviorale Ansätze, die in der Regel ein umfassendes Angstbewältigungsprogramm über­ prüften. Metaanalytische Studien dokumentieren eine hohe Effizienz [Evidenz-Level A; 80, 167]. Die ge­ fundenen Therapieeffekte sind er­ mutigend und sprechen ebenfalls für ein mehrjähriges Fortbestehen der erzielten Symptombesserung [39]. Für einen kognitiv-behavioralen An­ satz bei ambulanten Patienten stellte sich in einer randomisiert-kontrollier­ ten Studie eine statistisch gesicherte Überlegenheit im Vergleich zur einer Kontrollgruppe mit regelmäßigen Kontakten ohne spezifische Interven­ tionen dar. Die erzielten Resultate waren auch nach 8 Monaten weiter stabil [127]. Der potentielle Einfluss einer kognitiven Verhaltenstherapie auf die Langzeitentwicklung wurde bisher nur selten untersucht. In ei­ ner Follow-up Untersuchung war ein positiver Effekt auch 8 bis 14 Jahre nach einer kognitiv-behaviora­ len Intervention unter kontrollierten Bedingungen noch gut nachweisbar. Komplexität und Schweregrad der Generalisierten Angststörung trugen aber ebenfalls bedeutsam zum Lang­ zeit-Outcome bei [58]. Im jüngsten Cochrane-Review wurde zwar ins­ gesamt der überzeugende Stellenwert kognitiv-behavioraler Ansätze betont, aber einerseits die empirischen Daten hinsichtlich einer Langzeitperspekti­ ve als noch nicht ausreichend einge­ stuft, andererseits eine differenzielle Bewertung gegenüber anderen Psy­ chotherapieformen als derzeit noch nicht möglich erachtet [97]. Kapfhammer Empirische Ergebnisse psychodynamischer Verfahren Einige nicht systematisch kontrol­ lierte Studien lassen erkennen, dass psychoanalytische Therapieverfahren auch bei Patienten mit Generalisier­ ter Angststörung zufrieden stellende bis gute Ergebnisse erzielen können (Evidenz-Level C), auch wenn die Diagnosestellung noch nicht nach ICD-10 oder DSM-IV erfolgte [23, 50, 51, 119, 201, 202, 224]. Mentzos [145] berichtete mit seinen Mitarbei­ tern über 25 durchgeführte psycho­ analytische Langzeitbehandlungen mit einem modizifiziertem Setting im Sitzen und überwiegend 1–2 The­ rapiestunden in der Woche. Erste Ergebnisse eines Vergleiches von psychoanalytischen Langzeitthera­ pien gegenüber psychodynamischen Kurzzeitinterventionen veröffentlich­ ten Jakobsen und Mitautoren [100]. Soziale Phobie Eine forcierte Konfrontationsstrate­ gie, die sich bei den übrigen Phobien als so erfolgreich erweist, kann in der Behandlung der sozialen Phobie auf mehrere Probleme stoßen: Zum einen sind die sozialen Situationen, die be­ einträchtigende Angstsymptome trig­ gern, höchst variabel und erschweren somit eine rationale Therapieplanung erheblich [154]. Zum anderen gefähr­ den reale Mängel in den sozialen Fer­ tigkeiten eine Erfolg versprechende Exposition in sozialen Situationen mit Leistungscharakter, da sie erneu­ te Misserfolge geradezu vorprogram­ mieren. Hier ist es von grundlegender Bedeutung, zunächst eine Schulung und ein Training in den nötigen „so­ cial skills“ voranzustellen [225]. Als weiteres Hauptelement eines ver­ haltenstherapeutischen Ansatzes aber muss eine systematische Identifikati­ on und Modifikation der die Störung begleitenden negativen automatischen Gedanken und Bewertungsschemata gelten. Dieser dysfunktionale Denk­ stil zeichnet sich in aller Regel durch eine Reihe von logischen Fehlern und kognitiven Verzerrungen aus. 58 In einem am Therapiemodell nach A. Beck orientierten Vorgehen las­ sen sich so charakteristische Beispie­ le einer „dichotomen Denkweise“, die in einer Situationseinschätzung bevorzugt „Alles-oder-Nichts“- Ka­ tegorien demonstriert, eine „Über­ generalisierung“ aufgrund von Ein­ zelbeobachtungen, eine „selektive Abstraktion“, die nur wenige, in der Regel die ungünstigen Aspekte einer Szene aufgreift, ohne den Gesamt­ kontext zu würdigen, „Selbstentwer­ tungen“ bei positiven Erfolgen usw. erfassen. Kognitiv-verhaltensthera­ peutische Verfahren werden durch eine systematische Beachtung der bei sozialphobischen Patienten typischen Merkmale der affektiven und kogniti­ ven Informationsprozessierung profi­ tieren [46]. In einer pragmatisch-em­ pirischen Grundeinstellung werden diese typischen Fehlinterpretationen überprüft und modifiziert. Erst dann schließt sich ein Expositionstraining in definierten sozialen Situationen an [242]. Neben einer Individualthera­ pie kommen bei dieser Indikations­ stellung auch gruppentherapeutische Settings zum Einsatz. Empirische Ergebnisse der kognitiven Verhaltenstherapie Zur verhaltenstherapeutischen Be­ handlung der sozialen Phobie liegen mehrere kontrollierte Therapiestudi­ en vor [62]. Metaanalysen bestätigen eine Wirksamkeit auf einem EvidenzLevel A. Ein kognitiv-behavioraler Ansatz ist einer pharmakologischen Behandlung ebenbürtig [78]. Meta­ analytisch führt sowohl ein Expo­ sitionstraining alleine als auch ein breiteres kognitiv-behaviorales Ver­ fahren zu vergleichbaren Effekten [67]. In einer rezenten randomisiertkontrollierten Studie war ein neu entwickeltes kognitives Verfahren gegenüber einem Expositionstraining und Entspannung sogar überlegen [44]. Vor allem aus der Behandlung von Patienten mit schweren sozialen Ängsten resultiert die Empfehlung, einem Expositionstraining in defi­ nierten sozialen Situationen zuerst eine systematische Identifikation und Modifikation begleitender negativer automatischer Gedanken und Be­ wertungsschemata vorauszuschalten [137; Metaanalyse: 227]. Die Er­ gebnisse eines solchen kombinierten Vorgehens scheinen recht günstig zu sein und über einen mehrjährigen Zeitraum auch stabil anzuhalten [65, 231]. Gegenüber einer intensiven kognitiven Verhaltenstherapie in der Gruppe sowie einer üblichen psych­ iatrischen Behandlungsform (mittels SSRI) erwies sich eine individuelle KVT als überlegen [160]. Wenn die therapeutische Beziehung von sozial phobischen Patienten subjektiv als sehr tragfähig eingestuft wird, dann setzen sie sich in den Einzelsitzun­ gen auch bereitwilliger verunsichern­ den Expositionen aus und profitieren von diesen Übungen stärker [86]. Die bekannten Hemmungen dieser Patientengruppe, sich überhaupt in eine fachspezifische Behandlung zu begeben, könnten durch eine nieder­ schwellige Zugangsmöglichkeit zu kognitiv strukturierten Behandlungs­ formen über Internet abgemildert werden, wie eine randomisierte und kontrollierte Studie belegte [41]. Empirische Ergebnisse psychodynamischer Verfahren Zerbe [245], Marshall [136] und Al­ nas [7] publizierten über psychodyna­ mische Ansätze bei sozialphobischen Patienten in Einzelfallstudien. Eine Beurteilung der empirischen Erfolgs­ aussichten eines solchen Vorgehens ist derzeit noch nicht möglich, auch wenn erste vorliegende Daten für eine durchaus mit anderen etablierten Psychotherapieverfahren vergleich­ bare Wirksamkeit sprechen [30, 118]. Leichsenring et al. [117] haben eine auf psychodynamischen Prinzipien beruhende Behandlung in manuali­ sierter Form entwickelt, die derzeit in einer randomisierten und kontrollier­ ten Multicenter-Studie erprobt wird. Spezifische Phobien Spezifische Phobien sind die Do­ mäne der verhaltenstherapeutischen Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen 59 Expositionsverfahren, wie sie für die Agoraphobie beschrieben worden sind. Der systematischen Desensibili­ sierung kommt nur gelegentlich noch eine Bedeutung zu. lem bei der Flug- und der Höhenangst als aussichtsreich beurteilt, kognitive Ansätze hingegen bei der Klaustro­ phobie und bei der Blut- bzw. Verlet­ zungsphobie favorisiert [43]. legtes Vorgehen, dann lassen sich speziell in üblichen Versorgungskon­ texten gute Gründe für eine Kombi­ nationsbehandlung bei Angststörun­ gen finden [56, 63, 83, 114, 187]. Die klassische Form der systemati­ schen Desensibilisierung beinhaltet eine graduierte Stimulusexposition und kann entweder in der Vorstel­ lung oder in vivo vollzogen werden. Wesentlich ist, dass der Patient zuvor gelernt hat, sich in einen völlig ent­ spannten Zustand zu versetzen. Man spricht deshalb von einem „Angst­ meidungstraining“. Diese Entspan­ nungsübung wird regelhaft in der hierarchischen Annäherung an den spezifischen Angststimulus einge­ setzt, um über eine „reziproke Hem­ mung“ wieder in einen ausgegliche­ nen physiologischen Erregungszu­ stand zu gelangen. Erst dann wird der nächste Schritt in Richtung auf eine volle Exposition gegenüber dem pho­ bischen Objekt gewagt. In einer heuti­ gen Einschätzung ist die entscheiden­ de Wirkkomponente aber nicht mehr in einer durch Entspannungselemente bewirkten „reziproken Hemmung“ zu erblicken, sondern in der Habituation, die sich natürlicherweise nach einer ausreichend langen Konfrontation mit dem phobischen Objekt einstellt. Empirische Ergebnisse psychodynamischer Verfahren Es liegen bisher nur vereinzelte ka­ suistische Fallstudien zur psychody­ namisch orientierten Behandlung von spezifischen Phobien vor [146, 194]. Eine Beurteilung der empirischen Er­ folgsaussichten eines solchen Vorge­ hens ist derzeit nicht möglich. Panikstörung und Agoraphobie Eine Metaanalyse bei der Panik­ störung fand nur wenige Belege für Vorteile einer Kombination von Phar­ mako- und Psychotherapie [155]. In einem neueren systematischen Re­ view, der nach Akutbehandlung und Langzeitperspektive unterschied, zeigten sich Vorteile einer Kombi­ nationsbehandlung gegenüber Phar­ mako- und Psychotherapie je alleine für die Akutphase. Diese Vorteile ei­ nes kombinierten Vorgehens waren in der Langzeitbehandlung gegenüber einer Pharmakomonotherapie, nicht aber gegenüber einer Psychotherapie alleine nachzuweisen [71, 164]. Empirische Ergebnisse der Exposi­ tionsverfahren Systematische Reviews über 21 bzw. 25 kontrollierte Studien [170, 171] sowie auch eine Metaanalyse [203] belegen, dass Expositionsverfahren eine hoch signifikant überlegene Ef­ fizienz gegenüber einer Wartegruppe aufweisen (Evidenz-Level A). Zu­ mindest bei unkomplizierten spezi­ fischen Phobien kann mit wenigen Therapiestunden eine bedeutsame Symptomverbesserung bei ca. 90% der Patienten erzielt werden. In einem systematischen Review jüngst wurde diese Einschätzung hinsichtlich der meisten Phobien geteilt, aber auch auf bedeutsame Drop-Out-Quoten hinge­ wiesen. Ein Expositions-Training in der virtuellen Realität wurde vor al­ Kombinationsbehandlung In einem Vergleich von Psychothe­ rapie und Pharmakotherapie wer­ den bei den Angststörungen für die psychotherapeutischen Ansätze sehr häufig höhere Effektstärken gefunden [200]. Nicht selten ist hierbei aber die Qualität des medikamentösen Thera­ piearms in den Untersuchungen zu kritisieren. Hinzu kommt, dass in den Studiensamples mehrheitlich Patien­ ten eingeschlossen wurden, die ohne psychiatrische Komorbidität wa­ ren und ein eher nur geringgradiges agoraphobisches Verhalten zeigten. Gegenüber früheren Einschätzungen relativierten jüngere, komplexe me­ taanalytische Untersuchungen aber die erzielten Effekte bedeutsam. Vor allem im Hinblick auf eine in den Psychotherapiestudien übliche Aus­ wahl von Patienten ohne begleitende psychiatrische Komorbiditäten soll­ ten die berichteten Effizienzgrade nicht überschätzt werden und auch nicht so ohne weiteres auf durch­ schnittliche Versorgungsbedingungen extrapoliert werden [159, 243]. Berücksichtigt man höhere klinische Schweregrade, eine mehrheitlich as­ soziierte psychiatrische Komorbidi­ tät, langfristige Rezidivquoten, nicht selten begrenzte Therapieerfolge je eines Ansatzes, u. U. ein nicht simul­ tanes, sondern ein sequentiell ange­ In den Vergleichsstudien waren pharmakotherapeutisch einerseits Benzodiazepine, andererseits Anti­ depressiva (v. a. Imipramin) einge­ setzt worden. Bezüglich einer Ben­ zodiazepingabe zusätzlich zu einem Expositionsverfahren äußerten einige Autoren Bedenken, dass unter dieser Kombination der therapeutisch indu­ zierte Lernprozess weniger wirksam sei. Diese Einschätzung wird nicht von allen Experten geteilt, aber in je­ dem Fall eine notwendige Abwägung von kurzfristig erzielten Effekten ge­ genüber langfristig möglichen Proble­ men gefordert [241]. Auf Grund der vorliegenden Studienergebnisse gibt es wiederum keinen Hinweis, dass eine psychologische Exposition oder Verfahren der kognitiven Verhaltens­ therapie durch eine antidepressive Medikation negativ beeinflusst wer­ den könnten [172, 229]. Wegen ihres nach wie vor breiten Ein­ satzes unter dieser Indikationsstellung sind auch eventuelle Kombinationsbzw. Interaktionseffekte von Benzodiazepinen und Expositionstherapie zu diskutieren. Marks et al. [135] konn­ ten zu dieser Fragestellung einerseits Kapfhammer eine klare Überlegenheit der Kom­ bination von Alprazolam und Expo­ sition gegenüber Alprazolam alleine nachweisen. Andererseits zeigte der Vergleich der Kombinationsgruppe gegenüber der Gruppe mit Exposition alleine keinerlei statistisch oder kli­ nisch relevante Unterschiede, obwohl unter der Kombination die therapeu­ tischen Effekte früher auftraten. In der Langzeitperspektive musste aber ein differentielles Entwicklungs­ muster festgehalten werden. Wäh­ rend die Therapieeffekte nach einer Expositionsmonobehandlung stabil blieben, kam es in der Kombinati­ onsgruppe nach Absetzen von Al­ prazolam doch zu einem deutlichen Wiederaufflammen des phobischen Ver­meidungsverhaltens. Betrachtet man die durchaus günstigen Kombi­ nationseffekte in der Akutinterventi­ on, so sollte man bei einer individu­ ellen Entscheidung für den zusätzli­ chen Einsatz eines Benzodiazepins pragmatisch dafür sorgen, dass dieses möglichst noch während des aktiven Expositionstrainings wieder ausge­ schlichen wird [238]. Reduziert auf die Frage, ob Imipramin die therapeutischen Effekte einer Exposition erhöhe, kamen nur Marks et al. [134] zu einem negativen Resul­ tat. Vier andere kontrollierte Studien [139, 228, 246, 247] sprachen hinge­ gen für klare Vorteile im Sinne einer günstigeren klinischen Gesamtbesse­ rung mit einer Generalisierung des antiphobischen Effekts auch auf die Dimensionen von Panik und antizi­ patorischer Angst in der Akutbehand­ lung. Voraussetzung für den Nach­ weis eines positiven Kombinations­ effektes war aber eine ausreichende Imipramindosis (150–200 mg/Tag). Die umgekehrte Frage, ob eine Exposition die therapeutischen Effekte von Imipramin erhöhe, ließ sich da­ hingehend beantworten, dass Imi­ pramin ohne spezifische Instruktio­ nen für oder gegen Exposition zwar therapeutische Effekte zeige, durch 60 eine Kombination mit systematischer Exposition die Wirkung aber deutlich gesteigert werden könne. Umgekehrt schien eine explizite Anweisung, sich in keiner Weise den sozialen Situatio­ nen mit Angstauslösung zu stellen, den antipanischen und antiphobi­ schen Effekt von Imipramin erheb­ lich zu mindern [138, 228]. Zusammenfassend kann für die Akut­ behandlung ein gut gesicherter Po­ tenenzierungseffekt von Imipramin und Exposition auf die Extinktion des phobischen Vermeidungsverhaltens behauptet werden. Hinsichtlich ei­ nes antipanischen Effektes entfalten beide Therapiemodalitäten je für sich bereits gute Wirkungen, die in einer Kombination aber nicht durchgängig gesteigert werden können [142]. Von großer klinischer Bedeutsam­ keit ist, dass sich die in der Akut­ phase erzielten Kombinationseffekte auch nach 2 Jahren noch stabil hal­ ten [140]. Sie vermitteln einen guten Schutz gegenüber dem hohen Rezi­ divrisiko, das nach Absetzen einer Imipraminmonotherapie droht [141]. Es ist zu beachten, dass ca. 20% der Patienten aber auch von einer Kom­ binationstherapie letztlich nicht ent­ scheidend profitieren. Das Vorliegen einer zusätzlichen Persönlichkeitsstö­ rung erweist sich als ein ungünstiger Prädiktor für die Therapieresponse [143]. Gerade bei diesen Patienten mit unzureichendem Ansprechen auf eine pharmakologische Mono­ therapie oder einfache Kombination von Antidepressiva und Exposition sind einerseits differenzierte psycho­ pharmakotherapeutische Strategien gerechtfertigt, besitzen andererseits zusätzliche Kombinationen mit ko­ gnitiven Verfahren sowie traditionel­ le psychodynamische Ansätze ihren wichtigen Stellenwert [142]. Unter einem etwas veränderten kli­ nischen Blickwinkel kann sich eine andere Indikation für eine Kombination von Pharmakotherapie und Psychotherapie stellen, die nicht simul­ tan, sondern sequentiell durchgeführt wird. Bruce et al. [36] konnten zei­ gen, dass Patienten, die zuvor lang­ fristig Benzodiazepine erhalten hat­ ten, eine signifikant höhere Chance hatten, mittels kognitiv-behavioraler Techniken einen Benzodiazepinent­ zug erfolgreich zu absolvieren und auch noch nach 6 Monaten abstinent zu bleiben. Zudem erzielten sie über dieses psychotherapeutische Zusatz­ verfahren einen günstigeren Schutz vor einem Rezidiv der Angststörung. Patienten mit Panikstörung, die auf eine kognitive Verhaltenstherapie nicht oder nur sehr unzureichend an­ gesprochen haben, können von der anschließenden Gabe eines SSRI noch gut profitieren, wie eine ran­ domisierte Studie für Paroxetin ge­ genüber Placebo nachweisen konnte [101]. Umgekehrt können Patienten, die unter Pharmakotherapie thera­ pieresistent waren, in einem hohen Prozentsatz mit einer anschließenden KVT noch entscheidende Symptom­ verbesserungen erzielen [91]. Wiederum deutet sich eine andere Kombinationsindikation an, wenn eine zusätzliche KVT bei einer antidepres­ siven Medikation (z.B. Imipramin) die Rate von beklagten Nebenwirkungen deutlich reduzieren kann [132]. Generalisierte Angststörung Für die Generalisierte Angststörung sind kombinierte Therapieansätze eher die Regel als die Ausnahme. Dies ist aber nicht Ausdruck eines durch empirische Daten schon gut gestütz­ ten Behandlungsrationale. Vielmehr spiegeln sich hierin die häufigen Schwierigkeiten im therapeutischen Vorgehen bei dieser Patientengruppe wider [114]. Die wenigen kontrollier­ ten Untersuchungen gestatten bisher keine eindeutige Schlussfolgerung für eine klinische Handlungsanwei­ sung [20]. Eine der durchgeführ­ ten Studien betraf einen Vergleich von kognitiver Verhaltenstherapie (KVT), Diazepam, Plazebo und KVT und Diazepam in einer 10wöchigen Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen Akutphase [185]. Sowohl im unmit­ telbaren Vorher-Nachher-Vergleich als auch zum Follow-up-Termin nach 6 Monaten erwiesen sich die beiden Therapiearme mit KVT alleine oder in Kombination mit Diazepam als über­ legen. Diazepam war im Vergleich zu Plazebo nicht wirksamer, was mög­ licherweise mit der zu niedrigen und fixen Dosierung von Diazepam zu er­ klären war. Die Autoren diskutierten, dass eventuelle additive Effekte unter einer Diazepamkombinationstherapie durch eine flexiblere symptomorien­ tierte Dosierung erzielbar gewesen wären. Bond et al. (31) fanden einen nur geringen Zusatzbenefit für Pa­ tienten, die neben einer kognitiven Verhaltenstherapie im Vergleich zu Placebo auch eine Buspiron-Medi­ kation erhielten. Ein sehr kleines Sample von Studien-Patienten sowie eine relativ hohe Drop-out Quote schränkten Schlussfolgerungen aber stark ein. In einer randomisierten und kontrollierten Studie erwies sich ein telefon-gestütztes, supportives Ma­ nagement, das kollaborativ zu einer medikamentösen Therapie durch den Hausarzt angeboten wurde, einer Pharmakomonotherapie als überle­ gen [197]. KVT kann hoch wirksam den Prozess eines sukzessiven Ben­ zodiazepinentzugs unterstützen [77]. Soziale Phobie Auch bei der sozialen Phobie spre­ chen zunächst klinische Aspekte für den möglichen Nutzen einer Kom­ binationsbehandlung, berücksichtigt man die häufig unzulänglichen The­ rapieeffekte beispielsweise unter VT alleine (Drop-out-Rate bis zu 30%), ein ungenügendes Ansprechen auf in dieser Indikationsstellung erprob­ te Medikamente wie z.B. Moclobe­ mid (mangelhafte Therapieresponse bis zu 50%) sowie eine ausgeprägte psychiatrische Komorbidität. Die vorliegenden Informationen aus kon­ trollierten empirischen Studien erlau­ ben derzeit erst orientierende Richt­ linien für ein kombiniertes Vorgehen [23, 196]. Mehrere kontrollierte Stu­ dien [45, 52, 69, 112] wie auch eine naturalistische Studie mit einer der KVT vorgeschalteten antidepressiven Therapie [195] zeigten, dass Pharma­ komonotherapie (Fluoxetin), kogni­ tive Verhaltenstherapie alleine und Kombinationsbehandlung jeweils der Plazebobedingung signifikant über­ legen waren, aber sich kaum eine Überlegenheit der Kombinations­ therapie gegenüber den beiden Mo­ notherapien darstellte bzw. eine vor­ ausgehende antidepressive Behand­ lung eine nachfolgende KVT in ihrer Wirksamkeit nicht beeinflusste. Zu einem recht vergleichbaren Ergebnis war auch eine andere kontrollierte, aber nicht verblindete Studie gekom­ men, bei der Sertralin pharmakothe­ rapeutisch eingesetzt wurde [29, 85]. Eine analog konzipierte Studie mit Phenelzin, das im Vergleich etwa zu Fluoxetin oder Sertralin einen be­ deutsamen Effekt bei der sozialen Phobie aufweist, zeichnete sich eine Überlegenheit der Kombinations­ therapie ab [89]. In einer weiteren kontrollierten Studie wurden über 6 Monate drei Therapiearme (suppor­ tive Führung + Moclobemid; kogni­ tiv-behaviorale Gruppentherapie + Placebo; kognitiv-behaviorale Grup­ pentherapie + Moclobemid) mitein­ ander verglichen und ein Follow-up nach 2 Jahren angeschlossen [186]. Die Kombinationstherapie führte ins­ gesamt zur raschesten Symptomre­ duktion. Moclobemid alleine erwies sich nach 3 Monaten überlegen in der Besserung der allgemeinen subjekti­ ven Angstsymptomatik, zeigte aber nur einen bescheidenen Einfluss auf das Vermeidungsverhalten. Für den kognitiv-behavioralen Ansatz stell­ ten sich die Wirkungen genau umge­ kehrt dar. Nach 6 Monaten zeichnete sich die kognitive Verhaltenstherapie durch die besten Ergebnisse aus, die Kombinationstherapie erzielte keinen zusätzlichen Benefit. In einem Ver­ gleich der Rückfallquoten schnitten jene Patienten, die entweder alleine oder in Kombination kognitive Ver­ haltenstherapie erhalten hatten, ge­ genüber einer Moclobemidmonothe­ rapie signifikant günstiger dar. 61 Spezifische Phobien Trotz einiger kontrollierter Studien mit älteren Psychopharmaka besteht Einigkeit darin, dass spezifische Phobien primär nicht pharmakothe­ rapeutisch behandelt werden sollten. Ausnahmen bestehen bei einer se­ kundär sich entwickelnden Kompli­ kation wie einer anderen Angst- oder depressiven Störung. Lediglich bei massiven panikartigen Ängsten in der Konfrontation mit einem phobischen Objekt kann der Einsatz eines Ben­ zodiazepins gerechtfertigt sein. Er muss aber zu einem verhaltensthera­ peutisch orientierten Expositionsver­ fahren führen, das in aller Regel eine hohe Erfolgsaussicht verspricht. Die zusätzliche Gabe eines Benzodiaze­ pins beeinflusst das Ergebnis einer akuten Exposition vermutlich nicht signifikant, muss aber hinsichtlich langfristiger Konsequenzen ähnlich eingeschätzt werden wie bei der Ago­ raphobie [81]. Künftig könnte es eine gewisse Ver­ sorgungsrelevanz erlangen, wenn der mit psychologischen Techniken z.B. mittels Exposition in Gang gebrach­ te Löschungsprozess von patholo­ gischen Ängsten durch glutamaterg wirksame Medikamente wie z.B. D-Cycloserin signifikant gefördert werden kann [116, 173]. Derzeit lie­ gen erste Erfahrungen aus kleineren empirischen Studien vor mit zum Teil ermutigenden [Höhenangst – 188; soziale Phobie – 96], zum Teil wenig überzeugenden Ergebnissen [Spin­ nenphobie – 82]. Der Prozess der emotionalen Gedächt­ nisbildung, aber auch des Wiedererin­ nerns von emotionalen Inhalten, wie er grundlegend bei pathologischen Ängsten ist, wird von zahlreichen Neurotransmittern, aber auch von Glukokortikoiden gesteuert [198]. Er­ ste Ergebnisse bei der Spinnenphobie und der sozialen Phobie zeigten, dass der Einsatz von niedrig dosiertem Kortison (10 mg/die, 25 mg/die) zu einer deutlichen Reduk­tion der unter Exposition provozierten Ängste füh­ Kapfhammer ren und so ein therapeutisches Neu­ lernen fördern kann [214]. Pharmakotherapie – pragmatische Perspektive Generell muss für die Pharmakothe­ rapie der Angststörungen festgestellt werden, dass ein hohes Rezidivrisi­ ko nach Absetzen der Medikamente droht, wenn Pharmaka zuvor aus­ schließlich monotherapeutisch ver­ abreicht worden sind. Selbstverständ­ lich sind Probleme der Nebenwir­ kungsunverträglichkeit gegenüber bestimmten Substanzklassen von Anti­depressiva und die hiermit as­ soziierten Schwierigkeiten von NonCompliance bzw. Therapieabbruch zu bedenken. Hinsichtlich eines Ben­ zodiazepinlangzeitgebrauchs müssen zusätzliche Risiken und Komplika­ tionen wie z.B. Missbrauchs- und Abhängigkeitsproblematik reflektiert werden. Wiederum nicht zu über­ sehen ist, dass immerhin 30–45% der Patienten mit unterschiedlichen Angststörungen in empirischen Studi­ en auch eine gute Plazebo-Response zeigen. Hierbei ist zu beachten, dass bei fast allen durchgeführten psy­ chopharmakologischen Studien auch wichtige supportive Elemente einer ärztlichen Führung einschließlich der ermunternden Instruktion, sich den Angst auslösenden Situationen aktiv auszusetzen, also Aspekte eines Ex­ positionstrainings mit enthalten sind. Diese meist unkontrollierten Effekte verweisen per se in Ansätzen schon auf ein kombiniertes Behandlungs­ vorgehen. Psychotherapie – pragmatische Perspektive Wo auch immer möglich, sollten Patienten zu einer differenzierten störungsorientierten Psychotherapie motiviert werden. Psychotherapeu­ tischen Verfahren ist wahrscheinlich 62 kann den Therapeuten leicht vor einer emotional intensiveren Be­ ziehung zurückschrecken lassen. Um sich zu entlasten, entschließt er sich vielleicht zu einer vor­ schnellen medikamentösen Inter­ vention, die kontraproduktiv sein kann. Eine abwehrbestimmte Idea­ lisierung des Therapeuten durch den Patienten impliziert auch eine Zuschreibung jeglicher Ver­ antwortung in Fragen wichtiger Entscheidungen wie z.B. dem An­ setzen von Medikamenten. Diese Idealisierung mag der Therapeut bereitwillig aufgreifen. Eine di­ rektive Grundhaltung bewahrt ihn davor, sich mit einer möglichen Enttäuschungswut des Patienten zu konfrontieren. Vordergründig verschaffen Medikamente einem Patienten eine rasche Abhilfe für seine Bedürftigkeit, bestärken aber gerade darin seine Abhän­ gigkeit von ambivalent erlebten Objekten. Medikamente nehmen Bedeutungen der unbewussten therapeutischen Beziehung an. eine Vorrangstellung einzuräumen, wenn die vorliegenden Angststörun­ gen einen leichten bis mittleren Stö­ rungsgrad aufweisen. Aber auch bei dieser Ausgangssituation ist das ty­ pische Krankheitsverständnis und die subjektive Therapieerwartung eines Patienten zu berücksichtigen. Hohe Schweregrade, psychiatrische Ko­ morbidität und chronischer Krank­ heitsverlauf unterstreichen die unver­ zichtbare Rolle einer differenziellen Psychopharmakotherapie. Auch in diesen Fällen sollte, wo möglich, eine Kombination mit psychotherapeuti­ schen Verfahren angestrebt werden. Werden Psychopharmaka in Psycho­ therapien von Angstpatienten einge­ führt, so können im Therapieprozess wichtige Übertragungs- und Gegen­ übertragungsmuster angestoßen wer­ den. Sie lassen sich psychodynamisch konstruktiv aufnehmen, führt man sich vor Augen, dass bei Angstpati­ enten oft dependente Persönlichkeits­ züge einerseits, ängstlich-vermeiden­ de Persönlichkeitszüge andererseits vorherrschen können [102]: • Für Patienten mit einer stark dependenten Persönlichkeit ist an­ klammerndes und unterwürfiges Verhalten einem Therapeuten ge­ genüber typisch. Um tiefe Ängste vor Trennung und Alleinsein zu kontrollieren, signalisieren sie eine verstärkte Hilfsbedürftigkeit. Das prinzipielle therapeutische Dilemma bei ihnen besteht darin, dass sie zur Überwindung ihrer Unselbständigkeit und Asthenie sich zuvor in eine therapeutische Abhängigkeit begeben müssen, gerade darin aber oft ein Thera­ pieziel an sich erblicken. Zyklen von Übertragungs- und Gegenübertragungsmustern im Laufe einer Behandlung müssen erkannt und speziell auch bei ei­ nem psychopharmakologischen Ansatz reflektiert werden. Die drängende Suche des dependenten Patienten nach Hilfe und Führung besonders zu Behandlungsbeginn Sie können die Funktion eines „Übergangsobjekts“ zur Abwehr eines schwer erträglichen Allein­ seins ausüben und mit einem idio­ synkratischen, zuweilen selbstge­ fährdenden Einnahmeverhalten einhergehen. Da die Beziehung zum Therapeuten nur schwer auf­ gegeben werden kann, darf der Patient aber auch keine entschei­ denden Behandlungsfortschritte erzielen. Diese „negative thera­ peutische Reaktion“ drückt sich oft in einer unfruchtbaren Dis­ kussion um erwartbare, aber dann doch nie eintretende Medikamen­ teneffekte und um stets wieder­ kehrende Unverträglichkeitsreak­ tionen unter den verschiedensten Pharmaka aus. Umgekehrt kann ein Patient evtl. schwerwiegende Nebenwirkungen vor sich ver­ leugnen oder dem Arzt gegenüber verschweigen, da er mit ihrer Mit­ teilung eine Gefährdung der Be­ ziehung verbindet. Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen Es ist also bei einem Patienten mit einer dependenten Persön­ lichkeitsstörung entscheidend, die Indikation für Medikamen­ te sehr sorgfältig zu begründen, sich hierbei das angesprochene therapeutische Dilemma immer wieder bewusst zu machen und mit einer Pharmakotherapie asso­ ziierte Übertragungswiderstände zu reflektieren. Als therapeutische Grundregel muss wohl gelten, dass die vordergründig geäußer­ ten Wünsche eines Patienten nach rascher Abhilfe für psychopatho­ logische Symptome selten seine eigentlichen Bedürfnisse ausdrüc­ ken. Die Gabe von Medikamenten kann deshalb immer auch zu einer unbewussten Aktivierung frühe­ rer schädlicher Beziehungsmuster beitragen. • Bei Patienten mit einer vorwie­ gend ängstlich-vermeidenden Persön­lichkeit muss einerseits die besondere Vulnerabilität für eine beschämende Bloßstellung, die oft der sozialen Ängstlichkeit zugrunde liegt, andererseits eine generalisierte katastrophisierende Einstellung gegenüber unvorher­ gesehenen Veränderungen oder neuen Herausforderungen der Umwelt beachtet werden. Die Anfälligkeit für Beschämung und Kritik mag es beispielsweise ei­ nem Patienten unmöglich machen, sich in seiner Hilfsbedürftigkeit und Schwäche mitzuteilen. Statt­ dessen aber missversteht er den wohlmeinenden Rat des Arztes zu einer medikamentösen Stützung als Kränkung und Zurückweisung und wertet die mit einem Pharma­ kon verknüpften Nebenwirkungen als Beleg für diese interpersonale Demütigung. Und in eben diesen inneren Erlebnissen kann er sich dem Therapeuten gegenüber nur schwer öffnen, so dass die Gefahr eines abrupten Behandlungsab­ bruchs droht. Das ausgeprägte Bedürfnis nach Sicherheit und die z. T. extreme Sensibilität gegenüber Abwei­ chungen von eingeengten Erwar­ tungen können v. a. zu einer heik­ len Verarbeitung von möglichen Nebenwirkungen einer psycho­ pharmakologischen Medikation führen. Die prinzipielle Tendenz des Patienten zu einer katastro­ phisierenden Bewertung macht es dem Arzt wiederum oft unmög­ lich, in dessen Beschwerden zwi­ schen harmlosen und gefährlichen Effekten zu unterscheiden. Nicht selten wehrt er die in den Klagen des Patienten implizite Infrage­ stellung seiner psychopharma­ kologischen Kompetenz dadurch ab, dass er eine Übertreibung und Schwächlichkeit des Patienten thematisiert, ihn dadurch kränkt und wiederum einem Circulus vitiosus von Beschämung und Rückzug aussetzt. Gelingt es hin­ gegen Patienten und Therapeuten in einem gefestigten Arbeitsbünd­ nis diese psychodynamischen As­ pekte zu integrieren, dann können psychopharmakologische Inter­ ventionen oft zu erstaunlichen Therapiefortschritten beitragen. Patienten tolerieren nun erstmals ein Expositionsverhalten, das ih­ nen ein vielschichtiges soziales Lernen eröffnet und lange Zeit brach gelegene Talente endlich positiv erproben lässt. 63 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] Literatur [1] [2] [3] Aarre T.F.: Phenelzine efficacy in re­ fractory social anxiety disorder: A case series. Nord J Psychiatry 57: 313-315 (2003). Allgulander C., Bandelow B., Holland­ er E. et al.: WCA recommendations for the long-term treatment of generalized anxiety disorder. CNS Spectrums 8 (suppl 1): 53-61 (2003). Allgulander C., Dahl A.A., Austin C. et al.: Efficacy of sertraline in a 12-week trial for generalized anxiety disorder. Am J Psychiatry 161: 16421649 (2004). [14] [15] [16] Allgulander C., Hackett D., Salinas E.: Venlafaxine extended release (ER) in the treatment of generalized anxiety disorder: Twenty-four-week placebocontrolled dose-ranging study. Br J Psychiatry 179: 15-22 (2001). Allgulander C., Mangano R., Zhang J., et al.: Efficacy of venlafaxine ER in patients with social anxiety disorder: A double-blind placebo-controlled, parallel-group comparison with parox­ etine. Hum Psychopharmacol 19: 387396 (2004). Allgulander C.: Paroxetine in social anxiety disorder: A randomized pla­ cebo-controlled study. Acta Psychiatr Scand 100:193-198 (1999). Alnas R.: Social phobia: Research and clinical practice. Nord J Psychiatry 55:419–425 (2001). Altamura AC, Pioli R, Vitto M, Mannu P (1999) Venlafaxine in social phobia: A study in selective serotonin reuptake inhibitor non-responders. Int Clin Psy­ chopharmacol 14: 239-245 Asakura S., Tajima O., Koyama T.: Fluvoxamine treatment of general­ ized social anxiety disorder in Japan: a randomized double-blind, placebocontrolled study. Int J Neuropsychop­ harmacol 10, 263-274 (2007). Bakker A., van Balkom A.J., Spinhov­ en P.: SSRIs vs. TCSs in the treatment of panic disorder: A meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 106: 163-167 (2002). Baldwin D., Bobes J., Stein D.J. et al.: Paroxetine in social phobia/social anxiety disorder. Randomised, doubleblind, placebo-controlled study. Par­ oxetine Study Group. Br J Psychiatry 175:120-126 (1999). Baldwin D.S., Andersen I.M., Nutt D.J., et al. Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders: Recommendations from the British Association for Psy­ chopharmacology. J Psychopharma­ cology 19: 587-596 (2005). Baldwin D.S., Huusom A.K., Maeh­ lum E.: Escitalopram and paroxetine in the treatment of generalised anxiety disorder: randomised, placebo-control­ led, double-blind study. Br J Psychiatry 189, 264-272 (2006). Baldwin D.S., Polkinghorn C.: Evi­ dence-based pharmacotherapy of gen­ eralized anxiety disorder. Int J Neu­ ropsychopharmacol 8:293-302 (2005). Ballenger J.C.: Overview of different pharmacotherapies for attaining remis­ sion in generalized anxiety disorder. J Clin Psychiatry 62 (suppl. 19): 11-19 (2001). Bandelow B., Rüther E.: Treatmentresistant panic disorder. CNS Spectr 9:725-739 (2004). Kapfhammer [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] Bandelow B., Wededind D., Leon T.: Pregabalin for the treatment of gener­ alized anxiety disorder: a novel phar­ macologic intervention. Expert Rev Neurother 7, 769-781 (2007). Bandelow B., Zohar J., Hollender E. et al.: World Federation of Societies of Biological Psychiatry [WFSBP] Guide­ lines of the pharmacological treatment of anxiety, obsessive-compulsive and posttraumatic stress disorders. World J Biol Psychiatry 3: 171-199 (2002). Barlow D.H., Craske M.G., Cerny J.A., Klosko J.S.: Behavioral treat­ ment of panic disorder. Behav Ther 20:261–282 (1989) Beaudry P.: Generalized anxiety disor­ der. In: Beitman B.D., Klerman G.L. (eds.) Integrating pharmacotherapy and psychotherapy. American Psychi­ atric Press, Washington/DC, London, pp 211–230 (1991). Beck A.T., Sokol L., Clark D., Berchik R., Wright F.A.: crossover study of fo­ cused cognitive therapy for panic dis­ order. Am J Psychiatry 149:778–783 (1992). Becker E.S., Margraf J.: Kognitive Therapie von Angsterkrankungen. In: Kasper S, Möller HJ (Hrsg) Angst- und Panikerkrankungen. Schattauer, Jena Stuttgart, S 412–431 (1995). Belzer K.D., McKee M.B., Liebowitz M.R.: Social anxiety disorder: Current perspectives on diagnosis and treatment. Prim Psychiatry 12:35-48 (2005). Bhanji N.H., Chouinard G., Kolivakis T., Margolese H.C.: Persistent tardive rebound panic disorder, rebound anxi­ ety and insomnia following paroxetine withdrawal: A review of reboundwithdrawal phenomena. Can J Clin Pharmacol 13, e69-74 (2006). Blanco C., Schneier F.R., Schmidt A., et al.: Pharmacological treatment of social anxiety disorder. Depress Anxi­ ety 18: 29-40 (2003). Blaya C., Seganfredo A.C., Donrelles M., Torres M., Paludo A., Heldt E., Manfro G.G.: The efficacy of mil­ nacipran in panic disorder: an open trial. Int Clin Psychopharmacol 22, 153-158 (2007). Blazer D.G., Hughes D., George L.K.: Stressful life events and the onset of a generalized anxiety syndrome. Am J Psychiatry 144:1178–1183 (1987). Blier P., Szabo S.T.: Potential mecha­ nisms of action of atypical antipsy­ chotic medication in treatment-resist­ ant depression and anxiety. J Clin Psy­ chiatry 66 (suppl 8): 30-40 (2005). Blomhoff S., Haug T.T., Hellstrom K. et al.: Randomised controlled general practice trial of sertraline, exposure therapy and combined treatment in 64 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] generalised social phobia. Br J Psy­ chiatry 179:23–30 (2001). Bögels S., Wijts S., Sallaerts S.: Ana­ lytic psychotherapy versus cognitvebehavioral therapy for social phobia. European Congress for Cognitive and Behavioural Therapies, September 1013, Prague, Czech Republic (2003). Bond A.J., Wingrove J., Valerie Cur­ ran H., Lader M.H.: Treatment of gen­ eralized anxiety disorder with a short course of psychological therapy, com­ bined with buspirone or placebo. J Af­ fect Disord 72: 267-271 (2002). Bond M., Perry JC.:Long-term changes in defense styles with psychodynamic psychotherapy for depressive, anxiety, and personality disorders. Am J Psy­ chiatry 161: 1665-1671 (2004). Boyer W.: Serotonin uptake inhibitors are superior to imipramine and alpra­ zolam in alleviating panic attacks: A meta-analysis. Int Clin Psychopharma­ col 10: 45-49 (1995). Bradwejn J., Ahokas A., Stein D.J. et al. Venlafaxine extended-release cap­ sules in panic disorder: Flexible-dose, double-blind, placebo-controlled study. Br J Psychiatry 187: 352-359 (2005). Brawman-Mintzer O., Knapp R.G., Rynn M. et al.: Sertraline treatment of generalized anxiety disorder: A randomized, double-blind, placebocontrolled study. J Clin Psychiatry 67: 874-881 (2006). Bruce T.J., Spiegel D.A., Gregg S.F., Nuzzarello A.: Predictors of alpra­ zolam discontinuation with and with­ out cognitive behavior therapy in panic disorder. Am J Psychiatry 152:1156– 1160 (1995). Busch F., Cooper A., Klerman G.L. et al.: Neurophysiological, cognitivebehavioral, and psychoanalytic ap­ proaches to panic disorder: Toward an integration. Psa Inquiry 11:316–332 (1991). Busch F., Milrod B., Cooper A., Sha­ piro T.: Psychodynamic approaches to panic disorder. J Psychother Pract Res 5:73–83 (1996). Butler G., Fennell M., Robson P., Gelder M.: Comparison of behavior therapy and cognitive behavior therapy in the treatment of generalized anxi­ ety disorder. J Consult Clin Psychol 59:167–175 (1991). Carlbring P., Bohman S., Brunt S., Buhrman M., Westling B.E., Ekselius L., Andersson G.: Remote treatment of panic disorder: a randomized trial of internet-based cognitive behavior therapy supplement with telephone calls. 163, 2119-2125 (2006). Carlbring P., Gunnarsdottir M., Heden­ sö L., Andersson G., Ekselius L, Fuhr­ [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] mark T.: Treatment of social phobia: Randomised trial of internet-delivered cognitive-behavioural therapy with tel­ ephone support. Br J Psychiatry 190, 123-128 (2007). Chessick C.A., Allen M.H., Thase M., et al.: Azapirones for generalized anxi­ ety disorder. Cochrane Database Syst Rev 3:CD006115 (2006). Choy Y., Fyer A.J., Lipsitz J.D.: Treat­ ment of specific phobia in adults. Clin Psychol Rev 27, 266-286 (2007). Clark D.M., Ehlers A., Hackman A. et al.: Cognitive therapy versus expo­ sure and applied relaxation in social phobia: A randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol 74: 568-578 (2006). Clark D.M., Ehlers A., McManus F. et al.: Cognitive therapy versus fluox­ etine in generalized social phobia: A randomized, placebo-controlled trial. J Consult Clin Psychol 71: 1058-1067 (2003). Clark D.M., McManus F.: Information processing in social phobia. Biol Psy­ chiatry 51: 92-100 (2002). Clark D.M., Salkovskis P.M., Hack­ mann A., t al.: A comparison of cog­ nitive therapy, applied relaxation and imipramine in the treatment of panic disorder. Br J Psychiatry 164:759–769 (1994). Craske M.G., Brown T.A., Barlow D.H.: Behavioral treatment of panic disorder: A two-year follow-up. Behav Ther 22:289–304 (1991). Craske M.G., Waters A.M: Panic dis­ order, phobias, and generalized anxi­ ety disorder. Annu Rev Clin Psychol 1:197-225 (2005). Crits-Christoph P., Connolly M.B., Azrian K. et al.: Psychodynamic-in­ terpersonal treatment of generalized anxiety disorder. Psychotherapy 33: 418-430 (1996). Crits-Christoph P., Crits-Christoph K., Wolf-Palacio D. et al.: Brief support­ ive-expressive psychodynamic therapy for generalized anxiety disorder. In: Barber J.P., Crits-Christoph P. (eds.) Dynamic therapies for psychiatric disorders (axis I). Basic Books, New York, 43-83 (1995). Davidson J.R.T., Foa E.B., Huppert J.D, et al.: Fluoxetine, comprehensive cognitive behavioural therapy, and placebo in generalized social phobia. Arch Gen Psychiatry 61, 1005-1013 (2004). Davidson J.R., Bose A., Korotzer A., Zheng H.: Escitalopram in the gener­ alized anxiety disorder: Double-blind, placebo controlled flexible-dose study. Depress Anxiety 19: 234-240 (2004). Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] Davidson J.R.: Pharmacotherapy of generalized anxiety disorder. J Clin Psychiatry 62 (Suppl 11):46–50 (2001). Davidson JRT, Potts NLS, Richichi EA et al. (1993 b) Treatment of social phobia with clonazepam and placebo. J Clin Psychopharmacol 13:423–428 Demertzis K.H., Craske M.G.: Cog­ nitive-behavioral therapy for anxiety disorders in Primary Care. Prim Psy­ chiatry 12: 52-58 (2005). Denys D., De Geus F.: Predictors of pharmacotherapy response in anxiety disorders. Curr Psychiatr Rep 7: 252257 (2005). Durham R.C., Chambers J.A., Mac­ Donald R.R., et al.: Does cognitivebehavioural therapy influence the long-term course of generalized anxi­ ety disorder? An 8-14 year follow-up of two clinical trials. Psychol Med 33: 499-509 (2003). Edelman R.E., Chambless D.L.: Com­ pliance during sessions and homework in exposure-based treatment of agora­ phobia. Behav Res Ther 31:767–773 (1993). Fahlen T., Nilsson H.L., Borg K. et al.: Social phobia: The clinical efficacy and tolerability of the monoamino oxi­ dase-A and serotonin uptake inhibitor brofaromine: A double-blind placebocontrolled study. J Clin Psychophar­ macol 17: 255-260 (1997). Faravelli C., Rosi S., Truglia E.: Ben­ zodiazepines. In: Nutt D, Ballenger J (eds) Anxiety disorders. Blackwell Publishing, Oxford, 315-338 (2003). Fava G.A., Grandi S., Rafanelli C. et al.: Long-term outcome of social pho­ bia treated by exposure. Psychol Med 31:899–905 (2003). Fava G.A., Ruini C., Rafanelli C.: Se­ quential treatment of mood and anxi­ ety disorders. J Clin Psychiatry 66: 1392-1400 (2005). Fava G.A., Zielezny M., Savron G., Grandi S.: Long-term effects of be­ havioural treatment for panic disor­ der with agoraphobia. Br J Psychiatry 166:87–92 (1995). Fedoroff I.C., Taylor S.: Psychologi­ cal and pharmacological treatments of social phobia: a meta-analysis. J Clin Psychopharmacol 21:311–324 (2001). Ferguson J. M., Khan A., Mangano R., Entsuah R., Tzanis E.: Relapse prevention of panic disorder in adult outpatient responders to treatment with venlafaxine extended release. J Clin Psychiatry 68, 58-68 (2007). Feske U., Chambless D.L.: Cognitive behaviour versus exposure treatment for social phobia: A meta-analysis. Be­ hav Ther 26: 695-720 (1995). [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] Feusner J., Cameron M., Bystritsky A.: Pharmacotherapy and psychotherapy for panic disorder. Primary Psychiatry 12:49-55 (2005). Foa E.M., Davidson J.R.T., Huppert J.D., et al.: Comprehensive CBT, flu­ voxamine, and their combination: A randomized placebo-controlled trial. Annual Meeting of the Association for the Advancement of Behavior Ther­ apy, November 20-23, Boston, Mass (2003). Freud S.: Wege der psychoanalyti­ schen Therapie. GW Bd. 12, S 183– 194 (1919). Furukawa T.A, Watanbe N., Churchill R.: Psychotherapy plus antidepressant for panic disorder with or without ago­ raphobia. Br J Psychiatry 188:305-312 (2006). Furukawa T.A., Streiner D.L., Young L.T.: Antidepressant and benzodi­ azepine for major depression. Cochrane Database Syst Rev 1: CD001026 (2002). Gelenberg A., Lydiard R.B., Rudolph R., et al.: Efficacy of venlafaxine extended-release capsules in nonde­ pressed outpatients with generalized anxiety disorder: A 6-month rand­ omized controlled trial. JAMA 283: 3082-3088 (2000). Gelernter C.S., Uhde T.W., Cimbolic P. et al.: Cognitive-behavioral and pharmacological treatments of social phobia: A controlled study. Arch Gen Psychiatry 48: 938-945 (1991). Goddard A.W., Brouette T., Almai A., et al.: Early coadministration of clon­ azepam with sertraline for panic disor­ der. Arch Gen Psychiatry 58: 681-686 (2001). Goisman R.M., Warshaw M.G., Kel­ ler M.B.: Psychosocial treatment pre­ scription for generalized anxiety disor­ der, panic disorder, and social phobia, 1991-1996. Am H Psychiatry 156: 1819-1821 (1999). Gosselin P, Ladouceur R., Morin C.M., Dugas M. J., Baillargeon L.: Benzodi­ azepine discontinuation among adults with GAD: A randomized trial of cog­ nitive-behavioral therapy. J Consult Clin Psychol. 74, 908-19 (2006). Gould R.A., Buckminster S., Pollack M.H., et al.: Cognitive-behavioral and pharmacological treatment for social phobia: A meta-analysis. Clin Psychol Science Prac 4:291-306 (1997). Gould R.A., Otto M.W., Pollack M.H.: A meta-analysis of treatment outcome for panic disorder. Clin Psychol Rev 15: 819-844 (1995). Gould R.A., Safren S.A., Washington D.O.N, Ott M.W.: Cognitive-behavio­ ral treatment for generalized anxiety disorder: A metaanalytic review. In: 65 [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] Mennin D.S. (ed.) Gneralized anxi­ ety disorder: Advances in research and practice.Guilford Press, New York (2003). Grös D.F., Anthony M.M.: The assess­ ment and treatment of specific phobias: A review. Curr Psychiatry Rep 8: 298303 (2006). Guastella A.J., Dadds M.R., Lovibond P.F., Mitchell P., Richardson R.: A ran­ domized controlled trial of the effect of d-cycloserine on exposure therapy for spider fear. J Psychiatr Res (Epub ahead of print) (2006). Haby M.M., Donnelly M., Corry J., Vos T.: Cognitive behavioural therapy for depression, panic disorder and generalized anxiety disorder: A metaregression of factors that may predict outcome. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 40:9-19 (2006). Hartford J., Kornstein S., Liebowitz M., et al.: Duloxetine as an SNRI treat­ ment for generalized anxiety disorder: results from a placebo and active-con­ trolled trial. Int Clin Psychopharmacol. 22, 167-174 (2007). Haug T.T., Blomhoff S., Hesstrom K., et al.: Exposure therapy and sertraline in social phobia: I-year follow-up of a randomised controlled trial. Br J Psy­ chiatry 182:312-318 (2003). Hayes S.A., Hope D.A., VanDyke M.M., Heimberg R.G.: Working alli­ ance for clients with social anxiety dis­ order: relationship with session help­ fulness and within-session habituation. Cong Behav Ther 36, 34-42 (2007). Hedges D.W., Brown B.L., Shwalb D.A., Godfrey K., Larcher A.M.: The efficacy of selective serotonin reuptake inhibitors in adult social anxiety disor­ der: A meta-analysis of double-blind, placebo-controlled trials. J Psy­ chopharmacol (Epub ahead of print) (2006). Heimberg R.G., Liebowitz M.R., Hope D.A., et al.: Cognitive-behavioral group therapy vs. phenelzine therapy for social phobia: 2-week outcome. Arch Gen Psychiatry 55: 1133-1141 (1998). Heimberg R.G.: Cognitive behavioral and psychotherapeutic strategies for social anxiety disorder. Annual Meet­ ing of the Anxiety Disorders Associa­ tion of America. March 27-30, Toronto (2006). Heldt E., Blaya C., Kipper L., Salum G.A., Otto M.W., Manfro G.G.: De­ fense mechanisms after brief cogni­ tive-behavior group therapy for panic disorder: one-year follow-up. J Nerv Ment Dis 195, 540-543 (2007). Heldt E., Gus Manfro G., Kipper L., et al.: One-year follow-up of pharmaco­ therapy restistant patients with panic Kapfhammer disorder treated with cognitive-behav­ iour therapy: Outcome and predictors of remission. Behav Res Ther 44, 647665 (2006). [92] Hicks T.V., Leitenberg H., Barlow D.H., et al.: Physical, mental, and so­ cial catastrophic cognitions as prog­ nostic factors in cognitive-behavioral and pharmacological treatment for panic disorder. J Consult Clin Psychol 73: 506-514 (2005). [93] Hoehn-Saric R.: Generalized anxiety disorder in medical practice. Prim Psy­ chiatry 12: 30-34 (2005). [94] Hoffmann S.O., Bassler M.: „Manual“ für fokal orientierte psychoanalytische Psychotherapie bei Angststörungen. Erste Erfahrungen aus einer Therapi­ estudie. Forum Psa 11:2–14 (1995). [95] Hofmann S.G., Meuret A.E., Rosen­ field D., et al.: Preliminary evidence for cognitive mediation during cogni­ tive-behavioral therapy of panic dis­ order. J Conult Psychol 75, 374-379 (2007). [96] Hofmann S.G., Meuret A.E., Smits J.A., et al.: Augmentation of exposure therapy with D-cycloserine for social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry 63: 298-304 (2006). [97] Hunot V., Churchill R., Silva de Lima M., Teixeira V.: Psychological thera­ pies for generalised anxiety disor­ der. Cochrane Database Syst Rev 24, CD001848 (2007). [98] Huppert J.D., Bufka L.F., Barlow D.H. et al.: Therapists, therapist variables, and cognitive-behavioral therapy out­ come in a multicenter trial for panic disorder. J Consult Clin Psychol 69: 747-755 (2001). [99] Ipser J.C., Carey P., Dhansay Y., et al.: Pharmacotherapy augmentation strate­ gies in treatment-resistant anxiety dis­ orders. Cochrance Database Syst Rev. 18, CD005471 (2006). [100] Jakobsen T., Rudolf G., Brockmann J., et al.: Results of psychoanalytic long-term therapy i specific diagnos­ tic groups: improvement in symptoms and interpersonal relationship [article in german]. Z Psychosom Med Psy­ chother 53, 87-110 (2007). [101] Kampman M., Keijsers G.P.J., Hoog­ duin C.A.L., Hendriks G.J.: A rand­ omized, double-blind, placebo-control­ led study of the effects of adjunctive paroxetine in panic disorder patients unsuccessfully treated with cognitivebehavioral therapy alone. J Clin Psy­ chiatry 63: 772-777 (2002). [102] Kapfhammer H.P.: Psychotherapie und Pharmakotherapie. Eine Übersicht zur Kombinationsbehandlung bei neuroti­ schen und Persönlichkeitsstörungen. Psychotherapeut 43:331–351 (1998). 66 [103] Kapfhammer H.P.: Angststörungen. In: Möller H.J., Laux G., Kapfham­ mer H.P. (Hrsg.) Psychiatrie und Psy­ chotherapie. 3. Aufl. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo (2007) [104] Kaplan M.E., DuPont R.L.: Benzo­ dazepines and anxiety disorders: A re­ view for the practicing physician. Curr Med Res Opin 21: 945-50 (2005). [105] Kasper S., Stein D., Loft H. et al.: Escitalopram in the treatment of social anxiety disorder: Randomized, pla­ cebo-controlled, flexible dosage study. Br J Psychiatry 186: 222-226 (2005). [106] Katschnig H., Stein M.B., Buller R, The International Multicenter Clinical Trial Group on Moclobemide in Social Phobia: Moclobemide in social pho­ bia: A double-blind, placebo-control­ led clinical study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 247: 71-80 (1997). [107] Katzelnick D.J., Kobak K.A., Greist J.H., et al.: Sertraline for social pho­ bia: A double-blind, placebo-control­ led crossover study. Am J Psychiatry 152: 1368-1371 (1995). [108] Kim T.S., Pae C.U., Yoon S.J., et al.: Comparison of venlafaxine extended release versus paroxetine for treatment of patients with generalized anxiety disorder. Psychiatry Clin Neurosci. 60, 347-351 (2006). [109] Kinrys G., Soldani F., Hsu D., et al.: Adjunctive tiagabine for treatment re­ fractory social anxiety disorder. Poster presented at: Annual meeting of the American Psychiatric Association. May 1-6, New York (2004). [110] Klein C., Milrod B., Busch F., Levy K.N., Shapiro T.: A process-outcome study of panic-focused psychodynam­ ic psychotherapy. Psa Inquiry 23: 308331 (2003). [111] Klein D.F.: Anxiety reconceptualised. Gleaning from pharmacological dis­ section: Early experience with imi­ pramine and anxiety. Mod Probl Phar­ macopsychiatry 22: 1-35 (1987). [112] Kobak K.A., Griest J.H., Jefferson J.W., Katzelnick D.J.: Fluoxetine in social phobia: A double blind, placebocontrolled pilot study. J Clin Psychop­ harmacol 22: 257-262 (2002). [113] Kroenke K., Messina N., Benattia I., Graepel J., Musgnung J.: Venlafax­ ine extended release in the short-term treatment of depressed and anxious primary care patients with multiso­ matoform disorder. J Clin Psychiatry 67: 72-80 (2006). [114] Kuzma J.M., Black D.W.: Integrating pharmacotherapy and psychotherapy in the management of anxiety disor­ ders. Curr Psychiatr Rep 6: 268-273 (2004). [115] Lader M.: Pharmacotherapy of mood disorders and treatment discontinua­ tion. Drugs 67, 1657-1663 (2007). [116] Ledgerwood L., Richardson R., Cran­ ney J.: D-cycloserine facilitates extinc­ tion of learned fear: Effects on reacqui­ sition and generalized extinction. Biol Psychiatry 15:841-847 (2005). [117] Leichsenring F., Beutel M., Leibing E.: Psychodynamic psychotherapy for so­ cial phobia: a treatment manual based on supportive-expressive therapy. Bull Menninger Clin 71:56-83 (2007). [118] Leichsenring F., Rabung S., Leibing E.: The efficacy of short-term psy­ chodynamic psychotherapy in specific psychiatric disorders: A meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 61: 1208-1216 (2004). [119] Leichsenring F., Winkelbach C., Leib­ ing.: Die Generalisierte Angststörung – Krankheitsmuster, Diagnostik und Therapie. Z Psychosom Med Psy­ chother 48: 235-255 (2002). [120] Lenox-Smith A.J., Reynolds A.: A double-blind, randomised, placebocontrolled study of venlafaxine XR in patients with generalized anxiety dis­ order in primary care. Br J Gen Pract 53: 772-777 (2003). [121] Liebowitz M.R., DeMartinis N.A., Weihs K., et al.: Efficacy of sertraline in severe generalized social anxiety disorder: Results of a double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psy­ chiatry 64:785-792 (2003). [122] Liebowitz M.R., Gelenberg A.J., Munjack D.: Venlafaxine extended release vs placebo and paroxetine in social anxiety disorder. Arch Gen Psy­ chiatry 62:190-198 (2005 a). [123] Liebowitz M.R., Ginsberg D.L., Ninan P.T., et al.: Integrating neurobiology and psychopathology into evidencebased treatment of social anxiety dis­ order. CNS Spectr 10:1-16 (2005). [124] Liebowitz M.R., Mangano R.M., Bradwein J., Asnis G.: A randomized controlled trial of venlafaxine extend­ ed release in generalized social anxiety disorder. J Clin Psychiatry 66:238-247 (2005 b). [125] Liebowitz M.R., Schneider F., Campeas R. et al.: Phenelzine vs atenolol in so­ cial phobia: A placebo-controlled com­ parison. Arch Gen Psychiatry 49:290300 (1992). [126] Liebowitz M.R., Stein M.B., Tancer M. et al.: A randomised, double-blind, fixed-dose comparison of paroxetine and pacebo in the treatment of gener­ alized social anxiety disorder. J Clin Psychiatry 63: 66-74 (2002). [127] Linden M., Zubrägel D., Bär T. et al.: Efficacy of cognitive behaviour ther­ apy in generalized anxiety disorders. Results of a controlled clinical trial Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] (Berlin CBT-GAD Study). Psychother Psychosom 74: 36-42 (2005). Lipsitz J.D., Gur M., Miller N.L., et al.: An open pilot study of interperson­ al psychotherapy for panic disorder. J Nerv Ment Dis 194:440-445 (2006). Llorca P.M., Spadone C., Sol O., et al.: Efficacy and safety of hydroxyzine in the treatment of generalized anxi­ ety disorder: A 3-month double-blind study. J Clin Psychiatry 63:1020-1027 (2002). Lott M., Greist J.H., Jefferson J.W. et al.: Brofaromine for social phobia: A multicenter, placebo-controlled, dou­ ble-blind study. J Clin Psychopharma­ col 17: 55-260 (1997). Marchesi C., Cantoni A., Fonto S., Gi­ anelli M.R., Maggini C.: Predicotors of symptom resolution in panic disor­ der after one year of pharmacological treatment: a naturalistic study. Phar­ macopsychiatry 39, 60-65 (2006). Marcus S.M., Gorman, J., Shear M.K., et al.: A comparison of medication side effect reports by panic disorder patients with and without concomi­ tant cognitive behaviour therapy. Am J Psychiatry. 164, 273-275 (2007). Margraf J., Barlow D.H., Clark D.M., Telch M.J.: Psychological treatment of panic: Work in progress on outcome, active ingredients, and follow-up. Be­ hav Res Ther 31:1–8 (1993). Marks I.M., Gray S., Cohen D. et al.: Imipramine and brief therapist-aided exposure in agoraphobics having selfexposure homework. Arch Gen Psy­ chiatry 40:153–162 (1983). Marks I.M., Swinson R.P., Basoglu M. et al.: Alprazolam and exposure alone and combined in panic disorder with agoraphobia. Br J Psychiatry 162:776– 778 (1993). Marshall R.D.: Integrated treatment of social phobia. Bull Menninger Clin 59 (Suppl A): A27–A37 (1995). Mattick R.P., Peters L., Clarke J.C.: Exposure and cognitive restructuring for severe social phobia: A controlled study. Behav Ther 20: 3-23 (1989). Mavissakalian M.R., Michelson L., Dealy R.S.: Pharmacological treat­ ment of agoraphobia: Imipramine vs imipramine with programmed practice. Br J Psychiatry 143:348–355 (1983). Mavissakalian M.R., Michelson L.: Relative and combined effectiveness of therapist-assisted in vivo exposure and imipramine. J Clin Psychiatry 47:117–122 (1986 a). Mavissakalian M.R., Michelson L.: Two-year follow-up of exposure and imipramine treatment of agorapho­ bia. Am J Psychiatry 143:1106–1112 (1986 b). [141] Mavissakalian M.R., Perel J.M.: Clini­ cal experiments in maintenance and discontinuation of imipramine in panic disorder with agoraphobia. Arch Gen Psychiatry 49:318–323 (1992). [142] Mavissakalian M.R.: Combined behav­ ioral and pharmacological treatment of anxiety disorders. In: Oldham JM, Riba MB, Tasman A (eds) Review of psychiatry, vol 12. American Psychiat­ ric Press, Washington/DC London, pp 565–584 (1993). [143] Mavissakalian M.R.: The relationship between panic disorder/agoraphobia and personality disorders. Psychiatr Clin North Am 13:661–684 (1990). [144] Mentzos S.: Angstneurose. Psychody­ namische und psychotherapeutische Aspekte. Fischer, Frankfurt/Main (1984). [145] Menza M.A., Dobkin R.D., Marin H.: An open-label trial of aripiprazole aug­ mentation for treatment-resistant gen­ eralized anxiety disorder. J Clin Psy­ choopharmacol. 27, 207-210 (2007). [146] Meyer J.K., Maletic V.: The clinical and theoretical structures of adult pho­ bias. Psa Inquiry 11:333–350 (1991). [147] Milrod B. L., Leon A.C., Barber J.P., Markowitz J.C., Graf E.: Do comorbid personality disorders moderate panicfocused psychotherapy? An explora­ tory examination of the American Psy­ chiatric Association practice guideline. J Clin Psychiatry 68, 885-891 (2007). [148] Milrod B., Busch F., Leon A.C. et al.: A pilot open trial of brief psychodynamic psychotherapy for panic disorder. J Psychother Pract Res 10:239–245 (2001). [149] Milrod B., Busch F., Leon A.C., et al.: Open trial of psychodynamic psy­ chotherapy for panic disorder: A pilot study. Am J Psychiatry 157: 18781880 (2000). [150] Milrod B., Leon AC, Busch F., et al.: A randomized controlled clinical trial of psychoanalytic psychotherapy for panic disorder. Am J Psychiatry 164, 976-977 (2007). [151] Milrod B.L., Busch F., Cooper A., Sha­ piro T.: Manual of panic-focused psy­ chodynamic psychotherapy. American Psychiatric Press, Washington/DC London (1997). [152] Milrod B.L., Shear M.K.: Dynamic treatment of panic disorder: A review. J Nerv Ment Dis 179:741–743 (1991 a) [153] Milrod B.L., Shear M.K.: Psychody­ namic treatment of panic: Three case histories. Hosp Comm Psychiatry 42:311–312 (1991 b). [154] Mineka S., Zinbarg R.: Condition­ ing and ethological models of social phobia. In: Heimberg R.G., Liebowitz M.R., Hope D.A. (eds.) Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment. 67 [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] Guilford, New York, pp 134–162 (1995). Mitte K. A meta-analysis of the effi­ cacy of psycho- and pharmacotherapy in panic disorder with and without agoraphobia. J Affect Disord 88: 27-45 (2005). Mitte K., Noack P., Steil R., Hautzinger M.: A meta-analytic review of the ef­ ficacy of drug treatment in generalized anxiety disorder. J Clin Psychophar­ macol 25:141-150 (2005). Möller H.J., Volz H.P., Reimann I.W., Stoll K.D.: Opipramol for the treat­ ment of generalized anxiety disorder: A placebo-controlled trial including an alprazolam-treated group. J Clin Psy­ chopharmacol 21:59-65 (2001). Montgomery S.A., Tobias K., Zornberg G.L., Kasper S., Pande A.C.: Efficacy and safety of pregabalin in the treat­ ment of generalized anxiety disorder: 1 6-week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled com­ parison of pregabalin and venlafaxine. J Clin Psychiatry 67, 771-782 (2006). Morrison K.H., Bradley R., Westen D.: The external validity of control­ led clinical trials of psychotherapy for depression and anxiety: A naturalistic study. Psychol Psychother 76:109-132 (2003). Mörtberg E., Clark D.M, Sundin O., Aberg Wistedt A.: Intensive group cognitive treatment and individual cognitive therapy vs. treatment as usual in social phobia: a randomized controlled trial. Acta Psychiar Scand 115, 142-154 (2007). Mühlbacher M., Nickel M.K., Nickel C., et al.: Mirtazapine treatment of so­ cial phobia in women: A randomized, double-blind placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol 25:580-583 (2005). Mula M., Pini S., Cassano G.B.: The role of anticonvulsant drugs in anxi­ ety disorders: a critical review of the evidence. J Clin Psychopharmacol 27, 263-272 (2007). Muller J.E., Koen L., Seedat S., Stein D.J.: Social anxiety disorder current treatment recommendations. CNS Drugs 19:377-391 (2005). Nagoya T.A., Watanabe N., Churchill R.: Combined psychotherapy plus an­ tidrepressants for panic disorder with or without agoraphobia.Cochrane Database Syst Rev. 24, CD004364 (2007). Nemeroff C.B.: Use of atypical antip­ sychotics in refractory depression and anxiety. J Clin Psychiatry 66 (suppl 8): 13-21 (2005). Nimatoudis I., Zissis N.P., Kogeorgos J. et al.: Remission rates with venla­ faxine extended release in Greek oup­ Kapfhammer [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] taients with neralized anxiety disorder: A double-blind, randomized, placebo controlled study. Int Clin Psychophar­ macol 19: 331-336 (2004). Norton P.J., Price E.C.: A meta-analyt­ ic review of adult cognitive-behavioral treatment outcome across the anxiety disorders. J Nerv Ment Dis 195, 521531 (2007). Noyes R., Moroz G., Davidson J.R.T. et al.: Moclobemide in social phobia: A controlled dose-response trial. J Clin Psychopharmacol 17: 247-254 (1997). Nutt D.J.: Overview of diagnosis and drug treatments of anxiety disorders. CNS Spectr 10: 49-56 (2005). Öst L.G.: Rapid treatment of spe­ cific phobias. In: Davey G.C.L. (ed.) Phobias. Wiley, New York, 227-246 (1997). Öst L.G.: Spezifische Phobien: In: Margraf J. (Hrsg.) Lehrbuch der Ve­ rhaltenstherapie, Bd 2, 2. Aufl. Spring­ er, Berlin Heidelberg New York, 29-42 (2000). Otto M.W, Powers M., Smits J.A.J.: Adding cognitive-behavioral therapy to pharmacotherapy for panic disor­ der. Issues and strategies. CNS Spectr 9:32-39 (2005). Otto M.W., Basden S.L., Leyro T.M., McHugh R.K., Hofmann S.G.: Clini­ cal perspectives on the combination of D-cydloserine and cognitive-behavio­ ral therapy for the treatment of anxi­ ety disorder. CNS Spectr 12, 51-61 (2007). Otto M.W., Gould R.A., Pollack M.H.: Cognitive-behavioral treatment of panic disorder: Considerations for the treatment of patients over the long term. Psychiatr Annals 24:307–315 (1994). Otto M.W., Tuby K.S., Gould R.A. et al.: An effect-size analysis of the relative efficacy and tolerability of serotonin selective reuptake inhibitors for panic disorder. Am J Psychiatry 158:1989–1982 (2001) Pande A.C., Davidson J.R., Jefferson J.W., et al.: Treatment of social phobia with gabapentin: A placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol 19:341348 (1999). Pande A.C., Feltner D.E., Jefferson J.W., et al.: Efficacy of the novel anxiolytic pregabalin in social anxiety disorder: A placebo-controlled, multi­ center study. J Clin Psychopharmacol 24: 141-149 (2004). Papp L.A., Schneier F.R., Fyer A.J. et al.: Clomipramine treatment of panic disorder: Pros and cons. J Clin Psy­ chiatry 58: 423-425 (1997). Pohl R.B., Feltner D.E., Fieve R.R., Pande A.C.: Efficacy of pregabalin in the treatment of generalized anxiety 68 [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] disorder: Double-blind, placebo-con­ trolled comparison of BID versus TID dosing. J Clin Psychopharmacol 25: 151-158 (2005). Pollack M.H., Lepola U., Koponen H., et al.: A double-blind study of the efficacy of venlafaxine extended-re­ lease, paroxetine, and placebo in the treatment of panic disorder. Depress Anxiety 24, 1-14 (2007). Pollack M.H., Otto M.W., Kaspi S.P., Hammerness P.G., Rosenbaum J.F.: Cognitive therapy for treatment-refrac­ tory panic disorder. J Clin Psychiatry 55:200–205 (1994). Pollack M.H., Simon N.M., Worthing­ ton J.J. et al.: Combined paroxetine and clonazepam treatment strategies compared to paroxetine monotherapy for panic disorder. J Psychopharmacol 17: 276-282 (2003). Pollack M.H., Zaninelli R., Goddard A. et al.: Paroxetine in the treatment of generalized anxiety disorder: Results of a placebo controlled, flexible-dos­ age trial. J Clin Psychiatry 62: 350-357 (2001). Pollack M.H.: The pharmacotherapy of panic disorder. J Clin Psychiatry 66 (suppl 4): 23-27 (2005). Power K.G., Simpson R.J., Swanson V., Wallace L.A.: A controlled com­ parison of cognitive-behaviour thera­ py, diazepam, and placebo, alone and in combination, for the treatment of generalized anxiety disorder. J Anxiety Disord 4:267–292 (1990). Prasko J., Dockery C., Horacek J., et al.: Moclobemide and cognitive be­ havioral therapy in the treatment of social phobia. A six-month controlled study and 24 months follow up. Neuro Endocrinol Lett (Epub ahead of print) (2006). Pull C.B.: Combined pharmacotherapy and cognitive-behavioural therapy for anxiety disorders. Curr Opin Psychia­ try 20, 30-35 (2007). Ressler K.J., Rothbaum B.O., Tannen­ baum L., et al.: Cognitive enhancers as adjuncts to psychotherapy: Use of D-cycloserine in phobic individuals to facilitate extinction of fear. Arch Gen Psychiatry 61: 1136-1144 (2004). Rickels K., Mangano R., Khan A.: A double-blind, placebo-controlled study of a flexible dose of venlafaxine ER in adult outpatients with generalized so­ cial anxiety disorder. J Clin Psychop­ harmacol 24:488-496 (2004). Rickels K., Pollack M.H., Feltner D.E., et al.: Pregabalin for treatment of generalized anxiety disorder: a 4week, multicenter, double-blind, pla­ cebo-controlled trial of pregabalin and alpazolam. Arch Gen Psychiatry 62, 1022-1030 (2005). [191] Rickels K., Rynn M., Iyengar M., Duff D.: Remission of generalized anxiety disorder: A review of the paroxetine clinical trials database. J Clin Psychia­ try 67: 41-47 (2006). [192] Rickels K., Zaninelli R., McCafferty J. et al.: Paroxetine treatment of general­ ized anxiety disorder: A double-blind, placebo-controlled study. Am J Psy­ chiatry 160: 749-756 (2003). [193] Rickels K.: Use of antianxiety agents in anxious outpatients. Psychopharma­ col 58: 1-17 (1978). [194] Rocah B.S.: A clinical study f a phobic illness: The effects of traumatic scars on symptom formation and treatment. Psa Inquiry 11: 351-375 (1991). [195] Rocca P., Fonzo V., Scotta M. et al.: Paroxetine efficacy in the treatment of generalized anxiety disorder. Acta Psy­ chiatr Scand 95: 444-450 (1997). [196] Rodebaugh TL, Holaway RM, Heim­ berg RG (2004) The treatment of so­ cial anxiety disorder. Clin Psychol Rev 24: 883-908 [197] Rollman B..L, Belnap B.H., Mazum­ dar S., et al.: A randomized trial to im­ prove the quality of treatment for panic and generalized anxiety disorders in primary care. Arch Gen Psychiatry 62:1332-1342 (2005). [198] Roozendaal B., Okuda S., de Quervain D.J., McGaugh J.L.: Glucocorticoids interact with emotion-induced no­ radrenergic activation in influencing different memory functions. Neuro­ science 138: 901-910 (2006). [199] Rosser S., Erskine A., Crino R.: Preex­ isting antidepressants and the outcome of group cognitive behaviour therapy for social phobia. Aust N Z J Psychia­ try 38, 233-239 (2004). [200] Roth A., Fonagy P.: What works for whom? A critical review of psycho­ therapy research. 2nd ed. Guilford Press, New York, London (2005). [201] Rudolf G., Grande T., Porsch U.: Die Berliner Psychotherapiestudie. Z Psy­ chosom Med Psychoanal 34:2–18 (1988). [202] Rudolf G., Manz R., Öri C.: Ergeb­ nisse psychoanalytischer Therapien. Z Psychosom Med Psychoanal 40:25–40 (1994). [203] Ruhmland M., Margraf J.: Effektivität psychologischer Therapien von spe­ zifischer Phobie und Zwangsstörung: Meta-Analysen auf Störungsebene. Verhaltenstherapie 11: 14-26 (2001). [204] Rynn M.A., Brawman-Mintzer O.: Ge­ neralized anxiety disorder: Acute and chronic treatment. CNS Spectr 9: 716723 (2004). [205] Schneier F.R., Goetz D., Campeas R. et al.: Placebo-controlled trial of mo­ clobemide in social phobia. Br J Psy­ chiatry 172: 70-77 (1998). Zur Psychotherapie und Pharmakotherapie der Angststörungen [206] Schulz J.B.A., Gotto J.G., Rapaport M.H.: The diagnosis and treatment of generalized anxiety disorder. Prim Psychiatry 12: 58-67 (2005). [207] Scocco P., Barbieri I., Frank E.: Inter­ personal problem areas and onset of panic disorder. Psychopathology 40, 8-13 (2007). [208] Seedat S., Stein M.B.: Double-blind, placebo-controlled assessment of combined clonazepam with parox­ etine compared with paroxetine mono­ therapy for generalized social anxiety disorder. J Clin Psychiatry 65: 244-248 (2004). [209] Shear M.K., Pilkonis P.A., Cloitre M., Leon A.C.: Cognitive behavioral treat­ ment compared with nonprescriptive treatment of panic disorder. Arch Gen Psychiatry 51:395–401 (1994). [210] Sheehan D., V., Harnett Sheehan K.: Current approaches to the pharmaco­ logic treatment of anxiety disorders. Psychopharmacol Bull 40, 09-109 (2007). [211] Simon N.M., Safren S.A., Otto M.W., et al.: Longitudinal outcome with phar­ macotherapy in a naturalistic study of panic disorder. J Affect Disord 69: 201-208 (2002). [212] Simpson H.B., Schneider F.R,. Campeas R., et al.: Imipramine in the treatment of social phobia. J Clin Psy­ chopharmacol 18:132-135 (1998). [213] Slaap B.R., Boer J.A. den: The predic­ tion of nonresponse to pharmacothera­ py in panic disorder: a review. Depress Anxiety 14:112–122 (2001). [214] Soravia L.M., Heinrichs M., Aerni A. et al.: Glucocorticoids reduce phobic fear in humans. Proc Natl Acad SCI USA 103:5585-5590 (2006). [215] Starcevic V., Berle D.: Cognitive spe­ cificity of anxiety disorders: A review of selected key constructs. Depress Anxiety 23: 51-61 (2006). [216] Starcevic V.: Anxiety states: A re­ view of conceptual and treatment is­ sues. Curr Opin Psychiatry 19: 79-83 (2006). [217] Stein D.J., Berk M., Els C., et al.: A double-blind placebo-controlled trial of paroxetine in the management of social phobia (social anxiety disorder) in South Africa. S Afr Med J 89:402406.(1999). [218] Stein D.J., Stein M.B., Goodwin W., et al.: The selective serotonin reuptake inhibitor paroxetine is effective in more generalized and in less general­ ized social anxiety disorder. Psychop­ harmacology 158:267–272 (2001) [219] Stein D.J., Westenberg H.G., Yang H., Li D., Barbato L.M.: Paroxetine treat­ ment of generalized social phobia (so­ cial anxiety disorder): A randomized [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] controlled trial. JAMA 26:708-713 (1998). Stein M.B., Fyer A.J., Davidson J.R., Pollack M.H., Wiita B.: Fluvoxamine treatment of social phobia (social anxi­ ety disorder): A double-blind placebocontrolled study. Am J Psychiatry 156:756-760 (1999). Stein M.B., Kasper S., Andersen E.W., et al.: Escitalopram in the treatment of social anxiety disorder: Analysis of ef­ ficacy for different clinical subgroups. Depress Anxiety 20: 175-181 (2005 a). Stein M.B., Pollack M.H., Bystritsky A. et al.: Efficacy of low and higher dose extended - release venlafaxine in generalized social anxiety disorder: A 6-month randomized controlled trial. Psychopharmacology 177: 280-288 (2005 b). Stein M.B., Sareen J., Hami S., Chao J.: Pindolol potentiation of paroxetine for generalized social phobia: A dou­ ble-blind, placebo-controlled croos­ over study. Am J Psychiatry 158: 1721727 (2001). Strauss B., Burgmeier-Lohse M.: Evaluation einer stationären Langzeit­ gruppenpsychotherapie. Ein Beitrag zur differentiellen Psychotherapiefor­ schung im stationären Feld. Psychother Psychosom Med Psychol 44:184–192 (1994). Stravynski A., Arbel N., Bounader J., et al.: Social phobia treated as a prob­ lem in social functioning: A controlled comparison of two behavioural group approaches. Acta Psychiatr Scand 102: 188-198 (2000). Susman J., Klee B.: The role of highpotency benzodiazepines in the treat­ ment of panic disorder. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 7: 5-11 (2005). Taylor S.: Meta-analysis of cognitivebehavioral treatments for social pho­ bia. J Behav Ther Exp Psychiatry 27: 1-9 (1996). Telch M.J., Agras W.S., Taylor C.B., et al.: Combined pharmacological and behavioral treatment for agoraphobia. Behav Res Ther 23:325–335 (1985). Thase M.E., Jindal R.D.: Combining psychotherapy and psychopharmacol­ ogy for treatment of mental disorders. In: Lambert M.J. (ed.) Bergin and Garfield´s Handbook of psychotherapy and behaviour change. 5th ed.John Wiley & Sons, New York, 743-766 (2004). Trull T.J., Nietzel M.T., Maier A.: The use of meta-analysis to assess the clini­ cal significance of behavior therapy for agoraphobia. Behav Ther 19: 527-538 (1988). 69 [231] Turk C.L., Lerner J., Heimberg R.G., Rapee R.M.: An integrated cognitivebehavioral model of social anxiety. In: Hofmann S.G., Di Bartolo P.M. (eds.) From social anxiety to social phobia: Multiple perspectives. Allyn, Bacon, Heedham Heights, 281-303 (2002). [232] Van Ameringen M., Mancini C., Pipe B., Bennett M.: Optimizing treatment in social phobia: A review of treatment resistance. CNS Spectr 9: 753-762 (2004). [233] Van Ameringen M., Mancini C., Wil­ son C.: Buspirone augmention of se­ lective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in social phobia. J Affect Dis­ ord 39: 115-121 (1996). [234] van Balkom A.J., Bakker A, Spin­ hoven P. et al.: A meta-analysis of the treatment of panic disorder with and without agoraphobia: A comparison of psychopharmacological, cognitive-be­ havioral, and combination treatments. J Nerv Ment Dis 185: 510-516 (1997). [235] Van den Hout M, Arntz A, Hoekstra R (1994) Exposure reduced agoraphobia but not panic, and cognitive therapy reduced panic but not agoraphobia. Behav Res Ther 32:447–451 [236] Van Vliet I.M., den Boer J.A., West­ enberg H.G.: Psychopharmacological treatment of social phobia: Clinical and biochemical aspects of brofaromine, a selective MAO-A inhibitor. Eur Neu­ ropsychopharmacol 2: 21-29 (1992). [237] Van Vliet I.M., den Boer J.A., West­ enberg H.G.: Psychopharmacological treatment of social phobia: A double blind placebo controlled study with fluvoxamine. Psychopharmacology 115: 128-134 (1994). [238] Vanelli M.: Improving treatment re­ sponse in panic disorder. Prim Psy­ chiatry 12: 68-73 (2005). [239] Versiani M., Nardi A.E., Figueria J. et al.: Double-blind placebo-controlled trial with bromazepam in social pho­ bia. J Brasil de Psiquiutria 46: 167-171 (1997). [240] Versiani M., Nardi A.E., Mundim F.D., et al.: Pharmacotherapy of social phobia: A controlled study with mo­ clobemide and phenelzine. Br J Psy­ chiatry 161: 353-360 (1992). [241] Watanabe N., Churchill R, Furukawa T.A.: Combination of psychotherapy and benzodiazepines versus either therapy alone for panic disorder: a sys­ tematic review. BMC Psychiatry 14, 18 (2007). [242] Wells A., Papageorgiou C.: Brief cog­ nitive therapy for social phobia: a case series. Behav Res Ther 39:713–720 (2001). [243] Westen D., Morrison K.: A multidi­ mensional meta-analysis of treatments for depression, panic, and generalized Kapfhammer anxiety disorder: An empirical exami­ nation of the status of empirically sup­ ported therapies. J Consult Clin Psy­ chol 69:875–899 (2001). [244] Wiborg I.M., Dahl A.A.: Does brief dynamic psychotherapy reduce the re­ lapse rate of panic disorder? Arch Gen Psychiatry 53:689-694 (1996). [245] Zerbe K.J.: Uncharted waters: Psy­ chodynamic considerations in the di­ agnosis and treatment of social phobia. Bull Menninger Clin 58 (Suppl A) A3–A20 (1994). 70 [246] Zitrin C.M., Klein D.F., Woerner M.G.: Treatment of agoraphobia with group exposure in vivo and imipramine. Arch Gen Psychiatry 37:63–72 (1980). [247] Zitrin C.M., Klein D.F., Woerner M.G.: Treatment of phobias I: Comparison of imipramine hydrochloride and place­ bo. Arch Gen Psychiatry 40:125–138 (1983). Univ. Prof. Dr.med. Dr.phil. Hans-Peter Kapfhammer Klinik für Psychiatrie Medizinische Universität Graz [email protected] Übersicht Review Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 2/2008, S. 71–82 Depressive Symptome und das Idiopathische Parkinson Syndrom (IPS): Ein Review Giancarlo Giupponi1, Roger Pycha2, Andreas Erfurth3, Armand Hausmann4 und Andreas Conca5 1 Psychiatrische Dienste Bozen, Italien 2 Psychiatrische Dienste Bruneck, Italien 3 Univ.-Klinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Wien 4 Univ.-Klinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck Abteilung für Psychiatrie, Landeskrankenhaus Rankweil 5 Schlüsselwörter: Idiopathisches Parkinsonsyndrom – organische Depression – Diagnose – Therapie Keywords: ideopathic parkinson’s syndrome – organ- den. Dopamin-Agonisten der neuen Generation und Antidepressiva sind die Basis der medikamentösen Behandlung. Ein auf theoretischen Überlegungen basierender therapeutischer Algorithmus wird tabellarisch vorgestellt. ic depression – diagnosis – therapy Depressive Symptome und das Idiopathisches Parkinson Syndrom (IPS): Ein Review Das IPS ist mit einer Prävalenz von 2% die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Neben den psychotischen, kognitiven und Verhaltensstörungen, welche dieses Syndrom begleiten, fokussieren die Autoren auf die Pathogenese, Klinik und Therapie depressiver Symptome im Rahmen des IPS. Metaanalytische Daten sprechen von einer durchschnittlichen Prävalenz depressiver Symptome von 31%. Bei der Depression im Rahmen einer Parkinsonerkrankung liegt eine komplexe Verflechtung psychologischer und biologischer Faktoren vor, welche klinisch schwierig zu fassen ist da die Symptome sich von typischen depressiven Bildern unterschei© 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Depressive symptoms and the Ideopathic Parkinson’s Syndrome (IPS): A review The prevalence of the Ideopathic Parkinson’s Syndrome sums up to 2% and ranks second in the list of neurodegenerative diseases. Beside psychotic, cognitive and behavioral symptoms that go along with the IPS, the authors focus on epidemiology, pathogenesis as well as diagnosis and therapy of depressive symptoms seen in the context of IPS. Metaanalytic data on the prevalence of depressive symptoms sum up to 31%. As depression in IPS relies on a complex interaction of psychological and biological causes the clinical picture is difficult to assess because symptomatology differs from classical depression. Dopamine agonists as well as antidepressants present the mainstay in biological therapeutic interventions. A therapeutic algorithm based on theoretical considerations is presented. Einleitung Das Idiopathische Parkinson Syndrom (IPS-Morbus Parkinson-) ist mit einer altersabhängigen Prävalenz von 2% eine der häufigsten neurologischen Störungen. Meist liegt der Erkrankungsbeginn dieser nach dem Morbus Alzheimer zweithäufigsten neurodegenerativen Erkrankung zwischen dem 55. und 65. Lebensjahr. [1,2] Die Störung war seit jeher aufgrund ihrer typischen motorischen Symptome wie Tremor, Rigor, Hypokinese und Haltungsinstabilität als rein neurologisch definiert, obwohl in den Erstbeschreibungen von Parkinson 1871 und von Charcot und Vulpian 1861-62 auch markante psychiatrische Symptome zu finden sind und die Erkrankung in den letzten Jahren zunehmend routinemäßig auch die Psychiatrie beschäftigt. Diese späte Aufmerksamkeit erklärt sich einerseits aus der diagnostischen Vorliebe der Ärzte für das sichtbare und leicht prüfbare motorische Bild und anderseits aus der defensiven Haltung einiger psychiatrischer Schulrichtungen gegenüber den als „organisch“ definierten Krankheiten und ihren psychischen Aspekten. Man überließ oft den Neurologen das Feld, und diese fokussierten auf andere Symptome. Giupponi, Pycha, Erfurth, Hausmann, Conca Moderne Behandlungsmöglichkeiten der motorischen Krankheitskomponente hatten verbesserte Lebensqualität und verlängerte Lebenserwartung zur Folge, und die stürmische Entwicklung der Neuropsychiatrie machte therapeutische Eingriffe zur Besserung der psychischen Symptomatik systematisch möglich, sodass das Augenmerk der behandelnden Ärzte zunehmend auch auf psychiatrische Aspekte fallen konnte. Die Lebensqualität von Parkinsonpatienten wird jenseits der motorischen Einschränkungen auch durch, kognitive und affektive Defizite beschnitten. [3] Die Stimmung beeinflusst offenbar unabhängig vom motorischen Bild die Schmerzsymptomatik [4], die Compliance, die kognitive Leistung, die organische Symptomatik [5], die Lebensqualität der Patienten und belastet die Beziehung zu Angehörigen und Helfern – weshalb es angezeigt ist, sich mit ihr auseinanderzusetzen. [6,7,8]. Klassifikation der psychiatrischen Aspekte Das psychiatrische Spektrum des IPS ist 4 großen Segmenten zuordenbar: 1. Die kognitiven Störungen: Betroffen sind zu Beginn der Erkrankung vorwiegend die frontalen exekutiven Funktionen .[9] Sie können Ausdruck eines neurodegenerativen Prozesses sein , der allmählich zu einer Demenz, aber auch zu fokalen kognitiven Defiziten führt; Abzugrenzen sind sie von medikamentös induzierten Verwirrtheitszuständen und von kognitiven Störungen im Rahmen einer Depression, die allerdings überzufällig häufig bei Parkinsonpatienten Vorläufer einer dementiellen Entwicklung sind. [10] 2. Die affektiven Störungen: Entsprechend der Diagnosekriterien nach ICD 10 können sie als depressive Episode, Dysthymie, Anpassungsstörung und Angststörung klassifiziert werden. 3. Die psychotischen Störungen: Dabei kann man ein hirnorganisch begründbares paranoid halluzinatorisches Syndrom (wie z.B. Delirium, Halluzinose und Verwirrtheitszustand mit und ohne medikamentöse Einflüsse) von depressiven Episoden ev. mit psychotischen Symptomen abgrenzen. [11] 4. Die Verhaltensstörungen: Sie hängen mit der Akzentuierung der Persönlichkeitsmerkmale zu­ sam­men und sind vielen psycho­ organischen Störungen gemein. Epidemiologie depressiver Symptome Die depressiven Symptome Energieund Antriebsarmut, motorische Verlangsamung, Insomnie, geringer oder übermäßiger Appetit, Konzentrationsund Entscheidungsfindungsstörungen entsprechen den Symptomen des IPS. Dieser Umstand limitiert eine eindeutige epidemiologische Beurteilung der Komorbidität. So ist es auch nicht verwunderlich, dass in Abhängigkeit von Methodik und Diagnosekriterien die Prävalenz der Depression bei Parkinsonpatienten von 4 bis 75% variiert. [12] Eine profunde Metaanalyse mit 45 Studien und 5911 ParkinsonPatienten ergibt eine durchschnittliche Prävalenz von 31% mit einer Varianz von 20-40%. Diese leitet sich aus 42,4% unter Anwendung präziser nosologischer Kriterien, aus 37,5% bei Verwendung von Beurteilungsskalen und aus 23,7% bei klinischer Diagnosestellung ohne Hilfsmittel ab. Die durchschnittliche Prävalenz der Analyse ist immerhin doppelt so hoch wie die 16% Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung. [13,14, 15, 16] Eine weltweite Studie der WHO mittels des BDI (Beck Depression Inventory) ergab eine Prävalenz depressiver Symptome bei 50% der Patienten. Dabei waren sich nur 2% der Patienten der Depression bewusst und nur 1% der Helfer nahm sie wahr. [17] 72 Nicht immer ist eine typische depressive Episode diagnostizierbar. Diese Schwierigkeit besteht üblicherwiese bei der Beurteilung älterer Patienten, bei denen depressive Symptome insgesamt zu selten diagnostiziert werden. Depressive Symptome, die nicht ausreichend sind, um eine Depression zu diagnostizieren, sind bei 20% der über 65jährigen zu beobachten und werden häufig als Nebenwirkungen von Pharmakotherapien fehlgedeutet. Einige Autoren [18] beschreiben eine seltene Komorbidität zwischen IPS und Major Depression (7,7% der Fälle), während leichte depressive Syndrome oder einzelne depressive Symptome sehr häufig seien (45,5%). Am häufigsten bestehen einzelne depressive Symptome (bei mehr als 50% der Patienten) [1], die zur Diagnose einer Anpassungsstörung führen und eine wenngleich geringfügige funktionelle Beeinträchtigung nach sich ziehen. Risikofaktoren für eine Depression bei Parkinsonpatienten sind weibliches Geschlecht [18], Depression in der Vorgeschichte [19], früher Beginn der Parkinsonerkrankung (vor dem 55. LJ) [20], Rechtslastigkeit der motorischen Symptome (19) oder atypisches IPS (rigordominante, akinetische oder vaskuläre Formen). [21] Nicht unerwähnt sollte auch die Tatsache bleiben, dass die Parkinsonkrankheit per se schwierig zu diagnostizieren ist. Selbst wenn von Experten nach standardisierten Kriterien durchgeführt, zeigen post mortem Untersuchungen (der Gold-Standard) eine Fehlerrate von bis zu 25 %.[22] Pathogenese Grundsätzlich liegen zwei Erklärungsmodelle affektiver Störungen, nämlich ein reaktives und ein biologisches, vor. Depressive Symptome und das Idiopathische Parkinson Syndrom (IPS): Ein Review Die reaktive Hypothese sieht eine psychische Reaktion auf die zunehmenden körperlichen Beeinträchtigungen im Vordergrund. Diese Reaktion ist allen chronischen und invalidisierenden Krankheiten gemeinsam, tritt aber bei IPS häufiger auf und scheint nicht linear mit dem Schweregrad der Erkrankung zu korrelieren. [23] Autoren wie Liebermann bezweifeln diese Häufigkeit grundsätzlich und führen als Argument dafür das Fehlen von Scham-, Schuld- und Traurigkeitsgefühlen an; die vorhandene oder nicht vorhandene Dysfunktionalität des dopaminerg dominierten mesokortikalen Regelkreises, der den orbitofrontalen Kortex (OFC) mit einschließt, könnte dabei von entscheidender Relevanz sein. Die biologische Hypothese bezieht sich auf die neurochemische Basisstörung, nämlich den Dopaminmangel. Die Symptome Apathie und Anhedonie lassen sich dem subkortikalen Regelkreis Ncl Accumbens, Ventrales Striatum, über den Ventralen Globus Pallidus zum Thalamus und dem vorderen Gyrus Cinguli und wiederum zurück zum Ncl. Accumbens zuschreiben; dieser Regelkreis liegt in unmittelbarer anatomisch-funktioneller Nachbar­ schaft zum motorischen nigrostriatalen System, welches von der Substantia Nigra zum Dorsalen Striatum, vom Dorsalen Globus Pallidus zum Thalamus, weiter zum supplementorischen motorischen Kortex und zurück ins Dorsale Striatum zieht. [24] Weitere Symptome der Depression lassen sich auch zwei anderen subkortikalen- kortikalen Regelkreisen 1. vom OFC übers Caudatum zum Globus Pallidus, Thalamus und zurück zum OFC und 2. dem dorsolateralen Präfrontalen Kortex (DLPFC) übers Caudatum zum Globus Pallidus, weiter zum Thalamus und zurück zum DLPFC zuordnen. [25] Neben diesem Dopaminmangel im Putamen, im lateralen Hypothalamus, im Nucleus Accumbens und im Nucleus Caudatus konnte auch eine herabgesetzte serotonerge Aktivi- tät im temporalen Pol des Nucleus Caudatus und im frontalen Pol des Hippocampus sowie in den dorsalen Raphe Kernen und im Liquor nachgewiesen werden; da allerdings Serotonin die dopaminerge Ausschüttung im Striatum hemmt, könnte diese Reduktion auch als ein adaptativer Prozeß verstanden werden. So könnte auch erklärt werden, weshalb die Depression häufig dem IPS vorausgeht und weshalb eine Behandlung mit SSRI einen Parkinson erst demaskiert. [26, 27, 28] Andererseits konnten Scholtissen und Mitarbeiter 2006 in funktionellen Testversuchen nachweisen, dass die nicht-spezifische serotonerge Aktivität und die selektive HT-5 1 A Rezeptor-Modulation selbst im frühen Stadium des IPS weder die kognitive Leistung noch die Stimmung direkt beeinflussen, sehr wohl aber die Bradykinese. [29] Auch in den noradrenergen und cholinergen Systemen sind Dysfunktionalitäten bei Parkinsonpatienten mit depressiven Störungen nachgewiesen worden. [30,31,32] Diese Ergebnisse sind durch PET- und MRI-Befunde belegt [33, 34, 35, 36, 37] und erneuern die Hypothesen des Gleichgewichtes zwischen diesen beiden Neurotransmittern und ihrer Bedeutung für die Modulation der Stimmung, des Antriebs, der Psychomotorik, des Affekt-Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit und der Konzentration. Allerdings wäre es verfehlt, einzelne Neurotransmitter oder „TransmitterPaare“ für die Erklärung eines dynamischen komplexen Prozesses, wie ihn die depressive Störung an sich, und umso mehr die Komorbidität mit dem IPS, darstellt, heranzuziehen. Die Vielfalt und Variabilität der funktionellen Störung der Neurotransmitter und ihrer verschiedenen Rezeptoren in diversen Hirnregionen sind für die Heterogeneität der psychischen Symptome und für den Schweregrad der Depression verantwortlich. [38] Einblicke in die Pathophysiologie der affektiven Störungen gibt uns auch die tiefe Hirnstimulation. Die Stimulation des Ncl Subthalamicus, aber 73 auch angrenzender Regionen kann unabhängig von der motorischen Besserung mit depressiven, manischen, panischen, aber auch rasch wechselnden Stimmungszuständen einhergehen, sogar eine erhöhte Inzidenz an Suizidalität wurde beschrieben. [39, 40] Andererseits wurden auch deutliche positive und andauernde Effekte auf die Stimmung und Neurokognition beobachtet. [41] Die Anatomie mit der unmittelbaren Nachbarschaft zum Ventralen Tegmentum, dem dopaminergen Ursprung der mesolimbischen und mesokortikalen Bahnen und die direkt und indirekt mit dem Ncl. Subthalamicus in Verbindung stehenden katecholaminergen und serotonergen Pfade erklären dessen eigenständigen Beteiligung an der Entsehung affektiver Prozesse. Bei einem Volumen des Ncl subthalamicus von 10 mm Breite, 6 mm Tiefe und 8 mm Länge mit ca 540.000 Neuronen, die in 3 funktionelle (motorische, assoziative und limbische) Gruppen mit entsprechenden subkortikalen-kortikalen Verbindungen unterteilt sind, kann es leicht geschehen, dass innerhalb der Struktur oder in angrenzenden Regionen nicht selektiv mitstimuliert wird, was auch die zum Teil widersprüchlichen Beschreibungen der Psychopathologie erklären würde. [42,43] Klinisch-diagnostische Aspekte Die psychopathologische Aussagekraft der affektiven Symptome wird durch die motorischen Defizite eingeschränkt. Diese verändern die üblichen Grenzen der Dauer, Flüssigkeit, Modulierbarkeit und Intensität des motorischen Ausdrucks, die im Verlauf des psychiatrischen Gesprächs eine Unterscheidung zwischen physiologischen und pathologischen Schwankungen der Affekte ermög­ lichen. Das Gespräch, die Haltung, die Gestik, die Mimik des Gesichts, die Giupponi, Pycha, Erfurth, Hausmann, Conca unwillkürliche Körpersprache (die vom autonomen System gesteuert wird), der motorische Antrieb und die Schlafstörung dürfen die Diagnose nur partiell beeinflussen. Beinahe alle Beurteilungsskalen der Depression, die richtigerweise bei reinen Depressionen auch deren motorische Komponente berücksichtigen, ergeben bei Parkinsonpatienten fälschlicherweise erhöhte Depressionswerte. Deshalb sollten bei IPS am ehesten jene Instrumente Verwendung finden, die motorische und somatische Aspekte der Depression kaum berücksichtigen. Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, empfehlen einige Autoren, auf die subjektiven Depressionsempfindungen der Patienten, wie Leeregefühl, Verzweiflung, Affektarmut und Anhedonie zu fokussieren. Eine Ausnahme liegt vor, wenn die depressiven Symptome der Parkinsonerkrankung vorausgehen. Das Risiko depressiver Patienten, ein IPS zu entwickeln wird mit 3.13 angegeben. [44] In diesen Fällen, die Früherkrankungen mit mäßigem Schweregrad und positiver Familienanamnese darstellen (ca. 25 % aller Fälle) [45,23] folgen die motorischen Symptome dem depressiven Bild und erschweren die Diagnose nicht. Offen bleibt, ob die affektiven Symptome Frühzeichen des IPS sind oder eben ein erhöhtes Risiko darstellen; dabei wäre auch zu klären, ob depressive Symptome nicht überhaupt ein „allostatic load“ für neurodegenerative Störungen bedeuten (siehe Zusammenhang Depression-IPS; Depression-Alzhei­ mer; Depression-cerebrovaskuläre Störungen). [46] In diesem Fall erübrigt sich die Diskussion um den Begriff der „reaktiven Depression“, da ein Patient nicht auf eine schwere chronische Erkrankung depressiv reagieren kann, an der er noch nicht leidet. Darüber hinaus stützen bedeutsame Befunde die Hypothese einer biologischen Genese der Depression, auch wenn die Unterscheidung zwischen „endogen“ und „reaktiv“ ein komplexes Phänomen bleibt. [47] Die klinische Ausprägung der depressiven Störung ist auch von anderen Faktoren wie der medikamentösen Behandlung und allfälligen Nebenwirkungen, dem fortgeschrittenen Alter mit seinen psychosozialen Implikationen, der psychischen Reaktion auf motorische Einschränkung und Behinderung, der eventuellen Beteiligung anderer höherer Hirnfunktionen und der Komorbidität mit anderen Krankheiten abhängig. [48] So liegt bei der Depression im Rahmen einer Parkinsonerkrankung eine komplexe Verflechtung psychologischer und biologischer Faktoren vor. Grundsätzlich werden drei Varianten beschrieben: Die depressive Episode (die ca. bei 50% der Fälle vorliegt), die Anpassungsstörung (die ca. die zweite Hälfte der Fälle ausmacht) und ein depressives Bild kombiniert mit Angst-Paniksymptomatik (das eine kleine Minderheit der Fälle ausmacht) (49). Die Persönlichkeit des Patienten und die Schwierigkeiten, das Auftreten oder die Verschlechterung der Erkrankung zu akzeptieren, nehmen Einfluss auf den Krankheitsverlauf der depressiven Störung und des IPS. [50] Der Zusammenhang zwischen Schwere­grad der Beeinträchtigung, be­sonderen motorischen Symptomen (wie rechter Hemiparkinson, im Vordergrund stehende Bradykinesie oder Rigor), kognitiven Störungen, Erkrankungsalter und Depression ist trotz der Ergebnisse einiger Studien Gegenstand offener Diskussionen. Die Persönlichkeit des Patienten ist ein bedeutsames Element aller psychiatrischen Störungen und beeinflusst auch bei Parkinsonpatienten den Ausdruck affektiver Symptome. Die Persönlichkeitsmerkmale können die Symptome im Sinn einer Glättung oder Verstärkung modulieren. Vor allem bei älteren Patienten treten maskierte oder somatisierte Depressionen sehr häufig auf. Einige Autoren haben eine prämorbide Persönlichkeit zu definieren versucht, die von rigiden, introvertierten, ängstlichen und zu Abhän- 74 gigkeit neigenden Verhaltensweisen bestimmt wäre. Allerdings bleibt unklar, ob dieses Bild nicht einem unauffälligen Krankheitsbeginn mit noch wenig evidenten Symptomen entspricht. [13] Um dennoch einen praktikablen und flexiblen Umgang mit den gängigen Diagnosesystemen zu gewährleisten und in der Diagnostik kategorial (=syndrom-orientiert) vorzugehen, sind die Symptom- und Zeit-Kriterien der Affektiven Störung und der Depressiven Episode nach DSM IV in Tabelle 1 und 2 angeführt. Präzisere Angaben sind den Handbüchern des DSM IV oder des ICD 10 zu entnehmen [51,52].Wie oben beschrieben sind die von den Patienten angegebenen Symptome oft nicht zureichend, um die Diagnose einer Major Depression zu stellen, sondern erfüllen die Kriterien einer leichten depressiven Störung oder einer Dysthymie (Tabelle 2). [19] Die Symptome der Depression bei IPS scheinen sich von typischen depressiven Bildern abzuheben. Einige Autoren [53,54,55] haben in diesem Fall das Fehlen bestimmter Symptome wie negative Selbsteinschätzung, Schuld- oder Versagensgefühle, Selbstanklage, Selbsthass oder Selbstbestrafung bemerkt. Andere Autoren unterstrichen eine starke Dysphorie, Ängstlichkeit und pessimistische Zukunftssicht, sowie eine Reizbarkeit und gedankliche Auseinandersetzung mit dem Suizid bei geringer Tendenz zur Verwirklichung. Halluzinationen träten bei entsprechenden depressiven Episoden selten auf. Die Untersuchung der psychopathologischen Unterschiede hat die Hypothese genährt, IPS-Patienten entwickelten auch auf der Basis biologischer Besonderheiten andere Depressionsformen als Patienten mit typischen affektiven Störungen. [56] Van Praag hat eine ängstlich/ dysphorisch/irritable Form, die mit Serotoninmangel korreliert sein soll, von einer Form mit Einschränkungen der Motivation und des Antriebs, die Depressive Symptome und das Idiopathische Parkinson Syndrom (IPS): Ein Review 75 Diagnostische Kriterien im DSM IV für die Affektive Störung Aufgrund von (in diesem Fall einem Morbus Parkinson) (293.83). Im ICD 10 wird diese Störung organische depressive Störung (F06.32) genannt. A Eine bedeutsame und dauerhafte Störung der Stimmung beherrscht das klinische Bild und ist von einem (oder beiden) der folgenden Symptome gekennzeichnet: 1. gedrückte Stimmung oder markanter Verlust von Interesse oder Freude an (beinahe) allen Aktivitäten 2. gehobene, expansive oder gereizte Stimmung B Aus Anamnese, körperlicher Untersuchung oder Laborbefunden geht hervor, dass die Störung die direkte körperliche Folge eines medizinischen Krankheitsfaktors ist. C Das affektive Störungsbild kann nicht besser durch eine andere psychische Störung erklärt werden (z. Bsp. Anpassungsstörung mit depressiver Stimmung), die sich als psychische Reaktion auf die psychosoziale Belastung, an einer körperlichen Krankheit zu leiden, entwickelt. D Die Störung tritt nicht ausschließlich im Verlauf eines Delirs auf. E Die Symptome führen zu klinisch bedeutsamen Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen Diagnostische Kriterien für die Major Depression (296.2x). Im ICD 10 heißt diese Störung depressive Episode (F32.xx) A Vorliegen einer Episode einer Major Depression (siehe unten). B Die Episode ist nicht eher als Schizoaffektive Störung einordenbar und ist nicht einer Schizophrenie, einer Schizopfreniformen Störung, Wahnhaften Störung oder einer Anderen Psychotischen Störung superponiert. C Eine Manische, Hypomanische oder Gemischte Episode war nie vorhanden. Kriterien des DSM IV für eine Episode einer Major Depression A Fünf (oder mehrere) der folgenden Symptome sind gleichzeitig während zweier Wochen vorhanden und bedingen eine Veränderung gegenüber dem vorbestehenden Funktionszustand, mindestens eines der Symptome ist 1. gedrückte Stimmung oder 2. Verlust von Interessen und Freude (subjektiv beschrieben oder objektiv beobachtet) 3. Gedrückte Stimmung fast den ganzen Tag über und beinahe jeden Tag, die vom Betroffenen beschrieben (er fühlt sich z. B. traurig und leer) oder von anderen beobachtet wird (erscheint z. B. klagsam) 4. Markante Interesse- oder Freudlosigkeit beinahe den ganzen Tag über und fast jeden Tag 5. Signifikanter Gewichtsverlust ohne Diät oder Gewichtszunahme (z.B. um mehr als 5% des Körpergewichts in 1 Monat) oder Verlust oder Steigerung des Appetits beinahe jeden Tag 6. Insomnie oder Hypersomnie fast jeden Tag 7. Agitiertheit oder psychomotorische Verlangsamung fast täglich (von anderen beobachtet, nicht allein subjektiv empfunden) 8. Müdigkeit und Energieverlust fast täglich 9. Übertriebene und inadäquate Minderwertigkeits- und Schuldgefühle (die wahnhaft sein können) beinahe täglich (sie gehen über die einfachen Selbstvorwürfe oder Schuldgefühle wegen der Erkrankung hinaus) 10. Fast täglich reduzierte Denk-, Konzentrations- oder Entscheidungsfähigkeit (subjektiver Eindruck oder beobachtbares Phänomen) 11. Wiederkehrende Todesgedanken (nicht bloße Angst vor dem Tod), wiederkehrende Suizidideen ohne oder mit konkretem Suizidplan, Suizidversuche B Es liegt keine Gemischte Episode vor. C Die Symptome verursachen klinisch bedeutsamen Leidensdruck oder Einschränkungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. D die Symptome sind nicht auf die direkte körperliche Wirkung oder Nebenwirkung einer Substanz (Droge, Medikament) und nicht auf einen medizinischen Krankheitsfaktor (z. B Hypothyreose) zurückführen lassen. E Die Symptome sind nicht leichter durch Trauer erklärbar: Sie persistieren nach dem Verlust einer geliebten Person länger als 2 Monate oder sind von deutlicher funktioneller Beeinträchtigung, pathologischen Minderwertigkeitsgefühlen, Suizidgedanken, psychotischen Symptomen oder psychomotorischer Verlangsamung begleitet. Tabelle 1:Kategoriale Kriterien für depressive Störungen nach DSM IV Giupponi, Pycha, Erfurth, Hausmann, Conca 76 Diagnostische Krierien des DSM IV für die Dysthymie (300.4, entspricht im ICD 10 F34.1) A Depressive Stimmung den größten Teil des Tages über, beinahe täglich, laut Angabe des Betroffenen und Beobachtung anderer, für mindestens 2 Jahre B 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vorhandensein von zwei oder mehreren der folgenden Symptome während der depressiven Verstimmung: geringer oder übermäßiger Appetit Insomnie oder Hypersomnie wenig Energie oder Asthenie geringes Selbstvertrauen Konzentrations- und Entscheidungsfindungsstörungen Verzweiflung C Während der 2 Krankheitsjahre war der Betroffene nie für länger als ununterbrochene 2 Monate frei von den unter A oder B aufgezählten Symptomen D Während der ersten 2 Krankheitsjahre war keine Episode einer Major Depression präsent, d.h., die Störung kann nicht eher als chronische Major Depression oder als Major Depression in Teilremission beschrieben werden. E Es war nie eine manische, gemischte oder hypomanische Episode vorhanden, auch die Kriterien für eine zyklothyme Störung sind nie erfüllt gewesen. F Die Erkrankung manifestiert sich nicht ausschließlich während einer chronischen psychotischen Störung, wie Schizophrenie oder wahnhafte Störung. G Die Symptome sind nicht unmittelbar von einer Substanz oder einem medizinischen Krankheitsfaktor verursacht. H Die Symptome verursachen klinisch relevante Leidenszustände oder Beeinträchtigungen des sozialen, beruflichen oder anderer wichtiger Bereiche. Tabelle 2:Kategoriale Kriterien für depressive Störungen nach DSM IV durch Noradrenalin- und Dopaminmangel erklärbar ist, abgegrenzt. [57] Alexopoulos hat eine bevorzugt die Exekutivfunktionen einschränkende Form beschrieben, die vor allem ältere Patienten mit psychomotorischer Verlangsamung und Apathie beträfe. Diese Form könnte durch Defizite in den frontostriatalen Bahnen und an den D3-Rezeptoren erklärt werden und geringes Ansprechen auf Antidepressiva und Chronifizierungsneigung zur Folge haben. [58] Kirsch et al. konnten hingegen zeigen, dass gerade die Apathie ein typisches Symptom des IPS ist und nicht der Depression. [59] Teilweise werden diese verschiedenen Befunde von Ehrt et al. [60] bestätigt; was heißt, dass geriatrische depressive Patienten ohne IPS im Vergleich zu denen mit IPS deutlich weniger Konzentrationsstörungen hatten, aber ausgeprägtere depressive Stimmungslagen und Schuldgefühle, allerdings auch eine bedeutendere Antriebslosigkeit. Eigens zu erwähnen und mit therapeutischen Konsequenzen verbunden ist die mit 60% hohe Inzidenz der isolierten Schlafstörung beim IPS. Sie geht häufig mit einem hohen depressiven Score einher und kann deshalb im Rahmen eines Syndroms missverstanden werden. [61] Therapie Jede medikamentöse antidepressive Therapie muss Teil eines ganzheitlichen Therapieplans sein, der psychologische und soziale Maßnahmen einschließt. Der Patient soll eingehend über die Krankheit aufgeklärt und mit einem übersichtlichen Therapiekonzept vertraut gemacht werden, um seine Motivation und Beteiligung an der Behandlung möglichst groß zu halten. Auch über den Ablauf einer antidepressiven Therapie und ihre Wirkungsweise sind Patient und Angehörige eingehend und wiederholt aufzuklären. Die erwünschte Wirkung von Antidepressiva tritt nach 24 Wochen ein, manchmal sind sogar 6 Wochen Wirklatenz zu erwarten.[62] Depressive Symptome und das Idiopathische Parkinson Syndrom (IPS): Ein Review In aller Regel treten Nebenwirkungen deutlich früher auf als der antidepressive Effekt. Über diesen Umstand müssen Patienten und ihre Angehörigen genau informiert werden, damit die Therapie nicht noch vor dem Wirkungseintritt abgebrochen wird. Mitund Zusammenarbeit (compliance und adhearence) sind die Schrittmacher jeder Therapie! Zwei große Substanzklassen (Dopamin-Agonisten der neuen Generation und Antidepressiva) sind die Basis der medikamentösen Behandlung. 1. Die Dopamin-Agonisten der neuen Generation Die zur Behandlung der motorischen Symptome verwendeten Substanzen besitzen aufgrund ihrer dopaminergen Wirkung auch einen antidepressiven Effekt. Stimmungsschwankungen sind während Levodopa-Therapien, vor allem während der on/off-Phasen, beschrieben worden. Pramipexol und Ropinerol, Dopaminagonisten auf D2- und D3-Rezeptoren , sind sogar mit Erfolg zur Augmentation bei therapieresistenten Depressionen eingesetzt worden. [63] Die antidepressive Wirkung scheint mit der D3-Rezeptoraffinität zu korrelieren [64] Der D3 Rezeptor ist in mesolimbischen Regelkreisen vom ventralen Mesencephalon, über den Ncl. Accumbens und den Amygdalae weitläufig exprimiert. [65] Eine eindeutige antidepressive Wirksamkeit von Pramipexol bei geringer Nebenwirkungsrate ist in zwei offenen Studien (n=724) nachgewiesen worden. [66,67,68] Denselben Effekt von Pramipexol ergab auch eine placebokontrollierte Studie. [69] 77 2. Antidepressiva Zur medikamentösen Therapie der Depression bei IPS gibt es viele offene Studien und Fallberichte, aber wenige placebokontrollierte Doppelblindstudien. [70] Die wenigen vorhandenen Studien beschränken sich vorwiegend auf die Verwendung von Trizyklika, entsprechen selten den üblichen Standards und sind zudem in ihrem Design heterogen, was einen Vergleich schwierig macht. [71] In der Vergangenheit hat die Verwendung der üblichen Beurteilungsskalen (die für diese Störung nicht korrekt validiert sind) eine präzise Erfassung des affektiven Zustandes von Parkinsonpatienten erschwert. [72,73] Der Database Cochrane (2003) [74] spricht von mangelndem Wirk­samkeitsnachweis der Elektrokonvulsionstherapie, der Verhaltens- Antidepressiva mit vorwiegender oder selektiver Hemmung der Serotoninwiederaufnahme Trizyklika wie Clomipramin mit vorwiegender Serotonin-Wiederaufnahmehemmung Citalopram, Sertralin, Paroxetin, Fluxetin und Fluvoxamin als selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Venlafaxin als selektiver Serotonin-, und in höheren Dosen auch als selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Nefazodon als vorwiegender Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und Antagonist am 5HT2-Rezeptor Antidpressiva mit vorwiegender oder selektiver Hemmung der Noradrenalin-Wiederaufnahme Trizyklika wie Nortriptylin oder Desipramin mit vorwiegender Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmung Reboxetin als vorwiegender Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Tetrazyklika wie Maprotilin mit vorwiegender Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmung Mianserin als vorwiegender Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer und Antagonist der Histamin-, 5HT2-, Alpha-1-, und Alpha-2-Rezeptoren. Antidepressiva mit Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmung Trizyklika wie Apitriptylin, Imipramin, Doxepin,Venlafaxin, Duloxetin, Milnacipran Antidepressiva mit bevorzugter oder selektiver Dopamin-Wiederaufnahmehemmung Bupropion Monoaminooxydase-Hemmer Moclobemid als selektiver reversibler MAO-A-Hemmer Tranylcipromin als irreversibler nicht selektiver MAO-Hemmer Andere Wirkmechanismen Phytopharmaka: Hypericum soll ein schwacher Serotonin-, Noradrenalin- und Dopaminwiederaufnahmehemmer sein Mirtazapin ist ein Alpha-2- (und ein schwächerer Alpha-1)Rezeptorblocker, antagonisiert aber auch die Histamin-, 5HT2- und 5HT3-Rezeptoren und verstärkt auf indirekte Weise die noradrenerge und serotonerge Transmission Trazodon ist ein schwacher Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und ein 5HT2-, und Alpha-1-Rezeptorantagonist Tabelle 3:Einteilung der Antidepressiva nach ihrer primären Wirkung im ZNS Giupponi, Pycha, Erfurth, Hausmann, Conca therapie und der Antidepressiva. Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2005, die ca. dreißig Publikationen zum Thema berücksichtigt und 11 davon in die Metaanalyse inkludiert, ergibt einen unspezifischen positiven Effekt der antidepressiven Behandlung trotz mangelnder signifikanter Unterschiede zu Placebo. Die Patienten schienen die Antidepressiva gut zu tolerieren und keine Verschlechterung des IPS zu erleiden. [75] Die antidepressiven Substanzen werden gemeinhin nach ihrer chemischen Beschaffenheit oder nach ihrer Hauptwirkung im ZNS eingeteilt (Tabelle 3) Serotonin, Noradrenalin und teilweise auch Dopamin scheinen eine bedeutsame Rolle bei der Pathophysiologie der Depression zu spielen. Fast alle auf dem Markt befindlichen Antidepressiva wirken über eine Hemmung der Wiederaufnahme oder eine Blockade des abbauenden Enzyms auf einen oder mehrere der genannten Transmitter. Neben den SSRI`s ist Bupropione hervorzuheben. Es wirkt als selektiver Dopamin- und Noradrenalin- Wiederaufnahme-Hemmer. Wegen dieses Wirkmechanismus bietet es sich zur Depressions- und Parkinson-Behandlung von Patienten mit IPS geradezu an. Aber es fehlen die kontrollierten Studien; in Fallberichten zumindest werden positive Effekte auf die Symptome des IPS beschrieben: Während die psychoaktive Wirksamkeit bescheiden ist, kann die Tagesmüdigkeit positiv beeinflusst werden. [76,77] Nur wenige Antidepressiva, wie zum Beispiel Mirtazapin, Trazodon, Trimipramin oder die Phytopharmaka weisen alternative Wirkmechanismen auf. Jenseits ihrer Hauptwirkung beeinflussen Antidepressiva zentral auch das Azetylcholin-, das Histamin- und weitere Systeme. Daraus abgeleitete Effekte bedingen das spezifische Profil des Antidepressivums mit und sind oft für Nebenwirkungen verantwortlich (Tabelle 4 und 5). 78 Blockade der muskarinartigen Azetylcholinrezeptoren 1. Akkomodatonsstörungen 2. Mundtrockenheit 3. Obstipation 4. Sinustachykardie 5. Miktionsstörungen, Harnverhalten 6. Zentrales anticholinerges Syndrom mit Kurzzeitgedächnisstörungen, Verwirrtheit, Delir Blockade der Histaminrezeptoren 1. Müdigkeit 2. Sedierung 3. Gewichtszunahme 4. Desorientiertheit, Verwirrtheit Blockade der 5HT-2-Rezeptoren 1. Gewichtszunahmen 2. Angstlösende Wirkung 3. Sedierung Blockade der Dopaminrezeptoren 1. Prolaktinerhöhung 2. Libidoreduktion 3. Extrapyramidal-motorische Bewegungsstörungen Blockade der adrenergen Alpha-1-Rezeptoren 1. Orthostatische Hypotonie 2. Vertigo 3. Müdigkeit 4. reflektorische Tachykardie Tabelle 4:Durch postsynaptische Rezeptorblockade verursachte Nebenwirkungen Bei Therapiebeginn (erste 2 – 4 Wochen): Angst, Agitation, sexuelle Funk­tionsstörungen, Inappetenz und Gewichtsverlust, Reizbarkeit, Nausea, ­ Erbrechen, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche 5HT2A-Rezeptoren 1. Angst 2. Agitation 3. Störungen der Sexualfunktion (persisitieren) 5HT2C-Rezeptoren 1. Inappetenz, Gewichtsverlust 2. Reizbarkeit 5HT3-Rezeptoren 1. Nausea 2. Erbrechen 3. Kopfschmerzen Durch Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmung verursachte Nebenwirkungen 1. Tremor 2. Tachykardie 3. Agitation 4. Kopfschmerz 5. Miktionsstörungen 6. Schweißausbrüche 7. Mundtrockenheit Tabelle 5: Nebenwirkungen der Serotonin-Wiederaufnahmehemmung Depressive Symptome und das Idiopathische Parkinson Syndrom (IPS): Ein Review 79 Therapiephase Procedere Beginn Berücksichtigung nicht-pharmakologischer Faktoren wie Infekte und Dehydrierung Absetzen/Reduktion nicht notwendiger Medikamente und Beginn der Antiparkinsontherapie; Psychoedukation, Soziotherapie, Physiotherapie und Sport, kognitive VT Optimierung der Antiparkinson-Therapie Gabe von Dopaminagonisten der neuen Generation wie Pramipexol als Mono- oder Kombinationstherapie; ev. Absetzen von MAO-B-Hemmern (z.B. Selegilin) mindestens 4-6 Wochen Antidepressive Therapie 1. Wahl SSRI: z.B. Sertralin (Einstiegsdosis 50 mg/d , steigern bis 150 mg/d) Citalopram (Einstieg 20 mg/d, steigern bis 40 mg/d), Paroxetin (Einstieg 20 mg/d, steigern bis 40 mg/d: cave Interaktion CYP 2D6!) mindestens 4-6 Wochen antidepressive Therapie 2. Wahl SNRI: z.B. Reboxetin (Einstieg 4 mg/d, steigern bis 8 mg/d) SDNRI: z.B. Bupropion (Einstieg 150 mg/d, steigern 300 mg/d) wenn auch nicht zugelassen manchmal 450 mg/d Cave Epileptische Anfälle besonders bei Essgestörten mindestens 4-6 Wochen antidepressive Therapie 3. Wahl Kombination von SSRI und SNRI oder Gabe von SSNRI , z.B. Venlafaxin (Einstiegsdosis 150 mg/d, steigern bis 225 mg/d) oder Duloxetin (60 mg/d) mindestens 4-6 Wochen antidepressive Therapie 4. Wahl Gabe von Trizyklika: z.B. Clomipramin (Einstiegsdosis 150 mg/d, steigern bis 250 mg/d) Amitriptylin (Einstieg 150 mg/d, steigern bis 225 mg/d), mindestens 4-6 Wochen antidepressive Therapie 5. Wahl Kombination Antidepressiva und Schlafentzug oder Lithium (cave Kreatinin, Cl und Kognitive Störungen) mindestens 4-6 Wochen Absetzen der antidepressiven Therapie. Diagnostische Neubeurteilung (Ausschluss von Demenz oder anderen progressiven organischen Erkrankungen); eventuell Wiederholung der gesamten Diagnostik. 1 bis 4 Wochen antidepressive Therapie 6.Wahl Gabe von MAO-Hemmern, z.B. Moclobemid (Einstieg 300 mg/d, steigern bis 600 mg/d) Erfahrungsgemäss reichen 600 mg nicht aus. 1200 mg sind oft notwendig (wenn auch nicht zugelassen Tranylcipromin (Einstieg 10 mg/d, steigern bis 30mg/d) antidepressive Therapie 7. Wahl ECT antidepressive Therapie 8. Wahl TMS und VNS Tabelle 6: Algorithmus der ambulanten Depressionsbehandlung beim IPS Dauer Giupponi, Pycha, Erfurth, Hausmann, Conca Bei der Behandlung von (vor allem älteren) Parkinsonpatienten ist die Beurteilung des körperlichen Zustandes von besonderer Wichtigkeit, um Interaktionen mit anderen Krankheitsbildern oder pharmakologischen Therapien zu vermeiden. Beim älteren Patienten tritt die Wirkung von Pharmaka grundsätzlich später ein, auch soll die Therapie mit besonders niedrigen Einstiegsdosen begonnen werden, um das Intoxikationsrisiko zu senken. Einem Patienten mit ausgeprägten kognitiven Störungen, der unter Sedierung und Harnretention leidet, ist von der Verwendung eines Trizyklikums abzuraten, weil anticholinerge und anithistaminische Nebenwirkungen die Compliance eher verschlechtern und das Erreichen eines suffizienten Wirkspiegels wahrscheinlich verunmöglichen würden. Hingegen könnte ein jüngerer Patient von der anticholinergen Wirkung auf seine motorische Störung und vom sedierenden antihistaminischen Effekt profitieren. tigen Wirkungseinritt verbessern und den Effekt der Antidepressiva steigern. Die häufigste flankierende Behandlung nach den Benzodiazepinen stellen atypische Antipsychotika und Hormone dar. Weitere hilfreiche Behandlungsversuche können der Schlafentzug, die Lichttherapie und die TMS sein; für die Elektrokonvulsionstherapie liegen positive Ergebnisse aus Fallserien vor [78] . Es fehlen also evidenzbasierte Daten nach denen man fundierte TherapieEmpfehlungen und -Schritte geben könnte. So fußt der von den Autoren zusammengestellte BehandlungsAlgorithmus (Tabelle 6) nur auf den wenigen kontrollierten Studien zu den SSRI`s, überwiegend aber auf Studien zu Fallserien, einzelnen Kasuistiken und fundierter aber theoretischer Wirkmodelle. [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Literatur [1] Auch wenn die höchste Evidenzstufe für die Wirksamkeit medikamentöser antidepressiver Behandlungen bei dieser Indikation fehlt, ist es aufgrund zahlreicher empirischer Befunde unter Einbezug der Nebenwirkungsund Sicherheitsprofile der einzelnen Substanzen möglich, im Sinne einer individuellen Nutzen/Risiko Abwägung konsensuelle Therapie-Empfehlungen abzugeben. Grundsätzlich wird eine Monotherapie mit einer niedrigen Einstiegsdosis empfohlen, wobei die Substanz zu bevorzugen ist, die bereits in der Vergangenheit gute Wirkung gezeigt hat und ein möglichst günstiges Nebenwirkungsprofil aufweist. Falls auch nach geeigneter Dosiserhöhung kein therapeutisches Ansprechen erfolgt, kann zu einer antidepressiven Kombinationsbehandlung übergegangen werden Auch eine symptomatische Begleittherapie ( z. B. bei starker Angstkomponente mit einem Benzodiazepin) kann die Compliance durch sofor- 80 [2] [3] [4] [5] [6] [7] McDonald W.M., Richard I.H., Delong M.R.: Prevalence, Etiology, and Treatment of Depression in Parkinson´s Disease. Biol Psychiatry 54(3): 363-375 (2003). Leentjens A.F.: Depression in Parkinson’s disease: Conceptual issues and clinical challenges. J Geriatr Psychiatry Neurol 7: 120 – 126 (2004). Hobson P., Golden A., Meara J.: Measuring the impact of Parkinson’s disease with the Parkinson’s Disease Quality of life questionnaire. Age Ageing 28: 341346 (1999). Friedman J.H., Fernandez H.H.: The non-motor problems of Parkinson’s disease. Neurologist 6: 18-27 (2000). Torta R., Borio R.: Depressione e demenza:manifestazioni sindromiche e differenziazione categoriale. Quaderni Italiani di Psichiatria XVIII (2): 5-15 (1999). Caap-Ahlgren M., Dehlin O.: Insomnia and depressive Symptoms in patients with Parkinson’s disease. Relationship to health- related quality of the life. An interview study of patients living at home. Arch Gerontol Geriatr 32: 23-33 (2001). Kuopio A.M., Marttila R.J., Helenius H., Toivonen M., Rinne U.K.: The life quality in Parkinson’s disease. Mov Disord 15: 216-223 (2000). [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] Global Parkinson’s Disease Survey Steering Committee. Factors impacting on life quality in Parkinson’s disease: Results from an international survey. Mov Disord 17: 60-67 (2002). Silberman C.D., Laks J., Capitão C.F., Rodrigues C.S., Moreira I., Vasconcellos L.F., Engelhardt E.: Frontal functions in depressed and nondepressed Parkinson's disease patients: impact of severity stages. Psychiatry Res 149: 285-289 (2007). Lieberman A.: Are dementia and depression in Parkinson's disease related? J Neurol Sci 248: 138-142 (2006) Weintraub D., Morales K.H., Duda J.E,. Moberg P.J., Stern M.B.: Frequency and correlates of co-morbid psychosis and depression in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 12(7): 427-431 (2006). Allain H., Schuck S., Mauduit N.: Depression in Parkinson´s disease. Br Med J 320(7245): 1287-1288 (2000). Slaughter J.R., Slaughter K.A., Nichols D.: Prevalence, Clinical Manifestations, Etiology and Treatment of Depression in Parkinson’s Disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 13: 187-196 (2001). Lieberman A.: Depression in Parkinson's disease- a review. Acta Neurol Scand 113: 1-8 (2006). Brooks D.J., Doder M.: Depression in Parkinson's disease. Curr Opin Neurol14: 465- 470 (2001). Kessler R.C., Berglund P., Demler O.: National Comorbidity Survey Replication. The epidemiology of major depressive disorder: results from the National Comorbidity Survey Replication (NCSR). JAMA 289: 3095-3105 (2003). Yamamoto M.: Depression in Parkinson’s disease: its prevalence, diagnosis, and neurochemical background. J Neurol 248 (Suppl 3): III: 5-11 (2001). Tandberg E., Larsen J.P., Aarsland D.: The occurence of depression in Parkinson’s disease. Arch Neurol 53: 175-179 (1996). Starkstein S.E., Preziosi T.J., Buldoc P.L., Robinson R.G.: Depression in Parkinson’s disease. J Nerv Ment Dis 178: 27-31 (1990) Cole S.A., Woodard J.L., Juncos J.L., Kogos J.L., Youngstrom E.A., Watts R.L.: Depression and disability in Parkinson´s disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosi 8: 20-25 (1996). Tanderberg E., Larsen J.P., Aarsland D., Laake K., Cummings J.L.: Risk factors for depression in Parkinson disease. Arch Neurol 54: 625-630 (1997). Hughes A.J., Daniel S.E., Kilford L.: Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson’s disease: clinico-pathological study of 100 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 55:181-185 (1992). Depressive Symptome und das Idiopathische Parkinson Syndrom (IPS): Ein Review [23] Tom T., Cummings J.L.: Depression in Parkinson’ s disease. Pharmacological characteristics and treatment. Drugs Aging 12: 55-74 (1998). [24] Cummings J.L.: Frontal-subcortical circuits and human behavior. Arch Neurol. 50: 873-880 (1993). [25] Alexander G.E., DeLong M.R., Strick P.L.: Parallel organization of functionally segregated circuits linking basal ganglia and cortex. Annual Rev Neurosci. 9: 357- 381 (1986). [26] Van Praag H.M., De Haen S.: Central serotonergic metabolism and frequency of depression. Psychiatr Res 1: 219-224 (1979). [27] Leo R :J. : Movement disorders associated with the serotonin selective reuptake inhibitors. J Clin Psychiatry 57; 449-454 (1996). [28] Gerber P.E., Lynd L.D.: Selective serotonin reuptake inhibitor-induced movement disorder. Ann Pharmacother 32: 692-698 (1998). [29] Scholtissen B., Verhey F.R., Adam J.J., Weber W., Leentjens A.F.: Challenging the serotonergic system in Parkinson disease patients: effects on cognition, mood, and motor performance. Clin Neuropharmacol 29: 276-85 (2006). [30] Hornykiewicz O., Kish S.J.: Biochemical pathophysiology of Parkinson’s disease. Adv Neurol 45: 19-34 (1986). [31] Remy P., Doder M., Lees A., Turjanski N-, Brooks D.: Depression in Parkinson's disease: loss of dopamine and noradrenaline innervation in the limbic system. Brain 128: 1314-1322 (2005). [32] Bohnen N.I., Kaufer D.I. Hendrickson R., Constantine G.M,. Mathis C.A., Moore R.Y.: Cortical cholinergic denervation is associated with depressive symptoms in Parkinson's disease and parkinsonian dementia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 78: 641-643 (2007). [33] Mayberg H.S., Solomon D.H.: Depression in Parkinson´s disease: a biochemical and organic viewpoint. Adv Neurol 65: 49-60 (1995). [34] Becker T., Becker G., Seufert J., Hoffmann E., Lange K.W., Naumann M., Lindner A., Reichmann H., Riederer P., Beckmann H., Reiners K.: Parkinson´s disease and depression: evidence for an alteration of the basal limbic system detected by transcranial sonography. J Neurol Neurosurg Psychiatry 63: 590596 (1997). [35] Piccini P.: Neurodegenerative movement disorders: the contribution of functional imaging. Curr Opin Neurol 17(4): 45966 (2004). [36] Sossi V., de la Fuente-Fernandez R., Holden J.E., Schulzer M., Ruth T.J., Stoessl J.: Changes of dopamine turnover in the progression of Parkinson's disease as measured by positron emission tom- [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ography: their relation to disease-compensatory mechanisms J Cereb Blood Flow Metab 24(8): 869-76 (2004). Kerenyi L., Ricaurte G.A., Schretlen D.J., McCann U., Varga J., Mathews W.B., Ravert H.T., Dannals R.F., Hilton J., Wong D.F., Szabo Z.: Positron emission tomography of striatal serotonin transporters in Parkinson disease. Arch Neurol. 60(9): 1223-1239 (2003). Torta R.: Depressione, Parkinson ed Epilessia. Mediserve, Milano, (1995) Anderson V.C., Burchiel K.J., Hogarth P., Favre J., Hammerstad J.P.: Pallidal vs subthalamic nucleus deep brain stimulation in Parkinson disease. Arch Neurol. 62: 554-560 (2005). Perriol M.P., Krystkowiak P., Defebvre L., Blond S., Destée A., Dujardin K.: Stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease: cognitive and affective changes are not linked to the motor outcome. Parkinsonism Relat Disord 12: 205-210 (2006). Kalteis K., Standhardt H., KryspinExner I., Brücke T., Volc D., Alesch F.: Influence of bilateral Stn-stimulation on psychiatric symptoms and psychosocial functioning in patients with Parkinson's disease. J Neural Transm. 113: 1191-206 (2006). Kopell B.H., Greenberg B., Rezai A.R.: Deep brain stimulation for psychiatric disorders. J Clin Neurophysiol 21: 51-67 (2004). Temel Y., Blokland A., Steinbusch H.W., Visser-Vandewalle V.: The functional role of the subthalamic nucleus in cognitive and limbic circuits. Prog Neurobiol. 76: 393-341 (2005). Leentjens A.F., Van den Akker M., Metsemakers J.F.: Higher incidence of depression preceding the onset of Parkinson's disease: a register study. Mov Disord 18: 414- 418 (2003). Santamaria J., Tolosa E., Valles A.: Parkinson’s disease with depression: a possibile subgrup of idiopathic parkinsonism. Neurology 36: 1130-1133 (1986). McEwen B.S.: Protective and damaging effects of stress mediators: central role of the brain. Dialogues Clin Neurosci 8: 367-81 (2006). Menza M.A., Colbe L.I., Cody R.A., Forman N.E.: Dopamine-related personality traits in Parkinson´s disease. Neurology 45: 505-508 (1993). Papapetropoulos S., Ellul J., Argyriou A.A., Chroni E., Lekka N.P.: The effect of depression on motor function and disease severity of Parkinson's disease. Clin Neurol Neurosurg. 108: 465-469 (2006). Schiffer R.B., Kurlan R., Rubin A., Boer S.: Evidence for atypical depression in Parkinson's disease. Am J Psychiatry 145(8): 1020-1022.(1988). 81 [50] Costa A., Peppe A., Carlesimo G.A., Pasqualetti P., Caltagirone C.: Major and minor depression in Parkinson's disease: a neuropsychological investigation. Eur J Neurol. 13: 972-80 (2006). [51] American Psychiatric Association. DSM- IV-TR Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali Text Revision Masson (2001) [52] WHO. ICD-10 Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali. Guida tascabile; Masson (1996) [53] Brown R.G., MacCarthy B., Gotham AM et al. Depression and disability in Parkinson’s disease: a follow-up study of 132 cases. Psychol Med 18: 49-55 (1988). [54] Meco G.: I disturbi psichiatrici nei disordini del movimento. “tb today” vol 18, (suppl 3) (1994). [55] Gasparini M., Fabrizio E., Alessandrini A., Meco G. Morbo di Parkinson e Depressione, Studio Descrittivo. Atti XXII Riunione LIMPE, Trieste 457-464 (1995). [56] Mayberg H.S., Solomon D.H.: Depression in Parkinson’s disease: a biochemical and organic viewpoint. Adv Neurl 65: 49-60 (1995). [57] van Praag H.M.: 5-HT-related, anxietyand/or aggression-driven depression. Int Clin Psychopharmacol 9 (Suppl 1): 5-6 (1994). [58] Alexopulos G.S.: The depression-executive dysfunction syndrome of late life: a specific target for D3 agonists? Am J Geriatr Psychiatry 9: 22-29 (2001). [59] Kirsch-Darrow L., Fernandez H.H., Marsiske M., Okun M.S., Bowers D.: Dissociating apathy and depression in Parkinson disease. Neurology 11, 67: 33-38 (2006). [60] Ehrt U., Brønnick K., Leentjens A.F., Larsen J.P., Aarsland D.: Depressive symptom profile in Parkinson's disease: a comparison with depression in elderly patients without Parkinson's disease. Int J Geriatr Psychiatry 21(3): 252-258 (2006). [61] Gjerstad M.D., Wentzel-Larsen T., Aarsland D., Larsen J.P.: Insomnia in Parkinson's disease: frequency and progression over time. J Neurol Neurosurg Psychiatry 78(5): 476-479 (2007). [62] Gelenberg A.J., Chesen C.L .: How fast are antidepressants? J Clin Psychiatry 61(10):712-21 (2000). [63] Corrigan M.H., Denahan A.Q., Wright C.E., Ragual R.J., Evans D.L.: Comparison of pramipexole, fluoxetine, and placebo in patients with major depression. Depress Anxiety 12: 58-65 (2000). [64] Maj J., Rogoz Z., Skuza G., Kolodziejczyk K.: Antidepressant effects of promipexole, a novel dopamine receptor agonist. J Neural Transm 104: 525-533 (1997). Giupponi, Pycha, Erfurth, Hausmann, Conca [65] Cummings J.L.: D-3 receptor agonists: combined action neurologic and neuropsychiatric agents. J Neurol Sci 163: 2-3 (1999). [66] Barone P., Scarzella L., Marconi R., Antonini A., Morgante L., Braccco F., Zappia M., Musch B.: Pramipexole versus sertraline in the treatment of depression in Parkinson´s disease. J Neurol 253: 601-607 (2006). [67] Lemke M.R., Brecht H.M., Koester J., Reichmann H.: Effects of the dopamine agonist pramipexole on depression, anhedonia and motor functioning in Parkinson's disease. J Neurol Sci 248: 26670 (2006). [68] Pahwa R., Stacy M.A., Factor S.A., Lyons K.E., Stocchi F., Hersh B.P., Elmer L.W., Truong D.D., Earl N.L., EASE-PD Adjunct Study Investigators: Ropinirole 24-hour prolonged release: randomized, controlled study in advanced Parkinson disease. Neurology 68: 1108-15 (2007). [69] Corrigan M.H., Denahan A.Q., Wright C.E.: Comparison of pramipexole, fluoxetine, and placebo in patients with major depression. Depress Anxiety 11: 58 – 65 (2000). [70] Lemke M.R., Reiff J.: Therapie der Depression bei Parkinson- Patienten. Arzneimitteltherapie 19: 324-330 (2001). [71] Poewe W., Seppi K.: Treatment options for depression and psychosis in Parkinson’s disease. J Neurol 248 (Suppl 3: III) 12-21 (2001). [72] Weintraub D., Oehlberg K.A., Katz I.R., Stern M.B.: Test Characteristics of the 15-Item Geriatric Depression Scale and Hamilton Depression Rating Scale in Parkinson Disease. Am J Geriatr Psychiatry 14: 169-175 (2006). [73] Visser M., Leentjens A.F., Marinus J., Stiggelbaut A.M., van Hilten J.J.: Reliability and Validity of the Beck Depression Inventory in Patients with Parkinson´s disease. Mov Disord 21(5): 668-672 (2006). [74] Shabnam G.N., Th C., Kho D., H R., Ce C. Therapies for depression in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev.(3): CD003465 (2003). [75] Weintraub D., Morales K.H., Moberg P.J., Bilker W.B., Balderston C., Duda J.E., Katz J.R., Stern M.B.: Antidepressant Studies in Parkinson´s Disease: A 82 Review and Meta- Analysis. Mov Disord Vol 20 N. 9: 1161-1169 (2005) [76] Goetz C.G., Tanner C.M., Klawans H.L.: Bupropion in Parkinson's disease. Neurology 34: 1092-1094 (1984). [77] Rye D.B.: Excessive daytime sleepiness and unintended sleep in Parkinson's disease. Curr Neurol Neurosci Rep. 6(2): 169-176 (2006). [78] Veazey C., Aki S.O., Cook K.F., Lai E.C., Kunik M.E.: Prevalence and treatment of depression in Parkinson's disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 17: 310-323 (2005). Giancarlo Giupponi Psychiatrische Dienste Bozen [email protected] Originalarbeit Original Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 2/2008, S. 83–91 Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der elterlichen Betreuung von Schizophrenie-Kranken? Johannes Wancata1, Marion Freidl1, Fabian Friedrich1, Teresa Matschnig1, Anne Unger1, Andrea Kucera1, Ralf Gössler2 und Rainer Alexandrowicz3 Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien Univ.-Klinik für Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters, Medizinische Universität Wien 3 Institut für Psychologie, Abteilung für Angewandte Psychologie und Methodenforschung, Universität Klagenfurt 1 2 Schlüsselwörter: Angehörige – Schizophrenie – Belas­tun­ gen – Gender Keywords: Caregivers – parents – schizophrenia – burden – gender Gibt esgeschlechtsspezifische Unter­ schiede in der elterlichen Betreu­ ung von Schizophrenie-Kranken? Anliegen: Ziel der vorliegenden Studie war es, Unterschiede zwischen Müttern und Vätern von Kranken, die unter Schizophrenie oder schizoaffektiven Psychosen leiden, zu untersuchen, wobei neben dem zeitlichen Aufwand der Angehörigen auch andere Aufgaben der Betreuung erfasst werden sollten. Methode: Insgesamt wurden 101 Mütter und 101 Väter derselben PatientInnen mit der Diagnose Schizophrenie oder schizoaffektive Störung entsprechend ICD-10 untersucht. Ergebnisse: Es zeigte sich, dass im Mittel Mütter signifikant mehr Zeit als Väter persönlich oder telephonisch in Kontakt mit den Kranken stehen. Bezogen auf die einzelnen Kranken zeigte sich, © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 dass in etwa der Hälfte der Fälle die Mütter mehr Zeit aufwandten, bei nahezu 40% aber Mütter und Väter gleich viel Zeit aufwandten. In 12% der Fälle verbrachten die Väter mehr Zeit in persönlichem oder telephonischem Kontakt mit den Kranken als die Mütter. Bei anderen erfassten Variablen bezüglich der Betreuungsintensität von Müttern und Vätern (z.B. Sachwalterschaft, Betreuung des Haushalts der Kranken, finanzielle Ausgaben) fanden sich keine Unterschiede zwischen Müttern und Vätern. Schlussfolgerungen: Wir konnten die üblichen geschlechtspezifischen Annahmen, dass Mütter generell in höherem Umfang in die Betreuung der Kranken involviert sind, in mehreren wesentlichen Aspekten nicht bestätigen. Are there gender-specific differ­ ences between mothers and fathers caring for a schizophrenia patient? Objective: The purpose of this study was to investigate differences between mothers and fathers of patients with schizophrenia or schizoaffective disorders concerning the time spent with the patients as well as other aspects of caring. Methods: 101 mothers and 101 fathers of the same patients suffering from schizophrenia or schizoaffective disorders according to ICD-10 were investigated. Results: The mean time spent in personal (i.e. face-to-face) or telephone contact with patients was significantly higher for mothers than for fathers. About the half of the mothers spent more time with the patients than the fathers, while 12% of fathers spent more time than the mothers. Among 40% of patients, mothers and fathers spent an equal amount of time for personal or telephone contact with the patients. Concerning other aspects of caring (legal representative of the patient, payment for patient’s costs, caring for the patient’s household) we could not find any differences between mothers and fathers. Conclusions: Concerning several aspects we could not confirm that mothers are more involved into the patients’ care than the fathers. These findings are in contrast to the usual assumptions about familial caregivers based on the traditional gender-specific role models. Einleitung Angehörige von Schizophreniekranken leiden unter zahlreichen Belastungen, die von Stress über finanzielle Belastungen bis hin zu Symptomen einer Depression reichen [6, 7, 12, 15, 20, 29]. Mittlerweile ist aber auch bekannt, dass Interventionen zur Unterstützung der Angehörigen und zur Verbesserung ihrer Kommu- Wancata et al. nikation mit den Kranken wirksam sind [11, 18, 24]. In den meisten Studien, die die Angehörigen von Schizophreniekranken untersucht hatten, bestanden die Stichproben der Angehörigen überwiegend aus Eltern und unter den untersuchten Eltern waren überwiegend Mütter [5]. Beispielsweise berichteten Katschnig et al. [7], dass in ihrer Stichprobe von Angehörigen 77% Müttern und 6% Väter waren. Eine ähnliche Stichprobenzusammensetzung war auch von zahlreichen anderen AutorInnen berichtet worden [12, 14, 15, 26]. Erst in letzter Zeit finden sich Studien, die sich auch mit anderen Familienmitgliedern wie Geschwistern, Partnern oder Kindern der Kranken beschäftigten [3, 9, 10, 21, 22]. Obwohl bei psychischen Kranken zahlreiche geschlechtsspezifische Unterschiede berichtet wurden [4, 19, 28], finden sich bislang kaum Studien, die eventuelle geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Angehörigen explizit zum Thema gemacht haben. Die meisten Studien, die sich mit den Familienangehörigen von Schizophreniekranken beschäftigten, basieren auf dem Konzept des „Key relative“, womit jenes Familienmitglied gemeint ist, das zeitlich den meisten Kontakt zur Patientin oder zum Patienten hat [13]. Dieses Konzept geht implizit davon aus, dass der „Key relative“ die zentrale Rolle in der Betreuung innehat und somit auch die größten Belastungen erlebt. Dieser Forschungsansatz berücksichtigt aber nicht, ob auch andere Angehörige beträchtliche Zeit für die Betreuung verwenden. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass andere Angehörige nahezu die gleiche Zeit wie der „Key relative“ aufwenden. Überdies ist es möglich, dass andere Angehörige (unabhängig von der aufgewandten Zeit) emotional viel stärker involviert sind, was möglicherweise auch die erlebte Belastung erhöhen könnte. Unseres Wissens findet sich nur eine einzige neuere 84 Studie, die die Belastung der „Key relatives“ mit jener anderer Angehöriger derselben Kranken verglichen hat [13]. In dieser Studie fanden sich zwischen den erwähnten Angehörigen keine Unterschiede bezüglich der Belastungen. Da nach bisheriger Datenlage – wie erwähnt – der Großteil der Betreuungsarbeit von den Eltern der Kranken geleistet wird, stellt sich die Frage, ob das Konzept des „Key relative“ für die Eltern von Schizophreniekranken wirklich zutreffend ist und ob Väter wirklich in den meisten Fällen weniger als die Mütter zur Betreuung der Kranken beitragen. Bei den meisten Studien wurde pro PatientIn nur ein einziges Familienmitglied untersucht [7, 10]. Da aber der Zeitaufwand und die erlebten Belastungen der Angehörigen auch von der individuell unterschiedlichen Situation der Kranken (z.B. Krankheitssymptomatik, Einschränkungen im Alltag, Dauer der Krankheit) abhängen können, kann die Frage des Vergleichs zwischen Müttern und Vätern nur sehr eingeschränkt untersucht werden, wenn Mütter und Väter von verschiedenen Kranken untersucht werden. Der Einfluss derartiger konfundierender Variable sollte also durch das Studiendesign möglichst ausgeschlossen werden. Wenn in einer Studie sowohl Väter als auch Mütter derselben Kranken untersucht werden, ist es möglich den Einfluss derartiger potenziell konfundierender Variablen zu vermeiden. Das Ziel der vorliegenden Studie war es daher, die Mütter und die Väter derselben Kranken zu untersuchen, wobei neben dem zeitlichen Aufwand der Angehörigen auch andere Aufgaben der Betreuung erfasst werden sollten. Methodik In der vorliegenden Studie untersuchten wir sowohl die Mütter als auch die Väter derselben Kranken. Die Einschlusskriterien betreffend die Kranken waren abgeschlossenes 16. Lebensjahr und die Diagnose einer Schizophrenie bzw. schizoaffektiven Störung entsprechend ICD-10. Eine weitere Voraussetzung war, dass zumindest einer der Elternteile im selben Haushalt wie der/die PatientIn lebte oder zumindest mehrmals wöchentlich persönlichen Kontakt zum/r PatientIn hatte. Es war geplant, zumindest 100 Kranke und deren Mütter und Väter in die Studie einzuschließen. In den folgenden Einrichtungen wurden die PatientInnen und deren Angehörige eingeladen an der Studie teilzunehmen: Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Wien, Abteilung für Sozialpsychiatrie des Krankenhauses Hollabrunn, Universitätsklinik für Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters Wien, 5. Psychiatrische Abteilung des Otto-Wagner-Spitals in Wien, Sozialpsychiatrischer Dienst der Caritas St. Pölten, Sozialpsychiatrische Beratungsstelle Graz, Sozialpsychiatrisches Zentrum der Caritas Wien, Pro Mente Wien, Therapeutische Wohngemeinschaft „Pension Bettina“ Wien. Sowohl in den ambulanten als auch in den tagesklinischen und stationären Einrichtungen wurden die PatientInnen gefragt, ob sie bereits wären an dieser Studie teilzunehmen und ob die Studienmitarbeiter die Eltern kontaktieren dürften. Wenn die PatientInnen einverstanden waren, wurden die Eltern gefragt, ob sie bereit wären an der Untersuchung teilzunehmen. In jedem Fall wurde von den PatientInnen, den Vätern und Müttern eine schriftliche Einverständniserklärung eingeholt. Die vorliegende Studie war von der Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien geprüft worden. Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der elterlichen Betreuung von Schizophrenie-Kranken? Von den PatientInnen wurden soziodemographische Daten sowie Informationen zur Krankheit und deren Verlauf erfragt. Weiters wurde die Krankheitssymptomatik der PatientInnen im Rahmen eines psychiatrischen Interviews mittels der Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS [8]] erfasst. Die PANSS-Skala basiert auf einem Experteninterview. Die Daten für die Interrater-Reliabilität der deutschsprachigen Übersetzung waren zufrieden stellend [17]. Von den Eltern wurden neben soziodemographischen Daten auch Informationen zu ihrem Kontakt mit psychiatrischen Diensten und Einrichtungen sowie zu ihrem Kontakt mit den Kranken erfragt. Um das Ausmaß des Kontakts mit den Kranken und die finanziellen Ausgaben zu erfassen wurden Teile des Involvement Evaluation Questionnaire [27] verwendet. Die mit den Kranken verbrachte Zeit wurde bewusst durch mehrere Variable erhoben, da beispielsweise manche Kranke zwar eine eigene Wohnung haben, in der sie den Großteil der Zeit verbringen, aber in Zeiten akuter Krankheit vorübergehend wieder bei einem Elternteil wohnen oder in dieser Zeit von den Eltern häufiger besucht werden. Alle Daten wurden von ÄrztInnen in Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie oder PsychologInnen mit ausreichend psychiatrischer Erfahrung erhoben. Statistische Auswertungen Alle Auswertungen erfolgten mittels SPSS. Je nach Datenqualität wurden für die Vergleiche zwischen Vätern und Müttern McNemar Tests, Chi-Quadrat-Tests und Wilcoxon Signed Ranks Tests verwendet. Für alle Berechnungen wurde ein kritisches Alpha von 0,05 angenommen. Da auf zahlreiche bivariate Unterschiede getestet wurde, wurde eine Korrektur des Alpha-Fehlers nach Bonferoni [1] vorgenommen (neues kritisches Alpha 0,0023). Ergebnisse Stichprobe der PatientInnen Insgesamt wurden in die vorliegende Untersuchung 104 PatientInnen sowie deren Väter und Mütter eingeschlossen. Nach Beginn der Datenerhebung entschieden sich 3 Elternteile ihre Bereitschaft zur Studienteilnahme zurückzuziehen. Diese Daten wurden von den vorliegenden Analysen ausgeschlossen. Somit standen die Daten von 101 PatientInnen, Vätern und Müttern zur Auswertung zur Verfügung. Etwa zwei Drittel der PatientInnen (67,3%) waren männlichen Geschlechts. Das mittlere Alter der PatientInnen war 28,3 Jahre (Standardabweichung = SD = 7,4) und 93% waren ledig. Nur 12,6% hatten eine Vollzeitanstellung und 7,4% hatten eine Teilzeitanstellung, während 9,5% Studenten und 70,5% gänzlich ohne Arbeit waren. Bereits 26,5% mussten von einer Invaliditätspension und 31,4% von einer Arbeitslosenunterstützung oder vom Krankengeld leben. 86% der PatientInnen litt unter einer Schizophrenie und 14% unter einer schizoaffektiven Psychose. Die mittlere Krankheitsdauer der Stichprobe betrug 6,9 Jahre (SD 5,8). Die Hälfte der PatientInnen war dreimal oder öfter stationär im Spital aufgenommen worden und mehr als die Hälfte (56,5%) war zumindest einmal in einer psychiatrischen Tagesklinik behandelt worden. Der Gesamtscore der psychiatrischen Symptomatik (PANSS-Summenscore) betrug 69,1 (SD 20,8). Stichproben der Mütter und Väter Die Beschreibung der beiden Stichproben der Mütter und Väter anhand soziodemographischer Daten ist in Tabelle 1 dargestellt. Die Väter waren durchschnittlich älter und waren häufiger verheiratet bzw. in einer Beziehung lebend als die Mütter. Bezüglich Berufstätigkeit waren die Väter häufiger selbständig oder bereits in 85 Pension, während die Mütter häufiger im Haushalt tätig waren. Väter hatten häufiger als die Mütter eine allgemein bildende höhere Schule oder die Universität bzw. eine Hochschule abgeschlossen. Nach Alpha-Adjustierung fand sich kein Unterschied zwischen Vätern und Müttern bezüglich Zahl der Personen im Haushalt, monatlichem Einkommen und der Frage, ob sie mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenleben. Betreuung der PatientInnen durch Mütter und Väter Knapp 40% der Mütter und Väter lebte mit den Kranken im selben Haushalt (Tabelle 2). Wenn die Eltern nicht mit den Kranken zusammenlebten, betreuten 40% der Mütter aber nur 22% der Väter auch den Haushalt der Kranken (Unterschied nicht signifikant). Auch bezüglich der Zahl der Tage während des letzten Monats, an denen die Kranken bei einem Elternteil gelebt hatten, fand sich kein signifikanter Unterschied. Sowohl Mütter als auch Väter waren vom Gericht nur sehr selten als Sachwalter der Kranken eingesetzt. Mütter hatten zwar wegen des kranken Familienmitgliedes häufiger als Väter Kontakt mit psychiatrischen Einrichtungen, dieser Unterschied war aber nach Alpha-Adjustierung nicht signifikant. Die Mütter hatten insgesamt mehr persönlichen oder telephonischen Kontakt mit den Kranken als die Väter (Tabelle 2). In Tabelle 3 ist dargestellt, ob Mütter oder Väter mehr persönlichen oder telephonischen Kontakt mit den Kranken hatten (in Stunden mittels einer Rangskala erfasst). Es zeigte sich, dass in knapp der Hälfte der Fälle Mütter mehr Zeit mit den Kranken verbrachten, während in 12,1% die Väter mehr Zeit mit den Kranken verbrachten. Bei 38,4% fand sich für Mütter und Väter ein ähnlicher Zeitumfang. Wancata et al. Alter (Jahre) Familienstand Höchster Schulabschluss Lebt mit PartnerIn im selben Haushalt zusammen Berufstätigkeit Zahl der Personen, die im Haushalt eben Nettoeinkommen im Monat (Euro) 86 Mütter Väter Wert p Mittelwert 54,9 59,1 7,063 0,000 *** SD 8,6 9,0 82,717 0,000 ** 62,937 0,000 ** Ledig (%) 0,0 1,0 Verheiratet / in Beziehung (%) 84,2 87,1 Geschieden (%) 13,7 10,9 Verwitwet (%) 2,1 1,0 Pflichtschule (%) 27,5 28,4 Berufsschule (%) 20,0 21,0 Berufsbildende mittlere und höhere Schule (%) 22,5 14,8 allgemein bildende höhere Schule (%) 11,3 14,8 Universität / Hochschule / College (%) 18,8 21,0 Nein (%) 35,6 27,7 Ja (%) 64,4 72,3 Angestellt (%) 34,2 30,9 Selbständig (%) 8,9 18,5 Pensioniert (%) 39,2 45,7 ohne Beschäftigung im erwerbsfähigen Alter (%) 2,5 1,2 im Haushalt tätig (%) 10,1 3,7 Anderes (%) 5,1 0 Mittelwert 2,9 3,0 SD 1,4 1,4 < 500 (%) 1,0 0,0 500 – 1000 (%) 7,2 5,3 1000 – 1500 (%) 19,6 15,8 1500 – 2000 (%) 22,7 18,9 2000 – 2500 (%) 21,6 25,3 > 2500 (%) 27,8 34,7 0,008 * 67,146 0,000 ** 2,335 0,020 *** 2,244 0,025 *** Tabelle 1:Stichprobe der Angehörigen: soziodemographische Daten (SD = Standardabweichung) * McNemar-Test ** Chi-Quadrat-Test *** Wilcoxon Signed Ranks Test (Z-Wert) Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der elterlichen Betreuung von Schizophrenie-Kranken? Vom Gericht als Sachwalter eingesetzt Zahl der Kontakte mit psychiatrischen oder sozialen Einrichtungen (wegen Kranken, letzte 3 Monate) Lebt mit PatientIn im selben Haushalt Falls nicht selber Haushalt: betreut Haushalt des/r Kranken Zahl der Tage, die mit Krankem/r während der letzten 4 Wochen im selben Haushalt gewohnt Stunden pro Woche persönlicher oder telefonischer Kontakt mit Krankem/r (letzte vier Wochen) Mütter Väter Nein (%) 97,6 98,9 Ja (%) 2,4 1,1 Mittelwert 2,21 1,88 SD 1,71 1,62 Nein (%) 60,6 62,0 Ja (%) 39,4 38,0 Nein (%) 60,0 77,9 Teilweise (%) 16,9 2,9 Voll (%) 23,1 19,1 keinen Tag (%) 28,7 26,0 einen Teil der 4 Wochen (%) 41,6 42,0 die gesamten 4 Wochen (%) 29,7 32,0 <1 (%) 5,0 15,0 1–4 (%) 15,0 20,0 5–8 (%) 18,0 21,0 9 – 16 (%) 16,0 18,0 17 – 32 (%) 19,0 11,0 > 32 (%) 27,0 15,0 Wert * McNemar-Test ** Chi-Quadrat-Test p 1,000 * 2,026 0,043 *** 0,727 * 2,000 0,046 *** 1,043 0,297 *** 4,218 0,000 *** Tabelle 2: Stichprobe der Angehörigen: Aspekte der Betreuung der Kranken (SD = Standardabweichung) 87 *** Wilcoxon Signed Ranks Test (Z-Wert) Wancata et al. 88 % Vater mehr Zeit 12,1 Gleiche Zeit 38,4 Mutter mehr Zeit 49,5 Tabelle 3: Vergleich von Müttern und Vätern: Stunden pro Woche persönlicher oder telefonischer Kontakt der Eltern mit den Kranken (letzte vier Wochen) Zahl der Tage % >20 5,1 10-19 1,0 1-9 12,4 0 61,5 1-9 14,5 10-19 4,0 >20 1,0 Vater mehr Tage Gleiche Zahl von Tagen Mutter mehr Tage Tabelle 4: Vergleich von Müttern und Vätern: Zahl der Tage, die die Eltern mit den Kranken während der letzten 4 Wochen im selben Haushalt gewohnt haben Als weiterer Indikator, ob Mütter oder Väter mehr in die Betreuung der Kranken involviert sind, wurde die Differenz der Zahl der Tage, die Mütter und Väter in den letzten 4 Wochen mit den Kranken im selben Haushalt gewohnt haben, gebildet (Tabelle 4). In 61,5% der Stichprobe lebten Mütter und Väter dieselbe Zahl von Tagen mit den Kranken im selben Haushalt. Wenn die Zahl der Tage in Gruppen zusammengefasst werden, finden sich für Mütter und Väter sehr ähnliche Ergebnisse. Sowohl Mütter als auch Väter hatten durch die Krankheit ihres Familienmitgliedes hohe finanzielle Belastungen. 32,5% der Mütter und 35,2% der Väter hatten im letzten Monat mehr als 250 Euro für die Kranken ausgegeben (Tabelle 5). Beide Elternteile berichteten, dass vor allem für professionelle Hilfe, für Medikamente und für Fahrtkosten besonders häufig Ausgaben angefallen waren. Zwischen Vätern und Müttern fanden sich keine Unterschiede bezüglich der Gesamtsumme der Ausgaben und der einzelnen Gründe für die Aus­gaben. Diskussion Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um die erste Studie, in der gezielt die Mütter und die Väter derselben Kranken untersucht wur- den. Auf diese Weise gelang es den Einfluss anderer potenziell konfundierender Variablen auszuschließen. Trotz dieses methodischen Vorteils müssen aber die Ergebnisse der vorliegenden Studie auf jene Angehörigen beschränkt bleiben, wo sowohl Väter als auch Mütter zur Betreuung der Kranken zur Verfügung standen. Über jene Kranken, die von einem einzigen Elternteil versorgt werden, können aus der vorliegenden Studie keine Aussagen getroffen werden. Die hohe Zahl von mehrfachen Spitalsaufnahmen, der geringe Anteil der Berufstätigen sowie der hohe Anteil jener, die von einer Invaliditätspension oder Arbeitslosenunterstützung leben mussten, weist darauf hin, dass in die vorliegende Studie in einem beträchtlichen Umfang PatientInnen mit stark beeinträchtigenden Krankheitsverläufen eingeschlossen worden waren. Diese Behinderungen und Belastungen im Alltag stimmen mit den Ergebnissen zahlreicher Studien überein [2, 16, 23, 30]. Die Tatsache, dass in knapp 40% der Fälle die Kranken im selben Haushalt wie Vater oder Mutter lebten, zeigt, dass die Angehörigen in die Betreuung der Kranken in beträchtlichem Ausmaß involviert waren, was mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen übereinstimmt [5, 7, 12, 20]. So wie in anderen Studien fanden sich teilweise enorm hohe finanzielle Ausgaben der Eltern für die Kranken [29]. E zeigte sich, dass im Mittel Mütter signifikant mehr Zeit als Väter persönlich oder telephonisch in Kontakt mit den Kranken stehen. Als wir der Frage nachgingen, wie häufig einzelne Mütter mehr Zeit als die Väter mit den Kranken verbringen, zeigte sich, dass in etwa der Hälfte der Fälle die Mütter mehr Zeit aufwandten, bei nahezu 40% aber Mütter und Väter gleich viel Zeit aufwandten. In 12% der Fälle verbrachten die Väter mehr Zeit in persönlichem oder telephonischem Kontakt mit den Kranken als die Mütter. Obwohl also die Mütter Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der elterlichen Betreuung von Schizophrenie-Kranken? Ausgaben in Euro Grund für die Ausgaben 89 Mütter Väter Wert p 1,049 0,294 *** < 50 (%) 25,8 30,7 50 – 100 (%) 20,2 18,2 100 – 250 (%) 21,3 15,9 250 – 500 (%) 25,8 19,3 < 500 (%) 6,7 15,9 Professionelle Helfer (Ärzte, Psychologen, Kranken­ schwestern, Sozialarbeiter) (%) 29,7 22,8 0,210 * Schaden von Kranken angerichtet (%) 6,9 5,9 1,000 * Viel Geld, das Kranke ausgegeben haben (%) 16,8 12,9 0,454 * Fahrtkosten (%) 28,7 26,7 0,839 * Medikamente (%) 23,8 20,8 0,607 * Schulden der Kranken (%) 3,0 5,9 0,453 * Andere (%) 11,9 10,9 1,000 * Tabelle 5: Ausgaben für von den Kranken verursachte Kosten (während der letzten vier Wochen) * McNemar-Test ** Chi-Quadrat-Test häufig mehr Zeit als die Väter aufwenden, gibt es einen beträchtlichen Teil, wo beide Elternteile gleich viel Zeit aufwenden. Die sonst übliche Annahme, dass ein einziges Familienmitglied die Hauptkontaktperson für die Kranken ist, konnte also in einem beträchtlichen Teil unserer Stichprobe nicht bestätigt werden. In unserer Studie hatten wir aber – den Fragen des Involvement Evaluation Questionnaire [27] folgend – den *** Wilcoxon Signed Ranks Test (Z-Wert) Zeitaufwand für telephonischen und persönlichen Kontakt gemeinsam erfasst. Möglicherweise würden sich bei einer getrennten Auswertung von persönlichem Kontakt und telephonischem Kontakt die Ergebnisse in Richtung eines größeren persönlichen Kontakts der Mütter verschieben. Dies muss als Einschränkung der vorliegenden Untersuchung gewertet werden. In unserer Studie wurde die Rolle der „Key relatives“ aber nicht nur aufgrund der gemeinsam mit den Kranken verbrachten Zeit, sondern auch aufgrund anderer Variablen wie der Häufigkeit des Kontakts zu psychiatrischen Einrichtungen, Zusammenleben mit den Kranken oder finanziellem Aufwand untersucht. In der Auswertung des Mittelwerts der Tage, die Mütter und Väter mit den Kranken im selben Haushalt gelebt hatten, fand Wancata et al. sich kein Unterschied zwischen den Elternteilen. Auch in der Auswertung der Differenz der Tage zwischen Müttern und Vätern zeigte sich, dass in nahezu zwei Drittel der untersuchten Stichprobe beide Elternteile die gleiche Zahl von Tagen mit den Kranken im selben Haushalt gewohnt hatte. Bei allen anderen erfassten Variablen bezüglich der Betreuungsintensität von Müttern und Vätern (z.B. Sachwalterschaft, Zahl der Kontakte mit psychiatrischen und sozialen Einrichtungen, Betreuung des Haushalts der Kranken, finanzielle Ausgaben) fanden sich keine Unterschiede zwischen Müttern und Vätern. Auch diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass das Konzept des „Key relative“ bei einem nicht unwesentlichen Teil der Kranken nicht zutreffend ist. Angesichts der Tatsache, dass sich bezüglich der meisten Variablen kein signifikanter Unterschied zeigte, stellt sich die Frage, ob durch die Adjustierung des Alpha-Fehlers (wegen der zahlreichen bivariaten Vergleiche) reale Unterschiede verschleiert wurden. Aber auch bei einem unkorrigierten kritischen Alpha von 0,05 wären die meisten Ergebnisse bezüglich der Frage, wer der „Key relative“ ist, unverändert geblieben. Es scheint interessant, dass Mütter und Väter sich in einer Reihe soziodemographischer Aspekte unterscheiden. So waren die Väter älter, hatten häufig einen höheren Schulabschluss und unterschieden sich von den Müttern bezüglich Berufstätigkeit und Familienstand, was den Geschlechtsunterschieden in der österreichischen Bevölkerung entspricht [25]. Es scheint also, als würden die von uns untersuchten Eltern bezüglich soziodemographischer Variablen die üblichen geschlechtspezifischen Aspekte aufweisen (z.B. höheres Alter der Väter, höherer Schulabschluss der Väter). Bezüglich der Versorgungsaufgaben konnten wir aber die übliche geschlechtspezifische Annahme, dass Mütter generell in höherem Umfang 90 in die Betreuung der Kranken involviert sind, in mehreren wesentlichen Aspekten (z.B. Zusammenleben mit Kranken, Versorgung des Haushalts der Kranken) nicht bestätigen. Die vorliegenden Ergebnisse weisen darauf hin, wie wichtig es ist, dass psychiatrische Dienste ihre Angebote für Angehörige nicht nur Mütter, sondern auch für Väter anbieten. Möglicherweise führen auch traditionelle geschlechtsspezifische Rollenerwartungen der in der Psychiatrie Tätigen dazu, dass Mütter stärker als Väter zu Angeboten wie Angehörigenrunden, Psychoedukation oder Familiengespräche eingeladen werden. Danksagung Die hier dargestellte Studie wurde vom “Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank” gefördert, dem wir hierfür zu Dank verpflichtet sind (Projekt-Nummer. 11550). Literatur [1] Dunn G.: Statistics in psychiatry. Arnold, London 2000. [2] Frühwald S., Bühler B., Grasl R., Gebetsberger M., Matschnig T., König F., Frottier P.: (Irr-) Wege in die Arbeitswelt – Langzeitergebnisse arbeitsrehabilitativer Einrichtungen für psychisch Kranke der Caritas St. Pölten. Neuropsychiatrie 20, 250–256 (2006). [3] Grube M., Dorn A.: Elternschaft bei psychisch Kranken. Psychiat Prax 34, 66-71 (2007). [4] Günther O.H., Friemel S., Bernert S., Matschinger H., Angermeyer M.C., König H.-H.: Die Krankheitslast von depressiven Erkrankungen in Deutschland Ergebnisse aus dem Projekt European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD). Psychiat Prax 34, 292-301 (2007). [5] Jungbauer J., Bischkopf J., Angermeyer M.C.: Belastung von Angehörigen psychisch Kranker: Entwicklungslinien, Konzepte und Ergebnisse der Forschung. Psychiat Prax 28, 105-114 (2001). [6] Jungbauer J., Stelling K., Angermeyer M.C.: „Auf eigenen Beinen wird er nie stehen können“: Entwicklungsprobleme in Familien mit schizophrenen Patienten aus Sicht der Eltern. Psychiat Prax 33, 14-22 (2006). [7] Katschnig H., Simon M., Kramer B.: Die Bedürfnisse von Angehörigen schizophreniekranker Patienten - Erste Ergebnisse einer Umfrage. In: Katschnig H., König P.: Schizophrenie und Lebensqualität. Springer, Vienna - New York 1994. [8] Kay S.R., Fiszbein A., Opler L.A.: The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophr Bull 13, 261–276 (1987). [9] Könnecke R., Wening U., Ropeter D., an der Heiden W., Maurer K., Häfner H.: Sozialer Entwicklungsstand und subjektives Belastungserleben bei Nachkommen Schizophrener. Psychiat Prax 33, 269-276 (2006). [10] Krautgartner M., Unger A., Gössler R., Rittmannsberger H., Simhandl C., Grill W., Stelzig-Schöler R., Doby D., Wancata J.: Minderjährige Angehörige von Schizophrenie-Kranken: Belastungen und Unterstützungsbedarf. Neuropsychiatrie 21, 267–274 (2007). [11] Leff J., Kuipers L., Berkowitz R., Eberlein-Vries R., Sturgeon D.: A controlled clinical trial of intervention in families with schizophrenia patients. Brit J Psychiatry 141, 121-134 (1982). [12] Magliano L., Fadden G., Economou M., Held T., Xavier M., Guarneri M., Malangone C., Marasco C., Maj M.: Family burden and coping strategies in schizophrenia: 1-year follow-up data from the BIOMED-1 study. Soc Psychiatr Psychiat Epidemiol 35, 109115 (2000). [13] Magliano L., Fadden G., Fiorillo A., Malangone C., Sorrentino D., Robinson A., Maj M.: Family burden and coping strategies in schizophrenia: are key relatives really different to other relatives? Acta Psychiatr Scand 99, 10-15 (1999). [14] Martens L., Addington J.: The psychological well-being of family members in individuals with schizophrenia. Soc Psychiatry Psychiat Epidemiol 36, 128-133 (2001). [15] Meijer K., Schene A., Koeter M., Knudsen H.C., Becker T., Thornicroft G., Vazquez-Barquero J.L., Tansella M.: Needs for care of patients with schizophrenia and the consequences for their informal caregivers: results from the EPSILON multi center study on schizophrenia. Soc Psychiatr Psychiat Epidemiol 39, 251-258 (2004). Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der elterlichen Betreuung von Schizophrenie-Kranken? [16] Meise U., Sulzenbacher H., Eder B., Klug G., Schöny W., Wancata J.: Psychische Gesundheitsversorgung in Österreich. Neuropsychiatrie 20, 174185 (2006). [17] Mueller M.J., Rossbach W., Davids E., Wetzel H., Benkert O.: Evaluation of standardized training for the “Positive and Negative Syndrome Scale” (PANSS). Nervenarzt 71, 195-204 (2000). [18] Pilling S., Bebbington P., Kuipers E., Garety P., Geddes J., Orbach C., Morgan C.: Psychological treatments in schizophrenia: 1. Meta-analysis of family interventions and cognitive behavioural therapy. Psychol Med 32, 763-782 (2002). [19] Rutz W., Klotz T.: Gesundheitsverhalten bei Männern – kaum eine Besserung in Sicht. Psychiat Prax 34, 367369 (2007). [20] Schene A.H., Tessler R.C., Gamache G.M.: Instruments measuring family or caregiver burden in severe mental illness. Soc Psychiatr Psychiat Epidemiol 29, 228-240 (1994). [21] Schmid R., Schielein T., Spießl H., Cording C.: Belastungen von Geschwistern schizophrener Patienten. Psychiat Prax 33, 177-183 (2006). [22] Schrank B., Sibitz I., Schaffer M., Amering M.: Zu unrecht vernachlässigt: Geschwister von Menschen mit schizophrenen Psychosen. Neuropsychiatrie 21, 216–225 (2007). [23] Schwappach D.L.B.: Die ökonomische Bedeutung psychischer Erkrankungen und ihrer Versorgung – ein blinder Fleck? Neuropsychiatrie 21, 18–28 (2007). [24] Solomon P., Draine J., Mannion E., Meisel M.: Impact of brief family psychoeducation on self-efficacy. Schizophrenia Bull 22, 41-50 (1996). [25] Statistik Austria: Volkszählung: Die demographische, soziale und wirtschaftliche Struktur der österreichischen Bevölkerung. Statistik Austria, Wien, 2007. [26] Szmukler G.I., Burgess P., Herrman H., Benson A., Colusa S., Bloch S.: Caring for relatives with serious mental illness: the development of the Experience of Caregiving Inventory. Soc Psychiatry Psychiat Epidemiol 31, 137-148 (1996). [27] Van Wijngaarden B., Schene A.H., Koeter M., Vazquez-Barquero J.L., Knudsen H.C., Lasalvia A., McCrone P.: Caregiving in schizophrenia: development, internal consistency and reliability of the Involvement Evaluation Questionnaire - European Version. EPSILON Study 4. European Psychiatric Services: Inputs Linked to Outcome Domains and Needs. Brit J Psychiatry Suppl 39, s21-s27 (2000). [28] Weiss E.M., Marksteiner J., Hinterhuber H., Nolan K.A.: Geschlechtsunterschiede bezüglich aggressivem und gewalttätigem Verhalten bei schi- 91 zophrenen und schizoaffektiven Patienten. Neuropsychiatrie, 20, 186–191 (2006). [29] Wilms H.-U., Mory C., Angermeyer M.C.: Erkrankungsbedingte Kosten für Partner psychisch Kranker: Ergebnisse einer Mehrfacherhebung. Psychiat Prax 31, 177-183 (2004). [30] Zechmeister I., Österle A.: Informelle Betreuung psychisch erkrankter Menschen: Schafft das österreichische Pflegevorsorgesystem adäquate Voraussetzungen? Neuropsychiatrie 21, 29–36 (2007). Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Medizinische Universität Wien E-Mail: [email protected] Originalarbeit Original Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 2/2008, S. 92–99 Geschwindigkeit des Depressionsbeginns: Ein Unterscheidungsmerkmal hinsichtlich uni- versus bipolarer affektiver Störungen Ulrich Hegerl1, Anja-Christine Bottner2, Roland Mergl1, Bettina Holtschmidt-Täschner2, Florian Seemüller2, Winfried Scheunemann2, Michael Schütze2, Heinz Grunze3, Verena Henkel2, Jules Angst4 und Christoph Born2 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Universitätsklinikum Leipzig Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Ludwig-Maximilians-Universität München 3 School of Neurology, Neurobiology and Psychiatry, Newcastle University 4 Zürich Universitätshospital für Psychiatrie, Zürich 1 2 Schlüsselwörter: Onset-of-Depression Inventory – unipolare Depression – bipolare affektive Störung – depressive Episode – Geschwindigkeit des Beginns Key words: Onset-of-Depression Inventory – unipolar depression – bipolar affective disorder – depressive episode – speed of onset Geschwindigkeit des Depressions­ be­ginns: Ein Unterscheidungsmerk­ mal hinsichtlich uni- versus bipo­ larer affektiver Störungen Anliegen: Depressive Episoden können abrupt oder über Wochen langsam einschleichend beginnen. Dieses bedeutsame klinische Merkmal affektiver Störungen ist bis heute nicht systematisch untersucht. Ziel dieser Studie war, die Geschwindigkeit des Einsetzens der Symptomatik depressiver Episoden bei Patienten mit einer unipolaren Depression (UD) und einer Depression im Rahmen einer © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 bipolaren affektiven Störung (BAS) zu analysieren. Methode: Untersucht wurden 158 Patienten mit einer UD (N=108) und BAS (N=50) mit dem strukturierten “Onset-of-Depression Inventory” (ODI). Patienten, die von kritischen Lebensereignissen berichteten, die dem Einsetzen depressiver Symptomatik unmittelbar vorausgingen, wurden ausgeschlossen. Ergebnisse: Gefunden wurde eine signifikante Assoziation zwischen der Geschwindigkeit des Einsetzens der letzten und der vorangehenden depressiven Episode (rho = 0.66; p < 0.001). Bei Patienten mit BAS war der Depressionsbeginn signifikant rascher als bei Patienten mit UD (p < 0.001) (innerhalb 1 Woche bei 58% der Patienten mit BAS vs. 7.4% mIT UD). Schlussfolgerungen: Der rasche Beginn depressiver Episoden (innerhalb einer Woche) ist typisch für bipolare, nicht dagegen für unipolare affektive Störungen. Dieses klinische Merkmal kann Hinweise auf das mögliche Vorliegen einer BAS bei Patienten mit bisher ausschließlich depressiver Episode liefern und auf Untergruppen mit unterschiedlichen neurobiologischen Mechanismen der Pathogenese deuten. Speed of onset of depressive epi­ sodes: a clinical criterion helpful for separating uni- from bipolar affective disorders Objective: Depressive episodes can begin abruptly or start very slowly (over weeks). This relevant clinical feature of affective disorders has not been systematically investigated so far. The aim of this study was to analyze speed of onset of depressive episodes in patients with unipolar depression (UD) and bipolar affective disorders (BD). Methods: 158 adult patients with UD (N=108) and BD (N=50) were examined using the structured “Onset-of-Depression Inventory”. Only patients without acute critical life events preceding the onset were included in the study. Results: There was a significant positive correlation between speed of onset of the present and that of the preceding depressive episode (rho = 0.66; p < 0.001). The association between speed of onset and speed of decay of depressive episodes failed to be significant (rho = 0.20; p = 0.09). Patients with bipolar disorder were found to develop depressive episodes significantly faster than patients with major depression (p < 0.001): Whereas depressive episodes started in 58% of patients with bipolar disorder within one week, this was only the case in 7.4% of patients Geschwindigkeit des Depressionsbeginns: Ein Unterscheidungsmerkmal ... with major depression. Conclusions: Within subjects, the speed of onset of depression is similar across different episodes. In the absence of acute critical life events, rapid onset of depressive episodes (within one week) is typical for bipolar depression, but not for unipolar depression. A rapid onset of depressive episodes might point to BD in patients with solely depressive episodes in the past and to subgroups with different neurobiological pathogenetic mechanisms. Einleitung Die klinische Erfahrung zeigt, dass sich depressive Episoden mit unterschiedlicher Geschwindigkeit entwickeln. Auf der einen Seite des Spektrums sind Patienten mit abruptem Beginn, bei denen sich voll ausgeprägte depressive Symptomatik innerhalb einer Stunde ausbildet, auf der anderen Seite sind Patienten, bei denen sich depressive Episoden langsam innerhalb von Monaten entwickeln. Es ist zu erwarten, dass sich diese Patienten hinsichtlich neurobiologischer Mechanismen der Pathogenese dieser Episoden unterscheiden. In diesem Kontext ist es von Interes­ se, dass die Geschwindigkeit des Einsetzens depressiver Episoden bei Patienten mit einer bipolaren affektiven Störung („bipolare Depression“; BD) rascher zu sein scheint, verglichen mit Patienten mit unipolarer Depression (UD). Dies ist insbesondere eindrücklich bei raschen Wechseln von depressiver und manischer Stimmungslage. 20% der Patienten mit BD erleben ein „rapid cycling“, wie eine Auswertung des „Systematic Treatment Enhancement Program“ (STEP-BD) ergab, während die Angaben in anderen Studien zwischen 14% und 56% liegen [14]. In diesem Rahmen erleben viele Patienten einen abrupten „Switch“ in die Stimmungslage entgegen gesetzter Polarität ohne ein längeres euthymes Intervall. Überdies ist seit langem bekannt, dass manische Episoden im Rahmen von BD wesentlich rascher einsetzen als depressive Episoden [16]. So könnte der Beginn einer Depression nach einem euthymen Intervall ebenfalls schneller sein, wie in einer retrospektiven Vergleichsstudie vermutet [9]. Wenn dies der Fall ist, könnte die Geschwindigkeit des Einsetzens hilfreich sein, depressive Episoden bei UD versus BD zu unterscheiden. Das frühe Erkennen von Patienten mit BD ist ein klinisch relevantes und bisher nicht zufriedenstellend gelöstes Problem, da es bei bis zu 45% der Patienten mit BD initial nur zu Episoden einer Major Depression kommt [10]. Ohne frühere manische oder hypomanische Episoden gibt es bisher keine Indikatoren, die eine reliable diagnostische Klassifikation depressiver Episoden erlauben [3]. Einige mögliche Indikatoren wie Major Depression oder Manie in der Familienanamnese [13, 17], psychotische Merkmale während der ersten depressiven Episode [6, 15], atypische und neurovegetative Symptome (etwa Hyperphagie und Hypersomnie) [1, 4], melancholische Merkmale [2, 12] und familiäre Variationen in der Häufigkeit der Episoden [8] wurden untersucht, aber die Ergebnisse in der Literatur sind nicht konsistent (Überblick bei [5]). Trotz deutlicher interindividueller Unterschiede in der Geschwindigkeit des Beginns depressiver Episoden wurde dieses klinische Merkmal unseres Wissens bisher nicht systematisch untersucht. Allein in einer Studie werden quantitative Informationen zu Unterschieden zwischen Patienten mit BD und UD hinsichtlich der Geschwindigkeit des Beginns depressiver Episoden berichtet: In dieser Studie bei stationären tunesischen Patienten wurde bei 44,8% der Patienten mit BD, aber nur bei 15,9% der Patienten mit einer rezidivierenden depressiven Störung ein schnelles Einsetzen depressiver Episoden beobachtet [9]. 93 Mit Hilfe eines speziell entwickelten strukturierten klinischen Interviews – des “Onset-of-Depression Inventory” (ODI) – wurde in dieser Studie die Bedeutung der Geschwindigkeit des Depressionsbeginns für die Diagnose und Subtypisierung von Patienten mit depressiver Störung untersucht. Zunächst wurde geprüft, ob die Geschwindigkeit des Beginns depressiver Episoden ein individuell stabiles Charakteristikum über verschiedene depressive Episoden hinweg ist. Dies sollte der Fall sein, wenn die Geschwindigkeit des Beginns auf stabile interindividuelle Unterschiede hinsichtlich pathophysiologischer und möglicher genetischer Aspekte hinweist. Dafür korrelierten wir die Geschwindigkeit des Einsetzens der letzten depressiven Episode mit jener der vorangehenden Episode. Danach wurden Patienten mit UD und BD hinsichtlich dieser Merkmale verglichen. Die Hypothese war, dass bei BD ein schnellerer Beginn zu beobachten ist als bei UD. Abschließend wurde explorativ untersucht, ob die Geschwindigkeit des Beginns depressiver Episoden mit der Geschwindigkeit ihres Abklingens korreliert. Material und Methode Patienten Die Patienten (N = 215) wurden sowohl in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, der dortigen Spezialambulanz für Patienten mit bipolarer affektiver Störung als auch im Zentrum für klinische Studien in Nürnberg, welches mit der Münchener Klinik für Psychiatrie der LMU assoziiert ist, konsekutiv eingeschlossen. Im Nürnberger Studienzentrum wurden Patienten im Kontext einer klinischen Studie für leichte Depressionen im Rahmen der Primärversorgung rekrutiert. Die Daten wurden zwischen Dezember 2001 und Januar 2007 gesammelt. Hegerl et al. Als Einschlusskriterien für diese offene Querschnittsstudie galten: ein Mindestalter von 18 Jahren; die Fähigkeit, das schriftliche Einverständnis zu geben; bipolare affektive Störungen; depressive Episoden im Rahmen einer depressiven Störung oder rezidivierenden depressiven Störung. Ausschlusskriterien waren die Diagnosen Dysthymie, “Double Depression” oder persistierende depressive Störung ohne Episoden einer Major Depression, eine Dauer der gegenwärtigen depressiven Episode von mehr als 2 Jahren (dies war der Fall bei 13 Patienten), akute Suizidalität, Vorliegen einer Abhängigkeit von Alkohol- oder illegalen Drogen, drogeninduzierte depressive Störung, psychotische Störung, schwere somatische Erkrankung. Die psychiatrische Diagnose wurde nach den Kriterien der ICD-10 gestellt. Bei der Mehrheit der in München rekrutierten Patienten war die Diagnose auch mit einem „Strukturierten klinischen Interview nach DSM-IV für Achse-I-Störungen“ (SKID I) gestellt worden. In einer Subkohorte der Patienten aus Nürnberg (n=87) basierte die Diagnose zusätzlich auf einem strukturierten klinischen Interview (Composite International Diagnostic Interview, CIDI) nach den Kriterien des DSM-IV. Hierfür wurde die deutsche computergestützte Form (DIAX) [18] verwendet, basierend auf CIDI Version 1.1 [19]. Nachdem den Patienten das Vorgehen beschrieben worden war, gaben diese ihr schriftliches Einverständnis gemäß der Deklaration von Helsinki. Die Ethikkommission der medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München gab ihr Einverständnis vor Studienbeginn. Onset-of-Depression Inventory (ODI) Um die Geschwindigkeit des Ein­ setzens der letzten sowie früherer Episoden und der ersten depressiven Episode zu erfassen, wurde das “Onset-of-Depression Inventory” (ODI) entwickelt. 94 Der ODI ist ein strukturiertes Patienteninterview, mit dem zunächst das Vorkommen gegenwärtiger oder vergangener manischer oder hypo­manischer Episoden in der Anam­nese der Patienten erhoben wird. Im nächsten Teil des ODI wird das Einsetzen der zuletzt erlebten depressiven Episode fokussiert. Der Patient wird nach dem Datum des Einsetzens erster Symptome und der Dauer bis zur Entwicklung der voll ausgeprägten Depression befragt (unterschieden in 9 Kategorien: 0 bis 30 Minuten; >30 bis 60 Minuten; >1 bis 3 Stunden; >3 bis 24 Stunden; >1 bis 3 Tage; >3 bis 7 Tage; >1 bis 4 Wochen; >1 bis 4 Monate; mehr als 4 Monate). Darüber hinaus werden die Symptome untersucht, mit denen die letzte depressive Episode begann (unterschieden in 11 Kategorien: depressive Stimmung; Freudlosigkeit; Interesseminderung; Zunahme von Müdigkeit; Schlafstörungen; Verän­ derungen der Stimmungslage am Tage; Energielosigkeit; Änderungen des Appetits; Minderung der Libido; Störungen der Konzentration; Suizida­ lität). Zusätzliche Symptome (etwa Angst) können ebenfalls erfasst werden. Akute kritische Lebensereignisse (Typ und Datum) in den 14 dem Einsetzen der Symptomatik vorausgegangenen Tagen werden notiert. Vorausgegangene Behandlungen (Medikation, Elektrokrampftherapie und Psychotherapie) sowie Än‘­ derungen der Behandlung werden dokumentiert. Zusätzlich zur zuletzt erlebten Epi­ sode werden Beginn und Ende der vorangegangenen und der ersten depressiven Episode (im Falle einer rezidivierenden depressiven Störung) im ODI charakterisiert. Außerdem werden folgende klinische Variablen erhoben: Gesamtzahl depressiver Episoden; psychiatrische Komorbidität; Summenscore in der Hamilton-Depressionsskala (17Item-Ver­sion [11]); Gesamtdauer der de­pressiven Episoden; Gesamtdauer der Behandlungen in Kliniken. Die Interviews mit dem ODI wurden durchgeführt von vier Ärzten mit mehrjähriger klinischer Erfahrung (B.H.-T., F.S., M.S. und W.S.) und einer klinisch erfahrenen Psychologin (A.-C. B.). Die Interviews wurden nach Stabilisierung und Besserung der depressiven Symptomatik durchgeführt. Statistische Analyse Die Daten wurden mit dem Statistikprogramm SPSS (Version 12.0) ausgewertet. Wir berechneten Spearman-Brown-Korrelationsko­ effizienten zwischen Geschwindig­ keitsparametern für die depressive Episode. Unterschiede zwischen Patienten mit UD und BD in kontinuierlichen, normal verteilten Variablen (etwa Alter) wurden mit dem t-Test für unabhängige Gruppen getestet. Die Mediane für die Geschwindigkeit des Einsetzens depressiver Episoden wurden mit dem nonparametrischen Mann-WhitneyU-Test verglichen. Proportionen wurden mit dem Chi-Quadrat-Test nach Pearson verglichen, der Gültigkeit hat, wenn mehr als 80% der Felder Erwartungswerte über 5 haben. Wenn dies nicht der Fall war, wurde Fishers exakter Test für den Vergleich zweier dicho­tomer Variablen angewandt. Um valide Schwellenwerte für die Unterscheidung zwischen Patienten mit UD und BD hinsichtlich der Geschwindigkeit des Einsetzens der letzten depressiven Episode zu erhalten, wurde eine „receiver operating characteristic“ (ROC)-Kurve konstruiert. Die entsprechende „area under the curve” (AUC-Wert) und eine Tabelle, welche die Koordinaten der ROC-Kurve zusammenfasst, wurden hierfür berechnet. Ergebnisse Soziodemographische und kli­ni­ sche Charakteristika 33 von 141 Patienten mit UD (23.4%) und 24 von 74 Patienten mit BD Geschwindigkeit des Depressionsbeginns: Ein Unterscheidungsmerkmal ... (32.4%) wurden aufgrund akuter kritischer Lebensereignisse in den zwei Wochen vor Einsetzen der Depression von der weiteren Analyse ausgeschlossen. Die am häufigsten von den Patienten selbst berichteten akuten kritischen Lebensereignisse waren alltägliche Stressoren (z.B. belästigende Telefonanrufe, Wohnungsumzüge) (UD: 27.3%; BD: 37.5%), Trennung vom Lebensgefährten und zwischenmenschliche Konflikte (UD: n = 10, 30.3%; BD: n = 5, 20.8%), beschäftigungsbedingte kri­tische Lebensereignisse (z.B. Ar­beits­­ platzverlust) (UD: n = 6, 18.2%; BD: n = 4, 16.7%), Tod naher An­ gehöriger (UD: n = 5, 15.2%; BD: n = 2, 8.3%). 95 Demographische und klinische Merk­ male der verbleibenden Patien­ten mit BD versus UD sind in Tabelle 1 dargestellt. Von den Patienten mit UD hatten 80 (74.1%) eine rezidivierende depressive Störung. 48 (96%) der Patienten mit BD berichteten von mehr als einer depressiven Episode. Charakteristika des Beginns der depressiven Episoden Die Assoziation zwischen der Geschwindigkeit des Beginns der zuletzt erlebten und jener der vorangegangenen depressiven Episode war hoch signifikant (rho = 0.66; p < 0.001; für Patienten mit UD: rho = 0.52; p < 0.001; für Patienten mit BD: rho = 0.61; p < 0.001). Abbildung 1a zeigt die Häufig­ keits­verteilung hinsichtlich der Ge­ schwindigkeit des Beginns der letz­ten depressiven Episode für alle Patienten. Der Median für Patienten mit UD (N=108) lag bei dieser Variablen zwischen 1 und 4 Monaten; im Gegensatz dazu berichteten Patienten mit BD (N=50) über ein weit schnelleres Einsetzen der letzten depressiven Episode (Median: zwischen 4 und 7 Tagen). Die entsprechende Gruppendifferenz war signifikant (Z = -7.46; p < 0.001). Abbildung 1b gibt detaillierte Informationen über die Geschwindigkeit des Beginns der letzten depressiven Episode für Patienten mit UD versus BD wieder. Die zuletzt erlebte depressive Episode Variablen Unipolare Depression (N=108) Depressionen bei bipolarer affektive Störung (N=50) p Alter (in Jahren) (M±s) 47.62 ± 14.13 48.89 ± 11.71 0.58a Geschlecht (männlich/weiblich) 37%/63% 52%/48% 0.08+b stationär/ambulant (%) 9.3%/90.7% 52%/48% <0.001***b HAMD-17-Summenwert (M±s) 14.20 ± 5.48 11.74 ± 5.10 0.04*c Anzahl depressiver Episoden (M±s) 2.06 ± 0.81 2.80 ± 0.495 <0.001***c Behandlungsdauer der aktuellen depressiven Episode bei stationären Patienten (M±s) 71.82 ± 19.98 85.85 ± 69.56 0.71c Dauer der aktuellen depressiven Episode (in Tagen) (M±s) 218.26 ± 170.89 155.13 ± 155.26 0.06+c Tabelle 1: Demographische und klinische Charakteristika der Stichprobe Anmerkungen: a t-test für unabhängige Stichproben (zweiseitig); b χ2-Test für zwei unabhängige Stichproben (zweiseitig); c Mann-Whitney-U-Test (zweiseitig); HAMD-17 = Hamilton-Depressionsskala (17-Item-Version [11]); M = (arithmetischer) Mittelwert; N = Stichprobengröße; s = Standardabweichung. + p ≤ 0.10; * p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 (nicht-adjustierte Signifikanzniveaus). Hegerl et al. 96 = 0.86; 95% K.I. = 0.797-0.92; p < 0.001) (siehe Abbildung 2). Ein Schwellenwert von einem Monat unterschied die Gruppen der Patienten sehr gut: 46 von 50 Patienten mit BD (92%) hatten ein rascheres Einsetzen, 74 von 108 Patienten (68.5%) mit UD hatten ein langsameres Einsetzen der gegenwärtigen depressiven Episode berichtet. Abbildung 1 a und b: Häufigkeitsverteilung der Variablen “Geschwindigkeit des Beginns der letzten depressiven Episode” a. in der ganzen Kohorte (N=158); b. bei Patienten mit unipolarer Depression (N=108) und bei Patienten mit bipolarer affektiver Störung (N=50). setzte bei 29 von 50 Patienten mit BD (58%) innerhalb einer Woche ein, was allein bei 8 (7,4%) von 108 Patienten mit UD der Fall war. Eine ROC-Analyse unterstreicht die obengenannten Ergebnisse und zeigte, dass Patienten mit UD und jene mit BD insgesamt hinreichend unterschieden werden konnten (AUC Von den Patienten mit BD (N = 50) hatten 7 (14%) einen “Switch” aus einer Manie in die letzte depressive Episode erlebt. Die übrigen Patienten mit BD waren euthym vor der letzten depressiven Episode. Wenn bipolare Patienten, die einen “Switch” erlebt hatten, von der Analyse ausgeschlossen wurden, blieben die Unterschiede zwischen Patienten mit UD versus BD hinsichtlich der Geschwindigkeit des Beginns der letzten depressiven Episode signifikant (Mann-WhitneyU-Test: Z = -6.99; p < 0.001). Tendenziell fand sich eine positive Assoziation zwischen der Geschwindigkeit des Beginns und der des Abklingens der zuletzt erlebten depressiven Episode (rho = 0.20; p = 0.09). Bei getrennter Betrachtung ließ sich weder bei Patienten mit BD noch DU eine derartige Korrelation statistisch nachweisen. Geschwindigkeit des Depressionsbeginns: Ein Unterscheidungsmerkmal ... Abbildung 2: Ergebnisse der ROC-Analysen: Unterschiede zwischen Patienten mit unipolarer Depression (UD; N=108) und Patienten mit bipolarer affektiver Störung (BD; N=50) hinsichtlich der Geschwindigkeit des Beginns der letzten depressiven Episode. Die Achsen geben die Wahrscheinlichkeit (p) wieder, dass Patienten mit UD/BD ein langsameres Einsetzen der letzten depressiven Episode haben als vom entsprechenden Schwellenwert angezeigt (z.B. 1 Monat; UD: 68.5%; BD: 8%). h = Stunde; Min. = Minute. Diskussion Untersucht wurde die Geschwindig­ keit des Einsetzens depressiver Episoden bei unipolarer Depression (UD) und bipolarer Depression (BD). Sie könnte einen bedeutenden klinischen Aspekt zur Unterscheidung von UD und BD darstellen, welcher unseres Wissens in der klinischen Forschung bisher weitgehend unbeachtet blieb. Es zeigten sich intraindividuell ähnliche Geschwindigkeiten des Einsetzens depressiver Symp­to­ matik in verschiedenen Episoden. Sowohl in der Gruppe mit UD als auch der mit BD war die Geschwindigkeit des Beginns der zuletzt erlebten und der vorangegangenen Episode positiv korreliert. Dies lässt vermuten, dass es sich um ein stabiles Merkmal handelt, welches möglicherweise auf unterschiedliche neurobiologische Mechanismen hinweist. Die Hypothese, dass die Geschwin­ digkeit des Beginns depressiver Epi­ soden schneller bei Patienten mit BD als bei Patienten mit UD ist, wurde durch die Ergebnisse deutlich bestätigt. Schnelles Einsetzen der depressiven Episode (innerhalb eines Monats) war häufiger bei Patienten mit BD als UD (92% vs. 31,5%). Die beobachtete Differenz in der Geschwindigkeit des Beginns depressiver Episoden ergab sich nicht aufgrund der Unterschiede in der Häufigkeit vorangegangener akuter kritischer Lebensereignisse, die zu einem schnelleren Einsetzen der 97 Episoden führen können (etwa akute Verlusterlebnisse): Die Grup­pen unterschieden sich nicht signi­fikant hinsichtlich des prozentua­len Anteils solcher Ereignisse und die beobachteten signifikanten Unterschiede zeigten sich nach Ausschluss der Patienten mit akuten kritischen Lebensereignissen. Eben­falls nach Ausschluss von 7 Patienten, die einen „Switch“ aus der vorangegangenen (hypo)manischen Episode erlebt hatten, zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen Patienten mit UD und BD hinsichtlich der Geschwindigkeit des Beginns der zuletzt erlebten depressiven Episode. In der Literatur findet sich nur eine retrospektive Vergleichsstudie, in der über das Einsetzen depressiver Epi­soden bei Patienten mit UD und BD berichtet wurde [9]: Dort wurde bei 44.8% der Patienten mit BD, aber nur bei 15.9% der Patienten mit rezidivierender depressiver Störung ein plötzlicher Beginn gefunden. Dieses Ergebnis ist jenen unserer Studie ähnlich, in der sich depressive Episoden bei 42% der Patienten mit BD innerhalb von drei Tagen entwickelten, im Gegensatz zu 4.7% der Patienten ­ mit UD. Ein weiteres Ergebnis dieser Studie bezieht sich auf die Frage, ob die Geschwindigkeit des Beginns einer depressiven Episode die Geschwindigkeit ihres Abklingens zu prädizieren erlaubt. Dies wurde nicht bestätigt. Weder bei Patienten mit UD noch mit BD korrelierte die Geschwindigkeit des Beginns einer depressiven Episode mit deren Abklingen. Es ergeben sich einige Ein­schrän­ kungen der Aussagekraft dieser Studie: 1.) Bei Untersuchungen der Ge­ schwindigkeit des Beginns de­pressiver Episoden müssen als mögliche Auslöser der Episode akute kritische Lebensereignisse berücksichtigt werden. Die Definition und valide Untersuchung sol- Hegerl et al. 2.) 3.) 4.) 5.) cher Lebensereignisse ist bekanntermaßen schwierig [7]. Dieses Problem dürfte unsere Ergebnisse jedoch kaum tangiert haben, weil depressive Episoden mit identifizierbaren vorausgegangenen akuten kritischen Lebensereignissen von der weiteren Analyse der Daten ausgeschlossen wurden. Der Einfluss von Psychotherapie und Pharmakotherapie wurde nicht kontrolliert. Somit ist nicht auszuschließen, dass unterschiedliche medikamentöse Compliance in beiden Gruppen oder gar das Absetzen der antidepressiven Medikation Ein­ fluss auf die Ergebnisse gehabt haben. In die Studie wurden neben Patienten mit Bipolar-I-Störung (n=15) auch Patienten mit Bipolar-II-Störung (n=1) eingeschlossen (bei 34 Patienten konnte nicht mehr ermittelt werden, ob sie eine BipolarI- oder Bipolar-II-Störung hatten). Zwei Patienten erfüllten die diagnostischen Kriterien für Rapid Cycling. Für eine Berücksichtigung dieser diagnostischen Untergruppen war die statistische Power nicht ausreichend. Für weiterführende Studien wäre es wünschenswert, den unipolar depressiven Patienten eine homogenere Gruppe von Patienten im Rahmen des bipolar affektiven Spektrums gegenüberzustellen. Eine weitere Einschränkung ist, dass die Interviewer nicht verblindet waren hinsichtlich der Diagnose der Patienten und es nicht ausgeschlossen werden kann, dass dies in einigen Fällen Einfluss auf die Ergebnisse der Studie gehabt hat. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die meisten Patienten nach klinischer Besserung interviewt wurden. Sie mussten sich erinnern, wie die letzte und die vorangegangene bzw. erste depres- 98 sive Episode begann. Bei einigen Patienten lagen diese Ereignisse bereits mehrere Monate zurück, was die Validität der Berichte der Patienten einschränkt. 6.) ODI-Validierungsstudien stehen noch aus. Unter Berücksichtigung dieser Ein­schrän­kungen konnte in dieser Studie gezeigt werden, dass die Ge­ schwindigkeit des Beginns depressiver Episoden ein relevanter klinischer Aspekt ist, welcher in zukünftigen Studien sorgfältiger berücksichtigt werden sollte. Für die Behandler ist es wichtig zu wissen, dass ein schnelles Einsetzen einer bestimmten depressiven Episode (innerhalb einer Woche) häufiger im Rahmen bipolarer affektiver Störungen zu beobachten ist und weniger häufig bei unipolaren Depressionen. Die Geschwindigkeit des Beginns depressiver Episoden mag ebenso hilfreich sein, um pathophysiologisch homogenere Subgruppen innerhalb unipolarer und bipolarer affektiver Störungen zu definieren. Bedeutende Fragen für die weitere Forschung sind u.a., ob sich Patienten mit raschem versus langsamem Beginn depressiver Episoden hinsichtlich des Ansprechens auf Medikamente und genetischer Aspekte voneinander unterscheiden. Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF; FKZ 01 GI 9922/0222) geförderten Kompetenznetzes Depression/Suizidalität. Sie wurde vom Bayerischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (im Kontext des Promo­ tionsstipendiums für Frau Dipl.Psych. Anja-Christine Bottner) gefördert. [10] [11] [12] [13] Abrams R., Taylor M.A.: A comparison of unipolar and bipolar depressive illness. American Journal of Psychiatry 137, 1084-1087 (1980). Akiskal H.S.: Classification, diagnosis and boundaries of bipolar disorders: a review. In: Maj M., Akiskal H.S., LopezIbor J.J., Sartorius N.: Bipolar Disorder. Wiley, Chichester 2002. Angst J., Sellaro R., Stassen H.H., Gamma A.: Diagnostic conversion from depression to bipolar disorders: results of a long-term prospective study of hospital admissions. Journal of Affective Disorders 84, 149-157 (2005). Benazzi F.: Clinical differences between bipolar II depression and unipolar major depressive disorder: lack of an effect of age. Journal of Affective Disorders 75, 191-195 (2003). Benazzi F.: Melancholic outpatient depression in Bipolar-II vs. unipolar. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry 28, 481-485 (2004). Coryell W., Endicott J., Maser J.D., Keller M.B., Leon A.C., Akiskal H.S.: Long-term stability of polarity distinctions in the affective disorders. American Journal of Psychiatry 152, 385-390 (1995). Dohrenwend B.P.: Inventorying stressful life events as risk factors for psychopathology: Toward resolution of the problem of intracategory variability. Psychological Bulletin 132, 477-495 (2006). Fisfalen M.E., Schulze T.G., DePaulo J.R. Jr., DeGroot L.J., Badner J.A., McMahon F.J.: Familial variation in episode frequency in bipolar affective disorder. American Journal of Psychiatry 162, 1266-1272 (2005). Gassab L., Mechri A., Gaha L., Khiari G., Zaafrane F., Zougaghi L.: Bipolarity correlated factors in major depression: about 155 Tunisian inpatients. Encephale 28, 283-289 (2002). Goldberg J.F., Harrow M., Whiteside J.E.: Risk for bipolar illness in patients initially hospitalized for unipolar depression. American Journal of Psychiatry 158, 1265-1270 (2001). Hamilton M.: A rating scale for depression. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 23, 56-61 (1960). Mitchell P.B., Wilhelm K., Parker G., Austin M.-P., Rutgers P., Malhi G.S.: The clinical features of bipolar depression: a comparison with matched major depressive disorder patients. Journal of Clinical Psychiatry 62, 212-216 (2001). Perlis R.H., Brown E., Baker R.W., Nierenberg A.A.: Clinical features of bipolar depression versus major depres- Geschwindigkeit des Depressionsbeginns: Ein Unterscheidungsmerkmal ... sive disorder in large multicenter trials. American Journal of Psychiatry 163, 225-231 (2006). [14] Schneck C.D., Miklowitz D.J., Calabrese J.R., Allen M.H., Thomas M.R., Wisniewski S.R., Miyahara S., Shelton M.D., Ketter T.A., Goldberg J.F., Bowden C.L., Sachs G.S.: Phenomenology of rapid cycling bipolar disorder: data from the first 500 participants in the Systematic Treatment Enhancement Program. American Journal of Psychiatry 161, 1902-1908 (2004). [15] Strober M., Carlson G.: Bipolar illness in adolescents with major depression: clinical, genetic, and psychopharmacologic predictors in a three- to four-year prospective follow-up investigation. Archives of General Psychiatry 39, 549555 (1982). [16] Winokur, G.: Duration of illness prior to hospitalization (onset) in the affective disorders. Neuropsychobiology 2, 87-93 (1976). [17] Winokur G., Coryell W., Endicott J., Akiskal H.: Further distinctions between manic-depressive illness (bipolar disorder) and primary depressive disorder (unipolar depression). American Journal of Psychiatry 150, 1176-1181 (1993). [18] Wittchen H.-U., Pfister H.: Instruktionsmanual zur Durchführung von DIA-X Interviews. Swets Test Services, Frankfurt am Main 1997. [19] World Health Organization: Composite International Diagnostic Interview, Version 1.1. World Health Organisation, Genf 1993. 99 Professor Dr. med. Ulrich Hegerl Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Universitätsklinikum Leipzig [email protected] Originalarbeit Original Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 2/2008, S. 100–111 Das Gesundheitsverhalten schizophrener erkrankter Patienten: ein typisches Verhaltensmuster? Christiane Roick1, Jana Schindler2, Matthias C. Angermeyer3, Anita Fritz-Wieacker4, Steffi Riedel-Heller4 und Stefan Frühwald5 1 Universität Leipzig, Stiftungsprofessur für Gesundheitsökonomie 2 Vogtland-Klinikum Plauen, Klinik für Psychiatrie und Psychiatrie 3 Center for Public Mental Health, Gösing am Wagram 4 Universität Leipzig, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie Psychosozialer Dienst, Caritas der Diözese St. Pölten 5 Schlüsselwörter: Schizophrenie – Gesundheitsverhalten – Deutschland – Österreich Keywords: Schizophrenia – health habits – Germany – Austria Das Gesundheitsverhalten schizophren erkrankter Patienten: ein typisches Verhaltensmuster? Anliegen: Schizophren Erkrankte haben in vielen Lebensbereichen einen ungesünderen Lebensstil als die Allgemeinbevölkerung. Die vorliegende Studie analysiert, ob das ungesunde Verhalten ein typisches, überregionales Muster darstellt und ob psychosoziale Folgen der Schizophrenie (Alleinleben, Erwerbslosigkeit) das Verhalten beeinflussen. ­ Methode: Schizophren erkrankte, ambulant behandelte Patienten in Deutschland (N=95) und Österreich (N=97) wurden zu Ess- und Trinkverhalten, Nikotinkonsum und körperlichen Aktivitäten befragt. Die Auswertung erfolgte durch Regressionsanalysen. Ergebnisse: Das Gesundheitsverhalten schizophren erkrankter Patienten in Deutschland und Österreich ist ähnlich. Die österreichischen Pro© 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 banden zeigten nur beim Zigarettenkonsum und der Nahrungsmittelwahl einen etwas ungesünderen Lebensstil, waren aber am Wochenende körperlich aktiver. Das Alleinleben hatte keinen Einfluss auf das Gesundheitsverhalten, aber Erwerbslosigkeit war mit geringerer körperlicher Aktivität an Werktagen verbunden. Schlussfolgerungen: Das Gesundheitsverhalten schizophren erkrankter Patienten weist nach unseren Ergebnissen ein typisches, überregionales Muster auf. Psychosoziale Folgen der Schizophrenie erklären das Gesundheitsverhalten der Patienten jedoch kaum. Health habits of patients with schizophrenia: a general pattern? Objective: Schizophrenia patients have in many aspects an unhealthier lifestyle than the general population. The aim of this study is to determine if disadvantageous health habits of schizophrenia patients present a general pattern that repeats itself in other regions and if psychosocial consequences of schizophrenia (singleness, unemployment) influence patients’ health habits. Methods: 95 schizophrenia outpatients from Germany and 97 from Austria were examined regarding eating-, drinking-, smoking- and physical-activity habits. Differences in health habits and the influence of psychosocial pa- rameters were examined with regression analyses. Results: Health habits of schizophrenia patients in Germany and Austria were very similar. Subjects from Austria lived unhealthier only regarding cigarette consumption and grocery choices, while they had a healthier lifestyle regarding physical activity on the weekend. Singleness had no influence on health habits, unemployment was connected with less physical activity on workdays. Conclusions: Health habits of schizophrenia patients seem to have a general pattern, but psychosocial consequences of schizophrenia explain little about the patients’ health habits. Einleitung Schizophren erkrankte Patienten haben im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein erhöhtes Risiko für körperliche Erkrankungen, insbesondere für Übergewicht, Diabetes, Herz- und Kreislauf-Erkrankungen sowie bösartige Neubildungen [10, 11, 20, 24, 33, 39]. Zudem ist bei ihnen die Sterblichkeit an Herz-Kreislauferkrankungen und Diabetes höher als in der Allgemeinbevölkerung [3, 5, 31]. Über die Ursachen der erhöhten Morbidität und Mortalität mit körperlichen Erkrankungen ist bislang relativ wenig bekannt. Nur der Das Gesundheitsverhalten schizophrener erkrankter Patienten: ein typisches Verhaltensmuster? Zusammenhang zwischen neuroleptischer Medikation und Übergewicht bzw. Diabetes ist relativ gut untersucht [7, 38, 43]. Allerdings wurde das Phänomen der Gewichtszunahme bei schizophrenen Erkrankten auch schon vor der Einführung von Neuroleptika beobachtet [41] und nicht alle Patienten, die Neuroleptika erhalten, nehmen gleichermaßen an Gewicht zu [2]. Ebenso liegt das häufigere Auftreten eines Typ-2-Diabetes nicht nur an der Einnahme von Medikamenten, sondern es besteht zudem offensichtlich ein Zusammenhang mit der schizophrenen Erkrankung selbst [34, 37]. Das bedeutet, dass außer den Nebenwirkungen der Pharmakotherapie auch der Lebensstil der Erkrankten Einfluss auf die hohe somatische Komorbidität bei schizophrenen Psychosen haben könnte. Dieser Aspekt wurde jedoch bislang nur unbefriedigend untersucht [7]. Während einige Studien das Gesundheitsverhalten diagnostisch inhomogener Gruppen von psychisch Kranken analysierten [8, 40], beleuchteten andere nur Einzelaspekte des Gesundheitsverhaltens schizophrener Patienten [9, 14, 24, 26-28] oder ermöglichten Vergleiche mit dem Gesundheitsverhalten der Allgemeinbevölkerung nur unter erheblichen methodischen Einschränkungen [4]. Wir haben deshalb kürzlich eine Pilotstudie durchgeführt, in welcher der Lebensstil schizophrener Patienten umfassend analysiert und den Ergebnissen einer Bevölkerungsumfrage gegenübergestellt wurde [36]. Wir untersuchten ambulant behandelte, schizophren erkrankte Patienten aus Ostdeutschland und verglichen deren Angaben direkt mit den Angaben von Probanden aus der ostdeutschen Allgemeinbevölkerung. Unsere Studie zeigte in Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Studien, dass schizophrene Patienten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung in vielen Bereichen einen ungesünderen Lebensstil als die Allgemeinbevölkerung haben. Sie essen seltener Lebensmittel, die für häufigen Konsum empfoh- len werden; sie trinken mehr Kaffee; frühstücken seltener und essen öfter noch spät am Abend. Zudem ist nicht nur die Anzahl der Raucher, sondern auch die Zahl der von den Rauchern konsumierten Zigaretten bei schizophrenen Patienten größer als in der Allgemeinbevölkerung. Darüber hinaus gelingt es schizophren Erkrankten deutlich seltener und im Mittel erst sechs Jahre später als Rauchern in der Allgemeinbevölkerung, das Rauchen langfristig aufzugeben. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung sind schizophren Erkrankte überdies sowohl in ihrer Freizeit als auch im Verlauf normaler Werk- und Wochenendtage deutlich weniger körperlich aktiv [36]. Bislang bleibt bei den eingangs erwähnten Studien jedoch unklar, ob das Gesundheitsverhalten schizophrener Patienten ein typisches Muster darstellt, das auch bei schizophren Erkrankten in anderen Regionen wiedergefunden werden kann. Zudem ist noch wenig bekannt über die Ursachen des abweichenden Gesundheitsverhaltens schizophren Erkrankter. Bislang konnte nur gezeigt werden, dass Nikotin schizophren Erkrankten auch als Selbstmedikation dient, um die Nebenwirkungen von Neuroleptika abzuschwächen, Negativsymptome zu kompensieren und kognitive Defizite, die mit der Schizophrenie verbunden sind, auszugleichen [18]. Auch der starke Kaffeekonsum schizophrener Patienten könnte mit einer günstigen Beeinflussung von Negativsymptomen in Verbindung stehen [21]. Die Negativsymptome selbst können wiederum dazu führen, dass schizophren Erkrankte weniger motiviert sind, sich in ihrer Freizeit zu bewegen [17], oder morgens später aufstehen [36]. Neben diesen, direkt mit der schizophrenen Erkrankung verbundenen Ursachen, können aber auch die psychosozialen Folgen der Schizophrenie den Lebensstil der Erkrankten ungünstig beeinflussen. So lebt im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein deutlich höherer Prozentsatz schizo- 101 phrener Patienten allein und/oder ist von Erwerbslosigkeit betroffen [1]. Das Alleinleben kann es erschweren, Sport zu treiben, spazieren zu gehen oder für sich selbst zu kochen. Arbeitslose sind in der Regel geringeren körperlichen Anforderungen ausgesetzt als Erwerbstätige. Zusätzlich führen die aufgrund der Erwerbslosigkeit zur Verfügung stehenden geringeren finanziellen Mittel dazu, dass weniger Geld für vergleichsweise teure gesunde Lebensmittel, wie Obst und Gemüse, ausgegeben werden kann [25]. Inwieweit die genannten psychosozialen Konsequenzen der schizophrenen Erkrankung Einfluss auf den Lebensstil der Patienten haben, wurde bislang noch nicht untersucht. Die vorliegende Studie verfolgt deshalb zwei Ziele. Zum einen soll geklärt werden, ob das von der Allgemeinbevölkerung abweichende Gesundheitsverhalten schizophrener Patienten ein generelles Muster darstellt und daher auch in anderen Untersuchungsregionen replizierbar ist. Zum anderen soll analysiert werden, inwieweit die psychosozialen Konsequenzen der Schizophrenie das Gesundheitsverhalten der Erkrankten beeinflussen. Für die vorliegende Untersuchung wurden schizophrene Patienten in Deutschland und Österreich befragt, weil in den beiden Nachbarländern die gleiche Sprache gesprochen wird und das medizinische und psychiatrische Versorgungsangebot vergleichbar gut ist. Der Untersuchung liegen folgende Hypothesen zugrunde: • Der ungesunde Lebensstil schizophrener Patienten stellt ein typisches Muster dar und findet sich daher nicht nur bei schizophren Erkrankten in Deutschland, sondern auch bei schizophren erkrankten Patienten in Österreich wieder. • Der ungesunde Lebensstil schizo­­ phrener Patienten wird durch psychosoziale Konseque­nzen der schizophrenen Er­kran­­kung (Erwerbslosigkeit und Alleinleben) moderiert. Roick, Schindler, Angermeyer, Fritz-Wieacker, Riedel-Heller, Frühwald Stichprobe und Methode Stichprobe 95 schizophren erkrankte Patienten aus Deutschland (Plauen), die in unserer Pilotstudie im Gesundheitsverhalten deutliche Unterschiede im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung gezeigt hatten [36], wurden mit 97 schizophrenen Patienten aus Österreich (St. Pölten) verglichen. Plauen ist eine sächsische Kleinstadt mit einer Größe von 102 km2 und 69.000 Einwohnern [45]. St. Pölten wurde als Untersuchungsregion in Österreich gewählt, da es in seiner kleinstädtischen Struktur sowie der Größe und der Einwohnerzahl mit Plauen vergleichbar ist. In der niederösterreichischen Stadt leben 50.000 Einwohner auf einer Fläche von 109 km2 [19]. Zur Probandenrekrutierung wurden die ambulanten Einrichtungen beider Untersuchungsregionen gebeten, alle Patienten im Alter zwischen 18 und 79 Jahren mit der Diagnose einer Schizophrenie (ICD10 F20; [46]) über die geplante Studie zu informieren. Den Patienten wurden die Ziele der Untersuchung erläutert und sie wurden auf die Möglichkeit hingewiesen, die Studienteilnahme ohne Angabe von Gründen zu verweigern. Die Probandenrekrutierung erfolgte konsekutiv mit dem Ziel, in jeder Region ca. 100 Probanden zu befragen. Patienten mit kognitiven Problemen und Erkrankte, die nicht in der Lage waren, den Studienfragebogen selbst auszufüllen, wurden von der Studie ausgeschlossen. In Plauen wurden 115 Patienten gebeten, an der Studie teilzunehmen. 19 Personen (17%) verweigerten die Teilnahme, 96 (83%) stimmten einer Untersuchung zu. Allerdings konnte der Fragebogen eines Teilnehmers aufgrund unzureichender Angaben nicht in die Auswertung einbezogen werden. In St. Pölten wurden 121 Patienten gebeten, an der Studie teilzunehmen. Davon verweigerten 22 Personen (18%) die Teilnahme, 99 (82%) stimmten einer Untersuchung zu, jedoch konnten zwei Fragebögen aufgrund unzureichender Angaben nicht ausgewertet werden. Damit umfasste die untersuchte Stichprobe insgesamt 192 Probanden (Plauen: N=95, St. Pölten: N=97). Die Datenerhebung fand zwischen August 2004 und Oktober 2005 statt. Untersuchungsmethode Die Probanden erhielten einen Fragebogen zum Selbstausfüllen und konnten, wenn sie Schwierigkeiten mit der Beantwortung hatten, einen Projektmitarbeiter um Hilfe bitten. Die soziodemographischen Daten der Studienteilnehmer und die Angaben zu ihrem Gesundheitsverhalten wurden unter Verwendung der jeweiligen Sektionen aus dem Deutschen Bundesgesundheitssurvey 1998 [42] erfragt. Die Sektionen des Bundesgesundheitssurveys wurden als Messinstrument ausgewählt, weil die damit in der deutschen Allgemeinbevölkerung erhobenen Daten für wissenschaftliche Zwecke frei zugänglich sind und somit ein direkter Vergleich des Gesundheitsverhaltens schizophren erkrankter Patienten mit dem der deutschen Allgemeinbevölkerung möglich ist. Bei der Untersuchung des Ess- und Trinkverhaltens wurden Daten zur Häufigkeit des Konsums bestimmter Nahrungsmittel und Getränke im vergangenen Jahr erhoben. Die Antworten waren auf einer 7-stufigen Likertskala zu codieren, die von 0 (nie) bis 6 (mehrmals täglich) reichte. Um das detailliert erfragte Ernährungsverhalten sinnvoll zusammenfassen zu können, wurden alle Nahrungsmittel entsprechend der Empfehlungen internationaler Guidelines für gesunde Ernährung einer der folgenden drei Kategorien zugeordnet: Nahrungsmittel, die für häufigen, mäßigen oder seltenen Konsum empfohlen werden [32]. Zusätzlich wurde erhoben, welche Mahlzeiten die Probanden normalerweise an Werktagen einnehmen. 102 Die Menge des konsumierten Alkohols wurde, differenziert nach den unterschiedlichen Arten alkoholischer Getränke, in Litern bzw. Zentilitern erfragt. Die angegebenen Alkoholmengen wurden auf der Basis des durchschnittlichen Alkoholgehalts der gängigen alkoholischen Getränke in Gramm Alkohol umgerechnet. Dazu wurden die von Möller et al. publizierten Umrechnungswerte verwendet [29]. Die durchschnittliche tägliche Trinkmenge wurde anhand der Häufigkeit des Alkoholkonsums im vergangenen Jahr und anhand der durchschnittlichen Trinkmenge bei Alkoholkonsum ermittelt. Außerdem wurden die Probanden gefragt, ob sich ihr Alkoholkonsum im Vergleich zu früher verändert hat. Bei der Beurteilung des Rauchverhaltens wurden drei Gruppen unterschieden: Personen, die nie geraucht haben; Personen, die aufgehört haben zu rauchen und Personen, die gegenwärtig rauchen. Für letztere Gruppe wurde der durchschnittliche Zigarettenkonsum pro Tag erfasst. Die körperliche Aktivität wurde zum einen danach beurteilt wie viel Zeit die Probanden in den letzten 3 Monaten im Laufe eines 24-stündigen Tages durchschnittlich mit bestimmten Aktivitäten verbrachten. Die Aktivitäten wurden entsprechend der mit ihnen verbundenen körperlichen Belastung in drei Schweregrade eingeteilt: körperlich nicht anstrengende, mäßig anstrengende und anstrengende Aktivitäten. Zum anderen wurde erfasst, wie oft und wie lange die Probanden in ihrer Freizeit sportlichen Aktivitäten nachgingen. Statistische Analyse Zur Untersuchung der soziodemographischen Unterschiede zwischen beiden Stichproben wurden der Chi2Test bzw. der Mann-Whitney-U-Test verwendet. Die Prüfung auf statistisch signifikante Unterschiede im Gesundheitsverhalten der Probanden aus Plauen und St. Pölten (Hypothese 1) erfolgte mit linearen oder Das Gesundheitsverhalten schizophrener erkrankter Patienten: ein typisches Verhaltensmuster? logistischen Regressionsanalysen unter Kontrolle derjenigen soziodemographischen Parameter, die sich in beiden Subgruppen signifikant unterschieden (Bildungsniveau, Beschäftigungsstatus, Wohnsituation, Anzahl der bisherigen stationären und teilstationären Aufenthalte). Parallel zur Untersuchung der Gesamtstichprobe wurden geschlechtsspezifische Analysen durchgeführt. Diese Ergebnisse werden im Interesse einer übersichtlichen Darstellung im Folgenden aber nur erwähnt, wenn sie sich deutlich von den Ergebnissen der Gesamtanalyse unterscheiden. Die Berechnungen wurden mit den Statistik-Programmen SPSS (Version 12.0) und STATA (Version 8.2) durchgeführt. Um zu prüfen, ob die psychosozialen Folgen der Schizophrenie das Gesundheitsverhalten der Patienten modifizieren (Hypothese 2) wurden lineare Regressionsanalysen durchgeführt. Dafür wurde in den Bereichen Ernährung, Trinkverhalten, Rauchen und körperliche Aktivität jeweils ein wesentlicher Aspekt des Gesundheitsverhaltens als abhängige Variable ausgewählt. Als unabhängige Variablen wurden die primär interessierenden Variablen Erwerbslosigkeit und Alleinleben in das Modell aufgenommen, sowie als Kontrollvariablen soziodemographische Parameter (Alter, Geschlecht, Ausbildungsniveau) und Indikatoren für die Krankheitsschwere (Krankheitsdauer, Unterbringung in beschützten Wohnformen und Anzahl der bisherigen stationären und teilstationären Aufenthalte). Ergebnisse Analyse der Stichproben-Eigenschaften und möglicher Selek­ tionseffekte Um mögliche Selektionseffekte identifizieren zu können, wurden basale soziodemographische Daten der 41 Patienten, die ihre Teilnahme an der Studie verweigert hatten, mit den Daten der 192 schizophrenen Patienten verglichen, die teilgenommen hatten. Zwischen Teilnehmern und NichtTeilnehmern fanden sich keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Geschlechtsverteilung (p=0,517), des Alters (p=0,284), und dem Anteil der beiden Patientengruppen in jeder Untersuchungsregion (p=0,715). 49% der Patienten begründeten die Verweigerung ihrer Teilnahme an der Studie mit einer generellen Skepsis gegenüber Studien, 20% konnten aufgrund akuter Krankheitssymptome nicht teilnehmen, 15% aufgrund Zeitmangels, 10% hatten keine Lust an einer Befragung teilzunehmen und 7% verweigerten ihre Teilnahme aufgrund einer spezifischen Aversion gegen das Thema der Studie. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die soziodemographischen Merkmale der Probanden aus Plauen und St. Pölten. Beide Stichproben unterscheiden sich nicht hinsichtlich der Geschlechtsverteilung, des Alters, des Familienstands und der Dauer der schizophrenen Erkrankung. Der Anteil der Probanden ohne abgeschlossene Berufsausbildung ist in St. Pölten jedoch signifikant höher als in Plauen (p=0,001). Im Gegensatz dazu ist der Anteil an gegenwärtig nicht erwerbstätigen Probanden in Plauen signifikant höher (p=0,007). Auch hinsichtlich des Krankheitsverlaufs gibt es Unterschiede zwischen beiden Gruppen. So lebt bei den Probanden aus Plauen ein wesentlich größerer Prozentsatz in beschützten Wohnformen (p=0,001) und die Zahl der bisherigen stationären und teilstationären Aufnahmen ist in der Plauener Stichprobe im Mittel ebenfalls höher als in St. Pölten (p<0,001). Um den Einfluss dieser Stichprobenunterschiede kontrollieren zu können, erfolgte die Prüfung auf statistisch signifikante Unterschiede im Gesundheitsverhalten der Probanden aus Plauen und St. Pölten mit linearen oder logistischen Regressionsanalysen unter Kontrolle der Variablen Ausbildungsniveau, Beschäftigungsstatus, Wohnsituation sowie Anzahl 103 der bisherigen stationären und teilstationären psychiatrischen Aufenthalte. Vergleich des Gesundheitsverhaltens der Probanden aus Deutschland und Österreich Hinsichtlich der Anzahl und der Art der Mahlzeiten, welche die Probanden gewöhnlich an Werktagen zu sich nahmen, bestanden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Probanden aus Plauen und St. Pölten (Tabelle 2). Die österreichischen Probanden nahmen jedoch tendenziell häufiger noch am späten Abend etwas zu sich. Dieser Unterschied erreichte bei den Männern das Signifikanzniveau (p=0,026). Zudem zeigt Tabelle 2, dass die Probanden aus Plauen seltener Nahrungsmittel aßen, die für seltenen Konsum empfohlen werden (p=0,011), aber häufiger Nahrungsmittel konsumierten, die für mäßigen (p=0,021) oder häufigen Konsum (p=0,026) empfohlen werden. Das Trinkverhalten der schizophren erkrankten Patienten aus Plauen und St. Pölten unterschied sich in 10 von 12 untersuchten Bereichen nicht signifikant. Die Probanden aus St. Pölten tranken allerdings häufiger Mineralwasser (p=0,021) und seltener Bier (p=0,033; Tabelle 2). In der geschlechtsspezifischen Analyse zeigte sich zudem, dass Frauen aus Plauen mehr Wein und Sekt tranken (p=0,002), während bei den männlichen Patienten beider Untersuchungsregionen diesbezüglich kein signifikanter Unterschied bestand (p=0,344). Die schizophrenen Patienten aus Plauen konsumierten pro Tag durchschnittlich 8,2 Gramm (SD 19,2) reinen Alkohol, während die Patienten aus St. Pölten 6,4 Gramm (SD 18,9; p=0,218) zu sich nahmen. 38% der Probanden aus Plauen und 45% der Probanden aus St. Pölten gaben an, früher mehr Alkohol getrunken zu haben (p=0,292). Roick, Schindler, Angermeyer, Fritz-Wieacker, Riedel-Heller, Frühwald Geschlecht, Anteil der Männer N (%) Alter, Mittelwert (SD) 104 Plauen (N=95) St. Pölten (N=97) p Wert 49 (52) 46 (47) 0,565 42,1 (13.0) 42,0 (12,3) 0,950 Familienstand % Ledig 52 55 Verheiratet 22 14 Geschieden / Getrennt lebend 24 28 Verwitwet 2 3 0,561 Berufliches Ausbildungsniveau, % Universität / Hochschule 9 4 Lehre / Fachschule / Berufsfachschule 72 49 Keine abgeschlossene Berufsausbildung 14 40 Noch in Ausbildung 2 3 Sonstiges 3 4 86,3 70,1 0,007 12,8 (11,5) 11,7 (9,1) 0,951 23,2 6,2 0,001 7,6 (6,5) 5,7 (7,3) <0,001 Zur Zeit ohne Erwerbstätigkeit, % Dauer der schizophrenen Erkrankung in Jahren, Mittelwert (SD) Unterbringung in beschützter Wohneinrichtung, % Bisherige stationäre bzw. teilstationäre Aufenthalte in der Psychiatrie, Mittelwert (SD) 0,001 Tabelle 1: Soziodemographische Stichprobenmerkmale und Parameter des Krankheitsverlaufs der Probanden aus Plauen (Deutschland) und St. Pölten (Österreich) Auch das Rauchverhalten der Probanden aus Plauen und St. Pölten unterschied sich nicht signifikant (Tabelle 3). In beiden Regionen war der Anteil der Probanden, die noch nie geraucht hatten, die gegenwärtig rauchten und die erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört hatten, ähnlich groß. Auch das Alter, in dem die Probanden im Mittel mit dem Rauchen anfingen bzw. das Alter, in dem es ihnen gelang, mit dem Rauchen aufzuhören, war in beiden Untersuchungsregionen ähnlich. Nur beim Zigarettenkonsum der gegenwärtigen Raucher zeigte sich, dass die schizophren erkrankten Patienten aus St. Pölten im Mittel deutlich mehr Zigaretten pro Tag rauchten als die Patienten aus Plauen (p=0,008). Die Zeit, welche die schizophren erkrankten Patienten aus Plauen und St. Pölten an Werktagen durchschnittlich mit körperlich nicht anstrengenden, mäßig anstrengenden oder anstrengenden Aktivitäten verbrachten, unterschied sich nicht signifikant (Tabelle 4). Am Wochenende waren die österreichischen Probanden jedoch körperlich etwas aktiver als die deut- sche Vergleichsgruppe (p=0.038). Der Anteil der schizophren Erkrankten, die angaben, in ihrer Freizeit überhaupt keinen Sport zu treiben, war in beiden Untersuchungsregionen ähnlich. Bei den Probanden, die in ihrer Freizeit sportlichen Aktivitäten nachgingen, fand sich kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der damit verbrachten Zeit. Das Gesundheitsverhalten schizophrener erkrankter Patienten: ein typisches Verhaltensmuster? 105 Plauen St. Pölten p Wert + 3,4 (0.8) 3,5 (1,0) 0,545 Probanden die frühstücken, % 78 65 0,265 Probanden die ein zweites Frühstück zu sich nehmen, % 19 31 0,531 Probanden die zu Mittag essen, % 91 94 0,304 Probanden die nachmittags eine Zwischenmahlzeit zu sich nehmen, % 40 45 0,255 Probanden die zu Abend essen, % 100 84 – Probanden die einen Spätimbiss zu sich nehmen, % 14 35 0,088 Für seltenen Konsum empfohlene Nahrungsmittel 1, Mittelwert (SD) 1,9 (0,9) 2,3 (1,0) 0,011 Für mäßigen Konsum empfohlene Nahrungsmittel 2, Mittelwert (SD) 3,4 (0,6) 3,1 (0,7) 0,021 Für häufigen Konsum empfohlene Nahrungsmittel 3, Mittelwert (SD) 3,1 (0,7) 2,9 (0,9) 0,026 Mineralwasser, Mittelwert (SD) 4,8 (1,4) 5,3 (1,5) 0,021 Obst- und Gemüsesäfte, Mittelwert (SD) 3,3 (1,6) 3,3 (2,2) 0,787 Milch, Mittelwert (SD) 3,1 (1,8) 3,7 (2,1) 0,565 Schwarztee, Mittelwert (SD) 1,1 (1,6) 1,1 (1,6) 0,829 Kaffee, Mittelwert (SD) 4,7 (2,0) 4,6 (2,1) 0,559 Sportlergetränke, Mittelwert (SD) 0,4 (1,1) 0,6 (1,5) 0,381 Kalorienreduzierte Getränke, Mittelwert (SD) 2,2 (1,9) 1,8 (2,0) 0,373 Limonade, Cola, Tonic, Mittelwert (SD) 2,9 (2,0) 2,9 (2,2) 0,781 Alkoholfreies oder -reduziertes Bier, Mittelwert (SD) 0,4 (0,8) 0,5 (1,0) 0,422 Normales Bier, Mittelwert (SD) 1,3 (1,7) 1,0 (1,6) 0,033 Wein und Sekt, Mittelwert (SD) 1,0 (1,2) 0,8 (1,5) 0,155 Hochprozentige alkoholische Getränke, Mittelwert (SD) 0,4 (1,0) 0,4 (1,1) 0,488 Essverhalten Anzahl der Mahlzeiten pro Tag, Mittelwert (SD) Mahlzeiten, die an Werktagen überlicherweise eingenommen werden Konsum von Nahrungsmitteln # Konsum von Getränken # Tabelle 2: Essverhalten und Konsum von Nahrungsmitteln und Getränken bei schizophren Erkrankten in Plauen (Deutschland) und St. Pölten (Österreich Anmerkungen: + Die Berechnung der p-Werte erfolgte unter Kontrolle des Ausbildungsniveaus, des Erwerbsstatus’, der Wohnsituation und der ­Anzahl der bisherigen stationären und teilstationären psychiatrischen Aufenthalte. # Die Items sind skaliert von 0 (nie) bis 6 (mehrmals täglich). 1 Pommes frites/Bratkartoffeln; Kuchen/Kekse/Süßigkeiten/Schokolade; Kartoffelchips/Cracker/Erdnüsse; fast food (Bratwurst/ Hamburger/Kebab/Pizza) (4 Items). 2 Frischkäse/Yoghurt/Quark; Fisch; Käse/Butter; Roggenmischbrot/Weißbrot und Brötchen; Eier; Fleisch/Wurst (6 Items). 3 Frisches Obst; Rohkostsalat/Gemüse; Vollkornbrot/Vollkornbrötchen; Haferflocken und Müsli; gekochtes Gemüse, Nudeln/Reis (6 Items). Roick, Schindler, Angermeyer, Fritz-Wieacker, Riedel-Heller, Frühwald 106 Plauen St. Pölten p Wert + Gegenwärtiges Rauchverhalten Schon immer Nichtraucher, % 30 25 0,326 Tägliche Raucher, % 56 59 0,577 Gelegenheitsraucher, % 6 3 0,162 Nichtraucher seit > 1 Jahr, % 6 12 0,128 Nichtraucher seit < 1 Jahr, % 1 0 – Derzeitige und ehemalige Raucher: Alter bei Beginn des Rauchens, Mittelwert (SD) 17,4 (5,1) 20,6 (9,1) 0,097 Nichtraucher seit > 1 Jahr: Alter bei Beendigung des Rauchens, Mittelwert (SD) 46,7 (14,7) 37,5 (11,7) 0,489 Tägliche Raucher: Anzahl der Zigaretten pro Tag, Mittelwert (SD) 18,6 (9,3) 25,6 (13,3) 0,008 Tabelle 3: Nikotinkonsum bei schizophren Erkrankten in Plauen (Deutschland) und St. Pölten (Österreich) Anmerkungen: + Die Berechnung der p-Werte erfolgte unter Kontrolle des Ausbildungsniveaus, des Erwerbsstatus’, der Wohnsituation und der ­Anzahl der bisherigen stationären und teilstationären psychiatrischen Aufenthalte. Plauen St. Pölten p Wert+ Körperliche Aktivität an einem Werktag (24 Stunden) in Stunden Körperlich nicht anstrengende Aktivitäten 1, Mittelwert (SD) 22,2 (2,1) 21,4 (2,8) 0,476 Körperlich mäßig anstrengende Aktivitäten 2, Mittelwert (SD) 1,4 (1,6) 1,6 (1,8) 0,913 Körperlich anstrengende Aktivitäten 3, Mittelwert (SD) 0,4 (1,1) 0,9 (2,4) 0,298 Körperliche Aktivität an einem Wochenendtag (24 Stunden) in Stunden Körperlich nicht anstrengende Aktivitäten 1, Mittelwert (SD) 22,9 (1,6) 22,3 (1,9) 0,028 Körperlich mäßig anstrengende Aktivitäten 2, Mittelwert (SD) 0,8 (1,0) 1,2 (1,4) 0,038 Körperlich anstrengende Aktivitäten 3, Mittelwert (SD) 0,2 (0,9) 0,5 (1,0) 0,138 46,8 37,9 0,273 50,0 (50,2) 59,6 (61,5) 0,606 Probanden, die überhaupt keinen Sport treiben, % Trainingsstunden pro Jahr bei Probanden die Sport treiben, Mittelwert (SD) Tabelle 4: Körperliche Aktivität schizophren Erkrankter in Plauen (Deutschland) und St. Pölten (Österreich) Anmerkungen: + Die Berechnung der p-Werte erfolgte unter Kontrolle des Ausbildungsniveaus, des Erwerbsstatus’, der Wohnsituation und der Anzahl der bisherigen stationären und teilstationären psychiatrischen Aufenthalte. 1 z.B. schlafen, ruhen, sitzende und leichte Aktivitäten 2 z.B. joggen, aufräumen, Fahrrad fahren, schwimmen 3 z.B. schwere Sachen tragen, schwere Gartenarbeit, Holzhacken -0,004 -0,095 -0,282 0,001 -0,003 -0,337 0,020 3,127 Alter in Jahren Allein lebend (0 nein, 1 ja) Keine abgeschlossene Berufsausbildung (0 nein, 1 ja) Erwerbstätig (0 nein, 1 ja) Dauer der schizophrenen Erkrankung in Jahren Unterbringung in Beschützter Einrichtung (0 nein, 1 ja) Anzahl der bisherigen stationären/teilstationären Aufenthalte Konstante 0,13 0,000 0,028 0,046 0,694 0,997 0,035 0,416 0,435 0,001 p Wert 2,287 0,021 2,114 0,074 0,277 3,257 3,202 0,053 -3,631 Koeffizient 0,03 0,669 0,914 0,567 0,627 0,931 0,270 0,215 0,661 0,158 p Wert Trinken Durchschnittlicher Alkoholkonsum (g Alkohol pro Tag) 20,423 0,300 0,292 0,131 0,932 2,593 0,089 -0,221 -6,777 Koeffizient 0,12 0,000 0,063 0,922 0,287 0,716 0,275 0,966 0,022 0,001 p Wert Rauchen Anzahl der Zigaretten pro Tag (Raucher und Nichtraucher) Tabelle 5: Multiple Regressionsanalyse der Prädikatoren des Gesundheitsverhaltens schizophren erkrankter Patienten R2 0,389 Geschlecht (0 männlich, 1 weiblich) Koeffizient Ernährung Aufnahme von Nahrungsmitteln die für häufigen Konsum empfohlen werden (Häufigkeit) 20,784 -0,016 0,693 0,030 -1,428 -0,224 0,217 0,014 0,734 Koeffizient 0,12 0,000 0,622 0,254 0,213 0,005 0,638 0,601 0,465 0,074 p Wert Körperliche Aktivität Körperlich nicht anstrengende Aktivitäten an Werktagen (Stunden) Das Gesundheitsverhalten schizophrener erkrankter Patienten: ein typisches Verhaltensmuster? 107 Roick, Schindler, Angermeyer, Fritz-Wieacker, Riedel-Heller, Frühwald Der Einfluss psychosozialer Faktoren der Schizophrenie Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse der Regressionsanalysen, die durchgeführt wurden um zu prüfen, ob die psychosozialen Folgen der schizophrenen Grunderkrankung das Gesundheitsverhalten der Erkrankten in den Bereichen körperliche Aktivität, Ernährung sowie Alkohol- und Nikotinkonsum modifizieren. Wie deutlich wird, steht eine fehlende Berufstätigkeit in Zusammenhang mit einer geringeren körperlichen Aktivität an Werktagen. Auf die anderen untersuchten Bereiche des Gesundheitsverhaltens hat die fehlende Erwerbstätigkeit jedoch keinen signifikanten Einfluss. Ob schizophren Erkrankte allein leben oder nicht, hat in keinem der untersuchten Bereiche signifikanten Einfluss auf das Gesundheitsverhalten. Betrachtet man die Kontrollvariablen, so findet sich ein signifikanter Einfluss des Geschlechts auf das Ernährungs- und das Rauchverhalten, wobei Frauen jeweils ein gesundheitsbewussteres Verhalten zeigen. Das Alter ist ein Prädiktor für den Nikotinkonsum, der mit zunehmendem Alter geringer wird. Ein niedrigeres Bildungsniveau, das sich in einem fehlenden Berufsabschluss widerspiegelt, prädiziert einen selteneren Konsum von gesunden und empfohlenen Lebensmitteln. Die Dauer der schizophrenen Grunderkrankung hat keinen Einfluss auf das Gesundheitsverhalten. Dagegen steht das Leben in beschützten Wohnformen in Zusammenhang mit einem selteneren Konsum von gesunden und empfohlenen Lebensmitteln, während ein häufigerer Konsum dieser Lebensmittel durch eine höhere Zahl stationärer oder teilstationärer Voraufnahmen prädiziert wird. Betrachtet man die Varianzaufklärung in den Modellen, wird deutlich, dass mit einem R2 von 0,12 – 0,13 in den Bereichen Ernährung, Nikotinkonsum und körperliche Aktivität offensichtlich einige bedeutsame Einflussfaktoren auf das Gesundheitsverhalten identifiziert werden konnten. Anders ist dies bei dem Regressionsmodell zum Alkoholkonsum, das die geringste Varianzaufklärung hat (R2=0,03) und in dem keine der untersuchten Variablen einen signifikanten Einfluss auf das Trinkverhalten hat. Diskussion Aus unserer Pilotstudie war bekannt, dass schizophren erkrankte Patienten in Deutschland in vielen Bereichen einen ungesünderen Lebensstil als die Allgemeinbevölkerung haben [36]. Sie nehmen seltener Lebensmittel zu sich, die für häufigen Konsum empfohlen werden, sie frühstücken seltener, essen häufiger spät abends und trinken mehr Kaffee. Zudem ist nicht nur der Anteil der Raucher unter den schizophrenen Patienten größer als in der Allgemeinbevölkerung, sondern die Raucher konsumieren auch deutlich mehr Zigaretten pro Tag. Der Prozentsatz derjenigen, die vor längerer Zeit mit dem Rauchen aufgehört haben, ist unter den schizophrenen Patienten geringer. Zudem gelingt schizophren Erkrankten das Aufgeben des Rauchens im Mittel erst sechs Jahre später als der Allgemeinbevölkerung. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung bewegen sich schizophrene Patienten im Laufe eines normalen Werk- oder Wochenendtages weniger und Sport spielt in ihrer Freizeitgestaltung eine geringere Rolle. Die vorliegende Studie hat nun gezeigt, dass sich das Gesundheitsverhalten schizophren erkrankter Patienten in vergleichbaren Untersuchungsregionen in Deutschland und Österreich in den meisten Parametern nicht signifikant unterscheidet. Unterschiede bestehen lediglich beim Zigarettenkonsum der Raucher und der Nahrungsmittelauswahl, wobei die Probanden aus Österreich eine etwas ungesündere Lebensweise zeigen, sowie bei der körperlichen Aktivität am Wochenende, wo die Probanden 108 aus Österreich eine etwas gesündere Lebensweise zeigen. Zudem trinken schizophren Erkrankte aus Österreich häufiger Mineralwasser und seltener Bier als die Probanden aus Deutschland, wobei letzterer Aspekt sicher auch damit in Zusammenhang steht, dass in Deutschland generell mehr Bier getrunken wird als in Österreich [47]. Die vorliegende Untersuchung zeigt somit ein weitgehend ähnliches Gesundheitsverhalten der schizophren Erkrankten in Deutschland und Österreich und bestätigt damit die eingangs geäußerte Vermutung, dass eine ungesunde Lebensweise spezifisch für schizophren erkrankte Patienten ist. Erwerbslosigkeit und Alleinleben, psychosoziale Konsequenzen der Schizophrenie, beeinflussten das Gesundheitsverhalten der Erkrankten in geringerem Ausmaß als eingangs vermutet. Das Alleinleben hatte in keinem der untersuchten Bereiche Einfluss auf das Gesundheitsverhalten der Probanden. Die fehlende Berufstätigkeit stand lediglich in Zusammenhang mit einer geringeren körperlichen Aktivität an Werktagen und bestätigt damit die Vermutung, dass Erwerbstätige körperlich mehr gefordert sind als nicht Erwerbstätige. Auf die körperliche Aktivität an Wochenenden und auf die in der Freizeit mit sportlichen Aktivitäten verbrachte Zeit hatte die Berufstätigkeit ebensowenig Einfluss wie auf den Verzehr von Nahrungsmitteln, die für häufigen Konsum empfohlen werden. Darüber hinaus bestätigt unsere Studie die aus Untersuchungen der Allgemeinbevölkerung bekannte Tatsache, dass das Gesundheitsverhalten durch das Alter, das Geschlecht und das Bildungsniveau der Probanden modifiziert wird [13]. So konsumieren Frauen in der Allgemeinbevölkerung häufiger gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse und rauchen seltener [6, 16, 44]. Bei den schizophren erkrankten Probanden findet sich dieser Zusammenhang ebenfalls. Dagegen ist das Geschlecht bei schi- Das Gesundheitsverhalten schizophrener erkrankter Patienten: ein typisches Verhaltensmuster? zophren erkrankten Patienten kein signifikanter Prädiktor für den Alkoholkonsum, obwohl es in der Allgemeinbevölkerung so ist, dass Frauen weniger Alkohol trinken [44]. Ein niedriges Bildungsniveau ist in der Allgemeinbevölkerung ein starker Prädiktor für einen allgemein ungesünderen Lebensstil [35] und für eine ungesündere Ernährung (weniger Obst und Gemüse) [16]. Dieser Zusammenhang ließ sich auch bei den von uns untersuchten schizophren Erkrankten beobachten. Auch das Lebensalter modifiziert in der Allgemeinbevölkerung das Gesundheitsverhalten, wobei ein höheres Alter mit häufigerem Konsum von Obst und Gemüse [16], geringerem Nikotinkonsum [22], aber auch mit geringerer körperlicher Aktivität [12] assoziiert ist. Auch bei den von uns untersuchten schizophren Erkrankten wurde der Nikotinkonsum mit zunehmendem Alter geringer, während das Gesundheitsverhalten in den anderen Bereichen nicht durch das Alter moderiert wurde. Unter Kontrolle des Lebensalters hatte die Dauer der schizophrenen Grunderkrankung in unserer Studie keinen Einfluss auf das Gesundheitsverhalten der Probanden. Dies spricht dafür, dass sich der ungesunde Lebensstil schon bei Erkrankungsbeginn manifestiert. Interventionen zur Verbesserung des Gesundheitsverhaltens schizophrener Patienten sind deshalb schon in frühen Phasen der Erkrankung sinnvoll und notwendig. Zudem hat unsere Studie gezeigt, dass die Unterbringung in beschützten Wohnformen in Zusammenhang mit einem selteneren Konsum von gesunden und empfohlenen Lebensmitteln steht. Dies spricht dafür, dass zur Verbesserung des Gesundheitsverhaltens schizophrener Patienten nicht nur eine Verhaltensprävention, sondern auch eine Verhältnisprävention erforderlich ist, denn offensichtlich entspricht der Speiseplan in beschützten Wohneinrichtungen bislang nicht den von Ernährungswis- senschaftlern empfohlenen Standards einer gesunden Ernährung. Dass schizophren Erkrankte mit einer größeren Zahl stationärer oder teilstationärer Voraufnahmen häufiger gesunde Lebensmittel konsumieren, verwundert zunächst. Der Grund dafür besteht möglicherweise darin, dass im Rahmen der stationären und teilstationären Versorgung in Deutschland und Österreich mittlerweile regelmäßig Kurse zum Thema gesunde Ernährung und Gewichtsreduktion angeboten werden, während ambulante Patienten schlechter Zugang zu entsprechenden Angeboten haben. Es könnte daher sein, dass stationär behandelte Patienten durch die Kurse mehr über gesunde Ernährung wissen und daher häufiger gesunde Lebensmittel konsumieren. Da in unserer Studie nur ambulant behandelte schizophren Erkrankte untersucht wurden, sind schwer kranke Patienten, die oft stationär behandelt werden und wenig Zeit in der Gemeinde verbringen, in unserer Stichprobe wahrscheinlich unterrepräsentiert. Die Beschränkung auf ambulante Patienten ist jedoch auch ein Vorteil. Einerseits sind schwer kranke Patienten dadurch nicht überrepräsentiert, wie es in Stichproben mit stationären Patienten häufig der Fall ist, und andererseits können die alltäglichen Verhaltensweisen der Patienten bei der Rekrutierung aus dem ambulanten Versorgungsbereich genauer beschrieben werden. Da unsere Studie auf Selbstauskünften der Probanden basiert, können Verzerrungen aufgrund eines erwünschten Antwortverhaltens oder des Herunterspielens bestehender Probleme, z.B. mit dem Alkoholkonsum, nicht ausgeschlossen werden. Da die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Phänomene aber in beiden Stichproben gleich groß ist, ist eine valide Beschreibung der Unterschiede zwischen den Probanden aus Deutschland und Österreich trotzdem möglich. Die vorliegende Untersuchung ging von der Beobachtung aus, dass schi- 109 zophrene Patienten in Deutschland ein in vielen Lebensbereichen ungünstigeres Gesundheitsverhalten zeigen, als die deutsche Allgemeinbevölkerung [36]. Die Studienergebnisse haben deutlich gemacht, dass schizophren erkrankte Patienten in Österreich ein in vielen Bereichen ähnliches und tendenziell sogar ungünstigeres Gesundheitsverhalten als die deutsche Vergleichsgruppe haben. Allerdings kann das Gesundheitsverhalten der österreichischen Probanden nicht direkt mit dem der österreichischen Allgemeinbevölkerung verglichen werden, weil dafür keine Daten vorliegen. Mehrere Untersuchungen der Allgemeinbevölkerung sprechen jedoch dafür, dass das Gesundheitsverhalten in den Nachbarländern Deutschland und Österreich ähnlich ist [47-50]. Deshalb kann die beobachtete ungesunde Lebensweise der Probanden in Österreich tatsächlich als Spezifikum der Lebensweise schizophrener Patienten gewertet werden und ist wahrscheinlich nicht auf eine ungesündere Lebensweise der österreichischen Allgemeinbevölkerung zurückzuführen. Schlussfolgerungen Obwohl das Gesundheitsverhalten schizophrener Patienten ein spezifisches, in unterschiedlichen Regionen replizierbares Muster zu haben scheint, ist es bislang nur ansatzweise gelungen, wesentliche, mit der schizophrenen Erkrankung in Verbindung stehende Ursachen dieses Verhaltens zu identifizieren. Auch Erwerbslosigkeit und Alleinleben, die psychosozialen Folgen einer schizophrenen Erkrankung, tragen wenig oder gar nichts zur Erklärung des abweichenden Gesundheitsverhaltens der Patienten bei. Künftige Untersuchungen müssen deshalb prüfen, welchen Einfluss andere Parameter, wie die Krankheitssymptomatik, auf das Gesundheitsverhalten haben. Roick, Schindler, Angermeyer, Fritz-Wieacker, Riedel-Heller, Frühwald Zum Gesundheitsverhalten schizophrener Patienten in Österreich lagen bislang noch keine Daten vor. Mit unserer Studie konnte gezeigt werden, dass schizophren Erkrankte in Österreich ein ähnlich ungünstiges Gesundheitsverhalten aufweisen wie in Deutschland und dass sie damit eine wichtige Zielgruppe für gesundheitsfördernde Interventionen sind. Besonders im Hinblick auf die Nahrungsmittelauswahl und den Zigarettenkonsum der Raucher, wo schizophren Erkrankte aus Österreich eine noch ungesündere Lebensweise als Patienten aus Deutschland zeigen, sind Interventionen erforderlich. Präventive Maßnahmen sollten Informationen über gesunde Ernährung beinhalten und die Patienten dazu motivieren, für sich selbst zu kochen. Sport und sonstige körperlichen Aktivitäten sollten in der psychiatrischen Versorgung einen höheren Stellenwert bekommen als bislang. Zudem sollten schizophren Erkrankte massiv dabei unterstützt werden, das Rauchen aufzugeben. Da ein langfristiger Erfolg für viele Patienten jedoch nur schwer zu erreichen ist, kann die Reduktion der Zahl der täglich gerauchten Zigaretten ein leichter erreichbares und trotzdem sinnvolles Teilziel sein [23]. Entsprechende Interventionen sollten in die gemeindepsychiatrische Versorgung integriert und bereits zu Beginn einer schizophrenen Erkrankung vermittelt werden. Darüber hinaus muss das medizinische Personal aber auch dafür sensibilisiert werden, neben den psychischen auch die physischen Probleme schizophren erkrankter Patienten wahrzunehmen und zu behandeln. Denn bislang erhalten die Betroffenen trotz ihres ungesunden Lebensstils immer noch eine schlechtere somatische Versorgung als körperlich Kranke [15, 30]. 110 Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] Agerbo E., Byrne M., Eaton W.W., Mortensen P.B.: Marital and labor market status in the long run in schizophrenia. Archives of General Psychiatry 61, 28-33 (2004). Allison D.B., Casey D.E.: Antipsychotic-induced weight gain: a review of the literature. Journal of Clinical Psychiatry 62 Suppl 7, 22-31 (2001). Brown S.: Excess mortality of schizophrenia. A meta-analysis. British Journal of Psychiatry 171, 502-8 (1997). Brown S., Birtwistle J., Roe L., Thompson C.: The unhealthy lifestyle of people with schizophrenia. Psychological Medicine 29, 697-701 (1999). Brown S., Inskip H., Barraclough B.: Causes of the excess mortality of schizophrenia. British Journal of Psychiatry 177, 212-7 (2000). Center for disease control and prevention: Prevalence of healthy lifestyle characteristics - Michigan, 1998 and 2000. Morbidity and Mortality Weekly Report 50, 758-61 (2001). Connolly M., Kelly C.: Lifestyle and physical health in schizophrenia. Advances in Psychiatric Treatment 11, 12532 (2005). Daumit G.L., Goldberg R.W., Anthony C., Dickerson F., Brown C.H., Kreyenbuhl J., et al.: Physical activity patterns in adults with severe mental illness. Journal of Nervous and Mental Disorders 193, 641-6 (2005). de Leon J., Tracy J., McCann E., McGrory A., Diaz F.J.: Schizophrenia and tobacco smoking: a replication study in another US psychiatric hospital. Schizophrenia Research 56, 55-65 (2002). Dickerson F.B., Pater A., Origoni A.E.: Health behaviors and health status of older women with schizophrenia. Psychiatric Services 53, 882-4 (2002). Dixon L., Weiden P., Delahanty J., Goldberg R., Postrado L., Lucksted A., et al.: Prevalence and correlates of diabetes in national schizophrenia samples. Schizophrenia Bulletin 26, 903-12 (2000). Elizondo-Armendariz J.J., Guillen Grima F., Aguinaga Ontoso I.: Prevalence of physical activity and its relationship to sociodemographic variables and lifestyles in the age 18-65 population of Pamplona, Spain. Revista Española de Salud Pública 79, 559-67 (2005). Gillis A.J.: Determinants of a health-promoting lifestyle: an integrative review. Journal of Advanced Nursing 18, 345-53 (1993). Hughes J.R., McHugh P., Holtzman S.: Caffeine and schizophrenia. Psychiatric Services 49, 1415-7 (1998). Jeste D.V., Gladsjo J.A., Lindamer L.A., Lacro J.P.: Medical comorbidity in [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 22, 413-30 (1996). Johansson L., Thelle D.S., Solvoll K., Bjorneboe G.E., Drevon C.A.: Healthy dietary habits in relation to social determinants and lifestyle factors. British Journal of Nutrition 81, 211-20 (1999). Koga M., Nakayama K.: Body weight gain induced by a newer antipsychotic agent reversed as negative symptoms improved. Acta Psychiatrica Scandinavica 112, 75-6 (2005). Kumari V., Postma P.: Nicotine use in schizophrenia: the self medication hypotheses. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 29, 1021-34 (2005). Land Niederösterreich: Das Land Niederösterreich. 2006: http://www01.noel. gv.at/scripts/ru/ru2/stat.asp?NR=30201. Lichtermann D., Ekelund J., Pukkala E., Tanskanen A., Lonnqvist J.: Incidence of cancer among persons with schizophrenia and their relatives. Archives of General Psychiatry 58, 573-8 (2001). Lucas P.B., Pickar D., Kelsoe J., Rapaport M., Pato C., Hommer D.: Effects of the acute administration of caffeine in patients with schizophrenia. Biological Psychiatry 28, 35-40 (1990). Manzoli L., Di Giovanni P., Dragani V., Ferrandino M.G., Morano J.P., Rauti I., et al.: Smoking behaviour, cessation attempts and the influence of parental smoking in older adult women: a crosssectional analysis from Italy. Public Health 119, 670-8 (2005). McChargue D.E., Gulliver S.B., Hitsman B.: Would smokers with schizophrenia benefit from a more flexible approach to smoking treatment? Addiction 97, 78593 (2002). McCreadie R.G.: Diet, smoking and cardiovascular risk in people with schizophrenia: descriptive study. British Journal of Psychiatry 183, 534-9 (2003). McCreadie R.G., Kelly C., Connolly M., Williams S., Baxter G., Lean M., et al.: Dietary improvement in people with schizophrenia: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry 187, 346-51 (2005). McCreadie R.G., Macdonald E., Blacklock C., Tilak-Singh D., Wiles D., Halliday J., et al.: Dietary intake of schizophrenic patients in Nithsdale, Scotland: case-control study. British Medical Journal 317, 784-5 (1998). McEvoy J.P.: Schizophrenia, substance misuse, and smoking. Current Opinion in Psychiatry 13, 15-9 (2000). McEvoy J.P., Allen T.B.: Substance abuse (including nicotine) in schizophrenic patients. Current Opinion in Psychiatry 16, 199-205 (2003). Möller H.-J., Laux G., Deister A.: Psychiatrie und Psychotherapie. Thieme, Stuttgart 2001. Das Gesundheitsverhalten schizophrener erkrankter Patienten: ein typisches Verhaltensmuster? [30] Munk-Jorgensen P., Mors O., Mortensen P.B., Ewald H.: The schizophrenic patient in the somatic hospital. Acta Psychiatrica Scandinavica 407, S96-9 (2000). [31] Osby U., Correia N., Brandt L., Ekbom A., Sparen P.: Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Schizophrenia Research 45, 21-8 (2000). [32] Painter J., Rah J.H., Lee Y.K.: Comparison of international food guide pictorial representations. Journal of the American Dietetic Association 102, 483-9 (2002). [33] Paton C., Esop R., Young C., Taylor D.: Obesity, dyslipidaemias and smoking in an inpatient population treated with antipsychotic drugs. Acta Psychiatrica Scandinavica 110, 299-305 (2004). [34] Peet M.: Diet, diabetes and schizophrenia: review and hypothesis. British Journal of Psychiatry 47, S102-5 (2004). [35] Pronk N.P., Anderson L.H., Crain A.L., Martinson B.C., O'Connor P.J., Sherwood N.E., et al.: Meeting recommendations for multiple healthy lifestyle factors. Prevalence, clustering, and predictors among adolescent, adult, and senior health plan members. American Journal of Preventive Medicine 27, 2533 (2004). [36] Roick C., Fritz-Wieacker A., Matschinger H., Heider D., Schindler J., Riedel-Heller S., et al.: Health habits of patients with schizophrenia. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 42, 268-76 (2007). [37] Ryan M.C., Collins P., Thakore J.H.: Impaired fasting glucose tolerance in first-episode, drug-naive patients with [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] schizophrenia. American Journal of Psychiatry 160, 284-9 (2003). Sernyak M.J., Leslie D.L., Alarcon R.D., Losonczy M.F., Rosenheck R.: Association of diabetes mellitus with use of atypical neuroleptics in the treatment of schizophrenia. American Journal of Psychiatry 159, 561-6 (2002). Silverstone T., Smith G., Goodall E.: Prevalence of obesity in patients receiving depot antipsychotics. British Journal of Psychiatry 153, 214-7 (1988). Strassnig M., Brar J.S., Ganguli R.: Nutritional assessment of patients with schizophrenia: a preliminary study. Schizophrenia Bulletin 29, 393-7 (2003). Tardieu S., Micallef J., Gentile S., Blin O.: Weight gain profiles of new antipsychotics: public health consequences. Obesity Reviews 4, 129-38 (2003). Thefeld W., Stolzenberg H., Bellach B.M.: Bundes-Gesundheitssurvey: Response, Zusammensetzung der Teilnehmer und Non-Responder-Analyse. Gesundheitswesen 61, S57-61 (1999). Vieweg W.V., Sood A.B., Pandurangi A., Silverman J.J.: Newer antipsychotic drugs and obesity in children and adolescents. How should we assess drugassociated weight gain? Acta Psychiatrica Scandinavica 111, 177-84 (2005). von Bothmer M.I., Fridlund B.: Gender differences in health habits and in motivation for a healthy lifestyle among Swedish university students. Nursing & Health Sciences 7, 107-18 (2005). Weck S., Mennel F.: Stadt Plauen. 2006: http://www.plauen.de/. 111 [46] World Health Organization: The ICD10 classification of mental and behavioral disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. World Health Organisation, Geneva 1992. [47] World Health Organization: Adult per capita alcohol consumption. 2001: http://globalatlas.who.int/globalatlas/ dataQuery/reportData.asp?rptType=1. [48] World Health Organization: BMI / Overweight / Obesity - prevalence. 2002: http://www.who.int/ncd_surveillance/infobase/web/InfoBasePolicyMaker/CountryProfiles/QuickCompare. aspx?DM=5&Countries=40%2c276&Y ear=2002&sf1=all&Sex=all. [49] World Health Organization: Mortality - Communicable, maternal, perinatal and nutritional conditions. 2002: http:// www.who.int/ncd_surveillance/infobase/web/InfoBasePolicyMaker/CountryProfiles/QuickCompare.aspx?DM=1 0&Countries=40,276&Year=2002&sf1 =all&Sex=all. [50] World Health Organization: The World Health Report 2002. 2002: http://www. who.int/whr/2002/en/. Dr. med. Christiane Roick, MPH Universität Leipzig, Stiftungsprofessur für Gesundheitsökonomie, Leipzig [email protected] Originalarbeit Original Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 2/2008, S.112–123 Führt Mobbing zur posttraumatischen Belastungsstörung? Implikationen von Stressverarbeitung und Persönlichkeit Barbara Kreiner, Christoph Sulyok und Hans-Bernd Rothenhäusler Univ.-Klinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Graz Schlüsselwörter: Mobbing – Posttraumatisches Be­lastungs­ störung – Stressverarbeitung – Per­ sönlichkeit – gesundheitsbezogene Leb­ ensqualität Key words: Mobbing – posttraumatic stress disorder – coping strategies – personality – healthrelated quality of life Führt Mobbing zur posttrauma­ tischen Belastungsstörung? Impli­ kationen von Stressver­arbei­tung und Persönlichkeit Anliegen: In bisherigen Unter­suchun­ gen wurde gezeigt, dass Mobbing eine Vielzahl von Angst-, Depres­ sionsund psychosomatischen Symptomen bei Betroffenen hervor­ rufen kann. Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, wie häufig eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) auftrat und welche Faktoren jene Mobbing-Betroffenen, die keine PTBS entwickelten von denen mit einer PTBS unterschieden. Methode: Mittels SKID Interview ermittel­ ten wir bei 20 Mobbing-Betroffenen das Auftreten einer PTBS. Mobbing wur­de hierbei als Trauma angesehen. Ergebnisse: Es zeigte sich, dass 55% der Befragten eine PTBS aufgrund der Kriterien des SKID Interviews en­ © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 twickelten und 70% an ausgeprägten posttraumatischen Stresssymptomen (Impact of Event Skala, IES) litten. Mittels MANOVA konnte gezeigt werden, dass Mobbing-Betroffene mit aktueller PTBS tendenziell höhe­ re posttraumatische Stress- (IES) und Depressionssymptomatik (Beck De­ pression Inventar) sowie signifikant geringere Lebensqualitätskennzif­ fern (Fragebogen zum Gesundheits­ zu­stand), insbesondere im Hinblick auf körperliche Schmerzen, aufwie­ sen. Bezüglich ihrer Persönlichkeit (Freiburger Persönlichkeitsinven­ tar) zeigten sich multivariat keine signi­fikanten Unterschiede. In den uni­variaten Vergleichen erzielten Mobbing-Betroffene mit PTBS ten­ denziell höhere Werte in den Ska­len soziale Orientierung und körper­liche Beschwerden. In ihrer Stressverarbei­ tung (Stressverar­beitungsfragebogen) verwandten sie generell weder ver­ mehrt positive noch negative Copin­ gstrategien. Insgesamt nützten Mob­ bing-Betroffene mit PTBS jedoch häufiger Kontrollstrategien, Vermei­ dung, Abkapselung und gedankliche Weiterbeschäftigung zur Stressve­ rarbeitung. Schlussfolgerung: Po­ sttraumatische Belastungsstörungen infolge von Mobbing können häufig auftreten. Sie sollten folglich in der Routineversorgung Mobbing-Betrof­ fener gezielt berücksichtigt werden. Does mobbing cause posttraumatic stress disorder? Impact of coping and personality Introduction: Previous research has documented that a variety of anxi­ ety, depressive, and psychosomatic symptoms are present in a substan­ tial portion of mobbing victims. This study aimed to explore the frequen­ cy of posttraumatic stress disorder (PTSD) among mobbing victims, and to investigate how PTSD was linked to pertinent psychometric scales. Method: We recruited 20 mobbing victims and conducted the Structural Clinical Interview (SCID) to assess PTSD according to DSM-IV criteria. The trauma criterion was homogene­ ously defined as mobbing. Results: 55% of our entire sample had a cur­ rent PTSD, and 70% suffered from severe posttraumatic stress symptoms according to the Impact of Event Scale. Using multivariate analysis of variance (MANOVA), we found that mobbing victims with a current PTSD tended to demonstrate higher levels of stress and depressive symp­ toms, and less quality of life (SF 36 Short-Form Health Survey), especial­ ly in terms of bodily pain, compared with those without a PTSD diagnosis. No significant differences in person­ ality factors (Freiburg Personality Inventory) between mobbing-victims with and without PTSD were evident by multivariate analysis. Univari­ ate statistics, however, revealed that mobbing-related PTSD showed a trend towards higher scores in social orientation and somatic complaints. Führt Mobbing zur posttraumatischen Belastungsstörung? Implikationen von Stressverarbeitung und Persönlichkeit There was no general evidence that mobbing victims with a PTSD used more often negative and positive coping strategies (SVF – Stress Cop­ ing Questionnaire). However, they showed a tendency to employ control strategies, avoidance, social with­ drawal, and cognitive preoccupation. Conclusion: Posttraumatic stress disorder subsequent to mobbing can occur frequently. PTSD therefore should be specifically considered in routine care. Einleitung Der Begriff Mobbing beschreibt ne­ gative kommunikative Handlungen (von einem oder mehreren anderen), die gegen eine Person gerichtet sind, sehr oft über einen längeren Zeitraum bestehen und damit die Beziehung zwischen Täter und Opfer kennzeich­ nen [18]. Zapf [40] spricht von Mob­ bing bei feindseligen Interaktionen am Arbeitsplatz, wo einzelne Perso­ nen von Vorgesetzten oder Kollegen schikaniert werden. Im Rahmen der Stressforschung lässt sich Mobbing als extreme Form sozialer Stressoren einordnen. Dabei sind die am häufig­ sten gesetzten Mobbing-Handlungen: Hinter dem Rücken schlecht über je­ manden sprechen, abwertende Blicke oder Gesten und Kontaktverweige­ rungen [15]. Auswirkungen von Mobbing-Hand­ lungen können sehr unterschiedlich sein. Neben betrieblichen Folgen, wie schlechteres Betriebsklima und Betriebsergebnis, erhöhten Fehlzei­ ten und Krankenständen, Kündigun­ gen und Personalfluktuation gibt es eine Vielzahl von psychischen und physischen Beschwerden bei den betroffenen Individuen selbst: Ner­ vosität, Apathie, Konzentrations­ schwierigkeiten und psychosomati­ sche Beschwerden [16]. Auch treten im Gefolge von Mobbing depressive Erkrankungen [27,26] und kardio­ vaskuläre Erkrankungen [14] auf. Weitere psychische Folgen können Selbstzweifel, Selbstunsicherheit, Orientierungslosigkeit, Verzweiflung, gereizte bis aggressive Stimmung und Gedankenkreisen bis hin zu Suizid­ gedanken sein. Gleichfalls zeigt sich nicht selten zwanghaftes Denken, in dem von Betroffenen unentwegt über das eigene Leid geklagt wird. Unwil­ len und Abwendung im sozialen Um­ feld des Mobbing-Betroffenen sind die Folge. In diesem Zusammenhang kann es zu schwerwiegenden psychi­ schen Folgestörungen wie Alkoholund Drogenabhängigkeitssyndrome, Angststörungen und posttraumati­ sche Belastungsstörungen kommen [16, 17]. Unter posttraumatische Belastungs­ störungen (PTBS) versteht man nach der ICD-10 [5] „eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf eine extre­ me Bedrohung oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes (kurz oder lang anhaltend), die fast bei je­ dem eine tiefe Verzweiflung hervor­ rufen würden“ (S.169). Hauptkriteri­ um nach dem DSM-IV [31] stellt das Vorhandensein eines traumatischen Ereignisses dar (Kriterium A). Wei­ tere Kardinalsymptome sind wieder­ holte, unausweichliche Erinnerung an das belastende Erlebnis (Flashbacks bzw. Intrusionen) (Kriterium B), sozialer Rückzug und Vermeidung (Kriterium C) sowie ein Zustand ve­ getativer Übererregung (Kriterium D). Laut DSM-IV besteht in den USA eine durchschnittliche Lebenszeitprä­ valenz von 8% bei der erwachsenen Allgemeinbevölkerung. Bei Mobbing als Ursache für PTBS ergibt sich oft das Problem der Nicht­ erfüllung des Kriteriums A. Anderer­ seits wird Mobbing von verschiede­ nen Autoren als kumulatives Trauma angesehen, das sehr wohl im Ausmaß seiner Stresssymptomatik schwerwie­ genden Traumata entsprechen kann, wie z.B. dem Überfahren von Perso­ nen durch Zugführer, Vergewaltigun­ gen, Kriegseinsätze [17, 21, 23]. Wie häufig Mobbing auftritt, ist schwer zu sagen. Laut Zapf [40] schwankt die Prävalenzrate zwischen 113 0,3% und 26,6%, was auf Selektions­ effekte und unterschiedliche Mög­ lichkeiten der Messung von Mobbing zurückgeführt werden kann [38]. Prinzipiell empfiehlt Zapf daher, sich an Studien mit großen Stichproben zu orientieren. So nennt er die Untersu­ chungen von Einarsen und Skogstad [7] und Leymann [18], in denen Prä­ valenzraten zwischen 1,2% und 3,5% angegeben werden. In zwei rezenten Studien finden sich jedoch deutlich höhere Prävalenzraten: Niedermann et al. [27] untersuchten 7.694 franzö­ sische Arbeiter, von denen immerhin 10,95% der Männer und 12,78% der Frauen von Mobbing betroffen wa­ ren. In einer von Pranjic et al. [28] in Bosnien – Herzegovina durchge­ führten Untersuchung waren 26% der befragten Ärzte direkt von Mobbing betroffen. Weitaus weniger Studien geben dar­ über Auskunft, wie häufig sich PTBS als Folge von Mobbing entwickelt. Leymann und Gustafsson [17] haben 64 Mobbing Opfer untersucht, von denen 59 eine PTBS-Symptomatolo­ gie entwickelten. Einarsen [6] unter­ suchte in einer norwegischen Stich­ probe 102 Mobbing-Betroffene, von denen 75% PTBS-Stresssymptome aufwiesen. Matthiesen und Einarsen [21] berichteten, dass 63% der un­ tersuchten Mobbing-Betroffenen an PTBS-Kernsymptomen wie intrusi­ ve Rekollektionen und Vermeidung litten. Ursachen für Mobbing können in der Organisation bzw. dem System, der Person des Täters und der Person des Opfers gesehen werden [40]. Was die Persönlichkeit des Täters betrifft, stellt Stucke [35] fest, dass Täter mehrheitlich durch stark ausgepräg­ ten Narzissmus und geringe Selbst­ konzeptklarheit charakterisiert sind. Als Faktoren, die in der Person des Mobbing-Betroffenen liegen, werden ebenfalls Persönlichkeitseigenschaf­ ten und Stressbewältigungsstrategien diskutiert [26, 30, 33, 37]. So zeigen Rammsayer und Schmiga [29], dass Mobbing-Betroffene höhere Werte in den beiden Big Five-Persönlichkeits­ Kreiner, Sulyok, Rothenhäusler dimensionen „Neurotizismus“ und „Offenheit für Erfahrung“ aufweisen. Generell verwenden Mobbing-Be­ troffene häufiger negative Stressver­ arbeitungsweisen, zeigen ein erhöhtes soziales Unterstützungsbedürfnis und kapseln sich eher von anderen ab. In der Zusammenschau gibt es in der Literatur keine uns bekannten An­ haltspunkte dafür, ob solche Persön­ lichkeitsdimensionen und Stressver­ arbeitungsstile innerhalb der Gruppe von Mobbing-Betroffenen auch die Entstehung von PTBS erklären könn­ ten. Außerdem wurde in den bisheri­ gen Untersuchungen auf eine PTBSDiagnosestellung nach den derzeit gültigen Klassifikationssystemen DSM-IV und ICD-10 verzichtet. Ziel unserer Studie ist es, sich syste­ matisch auf Unterschiede innerhalb der Mobbing-Betroffenen zu konzen­ trieren. Wie häufig tritt eine PTBS nach dem DSM-IV eigentlich auf? Warum entwickelt sich bei einigen Mobbing-Betroffenen eine PTBS, bei anderen indes nicht? Münker-Kramer [24] listet zehn Risikofaktoren für die Entstehung einer PTBS auf. Hiernach sind beispielsweise Personen, die an einer ständigen Übererregung leiden und bereits vor dem Durchleben der belastenden Situation eine Tendenz zu depressiven Syndromen aufwei­ sen, eher gefährdet, eine PTBS zu entwickeln. Wenn nun spezifische Stressbewältigungsstrategien und da­ mit verbundene Persönlichkeitsmerk­ male Risikofaktoren für die Beein­ trächtigung durch Mobbing darstel­ len können, stellt sich uns die Frage, ob diese Faktoren auch bei MobbingBetroffenen die Entwicklung einer PTBS fördern können. Methode Prozedere Das SKID Interview wurde von ei­ nem speziell geschulten Psycholo­ giestudierenden im letzten Abschnitt (C.S.) durchgeführt, der von einer klinischen Psychologin (B.K.) und 114 einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (H.B.R.) supervidiert wurde. Dabei wur­ de Mobbing als Trauma-A-Kriterium festgelegt. Gleichzeitig wurde eine Reihe von Selbstbeurteilungsfrage­ bögen den an unserer Studie teilneh­ menden Mobbing-Betroffen vorge­ legt. Stichprobe Es handelt sich um eine explorative Studie mit einer konsekutiven Stich­ probe in der jene Mobbing-Betroffe­ ne berücksichtigt wurden, die inner­ halb eines Zeitraums von 12 Monaten in die Mobbing-Sprechstunde unserer Ambulanz an der Grazer Universi­ tätsklinik für Psychiatrie bzw. in die Sprechstunde der Arbeiterkammer Graz gekommen sind. Als zusätzli­ ches Kriterium wurde ermittelt, wel­ chen aktiven und passiven Mobbing­ handlungen die Personen ausgesetzt waren. Es sei betont, dass in unsere Studie nur Mobbing-Betroffene ein­ geschlossen wurden, bei denen min­ destens fünf von den von Leymann [18] beschriebenen Mobbinghand­ lungen zu eruieren waren. Unsere Mobbing-Sprechstunde wurde von einer interdisziplinären Arbeitsgrup­ pe (Psychologen, Psychiater, Allge­ meinmediziner, Betriebsrat, Personal­ direktion) zum Thema Konfliktlösun­ gen am Universitätsklinikum - LKH Graz begründet. Die Sprechstunde ist allgemein zugänglich, an der Ambu­ lanz der Grazer Universitätsklinik für Psychiatrie angesiedelt und eine erste Beratung erfolgt generell durch die dort tätige Psychologin. Insgesamt wurden 20 Mobbing-Betroffene ein­ geschlossen, wobei es sich um zwei Männer und 18 Frauen im Alter von 23 bis 58 Jahren (MD = 44.5; SD =9.24) handelte. 45% der Personen waren ledig, 25% verheiratet und 20% geschieden. Bezüglich der Aus­ bildung ist festzuhalten, dass 13 Stu­ dienteilnehmer einen Pflichtschulab­ schluss und sieben Matura aufwie­ sen. Drei Personen hatten einen aka­ demischen Titel, sieben absolvierten eine berufsbildende Schule, 6 einen Lehrabschluss und eine Person eine Meisterprüfung. Die überwiegende Mehrheit (19 Personen) war vollzeit­ beschäftigt, nur eine Teilnehmerin arbeitete als Teilzeitkraft. 75 % der untersuchten Personen waren Ange­ stellte, 10% Arbeiter und je 5% waren selbständig, Studierende oder Beam­ te. Tabelle 1 gibt eine Zusammenfas­ sung der soziodemographischen Da­ ten. Mittels Chi-Quadrat Tests wurde nachgewiesen, dass sich die beiden Gruppen (Mobbing-Betroffene mit und ohne PTBS) in den genannten so­ zioökonomischen Daten nicht unter­ schieden. Das gilt auch für das Alter, wonach zum Zeitpunkt der Untersu­ chung Personen mit PTBS im Mittel 47 Jahre und Personen ohne PTBS 41 Jahre alt waren (t(18) = -1.48, p = .16). Mobbing-Betroffene mit PTBS litten durchschnittlich 37 Monate (SD = 29.20), jene ohne PTBS durchschnitt­ lich 26 Monate (SD=25.86) unter den Mobbing-Handlungen (t(18) = -1.14, ­ p = .27). Erhebungsmethoden SKID – Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV von Wittchen, Zaudig und Fydrich [39] Das SKID Interview dient der Erfas­ sung und Diagnostik ausgewählter psychiatrischer Störungen. In unse­ rer Untersuchung haben wir jenen Abschnitt des Interviews verwendet, der sich mit Posttraumatischen Be­ lastungsstörung (PTBS) beschäftigt. Zusätzlich haben wir das PTBS Sup­ plement mit der Liste von PTBS aus­ lösenden Situationen vorgegeben. Impact of Event Scale (IES) von Horowitz [11] Die Impact of Event Scale (IES) misst individuelle Belastungsreaktionen im Kontext von belastenden Lebenser­ eignissen [9]. Sie wird in der Ver­ laufdiagnostik von PTBS eingesetzt und erhebt mit den beiden Skalen In­ trusion (Aufdrängen von belastenden Gedanken) und Vermeidung (von Gefühlen und Erinnerungen, die mit dem belastenden Ereignis assoziiert sind) zwei charakteristische syndro­ Führt Mobbing zur posttraumatischen Belastungsstörung? Implikationen von Stressverarbeitung und Persönlichkeit Stichprobenvariablen Geschlecht Familienstand Wohnsituation Schulausbildung Berufbildender Abschluss Beschäftigungsmodus Berufsstatus Einkommen Gruppenvergleiche Chi2 p 0.02 .88 1.41 3.13 .61 .08 .82 .09 .01 .24 .08 .44 .78 .37 .76 .94 Prozentuale Häufigkeit in den Gruppen Mobbing Betroffene ohne PTBS Mobbing-Betroffene mit PTBS Frauen 88.9 90.0 Männer 11.1 9.1 Ledig/Single Verheiratet/feste Partnerschaft Geschieden/getrennt 66.7 27.3 11.1 54.5 22.2 18.2 Allein 66.7 18.2 Bei den Eltern 11.1 9.1 Mit Kindern und Partner 11.1 18.2 Mit Kindern 11.1 54.5 Pflichtschulabschluss 55.6 72.2 Matura/Abitur 44.6 27.3 Kein Abschluss 11.1 0 Lehrer 22.2 36.4 Berufbildende Schule 33.3 36.4 Meisterprüfung 11.1 9.1 Universität 22.2 18.2 Vollzeit 100 90.9 Teilzeit 0 9.1 Selbständig 11.1 0 Arbeiter(in) 11.1 9.1 Angestellte(r) 55.6 90.9 Beamte(r) 11.1 0 Studierende(r) 11.1 0 Gehalt 88.9 90.9 Elterliche Unterstützung 11.1 0 0 9.1 Aktiv 22.2 9.1 Passiv 77.8 90.9 Rente/Pension Mobbinghandlung .64 .43 Tabelle 1: Gruppenvergleiche und prozentuale Häufigkeit verschiedener soziodemographischer Daten der Mobbing Betroffenen ohne PTBS (n=9) und mit PTBS (n=11) Anmerkung: Die Chi2 Tests prüfen die Gleichverteilung der soziodemographischen Variablen in den beiden Gruppen MobbingBetroffene mit und ohne PTBS 115 Kreiner, Sulyok, Rothenhäusler male Cluster der PTBS. Die beiden Subskalen werden zu einem Gesa­ mtsummenwert addiert. Laut Corneil [4] unterteilt die IES folgende PTBSSchweregrade: 0-8 Punkte subkli­ nische, 9-25 Punkte leichte, 26-43 Punkte mittelschwere und ab 44 Punkte schwere PTBS-Ausprägung. SF-36 Fragebogen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Bullinger und Kirchberger [3] Der SF-36 ist ein krankheitsübergrei­ fendes Instrument zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqual­ ität. Diese wird auf acht Dimensionen erfasst: Körperliche Funktionsfähig­ keit, körperliche Rollenfunktion, kör­per­liche Schmerzen, allgemeine Ge­sundheitswahrnehmung, Vitalität, soziale Funktionsfähigkeit, emotion­ ale Rollenfunktion und psychisches Wohlbefinden. Die einzelnen Ska­ lenrohwerte werden gewichtet und schließlich transformiert, wodurch man für jede Skala eine Prozentang­ abe erhält (100 bedeutet hervorra­ gende Lebensqualität). Die interne Konsistenz der Subskalen liegt zwischen α = .57 und α = .94. Beck-Depressions-Inventar (BDI) von Hautzinger, Bailer, Worall und Keller [10] Das BDI erhebt mittels Selbst­ beurteilung den Schweregrad ein­ er depressiven Symptomatik, in dem depressive Beschwerden, wie z.B. traurige Stimmung, Pessimis­ mus, Versagen, Unzufriedenheit, Schuldgefühle, Reizbarkeit, sozialer Rückzug, Schlafstörungen, abge­ fragt werden. Die Reliabilität des Inventars ist gegeben. So liegt die interne Konsistenz in Abhängigkeit von der Stichprobe zwischen α = .73 und α =.95. Die konvergente Valid­ ität mittels Korrelation mit anderen Selbstbeurteilungsskalen depressiver Symptomatik beträgt r = .76. 116 FPI-R, Freiburger Persönlichkeitsinventar von Fahrenberg, Hampel und Selg [8] Der FPI-R ist ein Selbstbesch­ reibungsinventar, das die Persönli­ chkeit aufgrund von faktorenana­ lystisch bestimmten Dimensionen erhebt: Lebenszufriedenheit, soziale Orientierung, Leistungsorientierung, Gehemmtheit, Erregbarkeit, Aggres­ sivität, Beanspruchung, körperliche Beschwerden, Gesundheitssorgen und Offenheit. Zusätzlich gibt es die zwei Sekundärskalen Extraversion und Emotionalität. Die interne Kon­ sistenz der Skalen liegt zwischen α = .73 und α = .83. Die empirische Validität ist durch die Korrelation mit Selbst- und Fremdeinstufungen belegt. SVF-120 Stressverarbeitungsfragebogen von Janke, Erdmann und Kallus [12] Der SVF-120 erfasst die Reaktionen in belastenden Situationen und die unterschiedlichen kognitiven und ver­haltensbasierten Stressverarbei­ tungsstrategien. Auf einer fünfstu­ figen Ratingskala von „gar nicht“ bis „sehr wahrscheinlich“ schätzen die Probanden 120 Aussagen ein, die 20 Subskalen zugeordnet sind: Bagatellisierung, Herunterspielen, Schuldabwehr, Ablenkung, Ersatzbe­ friedigung, Selbstbestätigung, Situ­ ationskontrolle, Reaktionskontrolle, positive Selbstinstruktion, soziales Unterstützungsbedürfnis, Vermei­ dung, Flucht, soziale Abkapselung, gedankliche Weiterbeschäftigung, Re­si­gnation, Selbstbemitleidung, Selbst­beschuldigung, Aggression, Phar­makaeinnahme und Entspan­ nung. Wir haben die Standardform (SVF 120) verwendet, da sie im Vergleich zur Kurzversion zusät­ zlich sieben Subskalen enthält (z.B. die klinisch relevante Strategie der Pharmakaeinnahme). Weiters unter­ scheiden Sekundärskalen zwischen positiven (stressreduzierenden) und negativen (stressvermehrenden) Ve­ rarbeitungsstrategien. Die positiven Strategien setzen sich aus drei Be­ reichen zusammen: kognitive Be­ wältigungsstrategien (Positiv 1), Ablenkung von der Belastung bzw. Hinwendung zu stressinkompatiblen Situationen (Positiv 2) und Maßnah­ men zur Kontrolle des Stressors (Pos­ itiv 3). Das Verfahren ist theoretisch gut abgesichert, weil die internen Konsistenzen (Cronbach`s Alpha) der Subtests zwischen α = .66 und α = .92 und die Re-testreliabilität nach etwa vier Wochen zwischen α = .69 und α = .86 liegen. Statistische Auswertung Alle folgenden Berechnungen wur­ den mit dem Computerprogramm SPSS Version 14.0 durchgeführt. Um mögliche soziodemographische Einflüsse auszuschließen, verglichen wir die beiden Gruppen (MobbingBetroffene mit PTBS versus Mob­ bing-Betroffene ohne PTBS) mittels Chi-Quadrat Verfahren. Die Auswertung der Hauptfragestel­ lung, wie häufig bei Mobbing-Betrof­ fenen auch PTBS auftritt, erfolgte rein deskriptiv. Generell wurden für die statistischen Berechnungen die Rohwerte der Skalen herang­ ezogen, da der Fokus auf den Un­ terschieden der beiden Gruppen lag. Außerdem spiegeln Rohwerte im Allgemeinen exakt gefundene Werte wider. Schließlich werden durch Nor­ mierung bedingte Streuungsverschie­ bungen vermieden. Aufgrund inhaltlicher Überlegungen, die Heterogenität der in den Frag­ estellungen berücksichtigten Kon­ strukte betreffend, wurden vier mul­ tivariate Varianzanalysen berechnet. Zuvor wurde die Normalverteilung und Varianzhomogenität mittels Kol­ mogorov-Smirnov bzw. Levine-Test überprüft. Eine solche konservative multivariate Verrechnung bietet auch den Vorteil der integrierten AlphaAdjustierung. Da unsere Studie einen ausschließlich explorativen Charak­ ter aufwies und als Teststatistik die Pillai-Spur verwendet wurde, die sich als robust gegen Voraussetzungsver­ letzungen erweist [36] und bei klei­ neren Stichproben nach Bortz [2] Führt Mobbing zur posttraumatischen Belastungsstörung? Implikationen von Stressverarbeitung und Persönlichkeit Ergebnisse eher zu konservativen Entscheidun­ gen führt, wurden auch bei lediglich einer tendenziellen Signifikanz der konservativen multivariaten Tests der MANOVA, die Tests der Zwischen­ subjektfaktoren (univariate Gruppen­ vergleiche) in der Interpretation be­ rück­sichtigt. Zunächst wurde eine multivariate Var­ ianzanalyse (MANOVA) bezüglich der posttraumatischen Stresssymp­ tomatik berechnet. In einer weiteren MANOVA wurde der Bereich der Lebensqualität erfasst. Ebenfalls auf­ grund der heterogenen Konstrukte wurde jeweils eine MANOVA das Copingverhalten und eine MANOVA die Persönlichkeitseigenschaften be­ treffend berechnet. Zur MANOVA bezüglich des Copingverhaltens ist zu sagen, dass der SVF 120 Skalen auf unterschiedlichen Abstraktion­ sniveaus erfasst. Um eine Verzerrung der Ergebnisse aufgrund dieser un­ terschiedlichen Abstraktionsniveaus auszuschließen, wurde die MANOVA ausschließlich mit den Sekundärska­ len (integrative positive und negative Stressverarbeitungsskalen) berech­ net. Aufgrund des explorativen Char­ akters der gesamten Untersuchung, wurden auch die weiteren Subskalen in einzelnen Gruppenvergleichen un­ tersucht. Führte Mobbing zur Entwicklung einer PTBS? Für die Diagnostik einer PTBS wa­ ren in unserer Untersuchung die Kri­ terien des DSM-IV [31] zu erfüllen, die mittels SKID Interview ermittelt wurden. Es zeigte sich, dass 11 (55%) unserer 20 interviewten Mobbing-Be­ troffenen unter einer nach DSM-IV zu klassifizierenden PTBS litten. Zusätzlich wurde die IES Skala [11] verwendet, die Auskunft über das Vorhanden-Sein einer Stresssympto­ matik gibt, die auf eine PTBS hin­ weist. Um den Zusammenhang der beiden Maße zu bestimmen, wurden Pearson Korrelationen zwischen der Anzahl der genannten Symptome im SKID Interview und den einzelnen Skalen der IES berechnet. Es zeigten sich Korrelationen in der Höhe von r = .39 (p = .09) mit der Gesamtskala, r = .25 (p = .29) mit der Vermeidungs­ skala und r = .50 (p = .03) mit der Intrusionsskala. Der IES zur Folge wiesen nur zwei Personen unserer Stichprobe keine klinisch relevante Ausprägung einer Stresssymptoma­ tik auf, je vier Personen eine leichte oder mittlere Ausprägung und zehn Personen eine schwere Ausprägung. Hiernach waren 70% unserer unter­ suchten Mobbing-Betroffenen von posttraumatischen Stresssyndromen nach der IES betroffen. Ohne PTBS 117 Worin unterschieden sich die Mob­ bing-Betroffenen, die eine PTBS entwickelten von jenen MobbingBetroffenen, die keine PTBS zeigten? War die Dauer der Mobbing-Situation ein Belastungsfaktor? Die beiden Gruppen der MobbingBetroffenen mit und ohne PTBS un­ terschieden sich weder im Hinblick auf die Dauer der Mobbing-Handlun­ gen (t18 = -1.14 , p = .27) noch auf den Zeitraum der zuletzt erfolgten Mob­ bing-Handlung (t18 = .91, p = .38). Stellte die Stresssymptomatik einen Belastungsfaktor dar? In einem Vergleich mittels MANO­ VA zeigten Mobbing-Betroffene mit PTBS im Vergleich zu jenen ohne PTBS zum einen höhere Werte im IES-Gesamtscore, zum anderen in der IES-Subskala Intrusion. Bezüglich der IES-Subskala Vermeidung war nur eine statistische Tendenz nach­ zuweisen. Mobbing-Betroffene mit PTBS wiesen im Mittel einen Wert von 50.18 (SD = 18.61) auf, Mob­ bing-Betroffene ohne PTBS erziel­ ten einen mittleren Gesamtwert von 30,67 (SD=16.98). Tabelle 2 fasst die ISE-Resultate zusammen. Mit PTBS M SD M SD F P Gesamtwert (ISE) 30.67 16.98 50.18 18.61 5.89 .03* Intrusion (ISE) 16.67 6.96 26.64 10.01 6.37 .02* Vermeidung (ISE) 14.00 10.63 23.55 11.06 3.82 .07 Tabelle 2: Mittelwerte, Standardabweichungen und Signifikanzen (Test der univariaten Zwischensubjekteffekte) in den ISE-Skalen (Summenscores) Anmerkung: Der multivariate Test der MANOVA ist tendenziell signifikant (F(2,17) = 3.08, p = .07). Kreiner, Sulyok, Rothenhäusler Gab es Unterschiede in der Depressionssymptomatik? Es zeigte sich, dass Mobbing-Betrof­ fene mit PTBS nur tendenziell höhe­ re BDI-Depressionswerte hatten als jene ohne PTBS (t = -1.81, p = .09). Mobbing-Betroffene mit PTBS wie­ sen im Mittel einen BDI-Wert von 18,73 (SD = 8,67) auf, Mobbing-Be­ troffene ohne PTBS hingegen einen durchschnittlichen BDI-Wert von 11,78 (SD = 8,43). 118 War die Lebensqualität bei den Mobbing-Betroffenen mit PTBS stärker beeinträchtigt? In dem multivariaten Test der MA­ NOVA fanden sich bei den MobbingBetroffenen mit PTBS im Vergleich zu jenen ohne PTBS signifikant stär­ kere Einbußen in der gesundheitsbe­ zogenen Lebensqualität (F(8,11) = 3.65, p = .03). Dieser Unterschied galt vor allem für die SF-36 Domäne der kör­ perlichen Schmerzen. In Tabelle 3 sind die Mittelwerte (M), Standard­ Ohne PTBS abweichungen (SD) und Signifikan­ zen der SF-36 Skalen dargestellt. Stellt die Stressverarbeitung Risikobzw. Gesundheitsfaktoren bei der Entwicklung eines PTBS dar? In der globalen Betrachtung der Se­ kundärskalen der positiven und ne­ gativen Stressverarbeitungsstrategien des SVF 120 mittels MANOVA zeig­ te sich kein Unterschied in den bei­ den Gruppen der Mobbing-Betroffe­ nen mit und ohne PTBS. Betrachteten Mit PTBS M SD M SD F P Körperliche Funktionsfähigkeit 81.11 27.93 75.45 29.53 .19 .67 Körperliche Rollenfunktion 36.11 43.50 43.18 43.43 .13 .72 Körperliche Schmerzen 62.22 25.63 30.82 17.97 10.36 <01** Allgemeine Gesundheit 58.78 22.47 55.45 23.73 .10 .75 Vitalität 42.78 23.86 28.64 21.69 1.92 .18 Soziale Funktionsfähigkeit 52.78 25.60 36.36 24.01 2.18 .16 Emotionale Rollenfunktion 44.44 47.14 21.14 26.91 1.93 .18 Psychisches Wohlbefinden 49.33 22.72 34.18 22.44 1.23 .15 Tabelle 3: Mittelwerte und Standardabweichungen und Signifikanzen (Test der univariaten Zwischensubjekteffekte) in den SF-36-Skalen Anmerkung: Der multivariate Test der MANOVA ist signifikant (F(8,11) = 3.65, p = .03) Ohne PTBS Mit PTBS M SD M SD F P Negative Strategien 11.33 6.64 15.00 3.24 2.20 .14 Positive Strategien 13.38 2.96 14.06 2.98 .25 .62 Positiv 1 12.56 2.46 11.53 3.96 .45 .51 Positiv 2 12.47 3.96 12.20 4.05 .02 .88 Positiv 3 21.04 17.87 18.83 2.64 2.20 .25 Tabelle 4a: Mittelwerte, Standardabweichungen und Signifikanzen (Test der univariaten Zwischensubjekteffekte) in den SVF Skalen (Summenscores) Anmerkung: Der multivariate Test der MANOVA ist nicht signifikant (F(5,13) =2.08, p=.13) Führt Mobbing zur posttraumatischen Belastungsstörung? Implikationen von Stressverarbeitung und Persönlichkeit Ohne PTBS 119 Mit PTBS M SD M SD t-Wert P Bagatellisierung 13.67 3.71 10.00 5.29 1.73 .10 Herunterspielen 10.89 4.26 9.60 5.08 .60 .56 Schuldabwehr 13.11 4.17 15.00 5.83 -.80 .43 Ablenken von Situationen 13.78 3.99 12.90 5.47 .40 .70 Ersatzbefriedigung 11.56 6.88 12.20 5.49 -.23 .82 Selbstbestätigung 14.44 5.61 13.60 6.02 .32 .76 Entspannung 10.11 8.05 10.10 3.63 .00 .99 Situationskontrolle 15.78 5.38 20.30 3.13 -.2.27 .04* Reaktionskontrolle 15.44 3.00 18.60 3.03 -2.28 .04* Positive Selbstinstruktion 15.22 5.91 17.60 5.33 -.92 .37 Soziales Unterstützungsbedürfnis 14.78 4.66 15.70 7.07 -.33 .74 Vermeidung 13.44 6.21 19.00 2.98 -.244 .03* Flucht 11.33 7.58 14.70 6.71 -.103 .32 Abkapselung 7.11 5.23 12.60 5.25 -2.28 .04* Gedankliche Weiterbeschäftigung 14.89 7.30 22.30 2.31 -3.05 .01** Resignation 10.89 7.69 11.40 3.57 -.19 .86 Selbstbemitleidung 11.78 8.55 13.70 4.30 -.63 .54 Selbstbeschuldigung 12.00 7.07 11.90 3.96 .04 .97 Aggression 8.78 4.15 9.30 6.25 -.21 .84 Pharmakaeinnahme 5.22 4.82 8.00 7.29 -.97 .35 Tabelle 4b: Mittelwerte, Standardabweichungen und Signifikanzen in den SVF Skalen (Summensores) Anmerkung: Für die Einzelgruppenvergleiche wurden t-Tests berechnet wir speziell die einzelnen Subskalen, so gab es mittels t-Tests signifikante Unterschiede in den Subskalen Situa­ tionskontrolle, Reaktionskontrolle, Ver­meidung und gedankliche Weiter­ beschäftigung (Tabelle 4a und Tabelle 4b). Gab es auch Unterschiede zwischen Mobbing-Betroffenen mit und ohne PTBS in ihrer Persönlichkeit? Mittels MANOVA konnte im mul­ tivariaten Test kein Hinweis darauf gefunden werden, dass die FPI-RPersönlichkeitsfaktoren einen Schutz­ faktor gegen eine PTBS Erkrankung unserer Mobbing-Betroffenen dar­ stellte. Denn unsere beiden Gruppen unterschieden sich generell nicht. In den Zwischensubjektvergleichen konnten Tendenzen in den Subskalen „soziale Orientierung“ und „körper­ liche Schmerzen“ gefunden werden (Tabelle 5). Kreiner, Sulyok, Rothenhäusler 120 FPI-Skalen Ohne PTBS Mit PTBS M SD M SD F p Lebenszufriedenheit 5.44 3.13 6.27 2.69 .41 .53 Soziale Orientierung 6.78 2.82 9.64 1.75 7.74 .01* Leistungsorientierung 6.11 2.37 7.10 2.95 .65 .43 Gehemmtheit 5.67 2.92 4.82 1.94 .60 .45 Erregbarkeit 4.22 2.28 6.00 3.44 1.77 .20 Aggressivität 3.11 2.62 4.36 3.23 .88 .36 Beanspruchung 5.22 3.35 7.09 2.91 1.78 .20 Körperliche Beschwerden 4.11 3.41 6.91 2.11 4.92 .04* Gesundheitssorgen 4.67 2.74 5.00 2.00 .10 .76 Offenheit 5.22 2.68 4.91 3.24 .05 .82 Extraversion 5.00 1.94 7.00 3.74 2.10 .17 Emotionalität 6.11 3.16 8.00 3.16 1.80 .20 Tabelle 5: Mittelwerte, Standardabweichungen und Signifikanzen (Test der univariaten Zwischensubjekteffekte) in den FPI-Skalen (Summenscores) Anmerkung: Der multivariate Test der MANOVA ist nicht signifikant F(12,7)=1.70, p=.25 Diskussion Für das zeitgerechte Erkennen und Behandeln von PTBS als Folge von Mobbing ist es von klinischer Rel­ evanz, Angaben über die Prävalen­ zraten aufzustellen. In dieser Studie konnte zwar nur eine geringe Stich­ probe an Mobbing-Betroffenen be­ rücksichtigt werden, aber gerade in Ermangelung an Untersuchungen mit Hilfe von strukturierten klinischen Interviews zur Diagnosestellung von PTBS bei Mobbing-Betroffenen stel­ len unsere Studienergebnisse einen gewichtigen Beitrag dar. Dass 55% unserer interviewten Mobbing-Be­ troffenen zum Zeitpunkt der Evalua­ tion an einer PTBS litten, stützt die studienbasierte Evidenz, dass Mob­ bing zu PTBS führen kann. Betra­ chtet man die Entwicklung einer post­ traumatischen Stresssymptomatik mit­tels IES, so wiesen 70% unserer Mobbing-Betroffenen eine klinisch relevante Symptomatik auf. Dieser Befund steht auch im Einklang mit der bisherigen Literatur [6, 21], in der Häufigkeitsraten zwischen 63% und 75% berichtet werden. Was die Lebensqualität betrifft, ist es auffällig, dass unsere Mobbing-Be­ troffenen mit PTBS deutlich stärker unter körperlichen Schmerzen litten als jene ohne eine PTBS. Im Vergleich zu der von Bullinger und Kirchberger [3] publizierten Normstichprobe von nicht chronisch Erkrankten schnitten unsere untersuchten Mobbing-Betrof­ fenen mit und ohne PTBS deutlich ungünstiger ab und zeigten insgesamt eingeschränkte Lebensqualitätsken­ nziffern in allen acht gesundheitsb­ ezogenen Bereichen. Unsere unter­ suchten Mobbing-Betroffenen hatten folglich einen Gesundheitszustand zu beklagen, der körperliche Aktivitäten und die Arbeit stark einschränkte. Ebenfalls war die Widerstandskraft gegenüber anderen Erkrankungen geschwächt und die persönliche Gesundheit wurde als angegriffen beurteilt. Sie fühlten sich verstärkt müde, erschöpft und energielos. Was waren nun aber Faktoren bei un­ seren Mobbing-Betroffenen, die das Auftreten einer PTBS begünstigten beziehungsweise verhinderten? Die Literatur geht davon aus, dass die Persönlichkeit und Stressverarbei­ tungsstrategien für die Entstehung einer Mobbing-Situation relevant sind [16, 30, 40, 41]. Stressverarbei­ tungsstrategien, wie sie im SVF 120 erfasst werden, sind als individuelle Tendenzen zu verstehen, bestimmte Stressverarbeitungsweisen situation­ sunabhängig einzusetzen. Ramsayer et al. [29] zeigten, dass sich Mob­ Führt Mobbing zur posttraumatischen Belastungsstörung? Implikationen von Stressverarbeitung und Persönlichkeit bing-Betroffene von Nicht-Betrof­ fenen nicht generell in der Verwend­ ung von positiven Stressstrategien unterschieden, dass sie aber sehr wohl vermehrt in der Lage waren, Stress­ belastungen zu bagatellisieren und zu relativieren. Im Vergleich dazu ver­ wandten unsere Mobbing-Betroffen mit PTBS zur Reduktion von Stress vor allem Kontrollstrategien. Das be­ deutet, sie versuchen, vermehrt Kon­ trolle über die belastende Situation zu gewinnen. Deshalb analysierten sie die Mobbingsituation genau, planten mögliche Maßnahmen zur Verbesse­ rung der Mobbingsituation und ver­ suchten auch aktiv in das Geschehen einzugreifen. Im Allgemeinen wird diese Form der Stressbewältigung als besonders konstruktiv angesehen [12] und sollte demnach vor der En­ twicklung eines PTBS schützen. Un­ sere Mobbing-Betroffenen mit PTBS betrieben einen hohen Aufwand, um die belastende Situation zu kontrol­ lieren. Wenn sie dabei aber scheit­ erten, dann bedeutete das wiederum einen Zuwachs von negativen Ge­ fühlen wie Hilflosigkeit oder Ver­ sagen, was zur Senkung des Selbst­ wertes führte und damit indirekt das Auftreten einer PTBS förderte. Ein solches erfolgloses Einsetzen von Stressbewältigungsstrategien kommt unter Mobbing-Betroffenen generell häufig vor. Knorz und Zapf [15] bzw. Zapf und Gross [41] berichteten, dass nur 12% bzw. überhaupt nur 6% ihrer untersuchten Mobbing-Betroffenen „erfolgreiche Stressbewältiger“ waren, also daran glaubten, dass sich die Arbeitssituation aufgrund ihrer Bemühungen verbessert hatte. Die erhöhte Kontrolle betrifft im Allgemeinen aber auch die eigene Reaktion auf die belastende Situ­ ation. So versuchten unsere Mob­ bing-Betroffenen mit PTBS negative Emotionen wie innere Erregung erst gar nicht entstehen oder sich diese nicht anmerken zu lassen und kämpf­ ten gegen bereits bestehende Erre­ gung an. Wenn sich jemand ohnehin schon zusammenreißt und versucht nicht die Fassung zu verlieren, der Konflikt jedoch nicht gelöst werden kann, dann ist man höherer Frustra­ tion ausgesetzt. Es wäre interes­ sant zu untersuchen, ob generell die Frustrationstoleranz bei den Perso­ nen mit aktueller PTBS niedriger liegt. Schmiga und Rammsayer [33] fanden bereits erhöhte Reaktionskon­ trollwerte bei Mobbing-Betroffenen im Vergleich zu Nicht-Betroffenen und argumentierten übereinstimmend mit Schickerath und Kneip [32], dass ein habituelles Unterdrücken von of­ fenen Aggressionen im engen Zusam­ menhang mit dem Auftreten von psy­ chosomatischen Beschwerden stehe. Auch in unserer Untersuchung kon­ nten wir eine deutlich eingeschränkte Lebensqualität der Mobbing-Betrof­ fenen bezüglich ihrer körperlichen Beschwerden feststellen. Der Be­ reich der Reaktionskontrolle spielt also nicht nur bei der Entstehung von Mobbing, sondern auch bei der Entwicklung einer PTBS eine Rolle. Reaktionskontrolle sollte folglich in der psychologischen und psychother­ apeutischen Behandlungssituation eine besondere Bedeutung beigemes­ sen werden. Schmiga und Rammsayer [33] berichteten weiters, dass MobbingBetroffene im Vergleich zu Nicht - Betroffenen vermehrt negative Stressverarbeitungsweisen einsetz­ ten. Wir konnten nicht beobachten, dass jene Mobbing-Betroffenen mit PTBS generell häufiger stressver­ mehrende Strategien benützten als jene ohne PTBS. Auffällig ist allerd­ ings, dass sich Mobbing-Betroffene mit PTBS insgesamt stärker mit der Mobbingsituation gedanklich weiter­ beschäftigten. Sie konnten sich weni­ ger gut von der erlebten Belastung distanzieren, die negativen Gedanken und Vorstellungen drängten sich im­ mer wieder auf und somit wurden die belastende Situation und die damit einhergehende Erregung in einer kognitiven Perspektive prolongiert. Vor diesem Hintergrund sollen spe­ zifische kognitive Kapazitäten der Betroffenen beansprucht werden, und es wird fast unmöglich, positivere 121 Strategien wie Entspannung oder das Herunterspielen der Gegebenheiten oder der eigenen Reaktion einzu­ setzen [12]. Außerdem tendierten un­ sere Mobbing-Betroffenen mit PTBS verstärkt dazu, die belastende Mob­ bingsituation zu vermeiden und sich zurückzuziehen. Sie gingen Kontak­ ten mit Mitmenschen verstärkt aus dem Weg und zogen es vor, alleine zu sein. Sozialer Rückzug stellt dem­ nach einen wesentlichen Faktor dar, der das Auftreten und die Entwick­ lung einer PTBS begünstigen kann und könnte hiernach vorteilhaft in die Therapie Mobbing-Betroffener integriert werden. Der Einfluss von Persönlichkeitsfak­ toren in der Entstehung einer Mob­ bing-Situation wurde von Leymann (1996) abgelehnt. Geht man davon aus, dass sich bei 12 untersuchten FPI-R-Persönlichkeitsdimensio­ nen nur zwei als unterschiedlich er­ wiesen, könnte man vermuten, dass die persönlichen Eigenschaften nur einen geringen Einfluss auf die Ent­ wicklung einer PTBS haben sollten. Beachtenswert war allerdings, dass unsere Mobbing-Betroffenen mit PTBS häufiger soziale Verantwor­ tung übernahmen und ihre Hilfsbere­ itschaft oder Sorgen gegenüber ihren Mitmenschen ausdrückten. Eine zu hohe soziale Orientierung ist demnach ein Risikofaktor für die Entwicklung einer PTBS. In der Literatur [16] wird häufig von psychosomatischen Be­ schwerden bei Mobbing-Betroffenen berichtet. Innerhalb der unserer Mob­ bing-Betroffenen manifestierte sich auch, dass jene mit PTBS von einem gestörten Allgemeinbefinden berich­ teten. Sie gaben an, unter Schlaf­ störungen, Kopfschmerzen, Verstop­ fungen, Magenverstimmungen oder zittrigen Händen zu leiden. Gerade auch die nicht signifikanten Ergebnisse unserer Studie sind von Interesse. Denn es gibt in der Lit­ eratur [30, 37, 40] Hinweise dafür, dass die Persönlichkeitsdimension Neurotizimus ein Charakteristikum von Mobbing-Betroffenen darstellt. Neurotizismus steht für emotionale Kreiner, Sulyok, Rothenhäusler Labilität und einer Tendenz zur emo­ tionalen Überempfindlichkeit, dahi­ ngehend, dass es im limbischen Sys­ tem eine geringe Erregungsschwelle gibt und bereits Reize von geringer Intensität Reaktionen hervorrufen. Hohe Neurotizismuswerte gehen mit Ängsten, unangenehmen Gefüh­ len und Sorgen einher und häufiger treten somatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit oder Verdauungsstörungen auf [1]. In der FPI-R-Skala Emotionalität werden die wesentlichen Komponenten der Persönlichkeitsdimension Neuro­ tizimus abgebildet [8]. Wir konnten analog zu Rammsayer und Schmiga [29] nachweisen, dass hohe Neuro­ tizismuswerte mit negativen Stress­ verarbeitungsstrategien bei unseren Mobbing-Betroffenen unabhängig vom Vorliegen einer PTBS assoziiert waren (r = .74). Wir sind daher der Ansicht, dass Neurotizismus keinen Risikofaktor für die Entstehung von PTBS bei Mobbing-Betroffenen darstellt. Ausblick und Limits Auch wenn unsere Studie auf einer geringen Stichprobenzahl beruht, so gibt es doch wichtige Ansätze für die weitere Forschung und Behandlung von Mobbing-Betroffenen. Das Mob­ bing als kumulatives Traumata [23] beschrieben werden kann, spiegelt sich auch in den hohen ISE-Gesa­ mtscores in unserer Untersuchung. Dennoch bleibt, gerade angesichts der aktuellen Ansätze zur genaueren Strukturierung der komplexen Diag­ nosegruppe der Anpassungsstörun­ gen durch beispielsweise die Arbe­ itsgruppen von Maerker in Zürich und Linden in Berlin, in Zukunft eine Untersuchung zum Zusam­ menhang zwischen Mobbing und Stress-Response-Konzept bei der Anpassungsstörung [22], der post­ traumatischen Verbitterungsstörung [20] und der Arbeitsplatzphobie [19] durchzuführen. 122 Im Verständnis von Mobbing als dy­ namischen Prozess zwischen Täter und Betroffenen [25] sollte in der Behandlungssituation tatsächlich beim Mobbing-Betroffenen selbst angesetzt werden und nicht nur bei der Mobbing-Situation. Insbesondere müssen Strategien erarbeitet werden, die gegen die soziale Abkapselung und gedankliche Weiterbeschäftigung mit der Mobbingsituation ankämpfen. Außerdem sollte genau hinterfragt werden, ob die eventuell vermehrt eingesetzten Kontrollstrategien auch erfolgreich sind oder womöglich die Symptomatik verstärken. In der psy­ chologischen Behandlung der Mob­ bing-Betroffenen an unserer Klinik haben sich Techniken zur Stress- und Problemanalyse (z.B. nach Kaluza [23]) und die Erarbeitung von sub­ jektiv als erfolgreich und erfolglos erlebten Copingstrategien bewährt. Wesentlich sind eine Erarbeitung von irrationalen Gedankenmustern und eine Bewusstseinsförderung der eigenen, persönlichen Anteile an der Entstehung und Aufrechterhaltung einer Mobbing-Situation. Hilfreich sind die Förderung von Selbstverbali­ sationsfähigkeiten mit Hilfe von Rol­ lenspielen und auch Elementen des Weisheitstrainings [34]. Ebenfalls sollten Ansätze aus verschiedenen Selbstsicherheitstrainings integriert werden. Diese Therapieansätze sind allerdings immer auf das einzelne Individuum abzustimmen und kön­ nen beispielsweise keine Mediation­ sarbeiten mit allen beteiligten Konf­ liktparteien ersetzen. Auf jeden Fall sollten in der Routineversorgung von Mobbing-Betroffenen gezielt psychiatrische Komplikationen in Gestalt von posttraumatischen Belas­ tungsstörungen berücksichtigt wer­ den. Interessenskonflikt: Es besteht kein Interessenskonflikt Literatur [1] Amelang, M. & Bartussek, D.: Differen­ tielle Psychologie und Persönlichkeits­ forschung (5.Auflage). Kohlhammer, Stuttgart 2001. [2] Bortz, J.: Statistik für Sozialwissenschaf­ ter (5. vollst. überarb. Auflage). Sprin­ ger, Berlin 1999. [3] Bullinger, M. & Kirchberger, I.: Der SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszu­ stand. Hogrefe, Göttingen 1995. [4] Corneil, W., Beaton, R., Murphy, S., Johnson, C. & Pike, K.: Exposure to tramatic incidents and prevalence of posttraumatic stress symptomatology in urban firefighters in two countries. Jour­ nal of Occupational Health Psychology. 4 (2), 131-141 (1999). [5] Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M.H. (Hrsd).: Internationale Klassifika­ tionen psychischer Störungen. Klinsichdiagnostische Leitlinien. Hans Huber, Bern 2000. [6] Einarsen, S.: The nature and couses of bullying at work. International Journal of Manpower, 20, 16-27 (1999). [7] Einarsen, S. & Skogstad, A.: Prevalence and risk groups of bullying and harrass­ ment at work. European Journal of work and organizational psychology, 5, 185202 (1996). [8] Fahrenberg, J., Hampel, R. & Selg, H.: Das Freiburger Persönlichkeitsinventar FPI – Revidierte Fassung FPI-R und teilweise geänderte Fassung FPI-A1, Handweisung (6. Auflage). Hogrefe, Göttingen 1994. [9] Ferring, D. & Filipp, S.H.: Teststatis­ tische Überprüfung der Impact of Event Skala: Befunde zu Reliabilität und Sta­ bilität. Diagnostica, 40, 344-362 (1994). [10] Hautzinger M, Bailer M, Worall W, Kel­ ler F.: BDI Beck-Depressions-Inventar 2., überarbeitete Auflage. Hogrefe, Göt­ tingen 1995. [11] Horowitz, M.J, Wilner, N.R. & Alvarez, W.: Impact of Event Scale: a measure of subjective stress. Psychosomatic Medi­ cine, 41, 209-218 (1979). [12] Janke, W., Erdmann, G., Kallus, W.& Boucsein W.: Stressverarbeitungsfrage­ bogen (SVF 120) – Kurzbeschreibung und grundlegende Kennwerte. Hogrefe, Göttingen 1997. [13] Kaluza, G.: Stressbewältigung. Train­ ingsmanual zur psychologischen Ge­ sundheitsförderung. Springer, Heidel­ berg 2005. [14] Kivimäki, M., Virtanen, M., Vartia, M., Elovainio, M., Vahtera, J & KeltikangasJärvinen, L.: Workplace bullying and the risk of cardiovascular disease and depression. Occup. Environ. Med. 60, 779-783 (2007). [15] Knorz, C. & Zapf, D.: Mobbing: Eine extreme Form sozialer Stressoren am Führt Mobbing zur posttraumatischen Belastungsstörung? Implikationen von Stressverarbeitung und Persönlichkeit [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] Arbeitsplatz. Zeitschrift für Arbeitsund Organisationspsychologie, 1, 12-22 (1996). Kolodej, C.. Mobbing - Psychoterror am Arbeitsplatz und seine Bewältigung. Facultas, Wien 2005. Leymann, H. & Gustafsson, A.: Mobbing at Work and the DEvelopment of Posttraumatic Stress Disorders. European Journal of work and organizational psy­ chology, 5, (2), 251-275 (1996). Leymann, H.: Mobbing: Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1993. Linden, M. & Muschalla, B.: Arbeit­ splatzbezogene Ängste und Arbeitsplatz­ phobie. Nervenarzt, 78, 39-44 (2007). Linden, M., Rotter, M., Baumann, K. & Lieberei, B.: Posttraumatic Embitter­ ment Disorder. Definition, Evidence, Di­ agnosis, Treatment. Hogrefe, Göttingen 2007. Matthiesen, S.B. & Einarsen, S.: Psychi­ atric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work. Brit­ ish Journal of Guidance & Counselling, 32, (3), 335-356 (2004). Maercker, A., Einsle, F. & Köllner, V.: Adjustment disorders as stress response syndromes: A new diagnostic concept and its exploration in a medical sample. Psychopathology, 40, 135-146 (2007). Mikkelsen, E., G. & Einarsen, S.: Basic assumptions and symptoms of post-trau­ matic stress among victims of bullying at work. European Journal of work and organizational psychology, 11, (1), 87111 (2002). Münker-Kramer, E.: Akute Belas­ tungsreaktion. Posttraumatische Be­ lastungsstörung. In W. Beiglböck, S. Feselmayer & E. Honemann (Hrsg.), Handbuch der klinisch-psychologischen Behandlung (2.Auflage) (S.293-322). Springer, Wien 2006. Neuberger, O.: Mobbing. Übel mitspielen in Organisationen (2.Auflage). Hampp, München 1995. [26] Niedl, K.: Mobbing/Bullying am Ar­ beitsplatz. Eine empirische Analyse zum Phänomen sowie zu personalwirt­ schaftlich relevanten Effekten von sys­ tematischen Feindseligkeiten. Hampp, .München 1995. [27] Niedhammer, I., David, S. & Degioanni, S.: Association between workplace bul­ lying and depressive symptoms in the french working population. Journal of psychosomatic and research, 61, 251259 (2006). [28] Pranjic, N., Males-Bilic, L., Beganlic, A. & Mustajbegovic, J.: Mobbing, Stress, and work ability index among phsysi­ cians in Bosnia and Herzegovina: Sur­ vey Study. Croat Med J., 47, 750-758 (2006). [29] Rammsayer, T. & Schmiga, K.: Mob­ bing und Persönlichkeit: Unterschiede in grundliegenden Persönlichkeitsdimen­ sionen zwischen Mobbing-Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Wirtschaftspsy­ chologie, 2, 3-11 (2003). [30] Rammsayer, T., Stahl, J. & Schmiga, K.: Grundlegende Persönlichkeitsmerk­ male und individuelle Stressverarbei­ tungsstrategien als Determinanten der Mobbing-Bettroffenheit. Zeitschrift für Personalpsychologie, 5, (2), 41-52 (2006). [31] Saß, H., Wittchen, H.U. & Zaudig, G.: Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM-IV-TR). Textrevision. Hogrefe, Göttingen 2003. [32] Schickerath, J. & Kneip, V.: Mobbing am Arbeitsplatz: Interaktionelle Problembe­ reiche, psychosomatische Reaktionsbil­ dungen und Behandlungsansätze. Wirt­ schaftspsychologie, 4, 45-60 (2002). [33] Schmiga., K. & Rammayser, T.: Mob­ bing und Persönlichkeit: Unterschiede in habituellen Stressverarbeitungswei­ sen zwischen Mobbing-Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Wirtschaftspsycho­ logie, 1, 84-92 (2004). [34] Schippan, B., Baumann, K. & Linden,M.: Weisheitstherapie – kognitive Therapie der posttraumatischen Verbitterungsstö­ [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] 123 rung. Verhaltenstherapie, 14, 284-293 (2004). Stucke, T.S.: Persönlichkeitskorrelate von Mobbing – Narzissmus und Selbst­ konzeptklarheit als Persönlichkeitskor­ relate bei Mobbingtätern. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 46, (4), 216-221 (2002). Tabachnick, B.B. & Fidell, L.S.: Using multivariate statistics. Allyn and Bacon, Boston 2001. Vartia, M.: The source of bullying – psy­ cholgical work environment and organi­ zational climate. European Journal of work and organizational psychology, 5, 203-214 (1996). Willingstorfer, B., Schaper, N. & Son­ ntag, K.: Mobbingmaße und – faktoren sowie bestehende Zusammenhänge mit sozialen Arbeitsplatzbedingungen. Zeitschrift für Arbeits- und Organi­ sationspsychologie, 46, (3), 111-125 (2002). Wittchen, H.U., Zaudig, M. & Fydrich,T.: Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV Achse I und II – Handanwei­ sung. Hogrefe, Göttingen 1997. Zapf, D.: Mobbing in Organisationen – Überblick zum Stand der Forschung. Zeitschrift für Arbeits- und Organisa­ tionspsychologie, 43, 1-25 (1999). Zapf, D. & Gross, C.: Conflict escalation and coping with workplace bullying: A replication and extention. European Journal of work and organizational psy­ chology, 10, (4), 497-522 (2001). Univ. Doz. Dr. Hans-Bernd Rothenhäusler Universitätsklinik für Psychiatrie der Medizinischen Universität Graz [email protected] Fallbericht Case report Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 2/2008, S. 124–126 Der Weichselzopf (Plica polonica) – eine aktuelle Kasuistik zu einem historischen Krankheitskonzept Florian Wolf, Martin Scherr, Dirk Scherthöffer, Josef Bäuml und Hans Förstl Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum des Saarlandes Schlüsselwörter: Plica polonica – Weichselzopf – Trichom – Wahnerkrankung – Paraphrenie Key words: considered as cause, consequence and treatment of mental disease. The historical development of “plica polonica” is briefly reviewed as an example of early and once popular psychiatric disease concepts. plica polonica – dreadlocks – trichoma – delusional disorder – late paraphrenia Einleitung Der Weichselzopf (Plica polonica) – eine aktuelle Kasuistik zu einem historischen Krankheitskonzept Wir berichten über eine 62-jährige Patientin mit einer chronischen Wahnerkrankung, die wegen drohender Selbstgefährdung auf einer geschützten psychiatrischen Station untergebracht wurde. Die Patientin zeigte bei Aufnahme eine auffallende Verfilzung der Haare, die in der medizinischen Literatur des 19. Jahrhunderts als Hexen- oder Weichselzopf (plica neuropathica oder polonica) bezeichnet und als Ursache, Ausdruck und gleichzeitig Heilverfahren psychischer Störungen angesehen wurde. Trichoma (Plica polonica) – a contemporary case with a historical disease We describe a 62-year-old patient with a chronic delusional disorder who presented with severely matted hair (“plica polonica”). Until the late 19th century such dreadlocks were © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Psychische Störungen werden heute nach standardisierten Kriterien diagnostiziert, die durch eine Anpassung an neue Erkenntnisse einem ständigen Wandel unterworfen sind. Dennoch erscheinen manche frühe Beschreibungen psychischer Störungen auch nach Jahrhunderten so charakteristisch, dass sie eine Diagnose nach modernen Kriterien nahe legen [3]. Bei anderen historischen Berichten wurden die ätiologischen und therapeutischen Konzepte so in den Vordergrund gerückt, dass die dahinter stehenden Störungen aus heutiger Sicht schwer verständlich bleiben. Dies liegt zum einen an der unklaren Symptomschilderung, zum anderen daran, dass manche der historischen Leitsymptome heute kaum mehr beobachtet werden. Wir berichten über eine Patientin, deren auffallende Erscheinung einem Krankheitskonzept aus der Renaissance entspricht, das bis ins 19. Jahrhundert für eine große Zahl vielfältiger psychischer Störungen verantwortlich gemacht wurde. Kasuistik Anamnese und Befund Eine 62-jährige Patientin wurde von ihren Kindern in die psychiatrische Klinik gebracht. Sie berichteten, ihre Mutter habe seit etwa 10 Jahren das Haus nicht mehr verlassen und sich bevorzugt im Keller aufgehalten, da sie befürchtete, abgehört, beobachtet und verfolgt zu werden. Sie habe auch nur noch bestimmte, besonders „reine“ Nahrungsmittel zu sich genommen. Die äußerlich verwahrloste Patientin betonte im Aufnahmegespräch wiederholt, dass sie ihren Aufenthalt in der Klinik ablehne, da ihr sozialer Rückzug schließlich ihre eigene Entscheidung sei. Entsprechend gab sie sich zunächst misstrauisch, ablehnend und dysphorisch. Von Anfang an machte sie eine Reihe paranoid wirkender Andeutungen (sie sei Opfer eine Rufmordes etc.), die allerdings vage und verrätselt blieben. Die Patientin war zunächst nur wenig mitteilsam, wobei aber die sporadischen Äusserungen sprachlich sehr differenziert wirkten. Von den Angehörigen war zu erfahren, dass die Haare der Patientin vor Jahren - zeitgleich mit ihrem Rückzug und dem Auftreten ihrer wahnhaften Symptome – stark zu verfilzen begannen. Die schlanke Patientin war insgesamt etwas ungepflegt, wobei das stark verfilzte Kopfhaar als dominierendes Merkmal hervorstach. Ansonsten war die körperliche Untersuchung unauffällig, ebenso wie die Ergebnisse der Laboruntersuchungen und einer kranialen Kernspintomographie. Neuropsychiatrische Symptome bei Sotos-Syndrom. Kasuistik und Literaturübersicht Wir diagnostizierten eine chronisch wahnhafte Störung (ICD-10: F22.0). Wegen des späten Krankheitsbeginns, der spärlichen Andeutungen über Wahrnehmungen und Gedanken sowie der allenfalls geringen intellektuellen Beeinträchtigung nach langem Krankheitsverlauf, wurden die Kriterien einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie (ICD-10: F20.0) nicht hinreichend erfüllt; wir stellten die Diagnose einer späten Paraphrenie. Therapie und Verlauf Zu Beginn des stationären Aufenthaltes hatte die Patientin alle diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen verweigert. Sie zog sich zurück und führte Selbstgespräche. Nach intramuskulärer Gabe von 8 mg Fluspirilen wöchentlich wurde sie deutlich zugänglicher und nahm an Therapieprogrammen teil. Schließlich ließ sich die Patientin auf eigenen Wunsch die verfilzten Haare entfernen. Dabei wurden weder Parasiten, noch Auffälligkeiten der Kopfhaut entdeckt. Anschließend erwähnte die Patientin, dass sie bei Aufnahme dachte, ihre Haarverfilzung sei für Strahlen undurchdringlich und daher wichtig für ihren Schutz. Diskussion Die extreme und irreversible Verfilzung der Kopf-, aber auch der Achsel- und Schamhaare ging unter verschiedenen Bezeichnungen in die medizinische Literatur ein: „Weichselzopf“ durch das angeblich endemische Auftreten in Polen während des späten Mittelalters und der Renaissance (Plica polonica sive neuropathica) [4;10], „Hexenzopf“ [5], „Trichoma“, „Elflock“, „Dreadlock“ (englisch), oder„kotun“ (polnisch) (Abbildung 1). Während Dreadlocks als Modeerscheinung akzeptiert Abbildung 1: Weichselzopf (mit Ge­ nehmigung des Medizinhistorisches Museums der Charité, HumboldtUniversität, Berlin; unsere Patientin gab keine Zustimmung zur Veröffent­ lichung ihres Portraits). werden, ­ finden sich Hinweise auf extreme Haarverfilzungen im pathologischen Kontext nur noch selten. Dabei werden dermatologisch meist Eigenheiten der Haarbeschaffenheit, mechanische Manipulationen, Haarpflegemittel und nur selten psychische Faktoren diskutiert [6]. Seit der Erstbeschreibung durch Johannes Schenck von Grafenberg (1584) war die Plica polonica ein fester medizinisch-wissenschaftlicher Topos, der Anlass zu gelehrten Debatten bot [9]. Einige sahen im Weichselzopf eine eigenständige Krankheit mit vielfältiger Symptomatik, manche sogar ein mystisches Zeichen. So wurden in frühen Erklärungsversuchen u.a. Hexen und Kobolde für die Entstehung des „Hexenzopfes“ verantwortlich gemacht [7]. Andere diskutierten klimatische Verhältnisse, das Tragen von Pelzmützen, diätetische Faktoren oder auch die feuchten Ausdünstungen des Lehmbodens in Polen [2]. Nach Butzke [2] war die Weichselzopfkrankheit durch einen stadienhaften Verlauf gekennzeichnet mit Prodromalsymptomen wie Kopfschmerz, Licht- Geräusch- und Be- 125 rührungsempfindlichkeit, Übelkeit, Tinnitus, Ophthalmopathien, Knochen- und Gelenkschmerzen, sowie Obstipation, Diarrhoe und Schlafstörungen und schliesslich den durch Joseph Frank definierten klassischen Symptomen „pavor, taedium, melancholia, mania“ [nach 2]. Die klinische Bandbreite reichte von affektiven Störungen bis zu Symptomen, die den Verdacht auf somatoforme, hysterische, epileptische oder meningo-enzephalitische Erkrankungen nahe legen. Es wurde befürchtet, dass ein Entfernen des Filzzopfs zu Komplikationen in anderen Organsystemen, oder einer Verschärfung der neuropsychiatrischen Symptomatik führen könne. Die Plica polonica selbst galt als Ausdruck eines physiologischen Heilungsprozesses und so wurde mitunter der Zopf nach Abklingen der Symptome belassen [4; 10]. Als Volksmittel wurde aber gelegentlich das „Umbinden eines abgezogenen Igels um den Kopf“ empfohlen. Ärzte unternahmen bis ins 19. Jahrhundert Therapieversuche mit Aderlässen, abführenden Mitteln und unterschiedlichsten Phytotherapeutika [2]. Da man auch eine Verbindung zwischen Plica polonica und Syphilis vermutete, wurde die Plica mit quecksilberhaltigen Elixieren und Dämpfen behandelt [2;10]. Die neuropsychiatrischen Symptome einer vermeintlichen Plica und einer echten Vergiftung mit volatilem Quecksilber sind schwer zu trennen (Stimmungslabilität, Angst, Erregung, Muskelzucken, Seh-, Hör-, Sprach- und Gangstörungen, Merkschwäche, Persönlichkeitsveränderung und Poly­ neuropathie) [8]. Nur selten war in der medizinischen Literatur der nahe liegende Zusammenhang mit mangelnder Hygiene herausgearbeitet worden. Beschorner unternahm 1843 [1] erstmals in einer umfangreichen epidemiologischen Studie den Versuch, systematisch nachzuweisen, dass das Phänomen vorrangig durch schlechte Körper­ pflege und Armut bedingt war, Kessler, Kraft während die gleichzeitig beobachteten psychischen Störungen in keinem direkten Zusammenhang standen. Fazit für die Praxis Bei unserer Patientin ließ sich eine zeitliche Parallele zwischen Beginn und Ausprägung von Wahnideen und selbst gewählter Depravation einerseits und der Plica andererseits nachweisen. Auch hatte sie der Verfilzung eine schützende Funktion zugesprochen, wobei diese Interpretation von uns therapeutisch nicht aufgegriffen wurde. Die Entfernung des Filzzopfs fiel zeitlich mit einer nachhaltigen klinischen Besserung zusammen. Diese augenscheinliche Koinzidenz erscheint geeignet, professionelles Verständnis für ein lächerlich anmutendes Krankheitskonzept von erstaunlicher Langlebigkeit zu wecken, das die Medizin von der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert beschäftigte. 126 Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Beschorner F (1843) Der Weichselzopf. Nach statistischen und physiologischen Beziehungen dargestellt. F. Hirt, Breslau Butzke EL (1859) Denkschrift über den Weichselzopf. T. Grieben, Berlin Förstl H, Angermeyer M, Howard R (1991) Karl Philipp Moritz’ Journal of Empirical Psychology (1783 – 1793): an analysis of 124 case reports. Psychol Med 21:299-304 Förstl H, Elliger H (1995) Dreadlocks and Mental Disease. An old argument and an early epidemiological study (1843). Br J Psychiatry 166:701-702 Grimm J (1854) Teutonic Mythology Vol. II. Dover Publications, Mineola New York, S 474 Kwinter J., Weinstein M. (2006) Plica neuropathica: novel presentation of a rare disease. Clin Exp Dermatol 31:790792 Lessing MB (1839) Ist der Weichselzopf eine ursprünglich deutsche Krankheit? In: Casper JL (Hrsg.) Wochenschrift für die gesamte Heilkunde. A. Hirschwald, Berlin 40:641-656 Risher JF, Amler SN (2005) Mercury Ex­ posure: Evaluation and Intervention The Inappropriate Use of Chelating Agents in the Diagnosis and Treatment of Puta­ tive Mercury Poisoning. Neurotoxicology 26:691–699 [9] Schenck von Grafenberg J (1584) Ob­ servationum medicarum rarior. Lib. VII. Lib. I de capite, observatio XIII de tricis incuborum. Frobeniana, Basel [10] Wunderlich, CA (1853) Handbuch der Pathologie und Therapie. 2.Band, 2.Auflage, Ebner und Seubert, Stuttgart, 262-263 Interessenkonflikt Die Autoren verwenden und verord­nen unter anderem Produkte von Johnson & Johnson. Dabei besteht keine finanzielle oder anderweitige Abhängigkeit. Hans Förstl Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie TU München [email protected] Kritisches Essay Critical Essay Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 2/2008, S. 127–131 Empowerment als Ziel sozialpsychiatrischer Bemühungen Hartmann Hinterhuber1, Ullrich Meise1 und Eva-Maria Hinterhuber2 1 2 Universitätsklinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck Maecenata Inst. für Philanthropie und Zivilgesellschaft, Humbolt-Universität, Berlin Schlüsselwörter: Psychiatrie – Empowerment – Betroffenenbewegung Keywords: Psychiatry – empowerment – consumer movement Empowerment als Ziel sozialpsy­ chia­trischer Bemühungen Bei Empowerment handelt es sich um ein neues Konzept, das über die Befreiungstheologie und die feministische Ideologie Eingang in die verschiedensten Disziplinen gefunden hat, wobei das Spektrum von der Psychiatrie und Psychologie über die Philosophie bis hin zur Politologie reicht. Das Empowerment-Konzept beansprucht sowohl ein mehrdimensionales als auch ein Mehr-EbenenKonzept zu sein: Empowerment kann verschiedene Formen annehmen, seine Relevanz reicht vom Individuum über Organisationen bis hin zu größeren Systemen. In der Psychiatrie ist Empowerment eine erfolgreiche Strategie der Selbstbefähigung, sie muß jedoch, da nicht jeder Betroffene zu jedem Zeitpunkt dazu in der Lage ist, die Grenzen und die Begrenztheit ihrer Methoden respektieren. © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Empowerment as a goal of social psychiatric endeavour Empowerment is a new concept that has found its way via recognition in liberation theology and feminist movement, in to varied disciplines ranging from psychiatry and psy­ chology through philosophy to poli­ tical science. Empowerment claims to be both a multi-dimensional and multi-level concept. It can take different forms and its relevance reaches from the individual over organisations to larger systems. In psychiatry empowerment is a success­ful self enabling strategy. The boundaries and limitations of its methods must, however, be respected as not every affected person is in a position at all times of using it. I. In seiner fundierten Stellungnahme zu den "Trends und Entwicklungen in der Psychiatrie", schrieb Norman Sartorius noch im Jahr 2002: "Die meisten der psychisch Schwerkranken haben keine Stimme und zählen nicht: Ihre Familien haben oft weder das Wissen, noch die Fähigkeit, um ihr Wohl mit jener Kraft und Energie zu kämpfen, mit der zum Beispiel Eltern körperlich kranker Kinder es tun, wenn sie Interessensverbände gründen oder sich auf andere Weise für Gesundheitsprogramme einsetzen. Die Patienten sind - auch heute noch - oft nicht willens - sogar, wenn ihr Gesundheitszustand es ihnen erlauben würde, für ihre Rechte zu kämpfen. Um zu kämpfen, müssten sie sich selbst als Patienten deklarieren: Die sozialen Nachteile, die Diskriminierungen, die für gewöhnlich auf die Einstufung einer Person als psychisch krank folgen, sind so stark, dass nur wenige Patienten andere von ihrer Krankheit wissen lassen wollen." Empfanden es noch in der Ver­gan­ gen­heit Psychiater notwendig, ihre Stimme den ihnen anvertrauten Pa­ tienten zu geben und für diese zu sprechen, ergreifen diese – dank der Empowerment-Bewegung – für sich selbst das Wort, sie re­kla­mieren ihre Mitbestimmung in der Pla­ nung psychosozialer Ein­rich­tun­ gen und kämpfen erfolg­reich um ihre Einbindung in Ent­schei­ dungsprozesse. Darüber hinaus for­ dern und entwickeln sie Alter­nativen im therapeutischen, sozialen und rehabilitativen Prozess. Betroffene sind somit heute in vielen Bereichen anzutreffen, die vor wenigen Jahren noch ausschließliche Domäne der professionellen Helfer waren: Sie leiten Selbsthilfegruppen, sind Inte­ ressensvertreter, Case Ma­na­­ger und engagieren sich in Arbeits­projekten. Die Zukunft wird zu den großen Errungenschaften der Medizin und besonders der Psychiatrie des 20. Jahr­­hunderts die Entwicklung der Psychopharmakotherapie zählen. Psychopharmaka haben das Bild der Psychiatrie und die Not des einzelnen Kranken grundlegend verändert, sie leiten den Heilungsprozess ein und unterstützen die notwendigen Schritte aus der psychischen Einengung in Hinterhuber, Meise, Hinterhuber jene freie, reife und ausgewogene Persönlichkeit, die der Betroffene – befreit von Angst, Depression, Halluzination und Wahn – sein kann. Dazu benötigt er jedoch die Kompetenz und die Möglichkeit, seine Umwelt so zu verändern, dass sich in ihr ein gesundes Leben verwirklichen lässt. Die Empowerment-Bewegung setzt gerade hier an, sie macht sich stark mit größtem Nachdruck jene Mängel zu beheben, auf die Norman Sartorius hingewiesen hat. In der modernen Psychiatrie sind anstelle der Zwangsmaßnahmen pa­ tientenorientierte Be­handlungs­pro­ gramme getreten, der Kranke ist eine Persönlichkeit mit allen menschlichen Rechten. Die Umsetzung einer pa­ tien­tengerechten Psychiatrie, und insbesondere die Verwirklichung der sich heute darbietenden Möglichkeiten der Selbstbefähigung und Selbst­ ermächtigung, stellen eine der größten ethischen Herausforderungen für unsere Gesellschaft dar. Ziel ist die Partizipationschancen der von psychischer Erkrankung Betroffener zu erhöhen: Empowerment hat den Paternalismus in der Psychiatrie abgelöst. Empowerment kann mit "Selbst­ befähigung" oder "Selbst­be­mäch­ tigung" übersetzt werden, auch mit "Selbstbefähigung", "Zu­wachs an Gestaltungsmacht", "Selbstkom­­pe­ tenz" oder "Mitwir­kungs­mög­lich­ keit". Empowerment bedeutet somit die Summe aller Bemühungen der betroffenen Menschen, sich die verloren gegangenen Fertigkeiten und Fähigkeiten wieder anzueignen und Macht und Einfluss bezüglich der Lebensgestaltung zu gewinnen. Empowerment hat somit immer auch die "Stärkung der Eigenmacht" der Betroffenen zum Ziel. Dieser Prozess ist von den professionellen Hilfsstrukturen zu unterstützen - diese können ihn jedoch nicht von sich aus "verordnen". 128 In seiner Entstehungsgeschichte geht der Begriff "Empowerment" zu­rück auf die amerikanische Black-Power-Bewegung, auf die Be­ freiungstheologie in Lateinamerika (im besonderen auf Paolo Freires "Pädagogik der Unterdrückten" und auf die Bemühungen von Leonardo Boff), auf die verschiedenen feministischen Strömungen, sowie auf die Arbeiterund Gewerkschaftsbewegung im angelsächsischen Raum. II. Das Konzept des Empowerments stemmt sich gegen den in vielen Sozialbereichen, auch in der Psy­chiatrie, immer noch weit verbreiteten defizitären Blickwinkel auf eine Patientengruppe, die mit Mängeln behaftet ist und stellt dieser Sichtweise eine Betonung der Potentiale und Ressourcen dieser Menschen gegenüber. Folgedessen zielt Empowerment primär auf die Stärkung der noch vorhandenen Ressourcen und auf eine Ermutigung, diese Möglichkeiten zu fördern, auszubauen und weiterzuentwickeln. Patienten mit Selbstkompetenz be­ mühen sich, Möglichkeiten zur Mitgestaltung ihrer Umwelt zu schaffen und auf der politischen Ebene Einfluss zu nehmen. Der Empowerment-Bewegung geht es auch um die Schaffung demo­ kratischer Strukturen und um den Abbau von Hierarchien in den Institutionen wie Krankenhäuser, Wohn­heimen, Tageskliniken und Be­ rufs­trainingszentren. Die Empo­wer­ ment-Bewegung setzt sich intensiv mit Machtstrukturen auseinander. Ziel ist immer, den Betroffenen mehr Macht zu geben: Macht etwas zu verändern, das eigene Schicksal in die Hand nehmen zu können, in der Gruppe mächtiger zu sein und somit Forderungen stellen zu können, mit dem Ziel, respektiert und akzeptiert zu werden. Alle diese Überlegungen gründen in der Machtlosigkeit, ja Ohnmacht, in die sowohl die Erkrankung selbst als auch – sekundär – die Gesellschaft die Betroffenen ge­ stürzt hat. Viele Patienten erleben Machtlosigkeit auf unterschiedlichen Ebenen: Beim Großteil der schizophren Erkrankten stehen paranoide Erlebnisweisen im Vordergrund, sie fühlen sich fremden Mächten und Gewalten ausgeliefert. Diese Ohnmacht wiederholt sich bei vielen Patienten wiederum beim Eintritt in eine psychiatrische Klinik, sie werden bei der Therapieplanung und bei der Erstellung der Re­ habilitationsprogramme nicht einge­ bunden. Das Ausgeliefertsein wird wiederum als Hilflosigkeit und Ohnmacht erlebt. In der Sichtweise des Empowerments verändern die traditionellen Heilberufe ihr Tätigkeitsfeld: Die professionelle Sozialarbeit beispielsweise sieht sich zunehmend als koordinierende und vermittelnde Unterstützung, immer im engen Zusammenwirken mit den Betroffenen. Der Prozess der Selbstbefähigung muss aber von den professionellen Hilfsstrukturen unterstützt werden diese können ihn nicht von sich aus "verordnen". Empowerment ist somit ein aktiver Prozess, der sowohl von den Betroffenen als auch von den professionellen Helfern getragen werden muss. Empowerment ist aber kein geradliniger Prozess, er ist in der Tat von Umwegen und manchmal Rückschritten gekennzeichnet. III. Grundsätzlich unterscheiden wir 2 Formen von Empowerment: – Empowerment der Betroffenen – Empowerment der Gemeinde Die Stärkung der Betroffenen er­ folgt durch eine Verbesserung des Selbstwertgefühls und eine inten­ si­ve Auseinandersetzung mit den The­menbereichen "Krank­heits­ur­­­ sachen", "Psychopathologie", "Diag­ Empowerment als Ziel sozialpsychiatrischer Bemühungen nostik", "Pharmakotherapie" und "Psychotherapie". Ziele des Empowerments der Ge­ meinde ist das Senken der Schwelle zwischen Psychiatrie und "Außenwelt" sowie eine Kompetenzerhöhung durch Wissensvermittlung an die Bevölkerung. Letzteres inkludiert nicht nur eine breit gefächerte und weit gestreute fachliche Information, sondern auch die Möglichkeit zum (anonymen) Erfahrungsaustausch von Betroffenen. Der Definition von Schwerin (1995: 81) setzt sich Empowerment aus acht Komponenten zusammen. Es sind dies: • Selbstachtung (self-esteem), • Selbsteinschätzung (self-efficacy; die positive Einschätzung der eige­nen Stärken), • Wissen und Fähigkeiten (know­ ledge and skills), • Politisches Bewusstsein (political awareness), • Soziale Teilhabe (social partici­ pation), • Politische Partizipation (political participation), • Politische Rechte und Verpflich­ tungen (political rights and res­ pon­si­bilities), • Ressourcen (resources) . • • • • • IV. Insgesamt werden sechs Hand­ lungsfelder unterschieden – das persönliche, soziale, politische, öko­ nomische, kulturelle und recht­liche Empowerment. • Das persönliche Empowerment ist auf die „Subjektbildung durch Selbstbewusstsein und Ei­gen­­ ständigkeit“ gerichtet; dies meint einen Zuwachs bzw. die Entwicklung von „voice, spa­ ce, choice“ im Sinne der Artiku­ la­tion von Interessen und Pro­blemen, der Ausdehnung von Handlungsräumen in der Öffentlichkeit und im Privaten und einem Zugewinn an Handlungsmöglichkeiten und Ver­ handlungsmacht. Rechtliches Empowerment strebt die Stärkung des Rechtbe­­wusst­ seins an; zu den diesbezüglichen Feldern zählen formale Rechts­ sicherheit und die Nutzung be­ stehender Rechte. Soziales Empowerment zielt auf eine kollektive Stärkung ab (Sichtbarkeit und soziale Präsenz, Partizipation am öffentlichen Le­ben oder Forderung der Respektierung durch andere Mit­ glieder der Gemeinschaft). Politisches Empowerment visiert politische Subjekte an (Politische Alphabetisierung, Partizipation an politischen Gremien, Politische Organisierung und Einfluss auf politische Institutionen). Kulturelles Empowerment zielt auf ein Mehr an Einfluss und Präsenz im kulturellen Bereich ab. Ökonomisches Empowerment schließlich meint „den Prozess der Überlebens­sicherung bis hin zu ökonomischer Unabhängigkeit von Menschen zwischen indi­ vidueller Erwirtschaftung des Lebens­notwendigen und kollek­ tiver Sicherung tragfähiger Lebens­bedingungen (sustainable livelihood)." (Rodenberg und Wichterich 1999) V. Von Betroffenen wird Empowerment durch folgende Eigenschaften defi­ niert (Judy Chamberlain): 1.Sich die Fähigkeit anzueignen, eigene Entscheidungen zu tref­ fen 2.Zugang zu Informationen und Ressourcen zu besitzen 3.Aus verschiedenen Handlungs­ alter­nativen wählen zu können 4.Sich durchzusetzen 5.Die Gewissheit zu haben, als Individuum etwas bewegen zu können 129 6.Lernen, kritisch zu denken und Konditionierungen nicht nur zu durchschauen, son­dern auch abzulegen. Nicht die Fallge­ schichte, sondern die Le­bens­ geschichte ist von Bedeutung: a) Lernen, neu zu definieren, wer wir sind (mit eigener Stimme sprechen). b) Lernen, neu zu definieren, was wir tun können. c) Lernen, unsere Beziehungen zu den Institutionen neu zu definieren. 7. Lernen, Ärger und Wut zu verstehen und adäquat aus­zu­ drücken. 8. Sich als Teil einer Gruppe zu begreifen. 9. Die Überzeugung vertreten, dass jeder Mensch Rechte hat, auch Psychiatriepatienten. 10.Änderungen im eigenen Leben und im Umfeld zu bewirken: Dadurch wird das Wissen gestärkt, über Kompetenz und Kontrolle zu verfügen. 11.Neue, subjektiv wichtige Fähig­ keiten erlernen. 12.Lernen, die Wahrnehmung an­de­rer bezüglich der ei­ge­ nen Kompetenz und Hand­ lungsfähigkeit zu korrigieren. 13.Lernen, "sichtbar" zu sein: "coming out" demonstriert Selbst­bewusstsein. 14.Lernen, dass Eigenmächtigkeit, Wachstum und Veränderung ein fortlaufender Prozess ist. 15.Lernen, sich ein positives Selbstbild zu erarbeiten und Stigmatisierungen zu über­win­ den. VI. Um die Möglichkeiten des Empower­ ments zu nutzen, ist es notwendig, sowohl bei den Betroffenen als auch bei den professionellen Helfern ein neues Rollenverständnis zu erarbeiten. Psychosoziale Einrichtungen sind aufgefordert "Bedingungen und eine Hinterhuber, Meise, Hinterhuber Arbeitshaltung zu entwickeln, die es ermöglichen, soziale Kräfte zu wecken oder sie zu entdecken." (Keupp 1997) Vordringlich sind Wege aufzuzeigen, die es den einzelnen Kranken oder definierten Gruppen ermöglichen, Kontrolle über ihr eigenes Leben und ihr Sozialgefüge zu gewinnen: Dadurch werden sie befähigt, die dafür erforderlichen Ressourcen zu akquirieren und auszubauen. Ulrich Seibert weist mit Recht darauf hin, dass die Bedürfnisse von Psychiatrie-Patienten oft nicht den Möglichkeiten der psychiatrischen Einrichtungen entsprechen. Jede psychiatrische Institution muss sich immer wieder von neuem die Frage stellen, inwieweit ihre thera­ peutischen Konzepte in der Lage sind, ihren Patienten Empowerment zu vermitteln: Psychiatrische Ein­ richtungen müssen in ihren Konzepten die Voraussetzungen schaffen, dass Empowerment gelingt, auf dass die Patienten lernen können, im Rahmen des Möglichen selbstbestimmte Ent­ scheidungen zu treffen, den Hand­ lungsspielraum zu erweitern und das Leben eigenmächtig zu gestalten. Zu Empowerment gehört konsti­ tutionell das Informationsrecht und die Aufklärungspflicht. Aufklärung und Informationsvermittlung haben einerseits der emotionalen Situa­ tion der Betroffenen Rechnung zu tragen und andererseits auch mögliche kognitive Defizite zu berücksichtigen. VII. Bernhard Badura, Professor für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld, stellt eine nicht ermutigende Systemanalyse des heutigen Gesundheitswesens an: Er kritisiert im Rahmen der Krankenbehandlung die biome­­di­­ zi­nische Kopflastigkeit und die Unterbewertung von zwischen­men­ schlichen Leistungen. Immer noch wird vielen Patienten eine aktive 130 Rolle im Rahmen der Behandlung verwehrt. Der Rückgewinnung oder dem Erhalt von sozialer Integration, Erwerbsfähigkeit und Lebensqualität wird oft nicht der entsprechende Stellenwert eingeräumt. Wörtlich hält er fest: "Die Bewältigung einer Krankheit findet zu Hause oder am Arbeitsplatz, nicht aber im Rahmen einer stationären Aufnahme statt". Die von einer menschengerechten Psychiatrie formulierten Ziele von Behandlung und Rehabilitation haben diese zuvor genannten Kritikpunkte bereits berücksichtigt. Die therapeutischen und rehabi­li­ tativen Ziele sind nicht ausschließlich auf die Heilung oder Besserung von Krankheitssymptomen ausge­ richtet. Es kann erst dann von einer erfolgreichen Behandlung ge­sprochen werden, wenn auch nichtmedizinische Aspekte von Gesundheit und Krankheit in die Behandlung einfließen und in der Gesamtbeurteilung berücksichtigt werden, so beispielsweise die För­­derung und der Erhalt von Fer­tigkeiten (die für eine soziale Integration erforderlich sind), die subjektive Lebensqualität, die Behand­ lungszufriedenheit von Patienten oder das Wohlergehen der Angehörigen. Das komplexe therapeutische Ange­bot muss den Bedürfnissen der einzelnen Patienten angepasst werden und in seinem Lebensfeld zur Verfügung stehen. Die Behandlung darf sich nicht an den Bedürfnissen von Institutionen, sondern an den Bedürfnissen und dem Bedarf des einzelnen Kranken orientieren. Konzepte wie "Empowerment" und "Salutogenese" spiegeln somit eine neue Sichtweise wider, die die moderne Psychiatrie aufgegriffen hat. Diese Perspektiven ersetzen die Defizitorientierung im Behand­ lungssetting, sie setzen an den persönlichen und ökologischen Res­ sourcen des Patienten an, indem sie vorhandene Fähigkeiten, Interessen und Stärken fördern und nützen. Die Patienten verlassen im Rahmen der Behandlung ihre passive Rolle, sie treten mit ihrer Umwelt aktiv in Beziehung, setzen sich mit ihrer Erkrankung auseinander und bestimmen und gestalten ihre Behandlung mit. Sie werden zu verantwortlichen Akteuren, deren subjektive Sicht und Meinung wichtig ist. Dieses Konzept setzt jedoch eine partnerschaftliche Kommunikation zwischen Behandlern und Patienten voraus und erfordert die Qualifizierung der Betroffenen in allen Aspekten ihrer Erkrankung. Diese ihre neue Rolle macht es möglich, dass Bedürfnisse besser erkannt und Behandlungs- und Rehabilitationsziele klarer formuliert und vereinbart werden können. Das Potential, das in der Selbsthilfe liegt, wird dadurch gefördert und therapeutisch genützt. Sichtbares Ergebnis und Folge der Empowerment-Bewegung ist der Trialog, die gemeinsame Plattform von Betroffenen, Angehörigen und professionellen Helfern. Der Tria­ log ist ein Diskussionsforum für allfällige Konflikte, er dient dem gegenseitigen Austausch wichtiger Erfahrungen und Informationen und koordiniert oder initiiert ge­ meinsame Projekte. Empowerment ist somit auch gleichbedeutend mit "Gesundheitsförderung". Empowerment als Ziel sozialpsychiatrischer Bemühungen Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Aktion psychisch Kranke: 25 Jahre Psychiatrie-Enquete Band 1 und 2, Psychiatrie-Verlag Bonn 2001 Amering M., Hofer H., Rath I: TrialogEin Erfahrungsbericht nach 2 Jahren „Erster Wiener Trialog“ in: Meise U., Hafner F., Hinterhuber H. (Hrsg) Gemeindepsychiatrie in Österreich, VIP-Verlag Intergrative Psychiatrie Innsbruck, 231- 252, 1998 Andresen B., Stark F., Gross J. (Hrsg.): Mensch-Psychiatrie-Umwelt. Psychiatrie-Verlag Bonn 1992 Antonovsky A.: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. dgvtVerlag Tübingen 1997 Burchard J. M.: Lehrbuch der systematischen Psychopathologie. Band 1 und 2, F. K. Schattauer Verlag Stuttgart 1980 Chamberlain J.: zitiert bei: Knuf A., Seibert U.: Selbstbefähigung fördern Empowerment und psychiatrische Arbeit. Psychiatrie-Verlag Bonn 2000 Erikson E.H.: Einsicht und Verantwortung. Stuttgart, Klett 1966 Friedman M.: Kapitalismus und Freiheit. zitiert bei E. Waibl. Praktische Wirtschaftsethik Studienverlag Inns­ bruck Wien München Bozen 2001 Frühwald S, Bühler B, Grasl R, Gebetsberger M, Matschnig T, Lönig F, Frottier P: (Irr-) Wege in die Arbeitswelt Langzeitergebnisse arbeitsrehabilitativer Einrichtungen für psychisch Kranke der Caritas St. Pölten. Neuropsychiatr 20, 250-256, 2006 Haberfellner E.M., Schöny, Platz T., Meise U.: Evaluationsergebnisse Medizinischer Rehabilitation für Men­ schen mit psychiatrischen Erkrankungen – ein neues Modell im komplexen psychiatrischen Leistungsangebot. Neu­ ro­psychiatr 20, 215-218, 2006 Haller R., R. Prunnlechner-Neumann: Forensische Psychiatrie - Die Rolle des Faches zwischen Medizin, Justiz und Öffentlichkeit. Neuropsychiatr 20, 1-3, 2006 Herriger N.: Empowerment in der sozialen Arbeit, Kohlhammer: 2002. Hinterhuber H.: Das Menschenbild in Medizin und Psychiatrie. In: Bilder des Menschen. H. Hinterhuber, M. P. Heuser, U. Meise (Hrsg.). VIP-Verlag Integrative Psychiatrie Innsbruck 82-91, 2003. Hinterhuber H., Hinterhuber E.M., Katschnig H., Meise U.: Das Menschenbild der Sozialpsychiatrie. In: Bilder des Menschen. H. Hinterhuber, M. P. Heuser, U. Meise (Hrsg.). VIPVerlag Integrative Psychiatrie Innsbruck, 98-108, 2003 [15] Hinterhuber H, Meise U.: Zum Stellenwert der medizinisch-psychiatrischen Rehabi­ litation. Neuropsychiatr 21, 1-4, 2007 [16] Hinterhuber H, Rutz W, Meise U: Psychische Gesundheit und Gesellschaft. „….Politik ist nichts anderes als Medicin im Großen.“ Neuropsychiatr 21,180186, 2007 [17] Katschnig H. (Hrsg.): Die andere Seite der Schizophrenie: Patienten zu Hause. 3. Aufl. Edition Psychiatrie. Psychologie Verlagsunion München 1989 [18] Katschnig H., Donat H., Fleischhacker W., Meise U.: 4 x 8 empfehlungen zur behandlung von schizophrenie. Edition Pro Mente Linz 2002 [19] Kauder V. (Hrsg.): Personenzentrierte Hilfen in der psychiatrischen Versorgung. Psychiatrie-Verlag Bonn 1999. [20] Keupp H.: Ermutigung zum aufrechten Gang. dgvt-Verlag Tübingen 1997. [21] Knuf A., Seibert U.: Selbstbefähigung fördern - Empowerment und psychia­ trische Arbeit. Psychiatrie-Verlag Bonn 2000 [22] Meise U., Fleischhacker WW, Schöny W: "Es ist leichter ein Atom zu zerstören, als ein Vorurteil." Neuropsychiatr 16, 14, 2002 [23] Meise U., Wancata J.: „Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit“Die Europäische Ministerielle WHO-Konferenz für Psychische Gesundheit; Helsinki 2005. Neuropsychiatr 19, 151-154, 2006 [24] Meise U., Sulzenbacher H., Eder B., Klug G., Schöny W., Wancata J.: Psychische Gesundheitsversorgung in Österreich – Eine Beurteilung durch unterschiedliche Gruppen von Psychiatriebetroffenen auf Grundlage der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Neuro­ psychiatr 20, 174-185, 2006 [25] Mohr L.: Ziele und Formen heil­pä­da­ gogischer Arbeit: eine Stu­­die zu "Em­ powerment" als Konzeptbe­griff in der Geistig­be­hinder­tenpädagogik. Luzern: Ed. SZH/CSPS, 2004 [26] Pfeiffer-Gerschel T., Wittmann M., Hegerl U.: Die „European Alliance Against Depression (EAAD)“ – Ein europäisches Netzwerk zur Verbesserung der Versorgung depressiv erkrankter Menschen. Neuropsychiatr 21, 51-58, 2007 [27] Rodenberg, B., Wichterich C.: Macht gewinnen. Eine Studie über Frauen­pro­ jekte der Heinrich-Böll-Stif­tung im Ausland, Berlin, 1999. [28] Rössler W (Hrsg): Psychiatrische Rehabilitation, Springer-Verlag BerlinHeidelberg-New York, 2004 [29] Sartorius N.: Perspektiven einer künftigen Psychiatrie. Hrsg. Theodor Meissel, Gerd Eichberger, Edition Pro Mente 2002 [30] Seyeringer M., Friedrich F., Stompe T., Frottier P., Schrank B., Frühwald S: Die 131 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] „Gretchenfrage“ für die Psychiatrie- Der Stellenwert von Religion und Spiritualität in der Behandlung psychisch Kranker. Neuropsychiatr 21, 239-247, 2007 Schwerin E. „Empowerment: Trans­ forming Power and Powerlessness“, in: ders., Mediation, Citizen ,Empowerment, and Tranformational Politics, Westport et al., 55-93, 1995 Schwerin, E.: „The Future of Empowerment and Transformational Politics“, in: ders., Mediation, Citizen Empowerment, and Tranformational Politics, Westport et al., 161-188, 1995 Schrank B., Amering M.: „Recovery“ in der Psychiatrie. Neuropsychiatr 21, 4550, 2007 Theunissen G., Plaute W.: Handbuch Em­ powerment und Heilpädagogik. Frei­burg im Breisgau: Lambertus Ver­lag 2002 Torrey EF.: Out of the shadows. Confronting America's mental illness crisis. New York, Chicester, Brisbane: John Wiley and Sons 1997. Waibl E.: Der Rechenstift am Kran­ kenbett? Medizin im Spagat zwischen Ethik und Ökonomie. Münchner Qua­litäts­management Forum 21, 1999 Waibl E.: Praktische Wirtschaftsethik. Studienverlag Innsbruck Wien München Bozen 2001 Wikipedia Enzyklopädie: http:// de.wikipedia.org/wiki/Empowerment Windfuhr M.: „Der Einfluß von NGOs auf die Demokratie“, in: W. Merkel, Demokratie in Ost und West, Frankfurt a. M., 520-547, 1999 Univ.-Prof. Dr. Harmann Hinterhuber Universitätsklinik für Psychiatrie Medizinische Universität Innsbruck hartmann.hinterhuber@ i-med.ac.at Kritisches Essay Critical Essay Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 2/2008, S. 132–136 Materie ist auch Geist! Anmerkungen zu Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung D. Yves von Cramon Max-Planck-Institut für Neurologische Forschung Köln I. Was ist das Wesen der Dinge und was ist das Ganze der Welt? Das sind die beiden ontologischen Kernfragen. Hirnforschung ist von jeher mit beiden Fragen eng verbunden. Das Leib-Seele-, das Gehirn-Geist-, das Gehirn-Bewusstseins-Problem, ist ein ontologisches Problem, hat es doch das Wechselspiel physikalischer und mentaler Ereignisse zum Inhalt. Bis heute gibt es für dieses Urproblem der Hirnforschung zwar manches Modell, aber keine umfassende, widerspruchsfreie Konzeption. Dass das Gehirn mentale Ereignisse hervorbringt, scheint offensichtlich, ob aber mentale Ereignisse prinzipiell auch ohne Gehirn stattfinden könnten, darüber besteht schon keine Einigkeit mehr. Für Anhänger des Funktionalismus beispielsweise sind mentale Zustände, also Überzeugungen, Wünsche, Vorlieben, Abneigungen, aber auch Schmerz oder Lust empfinden, ausschließlich durch ihre kausale Beziehung zu sensorischem Input oder Verhaltens-Output oder durch ihre kausale Beziehung zu anderen mentalen Zuständen bestimmt. In einer solchen Sichtweise könnten mentale Zustände auf vielerlei Weise realisiert werden, auch ohne Gehirn. Sind wir, wie Daniel Dennett (1996) meint, aus nichts anderem als aus geistlosen Robotern gemacht? Ist das Phänomen Bewusstsein nur scheinbar geheimnisvoll? Könnte das, was © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 wir für freie Willensakte halten, letztlich ebenso komplex durch entsprechend konfigurierte Maschinen realisiert werden? Tritt irgendwann ein „Monsieur Machine“ in unsere Welt, wie ihn im 18. Jahrhundert schon Julien de la Mettrie (1747) entworfen hatte? Trotz all der eindrucksvollen Befunde und der daraus abgeleiteten Erkenntnisse, mögen sie auf klinischen und experimentellen Hirnläsionen, auf pharmakologischen ZNS-Wirkungen, auf elektro-physiologischen Ableitungen und Stimulationen oder auf Methoden der Bildgebung bei Mensch und Tier beruhen, kann man der Einsicht nicht ausweichen, dass doch niemand noch verstanden hat, wie beispielsweise Erleben und Erlebtes kausal, nicht korrelativ, mit jenen schon so detailliert beschreibbaren elektro-chemischen und protein-chemischen Vorgängen in den dreidimensional im Gehirn ausgespannten glioneuralen Netzen zusammenhängen. Folgt man, wie vom seriösen Naturforscher unserer Zeit wie selbstverständlich erwartet, der ontologischen Intuition, dass Natur und Kerneigenschaften mentaler Zustände auf irgendeine Weise mit physikalischen Ereignissen identisch sind, mag einen schon erstaunen, wie überraschend wenig die unglaubliche Fülle neurowissenschaftlicher Fakten Einfluss genommen hat auf die Details und das bedeutet im Kern auf die Präzisierung der materialistisch orientierten Philosophien des Geistes. Die Gründe dafür dürften vielfältig sein. Aus philosophischer Sicht mag besonders ein Grund für die Schwierigkeit, die „essentia cerebri“ zu begreifen, in noch kaum reflektierten und schon gar nicht aufgelösten konzeptuellen Verhedderungen und Mystifikationen liegen. Hier kommt Philosophie ins Spiel, deren Domäne es ist und bleibt, konzeptuelle Inkohärenzen aufzudecken. Neurowissenschaftler sind gut beraten, sich künftig entschiedener und gründlicher als bisher mit den mannigfaltigen konzeptuellen Inkohärenzen und ihren Auswirkungen auf unsere Experimente auseinanderzusetzen. Eine gewisse Beliebigkeit, ein konzeptuelles Rauschen in den mit neurowissenschaftlichen Methoden aller Art und insbesondere auch mit der „Neurobildgebung“ erhobenen Befunden dürfte auf nicht erkannte konzeptuelle Inkohärenzen zurückzuführen sein. Ich werde darauf später noch einmal etwas genauer zurückkommen. Die Philosophie ist nicht dazu da, dem Neurowissenschaftler das nächste Experiment vorzuschlagen, wohl aber dazu, das jeweils letzte, vorhergehende Experiment besser zu verstehen. Ich will aber auch die Gegenposition nicht verschweigen. Francis Crick (1994) hält die Philosophie geradezu für obsolet und stellt ihr das denkbar schlechteste Zeugnis aus: „Philosophers have had such a poor record over the last two thousand years that they would do better to show a certain modesty rather than the lofty superiority that they usually display” (Crick, 1994, S. 258). Materie ist auch Geist! Anmerkungen zu Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung Ein weiterer Grund für unsere offensichtlich kaum verrückbare Ignoranz der Natur des psychoneuralen Wechselspiels, mag noch grundsätzlicher sein und mit der wissenschaftstheoretischen Position des Reduktionismus zu tun haben, der moderne Naturwissenschaften folgen, folgen müssen. Danach sollten alle Phänomene der Welt und somit auch die mentalen Phänomene im Prinzip durch einen Satz grundlegender Formeln, der "Theorie von allem" zu erklären sein Die grundlegendste Wissenschaft für die Aufklärung der Beziehung zwischen mentalen Phänomenen und Gehirn wäre demzufolge die Mikrophysik. Auch darauf werde ich noch zurückkommen. Aber Vorsicht: "More is different"! Menschen lassen sich nicht auf ihr Gehirn, auf ihr Nervensystem reduzieren. Menschen sind mehr als eine enorme, komplex interagierende Ansammlung von Nerven- und Gliazellen, so wie ein Gemälde mehr ist als eine Ansammlung und Verbindung von Farbpigmenten und Pinselstrichen. "More is different". Dieser Satz stammt von einem Festkörperphysiker, weil sich, so Philipp Warren Anderson (1972), das Verhalten von Kollektiven, schon eine große Zahl von Atomen, eben nicht aus grundlegenden Gesetzen vorhersagen lässt. Das verborgene Wechselspiel zwischen Gehirn und mentalen Zuständen mag letztlich im Schattenreich der Mikrophysik verborgen sein oder es mag durch eine reduktionistische Denkweise maskiert werden. Für die Zukunft jedenfalls ist Neurowissenschaftlern eine offene Geisteshaltung anzuraten, die sich bemüht, die Schwächen der reduktionistischen Wissenschaftsposition ernsthafter als bisher zu reflektieren. Auch kann nicht schaden, vermeintlich längst überholte Ideen hervorragender Frauen und Männer unserer Geistesgeschichte zu dieser zentralen ontologischen Frage wieder in Betracht zu ziehen. In meiner ganz persönlichen Sicht ist es auch nicht verkehrt, sogar die Möglichkeit zuzulassen, dass etwas in diesem Gehirn wirkt, das aufzudecken, die für uns Menschen erreichbare Erkenntnistiefe nicht ausreichen könnte. Noch ist die These nicht widerlegt: „The brain is not admittable by itself“. Ob es menschlicher Ratio notwendigerweise gelingen wird, eines wie fernen Tages auch immer, die Beschaffenheit des Kosmos im Großen wie im Kleinen zu durchdringen, muss offen bleiben. Lassen Sie mich ein weiteres persönliches Bekenntnis anschließen. Als Grenzgänger zwischen Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Theologie folge ich Papst Benedikt XVI sive Josef Kardinal Ratzinger (2004), wenn er eine Gefahr darin erblickt, dass die beispiellos erfolgreiche und darum gegenüber anderen Methoden so überlegen und gelegentlich auch hochmütig auftretende naturwissenschaftliche Denkweise nur das als Wirklichkeit akzeptiert, was der Beschränkung auf das durch Beobachtung und wiederholbares Experiment Falsifizierbare zugänglich ist. Gott kann in einer solchen Sichtweise "per definitionem" nicht vorkommen. Wenn die methodisch sinnvolle und notwendige Beschränkung der naturwissenschaftlichen Denkweise in eine grundsätzliche Beschränkung umschlägt, dann wird sie zur Weltanschauung und, wie ich hinzufügen möchte, zu einem Dämon. Der in den Wissenschaften notwendige Zweifel kann sich nur darauf beziehen, dass Erkenntnisse, die für richtig gehalten werden, in Wirklichkeit falsch sein können. Sollten aber wider Erwarten menschliche Erkenntnisfähigkeiten bestimmte ontologische Tiefen nicht auszuloten vermögen, dann gäbe es dafür kein richtig oder falsch. Gelegentlich steigt in mir die Gewissheit auf, die allerdings auch schnell wieder ins Wanken gerät, dass die uralte Frage, ob in uns ein Prinzip, eine Substanz wirkt – res extensa - oder 133 zwei Prinzipien oder Substanzen zusammenwirken – res cogitans und res extensa - wie dies die Vertreter monistischer und dualistischer Positionen über die Jahrhunderte hinweg, jeweils mit den Argumenten ihrer Zeit, verfochten haben, vom Ansatz her falsch gestellt sein könnte. Im unergründeten Schattenreich der Materie mögen sich Physik und Metaphysik letztlich nicht unterscheiden oder mutiger gesagt, ist nicht denkbar, dass wir in diesem Zwischenreich der Realität des Geistigen begegnen könnten? Materie ist auch Geist. Bevor Sie diese Überlegung zurückweisen, bedenken Sie nur, dass wir um das Gehirn und seine Funktionsweisen bis ins Letzte zu verstehen, die Möglichkeiten der Materie bis ins Letzte durchschauen müssten, was wir ganz offensichtlich nicht können. Um den aus diesen Worten aufgestiegenen metaphysischen Nebel wegzublasen, will ich Ludwig Wittgensteins Rat befolgen: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“ (1918). II. Lassen Sie mich im zweiten Teil meiner Überlegungen noch einmal das Problem konzeptueller Inkohärenzen aufgreifen und die Frage stellen, ob die Inhalte unserer mentalen Existenz tatsächlich so leicht zugänglich sind wie uns dies die Alltagspsychologie vorgaukelt. Im Alltag tun wir unzählige Äußerungen, die sensorische Erfahrungen mit mentalen Zuständen, mentale Zustände mit anderen mentalen Zuständen und mentale Zustände mit Verhalten kausal verketten. So merken wir beispielsweise an, dass der Geruch von Bratkartoffeln bei Herrn X ein Hungergefühl auslöst; dass Frau Y eine Diät machen will, weil sie dachte, übergewichtig zu sein und so weiter und so fort. von Cramon Letztlich aber mag die Alltagspsychologie, um eine drastische Formulierung von David Lewis (1969) zu verwenden, nichts anderes sein als ein Sammelsurium von uns allen geteilter Platitüden über Ursachen und Gründe mentaler Zustände in uns selbst und in Anderen, dass sie aber eigentlich nichts mehr ist als eine „façon de parler“. Wilfrid Sellars (1956) nannte dies, wie ich finde treffend „the myth of the given“. Er bezweifelte, dass unsere höchst gewöhnlichen Vorstellungen von den Ursachen und Gründen mentaler Zustände einen derart privilegierten erkenntnistheoretischen Status besitzen sollten. Um diesen Mythos zu enttarnen, erfand er einen anderen. Danach hätten sich unsere Vorfahren, zunächst beschränkt auf ein unmittelbares Verständnis von Alltagshandlungen, schrittweise eine Theorie angeeignet, die bestimmte mentale Zustände als Ursachen dieser Alltagshandlungen postulierte. Diese Theorie des Geistes – „theory of mind“ - hätten sie sodann auf ihre Mitmenschen angewandt, um deren Gedanken, Überzeugungen, Wünsche, Vorlieben und Abneigungen zu erklären und vorherzusagen, bis sie endlich das „mind-reading“ soweit vervollkommnet hätten, dass sie glaubten, ihre eigenen mentalen Zustände aus dieser verinnerlichten Theorie herleiten zu können. Ob sich diese Entwicklung, die heute als „Theorie-Theorie des Geistes“ bezeichnet wird, historisch so zugetragen hat oder nicht, ist für sich genommen an dieser Stelle nicht bedeutsam. Wohl aber die durch Sellars Zweifel angestoßene Debatte darüber, ob die Konzeption mentaler Zustände eben nicht vom direkten Zugang zu den „inner workings“ unseres Geistes hergeleitet ist, sondern im Fall der Theorie-Theorie von einem schlichten Bezugsrahmen, den wir kulturell ererbt haben. Was die zerebralen Korrelate einer Theorie-Theorie angeht, so würde man demzufolge in erster Annähe- 134 rung telenzephale Hirnregionen nennen wollen, die für die Repräsentation von episodischem und semantischem Gedächtnis, also von autobiographischem und Faktenwissen erforderlich sind. Als Spielwiese dieser Informationen könnte der anteriore präfrontale Cortex mit seiner außerordentlichen Fähigkeit zu abstrakter, regelbasierter relationaler Integration fungieren. Das „Material“, mit dem er gefüttert wird, scheint in seinem lateralen Abschnitt die Umwelt und in seinem medianen Abschnitt Selbstbezogene, d.h. individuelle, subjektive Erfahrungen zu sein. Alltagspsychologie tritt uns noch in einer zweiten Form gegenüber, nämlich als mentale Simulationstheorie, die gerade in den Neurowissenschaften in den letzten Jahren große Beachtung gefunden hat. Simulation wird, etwas phantasievoll vielleicht, gerne als „putting oneself in the other´s place“ verstanden. In der kognitiven Neurowissenschaft bezeichnet Simulation die für gewöhnlich automatische, nicht bewusste Aktivierung zerebraler Mechanismen als Antwort auf das beobachtete Verhalten Anderer - Mensch oder Tier -, die mit der Produktion gleichen Verhaltes in einem selbst assoziiert sind. Die Kernfrage der Simulationstheorie ist demnach, ob die zerebralen Mechanismen, die zu Verstehen und Vorhersagen von Verhalten Anderer führen, denen ähneln, die wir für unser eigenes, „Erste-Person“ Verhalten einsetzen. In der Tat verfügt das Primatengehirn über Strukturen, die zwei Aufgaben zugleich dienen können: zum einen werden diese Strukturen endogen als Folge eigener Entscheidungen oder Emotionen aktiviert, zum anderen aber exogen durch den bloßen Anblick anderer menschlicher und tierischer Gesichter und Körper. Autonome Reaktionen, wie sie für verschiedene Emotionen als Korrelate der sie begleitenden Gefühle so typisch sind, treten für gewöhnlich als „Output“ der Verarbeitung emotionaler Stimuli auf. Die gleichen Reaktionen werden aber auch ausgelöst, wenn man nur das Gesicht eines Anderen sieht, das die entsprechende Emotion ausdrückt. Die Wahrnehmung des Verhaltens unserer Mitmenschen und „MitTiere“ scheint vielfach in „double duty“-Systemen zu erfolgen. In dieser Hinsicht berühmt, wegen der Überdehnung dieses Konzeptes auch ein wenig berüchtigt, sind hier die „mirror neurons“, die Spiegelneurone zu nennen (Rizzolatti & Craighero, 2004). Im ventralen prämotorischen Cortex von Makaken erstmals von Giacomo Rizzolatti und Kollegen entdeckt, dürften sie auch beim Menschen vorkommen. Diese Spiegelneurone haben die erstaunliche Eigenschaft, dass sie, wenn ein Individuum objektgeleitete Handlungen eines bestimmten Typs ausführt oder wenn dieses Individuum ein anderes Individuum Handlungen des gleichen Typs ausführen sieht, gleichermaßen feuern. Ob und wie diese Spiegelneurone aber mit den Trägeren kognitiver Prozesse höherer Ordnung verhandeln, insbesondere mit solchen, die das „putting onself in another´s place“ ermöglichen, gilt es allerdings erst noch herauszufinden. Lassen Sie uns hier kurz inne halten und die Ausgangsfrage nach dem Wert der Alltagspsychologie noch einmal zuspitzen: Was wäre, wenn sowohl die Theorie-Theorie als auch die Simulationstheorie unzutreffend wären, wie dies die Position des eliminativen Materialismus ist. Dass wir mentale Zustände, wie sie uns in der Alltagspsychologie, der „folk oder common sense psychology“, erscheinen, nicht auf neuro-wissenschaftlich fassbare Strukturen reduzieren können, hätte dann seinen Grund darin, dass alle mentalen Zustände, dass unsere Überzeugungen, Wünsche, Vorlieben und so weiter letztlich Fiktionen, also nicht existent sind. Materie ist auch Geist! Anmerkungen zu Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung Menschliches Verhalten, würde daraus folgen, ließe sich vollständig durch die Neurowissenschaften erst dann erklären, wenn man auf den Rückgriff auf jene primitiven Begriffe und Konzepte der Alltagspsychologie ganz und gar verzichtete. Jerry Fodor (1987) hat diese doch beunruhigende Sichtweise so kommentiert: „If commonsense psychology were to collapse, that would be, beyond comparison, the greatest intellectual catastrophy in the history of our species”. In diesen beinahe apokalyptisch anmutenden Zusammenhang gehört auch die brisante These, dass das, was wir als Ich erleben, letztlich nur ein Artefakt ist, das sich im Umgang mit sozialen Konventionen konstituiert, per se aber nicht existiert. Wer rettet dann noch unsere unsterbliche Seele? III. Im dritten Teil meiner Betrachtung möchte ich, trotz der sehr wohl beherzigten Mahnung "more is different" meine Neugierde doch noch einmal auf die kleine Welt richten, nämlich auf die Mikrophysik. Die Lösung des Gehirn-BewusstseinsProblems mag erst dann gelingen, so formulierte der Physiker Thomas Görnitz, ein Schüler des jüngst verstorbenen Carl-Friedrich von Weizsäcker in einem Seminar, wenn sich Wissenschaftler von den Zwängen eines vorquantischen Denkens befreien und für die Lösung dieser Frage auch kosmologische, also vor-biologische Entwicklungen einbeziehen, Entwicklungen also, wie sie schon seit der Entstehung des Kosmos ablaufen. Fast alle Atome unserer Körper sind durch zwei Supernova-Explosionen hindurchgegangen. Der Urgrund der Materie, so Thomas Görnitz (2005), ist Protyposis, d.h. Quanteninformation. Die Ein- beziehung einer abstrakten Quanteninformation ermöglicht ein neues Verständnis von Materie, das die positiven Aspekte sowohl einer materialistisch-monistischen als auch einer dualistischen Weltsicht zu bewahren und die jeweiligen Nachteile zu überwinden erlaubt. Aus der Schichtenstruktur von klassischer Physik, die die Welt durch Fakten erfasst und Quantenphysik, die diese in ihren Möglichkeiten beschreibt, mag ein naturwissenschaftlich begründetes Verständnis für das Phänomen Bewusstsein erwachsen und sogar ein Verständnis für die Möglichkeit freier Willensentscheidungen. In der “Stanford Encyclopedia of Philosophy” (2007) liest sich das so: „Quantum randomness might indeed open up novel possibilities for free will”. Aus der Quantentheorie folgt, dass Vorgänge in unserem Bewusstsein und ebenso im Un- oder Vorbewussten keinesfalls vollständig determiniert sein können. Zwar sind die Möglichkeiten und ihre zeitliche Entwicklung determiniert, nicht aber die künftigen Fakten, was immerhin die Option aufmacht, dass ich selbst und nicht ein Anderes meine Entscheidungen bestimmt. Quanteninformation, so heißt es, besitzt die reflexive Struktur, die für eine Modellierung von Erleben erforderlich ist. In dieser Sichtweise ist Bewusstsein verborgene, potenzielle Information, die sich selbst kennt und erlebt. Der Mathematiker Roger Penrose und der Anästhesist Stuart Hameroff (siehe Penrose, 2001) haben Mitte der neunziger Jahre ein Modell entworfen, nach dem Bewusstsein auf nicht-algorithmischen, quantenmechanischen Effekten (wie z.B. dem Einstein-Podolsky-Rosen-Phänomen, der Quanten-Verschränkung, der Quanten-Nichtlokalität), letztlich auf Gravitations-induzierten Reduktionen kohärenter Superpositionszustände in den Mikrotubuli des neuronalen Zellskelettes beruhen könnte. 135 Die Vorstellung, Bewusstsein anatomisch an Mikrotubuli fest zu machen, wird damit begründet, dass man nach einer zerebralen Struktur suchte, in denen Quantenzustände lang genug überleben, um durch Schwerkrafteinflüsse reduziert zu werden und nicht nur durch Wechselwirkungen mit der warmen und feuchten Umgebung im lebenden Gehirn. Ohne uns mit für quantenphysikalische Laien nicht zu bewertenden Details der Diskussion über dieses Modell weiter zu überfordern, sei nur soviel angemerkt: nach meinem Verständnis ist es durchaus legitim, zu untersuchen, ob zerebrale Quanten-Ereignisse wirksam und relevant sein könnten für diejenigen Aspekte der Hirnaktivität, die mit mentalen Ereignissen korreliert sind? Dass sich Quantenphysiker mit dem Gehirn-Bewusstseins-Problem beschäftigen, eröffnet Möglichkeiten, auf der basalsten Ebene, auf der wir bislang Materie beschreiben können, nach einer Lösung für das Urproblem der Hirnforschung zu fahnden. IV. Was folgt aus dem bisher Gesagten für den Hirnforscher, die Hirnforscherin der Zukunft, für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht mehr mit dem Was und Wo begnügen, sondern sich dem Wie im Gehirn annähern wollen. Weiterer Fortschritt in diesen ontologischen Fragen, so meine Hoffnung, ist von einem klug orchestrierten Zusammenspiel vieler Disziplinen zu erwarten, unter denen die Physik, die Mathematik, die Informatik, aber eben auch Philosophie, Psychologie, Sprachwissenschaften und natürlich die Neurowissenschaften eine herausragende Rolle spielen. Keine Disziplin hat für sich die konzeptuelle Tiefe und die methodische Kraft, nach der das psychoneurale, das ontologische Urproblem verlangt, immer vorausgesetzt, dass die von Cramon Lösung dieses Problems tatsächlich in unserer mentalen Zuständigkeit liegt. Die genannten Disziplinen und gewiss noch andere werden nötig sein, um in wechselseitigen und iterativen Validierungsprozessen eine „co-evolutionäre Forschungsstrategie“ zu entwickeln, wie sie vor Jahren schon Barbara von Eckardt (1978) als Kernstück einer zukunftsweisenden Neurophilosophie gefordert hat. Geeignete Strukturen, geeignete Plattformen für ein solch weit gespanntes Unternehmen zu entwerfen und in die Tat umzusetzen, ist gewiss eine herkulische Aufgabe. Keiner von uns Älteren, aber sehr wahrscheinlich auch keiner von den heute Jüngeren kann hoffen, die Lösung des Leib-Seele-Problems noch zu Lebzeiten zu erfahren. Aber mit jeder Erweiterung des Wissens über unser Gehirn, mit jeder neuen Einsicht und mit jeder neuen Frage, die sich dahinter auftut, mögen wir die dieser wunderbaren Substanz innewohnende Weisheit tiefer verehren, mögen wir ehrfürchtiger bestaunen, dass sie so in unserem Kosmos entstanden ist. 136 Prof. Dr. D. von Cramon ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und am Max-Planck-Institut für Neurologische Forschung in Köln. Dieser Vortrag wurde am 22. September 2007 zur Feier des 40-jährigen Bestehens der Fakultät für Medizin an der TU München gehalten. [8] [9] [10] [11] [12] Literatur [13] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Anderson, P.W.: More is different. Science 177, 393-396 (1972). Crick, F.: The Astonishing Hypothesis – the Scientific Search for the Soul. Ch. Scribner & Sons, New York (1994). De la Mettrie, J.O.: L’homme machine – der Mensch, eine Maschine. Reclam, Stuttgart, (1747/2001). Dennett, D.C.: Kinds of Minds – Toward the Understanding of Consciousness. Basic Books, (1996). Fodor, J.: Psychosemantics – the Problem of Meaning in the Philosophy of Mind. MIT Press,Cambridge, Mass. (1987). Görnitz, T.: Protyposis. Philosophia naturalis 2 (2005) Hameroff S, Penrose R. Conscious events as orchestrated space-time selections. J. Consciousness Studies 3, 36-53 (1996) [14] [15] Lewis, D.K.: Convention – a Philosophical Study. Harvard Univ. Press (1969). Penrose, R.: Consciousness, the brain, and spacetime geometry: an addendum. Some new developments on the Orch OR model for consciouness (2001). Ratzinger, J. and Seewald, P.: Salz der Erde. Christentum und Katholische Kirche im neuen Jahrtausend. Heyne Taschenbuch (2004). Rizzolatti G., Craighero, L.: The mirrorneuron system. Ann. Rev. Neurosci. 27, 169-192 (2004). Sellars, W.S.: Empiricism and the Philosophy of Mind. Univ. of Minnesota Press, Minneapolis (1956). Stanford Encyclopaedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu Von Eckardt, B. : Inferring functional localization from neurological evidence. PSA, Vol.1, 319-328 (1978). Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus. Kritische Edition. Suhrkamp, Frankfurt / M. (1918/1998). Prof. Dr. D. Yves von Cramon Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig [email protected] Bericht Report Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 2/2008, S. 137–139 Das „Tiroler Bündnis gegen Depression“ – eine Leistungsbilanz Angela Ibelshäuser1 und Ullrich Meise1,2 1 2 Gesellschaft für psychische Gesundheit – pro mente tirol Klinik für Allgemeinpsychiatrie- und Sozialpsychiatrie, Department für Psychiatrie und Psychotherampie, Medizinische Universität Innsbruck The„Tyrolean Alliance against Depression“-a balance of activities Das „Tiroler Bündnis gegen Depres­ sion“ ist Kooperationspartner des „Euro­päischen Bündnisses gegen De­ pression ( EAAD) [1], das im Weißbuch zur Europäischen Ministeriel­ len WHO Konferenz für psychische Gesundheit- Helsinki 2005- [2] explizit als gelungenes Bei­spiel für die geforderten Akti­vitäten zur psychischen Gesundheitsförderung (Mental Health Promotion und Mental Disorder Prevention) angeführt wird. Diesbezüglich weist auch Österreich einen Handlungsbedarf auf [3]. Ziele unserer Aktivitäten sind: eine Entstigmatisierung von Betroffenen, eine Verbesserung der Diagnose und der Behandlung depressiv erkrankter Menschen und dadurch auch eine Vorbeugung von Suiziden, eine Verbesserung des Verständnisses der Erkrankung Depression in der Bevölkerung und somit eine Veränderung des Bewusstseins in der Öffentlichkeit gegenüber psychischen Erkrankungen. © 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Hintergrund Methodik Depressive Störungen gehören zu den häufigsten und am meisten unterschätzten Erkrankungen unserer Zeit. In Tirol leiden zum heutigen Tag rund 5% der Bevölkerung – 35.000 Menschen – an einer behandlungsbedürftigen Depression. Die WHO geht davon aus, dass die Depression bis zum Jahr 2020 in den entwickelten Ländern zur zweithäufigsten Erkrankung werden wird. Betrachtet man die Beeinträchtigung der Lebensqualität durch eine Depression oder die mit ihr vergesellschaftete Gefährdung, wird der Handlungsbedarf deutlich. Etwa 70% der Menschen, die sich das Leben nahmen, waren depressiv erkrankt (in Tirol über 100 Personen pro Jahr), wobei das Risiko für Männer, an einem Suizid zu versterben, deutlich höher ist als jenes für Frauen [4]. Das Thema „Depression“ wird von der Öffentlichkeit wenig wahrgenommen und oft missverstanden. Viele Betroffene erkennen selbst nicht, dass sie unter Depression leiden, sondern glauben, körperlich erkrankt zu sein. Andere trauen sich aus Scham und/oder Angst vor Stigmatisierung und Ausgrenzung nicht, Hilfsangebote wahrzunehmen. Der Mehrzahl der Betroffenen könnte erfolgreich geholfen werden, aber nur eine Minderheit der Betroffenen erhält derzeit eine adäquate Behandlung. Das persönliche Leid für Betroffene, deren Angehörige und Freunde wäre vermeidbar. Mit einem „4-Ebenen-Ansatz“, der mindestens über 10 Jahre verfolgt werden soll, müsste ein Großteil der Bevölkerung erreicht werden: • Öffentlichkeitsarbeit: Durch eine intensive und breite Informations- und Aufklärungsarbeit mittels Plakate, Flyer, Broschüren, Videokasetten, CDROMs, Webseiten, Kinospot, Aktionstagen, Schulaktion, Vorträgen, Medienberichten soll die Bevölkerung für das Thema sensibilisiert werden. Die Kenntnisse über die Erkrankung Depression und somit die Einstellung zur Erkrankung und zu Betroffenen sollen dadurch auffällig verbessert werden. • Angebote für PatientInnen und Angehörige: Betroffene werden gezielt über Hilfsangebote in Krisensituationen informiert; darüber hinaus werden bestehende oder neu zu gründende Selbsthilfegruppen unterstützt. Eine anonyme EmailBeratung für Betroffene steht zur Verfügung. • Kooperation mit Multiplika­ torInnen: Berufsgruppen wie LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, SeeslorgerInnen, Pflegepersonal, PolizeibeamtInnen, die berufsbedingt viel mit Menschen und/oder depressiven PatientInnen zu tun haben, wirken als MultiplikatorInnen. Ibelshäuser, Meise Sie erhalten Informationsmaterial zur Weitergabe und werden auf Wunsch in individuell zugeschnittenen Fortbildungsveranstaltungen informiert. • Kooperation mit ÄrztInnen für Allgemeinmedizin: ÄrztInnen soll die Möglichkeit angeboten werden, ihre Erfahrungen mit PatientInnen zu reflektieren; sie sollen – so gewünscht – Unterstützung bei persönlichen Fragen bekommen, denen sie in ihrer Arbeit mit depressiven PatientInnen begegnen. Struktur des Projektes Dem Tiroler Bündnis haben sich ca. 30 Organisationen und Personen als Partnerinnen und Partner angeschlossen, ca. 10 arbeiten aktiv in der Steuerungsgruppe zur Koordination der tirolweiten Aktivitäten. Dazu zählen u.a. Angehörigen- und Betroffenen-Selbsthilfe, Sozialpsychiatrische Vereine, Universitätsklinik für Psychiatrie Innsbruck und BKH Hall, FachärztInnen, Stadtmagistrat Innsbruck, Telefonseelsorge, Berufsverbände (Tiroler Landesverband für Psychotherapie), …. Auch ist es uns gelungen, dass sich in den Bundesländern Steiermark, Wien, Kärnten und Niederösterreich „Bündnisse“ formiert haben, die die Ziele und den Ansatz von EAAD in ihrer Region vertreten und umsetzen. Aktivitäten Die Auftaktveranstaltung fand am 24. Feber 2005 statt. • Öffentlichkeitsarbeit: ­– Intensive, kontinuierliche Medienarbeit (Pressekonferenzen 16, Medienpräsenz in Printmedien 80, TV und Radio 26, Fachmedien 4) 138 –­ Video für Klinikfernsehen (Sendezeit 10 Min., 2 Monate, mehrfach täglich) ­– Kinospot (4 Orte, 2 Monate, 11 Säle) ­– Vorträge, Lesung, Aktionen in Innsbruck und Tiroler Be­ zirken (48) ­– Beteiligung an Gesundheits­ tagen (5) ­– Schulaktionen; Workshops für SchülerInnen (Schulklassen 80, 1850 Schülerinnen und Schüler), Evaluierung der Einstellungsänderung ­– Informationsflyer, Inlay, Ankündigungsplakate, Handouts (insg. 20.000) • Angebote für Betroffene und ihre Angehörigen: –­ Homepage (www.buendnisdepression.at) und Emailberatung –­ Förderung und Gründung neuer Selbsthilfegruppen für Betroffene und Angehörige (Gründung neuer Selbsthilfegruppen: 3) ­– Medienarbeit zur Unterstützung der Arbeit der Selbsthilfegruppen ­– Fachtagung: „Tabu Suizid“ für Hinterbliebene, Angehörige, Freunde (s.u. und Personen, die beruflich mit dem Thema konfrontiert sind) (insg. ca. 130 Teilnehmer) –­ Vorträge „Depression betrifft die ganze Familie“ in Innsbruck und Tiroler Bezirken (10 gemeinsam mit HPE gestaltete Vorträge, ca. 1100 Zuhörer) • Kooperation mit Multiplika­ torInnen: – Schulungen / Fachgespräche / Fachtagung z.B. für: ­ Altenpflegepersonal (14 Schulungen, 150 Teilnehmer) ­– Polizei (Vorträge 1, 15 Teilnehmer) ­– MedizinstudenInnen, PsychologiestudentInnen (Vorträge, ­– ­– ­– ­– ­– –­ Seminare 26, 1300 Teilnehmer) Train the Trainer Seminar für ReferentInnen der Schulaktion (20 Teilnehmer) Dekane, Priester, SeelsorgerInnen (Vorträge 2, 40 Teilnehmer, Fachtagung Anfang Juni 08: „Seelsorge und psychische Gesundheit“) Führungskräfte (Vorträge 3, 80 Teilnehmer) Workshop für Tiroler MedienvertreterInnen (Berichterstattung bei Suizid - Der Beitrag der Medien zur Suizidprävention), Weiter-Verteilung des Medien-Leitfadens „Berichterstattung bei Suizid“ innerhalb der Medien, Nominierung für den Tiroler Medienpreis Tirolissimo 2007 im Bereich Pressearbeit, eingereichtes Projekt: „Suizidprävention“ Fachtagung: „Tabu Suizid“ (s.o. für Hinterbliebene, Angehörige, Freunde) und Personen, die beruflich mit dem Thema konfrontiert sind (insg. ca. 130 Teilnehmer) 2 Medienschulungen für Bündnispartner • Kooperation mit ÄrztInnen für Allgemeinmedizin: ­ In Planung - bisher eine Schulung (26 TNInnen) Die Gesellschaft für psychische Ge­ sundheit- pro mente tirol, die die Projektkoordination für das Projekt übernommen hat, bietet seit über 30 Jahren für Menschen mit psychischen Erkrankungen vielfältige Betreuungs- und Rehabilitationsangebote an und bemüht sich gleichzeitig um die Entstigmatisierung und Integration der Betroffenen (www. gpg-tirol.at). Ihnen sollen die Möglichkeiten eröffnet werden, von ihrer psychischen Erkrankung zu genesen, die Krankheitsfolgen zu bewältigen, ihre oft schwierigen Lebensumstände selbstbestimmt zu verbessern sowie neue Lebensperspektiven und gesellschaft- Das „Tiroler Bündnis gegen Depression“ – eine Leistungsbilanz liche Teilhabe zu entwickeln. Dabei sollen transkulturelle und geschlechtsspezifische Aspekte in Zukunft stärker berücksichtigt werden [4]. Ein soziales Klima, das die wichtigen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt und schützt, sich gegen Armut, Stigma und Ausgrenzung wendet, trägt Wesentliches zur psychischen Gesundheit bei. Literatur [1] Pfeiffer-Gerschel T., Wittmann M., Hegerl U.: Die „European Alliance Against Depression (EAAD)“ – Ein europäisches Netzwerk zur Verbesserung der Versorgung depressiv erkrankter Menschen. Neuropsychiatr 21, 51-58 (2007) [2] Meise U., Wancata J.: „Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit“- Die Europäische Ministerielle WHO-Konferenz für Psychische Gesundheit; Helsinki 2005. Neuropsychiatr 19, 151-154 (2006) [3] Meise U., Sulzenbacher H., Eder B., Klug G., Schöny W., Wancata J.: Psychische Gesundheitsversorgung in Österreich – Eine Beurteilung durch unterschiedliche Gruppen von 139 Psychia­triebetroffenen auf Grundlage der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Neuropsychiatr 20, 174185 (2006). [4] Hausmann A., Rutz W., Meise U.: Frauen suchen Hilfe – Männer sterben! Ist die Depression wirklich weiblich? Neuropsychiatr 22, 43-48 (2008) Gesellschaft für Psychische Gesundheit – pro mente tirol „Tiroler Bündnis gegen Depression“ Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Mag. Angela Ibelshäuser Email: [email protected] URL: www.buendnis-depression.at Laudatio Laudatio Neuropsychiatrie, Band 22, Nr. 2/2008, S. 140–141 Univ.-Prof. Dr. Verena Günther – 50 Jahre Hartmann Hinterhuber Universitätsklinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck logie, die Klinische Psychologie und die Verhaltenstherapie ansteckend und inspirierend. Alle, die Frau Prof. Verena Günther je begegnet sind und sie kennen lernen konnten, sind von ihrem persönlichen und – vor allem – menschlichen Engagement beeindruckt, von ihrem Einsatz für die Univ.-Klinik für Psychiatrie, für ihre Abteilung für Klinische Psychologie, für die Wissenschaft, die Gesundheitspsychologie und – ganz besonders – für ihre Familie, aber auch für die Gesundheits- und Frauenpolitik: Alle diese Bereiche besitzen in ihr eine starke Stimme und eine unermüdliche Fürsprecherin. In herzlicher Verbundenheit feierten am 21.02.2008 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der „Abteilung für Klinische Psychologie“ und der „Psychotherapeutischen Ambulanz“ der Univ.-Klinik für Psychiatrie Innsbruck den runden Geburtstag der Leiterin dieser erfolgreichen Einheit und überbrachten ihr die herzlichsten Glückwünsche. Alle Mitglieder des Departments für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Innsbruck schließen sich in Freundschaft und Verbundenheit den vielen Wünschen in der Hoffnung an, von Frau Prof. Verena Günther auch in der weiteren Zukunft in Patientenbetreuung, Lehre und Forschung viele Anregungen und Impulse empfangen zu können. In der Tat ist ihr Enthusiasmus für die Gesundheitspsycho© 2008 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Frau Prof. Günther bewahrt Gelassenheit, Ruhe und Humor auch in schwierigen Situationen; sie beweist Souveränität und Geschicklichkeit im Umgang mit ihren vielen Patienten und Kreativität in der Lösung komplexer Probleme. Die Univ.-Klinik für Psychiatrie Innsbruck erwartet auch in Zukunft für ihre Fragestellungen und Sorgen konstruktive Lösungsvorschläge, wir erhoffen uns von ihrem wissenschaftlichen Elan neue Denkanstöße und kreative Lösungen. Verena Günther wurde am 21.02.1958 in Innsbruck in eine große Familie mit 5 Geschwister geboren. Ihr Vater, Univ.-Prof. Dr. Robert Günther, formte ihre wissenschaftliche Orientierung und ihre Bereitschaft zu großen sozialen und therapeutischen Leistungen, ihre Mutter, Helga Günther geb.Seifert, Spross einer alt- eingesessenen Innsbrucker Familie, prägte ihre durch große Liebenswürdigkeit und hohe Empathie sowie Realitätssinn und Bodenständigkeit ausgezeichnete Persönlichkeit: Frau Prof. Verena Günther ist durch große Vorbilder geformt ein leistungsorientierter, zuvorkommender und liebenswürdiger Mensch. Nach ihrer Matura am wirtschaftskundlichen Realgymnasium der Ursulinen in Innsbruck begann sie 1976 an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität ihr Studium, das sie 1981 mit dem Doktorat der Philosophie in den Fachgebieten Psychologie und Pädagogik abschließen konnte. Ihr Dissertationsthema "Die Persönlichkeitsstruktur chronisch rheumatisch erkrankter Frauen" war eine – verdiente – Hommage an ihren Vater! 1980 konnte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Univ.-Klinik für Psychiatrie Innsbruck gewonnen werden. 1984 schloss sie ihre Ausbildung in Gesprächspsychotherapie und 1987 jene in Verhaltenstherapie ab. 1990 wurde ihr bereits in Anerkennung ihrer Leistung und hohen Identität mit der Klinik und ihrem Fachbereich die Leitung der Abteilung für Klinische Psychologie und der Psychotherapeutischen Ambulanz übertragen. 1991 erfolgte die Eintragung sowohl in die Liste der "Klinischen Psychologen" und "Gesundheitspsychologen" als auch in jene der "Psychotherapeuten" mit der Zusatzbezeichnung "Verhaltenstherapie". Nachdem sich Frau Dr. Verena Günther 1988 als Lehrtherapeutin der Österreichischen Gesell- Univ.-Prof. Dr. Verena Günther – 50 Jahre schaft für Verhaltenstherapie etabliert hatte und in die Ausbildungskommission berufen wurde, konnte sie sich am 21.11.1994 an der Medizinischen Fakultät der Universität Innsbruck im Fachbereich "Medizinische Psychologie – Verhaltensmedizin" habilitieren. 2001 wurde ihr in Würdigung ihrer Verdienste der Titel einer Außerordentlichen Universitätsprofessorin verliehen. Verena Günther ist als exzellente Vortragende – wie ihr Vater – eine hervorragende Hochschullehrerin. Von 1995 bis 1999 war sie Vizepräsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Verhaltenstherapie, seit Dezember 1996 ist sie in die Supervisorenliste des Berufsverbandes Österreichischer Psychologen eingetragen. Ihr verdankt das Land Tirol auch die Etablierung der ersten Raucherberatungsstelle. Gemeinsam mit Doz. Dr. Martin Kopp leitet sie derzeit den Forschungsschwerpunkt "Gesund- heitspsychologie – Klinische Psychologie und Verhaltensmedizin" der Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie. Nicht nur in Tirol, sondern auch in Vorarlberg und in der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol wurden ihr die wissenschaftliche Leitung von postgraduellen universitären Lehrgängen anvertraut. Verena Günther hat viele Kolleginnen und Kollegen wissenschaftlich und psychotherapeutisch geformt, einige konnte sie zur Habilitation begleiten. Mit vielen wissenschaftlichen Beiträgen hat sie ihr Fach gefördert. Ihre Arbeiten haben ihr Lob und Wertschätzung der internationalen Scientific Community eingebracht, die in ihr eine hervorragende Repräsentantin gefunden hat. Heute zählt das wissenschaftliche Oeuvre von Frau tit. Ao. Univ.-Prof. Dr. Verena Günther mehr als 60 141 Originalarbeiten, sie ist Verfasserin von zahlreichen Buchartikeln und Lehrbuchbeiträgen und eines sehr angesehen Raucherentwöhnungsprogramms. Sie ist auch Herausgeberin von 3 Büchern. Neben all diesen beruflichen und wissenschaftlichen Leistungen ist sie für Ulli Meise die beste Ehegattin und für ihren Sohn Christoph die allerbeste Mutter! Die künftigen Jahrzehnte sollen Ihnen, liebe Frau Prof. Günther, Glück, Freude und Harmonie bescheren, sie soll Ihnen vor allem alle jene vielen Menschen erhalten, die Ihnen nahe sind. Dies wünscht Ihnen von Herzen Ihr Hartmann Hinterhuber