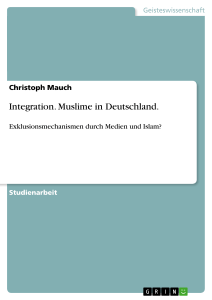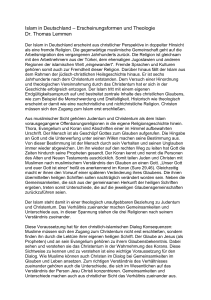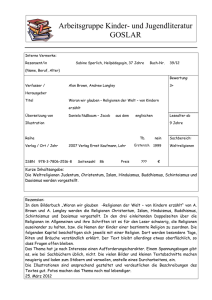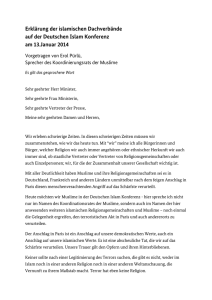Tagungsbericht - Akademie der Diözese Rottenburg
Werbung

Identität durch Differenz? Zur Rolle der wechselseitigen Abgrenzungen in Christentum und Islam Stuttgart-Hohenheim, 03.03.2006 - 05.03.2006 Identität durch Differenz? Tagungsbericht über die vierte Tagung des Theologischen Forums Christentum Islam Bernd Mussinghof Im Rahmen des „Theologischen Forums Christentum – Islam“, eines wissenschaftlichen Netzwerks und Diskussionsforums im Bereich christlich-islamischer Studien, fand vom 3. bis zum 5. März 2006 in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Stuttgart-Hohenheim die diesjährige Tagung des Forums statt, die wie in den vergangenen Jahren vom Bundesministerium des Inneren gefördert wurde. Die bislang größte Tagung dieser Art im deutschsprachigen Raum, zu der sich 90 christliche und muslimische Theologinnen und Theologen, Religionswissenschaftler/innen, Sozial- und Kulturwissenschaftler/innen aus zehn verschiedenen Ländern versammelt hatten, die sich in Forschung und/oder praktischen Arbeitsfeldern mit dem Verhältnis von Islam und Christentum befassen, stand unter dem Thema „Identität durch Differenz? Zur Rolle der wechselseitigen Abgrenzungen in Christentum und Islam“. Auf die Aktualität des Themas wies Tagungsleiter Dr. Hansjörg Schmid in seiner Einführung hin: In einer Zeit, in der Gegensätze und Grenzen – nicht nur zwischen Christentum und Islam, sondern auch innerhalb der Religionen und Kulturen – verstärkt gesucht und auch politisch wie ideologisch instrumentalisiert würden, gebe es zu einer Verständigung über deren Sachgemäßheit und Angemessenheit keine Alternative. Duran Terzi (Düsseldorf), der die Tagung von muslimischer Seite eröffnete, wies darauf hin, dass eine „Kultur des Umgangs mit Differenzen“ in Vergessenheit geraten bzw. bisher noch unterentwickelt geblieben sei. Zwei Leitfragen für die Tagung wurden von Schmid formuliert. Erstens fragte er nach Alternativen zu einer auf der Leitkategorie der Differenz aufbauenden christlich-muslimischen Verhältnisbestimmung, und zweitens stellte Schmid die Frage nach der Konstitutivität von Abgrenzungen für beide Religionen und danach, wie diese ohne Übergriffe auf die Identität des anderen vorgenommen werden könnten. Im ersten Hauptreferat von Prof. Dr. Dr. h. c. Jacques Waardenburg (Lausanne) mit dem Titel „Selbstsicht und Sicht des anderen – Verschiedenheit, Abgrenzungen und Wege zur Offenheit“ wurden aus religionswissenschaftlicher Perspektive erste grundlegende Überlegungen zum Tagungsthema angestellt und, wie im Untertitel angekündigt, vorsichtig Wege zur wechselseitigen Offenheit zwischen verschiedenen Menschen ganz allgemein und zwischen Muslimen und Christen im Besonderen aufgezeigt. Nach den zahlreichen Abgrenzungen, die es in nahezu vierzehn Jahrhunderten sowohl auf muslimischer als auch auf christlicher Seite gegeben habe, und zwar nicht nur von Christen zu Menschen außerhalb der eigenen christlichen Welt (Muslime als eine spezifische Teilgruppe dieser Menschen) bzw. von Muslimen zu Menschen außerhalb der eigenen islamischen Welt (Christen als eine spezifische Teilgruppe dieser Menschen), sondern auch von bestimmten muslimischen und christlichen Personen und Gruppen zueinander, gebe es in den letzten fünfzig Jahren auch neue Wege zur Offenheit. Eine solche neue Offenheit aber, so Waardernburg, verlange Anstrengung, soweit sie nicht angeboren sei. Sie ermögliche jedoch die Wahrnehmung von Differenz nicht nur als negativ, als schicksalhafte Folge verschiedener Identitäten, sondern 1/9 Identität durch Differenz? Zur Rolle der wechselseitigen Abgrenzungen in Christentum und Islam Stuttgart-Hohenheim, 03.03.2006 - 05.03.2006 auch als positive Voraussetzung für Identitätsbildung. Bis jetzt hätten Muslime wie Christen ihren wesentlichen Unterschied als Differenz zwischen beiden Religionen gesehen, wodurch ihre menschlichen Unterschiede als eine religiöse Differenz identifiziert und mit dem Gegensatz zwischen Islam und Christentum legitimiert worden seien. Die wissenschaftliche Unhaltbarkeit dieser Konstruktion, der bislang zahllose Menschen zum Opfer gefallen seien, führte Waardenburg anschaulich vor Augen. So forderte er Vorsicht beim Umgang mit den Allgemeinbegriffen „Islam“ und „Christentum“. Statt von deren wesentlicher Entgegensetzung zu sprechen – eine Aussage, die Waardenburg als wissenschaftlich unwahr kennzeichnete –, solle man genau sagen, welchen Islam man welchem Christentum entgegenzustellen beabsichtige. Eine bessere Kenntnis anderer Gemeinschaften und ihrer Religionen sowie eine stärker inhaltliche Kommunikation mit den betreffenden Menschen selbst, so ein zentraler Punkt in Waardenburgs Referat, könne zu einer neuen Sicht auch auf die Beziehungen zwischen Religionsgemeinschaften führen. Bessere Kenntnisse und normale Kommunikation seien notwendig, um den Deformationen oder gar Entstellungen des anderen zu entgehen, die in vielen Fällen aus geläufigen Weisen der Selbstsicht resultieren könnten. Je nachdem, in welcher Weise Menschen sich selbst, ihre Lebensgemeinschaft, und so auch „Eigenes“ (Gesellschaft, Kultur, Religion) sähen und bewerteten, gebe es häufig den Fall, dass „der andere“ oder die andere Gruppe – im Bereich der Religion also die andere Religion – als Gegenbild der eigenen gesehen und gewertet werde, wodurch ein Dualismus konstruiert werde, innerhalb dessen die Menschen dann ihren Platz erst zu finden hätten. Um einem solchen Dualismus und der Verdinglichung von „Islam“ und „Christentum“ entgegenzuwirken, gebe es viele Möglichkeiten. Muslime und Christen könnten z. B. zusammen Forschung treiben und versuchen, theologische „Missverständnisse“ aufzuklären, gegebene religiöse und auch kulturelle und soziale Unterscheidungen feststellen und in ihren historischen und anderen Zusammenhängen zu durchschauen versuchen, die Interessen beider Gemeinschaften, vor allem bedrohter Gruppen verteidigen sowie sich im öffentlichen Leben für bessere muslimisch-christliche Zusammenarbeit einsetzen. Muslimen sei es möglich, ihre Beziehungen zu Christen als legitim anzusehen durch die Annahme, dass Christen als eine Art „irregehender Muslime“, die ihre islamische Offenbarung schon früher erhalten hätten, betrachtet werden könnten, die sich abseits des rechten Weges, aber im Diesseits der letzten Offenbarung befänden. Für Christen sei es möglich, ihre Beziehungen zu Muslimen als legitim anzusehen durch die Annahme, dass Muslime einen ähnlichen Gottesglauben hätten und so als Gläubige betrachtet werden könnten, die sich abseits der Erlösung, aber im Diesseits der letzten Offenbarung befänden. Letztlich komme es, um zu einer solchen oder ähnlichen neuen Sicht auf andere zu gelangen, darauf an, eine neue Selbstsicht zu gewinnen sowie Einsicht im guten Umgang miteinander. Über „Abgrenzung im islamischen Denken“ sprach im zweiten Hauptreferat Prof. Dr. Muḥammad Kalisch (Münster). Seinen Überblick über „Entwicklung, Bedeutung und Begründung des Abgrenzungsgedankens in der islamischen Theologie und im islamischen Recht“ gliederte er in drei Abschnitte: a) Definition des Islam, b) theologische Folgerungen, c) rechtliche Folgerungen. Wo eine neue Weltanschauung auftrete, so Kalisch, sei Abgrenzung nötig – es sei denn, es werde Kompatibilität mit anderen Weltanschauungen festgestellt. In der Frage nach der Definition für „Islam“ habe es Abgrenzungen nicht nur gegenüber anderen Religionen, sondern auch innerhalb des Islam gegeben, wenn es darum gegangen sei, die Grenzen zwischen Orthodoxie und Heterodoxie zu ziehen. Seine Ausführungen begrenzte Kalisch angesichts der knappen Zeit auf den ersten Bereich. Konsens unter Muslimen sei, dass entsprechend Sure 2, Vers 285, zu ihrem Glauben (arab. imān) fünf Punkte gehören: der Glaube an Gott, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten sowie an den Jüngsten Tag. Bei der Spezifizierung dessen, was mit diesen fünf Punkten gemeint sei, gebe es aber zwischen den verschiedenen von Muslimen vertretenen Auffassungen zum Teil deutliche Unterschiede: So gehe es bei der Frage nach Gott immer auch um die Problematik des tawhīd, an die sich die Frage nach dem Verhältnis vom Wesen Gottes zu seinen Attributen anschließe. Auch die Vorstellungen darüber, was Engel seien, gingen weit auseinander (universale Kräfte, personale Wesen 2/9 Identität durch Differenz? Zur Rolle der wechselseitigen Abgrenzungen in Christentum und Islam Stuttgart-Hohenheim, 03.03.2006 - 05.03.2006 u. a.). So formulierte Kalisch als formale Kriterien zur Unterscheidung von anderen Religionen vor allem die Überzeugung, dass Muhammad das Siegel der Propheten und der Koran die letzte, endgültige und unverfälschte Offenbarung sei. Eine so verstandene Definition des Islam sei allerdings manchmal problematisch, wenn z. B. bestimmte jüdische Gruppen Muhammad ebenfalls als Propheten anerkennten. Eine Ausweitung dieser „klassischen“ Definition habe Sayyid Ahmad Khan (1817-1898) geliefert, der jeden, der an Gott glaube und Gott ergeben ethisch lebe, als „Muslim“ bezeichnet habe. Die theologische Schlussfolgerung aus der „klassischen“ Islam-Definition sei diejenige gewesen, dass es ohne eine Anerkennung des Koran und von Muhammad im beschriebenen Sinn kein Heil gebe. Gegenüber der verbreiteten Vorstellung, bei den Sūfīs sei dies anders, machte Kalisch an mehreren Beispielen deutlich, dass dies nicht ohne weiteres gesagt werde könne. Allenfalls bei Ğalāladdīn Rūmī (1207-1273) vermochte er Ansätze einer Heilsrelevanz anderer Religionen zu sehen. Die auch im Koran häufig vorkommenden Begriffe „kufr“ (Unglaube) und „imān“ (Glaube) seien von muslimischen Theologen meistens mit verschiedenen vorgefassten theologischen Konzepten verstanden und diesen entsprechend interpretiert worden. Erst in der Moderne seien Koranverse wie Sure 2, Vers 82, oder Sure 5, Vers 69, im Sinne einer Heilsrelevanz über den Islam in nomineller Form hinaus verstanden worden. Im dritten Teil seiner Ausführungen ging Kalisch von der traditionellen Zweiteilung aus, die das islamische Recht in Bezug auf das Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen macht: „dār al-islām“ (Haus/Gebiet des Islam) und „dār al-harb“ (Haus/Gebiet des Krieges). Angesichts der vor allem für letzteres relevanten koranischen Regelungen in Bezug auf ius ad bellum wie ius in bello plädierte Kalisch für eine Deutung der entsprechenden Verse im Gesamtzusammenhang und gegen die verbreitete Deutung der später datierten „härteren“ Verse als Abrogation der früher datierten „weicheren“ Verse. In Bezug auf ersteres hob Kalisch hervor, dass es in diesem Zusammenhang Regelungen nicht nur für Muslime und „dimmīyūn“ (ständig im dār al-islām lebende „Schutzbefohlene“), sonder auch für sich dort vorübergehend aufhaltende Nichtmuslime („musta`minūn“) gebe. Im Folgenden ging Kalisch vor allem auf die rechtliche Stellung der dimmīs ein, wobei er grundsätzlich eine zunehmende Verschlechterung im Laufe der Zeit konstatierte. Grundsätzlich gelte, dass diese sich durch einen Vertrag, in dem ihre Stellung als dimmīs geregelt werde, in das islamische Recht fügten. Hierdurch sei ihnen gegenüber den Muslimen gleiches Lebensrecht, gleiches Recht auf Eigentum, auf Freiheit, auf Würde und Familienehre sowie – mit Einschränkungen (v. a. in Bezug auf den Neubau von Kirchen bzw. Synagogen) – gleicher Religionsschutz gewährt. Anders als die Muslime seien die dimmīs aber verpflichtet zur Zahlung der „ğizya“, einer besonderen Steuer, befreit seien sie hingegen vom Militärdienst und von der Pflicht, die „zakā“ (die zu den fünf „Säulen des Islam“ gezählte Abgabe vor allem zu Gunsten Armer) zu zahlen. Nicht möglich sei die Bekleidung eines der höchsten Staatsämter. Abgrenzung gegenüber Nichtmuslimen sei in der Praxis durchaus relevant, vor allem im Bereich des Erbrechts sowie des Eheund Familienrechts, worauf Kalisch im Anschluss einging. Die unterschiedlichen Positionen der verschiedenen muslimischen Schulen stellte er überblicksartig dar, die sich beim Ehe- und Familienrecht vor allem in der Frage unterscheiden, ob ein muslimischer Mann eine nichtmuslimische Frau heiraten dürfe. Nach sunnitischem Recht sei dies im Falle von jüdischen und christlichen Frauen erlaubt, nach zaiditischem gar nicht und nach imamitischem nur zeitlich begrenzt. Dass muslimische Frauen keinen nichtmuslimischen Mann heiraten dürften, sei Konsens in den klassischen muslimischen Rechtsschulen. Im Erbrecht gebe es Unterschiede vor allem in der Frage, ob Muslime Erben von Nichtmuslimen sein können. Nach imamitischem Recht sei dies möglich, in allen anderen Rechtsschulen hingegen nicht. Dass Nichtmuslime keine Erben von Muslimen sein können, sei hingegen wiederum Konsens in den Rechtsschulen. Kalisch schloss seinen Vortrag mit einem Ausblick auf aktuelle Diskussionslinien in relevanten Bereichen des islamischen Rechts. Diskussionen würden vor allem über die Frage geführt, wie das Völkerrecht sich zur klassischen dār al-islām/dār al-harb-Dichotomie verhalte, sowie über die Frage, ob das Verbot für muslimische Frauen, einen 3/9 Identität durch Differenz? Zur Rolle der wechselseitigen Abgrenzungen in Christentum und Islam Stuttgart-Hohenheim, 03.03.2006 - 05.03.2006 nichtmuslimischen Mann zu heiraten, bei Gleichstellung von Mann und Frau noch Sinn mache. Die Suche nach der „hikma at-tašri´īyya“, der „Weisheit“ bzw. des „Sinns“ der (koranischen) Gesetzgebung sei heute weit verbreitet. Die folgende „Erwiderung“ von Prof. Dr. Christian W. Troll SJ (Frankfurt) gestaltete dieser nicht als konfrontative Auseinandersetzung mit Kalischs Vortrag, sondern vielmehr als ergänzende und vertiefende Reflexion über einige wichtige Punkte daraus. So fragte er nach dem koranischen Gottesverständnis und der damit zusammenhängenden Beziehung zwischen Gott und Mensch. Mit der im „islamischen Glaubensbekenntnis“, der šahāda enthaltenen Formulierung „ila ’llāh“ ([ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt] „außer Gott“) werde hierbei schon eine Abgrenzung vorgenommen, vielleicht die Wichtigste, so Troll. Wenn nach muslimischer Auffassung Juden und Christen als von diesem ihnen ursprünglich eingeschaffenen Glauben (fitra) abgefallen angesehen würden, dann habe dies mit den auch koranisch häufig vorkommenden Begriffen mušrikūn und kāfirūn zu tun, über die eine grundlegende Abgrenzung vorgenommen werde. Außerdem ging Troll auf das Problem ein, das mit dem Ziel einer Wiederherstellung der einzigartigen Einheit der Menschen, die in unverfälschter Weise an den einen Gott glauben, verbunden ist: die Frage nach dem Umgang mit den Menschen, die sich diesem Ziel widersetzen. Wenn es eine Pflicht der umma gebe, durch das Vollziehen von Gottes zwiefältiger Gerechtigkeit eine klare Trennungslinie zwischen Gläubigen und Ungläubigen zu ziehen, dann liege darin, dass (und wie) die Muslime diese Pflicht wahrmachen wollten und müssten, der Kern der heutigen Probleme. Im dritten Hauptreferat sprach Prof. Dr. Olaf Schumann (Hamburg) über „Annäherungen und Abgrenzungen im christlichen Denken an den Islam“. In seinem breit angelegten historischen Überblick ging Schumann zunächst auf die unterschiedlichen Reaktionen auf das Entstehen des Islams bei Byzantinern und autochthonen orientalischen Kirchen ein. Während letztere den muslimischen Heeren mit Akzeptanz begegnet seien, sei bei ersteren das Bewusstsein, einer gehobeneren Zivilisation anzugehören als die orientalischen Eroberer mit Distanz diesen gegenüber zusammengekommen. Angesichts zahlreicher Ähnlichkeiten und auch Gemeinsamkeiten zwischen den einheimischen Christen und den Muslimen (auf der Ebene der Religion, der Kultur, aber auch auf sprachlicher Ebene, insbesondere zwischen den aramäischsprachigen syrischen Christen und den arabischsprachigen Muslimen) sei zunächst gar nicht wahrgenommen worden, dass eine neue Weltreligion entstanden sei, vielmehr scheine diese, in das bunte Bild des orientalischen Christentums eingeordnet worden zu sein. Auf Seiten der Byzantiner sei zu berücksichtigen, dass deren spätere Polemik gegen die Muslime gewissermaßen in der früheren Polemik gegen die nichtchalcedonensischen Kirchen einen Vorläufer habe, wobei als erhärtender Faktor für die Polemik gegenüber den Muslimen deren neue politische und militärische Macht hinzugekommen sei. Die erste Phase der byzantinischen Auseinandersetzung mit dem Islam zeigte Schumann an der Einordnung des Islam in den Strom christlicher Häresien in der Theologie des Johannes von Damaskus (ca. 675-754) auf. Dieser habe, so Schumann, die Muslime als außerhalb der Heilsgeschichte stehend angesehen, was er durch den Hinweis auf einige Namen umschrieben habe, mit denen die Christen (und wohl auch die Juden) die Muslime bezeichnet hätten: Hagarener, Ismaeliten (Nachfahren Hagars und Ismaels), Sarazenen (die von Sara Enterbten). Die Betrachtungsweise des Johannes, in der vom Islam nur diejenigen Lehren wahrgenommen worden seien, die sich mit der christlichen Religion berührten (meistens in konfrontativer Absicht), habe dazu geführt, dass er den Islam als eigenständige Religion gar nicht wahrnehmen konnte, so dass das, was er als Islam dargestellt habe, tatsächlich eine christliche Häresie gewesen sei – wobei alle anderen Themen des Islam, die nichts mit dem Christentum direkt zu tun haben, ausgeblendet worden seien. An zwei Beispielen machte Schumann im Folgenden deutlich, dass die Argumente des Johannes gegen die Muslime letztlich eher als theologische Argumente gegen Positionen, die denen des Johannes nicht entsprachen, zu betrachten seien denn als Argumente gegen den Islam als Religion. So ging er einerseits auf die Frage nach dem ontologischen Status des logos ein (ewig oder geschaffen), und 4/9 Identität durch Differenz? Zur Rolle der wechselseitigen Abgrenzungen in Christentum und Islam Stuttgart-Hohenheim, 03.03.2006 - 05.03.2006 andererseits auf die Frage nach dem freien Willen des Menschen bzw. der Prädestination. Schumann zeigte auf, dass beide Fragen sowohl in der christlichen als auch in der islamischen Theologie kontrovers diskutiert worden seien. So werde zwar im Koran klar ausgesagt, dass Jesus ein Geschöpf sei, hiermit sei aber die Frage nach der Erschaffenheit des logos noch nicht beantwortet. Diese werde in der islamischen Theologie unter der Frage nach der „Rede Gottes“ (kalāmu `llāh) behandelt und nicht auf Jesus, sondern auf den Koran in seiner Urform bezogen – und (mit Ausnahme der mu´tazilitischen Theologie) im Sinne der Ewigkeit desselben beantwortet. Am Beispiel zweier späterer christlicher Theologen, die sich mit dem Islam auseinander setzten, stellte Schumann abermals einen Unterschied zwischen byzantinischer und nichtchalcedonensischer Theologie fest: Niketas von Byzanz (Anfang 10. Jh.) auf byzantinischer Seite und der syrische Patriarch Timotheus I. (728-823) auf der Seite der Nichtchalcedonenser. Die polemischen Ausführungen des Niketas über „den Gott des Islams“ hätten zwar dazu beigetragen, dass die in der byzantinischen Abschwörungsformel für Muslime übliche Verfluchung des „Gottes des Islams“ in einen Fluch über Muhammad umgewandelt worden sei (wegen der von Kaiser Romanos – allerdings erst mehr als 200 Jahre später – aufgenommenen Befürchtung, mit der bis dahin üblichen Formulierung werde Gott gelästert), in der abgewandelten Fluchformel spiegele sich allerdings auch eine Sorge des Niketas, der den Islam als einen Versuch angesehen habe, die christliche Religion zu zerstören, für den Muhammad die Hauptverantwortung trage. Anders, so Schumann, Patriarch Timoetheus: Dessen Überlegungen zu der Frage, ob Jesus (wie im Koran) als „´abd Allāh“ (Knecht Gottes) bezeichnet werden dürfe (was der Patriarch nur in metaphorischer Redeweise als erlaubt ansah), zeichneten sich u. a. durch die gute Beherrschung auch der Begriffe und Kategorien islamischer Theologie aus und seien als ein Versuch zu bewerten, durch Inanspruchnahme auch koranischer bzw. islamischer Vorstellungen und Aussagen die christlichen Lehren zu untermauern – viel hänge von der Interpretation ab, einen kategorischen Gegensatz könne man aus diesen Ausführungen nicht ableiten. In nächsten Teil des Vortrags über die lateinische Kirche und den Islam ging Schumann kurz auf die ersten Begegnungen zwischen der lateinischen Oberschicht Nordafrikas mit den Muslimen, und ausführlicher auf die Situation in Spanien vor, während und nach der Eroberung der Halbinsel durch die Araber ein. Einen für die Beantwortung der Frage, wie es von der convivencia in al-Andalus zur reconquista kam, wichtigen Aspekt sah Schumann darin, dass die Lateiner anders als die „Mozaraber“ (arab. musta´ribūn, die spanischen Christen, die arabisch zu sprechen begannen) offenbar wenig Anteil an der vielfach erwähnten convivencia gehabt hätten, und es bei ihnen schon im neunten Jahrhundert, also lange vor den Kreuzzügen, Befürworter einer offenen Konfrontation mit den arabischen Herrschern gegeben habe, was er mit dem Hinweis auf erste Hinrichtungen im Jahre 859 belegte. Breiten Raum nahmen Schumanns Ausführungen zu Nikolaus von Kues (1401-1464) ein, in dessen Cribatio Alchorani („Aussiebung des Korans“) er im Unterschied zur Koranübersetzung und den Schriften zum Koran und Islam des Petrus Venerabilis bzw. Robert von Ketton nicht den Versuch sah, koranische Fehler und Verdrehungen beweisen zu wollen, sondern die Wahrheit des Evangeliums auch aus dem Text des Korans ersichtlich werden zu lassen. Hierbei sei ein neuer Ton vernehmbar geworden, wenn der Cusaner davon ausgehe, dass im Koran Gutes und Wahres zu finden sei, und dieser nicht von Muhammad mit niederen Vorsätzen oder von bösem Willen motiviert verfasst worden sei. Für die Reformation konstatierte Schumann, dass sie im Blick auf eine Wahrnehmung des Islam als eigenständige Religion und Respektierung derselben trotz theologischer Unterschiede und Gegensätze keinen eigentlichen Fortschritt gebracht habe, wenngleich sich die Haltungen der einzelnen Reformatoren zum Islam durchaus voneinander unterschieden hätten. Während Philipp Melanchthons Eifer gegen alles Häretische auch seine harte Haltung gegenüber dem Islam (von dem er wohl nur sehr rudimentäre Kenntnisse hatte) geprägt habe, stellte Schumann bei Martin Luther vor 5/9 Identität durch Differenz? Zur Rolle der wechselseitigen Abgrenzungen in Christentum und Islam Stuttgart-Hohenheim, 03.03.2006 - 05.03.2006 allem in dessen jüngeren Jahren durchaus eine Anerkennung von positiven Zügen im Leben und auch in der Ethik und Frömmigkeit der Muslime fest. Für ihn seien die Muslime wie auch die Juden keine Heiden, da ihnen die Botschaft von der bedingungslosen Gnade Gottes nicht unbekannt sei. Die Einordnung des islamischen Glaubens als eine Zurückweisung Gottes, wie er sich selbst offenbart hat (deus revelatus), und als der Versuch, aus eigenen Kräften einen Zugang zu Gott zu finden, erlaube ihnen nach Luther zwar eine Begegnung mit Gott, aber nur in der Weise des deus absconditus oder ihres eigenen Bildes von Gott. Vor einer Drucklegung der auf Petrus Venerabilis zurückgehenden lateinischen Übersetzung des Korans, die diese einer breiteren Leserschaft zugänglich machen würde, habe Luther – anders als manche seiner Zeitgenossen – nicht nur keine Angst gehabt, vielmehr habe er sie ausdrücklich unterstützt. Mit einem Sprung in das 20. Jahrhundert kam Schumann auf das II. Vatikanische Konzil zu sprechen, insbesondere auf die Konzilserklärung Nostra Aetate, mit der ein Neubeginn in der Bestimmung des Verhältnisses der Kirche (zunächst der katholischen, dann aber auch der großen christlichen Kirchen insgesamt) zum Islam markiert worden sei. Neben anderen Punkten stellte Schumann heraus, dass die Suchrichtung sich im Vergleich zu früheren Zeiten quasi umgekehrt habe: der gemeinsame Nenner sei gesucht worden, nicht die Unterschiede, und das, was als „gemeinsam“ aufgelistet worden sei, sei nicht wenig. Deutlich werde diese Umkehrung der Suchrichtung u. a. an der Beobachtung, dass in Nostra Aetate das arabische Wort „Allāh“ übersetzt worden sei – wodurch zum Ausdruck gebracht worden sei, dass auch die Muslime es mit Gott zu tun haben. Hiermit sei, so Schumann, in gewisser Hinsicht das Anliegen des Niketas von Byzanz aufgenommen worden, der die Sorge hatte, dass Verschmähungen Allāhs letztlich nichts anderes seien als eine auch für Christen verbotene Gotteslästerung. Ein Ausblick auf neuere Stimmen aus dem Protestantismus zum Islam (Hendrik Kraemer und Emmanuel Kellerhals), vor allem im Hinblick auf die Frage nach der Möglichkeit einer christlichen Anerkennung des prophetischen Anspruchs Muhammads, schloß Schumann seinen rasanten Überblick über die Geschichte der christlichen Beschäftigung mit dem Islam. In seiner Erwiderung stellte Prof. Dr. Tahsin Görgün (Frankfurt) fest, dass es den Christen ganz offensichtlich nicht leicht gefallen sei, den Islam als eigenständige Religion anzuerkennen. Vier Haltungstypen grenzte er hierbei voneinander ab: a) die Betrachtung des Islam als christliche Häresie (u. a. Johannes von Damaskus); b) die Ausklammerung von inhaltlichen Fragen zu Gunsten eines Streits über die Person Muhammads (z. B. Niketas v. Byzanz), oft verbunden mit dem Vorwurf, dass dieser die erhaltenen Lehren pervertiert habe; c) eine gemeinsame Anerkennung bestimmter rationaler Prinzipien, ein friedliches Zusammenleben, die Herausarbeitung der Unterschiede durch Hinweise auf Gemeinsamkeiten (Patriarch Timotheus, II. Vatikanum); d) die Bekämpfung der Muslime als politische Gegner, entweder mit (Kreuzzüge) oder ohne Schwert (Übersetzung des Koran in der Zeit der Kriege gegen die Osmanen). Görgün machte sich stark für eine Ethik des Gesprächs, in der es um Anerkennung des anderen, den Verzicht auf Zwang im Glauben sowie einen Wettstreit um gute Taten gehe. Im sich anschließenden „offenen Forum“ gab es vor allem für Nachwuchswissenschaftler/innen die Gelegenheit, aktuelle Forschungsvorhaben oder Projekte zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. So präsentierte z. B. Dr. Markus Kneer (Hamm) sein Habilitationsvorhaben zum Thema „ ‚Person’ als Konzept koranischer Anthropologie? Zur Religionsphilosophie M. A. Lahbabis (19221993)“, und Dr. Anja Middelbeck-Varwick (Berlin) stellte ihre Dissertation zum Thema „Die Grenze zwischen Gott und Mensch. Eine Skizze zur Theodizee in Islam und Christentum“ vor. Nach dem „offenen Forum“ folgten drei zeitgleich stattfindende „thematische Foren“ mit Kurzreferaten, Textarbeit und Diskussion. Im ersten Forum, das unter der Überschrift „Koranische/bibilische Abgrenzungen und ihre Wirkungsgeschichte“ stand, referierten Prof. Dr. Ömer Özsoy (Ankara) zum Thema „Leute der Schrift oder Ungläubige? Abgrenzungen gegenüber 6/9 Identität durch Differenz? Zur Rolle der wechselseitigen Abgrenzungen in Christentum und Islam Stuttgart-Hohenheim, 03.03.2006 - 05.03.2006 Christen im Koran“ und Prof. Dr. Stefan Schreiner (Tübingen) zum Thema „Abgrenzungen in biblischen Texten und ihre Instrumentalisierung zur Abgrenzung gegenüber dem Islam“. Das zweite Forum stand unter der Überschrift „Die Kreuzzüge und ihre Rezeption als Beispiel für historische Abgrenzungen“. Prof. Dr. Peter Antes (Hannover) sprach zum Thema „Kreuzzüge: Theorie und Praxis“, und Thomas Würtz (Zürich) hatte seine Ausführungen unter das Thema „Die Kreuzzüge zwischen geschichtlicher Wirklichkeit und ideologischer Darstellung“ gestellt. Im dritten Forum ging es um „Fundamentalistische Abgrenzungsdiskurse in Christentum und Islam“. Hier sprachen Dr. Bekim Agai (Bonn) über „Abgrenzung vom Christentum und Polemik gegen alternative Islaminterpretationen in fundamentalistischen Diskursen des Islams“ und Prof. Dr. Grit Klinkhammer (Bremen) über „Abgrenzung vom Islam in fundamentalistischen Diskursen des Christentums“. Das vierte und letzte Hauptreferat der Tagung hielt Prof. Dr. Assaad Elias Kattan (Münster), dessen „Überlegungen zu einer weniger abgrenzenden Identitätsbestimmung“ er unter das Thema „Trennende Differenz vs. versöhnende Synthese?“ gestellt hatte, womit er die anfangs von Schmid gestellten Leitfragen, die die verschiedenen Beiträge und Diskussionen der Tagung durchzogen hatten, noch einmal aufgriff. Ausgehend von den Analysen René Girards zu Gewalt zwischen rivalisierenden Menschen oder Gruppen, denen zufolge Gewalt aus gescheitertem mimetischem Verhalten hervorgehen könne, schlug Kattan als ein mögliches Paradigma zur Erschließung des Verhaltens von Religionen vor, diese anthropologisch zu deuten, also weniger als bestehende Systeme aufzufassen, sondern sie vielmehr mit lebenden Personen zu vergleichen, da jede Religion eine von Menschen getragene Größe sei. Die gewählte anthropologische Herangehensweise wandte Kattan auch auf die Rivalitätserscheinungen zwischen den Religionen an, deren Konkurrenzverhältnis, das zum Hervorrufen von gewalttätigen Konflikten in der Lage sei, durch primäre Ähnlichkeit bedingt sei. Die entsprechenden Kräfte würden, so deutete Kattan an, beim Ausbleiben von expliziten Gewalttaten von Religionen derart funktionalisiert, dass sich die eine von der ihr in vielfacher Hinsicht ähnlichen, die gerade deshalb in einem Konkurrenzverhältnis zu ihr stehe, bewusst abgrenze. Dies diene nicht nur zur Definition oder Stärkung der eigenen Identität einer Religion, sondern auch zur Verschleierung der ursprünglichen Verwandtschafts- oder Ähnlichkeitsrelation verschiedener Religionen. Dem Dialog zwischen den Religionen wies Kattan daher eine hohe Bedeutung zu, führe dieser doch meistens dazu, die Unterschiede zwischen den Religionen neu zu bewerten, indem der kritische Blick des anderen bewirke, dass Aspekte der eigenen Tradition in einem anderen Licht erschienen und neu auf ihre Sachgemäßheit hin befragt würden. Ausgehend von der Vision einer Symphonie der Religionen, die Kattan anfangs durch ein Zitat von Ulrich Schön andeutete, versuchte er abschließend, ein religiöses Identitätsbestimmungsmodell zu skizzieren, in dem die Unterschiede nicht als trennende Differenzen fungieren müssen. Wenn es gelinge, das Spezifikum der je eigenen Religion in einem weniger essentialistischen Sinne zu begreifen, sondern vielmehr in der kreativen Synthese, die aus dem Zusammenkommen zahlreicher Elemente resultiere, werde das Neue, Kreative, Fruchtbringende, das einer Religion ihre Einmaligkeit verleihe, besser sichtbar, als bei der Auffassung von verschiedenen Religionen als einander gegenüberstehenden essenzialistischen und monolithischen Blöcken. Keineswegs gehe es hierbei darum, Besonderheiten einzelner Religionen zu leugnen oder ihnen abzuerkennen. So stelle z. B. der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus von Nazareth das Besondere des Christentums und seinen Hauptunterschied zu den restlichen Weltreligionen dar. Im Bild der Symphonie lasse sich aber, so Kattan, dies folgendermaßen formulieren: In der einmaligen Melodie, die das Christentum spiele, komme dem musikalischen Motiv Jesus von Nazareth eine führende Bedeutung zu. Wenn es nun den Religionen gelinge, unter Verwendung der ihnen eigenen Motive neue Melodien zu spielen, indem sie neue Wege der Identitätsbestimmung wagten, so dass versöhnende Synthesen möglich würden, dann sei dem Erklingen einer Symphonie, die aus der Synthese der Melodien der verschiedenen Religionen entstehe, hoffnungsvoll entgegen zu blicken. Bei der anschließenden Abschlussdiskussion, in der es um die Suche nach neuen Perspektiven für eine Verhältnisbestimmung von Islam und Christentum ging, wurde unter anderem die Frage nach einer 7/9 Identität durch Differenz? Zur Rolle der wechselseitigen Abgrenzungen in Christentum und Islam Stuttgart-Hohenheim, 03.03.2006 - 05.03.2006 gemeinsamen Hermeneutik für Muslime und Christen gestellt. Prof. Kalisch gab hierbei zu bedenken, dass eine gemeinsame Hermeneutik beim Umgang mit den jeweiligen Heiligen Schriften zwar bis zu einem gewissen Grad möglich sei, aber bestimmte Differenzen bestünden: so sei nach dem jeweiligen Selbstverständnis der beiden Religionen der Koran an eine einzige Person geoffenbart worden, die Bibel hingegen an mehrere Generationen. Dies sei beim Umgang mit den jeweiligen Schriften zu berücksichtigen – was eine historisch-kritische Koranforschung allerdings nicht ausschließe, wie Kalisch ausdrücklich betonte. Prof. Schumann gab zu bedenken, dass eine gemeinsame christlichmuslimische Hermeneutik auch zu Vergewaltigungen führen könne – eine gemeinsame Interpretation von Koran und Bibel sei aber möglich. Die unterschiedliche Ausgangslage für eine theologisch fundierte Verhältnisbestimmung brachte Prof. Görgün zur Sprache: so sei christliche Theologie an vielen europäischen Hochschulen fest etabliert, eine islamische Theologie in einer europäischen Sprache fehle aber noch weitestgehend. Die Frage, ob für neue Identitätsbestimmungen Begriffe der jeweiligen dogmatischen Traditionen aufgegeben werden könnten, wurde von Prof. Schumann gestellt. So könnten Probleme, die von historisch belasteten und missverständlichen und missverstandenen Begriffen ausgingen, vermieden werden, gleichzeitig müsse aber sichergestellt werden, dass die mit den jeweiligen Begriffen gemeinten Inhalte nicht verloren gingen. Prof. Kalisch wies darauf hin, dass Abgrenzungskonzepte auch immer mit dem jeweiligen Gottesbild zu tun hätten. Mit der Frage, welches Interesse Gott daran haben sollte, dass Christen und Muslime sich gegenseitig bekämpfen, verwies er auf den theologischen Kern der Diskussion. Um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser perspektivenreichen und in vielfacher Hinsicht anregenden Tagung den Abschied zu erleichtern, verwies Prof. Kattan gleichsam abschließend auf ein Wort des Johannes Chrisosthomos, der den Alltag, in den die einzelnen nun wieder aufzubrechen hätten, als „Liturgie nach der Liturgie“ bezeichnet habe. Dass ein solcher neuer Aufbruch nach den vielen vertiefenden und bereichernden Gesprächen vor, während und nach den offiziellen Programmpunkten der Tagung lohnenswert ist, war am Ende nicht nur die Ansicht von Prof. Kattan. Angaben zum Verfasser: Bernd Mussinghoff, Dipl.-Theol., ist wissenschaftlicher Referent am Institut für Theologie und Frieden, Hamburg, und arbeitet an einem Dissertationsprojekt über islamische Friedensethik. 8/9 Identität durch Differenz? Zur Rolle der wechselseitigen Abgrenzungen in Christentum und Islam Stuttgart-Hohenheim, 03.03.2006 - 05.03.2006 Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor des Textes. Eine Stellungnahme der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieses Textes nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernommen werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um entsprechende Mitteilung. Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart Im Schellenkönig 61 70184 Stuttgart DEUTSCHLAND Telefon: +49 711 1640-600 E-Mail: [email protected] 9/9