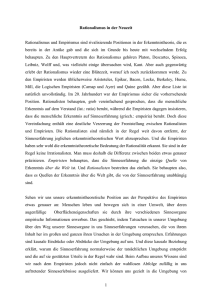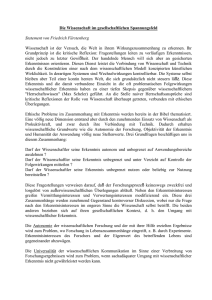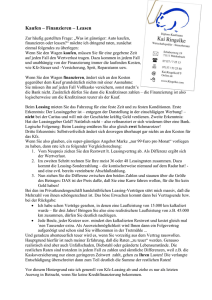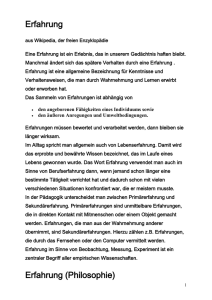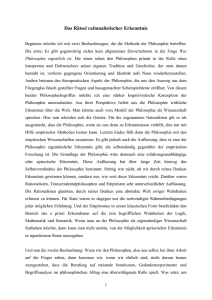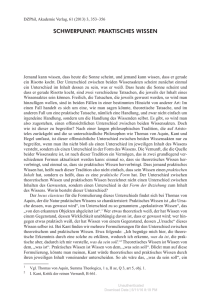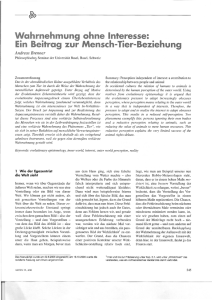Rationalismus in der Neuzeit - UK
Werbung
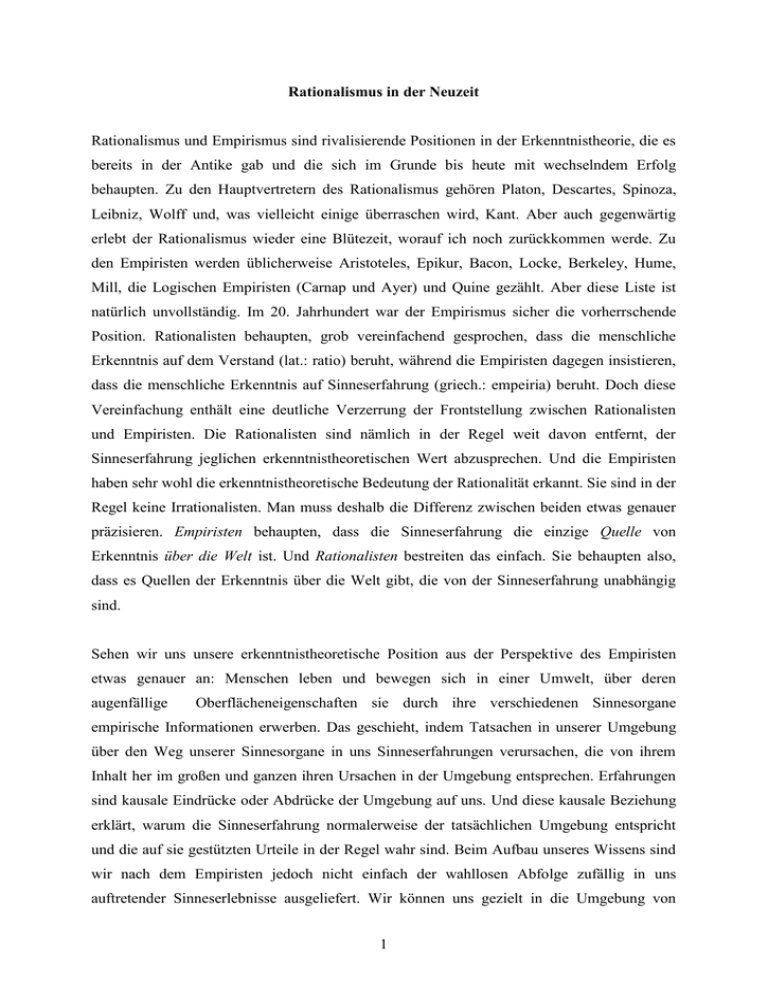
Rationalismus in der Neuzeit Rationalismus und Empirismus sind rivalisierende Positionen in der Erkenntnistheorie, die es bereits in der Antike gab und die sich im Grunde bis heute mit wechselndem Erfolg behaupten. Zu den Hauptvertretern des Rationalismus gehören Platon, Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff und, was vielleicht einige überraschen wird, Kant. Aber auch gegenwärtig erlebt der Rationalismus wieder eine Blütezeit, worauf ich noch zurückkommen werde. Zu den Empiristen werden üblicherweise Aristoteles, Epikur, Bacon, Locke, Berkeley, Hume, Mill, die Logischen Empiristen (Carnap und Ayer) und Quine gezählt. Aber diese Liste ist natürlich unvollständig. Im 20. Jahrhundert war der Empirismus sicher die vorherrschende Position. Rationalisten behaupten, grob vereinfachend gesprochen, dass die menschliche Erkenntnis auf dem Verstand (lat.: ratio) beruht, während die Empiristen dagegen insistieren, dass die menschliche Erkenntnis auf Sinneserfahrung (griech.: empeiria) beruht. Doch diese Vereinfachung enthält eine deutliche Verzerrung der Frontstellung zwischen Rationalisten und Empiristen. Die Rationalisten sind nämlich in der Regel weit davon entfernt, der Sinneserfahrung jeglichen erkenntnistheoretischen Wert abzusprechen. Und die Empiristen haben sehr wohl die erkenntnistheoretische Bedeutung der Rationalität erkannt. Sie sind in der Regel keine Irrationalisten. Man muss deshalb die Differenz zwischen beiden etwas genauer präzisieren. Empiristen behaupten, dass die Sinneserfahrung die einzige Quelle von Erkenntnis über die Welt ist. Und Rationalisten bestreiten das einfach. Sie behaupten also, dass es Quellen der Erkenntnis über die Welt gibt, die von der Sinneserfahrung unabhängig sind. Sehen wir uns unsere erkenntnistheoretische Position aus der Perspektive des Empiristen etwas genauer an: Menschen leben und bewegen sich in einer Umwelt, über deren augenfällige Oberflächeneigenschaften sie durch ihre verschiedenen Sinnesorgane empirische Informationen erwerben. Das geschieht, indem Tatsachen in unserer Umgebung über den Weg unserer Sinnesorgane in uns Sinneserfahrungen verursachen, die von ihrem Inhalt her im großen und ganzen ihren Ursachen in der Umgebung entsprechen. Erfahrungen sind kausale Eindrücke oder Abdrücke der Umgebung auf uns. Und diese kausale Beziehung erklärt, warum die Sinneserfahrung normalerweise der tatsächlichen Umgebung entspricht und die auf sie gestützten Urteile in der Regel wahr sind. Beim Aufbau unseres Wissens sind wir nach dem Empiristen jedoch nicht einfach der wahllosen Abfolge zufällig in uns auftretender Sinneserlebnisse ausgeliefert. Wir können uns gezielt in die Umgebung von 1 Objekten versetzen, die uns interessieren, und wir können mit ihnen durch Experimente auf gezielte Weise interagieren, so dass uns unsere Erfahrung auf vorgefasste Fragen Antworten geben kann und das Testen bestimmter Annahmen über unsere Umgebung ermöglicht. Die Ergebnisse können wir systematisch sammeln, so dass wir auf diese Weise zu einem immer umfassenderen Wissen über unsere Umwelt gelangen. Empiristen bleiben jedoch nicht bei Erkenntnissen stehen, die sie direkt auf die Sinneserfahrung stützen können. Und genau an dieser Stelle kommt der Verstand ins Spiel. Mit Hilfe von logisch gültigen Schlüssen können wir Informationen, die in unserem unmittelbaren Wahrnehmungswissen enthalten sind, weiter verarbeiten und abstrahieren. Wir können durch die Überprüfung der Konsistenz unserer unmittelbar auf Erfahrung gestützten Überzeugungen untersuchen, ob sich Fehler in unser Überzeugungssystem eingeschlichen haben. Und wir können durch logische Schlüsse die Konsequenzen sichtbar machen, die eine Hypothese für die Erfahrung hat, und diese Hypothese so an der Erfahrung überprüfen. In allen diesen Fällen dient der Verstand der Verarbeitung gegebener sinnlicher Information, aber er ist keine eigenständige Quelle von Informationen und Erkenntnissen über die Welt. Wenigstens ist das die Auffassung des Empiristen. Doch halt, ist das überhaupt richtig? Was ist mit Erkenntnissen der folgenden Art: „Wenn die Aussage p wahr ist und die Aussage wenn p, dann q, dann muss auch die Aussage q wahr sein“ „Junggesellen sind unverheiratete Männer (wenn diese erwachsen und nicht verwitwet sind)“ „2+2=4“ Im ersten Fall haben wir es mit dem logischen Schlussprinzip des modus ponens zu tun, im zweiten Fall mit einem klassischen Beispiel eines analytischen Satzes und im dritten Fall mit einer mathematischen Wahrheit. Natürlich könnte man sagen (und einige Empiristen haben sogar versucht, so etwas zu sagen), dass wir die Wahrheit dieser Aussagen empirisch erkennen. Dass Junggesellen unverheiratet sind, kann man natürlich auch dadurch herausfinden, dass man sich die Leute, die Junggesellen sind, genauer ansieht und das Ergebnis induktiv verallgemeinert. Und dass 2 plus 2 gleich 4 ist kann man auch dadurch erkennen, dass man es empirisch an seinen Fingern abzählt. Tatsächlich erkennen wir logische, analytische und mathematische Wahrheiten jedoch unabhängig von der Erfahrung. Es genügt, dass wir die durch die Sätze ausgedrückten Gedanken vollständig verstehen, um unmittelbar einzusehen, dass sie wahr sind. Es bedarf keiner zusätzlichen empirischen Gründe dazu. Dieses unmittelbare Einleuchten eines Gedankens aus sich selbst heraus nennt man auch 2 „Selbstevidenz“. Diese Selbstevidenz unterscheidet einen Gedanken wie „2+2=4“ von dem Gedanken, dass sich vor mir viele Zuhörer befinden. Den letzteren Gedanken kann ich verstehen, ohne dass mir seine Wahrheit einleuchtet. Ich bedarf zusätzlicher empirischer Belege, um einen Grund zu haben, diesen Gedanken für wahr zu halten. Er ist also nicht selbstevident, sondern wird durch eine entsprechende Wahrnehmung evident gemacht. Die allermeisten Empiristen (ich möchte sie als gemäßigte Empiristen bezeichnen) akzeptieren, dass logische, analytische und mathematische Urteile selbstevident sind, dass sie also keiner empirischen Begründung bedürfen, sondern eine erfahrungsunabhängige oder apriorische Quelle (im Verstand) haben. Was, so werden Sie sich jetzt vielleicht fragen, unterscheidet diese Empiristen dann noch von ihren Gegnern, den Rationalisten? Offenbar räumen sie doch ein, dass der Verstand eine Quelle von Erkenntnis sein kann. Entscheidend ist hier, dass die gemäßigten Empiristen bestreiten, dass die selbstevidenten, apriorischen Erkenntnisse sich auf die Welt beziehen. Es handelt sich ihrer Meinung nach um bloße Tautologien, deren Wahrheit nicht von den Tatsachen in der Welt abhängt, sondern nur von der Bedeutung der in den Gedanken enthaltenen Begriffe. Was ein Urteil wie „Junggesellen sind unverheiratete Männer“ wahr macht ist die Tatsache, dass der Ausdruck „Junggeselle“ dasselbe bedeutet wie „unverheirateter Mann“. Und dass 2+2 als Ergebnis 4 hat folgt aus der Definition der Zahl „2“ und der Definition des Pluszeichens. Auch logische Wahrheiten enthalten danach keine Informationen, die über die in ihren Begriffen enthaltene Information hinausgeht. Diese Tatsache erklärt auch, warum wir die Wahrheit der Gedanken allein aufgrund unseres Verstehens dieser Gedanken erfassen können. Der gemäßigte Empirist ist also gar kein entschiedener Gegner erfahrungsunabhängiger (apriorischer) Erkenntnis, sondern er hält nur die Idee für mysteriös, dass wir durch bloßes Nachdenken erkennen können, wie die Welt um uns herum beschaffen ist. Wie sollte das auch möglich sein? Anders als im Fall der Sinneswahrnehmung fehlt uns offenbar ein Organ intellektueller Wahrnehmung. Und selbst wenn wir ein solches intellektuelles Sensorium besäßen, bliebe rätselhaft, wie logische Gesetze oder mathematische Tatsachen, wenn sie als objektive Entitäten außer uns verstanden werden, kausal auf dieses Sensorium einwirken sollten. Solche abstrakten Entitäten existieren sicher nicht im Bereich unserer natürlichen Welt. Wir aber sind ein Teil dieser natürlichen Welt. Nimmt man nun an, dass die natürliche Welt kausal geschlossen ist (d.h. jede Wirkung in der natürlichen Welt eine Ursache in der natürlichen Welt hat), dann ist es geradezu ausgeschlossen, dass abstrakte Tatsachen in diese 3 natürliche Welt hineinwirken. Platos Rationalismus liegt die Idee einer intellektuellen Wahrnehmung zugrunde. Er glaubte, dass wir unser Wissen von den Ideen durch Erinnerung (anamnesis) gewinnen können. Eine solche Erinnerung setzt aber einen vorgeburtlichen Wahrnehmungskontakt der Seele mit den Ideen voraus. Eine solche intellektuelle Wahrnehmung erweist sich nun aber als hölzernes Eisen. Der gemäßigte Empirist lehnt also rationalistisches Wissen von der Welt ab, weil er es für vollkommen unerklärbar hält. Der neuzeitliche Rationalismus seit Descartes lässt sich nun als Reaktion auf diese empiristische Skepsis gegenüber rationalistischem Wissen über die Welt verstehen. Die neuzeitlichen Rationalisten haben zum einen zu zeigen versucht, dass ein solches erfahrungsunabhängiges, apriorisches Wissen über die Welt unverzichtbar ist: unverzichtbar als Fundament unseres empirischen Wissens über die Welt, so dass ein Zweifel am Rationalismus letztlich zu einem globalen Skeptizismus führen würde, der auch das vom Empiristen hoch gehaltene empirische Wissen beträfe; unverzichtbar aber auch als Grundlage für zentrale Bereiche unseres philosophischen Wissens. Diese Unverzichtbarkeitsargumente werden flankiert von alternativen Erklärungsversuchen rationalistischer Erkenntnis über die Welt, die ohne die Annahme intellektueller Wahrnehmung auskommen. Beides – die Unverzichtbarkeitsargumente sowie die Erklärungsversuche rationalistischen Wissens – möchte ich mir in der verbleibenden Zeit mit Ihnen gemeinsam genauer ansehen. Zu Beginn der Neuzeit ist es der Rationalist Descartes gewesen, der das erste Unverzichtbarkeitsargument für erfahrungsunabhängiges Wissen über die Welt formuliert hat. Ich werde sein Argument „Gewissheitsargument“ nennen: (1) Wissen im strengen Sinne erfordert Gewissheit. (2) Erfahrung gibt uns keine Gewissheit. (3) Wir haben Wissen. Also: Es muss erfahrungsunabhängige Quellen der Gewissheit geben (also rationalistische Erkenntnis). Nach Descartes liegt Gewissheit vor, wenn wir jede Möglichkeit eines Irrtums ausschließen können. Für Wissen ist Gewissheit erforderlich, weil die Wahrheit einer Meinung solange zufällig bleibt, solange nicht alle Irrtumsmöglichkeiten ausgeschlossen sind. Und bloß zufällig wahre Meinungen bilden kein Wissen. Das kann man sich an einem simplen Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie würden mit Ihrem Auto bei herrlichem Wetter und klarer Sicht durch eine ländliche Gegend Niederbayerns fahren. Sie sehen neben der Straße in 4 regelmäßigen Abständen Scheuen stehen. Jetzt ist es gerade wieder soweit und sie sagen zu Ihrer Beifahrerin „Dort drüben steht eine Scheune“. Wissen Sie es? Nehmen wir einmal an, das Gebäude, auf das Sie hinweisen, ist wirklich eine Scheune, dann sagen Sie etwas Wahres und Sie sind aufgrund Ihrer Sinneserfahrung auch berechtigt zu dieser Behauptung. Nehmen wir jetzt aber einmal zusätzlich an, dass diese Scheune (ohne dass Sie es bemerken) die einzige echte Scheune in der Umgebung ist. Bei allen anderen Gebäuden handelt es sich in Wirklichkeit um bloße Scheunenattrappen, die allein aus einer Vorderfront bestehen und für eine Filmproduktion aufgebaut worden sind. In diesem Fall hätten Sie nur zufällig die Wahrheit getroffen, sie hätten sich sehr leicht täuschen können, denn jede der so täuschend echt aussehenden Attrappen hätten Sie für eine echte Scheune gehalten. Wenn das so wäre, würden wir nicht sagen, dass Sie Wissen haben, wenn Sie einmal zufällig die Wahrheit treffen. Wissen schließt also Irrtumsmöglichkeiten aus. Nun ist ebenfalls klar, dass unsere Sinne uns leicht täuschen können: durch Illusionen, Halluzinationen oder – so inszeniert Descartes den Fall – wenn uns ein böser Dämon permanent irreführende Sinneserfahrungen vorgaukelt (die moderne Fassung dieses Täuschungsszenarios bietet uns der Film „Die Matrix“). Wenn wir also überhaupt Wissen haben, dann nur durch erfahrungsunabhängige Quellen, die den Status der Gewissheit erfüllen. Für Descartes leistet das klare und deutliche rein intellektuelle Erscheinen der Wahrheit im Falle von selbstevidenten Gedanken, die uns unmittelbar so sehr einleuchten, dass wir gar nicht anders können, als an die Wahrheit dieser Gedanken zu glauben. Doch sind solche selbstevidenten Gedanken tatsächlich gewiss im Sinne von Descartes? Ich denke, hier muss die Antwort ganz klar „nein“ lauten. Auch wenn uns die Wahrheit noch so sehr psychologisch als unausweichlich erscheint, ist es immer noch möglich, dass uns ein böser Dämon auch in den Gedanken täuscht, die für uns selbstevident sind. Descartes’ Versuch, diese Möglichkeit auszuschließen, indem er beweist, dass es für uns selbstevident ist, dass ein guter nichtbetrügerischer Gott existiert, mündet in einen grandiosen Zirkel, der die Gewissheit selbstevidenter Einsicht bereits voraussetzt. Es ist sogar nicht nur möglich, sondern kommt tatsächlich immer wieder vor, dass sich selbstevidente Gedanken als falsch herausstellen. Lange hat man die Axiome der Euklidischen Geometrie oder der klassischen Aristotelischen Logik für unangreifbar gehalten. Aber Einsteins Relativitätstheorie hat empirisch gezeigt, dass eine Gerade nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten im Raum ist. Und Freges Quantorenlogik hat die Aristotelische Logik abgelöst. Es gibt also selbst in den apriorischen Grundlagen der Logik und Mathematik Fortschritt und Revision. Außerdem 5 beweisen die vielen Paradoxien, dass es Widersprüche zwischen selbstevidenten Annahmen gibt und deshalb nicht alle wahr sein können. Rationalistisch gestützte Überzeugungen sind also weder cartesianisch gewiss noch immer wahr. Das bedeutet nicht, dass es apriorische Quellen der Erkenntnis über die Welt nicht gibt. Aber es bedeutet, dass diese Erkenntnis keinesfalls den Status der Gewissheit hat. Das Gewissheitsargument ist demnach kein gutes Argument für die Existenz apriorischer Erkenntnis. Übrigens bedeutet das Fehlen cartesianischer Gewissheit nicht automatisch, dass ein globaler Skeptizismus (der jegliches Wissen leugnet) Recht behält. Im Gewissheitsargument ist nämlich die Prämisse (1) falsch („Wissen im strengen Sinne erfordert Gewissheit“). Es ist zwar richtig, dass Wissen nur dann vorliegt, wenn die Wahrheit der gerechtfertigten Meinung nicht zufällig ist. Dass die Wahrheit zufällig ist, lässt sich jedoch auf zwei unterschiedliche Weisen verstehen. Wir können die Wahrheit einer Meinung zum einen als zufällig bezeichnen, solange Irrtum denkbar ist. Zum anderen können wir aber dieses Prädikat auch den Meinungen vorbehalten, die – so wie die Welt tatsächlich aussieht – auch falsch sein könnten. Im ersten Fall bemisst sich der Zufall an den von uns ins Spiel gebrachten Denkmöglichkeiten. Im zweiten Fall an den Möglichkeiten, die durch die Tatsachen offen gelassen werden. Sieht man genauer hin, dann schließt der Wissensbegriff nur aus, dass ein Irrtum real möglich gewesen wäre. Dafür ist jedoch Gewissheit im cartesianischen Sinne (die jeden denkmöglichen Irrtum ausschließt) nicht erforderlich. Wissen lässt sich demnach auch ohne Gewissheit behaupten. Sehen wir uns ein weiteres Unverzichtbarkeitsargument an: das Regressargument. Das Argument lautet folgendermaßen: (1) Eine Quelle kann eine Meinung normalerweise nur dann rechtfertigen (oder Wissen generieren), wenn ihre Zuverlässigkeit durch eine Meinung höherer Ordnung autorisiert wird, deren Rechtfertigung sich aus einer anderen Quelle speist. (2) Daraus ergibt sich ein Regress der Metarechtfertigung. (3) Dieser Regress kann nur durch Meinungen gestoppt werden, deren Rechtfertigung keiner Autorisierung höherer Ordnung bedarf. (4) Selbstevidente Meinungen sind die einzigen Meinungen, die ohne Autorisierung höherer Ordnung gerechtfertigt sind und die Zuverlässigkeit anderer Erkenntnisquellen rechtfertigen können. Also: Es gibt gerechtfertigte Meinungen nur, wenn es selbstevidente Meinungen gibt. 6 Dieses Argument ist bereits in Aristoteles Antwort auf das antike Problem des Kriteriums enthalten, so wie sie sich in den Zweiten Analytiken abzeichnet. Es spielt aber auch eine Rolle bei Descartes und feiert seinen zweiten Frühling in der gegenwärtigen Renaissance des Rationalismus (etwa bei Laurence BonJour). Die dahinter stehende Grundidee ist schlicht die folgende: Damit etwa meine Sinneserfahrung, dass vor mir ein Tisch steht, mich in meiner Überzeugung, dass vor mir ein Tisch steht, rechtfertigen kann, muss die Sinneserfahrung nicht nur besagen, dass vor mir ein Tisch steht, sondern ich muss auch erkennen, dass die Sinneserfahrung, auf die ich mich stützte, zuverlässig die Wahrheit indiziert. Um das zu erkennen, brauche ich eine Erkenntnis höherer Ordnung über die Zuverlässigkeit meiner Wahrnehmung usw. Der sich abzeichnende Regress darf nur abgebrochen werden, wenn es Quellen der Rechtfertigung gibt, die ihre eigene Zuverlässigkeit verbürgen und deshalb keiner höheren Autorisierung bedürfen. Und genau das sollen – aus der Perspektive des Rationalisten – selbstevidente Gedanken leisten. Doch können selbstevidente Gedanken das halten, was sie versprechen? Dafür müssen wir uns das Phänomen der Selbstevidenz etwas genauer ansehen. Rationalisten beschreiben die Sache in etwa folgendermaßen: Wenn ich mir überlege, ob etwa der Gedanke „Alles ist mit sich selbst identisch“ wahr ist, dann komme ich ohne weitere Gründe zu dem Urteil, dass es sich so verhalten muss, wie der Gedanke sagt. Ich komme also zu dem Ergebnis, dass alles notwendigerweise mit sich selbst identisch ist. Doch wenn es mit sich selbst identisch sein muss, dann ist die Wahrheit des Gedankens im höchsten Grade wahrscheinlich. Und deshalb braucht man keine höhere Autorisierung, um den Inhalt des Gedankens gerechtfertigt zu glauben. Wenigstens behauptet das der Rationalist. Ich glaube jedoch, dass es sich hier um einen Fehlschluss handelt. Selbstevidente Zustände besagen, dass sich etwas notwendigerweise auf eine bestimmte Weise verhält. Sie beziehen sich also von ihrem Inhalt her auf notwendige Tatsachen – Tatsachen, die unter allen Umständen so wären, wie sie sind. Daraus folgt jedoch nichts über die Zuverlässigkeit selbstevidenter Zustände: Aus: (1) Notwendig p folgt nicht: (2) Für alle p, notwendigerweise (wenn p selbstevident ist, dann p). Und deshalb ist die Einsicht in die Notwendigkeit einer Tatsache nicht automatisch ein guter Grund für die Zuverlässigkeit dieser Einsicht. Kurz: Ich sehe nicht, wie selbstevidente 7 Gedanken den drohenden Metaregress stoppen können, wenn eine Autorisierung der Zuverlässigkeit Bedingung jeder Rechtfertigung ist. Solche Gedanken können sich, wenn ich Recht habe, nicht auf die geforderte Weise selbst autorisieren. Doch auch wenn ein Regressstopp durch selbstevidente Gedanken nicht in Sicht ist, muss das nicht zwangsläufig zu einem globalen Skeptizismus führen. Die in der ersten Prämisse enthaltene Behauptung, dass jede Rechtfertigung eine höherstufige Autorisierung der Zuverlässigkeit des Grundes erfordert, scheint mir nämlich viel zu stark zu sein. Der erkenntnistheoretische Externalist gibt sie auf und verlangt nur, dass die Gründe tatsächlich zuverlässig sind. Aber für eine solche, meiner Ansicht nach plausible, Position, möchte ich hier nicht eigens argumentieren. In jedem Fall scheitert auch das Regressargument für die Existenz apriorischer Erkenntnis. Ich hatte eingangs erwähnt, dass ich auch Kant zu den Rationalisten zähle, weil er den Verstand als eigenständige Erkenntnisquelle betrachtet. Sehen wir uns nun sein transzendentales Unverzichtbarkeitsargument an. Nach Kant kann es rein intellektuelle Erkenntnisse über die Welt nicht geben. Unsere Erkenntnis reicht nicht über den Bereich der erfahrbaren Wirklichkeit hinaus. Was wir aber nach Kant erfahrungsunabhängig erkennen können ist die Grundstruktur der erfahrbaren Welt. Wie ist das möglich? Kants Argumentation beginnt mit einigen unstrittigen Annahmen über den Inhalt der Erfahrung und fragt dann nach den Bedingungen der Möglichkeit dieser Tatsachen über die Erfahrung. Das Ergebnis der Argumentation lautet, dass diese Tatsachen nur dadurch erklärbar sind, dass der Verstand die Erfahrungsinhalte strukturiert und formt. Deshalb können wir a priori wissen, dass die Welt, sofern sie erfahren wird, unserer Verstandesstruktur entsprechen muss. In diesem Sinne ist der Verstand eine Quelle unserer Erkenntnis über die Welt. Sehen wir uns diese transzendentale Argumentation etwas genauer an. Kant geht davon aus, dass unsere Erfahrung intentionale Objekte hat und dass wir uns unsere Erfahrungen selbst zuschreiben können. Das ist beides erläuterungsbedürftig. Dass die Erfahrung intentionale Objekte hat bedeutet, dass wir nicht einfach rötlich oder schmerzhaft erleben, sondern dass wir etwa sehen, dass ein Gegenstand vor uns rötlich ist, oder dass wir empfinden, dass uns eine bestimmte Stelle im Körper weh tut. Wir erfahren also, dass ein Objekt bestimmte Eigenschaften hat. Die Selbstzuschreibbarkeit der Erfahrung bedeutet, dass jedes menschliche Subjekt sich durch alle seine Erfahrungen hindurch reflexiv darüber bewusst werden kann, dass jede dieser Erfahrungen und alle zusammen seine eigenen Erfahrungen sind. Das lässt sich als eine erste Prämisse formulieren: 8 (1) Jeder Mensch hat Erfahrungen von intentionalen Objekten, die er sich selbst als die seinen zuschreiben kann. Kant glaubt nun weiter, dass eine solche selbstzuschreibbare intentionale Erfahrung nur möglich ist, wenn die Erfahrungen jeweils und alle zusammen einen einheitlichen Zusammenhang bilden. (2) Damit Erfahrungen von intentionalen Objekten und deren Selbstzuschreibbarkeit möglich ist, müssen die Erfahrungen einen einheitlichen Zusammenhang bilden. Außerdem glaubt Kant, dass solche Einheit kein Produkt unserer Sinne sein kann, sondern nur durch den Verstand in die Erfahrung hineingebracht werden kann. (3) Die Einheit der Erfahrung ist nur durch Verstandesleistungen möglich. Kant ist ferner der Auffassung, dass diese Verstandesleistungen nicht einfach Erfahrungsinhalte wie ein logisches UND verbinden, sondern den Gegenständen der Erfahrung ihre Struktur geben. (4) Verstandesleistungen strukturieren die Gegenstände der Erfahrung. Also: Der Verstand legt die Struktur der erfahrbaren Gegenstände fest. Wenn wir das a priori erkennen, dann wissen wir damit a priori etwas über die Struktur der erfahrbaren Welt (und das war ja die These des Rationalismus). Kurz: Nach Kant können wir apriorische Erkenntnisse über die Welt haben, weil der Verstand den Inhalt der Erfahrung strukturiert. Man darf die Erfahrung folglich nicht wie Aristoteles und Locke nach dem Modell einer tabula rasa, eines unbeschriebenen Blattes, verstehen, sondern muss Erfahrung als Produkt aus kausaler Einwirkung der Außenwelt (Rezeptivität) und konstruktiver Verstandestätigkeit (Spontaneität) verstehen. Bereits Leibniz hatte in diesem Sinne auf Lockes empiristisches Diktum, dass nichts im Verstande sei, was nicht zuvor in den Sinnen gewesen sei, geantwortet. „Nichts außer dem Verstand selbst!“ Und deshalb wissen wir a priori, dass die Erfahrungsgegenstände der kategorialen Verstandesstruktur entsprechen müssen. Mit dieser transzendentalen Argumentation Kants gibt es vor allem drei Probleme. Erstens genügt es für apriorischer Erkenntnis über die Welt nicht, dass der Verstand die Erfahrung von den Gegenständen strukturiert, die Struktur muss auch den Gegenständen selbst entsprechen. Kant entschärft diesen Einwand bekanntlich dadurch, dass er unsere Erkenntnisansprüche auf die Erscheinungen der Gegenstände beschränkt. Das ist die These des transzendentalen Idealismus, deren Tragfähigkeit wir uns später noch ansehen werden. Zweitens können wir auf diesem Wege nur dann apriorische Erkenntnis gewinnen, wenn der 9 Verstand die Erfahrung nicht nur tatsächlich strukturiert, sondern wir auch davon wissen. Dieses Wissen muss jedoch selbst a priori sein. (Wir müssen also alle Prämissen des zuvor angeführten Arguments a priori erkennen können.) Doch dann wird durch das Argument eine apriorische Bedingung der Erfahrung nur dadurch erwiesen, dass dabei bereits apriorisches Wissen vorausgesetzt wird. Drittens erscheint mir die Prämisse (3) (dass also die Einheit der Erfahrung nur durch Verstandesleistungen möglich ist) in Anbetracht neuerer kognitionspsychologischer Untersuchungen äußerst fragwürdig. Danach ist es zwar richtig, dass die Erfahrung in mehreren Schritten bis hin zur 3-D-Vorstellung konstruktiv aufgebaut wird. Dieser Aufbau der Erfahrung geschieht jedoch ohne Einfluss des Verstandes, vollkommen modular, d.h. abgekapselt von rationalen Einflüssen. Lassen Sie mich die Ergebnisse meiner bisherigen Überlegungen kurz resümieren: Wir haben uns drei klassischen Argumente der Rationalisten dafür angesehen, dass rationalistische Erkenntnis das Fundament von Erkenntnis im Allgemeinen oder empirischer Erkenntnis bildet. Alle drei Argumente – das Gewissheitsargument, das Regressargument und das transzendentale Argument – haben sich als wenig überzeugend erwiesen. Die Rationalisten haben jedoch nicht alle behauptet, dass es ein apriorisches Fundament unseres Wissens geben müsse, sondern sie haben z.T. auch einen anderen Weg zu ihrer Verteidigung eingeschlagen. Im Zentrum steht dabei die Behauptung, dass es objektive Tatsachen gibt, von denen wir Wissen haben, obwohl es kein empirisches Wissen von diesen Tatsachen geben kann (weil es sich um metaphysische Tatsachen handelt). Wissen von diesen erfahrungstranszendenten Tatsachen können wir nur auf erfahrungsunabhängige Weise bekommen. Um welche Tatsachen handelt es sich dabei? Klassische Rationalisten wie Descartes und Leibniz hatten natürlich Dinge wie die Unsterblichkeit der Seele, den absoluten Anfang des Kosmos oder die Existenz Gottes im Sinn. Alles Dinge, von denen wir heute sagen würden, dass wir nicht mehr selbstverständlich davon ausgehen können, dass wir Wissen von ihnen haben. So dass ein Beweis der Möglichkeit apriorischer Erkenntnis nicht von dieser Annahme abhängen sollte. Daneben spielen vor allem für Leibniz die logischen und mathematischen Axiome eine zentrale Rolle. Hier können wir kaum bestreiten, dass wir von ihnen ein Wissen haben. Und wir können ebenfalls nur schwer bestreiten, dass dieses Wissen nicht auf Erfahrung beruht. Doch auch dieser Argumentationszug kann die Existenz erfahrungsunabhängiger Erkenntnis im rationalistischen Sinne nicht direkt beweisen, denn wir hatten gesehen, dass die gemäßigten Empiristen eine apriorische Erkenntnis in der Logik und 10 Mathematik akzeptieren, jedoch behaupten, dass logische und mathematische Tatsachen keine objektiven Tatsachen sind, sondern von unseren Begriffen abhängen. Wenn wir von diesen Tatsachen wissen, dann wissen wir damit nichts über die Welt. Es gibt nun jedoch noch einen dritten Bereich von Tatsachen, der beides zu erfüllen scheint: wir haben erstens apriorisches Wissen von ihm und zweitens handelt es sich um objektive Tatsachen und keine Reflexe unserer Begriffe. Ich meine den Bereich starker modaler Tatsachen. Modale Tatsachen besagen, was möglicherweise der Fall ist, und dem, was notwendigerweise der Fall ist. Dabei sind jedoch unterschiedliche Grade von Möglichkeit und Notwendigkeit im Spiel. Sehen wir uns das zunächst für die Notwendigkeit an. Ich kann sagen „Der Täter musste seine Tat begehen“ und meine damit, dass er diese Tat notwendigerweise begehen musste, relativ zu seinen psychologischen Merkmalen. Aber diese relative Notwendigkeit ist damit verträglich, dass der Täter seine Tat auch hätte unterlassen können, wenn er andere psychologische Merkmale gehabt hätte. Wir sagen auch „Gegeben das verursachende Ereignis musste das bewirkte Ereignis eintreten“, aber auch die dadurch ausgedrückte Notwendigkeit ist relativ auf die bei uns geltenden Kausalgesetze. Wären diese Gesetze andere gewesen, dann hätte die Wirkung (gegeben die Ursache) auch ausbleiben können. Unter starker Notwendigkeit verstehe ich eine absolute Notwendigkeit, die nicht mehr relativiert ist auf die möglichen Situationen, in denen bestimmte Tatsachen oder Gesetze bestehen. Dasselbe gilt auch für Möglichkeiten. Nahe liegende Möglichkeiten wie „Ich hätte heute auch nicht in die Universität kommen können“ oder „Wenn ich meinen Zug verpasst hätte, dann wäre ich nicht rechtzeitig zu meiner Vorlesung gekommen“ können wir empirisch begründen. Aber wenn wir Aussagen darüber treffen, dass etwas im stärksten Sinne absolut notwendig ist, oder wenn wir Aussagen über einschränkungslos alle Möglichkeiten, also auch die weit abliegenden wie „Ich hätte kein Wissen, wenn ein böser Dämon mich fortwährend täuschen würde“ treffen wollen, dann können wir das nicht mehr auf der Grundlage unserer Erfahrung tun. Überzeugungen mit einem starken modalen Inhalt können also nur erfahrungsunabhängig gerechtfertigt und gewusst werden. Es gehört nun zum Selbstverständnis der Philosophie, dass sie Wissen über starke modale Tatsachen liefert. Klassische Rationalisten wie Leibniz haben dabei vor allem notwendige Vernunftwahrheiten im Auge gehabt. Wenn man die Logik und Mathematik einmal außer Acht lässt, dann wären Aussagen wie „Jedes Ding ist notwendigerweise mit sich selbst identisch“ oder „Kein Ding kann zugleich ganz rot und ganz grün sein“ gute Beispiele. Aber 11 Wissen über metaphysische Möglichkeiten spielte in der Philosophie auch von Anfang an eine wichtige Rolle (auch wenn dieser Umstand methodologisch nicht genügend reflektiert wurde). Denken Sie an die sokratischen Intuitionen darüber, ob bestimmte kontrafaktische Fälle unter einen bestimmten Begriff (wie Tugend, Gerechtigkeit oder Wissen) fallen würden. Um nichts anderes geht es Platon in seinen Frühdialogen. Durch solche sokratischen Intuitionen (deren Nachfolger heute „Gedankenexperimente“ genannt werden) kann der Philosoph die objektive Natur zentraler philosophischer Eigenschaften klären. Es geht dabei nicht primär um eine Klärung unserer Begriffe, sondern darum, unter welchen notwendigen und hinreichenden Bedingungen etwas ein Fall eines solchen Begriffes ist. Und die Annahmen über solche notwendigen und hinreichenden Bedingungen werden an den sokratischen Intuitionen überprüft. Dadurch können wir die Frage nach der objektiven Natur der Wahrheit, des Wissens, der Freiheit, der Gerechtigkeit etc. beantworten. Vielleicht werden Sie sich jetzt fragen, warum die Beantwortung dieser Frage für die Philosophie so wichtig ist. Zunächst könnte man antworten, dass unsere natürliche Neugier uns antreibt, grundlegende Phänomene wirklich verstehen zu wollen. Aber es gibt noch eine weitergehende Antwort: Unser aufgeklärtes modernes Weltbild lässt es einfach nicht zu, alle möglichen Phänomene unverbunden nebeneinander bestehen zu lassen. Deshalb taucht die Frage, ob es denn Freiheit, Gerechtigkeit usw. wirklich gibt, hartnäckig immer wieder auf. Um aber herauszufinden, ob sich diese Phänomene in unser bestehendes Weltbild ohne Widerspruch integrieren lassen, müssen wir zunächst klären, welcher Natur diese Phänomene sind. Hier liegt die eigentliche Bedeutung der Philosophie für die Metaphysik. Aber warum muss man die Natur der Eigenschaften, die für die Philosophie von zentraler Bedeutung sind, durch die apriorische Bewertung metaphysisch möglicher Situationen herausfinden? Warum kann man die Phänomene nicht genauso wie natürliche Arten empirisch untersuchen? Wenn wir die Natur natürlicher Arten wie chemischer Grundstoffe oder biologischer Arten herausfinden wollen, dann untersuchen wir die paradigmatischen Fälle solcher Arten mit Hilfe empirischer Methoden. So stellte sich beispielsweise heraus, dass Walfische gar keine Fische, sondern Säugetiere sind. Betrachten Sie dagegen den Fall von Wissen. Auch hier könnten wir uns paradigmatische Fälle herausgreifen, also herausragende Beispiele von Wissen. Aber nun stellen Sie sich vor, wir würden entdecken, dass in diesen Fällen – allem Anschein zum Trotz – die vorliegenden Überzeugungen gar nicht wahr sind. Würde das bedeuten, dass die Natur des Wissens nichts mit Wahrheit zu tun 12 hat, so wie die Walfische ihrer Natur nach nichts mit Fischen zu tun haben? Ich denke, unsere natürliche Reaktion wäre zu sagen, dass dann eben die Paradebeispiele von Wissen gar keine echten Fälle von Wissen waren. Diese Asymmetrie zeigt, dass man den philosophisch interessanten Phänomenen nicht empirisch, sondern nur mit Hilfe apriorischer Erkenntnis zu Leibe rücken kann. Seiner Struktur nach lautet das modale Unverzichtbarkeitsargument, das sich so ähnlich bereits bei Leibniz findet: (1) Wenn wir Wissen von objektiven starken modalen Tatsachen haben, dann kann dieses Wissen nur rationalistische Quellen haben. (2) Wir haben Wissen von objektiven starken modalen Tatsachen (z. B. in der Metaphysik). Also: Es gibt Wissen aus rationalistischen Quellen. Damit stehen wir vor folgendem Ergebnis: Anders als Descartes, Kant und einige zeitgenössische Rationalisten geglaubt haben, dient apriorisches Wissen über die Welt weder als Fundament oder Rahmen unseres Wissens im Allgemeinen noch ist es unfehlbar gewiss. Rationale Intuitionen bilden vielmehr die Basis unseres starken modalen Wissens, das für die Metaphysik eine wichtige Rolle spielt. So oder so ähnlich hat Leibniz die Rolle rationalistischer Erkenntnis gesehen. Der Rationalist kann sich auf dieser Position jedoch nicht ausruhen. Eigentlich kann er nämlich nur eine bedingte Aussage machen: Wenn Metaphysik und Wissen von starken modalen Tatsachen überhaupt möglich ist, dann muss es eine rationalistische Erkenntnis geben. Aber wer sagt denn, dass eine philosophische Metaphysik überhaupt möglich ist? Wenn sie es nicht wäre, dann stünde es schlecht um die Philosophie und viele unserer Grundfragen müssten vielleicht unbeantwortet bleiben, aber das wäre kein Weltuntergang. Gerade weil die rationalistische Erkenntnis nicht das Fundament unseres Wissens im Allgemeinen ist, würde dieses Wissen auch die Widerlegung des Rationalismus überleben. Will man die rationalistische Option verteidigen, dann muss man zweierlei gegen die Empiristen zeigen. Man muss erstens zeigen, dass und wie rationalistische Methoden der Meinungsbildung psychologisch gesehen funktionieren. Zweitens muss man aber erklären können, wie es sein kann, dass die rationalistischen Methoden der Meinungsbildung (einmal angenommen, dass es sie gibt) zuverlässig die Wahrheit indizieren, ohne dass die modalen Tatsachen auf uns kausal einwirken (wie im Fall der Wahrnehmung). Eine solche kausale 13 Einwirkung der modalen Realität auf uns kann es nämlich, wie ich bereits angedeutet habe, nicht geben. Die neuzeitlichen Rationalisten haben nun im Grunde zwei verschiedene Alternativmodelle angeboten, um die Zuverlässigkeit rationaler Einsicht zu erklären. Das erste Modell erklärt rationalistische Erkenntnis über die Welt durch angeborenes Wissen bzw. angeborene Begriffe. Dieses Modell wurde vor allem von Descartes und Leibniz vertreten. Diesem Modell zufolge hat der allwissende und allgütige Gott uns von Geburt an mit Begriffen ausgestattet, die der Welt entsprechen. Wenn wir also auf die in diesen Begriffen enthaltenen Informationen reflektieren, gewinnen wir damit zuverlässige Information über die Welt. Und rationalistische Erkenntnis beruht nach Descartes und Leibniz genau auf diesem intellektuellen Zugriff auf unsere Begriffe. Der britische Empirist Locke hat das rationalistische Modell angeborener Begriffe scharf attackiert. Wären Menschen mit angeborenen Begriffen tatsächlich ausgestattet, so Locke, dann müsste ihnen das auf diese Weise angeborene Wissen von Geburt an und universell zur Verfügung stehen. Dass das offensichtlich nicht der Fall ist zeigt beispielsweise unser Wissen von logischen Prinzipien (dem rationalistischen Paradebeispiel angeborener Prinzipien): Viele Kinder haben keinerlei Wissen von solchen Prinzipien und auch viele Erwachsene kommen niemals dazu, solche Prinzipen zu erkennen. Die Rationalisten haben jedoch schnell die Schwachstelle dieser Argumentation erkannt. Es ist einfach nicht richtig, dass jede angeborene Anlage sich sofort mit der Geburt manifestiert. Oft sind dazu Reifungsprozesse erforderlich, wie beispielsweise für den Bartwuchs, der beim Mann sicher angeboren ist, sich aber erst in der Pubertät zeigt. Und viele angeborene Dispositionen manifestieren sich erst durch auslösende Faktoren, doch diese auslösenden Faktoren sind eben nicht identisch mit dem Erwerb der Disposition. So gehen heute viel Linguisten nach Chomsky davon aus, dass Syntaxkompetenzen dem Menschen angeboren sind, ihre Ausprägung jedoch davon abhängen, dass die richtigen Umweltreize auftreten. Genauso plausibel wäre die Annahme, dass uns logische Prinzipien angeboren sind, wir sie jedoch erst durch das richtige Maß an Reflexion als solche erkennen können. Das eigentliche Problem des Modells liegt meines Erachtens jedoch in Gott als Garant der Korrespondenz zwischen den Begriffen und der Welt. Es besteht nicht darin, dass wir bereits zirkulär apriorisches Wissen in Anspruch nehmen müssen, um von Gott zu wissen und so die Möglichkeit apriorischer Erkenntnis erklären zu können. Denn auch bei der Erklärung 14 empirischen Wissens über die Welt müssen wir bereits empirisches Wissen über unsere kausale Interaktion mit unserer Umwelt in Anspruch nehmen. Darin liegt nichts an sich Verwerfliches. Das Problem liegt vielmehr darin, dass die Möglichkeit selbst apriorischer Gottesbeweise in der rationalistischen Tradition zunehmend problematisch geworden ist. An Gott kann man glauben, aber wissen kann man von seiner Existenz nicht. Das gilt spätestens seit Kant weithin, wenn auch keineswegs ungeteilt als ausgemacht. Erklärungen, deren Prämissen man aber bloß glauben kann, hängen irgendwie in der Luft. Nun gibt es neuerdings einen Versuch, die Erklärung rationalistischer Erkenntnis durch angeborene Begriffe modifiziert wieder aufzugreifen. Die Vertreter der evolutionären Erkenntnistheorie (wie Peter Carruthers) beanspruchen nämlich, dass sie die Übereinstimmung unserer angeborenen Begriffe mit der Welt auch ohne Rückgriff auf göttliche Garantien erklären können, und zwar durch evolutionäre adaptive Prozesse. Der Selektionsdruck garantiere, dass die angeborenen Merkmale mit der Wirklichkeit übereinstimmen, da ansonsten das Verhalten der Lebewesen unangepasst sei und wenig Überlebenschancen habe. Diese evolutionäre Variante vermag nun meines Erachtens die Zuverlässigkeit empirischer Erkenntnis sehr wohl zu erklären. Bezüglich rationalistischer Erkenntnis muss sie jedoch scheitern, weil die Evolution nur die Adaption an die aktuale Welt belohnt, zuverlässige Erkenntnis über stark modale Tatsachen vom evolutionsbiologischen Standpunkt jedoch nutzlos ist. Möglichkeiten und Notwendigkeiten sind nicht das Brot, das uns ernährt. Der zweite neuzeitliche Ansatzpunkt für eine Erklärung rationalistischer Erkenntnis ist Kants transzendentaler Idealismus. In ihm tritt das Subjekt an die Stelle Gottes als Garant der Korrespondenz zwischen unseren apriorischen Urteilen über die Welt und der Welt selbst. Kant behauptet nämlich, dass der Gegenstand der Erfahrung (auf den sich alle unsere Erkenntnisse beziehen) gar nicht gänzlich unabhängig vom Subjekt sei, sondern durch den Verstand konstruiert werde und deshalb auch seinen Grundbegriffen entsprechen müsse. Kant beschreibt diesen Zusammenhang in der Einleitung in seine KrV auch wie folgt: „dass wir nämlich von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen.“ (B XVIII) Dahinter steht die radikale These, dass die gesamte natürliche Erfahrungswelt vom Verstand abhängt. Leider liefert Kant für diese These keine wirklich durchschlagenden Argumente. (Denn aus der offensichtlichen Tatsache, dass Gegenstände für mich nur etwas sind, wenn ich mich vorstellend auf sie beziehe, folgt nicht, dass diese Gegenstände bloß meine 15 Vorstellungen oder Erscheinungen sind.) Und der transzendentale Idealismus impliziert andererseits eine reduktionistische Behauptung, dass nämlich alle unsere Aussagen über die erfahrbare Natur ohne Rest auf Aussagen über unsere Erfahrung der Natur reduziert werden können. Doch dieser Reduktionsanspruch widerspricht dem in unsere Überzeugungen eingebauten Alltagsrealismus, wonach die Natur unabhängig von uns Menschen existiert. Letzten Endes kann also Kant die Möglichkeit rationalistischer Erkenntnis nur um den Preis erklären, dass sie sich gar nicht wirklich auf eine von uns unabhängige Welt bezieht, sondern nur von unserer Vorstellungswelt handelt. Und das bedeutet letztlich, dass er gerade nicht das erklären kann, was der Rationalist beansprucht, dass wir apriorisches Wissen von einer von uns unabhängigen Welt haben können. Wenn jedoch die zwei neuzeitlichen Erklärungsmodelle – angeborene Begriffe und transzendentaler Idealismus – sowie das antike Modell der intellektuellen Wahrnehmung nicht das halten, was sie versprechen, ist dann rationalistische Erkenntnis am Ende nichts anderes als das, wofür Empiristen es stets gehalten haben – ein obskures, mysteriöses, unerklärliches Unding? Ich denke, wir müssen die Fragerichtung umkehren und noch einmal überlegen, ob nicht am Ende die Erklärungsforderung der Empiristen selbst unangemessen und überzogen ist. Damit Urteile, die sich auf eine bestimmte Quelle stützen, Erkenntnis oder Wissen darstellen, muss ein nicht-zufälliger, zuverlässiger Zusammenhang zwischen diesen Urteilen und ihrer Wahrheit bestehen. Soviel sollte unstrittig sein. Im Fall von Urteilen über kontingente Tatsachen (die auch anders sein könnten) besteht kein solcher zuverlässiger Zusammenhang, solange es keinen metaphysischen Zusammenhang zwischen der Quelle der Urteile und den Tatsachen gibt, die diese Urteile wahr machen. Solange die Tatsachen in unserer Umgebung unsere Sinneserfahrung nicht kausal bestimmen (wie etwa im Traum oder bei einem durch einen Computer manipulierten Gehirn im Tank), ist nichts da, was gewährleistet, dass die Erfahrung auch eine Veränderung der Tatsachen in der Umgebung registrieren würde. Es fehlt die metaphysische Basis für eine zuverlässige Kovarianz zwischen Tatsachen und Erfahrung. Und solange diese Basis fehlt, besteht auch kein zuverlässiger Zusammenhang und damit auch keine Erkenntnis und kein Wissen. Wie wir gesehen haben, kann das metaphysische Fundament der zuverlässigen Korrelation auch in Gott und seinen Schöpfungsakten liegen oder in einer metaphysischen Abhängigkeit der Tatsachen vom Subjekt, wie es der transzendentale Idealismus will. Aber ohne eine metaphysische Basis gibt es keine zuverlässige Korrelation. 16 Ganz anders sieht die Sache aus, wenn wir es mit rationalen Intuitionen zu tun haben, die sich auf modale Tatsachen beziehen. Hier kann es eine zuverlässige Übereinstimmung auch ohne metaphysischen Zusammenhang zwischen Intuitionen und Tatsachen geben, weil modale Tatsachen sich nicht verändern können und auch nicht hätten anders sein können. Sie sind stabil über alle möglichen Welten. Was möglich ist, ist notwendigerweise möglich, und was notwendig ist, ist notwendigerweise notwendig. Wenn das richtig ist, dann kann es hier auch eine zuverlässige Übereinstimmung ohne metaphysischen Zusammenhang geben, weil ein Garant der Kovarianz nur dann erforderlich ist, wenn die Tatsachen, auf die sich unsere Intuitionen beziehen, überhaupt variieren können. Das ist aufgrund ihrer Stabilität bei modalen Tatsachen jedoch nicht der Fall. Was ich hier allenfalls andeuten kann, ist die Asymmetrie zwischen Erkenntnissen über kontingente und Erkenntnissen über modale Tatsachen. Im ersten Fall ist eine metaphysische Grundlage der erforderlichen zuverlässigen Wahrheitsbeziehung nötig, die diese dann auch erklärt. Im zweiten Fall ist diese Erklärung überhaupt nicht nötig. Und deshalb ist es zwar richtig, dass wir rationalistische Erkenntnis nicht erklären können, aber diese Tatsache diskreditiert nicht den erkenntnistheoretischen Status rationaler Intuition. Mein Schnelldurchgang durch den neuzeitlichen Rationalismus hat einige Überraschungen zu Tage gefördert. Zunächst einmal können rationalistische Erkenntnisse nicht die Funktion übernehmen unserem empirischen Wissen ein Fundament zu geben. Rationalistische Erkenntnisse sind basale Erkenntnisse neben anderen wie Wahrnehmung, Erinnerung, Selbstwissen usw. Ihr Funktion liegt vor allem darin, die metaphysische Natur grundlegender philosophischer Phänomene (wie Wissen, Freiheit, Wahrheit) ans Licht zu bringen, und zwar mit Hilfe kontrafaktischer Überlegungen über Möglichkeiten. Darin liegt wohl eine wesentliche Aufgabe der Philosophie. Abrücken müssen wir von der lieb gewonnenen Vorstellung, dass Erkenntnis aus reiner Vernunft irrtumsimmun ist. Descartes hat diese Idee propagiert, aber bereits viele vorsichtigere Rationalisten der Neuzeit haben bemerkt, dass dieser Anspruch übertrieben ist. Wenn wir von der Unfehlbarkeit apriorischer Erkenntnis abrücken, machen wir sie damit jedoch auch weniger angreifbar durch das Totschlagsargument des universellen Fallibilismus. Eine Menge Tatsachen über rationale Intuitionen liegen nach wie vor vollkommen im Dunkeln. So ist immer noch unklar, durch welche psychologischen Prozesse sie zustande kommt und ob diese Prozesse tatsächlich hinreichend unabhängig von der Erfahrung sind, um am Anspruch des Rationalismus festhalten zu können. Außerdem müsste durch psychologische Studien genauer als bislang 17 geschehen untersucht werden, ob rationale Intuitionen über die Zeit hinweg und zwischen verschiedenen Personen konvergieren ausreichend konvergieren. Nur wenn das der Fall ist, lässt sich der Anspruch des Rationalisten aufrechterhalten. Der Streit zwischen Rationalisten und Empiristen ist also noch lange nicht entschieden. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass der Rationalismus nach wie vor eine attraktive Position ist. 18