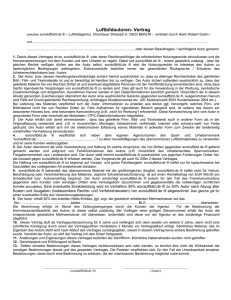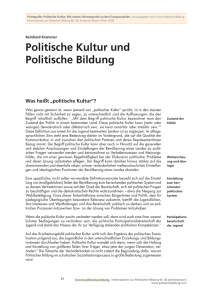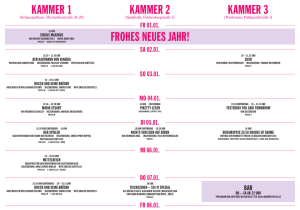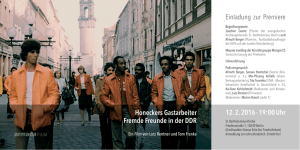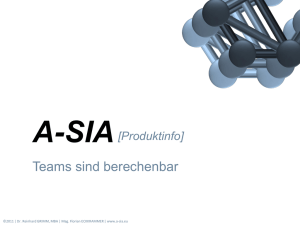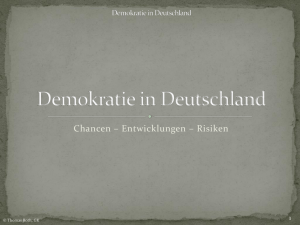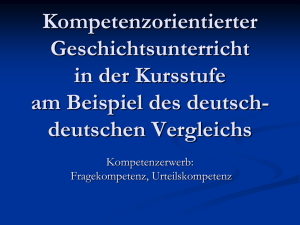Reinhard Jirgl aus Autor der ehemaligen DDR und sein Schreiben
Werbung

Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 1 Susanne Ledanff Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland mit einem besonderen Blick auf die Romane Die Unvollendeten und Die Stille Reinhard Jirgl einen besonderen Stellenwert in einer Untersuchung von Autoren der ehemaligen DDR und ihres Schreibens im vereinten Deutschland einzuräumen, liegt schon deshalb nahe, weil der Autor im aktuellen Spektrum der deutschen Gegenwartsliteratur eine spektakuläre Erfolgsgeschichte vorzuweisen hat, die in der Verleihung des Büchner-Preises im Jahre 2010 gipfelte. Jirgl gehört sicherlich in die von ostdeutschen Autoren dominierte „Preisträger-Pyramide“ (Roland Berbig)1. Einige Stichworte aus der Begründung der Jury seien zum Ausgangspunkt für die Besprechung von Jirgls Nachwende-Schreiben genommen. So hieß es, Jirgl habe ein Romanwerk „von epischer Fülle und sinnlicher Anschaulichkeit“ und „ein eindringliches, oft verstörend suggestives Panorama der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert entfaltet“. Ausgezeichnet wurden ein relativ neuer Schreibimpuls des Autors zur Vertriebenenproblematik in seinem Roman Die Unvollendeten und das in seinem neuen Roman Die Stille vorgestellte Panorama der Schrecken des 20. Jahrhunderts, seiner Kriege und Diktaturen. Mit diesen beiden Zeit- und Geschichtsromanen sei Jirgl in der Erinnerungstopik bundesrepublikanischen Schreibens und der sogenannten ‚Enttabuisierung‘ des Themas der Deutschen als Opfer angelangt. Sie zeichneten sich darüber hinaus durch die „große erzählerische Sensibilität und Leidenschaft“ des Autors, „geschützt durch den Firnis eines avantgardistischen Schreibgestus“, aus.2 Einige Kritiker thematisierten anlässlich der Preisverleihung aber auch den Stellenwert von Jirgls formalem Avantgardismus und dessen eventuelle Überlebtheit.3 Gregor Dotzauer stellte fest, dass Jirgl inhaltlich seinen „antimodernen Impetus gegen alles Kulturindustrielle aus der DDR verlustlos in die Bundesrepublik gerettet“4 habe. Iris Radisch bezog sich im Kontext ihrer These der „zwei getrennten Gegenwartsliteraturen in Ost und West“ namentlich auf die Romane Jirgls, die um die Mitte der 1990er-Jahre erschienen waren. Sie sprach von einer inhaltlich und formal spezifisch ostdeutschen Literatur als einer „poetischen, tragischen, im besten Sinne politischen Literatur, die nicht Stellung bezieht, aber durch die machtvolle Bergwerksarbeit ihrer originellen und häufig sehr expressiven Sprache, deutsche Wirklichkeit decouvriert, dekonstruiert, destabilisiert – mit einem Wort literarisch kommentiert“. Sie fügte hinzu: „Diese Literatur ist in einem beinahe vergessenen Sinn gesellschaftskritisch.“5 Als Radisch 2000 auf den Trend der zwei Literaturen – der „idealistischen“ Ost- und „postidealistischen“-postmodernen Westliteratur – aufmerksam machte, stellte dies interessanterweise eine Fortsetzung des deutsch-deutschen Literaturstreits dar. Dessen erste Phase im Jahre 1990 war geprägt von einer folgenreichen Polemik gegen die engagierte oder „Gesinnungsliteratur“ der älteren Autorengeneration in Ost und West. Radischs Loblied auf die Vertreter der „tragischen“ Hier zitiert nach: Ludwig, Janine; Meuser, Mirjam: In diesem besseren Land – Die Geschichte der DDRLiteratur in vier Generationen engagierter Literaten. In: Dies. (Hg.): Literatur ohne Land? Schreibstrategien einer DDR-Literatur im vereinten Deutschland. Freiburg 2009, S. 11-72, hier S. 59. Im Folgenden: Ludwig/Meuser. 2 Spreckelsen, Tilman: Mit Hellsicht geschlagen. In: Faz.net vom 9.10.2010. URL: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/bedeutendster-deutscher-literaturpreis-reinhard-jirgl-mit-buechnerpreis-ausgezeichnet-1638842.html, eingesehen am 3.5.2012. 3 Ebd. 4 Dotzauer, Gregor: Reinhard Jirgl und die Stimmen der Verschütteten. In: Tagesspiegel.de vom 9.7.2010. URL: http://www.tagesspiegel.de/kultur/georg-buechner-preis-reinhard-jirgl-und-die-stimmen-derverschuetteten/1879564.html, eingesehen am 3.5.2012. 5 Radisch, Iris: Es gibt zwei deutsche Gegenwartsliteraturen in Ost und West! In: Fischer, Gerhard; Roberts, David (Hg.): Schreiben nach der Wende. Ein Jahrzehnt deutscher Literatur 1989-1999. 2. unveränd. Aufl. Tübingen 2007, S. 1-14, hier S. 13. 1 Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 2 Ostmoderne im Kontext der Zwei-Literaturen-These stellt eine neue Kehrtwende im Literaturstreit dar. Hatte man wenige Jahre zuvor eine von Reflexion und moralischem Engagement befreite „Nullpunkt-Literatur“ gefeiert, so suchte die deutsche Literaturkritik in der postmodernen Oberflächlichkeit des Gegenwartsschreibens nun nach Tiefgang – und fand diesen namentlich bei Reinhard Jirgl. Zu der im Nachwendeschreiben herausragenden „negativen DDR-Heimatliteratur“ gehören nach Radisch außer Jirgl u. a. Wolfgang Hilbig, Ingo Schramm, Ulrich Zieger und Gert Neumann. Ähnlich wie Radisch bringt Helmut Böttiger den Begriff der „Ostmoderne“ mit „ihrer schwarzen Phantasie“ und ihrer „apokalyptisch anmutenden Negation aller Utopien und humaner Werte“, in seinen Besprechungen von Jirgls Werk ins Spiel, und dies namentlich im Vergleich mit Hilbig.6 In den Bestimmungen von Ostmoderne im Sinne einer Fortführung der Traditionen literarischer Moderne bzw. auch als einer emphatischen Form literarischer Gesellschaftskritik ist den beiden Kritikern zuzustimmen. Man denke an die Rolle nihilistisch gebrochener Gesellschaftsutopien z. B. bei Gottfried Benn und weiterhin an die apokalyptische Metaphorik der Expressionisten (allesamt Autoren, die als literarische Vorbilder Jirgls zu gelten haben). In diesen einleitenden Überlegungen geht es mir zunächst um Jirgls „Einzelgängertum“ in der neueren deutschen Gegenwartsliteratur. Die Obsession des 2007 gestorbenen Autors Hilbig mit den „Mondlandschaften“ in Sachsen/Thüringen war zum letzten Mal 2003 in seinem Erzählband Schlaf der Gerechten zu finden; auch die anderen Autoren der sogenannten Ostmoderne sind in jüngerer Zeit nicht mehr mit Beispielen einer „negativen Heimatliteratur“ hervorgetreten. Dies ist ganz anders bei Jirgl. Sein kulturpessimistischer Furor ist in allen seinen Nachwende-Texten zu finden – bis hin zu dem neuesten preisgekrönten Roman Die Stille. Es stellt sich die Frage: Ist Jirgl damit ein erratischer Block als letzter wahrhafter Vertreter einer Ostmoderne in der neuesten Gegenwartsliteratur? Anhand einer kurzen Betrachtung der Romane Die Unvollendeten und Die Stille soll diese Frage beantwortet werden. Der folgende Beitrag geht u. a. mit Böttiger von einer Kontinuität im Schreiben Jirgls als eines Autors aus der ehemaligen DDR aus.7 In vielerlei Hinsicht ist Jirgl der Sonderfall eines von seinen literarisch-intellektuellen Anfängen zu DDR-Zeiten geprägten Autors. Er blieb – bis auf eine Ausnahme – in der DDR unveröffentlicht, publizierte aber auch in dieser Zeit nicht im Westen. Sein wesentlich auf seiner Foucault-Rezeption basierender Kulturpessimismus entstand bereits zu DDR-Zeiten und bildete die Basis für die radikalen ästhetischen und gesellschaftskritischen Positionen des Autodidakten und Allesverschlingers Jirgl in der Nachwendezeit. Jirgls zahlreiche Aussagen zu seinen Schreibintentionen und in diesem Zusammenhang auch seine Bemerkungen zu einem Konzept von littérature engagée verdienen eine genauere Betrachtung. Mit den Rettungsversuchen und der Fortführung gesellschaftskritischer Aufgaben, die das literarische Schaffen einer älteren, loyal-kritischen Autorengeneration nach der Wende bestimmten, einem besorgten Begleiten der Leserschaft in die neue Zeit, von dem etwa Christa Wolf sprach, hat Jirgl wenig zu tun. Für diesen Autorenkreis, wie generell die „ungeheure Aufgeblasenheit“ des Literaturbetriebs in der DDR, findet Jirgl nur verachtende 6 Siehe: Böttiger, Helmut: Laudatio auf Reinhard Jirgl. In: Clarke, David; De Winde, Arne (Hg.): Reinhard Jirgl. Perspektiven, Lesarten, Kontexte. Amsterdam; New York 2007 (im Folgenden: Clarke/DeWinde), S. 13-20, hier S. 14. Vgl.: Danneman, Karen: „Der blutig-obszöne=banale 3-Groschenroman namens Geschichte“. Gesellschafts- und Zivilisationskritik in den Romanen Reinhard Jirgls. Würzburg 2009, S. 34. 7 Z. B. Böttiger, Helmut: Buchstaben-Barrikaden. Von Reinhard Jirgls Anfängen bis hin zu „Die Stille“ – ein in sich stimmiger ästhetischer Kosmos. In: Arnold, Heinz-Ludwig (Hg.): Reinhard Jirgl. Text + Kritik 189. München 2011 (im Folgenden: Arnold), S. 14-24. Im Folgenden: Böttiger. Weitere Untersuchungen dieser Kontinuität z. B. in den Arbeiten Karen Dannemanns sowie bei David Clarke und Erk Grimm in: Clarke/DeWinde. Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 3 Worte8. Er äußert sich ablehnend gegenüber einem simplifizierten Konzept von engagierter Literatur, die sich ins Politische einmischt. Natürlich war Jirgl in seiner oppositionellen Haltung zum DDR-System auch gefeit gegen jegliche Verpflichtung zur literarischen Darstellung einer sozialistischen Utopie, wie sie selbst noch bei seinem DDR-kritischen Mentor Heiner Müller auftauchte. Bereits zu DDR-Zeiten entwickelte Jirgl sein emphatisches Literaturkonzept zusammen mit den sich hieraus ergebenden ästhetischen (modernistischen) Prämissen. Die in der Literaturkritik beliebten Schlagworte wie „rabenschwarze[r] Pessimismus“ bzw. „negative Ethik“ (Werner Jung) bedürfen allerdings einer Präzisierung in Hinblick auf die kultur- und gesellschaftskritischen Intentionen des Autors.9 Mit Recht spricht Arne De Winde von Jirgl als einem „Übertreibungskünstler“, seinem Anspruch auf unbedingte Wahrheitssuche, seiner an Adorno geschulten „Taktik der Zuspitzung“.10 Jirgl selbst erklärt, dass sein Schreiben von der „stoischen Übung“ der „Vorwegnahme einer Zukunft, darin das größtmögliche Übel bereits eingetreten ist“, ausgehe. Es geht ihm darum, „das in den sozialen und mentalen Wirklichkeiten bestehende Unrecht zu benennen, zuzuspitzen, um es zu verneinen“11. Jirgl fügt hinzu: „Diese Verneinung aber, und das ist der wesentliche Unterschied zum sogenannten ‚engagierten Schreiben‘, hat ausschließlich im Kopf des Lesers, nicht auf dem Papier stattzufinden“12. Jirgl verwahrt sich grundsätzlich gegen an die Literatur „fremd herangetragene Anforderungen“, den „Kern des sogenannten Engagements“.13 Er zielt auf die „emotionale Intelligenz des Lesers“ und sagt: „Konkret allein ist die Form“, d. h. eine Form, in welcher „Spannungen und Konflikte des Außen in der Realität des Textes in der vom Autor zugespitzten, inszenierten Wirklichkeits-Form sich wiederfinden“.14 Kurz: Jirgls emphatischer Literaturbegriff ist Modernismus pur, denn auch das oben angesprochene Schlagwort vom „zu benennenden und zuzuspitzenden Unrecht“ wird nicht von einem in begrenzten zeithistorischen Umständen kritisch denkenden Schriftsteller formuliert, sondern ist weit universeller gedacht, als ein Versuch, menschheitsund kulturgeschichtliche Mechanismen von ihren fatalen und zerstörerischen Bedingungen her zu verstehen, wobei allerdings konkrete aktuelle „Unrechts“-Phänomene ins Visier der „Übertreibungen“ und „Zuspitzungen“ genommen werden. Modernistisch ist vor allem die Verbindung von radikalem kulturkritischem Aufklärungsanspruch und sperriger Form. Jirgl entwickelt eine Kunstsprache, die von der hochartifiziellen Emotionalität und Rhythmisierung seiner Sprachbilder charakterisiert ist und in der sich die Heftigkeit und das Chaos seiner Anklagen niederschlagen. Sie entsteht weiterhin durch das Durcharbeiten durch die „Bergwerksschichten“15 der Psyche der unterdrückten Subjekte. Will man Jirgl abschließend in einer Diskussion verorten, die nolens volens alle DDRAutoren auf ihre mehr oder weniger engagierten Schreibweisen bzw. ihre Stellungnahmen zu den Machtstrukturen der DDR befragt16, ist zu sehen, dass Sartres und Adornos Auffassungen Siehe Jung, Werner: „Material muss gekühlt werden“. Gespräch mit Reinhard Jirgl. In: ndl 3.46 (1998), S. 5670, hier S. 59. Im Folgenden: Jung. 9 Eine Auswahl und Einordnung von Kritikerstimmen finden sich in meinem Kapitel: Mythische Alptraumlandschaften. Der Sonderfall der Metropolen- und Berlindarstellung Reinhard Jirgls. In: Ledanff, Susanne: Hauptstadtphantasien. Berliner Stadtlektüren in der Gegenwartsliteratur 1989-2008. Bielefeld 2009, S. 346-376, hier S. 350. Im Folgenden: Ledanff. 10 De Winde, Arne: Das hatte ich mal irgendwo gelesen. Überlegungen zu Reinhard Jirgls Essayismus. In: Arnold, S. 86-97, hier S. 88. Im Folgenden: De Winde: Überlegungen. 11 Jirgl, Reinhard: „Das Gegenteil von Spiel ist nicht Ernst, sondern Wirklichkeit“. In: Arnold, S. 81-85, hier S. 81. Im Folgenden: Jirgl: Gegenteil. 12 Ebd. 13 Jirgl, Reinhard: „Schreiben ist meine Art, in der Welt zu sein“. Gespräche in Briefen mit Reinhard Jirgl. Von Clemens Kammler; Arne De Winde. In: Ders.: Land und Beute. Aufsätze aus den Jahren 1996 bis 2006. München 2008 (im Folgenden: Jirgl: Beute), S. 125-164, hier S. 158. Im Folgenden: Jirgl: Gespräche. 14 Jirgl: Gegenteil, S. 82. 15 Jung, S. 62. 16 Siehe: Ludwig/Meuser, S. 45. 8 Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 4 von littérature engagée im Sinne eines „Spannungsverhältnisses von politischem Engagement und ästhetischer Mehrdeutigkeit“ (Huntemann)17 auch für Jirgl zutreffen. Vor allem wird Sartres Engagementvorstellung der „Enthüllung und Veränderung der konkreten Entfremdungserscheinungen der Welt“18 in Jirgls vehementen kulturkritischen Positionen gespiegelt. Das DDR-Erbe der littérature engagée setzt sich gerade in Jirgls Kulturkritik, ja in seinem radikalen Kulturpessimismus fort. Zu beachten sind allerdings die Stellungnahmen Jirgls zu einer „veränderten Rolle von Literatur heute“, zu den „Verwerfungen der Wirklichkeit im Innern der Schrift selbst“.19 Seine kulturkritische Schreibintention ist nicht vom Primat formalästhetischer Anforderungen an die Literatur zu trennen, den „ureigensten Fähigkeiten des Schriftstellers“20. So lässt sich Jirgls Ästhetik vielleicht am besten zusammenfassen in seiner Aussage: „Wie sollte ... Pessimismus etwas anderes sein als ein Stilprinzip?!“21 In diesem Beitrag aber soll noch einmal der Blick auf die literarischen Anfänge des Autors in den 1980er-Jahren in der damaligen DDR gelenkt werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass Jirgl – wie einzelgängerisch auch immer – seinen existentiellen Literaturbegriff aus der Erfahrung seiner Opposition zum DDR-System entwickelt, dass also seine prägenden Leseerfahrungen und sein ästhetisches Konzept aus dieser existentiellen Sinnsuche entstanden. Reinhard Jirgl wurde am 16. Januar 1953 in Ost-Berlin geboren. Ab 1975 schrieb er kontinuierlich und brachte es zu DDR-Zeiten auf neun unveröffentlichte Manuskripte. Mit Unterstützung seines Förderers Heiner Müller gelang eine einzige Zeitschriftenveröffentlichung in Sinn und Form 1987. Erst 1990 erschien beim Aufbau-Verlag sein erstes Buch, MutterVaterRoman, das dort bereits 1985 eingereicht, aber wegen „nichtmarxistischer Geschichtsauffassung“22 abgelehnt worden war. In den Vereinigungswirren ging dieser Erstling unter. Wegen ihrer Schwere unverstanden blieben auch weitere nach der Wende geschriebene Werke des Autors. Zwei Prosabücher erschienen im Kleinstverlag Roland Jassmann, und zwar Überich. Protokollkomödie in den Tod (1991) und Das obszöne Gebet. Totenbuch (1992), sowie bei Luchterhand Im offenen Meer. Schichtungsroman (1991). Die Wende in Jirgls Schriftstellerexistenz trat ein, als er 1993 für das noch unfertige Manuskript Abschied von den Feinden den Alfred-Döblin-Preis erhielt. Der 1995 veröffentlichte Roman markierte Jirgls literarischen Durchbruch, und er wurde Autor beim Carl Hanser Verlag, der seitdem seine Bücher veröffentlicht. Dazu gehört auch das noch zu DDR-Zeiten geschriebene „Schubladenwerk“: Genealogie des Tötens (mit den Texten Klitaemnestra Hermafrodit & ‚Mamma Pappa Tsombi‘; MER – Insel der Ordnung; Kaffer. Nachrichten aus dem zerstörten Leben), welches 2002 erschien. Die Nachwenderomane Abschied von den Feinden (1995) und Hundsnächte (1997) wurden von der Kritik als grandiose Abrechnungsromane mit dem DDR-System aufgenommen. Sie bevorzugen den Schauplatz der ostdeutschen Provinz als Metapher für ein durch die Einheit nur größer gewordenes, alptraumhaftes Deutschland. Abschied von den Feinden enthält darüber hinaus Reminiszenzen an prägende Erlebnisse der Protagonisten noch aus der stalinistischen Steinzeit des Sozialismus.23 Bevor ich mit meinem Überblick fortfahre, will ich Jirgls Aussagen zur Identität als Autor aus der ehemaligen DDR und möglichen wendebedingten Veränderungen seines Werks 17 Zitiert nach: Ebd. Zitiert nach: Ebd., S. 40. 19 Jirgl: Gespräche, S.158. 20 Ebd. 21 Ebd., S. 153. 22 Jirgl, Reinhard: Schlußwort für einen „Nachlass zu Lebenszeiten“. In: Ders.: Genealogie des Tötens. München 2002, S. 815-834, hier S. 815. 23 Siehe meinen Artikel: Die Suche nach dem „Wenderoman“ – zu einigen Aspekten der literarischen Reaktionen auf Mauerfall und deutsche Einheit in den Jahren 1995 und 1996. In: Glossen 2 (1997), S. 1-13. URL: http://www2.dickinson.edu/glossen/heft2/wende.html, eingesehen am 14.6.2013. 18 Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 5 nach 1990 kurz betrachten. In den Gesprächen in Briefen, die Jirgl mit Clemens Kammler und Arne De Winde führte, wendet er sich, gefragt nach Radischs Zwei-Literaturen-These, gegen einen „totalisierenden Begriff von ‚DDR-Literatur‘“24 wie auch gegen eine Festmachung von DDR-Literatur an gesellschaftsbezogenen Themen oder einer Auseinandersetzung mit Systemerscheinungen. Vielmehr sollten die Werke der Schriftsteller, die in der DDR sozialisiert wurden, individuell beurteilt und auch die „geistigen Herkünfte der einzelnen Autoren, die ... Zugehörigkeiten zu Stilrichtungen und Formkonzepten“ einbezogen werden.25 Zu hinterfragen ist jedoch die in der Kritik gelegentlich vorgebrachte Einzelgängerthese, also die Behauptung, dass Jirgls Schreiben zu DDR-Zeiten weitgehend unbeeinflusst blieb vom damaligen Literaturbetrieb oder der oppositionellen Prenzlauer-BergSzene.26 Neben der erwähnten Foucault-Rezeption gab es weitere autodidaktische Bildungserlebnisse, die im Kontext des Außenseitertums des Autors zu DDR-Zeiten gesehen werden müssen. In der „Wärmlichkeit“ des DDR-Milieus empfand Jirgl seine NietzscheLektüren wie ein „kaltes Messer“27. Ähnlich verhielt es sich mit den schon früh rezipierten Texten Ernst Jüngers und Oswald Spenglers und den hier gefundenen Botschaften einer massenverachtenden nihilistischen Kulturverdammung, bzw. bei Jünger auch einer dezisionistischen Lebensbeschwörung. Hervorzuheben sind neben solchen zu DDR-Zeiten erarbeiteten philosophisch-ästhetischen Reflexionen gewisse Verbindungen, die Jirgl zu Teilen der Literaturszene der DDR in den 1980er-Jahren unterhielt. Da ist in erster Linie sein Mentor Heiner Müller zu nennen. Müllers Einfluss auf Jirgls Schreiben ist deutlich zu sehen in den dramatische Elemente aufweisenden Prosastücken seines Frühwerks28, insgesamt aber in seiner Müller verwandten Einstellung zu einer „unvergänglichen Vergangenheit“. Wie Müller ist Jirgl fasziniert von den Assoziationsräumen des Mythos, der „Fahrstühle durch die Geschichte“ erlaubt. Wie Müller tendiert Jirgl in seinen Geschichtsexplorationen vom Frühwerk bis zu den neuesten Romanen zu einem veritablen furor teutonicus.29 Interessant ist nun, was der Autor über die Auswirkungen der Nachwendezeit auf sein Schreiben sagt. Jirgls Position ist hier einerseits die der Kontinuität im Hinblick auf den Fundus von Lebensläufen von Menschen aus der ehemaligen DDR und ihren weiteren Erfahrungen. Was seine Schreibweise im Anschluss an Roland Barthes’ formalästhetischen Engagementbegriff, den „nach bewussten, frei gewählten Kriterien vollzogene(n) SprachZugriff“30 angeht, verweist er explizit auf die literarische Moderne als seinen Ausgangspunkt. Demnach sind „aus den Ergebnissen insbesondere der klassischen Moderne – der für uns zunächstliegenden, noch immer virulenten Literaturepoche – die für unsere Gegenwart erweiterten und durchaus neuartigen Schlußfolgerungen zu ziehen“31. Zu diesen Vorbildern mag man Poe, Kafka, Benn, Beckett, Genet, Artaud, aber auch Arno Schmidt zählen.32 Diese scheinbar rein ästhetische Belange thematisierenden Überlegungen sind jedoch ein Hinweis auf den Versuch des Autors, sich in der „Nullstunde“ des Nachwendeschreibens als „singulärer“ Literat in der neuen Literaturlandschaft zu etablieren, wie Christine Magerski in ihrer ausgezeichneten Analyse der Bilder eines nietzscheanischen, von der Masse 24 Jirgl: Gespräche, S. 125. Ebd., S. 126. 26 Siehe: Grimm, Erk: Reinhard Jirgl. In: Kritisches Literaturlexikon der Gegenwartsliteratur, 85. Nlg. 3 (2007), S. 3. Im Folgenden: Grimm: Jirgl. Vgl.: Böttiger, S. 17 f. 27 Böttiger, S. 18. 28 Siehe: Pabst, Stephan: Text – Theater. Zur Form der frühen Prosa Reinhard Jirgls“. In: Arnold, S. 25-37. 29 Siehe: Grimm über Jirgls Trilogie Genealogie des Tötens. In: Grimm: Jirgl, S. 13. Vgl. Emmerich, Wolfgang: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Erw. Neuausg. Leipzig 1996, S. 495. 30 Jirgl: Gespräche, S. 130. 31 Ebd., S. 129. 32 Vgl. Grimm, Erk: Alptraum Berlin: Zu den Romanen Reinhard Jirgls. In: Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur 86.2 (1994), S. 186-200, hier S. 187. 25 Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 6 abgesonderten „Literaten“ in den Romanen Abschied von den Feinden und Hundsnächte festhält.33 Wieder zurück zum Überblick über die wichtigsten thematischen Veränderungen im Nachwendeschreiben Jirgls. Selbstverständlich gibt es genau beschreibbare Kontinuitäten in Jirgls Themen, die an den Lebensläufen von ehemaligen DDR-Protagonisten festzumachen sind. Seit Abschied von den Feinden ist jeder Roman Jirgls in der Schreibgegenwart des Autors angesiedelt, wobei Die atlantische Mauer einen Ausblick auf die mit der „Nekropole“ Berlin verbundene Vision der Metropole New York vorführt, etwas, was sichtlich die deutsche Thematik überschreitet. Ab diesem Roman kann man eine deutliche ‚Verwestlichung‘ der Themen feststellen, die schon im Figurenarsenal zu sehen ist. Zwar waren Ost-West-Vergleiche schon in Abschied von den Feinden und Hundsnächte am Beispiel von Übersiedlerschicksalen angestellt worden. Nun gesellen sich zu den aus dem Osten stammenden Figuren in Jirgls Rollenprosa auch westdeutsche Protagonisten, z. B. der Schriftsteller im zweiten Teil des Romans Die atlantische Mauer. Ja, der Wahnsinn der Figur des Ostberliner Schauspielers in Die atlantische Mauer wird in Abtrünnig. Roman aus der nervösen Zeit auf einen dem gesellschaftlichen Totalitarismus den Gehorsam aufkündigenden westdeutschen Journalisten übertragen, dessen Leben in Totschlag und Amoklauf endet. Zudem ist festzuhalten, dass sich auf der formal-ästhetischen Ebene in Jirgls Nachwendeschreiben einige signifikante Veränderungen abzeichnen. Sie reichen von den theatralischen Inspirationen des Frühwerks zur Verwendung von Hyperlinks, die diskursive Abschweifungen erlauben (Abtrünnig) bzw. die Familienfotos des Romans Die Stille über solche Links verbinden. Die ‚Verwestlichung‘ des Figurenarsenals ist nur nachvollziehbar, wenn man sieht, wie Jirgls aus allen Rohren schießende Kapitalismuskritik auf einer Parallelisierung der DDRDiktatur mit der subtilen „Diktatur der Oberfläche“ der spätkapitalistischen Gesellschaft basiert. Wie schon angesprochen, verwandte Jirgl die von Foucault übernommene Auffassung von der Straf- und Disziplinargesellschaft bereits in seiner frühen Prosa als ein Analyseinstrumentarium für die DDR-Gesellschaft. Schon zu DDR-Zeiten ist für den Autor ein „mit Beziehung auf Foucault ‚archäologischer‘ und ein ‚genealogischer‘ Blick auf den Schreib-(Arbeits-)Gegenstand Mensch [zentral], der hinausführt über bloß zeitverhaftet politische Gegebenheiten“34. Aus der Thematik der „Grabplatten menschlicher Beziehungen“35, der Erinnerung über Kulturen hinweg, ergibt sich das seltsam ahistorische Bild der „Wiederkehr des Immergleichen“36, also immerwährender „Herrschafts- und Untertänigkeitslust“, dem „Faschismus in uns allen“, etwas, was Jirgl auch als „dieses Deutsche in den Deutschen“ bezeichnet.37 Im MutterVaterRoman hatte Jirgl noch diese „ewigen Permutationen“ und Atavismen auf die Verhältnisse in der DDR bezogen.38 Nach der Wende wird in seiner pessimistischen Anthropologie der westliche Kapitalismus als ein den diktatorischen Strukturen der DDR ebenbürtiges „Terrorsystem“ analysiert, das über subtile Mechanismen funktioniert. Diese Thematik spielt in zunehmender Weise eine Rolle nicht nur in seinem Romanwerk, sondern auch in seinen Essays, die man als einen integralen Bestandteil seines Werks ansehen kann (45 Essays und Reden, zwei Essaybände). Die Themen sind vielfältig. Unter anderem geht es um die Wiederkehr der Traumata des 33 Magerski, Christine: Trostlose Landschaft mit Literat. Kritische Bemerkungen zum Versuch der Inszenierung einer literarischen Nullstunde nach 1989 am Beispiel Reinhard Jirgls. In: Glossen 13 (2001). URL: http://www2.dickinson.edu/glossen/heft13/trostloselandschaft.html, eingesehen am 3.5.2012. 34 Jirgl: Gespräche, S. 130. 35 Jirgl zitiert nach: Jung, S. 65. 36 Jirgl: Gespräche, S. 147. 37 De Winde, Arne: Die Foucault-Rezeption des Schriftstellers Reinhard Jirgl. In: Kammler, Clemens; Pflugmacher, Torsten (Hg.): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur seit 1989. Heidelberg 2004, S. 153-171, hier S. 158. Im Folgenden: De Winde: Foucault-Rezeption. 38 Jirgl: Gespräche, S. 147. Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 7 20. Jahrhunderts im spätkapitalistischen Totalitarismus des „Fetischs des Gelds“ und der zeitgenössischen Kommunikationsstrukturen. Eine neue Diktatur herrscht in den „CodeStrukturen“, deren „Realisation […] sich […] im inflationären Wuchern sogenannter Kommunikationseinrichtungen“39 vollzieht. Jirgl beobachtet auch, dass nach dem Zusammenbruch der DDR das Referenzsystem für Freund und Feind in der Massendemokratie verloren gegangen sei. In diesem referenzlosen Raum bestehe die „katastrophische Ironie“40 darin, dass es zu einem omnipräsenten Kriegszustand komme, einem irrationalen Freund-Feind-Denken, zu Rassismus und einer Verachtung und Ausgrenzung des „heruntergekommenen Sozialen“. Weiterhin gibt es in Jirgls Posthumanismus die von Foucaults Subversion des Wissens inspirierte Vorstellung der technischen Utopie, die er auf die Fortschrittsideologie der Aufklärung zurückbezieht und deshalb als „Nuklearität“41 bezeichnet. Jirgls stößt vor zu der Vorstellung der Selbstauslöschung des Menschen im Höchststadium seiner Intellektualität und technischen Möglichkeiten – sprich der Konstruktion der Atombombe. Im Folgenden sei eine kurze Einordnung der drastisch geäußerten Gesellschaftskritik des Autors unternommen, allein schon um die Frage nach dem „engagierten“ Schreiben des Autors noch einmal zu diskutieren. Jirgls radikale Standpunkte sind teilweise kritisch kommentiert worden. So vermerkt Erk Grimm den „Einsatz eines Gitters von Reizvokabeln“, und zwar in einer politisch kontaminierten Terminologie.42 Auf die Feststellung eines Neokonservatismus in Jirgls Essays hatte sich die Literaturkritik zu wiederholten Malen eingeschossen. De Winde, der eigentlich eine Verteidigung der Essays Jirgls gegen seine Angreifer unternimmt, summiert eine Reihe von Kritikpunkten: eine an Botho Strauß erinnernde nicht-linke Intellektualität, Jirgls Dialog mit Denkern der konservativen Revolution (Jünger, Spengler, Carl Schmitt) sowie der Topos des Abscheus vor der nivellierenden Massengesellschaft.43 Weiterhin stellt De Winde den Gestus der Verallgemeinerung und Universalisierung heraus, der nun wieder an die linken Positionen der Gesellschaftskritik der späten 1960er-Jahre, also Horkheimer und Adorno, gemahnt.44 Die Frage ist, ob in Jirgls Posthumanismus eine neokonservative, elitäre Attitüde oder eine ‚linke‘ Gesellschaftskritik dominiert. Ich möchte – trotz einiger aus der konservativen Kulturrevolution übernommenen nihilistischen Auffassungen des Autors – den Akzent auf seine ‚linke‘ Kulturkritik legen. Dies drängt sich schon aufgrund der sein Denken in zentraler Weise prägenden französischen Poststrukturalisten, namentlich Foucaults, auf. Weiterhin erweitert Jirgl in der Nachwendezeit seine ursprünglichen Standpunkte durch neue Lektüren und hieraus bezogene Argumente, z.B. im Kontext einer postmodernen Medienkritik, die sich wie eine Mischung aus Baudrillard’scher Simulationstheorie und Lacan’scher Terminologie liest: „So rückt Reales beständig aus der Authentizität ins Symbolische, und kein Wort, kein Bild oder Zeichen, das vom Amalgam des Symbolischen nicht sogleich besetzt würde.“45 Um Jirgl als einen von ‚linken‘ gesellschaftskritischen Standpunkten herkommenden Autor zu sehen, genügt schon ein Blick auf den Roman Abtrünnig. Hier wimmelt es von Beispielen härtester Sozialkritik, in deren Zentrum die Demütigungen eines freiberuflichen Journalisten 39 Ders.: Die Diktatur der Oberfläche. Über Traum und Trauma des 20. Jahrhunderts. In: Ders.: Beute, S. 33-52, hier S. 41. Im Folgenden: Jirgl: Diktatur. 40 Ders.: Zeit der niedrigen Himmel. Über zwei Dimensionen von Ironie. In: Ders.: Beute, S. 53-65, hier S. 56. 41 Ders.: Gespräche, S. 157. Siehe auch De Winde: Foucault-Rezeption, S. 163 ff. 42 Grimm, Erk: Die Lebensläufe Reinhard Jirgls. Techniken der melotraumatischen Inszenierung. In: Jirgl: Perspektiven, S. 197-226, hier S. 216. Im Folgenden: Grimm: Lebensläufe. 43 De Winde: Überlegungen, S. 93. 44 Ebd., S. 92. 45 Jirgl: Diktatur, S. 43. Die Anleihen an Baudrillard machen Jirgl natürlich nicht zu einem postmodernen Autor. Zur Diskussion von einigen „postmodernen und poststrukturalistischen Elementen“ im Schreiben Jirgls siehe: Jung. Hier findet sich aber auch der entscheidende Hinweis, dass „bestimmte Theoreme der Postmoderne, etwa die Beliebigkeit oder die Selbstreferentialität nicht in dieser Weise vorhanden sind.“ Ebd., S. 63. Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 8 stehen. Gespickt ist der Roman mit Hinweisen auf gesellschaftliche Missstände, die jedoch als Jirgls universalisierte, aus seinem genealogischen Geschichtsverständnis stammende Feindbilder zu verstehen sind. Man findet aktuelle kapitalismus- und medienkritische Diskurse, aber auch allumfassende Entsprechungen zwischen den Bildern der „Brachstätten“ aus deutscher Vergangenheit, der Schreckenszeit des Nationalsozialismus, und dem Metropolenwahn des neuen Berlin. In dem Roman hat Jirgl die Opfer des Holocaust mit dem hilflosen Agieren der Arbeitslosen im Spätkapitalismus ineins gesetzt und damit die Literaturkritik nicht wenig irritiert. Als letzter Teil der Untersuchung sollen die deutschen Geschichtsromane Die Unvollendeten und Die Stille in Hinblick auf die bereits angesprochene Kontinuitätsthese betrachtet werden. Hier geht es um die Frage, wie sich der Autor eines hochaktuellen Geschichts- und Erinnerungsthemas in der bundesrepublikanischen Gegenwartsliteratur annimmt und wie seine fiktionale Erinnerungsarbeit von den zu DDR-Zeiten, aber auch danach entwickelten philosophisch-ästhetischen Auffassungen bestimmt ist. 2003 erschien der Roman Die Unvollendeten, ein eindrucksvolles Epos der frühen Nachwendezeit und eine Beschreibung der hoffnungslosen Heimatsuche von sudetendeutschen Vertriebenen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, wobei der Roman schließlich in der Gegenwart des vereinten Deutschlands – Schauplatz Berlin – anlangt. 2009 folgt mit Die Stille eine weitere deutsche Familiensaga, die in weiten Teilen im Gebiet der ehemaligen DDR angesiedelt ist, aber als Jahrhundertroman, der zwei Weltkriege, zwei Diktaturen und fünf Staatensysteme umfasst. Auch das Thema der Vertreibung der Sudetendeutschen in Die Unvollendeten ist in einer übergreifenden Perspektive auf das Jahrhundert eingebettet. Es ist das „Jahrhundert der Lager & Vertreibungen“46. Interessant ist, dass Jirgl in seinem Nachwort zur Genealogie des Tötens darauf hinweist, dass sich ihm nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der „alten Manuskripte“ ein neues Schreibprojekt auftat, und zwar eines, das in seiner eigenen Familiengeschichte angelegt war, das autobiographische Material der Vertreibung. Übrigens war das Thema schon in Jirgls Erstling MutterVaterRoman präsent. Jirgl spricht von einem „weißen Fleck“ und vom „Ungelittenen“ in der Behandlung des Themas.47 Dies muss angesichts der zahlreichen Publikationen zu dem Thema überraschen. Zu denken ist an die Stellungnahmen zum Luftkrieg bei Winfried Georg Sebald und die Ausgestaltung des Themas der Deutschen als Opfer in der neueren Literatur, etwa bei Günter Grass, Hans-Ulrich Treichel und Tanja Dückers. Unverkennbar handelt es sich bei Jirgl um eine kulturpolitisch besetzte Gegenerinnerung. Der Autor stellt sich polemisch gegen die Erinnerungspolitik in der Berliner Republik mit ihrer „Schuld- und Schamkultur“ und folgert, ein „Wahrnehmungsdefizit“ sei weiterhin vorhanden.48 Zunächst eine kurze Synopse des Romans Die Unvollendeten: Im ersten und zweiten Teil wird die Vertreibung und Flucht einer „matriarchalisch“ dominierten Familie aus dem Sudetenland und ihre Ansiedlung in der Sowjetisch Besetzten Zone, später der DDR, dargestellt. Es ist die Geschichte von vier Frauen aus drei Generationen: Die 70-jährige Johanna, ihre Töchter Maria und Hanna sowie Hannas Tochter Anna. Im dritten Teil erzählt Annas illegitimer Sohn Reiner seine Biographie in der DDR und Nachwendezeit. Die Unvollendeten ist der am leichtesten zugängliche Roman Jirgls, nicht nur wegen der klar abgesteckten Problematik. In der Tat erstellt Jirgl in den Eingangskapiteln zunächst ein relativ konventionelles Geschichtstableau der Vertreibung der Sudentendeutschen aus dem Ort Komotau. Er beschreibt ihre Odyssee, die Gewaltszenen, das Verhalten der Tschechen gegenüber der deutschen Minderheit. Das Hauptaugenmerk von Jirgls Schilderung liegt allerdings auf der misslungenen Integration der Umsiedler. Die „matriarchalische“ 46 Ders.: Die Unvollendeten. München 2007, S. 22. Im Folgenden: Jirgl: Die Unvollendeten. Ders.: Nachlass, S. 822; Vgl. Ders.: Gespräche, S. 144. 48 Ders.: Gespräche, S. 144 ff. 47 Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 9 Familieneinheit erfährt Demütigungen und Ausschließungen, ist vom immerwährenden Flüchtlingsschicksal traumatisiert, erkennbar in dem Leitmotiv „einmal Flüchtling, immer Flüchtling“. Darüber hinaus suggeriert Jirgl aber auch, dass sich die Traumata der Vertriebenengeschichte auf den letzten männlichen Vertreter der Familie erstrecken, ohne dessen unmittelbare Zeitzeugenschaft der Vergangenheit. Der Protagonist Reiner leidet an der Dulder-Mentalität seiner Familie, ist unfähig zu familiären Bindungen. „Im-Grund brüllte ich gegen mich selber, gegen Das, was ich in=mir wußte von dieser ver!fluchten Bescheidenheit….. die ich von diesen Flüchtlingen geerbt hatte wie nen seelischen Buckel. Daher meine Wut auf sie.“49 Die Problematik von Jirgls Roman besteht in den „Unschärferelationen“ der (jüdischen) Opfer und der Täter des 2. Weltkriegs, etwas, was eine Debatte ausgelöst hatte.50 Ohne diese hier weiter auszuführen, will ich Grimms kritischen und wohldurchdachten Überlegungen zu Jirgls „Relativismus von Geschichtsinterpretationen“ im Roman Die Unvollendeten folgen, aber auch seine Beobachtung aufgreifen, dass nämlich in der „melotraumatischen Inszenierung“ von Familiengeschichte das „Empfinden der Gerechtigkeit auf die Kindheit zurückgebunden bleibt“.51 Zu sagen ist, dass Jirgl ein ‚objektiver‘ Umgang mit der Opfer-Täter-Problematik nicht wirklich interessiert. Man mag hier ein Manko in Hinblick auf Jirgls Absolutheitsanspruch der „Unrechts“-Benennung sehen, andererseits ist die personale Ethik des Autors zu berücksichtigen, wonach die Traumata der Menschheitsund Zeitgeschichte in den Leiden der Subjekte aufgezeigt werden sollen. In jedem Fall ist die abgründige, individuelle Beschädigungen auslotende Innenschau dafür verantwortlich, dass die Erinnerungswahrheiten, denen Jirgl in seinen Deutschlandromanen nachgeht, zwar im aktuellen Mainstream-Thema der Vertriebenen und dem Leiden der deutschen Zivilbevölkerung im 2. Weltkrieg angesiedelt werden, aber in den jeweiligen Lebensläufen subjektiv zugespitzt sind. So schließen die Portraits der seelischen Abgründe dieser Protagonisten sich nahtlos an die Hauptmotive zerrütteter familiärer Konstellationen im gesamten Romanwerk des Autors an. Hochemotionale Rückbindungen auf früheste Erfahrungen finden wir auch in Die Stille. Hier begegnet uns wiederum der Motivkomplex der vaterlosen Kindheit, der kindlichen Grunderfahrungen von Verlust, Verrat und Einsamkeit. Der Zerrspiegel der deutschen Geschichte im familiären Raum ist im Vergleich zu Die Unvollendeten nun auf ein ungleich weiteres geschichtliches Panorama ausgedehnt, in dem traumatisierende Geschichtsereignisse bis zum 1. Weltkrieg zurückverfolgt werden. Jirgl entwickelt in seinem Roman den Anspruch, die Leidenswege der historischen Subjekte in ihrer Alltagsgeschichte jenseits der „Kommandohöhen der jeweiligen Mächte“52 darzustellen. Überzeugend ist, wie Jirgl von dieser geschichtspessimistischen und ideologiekritischen Warte aus die illusionären Friedenszeiten zwischen den Kriegen als eine andere Art der Kriegsführung beschreibt und weiterhin hervorhebt: Nicht also das industrielle gefertigte Leid, was seinerseits in Blitz-Kampagnen auf Dasleben einschlägt: Vielmehr & viel öfter ist es die kaum fühlbare Dauer all jener gleichförmig=kaltblütigen Kleinigkeiten innerhalb des über-die-Zeit niederdrückend All-täglich Gemeinen, was mit seiner Beharrlichkeit ins Werk gesetzter Bosheit die-Menschen zermürben muß.53 49 Jirgl: Die Unvollendeten, S. 227. Siehe: Kammler, Clemens: Unschärferelationen. Anmerkungen zu zwei problematischen Lesarten von Reinhard Jirgls Familienroman Die Unvollendeten. In: Jirgl: Perspektiven, S. 227-234. 51 Grimm: Lebensläufe, S. 212. 52 De Winde, Arne; Philipsen, Bart: Transitzone/Über die Grenzen des Erträglichen. Briefgespräch mit Reinhard Jirgl vom 13.8.2010. URL: http://ny-web.be/transitzone/briefgespräch-jirgl.html, eingesehen am 3.5.2012, S. 2. 53 Jirgl, Reinhard: Die Stille. München 2009, S. 246. Im Folgenden: Jirgl: Die Stille. 50 Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 10 Jirgl will einerseits die familiären Traumata in kohärenter Weise nachzeichnen, andererseits aus ihnen ein gleichsam universalisiertes Bild der Erduldungsmentalität in den Geschichtsverläufen des 20. Jahrhunderts gewinnen. Hierfür benutzt er ein ganzes Arsenal dessen, was ‚typisch‘ kleinbürgerliches Bewusstsein ausmacht, wobei interessant ist, dass die Figuren in ihrer Mehrzahl gegen „dieses faschistische Deutsche in den Deutschen“ aufbegehren und ihm zu entrinnen suchen. Anders als in Die Unvollendeten sind die zentralen Figuren des Familienepos nicht von der seltsam anmutenden Binarität der (selbstzerstörerischen) Tugenden der Protagonistinnen und ihrer feindlichen Umgebung gezeichnet. Das Verständnis für die „Webfehler“ der Familienstrukturen wird wie in allen Jirgl-Romanen sorgfältig aufgebaut, d. h. psychoanalytisch ausgestaltet. Im Zentrum der aufzuarbeitenden zerrütteten Familiengeschichte, die von Inzest und zahlreichen Tragödien überschattet ist, stehen die Geschwister, der 69-jährige Georg und seine nur wenig jüngere Schwester Felicitas sowie beider Sohn Henry. Auf den ausgedehnten familiären Kosmos dieses umfangreichen Romans kann hier aus Platzgründen nicht genauer eingegangen werden, auch nicht auf die kunstvolle Verwendung der fast ein Jahrhundert dokumentierenden Fotos und ihre ‚Verlinkung‘. In einem „Staffellauf“ des Erzählens wird die Familiengeschichte – und zwar anders als in der klar konturierten Rollenprosa früherer Romane – in unvermittelt springenden und nicht immer klar identifizierbaren Erzählerstimmen aufgeblättert. Dies führt dazu, dass Jirgls Sprachkunst von der atemlosen Beschwörung innerer Zustände, den Details der teilweise grausam ausgemalten Geschichtsepisoden und der Fülle der Gesellschaftsreflexionen profitiert. Der chaotische, verwirrende, vielstimmige „Staffellauf“ dieses Geschichtsepos’ erhöht die Sensibilität des Lesers für die hochemotionalen Sprachbilder, die wilde Metaphorik und die aggressiven Pointen von Jirgls „Privatorthographie“. Die Entwicklungen der Protagonisten werden in einem großen erzählerischen Bogen entfaltet. Die Figur des Georg verstummt nach einem entscheidenden Ereignis, aber aus eigenem Entschluss. Dies versinnbildlicht das Leitmotiv der Stille als Abbruch der zwanghaften, selbstzerstörerischen Handlungen und Diskurse, in denen die Subjekte gefangen sind. Nun gibt es in dem nie abreißenden, grübelnden Gedankenfluss der Figuren die typisch Jirgl’schen Verallgemeinerungen düster klagender Weltanschauungen, die sich den Augenschein authentischer Erkenntnisse der Protagonisten geben. Man hat diese stereotypischen Aussagen in die „Übertreibungskunst“ des Autors einzuordnen, was auch für die unzählige Male wiederholten Hinweise auf die Erhellung familiärer Neurosen gilt. All dies gehört zu den Zuspitzungen von Jirgls Erzählen, das sich gänzlich unironisch den vom Autor absolut gesetzten sozialen und mentalen „Übeln“ zuwendet. Kein Zweifel: Dieses Schreiben ist den philosophisch-ästhetischen Ursprüngen des Autors in seiner DDR-Biographie tief verhaftet, so sehr sich auch auf formaler und reflektorischer Ebene in der Nachwendezeit eine spannende Weiterentwicklung seiner ursprünglichen Auffassungen und Ansätze zeigt. Man mag die monolithische Position Jirgls in der Gegenwartsliteratur als ein Beispiel sehen, in dem „der katastrophale Ich- und Weltzustand [...] zur glückenden Produktionsbedingung“54 wird. Das bedeutet aber nicht, dass Jirgl eine Marktnische in der Gegenwartswartsliteratur besetzen will. Zutiefst ist der Autor von seinen kultur- und geschichtsphilosophischen Anschauungen überzeugt, ja mehr noch, von dem einzigartigen literarischen Auftrag, dem er sich aufgrund seiner kritischen Analysen verpflichtet fühlt. Genau dies macht ihn zu einem letzten Vertreter der Ostmoderne in der deutschen Gegenwartsliteratur. In Jirgls jüngstem Roman können die Leser aufregende Entdeckungen in der katastrophischen Phantasie des Autors machen. Ich denke besonders an die Textpassage in 54 Grimm: Lebensläufe, S. 218. Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 11 Die Stille, die Jirgls „Nuklearitätstheorie“ belegt. Auf 13 Seiten ergießen sich die ungeheuren Bilder eines von der Natur, aber eigentlich vom Menschen verursachten Weltuntergangs. 55 Bereits 1988 hatte Jirgl in dem Lesedramolett MER die Katastrophenvision einer radioaktiv verseuchten Urlaubsinsel in der DDR entfaltet, und dies nicht nur als Chiffre für die diktatorischen Verhältnisse, sondern als apokalyptisches Bild schlechthin. In der ähnliche Motive enthaltenden Passage in die Die Stille zeigt sich, welche Entwicklungen der Autor hin zu seiner literarischen Meisterschaft durchlaufen hat. 55 Jirgl: Die Stille, S. 351-363. Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 12 Literaturverzeichnis Reinhard Jirgl - Abschied von den Feinden. München 1995. - Abtrünnig. Roman aus der nervösen Zeit. München 2008. - Die Unvollendeten. München 2007. - Die Stille. München 2009. - Genealogie des Tötens. München 2002. - Hundsnächte. München 1997. - Land und Beute. Aufsätze aus den Jahren 1996 bis 2006. München 2008. Jung, Werner: „Material muss gekühlt werden“. Gespräch mit Reinhard Jirgl. In: ndl 3.46 (1998), S. 56-70. De Winde, Arne; Philipsen, Bart: Transitzone/Über die Grenzen des Erträglichen. Briefgespräch mit Reinhard Jirgl vom 13.8.2010. URL: http://nyweb.be/transitzone/briefgespräch-jirgl.html, eingesehen am 3.5.2012. Sekundärliteratur Arnold, Heinz-Ludwig (Hg.): Reinhard Jirgl. Text + Kritik 189. München 2011. Clarke, David; De Winde, Arne (Hg.): Reinhard Jirgl. Perspektiven, Lesarten, Kontexte. Amsterdam; New York 2007. Dannemann, Karen: „Der blutig-obszöne=banale 3-Groschenroman namens Geschichte“. Gesellschafts- und Zivilisationskritik in den Romanen Reinhard Jirgls. Würzburg 2009. De Winde, Arne: Die Foucault-Rezeption des Schriftstellers Reinhard Jirgl. In: Kammler, Clemens; Pflugmacher, Torsten (Hg.): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur seit 1989. Heidelberg 2004, S. 153-171. Dotzauer, Gregor: Reinhard Jirgl und die Stimmen der Verschütteten. In: Tagesspiegel.de vom 9.7.2010. URL: http://www.tagesspiegel.de/kultur/georg-buechner-preisreinhard-jirgl-und-die-stimmen-der-verschuetteten/1879564.html, eingesehen am 3.5.2012. Emmerich, Wolfgang: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Erw. Neuausg. Leipzig 1996. Grimm, Erk: Reinhard Jirgl. In: Arnold, Heinz-Ludwig (Hg.): Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 85. Nlg. 3 (2007). Ders.: Alptraum Berlin: Zu den Romanen Reinhard Jirgls. In: Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur 86.2 (1994), S. 186-200. Ledanff, Susanne: Die Suche nach dem „Wenderoman“ – zu einigen Aspekten der literarischen Reaktionen auf Mauerfall und deutsche Einheit in den Jahren 1995 und 1996. In: Glossen 2 (1997), S. 1-13. URL: http://www2.dickinson.edu/glossen/heft2/wende.html, eingesehen am 14.6.2013. Dies.: Mythische Alptraumlandschaften. Der Sonderfall der Metropolen- und Berlindarstellung Reinhard Jirgls. In: Dies.: Hauptstadtphantasien. Berliner Stadtlektüren in der Gegenwartsliteratur 1989-2008. Bielefeld 2009, S. 346-376. Magerski, Christine: Trostlose Landschaft mit Literat. Kritische Bemerkungen zum Versuch der Inszenierung einer literarischen Nullstunde nach 1989 am Beispiel Reinhard Jirgls. In: Glossen 13 (2001). URL: http://www2.dickinson.edu/glossen/heft13/trostloselandschaft.html, eingesehen am 3.5.2012. Pessimismus als Stilprinzip – Reinhard Jirgls Schreiben im vereinten Deutschland 13 Ludwig, Janine; Meuser, Mirjam: Literatur ohne Land? Schreibstrategien einer DDR-Literatur im vereinten Deutschland. Freiburg 2009. Radisch, Iris: Es gibt zwei deutsche Gegenwartsliteraturen in Ost und West! In: Fischer, Gerhard; Roberts, David (Hg.): Schreiben nach der Wende. Ein Jahrzehnt deutscher Literatur 1989-1999. 2. unveränd. Aufl. Tübingen 2007, S. 1-14. Spreckelsen, Tilman: Mit Hellsicht geschlagen. In: Faz.net vom 9.10.2010. URL: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/bedeutendster-deutscher-literaturpreisreinhard-jirgl-mit-buechner-preis-ausgezeichnet-1638842.html, eingesehen am 3.5.2012.