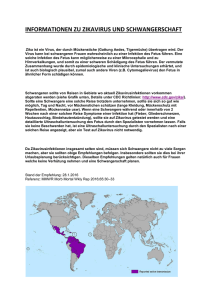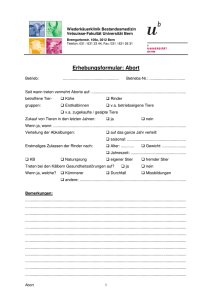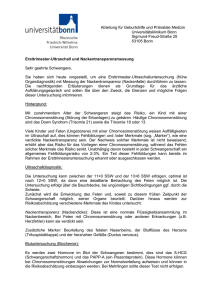Krens, I., Krens, H. (Hg.): Grundlagen einer
Werbung
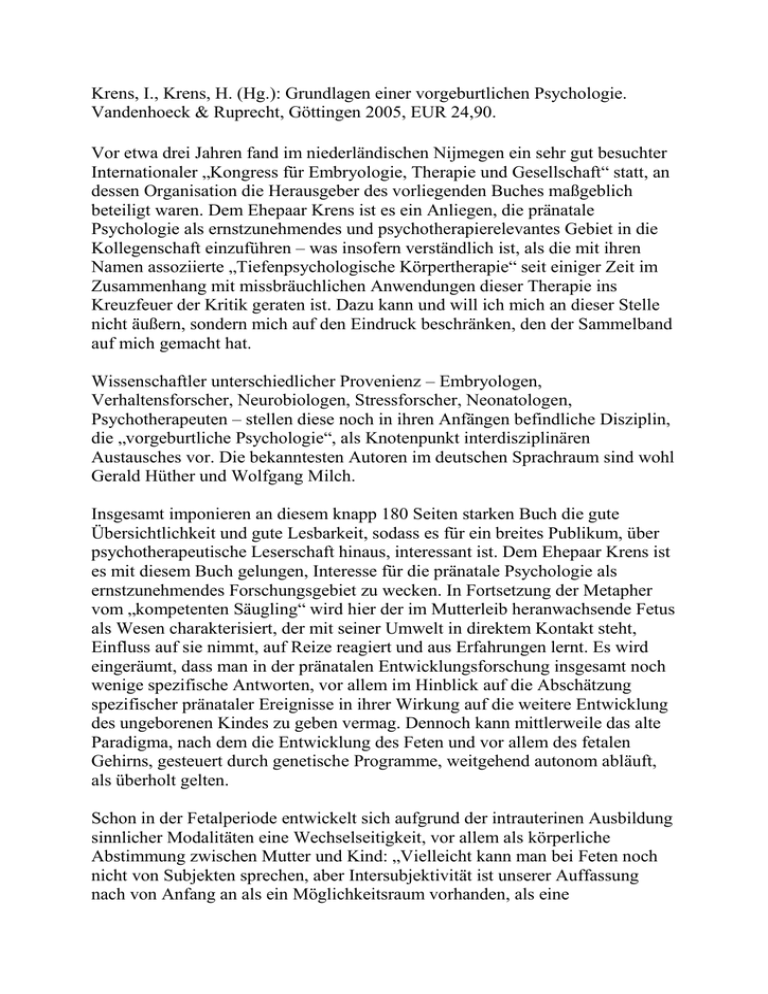
Krens, I., Krens, H. (Hg.): Grundlagen einer vorgeburtlichen Psychologie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005, EUR 24,90. Vor etwa drei Jahren fand im niederländischen Nijmegen ein sehr gut besuchter Internationaler „Kongress für Embryologie, Therapie und Gesellschaft“ statt, an dessen Organisation die Herausgeber des vorliegenden Buches maßgeblich beteiligt waren. Dem Ehepaar Krens ist es ein Anliegen, die pränatale Psychologie als ernstzunehmendes und psychotherapierelevantes Gebiet in die Kollegenschaft einzuführen – was insofern verständlich ist, als die mit ihren Namen assoziierte „Tiefenpsychologische Körpertherapie“ seit einiger Zeit im Zusammenhang mit missbräuchlichen Anwendungen dieser Therapie ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist. Dazu kann und will ich mich an dieser Stelle nicht äußern, sondern mich auf den Eindruck beschränken, den der Sammelband auf mich gemacht hat. Wissenschaftler unterschiedlicher Provenienz – Embryologen, Verhaltensforscher, Neurobiologen, Stressforscher, Neonatologen, Psychotherapeuten – stellen diese noch in ihren Anfängen befindliche Disziplin, die „vorgeburtliche Psychologie“, als Knotenpunkt interdisziplinären Austausches vor. Die bekanntesten Autoren im deutschen Sprachraum sind wohl Gerald Hüther und Wolfgang Milch. Insgesamt imponieren an diesem knapp 180 Seiten starken Buch die gute Übersichtlichkeit und gute Lesbarkeit, sodass es für ein breites Publikum, über psychotherapeutische Leserschaft hinaus, interessant ist. Dem Ehepaar Krens ist es mit diesem Buch gelungen, Interesse für die pränatale Psychologie als ernstzunehmendes Forschungsgebiet zu wecken. In Fortsetzung der Metapher vom „kompetenten Säugling“ wird hier der im Mutterleib heranwachsende Fetus als Wesen charakterisiert, der mit seiner Umwelt in direktem Kontakt steht, Einfluss auf sie nimmt, auf Reize reagiert und aus Erfahrungen lernt. Es wird eingeräumt, dass man in der pränatalen Entwicklungsforschung insgesamt noch wenige spezifische Antworten, vor allem im Hinblick auf die Abschätzung spezifischer pränataler Ereignisse in ihrer Wirkung auf die weitere Entwicklung des ungeborenen Kindes zu geben vermag. Dennoch kann mittlerweile das alte Paradigma, nach dem die Entwicklung des Feten und vor allem des fetalen Gehirns, gesteuert durch genetische Programme, weitgehend autonom abläuft, als überholt gelten. Schon in der Fetalperiode entwickelt sich aufgrund der intrauterinen Ausbildung sinnlicher Modalitäten eine Wechselseitigkeit, vor allem als körperliche Abstimmung zwischen Mutter und Kind: „Vielleicht kann man bei Feten noch nicht von Subjekten sprechen, aber Intersubjektivität ist unserer Auffassung nach von Anfang an als ein Möglichkeitsraum vorhanden, als eine konstituierende Bedingung des auftauchenden Selbst, das bereits ein charakteristisches subjektives Design aufweist“ (Milch S. 149). Eine ungefähre Ahnung von den pränatalen regulatorischen Möglichkeiten, die dem Feten zur Verfügung stehen, kann man bekommen, wenn man sich die Entwicklung der Sinneskanäle vor Augen hält. Ein auditorischer Reiz löst von der 20. bis 24. Schwangerschaftswoche an eine motorische Reaktion aus und ab der 28. Woche eine Steigerung der Herzschlagrate. Die Reaktion des Feten wird durch die Art des Geräusches, seine Häufigkeit, seine Intensität, seine Dauer und durch den momentanen Verhaltenszustand des Feten beeinflusst. Auch auf einen basalen Geruchs- und Geschmackssinn kann der Fetus zurückgreifen, und diese beiden Sinneskanäle fungieren intrauterin Hand in Hand. Aufgrund der Fähigkeit des Säuglings, Gerüchte und Geschmacksnoten wiederzuerkennen, geht man von der Annahme eines ab der Geburt funktionierenden chemosensorischen Systems aus, auch wenn bisher unbekannt ist, wann es sich entwickelt. Somatosensorische Reize sind die ersten, die eine Wirkung auf den Feten ausüben. Wenn er in der 8. Schwangerschaftswoche an den Lippen berührt wird, reagiert er mit Bewegung; diese Reaktionsbereitschaft dehnt sich allmählich auf die Wangen, die Stirn, die Handflächen und danach auf die Oberarme aus. Außer dem Rücken und der Schädeldecke reagieren alle Körperteile von der 14. Schwangerschaftswoche an auf Berührung. Von da an stimuliert sich der Fetus auch selbst. Ab der 13. Schwangerschaftswoche nimmt die Hand des Feten Kontakt mit seinem Mund auf und man kann beobachten, dass der Fetus am Daumen saugt – d. h. ein kinästhetischer Sinn entwickelt sich, der sich auf der Position der verschiedenen Körperteile untereinander stützt. Ab der 25. Schwangerschaftswoche zeigt der Fetus den sog. Aufrichtungsreflex und begibt sich gegen Ende der Schwangerschaft in eine bevorzugte Position, was auf ein funktionierendes vestibuläres System, das die Position des Körpers im Raum in Beziehung zur Schwerkraft reguliert, schließen lässt. Bisher ist umstritten bzw. unbekannt, ob der Fetus Schmerz spürt; auf Stressreize reagiert er ab der 23. Schwangerschaftswoche. Da der mütterliche Organismus für eine gleich bleibende Temperatur in der Gebärmutter sorgt, ist unwahrscheinlich, dass der Fetus größere Temperaturschwankungen spürt. Im letzten Schwangerschaftsdrittel hört der Embryo bereits die Stimme seiner elterlichen Bezugsperson und kann sich nach der Geburt erkennen. Zu dieser Zeit werden auch durch die Zusammensetzung des Fruchtwassers bedingte Geruchs- und Geschmacksempfindungen verarbeitet und als frühe Erfahrungen verankert. Von den Brustwarzen der stillenden Mütter werden identische Pheromone abgegeben, die auch im Fruchtwasser enthalten waren. Ändert man die Duftstruktur des Fruchtwassers, suchen neugeborene Kaninchen die spezifischen Duftzugaben überall dort, wo es darnach riecht. Auch beim Menschen scheint es so zu sein, dass Geschmack und Geruch der Muttermilch dem Neugeborenen bereits vertraut sind. Im Mutterleib wird bereits sehr viel gelernt. Die intrauterinen Lernvorgänge manifestieren sich auf Gehirnebene in zunehmend effizienteren neuronalen Verknüpfungen und in autonomer werdenden Teilfunktionen. Alles, was ein Neugeborenes an Kompetenzen scheinbar automatisch mit auf die Welt bringt, „hat es intrauterin bereits erfahren, kennen gelernt und in der einen oder anderen Weise bereits „geübt“. Das gilt für die Bewegungskoordination, für die Gleichgewichtsregulation, für die Atmung, für einfache Greifreflexe, aber auch für sehr gezielte Handlungen wie beispielsweise das Daumenlutschen“ (Hüther S. 53-54). Diese umfassende Lernfähigkeit des Feten wird biologisch begründet: Es ist für sein Überleben wichtig, dass bestimmte Bewegungen und Funktionen (wie die Atemfunktion) bereits im Vorfeld geübt werden, um sicherzustellen, dass sie gut funktionieren, wenn sie gebraucht werden (Hepper S. 76). Zu diesem Lernen gehören auch all jene Fähigkeiten, die den späteren Säugling in die Lage versetzen, die eigene Mutter wiederzuerkennen. Da das visuelle System des Neugeborenen noch nicht ausgereift ist, liefert der Gehör- und Geruchssinn die beste Grundlage für das Erkennen von Menschen in seiner Umgebung, denn diese beiden Sinne funktionieren auch über die Entfernung ohne direkten Blickkontakt zwischen Mutter und dem Neugeborenen. „Indem er etwas über seine wichtigste Bezugsperson lernt, stellt der Fetus sicher, dass er bevorzugt auf den Menschen reagiert, der sich nach der Geburt mit großer Wahrscheinlichkeit um ihn kümmert. Dieser Vorgang stellt wahrscheinlich auch den Beginn der Bindung dar. Die Mutter (oder eher die Gruppe von Reizen, die die Mutter ausmachen) ist der einzige bekannte Reiz, den das Neugeborene kennt, und stellt daher die ideale und sichere Basis dar, von der aus der neugeborene Säugling seine Umgebung erkunden und etwas über sie lernen kann“ (Hepper S. 77). Interessant fand ich auch die Überlegungen zum Körper-Gedächtnis, die auf die umfassende Bedeutsamkeit des „impliziten Wissens“ hinauslaufen: „Alles, was auf den Einfluss vergangener Erfahrungen auf bestimmte, durch die Beschaffenheit der jeweiligen Lebenswelt ausgelöste Veränderungen der Genexpression oder der Herausformung bestimmter Merkmale zurückzuführen ist, muss als eine in der Struktur des sich entwickelnden Organismus festgehaltene Erinnerung an das betreffende Ereignis verstanden werden. Als Gedächtnis wären dann all die vielen Spuren zu betrachten, die sich als Folge der Interaktionen eines Lebewesens mit der äußeren Welt in seine Struktur und seine innere Organisation eingegraben haben. So betrachtet besitzt jede Zelle, jedes Organ, jedes Individuum, ja sogar jede Lebensgemeinschaft ihr eigenes, durch ihre jeweiligen bisher gemachten Erfahrungen herausgeformtes Gedächtnis. Das menschliche Gehirn zeichnet sich dabei nur durch eine Besonderheit aus: Es kann die spezifischen Verhaltensmuster, die durch bestimmte Erfahrungen als innere Repräsentanzen im Gehirn herausgeformt worden sind, zu späteren Zeitpunkten wieder aktivieren und damit ein inneres Erinnerungsbild der betreffenden Erfahrungen erzeugen... Deshalb sind all jene Erfahrungen, die bereits im Säuglingsalter oder gar intrauterin gemacht werden, zwar im Gedächtnis der Zellen, einzelner Organe, einzelner Hirnbereiche oder des ganzen Körpers abgespeichert. Sie können jedoch nicht bewusst explizit erinnert oder mitgeteilt werden“ (Hüther S. 60-61). Daraus folgert er: „Während der ersten drei Lebensjahre, wenn die Fähigkeit zur bewussten Erinnerung allmählich herausgeformt wird, kommt es im Gehirn, insbesondere in den höheren assoziativen Zentren des Kortex, zu tief greifenden Reorganisationsprozessen. Es ist denkbar, dass von diesen Umbauprozessen auch solche Verschaltungen mit erfasst werden, die durch vorher gemachte, frühe Erfahrungen entstanden sind. Dann ließen sich unter Umständen später, wenn die Fähigkeit zum bewussten Erinnern voll ausgereift ist, diese früh entstandenen inneren Bilder zumindest bruchstückhaft, sehr verschwommen oder vorwiegend über Körperempfindungen abrufen“ (Hüther S. 61-62). Fazit: Innerhalb der Psychotherapie und im Speziellen der Psychoanalyse wird seit geraumer Zeit mehr und mehr auf die Bedeutsamkeit körperlicher Austauschprozesse hingewiesen – Stichworte „nonverbale Kommunikation“ und „Enactment“. Diese Schwerpunktverschiebung in der Betrachtung des psychotherapeutischen Geschehens hat im Prinzip weitreichende technische Konsequenzen, v. a. im Hinblick auf die Art der Handhabung der Gegenübertragung. Die Videomikroanalyse interaktiver Prozesse hat dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet. Nun können wir u. a. aufgrund moderner Ultraschalltechnik auch den Feten, innerhalb eines gewissen Rahmens, als kompetenten Interaktionspartner begreifen. Auf die Konsequenzen dieser Erweiterung der Sicht des Menschen in allen möglichen Anwendungsfeldern, nicht nur im psychotherapeutischen Bereich, können wir jetzt schon gespannt sein. Peter Geißler, Neu-Oberhausen bei Wien