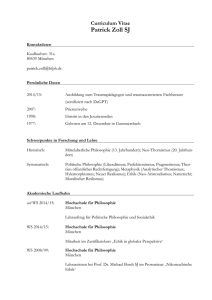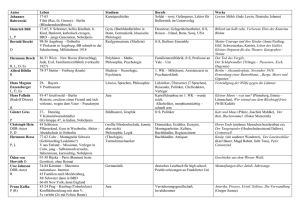Vs 5
Werbung

1 Vs 5 Idealismuskritik im Namen der Wirklichkeit und der Wissenschaft: Ludwig Feuerbach I. Rekapitulation: Nach-systematische Philosophie in neuen Textgattungen II. Feuerbach: Eine neue Philosophen-Biographie III. Feuerbachs „Philosophie der Zukunft“: „das Wirkliche in seiner Wirklichkeit“ IV. Literarische Realismen bei Gottfried Keller und Adalbert Stifter: „Ideal-Realismus“ 2 I. Rekapitulation: Nach-systematische Philosophie in neuen Textgattungen Zu den Vorwürfen, die man gegen eine „bloß“ historisch verfahrende Betrachtung von Philosophie erheben kann, gehört, daß man sich in dieser Verfahrensweise „nur“ mit Texten (und nicht mit Gedanken, Wahrheiten o.ä., die dem Anspruch nach unabhängig von einzelnen Texten formulierbar sein sollten) befaßt. Man kann jedoch – und sollte! – die direkte Gegenthese vertreten: nur indem man Philosophie anhand von Texten betrachtet, kommt man tatsächlich an die relevanten Aussagen heran. Damit ist nicht einfach behauptet, daß Philosophie ohne Textualität keine Aussicht auf Vermittlung hätte. Man kann eine sehr viel einfachere Konsequenz ziehen, die im philosophischen Alltagsleben weiterhilft: Die Betrachtung des Charakters der Texte, in denen Philosophie überliefert ist, bietet eine entscheidende Verständnishilfe nicht nur für einzelne Texte, sondern auch für die Zusammenhänge zwischen Texten, also auch für historische Entwicklungen. Daß in Texten auch nicht-diskursive Elemente, Schreib- und Denkformen der jeweiligen Alltagspraxis ihrer Entstehungszeit eingehen, läßt jede Betrachtung, die solches ausklammert und auf reine Gedanken zielt, als eine Einschränkung erscheinen. Ein Beispiel für diese Ebenendurchdringung: Kierkegaards Tagebuch des Verführers, 1843 als Schlußabschnitt eines philosophischen Werkes dieses in Romanform abrundend, zitiert Hegel: „Das Bestehende ist das Vernünftige“ (S. 25), verlegt Hegel aber in das Kalkül des auf feinst gesteigerte Lust bedachten Verführers, der abwägt, ob es besser sei, im dunklen Treppengang das Gesicht einer jungen Frau zu sehen oder aber die von dieser ihrem Verehrer zugeflüsterten Worte im Schutz der Dunkelheit zu erlauschen: „Das Bestehende ist das Vernünftige, ich bin und bleibe Optimist...“: Die Affirmation der Wirklichkeit wird integriert in eine Strategie zur Selbstgestaltung der Welt unter der Maxime einer konsequent eingesetzten, aber auf das jedenfalls aus klassisch-idealistischer Perspektive widervernünftige Ziel der Lustmaximierung bedachten Vernunft. Die idealismuskritischen Positionen der Jahrhundertmitte kann man an Hegels Anspruch anschließen, mit den Mitteln der Vernunft die Wirklichkeit vollständig erfaßt zu haben. Inwiefern gerät man mit der Wirklichkeit in Konflikt? Zunächst gibt es bei allen Idealisten einen sogar ausgesprochen starken Wirklichkeitsbezug; bei Kant: Begriffe ohne Anschauung sind leer; bei Fichte: Subjektive Evidenz, also eine wenigstens innere Wirklichkeit ist zentral; bei Schelling: Natur einbeziehen; Hegel fordert dringlich, nicht nur abstrakt zu denken. Idealistische Autoren entdecken zudem die Vielschichtigkeit von 3 Wirklichkeit; nicht nur die Wirklichkeit der äußeren Beobachtung, sondern auch Geschichte, Religion, der ganze Bereich innerer, geistiger Leistungen wird einbezogen. Ein Konfliktpotential entsteht, wenn die philosophische Zugriffsweise Universalität oder Absolutheit beansprucht. Eine echte Alternative wird erst dann erstehen, wenn es neuartige wirklichkeitsverbürgende Instanzen gibt. Solche Instanzen können die einzelnen Wissenschaften sein, die sich unmittelbar mit ihrer Entdeckung im Rahmen der philosophischen Fakultät aus dieser zu verselbständigen beginnen. Beispiel: Der bedeutende Botaniker Matthias Jakob Schleiden, wie Feuerbach 1804 geboren, greift in die Debatte mit einer scharfen Kritik an Hegels und Schellings Naturphilosophie ein (1843: Schellings und Hegels Verhältnis zur Naturwissenschaft), in der er u.a. das Hegelsche Mißgeschick der problematischen Vorhersage der Planetenabstände genüßlich ausbreitet. Seine Alternative besteht in einer soliden Methodologie der Einzelwissenschaften, in seinem Fall der beobachtenden Biologie. II. Feuerbach: Neue Philosophen-Biographie Ludwig Feuerbach: Karriere neben der Universität (mit gelegentlichen Berührungen) als philosophischer Privatgelehrter, was nur unter Einbringung eines gewissen privaten Vermögens möglich war. Die Parallelen zu Schopenhauer sind auffällig; beide studieren im Umkreis der klassischen deutschen Philosophie, beide bemühen sich zumindest zeitweise um eine Universitätskarriere, und beide entsagen dieser Karriere. Die außeruniversitäre Philosophiekarriere bleibt für den weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts ein erfolgreiches Modell: Marx, Engels, Nietzsche, Kierkegaard, Freud... Ludwig Feuerbach (1804-1872) 1804 geb. in Landshut ab 1823 Studium zunächst der Theologie in Heidelberg, dann der Philosophie in Berlin 1828 Promotion in Erlangen: De ratione una, universali, infinita ab 1833 Gibt die akademische Lehrtätigkeit auf; wohnhaft bei Nürnberg 4 Geschichte der neueren Philosophie von Bacon von Verulam bis Benedikt Spinoza 1839 u.a. Zur Kritik der Hegelschen Philosophie 1841 Das Wesen des Christentums 1842/43 Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie / Grundsätze der Philosophie der Zukunft 1872 gestorben; in Nürnberg begraben III. Feuerbachs „Philosophie der Zukunft“: „das Wirkliche in seiner Wirklichkeit“ Feuerbachs Texts sind immer wieder getragen von einer eigenartigen Doppelbödigkeit zwischen genüßlich ausgeführter Denunziation wertgeschätzter Phänomene und einem sehr ernsthaften Bemühen und Erklärung und damit auch um ein Verstehen dieses Phänomens. Der Themenkreis der Philosophie ändert sich damit in markanter Weise: auch ein Phänomen, das bei weitem nicht das ist, für das es gehalten wird, ja das sogar viel eher das Gegenteil dessen darstellt, was man mit ihm verbindet, ist ein völlig legitimer Gegenstand der philosophischen Reflexion. Philosophie ist nicht mehr der Aufbau eines Systems absolut gesicherter Wahrheiten, sondern eine Form der Analyse von Wahrheitsansprüchen. Doppelter Bezug zu Hegel (Kritik der Hegelschen Philosophie, S. 71): „Eitelkeit ist darum die Spekulation, die sich seither gegen Hegel erhoben und geltend gemacht hat – die Spekulation der Positivisten; denn statt über Hegel hinauszugehen, ist sie tief unter Hegel hinabgefallen, indem sie nicht verstanden hat gerade die bedeutungsvollsten Winke, die Hegel, und schon vor ihm Kant und Fichte, freilich in ihrer Art, gegeben haben. Die Philosophie ist die Wissenschaft der Wirklichkeit in ihrer Wahrheit und Totalität; aber der Inbegriff der Wirklichkeit ist die Natur (Natur im universellsten Sinne des Wortes). Die tiefsten Geheimnisse liegen in den einfachsten natürlichen Dingen, die der jenseits schmachtende phantastische Spekulant mit Füßen tritt. Die Rückkehr zur Natur ist allein die Quelle des Heils.“ Beispiele: Zur Natur des Menschen gehört nicht nur die „gemeine Werkstatt des Magens“, sondern auch der „Tempel des Gehirns“; nicht nur die „Darmzotten“, sondern auch „Ohren, die nur die Harmonie der Töne, und Augen, die nur das himmlische selbstlose Wesen des 5 Lichts entzückt.“ Alle diese Aspekte des Menschen treten damit, insofern sie alle gleicherweise natürlich sind (hierin steckt eine starke These!) nebeneinander. Feuerbach verbindet mit diesem Insistieren auf der Wirklichkeit der Natur die Forderung nach Vertrauen auf die Sinne und ihre Leistung auch im Bereich der Philosophie; er vertritt eine Form von Sensualismus, die sehr gut zu einer Orientierung nicht nur an der Natur, sondern auch an den Naturwissenschaften passt (Vorrede zur zweiten Auflage des Wesens des Christentums von 1843): „Ich bin himmelweit unterschieden von den Philosophen, welche sich die Augen aus dem Kopfe reißen, um desto besser denken zu können; ich brauche zum Denken die Sinne, vor allem die Augen, gründe meine Gedanken auf Materialien, die wir uns stets nur vermittelst der Sinnentätigkeit aneignen können, erzeuge nicht den Gegenstand aus den Gedanken, sondern umgekehrt den Gedanken aus dem Gegenstande, aber Gegenstand ist nur, was außer dem Kopfe existiert.“ Beide Aspekte werden zusammengefaßt werden in folgendem Zitat: „Als ein Spezimen dieser Philosophie nun, welche nicht die Substanz Spinozas, nicht das Ich Kants und Fichtes, nicht die absolute Identität Schellings, nicht den absoluten Geist Hegels, kurz, kein abstraktes, nur gedachtes oder eingebildetes, sondern ein wirkliches oder vielmehr das allerwirklichste Wesen, das wahre Ens realissimum: den Menschen, also das positivste Realprinzip zu ihrem Prinzip hat, welche den Gedanken aus seinem Gegenteil, aus dem Stoffe, dem Wesen, den Sinnen erzeugt, sich zu ihrem Gegenstande erst sinnlich, d.i. leiden, rezeptiv verhält, ehe sie ihn denkend bestimmt, ist also meine Schrift“. Neben der Kritik insbesondere an deren Entfernung von der sinnlich erfaßbaren Wirklichkeit steht eine strukturelle Gemeinsamkeit: Auch Feuerbach sucht nach einem Prinzip, das mit theologischen bzw. religionsphilosophischen Terminis beschrieben wird, nämlich: der Mensch, aber eben nicht mehr als absolutes Subjekt, sondern in allen seinen natürlichen Aspekten. Alle diese Aspekte gehen in die Leistungen ein, die Feuerbach rekonstruiert. Er möchte beispielsweise Religion aus Sicht der Anthropologie untersuchen, d.h. aber nicht einfach sie als menschliches Gedankenprodukt analysieren, sondern alle Ebenen des Menschen, also etwa auch dessen Triebe, Gefühle, Bedürfnisse einbeziehen. Dies bedeutet natürlich eine Denunziation der traditionellen Idealkonzeption von Religion als hehres Geistes- oder Inspirationsprodukt, zugleich liefert diese Betrachtung aber auch eine Erklärung von Religion, die aufgrund der Prinzipienstellung von Natur und natürlich aufgefaßtem Menschen ihrerseits hochrangig anzusetzen ist. Die konkrete Umsetzung dieses Programms läßt sich anhand seiner Grundsätze der Philosophie der Zukunft verfolgen. 6 Ausgangspunkt ist wiederum die Theologie, aber bereits im ersten Satz wird die Verwandlung und Auflösung der Theologie in die Anthropologie gefordert. Wesentlicher Kritikpunkt an traditioneller Philosophie und Theologie ist (§ 6) das Ausschließen von Sinnlichkeit. § 7: „Was im Theismus Objekt, das ist in der spekulativen Philosophie Subjekt; was dort das nur gedachte, vorgestellte Wesen der Vernunft, ist hier das denkende Wesen der Vernunft selbst.“ Der Mensch wird (§ 8) in den Standpunkt Gottes versetzt., als reiner Geist, „ohne Leidenschaften, ohne Bestimmungen von außen“ (§ 10) verstanden. Sein Gegenprogramm formuliert Feuerbach in § 31: „Die neue Philosophie, welche das Konkrete nicht auf abstrakte, sondern auf konkrete Weise denkt, die das Wirkliche in seiner Wirklichkeit, also auf eine dem Wesen des Wirklichen entsprechende Weise als das Wahre anerkennt und zum Prinzip und Gegenstand der Philosophie erhebt: Sie ist daher erst die Wahrheit der Hegelschen, die Wahrheit der neueren Philosophie überhaupt.“ Als Folgerung: Die Sinnlichkeit ist die Wahrheit der Idee. § 32: „Wahrheit, Wirklichkeit, Sinnlichkeit sind identisch.“ § 33 „Die neue Philosophie berücksichtigt das Sein, wie es für uns ist, nicht nur als denkende, sondern als wirklich seine Wesen“; „Das Sein als Gegenstand des Seins ist das Sein des Sinns, der Anschauung, der Empfindung, der Liebe“; „Die Liebe ist Leidenschaft, und nur die Leidenschaft ist das Wahrzeichen der Existenz.“ Damit wird die Frage dringlich, wer oder was eigentlich dieser Mensch ist. Feuerbach wendet sich ganz offenkundig gegen die Abstraktion, die dem Menschen als Subjekt der idealistischen Philosophie zugrundelag. Eine Wirklichkeit, die auf einen derart abstrakten Menschen zugreift, muß abstrakt bleiben; wenn wir die Wirklichkeit in ihrem konkreten Wesen erfassen wollen, brauchen wir hierzu auch einen konkreten Menschen, der sich nicht an den Ort eines Gottes setzt, sondern anthropologisch real erfaßt ist. § 36: „Ich bin ein wirkliches, ein sinnliches Wesen; ja der Leib in seiner Totalität ist mein Ich, mein Wesen selber.“ Dies wird wiederum in eine erkenntnistheoretische Strategie umgesetzt: § 37: Zu suchen ist nach einem unmittelbar Gewissen: „Sonnenklar st nur das Sinnliche“. Auch die Religion ist an sinnliche Anschauung, nicht an Vorstellung gebunden, wie Feuerbach in seinen Überlegungen zur anthropologischen Fundierung Gottes behauptet; § 39: „Der Gott im Menschen ist nichts anderes als das Wesen des Menschen.“ Feuerbach integriert dies in eine erkenntnistheoretische Position, die nicht einfach zurückgeht auf einen klassischen Empirismus oder Sensualismus, sondern diesen 7 verbinden möchte mit den Errungenschaften des Idealismus. Er möchte Begriffe von Wesen, Notwendigkeit etc. nicht abschaffen, sondern lediglich verhindern, daß damit die Welt in zwei Reiche zerfällt. Diese Unterschiede sind selbst nur innerhalb der Sinnlichkeit zu ziehen: Beispiel Linnés Klassifikation von Pflanzen Folgerungen/Zusammenfassungen: § 43: Abhängigkeit Mensch-Welt; „Hast du nichts, so bist du nichts.“ § 54: „Die neue Philosophie macht den Menschen mit Einschluß der Natur, als der Basis des Menschen, zum alleinigen, universalen und höchsten Gegenstand der Philosophie – die Anthropologie also, mit Einschluß der Physiologie, zur Universalwissenschaft.“ 8 VS 6 Wissenschaft statt Philosophie: Programme für eine naturwissenschaftlich ausgerichtete Philosophie I. Philosophie und Wissenschaften werden anrüchig 2. Hermann von Helmholtz: Die Tatsachen in der Wahrnehmung 3. Radikale Alternativen und wissenschaftsbegründete Kompromißlösungen: Haeckel und Du Bois-Reymond 4. Zusammenfassung: Wissenschaft und Wirklichkeit Die „vulgären“ Materialisten: Hermann von Helmholtz (1821-1894): Ludwig Büchner allgemein anerkannter Carl Vogt Universalwissenschaftler und populärer Jacob Moleschott Philosoph „Denken ist Phosphor“ - Realismus „Gedanken als Exkremente des Gehirns“ - Empirismus - unbewußte Schlüsse - Zeichentheorie - physiologisches Apriori Emil du Bois-Reymond (1818-1896): Das Ernst Haeckel (1834-1920): Streitbarer und „Ignorabimus“ des Physiologen umstrittener anti-materialistischer Monist Monismus Zwei Welträtsel: Ursprung der Materie Zellseelen und Ursprung des Bewußtseins Entwicklungstheorie 9 I. Philosophie und Wissenschaften werden anrüchig Zolas Roman experimental; Beispiel: Thérèse Raquin, Vorwort: 1868: „Ich habe Gestalten gewählt, die allmächtig von ihren Nerven und ihrem Blute beherrscht werden, keinen freien Willen besitzen und zu einer jeden Handlung ihres Lebens von dem Verhängnis ihres Leibes gezwungen werden. Thérèse und Lorenz sind menschliche Tiere, nichts weiter. Ich habe in diesen Tieren Schritt für Schritt das dumpfe Wirken der Leidenschaften, das Drängen des Naturtriebes und die infolge einer Nervenkrisis eingetretenen Verwirrungen des Gehirns zu verfolgen gesucht.“ Höhere Werte verschwinden zugunsten niederen Trieben, Freiheit zugunsten von Determination, jeweils im Namen der Wissenschaft. Vergleiche die i.f. angeführten polemisch zuspitzenden Kennzeichnungen materialistischer Positionen. Mit Schopenhauer und Feuerbach hatten wir zwei Vertreter einer neuen Klasse von Philosophen kennengelernt: Personen, die – ob freiwillig oder nicht – außerhalb der akademischen Philosophie standen und von dieser Außenposition aus die Philosophie, so wie sie sich unserem Rückblick darstellt, mit entscheidenden neuen Gedanken weiterentwickelte. Weitere Vertreter dieses Typus sind leicht zu finden; tatsächlich gehört ein großer Teil derjenigen Denker, die wir für die größten Philosophen des 19. Jahrhunderts halten, zu dieser Gruppe. Gemeinsam ist ihnen allen eine Haltung, die in anderer Weise kritisch ist als diejenige, die wir im Fortgang von Kant zu Hegel gesehen haben, aber auch in anderer Weise, als sie in den konservativen Kritiken und Polemiken gegen die neue Philosophie des Idealismus formuliert wurde. An Schärfe steht diese neue Form von Kritik den genannten Polemiken in keiner Weise nach; das Ziel aber besteht nicht nur in Destruktion, sondern im Aufbau eines ganz neuen Typus von Philosophie, der keine Rückkehr zu Bewährtem fordert, sondern traditionelle Anspruchshaltungen, unter Umständen entsprechend revidiert, in einer neuen Form, unter Verwendung neuer Erkenntnisse und angemessen an eine neue historische Situation philosophisch umsetzen will. Heute wenden wir uns einer Gruppe von Denkern zu, die ganz ähnliche Ziele verfolgten, dies aber aus einem anderen institutionellen Hintergrund und vor dem Hintergrund einer gewandelten Wissenschaftskonzeption taten. Feuerbach hatte die Gehirnfunktionen betont, ohne allerdings selbst sehr viel mehr vom Gehirn zu wissen als diejenigen Philosophen, die er damit kritisierte. Dies ändert sich im 19. Jahrhundert; Wissenschaftler, die das Gehirn als Gegenstand ihrer empirischen Forschung behandeln, beteiligen sich 10 zunehmend an philosophischen Debatten, genauso wie Physiker, Biologen oder Chemiker. Aus heutiger Sicht ist diese Entwicklung unmittelbar plausibel: In der aktuellen Philosophie des Geistes treffen sich immer wieder die Hirnforscher und die Philosophen, und es scheint fast selbstverständlich, daß viele der Resultate der Hirnforschung philosophisch relevant sind. Im 19. Jahrhundert hatte eine solche Begegnung zwischen Philosophie und Naturwissenschaft gänzlich andere Dimensionen. Dies liegt vor allem daran, daß es zunächst gar nicht um eine Begegnung zweier mehr oder weniger gleichrangiger Partner aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten gehen konnte. Eine eigenständige Naturwissenschaft existierte noch nicht; vielmehr gehörten alle Gebiete, die wir heute als Naturwissenschaften zusammenfassen und anderen Wissenschaftsformen gegenüber und an die Seite stellen, als unselbständig in den Zuständigkeitsbereich anderer Disziplinen, und zwar entweder als Hilfswissenschaften der Medizin (wie Physiologie, Botanik und Mineralogie, letztere wegen ihrer Rolle für die Pharmazie) oder aber eben zum Bereich der Philosophie, wie die grundlegenden Gebiete der Mathematik und Physik. Auch diese Zuordnung ist zunächst verständlich: Wenn Philosophie eine grundlegende Wissenschaft sein soll, werden auch die Wissenschaften, die grundlegende Erklärungen über die materielle Welt abgeben, zur Philosophie gehören. Es gehört zu den philosophisch unmittelbar relevanten institutionengeschichtlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, daß diese Zu- und damit auch Unterordnung überwunden wurde. Allerdings erfolgte die offizielle Anerkennung einer solchen Entwicklung – die sich bei Schopenhauer und Feuerbach ja bereits abzeichnet – erst erstaunlich spät: erst 1863 wird die erste eigene Fakultät für Naturwissenschaften gegründet (ironischerweise in Tübingen), und es dauerte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, bis die Verselbständigung der Naturwissenschaften von der Philosophie überall institutionell festgeschrieben war. Für andere Gebiete, insbesondere die Psychologie – mit der wir uns in einer späteren Vorlesung beschäftigen werden – vollzog sich diese Entwicklung noch deutlich später. Die heute zu besprechenden Autoren personifizieren den Typus des großen Naturwissenschaftlers – aus unterschiedlichen Gebieten: Physik, Physiologie, Zoologie --, der aufgrund seiner naturwissenschaftlichen Kompetenz kompetent auch zu philosophischen Problemen Stellung nehmen kann; genauer: der beansprucht, daß eben nur auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Kompetenz philosophische Probleme sinnvoll bearbeitet werden können, wobei ‚sinnvoll’ damit ausdrücklich gemessen wird an den Standards und Methoden, die in den jeweiligen Wissenschaften entwickelt werden. 11 Die Eigenständigkeit der Philosophie als derjenigen Wissenschaft, die allererst definiert, was als wissenschaftlich zu gelten habe, wird damit zugunsten einer Superiorität der einzelnen Wissenschaften aufgegeben, die aufgrund ihrer immer unübersehbarer werdenden Bedeutung mit großem Selbstbewußtsein beanspruchen dürfen, allgemein über Wissenschaftlichkeit Aussagen treffen zu können. Allerdings: Es bedurfte, wie gesagt, eines großen Entwicklungsschrittes, bis solche großen Naturwissenschaftler aufgrund ihrer professionellen Leistungen der Philosophie gegenübertreten konnten und als akademisch bestens etablierte Nicht-Philosophen auch philosophisch tätig werden konnten. Ein Bindeglied findet sich in einer Personengruppe, die – ganz ähnlich wie Schopenhauer und Feuerbach – als Nicht-Akademiker, in ihrem Fall als nicht-akademische (oder akademisch randständige) Naturwissenschaftler philosophisch bedeutsam wurden: Die Materialisten der Jahrhundertmitte. Hierzu gehören Personen wie Ludwig Büchner, der Bruder des Dichters; Carl Vogt oder Jakob Moleschott, alle um die Jahrhundertmitte tätig. Typischerweise aus den Lebenswissenschaften kommend, mit Physiologie und Medizin befaßt, bildeten diese Wissenschaftler eine erstaunlich homogene Gruppe – alle, wie gesagt, in Deutschland akademisch erfolglos, alle politisch mehr oder weniger revolutionär gesinnt (Vogt war ein prominenter Abgeordneter in der Paulskirche), alle in ihren Überlegungen ebenso wie in ihren Formulierungen auf Konfrontation ausgerichtet, und schließlich alle an populärer Verbreitung naturwissenschaftlicher Überlegungen interessiert. Büchner war der literarisch erfolgreichste von ihnen; sein Bestseller Kraft und Stoff ging durch viele Auflagen und gehörte zu den meistgelesenen Büchern der Zeit. Man kann die philosophischen Ideen dieser Autoren in zwei Bonmots zusammenfassen, die verständlich machen, warum man diese Autoren auch als „vulgäre“ Materialisten abqualifizieren konnte (interessanterweise kommt diese Kennzeichnung nicht aus dem konservativen Bürgertum, sondern von Materialisten, die sich eben nicht als vulgär, sondern als theoretisch und praktisch avanciert verstanden; die Bezeichnung wurde wohl von Friedrich Engels geprägt). Beide Bonmots stammen, auch das muß sofort betont werden, in der überlieferten Form selbst von polemischen Kritikern der Materialisten und geben die sehr viel differenzierteren Überlegungen dieser Autoren selbst in bewußter und polemischer Verzerrung wieder, bewahren aber gerade dadurch die verstörende, aufrührende Kraft dieser Gedanken. Moleschott, der sich eingehend mit dem Stoffwechsel, der Umsetzung von Nahrungsbestandteilen befaßt hatte, wird in dieser Perspektive reduziert auf den Gedanken: „Denken ist Phosphor“ (denn: im Gehirngewebe ist besonders viel Phosphor 12 enthalten, also ist – so die etwas präzisere Lesart – ist Phosphor offensichtlich zumindest eine notwendige Bedingung für das Funktionieren des Gehirns und muß also in ausreichendem Maße mit der Nahrung aufgenommen werden); Carl Vogt wird noch zugespitzter mit der Formulierung tradiert, Gedanken seien die Exkremente des Gehirns. Warum? Vogt hatte eine Analogieüberlegung formuliert: Gedanken verhalten sich zum Gehirn wie der Urin zu den Nieren. In der polemischen Zuspitzung wird die Analogie zur Identität und die von Vogt natürlich bewußt eingesetzte Vulgarität der Analogie zur inhaltlichen Pointe. Kein Wunder, daß derartige Autoren um 1850 am Rande des kulturellen Establishments standen – zu Hermann von Helmholtz, Emil Du Bois-Reymond oder auch Ernst Haeckel ist es immer noch ein großer Schritt, der sich aber wieder innerhalb weniger Jahre vollzieht. Die Herausbildung einer umfassenden, allgemein akzeptierten Gesellschafts- und Philosophiefähigkeit der Naturwissenschaften ist eine der großen kulturellen Veränderungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die drei genannten Autoren gehören zu den populärsten Wissenschaftlern dieser Zeit, und sie tragen die Texte, die wir heute diskutieren, zu offiziellen Anlässen wie den Jahrestagen von Universitäten und Akademien vor; Helmholtz schlägt direkt den Bogen zu Fichte als erstem Rektor der Berliner Universität, deren Jahrestag er zelebriert: Naturwissenschaftler tragen an der Stelle vor, die wenige Jahrzehnte zuvor selbstverständlich dem Philosophen zugefallen wäre. Welche Entwicklungen dieser Jahre lassen sich in den Texten greifen? Wie wird insbesondere – unsere Leitfrage – mit der Wirklichkeit umgegangen? Helmholtz, dem wir uns vornehmlich widmen wollen, kombiniert ein intensives Interesse an Kant mit einem Realismus, der sich – wie auch sein Interesse an Kant – in Inhalten und Methoden der Naturwissenschaft verdankt. Welche weiteren Implikationen ein solches Wirklichkeitsverständnis gewinnt, soll uns heute beschäftigen. Biographischer Überblick: Alle drei heute zu behandelnden Autoren gelten in Ihrer Zeit als herausragende Exponenten ihrer Wissenschaft. Daß diese Einschätzung und diese Bekanntheit sich nicht bis heute durchgehalten hat, markiert seinerseits relevante Wandlungen im Verhältnis von Philosophie und Wissenschaften. Behandelt werden sollen: Ernst Haeckel, Professor der Zoologie in Jena, mit einer Rede über Den Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft; Emil du Bois-Reymond, Physiologie-Professor und Sekretär der Akademie der Wissenschaften in Berlin, zum Thema der Grenzen des Naturerkennens, und Hermann 13 von Helmholtz, der vielseitigste und berühmteste deutsche Naturwissenschaftler im 19. Jahrhundert schlechthin, mit einer Rede über Die Tatsachen in der Wahrnehmung. Augenfällig ist sofort eine äußere Gemeinsamkeit der Texte: alle Texte wurden als Reden zu mehr oder weniger großen festlichen Anlässen vorgetragen, zielen also auf ein fächerübergreifendes Publikum, haben nicht den Charakter spezialistischer Analysen, sondern sind auch auf einen erbaulichen Ton gestimmt. Zugleich beanspruchen alle Texte, etwas Grundsätzliches zur Philosophie und ihrer Lage oder jedenfalls zu zentralen philosophischen Fragestellungen beizutragen, und knüpfen an die Tradition und große Vergangenheit der Philosophie an. Bereits in dieser Verbindung von populärem Redeanlaß und philosophischer Zielrichtung liegt eine gewichtige Eigenart der Lage der Philosophie in dieser Zeit: sie sucht ihren Ort außerhalb des spezialistischen Diskurses und entdeckt das Medium der Festrede oder des kurzen, programmatischen Textes. Der Versuch, dem Spezialdiskurs – genauer: der Vielzahl der Spezialdiskurse – zu entfliehen, steht dabei bewußt in der Tradition einer Philosophie, die sich als ein- und ganzheitlich verstand. Angesichts des Anwachsens und des Erfolges von Spezialistentum wird eine solche Suche, trotz ihres Anspruchs, ihrerseits in Nischen zurückgedrängt. Die nächste Gemeinsamkeit betrifft Elemente der Stilistik dieser Texte. Die Anlässe ähneln sich; wie stereotyp die Texte jedenfalls in Stilmerkmalen dann tatsächlich ausfallen, ist aber doch überraschend und birgt weiteres Erschließungspotential. So anspruchsvoll und so potentiell verstörend die Thesen der Texte auch sein mögen: Einig sind sich die Autoren in ihrer Berufung auf den traditionellen Bildungskanon. Goethe zu zitieren, wird nie verfehlt; gerade die Naturwissenschaftler statten ihre Texte verschwenderisch mit Goethe-Zitaten, und zwar aus seinen dichterischen, nicht aus den naturwissenschaftlichen Texten Goethes, aus. Was ist das Ziel hinter dieser Strategie? Man wird eine gedoppelte Strategie vermuten dürfen: zum einen den Versuch, seine eigene Verwurzeltheit in diesem Bildungskanon zu betonen, also klarzumachen, daß die Naturwissenschaften keineswegs die hergebrachten, überkommenen oder aus gutem Grund wertgeschätzten Bildungsbestände in Frage stellen; zum anderen aber umgekehrt zu zeigen, wie sich die überlieferten Formulierungen und Gedanken tatsächlich einpassen lassen in einen Horizont, der von anderen Wissenschaften geprägt ist. Wissenschaft wird damit in einer Form präsentiert, die es allgemein bildungskompatibel macht; im Bücherregal steht neben Goethe der Kosmos von Humboldt oder wenigstens Brehms Tierleben neben der Bibel. Damit zeichnet sich ein Diskurs ab, den wir heute als einen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften bezeichnen würden; wenn wir bei Schelling die Entdeckung eines 14 wissenschaftsfähigen – nicht nur fähigen: sogar wissenschaftsbegründenden! – Reiches des Geistes gefunden haben, so nun die Naturwissenschaften in ihrer philosophischen Bedeutung, gezielt und bewußt immer wieder an den höchsten traditionellen Ansprüchen der Philosophie gemessen. Allerdings, und darauf wird in der nächsten Stunde einzugehen sein: genausowenig wie die Natur- sind die Geisteswissenschaften feststehende Kulturelemente; auch sie müssen erst in ihrer methodischen und inhaltlichen Eigenständigkeit etabliert werden. Alle drei Protagonisten der heutigen Stunde exemplifizieren den Zustand der Wissenschaften vor der Ausdifferenzierung der Einzelwissenschaften: Alle studieren sie Medizin, obwohl keiner von ihnen wirklich als Arzt praktizieren wollte (Haeckel, bevor er Zoologie-Professor wurde und noch als Arzt praktizieren mußte, legte seine Sprechstunde auf 6 Uhr morgens, um keine Patienten anzulocken; Helmholtz, aus einfachem Elternhaus kommend, konnte nur mit einem staatlichen preußischen Stipendium studieren, für das er sich als Gegenleistung verpflichten mußte, Militärarzt zu werden – es gab nur einen einzigen Ausweg: Nämlich den Ruf auf eine ordentliche Professur, und Helmholtz nahm genau diesen Ausweg). Ausgehend von der Medizin – damals, wie bereits angedeutet, der beste Weg ein Studium in den allgemeinen Naturwissenschaften zu absolvieren – nahmen alle drei einen unterschiedlichen Weg. Helmholtz wurde zu demjenigen Wissenschaftler, dem man am ehesten den Rang eines Universalwissenschaftlers des 19. Jahrhunderts zusprechen wird, mit bahnbrechenden Leistungen in der Medizintechnik (Erfindung des Augenspiegels), Physiologie, v.a. der optischen und akustischen Wahrnehmung und der ersten Messung der Reizleitungsgeschwindigkeit in Nerven, in der Physik (eine der ersten mathematisch präzisen und umfassenden Formulierungen des Energieerhaltungssatzes, bedeutende Arbeiten zur Hydrodynamik), zur Metamathematik u.v.a.m. Er durchläuft Professuren für Anatomie und Physiologie, dann für Physiologie und schließlich für Physik, wo er als Präsident der physikalisch-technischen Reichsanstalt auch offiziell zum obersten Naturwissenschaftler im Land wird. Du Bois-Reymond, sehr viel weniger bekannt, aber kaum weniger bedeutend, ist einer der Begründer der modernen Elektrophysiologie, Physiologieprofessor in Berlin und dort ständiger Sekretär der Akademie der Wissenschaften. Akademisch tätig wird DuBois zunächst als Anatomiedozent an der Kunstakademie, ab 1855 wird er Professor der Physiologie in Berlin. Haeckel schließlich nimmt diesen beiden Heroen gegenüber eine etwas abseitige Position ein; er verbringt sein wissenschaftliches Leben fast vollständig im eher provinziellen Jena, wo er trotz 15 seiner radikalen Ansichten eine ungefährdete Stellung einnehmen kann. Radikal ist insbesondere seine unbedingte Umsetzung von Darwins Evolutionstheorie, die er als einer der ersten in Deutschland publik macht; noch bevor Darwin das selbst in aller Eindeutigkeit tat, publiziert er ausführlich über die Notwendigkeit, auch den Menschen in den Gang der Evolution einzubeziehen und aus diesem Gang zu verstehen (Anthropogenie, 1874). Haeckel wendet sie auf alle Bereiche des Lebens an, mit weitreichenden Forderungen auch politischer und kultureller Art (einschließlich aller schlimmen Verirrungen zum Sozialdarwinismus), und popularisiert zugleich mit ungeheurem Erfolg in Büchern und Vorträgen eine durchgehend wissenschaftliche, anti-kirchliche, politisch zwischen Neuerung und Konservativismus schwebende Weltanschauung. Sein Buch über die Welträtsel ist um 1900 neben der Bibel das in Deutschland am häufigsten gelesene Buch. Die Goethe-Affinitität, die Helmholtz herstellt, wird bei ihm zu einem Kult gesteigert, der Haeckel selbst einschließt (gegenüber seines Schreibtisches in seinem Arbeitszimmer stehen drei Büsten: Goethe in der Mitte, Darwin zur Linken, und zur Rechten: Haeckel selbst). Seine ersten Arbeiten gelten einzelligen Meeresorganismen, bevor er sich sehr viel allgemeineren Fragen zuwandte. Ein besonderes Talent besaß er für Begriffsschöpfungen (er hat unter anderem den Begriff „Ökologie“ kreiert) und zur bildlichen Popularisierung. 2. Hermann von Helmholtz: Die Tatsachen in der Wahrnehmung Helmholtz konnte als Philosoph gelesen werden; die Herausgeber seiner erkenntnistheoretischen Schriften, Moritz Schlick (dem wir in der Vorlesung noch begegnen werden ) und Paul Hertz betonen in ihrem Vorwort zu dieser Sammelausgabe, es gebe in Helmholtz’ Werk genau einen Aspekt, in dem er nicht etwas abgeschlossen Vollendetes, sondern etwas Zukunftsweisendes vorgelegt habe: die Erkenntnistheorie. Er kann also, auch von Seiten einer akademisch etablierten Fachphilosophie, als ein bedeutender Anreger philosophischer Überlegungen gelesen werden. Der Text, in dem alle seine philosophischen Gedankengänge integriert sind, ist eine Rede über die Tatsachen der Wahrnehmung, vorgetragen 1878 zum Stiftungsfest der Berliner Universität, also an der Institution, an der – wie Helmholtz betont – Fichte als erster Rektor wirkte. Der bereits angedeutete stilistische Gestus hin zum klassischen Bildungskanon ist kaum irgendwo so augenscheinlich wie in Helmholtz’ Text. Helmholtz überlegte, welchen Titel er seiner Rede geben solle; nach dem Ausgeführten ist nicht mehr überraschend, daß dabei 16 Goethe wieder eine prominente Rolle spielt; in einem Brief an seine Frau schreibt Helmholtz selbst: „Den Titel werde ich zuletzt machen, ich weiß ihn noch nicht. Vielleicht: ‚Was ist wirklich?’ oder ‚Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis’ oder ‚Ein Gang zu den Müttern’.“ Damit gibt sich sein Vortrag, wie auch im endgültigen Titel, als ein direkter Beitrag zur Debatte zwischen Realismus und Idealismus zu erkennen. Nach der anfänglichen Anrufung der großen Vergangenheit stellt Helmholtz zunächst die schliche Frage: „Was ist Wahrheit?“ Dieser Frage hat sich jede einzelne Wissenschaft in jeweils spezieller, die Philosophie aber in ganz allgemeiner Weise zu stellen: „Auf dieses Problem stoßen Philosophie und Naturwissenschaft von zwei entgegengesetzten Seiten; es ist eine gemeinsame Aufgabe beider.“ Bereits hier ist klar: Die philosophische Bearbeitung dieser Aufgabe ist der naturwissenschaftlichen nicht überlegen oder vorgeordnet; es gibt mehrere in gleicher Weise legitime Zugangsweisen zu dieser Frage. Helmholtz’ eigentümlicher Weg zur Beantwortung dieser Frage erschließt sich am besten, wenn man kurz überlegt, welchen Zusammenhang das Wahrheitsproblem und die Frage nach dem Wirklichen eigentlich haben. Diese – auch in ganz aktuellen Debatten immer wieder gestellte – Frage kann auf einen scheinbar unmittelbar naheliegenden Zusammenhang führen: Eine naheliegende Auffassung von Wahrheit wäre die, daß ein wahrer Satz einfach deshalb wahr ist, weil er etwas in der Welt Zutreffendes, etwas Wirkliches, so bezeichnet, wie es eben ist. Wahrheit würde durch Wirklichkeit garantiert und umgekehrt: jeder wahre Satz greift ein Stück Wirklichkeit heraus. Eine solche Auffassung würde zu einer Art von Abbildtheorie führen, in der Wahrheit und Wirklichkeit direkt aufeinander passen. Helmholtz’ Weg zur Behandlung dieser Frage ist jedoch ein anderer, und auch seine Resultate weichen ab. Helmholtz beginnt mit einer Theorie der Sinneswahrnehmungen, wie sie insbesondere von der Physiologie naturwissenschaftlich erforscht wird. Zugleich greift er hier Kant affirmativ auf und bildet dessen Suche nach apriorischen Kategorien des Erkennens auf die Leistungen der Physiologie ab. Unsere Weise, die Welt wahrzunehmen, ist demnach nicht nur durch die relativ abstrakten Formen der Anschauung (bei Kant: Raum und Zeit) bestimmt, sondern sehr viel detaillierter durch unseren physiologischen Wahrnehmungsapparat vorherbestimmt. Ein einfaches Beispiel: derselbe Reiz, ein Druck, kann entweder als Druck, oder, wenn man auf das Auge drückt, als Lichteindruck rezipiert werden. Es sind die Sinnesorgane, die diese Differenzen erzeugen und die Art unserer Wahrnehmung bestimmen : „Sie sehen, wie alle diese Unterschiede in der Wirkungsweise von Licht und Ton bedingt sind durch die Art, wie der Nervenapparat gegen sie reagiert.“ 17 Helmholtz sieht dies als unmittelbare Fortführung von Kantischen Ansätzen, wobei er die von Kant in nicht genauer angebebener Weise bezogenen Anschauungsformen durch die sehr viel präziseren und methodisch kontrollierten Verfahren der experimentellen Physiologie konkret ausgestaltet. Man kann Helmholtz aus diesem Grund als einen Neukantianer, genauer als einen physiologischen Neukantianer, verstehen, also als einen Philosophen, der Kantische Gedanken in neuer Form aufgreift. Andere Neukantianer werden wir in der nächsten Stunde kennenlernen. Folgende Aspekte seiner auf dieser Grundlage errichteten Erkenntnistheorie sind hervorzuheben: (1) Helmholtz insistiert auf einer Zeichen- im Gegensatz zu einer Abbildtheorie. Auch das folgt aus seinem physiologischen Ansatz: Wenn unsere Wahrnehmung der Außenwelt durchgehend durch unsere Sinnesorgane moduliert ist, kann in unserer Wahrnehmung die Außenwelt nicht einfach 1:1 abgebildet sein; sie wird durch die Wahrnehmung transformiert. Insofern stehen unsere Wahrnehmungen zur Außenwelt nur in einer Relation der Zeichenhaftigkeit: wie Buchstaben Zeichen für Laute sind, so sind unsere Wahrnehmungen Zeichen für Dinge in der Außenwelt: „Ein Zeichen aber braucht gar keine Ähnlichkeit mit dem zu haben, dessen Zeichen es ist. Die Beziehung zwischen beiden beschränkt sich darauf, daß das gleiche Objekt, unter gleichen Umständen zur Einwirkung kommend, das gleiche Zeichen hervorruft.“ (2) Dennoch geht der Wahrheitsbezug dabei nicht verloren; auch wenn man im Erkennen nur Zeichen der objektiven Sachverhalte erhält, in denen nicht einmal Ähnlichkeitsrelationen gewahrt sind, so fällt man doch nicht einer bloßen Beliebigkeit anheim. Der letzte Satz des gerade angeführten Zitats weist auf Helmholtz’ Ausweg (bei Nietzsche werden wir eine Theorie sehen, die genau die gegenteilige Schlußfolgerung aus dem Zeichencharakter unseres Erkennens zieht!): Selbst wenn die Zeichen keine Ähnlichkeit zum Bezeichneten aufweisen, bilden sich doch die Gesetzmäßigkeiten der äußeren Welt auch in Gesetzmäßigkeiten auf der Ebene der Zeichen ab und gestatten so allgemeingültige Aussagen. Zusammenhänge, gesetzliche Abhängigkeiten auf der einen Seite bilden sich in Zusammenhänge auf der anderen Seite ab, und das ist für Helmholtz alles, was für allgemeingültige Aussagen nötig ist. Auch das ist ein Kantischer Bezug, der jedenfalls bei Kant fundamentaler ansetzt als die physiologische Weiterführung der Idee, Wahrnehmung sei durch subjektive Strukturen prädeterminiert: Für Kant sind Gesetzmäßigkeiten die Grundlage, auf der unser Bild von einer objektiven Welt errichtet ist, und Helmholtz greift diesen Gedanken auf. Allerdings kommt hier ein Gedanke zum 18 Tragen, der nicht mehr mit Kant übereinstimmt und ebenfalls bereits anzitiert wurde: Wenn Helmholtz das Wahrheitsproblem gleichberechtigt von zwei Seiten aus angeht, hebt er die bei Kant eindeutig bestehende Privilegierung der Philosophie als kritische Wahrheitssicherung auf, und auch in seiner Auffassung von Gesetzmäßigkeit haben wir eine Zweiseitigkeit: Die Gesetze können bei Helmholtz nämlich eben doch abgebildet und also auch von außen aufgenommen werden. (3) Hieran hängt der Nächste wichtige Aspekt: Empirismus vs. Nativismus. Uns werden, wenn diese Zweiseitigkeit besteht, unsere Gesetze des Weltzugangs nicht apriori strikt vorgeben sein. Sie sind uns, wie Helmholtz in einer charakteristischen physiologischen Umformulierung sagt, nicht angeboren, wie ein Nativist behaupten würde. Helmholtz vertritt die gegenteilige, empiristische Annahme: Wir erwerben die Prinzipien unserer Wahrnehmung im Laufe unserer Ontogenese im Kontakt mit der Außenwelt. Bestes Beispiel: Die Ausdifferenzierung des Erkenntnisvermögens beim Kind oder die Entwicklung spezialisierter Wahrnehmungsfähigkeiten durch Übung. Hier kann Helmholtz in einem wichtigen Punkt direkt über Kant hinausgehen. Kant hatte den Raum als apriori vorgegebene Form der Anschauung angenommen, was für ihn implizierte, daß auch die Art unserer Raumwahrnehmung apriori eindeutig feststeht: Der Raum ist dreidimensional und euklidisch. Helmholtz hingegen kann das Aufkommen neuer, nicht-Euklidischer Geometrien in seine Theorie der Wahrnehmung einbeziehen. Zwar mag es ungemein schwierig sein, sich in solchen Räumen vorstellend zu bewegen, aber es ist jedenfalls keinesfalls apriori ausgeschlossen. Zudem: Wenn man Helmholtz fundamentales Interesse an Gesetzmäßigkeiten hinzunimmt, muß Anschaulichkeit gar nicht durch die Möglichkeit einer reichen und einfachen Imagination eines Sachverhalts bestimmt werden. Helmholtz gibt ein alternatives Kriterium für Anschaubarkeit an: „Ich verlange für den Beweis der Anschaubarkeit nur, daß für jede Beobachtungsweise bestimmt und unzweideutig die entstehenden Sinneseindrücke anzugeben seien, nötigenfalls unter Benutzung der wissenschaftlichen Kenntnisse der Gesetze, aus denen, wenigstens für den Kenner dieser Gesetze, hervorgehen würde, daß das betreffende Ding oder anzuschauende Verhältnis tatsächlich vorhanden sei.“ In diesem Sinne ist für einen Physiologen, der die optische Wahrnehmung studiert, eine nicht-Euklidische Geometrie mit Sicherheit anschaubar. Anschauung ist dann nicht mehr einfach und unmittelbar, auch nicht ein erster, vorbereitender Schritt für begriffliche Aufarbeitung (wie bei Kant), sondern durchgehend mit den Gesetzen des Denkens durchdrungen. Selbst in scheinbar einfachen Anschauungen gehen komplexe Leistungen ein, die Helmholtz an Schlußfolgerungen 19 annähert. Er bezeichnet sie als „unbewußte Schlüsse“; Beispiel: wir alle konstruieren den scheinbar unmittelbar angeschauten dreidimensionalen Raum aus einer komplexen Datenmenge, in die neben den Daten der Abbildung einer Szene auf der Netzhaut (die zweidimensional ist) Daten über die Stellung der beiden Augen zueinander, über Bewegungen und Verschiebungen im Gesichtsfeld und evtl. noch einiges mehr eingehen. Hieraus wird erst unsere Anschauung gewonnen; auch wenn die erforderlichen Prozesse durch Training und Gewöhnung unbewußt geworden sind, ist Anschauung nicht mehr einfach und unmittelbar. (4) Welche Folgerungen ergeben sich hieraus für das Realismus-Problem? Offensichtlich erlauben die bisher zusammengetragenen Aspekte keine eindeutige Antwort: Neben realistischen Aspekten – etwa in der Abbildbarkeit äußerer Gesetzmäßigkeiten – stehen idealistische wie die Bedingtheit unserer Wahrnehmung durch unseren Erkenntnisapparat – der aber, und nun wieder im realistischen Fahrwasser, empirisch erforscht werden kann und empirisch herausgebildet ist. Helmholtz selbst erklärt sich im Sinne eines Realismus, zusammengefaßt in einem Satz, der vieles bereits Genanntes aufgreift: „Was wir aber erreichen können, ist die Kenntnis der gesetzlichen Ordnung im Reiche des Wirklichen, diese freilich nur dargestellt in dem Zeichensystem unserer Sinneseindrücke“ (170); hier nun folgt das Goethe-Zitat aus Faust II: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“. Um die Zielrichtung dieser Form von Realismus genauer zu verstehen, sind zwei Aspekte zu beachten: Zum einen entscheidet sich Helmholtz, hier sehr bewußt und genau formulierend, für eine „realistische Hypothese“, und zum anderen hat sein Realismus ein genau umrissenes Ziel, nämlich den Gang der Wissenschaft zu unterstützen. Beginnen wir mit dem zweiten Aspekt: Wissenschaft wird entsprechend verstanden als: „künstliche Anordnung der Tatsachen“, die „keine abstrakten Begriffe darüber hinaus bilden“ soll. Das Ziel der Wissenschaft ist vollständig erreicht, wenn eine angemessene, das heißt in Gesetzlichkeiten formulierbare und damit auch Gesetzlichkeiten in der Natur abbildende Beschreibung der Welt gegeben wird. Wissenschaft ist nicht einfach eine Abbildung externer Gegenstände und kann deshalb keine strikte Eindeutigkeit, aber auch keine absolute Gewißheit beanspruchen. Noch das Kausalgesetz drückt für Helmholtz nur unser „Vertrauen“ in die durchgängige Verständlichkeit der Welt aus, ist also eher eine forschungsleitende Idee als eine faktische Wahrheit. Ein solches Vorgehen nimmt den Wissenschaften ihren Nimbus der Unfehlbarkeit; da aber für Helmholtz weiter gilt, daß wir keine bessere Erkenntnis besitzen 20 als diejenige, die uns die Wissenschaften liefern, beeinträchtigt das deren relative Stellung zumindest nicht. Das Ziel dieser erkenntnistheoretischen Überlegungen besteht darin, der Wissenschaft ein sicheres, von idealistischen Zweifeln unbetroffenes Arbeitsfeld zu eröffnen; Helmholtz betont, daß ein solcherart auch eingeschränktes Tätigkeitsfeld für die Wissenschaften keine Beeinträchtigung bedeuten muß (auch hierin folgt er Kant) – im Gegenteil: „Übrigens hat sich bisher die Wirklichkeit der treu ihren Gesetzen nachforschenden Wissenschaft immer noch viel erhabener und reicher enthüllt, als die äußersten Anstrengungen mythischer Phantasie und metaphysischer Spekulation sie auszumalen gewußt hatten.“ Zudem kann man in dieser Weise, wieder ist Goethe mit seiner beschreibenden Naturforschung der Kronzeuge, hoffen, Naturwissenschaft und Kunst wieder in engen Zusammenhang zu bringen. Damit zum zweiten Aspekt. Wie der Titel seiner Rede ankündigt, spielen für Helmholtz Tatsachen eine entscheidende Rolle; Tatsachen sind dabei genau das, was die Wissenschaft innerhalb der ihr gesetzten Grenzen mit Sicherheit ermitteln kann Dies führt zu einer grundlegenden (und von der Wissenschaft gerade dieser Zeit immer wieder erforderten) Unterscheidung zwischen Tatsachen und Hypothesen, wobei Helmholtz unbedingt fordert, den hypothetischen Charakter von Hypothesen festzuschreiben und sie eben nicht mit Tatsachen zu verwechseln: „Was wir aber unzweideutig und als Tatsache ohne hypothetische Unterschiebung finden können, ist das Gesetzliche in der Erscheinung.“ Alles andere, also auch die realistische Grundannahme, bleibt letztlich Hypothese, kann also nicht mit letztem Gewißheitsanspruch behauptet werden. Fassen wir Helmholtz’ Erkenntnistheorie knapp zusammen, so präsentiert sie sich in vielfacher Hinsicht als eine Anknüpfung an eine bewußt glorifizierte Vergangenheit mit dem Fixpunkten Kant und Goethe, wobei Helmholtz auf mehreren Ebenen operiert, Naturwissenschaften, neue Mathematik als Antwort auf traditionelle Fragen der Philosophie verstanden wissen will, den Bezug zur Kunst und damit zu tief verankerten kulturellen Werten wahren möchte, zugleich damit auch die Befürchtungen, eine zu enge Anlehnung an die Naturwissenschaften könnte zu einem Verlust solcher Werte führen, besänftigen möchte. Indem er sorgfältig zwischen (metaphysischen) Wahrheiten und Hypothesen unterscheidet und durchgehend, wo immer möglich, eine Konvergenz zwischen Aussagen auf der Grundlage de Naturwissenschaften und solchen der philosophisch-künstlerischen Tradition ausdrücklich vermerkt, wird die im konkreten 21 Argumentationsgang durchgehend tragende Rolle der empirischen Naturwissenschaft zurückgenommen. Neben den unumstrittenen Verdiensten von Helmholtz als Wissenschaftler trugen diese Züge seiner philosophisch orientierten Schriften dazu bei, daß er als allgemein akzeptable Größe gelten konnte. In seiner Stellungnahme zum Realismus zeichnet sich dabei eine Verschiebung ab; es formieren sich zwei jeweils einander gegenübergestellte Begriffspaare: Realistisch-idealistisch und empirischapriorisch. Helmholtz nutzt eine sehr entschiedene Einordnung auf der durch das letzte Begriffspaar markierten Skala, eindeutig nämlich auf der Seite des Empirismus, und zwar sowohl hinsichtlich der anzuwendenden Forschungsmethode wie in zentralen inhaltlichen Aussagen, um hiermit eine Stellungnahme in der ersten Disjunktion differenziert zu gestalten: Realismus ja, aber abgetönt dadurch, daß es eben – wie jede empirisch zu begründende Aussage – sich nur um eine Hypothese handeln könne. Die Einordnung auf dieser Skala wird also überlagert, vielleicht sogar bereits übernommen, von einer Einordnung auf einer Skala philosophisch-wissenschaftlicher Methoden, die von der Empirie zur apriorischen Spekulation reicht. Diese Strategie mag als hybrid, als ein unentschiedenes weder-noch und gleichzeitiges sowohl-als auch erscheinen. Radikalere Gegenpositionen liegen, wie wir gesehen haben, bereits bei den Materialisten vor, die aber, wie gesagt, anders als Helmholtz nicht gesellschaftsfähig waren. 3. Radikale Alternativen und wissenschaftsbegründete Kompromißlösungen: Haeckel und Du Bois-Reymond Emil du Bois-Reymond hielt seine berühmteste Rede über die Grenzen des Naturerkennens, die als Ignorabimus-Rede bekannt wurde, weil sie in der weitreichenden Behauptung endet, daß wir zumindest hinsichtlich zweier grundlegender Fragen uns auf ewig und prinzipiell mit einem Ignorabimus begnügen müssen, 1872 in der allgemeinen Sitzung der „Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte“, also als Vertreter der offiziellen Standesversammlung der vereinigten Naturwissenschaftler. Das Programm der Rede erinnert in doppelter Weise direkt an eine kantische Fragestellung: Zum einen greift DuBois den Topos des Entdeckers neuer Erdteile auf, allerdings depersonalisiert: Die Naturwissenschaft ist für ihn die „Weltbesiegerin unserer Tage“, zum anderen stellt er die Frage: Welches sind die prinzipiellen Grenzen der 22 Naturerkenntnis? Diese Frage, insbesondere in Verbindung mit dem Entdecker-Topos, läßt sich als Frage im Realismus-Kontext stellen: ist die „Weltbesiegerin“, die Naturwissenschaft, eine Art omnipotenter Universalherrscherin, oder gibt es etwas, was ihr unzugänglich ist? Wenn ja, dann wird die Wirklichkeit in zwei Bereiche geschieden, den naturwissenschaftlich faßbaren und den eben naturwissenschaftlich unzugänglichen. Die Wirklichkeit selbst wäre dann nicht mehr wissenschaftlich komplett zu fassen, was sofort die Frage nahelegt: Wie soll man dann erwarten können, mit Erfolg über den Restbestand Aussagen treffen zu können? Das Bild, das sich daraus generiert, ist eines von einer vielfältig strukturierten Wirklichkeit, die aber nicht komplett wissenschaftlich erfaßt ist (Helmholtz geht offensichtlich einen etwas anderen Weg: er schränkt die Wissenschaften nicht ein, nimmt aber den Anspruch auf absolute Gewißheit zurück). Dazu führt DuBois zunächst, um den Anspruch des Naturwissenschaftlers so stark wie möglich zu machen, den Laplaceschen Dämon ein, der eine – mit DuBois’ Terminus – „astronomische Kenntnis“ der Naturvorgänge besäße in dem Sinne, daß er alle Gesetze der Natur in voller Präzision verstünde und deshalb, mathematisch durch Einsetzen der Anfangsbedingungen, die komplette Lage des Natürlichen zu jeder Zeit berechnen könnte. Auch einem solchen Geist wären aber zwei Grenzen gesetzt: einmal die Materie und ihre grundlegenden Eigenschaften als Residuum aller Erklärungen in der materiellen Welt (S. 60). Jede Erklärung, die ein solcher Dämon abgäbe, würde mit Hilfe der Materie erklären, könnte aber diese Materie selbst nicht mehr erklären. Anderes, was vielleicht als ähnlich problematisch erscheinen könnte, ist nach DuBois problemlos erklärbar, allem voran die Erscheinungen des Organischen. Der andere Punkt des Unbegreiflichen liegt im menschlichen Bewußtsein. Warum? Hier versucht sich DuBois zwar an einer Beschreibung der Problematik, kommt dabei aber nicht sehr weit: „Die astronomische Kenntnis des Gehirnes, die höchste, die wir davon erlangen können, enthüllt uns darin nichts als bewegte Materie. Durch keine zu ersinnende Anordnung oder Bewegung materieller Teilchen aber läßt sich eine Brücke ins Reich des Bewußtseins schlagen.“ Sein Argument besteht also wesentlich in der – wiederum unserer Selbstwahrnehmung zu verdankenden – Annahme, daß unsere geistigen Vorgänge nicht aus Ereignissen zwischen materiellen Einheiten zu bestehen scheinen. Immerhin läßt sich hieraus eine positive Folgerung ziehen: Als unbegreiflich und der naturwissenschaftlichen Arbeit entzogen kann das Bewußtsein nicht Grundlage von Wissenschaft sein; man kann die Arbeit des Laplaceschen Dämons nachzuvollziehen suchen, ohne dazu auf Fundamente im menschlichen Subjekt achten zu müssen. Gerade 23 in seiner Unbegreiflichkeit also wird das Bewußtsein zu einem Gegenstand (obzwar anderer Sorte) neben anderen. DuBois’ Rede ist in besonderer Weise von der Ambivalenz gekennzeichnet, die auch bei Helmholtz zu konstatieren war: eine Bewunderung und Hochschätzung der ja von beiden mit großem Erfolg betriebenen Naturwissenschaft, verbunden mit einer immer wiederholten Warnung vor den Gefahren einer Übersteigerung von Wissenschaftsgläubigkeit. Wichtig in unserem Zusammenhang ist zu fragen, worauf DuBois seine Grenzziehungen begründet. Ich würde hierfür den Terminus einer „wissenschaftsbegründeten Kompromißlösung“ vorschlagen. Er geht nicht auf apriorische Theorien ein, denen zufolge es z.B. notwendig so sein müßte, daß das Bewußtsein oder die Materie unerklärbar sein müßten (etwa weil das Subjekt der Ausgangspunkt aller weitern Erklärung ist); sein Argument enthält ein starkes faktisches Argument, das die innere Selbstwahrnehmung unserer eigenen Zustände und ihrer nicht-materiellen Erscheinungsweise verknüpft mit einer Betrachtung der herrschenden Naturwissenschaft, in der etwa die Materie einen letzten Bezugspunkt darstellt. Der faktische Zustand von Wissenschaft wird damit, und zwar noch in der Steigerung zur bislang unerreichbaren Leistungsfähigkeit des Dämons, zum Kriterium für eine traditionell philosophische (und in Isolation auch reichlich banal klingende) Abgrenzung. Weltganzes, die komplette Wirklichkeit, und Wissenschaft werden separiert, wobei die Wissenschaft selbst wesentlich für die Ziehung der Demarkationslinie wird. An dieser Stelle wird Haeckel zum brisanten Diskussionspartner, weil Haeckel der Meinung ist, daß eine solche Grenzziehung in illegitimer Weise die Möglichkeiten der Wissenschaften unterschätzt. Wissenschaften, so der Darwinist Haeckel, entwickeln sich; keine bestehende Einschränkung der Wissenschaft kann als prinzipiell dauerhaft angesehen werden. Aus einer solchen Sicht ist DuBois’ „Ignorabimus“ für Haeckel nur ein Zeichen der Feigheit vor den etablierten Gegnern, vor allem in den Kirchen; Haeckel wählt, seine klassische Bildung etwas zu ostentativ hervorkehrend, eine ebenfalls lateinische Gegenformel: „Impavidi progrediamur“, laßt uns unerschrocken voranschreiten – der Entdeckertopos wird in die Wissenschaft selbst eingeschrieben. Haeckel hat eine ganz klare Antwort auf die Frage, auf welcher Grundlage alle philosophischen Probleme gelöst und eine allgemeine Weltorientierung gewonnen werden kann: einzig und vollständig auf der der Naturwissenschaften. Zwei Gedanken hebt er hervor: Helmholtz’ Entdeckung von der Erhaltung der Energie, wodurch viele scheinbar völlig heterogene 24 Wissenschaftsbereiche verknüpft werden, und die Darwinsche Entwicklungstheorie. Auf dieser Grundlage ergebe sich ein monistisches Weltbild: Monistisch, im Gegensatz zu dualistisch, wird definiert als eine einheitliche Position, die vor allem negativ bestimmt ist in Absetzung gegen alle dualistischen Versuche, Gott und Welt, Geist und Körper, Mensch und Tier... zu trennen. Auf dieser Grundlage entstanden um 1900 ungeheuer erfolgreiche Weltanschauungsorganisationen, die intensiv das populäre Verständnis von Wissenscahft beeinflußten. Sein Vortrag über den Monismus als Band zwischen Religion und Naturwissenschaft von 1892 formuliert diese Ideen: „Unzweideutig drücken wir damit unsere Überzeugung aus, daß ‚ein Geist in allen Dingen’ lebt, und daß die ganze erkennbare Welt nach einem gemeinsamen Grundgesetze besteht und sich entwickelt. Insbesondere betonen wir dabei die grundsätzliche Einheit der anorganischen und organischen Natur [...]. Ebensowenig als eine scharfe Grenze zwischen diesen beiden Hauptgebieten der Natur zu ziehen ist, ebensowenig können wir auch einen absoluten Unterschied zwischen Pflanzenreich und Tierreich anerkennen, ebenso auch nicht zwischen Tierwelt und Menschenwelt. Dementsprechend betrachten wir auch die ganze menschliche Wissenschaft als ein einheitliches Erkenntnisgebäude; wir verwerfen die übliche Unterscheidung zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft.“ Dies läßt sich unmittelbar auf das geistige Leben übertragen: „Wie die natürliche Entwicklungslehre auf monistischer Basis das ganze Gebiet der körperlichen Naturerscheinungen erhellt und aufgeklart hat, so auch das Gebiet des Geisteslebens, welches von jenem nicht zu trennen ist. Wie unser menschlicher Geist sich langsam und stufenweise aus einer langen Reihe von Wirbeltierahnen herangebildet hat, so gilt dasselbe auch von unserer Seele; als Funktion unseres Gehirns hat sie sich stufenweise in Wechselwirkung mit diesem ihrem Organ entwickelt.“ Halten wir zunächst fest, daß Haeckel – hier inhaltlich gut übereinstimmend, obwohl in der Tendenz ganz klar entgegengesetzt – eine Entsprechung, stärker noch: eine notwendige Gleichbehandlung von Natur und Geist fordert (damit natürlich auch die Geisteswissenschaften den Naturwissenschaften assimiliert, ein Punkt, den wir in der nächsten Stunde weiter erörtern werden). Klar wird hier auch, wie Haeckel für seinen Monismus argumentiert, nämlich auf der Grundlage von Analogien zwischen körperlicher und geistiger Entwicklung, zwischen körperlicher und geistiger Abhängigkeit des Menschen von seinen (tierischen) Vorgängern. Man kann dieses Vorgehen auch anders sehen, nämlich als eine Ausweitung aufgrund einzelner Theorien, hier des Darwinismus, hin zu einer Universalerklärung aller nur möglichen Vorgänge. Haeckels Vorgehen fällt damit genau unter den Vorbehalt, den Helmholtz gegenüber der Verwendung von 25 Hypothesen geltend machte, obwohl Haeckel selbst diese Ausweitung als durchgehend der wissenschaftlichen Rationalität und den wissenschaftlichen Resultaten folgend ansah. Sehr ausdrücklich widmet sich Haeckels Rede dem Problem der Religionen. In Analogie zur Entwicklungsidee der Religionen und Kulturen geht er die Religionsgeschichte durch und endet, kaum mehr überraschend, bei einer monistischen Gottesidee, „welche allein mit der geläuterten Naturerkenntnis der Gegenwart sich verträgt, erkennt ‚Gottes Geist in allen Dingen’.“ „man kann demnach ‚Gott’ auch als die unendliche Summe aller Naturkräfte bezeichnen, als die Summe aller Atomkräfte oder Ätherschwingungen“ (439). Auch hierfür wird wieder Goethe als Kronzeuge angeführt. Insgesamt scheint Haeckels Argumentation stark in Richtung der Materialisten zu gehen. Aber Haeckel wollte kein Materialist sein; für ihn implizierte bereits die Idee eines Materialismus, also die Erklärung aus materiellen statt immateriellen Prinzipien einen Dualismus. Wenn es konsequent nur ein Prinzip geben darf, darf dieses auch nicht materiell im Gegensatz zu immateriell sein. Hiermit hat Haeckel offensichtlich die Frage zu beantworten, die nach DuBois notwendig offenbleiben muß, die Frage nach dem Erklärung von Materie nämlich. Was wäre Haeckels Antwort? Zum einen muß Haeckel hier natürlich seinen Monismus geltend machen. Selbst wenn die Seele nicht materiell erklärbar ist, folgt für Haeckel nicht, daß sie in einer fundamental andersartigen Weise erklärbar ist. Umgekehrt vielmehr insistiert er darauf, daß eine einheitliche Erklärung für beide Gegenstandsbereiche möglich sein muß, so daß DuBois’ Ignorabimus für ihn nur ein Argument gegen die rein materialistische Erklärung irgendeines Phänomens bietet: Auch Zellen und Atome haben nach Haeckel Seelen; im Bereich des Geistigen darf keine prinzipiell neuartige Eigenschaft dazukommen, denn sonst würde die monistische Einheit der Natur gesprengt. Natürlich darf, und hier wird einer der bei Helmholtz bemerkten umstrukturierenden Aspekte ganz wichtig, dies nicht einfach als metaphysisches Postulat aufgestellt, sondern muß an verfügbare Evidenz aus den Wissenschaften angeknüpft werden: Haeckel verweist auf eine seinerzeit ganz neue Entdeckung, die Flüssigkristalle (wir würden heute vielleicht allgemeiner sagen: Phänomene spontaner Ordnungsentstehung im Anorganischen, wie jeder beim Blich auf die erstaunlich stabil geordneten Strömungszellen in einer Tasse heißen Tees sehen kann), um hierin die der Materie, also den Atomen, immanente geistige Leistungsfähigkeit demonstriert zu sehen. Auch Haeckel also war, anders als man die Materialisten der Jarhhundermitte wahrnahm, kein Reduktionist, auch er wollte nichts gestrichen, sondern er wollte vielmehr alles eingemeindet haben. 26 4. Zusammenfassung: Wissenschaft und Wirklichkeit Die Welt ist in dieser Perspektive durchgehend und einheitlich erfaßbar, die Wirklichkeit einheitlich strukturiert, und wieder sind es die Wissenschaften, die diese Struktur der Welt erfassen und Aussagen darüber ermöglichen. Eine empirische Fundierung wird gefordert – in der unbedingten Ausweitung einer solchen Weltanschauung aber auch arg strapaziert. Immer noch aber soll die Empirie Bezugspunkt sein, allerdings ohne daß, wie bei Helmholtz, im Detail das erkenntnistheoretische Problem wissenschaftlichen Weltzugriffs erörtert würde. Wissenschaft hat sich als Welt- und Wirklichkeitsgarant verselbständigt. Das Bild von Welt und Weltbezug, das man damit erhält, kann als eine (möglicherweise einseitige) Zuspitzung des eingangs skizzierten Zusammenhangs von Wahrheitsbestimmung und Weltbezug gesehen werden: Die Wissenschaften treten einerseits als Erkenntnisgaranten, andererseits als Weltinventar ein. - Typisch sind Positionen, die einen hybriden Charakter aufweisen, die sich nicht wirklich festlegen wollen zwischen der unbedingten Hochschätzung einer bestimmten Spezialwissenschaft einerseits, dem universellen Integrationsanspruch andererseits. Noch Haeckel, in seinen religiösen Bestrebungen und seinem Goethekult, wirkt wie ein radikaler Naturwissenschaftler, der keine der Errungenschaften der eben auch nichtnaturwissenschaftlich geprägten Vergangenheit aufgeben will. Wo soll Philosophie hier noch ihre Bedeutung finden? In räumlicher Metaphorik: Neben, über oder unter den anderen Wissenschaften? Philosophie wird in dieser Zeit verwissenschaftlicht und so zur „Fachphilosophie“, wodurch sie neben die anderen Wissenschaften tritt; ihre Leistungen in der Analyse und kritischen Beurteilung bzw. systematisierenden Klassifikation der anderen Wissenschaften lassen sie, je nach Perspektive, unter oder über diese treten. - Durchgehend wird eine Forderung der idealistischen Systeme, diejenige nach absoluter Gewißheit, abgewiesen. Der empirische Charakter der speziellen Wissenschaften universalisiert sich und trägt wesentlich zur angesprochenen Nebenordnung aller Wissenschaftsgebiete bei. Nur so kann auch der wirklichkeitsbestimmende Charakter ganz spezieller Wissenschaften gesichert werden. 27 - Eine ganze Reihe philosophischer Bewegungen dieser Zeit bestimmt sich als eine Erneuerung überkommener Positionen, so etwa in Forme eines (u.a. von Helmholtuz inaugurierten) Neukantianismus (daneben weitere Neo-Bewegungen: Neu-Fichteaner, Neuhegelianer...). Dies soll in der nächsten Stunde genauer ausgeführt werden, wobei wir genau die Frage nach dem Verhältnis von Geist und Natur vertiefen müssen. - Grundvoraussetzung der vorgestellten Positionen ist: Die Wissenschaften müssen selbst nicht mehr wirklich hinterfragt werden; können eher kommentierend begleitet werden. Das kann sich nur ändern, wenn sich das Verständnis von Wissenschaft insgesamt ändert; wenn nicht mehr selbstverständlich jeglicher Anspruch auf Wissenschaftlichkeit schon aufgrund seiner einzelwissenschaftlichen Hintergründe als solcher akzeptiert werden kann, wenn also zwischen Wissenschaft und Scheinwissenschaft zu unterscheiden ist. Auch eine solche Unterscheidung wird unmittelbare Folgerungen für unser Verständnis von Wirklichkeit haben müssen: Ablehnung von Wissenschaftlichkeitsansprüchen für ein bestimmtes Gebiet wird unmittelbar zur Folge haben, daß die dort angenommenen Gegenstände abgewiesen werden. Für unser Realismusproblem haben wir uns also um die Mitte des 19. Jahrhunderts in eine Lage manövriert, in der Wirklichkeit und Wissenschaftlichkeit untrennbar verwoben sind. 28 Vs 7 Lebensphilosophie und Philosophie der Geisteswissenschaften: Philosophische Gegenüberstellung von Geist und Natur 1. Wissenschaftskulturen 2. Allgemeine Merkmale empiristischer Positionen. 3. James Stuart Mill: „Biography of a steam engine“ 4. Mill: Alle Wissenschaft geht induktiv vor 5. Philosophie der Geisteswissenschaften: Wissenschaftlichkeit und Wirklichkeit der geistigen Welt 6. Zusammenfassungen 29 Begrüßung der SchülerInnen I. Wissenschaftskulturen Ihr heutiger Studienalltag ist wesentlich von Entwicklungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts geprägt; mit den philosophischen Diskussionen, die wir in der letzten Stunde betrachtet haben, und dem heute zu verhandelnden Gegenstück werden bis heute bestimmende Weichenstellungen vorgenommen. Ihnen allen ist eine grundlegende Unterscheidung im Wissenschaftssystem vertraut: Diejenigen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Diese Unterscheidung ist erst etwa 150 Jahre alt, erscheint uns aber immer wieder als ein fundamentaler Graben zwischen kaum zu vereinbarenden Wissenschaftsformen. In ganz aktuellen Debatten etwa um die Rolle der Neurowissenschaften für ein Verständnis des menschlichen Bewußtseins, oder, unmittelbarer jeden von uns betreffend, die Freiheit des menschlichen Willens, insbesondere aber im unmittelbaren Konfliktpotential, das die bloße These, die Naturwissenschaften könnten für solche Fragen relevant sein, besitzt, wird klar, wie tiefgreifend eine solche Unterscheidung unser Weltbild prägt. Betrachtet man die Themen der letzten Stunde, kann es so scheinen, als läge die Schuld für die Bildung unversöhnlicher Fronten bei den Naturwissenschaftlern. Die These, letztlich sei alles naturwissenschaftlich zu behandeln, bringt die Befürchtung mit sich, alle Phänomene würden dadurch auf niedrigstem Niveau als einheitlich betrachtet, in den Beispielen der letzten und vorletzten Stunde: Das Gehirn werde als bloßes Organ in Analogie zu so anrüchigen Organen wie dem Verdauungstrakt behandelt, Gedanken, Ideen, Kunsterfahrungen werden zu bloß organischen Produkten. Auch auf einer anderen Ebene kann man eine derartige Homogenisierung befürchten: Wenn die Naturwissenschaft immer auf allgemeine Gesetze zielt, scheinen individuelle Differenzen zwischen Menschen zugunsten des allgemeinen Typus Mensch eingeebnet zu werden. Schelling hat bereits 1802 eine Formel, die derartigen Befürchtungen Ausdruck verleiht: eine solche – materialistische – Betrachtungsweise führe auf ein „allgemeines Applanierungssystem“ gewaltsamer Einebnung, auf einen „literarischen Sansculottismus“. Die unmittelbare Gegenreaktion ist naheliegend: Zu versuchen, genau solchen individuellen Differenzen nachzugehen, dabei insbesondere die individualisierenden Erfahrungen etwa der Kunstrezeption und –produktion zu berücksichtigen, zugleich natürlich die Reichweite der Naturwissenschaften einzuschränken. Dies sind Ziele, die 30 traditionell mit den Geisteswissenschaften verbunden sind. Wichtig ist aber, sofort festzuhalten, daß die Geisteswissenschaften historisch eher noch jünger sind als die Naturwissenschaften: heute werden wir kennenlernen, wie erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Geisteswissenschaften sich verselbständigen. Zweitens: Echte Kraft gegenüber den als Auswüchsen wahrgenommenen Implikationen der Naturwissenschaften entfalten die Geisteswissenschaften nur dann, wenn es ihnen gelingt, nicht nur thetisch eine Alternative zu formulieren, sondern diese auch wissenschaftlich zu begründen: Wenn es also, wie das deutsche Wort unmittelbar betont, Geisteswissenschaften mit einem reflektierten und anspruchsvollen Wissenschaftsbegriff sind. Drittens: Die Debatte zwischen Natur- und Geisteswissenschaften kann nicht rein theoretisch sein. Wenn tatsächlich auf beiden Seiten echte Wissenschaftlichkeit vorliegt, ist schwer zu sehen, wie theoretisch zu entscheiden sein soll. Man wird dann sein Augenmerk zu richten haben auf die eher emotional-weltanschaulichen Aspekte: Will man eine Welt, die rational, gesetzlich und technisch umsetzbar erklärt ist? Will man eine Welt, in der Qualitäten von Individuen gerade aufgrund ihrer Unerklärbarkeit geschätzt werden sollen? Es ist kein Zufall, daß genau in dieser Zeit – ich werde kurz darauf eingehen – Weltanschauungen zum zentralen Thema der Philosophie wurden. Ein Beispiel für eine literarische Strategie, den absoluten Eigenwert des Individuums zu betonen, läßt sich sehr schön an Stefan George betrachten. Bilder George George, einer der großen Lyriker der Jahrhundertwende, inszeniert sich ganz bewußt als geniale Persönlichkeit und bedient sich dabei einer medialen Strategie, die ganz gezielt auf Bilder zurückgreift. Seine ersten Publikationen erscheinen in wenigen, aufwendig gestalteten Exemplaren, der Dichter gestaltet sich und sein Werk als Rara, die bereits äußerlich gegen den Zeitgeschmack und eine Verflachung des Menschenbildes und Literaturbetriebs opponieren. Diese Strategie allerdings bricht im Laufe seiner Karriere. Seine späteren Gedichtbände werden in massenhaften Auflagen von mehreren 10.000 Exemplaren gedruckt. Beide Haltungen, die Hinwendung an die wenigen Auserwählten ebenso wie die Massenproduktion, können unter ein gemeinsames Ziel, das einer wirksamen Verkündigung gestellt werden, dienen also einer Umgestaltung von Weltanschauungen, sollen die Welt im Sinne von Georges dichterischer Konzeption umgestalten. In einer solchen Haltung liegt ein anti-rationaler Affekt, der sich sehr klar im Einleitungsgedicht seiner Hymnen greifen läßt. Ich zitiere die ersten Verse, und Sie sehen sofort, wie hier ein hochgestimmter Weiheton mit größter Feinheit, gesuchter Preziosität in 31 Motivwahl und Sprache sich verbindet, zugleich aber die „Denkerstörung“ abgewiesen wird, um auf das Eigene, die individuelle Erkenntnisleistung oder Stimmung hinzulenken: „Hinaus zum strom! wo stolz die hohen rohre / Im linden winde ihre fahnen schwingen / Und wehren junger wellen schmeichelchore / Zum ufermoose kosend vorzudringen. // Im rasen rastend sollst du dich betäuben / An starkem urduft . ohne denkerstörung . / So dass die fremden hauche all zerstäuben. / Das auge schauend harre der erhörung.“ Geistige Phänomene, Wahrnehmungen zum Teil flüchtigster Art werden betont, die direkt aus Phänomenen der Natur gewonnen sind, die als „Urduft“ primordialen Charakter gewinnen. Eine solche Perspektive stellt sich zwischen individuelle Geistigkeit und allgemeine Natur. Damit ist ein Motiv benannt, das uns durch die heutige Vorlesung geleitet. Der Beginn einer philosophischen Reflexion über Geisteswissenschaften stammt nämlich nicht aus der preziös-individualistischen Kunstwelt, sondern aus ganz robusten Überlegungen zur Methode einer Wissenschaft von der Natur. Deshalb beginne ich mit einem größeren Abschnitt zum Empirismus, in dem John Stuart Mills Logik die zentrale Rolle spielt, um dann im zweiten Teil der Vorlesung auf die Theoretiker einer Philosophie der Geisteswissenschaften, Wilhelm Windelband und Wilhelm Dilthey, einzugehen. Der in der letzten Stunde bereits angedeutete Trend, Philosophie zunehmend auf die Methode der sich immer mehr verselbständigenden Wissenschaften zu beziehen, setzt sich damit fort. 2. Allgemeine Merkmale empiristischer Positionen. Ausgangspunkt einer empiristischen Position ist das konkrete Faktum, das die Erfahrung liefert. Wir hatten bereits bei Feuerbach gesehen, daß solche Fakta nicht unbedingt unmittelbar ins Auge springen; Feuerbach wollte zwar von konkreter Wirklichkeit ausgehen, diese konnte aber erst gewonnen werden, indem man den Menschen in seiner Gesamtheit betrachtet, also eine sehr komplexe wissenschaftliche Theorie des Menschen einbezieht. Wieder sieht man zudem, daß eine idealistische Philosophie wie diejenige Kants die Erfahrung nicht abwerten muß, sondern sogar als Maßstab für das Erkennbare überhaupt verwenden kann. Bei Kant ist das einzelne Faktum nur notwendiges Komplement der allgemeinen Formen der Erkenntnis, in das es einzupassen ist. So, und nur so, nach Kant, kann objektive Allgemeingültigkeit gesichert werden. Genau dieser Anspruch wird, so haben wir gesehen, im Zuge der zunehmenden Verselbständigung der Naturwissenschaften aufgehoben: Wenn man sich an den Wissenschaften orientieren soll 32 (wie ja auch Kant fordert), diese aber keine strikt absolut gewissen Aussagen liefern (sogar in der Mathematik!), muß man auch die Forderung nach absoluter Gewißheit fallenlassen und gewinnt damit neuartige Freiheitsgrade in der Berufung auf einzelne Fakta. Damit sind klassische Elemente Empirismus benannt: Die Forderung nach umfassender Wissenschaftsorientierung, die weit über Kants Berufung auf Mathematik und Physik hinausgeht und nun auch die empirischen Wissenschaften gleichrangig berücksichtigt, zugleich aber den Anspruch auf absolute Gewißheit aufgibt und sich deshalb viel stärker an einzelnen, „unmittelbaren“ Eindrücken orientieren kann. Ein weitreichendes Beispiel hatten wir bei Helmholtz gesehen: sogar unsere Raumwahrnehmung und damit die axiomatischen Grundlagen von Geometrie kommt aus solchen Eindrücken. Im Empirismus nimmt also jedes Wissen seinen Anfang mit der begriffsfrei, d.h. als rein Gegebenes gedachten Erfahrung und unterliegt ihrer Kontrolle. Genau diese Begriffsfreiheit von Erfahrung hatte Kant in Frage gestellt. Wichtig ist dabei, daß dieser Erfahrungsbezug und die Erfahrungskontrolle nicht notwendig direkt zur Wirklichkeit führen müssen. Helmholtz hatte betont, daß uns in solcher Erfahrung keineswegs die Dinge selbst gegeben sind, sondern nur stabile Zeichenverhältnisse zwischen Eindrücken. Einem Empirismus kann also ein starkes Moment von Wirklichkeitsdistanzierung innewohnen -- dennoch gehen empiristische Positionen typischerweise davon aus, daß eine Wirklichkeit vorhanden ist, selbst wenn diese nicht so beschaffen sein muß, wie wir sie zu erkennen meinen. Hieran hängt eine typische weitere Folgerung, die empiristische Theorien auszeichnet: wenn man von begriffsfreier Erfahrung ausgeht und nicht von vornherein eindeutige Feststellungen über die Art der unabhängigen Wirklichkeit treffen kann, muß jede solche Erfahrung gleichrangig behandelt werden. Eine Trennung in unterschiedliche Erfahrungsbereiche ist nicht möglich. Hierin liegt der Anknüpfungspunkt für eine Einbindung der Geisteswissenschaften: Geist und Natur, Geistes- und Naturwissenschaften können in einer empiristischen Position inseparabel verbunden werden. Übersichtsfolie: empiristische Autoren Hierin, im Nebeneinander von exklusiver Wissenschaftsdominanz und versöhnlicher Einbeziehung unterschiedlichster Erfahrungsbereiche, liegen unterschiedliche Optionen; man kann von hier auf eine naturalistische Wissenschaftsverherrlichung kommen, wie wir sie in der letzten Stunde gesehen hatten, aber auch auf ein individuelles Sendungsbewußtsein – nicht unähnlich demjenigen 33 Georges – oder eben auf eine Theorie der Geisteswissenschaften. Gar nicht so selten spitzt sich dieses Nebeneinander zu Skurrilitäten zu, die scheinbar Abstriche am Ideal durchgängiger Rationalität einbringen. Ein Beispiel: Jeremy Bentham, ein vor allem in Fragen der Moral- und Staatsphilosophie wesentlicher Bezugsautor für Mill, bestand darauf – er hatte gerade über Techniken zur Körperkonservierung bei den Maoris gelesen --, daß sein Körper entsprechend behandelt werde und allen zukünftigen Generationen die wahrhaftige, physisch und physiologisch reale Gestalt des größten Wohltäters der Menschheit, als den sich Bentham aufgrund seiner praktisch-politischen Theorien sah, vor Augen geführt werde. Leider scheiterte dieses Unterfangen am Handwerklichen, die traditionellen Konservierungstechniken ließen sich im wissenschaftlichen England nicht erfolgreich imitieren; immerhin jedoch: in einem Glaskasten in University College, London, einer Pförtnerloge nicht unähnlich, sitzt auch heute noch eine Gestalt im Kostüm des 18. Jahrhunderts: Benthams Skelett, angetan mit seinen originalen Kleidern, gekrönt von einem Wachskopf. Problem, daß Wissenschaftsberufung auf der einen Seite nicht unbedingt mit durchgehend offenkundiger Rationalität in der konkreten Umsetzung einherzugehen scheint. Lokale Vernünftigkeit wird (zumindest) verschroben, wenn sie universalisiert wird und den Körper eines Menschen als Mahnmal geistiger Leistungen verewigen möchte. Insgesamt scheint eine solche Philosophie sowohl den Idealisten als auch den Protagonisten der vorletzten Stunde ein radikales Gegenbild gegenüberzustellen. Das Factum brutum, das nackte, aber auch brutale Faktum erfordert für Feuerbach ausgiebige wissenschaftlich-anthropologische Vorarbeit; und für die Idealisten ist das einzige Faktum, das man legitimerweise einem philosophischen oder wissenschaftlichen System zugrundelegen kann, eben keine Aussage über ein Ding in der Welt, sondern eine selbstgesetzte Handlung des eigenen Ichs. Noch wenn der späte Schelling der Realität einen neuen Wert einräumt, ist die „Tatsache“, auf die er sich stützt, eine solche, die erst kompliziert „ausgemittelt“ werden muß; er ist Empirist insofern, als alles von Belang gesagt ist, sobald die Tatsache einmal bekannt ist; aber die Tatsache ist nicht am Anfang, sondern erst ganz am Ende bekannt. Damit ist gar nicht unbedingt einfach, zu sagen, worin der große Bruch mit der idealistischen Vergangenheit liegt. Auch John Stuart Mill ist daran interessiert, Wissenschaftlichkeit zu sichern, auch die modernen Empiristen des 19. Jahrhunderts sehen die Notwendigkeit, alle Fragen des theoretischen und praktischen 34 Lebens auf Wissenschaft zu basieren, alle vertreten sie weiter die Idee der Einheitlichkeit der Wissenschaften in einem sehr starken Sinn. 3. James Stuart Mill: „Biography of a steam engine“ Mit der Biographie John Stuart Mills lernen wir eine weitere Wissenschaftlerbiographie außerhalb der Universität und mit reichlich kuriosen Charakteristika kennen. Mills Laufbahn ist mit typischen Institutionen seiner Nation verknüpft; er beginnt seine schulische und wissenschaftliche Laufbahn mit großer Bravour, es kommt aber – nicht unähnlich wie bei Feuerbach und Schopenhauer -- zu einem Knick jedenfalls in der akademischen Karriere, und wie eine ganze Reihe der großen Philosophen des 19. Jahrhunderts – Kierkegaard, Nietzsche, Comte... – erlebt er tiefgreifende psychische Krisen. Generell gehört es zu den Merkmalen des Empirismus, auf die Durchführbarkeit präzise geplanter Bildungsprogramme zu vertrauen; wenn unmittelbare Eindrücke für geistige Tätigkeit zentral sind, so die Idee, kann man über die gezielte Auswahl der Eindrücke die Bildung eines Menschen bestimmen, und quantitativ durch die Zahl der Eindrücke verbessern. Comte oder Condillac in Frankreich hatten hierzu umfassende Programme vorgelegt, im Falle Mills war es sein Vater, James Mill, selbst ein bedeutsamer Philosoph insbesondere mit politisch-moralisch-staatsphilosophischem Einschlag, der die Erziehung seines Sohnes steuerte. John Stuart erhielt bereits mit drei Jahren den ersten Griechischunterricht und ist, dann nicht mehr überraschend, einer der jüngsten Studenten, die es im England seiner Zeit gab, wendet sich dann aber praktischen Aufgabenfeldern zu, die er auch in seinen Werken behandelt. Er selbst hat seinen eigenen Bildungsgang als die „Biography of a steam engine“ beschrieben, offensichtlich leidend unter den Ansprüchen und Methoden seines Vaters, und siedelt ein solches Bildungsprogramm damit genau im Bereich einer naturalistisch-entseelten Zurichtung an, wie sie als Implikation naturwissenschaftlicher Weltsichten befürchtet werden konnte. Bemerkenswert ist auch, daß die genaue Planung der Erziehung Mill nur teilweise zum funktionierenden Staatsbürger machte; er geriet mehrfach in Konflikt mit den Autoritäten, so wurde verhaftet, weil er Flugblätter zur Geburtenkontrolle verteilte. Ein anderes, im England seiner Zeit nicht offiziell goutiertes Betätigungsfeld bildete sein Einsatz für das Frauenwahlrecht. John Stuart Mill (1806-1873) 35 Reisen, juristische Studien; ab 1823 in der Ostindischen Handelsgesellschaft Ab 1841 Briefwechsel mit Comte (1846 Bruch mit Comte) 1843 A System of Logic 1863 Utilitarianism 1865 MP für Westminster 1873 Tod in Avignon 4. Mill: Alle Wissenschaft geht induktiv vor Lassen Sie mich mit dem spezielleren Textausschnitt beginnen. Der Volltitel von Mills Hauptwerk von 1843 – dasselbe Jahr, in dem Feuerbach, Kierkegaard und Schleiden gewichtige Texte vorlegten -- lautet A System of Logic, being a connected view of the principles of evidence and the methods of scientific investigation. Im Deutschen erhält dieser ohnehin schon gewundene Titel einige neue Windungen: Die inductive Logik. Eine Darlegung der philosophischen Prinzipien wissenschaftlicher Forschung, insbesondere der Naturforschung. Der Übersetzer, Johann Schiel, konzentriert sich zunächst lediglich auf einen Ausschnitt aus Mills Werk, nämlich den Teil zur Induktion, und spitzt diesen dann noch auf die Naturwissenschaften zu. Wie er selbst angibt, folgt er damit einer Anregung Justus Liebigs, des großen Chemikers, der so unter seiner eigenen, in seinen Augen verfehlten Bildung im Rahmen der idealistischen Naturphilosophie gelitten hatte und nun, offensichtlich auch in einem Akt der Kompensation, die Methodologie der Wissenschaften als philosophische Aufgabe befördern möchte. Daß Mill in seiner Logik eben auch die Deduktion behandelt und sich keineswegs auf die Naturwissenschaften beschränkt, wird in der Übersetzung unterschlagen. Offensichtlich sieht man, für das deutsche Publikum, die Bedeutung Mills in seiner Leistung für die Naturwissenschaften. Eine weitere Differenz zum englischen Titel ist augenfällig: im Englischen taucht, anders als im Deutschen, das Wort „Philosophie“ nicht im Titel auf. Ungeachtet aller dieser Einschränkungen wird gerade die Übersetzung von Mills Logik in Deutschland zu einem der prägenden Texte für den Begriff der Geisteswissenschaft. Verfolgen wir den einen Zentralbegriff von Mills Text, den der Induktion. Man kann Mills Text in doppelter Weise lesen: Einmal als Traktat von den technischen Verfahren der 36 Induktion, zum anderen aber als einen Meta-Traktat, der der Induktion eine ganz zentrale Position zuweisen möchte und in ihr die zentrale Grundlage aller Wissenschaften gefunden zu haben glaubt. Induktion ist für Mill das einzige Verfahren, um Erkenntnis zu gewinnen. Mill zeigt in einer Kritik an anderen Formen von Erkenntnissicherung ebenso wie aus Betrachtungen zu faktischen Vollzügen beim Erkenntnisgewinn, der immer die Kontrolle durch Erfahrung sucht, daß seiner Meinung nach keine andere Methode bleibt. Was aber ist Induktion für Mill? Allgemein zunächst können wir der Einleitung zur Logik entnehmen: Induktion ist ein Schluß, allerdings nicht in der Form des traditionellen (wissenschaftlichen) Syllogismus, der Besonders aus Allgemeinem folgert, also Aussagen über einen Einzelfall dadurch beweist, daß dieser Fall unter ein allgemeines Gesetz subsumiert wird. Das Standardbeispiel [allerdings: Wenn Sie das auf den Vater aller Syllogistik, Aristoteles, beziehen wollen, erweist sich dieses Beispiel als unstimmig; also Vorsicht!] ist der Schluß auf „Sokrates ist sterblich“ aus dem allgemeinen Gesetz „Alle Menschen sind sterblich“ und die Zusatzprämisse „Sokrates ist ein Mensch“. Das Problem liegt in der allgemeinen Prämisse: Da eine allgemeine Prämisse vorausgesetzt werden muß, kann ein solcher Syllogismus kein Modell für eine Erkenntnissicherung abgeben, die von einzelnen Eindrücken ausgehen muß. Mill kehrt die Abhängigkeit von Allgemeinem und Besonderem aber nicht einfach um; Induktion ist nicht dadurch definiert, aus Besonderem das Allgemeine, sondern wird in sehr viel generellerer Weise bestimmt: sie dient dazu„eine Behauptung aus bereits gegebenen Behauptungen folgen“ (VII) – Mills Pointe zeichnet sich bereits ab: es wird keinen scharfen Unterschied zwischen Besonderheit und Allgemeinheit geben können, in der verallgemeinerten Bestimmung der Induktion als Schluß spricht Mill ausdrücklich nicht von besonderen oder allgemeinen Prämissen bzw. Konklusionen. Damit fällt ein weiterer Aspekt traditioneller Syllogistik weg: es gibt dann keinen absoluten Anfang des Schließens in ersten Prämissen. Bereits eine elementare Betrachtung zu jeglichem schlußfolgernden Denken kann dies begründen: jeder Schluß muß von Voraussetzungen ausgehen; die ersten Voraussetzungen können selbst nicht mehr schlußfolgernd erlangt sein, sondern müssen aus der Anschauung bekannt sein. Anschauung, Intuition, ist für Mill über jeden Zweifel erhaben, kann und muß nicht mehr durch Schlüsse begründet werden. Ausdrücklich weist er aber die Annahme ab, mittels spezieller anschauender Vermögen könne ein Sachverhalt direkt bewiesen werden. Anschauungen selbst beweisen nicht, für einen Beweis bleibt eine Schlußfolgerung – in verallgemeinerter Form – erforderlich. 37 Das grundlegende Argument Mills gegen das syllogistische Schließen verdankt sich einer sehr simplen Überlegung: Jeder allgemeine Satz, also auch jeder allgemeine Obersatz eines Syllogismus, enthält bereits alle konkreten Fälle, über die eine allgemeine Aussage getroffen wird; genauer: der allgemeine Obersatz kann nur so verstanden werden, daß er die Summe aller bekannten konkreten Fälle darstellt. Wenn man daher die Sterblichkeit eines bestimmten Menschen aus der allgemeinen Tatsache der Sterblichkeit folgert, sagt man nichts Neues, sondern wiederholt nur Bekanntes: „kurz, das Schließen von dem Allgemeinen auf das Besondere, als solche, kann nichts beweisen, indem man aus dem allgemeinen Princip nichts folgern kann, was das Princip nicht als bekannt voraussetzt“ (XVI). Mill erörtert eine etwas subtilere Form dieses Arguments: man kann sagen, der allgemeine Obersatz sei durchaus mehr als das bloß in der Benennung zusammenfassende Aussprechen einer Menge von Einzelfällen; er kann durchaus auch nicht bereits vorab bekannte Einzelfälle umfassen. Dann aber ist er in sich bereits als eine Folgerung aufzufassen: er würde dann besagen, daß alle Fälle, die den bekannten hinreichen ähnlich sind, sich in gleicher Weise verhielten. Dann wäre der allgemeine Satz nicht einfach eine Zusammenfassung von Fällen, sondern vielmehr eine abkürzende Bezeichnung für eine Vielzahl von Folgerungen, die jeweils die Ähnlichkeit von Einzelfällen aufstellen und insofern von Besonderem auf Besonderes gehen. Deshalb kann Mill der Meinung sein, daß „alles Schließen Induction zu sein scheint“, wobei hier gar keine strikt allgemeinen Aussagen vorkommen. Das führt sofort zur naheliegenden Frage, insbesondere wenn man etwa von Kant her denkt, auf den Mill, ohne ihn wirklich zu erörtern, immer untergründig bezogen bleibt: Wie kann man die scheinbar notwendigen Wahrheiten etwa der Mathematik in diese Konzeption einbeziehen? Hierin nun sieht Mill nun keineswegs ein Problem, sondern im Gegenteil: einen starken Hinweis auf die Überzeugungskraft seiner Ansicht. Die Gegenstände der Geometrie gebe es nämlich in der von der Geometrie erforderten Form gar nicht in der Wirklichkeit; kein gezeichnetes Dreieck gehorcht den Gesetzen der Geometrie. Das hatte auch Kant behauptet; für Kant existieren mathematische Objekte in der wissenschaftlich erforderlichen Form nur in meiner Anschauung. Aber nicht einmal dort, nach Mill: „können wir uns eine Linie ohne Breite vorstellen“. Kants Berufung auf die reine Anschauung verfängt also, aufgrund der konkret-psychologischen Beschränkungen unseres Vorstellungsapparates, nicht. Auch unsere Vorstellungen in der reinen Anschauung müssen für eine Empiristen aus konkreten Eindrücken kommen. Dann aber sind mathematische Aussagen Generalisationen aus der Erfahrung: „daß die Halbmesser 38 eines Kreises gleich sind, ist, soweit es von einem Kreise wahr ist, von allen Kreisen wahr; genau wahr ist es jedoch von keinem Kreise; es ist nur nahezu wahr, so nahezu, daß man in der Praxis keinen merklichen Fehler begeht, wenn man es als ganz wahr annimmt“ (XX). Auch die Axiome und Definitionen der Mathematik werden damit, schlagwortartig zusammengefaßt, „experimentelle Wahrheiten, Generalisationen aus der Beobachtung“ (XXIV) Dies betrifft nicht nur die Grundlagen der Mathematik, sondern ganz allgemein den Charakter allgemeinster Denkgesetze. Wenn beispielsweise Kant die Unbegreiflichkeit bestimmter Aussagen (etwa einer vierdimensionalen Geometrie) als gewichtiges Argument heranzieht, widerspricht ihm Mill; wenn für uns etwas unbegreiflich ist, hat das nicht mit Aussagen über die Beschaffenheit der Dinge an sich oder mit der fundamentalen Struktur eines fest vorgegebenen Erkenntnisapparates zu tun, sondern mit unserer eigenen, notwendig zufälligen, Bildungsgeschichte. Mill führt Beispiele aus der Geschichte der Wissenschaften an: Descartes hatte die Bewegung der Himmelskörper dadurch erklärt, daß in einem Äther, der das ganze Planetensystem erfüllt, Wirbelbewegungen stattfinden, in denen die Planeten entsprechend mitschwimmen; Newton hatte im Gegenteil die Wirksamkeit einer fernwirkenden Kraft angenommen. Eine solche Kraft aber konnte sich Descartes, aufgrund seines Verhaftetseins an tatsächliche Beobachtungen, schlicht nicht vorstellen. Mill achtet also auf andere Aspekte an den Wissenschaften als Kant. Während Kant die unabänderliche Gewißheit und Objektivität wissenschaftlicher Aussagen betrachtet, sieht Mill die Wissenschaft als historisch sich entwickelndes, fortschreitendes, dabei auch Irrtümer durchlaufendes Geschehen. (Man wird üblicherweise geneigt sein, dem Empirismus eine engere Wissenschaftsorientierung zuzuschreiben als Kant; man sieht nun, daß das nicht so einfach geht: die direkte Anwendbarkeit und Beziehbarkeit auf vorwissenschaftliche Beobachtungen muß von den Empiristen bezahlt werden durch die Aufgabe bestimmter, gerade von den Wissenschaften hochgehaltener Ansprüche). Mill spricht hierbei ausdrücklich als Nicht-Naturwissenschaftler; die Geschichte der Wissenschaften und die Philosophie der Wissenschaften erhellen sich gegenseitig, ohne daß man auf eine absolut objektive Instanz in den Wissenschaften verweisen müßte oder auch nur könnte. Mill selbst gibt folgende Zusammenfassung seiner Überlegungen (S. XLVIIIf.): „Aus diesen Betrachtugnen geht hervor, daß alle deductive oder demonstrative Wissenschaften ohne Ausnahme inductive Wissenschaften sind; daß ihr Beweis der der 39 Erfahrung ist, daß sie aber auch Kraft des besonderen Charakters eines unentbehrlichen Theils der allgemeinen Formeln, nach denen ihre Inductionen gemacht sind, hypothetische Wissenschaften sind. Ihre Schlüsse sind nur auf gewisse Voraussetzungen hin wahr, welche Annäherungen an die Wahrheit sind, oder sein sollten, aber selten oder niemals genau wahr sind; und diesem hypothetischen Charakter ist die eigentümliche Gewißheit zuzuschreiben, von der man annimmt, sie sei inhärent oder demonstrativ.“ Mill geht über die theoretische Begründung der Notwendigkeit einer induktiven Theorie der Wissenschaften hinaus und möchte diese Theorie auch zu einem arbeitsfähigen Instrument für die wissenschaftliche Praxis machen. Wesentlich dabei ist eine starke Annahme über die Grundlage der Induktion: Das „Axiom von der Stetigkeit (Gleichförmigkeit) in dem Gang der Natur“. Mill betont auch hier, daß Gleichförmigkeit der Natur mit ihrer unendlichen Variabiltität einhergeht, also nicht eine strikt festlegende aprioristische Annahme bedeute. Standardbeispiel hierfür sind die schwarzen Schwäne, die offensichtlich zu einer Revision unserer Annahme an die Stetigkeit der Artbestimmung „Schwan“ zwingen. Die konkreten Regeln, die Mill vorgibt, geben an, wie man ausgehend von den komplexen Ereignissen, wie sie die Beobachtung darbietet, zu Gesetzen kommt, also die relevanten Ähnlichkeiten, die durchgehend gleichen Faktoren unter den wechselnden Eigenschaften herausfindet. Eine solche Regel kann beispielsweise sein: wenn man verschiedene Fälle hat, die sich im Eintritt des zu betrachtenden Resultats unterscheeden, ansonsten aber nur in einem Aspekt sich unterscheiden, dann liefert dieser Aspekt die kausale Ursache für den Eintritt des Resultats. Dies formalisiert, wie leicht zu sehen, eine mindestens seit Bacon ausdrücklich formulierte experimentelle Praxis der Wissenschaften; das wissenschaftliche Experiment zielt stets darauf, genau solche Fakturen zu eliminieren, indem systematisch Bedingungen des experimentellen Aufbaus variiert werden. Zwei ganz zentrale Folgerungen sind festzuhalten - Mill behandelt nicht nur die Naturwissenschaften, die „natural sciences“, sondern auch die „moral sciences“. Es ist dieser Terminus wird zumindest in einer der deutschen Übersetzungen zu „Geisteswissenschaften“ wird. Hierzu gehören z.B. Geschichte, Politikund Gesellschaftswissenschaften sowie die Fragen der Moral und Ethik. Man könnte zunächst der Meinung sein, daß auf diesen Gebieten gänzlich andere Verhältnisse vorlägen als im Falle der Naturwissenschaften. Hier scheint es keine echten allgemeinen 40 Regeln zu geben, jedes einzelne Ereignis scheint in sich so komplex zu sein, daß die Suche nach wenigen relevanten Faktoren von vornherein aussichtslos ist. In dieser Weise hat man im späteren 19. Jahrhundert einen Gegensatz zwischen Natur- und Geisteswissenschaften zugespitzt formuliert. Bei Mill liegt die Sache ganz anders. Es gibt für ihn gar keine typisch geisteswissenschaftlichen und keine davon unterschiedenen typisch naturwissenschaftlichen Sachverhalte. Wenn jeder Schluß, jede Wissenschaft von vornherein induktiv zu verfahren hat, dann wird der Millsche Wissenschaftskanon auch auf die Geisteswissenschaften Anwendung finden müssen. Mill nimmt das tatsächlich an; selbst wenn in den geisteswissenschaftlichen Gebieten nur ganz schwache Generalisierungen z.B. in Aussagen über Regularitäten im menschlichen Verhalten, etwa über die Abhängigkeit von Bildung und Charakter möglich sind, sind das immerhin erste Generalisierungen aus der Beobachtung. Um zu einer Wissenschaft vom Menschen gelangen zu können, ist nach Mill ein weiterer Schritt zu fordern: diese empirischen Generalisierungen müssen konvergieren mit deduktiven Ableitungen, die von einer Theorie über die Natur des Menschen stammen: „Man kann sagen, daß die Wissenschaft der menschlichen Natur in dem Maße vorhanden ist, als die annähernden Wahrheiten, welche die praktische Kenntniß der Menschennatur bilden, sich als Corollarien aus den durchgänig allgemeinen Gesetzen der menschlichen Natur, auf denen sie beruhen, darstellen lassen.“ Mill ist der festen Überzeugung, daß eine solche (natürlich ihrerseits induktiv zu begründende) Wissenschaft vom Menschen möglich ist. Diese spielt dann wiederum auf allen Ebenen seiner Theorie eine Rolle; daß wir beispielsweise nach Kausalerklärungen suchen, ist nach Mill nicht in der Kantischen Weise einer begrifflich notwendigen Grundlage unserer Erkenntnis zu verstehen, sondern einfach als Faktum innerhalb einer solchen Wissenschaft vom Menschen. Man kann von daher in allen Aussagen, die Mill über menschliches Erkennen und Wissenschaft trifft, Sätze sehen, die zu einer Theorie über den menschlichen Geist, also eine Psychologie in einem allgemeinen Sinne gehören. Diese Auffassung hat man als Psychologismus bezeichnet; wir werden bei Husserl darauf zurückkommen. - Auch in Mills moralphilosophischer Theorie kommen diese Grundgedanken zum Tragen. Mill vertritt in der Moralphilosophie einen Utilitarismus (dies ist der Punkt, wo Mill ganz direkt von Jeremy Bentham beeinflußt ist). Die Grundidee, das Greates Happiness Principle, ist so einfach wie provokant formulierbar: „The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the 41 reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain“. Was tut Mill, um diese These plausibel zu machen? Er zeigt, daß alles, was an herkömmlichen Moralbegründungen wertvoll ist, unter sein Prinzip fällt („Jesus’ golden rule“; Kants kategorischer Imperativ), und daß es natürlich auch „intellectual“, höhere, „pleasures“ gebe. Auch wenn man Mill zugesteht, daß sich – eventuell unter entsprechender Umdeutung des Begriffs „Happiness“ – alle traditionellen Moraltheorien unter dieses Prinzip bringen lassen, finden sich wichtige Neuerungen: Mill betont hier das Kontinuum zwischen allen Versionen und inhaltlichen Deutungen von Happiness. Dieser Kontinuumsgedanke und die Betonung des faktischen Charakters des Prinzips sind die wesentlichen Aspekte, mit denen sich Mills Moralphilosophie an seine Logik anschließt (obwohl er am Ende der Logik zugesteht, daß sie nicht wirklich einen Teil der Logik bilden kann; in der Moral käme es einerseits sehr viel mehr auf Einzelfallanalysen an, zum anderen sei der absolute Prinzipiencharakter stärker ausgeprägt, so daß man zwar von der Logik einen Ausblick auf eine damit kompatible Moraltheorie gewinnen, diese aber nicht in die Logik wirklich hereinholen kann.) Gemeinsam ist in jedem Fall die Annahme eines Bemerkungen zur Zusammenfassung: Kontinuum aller möglichen Ausprägungen von Happiness ebenso wie aller möglichen Gewißheitsgrade wissenschaftlicher Aussagen; von der Idee absoluter Begründung oder absoluter Gewißheit muß man sich verabschieden. Zugleich wird das (seinerseits wissenschaftlich erfaßte) humane Faktum überall in die Theorie eingebaut. Drittens schließlich hängen theoretische Erkenntnissicherung und praktische Umsetzung engstens, (aber bei Mill nicht wirklich bruchlos) zusammen. 5. Philosophie der Geisteswissenschaften: Wissenschaftlichkeit und Wirklichkeit der geistigen Welt In der letzten Stunde hatten wir eine Reihe von Ansätzen gesehen, wie man an Kant anknüpfend der Philosophie neue Aufgaben erschließen konnte, die zugleich den Ansprüchen der erstarkten Spezialwissenschaften Rechnung tragen können: Erkenntnistheorie und Wissenschaftsmethodologie, zusammen mit neuen Formen eines Apriori (der Physiolgoie bei Helmholtz) bilden den Rahmen für einen Neukantianismus, der sich bei Helmholtz an den Naturwissenschaften orientierte. Es wurden aber bei denselben Autoren auch Ansatzpunkte sichtbar, die in den Bereich der 42 Geisteswissenschaften überleiten, und die Darstellung von Mills Induktivismus bestärkt einen solchen Zusammenhang unmittelbar. In der letzten Stunde waren die Schwierigkeiten mit einer angemessenen Beschreibung geistiger Phänomene und die ungebrochene Bedeutsamkeit klassischen Bildungsgutes als Beispiele angesprochen worden. Lassen Sie mich eine weitere Frage stellen, die ebenfalls zu Geisteswissenschaftlern überleitet: Welche Rolle haben denn nun die naturwissenschaftlichen Autoren der Philosophie zuerkannt? Bei DuBois-Reymond werden spezifisch philosophische Fragen erörtert, aber es ist nicht erkennbar, welche eindeutig philosophischen Argumentrationsresourcen er nutzt; bei Haeckel kann es keine Philosophie unabhängig von den Naturwissenschaften geben, da die Naturwissenschaften, eventuell ausgeweitet zum Monismus, alles leisten, was die Philosophie nur beanspruchen könnte. Genauso, nur mit einem Schuß ätzender Radikalität mehr, argumentieren die Materialisten. Einzig Helmholtz scheint Optionen für eine echte, neuartige Zusammenarbeit von Philosophie und Naturwissenschaften anzudeuten, wenn er Erkenntnistheorie stark macht. Niemand kann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Erfolge der Naturwissenschaften ableugnen. Immer noch aber bleiben mehrere Strategien, um philosophisch mit diesen Erfolgen umzugehen: Man kann sie um eine Art von Grundlagenreflexion oder (erkenntnis-)kritische Begleitung ergänzen; oder man kann ihnen eine bloß eingeschränkte Reichweite zuweisen, unter der Annahme, daß sie eben nur einen Teil des philosophisch relevanten Problemkreises umfassen. An beide Strategien knüpfen geisteswissenschaftliche Ansätze an. Genauer muß man auch hier, genau wie bei den naturwissenschaftlichen Ansätzen der letzten Stunde, betonen: Es geht selbstverständlich um eine philosophische Reflexion auf die Geisteswissenschaften, die sich ebenfalls mit großem Erfolg verselbständigen; Gebiete wie die Philologien oder die Geschichtswissenschaften, einstmals wie die Naturwissenschaften untergeordnete Teilgebiete der Philosophie, etablieren sich mit großem Selbstbewußtsein. Wenn man um 1900 die Frage nach den herausragenden Exponenten von Wissenschaftlichkeit überhaupt stellt, erhält man immer wieder eine stereotype Antwort: Die idealtypischen Wissenschaften sind die reine Mathematik und die klassische Philologie, beide offensichtlich zweckfrei und offensichtlich hochgradig methodisch komplex, also lediglich einem rein immanenten Ideal von Wissenschaft verpflichtet. Philosophische Reflexion auf die Geisteswissenschaften verlang zunächst, daß genaue Kriterien angegeben werden, wie zwischen den unterschiedlichen 43 Wissenschaftsformen unterschieden werden kann. Diese Aufgabe stellt sich Wilhelm Windelband in einer überaus bekannt gewordenen Rede über Geschichte und Naturwissenschaft. Zugleich sieht er in dieser Aufgabe ein besonders wichtiges Beispiel für eine zeitgemäße und populär vermittelbare philosophische Aufgabe. Damit weist er der Philosophie einen weiteren, die gerade gegebene Liste von Optionen ergänzende Aufgabenstellung zu: Philosophie betätigt sich in der Wissenschaftssystematik, greift also reflektierend nochmals auf alle vorliegenden einzelnen Wissenschaften zu. In diesem systematisierenden Gesamtzugriff blieben wichtige Anspruchshaltungen traditioneller Philosophie erhalten, zugleich kommen die vereinzelten Wissenschaften in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit zu ihrem Recht: in dieser Perspektive scheint hierin tatsächlich eine echte Lösung für das Problem der Philosophie, nach dem Auszug der Einzelwissenschaften keinen eigentlichen Gegenstand mehr zu besitzen, zu liegen. Eine solche Systematisierung kann die Naturwissenschaft jedenfalls dann nicht leisten, wenn sich zeigen läßt, daß es tatsächlich zwei grundverschiedene Wissenschaftstypen gibt, die sich nicht aufeinander zurückführen lassen, so daß sich eine verallgemeinernde Beschreibung im Sinne allgemeiner Gesetze wie im Bereich des Naturalen verbietet. Von daher muß sich Windelband auch der Aufgabe widmen, eine verfeinerte Beschreibung der vorliegenden Wissenschaften zu entwickeln; und hierfür, so müßte man mit ihm argumentieren, ist gerade geisteswissenschaftliche Kompetenz gefragt. Windelband (1848-1915) exemplifiziert schon durch seine Karriere die inhaltlichen Probleme der Philosophie. Er studiert in Jena und Göttingen zunächst Medizin und Naturwissenschaften, dann erst Geschichte und Philosophie. Seine erste Professur in Zürich trägt die präzisierende Kennzeichnung „Professur für induktive Philosophie“, greift also genau das entscheidende Stichwort Mills auf. Daß Windelband als erklärtermaßen geisteswissenschaftlicher Philosoph diese Stelle erhielt (übrigens als Nachfolger eines viel stärker naturwissenschaftlich-experimentell ausgerichteten Wissenschaftlers: Von Wilhelm Wundt, der später als Begründer der experimentellen Psychologie bekannt wurde), demonstriert ganz konkret die Offenheit des Induktionsbegriffs. Die nächsten Stationen Windelbands führten ihn nach Freiburg, Straßburg, ab 1903 nach Heidelberg; die geographische Zuordnung bleibt in der Schulrichtung erhalten, der man ihm zuordnet: ein südwestdeutscher Kantianismus (Das setzt voraus, daß es einen anderen gibt: den Marburger Neukantianismus, der viel stärker naturwissenschaftliche Ansätze einbezog.) Bedeutsam wurde Windelband vor allem durch philosophiehistorische Arbeiten; von ihm stammt der massiv vorgetragene Anspruch, daß man Philosophiegeschichte vornehmlich 44 problemgeschichtlich und nicht einfach individualbiographisch zu schreiben habe. Sein Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, erstmals 1892 erschienen, wurde immer wieder aufgelegt und ergänzt und ist bis heute erhältlich und immer noch empfehlenswert. Seine eigene Position entfaltet Windelband am prägnantesten in einer Reihe von Aufsätzen, die in der zweibändigen Sammlung Präludien (1884) zusammengetragen sind; auch die im folgenden zu besprechende Straßburger Rektoratsrede von 1894 ist in den späteren Auflagen dieser Sammlung enthalten. Geschichte und Naturwissenschaft entsteht aus einem ganz konkreten Redeanlaß: Windelband muß als neuer Rektor eine programmatische, die ganze Universität einbeziehende, zugleich aber ein spezifisch philosophisches Profil entwickelnde Rede halten. Ausgangspunkt seiner Rede ist genau diese pragmatisch naheliegende Frage: Welche Frage kann denn ein Philosoph in einer Rektoratsrede behandeln? Zunächst hat die Philosophie ganz spezielle Schwierigkeiten mit dieser Frage: „Für die Philosophie gibt es streng genommen überhaupt keine Spezialuntersuchung; jedes ihrer Sonderprobleme dehnt seine Linien von selbst in die höchsten und letzten Fragen aus.“ (136). Angesichts dieses Anspruchs und der Schwierigkeit, ihn einzulösen, sieht Windelband zwei Auswege, die beide bequem scheinen und beide in seiner Zeit gängig sind, Windelbands Ansprüchen an die Philosophie aber in keine Weise genügen können: einmal einen bloß philosophiegeschichtlichen Zugriff, zum anderen „seine Zuflucht zu der besonderen Erfahrungswissenschaft zu nehmen, die ihm nach den noch bestehenden akademischen Einrichtungen und Gewöhnungen ebenfalls obzuliegen pflegt – der Psychologie.“ (137). Windelband sieht in beiden Versuchen einen Verzicht auf den traditionellen Anspruch der Philosophie, sich den großen Fragen gewachsen zu zeigen. Im ersten Fall verzichtet man auf eine aktuelle Relevanz der Philosophie, im zweiten übergibt man die philosophische Kompetenz einer anderen, nicht-philosophischen Disziplin. Was Windelband selbst dann unter dem Titel Geschichte und Naturwissenschaft vorlegt, ist nichts weniger als ein Versuch, ein exemplarisches Beispiel dafür vorzulegen, wie die Philosophie sich, auch nach Ablegen der „metaphysischen Begehrlichkeiten“, mit solchen Fragen befassen kann. Das Problem, das er beantworten möchte, läßt sich ganz schlicht benennen: er möchte herausarbeiten, wie man Geschichte als die typische Geisteswissenschaft von den Naturwissenschaften begrifflich präzise unterscheiden kann. Dieses Problem hatte zu seiner Zeit unbestreitbare Aktualität und ist sicher über die Fächergrenzen hinweg interessant und erfüllt somit wenigstens einige der Anforderungen an eine Rektoratsrede – aber warum konnte er der Meinung sein, damit einen Beitrag zu den „großen Fragen“ 45 geleistet zu haben? Seine Antwort ist, wo sie konkret vorliegt, selbst historisch: Philosophie habe sich immer im „Lebenszusammenhang“ mit den anderen Wissenschaften bewegt; von daher gehöre eine wissenschaftslogische Frage wie diejenige nach der Unterscheidung grundlegender Wissenschaftsformen zum traditionellen Kernbestand der Philosophie. Man wird aber vermuten dürfen, daß ein anderes Motiv mindestens genauso stark wirkte: Nämlich der Versuch, für die Philosophie Kompetenzen darin zu gewinnen, daß sie über das System der Wissenschaften insgesamt nachdenkt und dazu natürlich auch die Wissenschaften zu klassifizieren und typologisch einzuteilen hat. Die bereits angeführten Motive für dieses Motiv sind dann durchsichtig: Man kann so der Philosophie ihre traditionelle Affinität zum Systematischen erhalten und zugleich ihre Abhängigkeit von den sich spezialisierenden Wissenschaften würdigen; man kann sogar dem Prozeß der zunehmenden Spezialisierung, der vordergründig eine Entfremdung der Wissenschaften von der Philosophie darstellt, positive Bedeutung geben: Denn erst dieser Prozeß würde dann die philosophische Aufgabe der Systematisierung erst wirklich dringlich und aktuell machen. Welche Einteilungsmerkmale ermittelt Windelband nun? Klar scheint ihm zu sein, daß eine Unterscheidung nach den Gegenständen, die in den Natur- bzw. Geisteswissenschaften verhandelt werden, nicht gangbar ist. Hierfür genügt das Beispiel der Psychologie, die sich zwar mit dem Gegenstand des menschlichen Geistes befaßt, methodisch aber, etwa durch das Experiment, die Orientierung an den Naturwissenschaften sucht. Die Unterscheidung wird also methodologisch zu treffen sein. Als gemeinsames Merkmal der Naturwissenschaften sieht Windelband die Suche nach Gesetzmäßigkeiten, nach allgemeinen Aussagen. „Demgegenüber ist die Mehrzahl derjenigen empirischen Disziplinen, die man wohl sonst als Geisteswissenschaften bezeichnet, entschieden darauf gerichtet, ein einzelnes [...] Wirkliches zu voller und erschöpfender Darstellung zu bringen.“ (144) Damit hat er bereits ein Kriterium gewonnen, das es gestattet, zwei Wissenschaftsformen einander gegenüberzustellen: „Die einen sind Gesetzeswissenschaften, die anderen Ereigniswissenschaften; jene lehren, was immer ist, diese, was einmal war.“ (145) Hierfür prägt Windelband zwei neue Ausdrücke: Idiographisch vs. nomothetisch. Diese Ausdrücke gehen über die bloße Gegenüberstellung von Allgemeinheit – im Gesetz, dem nomos – und Einzelnheit – dem idion – hinaus und skizzieren zugleich, wie diese jeweils konkret methodisch erreicht werden können: Die Einzelheit wird im Verfahren des Beschreibens erfaßt, während Gesetze immer thetisch hingestellt werden; thetische Gesetze werden nie jedem Einzelfall genau angemessen sein 46 können, während Beschreibungen genau das adäquate Erfassen des Einzelfalls fordern. Weitere Möglichkeiten, diese Unterscheidung auszuformulieren, wären: die eine Wissenschaftsform sucht Gesetze, die andere Gestalten; die eine besitzt eine Tendenz zur Abstraktion, die andere zur Anschaulichkeit. Denken Sie an die typischen Produkte der jeweiligen Wissenschaften, um sich diese Unterscheidung zu veranschaulichen: Das Gesetz, mathematisch formuliert, typographisch in einem Kasten abgesetzt und durchnumeriert, im Falle der Naturwissenschaften; die literarisch geformte Beschreibung etwa des Lebens einer historischen Gestalt in einer Biographie; die Auslegung einer Dichtung, die nie Einzigkeit, aber gerade in ihrer Vielfältigkeit Angemessenheit an den künstlerischen Gegenstand beanspruchen kann. Wichtig ist: das ist eine rein methodologische Klassifikation; es bleibt sehr gut denkbar, daß ein und derselbe Gegenstand sowohl in einer geisteswissenschaftlich als auch in einer naturwissenschaftlich zu analysierenden Weise behandelt werden kann. Ein Baum kann von einem Botaniker als Eiche klassifiziert und unter allgemeine Sätze gebracht werden, während ihn der Kulturhistoriker als Ort eines historischen Ereignisses oder ein Literaturwissenschaftler als symbolische Gestalt beschreibt. Eine weitere Gemeinsamkeit ist wichtig und führt uns direkt auf die Leistungen John Stuart Mills zurück: Ungeachtet aller methodologischen Differenzen kommen beide Wissenschaftstypen in einem zentralen Punkt überein: in beiden Fällen handelt es sich um Erfahrungswissenschaften; 148 „Beide bedürfen zu ihrer Grundlage einer wissenschaftlich gereinigten, kritisch geschulten und in begrifflicher Arbeit geprüften Erfahrung.“ Sofort einsichtig wird dies, so Windelband, aus den empirischen Kenntnissen, die beispielsweise ein Handschriftenkundler besitzen muß. Dieser Erfahrungsbezug macht auch klar, warum Windelband mit einem gewissen Recht eine Professur für induktive Philosophie bekleiden konnte. Ungeachtet dieser Entsprechungen ist es Windelband wichtig, darauf zu insistieren, daß beide Wissenschaftstypen nicht aufeinander reduziert werden können. Insbesondere haben die Geisteswissenschaften einen irreduziblen Eigenwert: 155 „alles Interesse und Beurteilen, alle Wertbestimmung des Menschen [bezieht sich] auf das Einzelne und das Einmalige.“ Nur eine Wissenschaft von einzelnen Ereignissen also kann dem menschlichen Erfordernis nach Werturteilen Genüge leisten; umgekehrt: die zentrale Rolle, die Werturteile für den Menschen haben, verlangt notwendig nach einer bestmöglich fundierten Wissenschaft solcher einzelner Ereignisse, eben nach mit großem Anspruch ausgestatteten Geisteswissenschaften. Hierin liegt eine formale Entsprechung zu Kants 47 Versuch, philosophisch die Stellung von Mathematik und Naturwissenschaften zu sichern. Geschah dies bei Kant im Interesse der Sicherung objektiv-allgemeingültiger Aussagen über Dinge in der Welt, wird bei Windelband eine philosophische Fundierung der Geisteswissenschaften nötig, um Werturteile zu begründen. Die formale Analoge bleibt bestehen; Windelband operiert damit als ein Neukantianer, dem die Begründung von Werturteilen zentrale Aufgabe ist. Damit deutet sich eine Aufgabenteilung an, in der Natur- und Geisteswissenschaften zusammenwirken können: „den festen Rahmen unseres Weltbildes gibt jene allgemeine Gesetzmäßigkeit der Dinge ab, welche, über allen Wechsel erhaben, die ewig gleiche Wesenheit des Wirklichen zum Ausdruck bringt; und innerhalb dieses Rahmens entfaltet sich der lebendige Zusammenhang aller für das Menschentum wertvollen Einzelgestaltungen ihrer Gattungserinnerung“ (157). Diese Arbeitsteilung führt zu einem weiteren, wesentlich mit Windelbands Arbeit verbundenen Stichwort: Philosophie sucht ihre Rolle wesentlich darin – und bei Windelband arbeiten gerade auch die Kategorien zur Wissenschaftsklassifikation darauf hin --, zu verstehen, wie sich die „Weltanschauung“ des Menschen herausbildet und welche Funktion eine solche Weltanschauung hat. Weltanschauungen sind dabei definiert als diejenigen Gebilde, die als umfassende Deutungs- und Wertungsgebilde über die bloß theoretische Ordnung der Gesamtheit unserer Erkenntnisse hinausreichen und die emotionale, affektive, moralische Bedeutung unserer Erkenntnis von der Welt und unserer Stellung in der Welt thematisieren. Auch hierin sind ersichtlich traditionelle Aufgaben der Philosophie bewahrt: In der Reflexion über Weltanschauungen kann Philosophie als letzte Orientierungsinstanz wirken; zugleich wiederum ist das immer wieder beobachtete Motiv verarbeitet, daß es nicht mehr um logisch absolut stringente Letztbegründung gehen kann; Weltanschauungen sind keine deduktiv geschlossenen Welterklärungen oder Handlungsanweisungen, sondern emotional fundierte, den Menschen auf allen Ebenen ansprechende, gerade auch ins nicht mehr rational Faßbare reichende Orientierungsrahmen. Von daher überrascht nicht, daß im Zusammenhang mit Überlegungen, wie wir sie bei Windelband finden, eine eigene Weltanschauungsphilosophie entwickelt werden konnte. Alle diese Motive werden beim letzten heute zu besprechenden Autor, Wilhelm Dilthey, aufgegriffen. Dilthey, 1833-1911, studierte Geschichte, Altertumswissenschaft, Philosophie und Theologie; eher ungewöhnlich noch im Vergleich mit Windelband, ist mithin, daß seine Studien direkt und vollständig mit seinen späteren Arbeiten korreliert 48 sind. Er legt bahnbrechende historische, theologie- und philosophiegeschichtliche Arbeiten sowie Editionen vor; die Kant-Akademieausgabe geht auf seine Initiative zurück. Zentrale Werke spiegeln diese Interessen und zeigen, daß er von der philosophisch-methodischen Reflexion über die Geisteswissenschaften (Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1883) und zur Theorie von Weltanschauungen (Weltanschauungslehre) bis hin zu eigenen historischen Studien (z.B. Leben Schleiermachers, 1870) und intensiven Literaturinterpretationen das ganze Feld geisteswissenschaftlicher Forschung abdeckte. Sein Text über Leben und Erkennen ist ein Nachlaßtext, der nicht wie Windelbands Rede und die Texte der letzten Stunde aus einem konkreten populären Redeanlaß stammt, wobei aber auffallend ist, wie ähnlich trotzdem Stilebene und Argumentationsform ausfallen. Ausgangspunkt ist ein analogischer Zusammenhang zwischen „Lebenseinheit oder Subjekt und Ding oder Objekt“. Wenn Dilthey das ausformuliert, klingt das Resultat zunächst nach einer schlichten Beschreibung von Erkenntnisvorgängen: „Der Zusammenhang in dem Selbst wird nach dem Verhältnis der Dinge zu ihm auch in diesem modifiziert auftreten. Er wird modifiziert auftreten, weil die Umstände der Bildung der Dingvorstellung andere sind. Eine Reizmannigfaltigkeit und deren Veränderungen sind das Außen, welches von dem Widerstandsgefühl aus als ein Ganzes von Volition oder Kraft angeeignet wird. Und dieser Vorgang vollzieht sich von einem Interessenpunkte aus“ (169). Klassisch-idealistische Termini – der Zusammenhang im selbst, die in gewissem Ausmaß eigenständige Bildung einer Dingvorstellung – bleiben dabei zunächst erhalten. In der nächsten Umformulierung aber wird bereits Diltheys eigentliches Interesse sichtbar: „Der Vorgang ist dem analog, durch welchen wir eine Person verstehen“. Zentral also ist nicht das individuelle Verhältnis eines erkennenden Subjekts zu einer Dingwelt, sondern das Verstehen als eine interpersonale Deutungsleistung; Erkennen bedeutet nicht Aufnehmen oder Erzeugen, sondern Interpretieren. Damit ist bereits das Erkennen direkt an methodisch hochstehende Aufgaben der Geisteswissenschaften angeschlossen: Dilthey definiert die Grundaufgabe der Geisteswissenschaften folgendermaßen: „die Aufgabe der Geisteswissenschaften ist, diese [Lebenszusammenhänge] nachzuerleben und denkend zu erfassen.“1 Erkennen bildet nicht ab oder konstruiert, sondern vollzieht sich in einem dauernden wechselseitigen Abgleich von Interpretationsvorschlägen und deren Bewährung. 1 Wesen der Philosophie, Reclam S. 27. 49 Bemerkenswert ist der nächste Schritt, den Dilthey vornimmt: Nicht die hochgeistige Leistung der verstehenden Aneignung wird betont, sondern Dilthey geht vom Terminus des „Zusammenhangs“ aus und schildert Erkennen in direkter Analogie zu ganz entwicklungsbiologischen (auch psychologisch/psychoanalytischen) Formen von Zusammenhang. Jeder Mensch erlebt in seiner frühen Kindheit einen völlig undifferenzierten Zusammenhang nach dem Modell von Kind und Amme (darin steckt natürlich ein unfreiwilliger Einblick in soziologische Verhältnisse der deutschen akademischen Welt dieser Zeit, in der ein solcher Zusammenhang nicht zur Mutter bestand!). Genauso wie die Entwicklung des Individuums in einem fortschreitenden Ausdifferenzieren dieses Zusammenhangs besteht, wobei das Individuum lernt, zwischen sich und der Umwelt zu differenzieren, komplexere Bedürfnisse und Wahrnehmungsmuster zu entwickeln, ist auch das Erkennen zu verstehen. Wie bei Windelbands Erfahrungsberufung findet man also auch hier, bei einer fundamental geisteswissenschaftlich ansetzenden Philosophie, eine überraschend naturalistische Note, die aber wiederum nicht auf eine naturalisierende Reduktion führen darf. Folgerung Diltheys ist zunächst eine durchgehende Einheitlichkeit unseres Erkennens bzw. der Mittel, deren wir uns beim Erkennen bedienen. Es gibt nur ein Set von Kategorien; Subjekt- und Objektwelt fallen nicht auseinander: „Aus diesem Verhältnis ergibt sich, daß auch die Kategorien, in denen wir den gegebenen Zusammenhang des Lebens uns zum Bewußtsein bringen, durch das Ich und das Andere, das Subjekt und das Objekt, die Lebenseinheit und die Welt sich erstrecken. Sonach sind sie echte und volle Kategorien“. Allerdings: diese Kategorien dürfen nicht als fixes, formales Raster verstanden werden. Es gibt wohl formale Kategorien, die sich durch alle Bereiche des Erkennens ohne Änderung durchziehen, wie die Kategorie der Identität. Solche Kategorien sind aber eben auch nur formal, es sind keine „realen“ Kategorien. Formale Kategorien sind dadurch ausgezeichnet, ganz „durchsichtig“, dem Verstande restlos transparent zu sein. Dies kann von den realen Kategorien, vom Lebenszusammenhang selbst, nicht gesagt werden. Dieser ist nie voll verstanden, er verlangt eine dauernde Bemühung um ein angemessenes Verständnis, läßt aber auch eine Vielzahl unterschiedlicher Interpretationen zu. Keine der Interpretationen hat gegenüber einer anderen ein absolutes Recht, sich als die einzige mögliche Interpretation verstanden wissen zu dürfen. Wieder sind damit klassische topoi einer typisch geisteswissenschaftlichen Theorie von Interpretation in die philosophische Deutung des Erkennens einbeschrieben. 50 Ein Beispiel: während Identität eine lediglich formale Kategorie darstellt, bildet Selbigkeit eine reale Kategorie, die Dilthey folgendermaßen definiert (174): „Es ist eine im Subjekt gegründete reale Forderung von dessen Übereinstimmung mit sich selbst in Bezug auf jede Aussage von Wirklichkeit, was im Denken vorliegt.“ Diese Form von Übereinstimmung wird sie je nach konkretem Kontext, nach dem jeweiligen Lebenszusammenhang, modifizieren und bildet damit eine reale Kategorie. Geisteswissenschaften werden damit gegenüber Windelband weitergehend bestimmt. Sie sind Wissenschaften vom Verstehen; auch als solche suchen und finden sie keine absoluten Wahrheiten. Genauso wie im Verstehen aber immer Vorannahmen, allgemeine Verständnishorizonte in Anspruch genommen werden müssen, um überhaupt eine Basis für Verstehen zu schaffen, kann man aber dann im Erkennen überhaupt auf solche umfassenden, nicht mehr im jeweiligen Erkenntnisakt diskutierbaren Horizonte hinführen. Diese stellen keine absolut gültigen Aussagen dar, liegen aber genau an dem Ort, an dem traditionelle Letztbegründungen ansetzen (das philosophiehistorische Stichwort für die Theorie, die diese Fragen weiter verfolgt, wäre: Hermeneutik). Hier nun ist interessant: Wir hatten immer wieder gesehen, daß auf absolute Wahrheiten Verzicht zu leisten, der einzige Ausweg aus den anscheinend untragbar starr gewordenen idealistischen Systemen auszubrechen. Auch bei den Naturwissenschaftlern war das zu beobachten, wenn der empirische Anteil oder die Rolle von Hypothesen betont wurden. Auch die Naturwissenschaften können dann nicht mehr unbedingt als monolithischer Block aufgefaßt werden. Die Geisteswissenschaften gehen nun anders mit dem Problem des Verlustes absoluter Gewißheit um. Sie bestimmen ihren Gegenstandsbereich von vornherein so, daß in ihm überhaupt nicht sinnvoll nach einer adäquaten Wahrheit gefragt werden kann; alles, wonach man suchen kann, ist eine angemessene Interpretation, und die ist z.B. von der Fragestellung, von eigenen und von außen herangetragenen Horizonten abhängig. Es ist wichtig zu sehen, daß diese Überlegungen bei Dilthey selbst wiederum auf die Grundlagen echter Wissenschaftlichkeit, nun in den Geisteswissenschaften, führen. 6. Zusammenfassungen - Natur und Geisteswissenschaften sind historisch nicht so scharf entgegengesetzt, wie man heute anzunehmen geneigt ist. Auf beiden Gebieten waren 51 Erfahrungsbezug und methodologische Reflexionen zentral, auf beiden Gebieten gab man die Annahme absoluter Gewißheit auf. - Typisch waren häufig Positionen, die einen hybriden Charakter aufweisen, die sich nicht wirklich festlegen wollen zwischen der unbedingten Hochschätzung einer bestimmten Spezialwissenschaft einerseits, dem universellen Integrationsanspruch andererseits. Noch Haeckel, in seinen religiösen Bestrebungen und seinem Goethekult, wirkt wie ein radikaler Naturwissenschaftler, der keine der Errungenschaften der eben auch nicht-naturwissenschaftlich geprägten Vergangenheit aufgeben will. Interessanterweise sind die geisteswissenschaftlichen Positionen von eher schärferen Abgrenzungen gekennzeichnet; zwar zitiert beispielsweise auch Dilthey immer wieder Darwin, aber nur, um zu zeigen, daß manches, was eigentlich die Naturwissenschaften für sich beanspruchen, schließlich doch nur mit geisteswissenschaftlichen Kategorien zu erfassen sei. - Wo soll Philosophie ihre Bedeutung finden? In räumlicher Metaphorik: Neben, über oder unter den anderen Wissenschaften? Philosophie wird verwissenschaftlicht und so zur „Fachphilosophie“, wodurch sie neben die anderen Wissenschaften tritt; ihre Leistungen in der Analyse und kritischen Beurteilung bzw. systematisierenden Klassifikation der anderen Wissenschaften lassen sie, je nach Perspektive, unter oder über diese treten: Philosophen fungieren zunehmend, in einer modernen Formel von Odo Marquard, als „Spezialisten für das Allgemeine“. - Die Reflexion über Geisteswissenschaften kann sich genauso wie eine neuze Reflexion auf die Naturwissenschaften in den Rahmen eines Neukantianismus einbinden. Ein Neukantianismus kommt in zwei Ausrichtungen und zwei lokalen Zuordnungen auf: Südwestdeutsch (Vertreter: Windelband, Heinrich Rickert) und Marburg (Hermann Cohen, Paul Natorp, Ernst Cassirer; Dilthey hat starke Affinitäten zu dieser Richtung); inhaltlich aufeinander bezogen wie geisteswissenschaftlich und mathematisch-physikalisch ausgerichtet. Ausgangspunkt für den Neukantianismus als ausgebildete Schulrichtung ist ein Text von Otto Liebmann mit dem Titel: Kant und die Epigonen, 1865, der den Schlachtruf „Es muß auf Kant zurückgegangen werden.“ enthält. Vier Merkmale eines Neukantianismus seien hervorgehoben: - Erkenntniskritik, nun in Form von Methodologie; - Suche nach allgemeinsten Kategorien (im Falle Windelbands: Allgemeinheit vs. Besonderheit); - Philosophie hat wissenschaftsbegründende Kraft, ohne selbst eine Wissenschaft neben den anderen zu sein; - Vorschlag zu neuen Formen eines Apriori (Physiologie; Werte...). 52 7. Literarische Umsetzungen Vor dem Hintergrund der Windelbandschen Unterscheidungen von Wissenschaftstypen gewinnt der elitaristische Aspekt von Stefan Georges Auftreten nochmals Gewicht: Der Künstler, der sich der Masse entheben möchte, kann dies in den Dienst nicht nur einer spezifisch künstlerischen, sondern einer allgemein geistigen Sicht der Welt tun. Idiographischer, anti.allgemeiner Aspekt: zu den Monisten gehört unbedingt der Drang zu allgemeiner, breiter Wirkung. Dagegen: das individuelle Erleben: Elitarismus: Stefan George; Sendungsbewußtsein; aber bei George selbst ein Schwanken zwischen Elitarismus und Massenkultur. Allerdings: es ist nicht klar, inwieweit das philosophische Projekt, mit neuen Formen von Wissenschaftsbegründung auf die zunehmende Spezialisierung der einzelnen Wissenschaften zu reagieren, tatsächlich erfolgreich war. Eine pessimistische Lesart gibt Hugo von Hofmannsthal in einem erfundenen Brief, den ein junger Autor bezeichnenderweise an den großen Übervater alles induktiven Philosophierens, an Francis Bacon richtet, im sogenannten Chandos-Brief. Der junge Autor formuliert darin (in bemerkenswerter Eloquenz und lyrischer Geschliffenheit) ein für einen Autor fatales Erlebnis: Er hat das Gefühl, daß ihm angesichts der Zeitumstände überhaupt die Fähigkeit abhanden gekommen sei, zusammenhängend denken oder sprechen zu können. Wie „modrige Pilze“ zerfallen ihm die Worte im Mund. Auch Bacons wissenschaftlicher Induktivismus kann nicht für Ordnung und Zusammenhang sorgen; die Ungreifbarkeit der Phänomene sperrt sich gegen alle Versuche, sie zusammenfassend in den Griff zu bekommen. Wenn Sie schließlich einen Text suchen, der die ganz persönlichen Erlebnisse eines jungen Menschen dieser Zeit im Umgang mit Philosophie und Wissenschaften reflektiert, greifen Sie zu Robert Musils Zögling Törleß. Törleß, der sensible, von dichterischem Weltblick und untergründiger Sinnlichkeit umgetriebene Internatsschüler, wird angesichts einer mathematischen Frage (wie kann man eigentlich begreifen, daß die komplexen Zahlen die Wurzel aus negativen Zahlen zu ziehen gestatten?) von seinem Mathematiklehrer auf Kant verwiesen. Musil, selbst studierter Ingenieur mit einer philosophischen Promotion zum wissenschaftlichen Status der Psychologie, spannt sienen Zögling zwischen Wissenschaft – der Mathematiklehrer verweist für das mathematische Problem auf die Notwendigkeit, einfach noch mehr zu lernen; eine rasche Begründung gebe es nicht – und Philosophie ein: Der Kant-Text ist beim Lehrer nur ein 53 „Renommierband“. Törleß hat den Kant-Band in der Hand, empfindet aber „Angst“ und „Ekel“, da er angesichts der wenig überzeugenden Position seines Lehrers nicht sieht, wie ihm die Philosophie helfen kann. Als Törleß sich am Ende vor dem Lehrerkollegium verantworten muß wegen der Mißhandlung eines Mitschülers, von der er zumindest wußte, versucht er sich dann selbst in einer philosophisch genauen Darstellung seines eigenen Seelenzustandes – wird aber vom Direktor angeherrscht, doch endlich „Klipp und klar“ zu sagen, was eigentlich mit ihm los sei, und sich nicht auf philosophische Diskussionen zu verlegen: Philosophie als Angebot der Selbstvergewisserung wie der Weltorientierung scheitert hier brutal an zwei Fronten, einmal beim Versuch des jungen Menschen, seine eigenen Erlebnisse in Begriffe zu fassen, zum anderen am Unverständnis der Hüter der Bildung, die auf Klarheit aus sind, die sich im ohnehin scheiternden philosophischen Bemühen um das Erfassen von individueller Psyche nicht erzielen läßt. Damit ergibt sich ein Folgeproblem aus dem geisteswissenschaftlichen Ansatz von Philosophie: Das Problem nämlich, wie man solche besonderen, auch exaltierten, Gemütszustände, wie man existentielle Erfahrungen philosophisch thematisieren kann. Dies wird Thema der nächsten Stunde sein. 54 Empiristische Autoren John Locke (1632-1704) (George Berkeley) (1685-1753) David Hume (1711-1776) David Hartley Étienne Bonnot de Condillac (17141780) Immanuel Kant Jakob Friedrich Fries (1773-1843) William Whewell (1794-1866) Jeremy Bentham (1748-1832) John Stuart Mill [[August Comte]] (1798-1857) Nach Kant: „empirischer Idealismus“; „esse est percipi“ Assoziationstheorie Transzendentaler Idealist + empirischer Realist empiristischer Kantianer Empirismus + Kantianismus; Geschichte und Philosophie der induktiven Wissenschaften Utilitarismus [[Positivismus]] 20. Jh.: Logischer Empirismus = Neopositivismus John Stuart Mill (1806-1873) Reisen, juristische Studien; ab 1823 in der Ostindischen Handelsgesellschaft Ab 1841 Briefwechsel mit Comte (1846 Bruch mit Comte) 1843 A System of Logic 1863 Utilitarianism 1865 MP für Westminster 1873 Tod in Avignon 55 John Stuart Mill: System of Logic (1843) -- Kernaussagen Induktion als einziges Verfahren zur Erkenntnissicherung: Behauptungen aus gegebenen Behauptungen folgern; Besonders und Allgemeines können nicht strikt unterschieden werden Auch mathematische Aussagen sind „experimentelle Wahrheiten, Generalisationen aus der Beobachtung“ Unbegreiflichkeit folgt aus jeweils subjektivem Bildungshintergrund „Aus diesen Betrachtungen geht hervor, daß alle deductive oder demonstrative Wissenschaften ohne Ausnahme inductive Wissenschaften sind; daß ihr Beweis der der Erfahrung ist, daß sie aber auch Kraft des besonderen Charakters eines unentbehrlichen Theils der allgemeinen Formeln, nach denen ihre Inductionen gemacht sind, hypothetische Wissenschaften sind. Ihre Schlüsse sind nur auf gewisse Voraussetzungen hin wahr, welche Annäherungen an die Wahrheit sind, oder sein sollten, aber selten oder niemals genau wahr sind; und diesem hypothetischen Charakter ist die eigentümliche Gewißheit zuzuschreiben, von der man annimmt, sie sei inhärent oder demonstrativ.“ Axiom der Stetigkeit; Kanones der Induktion Folgerungen: Natur- und Geistesweissenschaften („natural“ und „moral“ sciences; der Terminus „Geisteswissenschaft“ im Deutschen geht wesentlich auf Mill-Übersetzungen zurück) sind gleich zu behandeln Moralphilosophie: Utilitarismus: „The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as 56 they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain“ 57 Vorlesung 8 Neue Formen der Erfahrung und ihre philosophische Reflexion: Kierkegaard; Heidegger 1. Individuelle Erfahrung und Philosophie: Ein Überblick von Kant bis zum Existentialismus 2. Sören Kierkegaard: Biographie einer pseudonymen Persönlichkeit; Philosophische Grundgedanken eines religiösen Schriftstellers 3. Der Begriff Angst: Philosophische Auswertung eines Gefühls 4. Martin Heidegger: Existenz und Metaphysik Sören Kierkegaard 1813-1855, Kopenhagen Studium der Theologie, 1841/42 Studium bei Schelling Werke (kleine Auswahl!): 1843 Entweder-Oder 1844 Philosophische Brocken Der Begriff Angst 1850 Einübung in das Christentum Martin Heidegger 1889-1976; Meßkirch-Freiburg Studium: Mathematik, Theologie, Philosophie Professuren in Marburg und Freiburg Werke (kleine Auswahl!): 1927 Sein und Zeit 1936ff. Schriften zu Hölderlin 1947 Humanismusbrief 1950 Holzwege 1961 Nietzsche 1967 Wegmarken 58 1. Individuelle Erfahrung und Philosophie: Ein Überblick von Kant bis zum Existentialismus Jean Paul Sartre hat das Individuum in neuer Form literarisch und philosophisch thematisiert. Sein Roman Der Ekel, 1938, beginnt damit, daß der Protagonist an sich eine nicht weiter bestimmbare Veränderungserfahrung: „Irgend etwas ist mit mir geschehen, ich kann nicht mehr daran zweifeln. Es ist wie eine Krankheit gekommen, nicht wie eine normale Gewißheit, nicht wie etwas Offensichtliches. Heimtückisch, ganz allmählich hat sich das eingestellt; ich habe mich ein bißchen merkwürdig gefühlt; das war alles“. Das Subjekt verfügt nicht mehr über sich, ganz im Gegensatz zu den idealistischen Positionen, mit denen wir begonnen hatten, es versteht sich nicht mehr in seiner Vollständigkeit. Zugleich aber geht es nicht im fixierbaren Wissen von äußeren Dingen auf; Sartres Subjekt sucht sich im Spiegel; (S. 27) „was ich sehe, ist noch weit unter dem Affen, an der Grenze der pflanzlichen Welt, auf dem Niveau der Polypen. Das lebt, ich bestreite es nicht; ich sehe leichte Zuckungen, ich sehe schales Fleisch, das ungezwungen schwillt und bebt. [...] Ich kann nicht sagen, daß ich die Einzelheiten wiedererkenne. Aber das Ganze macht auf mich den Eindruck von Déja-vu, das mich erschlaffen läßt“. Das Gesicht ist nicht in äußeren Koordinaten faßbar: es bleibt dabei, daß wir subjektiv dazu Stellung nehmen müssen. Unverfügbarkeit und Unhintergehbarkeit kommen hier zusammen; diese Kombination bedingt einen neuen Modus, der philosophische Reflexion, die traditionelle Vorgehensweise beim Aufsuchen der letzten Gründe, und die literarisch fixierte subjektive Erfahrung kombiniert. Einen ähnlichen Gegensatz eröffnet Sartre am Anfang seines philosophischen Hauptwerks, Das Sein und das Nichts, von 1943. Zwar habe die moderne Philosophie versucht, traditionelle Dualismen zu überwinden, indem sie auf das Phänomen sich konzentriert habe, also auf sachhaltige Strukturen, die nicht mehr einen wahren Kern hinter einer nur äußeren Schale verbergen, um nur einen dieser Dualismen zu nennen. Sartre fällt aber auf, daß eine solche phänomenologische Betrachtung in einen neuen Dualismus führt: Phänomene sind immer einzelne Ereignisse, Ansichten, Perspektiven, bezogen auf einen umfassenden Horizont der Ganzheit möglicher Ereignisse, Ansichten, Perspektiven. Sie eröffnen also einen Dualismus zwischen Endlich und Unendlich. Auch dieser Gedanke läßt sich an konkreten Erfahrungen festmachen; Sartre beschreibt u.a. die jeweils vorliegende Lebenssituation eines Menschen als eine Aktualisierung genau einer aus einer Vielzahl gleichmöglicher Alternativen. Dies nimmt in radikaler Weise der menschlichen Position in der Welt ihre Gewißheit, jedenfalls – und diese Qualifikation ist 59 wichtig – wenn wir „menschliche Position“ im Ausgang von der Lage des Individuums verstehen (es wäre ja möglich, daß jedes Individuum eine hochgradig zufällige Existenz führt, die Menschheit insgesamt aber eine stabile Existenz besitzt). Wieder gilt: Die Existenz des Menschen ist zugleich unhintergehbar und unverfügbar. Mit diesen Merkmalen sind Grundzüge einer Existenzphilosophie benannt, zu deren wesentlichen Vorläufern bzw. Begründern Kierkegaard und Heidegger gehören. Am Leitfaden die Frage: Wie kann man die individuelle Erfahrung, das Subjekt philosophisch eigentlich angemessen thematisieren, läßt sich zunächst ein zusammenfassender Überblick über das bisher Behandelte geben. 60 Kant: Garantie von Objektivität durch Subjektivität „Ich denke“ Transzendentalphilosophie Fichte: Das Ich als Ausgangspunkt der Philosophie Ich = Ich, (subjektiver) Idealismus Das Ich setzt sich selbst Schelling: Einheit von Subjekt und Objekt Das Absolute als absolute Identitätsphilosophie; Einheit (objektiver/absoluter) Idealismus Hegel: Wirklichkeit und Begreifbarkeit/Begriff sind identisch Was wirklich ist, das ist absoluter Idealismus Wissenschafts- vernünftig und umgekehrt Neue Religionsphilosophie orientierte Der Mensch ist, was er hat; Anthropologie als Positionen Tempel des Gehirns und Grundwissenschaft Schellings Spätphilosophie: Die Unhintergehbarkeit der Person Feuerbach: Der Mensch in seiner Gesamtheit Darmzotten Naturwissenschaftliche Philosophen: Reduktion des Ichs? Neue Materialismus philosophische Begründungsprogramme Physiologischer Neukantianismus Geisteswissenschaftliche Philosophen: Leben, Zusammenhang, Idiographisch vs. nomothetisch; Neukantianismus Individuum als Grundkategorien der sich differenzierende Lebensphilosophie Zusammenhang des Lebens EXISTENTIALISTISCHE POSITIONENEN: SARTRE; KIERKEGAARD; HEIDEGGER 61 2. Kierkegaard: Biographie einer pseudonymen Persönlichkeit. Mit Kierkegaard meldet sich ein außerakademischer Nichtphilosoph philosophisch zu Wort, der sich selbst nicht als Philosoph, sondern als „religiöser Schriftsteller“ bezeichnet und seine eigene Subjektivität in seinen literarischen Arbeiten immer wieder hinter Pseudonymen verbirgt. 1813 in Kopenhagen geboren, aus streng religiösem Elternhaus, mit seinem Vater engstens verbunden; beginnt Theologie zu studieren, lernt eine junge Frau kennen, die in jeder Hinsicht die ideale Partnerin zu sein scheint, dann aber gerät diese Biographie auch äußerlich ins Wanken; der Vater stirbt, er verlobt sich zunächst, löst aber wenig später ohne hinreichende Gründe die Verlobung auf, promoviert sich mit einer Arbeit über Den Begriff der Ironie mit ständiger Beziehung auf Sokrates, und verläßt Dänemark, um in Berlin Schelling zu hören. In dieser Konstellation, so könnte man zusammenfassen, findet er seinen Lebensweg: kämpfend mit Schuldkomplexen aufgrund – übersteigerter – eigener Fehler und eines aufgekommenen Fehltritts seines Vaters, in persönlicher und fachlicher weitgehender Isolierung als Autor, der mit den Stilmitteln der Ironie und in einer hegelkritischen Strömung in wenigen Jahren ein umfangreiches Werk verfaßt: 1855 bereits erliegt er einem Schlaganfall. Zur literarischen Gestaltung seiner Werkle, die mit seiner Methode untrennbar verbunden ist: Bei ihm durchdringt sich die traditionelle Abhandlung mit dem individuellen Stil; vgl. Vorwort der Krankheit zum Tode: „Vielen wird vielleicht die Form dieser ‚Entwicklung’ seltsam vorkommen; sie wird ihnen zu streng erscheinen, um erbaulich, und zu erbaulich, um streng wissenschaftlich sein zu können.“ Zu seinem methodischen Ansatz gehört die Dialektik; anders als bei Hegel aber erkennt „rätselvolle Überraschungen der Dialektik“: Die Dialektik wird nicht abgelehnt, Kierkegaard operiert wie kaum ein zweiter mit Gegensätzen und deren konstruktiver Weiterentwicklung – aber eben diametral gegen die Intentionen des jeweiligen Begründers gewendet. 3. „Der Begriff Angst“: Philosophisches Fassen eines Gefühls Schon der Titel von Kierkegaards Schrift über den „Begriff Angst“ von 1844 zeigt diese Strategie am Werk: Wie kann man etwas so scheinbar völlig subjektives und nicht-(sei es 62 unter, über...)rationales wie die Angst philosophisch in den „Begriff“ fassen? Zugleich evoziert der Titel natürlich nochmals Hegel: wenn das Begriffliche, Begriffene bei Hegel universell wird: wie ist die Angst dann einzupassen? Der Untertitel von Kierkegaards Text führt weiter: „Eine simple psychologisch-hinweisende Erörterung in Richtung des dogmatischen Problems der Erbsünde von Vigilius Haufniensis“. Mit „Psychologie“ kann nicht gemeint sein, daß wir unsere subjektiven Zustände einer empirischen Wissenschaft anvertrauen, die sich darauf spezialisiert, in Analogie zu den Naturwissenschaften mit den Methoden des Experiments und abzielend auf allgemeine Aussagen diese Zustände zu erforschen; ebensowenig kann es sich einfach um einen theologischen Traktat handeln, worauf ja aber immerhin die Erbsünde im Titel hinweisen könnte. Ausgangspunkte: (1) Die Suche nach Unterscheidungen, gleichzeitig hegelkritisch und dialektisch. Durch die Dominanz des Systemgedankens sei das Aufsuchen und Würdigen von Unterscheidungen weitgehend verschwunden. Zugleich ist ein Unterscheiden eine typisch begriffliche und nicht einfach empirisch-experimentelle Operation. (2) Die Betonung der Wirklichkeit. (Dieses Stichwort fasziniert Kierkegaard jedenfalls kurzzeitig an Schellings Berliner Vorlesungen). Hegel hatte versucht, die Wirklichkeit begrifflich, mit den Mitteln der Logik einzuholen: Auch Kierkegaard sucht nach begrifflichen Bestimmungen, die beispielsweise dem Phänomen Angst angemessen sind, aber bereits die Tatsache, daß er dieses Phänomen so unbedingt herausstellt, zeigt, daß seine begrifflichen Bestimmungen keine logischen mehr sein können (S. 16): „man sieht, wie unlogisch die Bewegungen der Logik sein müssen, seit das Negative das Böse ist; wie unethisch sie in der Ethik sein müssen, seit das Böse das Negative ist. In der Logik ist es zu viel, in der Ethik zu wenig, nirgends paßt es, wenn es an beiden Stellen passen soll.“ Gegenstand der Schrift: „die reale Möglichkeit der Sünde ergründen“ (25), was Aufgabe der Psychologie ist. Wichtig: Dogmatik ist davon unterschieden und hat eine andere Aufgabe: die Erbsünde zu erklären. Psychologie in Kierkegaards Sinn erklärt also nicht (vgl. geisteswissenschaftliche Philosophie), beschreibt aber auch nicht einfach sondern ergründet Möglichkeiten, fragt also in einen Hintergrund, der sich der Erklärung entzieht, aber dennoch relevant wird für Phänomene, die wir aktual tatsächlich kennen. Das kann auf Umwegen geschehen: Die Sünde ist streng genommen nicht Gegenstand der Psychologie, wohl aber die Angst, und wenn Angst mit der Möglichkeit von Sünde verbunden ist, kann Psychologie sehr wohl die Möglichkeit von letzterer ergründen. 63 Bereits in diesem Zustand der Unschuld, dem Stand vor dem Sündenfall, entdeckt Kierkegaard, gut dialektisch, eine eigentümliche untergründige Gefährdung. Unschuld ist keineswegs ein idealer Zustand: Unschuld ist Ruhe und Frieden, weil nichts da ist, womit man streiten könnte. Damit ist, ganz unauffällig, eine weitreichende Aussage gemacht: da ist nichts. Warum sollten wir nicht eine Welt ohne Gefährdung als ideal erträumen? Das Nichts, das gerade die Unschuld nicht gefährdet, stellt die ultimative Gefahr dar: „Es gebiert – als seine Wirkung – die Angst“. Warum? Kierkegaard bleibt die Begründung schuldig; wir müssen also selbst danach suchen: an dieser Stelle zeigt sich der methodische Charakter der „psychologisch-hinweisenden“ Darstellung: Als Argument tritt unsere eigene Plausbilitätsüberlegung ein, die in diesem Rahmen aber tatsächlich den Charakter eines strikten Arguments annimmt: Kierkegaard greift die tatsächliche Phänomenologie von Angst auf: Angst empfindet man nicht vor etwas bestimmtem, sondern man ängstigt sich vor man weiß nicht was, man ängstigt sich, wie Kierkegaard anführt, „vor nichts“; „die Angst ist die Wirklichkeit der Freiheit als Möglichkeit für die Möglichkeit“. Zugleich ist damit klar, daß Angst nicht einfach ein Gefühl ist, das wir nur verabscheuen; es ist im Gegenteil mit einigen der tiefsten Manifestationen des Menschlichen verbunden, mit seiner Freiheit, mit Planen, mit Aktualisierung von Möglichkeiten: uns verbindet mit unserer Angst eine – wieder dialektische – „sympathische Antipathie“ und „antipathische Sympathie“; Sprachgebrauch: eine süße Angst, eine scheue Beängstigung. Die Vorliebe von Kindern für das Abenteuerliche und Unheimliche bestätigt Kierkegaard, daß die Angst, die immanent mit der Unschuld gesetzt ist, keine Last und keine Schuld darstellt. Dennoch kann man aus Angst schuldig werden, und hier setzt sich das doppeldeutige Verhältnis fort, das in der Angst (genauer in unserem Verhältnis zur Angst) angelegt war: Angst ist immer Einbrechen einer fremden Macht, des Nichts; aber man kann in der Angst versinken, die man liebt, indem man sie fürchtet und umgekehrt. (von hier schlägt sich die Brücke zum Sündenfall: „die ängstigende Möglichkeit, zu können“, „Das Verbot ängstigt ihn, weil das Verbot die Möglichkeit der Freiheit in ihm erweckt.“ Diese Doppeldeutigkeiten sind für Kierkegaard nicht nur isolierte Beschreibungen einzelner Phänomene wie der Angst, sie charakterisieren die Stellung des Menschen insgesamt, auch in philosophisch traditionell zentralen Aspekten, etwa den Begriff des Geistes (S. 42): der Geist „verhält sich als Angst“. Warum? „Sich selber loswerden kann der Geist nicht; sich selbst ergreifen kann er auch nicht“: Die untrennbare Verbindung von Unverfügbarkeit und Unhintergehbarkeit kehrt wieder, aber nun eben nicht aus logischen Gründen, nicht 64 aus einer Theorie der Letztbegründung, sondern aus einer Erfahrung individuellster Art, die zugleich Grundlage einer Charakteristik des Menschen überhaupt wird. Kierkegaards Untersuchung setzt an Gefühlen an, aber nicht, um diese qua Gefühl der Logik entgegenzusetzen, also nicht, um einfach der Logik mangelnde Reichweite in subjektive Zustände hinein vorzuwerfen. Es ist nicht das Gefühl, sondern tatsächlich der Begriff Angst, der für Kierkegaard philosophisch relevant wird. Das Gefühl zeigt einen Sachverhalt an, den man begrifflich zu erfassen suchen kann, obwohl hier die Mittel der logischen Fassung scheitern. Wir haben keinen fixen Ausgangspunkt, wir können nicht mit eindeutigen Bewertungen operieren; unendlicher Horizont von Möglichkeiten kann nicht zusammenfassend subsumiert werden, artikuliert sich aber dennoch sehr eindeutig und spezifiisch; zugleich: sobald man derartige Strukturen ins Auge faßt, langt man bei zweiseitigen Bestimmungen an, die qua Zweiseitigkeit zwar dialektisch (im Sinne Hegels) sind, aber weil sie sich einer nicht-logischen Verfaßtheit verdanken, anders als Hegels Dialektik nicht weiterführen auf eine durchgehende begriffliche Fassung der Welt hin. 4. Heidegger: Existenzphilosophie und Metaphysik Heideggers philosophische Ansätze lassen sich ein gutes Stück weit aus einer Kombination von Motiven Kierkegaards und Diltheys verstehen. Kierkegaard wird in § 40 von Heideggers frühem Hauptwerk Sein und Zeit von 1927, der dem Phänomen der Angst gewidmet ist, ausdrücklich angesprochen. Kontext: Heidegger sucht nach Erschließungsmöglichkeiten für das Sein des Daseins, die aus dem Dasein selbst gewonnen sind. Warum ist das ein echtes Problem? „Dasein“ verweist bei Heidegger durchgehend auf den Menschen. Der Mensch ist dadurch gekennzeichnet, ein Seiendes zu sein, dem es um das eigene Sein geht, der sein eigene Seinsweise selbst bestimmen muß; er kann also nicht beispielsweise als Spezialfall einer allgemeineren Kategorie bestimmt werden. Existenz ist für den Menschen eine Möglichkeit, kein vorgegebener Sachverhalt. Heidegger charaktierisiert die Angst in eindeutig an Kierkegaard angelehnten Überlegungen: Angst ist ein Gegenbegriff zu Flucht und Furcht: „ein Zurückweichen vor..., eine Abkehr von...“ als nicht konkret gerichtet bzw. abgewendet, sondern im offenen Horizont. „Das Wovor der Angst ist das In-der-Welt-sein als solches“. „Daß das Bedrohende nirgends ist, charakterisiert das Wovor der Angst.“ „Das beruhigt-vertraute In- 65 der-Welt-Sein ist ein Modus der Unheimlichkeit des Daseins, nicht umgekehrt“. In einer etymologisierenden Umformung des „Unheimlichen“ erklärt er das „Un-Zuhause“ als das ursprünglichere Phänomen der Seinsweise des Menschen. Damit sind die Stichworte genannt, die Heidegger in seiner Freiburger Antrittsvorlesung über die Frage Was ist Metaphysik? von 1929 anführt. Das Nichts, das bei Kierkegaard genau an der Stelle eintrat, wo in Heideggers Angst-Beschreibung das „Nirgends“ fungierte, tritt hier ins Zentrum. Auffällig ist aber sofort ein Unterschied in der Ausrichtung. Auch Kierkegaard bezieht sich bei seiner hoch-individualisierten Programmatik auf andere Philosophen, allen voran Hegel, aber sein Ziel ist nicht ein Beitrag zur klassischen Philosophie selbst. Ganz anders Heidegger; bereits sein Titel zeigt, daß er beansprucht, einen entscheidenden Beitrag zu einer traditionellen philosophischen Frage zu leisten. Heidegger untersucht typisch metaphysische Fragen und macht dabei eine Beobachtung, die an Kierkegaard erinnert: Wenn man die Aufgabe der Metaphysik – allgemeiner der Philosophie insgesamt – charakterisiert, bedient man sich Floskeln wie: Das Seiende und sonst nichts; das Allgemeine und nur das....„—und weiter nichts“: das scheint wichtig, geht aber zu leicht unter. Heidegger nimmt diese Redeweise, die zunächst lediglich nach einer präzisierenden Abgrenzungsfloskel klingt, radikal ernst und fragt: „Wie steht es nun um dieses Nichts?“ Die Frage „Was ist das Nichts?“ konterkariert sich immanent selbst und besitzt entsprechend keine mögliche Antwort; jeder Versuch, das Nichts durch das Sein fassen zu wollen (etwa in Form von Sätzen wie „Das Nichts ist X“), setzt das Nichts bereits in eine Abhängigkeit vom Sein und gibt damit eine eindeutige Rangfolge an, die in der Sache so nicht notwendig bestehen muß; vielmehr: „das Nichts ist ursprünglicher als das Nicht und die Verneinung“. Angesichts des Scheiterns sprachlicher oder logischer Mittel zur Bestimmung des Nichts verweist Heidegger auf eine „Grunderfahrung“, wie sie einer ganzen Reihe von Phänomenen (Langeweile, Freude an der Gegenwart des Daseins eines geliebten Menschen, Angst) aufscheint In allen diesen Phänomenen „überkommt“ uns im Alltag das „’im Ganzen’“; die eigentliche Langeweile tritt nicht ein, wenn einen ein Buch langweilt, sondern „wenn es einem langweilig ist“: Wieder tritt einem hier ein unbestimmtes Es gegenübert, das man dennoch distinkt erfährt, ohne damit einen bestimmten Seinsbestand vor Augen zu haben. „Die Angst offenbart das Nichts“, macht den Horizont der Allheit als eine nicht-Sache offenbar. Wie kann man das Nichts charakterisieren? Nicht als Sachverhalt, sondern qua Erfahrungen, in denen sich das Ganze der Welt im Ganzen offenbart: es wird also einen 66 aktivischen Charakter haben, den man aber nicht mit dem aktiven Verbum „sein“ oder seinen Derivativa benennen darf: Heidegger wählt dazu einen notorischen Terminus: Den des Nichtens: „Das Nichten ist kein beliebiges Vorkommnis, sondern als abweisendes Verweisen auf das entgleitende Seiende im Ganzen offenbart es dieses Seiende in seiner vollen, bislang verborgenen Befremdlichkeit als das schlechthin andere“. Drei Stichworte zu weiteren Implikationen: (1) Die Macht des Verstandes ist in dieser Betrachtungsweise gebrochen; dennoch werden orientierende Instanzen gesucht (etwa: „Führung nehmen“ aus dem Seienden). „Die Idee der Logik löst sich auf im Wirbel eines ursprünglicheren Fragens“: Kierkegaard hatte ebenfalls die Logik eingeschränkt durch andere, auf ursprünglicheres führende Perspektiven, aber eben nicht im Modus des Fragens, des Anfragens bei, sondern hier der individuellen Erfahrung. (2) Eigentliche Angst erlebt der Mensch nur in seltenen Momenten. Wenn diese Angst selten ist, bedeutet das „das Nichts ist uns zunächst und zumeist in seiner Ursprünglichkeit verstellt. Dadurch, daß wir uns in bestimmter Weise völlig an das Seiende verlieren“, „uns an der öffentlichen Oberfläche des Denkens verlieren“. Hierin liegen Ansatzpunkte für eine Technikkritik, eine Kritik an Spielarten der modernen Welt, aber auch eine Form von Tiefensehnsucht, die sich der rationalen Kontrolle entzieht. (3) Verbindung mit klassischen Themen der Metaphysik. Der klassisch metaphysische Satz „ex nihilo nihil fit“ erweist sich, und hierin zeigt sich dann die Kraft des Heideggerschen Entwurfs, in einem ganz neuen Licht. Hatte man bisher diesen Satz so gelesen, daß man eben ein weiteres, seinshaftes Prinzip braucht, so kann er nun als die umfassendste Aussage über das Sein gelesen werden: Wenn sich im Erleben des Nichts, genauer: Im Erleben, daß der Mensch in das Nichts hineingehalten ist, das Seiende im Ganzen offenbart, sagt der Satz: dieses „Im ganzen“ entsteht eben nur aus dem Nichts; „Ex nihilo omne ens qua ens fit“.