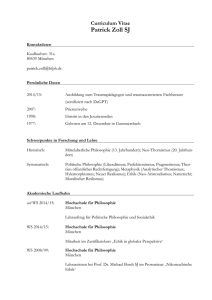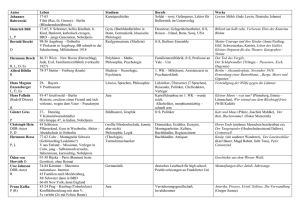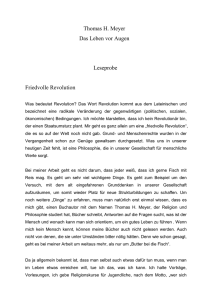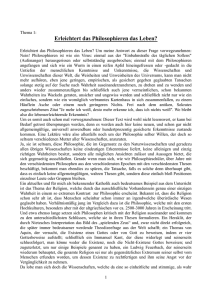Lob der Philosophie
Werbung

Ugo Perone LOBLIED DER PHILOSOPHIE 1. Der Rechenschieber und die Philosophie Ich entsinne mich eines wunderbaren Werkzeuges – eines Rechenschiebers –, das mein Vater zu benutzen pflegte, um komplexe Rechnungen durchzuführen. Immer in der Brusttasche bereitgehalten, tauchte der Rechenschieber auf wundersame Weise auf, um jede Rechnungsart zu lösen. Und die Gewohnheit brachte es mit sich, dass er ihn auch für eher einfache Rechnungen, was weiß ich – acht Mal sieben, benutzte. Rasch bekam man auch in diesem Fall die Antwort: Sechsundfünzig, begleitet aber von der unvermeidlichen Bemerkung: ungefähr. Denn zu den Zaubern des Rechenschiebers gehörte auch die Tatsache, dass das Ergebnis durch Annäherung erreicht wurde und nicht durch die trockene Präzision der Taschenrechner. Die Philosophie hat einige Ähnlichkeit mit dem Rechenschieber. Angewendet um banale Fragen des Alltags zu lösen, nötigt sie ein Lächeln ab, das ihre Ungenauigkeit aufweist, ebenso wie derjenige, der, um acht Mal sieben zu multiplizieren, einen Rechenschieber benutzt und unausweichlich den Schluss zieht: ungefähr sechsundfünfzig. Gegenüber komplexeren Fragestellungen erscheint diese Annäherung jedoch nicht mehr als unangebracht, sondern als vorsichtig und bescheiden. Hier findet der Rechenschieber oder, abseits der Metapher, die Philosophie den eigentlichen Ort ihrer Bestimmung. Ich beginne meinen Vortrag im Wissen darum, dass mir andere Essays gleichen Titels, und mit viel größerer Autorität, zuvorgekommen sind, und unter diesen insbesondere mein Lehrer Luigi Pareyson (im akademischen Jahr 1966-67 des italienischen Kulturvereins Associazione culturale italiana). Ich tue dies, indem ich mir die Anrede Paul Celans zueigen mache, die er bei der Verleihung des Büchner-Preises gebrauchte. „Meine Damen und Herren“ sagte Celan siebzehn Mal im Laufe seiner kurzen Ansprache, und mit eben solcher Eindringlichkeit möchte ich mich mit der Anrede „Meine Damen und Herren“ an Sie wenden, die, wie ich hoffe, auch nicht alle Berufsphilosophen sind. Eine Anrede, in der Tat, ein Aufruf; der Wunsch, dass, wie Celan auch sagte, etwas geschieht, in dieser kurzen Zeitspanne, der Zeit eines Vortrages. Was? Für mich sicherlich ein Bilanzieren, ein Bericht über den Lebensabschnitt, den ich damit verbracht habe, Philosophie zu betreiben; und für alle ein Augenblick des Innehaltens, welcher den unpersönlichen Fluss der Dinge unterbricht, und Fragen wieder aufwirft, die keine automatische und wahrscheinlich nicht mal eine definitive Antwort erlauben, ebenso wie die Rechnungen des Rechenschiebers. Jeder Beruf, im vollen Sinne dieses Wortes, ist für immer, und jeder Beruf ist gegenüber jemandem. Meine Damen und Herren, das Lob auf die Philosophie, das ich versuchen werde, ist eine Art, die Beschäftigung zu rechtfertigen, der ich mich gewidmet habe, und die ich Ihrem Urteil vorlege. Wenn das, dem sich ein Leben gewidmet hat, wenig ist, so ist auch der Sinn dieses Lebens davon geschwächt; wenn hingegen, wie Platon gesagt hätte, das, was unternommen wurde, groß und schön war, dann geht auch dieses Leben daraus bereichert hervor, was auch immer die Ergebnisse gewesen sein mögen. Ich sage dies im Bewusstsein dessen, was Alain Badiou im Zweiten Manifest für die Philosophie so gut ausgedrückt hat, nämlich der Notwendigkeit, erneut für die Philosophie eine fundamentale Rolle zu beanspruchen, und sei es in immer neuen Wendungen. In einer synthetischen Gegenüberstellung hinsichtlich den veränderten historischen Bedingungen des Ersten Manifests, merkt Badiou an: „[…] wenn die Existenz der Philosophie vor zwanzig Jahren als minimal erklärt wurde, so kann man sie heute immer noch als bedroht bezeichnen, aber aufgrund einer entgegengesetzten Ursache – weil ihr nämlich eine überbordendende künstliche Existenz zugeschrieben wird […]. Der Grund für einen solchen Umschwung – der sich in der verbreiteten Teilnahme der Philosophen an den unterschiedlichsten öffentlichen Debatten erkennen lässt – ist, dass […] auch nur die elementarste moralische Predigt gemeinhin als ‚Philosophie‘ bezeichnet wird“ Hin- und hergerissen zwischen einem Zuwenig und einem Zuviel der Philosophie läuft man schließlich Gefahr, so scheint es jedenfalls mir, das Wesentliche zu verlieren: Dieses immer neue und neuerliche Fragen nach der Wahrheit (und damit auch das In-Frage-Stellen der Wahrheit), und zwar ohne die illusorisch tröstende Abkürzung durch Schwächungen, aber auch ohne die Übertreibung der Meinungen, die sich auf dem konfusen Markt der Ideen vor allem aufgrund ihrer Fähigkeit halten, andere zu dominieren. Und es scheint mir sogar überraschend, dass einige philosophischen Richtungen, die sich wohl für den Begriff der 2 Wahrheit aussprechen, daran erinnert werden müssen, von jemandem, der sich, wie Badiou, als Materialist erklärt (wenn auch platonisch). Er schreibt: „[...] die aktuelle Periode, verwirrt und hässlich, erlegt uns auf zu behaupten, dass es ewige Wahrheiten gibt in der Politik, in der Kunst, in der Wissenschaft und in der Liebe“. 2. Zwischen den Arten der Wahrheit: Übereinstimmung, Offenbarung, Schutz In Con gli occhi del nemico (Mit den Augen des Feindes) gesteht David Grossman in berührenden Worten seine Berufung zum Schriftsteller: „Ich schreibe. Das Unglück, das mir zugefügt wurde, der Tod meines Sohnes Uri während des zweiten Libanonkrieges, durchdringt jeden Moment meiner Existenz. Die Kraft ist unermesslich in ihren Wirkungen, enorm. Stückweise besitzt sie paralysierende Eigenschaften. Und dennoch schafft der Akt zu schreiben für mich jetzt eine Art ‚Raum‘. Einen emotionalen Raum, den ich niemals zuvor gekannt habe, in dem der Tod nicht nur ein totaler, kategorischer Gegensatz des Lebens ist […] Ich schreibe. Die Welt verschließt sich nicht vor mir, sie wird nicht mehr bedrückend. Sie öffnet sich vor mir, hin zu einer Zukunft, zu anderen Möglichkeiten. Ich stelle mir vor. Der Akt selbst zu imaginieren, sich vorzustellen, verleiht mir Leben. Ich bin nicht versteinert, gelähmt von nun an durch den Wahnsinn. Ich erschaffe Personen. Von nun an habe ich den Eindruck, sie aus dem Eis herauszuziehen, in dem sie die Realität eingesperrt hat. Aber vielleicht, mehr als alles andere, ziehe ich mich selbst heraus aus diesem Eis. Ich schreibe. Ich nehme die unzähligen Möglichkeiten wahr, die in jeder menschlichen Situation vorhanden sind und die Möglichkeit, die ich habe, zwischen diesen zu wählen, die Süße der Freiheit, die ich dachte von nun an verloren zu haben. Ich nehme freudig Anteil an dem Reichtum der wahren, persönlichen, intimen Sprache, jenseits von Klischees. Ich empfinde wieder die Freude zu atmen in der richtigen Weise, ganz und gar, wenn ich heraustrete aus der Klaustrophobie der Slogans, der Gemeinplätze. Urplötzlich fange ich an aus vollen Lungen zu atmen […] Ich schreibe. Ich spüre die Sensibilität und die Intimität, die ich habe mit der Sprache, mit ihren diversen Schichten, mit der Erotik, mit dem Humor und mit der Seele, die sie besitzt, sie bringen mich zurück zu dem, was ich war, zu mir selbst, bevor jenes „Ich“ zum Verstummen gebracht wurde durch den Konflikt, die Regierung, das Militär, die Verzweiflung und die Tragödie. Ich schreibe.“ 3 Wieso sollte ein Philosoph nicht etwas Ähnliches wagen? Vielleicht weil ihn eine böse Gewohnheit eingesperrt hat in ein „Ich denke“, das sich, um nicht die Banalität einer einfachen Meinung zu riskieren, verwickelt hat in die Wendungen einer technischen Argumentation oder in ein Zitieren ohne persönliche Anteilnahme. Aber das „Ich denke“ ist ein Akt der Freiheit. Eine Freiheit, die weiter als die Widerspiegelung eines „Ich sehe“ geht und die Verantwortung auf sich nimmt, mit der trockenen Sprache des Gedankens einen Raum der Wahrheit zu konstruieren. Dieser Raum hat mehr als eine Dimension: er missachtet nicht das Maβ der Übereinstimmung, wo das Gesagte wahr ist, sagt die Sache, wie sie ist, aber beschränkt sich nicht auf diese Übereinstimmung. Bereits Descartes hatte dies präzise festgestellt: In den entscheidenden Fragen, dort wo es um den Sinn der Wahrheit selbst geht, reicht die Korrespondenz nicht aus. Der Zweifel – jene kritische Übung, die jede Philosophie vorschreibt – begnügt sich nicht mit der Feststellung, dass etwas so sei, sondern versucht, das Bewusstsein zu erlangen, dass es nur so sein könnte. Es ist der sehr bekannte Moment der Evidenz, d.h. einer Feststellung, die nicht mehr Folge einer empirischen Übereinstimmung zwischen dem Ausgesagten und der Sache, sondern ausgesprochen eine Offenbarung der Sache ist: ein „Ich sehe“ (mit den Augen des Gedankens), wo die Sache, sich manifestierend, sich mir offenbart. Nicht umsonst ist die Phänomenologie Husserls, Jahrhunderte später, und mit erneuerter, kritischer Vorsicht, in die Fußstapfen Descartes’ getreten. Und nicht umsonst sind die Cartesianischen Anklänge an das Proslogion des Anselm von Canterbury unleugbar, wo der Beweis des perfekten Wesens analog in einer zweifachen Bewegung eingeschlossen ist: die Feststellung, dass Gott derjenige ist, von dem man nichts Größeres denken kann (id quo maius cogitari nequit), und auch, dass Er etwas ist, das größer ist als alles, was jemals gedacht werden kann (quiddam maius quam cogitari possit). Die Wahrheit ist hier das SichOffenbaren der Sache, welche eine Kraft manifestiert, der man sich nicht entziehen kann. Aber auch dieser Modus der Wahrheit (auch die Wahrheit, nicht nur das Sein, gibt es in verschiedener Weise!) stellt nicht das letzte und umfassendste Wort dar. Vor allem sagt sie es nicht im Zeitalter der Moderne, nachdem der Anspruch eines einheitlichen, umfassenden, kompakten und hierarchisch geordneten Horizonts in die Krise geraten ist, in dem es legitim zu erwarten war, dass jede Sache sich manifestieren würde, wie sie ist. Das Universum der Moderne ist zerbrochen, unterbrochen, durchkreuzt von einer Wunde, die sich nicht natürlich 4 heilen lässt. Die Unmittelbarkeit der Wahrheit, leicht gekräuselt, da wo man den Bezug zwischen Wort und Sache wiederherzustellen versucht, entfernt sich bereits, wenn die an sich überhaupt nicht offensichtliche Evidenz nur am Ende eines komplizierten Verfahrens – und zum Preis eines verstummenden Sich-von-der-Sache-überragen-lassen – erlangt werden muss. Die Unmittelbarkeit ist daher schon nicht mehr unmittelbar, trotz allen intellektuellen Anspruchs, die Unmittelbarkeit wieder herzustellen. Aber der Preis ist enorm. Denn das Sehen der Evidenz bringt einen Effekt der intellektuellen Ausdünnung hervor und ist kein Fühlen, das in gewisser Weise die Verbindung mit der Sache aufrechterhielte; es erreicht sie, aber um den Preis, sie in eine Idee transformiert zu haben, das heißt in das, was, gemäß Descartes selbst, seinen eigenen Status darin hat, ein innerliches Objekt des Geistes zu sein. Die Philosophie verdammt sich somit selbst, nur in der Hälfte der Welt in ihrem eigenen Haus zu sein. Müsste die Philosophie nicht vielleicht immer das aufs Neue zurückgewinnen, was verloren ist, jene Einheit und jene Unmittelbarkeit, die unser nicht vergessener Ursprung sind? Und wie kann sie dies tun, wenn sie nicht zunächst unseren Abstand zum Ursprung einräumt, oder besser, wenn sie – einmal diesen Abstand eingeräumt – ihn durch den Kunstgriff eines Registerwechsels überwindet, in dem die Sache durch ihre mentale Repräsentation substituiert wird? Die Hermeneutik, diese Ontologie der modernen Zeit, beginnt mit der Distanz, hält die Angst zurück und sucht ein Wort – einen Sinn –, das fähig ist, Rechenschaft abzulegen einerseits von der Unterbrechung, andererseits von dem Bedürfnis nach Einheit. „Ich philosophiere, um mich zu ermutigen, so wie die Kinder singen in dunklen Korridoren.“ [„Je philosophe pour me rassurer, comme les enfants chantent dans les corridors sombres.“], schrieb Charles Secrétan, der Philosoph, bei dem ich meine erste philosophische Lehre gemacht habe. Dieser Satz, der mich immer begleitet hat, bedeutet für mich, dass der erwachsene Mensch der Philosophie weder die Angst beseitigt hat, von der das Kind angesichts der Dunkelheit ergriffen wird, noch die Beklemmung, die uns alle befällt angesichts der Leere einer Welt, die eines versicherten Sinns beraubt ist. Dieser Mensch, dennoch, füllt die Dunkelheit mit einer Stimme: nicht wegen einer einfachen Tröstung, sondern um Kraft, Sicherheit und Ruhe wiederzufinden, um sich selbst frei von der Angst wiederzugewinnen (alles dies bedeutet se rassurer) und den Ort bewohnbar und begehbar zu machen, den wir durchlaufen müssen. 5 Im Übrigen: Dort wo die Philosophie als tröstende Kraft erscheint, wie im überraschend modernen Dialog von Severinus Boethius (De consolatione philosophiae), geschrieben im Kerker in Pavia (wie viele große Gedanken sind in der Höhle des Gefängnisses geboren worden!), dort negiert die Philosophie nicht die Unbeständigkeit der Welt: „Eines steht ewig fest als ein uns Gesetztes: Nichts was irdisch erzeugt, beharrt.“ Die Dunkelheit der Welt, bereits in der platonischen Höhle symbolisiert, wird unter den Bedingungen der Sklaverei und des Exils erkannt und beschrieben. Nichtsdestotrotz werden in dem Gedanken eine Freiheit und eine Loslösung erahnt, welche fähig sind, auch jenen dunklen Ort bewohnbar zu machen: „Dieser Ort selbst, den du Verbannung nennst, ist seinen Bewohnern Vaterland. Nichts ist elend, als wenn man es dafür hält, und andererseits ist jedes Los glücklich dem, der es mit Gleichmut trägt.“ Vielleicht ist es nicht so sehr die platonisch-neuplatonische Vorgehensweise dieser Schrift, welche uns heute Halt geben kann, sondern ihre Einladung, die zwielichtige Hülle, die uns umgibt, zu durchdringen, festhaltend an jenem Funken von Glück, der das Leben entfacht und seine Kraft aufrechterhält. Wie Boethius schreibt und wie wir es wiederaufnehmen können, nicht unbedingt nur in dem Sinn, wie er es gedacht hat, „[…] aus diesem winzigen Fünkchen wird sich dir bald die Lebenswärme wieder entfachen.“ Auf diese Weise wird ein dritter Modus der Wahrheit geboren, jener, für den er ein umfassendes Wort ist, nämlich auf der Höhe der Komplexität, und von solcher Art und Weise, dass er alle Kräfte des Menschen mobilisiert: vom Intellekt bis zum Gefühl, vom Geist bis zum Körper, und daher in der Lage ist, auf das zu antworten, was die Lage gebietet. Dieses Wort wäre in angemessener Weise nur dem möglich, der eine Ansicht des Ganzen hätte. Aber einzig und allein Gott, wenn er existiert, könnte einen Blick haben, der fähig wäre, das Ganze zu durchdringen, ohne es zu verletzen. Dieses Wort ist also der Philosophie versagt, als Werk von Menschen, die über eine Situation sprechen immer von der Situation selbst ausgehend und die beim Sagen, während sie einschließen, immer auch ausschließen, und während sie wieder heilen, immer auch verletzen. Und doch ist dieses unmögliche Wort das eigentliche Wort der Philosophie. Jenes, für das es sich lohnt, ein Leben auf der Suche nach einem (auch einem einzigen) Ausdruck, der dieser Erwartung angemessen ist, zu leben. Wir haben schon gesagt, dass dieses Wort nicht möglich ist: auf der einen Seite überschreitet es die 6 Möglichkeiten der Endlichkeit, auf der anderen Seite würde es darin enden, die Welt in einem bereits völlig festgeschriebenen Sinn zu versiegeln. Und dennoch hat sich die Philosophie seit jeher auferlegt, den angemessenen Weg dahin zugänglich machen zu können. Sie hat nämlich gesagt, dass ihr Wissen nicht Wissenschaft, sondern Liebe ist. Um dies verständlich zu machen, hat jemand behaupten wollen, dass die wahre Aufgabe der Philosophie die Suche ist. Die Philosophie wäre demnach nicht an der Wahrheit interessiert, sondern an der Suche danach. Nichts ist aber peinlicher als eine Suche, die sich von Anbeginn die Unmöglichkeit vorschreibt, zu einem Ergebnis zu gelangen. Es ist also nicht der Weg, das Dictum der Philosophie zu verstehen. Vielmehr bedeutet es, dass das Wissen der Philosophie Liebe ist, das heißt eine Leidenschaft nicht des Besitzens, sondern der Ausübung. Dies bedeutet nicht den Verzicht auf das Ergebnis oder dessen Irrelevanz. Wenn es so wäre, dann würde sich die Aktivität, das Ergebnis zu erlangen, als irrelevant herausstellen, eben weil sie auf ein illusorisches Ergebnis abzielt. Die Philosophie wird jedoch nicht von ihrem Ergebnis her gemessen, sondern an ihrer Ausübung der Aktivität. Diese Ausübung ist bereits Wissen – denn jedes gesagte Wort ist schon eine Form des Wissens – und hat auch schon die Form der Liebe –, denn jedes gesagte Wort richtet sich nicht an einen Fremdkörper, sondern setzt in Bezug, in einen unauflöslichen und liebevollen Bezug, denjenigen, der (aus)sagt, und das, was ausgesagt wird. Die Philosophie ist jene Tätigkeit des Menschen, die den eigenen Maßstab sucht im Sagen: a) wie die Sachen sind, jedoch b) so, dass das volle Sich-Manifestieren der Sache ermöglicht wird, und darüber hinaus c) so, dass dieses sich Manifestieren in verantwortungsvoller Weise die Aufgabe auf sich nimmt, nicht nur die gesagte Sache zu respektieren und zu schützen, sondern auch jede andere Sache und jeden anderen Gesprächspartner. Auch wenn das Erreichen des Ergebnisses nie gesichert ist, kann das dieser Aufgabe angemessene Verhalten vorgeschrieben werden. Zurückgreifend, noch ein letztes Mal, auf Boethius, „es gibt keine Zwietracht zwischen wahr und wahr / Und sie stimmen immer, in unverbrüchlicher Weise, miteinander überein.“ Das heißt, um dieses Zitat zu den vorgeschlagenen drei Modi des Wahren zurückzubringen: Obgleich sie einem faulen Geist in Konflikt erscheinen können, sind sie jedoch miteinander vereinbar, und es ist wahre Philosophie, die Verbindungen zu sammeln, welche die drei Modi der Wahrheit verknüpfen. 7 3. Unterbrechung, Erwartung, Begehren Wenn ich meinen philosophischen Weg im Lichte dieser Prämissen wieder aufnehmen müsste, so könnte ich dies vielleicht in folgender Weise tun. Zwei Aspekte erscheinen mir entscheidend, um die Philosophie heute zu denken: auf der einen Seite das Bewusstsein, dass der kulturelle Horizont der Moderne nicht mehr einen Gedanken der Totalität zulässt, fähig, die Vielfältigkeit des Realen in einer einzigen Formulierung des Wissens umfassend einzuschließen; und auf der anderen Seite, die entgegengesetzte, aber verbundene Erfahrung eines immer dringenderen Bedürfnisses nach Mitteln, dieses Ganze anzugehen, das sich uns dennoch entzieht. Die erste Beobachtung, wie ich mehrmals bemerkt habe, ist bezogen auf die Moderne und die Modernität, in meinen Augen zwei unterschiedliche, aber übereinstimmende Epochen, die durch die bewusste Unterbrechung eines Kontinuitätsverhältnisses mit der Vergangenheit und mit jeder hierarchisch geordneten Perspektive des Einschlusses der Realität in einem ersten Wissen (eine Art prote philosophia) entstanden sind. In dieser abgekürzten Formulierung sind zwei Aspekte enthalten: Der erste ist das, was wir unter dem allgemeinen Stichwort der Krise der Tradition subsumieren können; der zweite unter dem Begriff der Säkularisierung. Die Krise der Tradition, die seit jeher jede Epoche, den Verfall der Gebräuche und die Gleichgültigkeit gegenüber etablierten und heiligen Sitten beklagend, denunziert hat, nimmt jedoch in unserer Zeit einen ganz spezifischen Charakter an, denn sie ist nicht das quasi organische und unausweichliche Ergebnis des einfachen Vergehens der Zeit, sondern die Folgerung einer beabsichtigten und programmatischen Geste. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass – mit einer im Vergleich zu anderen Epochen überraschenden Wendung – das Neue als Kategorie unvermittelt den Charakter eines Werturteils angenommen hat. Was die Säkularisierung angeht, so ist diese nicht so sehr, wie man lange gedacht hat, mit der in gewisser Weise karstigen Verschiebung vom Heiligen zum Profanen zu identifizieren, sondern in dem Aussetzen der Legitimität jedes einschließenden und einordnenden Horizonts. Der Verlust des Heiligen (auch eines schrittweise profanisierten 8 Heiligen) ist das Indiz, dass nichts mehr unter der Voraussetzung akzeptiert wird, an und für sich und a priori zu gelten. Im einen wie im anderen Aspekt wohnen wir im Grunde einer erheblichen Wendung der Horizonte a priori bei, welche eine Epoche definieren. Wenn diese beiden Aspekte eine verbreitete und allgemein geteilte Erfahrung der Moderne beschreiben, so können sie auch gut erklären, warum die Philosophie vor allem den Anspruch aufgegeben hat, in eine fundamentale und einschließende Ontologie zu münden; oder, wenn sie sich dieser in der romantischen Moderne ausgiebig gewidmet hat, so hat sie es unter der Einschränkung getan, das Ideale und Rationale zu ihrem eigentlichen Objekt zu machen, um auf diese Weise im Grunde jenes Reale, das den Gesetzen des Idealen Widerstand leistete, herabzustufen. Der eine Weg wie auch der andere haben Trümmer auf dem Boden hinterlassen. Sowohl fehlende als auch übertriebene Ambitionen grenzten die Philosophie vom erwarteten Wissen aus. Und dieses Wissen ist desto mehr erwartet, umso mehr es ausgeschlossen scheint. Die geniale Eingebung Schillers in seiner Forschung über das Naive (Über naive und sentimentalische Dichtung) liegt darin, dass er – im Gegensatz zu anderen Zeitgenossen, die sich bemühten, dessen Charakter in der einen oder anderen Form festzumachen – ehrlich anerkennt, dass das Naive etwas ist, das wir nicht mehr sind: „Während die anderen Autoren [Batteux, Mendelssohn, Sulzer, Wieland] eher fasziniert vom Naiven erscheinen, als Anwesenheit einer Natürlichkeit und Unschuld, einsetzbar als Korrektiv mal gegen das Künstliche, mal gegen das Überflüssige, mal gegen das Intellektuelle, fokussiert Schiller seinen Beitrag vielmehr auf die Abwesenheit dieser Natürlichkeit, von der das Naive gerade ein Zeichen ist.“ Alle diese einfachen Objekte, die wir als Natur kennzeichnen, „sind das, was wir waren“ und sie zeigen daher an, „das, was wir wieder werden sollen.“ Dieser Verlust der Naivität – eine Naivität, die kein Kunstgriff mehr in der Lage ist zu reparieren, eine Unterbrechung, die keine Kunst in der Lage ist zu beseitigen – ist desto mehr begehrt und gesucht, umso mehr sie hinter unserem Rücken liegt. Wie Schiller selbst hervorhebt, niemand besser als der Kranke weiß und schätzt die Gesundheit, die er dennoch verloren hat. Etwas Ähnliches, aber im Zeichen einer mittlerweile abgeschlossenen Modernität, sagt uns Luc Boltanski, wenn er in seiner dramatischen Kantate Les Limbes (Die Vorhölle) die 9 Vorhölle als Zeichen der „Herzmitte unserer [heutigen] Lebensweise“ annimmt, ein Ort, der beherrscht wird von einem „Warten, ohne wirklich zu wissen, worauf man wartet, oder was einen erwartet: Warten selbst, wenn man nichts begehrt […]“. Ein Ort also, wo alles auf die Selektion bezogen ist, projiziert jenseits der Mauer, die den Weg blockiert, aber ohne dass in irgendeiner Weise bekannt ist, wohin man ausgerichtet ist. Die Unterbrechung der Tradition hat dieses Ziel (oder diesen Ursprung) verlieren lassen, aber sie hat nicht die Erwartung und das Warten eliminiert, obwohl sie immer häufiger das Begehren danach abgeschliffen hat. In bittererer Weise als bei Schiller, dessen Perspektive noch mit dem höheren Ausgang eines vollkommen idealen, dritten Stadiums kompatibel war, wird hier eine analoge Doppelheit beschrieben: die einer Entwurzelung, die nicht aufhört, Warten zu sein. Der weitere Verlauf, mit dem wir konfrontiert sind, ist also die Tatsache, dass nicht nur das Objekt verloren gegangen ist, sondern dass das Warten sogar das Begehren des Objektes verloren hat. Der Automatismus des Wartens, das der Entwurzelung gefolgt ist, ist intakt geblieben; die Leere, die uns fehlt, wartet dennoch immer darauf gefüllt zu werden, aber ohne dass das Begehren – seit jeher auf das Suchen der Glückseligkeit gerichtet – sie noch suchen kann. Die Philosophie befindet sich zwischen diesen beiden gegensätzlichen Polen. Es ist daher gut, wenn sie einen Mittelweg, ein richtiges, angemessenes Wort, wählen würde, um Rechenschaft zu geben von diesem unmöglichen, aber wirklichen zweifachen Zustand: von der Wahrheit getrennt zu sein und nicht ohne sie leben zu können, sie zu benötigen und sie zu erwarten, aber ohne sie wirklich mehr zu begehren. Noch einmal ist es ein Schriftsteller, Orhan Pamuk, der in der Rede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises die eindrucksvollere Formulierung gefunden hat, um etwas sehr Ähnliches auszudrücken. Der letzte der vielen angeführten Gründe als Antwort auf die Frage, warum er sich dem Schreiben widmet, lautet nämlich: „Ich schreibe, weil es mir nie gelungen ist, glücklich zu sein. Ich schreibe, um glücklich zu sein.“ Treu jenem fordernden Anspruch auf Universalität, der die Philosophie begleitet, könnten wir vielleicht als Philosophen den Ausdruck in dieser Weise neu formulieren: Ich denke, um allen zu ermöglichen, glücklich in jenem uns allen gemeinsamen Ort zu wohnen, der so weit entfernt und so nah an der Freude ist. Ich denke, um das Begehren wiederzufinden, ich denke, damit das Warten eine Richtung und einen Namen hat, und damit es sie nicht nur für mich hat. 10 4. Die Gegenwart und ihre Anforderungen Aus diesem Grund habe ich der Zeit so viel Aufmerksamkeit gewidmet (Il presente possibile). Aber nicht der naturalistischen Zeit des Zyklus und auch nicht der fortschreitenden der Geschichte, sondern jener Zeit, die die Existenz heute, in der Gegenwart betrifft. Dies haben mich, jeder auf seine Weise und mit unterschiedlichen Akzenten, Walter Benjamin und Dietrich Bonhoeffer in der Moderne gelehrt. Der erste durch die Kritik einer historizistischen Auffassung der Geschichte und die Aufmerksamkeit auf die Jetzt-Zeit und der zweite durch die eigene Entschlossenheit, die Frage des Glaubens auf den Prüfstand des Heute zu stellen. Und es hat mir dies Pascal, dieser große Denker der Moderne, bestätigt, wenn er – nicht ohne Anklänge an Augustinus – mahnt: „Wir halten uns nie an die Gegenwart. Wir rufen uns die Vergangenheit zurück; wir greifen der Zukunft vor, als käme sie zu langsam und als wollten wir ihr Eintreten beschleunigen, oder wir rufen uns die Vergangenheit zurück, als wollten wir sie festhalten, da sie zu schnell vorübereilte, wir sind so unklug, dass wir in Zeiten umherirren, die nicht die unsrigen sind, und nicht an die einzige denken, die uns gehört […]“ Was für ein dramatisches Verbergen der Endlichkeit hat Heidegger hervorgerufen, das Dasein in einer permanenten Vorwegnahme der Zukunft hervorkommen lassend, welche das Dasein in das Netz einer Zukunft einschließt, die ausgehend vom Tod gedacht und von Angst affektiv gefärbt ist. Jene singuläre Zirkularität, die sich um die affektive Modalität der Angst kümmert, indem sie sie in dem ihr eigentlicheren, durch den Tod definierten Geltungshorizont denkt, ist im Übrigen eine sehr hohe philosophische Übersetzung der üblichen Spracherfahrung der Zeitmessung, so wie sie von der deutschen Sprache ausgedrückt ist, die Teile der Stunde nicht auf die letzte volle Stunde aufbaut, sondern die nächste, noch nicht geschlagene Stunde antizipiert: sie sagt nämlich nicht „zwei und halb“, sondern „halb drei“. Und auf den antiken Uhren ist das Enteilen der Zeit, wie Benjamin uns erinnert hat, nicht ohne Beklemmung, mit der bereitstehenden Sense des Todes, dargestellt. Die dramatische Darstellung durch Heidegger endet nichtsdestoweniger damit, die Härten der Endlichkeit in Klammern zu setzen und dadurch abzumildern: jenes immer nur 11 hier und jetzt Sein mit dem Wille aber, immer und an jedem Ort zu sein. Heidegger hat nicht die Härte dieses lediglich in einem Ort und in einer Zeit zu sein ernst genommen, hat damit jedoch auch nicht den unerschöpften und tiefen Wunsch bewahren können, dieses Hier und Jetzt in einem Horizont der Gesamtheit einzuschreiben. Die Gegenwart, in ihrer Unsicherheit und Hartnäckigkeit, in ihrem jederzeit zum Verschwinden Ausgesetzsein, aber auch in ihrem Anspruch zu widerstehen und zu dauern, beinhaltet umgekehrt das, was in der Endlichkeit entscheidend ist: jenes Etwas, das verschwinden kann, das aber durch die Aufmerksamkeit für die Aktualität den Wunsch zu bleiben einschließt und schützt. Die Gegenwart ist mithin nicht die Brücke, die zwei Horizonte der Zeitlichkeit verbindet, die sonst in unzugänglichen Festungen eingeschlossen sind: den verlorenen Schatz der Vergangenheit und das Eroberungsgebiet der Zukunft. Die Gegenwart ist eher die entscheidende Schwelle, die sich festigt, indem sie soviel wie möglich von dem behält, das gewesen ist, und daraus Baumaterial für die Zukunft macht. Es ist also in der Gegenwart, wo das stattfindet, was wir Vergangenheit und Zukunft nennen, jene Vergangenheit, die die (persönliche und kollektive) Erinnerung beibehalten hat, jene Zukunft, die sich der (persönliche und kollektive) Wunsch vorstellt. Ohne die Gegenwart verlieren auch diese Zeiten an Konsistenz, aber die Gegenwart dehnt, indem sie sich in die eine oder andere Richtung vorstreckt, das punktuelle Sein der Endlichkeit aus, indem sie ihrem intimen Wunsch nachgeht, in eine Richtung nämlich, die sie übersteigt und gleichzeitig ihr gehört. Die Gegenwart, die reiner Augenblick wäre, wäre ein Warten, das weder ein Woher noch ein Wohin hat. Die Gegenwart, die Schwelle ist, ist ein Warten, das sich in Aufmerksamkeit konkretisiert auf das, was ist und zu Begehren wird, und deswegen aus den Ruinen der Vergangenheit das sammelt, was würdig ist zu bleiben und es in Richtung Zukunft projiziert. Die Fülle einer gegenwärtigen Zeit ist fast Ewigkeit: immer weniger als die letztere, weil die Gegenwart, wenn auch voll, dennoch verfällt, jedoch nah bei jener – denn die Fülle der Gegenwart ist würdig zu sein und zu bleiben, ist Präfiguration der Ewigkeit. Die Philosophie denkt diese ewigkeitswürdige Zeitlichkeit. Mir scheint, dass ich damit das wiederaufnehme, wenngleich mit unterschiedlichen Akzenten, was Luigi Pareyson in 12 seinem jugendlichen, aber fundamentalen Essay über „Zeit und Ewigkeit“ (Tempo ed eternità) schrieb: „So wie sich in der Gegenwart der Entscheidung die Anforderung und die Bewertung einsammeln, die das Fundament der Zeit legen, so lebt in der Gegenwart der Initiative die Anwesenheit jener Ewigkeit, aus der sie besteht. Aus der Intuition dieses Aspektes kommen jene Theorien, die die Zeit von der Gegenwart ausgehend interpretieren. So tun es die Theorien, die in der Zeit vor allem die Aktualität beleuchten wollen. Es ist eine Gegenwart, von der man nicht sagen kann, dass sie labil und ephemer ist, denn sie ist derselbe Akt des Geistes. Aber eine solche Gegenwart ist nicht mehr lediglich Gegenwart: Sie ist Präsenz, und Präsenz jener Ewigkeit, die, indem sie die Geschichte gleichzeitig gründet und aussetzt, nur der religiösen Erfahrung zugänglich ist.“ Die Philosophie, so scheint mir, setzt auf diesem (schmalen) Grat das eigene Geschehen riskierend aufs Spiel. Sie tut dies, indem sie mit Gewissheit auf den großen Schatz der religiösen Erfahrung zurückgreifen kann, ohne jedoch daraus ein eigenes Fundament machen zu können. All das macht ihre Nähe zu anderen Formen der Kultur aus, wie, zum Beispiel, zur Poesie oder zur Theologie, jedoch unterscheidet sie auch von jenen. Diese nämlich, durch ihr Aussprechen des Ewigen in der Zeit, haben sich mit Hilfe von entscheidenden Klauseln, obgleich untereinander ganz unterschiedlich, abgesichert. Die Poesie (und mit ihr allgemein die Literatur) sichert sich ab durch die Einklammerung der Wahrheit als Korrespondenz: das ästhetisch Wahre muss nicht real sein. Die Theologie tut das durch ihr Vertrauen auf ein Wahres als Offenbarung, das von anderswo her seine Autorität bezieht. Die Philosophie ist ehrgeiziger, denn sie will dasselbe, sichert sich aber nicht mit einschränkenden Klauseln ab. Sie verschmäht weder die Korrespondenz noch die Offenbarung, aber sie begnügt sich weder mit der einen noch mit der anderen. Sie will die eine und die andere und noch mehr. Sie will eine Wahrheit, die sagt (wie die Dinge stehen), die offenbart (das was in ihnen verborgen liegt und von anderswo her kommt), die aber auch, durch das Sagen und das Offenbaren, die vielfachen, komplexen und gespannten Schichten schützt, aus denen die Realität besteht. Sie will alles – und weiß, dass jeder Besitz Gewalt wäre. Sie will alles – und weiß, dass alles, was sie darstellt, nichts anderes als Erfindung ist. Und trotzdem versteht sich die Erfindung der Interpretation als Entdeckung: eine Erfindung ist ein tieferes Finden; es ist vielmehr das Finden ganz unten in der Tiefe. 13 Die Hermeneutik ist durch Gegenwart gekennzeichnet. Durch eine Gegenwart, die von einem Abwesenden (von dem in der Zukunft versteckten Glück) kommt und in Beziehung zu einem Abwesenden steht (zu der in der Vergangenheit eingeprägten Leere des Leidens). Aristoteles, der seine Ethik so sehr mit Glückseligkeit ausfüllt, hatte wohl verstanden, dass diese nie wirklich und gänzlich abgesichert werden kann, da uns die Vorwegnahme der Zukunft verschlossen bleibt. Das Glück, das immer hier und jetzt ist, kann nie gesagt werden, außer nachdem man das Ganze der Zeit zitiert hat (und, bei Aristoteles, auf das Ende eines Lebens wartet, und sogar weiter geht bis zum Los der menschlichen Überreste und des Ruhms desjenigen, der gestorben ist). Deswegen ist das Glück immer von Spuren der Zukunft durchzogen: In der Endlichkeit bleibt ein Versprechen, von dem mich die Zeit die ersten Früchte genießen lässt. Das Glück ist im Grunde eine Totalität, von dem ich nichts anderes als fragmentierte Erfahrungen habe, die den vorläufigen Namen von Freude und Vergnügen haben. Deswegen ist es immer ein Abwesendes, aber reich an Versprechen. Und auch das Leiden ist ein Abwesendes: die abwesende und von Wunden gezeichnete Vergangenheit, die bevorsteht, ohne in einem Heute erlöst worden zu sein. Das abwesende Leiden wird durch die schmerzhaft-stechende Erfahrung der Aktualität erweckt, die man im Schmerz erlebt, aber dieser Schmerz versinkt wieder in Vergangenheit in dem Augenblick, in dem er im Leiden gerinnt, in der stummen Bürde des akkumulierten Schmerzes, der nicht mehr zu Wort kommt. Aus dem Glück und dem Leiden entspringt das Warten, aber noch nicht das Begehren. Gemäß den einfachen Mechanismen des Lebens konfiguriert das Glück die abwesende Zukunft wieder in Form von Warten und das Leiden fordert die Rechte der Vergangenheit, auf seine Erlösung wartend. Aber dabei handelt es sich nur um ein automatisches Reproduktionsverfahren. Trotz jeder Verwandtschaft ist das Warten nicht Aufmerksamkeit, weil es sein Gleichgewicht außerhalb der Gegenwart hat. Das Warten wartet auf das, was nicht ist, jedoch gibt es weder Kraft noch Richtung derjenigen Gegenwart, die ist. Das Warten in Begehren zu verwandeln, durch die Aufmerksamkeit für das Heute, das heißt durch das, was von Benjamin eine moderne Form des Gebets genannt worden ist, ist heute eine Aufgabe der philosophischen Interpretation. Diese Aufgabe ist schwer, weil jedes Vertrauen in die Möglichkeit, das Abwesende gegenwärtig zu machen, verschwunden ist. Die Hermeneutik 14 selbst erfasst nicht das Abwesende, weil sie es nicht besitzt, noch es besitzen könnte, aber sie kann es umschreiben. Sie ist also befreit von der Zauberei, auf das Abwesende warten zu müssen, und nachdem sie ihm die Sorge der Aufmerksamkeit gewidmet hat, kann sie wieder anfangen, es zu begehren, es hier und jetzt zu begehren, zu entdecken, dass sie jenes Begehren braucht. Sie kann wieder anfangen, damit das schwere Gleichgewicht zu finden, das Bedürfnis und Begehren zu einem Ausgleich führt, und die verschwindende Stunde aus diesem Gewebe zu spinnen. Dieser Akt ist subjektiv, denn er ist eine Geste der Freiheit des Subjekts; aber das, worauf er abzielt und das, was daraus entspringt, ist objektiv, ist die Rekonstruktion einer Welt, in der man die Zelte aufstellen und wohnen kann. Die Philosophie als Hermeneutik beginnt aus einer Wunde, aus einem verlorenen Paradies, jedoch umso begehrter, weil verloren. Sie wird aus einer Unterbrechung geboren. Sie erkennt sie und will sie nicht füllen, sondern in der Erinnerung beibehalten, das heißt in der Konstruktion eines möglichen Sinnes (Modernità e memoria). Hierbei handelt es sich darum, dem Ich einen eigenen Existenzraum zu erobern. Darum, zum Sein als endlichem Sein zu kommen, nach all den Wechselfällen, die es zerstört haben (Nonostante il soggetto). Darum, dem Ich zu entsprechen, das versucht, sich bis zu jenem Versagen zu erhalten, welches eigentlich Öffnung zum Anderssein ist. Um auf das aufzugreifen, was bereits Henri Bergson, wenn auch mit anderen Nuancen, gesagt hat: Die Philosophie – und mit ihr der Philosoph – kreist ihr ganzes Leben um einen einzigen Punkt, sehr einfach und dadurch auch unaussprechlich: „Schließlich konzentriert sich das Ganze in einem Punkt, und wir fühlen, dass man sich ihm immer mehr annähern könnte, ohne ihn je zu erreichen. In diesem Punkt liegt irgendetwas so Einfaches, so unendlich Einfaches, so außergewöhnlich Einfaches, dass es dem Philosophen niemals gelungen ist, es auszudrücken. Und darum hat er sein ganzes Leben lang darüber gesprochen.“ Meine Damen und Herren, die Arbeit der Philosophie besteht darin, die Zeit fruchtbar zu machen. Die endliche Existenz, die uns gegeben ist, ist weder Nichts noch Vollendung; es ist etwas. Aber dieses Etwas ist vor allem schutzbedürftig und auch wachstumsfähig. Das eine und das andere ereignen sich in der Zeit, so wie uns gewährt ist, sie zu erleben: eine Zeit, die, obwohl sie ein strukturelles Entweichen ist, dennoch weder Verbrauch noch Vernichtung ist. In der Zeit – die verläuft – zeichnet sich etwas ab, das verbleiben will. Die Philosophie, wie 15 Scheherazade, arbeitet daran, die Tage zu akkumulieren: einen nach dem anderen, einen der Erzählung des anderen angeschlossen, bis sie durch wiederholte Verzögerung einen Faden, eine Theorie von Tagen vorschlägt, die sich als mit Sinn versehen anbieten. Aber der Philosophie reicht von Anfang an keine private Konstruktion, sie exponiert sich strukturell der Universalität. Sie sucht sie wie die eigene Existenzbedingung. Deswegen ist die Philosophie nie nur Geständnis und auch nicht nur Theorie, sondern streckt sich in Richtung des Anderen der Welt und des Anderen der Anderen aus. Die Philosophie ist immer auch Moral und Politik, weil sie in ihrem – wirklich maßlosen – Anspruch, ein Maß sucht, das für alle gilt. Über den eigenen philosophischen Weg zu sprechen, ist deswegen keine bloß biographische Frage, sondern bedeutet für alle, das entscheidende Problem des Sinns zu stellen: Um welchen Sinn und um welche Wahrheit wollen wir versuchen, reflexiv unsere Existenz zu sammeln? Gewiss, weder der Sinn, noch die Wahrheit, noch das Gute existieren dadurch, dass die Philosophie sie setzt. Sie existieren einfach zwischen den Menschen, auch ohne dass ihre Natur und ihr Charakter reflexiv thematisiert worden sind. Gleichwohl riskiert eine Welt ohne Philosophie eine gefährliche Atomisierung, denn dann können Sinn, Wahrheit und Gutes, die doch existieren, nicht zu Wort kommen und können nicht gemeinsam geteiltes Vermögen werden. Sie bleiben auf dem neutralen Gebiet hingeworfen, in dem wir miteinander leben, aber wie stumme Inseln, von denen jeder von uns nur für sich antwortet. Philosophie heißt aber in erster Person zu antworten, jedoch vor allen und alle auf sich nehmend. Meine Damen und Herren, ohne Philosophie wären wir ärmer. Wie Walter Benjamin bemerkt hat, erzeugt die größere Vielfältigkeit der Erlebnisse an sich keine miteinander geteilte Erfahrung, das Ergebnis jenes Geschehnisses, das zur Botschaft wird. Auch Sinn, Wahrheit und Gutes sind Ergebnisse der Erfahrung. Die Philosophie hilft uns sicherzustellen, dass sie keine stummen, punktuellen und nicht kommunizierbaren Erlebnisse bleiben; sie baut eine Erfahrung auf, an der alle teilnehmen dürfen, auf jenem „Draußen“, das den philosophischen Gedanken immer neu nährt. (Eine erste deutsche Version dieses Vortrags schulde ich Silvia Richter und Augusto Minatta.) 16