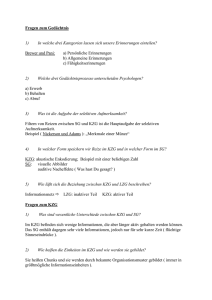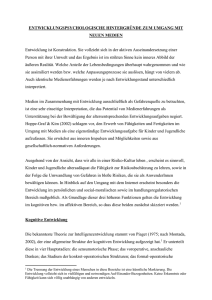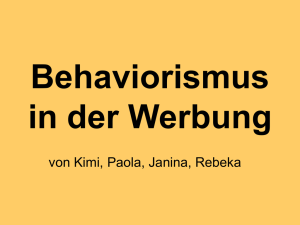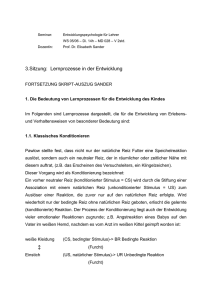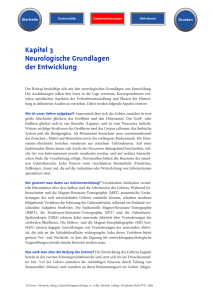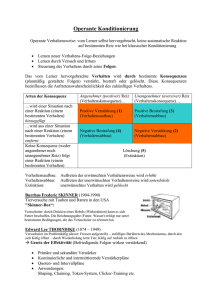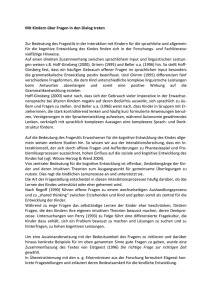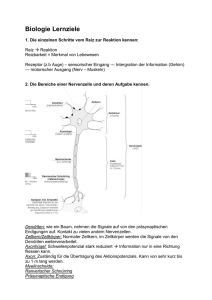Psycho_kompakt - EWS
Werbung
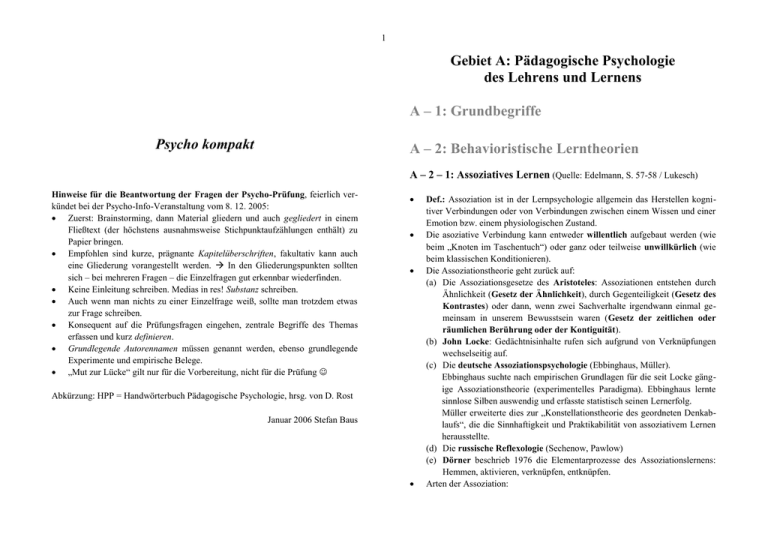
1 Gebiet A: Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens A – 1: Grundbegriffe Psycho kompakt A – 2: Behavioristische Lerntheorien A – 2 – 1: Assoziatives Lernen (Quelle: Edelmann, S. 57-58 / Lukesch) Hinweise für die Beantwortung der Fragen der Psycho-Prüfung, feierlich verkündet bei der Psycho-Info-Veranstaltung vom 8. 12. 2005: Zuerst: Brainstorming, dann Material gliedern und auch gegliedert in einem Fließtext (der höchstens ausnahmsweise Stichpunktaufzählungen enthält) zu Papier bringen. Empfohlen sind kurze, prägnante Kapitelüberschriften, fakultativ kann auch eine Gliederung vorangestellt werden. In den Gliederungspunkten sollten sich – bei mehreren Fragen – die Einzelfragen gut erkennbar wiederfinden. Keine Einleitung schreiben. Medias in res! Substanz schreiben. Auch wenn man nichts zu einer Einzelfrage weiß, sollte man trotzdem etwas zur Frage schreiben. Konsequent auf die Prüfungsfragen eingehen, zentrale Begriffe des Themas erfassen und kurz definieren. Grundlegende Autorennamen müssen genannt werden, ebenso grundlegende Experimente und empirische Belege. „Mut zur Lücke“ gilt nur für die Vorbereitung, nicht für die Prüfung Abkürzung: HPP = Handwörterbuch Pädagogische Psychologie, hrsg. von D. Rost Januar 2006 Stefan Baus Def.: Assoziation ist in der Lernpsychologie allgemein das Herstellen kognitiver Verbindungen oder von Verbindungen zwischen einem Wissen und einer Emotion bzw. einem physiologischen Zustand. Die asoziative Verbindung kann entweder willentlich aufgebaut werden (wie beim „Knoten im Taschentuch“) oder ganz oder teilweise unwillkürlich (wie beim klassischen Konditionieren). Die Assoziationstheorie geht zurück auf: (a) Die Assoziationsgesetze des Aristoteles: Assoziationen entstehen durch Ähnlichkeit (Gesetz der Ähnlichkeit), durch Gegenteiligkeit (Gesetz des Kontrastes) oder dann, wenn zwei Sachverhalte irgendwann einmal gemeinsam in unserem Bewusstsein waren (Gesetz der zeitlichen oder räumlichen Berührung oder der Kontiguität). (b) John Locke: Gedächtnisinhalte rufen sich aufgrund von Verknüpfungen wechselseitig auf. (c) Die deutsche Assoziationspsychologie (Ebbinghaus, Müller). Ebbinghaus suchte nach empirischen Grundlagen für die seit Locke gängige Assoziationstheorie (experimentelles Paradigma). Ebbinghaus lernte sinnlose Silben auswendig und erfasste statistisch seinen Lernerfolg. Müller erweiterte dies zur „Konstellationstheorie des geordneten Denkablaufs“, die die Sinnhaftigkeit und Praktikabilität von assoziativem Lernen herausstellte. (d) Die russische Reflexologie (Sechenow, Pawlow) (e) Dörner beschrieb 1976 die Elementarprozesse des Assoziationslernens: Hemmen, aktivieren, verknüpfen, entknüpfen. Arten der Assoziation: 2 (a) Paarassoziation: A B (b) Assoziationskette: A B C D (c) Assoziationskomplexe: A, B, C, und D sind untereinander vernetzt. Den Lernprozessen förderlich ist es, wenn mit Lerninhalten positive Assoziationen verknüpft werden können. Enthalten die Assoziationen Angstauslöser, dann wirken sie (Ausnahme: beim mechanischen Lernen) lernhemmend. Lerninhalte sollten von den Schülern möglichst auch mit einer emotionalen Valenz bzw. Attraktivität assoziiert werden. Erhöhung der Motivation. A – 2 – 2: Reiz-Reaktions-Lernen Ausschlaggebend ist, dass der zunächst neutrale Reiz des Glockentons in einer zeitlichen und räumlichen Nähe zum aversiven Reiz der Säureeinführung stand (Kontiguität). Dadurch konnte der neutrale Reiz zu einem Signal für den aversiven Reiz werden. Klassisches Konditionieren liegt dann vor, wenn Kontiguität zweier Reize vorliegt und ein Reiz eine Signalfunktion für einen anderen erhält. Es kommt zur Reizsubstitution. Lernen durch Reizsubstitution. Pawlow selbst verstand unter Reizen lediglich mechanische, akustische oder chemische Reize – keine Vorstellungen. A – 2 – 2 – 2: Weiterentwicklung von Pawlows Modell: Respondentes Lernen bzw. Reiz-Reations-Lernen (Quelle: Edelmann S. 59-70 / Prof. Schneider VL) Alternative Begriffe (mit nur schwachen Bedeutungsnuancen) sind: Signallernen, S-R-Lernen (Stimulus-Reaktions-Lernen), Klassisches Konditionieren, Klassisches Bedingen, Reaktives Lernen, Assoziatives Lernen. A – 2 – 2 – 1: Klassisches Konditionieren bei Pawlow Geht auf etwa um das Jahr 1900 durchgeführte Experimente des russischen Physiologen Iwan Petrowitsch Pawlow zurück. Ausgangspunkt seiner Experimente: Bei hungrigen Hunden sammelt sich schon beim Anblick von Speisen Speichel im Maul an. Speichelsekretion ist eine natürliche Reaktion eines Hundes auf den Reiz „Futter“ („ungelernte Reiz-Reaktions-Einheit“). Auf einen Glockenton zeigt der (unkonditionierte) Hund zunächst keine Reaktion. Dies ist für ihn ein neutraler Reiz. Wenn mehrmals der Glockenton unmittelbar vor der Fütterung ertönt, wird aus dem neutralen Reiz „Glockenton“ ein konditionierter Reiz. Es kommt zur Speichelsekretion schon alleine bei einem Glockenton, weil mit der Zeit die Koppelung von „Glockenton“ mit „Futter“ weggefallen ist. In einer anderen Variante führte Pawlow eine Säure in das Maul des Mundes, die er ausspie, nachdem er ausreichend Speichel im Maul hatte. (unkonditionierter Reflex, angeborene Verhaltensweise). Danach löste Pawlow immer vor der Einführung der Säure einen Glockenton aus, bis schließlich alleine der Glockenton ausreichte, um den Speichelfluss auszulösen (konditionierter Reflex, später als konditionierte Reaktion bezeichnet). Anfang der 1920er-Jahre übernahm Watson und die Schule der Behaviorsten das Pawlowsche Modell und übertrug es auf den Menschen. In (ethisch fragwürdigen) Experimenten konditionierte Watson z. B. den „kleinen Albert“, indem er den aversiven und angstauslösenden Reiz „Krach“ mit dem zunächst noch neutralen Reiz „mit der Ratte spielen“ verband. Schließlich wandelte sich die Freude des 1-jährigen Albert an der Ratte in Angst gegenüber Kleintieren (Es fand hier zusätzlich eine Reizgeneralisation statt.) Damit übertrug Watson den Konditionierungsansatz auf das menschliche Lernen. In der Lernpsychologie setzte sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass Reize auch in der Vorstellung gegeben sein können (und nicht nur in physikalisch-chemischen Außenweltereignissen). Außerdem erkannte man, dass Reize nicht zwangsläufig ein bestimmtes Verhalten auslösen müssen, sondern, dass sie auch zu einem bestimmten Erleben führen können. (Angst muss nicht zwangsläufig zu Flucht führen, sie kann sich auch in einem Gefühl der Ängstlichkeit äußern.) Der Begriff Reaktion schließt neben dem Verhalten im engeren Sinne auch das Erleben ein. Während es Pawlow nur um die Aktivierung von Muskeln und Drüsen ging (um Reflexe und Reaktionen im engeren Sinn), geht es heute viel stärker um emotionale und pädagogische Gesichtspunkte, z. B. um das Auslösen von Gefühlen und Bedürfnissen. Erscheinungsformen von lernpsychologischen Reiz-Reaktions-Abläufen: (a) Signaltheorie (oder „Verzögerte Paarung von SC und SUC“): Der zunächst neutrale Reiz kommt zeitlich unmittelbar vor dem natürlichen Reiz. Es liegt Kontiguität vor und aus dem neutralen Reiz wird ein Signalreiz. 3 Effektivste Form der klassischen Konditionierung, besonders wenn der SC sich zeitlich noch mit dem SUC überlappt. (b) Simultane Konditionierung: Gleichzeitigkeit von SC und SUC. (c) Assoziationstheorie (oder rückwirkende Konditionierung): Erst tritt ein natürlicher Reiz ein, dann der zunächst unkonditionierte (Bsp.: Bei einer Werbung wird zuerst die attraktive Frau wahrgenommen, dann erst die Bacardi-Flasche). Es liegt hier nur Kontiguität vor und es entsteht kein Signal. Trotzdem findet hier i. d. R. eine Konditionierung statt. Aber: Diese Form der Konditionierung ist die am wenigsten effektive. Besonderheiten des Reiz-Reaktions-Lernens: (a) Bekräftigung / Verstärkung: Mehrmalige Reizkopplung zum Aufbau einer bedingten Reaktion. Wiederholtes gemeinsames Vorkommen von 2 Reizen. (b) Löschung / Extinktion: Der bereits bedingte Reiz tritt mehrmals alleine auf (z. B. beim Pawlow´schen Hund: Es ertönt nur ein Glockenton, ohne anschließende Fütterung). Die bedingte Reaktion verschwindet wieder oder wird abgeschwächt. Abbau der Reiz-Reaktions-Verbindung. Anmerkung: Emotional-motivationale Reaktionen sind oftmals sehr widerstandsfähig gegenüber einer Extinktion. Teilweise werden manche Reaktionskomponenten gelöscht (z. B. Reflexe oder ein best. Verhalten), während andere Reaktionskomponenten aufgrund von Extinktionswiderständen (z. B. best. Gefühle) nicht gelöscht werden. Beispiel: Experiment von Edwards (1962) mit Army- und Navy-Veteranen, die auch lange nach ihrer Militärzeit beim Läuten der Alarmglocke psychogalvanische Hautreaktionen zeigten, während die Teilreaktion „Weglaufen“ gelöscht war. (c) Reizgeneralisierung: Auch ähnliche Reize wie der bedingte Reiz (z. B. ein ähnlicher Glockenton) lösen die bedingte Reaktion aus. (d) Reizdifferenzierung: Der bedingte Reiz wird scharf unterschieden von ähnlichen Reizen: Der eine löst eine bedingte Reaktion aus, der andere nicht. Folgt z. B. in den Hundeexperimenten bei Darbietung von zwei ähnlichen Tönen das Hundefutter nur noch in Kombination mit einem der beiden Töne, wird nach einigen Durchgängen die Speichelsekretion nur noch bei diesem Ton gezeigt. (e) Bedingte Reaktionen höherer Ordnung: Ein bereits bedingter Reiz gerät wiederholt in Kontiguität zu einem neutralen Reiz, sodass der neutrale Reiz die gleiche Reaktion auslöst wie der bedingte Reiz, der bereits die gleiche Reaktion auslöst wie ein natürlicher Reiz, der einmal in Kontiguität zu ihm stand. Bsp.: Schlagender Lehrer (SUC) Angst (RUC) Tadelnder Lehrer (SC) Angst (RC), weil Verbindung mit Schlägen Stirnrunzelnder Lehrer (SC2) Angst (RC2), weil Verbindung mit Tadel (f) Gegenkonditionierung: Ein bereits konditionierter Reiz wird neu konditioniert. Dadurch, dass nach einem Gongschlag z. B. keine Bestrafung, sondern eine Belohnung erfolgt, wird der Gongschlag zu einem positiven Signal. So kann es zum Abbau von gelernten Reaktionen kommen. (g) Die Gegenkonditionierung kann zum therapeutischen Verfahren der „systematischen Desensibilisierung“ genutzt werden. Durch Kontiguität mit einem positiven Reiz wird Angst (z. B. vor Prüfungen) schrittweise abgebaut. (Erst ein leichter, kurzer Test Erfolgserlebnis Dann ein längerer Test.) Der positive Reiz muss hierbei größer sein als der Grad der Angst (Berücksichtigung der „Angsthierarchie“.). Hier kommt das Prinzip der Gegenkonditionierung zur Anwendung. (h) Aversionstherapie: Konditionieren eines unerwünschten Verhaltens (z. B. Zigarettenrauchen) durch Herstellen einer Kontiguität zu einem aversiven Reiz (z. B. Tadel, Strafe). Die Aversionsvariante ist heute von eher untergeordneter Bedeutung. Kritik: Hier wird nur eine Erscheinungsform, nicht deren Ursache behandelt. A – 2 – 2 – 3: Die Bedeutung der klassischen Lerntheorie für den Unterricht Klassische Konditionierung hat eine besondere Bedeutung im Bereich der Emotionen, insbesondere beim Erlernen von Angstreaktionen. Die Schule und alles, was damit verbunden ist (Lehrer, Bücher, Schüler), können nach einiger Zeit Angst oder Abscheugefühle in einem Kind auslösen, das etwa am ersten Schultag Angstreaktionen gezeigt hat. Bei manchen Schülern tritt in den ersten Schuljahren Brechreiz als direkte Folge von Prüfungsangst auf. Schon früh in ihrer Laufbahn haben diese Kinder gelernt, dass zwischen den Prüfungsergebnissen und ihren Gefühlen von Misserfolg ein Zusammenhang bestand. Die Prüfungsergebnisse konnten z. B. Bestrafung durch Lehrer oder Eltern oder Spott von anderen Schulkindern zur Folge haben. Ein konditionierter Stimulus (die Ankündigung einer Prüfung) kann die konditionierte Reaktion (Angst) hervorrufen. 4 Viele Schüler erfahren einen sog. „Symbolschock“, wenn sie zum ersten Mal mit mathematischen Symbolen konfrontiert werden. Dies beruht wahrscheinlich auf einer Konditionierung der Symbole durch mathematische Problemstellungen. Der Anblick unbekannter Symbole, die zuvor mit schwierigen Inhalten gekoppelt waren, ruft negative Gefühle in den Schülern hervor und blockiert dadurch ein wirkungsvolles Lernen. Kinder, die ohne Frühstück in die Schule gehen, erleben in fortgeschrittenen Unterrichtsstunden einen Leistungsabfall und Konzentrationsschwierigkeiten. Der Hunger der Kinder führt verstärkt zu Angst und Verkrampftheit. Der Hunger ist der unkonditionierte Stimulus und die 6. Unterrichtsstunde der konditionierte Stimulus. Besonderes Problem bei Kindern aus sozialschwachen Milieus. Ansprechen im Unterricht. Klassische Konditionierung spielt in der Werbepsychologie eine große Rolle. Ein emanzipatorischer Unterricht muss sich eine Aufklärung über diese Sachverhalte zum Ziel setzen. Um den Unterricht „positiv zu konditionieren“ ist es wichtig, dass er einen hohen Aufforderungscharakter, d. h. eine hohe emotionale Valenz bzw. Attraktivität aufweist. Steigerung der Motivation. Vermeidung von Angstsituationen im Unterricht durch Schaffung einer Atmosphäre von Sicherheit. Klassisches Konditionieren Reizausgelöstes Verhalten Typ-S-Lernen (S für Stimulus) A – 2 – 3: Operantes Lernen (Quelle: HPP S. 507-511 / PP S. 57-59 / Prof. Schneider VL) Synonyme Begriffe: Operante oder instrumentelle Konditionierung Unter operantem oder instrumentellem Konditionieren werden Lernprozesse verstanden, die nicht direkt reizausgelöst sind, sondern als von innen herauskommende Wirkreaktionen aufgefasst werden können. Die Theorie des operanten Lernens geht auf Thorndike und Skinner zurück und ist in einem behavioralen Standpunkt gegründet. Grundannahme: Jedes Verhalten ist auf Steigerung von Lust und Vermeidung bzw. Verminderung von Unlust und Schmerz ausgerichtet. Grundlegende Gedanken über das Lernen wurden von Thorndike (1898) anhand von Tierexperimenten mit Katzen veröffentlicht. Thorndikes „Law of effect“: Reaktionen, die kurz vor einem befriedigenden Zustand gezeigt werden, werden mit höherer Wahrscheinlichkeit wiederholt. Reaktionen, die kurz vor einem unbefriedigenden Zustand auftreten, werden mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht wiederholt. Es geht um Verstärkung (Reinforcement) und Bestrafung, um Erhöhung oder Verminderung von Auftretenswahrscheinlichkeiten. (Die künftige Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens wird durch seine Konsequenzen bestimmt.) Skinner erklärt den Unterschied zwischen den zwei Konditionierungstheorien: Operantes Konditionieren Verhalten als instrumentelle Aktivität Typ-R-Lernen (R für Reinforcement) Zentrale Annahme: Über Beibehaltung oder Löschung eines Verhaltens (einer Reaktion „R“) entscheiden die auf das Verhalten folgenden Konsequenzen beziehungsweise die nachfolgenden Reize (Stimuli „SR“). Dies wird auch als Wenn-dann-Zusammenhang oder Kontingenz bezeichnet. Mit Kontingenz (ungleich Kontiguität!) ist die Regelmäßigkeit gemeint, mit der Umweltereignisse von bestimmten Verhaltensweisen einer Person abhängen, also die Beziehung zwischen Verhalten und Konsequenz. Die nachfolgenden Reize können positive Verstärker (S+R) oder negative Verstärker (S-R) oder Bestrafungen sein. Entscheidend ist also die beobachtbare Wirkung des Verhaltens und der Vergleich zwischen dem vorausgehenden, unkonditionierten, diskriminativen Stimuli (SD oder UCS) und den Konsequenzen (C). (Vgl. Zwei-FaktorenTheorie der Angstvermeidung: 1. Faktor: Erlernen, dass auf Verhalten A die negative Konsequenz B folgt. 2. Faktor: Erlernen, Verhalten A zu vermeiden.) Beispiel UCS R C (enthaltend einen S+R) Verstärkung von R Es ergeben sich 4 operante Lernprinzipien, zwei der Verstärkung, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens erhöhen und zwei der Bestrafung, die die Wahrscheinlichkeit des Auftretens vermindern.: (a) Darbietung eines positiven Reizes unmittelbar nach einem Verhalten: Positive Verstärkung oder Plus-Verstärkung. (b) Darbietung eines aversiven Reizes unmittelbar nach einem Verhalten: Bestrafung durch einen aversiven Reiz oder Plus-Bestrafung. Flucht- oder Vermeidungslernen. 5 (c) Entzug eines positiven Reizes unmittelbar nach einem Verhalten: Bestrafung durch Verstärkerentzug oder Minus-Bestrafung. Flucht- oder Vermeidungslernen. (d) Beendigung eines negativen Reizes unmittelbar nach einem Verhalten: Negative Verstärkung oder Minus-Verstärkung. Entscheidende Ziele der operativen Konditionierung: (a) schnelles Erwerben von Wissen / Verhalten (b) höhere Auftrittswahrscheinlichkeit eines bestimmten Verhaltens (c) Löschungsresistenz von Wissen / Verhalten (d. h. auch bei ausbleibender Verstärkung das Beibehaltung von Verhalten) Es gibt primäre Verstärker, die sich auf grundlegende Bedürfnisse beziehen (Nahrung, Schlaf, Sexualität, Einflussgewinn) und sekundäre Verstärker wie Geld, Anerkennung, Tokens (materielle, soziale, informative oder aktivitätsbezogene Verstärker), die durch Paarung mit primären Verstärkern selbst zu Verstärkern wurden. Wenn Verhaltenssteuerung ohne erkennbare äußere Verstärkung stattfindet, spricht man von Selbstverstärkung bzw. Selbstregulation. Die Verstärkerwirkung steigt mit steigendem Aufforderungscharakter bzw. steigender emotionaler Valenz und Wertigkeit eines Ziels. Der Reiz, der sognalisiert, dass in einer Situation eine Verstärkung erhältlich ist, ist ein positiver diskriminativer Reiz. Ein negativer diskriminativer Reiz signalisiert, dass keine Verstärkung erhältlich ist. Instrumentelles Lernen ist stark situationsabhängig (hat auch Nachteile z. B. im Bezug auf Bereitschaft zum Transfer etc...). Aufbau von Verhaltensketten (Chaining): Aufbau von komplexen Verhaltensketten durch systematische Verstärkung eines Zielverhaltens, das immer komplexer wird. (z. B. bei einem dressierten Delfin, aber auch bei motorischen Fähigkeiten wie Autofahren etc...). Verhaltensketten werden häufig vom Ende her gelernt. Shaping: Sukzessive Verhaltensformung. Verschiedene Verstärkungsstrategien: (a) kontinuierliche Verstärkung (Vorteil: schnelle Konditionierungserfolge, erfolgreich bei erstmaligen Lernprozessen / Nachteil: geringe Löschungsresistenz, Verwandlung von intrinsischer in extrinsische Motivation) (b) Intervallsverstärkung (z. B. Belohnung bei jeweils fünf Minuten) oder Quotenverstärkung: Belohnung z. B. bei jeder fünften guten Antwort. Beides sind Formen fixierter intermittierender Verstärkung. Diese sind für erstmalige Lernvorgänge weniger ertragreich, dafür aber hohe Löschungsresistenz als Wirkung. (c) Variable Verstärkung: Situativer Einsatz von Verstärkung. Vorteil: sehr hohe Löschungsresistenz. Löschung ist das Ergebnis eines geplanten Prozesses, während Vergessen einen natürlichen Vorgang darstellt. Je intensiver, unmittelbarer und konsequenter bestimmte Belohnungen oder Bestrafungen erfolgen, desto wirkungsvoller sind die Verstärker oder Hemmer. Mögliche negative Nebenwirkungen aversiver Reize und Bestrafungen: (a) Fluchtverhalten, Schulverweigerung (b) Förderung von aggressiven Verhaltensweisen (c) Psychosomatische Beschwerden (d) Negative Selbstwahrnehmung und geringer Selbstwert bzw. Ich-Schwäche (e) Gefühle der Angst, Hilfslosigkeit, Passivität, Orientierungslosigkeit, Aufbau negativer Erwartungen Zur Relevanz operativen Lernens in Schule und Unterricht: (a) Wenn ein Schüler zu Beginn eines Schultages Tabletten nimmt und damit Kopfschmerzen vermeidet, wird das Verhalten „Tabletteneinnahme“ negativ verstärkt. (b) Bestrafung im Unterricht: Tadel, Drohungen, Strafarbeiten, Strafen etc... intendieren eine Unterdrückung von unerwünschten Verhaltensweisen. Aber: Die Wahrscheinlichkeit, dass Bestrafung zu gewünschtem Verhalten führt, ist sehr gering, weil nicht aufgezeigt wird, wie das gewünschte Verhalten aussieht. Wichtiger zur Löschung ist eine Nicht-Verstärkung des Verhaltens (was in der Schule schwer sein kann, weil nicht selten Mitschüler durch Aufmerksamkeitszuwendung unerwünschtes Verhalten verstärken). Bestrafung kann durch Kontiguität mit dem Bestrafenden (Lehrer) assoziiert werden. Sehr unvorteilhaft. (c) Sanfte Rügen, die nur das beteiligte Kind hören kann, sind vergleichsweise am effektivsten (erläuternde, rücksichtsvolle Form von Bestrafung). (d) „Premack-Prinzip“: Angenehme Verhaltensweisen dazu benutzen, um weniger angenehme Verhaltensweisen zu verstärken. Vgl. „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!“ (e) Einsatz von Münzverstärkungsprogrammen (z. B. Tokens) oder Kontingenzverträgen (Aushandeln z. B. einer Aktivität beim Klassenausflug bei Engagement im Unterricht). 6 Grenzen der instrumentellen Lerntheorie: Es lässt sich nur schwer vorstellen, dass Sprache, Sitten etc... bei einem neuen Mitglied einer Kultur ausschließlich über eine Sequenz von Versuchs- und Irrtums-Lernprozessen aufgebaut werden. Dies hätte nicht ganz so erwünschte Folgen etwa beim Schwimmenlernen oder beim Erlernen des Operierens bei Medizinstudenten. (b) Bei passenden Themen Diskussionskultur fördern. Eigenverantwortung der Schüler/innen in best. Bereichen stärken. Wichtig ist, dass die Schüler im Bezug auf ihre Leistung eine Kausalattribution aufbauen. A – 3: Sozial-kognitive Lerntheorie A – 2 – 4: Gelernte Hilflosigkeit (Quelle: Edelmann, S. 140-141) Der Begriff wurde erstmals im Rahmen von Konditionierungsexperimenten von Seligmann und Maier (1967) verwendet. Versuchsaufbau: Einer Gruppe von Versuchstieren (Hunden) wurden elektrische Schläge verpasst, die sie durch Drücken einer Platte abschalten konnten (= unvermeidbare, aber beeinflussbare Reize). Einer zweiten Gruppe von Hunden wurden ebenfalls diese elektrischen Schläge verpasst, aber ohne dass diese die Chance hatten, sie abzustellen (= unvermeidbare und unbeeinflussbare Reize). Im zweiten Versuchsabschnitt wurden die Hunde in einen zweiteiligen Käfig gebracht, deren eine Hälfte nach dem Erlöschen einer Lampe am Boden elektrifiziert wurde. Ergebnis: Die Tiere der ersten Gruppe erlernten schnell das Fluchtverhalten in die zweite, nicht elektrifizierte Käfighälfte, die der zweiten Gruppe lernten dies nur langsam oder überhaupt nicht. Sie hatten „Hilflosigkeit erlernt“ und waren unfähig zur Kontrolle aversiver Reize. Humanversuche von Miller und Norman (1979) führten zu ähnlichen Ergebnissen. Aversive Ereignisse wurden als nicht kontrollierbar erlebt. Die Individuen sehen sich zu keinem Flucht- oder Vermeidungsverhalten in der Lage Gelernte Hilflosigkeit zeigt sich als kognitiv-emotionales Defizit, als eine Dakann-man-sowieso-nichts-machen-Mentalität. Bereits die Erwartung der Hilflosigkeit und der eigenen Ohnmächtigkeit untergräbt die eigenen Lern-Erfolgschancen und den Lernerfolg selbst. Schulische Maßnahmen gegen „gelernte Hilflosigkeit“: (a) Schüler bei best. Fragen miteintscheiden lassen, z. B. Klassenlektüre, Gestaltung des Klassenzimmers, Ziel eines Klassenausfluges. A – 3 – 1: Lernen am Modell / Beobachtungslernen (Quellen: HPP S. 514-519 und 664f / Edelmann S. 282-307 / Psy-VL) Lernen am Modell (bzw. „Modell-Lernen“ oder Imitationslernen) ist eine Form von „sozialem Lernen“ und geht als Begriff auf die Arbeiten von Bandura (ab 1963) zurück. Unter Modell-Lernen ist zu verstehen, dass sich das Verhalten eines Individuums aufgrund der Wahrnehmung von Verhaltensweisen anderer Personen oder aufgrund verbaler Darstellung über das Verhalten anderer Personen ändert, und zwar in Richtung größerer Ähnlichkeit mit dem rezipierten Verhalten. Lernen am Modell ergänzt die behavioristischen Lerntheorien um die Komponente der kognitiven Informationsverarbeitung. Grundannahme: Zwischen der Anregung eines Verhaltens durch das Modell und der Ausführung des Verhaltens durch den Beobachter finden kognitive Prozesse statt. Mit dem Modell-Lernen kann Unterschiedlichstes erlernt werden, z. B. (a) Sprache und Wissen (b) Neue Verhaltensweisen (c) Empathie und prosoziales Verhalten etc... Zentral: Identifikation und Imitation von beobachteten Verhaltensweisen. Modellierung (Identifikations- und Nachahmungsprozesse). Die Modellierungseinflüsse lassen sich drei Lerneffekten zuordnen: (a) Erwerb neuer Verhaltensweisen (ist am deutlichsten nachweisbar). (b) Verstärkung vorhandener Verhaltensweisen. (c) Verstärkung ähnlicher Verhaltensweisen (Auslösungseffekte / Übernahme von Mode-Erscheinungen). Ziel des Modell-Lernens: Ein an lernpsychologischen Prinzipien orientierter Aufbau von angemessenem Verhalten und Abbau unangemessenem. 7 Als zentral werden die Wechselwirkungen zwischen den beiden Interaktionspartnern angesehen: Konstituierende Komponenten sind das Modell (Lehrer) und der Beobachter (Schüler). Beim Medell kann es sich um eine Person, aber auch um „symbolische Modelle“ z. B. aus Film, Fernsehen, Literatur handeln. Positive Effekte beim Beobachtungslernen treten auf, wenn... (a) ... ein hoher Status, Kompetenz, Vorbildcharakter oder Sozialprestige des Modells gegeben ist und eine emotional gute Beziehung zwischen Modell und Beobachter. (b) ... es wahrgenommene Ähnlichkeiten zwischen Eigenschaften des Modells und des Beobachters gibt. (c) ... der Beobachter dem Modell eine große Aufmerksamkeit widmet. (d) ... das Verhalten des Modells sichtbar und auffällig ist und sich klar von dem Hintergrund konkurrierender Modelle abhebt. (e) ... es im Bereich der Kompetenz des Beobachters liegt, das Verhalten zu übernehmen. Beispiel: Kognitives Modellverfahren: Der Lehrer demonstriert, wie er eine Aufgabe löst, wie er sie in handhabbare Einzelschritte zerlegt, welche Methoden anzuwenden sind und wie das Ergebnis kontrolliert werden kann. Diesen Lösungsprozess begleitet er mit sprachlichen Erläuterungen. Das beobachtete Verhalten wird zur Handlungsrichtlinie. (Allerdings wird es zunächst auch auf seine Folgen hin reflektiert und dadurch reguliert.) Phasen des Modell-Lernens (nach Bandura): Aneignungsphase (a) Darbietungsphase (durch den Lehrer). Hier finden v. a. Aufmerksamkeitsprozesse statt. (Akquisitation) Modellierungsreize liegen in der affektiven Valenz. Der Beobachter braucht sensorische Fähigkeiten und muss erregbar und motivierbar sein. Die Aufmerksamkeitsprozesse bestehen aus kognitiven Fähigkeiten, aus Vorwissen und Lernerfahrungen und aus motivationalen und physiologischen Erregungsbedingungen des Schülers. (b) Es kommt zu einer kognitiven Auseinandersetzung mit dem beobachteten Verhalten, zu einer symbolischen Kodierung, zur kognitiven Organisation und Wiederholung (Gedächtnisprozesse). Kodierungsprozesse: Der Schüler kodiert beobachtete Handlungen und speichert sie ab. Behaltensprozesse: Dafür ist eine Vernetzung mit bisherigen Wissens- und Kompetenzbeständen wichtig. Ausführungsphase (c) Motorische Reproduktionsprozesse (Performanz): Spontane Verhaltensäußerungen der Beobachter (Schüler), wenn sie in einen ähnlichen Kontext gesetzt werden. Dazu bedarf es körperlicher Fähigkeiten und einer Selbstbeobachtung bei der Reproduktion. Anwendung von Reproduktionsprozessen bzw. Übungs- und Generalisierungsprozessen. (d) Ggf. Verstärkungs- und Motivationsprozesse: Antizipation von Verstärkung oder Bestrafung hat eine motivierende oder demotivierende Wirkung. Die Verhaltensregulierung geschieht jedoch nicht nur aufgrund von Konsequenzen externen Ursprungs, sondern auch über Prozesse der Selbstverstärkung und über stellvertretende Verstärkung (Verstärkung beim Modell): Erfolgreiches Handeln des Modells wird beim Beobachter verstärkt, erfolgloses Handeln weniger angewendet (wenngleich es im Verhaltensrepertoire gespeichert wird!). Durch Beobachtung der beim Modell instrumentell verstärkten Handlung kommt es zur stellvertretenden Verstärkung, die sich durch Antizipation der Konsequenzen einer möglichen Verhaltensübernahme auszeichnet. (e) Längerfristig wirksame Verhaltensaneignung. Anderer Systematisierungsschlüssel des Modell-Lernens nach Edelmann et al. (1982): (a) Orientierungsphase: Aufnahme neuer Informationen. Aktivierung best. Bereiche der kognitiven Struktur. Erstellen eines antizipatorischen Situationsbildes. (b) Realisierungsphase (c) Evaluationsphase Edelmann betont dabei, dass i. d. R. Modellvarianten auftreten, d. h. dass einzelne Phasen stärker ins Gewicht fallen und andere schwächer. Experimentelles Beispiel von Bandura (1965): (a) Versuchsaufbau: Es wurden vier Gruppen mit etwa fünfjährigen Kindern gebildet. Vor einer Gruppe behandelte ein Modell (Lehrer) eine lebensgroße Puppe sehr aggressiv. Eine zweite Gruppe sah diesen Lehrer in einer TV-Aufnahme, eine dritte Gruppe eine aggressive Comicfigur im TV. Die vierte Gruppe war als Konrollgruppe diesen Einflüssen nicht ausgesetzt. (b) Dann wurden die Kinder aller Gruppen einer leichten Frustration ausgesetzt, dadurch dass attraktive Spielzeuge weggenommen wurden. (c) Danach wurde beobachtet, wie die Kinder mit gleichen Puppen in einem ähnlichen Kontext umgehen. Es zeigte sich eine sehr hohe Aggression bei 8 der Gruppe mit dem menschlichen Modell, eine hohe Aggression bei den beiden Gruppen mit den TV-Modellen und kaum Agression in der Kontrollgruppe. (d) Später wurden längerfristige Verhaltensänderungen gemessen. Eine dann erfolgende Bestrafung aggressiven Verhaltens hemmte die Auswirkungen, eine Belohnung trug zur weiteren Enthemmung bei. Klassisches Experiment von Bandura und Ross (1963): Eine Gruppe von Vorschulkindern beobachteten, wie aggressives Verhalten belohnt wird: In einem Film machte ein Kind Rocky seinem Kameraden Jonny die Spielsachen erfolgreich streitig. Eine zweite Gruppe beobachtete, dass das aggressive Verhalten nicht zum Erfolg führte. Eine dritte Gruppe sah keinen Film. Später spielten alle Kinder mit den Spielsachen, die auch im Film vorkamen. Beobachtung von aggressivem Verhalten: Gruppe 1: 15 aggressive Handlungen – Gruppe 2: 8 aggressive Handlungen (neues Verhalten erlernt, aber zumeist unterdrückt) – Gruppe 3: 5 aggressive Handlungen (ist in etwa der Basiswert). Auswirkungen von Modell-Lernen: (a) Hemmungs- oder Enthemmungseffekte: Förderung oder Blockierung vorhandener Verhaltensweisen (z. B. könnte das Überqueren einer Straße bei „rot“ Kinder enthemmen). (b) Modellierender Effekt bzw. Aneignungseffekte: Erwerb völlig neuer Verhaltensweisen (motorisch, kognitiv, emotional...). Erweiterung des Verhaltensrepertoires. (c) Veränderung des emotionalen Erregungszustandes. (d) Auslösender Effekt. (e) Umgekehrt wirkt Imitation auch auf das Modell zurück: Imitiertes Verhalten führt tendenziell dazu, dass das Modell dieses Verhalten häufiger ausführt. Bandura betonte nach seiner Distanzierung zum Behaviorismus, dass zwischen der Anregung eines Verhaltens durch ein Modell und der Ausführung dieses Verhaltens kognitive Prozesse stattfinden. Dies ermöglicht auch die Selbststeuerung von Verhalten durch (a) präzise Selbstbeobachtung, (b) Bewertung des eigenen Verhaltens nach selbstfestgelegten (aber realistischen, sonst kann es zu Lernstörungen kommen) Leistungsstandards und (c) Selbstbestimmung von Verhaltenskonsequenzen (Selbstbelohnung, Selbstbestrafung). Mit Bandura vollzieht sich ein Wechsel von einer Orientierung am Paradigma des Verhaltens hin zum Paradigma des Handelns. Behaviorismus Paradigma des Verhaltens Weitestgehend außengesteuert Eher deterministische Ausrichtung Nützlich für die Vorhersage von Verhaltensweisen Sozial-kognitive Lerntheorie Paradigma des Handelns Weitestgehend innengesteuert Eher emanzipatorische Ausrichtung Nützlich für die Erklärung von Wahrnehmungsprozessen, Entscheidungsprozessen und höheren kognitiven Prozessen Lehrer sind exponierte Modelle mit hohem Beeinflussungspotenzial: (a) Sie haben einen hohen Status (Expertenwissen, Sanktionsmacht). (b) Sie bauen i. d. R. eine emotional tragfähige Beziehung zu den Schülern auf. (c) Sie sind viele Stunden täglich mit den Schülern zusammen und für den einzelnen gut sichtbar. Relevanz im Unterricht: Emanzipatorische Aufklärung über Modellwirkung z. B. des Fernsehens oder von Computerspielen. Problematisierung der Darstellung von Gewalt. Typische Beispiele: Anstieg von Gewalttätigkeiten nach Boxveranstaltungen, Anstieg der Selbstmordraten nach Veröffentlichungen über Suizide, Imitationseffekte bei Berichten über Flugzeugentführungen oder Randale in Vorstadtsiedlungen. TV ist zwar nicht der einzige Faktor, aber Johnson et. al. (2002) wiesen nach, dass es einen statistisch bedeutsamen Zusammenhang zwischen TV-Konsum von 14-Jährigen und späterer Gewalttätigkeit gibt. A – 4: Theorien des kognitiven Lernens A – 4 – 1: Lernen durch Einsicht (Quelle: GK Psychologie 2000/01) Die Theorie des Lernens durch Einsicht geht auf die Schule der Gestaltpsychologie (z. B. Köhler) zurück, die sich vom Behaviorismus und der Assoziationspsychologie abgrenzte. 9 Die Lösung eines Lernproblems erfolgt plötzlich, durch einen Einfall. An Thorndike und den Bahavioristen kritisieren die Gestaltpsychologen der Berliner und Leipziger Schule, dass bereits ihre Versuchsanordnung ihre Ergebnisse vorgeben: Die Aufgaben, die die Hunde und Katzen bekamen, gingen so weit über ihre geistigen Fähigkeiten hinaus, dass ihnen nichts anderes übrig blieb als das Trial-and-error-Verfahren. Die Zusammenhänge des Versuchsaufbaus waren für die Tiere nicht zu überblicken. Die Gestaltpsychologen verwendeten hingegen in Experimenten Affen, die Aufgaben bekamen, die für sie aus Einsicht lösbar waren. (Die Affen mussten eine Kiste auf eine andere stellen und darauf steigen, um zu einer Banane zu gelangen. Dies konnten sie aufgrund von Überlegungen und Einsicht bewältigen.) Charakteristika für das Lernen durch Einsicht: (a) Überschaubare Problemkonstellation: Die Problemsituation muss so beschaffen sein, dass die Situation überschaut werden kann. (b) Ist erst ein Einfall zur Lösung eines Problems vorhanden, so kann die Lösung sofort wiederholt werden. (c) Der Lernerfolg stellt sich nicht graduell ein wie beim assoziativen Lernen, sondern plötzlich und meist nach einer Phase des Nichthandelns (Inkubation). (d) Eine durch Einsicht erfolgte Lösung kann auch in neuen, veränderten Situationen wieder angewendet werden. Was gelernt wird, ist nämlich nicht ein bestimmter Handlungsablauf, sondern eine kognitive Struktur, die z. B. den Zusammenhang von Hilfsmitteln und strategischer Einsetzbarkeit aufweist. A – 4 – 2: Kognitives Lernen / Formen von Wissensrepräsentationen (Quelle: Edelmann S. 220-238) Kognitive Lerntheorien beziehen sich – im Gegensatz zu behavioristischen Lerntheorien – auf Abstraktionen und Repräsentationen, also Phänomene, die nicht direkt erfassbar sind. Im Zentrum jeder kognitiven Lerntheorie steht als Ziel der Aufbau einer kognitiven Struktur. Def. Repräsentation von Wissen: (a) Objekte aus der Umwelt werden im Bewusstsein entweder als konkrete Einzelfälle oder als Klasse ähnlicher Erscheinungen dargestellt bzw. als innere Wirklichkeit konstruiert. (b) Repräsentation ist eine verbale, bildhafte oder sensumotorische (handlungsmäßige) Begriffsbildung. Arten der Repräsentation von Wissen: (a) handlungsmäßige oder sensumotorische Repräsentation (entwicklungspsychologisch die erste Phase). (b) bildhafte oder analoge Repräsentation (entwicklungspsychologisch die zweite Phase). (c) aussagenartige oder sprachlich-inhaltliche Repräsentation (entwicklungspsychologisch die dritte Phase). Es gibt drei verschiedene Auffassungen, was zur kognitiven Repräsentation von Wissen zählt: (a) Nur die aussagenartige Repräsentation. (b) Die aussagenartige und die analoge Repräsentation. (c) Die aussagenartige, analoge und die handlungsmäßige Repräsentation. Vor allem die erste Auffasung ist jedoch sehr von linguistischen und strukturalistischen Vorannahmen beeinflusst, die nicht anerkennen, dass man sogar bei reinen Sachaussagen i. d. R. bildhafte oder emotionale Assoziationen hat. Paivio (1979) erklärte die Form der Informationsaufnahme mittels des „Modells der dualen Kodierung“ (Kodierung in zwei alternativen Systemen): Die Verarbeitung geschieht entweder analog-bildhaft (optisch) oder semantischaussagenartig (akustisch). Bei eher konkreten Sachverhalten sind beide Repräsentationsarten möglich und die analog-bildhafte wahrscheinlicher. Bei abstrakten Sachverhalten sind semantisch-aussagenartige (also begrifflich vermittelte) wahrscheinlicher. Zur aussagenartigen Repräsentation (Vgl. A – 5 – 2 – 2!): (a) Die Theorien zur aussagenartigen Repräsentation gehen davon aus, dass sich semantische Netze bilden. (Netzwerkmodelle). (b) „Modell der modifizierten Begriffshierarchie“: Jeder Begriff wird in ein System von Ober- und Unterbegriffen eingeordnet, wobei bei jedem Begriff nur die speziellen Charakteristika gespeichert werden, während die allgemeinen Charakteristika ausschließlich mit dem Oberbegriff verbunden werden. (z. B. Lachs: rosa, essbar / Fisch: hat Flossen und Kiemen, kann schwimmen.) 10 (c) Die LNR-Theorie (Lindsay-Norman-Rumelhart) der propositionalen Netzwerke: Die Abspeicherung und kognitive Repräsentation von Episoden geschieht über die Zerlegung in mehrere und nicht weiter zerlegbare Einzelereignisse (= kleinste Bedeutungseinheit oder Proposition) und zusätzlich durch die Speicherung z. B. kausaler oder temporaler Verknüpfungen. Die Speicherung erfolgt in vollkommen abstrakter Form. (d) Solche Propositionen werden in manchen Theorien auch zu hierarchischen Schemata oder (und in diesem Fall unter Aufnahme sensumotorischer Repräsentationsformen) zu „Handlungsskripts“ verdichtet. (e) Kritik an diesen Theorien der propositionalen Netzwerke: 1. Eine einseitige aussagenartige Orientierung kann zu mechanischem Lernen führen. Hier käme der (auf die Pegnitzschäfer des 17. Jhdts. zurückführbare) „Nürnberger Trichter“ (schulmeisterliches Eintrichtern) zur Anwendung. 2. Sie gehen lediglich von einer einheitlichen (und keiner dualen oder multiplen) Repräsentation aus. 3. Folglich ist sie einseitig ausgerichtet an der aussagenartigen Repräsentation und berücksichtigt nicht (oder kaum) bildliche oder sensumotorische Repräsentationsaformen. (f) Die Stärke der aussagenartigen Repräsentation liegt z. B. in der leicht herstellbaren linearen Ordnung von Begebenheiten in zeitlicher Folge oder im logischen Denken. Zur bildhaft-analogen Repräsentationsform: (a) Zwischen der äußeren Erscheinung und der inneren Repräsentation besteht eine bestimmte Ähnlichkeit. Letztlich handelt es sich jedoch bereits um eine mehr oder weniger realistische Interpretation der ursprünglichen Erscheinung. Es handelt sich um konkret-anschauliches Denken. (b) Die Stärke der bildhaft-analogen Repräsentation liegt in der Verarbeitung und Speicherung von räumlich angeordneten Dingen oder in der Gestaltung kreativer Prozesse. Für schlussfolgerndes Denken ist diese Repräsentationsform weniger geeignet. Zur handlungsmäßigen Repräsentation: (a) Dabei handelt es sich um die Kodierung motorischer Fähigkeiten, wie z. B. beim Schreibenlernen: Zunächst werden Einzelbewegungen kognitiv kodiert und einzeln abgerufen (was sich in einem stockenden Schreibfluss manifestiert), dann geschieht dies mit komplexeren Bewegungsformeln. (b) Es kann sich auch um den Erwerb von Sachwissen durch handelnden Umgang handeln, z. B. Gemüsepflanzen, Kochen, Unterrichtsversuch eines Praktikanten, um „Lehren“ praktisch zu erlernen. Auch beim Erwerb praktischer und professioneller Kompetenzen spielt die handlungsmäßige Repräsentation eine Rolle. (c) Zur Anwendung im Unterricht: „Engagement“ und „Zivilcourage“ können nicht ausschließlich aussagenmäßig oder bildhaft-analog erlernt werden. Konsequenzen aus der Unterscheidung kognitiver Lernformen: (a) Eine lernpsychologisch rein aussagenmäßig vermittelte Unterrichtspraxis führt zu einer defizitären Form von Lernen. (b) In der Unterrichtspraxis wirken Formen der multiplen Repräsentation (Mehrfachkodierung) besonders lernfördernd. Dabei werden beide Hirnhälften aktiviert. Durch gleichzeitige oder sukzessive Mehrfachkodierung werden Gegenstände präziser und vollständiger erfasst und sind in höherem Maße löschungsresistent. (Auch Comenius und Pestalozzi forderten dies schon.) Bilder als Mustervorlage für Prozesse des bildhaft-analogen Repräsentierens haben folgende Auswirkungen: (a) Steigert die Motivation, erregt Neugier. (b) Löst Emotionen aus. (c) Sie steuern die Aufmerksamkeitszuwendung. (d) Sie dienen der Veranschaulichung und Exemplifizierung. (e) Sie reichern Texte durch ihre assoziative Elaboration an. (f) Sie unterstützen die Anordnung und Organisation komplexer Zusammenhänge. (g) In Tests konnte allerdings auch nachgewiesen werden, dass sie bei übermäßiger Anwendung die Prozesse des Lesenlernens verlangsamen. Ähnliches dürfte für rationale Denkprozesse gelten. Erfolgreiches Lernen liegt dann vor, wenn die Struktur einer äußeren Präsentation in eine adäquate innere Repräsentation übergeführt worden ist. Der Wissenserwerb ist gekennzeichnet durch aktive und subjektive mentale Strukturierungsprozesse. Ziel des Lernens ist nicht die Addition isolierter Wissensbestände, sondern eine mentale Vernetzung. Für die Gestaltung des Unterrichts bedeutet dies, dass es ein wesentliches Lernziel darstellt, zwischen Wissensinseln Brücken zu bauen und eine freie Navigation im mentalen Netz zu ermöglichen. 11 A – 4 – 3: Transfer (Quelle: HPP S. 721-729) Def. „Transfer“: Erfolgreiche Anwendung angeeigneten Wissens oder einer Kompetenz bei einer noch nicht vorgekommenen kognitiven Anforderung. Dichotomische Klassifizierungen von Transferleistungen: (a) Horizontaler Transfer (Anwendung einer Kompetenz / eines Wissens auf eine Aufgabe gleicher Komplexität) Vertikaler Transfer (Anwendung einer Kompetenz / eines Wissens auf eine Aufgabe größerer Komplexität) (b) Spezifischer Transfer (Erworbene/s Kompetenz / Wissen wird direkt in anderer Situation angewendet Unspezifischer, genereller Transfer (Die Kompetenz des Kompetenz- oder Wissenserwerbs wird in einer anderen Situation angewendet) (c) Low-road-transfer erfordert wenig bewusste Anstrengung Highroad-transfer erfordert aktive Einarbeitung in ein Problem. Horizontale, spezifische und Low-road-Transfers sind proximale (naheliegende) Transfers Vertikale, unspezifische und High-road-transfers sind distale (weitreichende) Transfers, besitzen also eine höhere Qualität. Thorndikes „Theorie der identischen Elemente“: Identische Inhalte oder identische Vorgehensweisen sind unabdingbare Voraussetzungen für Transferleistungen. Unabdingbar sind einzelne, aber identische Stimulus-ReaktionsElemente. Thorndike plädiert für ein praxisnahes Problemlösen, fasst aber nur proximale Transfers ins Auge. Ähnlich ist das Konzept des situierten (realitätsnahen) Lernens: Authentische Problemkonstellationen erhöhen die Motivation zu Transferleistungen. Aber auch hier werden nur proximale Transfers anvisiert. Ein distaler Transfer hingegen bedarf einer Dekontextualisierung erworbener Handlungsschemata. Judds „Theorie der Übertragung von Prinzipien“: Lösungsprinzipien und Regeln besitzen ein hohes Abstraktionsniveau und eine hohe Nutzungsflexibilität und können somit auf viele Fälle angewendet werden. Wichtig ist dieser Strategie die Vermittlung von Regelwissen, prozeduralem Wissen und eine passende Strategievermittlung. Theorie des Transfers durch metakognitive Kontrolle: Bewusste Steuerung und Regulation des Lernens. Als entscheidend für das Auftreten von Transferleistungen werden metakognitive Prozesse angesehen, wie z. B. ein Problem erfassen, einen Lösungsplan erstellen, sukzessive Problembewältigung, Ergebnisverifizierung. Wichtig ist bei dieser Theorie die Vermittlung sowohl von konkretem (materialem) Wissen, als auch von metakognitiven (formalen) Problemlösungsstrategien. (Metakognition kann z. B. durch verbale Selbstinstruktion eingeübt werden.) Um nachhaltige Transfererfolge zu erzielen, sollten Elemente aus allen drei Theorien aufgenommen und integriert weden. Systematische Variation beim Üben und Problemlösen steigert in der Regel Transferleistungen. Transfer bedarf sowohl in der Aneignungs-, als auch in der Anwendungsphase einer hohen und möglichst intrinsischen Motivation. Diese hängt von der Selbstaktivierung und der Selbstkontrolle eines Individuums ab und erfordert selbstgesteuertes Lernen. Negative Nebenwirkungen im Zuge von Transferleistungen sind eher selten, können aber in der Übergeneralisierung neuer Kenntnisse oder in einer (vorübergehenden) Deautomatisierung von effektiven Handlungsroutinen oder in Interferenzen von Wissensbeständen liegen. A – 4 – 4: Problemlösen (Quelle: Edelmann, S. 313-323) Def.: Unter Problemlösen werden Denk- und Handlungsprozesse verstanden, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie ein Ziel anstreben, das aufgrund von Hindernissen bzw. Barrieren (Verfahrensunklarheit, Ausgangslagenunklarheit, Ergebnisunklarheit) auf direktem Weg nicht erreichbar ist. Unterscheidung von Problemlösen und Aufgabenlösen: Problemlösen Methode und konkrete Vorgehensweise zunächst unbekannt Heuristische Problemlösungsstruktur ist entscheidend (Allgemeine Strategien) Produktives Denken Aufgabenlösen Methode oder Operationalisierungsverfahren (Algorithmus) ist bekannt Epistemische Wissensstruktur ist entscheidend (Wissen, Begriffe, Regeln) Reproduktives Denken Strategien des Problemlösens: (a) Versuch- und Irrtum (b) Problemlösen durch Umstrukturierungen (bzw. gestaltpsychologisch: Problemlösen durch Einsicht. Suchen nach Lösungen mit einer einfachen, prägnanten Gestalt). Vgl. die Gaus´sche Additionsaufgabe! 12 (c) Eliminierung störender oder irrelevanter Einflüsse in der Problemkonstellation. Präzisierung und Vereinfachung des Problems. Systematische Reduktion von Komplexität. Auflösung in wenige und dafür handhabbare Parameter. (d) Übersichtliche Anordnung des vorhandenen Wissens und der vorhandenen Methoden erstellen. (e) Problemlösen durch Anwendung bestimmter Strategien (wie z. B. beim Schach). In der Schule ist das Einüben des Problemlösens wichtig. Handlungsmäßige Repräsentation von verschiedenen Strategien der Problemlösung. Evaluation von Problemlösungsfortschritten: Der Übungseffekt zeigt sich in der Verkürzung der Problemlösungszeiten. Bei einem Lernfortschritt werden aus Problemlösungsprozessen einfache Aufgabenlösungsprozesse. A – 4 – 5: Kreativität und Problemlösen (Quelle: Edelmann, S. 323-328) Es gibt verschiedene Niveaus von Kreativität: Situationsspezifische Einfälle; Kekule´s Entdeckung der Strukturformel des Benzolrings; Einsteins Relativitätstheorie etc... Kreatives Problemlösen ist eine besonders anspruchsvolle Form des Denkens, sie ist eine „harte Arbeit“. Kreatives Denken ist zumeist ein Zusammenspiel von konvergentem Denken (reproduktives, konventionelles Denken) und divergentem Denken (produktives, originelles, unorthodoxes Denken). Kreativität bringt einerseits einen Nutzwert hervor (z. B. in einem Unternehmen), andererseits trägt es auch zur Persönlichkeitsförderung bei (in der Schule sehr wichtig). 2 unterschiedliche Positionen zur Kreativität (a) Kreativität ist der durch Inspiration gewonnene Einfall einer kreativen Persönlichkeit. (b) Kreativität ist die originelle Nutzung einer reichen und hochwertigen Wissensbasis. Phasen des kreativen Problemlösens: (a) Problematisierung: Erkennen eines Problems oder einer Wissenslücke. Schwache oder eingefahrene Lösungen in Frage stellen. Lösung von Fixationen. Präzise Fragestellung erarbeiten. (b) Exploration: Erforschen des Problemfeldes aus verschiedenen Perspektiven. Umstrukturierungen mit den bisherigen Wissensbeständen vornehmen. Alternative und ggf. auch widersprüchliche Erklärungsversuche heranziehen. Hypothesenbildung. (c) Inkubation: Beiseitelegen des Problems. Aber: Unbewusste Prozesse bereiten die Problemlösung vor. Dabei ist allerdings vorausgesetzt, dass bereits intensive Problematisierungs- und Explorationsprozesse abgelaufen sind. (d) Inspiration / Illumination: Subjektiv ist dies das Erlebnis spontan auftauchender Lösungsmöglichkeiten. Diese bedürfen dann einer Bewertung. Auswahl der aussichtsreichsten Lösungsidee. (e) Verifikation und Elaboration: Systematische Ausarbeitung der Lösung. (f) Diffusion: Weitere Verarbeitung der kreativen Lösung. Neuronale Vernetzung fördern. Ggf. Übertragen auf andere Wissensbereiche. Faktoren, die eine kreative Persönlichkeit besonders kennzeichnen nach Guilford (1950): (a) Fähigkeit zur Entdeckung und Identifizierung von Problemen. Erkennen von Aporien und Wissenslücken. (b) Infragestellen von Gewohnheiten und herkömmlichen Denk- und Verfahrensweisen. (c) Überdurchschnittliche Frustrationstoleranz und Hartnäckigkeit. (d) Fähigkeit zur spielerischen Produktion von Einfällen. Originalität. (e) Flexibilität und Fähigkeit zur Neuorganisation von Erfahrungen und Wissen. (f) Gespür für aussichtsreiche Lösungswege und -ansätze. (g) Breit gestreutes, gründliches und gut vernetztes Wissen. (h) Fähigkeit, gefundene Lösungen kommunizierbar zu machen. Methoden des kreativen Denkens sind z. B. das Brainstorming und die versch. methematischen Verfahren. Hemmende Faktoren für kreatives Problemlösen: (a) Mechanistische, bürokratische Arbeitsatmosphäre. (b) Strikte Orientierung an konventionellen Problemlösungsansätzen. (c) Risikolosigkeit und unbedingtes Vermeidenwollen von Misserfolgen. 13 A – 5: Gedächtnis- und Wissenspsychologie A – 5 – 1: Allgemeine Psychologie des Lernens A – 5 – 1 – 2: Lernen als kognitiver Prozess (Quelle: Monikas Exzerpt zu Lukesch / Prof. Schneider VL) Es gibt zwei Klassen von Lerngegenständen: (1.) Lernbare und (2.) Nicht lernbare (z. B. feste Reaktionstendenzen, Reifungsvorgänge, Prägungsvorgänge, vorübergehende organische Zustände Siehe unter: A – 5 – 1 – 3!). Verhaltensweisen können also (1.) lernbar sein, (2.) pränatal erlernt worden sein oder (3.) genetisch festgelegt sein. Im konkreten Verhalten wirken genetische Faktoren und Umwelteinflüsse zusammen. Die genetischen Faktoren machen Lernen möglich und beschränken es. Lernen Anpassung an die Umwelt Variabel und anpassungsfähig Erbkoordinationen (Instinkthandlungen) Abgespeicherte phylogenetische Erfahrungen Starr und unvariabel A – 5 – 1 – 1: Verhaltensorientierte Lerndefinitionen / Lernen von Verhalten Def. Verhalten: Dazu gehören (1.) motorische Verhaltensweisen und (2.) interne Zustände (Gefühle, Veränderungen in der kognitiven Struktur etc...). Entscheidend sind die Performanzmerkmale und die Kompetenzmerkmale. Def. „Lernen von Verhalten“: Vorgänge, Prozesse oder nicht beobachtbare Veränderungen im Organismus, die durch Erfahrungen entstehen und zu einer Veränderung des Verhaltens führen. Lernen kann als Prozess beschrieben werden, durch den ein Organismus sein Verhalten als Resultat von Erfahrung verändert. Es handelt sich um eine Veränderung im Verhalten, nicht um Veränderung der physischen Eigenschaften. Lernen resultiert aus denjenigen Erfahrungen mit der Umwelt, durch die Beziehungen zwischen Reizen und Reaktionen hergestellt werden. Sehr unterschiedliche Lernphänomene: (a) bewusstes Lernen (sozial erwünscht oder unerwünscht) (b) unbewusstes Lernen (sozial erwünscht oder unerwünscht) Def. „Kognitives Lernen“: Prozess der Informationsaufnahme, -bearbeitung, speicherung und -wiedergabe entweder aufgrund von externer Anregung, oder aufgrund von eigenintitativem Denken. Bei der Information kann es sich um deklaratives oder um prozedurales Wissen handeln. Denken ist... (a) ...eine interpretierende, ordnungsstiftende Verarbeitung von Informationen (b) ...eine Verknüpfung kontextueller Informationen mit anderen Gedächtnisinhalten (c) ...ein gezieltes Produzieren von Verständnis, Erinnerungen, Analysen, Abstraktionen etc... (d) ...in Raum und Zeit beweglich (e) ...Vorbedingung für jeden Lernprozess Zum Zusammenhang von Lehren und Lernen: Def. „Lehren“: Lehren ist ein gezieltes Herbeiführen von Erfahrungen, die Lernprozesse bei Lernenden auslösen. Dies kann (a) direkt ausgeführt werden durch eine Lehraktivität eines Lehrers oder (b) indirekt ausgeführt werden durch die Bereitstellung einer Lernumgebung, die zu Lernprozessen anregen soll. A – 5 – 1 – 3: Vom Lernen abzugrenzende Verhaltensweisen / Anpassungsmodi Angeborene Reaktionstendenzen: Der Organismus kommt bereits mit einem angeborenen Verhaltensrepertoire auf die Welt. Vgl. unbedingte Reflexe (gleichbleibende und automatische Reaktionen auf bestimmte Reize). Ablauf dieser angeborenen Reaktionstendenzen: Rezeptor Afferenz (Nerv) Zentrale Synapse (Rückenmark) Efferenz (Nerv) Effektor (Muskel). Beispiel: Reflexartiges Zurückziehen der Hand von der Herdplatte. Automatismen: Körper und Gliedmaßen sind rhythmisch koordiniert bei Wirbeltieren. Beispiel: Armbewegungen beim Menschen. Erbkoordinationen, Instinkthandlungen: angeborene, artspezifische Verhaltensweisen. Sie sind eine komplizierte Kette von Einzelhandlungen. Ablauf: (a) Stimmung (körperlich bedingte innere Bereitschaft, Drang, Trieb, ausgelöst durch innere physiologische Zustände wie Hunger oder durch Hormone) 14 (b) Appetenz (Aufsuchen einer Situation, in der die Reize auftreten) (c) Schlüsselreiz (nur best. Merkmale sind Auslöser) (d) Reaktion. Wenn eine Instinkthandlung länger nicht mehr ausgelöst wurde, erniedrigt sich die Reizschwelle aufgrund von Erregungsstau. Übersprungshandlung: Instinkthandlungen ohne Zweckmäßigkeit und Sinn. Prägung: Sie findet nur in Phasen gesteigerter Emotionalität statt, ist eine mehr im Unbewussten ablaufende Variante des Modell-Lernens. Die Prägung weist eine hohe Löschungsresistenz auf. Reifung: Verhaltensänderungen, die aufgrund von physiologischen Veränderungen (neuronale, motorische, körperliche Reifung, aber auch Gedächtnisentwicklung) möglich werden. Reifungsvorgänge werden sofort durch Lernprozesse vervollkommnet. Vorübergehende organische Zustände (Ermüdung Leistungsabnahme / Gewöhnung, Habituation Abnahme der Wahrnehmungs- und Aufnahmebereitschaft / Drogenkonsum ) A – 5 – 2: Wissen (Quelle: Edelmann, S. 239-246 / Psycho-VL) einer Korrektur des Vorwissens und zu einer Angleichung des Vorwissens an das neuerworbene Wissen. (c) Finden weder Assimilations-, noch Akkomodationsprozesse statt, dann spricht man von mechanischem Lernen, also purem Auswendiglernen. Dieses Wissen ist kaum löschungsresistent, kann kaum auf vorhandenes Wissen bezogen werden und es ist fraglich, ob hier überhaupt von Wissenserwerb gesprochen werden kann. Bsp.: Lernen von Paar-Assoziationen im Fremdsprachenunterricht oder von isolierten Jahreszahlen im Geschichtsunterricht. Wissenserwerb und Begriffsbildung stellen zumeist nicht ein Erlernen eines völlig Neuen dar, sondern sind viel eher ein Umlernen. Korrektur oder Präzisierung alter Strukturen. Versch. Formen des Wissenserwerbes: (a) Sinnvolles Lernen: Inhaltliches und nicht wortwörtliches Lernen, Bezug zu bisherigem Wissen. (b) Rezeptives Lernen: Das Lernmaterial wird dem Schüler in relativ fertiger Form dargeboten. Es wird kein selbständiges Entdecken von Wissen, sondern nur Rezeption gefordert. Das kann sowohl sinnvoll, als auch mechanisch sein. (c) Entdeckendes Lernen: Der Hauptinhalt dessen, was gelernt werden soll, ist nicht vorgegeben, sondern muss vom Schüler entdeckt werden. A – 5 – 2 – 1: Charakteristiken von Wissen 4 Grundarten des Lernens nach Ausubel: Das wesentliche Merkmal des Lernens und der Wissensaufnahme ist die Erfahrungsbildung, die sozial (z. B. durch Lehrer) oder unmittelbar (z. B. durch ein Buch) vermittelt worden ist. Prototypen des schulischen Wissenserwerbes: (a) Frontalunterricht: Austausch von Informationen. (b) Offener Unterricht: Interaktion mit einer didaktisch aufbereiteten Umwelt. Es kommt zu unmittelbaren Erfahrungen und zu entdeckendem Lernen. Beim Wissenserwerb können verschiedene Prozesse stattfinden: (a) Assimilationsprozesse: Ein neuer Lernstoff wird mit bereits vorhandenen kognitiven Strukturen verbunden. Es kommt zur Verankerung der neuen Informationen im Vorwissen und dadurch zu einer Präzisierung des Vorwissens. (b) Akkomodationsprozesse: Durch einen neuen Lernstoff kommt es zur Veränderung der eigenen Denk- und Wissensstrukturen. Es kommt zu Mechanisch Mechanisches Lernen von dargebotenem Lernstoff Sinnvoll Dargebotener Lernstoff wird sinnvoll Rezeptiv in bisherige Wissensbestände integriert (von Ausubel favorisiert) Ein vom Lernenden Ein vom Lernenden entdeckter Entdeckend entdeckter Sachverhalt wird Sachverhalt wird sinnvoll in bisherige mechanisch gelernt Wissensbestände integriert (von Bruner favorisiert) Zu sinnvoll-rezeptivem Lernen nach Ausubel: (a) Advanced organization: Zentraler Lerninhalt soll am Anfang kurz zusammengefasst werden. Förderung der Lernprozesse. (b) Interaktion von bereits vorhandenem Lernstoff mit dem neuen Lernstoff. 15 (c) Prinzip: Der für das Lernen wichtigste Faktor ist das, was der Lernende bereits weiß. Dies gilt es zu ermitteln und danach soll unterrichtet werden. Sinnvoll-entdeckendes Lernen nach Bruner: (a) Ermöglichung von Transfer im Unterricht. (b) Entwicklung von Techniken des Problemlösens. (c) Förderung von intuitivem Denken (Lernen durch Einsicht). (d) Förderung der intrinsischen Motivation. (e) Auslösen kognitiver Konflikte (z. B. durch unerwartete Effekte), um Neugier zu erregen. Lernen durch Explorieren und Experimentieren. (f) Lernen durch Beispiele, induktives Denken (g) Verwendung von Beispiel-Regel-Sequenzen (statt Regel-Bsp-Sequenzen). „Kognitive Strukturen“ hat verschiedene Bedeutungsaspekte: (a) Die Binnenstruktur von Wissenselementen (z. B. Struktur von einzelnen Begriffen oder Propositionen). (b) Zusammenhang mehrerer Teilstrukturen. (c) Gesamtheit aller kognitiven Strukturen eines Menschen. Die kognitiven Strukturen sind keine Abbilder der Umwelt, sondern lediglich ähnliche (und in neuronalen Denkprozessen kodierte) Konstruktionen. Alltagswissen zeichnet sich in der Regel durch ein mittleres Differenzierungsniveau aus, das sich auch als am praktikabelsten und am nützlichsten erweist. Spezielles Detailwissen ist in vielen Alltagssituationen nicht nötig. Außerdem sind die Wissensbausteine des Alltagswissens praktisch besser operationalisierbar. Alltagswissen ist das Wissen des gesunden Menschenverstandes und von Selbstverständlichkeiten. Expertenwissen bzw. professionelles Wissen zeichnet sich dadurch aus: (a) Es ist detailreicher und ein besser und präziser strukturiertes Wissen mit einem höheren Differenzierungsgrad. (b) Es ist situations- und anforderungsspezifisch flexibel abrufbar. (c) Es ist ein Wissen in einem bestimmten Teilbereich. (d) Es ist (wie das Alltagswissen) ein weitestgehend verinnerlichtes Wissen. Zusammenfassung: Wissen (1) entsteht durch unmittelbare oder sozial vermittelte Erfahrung, (2) geschieht auf dem Weg von Assimilations- oder Akkomodationsprozessen, (3) bildet sich in einer kognitiven Struktur aus, (4) wird letztlich oft multipel repräsentiert, (5) ist selten linear-propositional und häufiger multipel vernetzt, (6) (7) (8) (9) hat seinen Verwendungszweck im Alltag oder in einer Profession, erlangt auf intuitivem oder rational-analytischem Weg Bewusstheit, kann zum Problemlösen herangezogen werden und ist auch mit Emotionen und Motivationen vernetzt. A – 5 – 2 – 2: Begriffslernen Begriffslernen ist die Verankerung von Begriffen im Semantischen Gedächtnis des LZG („neue Maschen einfügen“) Netzwerk-Modell. Die klassische Theorie des Begriffslernens geht davon aus, dass wir ohne die Möglichkeit zur Kategorisierung (abstrahieren von den Besonderheiten des Einzelfalls und ordnen unter gemeinsame Eigenschaften) hoffnungslos überfordert wären. Hierarchisch strukturiertes Netzwerk zur Repräsentation von Begriffen. Einspeicherung vollzieht sich nach dem Prinzip der kognitiven Ökonomie. Begriffsbildung: Eine Person bildet eine Kette von Hypothesen, die induktiv oder deduktiv entstanden sind und nacheinander abgetastet werden. Die Bildung von Begriffen ist i. d. R. kein völliges Neulernen, sondern ein Umlernen von bereits vorhanden Begriffen. Der Schulbesuch ist der mächtigste Faktor der Begriffsbildung (aktiver Wortschatz mit 6 Jahren etwa 2000-2500 Wörter, danach rasanter Anstieg, passiver Wortschatz zudem oft 10-mal größer!). Wissenserwerb als Lernen von Regeln: Ansatz von Gagné: Regeln sind eine Kette von Begriffen. Jüngere Kinder können meist nur einfachere Regeln lernen, weil sie über eine geringere Anzahl von Begriffen verfügen. Ein solches Lernen geschieht meist durch verbale Instruktion, in der der Aufbau der ganzen Begriffskette erklärt wird (z. B. bei Lernen der Abseitsregel). Die merkmalssemantische Theorie der Begriffsbildung: (a) Begriffe werden nicht isoliert erworben, sondern in Begriffshierarchien geordnet. Es gibt Ordnungsbegriffe, d. h. Kategorien oder Klassen. (b) Merkmale, die die Klassenzugehörigkeit ausmachen, nennt man kritische Attribute. (1.) Affirmation: Nur ein kritisches Attribut ist vorhanden, z. B. Sitzfläche für Sitzmöbel, (2.) Konjunktion: Zwei oder mehr kritische Attribute sind vorhanden, z. B. männlich und kinderhabend für Vater, (3.) Disjunktion: Entweder eines oder ein anderes kritisches Attribut ist vorhanden, z. B. Regen oder Schnee für Niederschlag. 16 (4.) Kondition: Ein kritisches Attribut schließt ein anderes mit ein, z. B. Wahlberechtigung Volljährigkeit. Von Begriffsbildung spricht man dann, wenn Objekte zu einer (subjektiv neuen) Kategorie zusammengefasst werden. Unter Begriffsidentifikation versteht man das Erkennen eines Objekts als Bestandteil einer (bereits vorhandenen) Kategorie. Prototypentheorie der Begriffsbildung (Rosch): (a) Sie ergänzt die merkmalssemantische Theorie der Begriffsbildung. (b) Sie geht davon aus, dass gerade alltagssprachliche Begriffe durch zwei Tatsachen gekennzeichnet sind: Vagheit / Unschärfe und Kontextabhängigkeit (was eine Tasse, eine Vase oder ein Becher ist, entscheidet sich oft aufgrund des Kontextes: Sind Blumen oder ist Kaffee drin?). (c) Die Begriffsbildung im Alltag erfolgt weniger nach formal-logischen, sondern eher nach pragmatischen Gesichtspunkten. (d) Bei vielen Begriffen wäre eine rein merkmalssemantische Begriffsbildung sehr umfangreich und hätte z. T. auch viele Ausnahmeregeln (z. B. beim Begriff „Vogel“), deshalb ist es praktikabler nach wahrscheinlichen und typischen Merkmalen ( Typikalität) zu unterscheiden. Ein Begriff ist durch wenige charakteristische Merkmale ausgezeichnet, wobei nicht alle Mitglieder diese Merkmale zwingend aufweisen müssen. (e) Begriffe werden in der Form der „besten Beispiele“ (Prototyp, idealer Vertreter, typisches Objekt) abgespeichert. (z. B. Auto für Fortbewegungsmittel, Schwalbe für Vogel etc...) Begriffe haben einen spezifischen Stärkewert, d. h. Anzahl der assoziativen Beziehung zu anderen Begriffen. („dicke oder dünne Knoten im Netzwerk“) Begriffe können auch unterschiedlich stark miteinander verbunden sein. Propositionale Netzwerke: Ist an der Valenz-Grammatik orientiert: Verb steht im Mittelpunkt der Satzanalyse, hat Valenzen, eröffnet best. Leerstellen etc... Alltags- oder Beschreibungsbegriffe (oft auf subjektive Weise verwendet) wissenschaftliche Begriffe (bestehen aus einer Kategorie und zusätzlich aus einer erklärenden Theorie, z. B. Aggression, Motivation, Kapitalismus) Z. B. Mondfinsternis als Beschreibungsbegriff (aufgegangener Mond scheint nicht) und als wissenschaftlicher Begriff (Erde deckt Sonnenstrahlen so ab, dass der Mond diese nicht auf die Erde reflektieren kann, eingebettet in die Theorie der kreisförmigen Planetenbewegungen). A – 5 – 3: Gedächtnis und Gedächtnisprozesse (Quelle: Monikas Lukesch-Exzerpt & Inés´ Lefrancois-Exzerpt) Def. Gedächtnis: Das Gedächtnis ist der Ort der Speicherung ontogenetisch erworbener Informationen, die sich in die neuronalen Strukturen so einfügt, dass sie wieder abgerufen werden können. Es ist die Grundvoraussetzung für ein Erkennen der Welt, für Planen, Denken, Problemlösen etc... Gedächtnis ist der Eindruck, den die Erfahrung hinterlässt. Es gibt im Gedächtnis nichts, was nicht gelernt worden ist. Als erster unterschied James (1890) zwischen einem primären Gedächtnis (~ Kurzzeitgedächtnis) und einem sekundären Gedächtnis, das nur durch einen konkreten Willensakt und durch Aufmerksamkeit aktiviert werden kann. Übersicht über das Mehrspeichermodell des Gedächtnisses: Eingang der Info Aufrechterhalten der Info UKZG präattentiv --- Art der Darstellung Kopie des Inputs der Info Verlust der Info Zerfall Spurdauer Suche bis 0,3 sek, maximal bis 2 sek ablesen Kapazität Niveau der Verarbeitung groß Keine Verarbeitung KZG erfordert Aufmerksamkeit dauerhafte Aufmerksamkeit und Wiederholen phonemisch, evtl. visuell oder semantisch Verdrängung oder ein Vorfall bis 30 sek. automatisch, Items sind im Bewusstsein klein Niedriges Niveau LZG erfordert Wiederholen Wiederholen und Organisieren semantisch, auch auditiv und visuell kaum Verlust, aber Verlust an Zugänglichkeit und Unterscheidbarkeit durch Interferenz viele Jahre Suchhinweise, Suchstrategien unterschiedlich Höheres Niveau 17 Biologische Prozesse Fortgesetze elektrochemische Aktivität kortikaler Neuronen, die sich innerhalb einer Schleife aktivieren Langanhaltende Veränderung der neuronalen Bahnung / Synthese von Proteinen Es handelt sich beim Mehrspeichermodell (oder Doppelkodierungs-, dual-encoding-, Zweiphasen- oder Two-stage-Modell) nicht um physikalische Strukturen, sondern um eine Abstraktion. Wichtig ist die Trennungslinie zwischen KZG und dem LZG und die zweifach erfolgende Einspeicherung. A – 5 – 3 – 1: Das Ultrakurzzeitgedächtnis im Mehrspeichermodell Andere Begriffe: Sensorisches Gedächtnis, Sensorisches Register. Abkürzung: UKZG). Physikalische Reize Rezeptoren Veränderung des Erregungspotenzials Ankunft im entsprechenden Areal der Hirnrinde. Hier: elektrochemische Kreisprozesse 0,1 – 0,5 sek. Refraktärzeit: Zeit bis zur Ankunft eines neuen Impulses wird durch Aufrechterhalten bzw. kurzzeitige Speicherung des alten Impulses überbrückt. Dadurch kontinuierliche Außenwahrnehmung trotz Diskontinuität der Reizleitung. Mit der Ankunft einer neuen Info aus dem selben Register (für die gleiche Wahrnehmungsart, z. B. optisch) wird die alte Info automatisch überschrieben (optional und durch Aufmerksamkeitsprozesse gesteuert) Weiterleitung ins KZG Ergebnis eines Versuchs: Eine begrenzte Zahl von Reizen bleibt für eine kurze Zeit nach der Präsentation zugänglich, auch wenn ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Vgl. Phänomen der verzögerten Reaktion: Man ist mit etwas mental sehr beschäftigt, geht an etwas vorbei und erkennt 2 sek. später, was man da gesehen oder gehört hat. Das UKZG ist sehr begrenzt im Bezug auf die absolute Menge an Infos und auch in Bezug auf die Zeitdauer. Gedächtnisareale des UKZG: (a) Optisches oder ikonisches Gedächtnis: Es werden für maximal 0,5 sek präperzeptionelle oder präkategoriale Informationen „gespeichert“. Eine Informationsselektion ist hier nicht möglich. (b) Echoisches oder auditives Gedächtnis: Merkleistung etwa 2 sek. (c) Taktiles oder haptisches Gedächtnis Funktionen des UKZG: (a) Ermöglichung der Selektion und Bewertung von Reizeinflüssen Nutzen für Erkenntnisprozess. (b) Kontinuierliche Wirklichkeitswahrnehmung. (c) Der Übergang zum KZG ist mit einem Filter geschützt (um vor Überlastung und vor Spam-Infos zu schützen). (d) Erfassen und Einordnen eines Objektes ist hier noch nicht möglich. A – 5 – 3 – 2: Aufmerksamkeit, Informationsaufnahme und der Weg ins Kurzzeitgedächtnis im Rahmen des Mehrspeichermodells Der Übergang ins Kurzzeitgedächtnis wird durch Aufmerksamkeitsprozesse gesteuert: Nur einer begrenzten Anzahl von Tätigkeiten kann gleichzeitig Aufmerksamkeit gewidmet werden (außer bei stark routinisierten Tätigkeiten). Aufmerksamkeit bezieht sich auf Prozesse, die implizieren, dass wir nur einen Bruchteil der Reize wahrnehmen und verarbeiten, die täglich auf uns einwirken. Das, was wir lernen und woran wir uns erinnern, ist zum Großteil ein Effekt der Aufmerksamkeit. W. James: „Die Aufmerksamkeit ist das Behalten eines von vielen miteinander konkurrierenden Objekten oder Gedankengängen im Geiste.“ Anders: Der Organismus ist dann auf einen Vorgang aufmerksam, wenn er sich bewusst ist, dass dieser stattfindet. Die Aufmerksamkeitsspanne ist gleichbedeutend mit dem (aktiven) KZG. Das, was wir für einige Sekunden im Gedächtnis behalten können, ist dasselbe wie diejenigen Dinge, denen wir für diese Zeit unsere Aufmerksamkeit widmen können. (An was momentan nicht gedacht wird, ist, wenn es erlernt worden ist, Teil des LZGs.) Größter Unterschied zwischen KZG und LZG ist die präsentische Bewusstheit. Die Prozesse des KZGs sind relativ leicht zu unterbrechen oder ablenkbar. (LZG ist gegen Störungen unempfindlicher.) 18 Was beeinflusst die Richtung der Aufmerksamkeit? (a) Äußere Faktoren: Intensivität, Neuheit, Unerwartetheit, Attraktivität von Reizen. (b) Innere Faktoren: Aktueller physiologischer und motivationaler Zustand, Vorerfahrungen, Vorwissen, Interessen etc... „Cocktailparty-Phänomen“: In der Disco kann eine Stimme herausgehört werden, nicht mehrere. Aber: Umschalten von einer Stimme auf eine andere ist möglich, z. B. weil da der eigene Name gefallen ist. Erklärungen: (a) Filter-Modell: Es gibt einen einzigen Infokanal mit einem begrenzten Fassungsvermögen. Es kommt zur Auswahl der Informationen aufgrund genereller physikalischer Eigenschaften (Kritik: Visuelle Infos können so nicht getrennt werden. Selektion nicht doch aufgrund semantischer Analysen?). Es gibt einen Mechanismus, der irrelevante Reize gänzlich ausfiltert. Die ausgewählten Stoffe werden dann im KZG analysiert. Will man zwei Unterhaltungen folgen, muss man zwischen den zwei Quellen ständig hin und her wechseln. (nach Broadbent 1958) Experiment von Broadbent: Probanden bekommen über Kopfhörer auf dem rechten und linken Ohr unterschiedliche Gespräche mit. Probanden sollen eine Geschichte miterzählen. Probanden konnten nachher nicht mehr angeben, um was es in der anderen Geschichte ging, ob sich die Sprache der anderen Geschichte geändert hat oder ob das andere Band rückwärts lief. Sie bekamen es nur mit, wenn auf dem anderen Ohr die Tonhöhe manipuliert wurde. (Grobe physikalische Veränderungen werden unterhalb der Bewusstseinsebene wahrgenommen.) (b) Verdünnungs- und Abschwächungsmodell (auch: Filter-AmplitudenModell): Geht z. B. wegen des „Namensnennungseffektes“ von drei Selektionsprinzipien aus: (1.) physikalische Eigenschaften, (2.) Silbenmuster und (3.) Wortbedeutungen. Ständige Analyse aller eintreffenden Reize. Es kommt entweder zu einer sequentiellen oder zu einer simultanen/paralellen Verarbeitung. Prinzip: Die irrelevanten Botschaften werden auf dem niedrigsten Niveau, das zur Unterscheidung nötig ist, geprüft. Die Selektion geschieht aufgrund von Abschwächungsvorgängen. Weiterleitung ins KZG oftmals in reduzierter Form (Nebensächliche Infos wurden weniger vollständig bearbeitet). Es finden also bereits präattentive Analysen statt. (nach Treismann 1964) (c) Modell der flexiblen Ressourcen-Allokation: (vs. sequentielle und vs. simultane Verarbeitungsmodelle!) Es konnte die Bedeutung von scheinbar unbeachteten Stimuli und deren simultane Verarbeitung nachgewiesen werden. Aufmerksamkeit kann – auf verschiedenen Qualitätsniveaus – auf verschiedene Infoquellen verteilt sein. Deshalb geht das Modell von einem Pool kognitiver Ressourcen aus, die entweder willkürlich oder unwillkürlich gesteuert werden. Bei automatisierter Infoverarbeitung ist die Kapazität wesentlich größer als bei willentlich gesteuerter. Aufteilung der Aufmerksamkeit unter versch. Inputreize. Die Selektion der UKZG-Infos wird sowohl durch externe, als auch durch interne Stimuli gesteuert. Die Verarbeitung der Reize wird von den bei der Selektion konkurrierenden Reizen beeinflusst. Die Phänomene, denen Aufmerksamkeit gewidmet wird, stehen vor der Verarbeitung fest. Experiment von Spelke et. al.: Probanden waren zunächst nicht in der Lage gleichzeitig zu lesen und ein Diktat aufzunehmen, aber nach viel Übung schon. Geteilte Aufmerksamkeit ist v. a. dann möglich, wenn sich die beiden Aufgaben genügend voneinander unterscheiden. Zur Bedeutung in der Schule: (1.) Infos auf Nebenkanälen können das Lernen beeinträchtigen. Hier wäre „Ressourcenpolitik“ besser: Zentrierung der Ressource Aufmerksamkeit. Oder: Erst Bewerten der Aufgabenschwierigkeit, dann Mobilisierung der entsprechenden Kräfte (flexibler und ökonomischer Einsatz). (2.) Erregung von Aufmerksamkeit durch Stimuli wie einem lauten Geräusch, durch explizite Hinweise, durch motivational-emotionalen Aufforderungscharakter, durch „kognitive Diskrepanzen“ oder unerwartete Ereignisse. (d) Kognitäts- oder Anstrengungsmodell: Die Menge an Infos, die zu einem Zeitpunkt behalten werden kann, hängt auch von der dazu nötigen Anstrengung ab. Versch. Inputreize können leichter simultan behalten werden, wenn sie z. B. bekannt sind. Je größer die für die Aufmerksamkeit erforderliche Anstrengung ist, desto schwieriger ist es, aufmerksam zu sein. Die Kapazität nimmt mit der Anstrengung ab. (e) Späte-Selektionsmodell (von Deutsch und Deutsch): Selektion erst im KZG. Das KZG nimmt best. sensorische Vorgänge niederschwellig (z. B. nicht als Melodie, sondern als Geräusch) auch dann auf, wenn keine explizite Aufmerksamkeit aufgewendet wird. Echogedächtnis oder sensorisches Gedächtnis. Aber: Nach 18 sek. erinnern sich Vpns an weniger als 10 % der dargebotenen Infos, wenn sie ihnen keine besondere Aufmerksamkeit schenken. 19 A – 5 – 3 – 3: Das Kurzzeitgedächtnis im Mehrspeichermodell Das KZG ist der bewusst aktive Teil des Gedächtnisses und die Schnittstelle nach innen und außen. Das Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis (kurz: KZG) enthält bereits bearbeitetes Material, also z. B. nicht das Schriftbild eines Textes, sondern den Sinn eines Textes, nicht den optischen Reiz eines Schriftbildes, sondern eine Kodierung in abstrakter semantischer Form, weniger häufig in optischer Form. Tests in Englisch konnten zeigen, dass bei schriftlich dargebotenen Buchstaben trotzdem lautlich ähnliche Buchstaben wie T und C, A und H oder B und G bei der Wiedergabe verwechselt wurden! Vgl. Einfluss der aussagenartigen Repräsentationsform im KZG. Die Speicherkapazität ist auf etwa 7 Einheiten begrenzt. Diese Einheiten sind bei Kleinkindern zunächst sehr einfach. Erwachsene können komplexere und besser Vernetzte (abstrahierte) Items abspeichern. Die Inhalte überdauern im KZG etwa 15 bis maximal 30 Sekunden. Dem Vergessen kann durch willentlich gesteuertes Wiederholen der Infos und wesentlich effektiver durch aktive Verarbeitung der Infos durch Verbesserung der Verarbeitungstiefe entgegengewirkt werden. Primacy-Recency-Effekt: Beim Lernen langer Ketten können die ersten und die letzten Einheiten am besten behalten werden, wobei der Recency-Effekt stärker als der Primacy-Effekt ist. Erklärung: (a) Zunächst leerer KZG-Speicher. Die Einheiten können öfter wiederholt werden und gelangen folglich leichter ins LZG. (Primacy-Effekt) (b) Nach ca. 7 Items ist das KZG erschöpft. Neue Items sind kürzer im KZG und kommen schwerer ins LZG. (c) Die letzten Einheiten werden nur noch aus dem KZG abgerufen (RecencyEffekt). Dies ist ein Beleg für die Existenz von KZG und LZG! Informationsverarbeitung (Sternberg-Paradigma): (a) Ausgangspunkt: Es gibt eine hohe negative Korrelation zwischen Gedächtnisleistung und Reaktionszeit. Darauf baute Sternberg Versuche auf, die die kognitive Verarbeitung bei Aufgaben verschiedenen Typs untersuchte. (b) Stadien der Infoverarbeitung nach Sternberg: (1.) Identifikation eines Stimulus, (2.) Memory scanning, Abscannen gespeicherter Vergleichs- inhalte, (3.) Ja/Nein-Entscheidung und (4.) Transformation der Entscheidung in eine motorische Reaktion. Funktionen des KZG: (a) Infos über eine längere Zeitspanne hinweg präsent halten. (b) Extraktion von Merkmalen aus dem Simultanangebot des UKZG. (c) Leistet Übergang zum kategorialen bzw. klassifikatorischen Gedächtnis. (d) Wechsel der Kodierungsform. (e) Vorbereitung zur Übertragung ins LZG. Aufbau und Struktur des KZG nach dem Modell von Baddeley und Hitch. Sie gehen davon aus, dass das KZG ein modular aufgebautes System ist mit getrennten und interaktiven Subsystemen: (a) Zentrale Exekutive: kapazitätsbegrenztes, supervisorisches Aufmerksamkeitssystem zur Kontrolle von Störreizen, zu Planungs- und Entscheidungsaktionen, für automatisch ablaufende Verarbeitungsvorgänge und notfalls auch für Speicherprozesse. (b) Artikulatorische (oder phonologische) Schleife: eigenständiges, sprachspezifisches Speichersystem mit beschränkter Speicherkapazität. Sie basiert auf akustischen Repräsentationen. Die Sprechdauer von Wörtern beeinflusst die Behaltensleistung. Texte bedürfen der inneren Stimme, um artikulatorisch weiterverarbeitet werden zu können. (c) Visuell-räumlicher Speicher: besteht aus Repräsentationen visueller Vorstellungen. Beweis für Existenz: „Mentale Rotationen“ bei 3-D-Gegenständen. Aber: Es besteht Unklarheit über die Unterscheidung zwischen KZG und LZG. Auch nach 30 Sekunden kann das KZG noch die aktive Instanz sein, z. B. durch Wiederholung des Reizes. Zusammenfassend: Der Begriff des KZGs bezieht sich auf die Zugänglichkeit einer kleinen Anzahl von Einheiten (etwa 7). Diese Zahl sinkt innerhalb von Sekunden und ist normalerweise nach 20 sek. verschwunden, wenn keine Wiederholungsprozesse erfolgen. Vgl. Phänomen, dass wir Wörter beim Lesen so lange behalten, bis das Ganze einen Sinn ergibt. 20 A – 5 – 3 – 4: Wiederholungs- und Kodierungsprozesse als Übergangsmechanismen zum Langzeitgedächtnis im Rahmen des Mehrspeichermodells Die entscheidenden Übergangsmechanismen zum LZG liegen in den (bewussten und unbewussten) Wiederholungs- und Kodierungsprozessen, der der Enkodierung im LZG dienen. Dazu sind zu zählen: (a) Erhaltende (oder primäre) Wiederholung: spontanes, stilles Wiederholen bessere Behaltensleistung. Entscheidend ist auch eine zeitliche Nähe zur Reproduktion. (b) Isolierungseffekt (Restorff-Effekt): herausfallende Elemente, d. h. Elemente in Isolierstellung kann man wesentlich besser behalten als in Häufungsstellung, weil seltene Ereignisse intensiver enkodiert werden als häufigere. Lernspsychologische Folgerung: Wichtige Items (im Text oder Tafelbild) hervorheben. Aber: Bei zu häufigem Gebrauch geht der Effekt natürlich verloren. Auf der anderen Seite wirken auch eine ganze Reihe von Interferenz- und Hemmungserscheinungen. Jeder Lernvorgang ist in eine Serie von Lernvollzügen eingebettet, die sich gegenseitig beeinflussen, d. h. dass vorhandene Wissensinhalte neuen Inhalten förderlich sein können, diese aber auch hemmen können (Überlagungen, Hemmungen): (a) Assoziative Hemmung: Wenn eine feste assoziative Verbindung vorliegt (z. B. Name – Telefonnummer) und ein Item erneuert wird (z. B. eine neue Nummer zum selben Namen). (b) Ähnlichkeitshemmung: Beispiel: Ein mittlerer Buchstabe eines Begriffes wird ausgetauscht und dieser falschgeschriebene Begriff soll erinnert werden. Sehr schwer! (c) Pro- und retroaktive Hemmung (im KZG oder LZG): Ein vorher gelernter Lernstoff beeinträchtig den aktuellen Lernstoff bzw. ein nachher gelernter Stoff oder vermischt sich mit diesem. (d) Hemmung bei der Wiedergabe, wenn erst kurz vor der Wiedergabe gelernt worden ist. Hier können noch postmentale Erregungsprozesse wirken. (e) Gleichzeitigkeitshemmung: Bei gleichzeitigen Aktivitäten möglich. (f) Affektive Hemmung: Kurzfristig schlechte Behaltensleistung aufgrund von erhöhter Emotionalität. Aber: Langfristig hohe Behaltensleistung bei emotionaler Erregtheit. Erinnerung geschieht am leichtesten bei angeneh- men Erlebnissen, am zweitleichtesten bei unangenehmen Erlebnissen und am schlechtesten bei neutralen Erlebnissen. (g) Schockhemmung: in Schocksituationen: Vollständiges Vergessen der unmittelbar vorangegangenen Ereignisse (aufgrund der Beeinträchtigung der physiologischen Gedächtnisspur). Die Kodierungsprozesse vollziehen sich in Wechselwirkung mit den bestehenden Strukturen und Wissensbeständen des LZG. Einfluss des Vorwissens. Versuch: Vpns werden mit einer indianischen Geschichte über die Folklore der Eingeborenen konfrontiert, die mit den europäischen Erwartungen nicht vereinbar sind. Bei Widergabe typische Veränderungen, die den Inhalt den kulturellen Vorstellungen anpassten (besonders bei langen Gedächtnisinhalten). Großer Einfluss der eigenen kulturellen Erwartungen. Kodierung: Vorgänge der Extraktion und Speicherung von Attributen einer Lernepisode. Zwischen der externen Welt und der gedächtnismäßigen Repräsentation finden best. Prozesse der „Übersetzung“ statt. Es lassen sich Topdown (konzeptionell gesteuerte) und Bottom-up-Prozesse (datengesteuerte) unterscheiden. Elaborative Kodierung: Einzelne Items werden mit Sinn, Bedeutung und Kontext angereichert Verbinden einzelner Elemente zu einem Ganzen. Reduktive Kodierung: Informationseineinheiten werden einfach verbunden. Chunking: Da nur 7 Items (+/- 2) abgespeichert werden können, kann es auch zu einer Neuverschlüsselung bzw. Recodierung kommen. Methode der Bündel- oder Klumpenbildung. größere Effizienz des KZG im Hinblick auf die Weiterleitung ins LZG bessere Merkleistung möglich (besonders bei linguistischen Merkleistungen). „Gechunkte“ Infos sind bedeutungsvoller als nicht-gechunkte Infos. Vgl. z. B. Schachgroßmeister, die sich die Position von 20 Figuren in 5 sek merken könen, aber nur solange es sich um keine vollkommen zufällige Konstellation handelt (da schneiden sie sogar schlechter ab). D. h. dass das Spielfeld als Konstellation und nicht in den Einzelpositionen gemerkt wird. Bei Wiedergabe: Gruppenweiser Abruf. Experten brauchen wesentlich weniger Zeit für ein Urteil (Physik, Medizin etc...), weil die Info-Einheiten nach Klassifizierungen kategorisiert sind (welche wiederum vom Vorwissen abhängig sind). Vorwissen erleichtert Verarbeitung und Speicherung von Infos. Außerdem führt Vorwissen zu einer effizienteren Informationsselektion. 21 Stimulusselektion: besonders effiziente Methode der Codierung. Nur best. Teile der Infos werden abgespeichert. Z. B. Merken von Buchstabenkombination und dazugehöriger Zahl: KRT: 2 BWT: 3 ZWN: 1 Wenn nur der erste Buchstabe und die Zahl gelernt werden ist eine größere Lernleistung möglich. Weitere Ergebnisse von Postman & Greenblom (1967): 1. Es treten deutliche Positionseffekte auf: der erste Buchstabe wird relativ häufig als Reiz ausgewählt, der mittlere am seltensten. 2. Leichte und aussprechbare Items werden als eine Einheit enkodiert (z. B. TON). Clustering / Kategorisieren / Subjektive Organisation: Clustering bezeichnet ein Verfahren zur Reproduktion, bei dem willkürlich dargebotene Wörter nach bestimmten Gesichtspunkten zu Gruppen zusammengefasst, gelernt und auch wiedergegeben werden. Gesichtspunkte können Oberbegriffe, assoziative Verbindungen, phonologischen Attribute (z.B. Reh, Zeh, Weh), gleiche Anfangsbuchstaben etc... sein. Das Phänomen des Clusterings hängt mit dem Konzept der reduktiven Kodierung zusammen. Dual-Code-Theorie von Paivio (1971): Erklärungsmodell für den Effekt, dass Sachverhalte sowohl bildhaft verarbeitet und gespeichert werden (als „Imagene“), als auch verbal (als „Logogene“). Diese sind aufeinander bezogen. Aus der Theorie lassen sich Aussagen ableiten: (a) Das bildhafte System wirkt stärker auf das Gedächtnis als das verbale. Bilder werden spontan dual kodiert (Bildüberlegenheitseffekt), aussagenartige Wörter hingegen nur dann, wenn sie sich auf etwas Abstraktes (und nichts Konkretes) beziehen. (b) Je konkreter eine Information ist, desto besser wird sie behalten (weil sie dual kodiert werden kann.) Das Bildgedächtnis bzw. das visuelle Gedächtnis ist äußerst leistungsfähig. („Eidetik“, „eidetisches Phänomen“). Besonders scharfe Konturen und Farben können gut erinnert werden. („Vulkanausbruch“ ist so gut wie immer visuell gespeichert, da die Speicherung so weniger komplex vorgenommen werden kann und weniger Denkanstrengung erfordert, also ökonomischer ist.) Wichtige und emotionsgeladene Ereignisse werden besser im LZG gespeichert. Mentale Modelle und die Kodierung von Texten: Die Behaltensleistung schwer verständlicher Texte steigt durch Zusatzinformationen bzw. Kontext- informationen. Assimilation an mentale Modelle, Vorwissen und Skripts. Aber: Konzeptgesteuerte Top-down-Prozesse vollbringen keine exakten Speicherleistungen. Repräsentation komplexen Wissens / Modell des Textverstehens von Kintsch und van Dijk (1978): Geht von einem Netzwerkmodell des Gedächtnisses aus. Grundprinzip: Makrooperationen verdichten Mikropropositionen (sehr kleine Aussageeinheiten) zu Makropropositionen (globale Aussageeinheiten). Es gibt zwei Tilgungs- (a, b) und zwei Ersetzungsoperationen (c, d): (a) Weglassen (b) Selektion (c) Generalisation (d) Konstruktion Textaussagen sind unterschiedlich relevant. Besonders relevant sind makrostrukturelle Formulierungen, wie Angabe des Themas, Aufmerksamkeitsstellen, Relevanzindikatoren (wie „vor allem aber...“). A – 5 – 3 – 5: Das Langzeitgedächtnis im Mehrspeichermodell Langzeitgedächtnis: Es hat eine sehr große Kapazität und ist relativ löschungsresistent. Daten sind erst dann fest im LZG, wenn ein neuropsychologischer Konsolidierungsprozess stattgefunden hat, d. h. wenn es zu einer Synthese von Proteinen gekommen ist, was mindestens einen Tag dauert. Je gründlicher und tiefer die Bearbeitung von Informationen ist, desto dauerhafter werden sie im LZG gespeichert. Das LZG enthält alles, was wir während unserer Erziehung erfahren haben, unser komplettes Wissen über Sprache, stabiles Weltwissen etc... Komponenten des LZG (wobei grundsätzlich eine sehr komplexe Vernetzung mit zahlreichen „Knoten“ zwischen allen Komponenten vorliegt): I. Deklaratives Gedächtnis: bewusstes Gedächtnis für Fakten und Ereignisse. (a) Episodischer Speicher: Persönliche und autobiographische Erinnerungen, Selbstreflexionen, Zeitkontext. Speicherung in Schemata (z. B. für Auto) und Skripts, d. h. Ereignisfolgen, die sich durch Frames (Rahmen) und Slots (Leerstellen) auszeichnen. (b) Semantischer Speicher: Stabiles Weltwissen, Grammatisches Sprachwissen, Gesetze, Prinzipien, Fakten, Strategien, Heuristika etc... Hier grundlegend: Netzwerk- und Merkmalsmodelle (siehe A – 5 – 2 – 2: Begriffslernen!). 22 II. Nicht-deklaratives Gedächtnis für unbewusste oder nur bedingt bewusstseinsfähige Gedächtnisprozesse. Unterteilbar in (a) Speicher für prozedurales Wissen für Fähigkeiten und motorische Fertigkeiten wie Gehen, Hüpfen, Essen, Sprechen, Waschen, Singen etc... Wird v. a. über das Lernen am Modell erlernt. Das motorische Gedächtnissystem ist dem visuell-bildhaften und dem aussagenartigen im Bezug auf die Behaltensleistung überlegen. Grundlegende Einheiten des sensorischen Wissens sind Marken (repräsentierte Erfahrungen) und Programme. (b) Priming- oder Prägungsspeicher für Voreinstellungen. Erhöhte Wiedererkennenswahrscheinlichkeit. (c) Konditionierungsspeicher, auch mit: Habituation und Sensitivierung. Mittel Tief A – 5 – 3 – 6: Das Einspeichermodell Weitere übliche Begriffe: Mehrebenenansatz, Modell der Verarbeitungstiefen, „levels-of-processing-Modell“. Entwickelt von Craig und Lockhart (1972). Grundthese: Unterschiedliche Gedächtnisleistungen sind nicht durch den Rückgriff auf versch. Gedächtnisspeicher zu erklären, sondern auf Unterschiede in der Reizverarbeitung bzw. Enkodierung. Es sei eine unterschiedliche Verarbeitungstiefe zu beobachten. Eine tiefere Verarbeitung führt zu einer genaueren und dauerhafteren Erinnerung, weil sie mit mehr Analysen, mehr Interpretationen, mehr Vergleichen und mehr Elaborationen verbunden ist. Man unterscheidet 3 Verarbeitungsebenen: (a) Flache Verarbeitung: Hier werden lediglich physikalische und sensorische Merkmale wie Farbe, Helligkeit, Kontur beachtet, z. B. die Buchstaben des Wortes „Herz“. (b) Mittlere Verarbeitung: Hier werden die akustischen Eigenschaften eines Reizes verarbeitet, z. B. Klangbild von „Herz“. (c) Tiefe Verarbeitung: Hier werden semantische Aspekte berücksichtigt, sowie der Bedeutungsinhalt der Items, z. B. Kontext und Intention von „Herz“. Verarbeitungstiefe Flach Reizanalyse Graphisch: Die Form Behaltensleistung Gering Phonemisch: Der Laut Semantisch: Die Bedeutung Mittel Hoch Die Theorie betont, wie unterschiedlich tief Infos verarbeitet werden können. Je nach Verarbeitungstiefe wird mehr oder weniger kognitive Anstrengung gebraucht, um Informationen zu enkodieren. Tests zu diesem Modell liefen so ab, dass Vpns einmal sich auf den Sinn eines Textes, einmal auf die Häufigkeit best. Buchstaben konzentrieren sollten. Bei Ersterem ließ sich eine tiefere Enkodierung und eine höhere Behaltensleistung feststellen. Kritik: Die Verarbeitungstiefe ist nicht ausreichend als ausschließliches Erklärungskonzept für die Gedächtnisleistung (Seltsamerweise kommt es kaum vor, dass man sich nur die Farben eines Buches merkt, den Titel und Inhalt aber gänzlich vergessen hat...) Auch der Primacy-recency-Effekt („serieller Positionseffekt“), der sehr gut belegt ist, spricht deutlich gegen dieses Modell. Ein Verbesserungsversuch geht so vor, dass die Verarbeitung als ein interaktives System verstanden wird, in das auch vorausgegangene Lernerfahrungen miteinbezogen werden. Die Verarbeitung von Infos kann demnach auch auf semantischer Ebene beginnen und nach „unten“ fortschreiten. A – 5 – 4: Erinnern, Wiedererkennen, Vergessen (Quellen: Edelmann: S. 248-256, GK 2000/01 / Lukesch / Oerter / Montada S. 654-659 / Inés´ Lefrancois-Exzerpt) A – 5 – 4 – 1: Zur physiologischen Natur der Gedächtnisprozesse Es kommt zu Veränderungen im Gehirn aufgrund von Lernvorgängen. Hierzu gibt es zwei konkurrierende Modellvorstellungen über die physiologische Natur der gebildeten Engramme (Gedächnisspuren): (a) Langfristig gespeicherte Gedächtnisinhalte können entweder als Eiweißmoleküle gedacht werden. Experimente: Anhand von Ratten konnten Veränderungen der neuronalen Bahnungen im Gehirn nachgewiesen werden. (Vergleich von Ratten in bereicherter Umgebung mit Ratten in isolierter Umgebung) Erstere Ratten hatten 23 nach ihrem Tod mehr Gliazellen. Eine vielgestaltete und reichhaltige Umgebung ist für kleine Kinder sehr wichtig. Versuche mit Plattwürmern: Würmer wurden daraufhin trainiert, auf Lichtreiz zu reagieren, andere nicht. Die Konzentration von RNS zeigt bei der ersten Wurmgruppe denselben Verlauf wie Lernfähigkeit. Gleiches Ergebnis wie bei den Ratten. (b) Sie können gedacht werden als wiederholt auftretende neuronale Erregungsmuster aufgrund früherer Bahnungsprozesse. Beide Vorstellung sind weit davon entfernt, alle Gedächtnisphänomene erklären zu können. A – 5 – 4 – 2: Erinnern, Wiedererkennen, Reproduzieren Def.: Erinnern ist derjenige Prozess, bei dem Informationen aus dem Langzeitgedächtnis aktiviert und ins Arbeitsgedächtnis transportiert werden. U. U. kann die Erinnerung auch fehlerhaft sein (vgl. Zeugenberichte). Das von einer Person im Moment Erinnerte entspricht nicht dem Inhalt des Gedächtnisses. Denn: Der Anteil des Erlernten und im Gedächtnis Behaltenen ist größer als der Anteil des Erinnerten. Bartlett: Der Erinnerungsprozess ist ein Rekonstruktionsvorgang, den wir im Rahmen unserer Erfahrungen vornehmen. Erinnern kann Wiedererkennen sein oder Reproduzieren: (a) Wiedererkennen: Durch einen Reiz werden Daten aus dem LZG in das KZG gebracht und dort mit dem aktuellen Reiz abgeglichen und für gleich oder ähnlich befunden. (b) Reproduzieren: Vergegenwärtigung von im LZG gespeicherten Infos ohne äußere Reize und nur durch einen Willensakt. Dies ist eine aktivere, komplexere und schwierigere Denkleistung als das Wiedererkennen. (c) Ähnlich wie das Reproduzieren ist das Abrufen von Inhalten aus dem Speicher, um ursprünglich Gelerntes neu zu strukturieren. Bartlett (1932) untersuchte die Erinnerungsfähigkeit unter Alltagsbedingungen. Er las Versuchspersonen einen Text vor, den diese nach einer gewissen Zeitspanne inhaltlich rekapitulieren sollten. Die daraufhin erinnerten Texte zeichneten sich durch signifikante Merkmale aus: (a) Sie waren kürzer als der Originaltext. Einzelheiten verschwanden. (b) Nur die Bedeutung, nicht der Wortlaut wurde erinnert. (c) Unverständliche Stellen wurden in verständliche transformiert. (d) Betont wurden individuell für wichtig erachtete Einzelgesichtspunkte. Gespeichert wurde demnach v. a. der Sinn eines Textes, auffällige Details und Emotionen. Beim Erinnern werden gespeicherte Daten in einer Ordnung rekonstruiert und zu einem sinnvollen Ganzen zusammengefügt. Bestimmte Einstellungen und Vorannahmen spielen hierbei eine große Rolle. Nicht-Erinnern kann seine Ursachen im Nicht-Lernen, im Verlust des gespeicherten Inhaltes oder in der Unfähigkeit, die Info aus dem Speicher abzurufen haben. Wimmer (1977): Mehrere kognitive Anforderungen beim Erinnerungsprozess: Bei absichtlich erlernten Infos wird ein Rekonstruktionsplan (ist eine Funktion des Metagedächtnisses) entworfen und mitgelernt. Dieser wird dann beim Erinnerungsprozess abgerufen. Methoden zur Förderung der Erinnerungsfähigkeit: (a) Anwenden von Wiederholstrategien. (b) Entwerfen eines strukturierten Rekonstruktionsplanes. (c) Aufteilung des Lernmaterials in sinnvolle Lerneinheiten. (d) Materialorganisation (gute externe Struktur der Infos), Einschätzung der Relevanz des Materials. A – 5 – 4 – 3: Vergessen Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus (1885) (a) Ebbinghaus lernte sinnlose Silben auswendig, bis er sie vollständig beherrschte und überprüfte nach festen Zeitabständen, wie viel Prozent der Slben er noch erinnern kann. (b) Das Vergessen vollzieht sich zunächst sehr rasch und geht dann viel langsamer vonstatten. In den ersten zwanzig Minuten nach dem Lernvorgang wird mehr vergesen, als in den darauf folgenden 31 Tagen. Die Häfte wird noch in der ersten Stunde Vergessen. Gut zwanzig Prozent bleiben löschungsresitent. Infos, die über lange Zeitabstände hinweg behalten werden, werden auch nach sehr viel längerer Zeit nicht vergessen. (c) Die Ebbinghausensche Vergessenskurve kann nur für mechanisch erlernte Daten (für Memorieren) herangezogen werden (z. B. Geschichtsdaten, Zahlenketten etc...) Für Wissensbestände, die assimiliert und im Vorwissen verankert sind, gilt die Vergesenskurve nicht. 24 Von welchen Determinanten ist das Vergessen abhängig? (a) Vom Grad der Sinnhaftigkeit des Lernmaterials. (b) Von der verwendeten Prüfmethode: Weniger Vergessenseffekte bei der Methode des Wiedererkennens oder bei „multiple choice“, mehr bei Reproduktionen ohne äußere Anreize. (c) Von der Anzahl der Wiederholungen und von eventuellem „Überlernen“. (d) Von der Extensität des Übens: Verteilte Übung ist vergessensresistenter als eine massierte Übung. (e) Von der Anzahl der beteiligten Sinnesgebiete und der Anschaulichkeit. (f) Von der individuellen Disposition, best. Gedächtnisinhalte besser behalten zu können, z. B. Namen, Nummern, Orte, Gesichter, Situationen etc... Erkärungen für das Vergessen: (a) Physiologische Spurenzerfallstheorie: Biologisches Vergessen. Auflösung neuronaler Bahnen. Vergessen als Effekt der Zeit. Ist auch in der Folge z. B. einer Hirnverletzung möglich. (b) Psychologisches Vergessen: Verdrängung, nach Freud aufgrund von traumatischen Erfahrungen. Ist nur auf gefühlsbetonte, angstauslösende, traumatische Situationen anwendbar. Experimentell schwer nachweisbar. (c) Interferenztheorie: Es kommt zu einer Hemmung bzw. Überlagerung des Gedächtnisinhaltes durch nachfolgende Lernprozesse („retroaktive Hemmung“) oder vorausgegangene („proaktive Hemmung“). Deshalb: Vor dem Schlafengehen Gelerntes wird oft besser behalten, weil weniger Hemmungseffekte auftreten. Auch: Geringere Behaltensleistungen bei alten Menschen, da viele Erfahrungen, viel Wissen hemmend wirken können. (d) Verzerrungstheorie: Bei der Enkodierung werden die Infos z. T. verändert, z. B. fehlerhaft erschlossene Slots (vgl. Experiment mit einer indianischen Geschichte). Bedeutungsspezifika gehen verloren. Tendenz zur Prägnanz, zur Symmetrie, zur geschlossenen Form. Diese Theorie hat besonders bei großen Zeiträumen hohe Relevanz. (e) Problem des Wiederfindens von Gedächtnisinhalten („aktive Reproduktion“): Der Abruf (Dekodierung) hängt eng mit der Verarbeitung (Kodierung) zusammen. Entspricht im Wesentlichen auch der Theorie der fehlenden Hinweisreize. Kein echtes Vergessen, aber „Findestörung“. Phänomen des „Auf-der-Zunge-Liegens“. Zwei Arten des Vergessens: (a) Cue-dependent: Reizabhängiges Vergessen. Unfähigkeit, eine Info abzurufen, weil kein geeigneter Hinweisreiz. (b) Trace-dependent: Veränderung der Gedächtnisspur. Aber: Niemand kann beweisen, dass Vergessen überhaupt stattfindet! Guthrie (1935) vertritt die These, dass nichts vergessen wird, sondern nur etwas nicht erinnert wird. Gegenstrategien gegen schlechtes Wiederfinden von Gedächtnisinhalten: (a) Ähnlichkeit herstellen zwischen der Lern- und Abrufsituation. (b) Simulation der Abrufsituation. (c) Arbeiten an einer höheren Verarbeitungstiefe und einer kognitiven Vernetzung. (d) Aufbau einer multiplen Wissensrepräsentation. A – 6: Gedächtnishilfen und Lernstrategien A – 6 – 1: Gedächtnistraining / Kognitives Training (Quelle: HPP S. 190-194, 200-205 und 343-349 / Lukesch) Def. von Gedächtnistraining bzw. kognitivem Training („memory training“): Präventions-, Interventions- und Fördermaßnahmen mit dem Ziel der Verbesserung kognitiver Fähigkeiten, des Transfervermögens und allgemein der Intelligenz. Unterscheidung von Coaching (Nahziele: kurzfristige Optimierung einer spezifischen Testleistung bzw. Performanz) Training (Fernziele: langfristige und substanzielle Kompetenzsteigerungen) Der Begriff „Übung“ bezieht sich auf die Eigenleistung des Gecoachten bzw. des Trainierten. Aber: Durch Üben (z. B. Auswendiglernen) allein kann man die Gedächtnisleistung nicht verbessern. Wichtig ist v. a. der Erwerb von Lerntechniken. Ziele des Gedächtnistrainings: (a) Befähigung zu proximalen und distalen Transfers (b) Langfristige, überdauernde kognitive Leistungsverbesserung; Löschungsresistenz der kognitiven Strategien (c) Integration in die alltägliche Aufgabenbewältigung 25 Umfassende Gedächtnistrainings- oder IQ-Förderprogramme berücksichtigen verschiedene Bereiche: (a) Grundlagen des Denkens, Logik, Induktion, Deduktion, Analogie (b) Sprachverständnis, verbales Denken (siehe unten) (c) Weltwissen und Wissensspeicherung (d) Problemlösen, Entscheidungstraining (e) Kreativ-schöpferisches Denken Komponenten des Gedächtnistrainings bzw. des kognitiven Trainings: (a) Einüben bereichsspezifischer Strategien (z. B. via Modell-Lernen, verbale Selbstinstruktion etc...) (b) Explizites Vermitteln von Informationen über den Nutzen und die Anwendungsmöglichkeit der Strategien und Kompetenzen. (c) Einüben genereller Techniken und Prinzipien der Selbstregulation und Lernregulation (Metakognition, Methoden des selbstgesteuerten Lernens wie verbale Selbstinstruktion, Überwachung, Steuerung des Lernprozesses, Vermittlung von metamemorialem Strategiewissen). Schrittweise Anleitung zum selbständigen Anwenden dieser Techniken. (d) Direktes Einüben des Strategietransfers durch Variation der Aufgabenstellungen ( Vergrößerung der Transferkompetenz Es kommt zur Strategiegeneralisierung). (e) Verknüpfen der Inhalte mit der persönlichen Zielmotivation der Teilnehmer. Anregungen und Impluse für persönliche Zielmotivation sind hier wichtig. Ein Grundsatz bei kognitivem Training ist, dass die Bereichsspezifität jedes Trainings beachtet werden sollte. Metakognitive Lernprozesse gehen immer von dieser Bereichsspezifität aus. Das Dilemma der Gedächtnistrainingsstrategien: (a) Je enger der Trainingsbereich eingegrenzt ist, desto höher ist die Wirkungsintensität, desto geringer aber die Wirkungsextensität (Ausdehnung auf andere Wissensfelder) und die Transferlösungskompetenz (Spezielles Training). (b) Je weiter ein Trainingsbereich ist, desto geringer ist die Wirkungsintensität und desto höher ist die Wirkungsextensität (Allgemeines Training). (c) Wirkungsintensität und Wirkungsextensität sind somit indirekt proportional zueinander. Gedächtnistrainingsprogramme sind dann besonders effektiv, wenn sie in kleinen, möglichst homogenen und möglichst gleich leistungsstarken Gruppen durchgeführt werden. (Ergebnis der Aptitude-treatment-Interaktionsforschung) Evaluation von Gedächtnistraining: (a) durch (verbale) Leistungsbeurteilungen, Zensuren (b) Komponentenevaluation: Evaluation der einzelnen Trainingskomponenten (c) Evaluation durch Testen einer kognitiv trainierten Gruppe und zugleich einer kognitiv nicht trainierten Vergleichsgruppe. Qualitätskriterien für kognitive Trainingsprogramme: (a) Es sollte eine theoretische Verankerung in der pädagogischen Psychologie aufweisen. (b) Es sollte eine Adaption des Programms auf unterschiedliche Leistungsniveaus der zu Trainierenden möglich sein. (c) Es sollte ein Nachweis proximaler und distaler Transferleistungen erbracht werden können. (d) Dauerhaftigkeit und Löschungsresistenz der Trainingsleistungen. (e) Vermeidung oder Verringerung von schädlichen Nebenwirkungen wie Demotivation, psychische Sättigung aufgrund von monotonem Training, Deautomatisierung vorhandener Routinen etc... (f) Effizienz des Trainings (Verhältnis von Aufwand und Ergebnis). A – 6 – 2: Gedächtnis und Lernhilfen (Quelle: Lukesch S. 213-303) Körperliche Verfassung, richtige Ernährung, Schlaf und Erholung sind Grundvoraussetzungen für Lern- und Erinnerungsleistungen. Früher Tiefschlaf und späterer REM-Schlaf unterstützen den Lernprozess. Zusammenhang zwischen dem Zustand, unter dem gelernt wird und der Gedächtnisleistung. Besonders gute Gedächtnisleistung, wenn Lern- und Abrufsituation ähnlich sind. Emotion und Gedächtnis: Bessere Gedächtnisleistungen, wenn derselbe emotionale Zustand wie beim Lernen besteht. Voraussetzungen für die effektive Verwendung von Strategien: (a) Überzeugung der Kontrollierbarkeit des Lernvorganges und Glauben an Verfügbarkeit persönlicher Ressourcen. (b) Wertschätzung systematischen Vorgehens und Überzeugung von der Nützlichkeit von Lernstrategien. 26 (c) Inhaltliche Gerichtetheit der motivationalen Dynamik. (d) Interesse: Bei Nichtverstehen Fragen stellen, nach Antworten suchen etc... (e) Bewusste Kontrolle zur Aufrechterhaltung der Motivation bei konkurrierenden Zielen oder schwacher Intention. A – 6 – 2 – 1: Was sind Lernstrategien, Mnemotechniken und Metakognition? Lernstrategien können bewusst angewandt, aber auch automatisiert aktiviert sein. Erfolgreiche Lerner haben zahlreiche Lernstrategien, die sie flexibel anwenden können. Lernstrategien sind zielgerichtete, übergeordnete und komplexe Vorgehensweisen, bei deren Ausführung Lern- und Gedächtnistechniken neben Methoden der Planerstellung und Überwachung eingesetzt werden. Mnemotechniken sind Verfahren, mit deren Hilfe Information verarbeitet und organisiert wird, um später wieder verfügbar zu sein. Lernstrategien und Mnemotechniken sind Teil des metakognitiven Wissens. Fünf Bereiche der Metakognition nach Flavell: (a) Wissen über die eigene Person, z.B. über eigene Fähigkeiten. (b) Wissen über Aufgabencharakteristika, z. B. Bewertung des Schwierigkeitsgrades. (c) Wissen über kognitive Strategien und deren Einsatz, z.B. mehrmaliges Lesen unklarer Abschnitte. (d) Metakognitive Empfindungen. Es werden z. B. emotionale Reaktionen wie Interesse oder Langeweile registriert und es wird dementsprechend darauf reagiert. (e) Metakognitive Kontrollprozesse, mit denen die Ausführung einer kognitiven Aktivität kontrolliert wird, z. B. durch Zusammenfassen der wesentlichen Gedanken eines Textes. A – 6 – 2 – 2: Ausgewählte Lernstrategien Sprachorientierte Gedächtnisstützen bzw. verbales Training. Folgende Strategien und Methoden: (a) Repetiermethode, Wortwiederholungen, „Rehearsal“ (b) Induktives Ordnen nach semantischen Oberbegriffen (c) Elaboration der zu lernenden Information. (d) Einspeicherung von Zusatzinfos, um Gelerntes besser aufzufinden. (e) Schlüsselwortmethode. (f) Lernen durch Rhythmus und Reim. (g) Akronyme als Merkwörter, z. B. NATO für North American Treaty Org. (h) Akrostichone: z. B. „Geh du alter Esel hole Fische“ für die Tonarten. (i) Narrative Verknüpfungen. Bildorientierte Lernstrategien (vgl. Dual-Code-Theorie von Paivio), z. B. Loci-Methode / „Methode der Orte“: Zu erinnernde Worte werden mental mit bestimmten Orten verbunden, so dass sich ein lokal definiertes Abrufschema für die Worte ergibt. Dann kann eine mentale Route entwickelt werden, wodurch die Worte in einer bestimmten Reihenfolge abgerufen werden können. Nachteil dieser Methode: Sie bedarf einer sehr hohen Motivation, da sie als eine nur schwer automatisierbare Mnemo-Technik eine hohe mentale Anstrengung erfordert. Im Alltag wird sie so gut wie überhaupt nicht angewendet. Außerdem handelt es sich um eine reine Speicher- und Merktechnik. Ein tieferes Verständnis wird so nicht erreicht. Verständnisorientierte Lernstrategien: (a) SQ3R-Methode bei Textverständnisaufgaben: Survey: Überblick verschaffen. Question: Fragen an den Text stellen. Read: Lesen. Recite: Wiedergeben des Gelesenen. Review: Rückschau, ob die Fragen hinreichend beantwortet worden sind. (b) Techniken des gezielten Unterstreichens, Gliederns, Exzerpierens. (c) Technik der Visualisierung und Schematisierung von Texten, z. B. durch Schaubilder mit Pfeilen, Kästchen, Diagrammen, Clustern etc... 27 A – 7: Unterrichtsqualität A – 7 – 1: Aptitude-Treatment-Interaktionsforschung (Quelle: HPP S. 12-16, Helmke) Def.: Unter ATI (wörtliche Übersetzung: Eignungs-Umgangs-Interaktion) versteht man die Wechselwirkung von Schülermerkmal und Lehrmethode, d. h. dass ein und derselbe Unterricht einmal adäquat und gut und einmal inadäquat und schlecht sein kann, je nach den emotionalen und motivationalen Eingangsvoraussetzungen auf der Schülerseite („differenzieller Profit“). „Matthäus-Effekt“: („Wer hat, dem wird gegegeben“): Bei einseitigem Methodeneinsatz können einzelne Schüler immer profitieren, während andere immer kaum profitieren. Deshalb: Variabilität der Unterrichtsmethoden (schon aus Fairnessgründen). Die Grundfrage der ATI-Forschung lautet: Welche Lernziele werden bei Anwendung welcher Lernmethoden bei den jeweils individuellen Lernvoraussetzungen erreicht? Ein charakterististisches Merkmal der ATI-Forschung ist es, dass sie Interaktionen von Effekten untersucht. Diese sind allerdings nur schwer nachzuweisen. Schon vor der eigentlichen ATI-Forschung plädierten Dewey (1902) und Thorndike (1911) dafür, eine möglichst weitgehende Anpassung an die individuellen Lernvoraussetzungen zu erreichen. Einzelnen Schülern sollten individuelle Lernprogramme zugewiesen werden. Die verschiedenen Eignungen (aptitudes) der Schüler können sein: (a) Impulsivität vs. Reflexivität (b) Bevorzugung bzw. Vernachlässigung bestimmter Sinneskanäle (c) Deduktive vs. induktive Lernstrategien (Top-down vs. Bottom-up) (d) Autoritätsgebunde Schüler (sie wollen lehrerzentrierte Interaktion) vs. autoritätskritische Schüler (sie wollen schülerzentrierten Unterricht) Der Einsatz von ATI-Methoden beruht auf unterschiedlichen Adaptionsmethoden: (a) Cronbach unterschied nach der zeitlichen Dauer der Adaption bzw. Anpassung eine Mikroadaption (Sekunden bis Minuten) und eine Makroadaption (Wochen und Monate). (b) Die drei ATI-Methoden nach Salomon (1972): (1.) Fördermodell: Beseitigung von Lerndefiziten durch Erhöhung des Zeitaufwandes. (2.) Kompensationsmodell: Abbau von Lerndefiziten durch Anwendung von Methoden zum Abbau von hemmenden Persönlichkeitsmerkmalen. (3.) Präferenzmodell: Gezielte Nutzung günstiger Schülerfähigkeiten und Lernvoraussetzungen. Hochbegabtenförderung. Nachteil der ersten beiden Modelle: Keine gezielte Förderung und Motivierung von Leistungsträgern. Nachteil des dritten Modells: Keine gezielte Förderung von Leistungsschwächeren. ATI ist lernpsychologisch von großer Relevanz: Positive Rückmeldungen durch den Lehrer fördern Schüler mit Ängstlichkeit, während weniger ängstliche Schüler ohne Rückmeldungen oft bessere Lernerfolge erzielen können. Schüler mit hohen Vorkenntnissen profitieren stark von ausführlichen verbalen Rückmeldungen, während bei kaum vorhandenen Vorkenntnissen visuelle Hilfestellungen oft nützlicher sind. ATI findet seine Anwendung besonders auch im programmierten Unterricht und beim Lernen mit Computerprogrammen. Ein solches Programm kann anhand von versch. Variablen (wie z. B. Schwierigkeitsgrad, Bearbeitungszeit etc...) auf Stärken und Schwächen des Schülers passend reagieren („Intelligente tutorielle Systeme“). Kritik an „Intelligenten tutoriellen Systemen“: (a) Mangelnde Flexibilität: Ein automatisches Feedback kann das Erklärungsniveau und die inhaltliche Perspektive nicht wechseln. (b) Eine Anpassung an Faktoren wie z. B. Motivation und Konzentration fehlt gänzlich. Bei Erfassung aller Lernparameter käme es zu einer „kombinatorischen Explosion“. Ein Computerprogramm kann also die Ganzheitlichkeit von Lernprozessen nicht berücksichtigen. (c) Solche Systeme reizen die Schüler dazu, mit den Programmen subversiv umzugehen, d. h. z. B. absichtliche Fehler zu machen, um das Feedback des Programms auszutesten. 28 A – 7 – 2: Unterrichtsqualität (Quelle: Helmke / HPP S. 267ff) A – 7 – 2 – 2: Lehr- und Lernvoraussetzungen A – 7 – 2 – 1: Lernziele Intendierte Ziele sind zu unterscheiden von den tatsächlich eintretenden Wirkungen („Sozialisationseffekte“) des Unterrichts. Blooms Taxonomie kognitiver Lernziele: (1.) Wissen, Kenntnisse (z. B. Name einer Pflanze). (2.) Verstehen (z. B. Entwicklung dieser Pflanze). (3.) Anwendung (z. B. Pflanze pflanzen im Schulgarten). (4.) Analyse (z. B. einzelne Pflanzenbestandteile und ihre Funktion). (5.) Synthese (z. B. Zusammenwirken der einzelnen Pflanzenbestandteile). (6.) Bewertung. Bloom geht von einer zunehmenden Komplexität der Lernziele aus. Allerdings wird sein bereichsübergreifender Ansatz heute so nicht mehr geteilt. Taxonomie affektiver Lernziele nach Bloom und Krathwohl: (1.) Beachten, Aufmerksamwerden für etwas. (2.) Reagieren. (3.) Werten. (4.) Organisation. Einordnung in das Wertesystem. (5.) Internalisierung. Es gibt auch pragmatische und psychomotorische Lernziele. Gagnés fünf Typen von „Lerning outcomes“: (1.) Verbal information, (2.) Intellectual skills, (3.) Cognitive strategies, (4.) Attitudes, (5.) Motor skills. Die sechs Bildungsziele nach Weinert: (1.) Erwerb von intelligentem Wissen, d. h. eines vernetzten Systems von flexibel nutzbaren Kenntnissen und Kompetenzen, (2.) Erwerb anwendungsfähigen Wissens, (3.) Erwerb variabel nutzbarer Schlüsselqualifikationen, (4.) Erwerb von Lernkompetenz, (5.) Erwerb sozialer Kompetenzen, (6.) Erwerb von Wertorientierungen. Typen von Zielkriterien, die jeweils ausbalanciert werden müssen: (a) Individuelle vs. soziale Zielkriterien (b) Fachwissen vs. Schlüsselkompetenzen (v. a. selbständiges Lernen und verständiges Lesen) (c) Kurz- vs. langfristige Effekte Für die Unterrichtsqualität günstige Merkmale der Lehrerpersönlichkeit: (a) Engagement, Lehrmotivation, ein der Situation angemessener Enthusiasmus, lebendige und überzeugende Kommunikation. (b) Bewusstsein über subjektive Theorien und epistomologische Überzeugungen, die als implizite Lehrertheorien unterschwellig wirken und dem Unterrichtserfolg zuwider laufen können. (c) Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion und Selbstverbesserung. (d) Fähigkeit zur „starken Präsenz“. Grundsätzlich gilt: Ein Unterricht kann bei sehr unterschiedlichen Stilen und Profilen des Lehrers erfolgreich verlaufen. Schwächen können durch Stärken kompensiert werden. Grundlegende Orientierungen der Lehrerinstruktion: (a) Methodenorientierung & Wirkungsorientierung: Traditionell galt, dass ein Unterricht dann gut ist, wenn er best. unterrichtsmethodische Forderungen erfüllt. Eine Gefahr dabei ist eine Standardisierung und Rigidisierung des Unterrichts. Deshalb: Methoden sind kein Selbstzweck, sondern Werkzeuge zur Erreichung bestimmter Ziele. Ein Unterricht muss also auch output-orientiert sein und den Faktor „Lehrerwirksamkeit“ mit berücksichtigen. Methoden und Wirkung ergänzen sich komplementär. (b) Variablen- & personzentrierter Ansatz: Der variablenorientierte Ansatz stetzt einzelne Variablen (z. B. Klarheit der Repräsentation oder Häufigkeit der Gruppenarbeit) in Beziehung zum Lernerfolg und versucht den Grad der Korrelation zu ermitteln. Aber: Die Ganzheitlichkeit und die Individualität der Schülerpersönlichkeit gerät so aus dem Blick. Deshalb ist eine Ergänzung durch einen personzentrierten Ansatz notwendig. Der Klassenkontext übt einen starken Einfluss auf die Unterrichtsqualität aus, u. a. die Faktoren: (a) Sozialer Hintergrund der Schüler (bildungsnah bildungsfern). (b) Sprachliche Zusammensetzung der Klasse (z. B. Anteil an Migranten). (c) Vorhandene beeichsspezifische Vorkenntnisse. (d) Klassenklima (ist jedoch nur bei Klassenübernahme relevant, danach wird es vom Lehrer stark mitgeprägt). 29 A – 7 – 2 – 3: Lehrplanung Fünf wichtige Komponenten instruktionspsychologischer Theorien im Sinne von Snow und Swanson (1992): (a) Beschreibung des gewünschten Soll- oder Zielzustandes der Schüler bezogen auf ein bestimmtes Wissensgebiet (Lehrzieldefiniton und Lehrstoffanalyse). (b) Beschreibung zielrelevanter Ist-Zustände der Schüler vor Beginn der Instruktion (Analyse von Lernvoraussetzungen). (c) Explikation des Prozesses für den Übergang vom Ist- in den Soll-Zustand (Analyse des angestrebten Lernprozesses). (d) Spezifikation derjenigen instruktionalen Bedingungen, die geeignet sind, den Übergang zu fördern (Instruktionsdesign). (e) Spezifikation von Verfahren zur Beurteilung des Lernerfolgs und anderer instruktionaler Effekte (Mess- und Evaluationsvorschriften). Klafki: (a) Sachanalyse. (b) Anthropogene Voraussetzungen. (c) Soziokulturelle Voraussetzungen. (d) Gegenwarts-, Zukunfts- und exemplarische Bedeutung. Varianten von Lehrstrategien: (a) Direkte Instruktion. (b) Kooperatives Lehren. (c) Entdeckenlassendes Lehren und offene Unterrichtsformen. Lehrfunktionen und Lehr-Lernschritte: (a) Die Aufmerksamkeit der Lernenden gewinnen. (b) Der Lernende muss motiviert sein. (c) Die Lernenden müssen über das Ziel der Unterrichts- oder Ausbildungseinheit informiert werden. (d) Sie müssen relevantes Vorwissen reaktivieren. (e) Der Lehrstoff muss mit Hinweis auf bedeutsame Eigenschaften präsentiert werden. (f) Der Lernprozess muss angeleitet werden. (g) Die Lernenden müssen das im Lehrziel geforderte Verhalten ausführen. (h) Das Behalten und der Transfer müssen unterstützt werden. Sicherung. A – 7 – 2 – 4: Diagnostik von Unterrichtsqualität Kriterien für eine didaktische Expertise: (a) Klarheit: akustische Verständlichkeit, Präzision, Korrektheit, fachliche Kohärenz, Strukturiertheit des Unterrichts, Verständlichkeit von Inhalten. (b) Individualisierung: Anpassung des Unterrichts an die lernrelevanten Unterschiede zwischen den Schülern, gezielte Förderung einzelner Schüler. (c) Motivierungsqualität: intrinsisch und extrinsisch. (d) Klassenführung: effektive Klassenführung durch autoritativen Erziehungsstil: Feste Richtlinien, die aber erklärt werden und über die diskutiert wird. Vermeidung sowohl eines permissiven, als auch autoritären Erziehungsstils. (e) Diagnostische Kompetenz: Objektivität, Reliabilität und Validität (kohärente Beurteilungsorientierung) der Bewertungen. (f) Inhaltliche Quantität und Qualität (g) Qualität des Lehr- und Lernmaterials. Medieneinsatz. 30 Gebiet B: Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie im Kontext der Schule B – 1: Modelle der Schulleistung B – 2: Kognitive Merkmale der Schülerpersönlichkeit B – 2 – 1: Strukturmodelle der Intelligenz (Quelle HPP S. 281) Generalfaktorenmodell nach Spaerman (1923): (a) Annahme eines einzigen Intelligenzfaktors („g“), der in allen intellektuellen Leistungen zum Ausdruck kommt. (b) Wesentlicher Indikator für die Ermittlung von „g“ ist das Erkennen von Beziehungen und Zusammenhängen. Gruppenfaktorenmodell nach Thurstone (1938): Für die Intelligenz sind voneinander unabhängige Gruppenfaktoren („primary mental abilities“) anzunehmen, nämlich (1.) verbales Verständnis, (2.) numerisches Verständnis, (3.) Gedächtnis, (4.) Wahrnehmungsgeschwindigkeit, (5.) Räumliches Denken, (6.) Verbale Flüssigkeit und (7.) Reasoning, d. h. induktives, deduktives, logisches Denken. Heute werden hierarchische Modelle angewendet: An der Spitze wird von einem Faktor „g“ ausgegangen, darunter gliedern sich verschiedene Gruppenfaktoren. B – 3: Motivational-emotionale Merkmale der Schülerpersönlichkeit B – 4: Kausalattribution und Leistung B – 5: Selbstkonzept B – 6: Interesse und Interessenmotivation B – 7: Berufliche Entwicklung von Lehrern 31 Gebiet C: Sozialpsychologie der Schule und der Familie C – 1: Schul- und unterrichtsbezogene Einstellungen und Vorurteile C – 1 – 1: Einstellungen (Quelle: Hillmann S. 173f / Zimbardo S. 578f / Six, Einstellungsänderung / Witte, Sozialpsychologie / Bierhoff) C – 1 – 1 – 1: Begriffsexplikation zu „Einstellungen“ (Haltungen) „Einstellung“ ist ein Konstrukt. Es handelt sich um eine Richtung des Denkens, Erkennens, Wahrnehmens, Urteilens, Wertens und Verhaltens. Einstellungen konstituieren sich (1.) aus kognitiven Meinungen, (2.) emotionalen Affekten und (3.) Verhaltensdispositionen. Einstellungen beeinflussen die psychologischen Prozesse wie Lernen, Denken etc... „Einstellung ist eine psychologische Tendenz, die durch die Bewertung einer speziellen Entität mit einem bestimmten Ausmaß der Zustimmung oder Ablehnung ausgedrückt wird.“ (Eagly et. al.) Psychischer Reaktions- oder Aktionsbereitschaftszustand und die physiologische Bereitschaft, Reize aufzunehmen und in Handlungen umzusetzen: Einstellungen bezeichnen innere Zustände, die sich als Bereitschaften kennzeichnen lassen. Sie sind erworbene Verhaltensdispositionen. Sie haben einen prägenden und bestimmenden Einfluss auf das Verhalten gegenüber der Umwelt (Personen, soziale Organisationen, Objekte etc...) und steuern die Individuum-Umwelt-Interaktion. Sie sind ein integraler Bestandteil von Handlungen – müssen aber nicht zwingend positiv mit einstellungsentsprechendem Handeln korrelieren. Hauptgrund dafür: Wirken des situatives Kontextes. Vgl. Studien in den rassengetrennten USA der 30er-Jahre: NobelRestaurants lehnten es ab, Chinesen zu bedienen, als aber Weiße in Begleitung von Chinesen tatsächlich ins Restaurant kamen, wurden sie trotzdem bedient. I. d. R. bewirken Einstellungen eine Konsistenz von Handlungen. Einstellungen wirken in dynamischen Prozessen und werden in sozialen Interaktion praktisch ständig (wenngleich oft nicht besonders stark) modifiziert. Einstellungen sind soziale Orientierungssysteme, die die Sinngebung erleichtern. Einstellungen sind Bindeglieder zwischen Individuum und Gesellschaft. Einstellungen können einen globalen Charakter haben oder einen bereichsspezifischen. Einstellungen werden dann schneller aus dem Gedächtnis (Priming-Speicher) abgerufen, wenn sie eine hohe Einstellungsstärke aufweisen. Einstellungen können auch Hemmnisse für Innovationen sein. Einstellungen können u. U. einen einstellungsändernden Effekt auf Andere ausüben. Um Einstellungen zu messen, eignen sich „semantische Differenziale“ wie „gut – schlecht“ etc... Wesentliche Einstellungsobjekte sind: (a) Ethnische Minoritäten (b) Rollen (c) Soziale und ökologische Erscheinungen (Arbeitslosigkeit, Waldsterben etc...) (d) Politische Themen (e) Religiöse und moralische Werte Genese von Einstellungen durch (a) Internalisierung soziokultureller Werte (b) Lern- und Erfahrungsprozesse: Modell-Lernen, Verstärkungslernen etc... (c) Katastrophentheoretische Erklärung bei abrupten Einstellungswandlungen (vgl. Zusammenbruch des 3. Reiches, aber auch persönliche Schicksalsschläge) Funktionen von Einstellungen: (a) Filterfunktion: Auswählen und Filtern von Erlebnisinhalten. (b) Bewusstwerdungsfunktion: Sie konstruieren persönliche Realitäten und bilden die Voraussetzung zur Bildung gemeinsamer sozialer Realitäten. (c) Anpassungs-, Adaptions- und Vergesellschaftungsfunktion. (d) Selbstbehauptungs-, Individualisierungs- und Identitätswahrungsfunktion: Sie führen i. d. R. zu verfestigten Strukturen von Anschauungen, Meinungen und Überzeugungen zu best. Bereichen oder Problemen der sozialen Umwelt. (e) Selbstdarstellungs- und Wertdarstellungsfunktion. (f) Wissens- und Erkenntnisfunktion. 32 (g) Komplexitätsreduzierungsfunktion. (h) Sinnstiftungsfunktion. C – 1 – 1 – 2: Einstellungsänderung Einstellungen sind leichter modifizierbar als Persönlichkeitseigenschaften. Im Gegenteil zu Vorurteilen lassen sie sich durch rationale Begründungen korrigieren. Günstige Faktoren zur Einstellungsänderung: (a) Wenn neue Infos dargeboten werden oder wenn ein Interesse an best. Infos besteht. (b) Wenn für das Individuum relevante Bezugspersonen einstellungsändernd einwirken. Glaubwürdigkeit dessen, der eine Einstellungsänderung nahelegt bzw. Glaubwürdigkeit der Referenzgruppe. (c) Anregen kognitiver Lernprozesse: Auseinandersetzung mit Gegenargumenten. (d) Affektive Einflüsse, z. B. Einsatz von positiv konnotierten Reizen (vgl. Werbepsychologie) oder von Furchtauslösern (z. B. Hinweis auf Terrorismusgefahr in der Politik oder auf die Notenvergabe in der Schule) Gefahr allerdings bei Angstauslösern: Reaktanzeffekte. Bedingungen für eine Einstellungsänderung nach Mc Guire (1985): (a) Eine Person muss ihre Aufmerksamkeit dem Einstellungsobjekt zuwenden. (b) Die Person muss ein Interesse haben und den Kommunikator mögen. (c) Die Person muss die Kommunikation über den Inhalt der Einstellungsänderung verstehen und verarbeiten. (d) Die Person muss diese Position akzeptieren. (e) Die Person muss die Einstellungsänderung im Gedächtnis abspeichern. (f) Die Person muss die abgespeicherte Information abrufen und anwenden können. Fällt ein Schritt negativ aus, ist die Einstellungsänderung (Persuasion) bereits gescheitert! Zwei Wege der Einstellungsänderung: (a) Via Argumentation, Inhalt der Persuasion. (b) Via Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Expertentum dessen, der eine Einstellungsänderung bewirken will. Merkmale erfolgreicher Persuasionen: (a) Argumentativität. Auch Gegenargumente miteinbeziehen. (b) Klare Intentionsangabe. Schussfolgerungen ziehen. (c) Reihenfolge der Argumente beachten: Bei geringen Vorkenntnissen bestes Argument zuerst (Primacy- oder Anker-Effekt), bei vielen Vorkenntnissen des zu Überzeugenden dieses zuletzt (Recency-Effekt) bringen. Einstellungen, die via Kommunikation Andere in Richtung ihrer Einstellung beeinflussen wollen, heißen Überzeugungen. C – 1 – 2: Vorurteile und Stereotype (Quelle: Böhm S. 727, Hillmann S. 914f / Witte, Sozialpsychologie / Bierhoff, Sozialpsychologie) Stereotype lassen sich als Zuschreibungen von psychologischen Merkmalen auf eine große menschliche Gruppe definieren, die bis zu einem gewissen Ausmaß von Anderen geteilt wird. „Implizite Stereotype“: Menschen müssen auch dann, wenn sie Vorurteile ablehnen, in gewissem Sinn mit Stereotypen leben. Aber im Unterschied zu vorurteilsvollen Personen stehen sie in einem kritischen Verhältnis zu ihnen. Auf die Stufe des Abrufens des Stereotyps (z. B. „Amerikaner sind oberflächlich“) folgt eine Stufe der kritischen Bewertung und ggf. der Distanzierung von dem Stereotyp. Stereotype werden automatisch und im vorbewussten Bereich ausgelöst. Der Einzelne hat keine oder nur eine geringe Kontrolle darüber, ob Stereotype aufgerufen werden. Erst danach kann entschieden werden, ob das Vorurteil angenommen wird. Def. „Vorurteile“: Starres, dogmatisches, längerfristiges und oft auch kollektivverbindliches Urteil, das vor der Prüfung aller sachlichen Aspekte gefällt worden ist. An einem Vorurteil wird oft auch dann noch festgehalten, wenn rationale Erfahrungen und Informationen gegen es sprechen. Vorurteile neigen dazu, affimativ sich selbst zu bestätigen (Vgl. Max Frisch: Andorra). Einmal erworben, neigen Stereotype dazu, ihre eigene Realität zu schaffen. Vorurteile haben kognitive, affektive und verhaltensbezogene Komponenten. Ein Vorurteil ist oft eine Antipathie, die auf einer fehlerhaften und starren Generalisierung beruht. 33 Der Inhalt eines Vorurteils ist i. d. R. wertend-moralisch. Oft handelt es sich um positive Autostereotype und um negative Heterostereotype. Es handelt sich nicht in erster Linie um ein kognitives Problem. Soziale Vorurteile richten sich gegen: (a) Gruppen oder einzelne Gruppenangehörige. Personen oder Personengruppen werden in sozialen Schemata (unterschwelliges Priming) repräsentiert. (b) Anhand von best. Kriterien wie Rasse, Ethnie, Nation, Weltanschauung, Religion, Sozialstatus, physisches Erscheinungsbild, Interessen etc... Vorurteile sind Einstellungen, die sich auf Personen beziehen, die sich selbst als einer Gruppe zugehörig fühlen und die auch in ihrer Gruppenzugehörigkeit wahrgenommen werden. Oft kommt es auch zu einer sozialen Diskriminierung zu Gunsten der Binnengruppe (positives Vorurteil). Studie von Clark und Clark (1947): Schwarzen Kindern wurde eine weiße und eine schwarze Puppe gezeigt und sie sollten angeben, welche schöner ist und mit welcher sie lieber spielen wollen. Eine große Mehrheit der schwarzen (!) Kinder präferierte die weiße Puppe. Beim gleichen Versuch im Jahr 1970 präferierten die schwarzen Kinder hingegen die schwarze Puppe. Funktion und Wirkungen von Vorurteilen: (a) Aufgrund ihrer Vereinfachung („Schwarz-weiß-Malerei“) erleichtern sie soziale Orientierung und Identifikation (Auto- und Heterostereotype). (b) Stärkung der gruppeninternen Verständigungskategorien und des Binnenkonsenses. (c) Stärkung des Gefühls der eigenen Überlegenheit und des Selbstwertgefühles. (d) Kompensation der Mängel der eigenen Gruppe. (e) Sündenbockfunktion oder Grundlage für Verschwörungstheorien. (f) Sie hemmen Prozesse des reflektierenden Nachdenkens und der prüfend differenzierenden Erfahrung. Lernen von Stereotypen: (a) In der Kindheit als Teil der kulturellen Wissensstruktur. (b) Bei 6-Jährigen zunächst rigide Stereotypisierung, ab etwa 9 Jahren zunehmende Flexibilisierung. (c) Sie verfestigen sich durch autoritäre und gruppenkonforme Erziehungsweisen. Begünstigende Faktoren für die Ausbildung von Vorurteilen: (a) Vermeidung von Kontakt zu best. Gruppen (Kontakthypothese) oder negative Erwartungen an einen Kontakt mit dieser Gruppe. (b) Vermeidung komplexer kognitiver Strategien wie Reflexion, Verifikation etc... (c) Theorie der realen Gruppenkonflikte, Interessendivergenz, z. B. versch. Stämme in einem Territorium, vgl. aber auch das Feldexperiment von Sherif! Wettbewerb als Ursache für soziale Konflikte und soziale Vorurteile. Liegt ein realer Gruppenkonflikt vor, so kann dieser durch Kooperation unter Anvisierung übergeordneter Ziele ausgeräumt werden. (d) Theorie der sozialen Identität: Vorurteile gegenüber anderen Gruppen sind dazu notwendig, nach innen für die eigene Gruppe eine Identität zu stiften, z. B. Identität eines Sektenmitglieds durch Abwertung eines Nichtsektenmitglieds oder Identität als Nazi durch Ablehnung von Juden. Vorurteile und Stereotype können über Eigenschaftslisten und Polaritätsprofile (z. B. Türken: tolerant intolerant) erfasst werden. Was sind die typischen Adjektive für best. Gruppen? Wie stark sind diese ausgeprägt? Modifikation: (a) Anleitung zur kognitiven Reflexion (vgl. Sokrates´ „Hebammentechnik“) Aber: Kognitive Aspekte spielen besonders bei stark verfestigten Vorurteilen nur eine geringe Rolle. (b) Interaktion mit und Integration von Randgruppen. (c) Gemeinsame Aufgaben und Ziele entwickeln (vgl. Feldexperiment von Sherif!). (d) Pluralistische Erziehung. (e) Analyse des sozialen Milieus der Vorurteilenden. (f) Stärkung des Selbstkonzeptes, um die Abwertung anderer nicht mehr für das eigene Selbstbewusstsein zu brauchen. 34 C – 2: Sozialpsychologische Grundbegriffe C – 2 – 1: Sozialisation (Quellen: HPP S. 669-679 / Grundkurs Psychologie 2000/01 / Witte, Sozialpsychologie S. 188ff. / Allg. Päd-VL) Def.: Sozialisation ist der Prozess, durch den ein Mensch zur gesellschaftlich handlungsfähigen Person wird. Sozialisation ist einerseits Anpassung an die sozialen Rollen- und Verhaltensanforderungen (affirmativer Aspekt), andererseits auch die Entwicklung eines Menschen zur autonomen Persönlichkeit (emanzipatorischer Aspekt). Im Sozialisationsprozess kommt es zur Auseinandersetzung mit der sozialen und materiellen Umwelt (äußere Realität), sowie mit den natürlichen Anlagen und der körperlichen und psychischen Konstitution (innere Realität). Zur Erklärung der Sozialisation bedarf es deshalb soziologischer und psychologischer Modelle. Sozialisation ist letztlich ein lebenslanger Prozess. Die Sozialisation vermittelt die Fähigkeit, die unmittelbare Befriedigung von Bedürfnissen aufzuschieben. Außerdem vermittelt sie gesellschaftlich nützliche Fähigkeiten und kulturelle Inhalte. Ziel der Sozialisation ist eine festgefügte Identität und die Erlangung von Kompetenzen, die zur Bewältigung von Alltagsproblemen notwendig sind. Sozialisation befähigt zum Übernehmen von Rollen in sozialen Interaktionen. Primäre Sozialisation: Frühkindliche, familiäre Sozialisation, vor allem in den ersten drei Lebensjahren. In ihr werden die Grundstrukturen der Persönlichkeit in folgenden Bereichen entwickelt: (a) Sprache (b) Denken (c) Empfinden (d) Soziales Verhalten (Erwerb von Generations- und Geschlechterrolle) Große Bedeutung hat der Erziehungsstil der Eltern (permissiv oder restriktiv / Wärme oder Ablehnung / Gelassenheit oder Ängstlichkeit / Einheitlichkeit oder Uneinheitlichkeit) Die Arbeits- und Berufsnormen der Eltern, das soziale Klima und die soziale Schicht des Elternhauses üben einen starken Einfluss auf die primäre Sozialisation aus. Beispiel: Je selbständiger Eltern an ihrem Arbeitsplatz sind, desto mehr Selbstentfaltungsmöglichkeiten gestehen sie ihren Kindern zu und desto größeren Wert legen sie auf eine Erziehung zur Selbständigkeit und Selbststeuerung. Phänomen der „sozialen Vererbung“ der Lebenslagenzugehörigkeit von einer Generation in die nächste. (Besonders in Deutschland gibt es einen engen Zusammenhang zwischen sozialem Status der Eltern, der Sozialisation und dem späteren Sozialstatus des Kindes. Grund: Kinder aus Arbeiter- oder Arbeitslosenfamilien empfinden einen starken Bruch zwischen der familiären Sozialisation und der der Bildungsinstanzen. Für Kinder aus akademischen Familien sind beide Sozialisationsformen besser kompatibel.) Sekundäre Sozialisation: Sie baut etwa ab dem 3. Lebensjahr auf der primären auf und erweitert und variiert diese. Träger der sekundären Sozialisation sind v. a. Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, Peer-Groups, Spielkameraden, sowie die Massenmedien. Die sekundäre Sozialisation legt die Grundlagen für den späteren sozialen Status, den Einfluss, die Position, das Einkommen etc... Charakteristisch sind: (a) Schrittweise Lösung von der Beziehung zu den Eltern. (b) Erlernen sachlicher und entemotionalisierter Beziehungen. (c) Erlernen von Gehorsam gegenüber der institutionellen Macht (Schule...). (d) Das Paradigma „Spiel“ wird durch das Paradigma „Leistung“ abgelöst. Neben der Einteilung in primäre und sekundäre Sozialisation ist es auch möglich, die Sozialisation auf 3 Niveaus zu beschreiben: Sozialisation auf dem Niveau des Mikrosystems (der Individuen): Familie und die ersten Peergroups: Hier kommen zum Tragen: Die ökonomischen Bedingungen der Familie und der Peergroup (vgl. dazu Bourdieu C – 2 – 2 – 2!), die Erziehungsorientierung der Eltern, der Aufbau affektiver Beziehungen zu den Eltern (assymetrische Beziehungen) und zu den Gleichaltrigen (symetrische Beziehungen). Sozialisation auf dem Niveau des Mesosystems (der Institutionen) bei zugleich fortlaufender Sozialisation auf der Mikroebene. Kindergarten und Schule als erste Institutionen. Erlernen ritualisierter Interaktionen (z. B. Spiel- und Kommunikationsregeln, Prüfungssituationen). Internalisierung institutionsspezifischer Werte und Normen. Kennenlernen institutionalisierter Rollen. Qualifizierung. Sozialisation auf dem Niveau des Makrosystems (der Gesamtgesellschaft) bei zugleich fortlaufender Sozialisation auf Mikro- und Mesoebene. Sozialisation zum mündigen Staatsbürger. Politische Sozialisation. 35 Sozialisationsinstanzen: (a) im Vorschulalter: Familie, Kindergarten, KiTa´s, ggf. Nachbarschaft (b) im Schulalter: Familie, Schule, Vereine, sozialpädagogische Institutionen wie Jugendzentren, verstärkt auch Massenmedien Insgesamt gewinnen die außerfamiliären Instanzen an Bedeutung. Zumeist (aber nicht immer) werden diese von professionellen Pädagogen geleitet. Sozialisationsstrukturen sind durch Asymmetrie gekennzeichnet. Ein Pädagoge hat ungleich mehr Einfluss als das Kind. Dennoch sind Sozialisationsprozesse wechselseitig und erfordern beidseitig Empathie. An die beiden Geschlechter sind unterschiedliche Sozialisationserwartungen geknüpft: Bei Jungen sind diese stärker am Paradigma des Berufes orientiert, bei Mädchen an dem der Familie. Jedoch lösen sich diese Unterschiede tendenziell auf. Gesellschaftliche Funktionen des Bildungs- und Sozialisationssystems: (a) Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Arbeit, Familie, Freizeit und öffentliches Leben. (b) Vergabe von anerkannten Leistungsnachweisen. (c) Vermittlung der Kompetenz zum Filtern relevanter Informationen. (d) Sicherstellen eines Konsenses über Grundwerte und soziale Umgangsformen. Risikofaktoren für eine gelingende Sozialisation: (a) Problembehaftete familiäre Voraussetzungen wie Scheidung, Arbeitsüberlastung der Eltern... (b) Zu hohe Leistungserwartung der Eltern, sehr hoher gesellschaftlicher Leistungsdruck aufgrund des Arbeitsplatzmangels. (c) Zu viele massenmediale Stimulationen und zu wenig soziale, motorische und emotionale Erfahrungen. C – 2 – 1 – 2: Sozialisation als Habitualisierung: Pierre Bourdieu (1979) C – 2 – 1 – 1: Sozialisation bei Emile Durkheim (1858-1917) Gefahr für moderne Gesellschaften sei die Anomie (Nichtmehraufgehobenheit in der Gesellschaft). Erziehung ist nicht nur eine individuelle, sondern eine soziale Tatsache. Sie muss ein einigendes Band stiften, dass die Gesellschaft trotz der modernen Arbeitsteilung zusammenhält und auf das Gemeinwohl und auf Solidarität hin ausrichtet. Der Heranwachsende soll durch die Sozialisation zu einer „aufgeklärten Zustimmung“ zu den Werten und Normen einer Gesellsachaft gelangen, diese aus freier Einsicht akzeptieren und sich ihnen unterordnen. Stiftung eines Kollektivbewusstseins. Die Sozialisation dient der Überwindung der Anomie und der Entfremdung. Sozialisationsprozesse sind Prozesse der Verinnerlichung der herrschenden Moral. Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse. Sozialisationsprozesse sind also immer abhängig von der gesellschaftlichen Realität. (Durkheim überträgt die Ethik Kants auf die Gesamtgesellschaft.) Bourdieu geht es nicht um die Reproduktion der Gesellschaft, sondern um die Aufhebung gesellschaftlicher Ungleichheiten. Sozialisation ist durch das Wirken von Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Konventionen bestimmt. Sozialisation ist bei Bourdieu das Einnehmen einer bestimmten Position im sozialen Raum. Der soziale Raum ist dreidimensional und konstituiert sich aus 3 Achsen: (a) Ökonomisches Kapital (Besitz) (b) Kulturelles Kapital (Wissen und Kompetenzen): Inkorporiertes kulturelles Kapital (Erlerntes Wissen), Objektiviertes kulturelles Kapital (Materielle Trägerobjekte von Wissen, z. B. Bücher), Institutionalisiertes kulturelles Kapital (z. B. Zeugnisse, Titel, Amt). (c) Soziales Kapital (Beziehungen). Die drei Kapitalformen zusammengenommen ergeben eine bestimmte Position im sozialen Raum und aus dieser erwächst ein bestimmter Habitus (Persönlichkeitsprofil). Dieser zeigt sich z. B. in der Kleidung, die man trägt, dem Auto, das man fährt, der Zeitung, die man liest, den Interessen, die man hat etc... Denken, Handeln und Fühlen vollziehen sich gemäß dem Habitus. V. a. die Familie ist die Instanz, die die Kapitalformen weitervererbt (und zwar nicht nur das ökonomische Kapital!). Die Schule ist ein wesentlicher Faktor zur Weitergabe von kulturellem Kapital. Vordergründig: Gefühl des Selbstführens. Hintergründig: Gesellschaftliches Geführtwerden. Ziel bei Bourdieu: Emanzipierung von gesellschaftlichen Zwängen. 36 C – 2 – 2: Personenwahrnehmung, Attribution, Implizite Persönlichkeitstheorien, Soziale Beeinflussung (Quelle: Tomas Kap. 8 / HPP S. 36ff.) C – 2 – 2 – 1: Soziale Wahrnehmung und Personenwahrnehmung Verschiedene Bedeutungsaspekte: (a) Wahrnehmung des sozialen Bereichs: Prozess der Eindrucksbildung über die Eigenschaften anderer Personen. (b) Wahrnehmung von Ereignissen in sozialen Situationen, z. B. das Zurechtweisen eines Schülers durch den Lehrer. (c) Mitbedingtheit der Wahrnehmung durch soziale Faktoren, wie z. B.: Wir nehmen Personen als zuverlässiger wahr, wenn wir erfahren haben, dass sie von Mitgliedern unserer sozialen Bezugsgruppe ebenfalls als zuverlässig beurteilt werden. Soziale Wahmehmungsprozesse: (a) Eindrucksbildung über andere Personen: Wie vollzieht sich der Prozess sozialer Wahrnehmung? Wie gelangen wir zu einem Eindruck über eine andere Person? Wie lässt sich beurteilen, ob unsere Eindrücke richtig sind? (b) Kognitionen als determinierende Faktoren der Eindrucksbildung: Welche Funktionen haben Wissens- und Überzeugungsstrukturen in dem Prozess der sozialen Wahrnehmung? Wie kommt es zur Ausbildung von wahrnehmungsbeeinflussenden Wissens- und Überzeugungsstrukturen? (c) Attributionsprozess: Wie vollzieht sich der Prozess der Kausalattribution? Soziale Wahrnehmung ist notwendig, weil die Handlungen anderer Personen das eigene Leben beeinflussen. Die soziale Wahrnehmung ist ein wirksames Instrument zur Einflusskontrolle, da sie es dem Handelnden erlaubt, sich einen zuverlässigen Eindruck von seinen Interaktionspartnern zu machen, aufgrund dessen er eine einigermaßen realistische Antizipation des Verhaltens eines Interaktionspartners machen kann. Die soziale Wahrnehmung setzt mit der Erwartung ein (Siehe dazu auch C – 4 – 2!). Die Erwartung ist eine Art Vorbereitung und bewirkt eine Sensibilisierung von Sinneseindrücken. Die Stärke und Richtigkeit dieser Erwartung hängt von mehreren Faktoren ab: (a) Häufigkeit vorangegangener (richtiger) Bestätigungen. (b) Stärke des monopolistischen Zuges. Je weniger Alternativen da sind, desto wahrscheinlicher ist die Erwartung richtig. (c) Kognitive Einbettung, d. h. die gedanklichen Assoziationen, die wir in einer best. Situationen haben. (d) Motivationale Einbettung: Die Wahrnehmung hängt von der Motivationslage ab. Ziele und Motive des Wahrnehmenden leiten die Suche nach Informationen und bestimmen den Inhalt dessen, was später wieder erinnert werden kann. (e) Soziale Einbettung: Mitbedingtheit unserer Erwartungen durch soziale Faktoren wie Rolle, Schicht usw... Asch konnte die Wirksamkeit von 4 Organisationsregeln bei der Eindrucksbildung nachweisen. Die Eindrucksbildung von Personen wird beeinflusst: (1.) Mehr von zentralen Eigenschaften und Merkmalen als von peripheren. (2.) Von den Kontextbedingungen, in die gegebene Eigenschaften eingebettet sind. (3.) Von der Reihenfolge, in der sich die Merkmale dem Wahrnehmenden darbieten. (4.) Tendenz zur Komplettierung: Hinzufügen fehlender Informationen, damit ein Gesamteindruck entsteht. Kognitive Faktoren beeinflussen den Wahrnehmungsprozess: (a) Das Menschenbild als Resultat bisheriger Lernerfahrungen im Umgang mit Interaktionspartnern und auch als Resultat des kulturspezifischen Sozialisationsprozesses. (b) Wertbezogene Überzeugungen: Nach der Allport-Vernon-Skala gibt es sechs Werttypen, den sozialen Werttyp, den theoretischen Werttyp, den ökonomische Werttyp, den politischen Werttyp, den ästhetischen Werttyp und den religiösen Werttyp. Man erkennt schneller wertbezogene Worte aus dem Wertebereich, der dem eigenen Wert entspricht. (c) Wirken der impliziten Persönlichkeitstheorien: Aus wenigen, unzusammenhängenden oder isoliert auftretenden Informationen wird ein stimmiger Eindruck von einer Person hergestellt. Es liegt eine implizite Annahme über Zusammenhänge zwischen verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften vor. (d) Einfluss von Schemata (Wissensstrukturen, die sich auf einen bestimmten Gegenstandsbereich beziehen), wie Prototypen, Stereotypen oder Skripts (standardisierte soziale Prozesse). Schemata bestimmen, welche Informa- 37 tionen aufgenommen und welche vernachlässigt werden und legen fest, wie die aufgenommene Information zu interpretieren ist. C – 2 – 2 – 2: Attribution und Kausalattribution Die Attribution (Zuordnung von Eigenschaften zu Personen) und die Kausalattribution (Ursachenzuschreibung) spielen bei der Gewinnung verlässlicher Eindrücke von unserer Umwelt eine bedeutsame Rolle. Der Mensch geht bei Wahrnehmungs- und Bewertungsvorgängen von der Überzeugung aus, dass Ereignisse und Handlungen bestimmte Ursachen haben (Kausalattributionsannahme). Eine beobachtete Handlung (z. B. eine Hilfeleistung) kann sehr unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, welche Gründe für ihr Auftreten angenommen werden. Attributionstheorie von Kelley: Unterscheidung von 3 Attributionstypen: (a) Personalattribution: Ursachen der Handlung liegen im Subjekt selbst. (b) Entitätsattribution: Ursachen liegen im Objekt der Handlung. (c) Umstandattribution: Ursachen liegen in den situativen Umständen. Verschiedene Ausprägungen von Kausalattributionen nach Kelley: (a) Distinktheit: Spezifische Attribution einer speziellen Person. (b) Konsensus: Große soziale Verbreitung einer best. Attribution. (c) Konsistenz: Eine Attribution tritt über einen längeren Zeitraum hinweg auf. Wann werden Kausalattributionen abgefragt? Weiner (1985): (a) Mastery: Ursachenforschung, um bessere Ergebnisse zu erzielen. (b) Funcionalism: Ursachenforschung, um besser zu verstehen. Besonders bei erwartungswidrigen oder negativen Erlebnissen werden Kausalattributionen abgefragt. 4-Felder-Schema der Kausalattribution nach Weiner (1986): Leitfrage: Woran lag es, dass ein Ergebnis so eingetreten ist, wie es eingetreten ist? stabil variabel internal (Eigene) Fähigkeit (Eigene) Anstrengung Attributionsverzerrungen entstehen durch (a) motivationale Faktoren. external Aufgabenschwierigkeit Zufall (b) kognitive Unzulänglichkeiten. (c) den fundamentalen Attributionsirrtum: Tendenz des Beobachters, den Einfluss des Handelnden auf bestimmte Ereignisse zu überschätzen und situative Einflussfaktoren zu vernachlässigen. Der Handelnde selbst neigt jedoch dazu, sein Verhalten durch situative Kontextbedingungen determiniert einzuschätzen (actor-observer-difference). (d) selbstwertdienliche Verzerrungen in der Attribution. Bedeutung für die Schule: (a) Wie attribuiert ein Schüler seine Leistung? (Am besten wäre eine internalvariable Attribuierung, durch Anstrengung. Lehrer sollte durch seine Kommentierungstechnik den Schüler dort hin leiten.) (b) Wie wird bei aggressivem Verhalten attribuiert? C – 3: Sozialpsychologie der Schule als Institution C - 3 - 1: Schul- und Klassenklima (Quelle: HPP) Begriffsexplikation: Gegenwärtig gibt es drei globale Verwendungsweisen des pädagogisch-psychologischen Begriffs: (a) Emotionale Grundtönung einer pädagogischen Gesamtatmosphäre, d. h. Gefühle, Stimmungen, Qualität der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, soziale Befindlichkeit in der Klasse. (b) Grundorientierungen und Werthaltungen in erzieherischen Umwelten. Klima entspricht also dem Begriff Schulethos oder Schulkultur. (c) Subjektiv wahrgenommene (Lern)Unwelt, also die subjektive Wahrnehmung, Beurteilung und das Erleben durch den Schüler. Diese Wahrnehmungen entstehen durch Selbstberichte. Klimawahrnehmungen spiegeln nicht einfach Umweltreize wider, sondern sind ein Resultat von Wahrnehmungen und Kognitionen, sog. Klimakognitionen. Wahrgenommene Konfiguration bedeutsamer Merkmale innerhalb der jeweiligen schulischen Umwelt. 38 Drei verschiedene Dimensionen des Klimas: (a) Individuelles Klima: Klimawahrnehmung einer einzelnen Person. Klimawahrnehmung durch verschiedene Persönlichkeits- und Situationsmerkmale beeinflusst (Alter, Geschlecht, Klasse...). (b) Aggregiertes Klima: Klimawahmehmung einer Gruppe einer Organisation (und Resultat einer Mittelwertsbildung). (a) Kollektives Klima: Innerhalb einer Organisation gibt es Gruppen von Personen, die durch Kommunikation ihre Umwelt ähnlich wahrnehmen. Versch. Facetten zum Verständnis des Klimabegriffs: (a) Inhalt: Aussagen über Klima können sich auf untersch. Bereiche einer Organisation beziehen (z. B. Beziehungen der Mitglieder untereinander, Beziehungen zwischen Vorgesetzten Begriffe: Sozialklima, Unterrichtsklima. (b) Organisationsbezug: Aussagen können sich auf eine Organisation insgesamt oder auf Ausschnitte beziehen. Begriffe: Klassenklima, Lehrkörperklima. (c) Subjektbezug: Aussagen können subjektiv erlebte Umwelt betreffen oder Kommunikation zwischen den Mitgliedern betreffen Begriffe: individuelles Klima, kollektives Klima. (d) Aggregierungsebene: Aussagen auf der Ebene verschiedenengroßer Personengruppe. Begriff: Aggregiertes Klima. (e) Quelle: Aussagen können von versch. Personengruppen stammen. Begriffe: Schülerklima, Lehrerklima, Elternklima. Messung des Klimas: Interviews und schriftliche Befragungen mit standarisierten Verfahren. Unterscheidung von 3 Ebenen bei der Auswertung von Klimadaten: (a) Beobachtungsebene: Ebene, auf der die Daten erhoben wurden (meist auf Individualebene). (b) Analyseebene: Ebene des Schulsystems, für die die Daten erhoben werden. Ich-über-mich-Aussagen? Ich-über-uns-Aussagen? Ich-über-sieAussagen? (c) Interpretationsebene. Fehlschlüsse treten auf, wenn Daten auf Individualebene erhoben werden, aber auf höherer Ebene verarbeitet werden (z. B. Berechnung von Klassenmittelwerten). Versch. Forschungstraditionen: (a) „Need-press-Modell“ (Murray 1938): Pädagogische Umwelten werden nach dem in ihnen herrschenden Umweltdruck beschrieben. (b) „Ecological psycology“: Umwelten von Individuen sollen möglichst objektiv erfasst und beschrieben werden und ihre Auswirkungen auf die in ihnen lebenden Personen gemessen werden. (c) Kognitiv orientierte Sozialpsychologie: Subjektive Repräsentationen von Umwelten erfassen und in ihrem Einfluss auf individuelles Verhalten bestimmen (Pervin, 1967). (d) Sozialisationstheorie: Einfluss struktureller Merkmale bzw. kollektiver Erfahrungen in der Schulklasse bzw. Schule auf die Entwicklung sozialen Verhaltens untersuchen (Fend, 1977). (e) Organisationspsychologie: Organisationsklima und -kultur als wichtige Faktoren, von denen Leistungsbereitschaft und Produktivität von einzelnen Mitarbeitern wesentlich beeinflusst wird (Weinert, 1998). Bei der Fortführung solcher Ansätze wird versucht die Schule als Lebensort von Kindern und Jugendlichen so zu gestalten, dass dort individuelles Wohlbefinden u. pers. Entwicklung ermöglicht und gefördert wird. Messinstrumente zur Messung des Klassenklimas: Verfahren Erhobene Größen CES Teacher Support, Lehrerkontrolle Classroom Klassengemeinschaft (Affiliation) Environment Scale Wettbewerbsverhalten (Competition) (Moss & Trickett Aufgabenorientierung 1974) Ordnung und Organisation, Regelklarheit Innovation Schüler-Involvement LASSO Fürsorglichkeit des Lehrers Landauer Skalen Aggression gegen den Lehrer zum Sozialklima Ausmaß der Cliquenbildung (1987) Hilfsbereitschaft Unterrichtszufriedenheit Reduzierte Unterrichtsteilnahme und Resignation etc... Insgesamt 17 Skalen (aufwendigstes Verfahren) Ausgerichtet am Klassenlehrerprinzip (v. a. GS) 39 LFSK Lindauer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima (Eder 1996) Pädagogisches Engagement Mitsprache, Gerechtigkeit Gemeinschaft vs. Rivalität Lernbereitschafts vs. Störneigung Sozialisations- und schultheoretischer Ansatz. Ausgerichtet am Fachlehrerprinzip (v. a. Sek. II) Dimensionalität des Klimas auf Klassenebene: (a) Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern. (b) Beziehungen der Schüler untereinander. (c) Qualität des Unterrichts. (d) Lernhaltungen der Schüler. Wirkungen des Klimas: (a) Vorhersage von Schülerverhalten aus Klimadaten ist eines der ersten Anliegen in der Klimaforschung. (b) Wahrgenommene Lernumwelt hat Erklärungskraft für Leistungen, Befinden, Verhalten, Einstellungen und Persönlichkeitsentwicklung der Schüler. Das Klassenklima ist eine wichtige Moderatorvariable. Schulklima: Def. nach Fend: Verlebendigung der institutionellen Vorstrukturierung der Schule durch die an der Schule handelnden Personen. Auskunftspersonen sind i. d. R. die Schüler. Fends Klimaskala: 3 Dimensionen: Inhalte, Interaktionen, soziale Beziehungen. Klima als Geflecht von Kommunikationsbeziehungen, Rollenselbstverständnis und Befindlichkeit der an der Schule beteiligten Gruppen. Schulklimadaten werden auch als Klassenklimadaten verwendet. Privat- und Alternativschulen unterscheiden sich in ihrem Klima deutlich von öffentlichen Schulen. In Schulen mit stark personenzentriertem Klima sind die Leistungen oft besser und die Schulunlust geringer. Besseres Schulinvolvement, weniger abweichendes Verhalten. Wichtig für Entkoppelung mit Herkunftsmerkmalen. Das Klima im Lehrkörper: Organisational Climate Description Questioniare (OCDQ) von Halpin und Croft (1963) erfasst 8 Dimensionen: 4 davon (disenagement, hindrance (Störung, Behinderung), esprit, intimacy) beziehen sich auf Rolleninterpretation, Kooperation und Beziehungen der Lehrer untereinander. Die anderen 4 Dimensionen (aloothness (Desinteresse), production emphasis, trust, consideration) beziehen sich auf das von Lehrern wahrgenom- mene Verhalten des Schulleiters. Studien zum OCDQ zeigen, dass das Lehrkörperklima relativ invariant gegenüber persönlichen und biographischen Merkmalen der Lehrer ist. Perspektiven für ein günstiges Klima: Verfahren unterscheiden zwischen Real- und Idealform. Diskrepanzen bilden dabei mögliche Ausgangspunkte für Klimaveränderungen (Oswald). Schritte zur Klimaveränderung: (a) Anfangsdiagnose stellen. (b) Maßnahmen und Strategien, die Veränderungen in Gang setzen; sie können auf versch. Ebenen (einzelne Lehrer, Gruppen von Lehrern) ansetzen. (c) Enddiagnose zur Evaluation des Projektes (Veränderungsmessung). C – 4: Sozialpsychologie des Unterrichts C – 4 – 1: Lehrer-Schüler-Interaktion (Quelle: HPP S. 381-386) Es sollte die Einseitigkeit vermieden werden, einseitig von der Lehrer- oder Schülerseite auszugehen, da es sich grundsätzlich um Wechselwirkungen handelt, um Prozesse der zirkulären Verstärkung, die sowohl positiv und leistungsfördernd, als auch negativ und leistungshemmend wirken können. Die Lehrer-Schüler-Interaktion hat 3 Ebenen: (a) Verhalten: Lehrer- und Schülerverhalten. (b) Kognitive Prozesse: Lehr- und Lernprozesse. (c) Affektiv-emotionale Kommunikation und Austausch. Aber: Sowohl die Lehrerpersönlichkeit, als auch dessen didaktische Fähigkeiten wirken sich auf die Schülerleistung aus. Einen besonderen Einfluss haben die impliziten Persönlichkeits- und Gesellschaftstheorien, die einen Wahrnehmungsfilter darstellen. Die Form des Unterrichtens hat auch Einfluss auf den Lernstil der Schüler. Hauptkriterien für Lehrereffektivität: (a) Affektive Beziehung zwischen Lehrer- und Schülergruppe (gut vs. schlecht). (b) Strukturiertheit der Aufgabenstellung (strukturiert vs. unstrukturiert). (c) Positionsmacht des Lehrers (hoch vs. niedrig): Machtquellen: (1.) Experten- und Informationsmacht: Wissen und Kompetenzen. (2.) Integrationsmacht: Beziehungen zu den Schülern. Erkennen und richtiges 40 Einschätzen sozial bedeutsamer Vorgänge in der Klasse. (3.) Identifikationsmacht: Wenn der Lehrer ein gutes Identifikationsangebot machen kann, kann er Aufmerksamkeit auf sich und seine Ziele lenken. (4.) Institutionelle („legitime“) Macht über Notenvergabe, Versetzungsentscheidungen, Belohnung, Bestrafungen, Zwänge etc... C – 4 – 2: Lehrererwartung, Schülererwartung, subjektive Theorien (Quellen: Hillmann S. 194 / HPP div. Stellen / Bierhoff) C – 4 – 1 – 1: Erziehungsstil von Lehrern Klassische Studie von Ryans (1970): Lehrerverhalten kann in drei Dimensionen untersucht werden: (a) distanziert, reserviert vs. verstehend, teilnehmend (b) planlos, vernachlässigend vs. systematisch, gewissenhaft (c) langweilig, routinemäßig vs. anregend, phantasievoll Einteilung von White (1939): Autokratisch, demokratisch, laissez-faire. Die höchste Leistungsfähigkeit, Kreativität, den stabilsten Gruppengeist, die entspannteste Atmosphäre und die geringste Aggression gibt es bei demokratischen Erziehungsstilen. Systematisierungsschlüssel von Tausch und Tausch (1973) (a) Grad der Lenkung (b) Grad der Wertschätzung Optimal: Mittleres Maß an Lenkung und hohes Maß an Wertschätzung. Kritik an diesen Lehrerverhaltensmodellen: Sie gehen einseitig vom Lehrer als der entscheidenden Instanz aus – und nicht von einer Lehrer-Schüler-Interaktion. C – 4 – 1 – 2: Das Kommunikationssystem Lehrer-Schüler Im zirkulären Prozess der Lehrer-Schüler-Kommunikation sind alle kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Aspekte von Bedeutung. Unter den affektiven Größen ist besonders das Vertrauen wichtig ( emotionale Sicherheit). Maßnahmen zur Verbesserung der Lehrer-Schüler-Kommunikation: (a) aktives Zuhören. (b) Verwendung von Ich-Botschaften und Feedbacks. (c) Aufbrechen dysfunktionaler Interaktionsmuster wie z. B. Schüler stört Lehrer tadelt Schüler stört weiter Lehrer tadelt weiter. Möglichkeit der paradoxen Intervention: Lob für störenden Schüler. Siehe auch: C – 2 – 2 – 1: Soziale Wahrnehmung! Def. und Komponenten von „Erwartung“ (a) Sie sind oft an (z. T. institutionalisierte) soziale Rollen geknüpft (z. B. Lehrerrolle). An diese Rolle sind best. Ansprüche, best. Aktions- und Reaktionsformen und best. Normen geknüpft (z. B. Fairness und Gleichbehandlung beim Lehrer). (b) Erwartungen können auch in der Persönlichkeit des Anderen gegründet sein. (c) Erwartungen gründen damit in subjektiven und zumeist impliziten Persönlichkeits- und Rollentheorien. (d) In zeitlicher Hinsicht ist unter Erwartung eine Vorstellung über das Eintreffen zukünftiger Ereignisse zu verstehen, bzw. über die Wahrscheinlichkeit seines Eintretens. (e) Erwartungen beeinflussen Ereignisse, entweder zu Gunsten der Erwartung (self-fullfilling-prophecy) oder zu Ungunsten der Erwartung (selfdestroying-prophecy). Lehrererwartungen und Feld(un-)abhängigkeit: Feldunabhängigkeit ist eine Persönlichkeitsdisposition: ausgeprägte Autonomie. Unabhängigkeit von externen Bezugsgrößen. Gute Fähigkeit zu kognitiven Umstrukturierungen, aber tendenziell beschränkte soziale Kompetenzen. Feldunabhängige Lehrer tragen höhere Erwartungen an die Schüler heran als feldabhängige und bewirken damit größere Leistungszuwächse. Schülerwartungen manifestieren sich u. a. in der Form von Schülerstrategien, z. B. darin eher erwünschte Antworten zu geben. (a) Anregender Unterricht. Lernfreude. (b) Gute Leistungen und gute Benotungen. (c) Kompetenzerweiterung. Zuverlässige Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse. (d) Antizipieren der Reaktion des Lehrers. (e) Schülererwartungen sind der Faktor „Nutzen“ in der Kosten-NutzenRechnung des Schülers, z. B.: Lohnt es sich ein Referat zu übernehmen? Lehrererwartungen: Mitarbeit, Leistungsbereitschaft, Interesse bei den Schülern. 41 Wichtig: Lehrer- und Schülererwartung unterliegen den „Gesetzmäßigkeiten“ der sozialen Urteilsbildung. Charakteristisch ist hierbei: (a) Soziale Urteilsbildung beruht auf der Voraktivierung von Schemata (Priming). (b) Eine einmal gebildete Meinung wird nur schleppend und unvollständig revidiert (Phänomen der Perseveranz). (c) Oft findet eine Assimilation der Wirklichkeit an die vorherrschenden Erwartungen statt. (d) Die Einschätzung von Personen und Ereignissen wird auch dadurch beeinflusst, was sich gerade ereignet und womit eine Person sich unmittelbar zuvor beschäftigt hat. C – 4 – 3: Pygmalion-Effekt (Quelle: HPP S. 567-572) Def.: Der Pygmalion-Effekt ist eine psychologische Variante der „selffulfilling prophecy“: Eine Voraussetzung oder Erwartung (im deskriptiven Sinn, nicht im normativen), die ihre eigene Erfüllung selbst verursacht. Die mentale Antizipation eines Ereignisses bewirkt das Ereignis der Antizipation. Den Begriff des Pygmalion-Effektes führte Rosenthal in Anlehnung an einen mythologischen zypriotischen Stadtkönig ( Ovid) ein. In der engeren Bedeutung von „Pygmalion-Effekt“ ist die interpersonale (und nicht die intrapersonale!) sich selbst erfüllende Prophezeiung im Schulunterricht gemeint. Die Beschreibung des Effektes geht auf Rosenthal zurück, der ab 1958 sozialpsychologische Experimente durchführte. Zunächst ging er davon aus, dass Forschungshypothesen die Forschungsergebnisse in Richtung der Hypothese beeinflussen. Dann: Feldexperiment Rosenthals: Lehrern wurde mitgeteilt, dass bei einigen (namentlich genannten) Schülern aufgrund von (vermeintlichen) Intelligenztests ein merklicher kognitiver Fortschritt zu erwarten sei. (Diese Schüler wurden jedoch zufällig ausgewählt.) In den Nachtests am Ende des Schuljahres wiesen diese Schüler im Vergleich zu ihren Mitschülern signifikant höhere Intelligenzwerte auf. Anmerkung: Für das Experiment war wichtig, dass ein Lehrer die Klasse neu übernahm, ansonsten fiel der Effekt entsprechend schwächer aus. Feldexperiment von Brophy und Good (1976): Forscher forderten Lehrer auf, eine Rangliste der Schüler aufzustellen nach dem Kriterium Leistungsfähigkeit. Dann: Unteruchungen im Unterricht. Ergebnis: Die Lehrer bemühten sich bei „guten” Schülern mehr und hatten mehr Geduld auf eine Antwort zu warten, während sie bei „schlechten“ schneller selbst die richtige Antwort sagten. Außerdem: Freundlichere Interaktionsatmosphäre. Es können richtige und falsche Erwartungen zur Self-fulfilling prophecy werden, wobei der Nachweis, welche Erwartung richtig und welche falsch war, nicht geleistet werden kann. Eine negative Spezialform einer „richtigen” Erwartung ist die Self-maintaining prophecy, die Beibehaltung eines best. Leistungsstandards. Es gibt auch einen subjektiven Pygmalioneffekt in der Leistungsbeurteilung: Hier ändert sich nicht die Realität oder die reelle Leistung, sondern nur die Wahrnehmung der Realität. Die Existenz dieses Effektes wurde in Versuchen zur Aufsatzbeurteilung nachgewiesen, aber auch bei der Beurteilung von Rechenaufgaben! Metaanalysen belegten statistisch einwandfrei die Existenz des PygmalionEffektes, auch wenn – aufgrund der Bekanntheit dieses Effektes („RosenthalSensibilisierungs-Effekt”) – Folgestudien eine schwächere Wirkung aufzeigen. Konsens heute: Versch. Variablen werden verschieden stark von Lehrerwerwartungen beeinflusst, v. a. Intelligenz, Leistung, Einstellung und Selbstkonzept. Die Gesamtvarianz der Schülerleistung, die auf eine Lehrererwartung zurückgeführt werden kann, schätzt Brophy (1983) auf 5 % bis 10 % ein. Den Pygmalioneffekt beeinflussende Faktoren auf Schülerseite sind (a) ethnische Zugehörigkeit des Schülers, (b) Geschlecht des Schülers, (c) sozioökonomischer Status der Schülerfamilie und (d) der Eindruck von Anstrengungsbereitschaft, den der Schüler vermittelt. Den Pygmalioneffekt beeinflussende Faktoren auf der Lehrerseite sind (a) eine autoritäre Persönlichkeit, „Dogmatismus-Syndrom“, Rigidität, Ambiguitätsintoleranz, (b) Empfänglichkeit gegenüber verzerrenden Informationen. Erzeugung eines positiven Pygmalion-Effektes durch (a) ein förderliches sozio-emotionales Klassenklima, (b) eine differenzierte und adäquate Leistungsrückmeldung (Feedback), (c) das Anbieten eines fordernden Lernstoffes (Input), 42 (d) einen schüleraktiven Unterricht (Output). Umgekehrt ließ sich auch ein Schülererwartungseffekt nachweisen: Wenn Schüler darüber informiert wurden, dass ihr neuer Lehrer besonders engagiert sei, zeigten sie eine höhere Lernbereitschaft. C – 5: Sozialpsychologie der Schülergruppe C – 5 – 1: Prosoziales Verhalten (Quelle: HPP S. 562-566 / Bierhoff) Synonyme Begriffe: Prosocial behaviour, altruistisches Verhalten, hilfreiches Verhalten. (Es lässt sich auch etwas differenzieren: Altruismus liegt prototypisch beim barmherzigen Samariter vor; hilfreiches Verhalten z. B. bei einer Stewardess.) Umfasst verschiedene Reaktionsweisen: Einer Person Hilfestellung geben, sie verteidigen, sie retten, mit ihr etwas teilen, für sie Zeit aufwenden. Es findet in der sozialen Interaktion zwischen Helfer und Hilfeempfänger statt. Zentral: Eine Wohltat erweisen, und zwar freiwillig! Prosoziales Verhalten erzeugt Verlässlichkeit. Voraussetzung für prosoziales Verhalten ist Empathie, also... (a) ...affektives Nachempfinden von Gefühlen (b) ...Übernahme einer fremden Perspektive (c) ...empathische Verhaltensweisen Erfassung von prosozialem Verhalten: (a) Beobachtung, Situationsanalyse und Beurteilung durch den Lehrer. (b) Einschätzung durch eine Bezugsperson (Vater, Mutter etc...). (c) Soziometrische Wahl durch die Schüler. Förderung von prosozialem Verhalten durch verschiedene Faktoren: (a) Die Einstellungen des Helfers (b) Die Einstellungen des Hilfsbedürftigen (z.B. Offenheit, Dankbarkeit) (c) Peer-Group: Prosoziales Verhalten verleiht Anerkennung durch Andere (Prosoziales Verhalten korrelliert stärker mit der sozialen Akzeptanz von Mitschülern als mit der Akzeptanz beim Lehrer!). (d) Lehrer: Positive attributionale Rückmeldung, d. h. durch Zeichnen eines positiven Charakterbildes wie „Du bist sehr hilfsbereit!“. (e) Aufgaben- und Zielorientierung. (Siehe etwas weiter unten!) (f) Materielle Belohnungen erhöhen höchstens situativ die Bereitschaft für prosoziales Verhalten. Dabei entsteht eine Entlohnungserwartung, die langfristig Hilfsbereitschaft unterminiert und die intrinsische Motivation für prosoziales Verhalten in eine extrinsische umschlagen lässt. Eine prosoziale Hilfestellung ist dann problematisch, wenn dadurch das Selbstwertgefühl des Hilfeempfängers bedroht ist (bei Gesichtsverlust). Deshalb steigt auch die Bereitschaft für das Anbieten und Annehmen prosozialer Verhaltensweisen, wenn die Aufgabenstellung teamworkorientiert ist, den Lernaspekt betont und die Motivation zu einer zielgerichteten Lösung groß ist. Entwicklung des prosozialen Verhaltens nach Eisenberg (1986): (a) Hedonistische Orientierung. (b) Orientierung an Bedürfnissen Anderer. (c) Orientierung an stereotypen Reaktionen. (d) Empathische Reaktionen. (e) Internalisierte prosoziale Orientierung. C – 5 – 2: Gruppen (Quellen: GK Psychologie 2000/01 / Zimbardo S. 599-603 / Bierhoff) Definition von „Gruppe“: (a) Sie konstituiert sich aus einer begrenzten Anzahl von Mitgliedern, die (b) über eine gewisse Zeitspanne hinweg in einem engen Kontakt und in einem gleichen Geschehenszusammenhang stehen, (c) sich gegenseitig als Mitglieder wahrnehmen, sich ihrer Zusammengehörigkeit bewusst sind, (d) sich in ihrem Verhalten gegenseitig beeinflussen, (e) ihre Meinungen und Einstellungen aneinander anpassen bzw. diese sich gegenseitig auf ein Orientierungssystem hin validieren, (f) die in bestimmter Hinsicht voneinander abhängig sind und (g) gemeinsame Ziele, die zumeist alleine nicht erreicht werden können, haben. Eine Gruppe ist ein differenziertes soziales Gebilde mit Rollen, gemeinsamen Zielen, Normen und einer klaren Beziehungsstruktur. Diese Aspekte unter- 43 scheiden eine Gruppe von der Masse oder der Menge, bei denen es sich nur um ein unstrukturiertes Nebeneinander vieler Menschen handelt. Unter Gruppenkohäsion versteht man die Bindung an eine Gruppe bzw. den Grad ihrer Attraktivität. Die Attraktivität steigt, wenn das Belohnungniveau innerhalb der Gruppe steigt. Differenzierungen von „Gruppe“ (a) Primäre Gruppe (Gruppe mit langandauerndem, engem emotionalen Kontakt) Sekundäre Gruppe (aufgabenorientierte Gruppe mit geringer Emotionalität) (b) Informelle (Wir-)Gruppen (Entstehen aufgrund von freiwilligen, persönlichen Beziehungen. Sie verfügen über konvergente oder kompatible Normen und Einstellungen) Formelle (Mitgliedschafts-)Gruppen (Bilden sich durch eine Institution oder eine Vorschrift. Zugehörigkeit durch äußere Merkmale oder eine bestimmte Rolle.) (c) In-group (eigene Gruppe) Out-group (fremde Gruppe). Die Höherbewertung der In-group gegenüber der Out-group bezeichnet man als Ingroup-Verzerrung. Die Zugehörigkeit zu einer In-group kann sich leistungsfördernd auswirken. Das Gefühl, zu einer rangniedrigeren Out-group zu gehören, kann das Mitgefühl stärken oder die Bereitschaft sich für gesellschaftlich diskriminierte Gruppen einzusetzen. Gruppenbildung nach Tuckman (1965): (a) Formierungsphase / Orientierungsphase / „forming“: freundliche, abwartende Atmosphäre und Überprüfung, welches Verhalten angebracht ist. (b) Konfliktphase / „storming“: Es kommt zu Konflikten zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern oder zwischen Gruppe und Leitern. Die Vermeidung der storming-Phase ist nicht erstrebenswert! In ihr werden wichtige Regeln, Verfahren, Ziele, Rollenverteilungen etc... verhandelt. (c) Normierungsphase / „norming“: Entwicklung von Normen, die das Zusammenleben erleichtern. Entwicklung eines Gruppenbewusstseins. Mit dem „Wir-Gefühl“ entsteht auch Distanz zu anderen Gruppen und deren Abwertung (vgl. Autostereotype vs. Heterostereotype!). Normen sind dabei (oftmals unausgesprochene) Vorstellungen der Gruppenmehrheit darüber, was richtiges Verhalten ist. Zur Sicherung der Normen werden i. d. R. Sanktionen ergriffen. Die Normen erleichtern die Kommunikation, erhöhen das Wir-Gefühl, und erleichtern eine effektive Aufgabenbewältigung. Auf der anderen Seite schränken sie die individuelle Freiheit ein und können zu Gruppenzwang führen. (d) Arbeitsphase / „performing“: Konzentration auf die Aufgabe und das Ziel. Das Tuckman-Modell stellt eine Vereinfachung dar, d. h. es kann auch zu Überschneidungen von Phasen o. ä. kommen. Gruppen können sich auch formell auflösen, dann: Beendigungsphase. Feldexperiment zur Gruppenbildung von Sherif (1961) (a) Aufbau des Feldexperiments: 12-jährige Jugendliche aus vergleichbaren familiären Verhältnissen werden in einem Sommerlager zusammengefasst. Studenten fungieren als teilnehmende Beobachter, die sich jedoch nicht in die Rolle eines Gruppenleiters drängen lassen durften. Sherif selbst war der Verwalter des Lagers. (b) Die Kinder lernten sich kennen. Bildung spontaner Freundschaften nach Sympathie (forming). Erhebung eines Soziogramms. (c) Es wurden zwei Gruppen entgegen den soziometrischen Wahlen gebildet. Daraufhin kam es zunächst zu Widerstand (storming). Durch Aufgaben, die nur durch engen Gruppenzusammenhalt erledigt werden können (Tragen sehr schwerer Gegenstände, Kochen...) kam es zur Gruppen- und Rollenbildung. Es wurden Identifikationssymbole (eine Flagge etwa) geschaffen, sowie eigene Gruppennamen: „Die Klapperschlangen“ und „Die Adler“. Es entstanden Autostereotype, und zwar in Form einer positiven Attribution der eigenen Gruppe. (d) Bei Kontakten mit der Fremdgruppe kam es zu aggressivem Verhalten aufgrund von Niederlagen in Wettbewerben und Rivalitäten. So wurde z. B. die Fahne der anderen Gruppe verbrannt. Es bildeten sich Heterosterotype, und zwar in Form einer negativen Attribution der anderen Gruppe. Auch die Gruppenstruktur veränderte sich: Körperlich starke Jungs wurden zu Führern. (Nebenbemerkung: Autostereotype sind wesentlich variabler als Heterostereotype. Sie lassen mehr Raum für individuelle Merkmale.) (e) Ein Zusammenbringen der beiden Gruppen brachte zunächst Konflikte zwischen ihnen hervor. Das Angebot angenehmer Tätigkeiten konnte die Feindseligkeiten nicht stoppen. Diese konnten jedoch durch gemeinsame Aufgaben (Gemeinsames Abschleppen eines Autos, Holen großer Wassermengen) überwunden werden. Die beiden Gruppen durchmischten sich wieder. Die Heterosterotype veränderten sich in eine positive Richtung. 44 Für die Entstehung von Gruppen sind gemeinsame Aufgaben und Ziele wichtiger als Sympathie oder Antipathie. Gemeinsame Ziele wirken kommunikationsfördernd und gruppenbestärkend. Sie erleichtern ein Zurückstellen persönlicher Ziele und begünstigen ein gutes und leistungsförderndes Gruppenklima. Die Etablierung von Gruppennormen: Der autokinetische Effekt (Sherif 1935): Eigene Einstellungen bewegen sich auf die Gruppennormen zu. Uniformitätsdruck, Belohnung von Konvergenz, Bestrafung von Divergenz. Der autokinetische Effekt ist in seiner Wirkung ambivalent. Experiment dazu: Schätzungen über einen Lichteffekt (Vpns sollten schätzen, wie sehr sich ein Licht, das sich in Wirklichkeit gar nicht bewegte, bewegte.) näherten sich einander an, nachdem sich eine Gruppe gebildet hatte, die darüber diskutierte. Reizbeurteilungen können selbst dann ins Wanken geraten, wenn sich die Vpns zunächst sehr sicher sind oder wenn sich die Vpns mit überzeugt vorgetragenen falschen Angaben auseinandersetzen müssen. Konformitätsneigung des Menschen. Rollen und Rollenkonflikte: Siehe unter Punkt C – 5 – 4! Machtstrukturen innerhalb einer Gruppe: (a) Institutionelle Macht: Macht durch Verfügbarkeit über Belohnung und Bestrafung. (b) Expertenmacht, Macht durch Kompetenzen. (c) Identifikationsmacht: hoher soziometrischer Rang, Vorbildcharakter. C – 5 – 3: Gruppenprozesse (Quellen: Luft, Gruppendynamik S. 37-41 / HPP / Witte, Sozialpsychologie) Effekte von Gruppenarbeiten bzw. Gruppeneinflüsse: (a) Effekt der „sozialen Erleichterung“ durch das bloße Vorhandensein einer Gruppe: Experiment von Triplet (1897): Kinder sollten Angelrollen aufwickeln. Taten sie das alleine, waren sie langsamer. Schon die Anwesenheit eines zweiten Kindes erhöhte das Arbeitstempo des Kindes. Beruhte auch nicht auf Konkurrenz, weil der Effekt auch ohne eine direkte Interaktion der Kinder zu Stande kam. (b) Effekt des „sozialen Bummelns“ bzw. der Verantwortungsdiffusion: Nachlassen der Leistungsbereitschaft in Gruppen durch... ... den „Free-rider-Effekt“: Trittbrettfahrermentalität schwächerer Schüler. ... den „Sucker-Effekt“: Demotivierung von Leistungsträgern, die sich ausgebotet fühlen. ... den statusabhängigen Effekt: Er reduziert Engagement statusniedrigerer Schüler. ... den Ganging-up-Effekt: Einpendeln der ganzen Gruppe auf das geringstmögliche Anstrengungsniveau. (c) Die Gruppe als sozialer Erfahrungsraum bietet ein umfangreiches Entwicklungspotenzial: (1.) Sich mit anderen vergleichen. (2.) Einen Status erwerben. Erwerb sozialer Kompetenz. (3.) Spielregeln mitbestimmen und befolgen. (4.) Zugehörigkeit erleben. Beziehungen und Freundschaften fördern. (5.) Gedanken austauschen und sich argumentativ behaupten. (6.) Selbsterfahrungen machen. (7.) Konflikte bestehen und Lösungen aushandeln. (8.) Kooperation und Solidarität praktizieren. (9.) Mit Andersartigkeit umgehen. (d) Insgesamt bieten Kleingruppen v. a. bei leistungsheterogener Zusammensetzung sowohl in kognitiver, als auch in sozialer Hinsicht für alle Beteiligten Vorteile. Die zu beachtenden Variablen bei der Initiierung von Gruppenprozessen sind: (a) Gruppengröße (sehr stabil: 2er-Gruppe – sehr „dynamisch“: 3er-Gruppe – bei größeren Gruppen: z. T. Ausklinken aus der Gruppe). (b) Art der Aufgabe. (c) Zusammensetzung der Gruppe (vgl. Soziometrie). (d) Zeit- und Qualitätsfaktoren. (e) Motivierende Kräfte innerhalb und außerhalb der Gruppe. (f) Grad an Gruppenautonomie bzw. Gruppenheteronomie, v. a. im Bezug auf die Methoden und Zielsetzungen. Damit korreliert der Grad des Konformitätsdruckes innerhalb der Gruppe. Wie stark sind die Gruppennormen? Wieviel Individualität lassen sie zu? (g) Mindestens ein Mitglied pro Gruppe muss zu tutoriellem Verhalten fähig sein. Vergleich von individueller Produktivität und Gruppenproduktivität. Wann ist Gruppenarbeit sinnvoll? (a) Problemlösekompetenzen und Produktivität können je nach Aufgabentyp höher bei individueller Arbeit oder höher bei Gruppenarbeit sein. (Proble- 45 me, die eine hochspezialisierte Kompetenz erforden vs. Probleme, die eine Vielfalt unterschiedl. Kompetenzen erfordern.) Gruppenleistungsexperiment von Thorndike (1938): 1200 College-Studenten wurden Aufgaben aus Geographie, Ökonomie und Alltag gestellt. Geprüft wurde die Richtigkeit der Ergebnisse vor und nach einer Gruppenarbeitsphase in Vierergruppen. Danach gab es bessere Ergebnisse, v. a. weil die „Richtiglöser“ eine größere Sicherheit hatten, richtig gelöst zu haben. Ihr Ergebnis wurde von anderen Gruppenmitgliedern öfter übernommen. Der Effekt ist umso größer, je größer die Nachprüfbarkeit der Ergebnisse ist. Ist diese nicht gegeben, zeigen Gruppenprozesse keine positive Wirkung. (b) Eine Gruppe kann eine Quelle interpersonaler Stimulierung sein. Für Gruppenarbeit geeignet: (a) Brainstormingaufgaben (b) Aufgaben vom Typ der gerichtlichen Wahrheitsfindung (z. B. im Literaturunterricht, Religion, Ethik etc...) (c) Aufgaben vom Typ des Interessenausgleichs (z. B. im Rollenspiel) (d) Aufgaben vom Typ der Güterabwägung (e) Aufgaben mit sozialen Zielsetzungen Ein Ziel von Gruppenarbeit: Das Erlernen von Teamworkfähigkeit: (a) Erkennen von Gruppennormen und Fähigkeit erwerben, auf diese einzuwirken. (b) Erlernen von ziel- oder verfahrensorientierten Methoden (c) Erlernen selbständiger sozialer Arbeitsorganisation: Aufgabenverteilung, Aufgabenkoordination etc... Gleiche Ziele in der Gruppe bessere Kooperation (Für den Unterricht: Entscheidend muss die Gruppenleistung sein bzw. dass möglichst alle Schüler ein best. Level erreichen.) Bei divergierenden Zielen leiden die Gruppenmoral und die Gruppenproduktivität. Zur Lösung von Gruppenkonflikten: (a) Kompromiss mit den opponierenden Gruppenmitgliedern. (b) Integration gegensätzlicher Ideen zu neuen Lösungen. Synthese. (c) Allianz der Gruppenmehrheit gegenüber opponierenden Mitgliedern (d) Ein- oder Unterordnung der opponierenden Mitglieder. (e) Ultima ratio: Ausschluss opponierender Mitglieder Gruppenkonflikte sind häufig unvermeidlich und tragen – wenn sie konstruktiv ausgetragen werden – oft zu einer erhöhten Produktivität bei. Eine Gruppendynamik entsteht häufig durch die Dialektik von Konsens und Konflikt. Vielzahl von Problemlösestrategien. C – 5 – 4: Rollen, Rollenverhalten und Rollenkonflikte (Quelle: Luft, Gruppendynamik, S. 42ff / GK Psychologie 2000/01) Def. „Rolle“: Eine Rolle zeichnet sich durch ein best. Verhaltensmuster bzw. einen Habitus aus. Sie charakterisiert den Platz eines Individuums in einer Gruppe. Eine Rolle besteht aus der Summe der Erwartungen, die Bezugspersonen an ein Individuum, das eine best. Position innehat, stellen. An eine Rolle werden Muss-, Soll- und Kann-Erwartungen herangetragen. (z. B. ein Lehrer muss den Schülern etwas beibringen, er soll alle gleich behandeln und er kann einen Schülerausflug organisieren.) C – 5 – 4 – 1: Rollenkonflikte Erster Systematisierungsschlüssel: Es gibt systembejahende, systemkritische und neutrale bzw. passive Rollen. Vgl. unter den Schülern: Den Wortführer, den Initiator, den Störer und den Gleichgültigen. Unterschiedl. Grade der Identifizierung mit der Rolle „Schüler“. Interrollenkonflikt: Ein Individuum gehört mehreren Gruppen gleichzeitig an und hat versch. Rollen inne, z. B. Rolle in der Peergroup und Rolle als Schüler, hier kann es zu Konflikten kommen. Intrarollenkonflikt: Es liegen unterschiedliche Erwartungen versch. Bezugspersonen an einen Rollenträger vor, z. B. Lehrer, der versch. Erwartungen von Eltern- und von Schülerseite entgegensteht. Rollenkonflikt durch Nichtakzeptieren einer Rolle, z. B. die Außenseiterrolle: Diese dient häufig als Sündenbock oder zur Stärkung des Wir-Gefühls einer Referenzgruppe. Der Konflikt liegt hier darin, dass die Erwartung der Referenzgruppe („Der gehört nicht zu uns!“) mit der des Außenseiters konfligieren kann („Ich will dazugehören!“). Zur Außenseiterrolle siehe auch: D – 5 – 4! Rollenkonflikt durch mangelnde Identifiziering mit einer Rolle. 46 C – 5 – 5: Soziale Positionen in Gruppen / Soziometrie (Quelle: HPP, S. 679-685) Def. wörtlich „Gesellschafts- oder Partnermessung“ (engl. „sociometry“). Es handelt sich dabei um eine Technik der empirischen Sozialforschung zur Erfassung interpersoneller Beziehungen in Gruppen sowie um die dazugehörige Theorie und methodische Reflexion. Begründet von Moreno (1934, 1954ff). Moreno konnte in der New York Training School for Girls, in der 505 Kinder von 12 bis 21 Jahren waren, demonstrieren, wie durch mehrmalige Umorganisationen des Schülerkollektivs nach soziometrisch ermittelten Anziehungen und Abstoßungen soziale Probleme eingedämmt werden konnten. (Moreno verband mit seiner Theorie sogar ein politisches Programm der „soziometrischen Revolution“, die die Gesellschaft dadurch umgestalten will, dass sie diese in solche Gruppierungen einzuteilen beabsichtigt, die den natürlichen Anziehungsbeziehungen entsprechen.) Ziele der Soziometrie: (a) Ermittlung typischer Beziehungsphänomene (z. B. Freundschaften, Feindschaften, ambivalente Beziehungen, Cliquen, Integration oder Desintegration von Subgruppen). (b) Klassifikation nach soziometrischen Rollen (z. B. Außenseiter, Stars, Isolierte, Abgelehnte, Unbeachtete, Kontroverse) und Beurteilung von deren soziometrischen Status. Vorgehen und Schritte einer soziometrischen Untersuchung: (a) Erhebung von soziometrischen Daten, z. B. durch Beobachtung und Wahrnehmung von Beziehungspräferenzen, Befragungen, Tests, Urteile verschiedener Personen, Bewertung der gegenseitigen Erwartungen oder durch soziometrische Wahl, die entweder nur auf Sympathie/Antipathie oder nach dem Grad der gegenseitigen Anziehung ausgerichtet ist. Die Daten müssen in einer festumrissenen sozialen Gruppe (wie z. B. in einer Klasse) erhoben werden. (b) Darstellung der Daten (entweder als Soziogramm, also als ein Pfeil- und Strukturdiagramm, oder durch die tabellenartige Form einer Soziomatrix). Das Soziogramm kann sowohl dyadische als auch polyadische Beziehungen, als auch einperspektivische Individualsoziogramme erfassen. (c) Auswertung der Daten (z. B. Ermittlung des soziometrischen Status von Individuen oder Subgruppen, Strukturkennzeichen wie Auffächerung in Subgruppen, Grad der Gesamtintegration, soziometrisches Statusgefälle). Die Soziometrie beschreibt Ausschnitte sozialer Netzwerke. Das zentrale Kriterium für soziometrische Untersuchungen in Schulklassen ist die Relationalität: Wer ist aktiv an einer Beziehung zu wem interessiert? Einseitigkeit oder Wechselseitigkeit der Beziehung? Die Relationalität kann auch dahingehend überprüft werden, inwieweit die Selbsteinschätzung über den Grad einer Beziehung mit der Interpretation dieser Beziehung durch den Anderen übereinstimmt. Der praktische Nutzen der soziometrischen Methode in der Schule: (a) Bei Gewalt in der Schule kann ein Soziogramm die Struktur der Beziehungen zwischen Tätern und Opfern ermitteln. Perspektivenvergleich: Wie denkt das Opfer über den Täter, wie der Täter über das Opfer? (b) Analyse und Förderung des Integrationsgrades von Ausländern und Minderheiten in Klassen. (c) Soziometrische Techniken als Lerngegenstand in Geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern wie D, R, Sk, G. (d) Soziometrie als Anstoß für soziale Lernprozesse. (e) Lösung von Problemen der Gruppierung von Schülern (Sitzordnung, Bildung von Klassen) (f) Eine soziometrische Leistungsbeurteilung kann als Ergänzung bei der Erstellung z. B. von Mitarbeitszensuren herangezogen werden. (g) Lehrer können die Genauigkeit ihrer sozialen Beziehungswahrnehmung anhand soziometrischer Daten überprüfen. Bei zunehmender Verkollektivierung des Erziehungs- und Bildungswesens (größere Klassenstärken etc...) ist die soziometrische Position ein entscheidender Faktor für die spätere Sozialisationskarriere. Es konnten Zusammenhänge zwischen der soziometrischen Kohäsion und der Zufriedenheit von Gruppen und der Arbeitsleistung nachgewiesen werden. Ein Hauptproblem bei der Anwendung soziometrischer Methoden ist der Widerspruch von Eltern. Dieser kann abgemildert werden durch Anonymisierung bei der Erhebung und Auswertung soziometrischer Daten. Ursachen für den soziometrischen Status: (a) Persönlichkeitsmerkmale, emotionale und soziale Intelligenz, erwünschte Eigenschaften, Attraktivität, Soziabilität. (b) Grad der Verdienste um das Gesamtwohl einer Gruppe und für das Wohlbefinden einer Gruppe („mood-Hypothese“). 47 Verbindende Faktoren innerhalb von Subgruppen bzw. trennende Faktoren zwischen Subgruppen: (a) ethnische Herkunft, Nationalität (b) Geschlecht (Mädchen spielen mehr mit Mädchen, Jungs mit Jungs...) (c) Interessen und Sympathie C – 5 – 6: Peergruppen, Freundschaften, Cliquen (Quelle: Oerter / Montada, Kap. 7) Funktionen der Peergruppe: (a) Verwirklichung von Gleichheit und Souveränität. Gleichheit verlangt Akzeptanz von Unterschieden zwischen den Gruppenmitgliedern und allgemeine Gerechtigkeit. Souveränität wird in der Peergruppe als Möglichkeit zur Selbstdarstellung und als Verwirklichung von Zielen erfahrbar. (b) Wichtige Entwicklungsfunktion im Jugendalter: Sie trägt zur Orientierung und Stabilisierung bei und gewährt emotionale Geborgenheit (Überwindung des Gefühls der Einsamkeit). (c) Sie bietet sozialen Freiraum für die Erprobung neuer Möglichkeiten im Sozialverhalten. (d) Sie hat eine wichtige Funktion in der Ablösung von den Eltern und bietet Unterstützung durch die normierende Wirkung einer Mehrheit („Die anderen dürfen auch so lange wegbleiben.“). (e) Sie kann zur Identitätsfindung beitragen, indem sie Identifikationsmöglichkeiten, Lebensstile und Bestätigung der Selbstdarstellungen bietet. (f) Peergruppen dienen ab der mittleren Adoleszenz auch dazu, den Kontakt mit dem anderen Geschlecht aufzunehmen. (g) These Eisenstadts, dass die Peergruppe und die durch sie getragene Subkultur oder Jugendkultur die gesellschaftlichen Konflikte und Defizite zum Ausdruck bringt. Die Subkultur sei eine Reaktion auf die Einseitigkeit des kulturellen Mainstreams, der etwas Neues und anderes, das die unterdrückten Lebensbedürfnisse artikuliert, entgegensetzt wird. Untersuchungen Fends über Cliquen und soziale Netze in Deutschland und der Schweiz: 8 % waren isoliert (relativ wenig soziale Beziehungen), 21 % mit Freundschaften, 34 % eingebettet in große Netze, 37 % Cliquenzugehörige (Kreis von Jugendlichen, der sich regelmäßig trifft und sich als zusammengehörig fühlt). In kleine Freundschaftsnetze eingebundene Jugendliche zeigten weniger Risiko- und Problemverhalten. Cliquengebundene setzten sich am meisten von den Leistungsnormen der Erwachsenengesellschaft ab. Isolierte zeigten die stärkste Erwachsenenorientierung. Jugendliche mit Freundschaften hatten gute positive Beziehungen zu Eltern und Lehrern. Es gibt auch deutliche Geschlechts- und Schulzugehörigkeitsunterschiede. Mädchen lebten weniger in Cliquen als Jungen. Am ausgeprägtesten sind Cliquenbildungen in Hauptschulen in Deutschland, am geringsten ausgeprägt bei Mädchen an Gymnasien. Der Wandel der Freundschaftsbeziehungen: Freundschaften dienen immer mehr und v. a. in der mittleren Adoleszenz als Medium der Selbstoffenbarung. Die wechselseitige Rückmeldung von Verständnis, Vertrauen und Verlässlichkeit stabilisiert zudem die Identität, so dass Freundschaften aus dieser Perspektive nahezu unentbehrlich für eine gesunde Entwicklung im Jugendalter sind. In der frühen Adoleszenz sind Freunde Personen, mit denen man etwas gemeinsam unternehmen kann, aber die Tiefe und Wechselseitigkeit der Beziehung und das besondere Gefühl der Freundschaft tritt erst später auf. Dieses verliert mit dem Eingehen partnerschaftlicher Beziehungen wieder etwas an Bedeutung. Siehe auch: D – 5 – 4! Familie und Peergruppe als komplementäre Gruppen: Situationshypothese: Brittain legte Mädchen der neunten bis elften Klasse Geschichten vor, die einen Konflikt zwischen Eltern- und Peererwartungen enthielten. Die Probandinnen wurden gefragt, was die Akteure der Geschichte wohl tun würden. Die befragten Jugendlichen entschieden sich für die Eltern, wenn der Kontext Entscheidungen für die Zukunft enthielt, und für die Peers, wenn augenblickliche Status- und Identitätsprobleme Gegenstand des Konfliktes waren. C – 5 – 6 – 1: Kommunikation unter Gleichaltrigen Das Regelwerk des Jugend- und Gruppenstils bestimmt in starkem Maße die soziale Interaktion und Kommunikation. Sehr große Unterschiede je nach Bildungsstand, sozialer Schicht, Interessen, Konfliktlage etc... Der Jugendjargon erfüllt mindestens 3 Funktionen: (a) Er drückt Dinge kurz und knapp und oft auch radikal simplifiziert aus und wendet sich damit gegen den Sprachstil der Erwachsenenwelt. 48 (b) Er drückt Erlebniszustände aus, die nach Meinung der Jugendlichen mit der herkömmlichen Sprache nicht beschrieben werden können, da diese Erwachsenensprache solche Zustände nicht kennt. (c) Er ermöglicht eine abgrenzende Verständigung und bewirkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Bedeutend ist auch die nonverbale Kommunikation. Gruppen tauschen sich oft über integrale Objekte aus, die den Mittelpunkt des Gruppenlebens bilden. Solche Objekte sind etwa das Motorrad, der Computer oder bestimmte Musikgruppen. Daneben gibt es Objekte, die ergänzend hinzugezogen werden, weil sie die Regeln und Thematiken des Gruppenstils unterstützen, wie z. B. Kleidung und Accessoires, die als Symbole der Zusammengehörigkeit und Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen dienen. Erziehungswissen Alltagspsychologisch fundierte, mit Erziehung verknüpfte Einstellungen, sowie instrumentelle Überzeugungen und Ziele C – 6: Sozialpsychologie der Familie C – 6 – 1: Erziehungsstile in der Familie (Quelle: HPP S. 139-146) Def. „Erziehungsstile“: Interindividuell verschiedene, aber intraindividuell relativ stabile Tendenzen von Eltern, bestimmte Erziehungspraktiken zu manifestieren. Erziehungsstile weisen eine charakteristische Konsistenz (Vorhersagbarkeit), Frequentialität (Häufigkeit) und Intensität von best. Erziehungspraktiken auf. Aus diesen formalen Kriterien lassen sich inhaltliche Konzepte entwickeln, z. B. „Strenge“. 3 Grundfragen: (a) Wie lassen sich individuelle Unterschiede im Erziehungsverhalten systematisch ordnen? (b) Welche Faktoren sind für das Zustandekommen solcher Unterschiede verantwortlich? (c) Welche Konsequenzen haben Unterschiede im Erziehungsverhalten für die Ausbildung spezifischer Persönlichkeitsmerkmale beim Kind? Die Familie ist die primäre Bezugsgruppe des Kindes und gewinnt Einfluss auf die Persönlichkeit des Kindes durch den „Familiencharakter“ im Ganzen und die Einzelpersönlichkeiten im Konkreten. Erziehungspraktiken Beobachtbare kindbezogene Reaktionen in erziehungsthematischen Situationen Zentrale Erziehungsstile (ermittelt durch induktiv klassifikatorische Forschung): (a) Schaefer (1961) Liebe vs. Feindseligkeit Autonomie vs. Kontrolle (b) Becker (1964) Liebe vs. Feindseligkeit Gewährenlassen (Permissivität) vs. Einschränken (Restriktivität) Gelassene Distanziertheit vs. Ängstliches Involviertsein (c) Weitere Kriterien: Unterstützung vs. Desinteresse Konsistenz vs. Inkonsistenz Reiz-Reaktionstheoretischer Erziehungsansatz: Zweikomponentenmodell elterlicher Bekräftigung (Hermann et. al. 1973). Konstitutiv: Paradigma des operanten Konditionierens. Kognitiver Erziehungsansatz: Kontrollmustermodell von Heilbrun (1973) Sozialkognitiver Erziehungsansatz: „Zweiprozessmodell elterlicher Erziehungswirkung“ von Krohne (1980ff): 1. Prozess: Durchführungsorientiertes Erziehen: Wie werden Aufgabenprozesse des Kindes begleitet? 2. Prozess: Ergebnisorientiertes Erziehen: Wie werden Ergebnisse bewertet? Hypothese: Die kindlichen Persönlichkeitsmerkmale entwickeln sich auf der Basis einer längerfristigen Konfrontation mit ähnlichen Ereignissen. Aber auch kurzfristig auftretende Episoden können zur Auslösung z. B. von Angst führen. Die Auswirkungen des elterlichen Erziehungsstils auf das Kind wurde v. a. anhand des Faktors „Angst“ untersucht. Analyse des Einflusses des elterlichen Erziehungsverhaltens auf die Entwicklung von Ängstlichkeit und auf die Angstbewältigungsdispositionen des Kindes. 49 Situationsaspekte für die Auslösung von Angst: (a) Das Vorliegen von Gefahrenreizen, z. B. gehäufte oder intensive Strafen oder aversive Reize. (b) Hohe Mehrdeutigkeit, Inkonsistenz, keine verlässlichen Infos und Signale. (c) Blockierung von Reaktionen zur Abwendung einer Gefahr, z. B. durch Handlungsrestriktionen der Eltern. Das elterliche Erziehungsverhalten hat Auswirkungen auf den Aufbau von Kompetenzen und Kompetenzerwartungen beim Kind. Hierbei zentral: Grad an Unterstützung oder Restriktivität: Unterstützend sind alle Maßnahmen, die zum Aufbau von Problemlösungsstrategien beitragen, sowie motivationale und emotionale Bedingungen für erfolgreiches Problemlösen schaffen (z. B. Stärkung von Interessen, Selbstkonzept...) Einschränkend sind alle Maßnahmen, die Orientierung an vorgegebenen Normen und Autoritätsmeinungen fördern oder die Abhängigkeit des Kindes vom Erzieher. Auswirkungen des elterlichen Erziehungsverhaltens auf die Konsequenzerwartung: Hier sind die Stile „negative Rückmeldung“ vs. „positive Rückmeldung“ wichtig (Neigung der Eltern zur Belohnung von erwünschtem oder Bestrafung von unerwünschtem Verhalten). Entscheidend sind die Determinanten: Frequentialität, Intensität, Konsistenz. Fazit: Ängstlichkeit wird gefördert durch: (a) Hohe Restriktivität (b) Wenig Unterstützung, wenig positive Rückmeldung (c) Viel Tadel, Strafe, negative Rückmeldung (d) Intensive Strafen (e) Inkonsistente Rückmeldungen Empirische Erfassung des Erziehungsverhaltens: (a) Schaefer & Bell (1958): Faktorenanalyse von Skalen, bes. „autoritative Kontrolle“, „Feindseligkeit“, „demokratische Einstellung“ Vergleichsweise globale und stereotype Erziehungseinstellungen der Eltern. (b) Bronfenbrenner et al. (1962): Parent behavior questionaire: Registrierung der vom Kind erlebten Erziehungsform. (Daran orientiert: Die „Marburger Skalen“) (c) Auf der Grundlage des Zweiprozessmodells von Krohne: „ErziehungsstilInventar“. Kritik an der klassischen Erziehungsstilforschung: (a) Vernachlässigung der Lernumwelt (b) Vernachlässigung des rückwirkenden Einflusses des Kindes auf die Eltern (c) Erziehungsprozesse werden über subjektive Aussagen erfasst und sind nur schwer und nur unter methodischen Risiken verobjektivierbar. (d) Erziehung ist ein Interaktionsprozess. Das erfordert methodisch eigentlich Beobachtungsverfahren. Eine Analyse von Verhaltenssequenzen vermittelt ein detaillierteres Bild von der Dynamik erzieherischer Interaktionen in best. Situationen. C – 6 – 1 – 1: Pluralisierung familiärer Lebenssysteme Traditionelle Kleinfamilie: Verheiratetes Ehepaar, ein Haushalt, mindestens 1 Kind, monogame, lebenslange, heterosexuelle Beziehung (optional auch als traditionelle Großfamilie mit Großeltern). Posttraditionelle Definition von Familie: Familie ist da, wo Kinder sind, z. B.: (a) Mutter-Kind-Familie (b) Vater-Kind-Familie (c) Lebensabschnittspartnerschaften mit Kindern (d) Regenbogenfamilie: Kinder in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften (e) Berufstätigkeit beider Eltern C – 6 – 2: Familiäre Beziehungen (Quelle: Oerter / Montada Kap. 7 / HPP S. 172ff.) Entwicklungsaufgabe: Die Lösung von der Ursprungsfamilie und Aufbau eines eigenständigen Lebens. Eltern können angesichts dieser Situation verschieden reagieren. Stierlin unterscheidet 3 Beziehungsmodi: (a) Bindungsmodus, der die Kinder festzuhalten versucht. (b) Delegationsmodus, bei dem die Jugendlichen zugleich festgehalten und ausgesandt werden („lange Leine der Loyalität“). (c) Ausstoßungsmodus, bei dem die zentrifugalen Kräfte dominieren und das Kind vernachlässigt oder ausgestoßen wird. 50 Fend nennt wichtige Indikatoren gelingender Anpassung der Eltern-Kind (Jugendliche)-Interaktion: (a) Bewahrung gegenseitiger Freude aneinander durch Vermeiden von Dauerkonflikten. (b) Fairness und Gerechtigkeit durch Aushandeln von Regelungen, Vermeidung von Willkür. (c) Weniger punitiver und stärker argumentationsorientierter Erziehungsstil. (d) Vermeidung von Überbehütung, aber Aufrechterhaltung unterstützender Maßnahmen, Schaffung von Zwischenbereichen der Unabhängigkeit. Hypothese der emotionalen Distanzierung: Der Höhepunkt des pubertären Wachstumsschubs führt zu einer Zunahme emotionaler Distanz zwischen Jugendlichen und ihren Eltern. Berufstätigkeit der Mutter oder Alleinerziehertum: Hierzu gibt es zwei alternative Hypothesen: (a) Die Berufstätigkeit der Frau erhöht den Stress in der Familie, da die Mutter eine Doppelbelastung erfährt; die Kinder bzw. Jugendlichen erhalten weniger Zuwendung, stehen weniger unter Aufsicht und sind daher stärker gefährdet. (b) Die Berufstätigkeit der Frau erhöht wegen der statussteigernden und emanzipatorischen Wirkung das Wohlbefinden der Mutter, was sich positiv auf die Familie auswirkt. Für beide Hypothesen gilt die Annahme des „Spil-over“: Überfließen der Befindlichkeit der Mutter auf die des Kindes. Die Familie ist zentral für die psychische Stabilisierung. Zahlreiche Studien belegen, dass kindliche Entwicklung und Wohlbefinden stark von familiärer Dysfunktionalität beeinträchtigt sind (z. B. psychosomatische Erkrankungen). In der Analyse gelingender vs. misslingender Familienkommunikation liegt der Schlüssel zum Verständnis vieler Verhaltensauffälligkeiten. Optimale Familienkommunikation: (a) Die am Gespräch Beteiligten wissen immer worum es geht und wer angesprochen ist. (b) Fragen werden klar formuliert und vollständig beantwortet. (c) Familienmitglieder können ohne Angst über ihre Hoffnungen und Befürchtungen sprechen. (d) Dispute werden nicht ignoriert. (e) Keine Bildung von Koalitionen, sondern Vermittlung und Stärkung der Beziehung. Die Familientherapie geht v. a. von dysfunktionalen Elternbeziehungen aus, die sich in Störungen beim Kind widerspiegeln. Pathologisierend ist nach Minuchin die Grenzverletzung in der Familienkommunikation, das Beharren auf Gesetzen und ein Elternteil, der sich mit dem Kind verbündet. Minuchin hat vier Familiencharakteristika herausgefunden, die ein psychosomatisches Symptommuster hervorrufen können: (a) Überstarke Bindungsmodi in der Familie. (b) Überprotektion. (c) Rigide Verhaltensmuster in der Familie. (d) Fehlen von Konfliktlösestrategien. Chronische Stressoren wie Familienkonflikte haben erheblichen Einfluss auf die Heranwachsenden. Gewalt in der Familie hat immense Auswirkungen auf die Entwicklung. Scheidungskinder: Die Symptombelastung der Trennungskinder liegt deutlich über den Normwerten. Daher ist es nach einer Scheidung wichtig, dass die Gestaltung der familiären Beziehungen so angelegt wird, dass sich die Kinder auch in der neuen Konstellation sicher und beschützt fühlen. C – 7: Soziale Konflikte und Konfliktbewältigung in der Schule 51 Gebiet D: Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters D – 1: Phasen, Übergänge und Entwicklungsaufgaben im Kindes- und Jugendalter D – 1 – 1: Modelle und Bedingungen der Entwicklung (Quelle: Oerter / Montada Kap. 1) Traditioneller Entwicklungsbegriff (z. B. bei Piaget): (a) Veränderungsreihe mit mehreren Schritten, die eine Richtung auf einen Endzustand aufweist, der gegenüber dem Ausgangszustand höherwertig ist. (b) Die Abfolge der Schritte ist irreversibel und die Veränderungen lassen sich als qualitative, strukturelle Transformationen beschreiben. (c) Frühere Glieder einer Veränderungsreihe sind Voraussetzung für die späteren. (d) Die entwicklungsmäßigen Veränderungen sind mit dem Lebensalter korreliert. Sie sind universell, natürlich und nicht kulturgebunden. Entwicklung ist eine naturgegebene Transformation, eine Entfaltung eines inneren Bauplans. (e) Phase des Aufbaus oder des Wachstums Phase der Reifung oder der Stabilität Phase des Abbaus. Kritik: (a) Annahme einer Veränderungsreihe ist einengend und empirisch schwer zu belegen. Viele Veränderungen sind Wandel eines Ausgangszustandes und nicht eine Abfolge mehrerer Schritte, z. B. neue Einsicht, Einstellung, Interesse und Handlungsziel. (b) Eine Stufe ist auch nicht immer notwendige Voraussetzung für das Erreichen der nächsten! (c) Besonders bei der Herausbildung von Persönlichkeitsmerkmalen, Wertvorstellungen etc... (die stark kultur- und kontextgebunden sind) weist der traditionelle Entwicklungsbegriff erhebliche Mängel auf. (d) Die Annahme eines End- oder Reifezustandes ist zu problematisieren. Die Entwicklung endet nicht im frühen Erwachsenenalter. Auch ist das Altern nicht mit dem Abbauen gleichzusetzen (vgl. Erfahrung, kristalline Intelligenz etc... können sogar noch ansteigen). (e) Neue Erkenntnis: Im historischen Vergleich gibt es starke kulturelle Veränderungen, z. B. deutlicher Anstieg der Intelligenz. Neue Kernannahme in Forschung und Theorienbildung: Es werden Vorannahmen getroffen über Aktivität und Passivität des Subjektes. Je nach dem, ob dem Subjekt und/oder der Umwelt ein Beitrag zur Entwicklung zugebilligt wird oder nicht, lassen sich vier prototypische Theoriefamilien unterscheiden: Aktives Subjekt Passives Subjekt Aktive Umwelt Interaktionistische Theorie Exogenistische Theorie Passive Umwelt Selbstgestaltungstheorie Endogenistische Theorie Exogenistisches Entwicklungstheorie: Behavioristisches Menschenbild. Der Mensch und seine Entwicklung sind vollkommen durch externe Reize kontrollierbar, deren Manipulation jedes gewünschte Ergebnis bringt (vgl. Kinderexperimente von Watson). Modell der mechanistischen Kausalität: Anstoß zur Veränderung kommt von außen. Verhaltenskontrolle durch Kontrolle der Reize. Endogenistische Theorie: Entwicklung als die Entfaltung eines angelegten Plans des Werdens: Anlagen und Reifung sind Erklärung für Veränderung. Wirken genetischer Entwicklungsprogramme in sensiblen Perioden. Selbstgestaltungstheorien: Mensch als Gestalter seiner Umwelt. Der reflexive Mensch reagiert nicht einfach mechanisch auf äußere Reize. Die Umwelt kann lediglich zum jeweils gegebenen Entwicklungsstand angemessene Anregungen geben, die in eigener entdeckender und strukturierender Aktivität des Subjekts konstruktiv genutzt werden müssen. Der Mensch trifft auch Wahlen bezüglich seiner sozialen und materiellen Umwelt. Der Mensch modifiziert von Geburt an seine Umwelt. Interaktionistische Theorien: Die Teilsysteme Mensch und Umwelt stehen im Austausch und beeinflussen sich gegenseitig. Kernannahme: Mensch und Umwelt bilden ein Gesamtsystem, sie sind beide aktiv und in Veränderung begriffen. Aktivitäten und Veränderungen beider Systeme sind verschränkt. 52 Veränderungen eines Teils führen zu Veränderungen auch anderer Teile. (Bsp: Nicht nur die Eltern formen das Kind, sondern Kind formt auch die Eltern.) Der Begriff der Passung: Brandstädter (1985) charakterisiert Entwicklungsprobleme als Passungsprobleme. Er spricht von Entwicklungsproblemen, wenn bestimmte Entwicklungsstandards nicht erreicht werden bzw. Entwicklungsaufgaben (Selbstständigkeit, Partnerschaft, Berufsfindung) nicht bewältigt werden. Die Entwicklungsprobleme sieht er als Diskrepanz (fehlende Passung) zwischen der tatsächlichen Lage und den (a) Entwicklungszielen des Individuums. (b) Entwicklungspotentialen des Individuums. (c) Entwicklungsanforderungen im familiären, schulischen, subkulturellen Umfeld des Individuums. (d) Entwicklungsangeboten. Die Entwicklungspsychologie untersucht die Auswirkungen von Einflussfaktoren nicht nur kurzfristig, sondern langfristig: Manche Situation mag – kurzfristig beobachtet – eine unangenehme und stressreiche Belastung darstellen, muss aber langfristig keine negativen Wirkungen haben (z.B. nach erfolgreicher Bewältigung). Die Entwicklungspsychologie untersucht, inwieweit der bereits erreichte Entwicklungsstand als Bedingung für die weitere Entwicklung eine Rolle spielt. Eine Einflussbedingung mag förderlich sein, wenn sie zur rechten Zeit kommt, Fehlentwicklung auslösen, wenn sie zu früh erfolgt, unwirksam bleiben, wenn sie zu spät erfolgt. Die Entwicklungspsychologie untersucht auch Aspekte der Kontinuität. Implizite Ziele der Entwicklungspsychologie: Günstige Beeinflussung von Entwicklung, Prävention von Fehlentwicklung, Vorbereitung auf Schicksalsschläge etc... D – 1 – 2: Entwicklungsaufgaben (Quelle: Oerter / Montada Kap. 1) Havinghurst (1948) hat den Lebenslauf als eine Folge von interaktionistischen Problemen strukturiert, die er Entwicklungsaufgaben nennt. Die Bewältigung von Problemen erfordert Entwicklung. Entwicklungsaufgaben gliedern den Lebenslauf. Drei allgemeine Quellen für Entwicklungsaufgaben während des Lebenslaufes: (a) Biologische Veränderungen (z. B. Pubertät, Menopause). (b) Gesellschaftliche Erwartungen: Aufgaben, die durch die Gesellschaft, etwa in Bildung und Beruf gestellt werden. Erwerb von Kulturtechniken. Zeitpunkt für Rollenübergänge. (c) Werte, Aspirationen und Ziele des sich entwickelnden Individuums. Interpretation, Bewertung und Sinngebung spielen eine entscheidende Rolle. Theorien der Entwicklung: (a) Sozialisationstheorien. (b) Entwicklung durch herausfordernde Probleme und Krisen im Lebenslauf (vgl. Erikson). (c) Aleatorische Entwicklungsmodelle: Entwicklung ist stark von situativen Zufällen abhängig. Entwicklungsaufgaben im Jugendalter: (a) Peer: Einen Freundeskreis aufbauen, d. h. zu Altergenossen beiderlei Geschlechts Beziehungen herstellen. (b) Körper: Veränderungen des Körpers und des eigenen Aussehens akzeptieren. (c) Beziehung, Partnerschaft und Familie: Engere Beziehungen zu einem Freund bzw. einer Freundin aufnehmen. (d) Ablösung: Sich von den Eltern loslösen und von ihnen unabhängig werden. (e) Beruf und Rolle: Sich über Ausbildung und Beruf Gedanken machen. (f) Selbst: Sich selbst kennen lernen und wissen, wie andere einen sehen. Klarheit über sich selbst gewinnen. (g) Werte: Eine eigene Weltanschauung entwickeln. Sich darüber klar werden, welche Werte man vertritt und an welchen Prinzipien man das eigene Handeln ausrichten will. (h) Zukunft: Eine Zukunftsperspektive entwickeln: Sein Leben planen und Ziele ansteuern, von denen man annimmt, dass man sie erreichen könnte. 53 D – 1 – 3: Persönlichkeitsentwicklung nach Erikson (Quelle: Oerter / Montada S. 64f / Internetquelle) Erikson (1973ff) baut seine psychosozialen Entwicklungsstufen (Haltung sich selbst gegenüber und gegenüber der Umwelt) auf Freuds Entwicklungsmodell der psychosexuellen Stadien auf. Eriksons besonderer Beitrag zur psychoanalytischen Entwicklungstheorie ist die Ausarbeitung eines Phasenmodells über die Kindheitsstadien hinaus und der Betonung einer Wechselwirkung zwischen der sich entwickelnden Persönlichkeit, der Umwelt, d. h. der Familie und der Gesellschaft. Erikson sieht die menschliche Entwicklung als Wachstumsprozess unter einem epigenetischen Prinzip, das er vom Wachstum des Organismus ableitet. Die Persönlichkeit wächst demnach in Abschnitten oder Stufen und gehorcht hierbei inneren Entwicklungsgesetzen, die eine Wechselwirkung zwischen dem Kind und seiner Umwelt ermöglichen. Dabei bemüht sich das Individuum fortgesetzt darum, seine in den verschiedenen Lebensabschnitten aktuell werdenden Bedürfnisse zu befriedigen und die Möglichkeiten der sozialen Umwelt zu nutzen. Jeder Lebensabschnitt hat sein besonderes Thema. Er ist somit auch eine Zeit vermehrter Konflikte und wird als Krise erlebt. „Krise“ im Sinne Eriksons bedeutet „normative Krise“ und unterscheidet sich von neurotischen oder traumatischen Krisen insofern, „als der Wachstumsprozess neue Energien und die Gesellschaft neue und spezifische Möglichkeiten bereitstellen“. Krise wird verstanden im Sinne eines Wendepunkts, an dem die Entwicklung verschiedene Wege einschlagen kann. Jede Krise bedarf Copingstrategien (Norman Haan), Bewältigungsstrategien, die konstruktiv und realitätsangepasst sein müssen. Abwehrstrategien sind ein falscher Weg. Der Lebenszyklus beruht auf aufeinander aufbauenden Stufen. Es gibt 8 Hauptstadien mit spezifischen Konflikten und Krisen. Wenn diese nicht bewältigt werden, kommt es zu Persönlichkeitsstörungen. Krisen des Übergangs. Dialektische Krisen. Die Konflikte können jedoch nie ein für allemal gelöst werden, aber es können Kompetenzen zur Bewältigung erworben werden. 1. Vertrauen vs. Misstrauen (1. Lebensjahr): Bildung von Vertrauen und Aufbau sicherer Beziehung v. a. zur Mutter. Wichtig ist aber auch Misstrauen als Schutzmechanismus. 2. Autonomie vs. Selbstzweifel bzw. Heteronomie (3. Lebensjahr): Verfolgen eigener Ziele oder die der Autoritäten, z. B. bei Sauberkeitserziehung, Anstandsregeln. Ziele: Selbstwahrnehmung als Handelnder. Körperbeherrschung. 3. Initiative vs. Schuldgefühle (4. und 5. Lebensjahr): Eroberung sozialer Positionen, Erkundung der Welt, Vertrauen auf eigene Initiativen und Kreativität. Regulation durch Eltern. 4. Wertsinn / Kompetenz vs. Minderwertigkeit (mittlere Kindheit): Schulanforderungen, soziale und intellektuelle Leistungsanforderungen. Negativ: Gefühle des Versagens. 5. Identität vs. Rollendiffusion (Adoleszenz): Aufbau eines Selbstkonzeptes. Identitätsfindung im Bezug auf Geschlecht, Herkunft, Religion, moralische Werte, politische Werte, Berufsbild etc... Integration zu einem konsistenten Selbstbild. Bei Misslingen: Rollendiffussion, Anfälligkeit für ideologische Einseitigkeiten. 6. Intimität vs. Isolation (Beginn des Erwachsenenalters): Solidarität in einer Wir-Gruppe. Fähigkeit zur Nähe und zu einer intimen Beziehung. 7. Generativität vs. Stagnation (mittleres Erwachsenenalter): Förderung der nächsten Generation. Interesse an Familie. Soziales, politisches, berufliches Engagement. Negativ: Selbstbezogene Interessen und Resignation. 8. Ich-Integrität vs. Verzweiflung (spätes Erwachsenenalter): Akzeptieren der Begrenztheit des Lebens. Verzweiflung über das, was im Leben nicht geklappt hat oder Erkennen der Ganzheit und der Sinnhaftigkeit des Lebens. Kritik: Fehlender empirischer Beleg. Oftmals spielen auch später noch frühere Konflikte und Krisen eine Rolle. D – 2: Intelligenzentwicklung Die entwicklungspsychologischen Erkenntnisse zum Phänomen der Intelligenz gehen auf zwei unterschiedliche Traditionen zurück: (a) Psychometrische Tradition (auf Intelligenztests aufbauend), z. B. Binet. (b) Arbeiten von Jean Piaget zur Denk- bzw. Intelligenzentwicklung von Kindern. 54 D – 2 – 1: Psychometrische Intelligenzmessung in der Folge von Alfred Binet (Quelle: Skript zu Schneider / Bullock) Erste Intelligenztests Ende des 19. Jhdt. von Binet und Simon: Testverfahren, um lernschwache Schüler zu identifizieren. „psychometrischer Ansatz“: Versuch, die intellektuelle Kapazität der Menschen mit einem genormten Verfahren zu messen: vereinbarte Mess-Skalen: Mittelwert 100, Standardabweichung 15 (normal = 85 bis 115 IQ-Punkte). Die Grundlage: Versch. Intelligenzmodelle: (a) „Generalfaktormodell“ (klassischer Ansatz): Intelligenz ist eine einheitliche Größe, die unsere intellektuellen Leistungen in unterschiedlichen Situationen bestimmt. (b) „Multiple“ Intelligenz: der Mensch verfügt in verschiedenen Situationen in unterschiedlichem Ausmaß über unabhängige Dimensionen der Intelligenz (z. B. Gedächtnis, Operieren mit Zahlen, Wortschatz, visuelle Wahrnehmungsfähigkeit). (c) Neuere Unterscheidung: kristalline Intelligenz (durch Gesellschaft und Kultur erworben, z. B. Sprachverständnis, Wortschatz) vs. fluide Intelligenz: Denkfähigkeit, -geschwindigkeit, -leistungsfähigkeit, die genetisch bestimmt sind (z. B. logische Schlüsse). Entwicklung der psychometrischen Intelligenz (Erkenntnisse stützen sich auf ältere amerikanische Langzeituntersuchungen): (a) kein konstanter IQ über die ganze Lebenszeit (b) größte Schwankungen zeigten sich im Vorschulalter (c) hohe Korrelation bei der IQ-Messung benachbarter Messzeitpunkte in der späten Kindheit und Jugend (d) vom Kindergartenalter an teilweise Langzeitstabilitäten über 10 Jahre. Erfassung der psychometrischen Intelligenz: Beispiel: HAWIK (HamburgWechsler-Intelligenztests für Kinder). Ausgelegt für das dritte bis sechste Schuljahr. Erfassung von: Verbaltests: (a) Allgemeines Wissen (b) Allgemeines Verständnis (c) Rechnerisches Denken (d) Gemeinsamkeitenfinden (e) Wortschatztest (f) Zahlennachsprechen (Zahlenkonservierung) Handlungstests: (g) Zahlen-Symbol-Test (visuell-motorische Koordination) (h) Bilderergänzen (Geometrisches Denken) (i) Bilderordnen (j) Mosaik-Test (k) Figurenlegen Die Ergebnisse von Intelligenztests zeigen, welche Position ein Kind im Vergleich zu seiner Altersgruppe einnimmt und wo seine Stärken und Schwächen in unterschiedlichen intellektuellen Bereichen liegen. Die Tests zeigen aber nur die richtige oder falsche Lösung, nicht etwa die Denkprozesse, die zur Lösung führten. Charakteristische Ergebnisse bei psychometrisch erfasster Intelligenz: (a) Wichtige Veränderungen im Alter zwischen 3 und 5 Jahren in Bereichen der bereichsspezifischen Denkentwicklung. Nach heutiger Auffassung sind die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Inhaltsbereichen eher lose (vs. Piaget: Veränderungen hängen strukturell zusammen und lassen sich auf Veränderung von Grundlagen des Denkens zurückführen). (b) Perspektivübernahme und die Fähigkeit, sich in Andere hineinzuversetzen, als weitere Entwicklung im Grundschulalter. (c) Vorläufer der Fähigkeit zum wissenschaftlichen Denken bereits im Grundschulalter. Analytische Fähigkeiten wie z. B Entwicklung von Hypothesen, Prüfen, Revidieren und Reflektieren von Prozessen (ist ein wichtiger Gegenstand der LOGIK-Studie). (d) Der über 5 Jahre beobachtete Zuwachs an Rohpunktwerten erfolgt nicht linear, sondern negativ beschleunigt. Die Zuwachsrate in der Intelligenz-Kapazität nahm mit zunehmendem Alter der Kinder leicht ab. Annäherung an ein Plateau der Intelligenz-Kapazität mit 12/13 Jahren, das dann im Jugendalter erreicht wird. (e) Individuelle Unterschiede zwischen Kindern; größere Zuwachsraten für Kinder mit anfangs höherem IQ-Wert. Erklärung durch Unterschiede in der sozialen Schichtzugehörigkeit Stabilität der Intelligenzunterschiede zwischen Kindern. (f) Interindividuelle Stabilitäten ab dem frühen Kindesalter (Fähigkeitsunterschiede, die im Vorschulalter beobachtet wurden, bleiben im späteren Alter stabil) 55 (g) Höhere Korrelationen für die Schulzeit im Vergleich zur Kindergartenperiode (h) Stabilität individueller Unterschiede wird ab der l. Klasse wesentlich. Meilensteine der Denkentwicklung im Vorschulalter: (a) Verständnis der Zahlinvarianz. (b) 3. bis 5. Lebensjahr: Wichtige Fortschritte in der intuitiven Alltagspsychologie des Kindes (z. B. Fähigkeit zum Unterscheiden subjektiver Überzeugungen und Realität; Fähigkeit zur sozialen Interaktion). (c) Für das Vorschulalter gilt, dass sich Kompetenzen in verschiedenen Fähigkeitsbereichen separat entwickeln und sich nur schwer Aussagen über die allgemeine intellektuelle Leistungsfähigkeit eines Kindes treffen lassen. Entwicklung des Denkens im Schulalter: (a) Aufgaben zur Erfassung des wissenschaftlichen Denkens von Kindern im Grundschulalter testen die Fähigkeit, Hypothesen zu prüfen und empirische Daten zu interpretieren. Hinzugezogen wurden Experimentier- sowie Interpretationsaufgaben. (b) Schon Grundschulkinder verfügen über ein Verständnis der Logik des Experimentierens, das sie unter unterstützenden Bedingungen demonstrieren können, wobei diese im Schulunterricht selten sind. Meist profitieren diejenigen Schüler mehr vom Unterricht (v. a. in Naturwissenschaften), die selbst Kontingenzen interpretieren und kritische Tests herstellen, ohne stets explizit angeleitet zu werden. (c) Einige Basisfertigkeiten, z. B. Interpretation von einfachen Datenmustern, wird schon früh im Grundschulalter erworben; die planvolle Konstruktion von Tests und die Interpretation komplexer Datenmuster hängt eng mit der Entwicklung eines expliziten, metatheoretischen Verständnisses des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses zusammen, das erst im Grundschulalter entsteht. Zusammenhänge zwischen Intelligenz, wissenschaftlichem Denken und Schulleistung: (a) Es wurden die Korrelationen zwischen den Maßen für die frühe und späte Schulzeit berechnet. Mathe- und Deutschnote als bestes Maß für Schulleistung. (b) Geringe Werte für korrelative Beziehung zw. Intelligenz und Schulnote in der 2. Jgst., danach leichter Anstieg in folgenden 3 Schuljahren. D – 2 – 2: Entwicklung des Denkens nach Piaget (Quelle: Skript zu Schneider / Bullock / Wikipedia-Artikel) Piaget war begeistert von Denkfehlern der Kinder, von der Eigenart ihres Denkens und den Unterschieden zum Denken der Erwachsenen. Seine Auffassung: Das Kind baut sein Verständnis der Wirklichkeit in der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt auf. (Vs. Reifungstheorien oder vs. behavioristische Lerntheorien) Kind ist aktiv handelndes Subjekt. Assimilation und Akkomodation sind die zentralen Prozesse der Anpassung des Organismus an seine Umwelt. (Vgl. Greifschema: Bei einer Greifbewegung eines Säuglings nach einem neuen Gegenstand kommt es zur Assimilation, beim Greifen nach Wasser zur Akkomodation. Die Inkorporation von einer Reihe von Gegenständen nennt Piaget generalisierende Assimilation. Explizit bedeutet Assimilation so viel wie kognitive Integration von Umwelteinflüssen und Akkomodation in etwa die Modifikation der vorhandenen Schemata im Angesicht dieser Umwelteinflüsse. Akkomodation ist komplementär zur Assimilation, aber auch widerläufig. Durch den Organismus wird eine Äquilibration, also ein Gleichgewicht, dieser beiden Prozesse angestrebt. Zunächst die Übersicht über Piagets Stadien der kognitiven Entwicklung: 1. Sensumotorisches Stadium (0-2 Jahre) – Erwerb von sensumotorischer Koordination, praktischer Intelligenz und Objektpermanenz. Diese aber noch ohne interne Repräsentation. 2. Präoperationales Stadium (2-6 Jahre) – Erwerb des Vorstellungs- und Sprechvermögens; gekennzeichnet durch Realismus, Animismus und Artifizialismus (zusammenfassend: Egozentrismus). 3. Konkretoperationales Stadium (6-11 Jahre) – Erwerb von Dezentrierung, Reversibilität, Invarianz bzw. Erhaltung, Seriation, Klasseninklusion. 4. Formaloperationales Stadium (11-16 Jahre) – Erwerb der Fähigkeit zum logischen Denken und der Fähigkeit Operationen auf Operationen anzuwenden. 1. Sensumotorisches Stadium (0-2 Jahre) (a) 0 - 1 Monat: Bei Geburt ist das Kind in einen Zustand des absoluten Egozentrismus eingeschlossen, es nimmt außer sich selbst nichts wahr. Das Kind beherrscht einfache Reflexe (Saugen, das Folgen von bewegten Objekten mit den Augen, das Schließen der Hand bei Berührung); aus 56 diesen Reflexen werden willkürliche Aktionen. Übung angeborener Reflexmechanismen. (b) 1 - 4 Monate: Neue Reaktionsmuster bilden sich durch zufällige Kombination primitiver Reflexe, die dann wiederholt werden. Das Kind vereinigt getrennte Aktionen, z. B. mit der Hand zappeln und daran saugen. Primäre und sekundäre Kreisreaktionen. Nachahmungsverhalten. (c) 4 - 8 Monate: Das Kind reagiert auf äußere Reize, aber Sehen und Greifen sind noch nicht koordiniert. Erste Versuche werden unternommen, um auf die Umgebung einzuwirken, z. B. durch das Erzeugen des Geräusches einer Rassel. Erkennen von Mittel-Zweck-Relationen. Experiment dazu: Strampeln bringt Rassel oder Mobile in Bewegung. (d) 8 - 12 Monate: Zielgerichtetes Verhalten entsteht. Ein Hindernis wird zur Seite geschoben, um einen Gegenstand zu greifen. Es entsteht die Objektpermanenz. Experiment dazu: Ein Gegenstand wird vor den Augen des Kindes durch einen Sichtschutz verdeckt. Das Kind wirkt überrascht und verhält sich so, als habe sich das Objekt in Luft aufgelöst! Ein Kind, das sich so verhält, hat Piaget zufolge noch keine Objektpermanenz ausgebildet. Neu tritt in diesem Alter auch die „Acht-Monat-Angst“ (Fremdeln) auf: Das Kind kann nun unterscheiden, welche Personen ihm vertraut sind und welche Personen ihm fremd sind. Während es früher alle menschlichen Gesichter angelächelt hat, schenkt es jetzt nur noch den ihm vertrauten Personen ein Lächeln. Auf Gesichter, die ihm fremd sind, reagiert es abweisend. (e) 12 - 18 Monate: Gerichtetes Tasten, Hilfsmittel werden gebraucht (auch zur symbolischen bzw. sensumotorischen Kommunikation), das Versuchund-Irrtum-Verhalten ist auf ein Ziel gerichtet. Entdeckung neuer Handlungsschemata durch Experimentieren. (f) 18 - 24 Monate: Das Kind beginnt, sich geistig zu entwickeln. Die motorische Aktion wird nach innen verlegt. Übergang vom sensumotorischen Intelligenzakt zur Vorstellung. Es gibt seinen egozentrischen Standpunkt auf der physischen, noch nicht auf der geistigen Ebene auf. 2. Präoperationales Stadium (2-6 Jahre): (a) Das Kind ersetzt die sensumotorischen Aktivitäten immer mehr durch verinnerlichte geistige Aktivitäten wie sprachlicher Ausdruck und Bildvorstellung. Es agiert in Gedanken. (b) Egozentrismus: Im präoperationalen Stadium sieht sich das Kind mit seinen Bedürfnissen und Zwecken noch als Zentrum. Alles wird in Bezug auf das Ich gesehen. Das Kind nimmt an, dass jeder so denkt wie es selbst und dass die ganze Welt seine Gefühle und Wünsche teilt. Dieses Gefühl des Einsseins mit der Welt führt das Kind zu der Überzeugung von seiner magischen Allmacht. Die Welt ist nur seinetwegen geschaffen. Aufgrund seines Egozentrismus ist das Kind nicht fähig, sich in andere Menschen hineinzudenken. Alle teilen vermeintlich seinen Standpunkt. Es kennt nur seine Perspektive. (c) Realismus: Das Kind glaubt, dass alles, was es für real hält (Worte, Namen, Bilder, Träume, Gefühle, der Weihnachtsmann), auch wirklich existiert. Auch auf der sprachlichen Ebene zeigt sich diese Egozentrizität. Das Kind ist nicht in der Lage, eine Geschichte so zu erzählen, dass sie für einen Zuhörer, der die Geschichte nicht kennt, verständlich wird. Experiment: 3-Berge-Aufgabe. (d) Animismus: Das Kind glaubt, dass die Dinge wie es selbst sind, belebt, bewusst und voller Absichten. Unterschiedliche Abstufungen dabei: Jeder Gegenstand kann mit einem Zweck oder bewusster Aktivität geladen sein. Ein Ball kann sich weigern geradeaus zu fliegen. / Nur Objekte, die sich bewegen, sind lebendig (z. B. Wolken). / Nur Objekte, die sich spontan und aus eigener Kraft bewegen, sind lebendig. / Nur Pflanzen und Tiere sind lebendig. (e) Artifizialismus: Vorstellung, dass die Gegenstände und Naturerscheinungen von Menschen geschaffen wurden. Zum Beispiel können Menschen Sterne, Berge und Flüsse erschaffen. Das Denken des präoperationalen Kindes beruht nicht auf Logik. Objekte und Vorgänge, die in einem raumzeitlichen Zusammenhang auftreten, werden in kausaler Beziehung gesehen, beispielsweise der Donner macht den Regen. (f) Zentrierung auf einen oder wenige Aspekte: Vgl. Nicht bewältigbare Aufgaben wie: 2 Autos starten gleichzeitig, eines kommt weiter. Kind: Es ist länger gefahren! / Wasser-Gefäße-Aufgabe / Klasseninklusionsprobleme (Männlich-weiblich-erwachsen-nichterwachsen-Test). 57 3. Konkretoperationales Stadium (6-11 Jahre): (a) Das Kind kann in Gedanken mit konkreten Objekten oder ihren Vorstellungen operieren. Das Denken ist auf konkrete anschauliche Erfahrungen beschränkt. Abstraktionen (wie Milliarden Jahre) sind nicht möglich. Das Denken ist noch nicht logisch sondern intuitiv und wird von der direkten Wahrnehmung beeinflusst. (b) Dezentrierung: So heißt der auf die unmittelbare Wahrnehmung folgende Prozess. Durch die Dezentrierung werden Irrtümer oder Verzerrungen der Wahrnehmung korrigiert. (c) Reversibilität (Umkehrbarkeit) ist das Vermögen in Gedanken rückwärts zu gehen. Durchgeführte Operationen können wieder rückgängig gemacht werden (Addition - Subtraktion). (d) Unter Invarianz bzw. Erhaltung ist die Fähigkeit zu verstehen, dass gewisse Eigenschaften eines Objekts konstant sind und erhalten bleiben, auch wenn es sein Aussehen ändert. Beispiele: Erhaltung der Substanz, auch wenn sich die Form ändert; Erhaltung des Gewichts bei Formänderung; Invarianz bzw. Erhaltung des Volumens, auch wenn das Wasser in ein höheres Gefäß gefüllt wird; Erhaltung der Länge eines Stocks auch wenn er verschoben wird; Erhaltung der Anzahl, auch wenn die Anordnung verändert wird. Experiment: Zwei Glasgefäße A und B. A ist gefüllt mit Wasser, B ist leer. Wasser aus Gefäß A wird komplett in B umgegossen. Der Wasserpegel steht nun in B höher als zuvor in A, da B schmaler und länglicher ist als A. Das Kind antwortet, dass nun in B nicht mehr Wasser enthalten ist als zuvor in A! (e) Seriation ist die Fähigkeit Objekte in einer Reihenfolge entsprechend der Größe, des Aussehens oder eines anderen Merkmals anzuordnen. Vgl. Stäbchenordnungstest. (f) Klassifikation bedeutet die Fähigkeit, eine Gruppe von Objekten entsprechend ihres Aussehens, Größe oder eines anderen Merkmals zu benennen oder zu identifizieren. Dies schließt die Idee ein, dass eine Klasse eine andere Klasse beinhalten kann (Klasseninklusion). 4. Formaloperationales Stadium (11-16 Jahre): (a) Metakognitionen: Der junge Mensch kann nun mit Operationen operieren, d. h. er kann nicht nur über konkrete Dinge, sondern auch über Gedanken nachdenken. Die Periode ist charakterisiert durch abstraktes Denken und das Ziehen von Schlussfolgerungen aus vorhandenen Informationen. (b) Variablenkontrollstrategien: Z. B. Versuch mit einem langen, leichten und einem kurzen, schweren Pendel. Ist Länge oder Schwere für Pendelfrequenz relevant? / Oder die Flugzeugaufgabe mit drei Variablen (Spitze, Flügel, Rumpf) Welche Form ist aerodynamisch am günstigsten? (c) Logische Gesetze: Identität, Negation, Korrelation, Reziprozität. / Mengeninklusions- und -exklusionsgesetze. Raum-, Zeit- und Mengenbegriffe werden an logische Regeln angepasst. (d) Verständnis für Proportionen: Wasser-Orangensaft-Aufgabe. / Fischfütterungsaufgabe (Dreisatzaufgabentyp). Diese vier Stadien haben folgende Charakteristika und Prinzipien: (a) Die einzelnen Stadien folgen notwendig aufeinander; ein Stadium muss durchlaufen sein, bevor das nächste folgen kann. (b) Die Stadien sind universell, d.h. sie kommen in allen Kulturen vor. (c) Die Stadien sind durch qualitative, nicht nur durch quantitative Unterschiede voneinander abgegrenzt. Höhere Stufen integrieren die niedrigeren. (d) Dialektisches Prinzip der Äquilibration: Erfahrung eines Ungleichgewichtes (fehlgeschlagener Assimilationsversuch, z. B. Kind will Wasser greifen) Anstrengung, das Gleichgewicht zu erreichen Findung des Gleichgewichtes da capo. (e) Äquilibration führt zu immer leistungsfähigeren Strukturen. (f) Auf jeder Entwicklungsstufe des Kindes besteht ein Gleichgewicht zwischen Assimilation und Akkommodation. Dieses Gleichgewicht wird durch die Reifung, durch Erfahrung und durch Erziehung gestört und führt zum Durchlaufen der einzelnen kognitiven Stadien. (g) Jedes Stadium ist durch Kompetenzen und Beschränkungen geistiger Fähigkeiten gekennzeichnet. Kritik an Piaget: Gegen seine Einteilung der kognitiven Entwicklung in Stufen und Stadien. Viele Experimente wurden erstellt, um zu zeigen, dass Kinder Fähigkeiten in einem Entwicklungsstadium X besitzen, die sie nach Piaget erst in dem Stadium Y besitzen sollten. Piaget kann kaum individuelle Abweichungen von diesen Phasen erklären. Unberücksichtigt: Kulturelle Aspekte bei der Wissensentwicklung: Formaloperatorisches Denken fehlt z. T in Naturvölkern. Außerdem: Piaget beschränkt sich auf die kognitive Entwicklung. Es fehlt: Sozialentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Motivationsentwicklung etc... 58 D – 3: Gedächtnis- und Wissensentwicklung D – 3 – 1: Gedächtnisentwicklung (Quelle: Oerter / Montada S. 659ff.) D – 3 – 1 – 1: Gedächtnisentwicklung von 0 bis 4 Jahren Methoden zum Nachweis von Gedächtnisleistungen in der frühen Kindheit: (a) Wiederholtes Vorlegen eines bestimmten visuellen Stimuli (z. B. ein Foto) Es ist ein Nachlassen der Aufmerksamkeit für diesen bestimmten Reiz beim zweiten und dritten Vorlegen beobachtbar – und zwar schon bei 3 Monate alten Babys. Sie verfügen bereits über die Unterscheidungsund Wiedererkennungsfähigkeit zwischen einem neuen und einem alten Stimulus. Habituierung bzw. „preference for novelty“. (b) Konjugierte Verstärkung: 3 Monate alte Babys strampeln häufiger, wenn an ihrem Knie ein Band befestigt ist, das ein Mobile in Bewegung versetzt. Die Babys haben eine assoziative Beziehung zwischen ihrer Bewegung und der des Mobiles gelernt. Auch eine Woche später konnte diese Assoziation noch beobachtet werden. Die Fähigkeit zum Wiedererkennen ist schon von Geburt an vorhanden und verbessert sich danach stetig. Respondentes Lernen. Generell spricht man vor dem 3. Lebensjahr von infantiler Amnesie. Es liegt kein Selbstkonzept vor und so gut wie kein episodischer Speicher. Danach Skripts: Schematisierte Handlungsabläufe, die sich später immer mehr entstandardisieren und flexibilisieren. Einjährige Kinder sind schon zum Modell-Lernen fähig: Ein Modell erzeugt an einem Gerät durch einen Knopfdruck einen Summton. Bekamen die Einjährigen einen Tag später das Gerät vorgesetzt, konnten sie den Ton auslösen. Mit jedem weiteren Lebensmonat verlängert sich die Speicherdauerhaftigkeit von modell-erlernten Handlungsweisen. Freie Reproduktionen, Imitationen. Schon bei Einjährigen sind alle Komponenten des Mehrspeichersystems (UKZG, KZG, LZG) vorhanden. Es gibt die ersten unbewussten und rudimentären Reproduktionsleistungen. Es entsteht die Fähigkeit, interne Repräsentationen aufzubauen (zunächst noch v. a. im nicht-deklarativen Speicher und davon im Konditionierungsspeicher.) Das Lokationsgedächtnis ist schon sehr früh entwickelt; im Vorschulalter gibt es hier kaum noch Verbesserungen. Bereits bei 3-jährigen Kindern können Lernerfahrungen des nicht-deklarativen Gedächtnisses nachgewiesen werden. Insgesamt ist das nicht-deklarative (oder implizite) Gedächtnis in weit geringerem Maß altersabhängig als das deklarative. Es ist schneller entwickelt. Im Vorschulalter noch sehr schwierig: Aufsuchen gespeicherter Infos ohne äußere Gedächtnishilfen. Keine effizienten Suchstrategien vorhanden. D – 3 – 1 – 2: Allgemeines zur Gedächtnisentwicklung von 5 bis 15 Jahren Die Gedächtnisleistung macht zwischen 6 und 10 Jahren die größten Fortschritte und steigt danach langsam bis zum 18. Lebensjahr an. Die Gedächtniskapazität steigt in diesem Alter aufgrund von neurologischen Reifungsprozessen – aber nur geringfügig und deutlich schwächer als die messbare Gedächtnisleistung. Die Gedächtnisspanne (Anzahl der erinnerbaren Einheiten) steigt von der frühen Kindheit an stetig aufgrund der verbesserten Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und der Weiterentwicklung strategischer und metakognitiver Kompetenzen (Chunkbildung etc...). Kognitive Prozesse werden im Verlauf ihrer Entwicklung zunehmend automatisiert und effizienter. Durch die höhere Effizienz beanspruchen gleichschwere Aufgaben immer weniger Gedächtniskapazität. Die Steigerung der Gedächtnisleistung im Grundschulalter ist stark auf diese Effizienzsteigerungseffekte zurückzuführen. Ein weiterer Faktor ist die Geschwindigkeit der verbalen Artikulation, die ebenfalls steigt. Es kommt zu schnelleren Enkodierungs- und Reproduzierprozessen im deklarativen Gedächtnis und v. a. in der „artikulatorischen Schleife“. Im Idealfall kommt es zur Entwicklung zu einem „guten Informationsverarbeiter“ (Pressley, Schneider et. al.), der sich dadurch auszeichnet, dass er... (a) ...Infos schnell auffasst und weiterverarbeitet (b) ...aktiv über mehrere und flexibel einsetzbare Gedächtnisstrategien verfügt (c) ...über ein breites Weltwissen verfügt (d) ...in den jeweiligen Problemlösesituationen gleichzeitig Strategien, Metagedächtnis, Welt- und Vorwissen aktivieren kann und so zu Analogieschlüssen kommen kann. Alle diese Aspekte können trainiert werden. 59 Ab dem späten Grundschulalter und bis in das frühe Erwachsenenalter erhöht sich auch die Reminiszenzrate, d. h. das zunächst vergessen geglaubte Infos wieder erinnert werden können. Dies ist auf breitere und flexiblere Enkodierungsverfahren zurückzuführen. Fazit: Gedächtnisentwicklung ist ein Prozess der Wechselwirkung und gegenseitigen Förderung zwischen den vier entscheidenden Determinanten: (a) Gedächtniskapazität (b) Gadächtnisstrategie (Siehe: D – 3 – 1 – 3!) (c) Bereichsspezifisches Wissen. (Siehe: D – 3 – 1 – 4!) (d) Metagedächtnis (Siehe: D – 3 – 1 – 5!) D – 3 – 1 – 3: Zur Entwicklung von Gedächtnisstrategien Produktionsdefizit: (a) Kein spontanes Anwenden von Gedächtnisstrategien, obwohl diese im Repertoire des Kindes vorhanden sind. (b) Strategieproduktion wird z. T. auch nach Training wieder aufgegeben. (c) Keine Anwendung von Wiederholungs-, Organisierungs- und Elaborierstrategien. (d) Kann durch gezielte Anleitung zu Gedächtnisstrategien ab dem Grundschulalter behoben werden. Mediationsdefizit: Vorschulkinder werden zur Anwendung einer Gedächtnisstrategie angeleitet, die aber die Gedächtnisleistung nicht verbessert, weil sie zu viel kognitive Anstregung erfordert oder weil sie noch nicht über die notwendigen kognitiven Voraussetzungen zur Strategieproduktion verfügen. Nutzungsdefizit: Spontanes Anwenden einer Gedächtnisstrategie ohne Verbesserung der Gedächtnisleistung, weil diese zu viel kognitive Anstregung erfordert. Ihre Anwendung ist zur Einübung der Strategie trotzdem sinnvoll, um später von ihr profitieren zu können. Es handelt sich hierbei oft um die Übergangsphase kurz vor dem gewinnbringenden Einsatz der Strategie. Im Alter von 5 bis 12 Jahren verbessert sich das strategische Verhalten bei Gedächtnisaufgaben massiv. Bei Memorieraufgaben steigert sich das aktive Wiederholen (rehearsal) der zu memorierenden Objekte von 10 % auf etwa 85 %. Psychologische Untersuchung: Kindergartenkinder, Zweitklässler und Fünftklässler sollen sich Bildobjekte möglichst gut merken. Sie bekommen einen Sichtschutzhelm aufgesetzt. Ermittlung der Lippenbewegungen bei den getesteten Kindern. Parallel zu den mit dem Alter häufiger werdenden Lippenbewegungen steigerte sich die Memorierleistung. Ab etwa dem 8. Lebensjahr steigert sich die Fähigkeit zum Organisieren und Kategorisieren deutlich. Solche Strategien werden zunehmend spontan eingesetzt. Ein erlernter Einsatz von solchen Strategien ist schon etwa ab dem 6. Lebensjahr möglich. Organisations- und Kategorisierungskompetenzen werden durch das Schulsystem erlernt – und treten bei Naturvölkern kaum auf. Psychologische Untersuchung: Probanden bekommen versch. Items vorgelegt, die sich kategorieren lassen, z. B. nach Tieren, Fahrzeugen etc... Bessere Merkleistung ab etwa 8 Jahren durch verstärktes Kategorisieren und „geordnetes Abspeichern“ unter Oberbegriffen. Mit 5 Jahren: Höchstens assoziatives Kategorisieren, später systematischeres Kategorisieren. Elaborieren: Hier handelt es sich um eine kognitive Operation, bei der semantische Beziehungen zwischen mehreren Wörtern aufgebaut werden. Findet v. a. beim Paar-Assoziationslernen Anwendung, z. B. Vokabellernen. Hier fallen individuelle Unterschiede stärker ins Gewicht. Elaborierstrategien treten erst relativ spät, z. T. erst in der frühen Adoleszenz verstärkt auf. Metakognitive Selbstprüfung und Verstehenskontrolle: Externe Gedächtnisanforderung wird vorweggenommen. Langsamer Beginn dieser Strategie mit 9 Jahren. V. a. im Alter von 6 bis 16 Jahren kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der Abrufstrategien. Infos aus dem LZG werden leichter zugänglich, mit flexibleren Strategien abgerufen und sind auch in Situationen abrufbar, die sich von der Enkodierungssituation deutlich unterscheiden. Es liegen also mehr und flexiblere interne Erinnerungshilfen vor (z. B. Rekonstruktionspläne). Fuzzy-Trace-Theorie: Es wird nicht so sehr auf exakte Repräsentationen zurückgegriffen, sondern auf vagere, allgemeinere. So können größere Datenmengen, wenn auch nicht ganz so exakt, gespeichert werden. D – 3 – 1 – 4: Zur Entwicklung des bereichsspezifischen (Vor-)Wissens Auch das Ausmaß des Vorwissens, der qualitative und quantitative Grad der Vernetztheit von Wissen und Begriffen korrelliert stark mit der Gedächtnisentwicklung. Die Vertrautheit von Begriffen wirkt sich auch positiv auf die Gedächtnisentwicklung aus: Das Memorieren von Cartoon-Figuren, die Drittklässlern vertraut waren und Collegestudenten nicht, fiel den Jüngeren in Versuchen von 60 Lindberg (1980) leichter! Kinderexperten können – bereichsspezifisch – bessere Leistungen erbringen als Erwachsene. Chi´s Studie (1978) mit zehnjährigen Schachexperten und erwachsenen Schachnovizen war so aufgebaut, dass Konstellationen auf dem Schachfeld erlernt und rekonstruiert werden sollten. Die Zehnjährigen Experten schnitten besser ab (und konnten ihre Leistung auch besser einschätzen) als die erwachsenen Novizen, obwohl sie bei gängigen Gedächtnistests schlechter abschnitten. Sollten sinnlose Anordnungen rekonstruiert werden, ging der Behaltensvorteil der Experten verloren. Experten-Novizen-Paradigma (vgl. hierzu auch das Phänomen des „Idiot savant“, des „wissenden Idioten“, der bereichsspezifisch zu unglaublichen Merk- und Denkleistungen fähig ist!) Außerdem können in einer Altersstufe „Schlechtlerner-Experten“ die „Gutlerner-Novizen“ übertreffen. Das ansteigende Welt- und Vorwissen verbessert die Gedächtnisleistungen quantitativ (Es können mehr Fakten behalten werden) und qualitativ (Die Fakten können präziser eingeordnet und bewertet werden). D – 3 – 1 – 6: Zur Entwicklung des episodischen bzw. des autobiographischen Speichers D – 3 – 1 – 5: Zur Entwicklung des Metagedächtnisses Entwicklung des deklarativen (expliziten) Metagedächtnisses (= vorhandenes Wissen über Gedächtnisvorgänge): Interviewstudie von Kreutzer et al (1975): Kindergartenkinder wissen bereits (1.) dass man vergessen kann, (2.) dass bei steigender Zeit eher vergessen wird, (3.) dass es leichter ist, sich weniger zu merken als mehr. Im Verlauf der Grundschulzeit lernen Kinder zudem (1.) dass die Lernzeit Auswirkungen hat auf den Lernerfolg, (2.) dass wörtliches Lernen schwieriger ist als sinngemäßes Lernen (3.) dass Ablenkungen den Lernerfolg beeinträchtigen und (4.) dass nach Oberbegriffen geordnete Inhalte leichter zu merken sind. (5.) Zunehmend engere Beziehungen zu strategischem Verhalten Entwicklung des prozeduralen Metagedächtnisses (= Fähigkeit zur Regulation und Kontrolle gedächtnisbezogener Aktivitäten, „monitoring“, „self-regulation“): Während 6-Jährige für das Lernen leichter und schwieriger Items gleich viel Zeit aufbringen, steuern 12-Jährige ihr Verhalten dahingehend, dass sie für schwierige Items wesentlich mehr Zeit veranschlagen als für leichte Items. ( Dies ist nur durch deutliche Fortschritte des prozeduralen Meta- gedächtnisses erklärbar. Dieses entwickelt sich noch bis in die späte Adoleszenzeit weiter.) Grundschulkinder können Metagedächtnisstrategien nur mit einer großen mentalen Anstrengung und einer Aufmerksamkeits-Fokussierung bewältigen. Die Entwicklung hin zu einem spontanen Einsatz dieser Strategien beginnt im Grundschulalter und setzt sich bis in die späte Adoleszenz fort. Die Entwicklung des Metagedächtnisses ist eine kulturelle Errungenschaft, die in Naturvölkern nicht anzutreffen ist. Vorschul- und Grundschulkinder können Geschichten und Episoden dann besser wiedergeben, wenn sie auf Skripts zurückgreifen können, d. h. auf einen schematischen Handlungsplan wie z. B. für „Ins-Restaurant-gehen“. Geschichten werden vor allem in frühen Entwicklungsphasen den Frames dieser Skripts angepasst. Bereits Kindergartenkinder können sich an wichtige persönliche Ereignisse erinnern. Vorhandensein eines episodischen LZG. Ältere Kinder können sich zunehmend an periphere Details und auch an NonSkript-Informationen (vom ritualisierten Schema abweichend) erinnern. Wenn Skripts verwendet werden, werden die Slots zunehmend flexibler gefüllt. Ältere Kinder können ihre Erlebnisse flüssiger, freier und konsistenter reproduzieren. Mit zunehmendem Alter können fehlende Informationen von Erzählungen besser erschlossen werden (Bessere Nutzung unvollständiger Infos). D – 3 – 2: Wissensentwicklung (Quelle: Oerter / Montada S. 622-653) Ältere Theorien gingen von einer bereichsübergreifenden Wissensentwicklung aus (Piaget, aber auch die sog. „Informationsverarbeitungstheorien“). Grundannahmen: (a) Es vollziehen sich globale Veränderungen des Denkens über alle Inhaltsbereiche hinweg. (b) Es gibt im Vorschulalter Einschränkungen des Denkens, die erst ab dem Grundschulalter überwunden werden. Einschränkungen seien v. a. ein feh- 61 lendes Kausalverständnis, ein fehlendes logisches Verständnis, Unfähigkeit zum Perspektivenwechsel aufgrund eines Egozentrismus. (c) Erst wenn eine globale Veränderung einsetzt, dann verändern sich auch die einzelnen Inhaltsbereiche. Kritik am Paradigma der bereichsübergreifenden Wissensentwicklung: (a) Zahlreiche Experimente konnten belegen, dass alle Einschränkungen des Denkens im Vorschulalter so nicht auftreten. Versuche konnten zeigen, dass schon 3-Jährge einfache kausale Zusammenhänge verstehen und Ursache und Wirkung einander zuordnen können. Außerdem können sie „Sehen“ und „Gesehenwerden“ auseinanderhalten und damit einen Perspektivenwechsel vollziehen. Es gibt also lediglich partielle Einschränkungen. (b) Es gibt wenig Evidenz für die Synchronie der Veränderungen über alle Bereiche hinweg. Heute geht man deshalb von Prozessen bereichsspezifischen Wissenserwerbs aus und nicht mehr von vorrangig globalen Strukturänderungen. Kinder sind zunächst „universelle Novizen“ – verfügen jedoch über ein angeborenes intuitives Wissen, z. B. über physikalische Grundgesetzmäßigkeiten. Schon bei Kleinkindern kommt es nicht nur zu einer bloßen Akkumulation von isolierten Wissensbestandteilen, sondern zur Integration von Infos in das jeweilige Weltbild bzw. Denksystem (das bei einem 3-Jährigen noch ein z. B. animistisches sein kann). Erst wenn zu viele Infos zum bisherigen Denksystem inkompatibel sind, kommt es zur Modifikation dieses Gesamtsystems. Schon bei kleinen Kindern kommt es zu fundamentalen Paradigmenwechseln im Sinne von Thomas Kuhn. Solche Paradigmenwechsel vollziehen sich zunächst bereichsspezifisch, d. h. sie treten in verschiedenen Bereichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf. Die entwicklungspsychologisch wichtigsten Bereiche sind zunächst intuitive Physik, intuitive Alltagspsychologie, später dann Biologie, Mathematik und Ökonomie. Mit den Veränderungen des bereichsspezifischen Wissens gehen aber trotzdem auch bereichsübergreifende Veränderungen einher. Z. B. kann das Konzept der Proportionalität in die Geometrie, die Kunst oder die Moral (Verteilungsgerechtigkeit) übertragen werden. Es kommt auch zu metakonzeptuellen Veränderungen im Denken des Kindes (steigender Grad an Reflexivität, steigendes Verständnis für Hypothesencharakter vieler Erkenntnisse) Aber: Auch die Methode des unreflektierten Ausprobierens bleibt bis ins Erwachsenenalter erhalten. Die Entwicklungsstufe einer kritischen Distanz zum eigenen Weltbild und zu den impliziten Vorannahmen wird auch von vielen Erwachsenen nicht erreicht. D – 3 – 2 – 1: Zur Entwicklung der intuitiven Physik Schon 4-monatige Babys wissen um die Undurchdringlichkeit von Objekten (Soliditätsprinzip) und die Objektpermanenz. Auf die Darbietung physikalisch unmöglicher Objektdurchdringungen reagieren diese Babys mit einer signifikant höheren Fixationsdauer. Ab etwa 8 Monaten verstehen Kinder implizit das Trägheitsprinzip und das Schwerkraftprinzip. Die kosmologischen Vorstellungen von Kindern bilden ein kohärentes System von Überzeugungen, so dass z. B. der Übergang vom geo- zum heliozentrischen Weltbild im Grundschulalter nicht bloß durch eine punktuelle Instruktion gelöst werden kann, sondern nur durch zusätzliches Anbieten eines umfassenderen Weltbildes. Im Grundschulalter können Kinder noch nicht zwischen „Gewicht“ und „Dichte“ unterscheiden. Sie verfügen über einen undifferenzierten „Gewicht-Dichte-Begriff“, so dass sie sich schwer damit tun, Objekte nur nach dem Gewicht oder nur nach der Dichte zu ordnen. Das Erlernen von „Gewicht“ und „Dichte“ erfordert einen Paradigmenwechsel in einen neues Wissenssystem und kann nicht durch bloße Instruktion gelernt werden. Frühestens ab 10 Jahren können Kinder Variablenkontrollstrategien anwenden, d. h. bei einem Experiment 2 Variablen konstant halten und die dritte variieren, um deren Einfluss isoliert messen zu können. D – 3 – 2 – 2: Zur Entwicklung der intuitiven Alltagspsychologie: Schon 3-Jährige können (1.) intendierte Handlungen von Fehlern oder Zufällen unterscheiden, (2.) Handlungen von Personen dadurch erklären, dass sie auf Wünsche und Absichten zurückgeführt werden und (3.) aus Informationen über Absichten und Ziele Handlungen voraussagen. 62 Erst 4-6-Jährige können subjektive Überzeugungen von der Realität unterscheiden. Vorher fehlt ein Konzept von „Überzeugung“. Erst mit Entwicklung dieses Konzeptes können sie berücksichtigen, dass, wenn sich jemand in einer falschen Überzeugung befindet (z. B. die irrige Annahme, dass sich die Schokolade an Ort A befindet) dieser entsprechend seiner Überzeugung handelt (und Ort A aufsucht). Im Jugendalter: Zunehmende Einsicht in den konstruktiven Charakter der geistigen Aktivitäten. Und: Verbesserte, präzisere soziale Kognitionen. D – 4: Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung D – 4 – 1: Entwicklung des moralischen Urteils (Quellen: Oerter/Montada S. 864-885 / HPP S. 471-476 / Zimbardo) D – 4 – 1 – 1: Grundsätzliches über die Entwicklung der Moral Def.: Moral (von „mos“: Sitte, Gebrauch) ist die Gesamtheit aller sittlichen Werturteile und Anschauungen. Moral in der Psychoanalyse: Internalisierung. Moral ist letztlich Resultat der Über-Ich-Bildung. Es gibt verschiedene Zielaspekte der moralischen Entwicklung: (a) Verstehen: Wissen über Normen muss erworben werden und es muss verstanden werden, was Normen in konkreten Situationen fordern. (b) Anerkennen: Der Geltungsanspruch von Normen muss – aus Einsicht und nicht durch Zwang – anerkannt werden. (c) Handeln: Die Normen müssen befolgt und umgesetzt werden. Siehe unter D – 4 – 2. Es lassen sich vier Hauptkategorien von moralischen Indikatoren ausmachen: (a) Wissen. Aber: Schüler mit z. B. oppositionellem Verhalten wissen über die Normen Bescheid, handeln aber nicht danach. (b) Urteile. Aber: Es ist nicht selten, dass Aussagen über das, was moralisch richtig wäre und die Motivation, dem auch zur Geltung zu verhelfen, auseinanderfallen. (c) Verhalten (normentsprechend oder normabweichend). Aber: Ist das Motiv für ein normentsprechendes Handeln moralische Einsicht oder z. B. Angst vor Kritik und Sanktionen oder Hoffnung auf Vorteile? Und: Wie soll das Verhalten in Dilemmasituationen sein? (d) Moralische Gefühle bei eigenen oder fremden Handlungen. Sie spiegeln die Moral einer Person. Allerdings sind diese schwer zu erfassen. Modelle zur Internalisierung von Normen: (a) Behavioristisches Internalisierungsmodell. Lernziel: Aufbau von extinktionsresistentem, normentsprechendem Verhalten durch Verstärkung normentsprechender Verhaltensweisen und Bestrafung normabweichenden Verhaltens. Kritik: Strafen bringen keine Einsicht in die Berechtigung einer Norm. Auch kann so kein autonomes moralisches Handeln und die Übernahme von persönlicher Verantwortung erreicht werden. (b) Normvermittlung durch Modell-Lernen und Identifikation. Lernziel: Übernahme des moralischen Werthorizonts von persönlich für bedeutsam angesehenen Personen (Eltern, Peer-Groups, Lehrer). Alle die Moral betreffenden Informationen können grundsätzlich auch aus der Beobachtung gelernt werden, auch spezielle Normen für spezielle Kontexte, sowie die Konsequenzen (un-)moralischen Verhaltens. Mit zunehmendem Alter spielt hier das Selbstbild eine wichtige Rolle: Widerspricht ein beobachtetes Verhalten dem Selbstbild, wird es zwar registriert, aber nicht übernommen. (c) Normvermittlung durch familiäre Sozialisation: Die Familie ist die erste Instanz der moralischen Sozialisation. Ein machtausübender Erziehungsstil verhindert tendenziell die Internalisierung von Normen. Auch ein rein liebesorientierter Erziehungsstil (Belohnung durch Liebe, Bestrafung durch Liebesentzug) hat darin eine Schwäche, dass die Auseinandersetzung um die kognitive Seite moralischer Normen zu kurz kommt. Ein dialogisch-induktiver Erziehungsstil fördert die moralische Entwicklung durch argumentative Erläuterungen, durch Aufzeigen eines Sinns, durch Durchdenken möglicher Ausnahmen und durch die Suche nach neuen Lösungsmöglichkeiten. Außerdem wird ein Spielraum für eigene Entscheidungen gewährt. (d) Normvermittlung durch Peer-Groups. Wichtige Aspekte für eine Moralförderung in der Schule: (a) Förderung starker Identitäten und starker Gemeinschaften. (b) Kooperatives Lernen und Atmosphäre gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Herausforderung der sozial-emotionalen Verhaltensebene. 63 (c) Reflektieren von moralischen Konfliktsituationen (kognitive Aspekte). (d) Treffen gemeinsamer Entscheidungen. (e) Sensibilisierung gegenüber dem Phänomen der Amoralität anonymer Institutionen. D – 4 – 1 – 2: Die Entwicklung des moralischen Urteils nach Jean Piaget D – 4 – 2 – 3: Entwicklung des moralischen Urteils nach Lawrence Kohlberg Testverfahren bei Piaget (1932): Beim Murmelspiel werden Kinder beobachtet, wie sie auf Regelverletzungen reagieren. (Ältere Kinder haben zuvor die Regeln festgelgt.) Außerdem: Konfrontation mit Geschichten über Diebstahl, Lüge etc... Moral stellt eine internalisierte kognitiv-emotionale Befindlichkeit dar. Prämoralische Ebene (0 bis 3 Jahre) Heteronome Moral (4 bis 8 Jahre) Kein Regelverständnis Kein Verpflichtungsgefühl, Regeln einzuhalten An Autoritäten und äußeren Instanzen orientiert Regeln werden von Autoritäten gesetzt und sanktioniert Ungehorsam ist moralisch grundsätzlich schlecht Regeln sind heilig, unantastbar und werden wörtlich (nicht nach dem Sinn) befolgt Glaube an eine immanente Gerechtigkeit Wenn Schaden entsteht, wird die Größe des Schadens beurteilt, nicht ob Absicht vorlag oder nicht Regeln sind veränderbar und werden durch Übereinkunft erzielt Zusammenarbeit, gegenseitige Achtung und Anerkennung Verletzung von Vertrauen ist das moralisch Schlechte Glaube an eine immanente Gerechtigkeit nimmt ab Urteile werden nach der Intention gefällt. Wenn Schaden entsteht: Lag Absicht vor oder nicht? Fähigkeit, autonome moralische Entscheidungen zu treffen Orientierung am Maßstab der Gerechtigkeit Autonome oder kooperative Moral (8 bis 12 Jahre) Bei Kohlberg (1963ff) kommt es dadurch zu einem Paradigmenwechsel, indem er das Hauptinteresse verschiebt: Es geht ihm um die Entwicklung der Begründungen der normativen Urteile und der Orientierungen, die diese Urteile leiten. Kohlberg untersuchte emprisch die Häufigkeit best. moralischer Niveaus, indem er best. Dilemmasituationen Kindern und Jugendlichen zur Bewertung vorlegte. (z. B. Heinz-Dilemma: Ein für einen Freund überlebenswichtiges Medikament ist unerschwinglich, der Apotheker gibt das Medikament nicht her und so kann es nur durch Diebstahl erworben werden. Die Frage ist primär nicht: Würdest du stehlen? Sondern: Wie begründest du dein Stehlen oder Nichtstehlen?) Dadurch wurde eine Wertpräferenz sichtbar. Mit jeder der folgenden Entwicklungsstufen nimmt der Grad der Reflexivität und Bewusstheit zu. Kohlberg fasst seine Stufenschema als eine Kompetenztheorie auf, ihm geht es also um möglichst optimale Formen des moralischen Urteils und in erster Linie um den Aufweis der qualitativen Unterschiedlichkeit der Stufen. I. Vormoralisches Niveau (idealtypisch*: Kindesalter) II. Konventionellkonformistisches Niveau (idealtypisch*: Jugendalter) Stufe 1: Lohn- und Straf-Moral. Es geht um Strafe bzw. Strafvermeidung aufgrund von Gehorsam und Ungehorsam. Völlige Heteronomie. Egozentrisch-hedonistische Orientierung. Stufe 2: Do-ut-des-Moral. Instrumentelle Nutzenorientierung. Stufe 3: Good-boy-nice-girl-Moral. Orientierung an wechselseitigen Erwartungen. Koordinierung mehrerer Blickwinkel. Es geht um das Aufrechterhalten guter Beziehungen, v. a. um Anerkennung. Moralische Konformität. Stufe 4: Rechte- und Pflichten-Moral. Orientierung an Gesetz und Ordnung und an der Gesellschaft. Betonung der Pflichten gegenüber der Gemeinschaft. 64 III. Postkonventionelles Niveau (idealtypisch* und theoretisch: Erwachsenenalter) Stufe 5: Prinzipien- und Sozialvertrags-Moral. Orientierung am Gemeinwohl („sozialer Nutzen“) und entsprechenden Prinzipien. Ausgleich verschiedener Interessen. Gesetzesänderung aufgrund rationaler Reflexion. Stufe 6: Einsicht in universale ethische Prinzipien. Orientierung am kategorischen Imperativ und der allgemeinen Menschenwürde. Autonomie der moralischen Entscheidungen. Stufe 7: Transzendenz bzw. kosmische Orientierung.** Transzendierung sozialer Normen. Sich selbst als Teil einer kosmischen Bewegung begreifen. * = Grundsätzlch können auch Menschen gleichen Alters auf z. T. sehr unterschiedlichen Entwicklungsstufen stehen. ** = Kohlberg überarbeitete mehrmals sein Modell. Stufe 7 kommt nicht in allen Modellen vor. Mit jeder Moralstufe erweitert sich die Fähigkeit, Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Neu bei Kohlberg: Stufe der moralischen Entwicklung ist weit weniger eng an best. Altersstufen gebunden. Fortschritte, Rückschritte sowie Stagnation sind möglich. Empirische Studien zeigen, dass Menschen auf einer höheren Kohlberg-Stufe politisch engagierter sind (größere Beteiligung an Protestkundgebungen etc...) und eher auf friedliche Weise für ihre Ziele eintreten. Außerdem lehnen sie ethisch verwerfliche Forderungen einer Autorität eher ab (Vgl. z. B. MilgramExperiment). Kritik an Teilaspekten von Kohlbergs Modell: (a) Er konzentriere sich zu sehr auf moralisches Urteilen und zuwenig auf moralisches Handeln. (b) Auch sind die höheren Stufen (v. a. die der postkonventionellen Ebene) nur schwer beweisbar. (c) Kulturelle Faktoren spielen eine Rolle: Tibetanische Mönche wurden mit einem Kohlberg-Dilemma konfrontiert und antworteten auf Stufe 3. Trotz- dem wird man bei ihnen von einem hohen moralischen Niveau ausgehen müssen. (d) Aus feministischer Sicht kam die Kritik, dass er eine männliche Gerechtigkeitsmoral vertrete und die weibliche Moral der Fürsorge und Anteilnahme vernachlässige. Konnte aber empirisch nicht belegt werden. (e) Situative Einflüsse: Menschen bewegen sich nicht immer auf dem gleichen Niveau: Wenn zuvor z. B. Stehlen verharmlost wurde, fällt die Antwort auf ein Kohlberg-Dilemma anders aus. Entwicklungsförderung des moralischen Denkens: (a) Kohlberg: Eine höhere moralische Stufe ist die Zielvorgabe für eine moralische Erziehung. Dem Kind sollten jeweils Argumente der nächsthöheren Stufe angeboten werden. (sog. „+1 Konvention“) (b) Oser vertritt in Fortführung von Kohlberg einen „progressiven Ansatz“, der zum Aufbau einer Kompetenz zur Lösung moralischer Probleme beitragen soll. Er wendet sich hingegen gegen eine „romantische Erziehungsphilosophie“, die naiv an das Gute im Menschen glaubt, völlig zwanglos erziehen möchte und die Frage nach der normativen Verbindlichkeit nicht stellt. Er wendet sich auch gegen das andere Extrem, die „erziehungstechnokratischen Ansätze“, die an der Gefahr der Indoktrination scheitern. (c) Weitere wichtige Aspekte zur Förderung moralischen Denkens sind die Förderung einer Diskussionskultur und die Erzeugung von Einsicht gegenüber den moralischen Rechten aller Menschen. (d) Es gibt verschiedene soziale Bedingungen, wie z. B. „stabile emotionale Zuwendung“, die den Übergang in den postkonventionellen Bereich erleichtern. D – 4 – 2: Entwicklung des moralischen Handelns (Quelle: Oerter/Montada S. 885-894 und HPP S. 471-476) Def. „Moralische Handlungsmotivation“: Sie ist eine verinnerliche Verantwortlichkeit, die ein Selbstkonzept und ein Bewusstsein, selbst zu handeln, voraussetzt. Sie äußert sich in moralischen Emotionen wie Schuld, Scham oder Wieder-gut-machen-wollen. Sie kann frühestens dann als vorhanden gelten, wenn ein Bewusstsein der Auswirkungen eigener Handlungen auf andere vorliegt. 65 Durch ein bestimmtes Niveau des moralischen Urteilens ist moralisches Handeln noch nicht determiniert. (a) Weil man auf dem gleichen Niveau trotzdem zu unterschiedlichen und z. T. konträren Ergebnissen kommen kann. So ist z. B. auf Stufe 4 die Forderung nach Wehrpflicht und die Forderung nach Wehrpflichtverweigerung denkbar. (b) Weil eine theoretisch ermittelte Position in einer konkreten Situation auf best. Interessen, Prioritäten, Belastungen, sozialkontextuelle Restriktionen etc... treffen kann, die der Position entgegenlaufen. (c) Moralisches Urteilen impliziert noch keine Motivation zu moralischem Handeln. (d) Moralische Gefühle wie Schuld oder Empörung drücken oft authentischer moralische Überzeugungen aus, als kognitive Moraleinstellungen. Sie können als Indikator für moralische Motivation angesehen werden. Der Anteil der Kinder mit einer moralischen Motivation wächst ab etwa dem vierten Lebensjahr stetig, während das egoistische Interessendurchsetzen verschwindet. Auch schon 4 bis 8-jährige Kinder haben – entgegen Kohlbergs Schema – intrinsische moralische Motivationen und ein schlechtes Gefühl bei „bösen“ Handlungen. Performanzfaktoren für das Umsetzen moralischen Denkens in moralisches Handeln: (a) Selbstsicherheit, wenn Zivilcourage erforderlich ist. (b) Handlungskompetenz bei Sachproblemen. (c) Ich-Stärke: Aufschub von Bedürfnisbefriedigung. Antizipation längerfristiger Konsequenzen. Frustrationstoleranz bei langwierigen Aufgaben. Faustregel: Nur wenn moralische Normen wichtige Facetten des Selbstbildes geworden sind, ist ihre handlungsleitende Funktion sicher. Moralisches Engagement ist dann verlässlich, wenn es der persönlichen Identität entspricht. Um moralisches Handeln zu fördern, ist eine Kontextualisierung der Stimulierung zu einer höheren Kohlberg-Stufe wichtig (Situiertes Lernen). Dies kann z. B. auf folgende Weisen geschehen: Das „Runder-Tisch-Modell“ eines realistischen Diskurses nach Oser: (a) Unterbrechung der normalen Lernsituation bei Konfliktfällen. (b) Setzen der Konfliktpartner oder -gruppen um einen Runden Tisch. Es gelten die Spielregeln der kommunikativen und diskursiven Fairness. (c) Ermittlung einer praktischen und tragfähigen Lösung. Erweitert auf die ganze Schule kann man auch das Konzept der „Justcommunity-Schule“ von Kohlberg heranziehen. Weitere Maßnahmen zur Steigerung der moralischen Handlungsmotivation sind: Steigerung von Empathie und moralischer Feinfühligkeit. Förderung von prosozialem Verhalten. Stärkung der Verantwortung der Schüler (Gewähren eines Gestaltungsspielraumes). D – 4 – 3: Selbstkonzept / Selbstvertrauen (Quelle: HPP S. 629-633) Alternative Begriffe: Selbstbild, Selbstmodell, Selbsttheorie, Selbsteinschätzung, Selbstwahrnehmung, Selbstwertgefühl, Selbstakzeptanz, Selbstbezogene Kognition, Self-esteem. Def.: Unter Selbstkonzept wird die Art der Kognition über sich selbst verstanden. Etwas konkreter ist Banduras Konzept der Selbstwirksamkeit, die sowohl auf die Einschätzung eigener Fähigkeiten, als auch auf die Beurteilung situativer Gegebenheiten rekurriert. Selbstwirksamkeit ist das Bewusstsein, inwieweit man selbst situationsadäquat und erfolgeich handeln kann. Früher wurde häufig von einem globalen Selbstkonzept ausgegangen, während heute viel stärker spezifische Teilbereiche des Selbstkonzeptes betrachtet werden (die geläufigsten Teilbereiche sind: soziales Selbstkonzept, emotionales Selbstkonzept, körperliches Selbstkonzep, akademisches bzw. professionelles Selbstkonzept bzw. für Schüler das schulische Leistungskonzept). Ein anderer Systematisierungsschlüssel unterteilt in die affektive Komponente des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauens und in die kognitive Komponente des Wissens im Bereich der Selbstwahrnehmung. Umstritten ist, inwieweit diese Selbstkonzeptsteilbereiche hierarchisch oder nicht-hierarchisch zueinander zu ordnen sind. Umstritten ist auch, inwieweit das Selbstkonzept stabil oder variabel bzw. fluktuierend ist. Tendenziell läst sich sagen, dass globalere Teile des Selbstkonzeptes und Bereiche mit hoher subjektiver Bedeutsamkeit stabiler sind als bereichsspezifische Facetten des Selbstbildes. Zur Genese des Selbstkonzeptes: Die sozialen Erfahrungen eines Individuums stellen die zentrale Quelle seines selbstbezogenen Wissens dar. Das Selbstkonzept entwickelt sich im Lauf der Sozialisation in Auseinandesetzung 66 mit den Feedback-Informationen und Attributszuschreibungen anderer Personen. Im Entwicklungsverlauf erlangen unterschiedliche Bezugsgruppen eine besondere Bedeutsamkeit für die Konstruktion des Selbstkonzeptes. (a) Kleinkindalter: v. a. Eltern (b) Ab Adoleszenzzeit: v. a. Peergroup (c) Erwachsene: Freunde und Arbeitskollegen Das Selbstkonzept hat eine wesentliche verhaltensregulative Funktion: Die Erwartung eigener Wirksamkeit und Kompetenz beeinflusst z. T. entscheidend die Initiierung von Verhalten, die dabei eingesetzte Anstrengungsintensität und die Verhaltenspersistenz im Fall von aversiven Erfahrungen (die bei einem positiven Selbstkonzept ansteigt!). Eine Metaanalyse von Hansford und Hattie (1982) ergab eine durchschnittliche Korrealation von r = +0,21 zwischen Selbstkonzepts-Parametern und Leistungsvariablen und sogar von r = +0,42 zwischen Parametern des akademischen Selbstkonzeptes und Leistungsvariablen. Auch Byrne (1984) kommt in einer Meta-Analyse zu einem ähnlichen Ergebnis: Schulische Leistung korreliert hoch mit fachspezifischen Selbstkonzepten, mäßig mit dem allgemeinen Leistungs-Selbstkonzept und sehr schwach mit außerschulischen Facetten des Selbstkonzeptes. Das Leistungs-Selbstkonzept der Schüler wird dadurch verstärkt, dass Lehrer eine individuelle Bezugsnorm und keine soziale Bezugsnorm anwenden. Es geht also darum, dass Leistung individuell an der Leistungsentwicklung des Schülers gemessen wird, also an dessen Lernfort- oder –rückschritten. Motivationsfördernd. Modell der Entwicklung des Selbstkonzeptes in der Schule nach Oerter (1989): (a) Niveau 1: Tüchtigkeitsselbst: Es beinhaltet ein Konzept von Tüchtigkeit. (b) Niveau 2: Ipsatives Fähigkeitsselbst: Selbstkonzept beinhaltet den Zusammenhang von Anstrengung und Fähigkeit. (c) Niveau 3: Normatives Selbstbild: Es beinhaltet die Fähigkeit als Ergebnis eines sozialen Vergleichs. (d) Niveau 4: Normativ-gesellschaftsbezogenes Selbstkonzept: Es beinhaltet Leistung und Fähigkeit als Faktor gesellschaftlicher Rollenzuteilung. Jüngere Kinder in der Schulanfangsphase neigen zu einem überhöhten Schulleistungskonzept, das sich im Verlauf der Grundschulzeit wieder normalisiert. Mit dem Wechsel auf eine weiterführende Schule bricht die Korrelation von Selbstkonzept und Leistung – und nur kurzzeitig – ein (aufgrund des Wechsels der Bezugsgrößen Lehrer und Mitschüler). In der Adoleszenzphase liegt eine hohe Korrelation von fächerspezifischen Selbstkonzepten und fächerspezifischer Leistung vor, während allgemeine Parameter des Selbstkonzeptes nur schwach mit schulischen Leistungen korrelieren. Self-enhancement-Konzept: Stärkung des Selbstkonzeptes Verbesserung schulischer Leistung. Skill-development-Konzept: Verbesserung schulischer Leistung Steigerung des Selbstwertes. Es liegen reziproke Prozesse vor, wobei in Übergangsphasen Self-enhancement-Konzepte wichtiger erscheinen während in Konsolidierungsphasen Skilldevelopment-Konzepte einen höheren Erklärungswert besitzen. Leistungsschwierigkeiten beeinträchtigen – und zwar schon ab der Grundschule – das akademische Selbstkonzept, v. a. aufgrund von Vergleichen mit der Bezugsgröße Klasse. Ein Schulwechsel (z. B. Gymnasium Realschule) kann sich positiv auf das Selbstkonzept und die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit auswirken (wobei ein solcher Wechsel aufgrund von zahlreichen anderen Faktoren insgesamt ambivalent ist). In einigen Teilbereichen (und nur dort!) lassen sich geschlechtsspezifische Unterschiede von disziplinären Sebstkonzepten ausmachen. Jungs haben ein höheres mathematisches Selbstkonzept, selbst bei vergleichbaren Leistungen und Noten; für Mädchen trifft das im sprachlichen Bereich zu. D – 4 – 4: Identität und Identitätsentwicklung (Quelle: Oerter/Montada S. 346ff) D – 4 – 4 – 1: Begriffsexplikation Def.: Unter Identität versteht man die einzigartige Kombination von unverwechselbaren Persönlichkeitsmerkmalen (im ontologischen Sinn das Wesentliche einer Persönlichkeit) und von Persönlichkeitsdaten (Name, Alter, Geschlecht, Beruf etc...), sowie die in Prozessen der Selbstwahrnehmung erfolgenden Interpretationen dieser Merkmale und Daten. Identität ist eine Antwort auf die Frage danach, wer ich bin. Die Frage wird durch die Suche nach Faktoren der biographischen Kontinuität und durch Bewusstwerden der in die Zukunft gerichteten Erwartungen beantwortet. 67 Identität impliziert persönliche Verpflichtungen, die jemand bewusst oder unbewusst eingegangen ist. Speziellere Identitätsbegriffe: (a) Persönliche Identität: Lebensgeschichtlicher Zusammenhang von Erfahrungen (roter Faden der Biographie). (b) Soziale Identität: Abbild der Position in der Gesellschaft und in gesellschaftlichen Gruppen. (c) Reale Identität: Das So-sein. (d) Ideale Identität: Das Wie-ich-sein-möchte. (e) Identität in der Außenansicht: Wie andere mich sehen. D – 4 – 4 – 2: Entwicklungsphasen im Bezug auf die Identität Schon Vorschulkinder verfügen über ein relativ stabiles Selbstkonzept. Damit ist eine Voraussetzung zur Bildung der Identität gegeben. Sie können schon zwischen I und Me unterscheiden (vgl. G. H. Mead), aber noch nicht zwischen Idealbild und Realbild. Zwischen 5 und 8 Jahren: Das Kind kann sich mit Gegensatzpaaren beschreiben (dick, dünn / klug, dumm). In der späten Kindheit wird das Selbstbild differenzierter, realistischer und hierarchisch komplexer. Die sensible Phase für die Entdeckung der reifen Identität ist die Adoleszenz. Die emotionale Lösung von den Eltern wird als entscheidender Faktor für die Identitätsbildung gesehen. Soziale Gruppen (Peers, Schule etc...) tragen entscheidend zur Entwicklung der kulturellen Identität bei. Hier kommt es auch zur Enkulturation von Werten wie Leistungsorientierung etc... Die Vorstellung der eigenen Identität verändert sich bei Jugendlichen von einer „autonomen Identität“ (widerspruchsfreie und konsistente Identität), hin zu einer „mutuellen Identität“ (Bewusstsein, dass auch Widersprüche und z. T. auch Brüche zur Identität gehören). Die Identitätsentwicklung vollzieht sich dialektisch durch Selbsterkenntnis (Ist-Zustand) und einer Vorstellung von einem Soll-Zustand. Dieser Transformationsprozess heißt Selbstgestaltung. Ergebnis des Offer-Selbstbild-Fragebogens von Offer (1988): Jugendliche haben i. d. R. keine tiefgreifenden Probleme, sondern fühlen sich mit ihrer Identität wohl. Die Bewertung der eigenen Identität bleibt über die Jugendjahre hinweg relativ stabil, und zwar im positiven Bereich. Depressive Neigungen sind in Deutschland sehr selten, in Japan hingegen häufiger. Über die Stabilität des Selbstkonzeptes und der Identität geben nur Längsschnittstudien Auskunft, die Personen über längere Zeiträume hinweg untersuchen. Allgemeingesetzliche Veränderungen können hingegen nur von Querschnittsstudien erfasst werden. Das Ringen um Identität in der späten Adoleszenz nach Marcia (1966ff): (a) Marcia untersuchte anhand von Interviews mit Jugendlichen, in welchen Lebensbereichen (z. B. Schule, Religion, Politik, Freundschaften etc...) die Jugendlichen (1.) eine Krise (Unsicherheit, Rebellion, Unklarheit über den Soll-Zustand etc...), (2.) eine Exploration (strategische Erkundung eines Lebensbereiches, um eine Entscheidung zu finden) oder (3.) eine Verpflichtung (Überzeugung, Engagement) erleben. (b) Die Antworten klassifizierte Marcia in (1.) diffuse Identität (weder Krise, noch Exploration, noch Verpflichtung – Patchwork-Identität ohne integrative Kraft), (2.) Moratoriums-Identität (Krise + Exploration), (3.) übernommene Identität (nur Verpflichtung) und (4.) erarbeitete Identität (Krise Exploration Verpflichtung). (c) Daraus ergeben sich (1.) progressive Verläufe (Moratoriums-Identität erarbeitete Identität), (2.) regressive Verläufe (Moratoriums-Identität diffuse Identität) und (3.) stagnierende Verläufe (Übernommene Identität). Marcia konnte 1989 nachweisen, dass der Anteil an Probanden mit diffuser Identität innerhalb von einer Generation von 20 % auf 40 % zugenommen hat. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit der (z. B. auch in der Arbeitswelt geforderten) Flexibilität und Unverbindlichkeit. Außerdem neigen Minoritätenjugendliche und Jugendliche aus Einwandererfamilien eher zu einer übernommenen Identität, weil diese im Elternhaus stärker erwartet wird und Krisen stärker unterdrückt werden. Real-Ideal-Diskrepanz: Sie besteht zwischen dem Ist-Zustand der Identität und dem Soll-Zustand. Sind diese beiden Zustände nahe beeinander, spricht man von Stimmigkeit, ansonsten von Diskrepanz. Eine Diskrepanz wird als schmerzlich empfunden. Sie zeigt den Zustand einer Krise an. Zur Auflösung der Real-Ideal-Diskrepanz: (a) Auflösung durch ein Zubewegen auf den Idealzustand. (b) Kompensatorische Auflösung durch symbolische Ergänzung (Kleidung, Statussymbole, musikalische Vorlieben etc...). 68 (c) Partielle oder völlige Aufgabe des Idealbildes, wobei es dabei im negativsten Fall zur suizidgefährdeten Selbstaufgabe kommt. (d) Syntaktische Kompetenz: Regeln zur Kombination von Wörtern zu Sätzen. Grammatik. (e) Lexikalische oder semantische Kompetenz: Bedeutungsstruktur des Wortschatzes. Lexikalische Bedeutungen von Wörtern. (f) Pragmatische Kompetenz: Sprechen als sprachliches Handeln innerhalb von sozial-interaktiven Beziehungen zwischen Kommunikationspartnern. Verständigungsfähigkeit. Berücksichtigung von Kontext, Situation und Kommunikationspartner. D – 5: Entwicklung verschiedener Funktionsbereiche D – 5 – 1: Sprachentwicklung (Quelle: Oerter / Montada Kap. 15) D – 5 – 1 – 1 : Die phonologisch-prosodische Entwicklung Theoriefamilien der Spracherwerbsforschung: (a) Inside-out-Theorien: Das Kind ist von Beginn an mit hochabstraktem grammatischem Wissen („Universalgrammatik“) sowie mit hoch spezialisiertem sprachbezogenem Verarbeitungssystem ausgestattet. Die Umweltsprache (Input) hat nur eine unbedeutende Rolle beim Spracherwerb. (b) Outside-in-Theorien: Annahme genereller Lernmechanismen. Angeborene sprachspezifische Voraussetzungen werden nicht angenommen oder minimiert. Das Kind erwirbt sprachliche Kompetenz erst durch die sprachliche Umwelt. (c) Interaktionistische Sichtweise: Gegenseitige Förderung durch interne und externe Faktoren. Kognitive Voraussetzungen für einen erfolgreichen Spracherwerb: Es gibt bedeutsame Zusammenhänge zwischen kognitiver Entwicklung (v. a. des KZG) und dem Erwerb sprachlicher Bedeutungen. Ab dem 5. Jahr kehrt sich die Wirkrichtung um: Der fortschreitende Spracherwerb treibt nun die weitere Entwicklung des Gehirns voran. Ein Kind muss 6 sprachliche Wissenssysteme aufbauen: (a) Prosodische Kompetenz: Sprachmelodie, Rhythmus, sprachtypische Betonungs- und Dehnungsmuster, z. B. ansteigende Sprachmelodie bei Fragen. (b) Phonologische Kompetenz: Lautstruktur der Sprache. Phoneme sind die kleinsten bedeutungsdifferenzierenden Laute. Bedeutungsunterscheidende Lautklassen und die Kombination von Lautklassen müssen erlernt werden. (c) Morphologische Kompetenz: Wortbildung und Wortbildungsregeln, z. B. für Anzahl, Geschlecht, Fall, Bestimmtheit etc... Die phonologisch-prosodische Entwicklung lässt sich in zwei Entwicklungsstränge zerlegen, in einen rezeptiven und einen produktiven. Rezeptive phonologisch-prosodische Entwicklung: (a) Phonologische Kategorien: Säugling unterscheidet menschliche Sprache von anderen Lauten und ordnet in phonologisch relevante Kategorien ein. Ab dem 10. Monat werden Differenzen beachtet, die in der eigenen Sprache bedeutsam sind. Erwerb der wichtigsten Regeln der Lautkombination. Unterscheidung von Wörtern der Mutter- gegenüber einer Fremdsprache. (b) Prosodische Merkmale: Sensibilität für prosodische Merkmale der Sprache (auch schon vorgeburtlich). Prosodische Strukturierungen sind auch für den Grammatikerwerb wichtig. Mit 7 Monaten: Vorzug von grammatischen Pausen an sinnvollen Stellen gegenüber willkürlichen grammatischen Pausen. Dann differenziertes Wissen über prosodisch-phonologische Kategorien. Produktive phonologische Entwicklung: (a) Gurren: 6. bis 8. Woche. (b) Lachen und Lautbildung: 2. bis 4. Monat. Nachahmung vorgesprochener Vokale. (c) Lallstadium: 6. bis 9. Monat. Reduplikation von Silben und Produktion von Konsonant-Vokal-Verbindungen („dada“). (d) Erste Wörter: 10. bis 14. Monat. (e) 50-Wörter-Marke: 18. Monat; schnelleres Lernen der Wörter; zeitweilige Regression, d. h. ungenaue Aussprache der Wörter als Fortschritt, da Wörter nicht mehr als isolierte Einheiten produziert, sondern ins phonologische System integriert werden. (f) Aussprachefehler bis zum Ende der Vorschulzeit. 69 D – 5 – 1 – 2: Drei Hauptschritte in der lexikalischen Entwicklung 1. Die ersten Wörter: (a) 10. bis 18. Monat: Die ersten 30 Wörter sind soziale Wörter (Papa, Winke-Winke) bzw. spezifisch kontextgebunde Namen (Auto für ein konkretes Auto). (b) Dann: Benennungsexplosion ab 1,5 Jahren: Wunsch nach Kategorisierung aller sehbaren Objekte. Kinder, die mit 24 Monaten nicht die 50-WortGrenze erreicht haben sind sog. „Late talkers“. Charakteristisch sind Übergeneralisierungen und Überdiskriminierungen. 2. Schneller Worterwerb für Objekte und Eigenschaften: (a) Schnelle Zuordnung zwischen Erfahrungen und Wortbedeutungen, trotz unvollständigem Wortverständnis. (b) Reziproke Beziehung zwischen Sprache und Kognition. (c) Kinder werden beim Wortlernen von Vorannahmen (constraints) geleitet: Ganzheits- und Taxonomieconstraints sind besonders wichtig: Das Kind geht davon aus, dass sich die neuen Wörter auf ganze Objekte, nicht auf Teile oder Eigenschaften beziehen. Kinder interpretieren Wörter als Bezeichnung für thematisch (bzw. taxonomisch oder kategorial) verbundene Objekte und als Dinge gleicher Art (z. B. verschiedene Hunde). 3. Schneller Erwerb von Verben: (a) Findet ab dem 30. Monat statt und ist eng mit der Entwicklung syntaktischer Constraints verbunden. Ein differenzierter und produktiver Verbgebrauch ist an den Erwerb syntaktischer Satzmuster gebunden. (b) Es kommt zu Verwechslungen und zu spontanen Verbesserungen. D – 5 – 1 – 4: Der Weg zur pragmatischen Kompetenz D – 5 – 1 – 3: Syntaktische Entwicklung: Auf dem Weg zur Satzproduktion. 18. Monat: produktiver Grammatikbeginn bei ersten Wortkombinationen von Kindern. Bei den ersten Zwei- und Dreiwortäußerungen werden Aspekte der Grammatik verstanden („kleines Balla“, „der müde“). Hauptmerkmale der frühen Grammatik: (a) Telegraphische Sprache: Auslassen bestimmter Satzelemente bei ersten Wortkombinationen. (b) Bedeutungsrelationen: Ausdruck enthält semantische Relationen (z. B. Handelnder/Handlung: „Papa schläft“ oder Besitzer/Besitz „Papa Hut“). (c) Beachtung formaler Regularitäten. (d) Wortordnung: Kinder halten bestimmte Wortordnungen bei ihren ersten Zwei- und Dreiwortverbindungen ein, z. B. „da ein Schönes“. 2,5 Jahre: Kinder produzieren Sätze mit mehreren Phrasen. 4 Jahre: Kinder beherrschen Satzkonstruktionen der Muttersprache. Aber: Weiter Schwierigkeiten bei ungewohnten grammatischen Konstruktion, wie z. B. beim Passiv. Vom impliziten zum expliziten Sprachwissen: (a) Ab 5 Jahren: Behavioral mastery, d. h. implizites Sprachwissen und korrekter Sprachgebrauch ohne Reflexion dessen. (b) Ab 6 Jahre: Fehler auf der Ebene des pragmatischen Sprachgebrauchs, spontane Selbstkorrekturen. (c) Ab 8 Jahre: Explizites Sprachwissen und bewusste Reflexion über Sprache (Schuleffekt). Situations - und kontextadäquater Gebrauch von Sprache schließt Aufbau von soziokulturellen Kenntnissen ein. Ab dem 3. Jahr: Kinder passen sich dem Alter und Status ihrer Gesprächspartner an. Sie sind immer mehr dazu in der Lage sich kommunikativen Erfolgen bzw. Misserfolgen anzupassen, Äußerungen umzuformulieren, Formen des Bittens kontextabhängig zu variieren, indirekte Anweisungen zu verstehen und zu verwenden, Sprache verschiedenen Rollenbedürfnissen anzupassen. Aber: Entwicklung der pragmatischen Kompetenz geht noch bis ins Erwachsenenalter weiter (vgl. Einstieg ins Berufsleben etc...). Vgl. auch „Jugendjargon“ in C – 5 – 6 – 1! 70 D – 5 – 1 – 4: Mütterliche Sprechstile und die Sprachentwicklung Der mütterliche Sprechstil ist eine zentrale sozial-kommunikative Voraussetzung für den Spracherwerb des Kindes. Zentral ist hierbei auch eine positive emotionale Beziehung, um eine gemeinsame Erfahrungsumwelt zu schaffen. Mütterlicher Sprechstil Ammensprache, Babytalk (erstes Lebensjahr) Stützende Sprache, Scaffolding (zweites Lebensjahr) Lehrende Sprache, Motherese (drittes Lebensjahr) Hauptmerkmale Überdeutliche Intonation Hoher Tonfall Einfache Sätze Kindgemäßer Wortschatz Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus Worteinführungen Mutter insistiert auf Antwort, erwartet Teilnahme Modellsprache Sprachanregung durch Fragen Funktion für den Spracherwerb Spracherkennung Phonologische Kompetenz Prosodische Kompetenz Lexikalische Kompetenz Morphologische Kompetenz Synataktische Kompetenz Pragmatische Kompetenz D – 5 – 2: Motivationsentwicklung (Quelle: Oerter / Montada Kap. 16) Etappen der Entwicklung der Leistungsmotivation: Vorstufe: Motiviertes Handeln ist zunächst vollständig intrinsisch motiviert, etwa im Sinne der Flow-Motivation. Im Mittelpunkt: Abdecken der Grundbedürfnisse. Hedonismus. 1. Freude am Effekt: Absichtliches Herbeiführen von Effekten im ersten Lebensjahr (vgl. Kreisreaktionen) führt zum Ausdruck von Freude. 2. Selbermachen: Sobald die Sprachentwicklung es zulässt, drückt das Kind den Wunsch aus, alles selber machen zu wollen. 3. Verknüpfung des Handlungsergebnisses mit der eigenen Tüchtigkeit: Etwa ab zweieinhalb Jahren drückt das Kind Freude und Stolz über ein gelungenes Werk und Enttäuschung über Misserfolge aus. Das Ergebnis wird mit der eigenen Tüchtigkeit erklärt. Dieses Kausalschema ist der entscheidende Schritt in der Entwicklung der Leistungsmotivation. 4. Unterscheidung von Tüchtigkeit und Schwierigkeit: Für das Zustandekommen einer Leistung muss man zwischen der eigenen Tüchtigkeit als internaler Ursache und der Aufgabenschwierigkeit als externaler Ursache unterscheiden können. Erfolg trotz hoher Schwierigkeit wird auf ein hohes Maß an Tüchtigkeit zurückgeführt. 5. Anspruchsniveau-Setzung: Als Bezugsnorm dient zunächst die Einschätzung des eigenen Könnens (individuelle Bezugsnorm, ab etwa 3,5 Jahren). Später wird der soziale Vergleich mit anderen Kindern wichtig (soziale Bezugsnorm, ab etwa 4,5 Jahren), bis schließlich beide Bezugsnormen nebeneinander je nach Situation zur Geltung gelangen. 6. Anstrengung als Ursache für Leistung: Ab dem fünften, sechsten Lebensjahr bildet die eigene Anstrengung das wichtigste Erklärungskonzept für Leistung. Das Kind nimmt eine proportionale Beziehung zwischen Aufwand und Ergebnis an. 7. Anstrengung mal Fähigkeit als Ursache für Leistung: Fähigkeit als Erklärung taucht erst zwischen ca. 10 und 12 Jahren auf. Anstrengung und Fähigkeit werden jetzt nicht mehr additiv kombiniert, sondern multiplikativ: Es wird erkannt, dass das Produkt aus niedriger Anstrengung und niedriger Fähigkeit besonders gering ausfallt, während es bei hoher Anstrengung und hoher Fähigkeit zu Hochleistungen kommt. Integration von individueller und sozialer Bezugsnorm. 8. Anstrengungsannahme statt Zufallsannahme. Aufgaben- und Ego-Orientierung: Nicholls zeigt, dass Leistungshandeln aus zwei unterschiedlichen Ausrichtungen gespeist sein kann: (a) Man strebt Leistung an, um eher eine höhere als eine niedrige Fähigkeit aufzubauen (Aufgabenorientierung). (b) Man strebt Leistung an, um Anerkennung, Zuwendung, einen hohen Sozialstatus etc... zu bekommen (Ego-Orientierung). Sowohl das Interesse, als auch die Leistungsmotivation hängt von Kontrollüberzeugungen (Überzeugung, eine best. Leistung erbringen zu können) ab. Diese Überzeugungen entstehen mit der Selbstbewertungsfähigkeit. 71 Drei Niveaus der Selbstbewertungsfähigkeit nach Stipek et al.: (a) Die Einjährigen nehmen noch keine Selbstbewertung vor und nehmen auch noch nicht Reaktionen auf ihre Leistungen vorweg, aber sie freuen sich darüber, dass sie ein Ergebnis selbst verursacht haben. (b) Kurz vor dem Alter von 2 Jahren orientieren sich die Kinder an den Reaktionen Erwachsener und suchen positive Antworten auf ihren Erfolg. Selbstbewertung wird durch externe Bewertung hergestellt. (c) Auf einer dritten Stufe haben die Kinder die Bewertung verinnerlicht (Internalisierung). Sie bewerten ihre Leistung unabhängig von einer äußeren Beurteilung und orientieren sich ausschließlich an Erfolg und Misserfolg. Zunächst überschätzen die Kinder ihre Kompetenz bei weitem, können aber ihre Fähigkeiten mit zunehmendem Alter realistischer einschätzen. Dies hat auch mit dem permanenten sozialen Vergleich und dem Wettbewerb in der Schule zu tun. Leistungsmotivation durch Erwartung: Eine solche Erwartung ist die vom Kind eingeschätzte subjektive Wahrscheinlichkeit, eine Aufgabe zu bewältigen. Der Anreizwert einer Leistung ist in der Hauptsache ein Affekt, nämlich Stolz auf die erbrachte Leistung. Da man stolzer ist, wenn man schwierige Leistungen vollbracht hat, steigt der Anreizwert mit sinkender Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Leistungsmotivation bewegt sich im Konfliktfeld zwischen Hoffnung auf Erfolg (Affekt: Stolz) und der Furcht vor Misserfolg (Affekt: Scham). Einfluss von Schule und Lehrer auf die Leistungsmotivation: Soziale und individuelle Bezugsnorm: Lehrer mit sozialer BezugsnormOrientierung erklärten die Leistungen der Schüler durch zeitstabile und internale Faktoren, v.a. Fähigkeit, aber auch Fleiß. Lehrer mit sozialer Bezugsnorm erteilten mehr Lob an überdurchschnittliche Schüler, selbst wenn deren Leistung abfiel. Lehrer mit individueller Bezugsnorm tadelten dagegen solche Schüler. Bei unterdurchschnittlichen Schülern verteilten nur Lehrer mit individueller Bezugsnorm Lob und Anerkennung. Lehrer mit individueller Bezugsnorm praktizierten stärker einen individualisierenden Unterricht, in dem sie den Schwierigkeitsgrad ihrer Fragen stärker variierten. Schüler, deren Lehrer eine individuelle Bezugsnorm zeigen, haben ein stärker ausgeprägtes Erfolgsmotiv, während Schüler, deren Lehrer eine soziale Bezugsnorm bevorzugen, im Vergleich ausgeprägt misserfolgsorien- tiert sind. Die soziale Bezugsnorm wirkt sich über mehrere Jahre hinweg negativ auf die Motivation und das Selbstkonzept von Schülern aus. D – 5 – 3: Entwicklung von Interessen (Quelle: Oerter Montada Kap. 16) Def.: Interesse verhindert Isolation und Abkapselung von der Außenwelt, es stellt ein zuverlässiges und sicheres Band zu ihr her und lenkt die Austauschprozesse von Aneignung und Vergegenständlichung in feste und zugleich sinnstiftende Bahnen. Mierke unterscheidet zwischen (a) einem phänomenologischen Aspekt: wie Interesse subjektiv erlebt wird. (b) einem genetischen Aspekt: wie sich Interessen entwickeln. (c) einem strukturpsychologischen Aspekt: welches Gefüge die Interessen bilden. Mit Krapp lassen sich zwei Komponenten des Interesses unterscheiden: (a) ein situatives Interesse, das die Zuwendung zum Gegenstand und die aktuelle Auseinandersetzung mit ihm beinhaltet. (b) Interesse als Persönlichkeitsdimension, das dauerhafter oder lang anhaltender Bestandteil der gesamten Person-Umwelt-Orientierung geworden ist. Das Interessen-Hexagon von Holland. Grundprinzip: Es gibt vier Grundausrichtungen (Dinge, Daten, Ideen, Menschen), aus denen sich sechs Typen speisen. Diese Struktur von Interessen findet sich v. a. im Erwachsenenalter, aber bereits auch bei Jugendlichen. Das Hexagon-Modell erwies sich auch über verschiedene subkulturelle Gruppen und Ethnien hinweg als gültig. Interessentyp Realistisch „R“ Bezug zu... Dinge Konventionell „C“ Dinge, Daten Unternehmerisch „E“ (für „enterprising“) Sozial „S“ Daten Menschen Charakteristika Bevorzugt praktische und technische Arbeit mit Gegenständen. Bevorzugt eine strukturierte Umwelt und konventionelles Wissen Versucht Führungsaufgaben zu unternehmen Bevorzugt Arbeit mit und für Andere. Freude am sozialen Kontakt. 72 Künstlerisch „A“ (für „artistic“) Forschend „I“ (für „investigative“) Ideen, Menschen Ideen Bevorzugt sprachlich-künstlerischen Bereich. Bevorzugt akademischwissenschaftliche Tätigkeiten. Entwicklungsmechanismen der Interessenbildung: (a) Dauer des Spiels und Spielobjekt (z. B. Puppe, Ball etc...) (b) Signifikante Person-Umwelt-Bezüge, die immer wieder aktiviert werden und eine funktionelle Autonomie erhalten. Sie werden zu Motivationssystemen, die unabhängig von aktuellen Anreizen Verhalten regulieren. Interessante Gegenstandsbereiche werden aktiv aufgesucht und können für den gesamten Lebenslauf handlungsleitende Funktion erlangen. Die Beschäftigung mit best. Gegenständen wirkt besonders sinnstiftend. D – 5 – 4: Entwicklung des Sozialverhaltens (Quelle: Oerter / Montada Kap. 6) D – 5 – 3 – 1: Die Entwicklung einzelner Interessenbereiche Universelle Interessen: Sie tauchen bereits im ersten Lebensjahr auf. Sie sind entweder stärker personorientiert oder stärker sachorientiert oder eine Mischung von beidem. Geschlechtsspezifische Interessen: Sie bilden sich im Vorschulalter heraus, was sich in der Bevorzugung von geschlechtstypischen Spielsachen und Aktivitäten anzeigt. Jugendliche, die das Gymnasium besuchen, sind weit weniger von geschlechtsstereotypischen Interessen abhängig als ihre Altersgenossen in anderen Schularten und weisen ein breiteres Interessenspektrum auf. Altersspezifische Interessen: Zu ihnen kommt es durch die Orientierung an Gleichaltrigen und durch Angebote und Moden der Konsumgesellschaft. Schulisch-akademische Interessen: Durch den Schulbesuch können Fachgebiete in berufliche und personale Interessen eingespeist werden. Wenn andererseits die Verknüpfung mit persönlichen Anliegen und Thematiken nicht gelingt, werden Schulfächer irrelevant, es kommt zu Schulverdrossenheit. Das Interesse an Schulfächern, besonders an Mathematik und Naturwissenschaften nimmt mit zunehmendem Alter ab. Berufliche Interessen: Während Kinder sich noch an äußeren attraktiven Merkmalen orientieren und Schornsteinfeger, Lokführer und Astronaut werden wollen, interessieren sich ältere Kinder schon mehr für die Tiefenmerkmale des Berufs und wägen schließlich als Jugendliche ihre Fähigkeiten, Aus- bildungsmöglichkeiten und Interessen ab. Berufliche Interessen sind z. T. an geschlechtsspezifische Interessen gebunden. Bei männlichen Jugendlichen wächst die Korrelation zwischen beruflichem Interesse und Berufsprestige mit zunehmendem Alter an, bei weiblichen Jugendlichen liegt sie bei Null. Individuelle Interessen: Hier handelt es sich um die einmalige Struktur von Person-Umwelt-Bezügen, die sich in einer im Laufe der Entwicklung herauskristallisieren und relevant oder gar zentral erscheinen, z. B. ein best. Beruf, Hobby, soziales oder religiöses Engagement. In der Entwicklung des Kindes gibt es einen Übergang zur sozialen Identität, bei dem die eigene Gruppe zunächst vorbehaltlos und unkritisch positiv bewertet wird. Die Identifikation mit einer Gruppe muss erlernt werden. Schwierigkeiten im sozialen Kontakt und Außenseiterrollen (Ablehnung und Nichtbeachtung): Die abgelehnten (rejected) Kinder werden mit negativen Emotionen und Beschreibungen belegt, die Nichtbeachteten (neglected) dagegen haben zwar auch keine Freunde, aber sie werden emotional entweder neutral oder positiv belegt. Abgelehnte zeigen deutlich abweichendes Verhalten, sind zurückgezogen, im Kontakt oft auch aggressiv. Entwicklung zum Außenseiter: Rubin et al. 2 unterscheiden zwei Pfade: (a) Das Neugeborene hat bereits ein schwieriges Temperament. Wenn weitere Risikofaktoren hinzutreten, v. a. eine ängstliche, aggressive Mutter mit wenig Zuwendung im Rahmen schwieriger ökonomischer Verhältnisse, so gerät das Kind leicht in die Isolation, zeigt feindseliges Verhalten und wird von den Gleichaltrigen abgelehnt. (b) Das Kind ist übersensibel, hat eine niedrige Erregungsschwelle für soziale Stimuli. Das erschwert den sozialen Kontakt. Es kann zu unsicherem Bindungsverhalten kommen. Durch Prozesse der Gruppendynamik wird die Außenseiterrolle festgeschrieben. Trotzdem ist es möglich, aus der Außenseiterrolle herauszukommen und einen höheren sozialen Status zu erreichen. Emotionale Regulierung und soziale Kompetenz: Ein erfolgreicher sozialer Umgang setzt voraus, dass man seine eigenen Gefühle unter Kontrolle hat und über Strategien zur Bewältigung von Konflikten verfügt. 73 Es gibt frühzeitig Unterschiede in sozialer Kompetenz zwischen den Kindern, die sich z. T. vorhersagbar auf späteres Verhalten auswirken. Entwicklung von Freundschaften: (a) Ab 6 Jahren: Freundschaften bilden sich nach dem do-ut-des-Prinzip. (b) Ab 9 Jahren: Qualitative Veränderung: Freudschaften werden von einem Partner benötigt, vom anderen gewährt. Eine Gegenleistung wird nicht unmittelbar verlangt. (c) Ab 12 Jahren wird der Freund zu jemandem, der einen besser kennt als die anderen und dem man sich offenbart. Gegenseitiges Verstehen wird wichtiger als eine aktuelle Hilfeleistung. Aspekte bei der Wahl von Freundschaften: Ähnlichkeit als Tiefenmerkmal, Altershomogenität bzw. –heterogenität als Oberflächenmerkmal, räumliche Nähe als sozial-ökologisches Merkmal. Die Ähnlichkeit gewinnt mit zunehmendem Alter tendenziell an Bedeutung, die Altershomogenität als Selektionsbedingung verliert an Wichtigkeit, die räumliche Nähe (Wohnung, Schule) ist zunächst völlig ausschlaggebend, wird aber später sukzessive unwichtiger. (d) Zunehmende Stabilität von Freundschaften. Tendenz zur Vermeidung von Wettbewerb und Wettstreit unter Freunden. Die Entwicklung des prosozialen Verhaltens: Bedingung für prosoziales Verhalten ist die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Siehe auch unter C – 5 – 5: Peergruppe, Cliquen etc... D – 5 – 5: Psychosexuelle Entwicklung und Entwicklung des Sexualverhaltens (Quelle: Oerter / Montada Kap. 7) D – 5 – 5 – 1: Körperliche und psychosexuelle Entwicklung Geschlechtsreifung (biosexuelle Entwicklung): Sie wird verursacht durch eine beträchtliche hormonale Umstellung. Die Entwicklung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale erfolgt in einer ziemlich festgelegten Reihenfolge. Dabei gibt es typische Entsprechungen zwischen männlichen und weiblichen Jugendlichen, allerdings finden die korrespondierenden Entwicklungsabschnitte beim Mädchen um rund 2 Jahre früher statt. Die Geschlechtsreifung hat Rückwirkungen auf die psychische Entwicklung des Jugendlichen. Typische Probleme: (a) Beginn der Menstruation bei Mädchen (Menarche) und die erste Ejakulation (Ejakularche) bei Jungen. Es zeigte sich, dass Mädchen, die auf die Menarche vorbereitet worden waren, diese eher als etwas Natürliches ansahen, während unvorbereitete Mädchen eher über negative Gefühle berichteten. Bei Jungen ergibt sich ein analoges Bild. (b) Veränderungen im Hormonhaushalt. Die neuen Hormone regen die Keimdrüsen und die Nebennierenrinde an. Bei Jungen: Mit etwa elf Jahren lösen gonadotrope Hormone das Wachstum von Zellen aus, die ihrerseits Samenzellen (Spermatozoen) herstellen. Ein Hormon der Hypophyse regelt die Produktion des männlichen Geschlechtshormons Testosteron in den Keimdrüsen. Das Testosteron bewirkt nun hauptsächlich die sexuelle Entwicklung zum Mann. Bei Mädchen: Es beginnt der Prozess der sexuellen Reifung früher. Die neuen Hormone der Hypophyse wirken hier schon mit etwa neun Jahren auf Eierstöcke und Nebenniere. Die Eierstöcke beginnen 2 Hormone zu produzieren: das Östrogen, das die Entwicklung der Brüste, der Schambehaarung und der Fettbildung steuert und das Progesteron, das den Menstruationszyklus vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation und die Empfängnisbereitschaft steuert. Es kann zur Akzeleration und zur Retardation kommen (Früh- und Spätreifung). Säkulare Akzeleration: In den westlichen Ländern hat es in den letzten 150 Jahren eine beträchtliche säkulare Akzeleration gegeben. In biosexueller Hinsicht reift der Mensch früher zum Erwachsenen heran. (Aber: Die Kluft zwischen biologischem und sozialem Erwachsensein ist auch noch in den letzten 20 Jahren gewachsen und der Trend der säkularen Akzeleration geht weiter.) Auswirkungen von Akzeleration und Retardation: (a) Spätreifende Jungen erweisen sich als unausgeglichener und unzufriedener. Sie haben ein negativeres Selbstkonzept, sind weniger verantwortungsbewusst und selbstsicher. Jugendliche, die infolge später Reifung mehr Zeit zur Verfügung haben für den Aufbau von Wissen und Copingstrategien, haben größere Chancen bei ihrer Identitätsbildung mit den Vorteilen größerer Entwicklungsoffenheit. (b) Frühreife Jungen sind einem größeren Risiko für Drogenkonsum und Devianz (Abweichung) unterworfen, denn infolge ihres Körperstatus suchen und finden sie leichter Anschluss an ältere Peergruppen und an deviante 74 Gleichaltrige. Eine Analyse von Längsschnittstudien zeigt aber, dass Frühreife mit 38 Jahren verantwortungsbewusster, selbstbewusster und sozial angepasster waren als ihre Altersgenossen. (c) Bei Mädchen erweist sich Frühreife deutlich als Nachteil. Frühreifende Mädchen sind weniger beliebt, weniger graziös und zeigen größere Zurückgezogenheit als ihre Altersgenossinnen. Frühentwickelte Mädchen sind sowohl hinsichtlich psychischer Störungen als auch in Bezug auf Sexualverhalten und Drogengebrauch besonders gefährdet, wenn weitere Risikofaktoren hinzutreten. (d) Insgesamt ist körperliche Retardation und Akzeleration nach heutigem Wissen mit Risiken behaftet, die durch Aufklärung in Familie und Schule aber relativ leicht aufgefangen werden können. Das Körperselbstbild bei Jugendlichen: Mit zunehmendem Alter wird Körperpflege wichtiger. Jungen äußern weniger Figurprobleme als Mädchen, bei denen die Unzufriedenheit mit dem Gewicht ansteigt, je älter sie werden. Mädchen haben häufiger als Jungen ein negatives Körperselbstbild (vgl. kultureller Einfluss!). D – 5 – 5 – 2: Entwicklung des Sexualverhaltens Die Entwicklung des Sexualverhaltens ist ein kompliziertes Zusammenspiel zwischen biologischen Faktoren, v. a. der hormonellen Entwicklung, den psychosozialen Bedingungen, den erotischen Stimuli, die eine Kultur bereit hält (z. B. in den Massenmedien), den sozialen Kontakten und den Settings, die Gelegenheit zu erotischen Erfahrungen bieten. Die Mehrzahl der Jugendlichen hat auch heute vor dem ersten Geschlechtsverkehr Zärtlichkeiten ausgetauscht und vorbereitende intime Körpererfahrung beim Petting gemacht. Masturbation wird eher von männlichen als von weiblichen Jugendlichen praktiziert. Sexuelles Wissen und sexuelles Verhalten liegen oft weit voneinander entfernt. Viele Jugendliche (und mehr Jungen) wissen nicht ausreichend über Verhütungsmethoden oder über das Empfängnisoptimum des weiblichen Zyklus Bescheid. Religiöser Einfluss: In evangelischen Familien wird häufiger als in katholischen und konfessionslosen Familien über Sexualität und Partnerschaft gesprochen. Beschleunigungsthese: Sie besagt, dass wir es mit einer Beschleunigung der Entwicklung des Sexualverhaltens zu tun haben. Vorverlagerung sexueller Erfahrungen. Entwicklungstheorie sexueller Orientierung nach Bem: Biologische Variablen wie Gene und pränatale Hormone prägen nicht per se die sexuelle Orientierung, sondern wirken sich zunächst auf das kindliche Temperament aus. Dies führt zur Bevorzugung bestimmter Spiele und Aktivitäten, die eher typisch männlich (Sport treiben, Raufen, Kampfspiele) oder eher typisch weiblich sind (Pflege, Hüpfspiele, ruhige Beschäftigungen). Die Kinder bevorzugen Peers mit gleichen Vorlieben und Aktivitäten. Ab der Pubertät führt dann das Gefühl der Fremdheit und Exotik zu einer erhöhten erotischen Erregung. Bems Modell versucht Heterosexualität und Homosexualität durch die gleichen Prozesse und Bedingungen zu erklären. Genetische Dispositionen spielen bei ihm so gut wie keine Rolle. Kurzzeit- und Langzeitstrategien des Sexualverhaltens nach Buss und Schmitt: Kurzzeitstrategien des Sexualverhaltens sind für Männer wesentlich attraktiver als für Frauen, da Männer biologisch den größten Fortpflanzungseffekt erreichen, wenn sie möglichst viele Frauen kontaktieren können. Bei den Langzeitstrategien hingegen gibt es einen wesentlich höheren Verpflichtungscharakter: Pflege und Erziehung der Kinder. (Naja, biologistische Sichtweise halt...) Befunde: Zunächst bei beiden Geschlechtern im Jugendalter die Bevorzugung kurzfristiger Strategien, d. h. die Bemühung mit vielen potentiellen Sexualpartnern in Beziehung zu kommen. Strategien: Dating, unverbindliche Treffen von Jungen und Mädchen, die gemeinsam etwas unternehmen. Mädchen ist bei der Partnerwahl Verstehen und Vertrauen, Zärtlichkeit und Rücksichtnahme, Liebe und sexuelle Treue wichtiger, während für Jungen Sexualität eher auch losgelöst von Beziehungen vorgestellt wird. Bei älteren Jugendlichen spielt die Langzeitperspektive eine größere Rolle, auch Werte wie Bindung, Verlässlichkeit und Treue. D – 6: Entwicklungsförderung 75 D – 7: Anlage-Umwelt-Problematik D – 7 – 1: Nachweis der Bedeutung von Anlageeinflüssen, Erbanlagen und Entwicklungsumwelt (Quelle: Oerter / Montada Kap. 1) Es gibt genetische Dispositionen, die sich in einem sehr weiten Spektrum von Entwicklungsumgebungen, wenn nicht gar universell auswirken. Es gibt andere, in denen die Risiken einer ungünstigen genetischen Disposition durch günstige Entwicklungskontexte ausgeglichen werden können. Erfassung von Erbunterschieden und chromosomalen Besonderheiten: (a) Vererbung ist unproblematisch nachzuweisen, wenn Zusammenhang zwischen phänotypischem Merkmal und chromosomaler Auffälligkeit erkennbar ist, z. B. bei Trisomie 21. (b) Erbeinflüsse sind zweifelsfrei nachzuweisen, wenn ein Merkmal oder eine Krankheit in aufeinanderfolgenden Generationen einem bekannten Erbgangsmodell entsprechen. Die meisten Merkmale werden nicht durch einzelne, sondern durch mehrere Gene determiniert, z. B. Größe, Gewicht, Haarfarbe, Intelligenz, Persönlichkeitsfaktoren. In vielen Fällen ist eine Erkrankung durch eine Anlage nicht deterministisch programmiert. Anlagebedingt ist nur ein erhöhtes Risiko zu einer best. Erkrankung. Bei in kontinuierlichen Abstufungen vorkommenden psychologischen Variablen wie Intelligenz, Dominanz oder Aggressivität muss ein Zusammenwirken vieler unabhängig voneinander vererbter Gene oder Gengruppen angenommen werden (polygene Vererbung). Dabei kann das gleiche Gen sich unter dem Einfluss anderer Gene (Modifikatoren) verschieden auswirken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den Anlageeinfluss nachzuweisen: (a) Reinzüchtung: Wenn die phänotypische Varianz der Nachkommen durch selektive Partnerwahl eingeschränkt wird, ist ein Erbeinfluss nachgewiesen. (b) Populationsgenetische Analyse (v. a. Zwillingsuntersuchungen) (c) Phänotypische Stabilität: Damit ist gemeint, dass die Positionen der Individuen in der Verteilung eines Merkmals oder einer Leistung in der Alterskohorte als Bezugsgruppe erhalten bleiben. Wir wissen aus Längsschnittuntersuchungen, dass vom Grundschulalter an der IQ bis ins Er- wachsenenalter eine vergleichsweise hohe und wachsende Stabilität aufweist. Entwicklung kann als Stabilisierung interindividueller Unterschiede aufgefasst werden und damit als Herausbildung von Eigenschaften und Fähigkeiten. Aber: Probleme des Nachweises der Stabilität von Eigenschaften und Fähigkeiten: Phänomenal Verschiedenes kann auf denselben Dispositionen, phänomenal Ähnliches kann auf verschiedenen Dispositionen beruhen. Zwillingsuntersuchungen: Eineiige Zwillinge entwickeln sich in einem einzigen befruchteten Ei und sind anlagemäßig identisch. Alle Unterschiede müssen auf andere als Anlagefaktoren zurückgeführt werden. Bei allen anderen Verwandtschaftsgraden: Ähnlichkeiten um so größer, je enger die Verwandtschaft ist und je länger sie im gleichen Kontext gelebt haben. Zweieiige Zwillinge sind anlagemäßig nicht ähnlicher als normale Geschwister; teilen aber normalerweise, da sie gleich alt sind, mehr an Kontext und Erfahrungen als diese. Eineiige Zwillingspaare weisen auch bei frühzeitiger Trennung eine größere Ähnlichkeit hinsichtlich der Intelligenzleistung auf als zweieiige Zwillinge, was für einen erheblichen Anlageanteil an den phänotypischen Ausprägungsdifferenzen bei der Intelligenz spricht. Dies gilt nicht nur für die Intelligenz, sonder z. B. auch für die meisten Persönlichkeitsmerkmale (Aggressivität, Selbstkontrolle, Ängstlichkeit, Impulsivität, Soziabilität). Ein größerer Anteil an der Varianz phänotypischer Unterschiede wird durch Unterschiede im Erbgut als durch Umweltunterschiede während der Entwicklung erklärt. Untersuchungen in Adoptivfamilien: Die adoptierten Kinder werden durch die Adoptiveltern in dem von diesen gestalteten Entwicklungskontext sozialisiert. Veränderung des Erblichkeitskoeffizienten mit dem Lebensalter: Entwicklungspsychologische Studien zeigen, dass die Erblichkeitskoeffizienten nicht in jedem Alter gleich sind. Genetische Ähnlichkeiten und Unterschiede manifestieren sich immer deutlicher nach der Vorschulperiode, da die Umwelteinflüsse der ersten Lebensjahre keine bis zur Adoleszenz stabil bleibenden Unterschiede verursachen. Aber: Ein hoher Erblichkeitskoeffizient darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass die Entwicklungsprozesse determiniert seien! 76 D – 7 – 2: Anlage-Umwelt-Entwicklungsmodelle (Quelle: Oerter / Montada Kap. 1) Plomin unterscheidet hypothetisch drei Arten der Anlage-Umwelt-Korrelation: (a) Passive Kovariation: Hat der Vater Interesse an Musik, überträgt er das auf sein Kind und kauft diesem vielleicht früh ein Instrument usw. (b) Evokative Kovariation: Das Kind erhält Angebote und Anforderungen, die durch seinen Genotyp ausgelöst sind, z. B. erhält ein lernbegieriges Kind mehr Lernangebote als ein uninteressiertes Kind, das diese Angebote nicht evoziert. (c) Aktive Kovariation: Kind wählt aus dem Umweltangebot das aus, was seinem Genotyp entspricht, bspw. soziale Kontakte, Interessengebiete. Im günstigsten Fall der Eltern-Kind-Beziehung fallen diese 3 Kovariationen zusammen. Weichen die Vorstellungen davon ab, sind drei Fälle fehlender Passung zu unterscheiden: (a) Eltern bemühen sich, kulturell positiv bewertete Ziele zu erreichen. (b) Eltern verkennen die positiven Entwicklungspotentiale und versuchen weniger ausgeprägte Potentiale zu fördern. (c) Eltern unterschätzen die Entwicklungspotentiale und ihre eigenen Möglichkeiten zur Entwicklungsförderung und bieten keine ausreichenden Entwicklungsmoglichkeiten. Mit steigendem Lebensalter verliert die passive Kovariation an Bedeutung, die aktive nimmt zu und die evokative bleibt gleich. Reifung: Unter Reifung wird die gengesteuerte Entfaltung der biologischen Strukturen und Funktionen verstanden, die universell in einer Altersperiode und weitgehend ohne Lernprozesse auftreten, z. B. selbstständiges Gehen (etwa 12. Lebensmonat), erste logische Operationen (um das sechste Lebensjahr). Es gibt keinen Weg, den Erwerb dieser Kompetenzen durch Lernanordnungen deutlich vorzuverlagern. Reifung wurde in der Entwicklungspsychologie auch negativ definiert, nämlich als jener Prozess, der anzunehmen ist, wenn Erwerbungen nicht oder kaum auf Erfahrung, Übung, Erziehung, Sozialisation oder gedankliche Erkenntnisgewinnung zurückgeführt werden können. Die Konzepte Reifestand und sensible Perioden beinhalten, dass ein bestimmter Entwicklungsstand gegeben sein muss, damit Erfahrungen auf fruchtbaren Boden fallen können. Jedes zu früh oder zu spät ist mühsam, langwierig und vielfach zum Scheitern verurteilt. Sensible Perioden: In der Entwicklungspsychologie werden sensible Perioden als Entwicklungsabschnitte definiert, in denen spezifische Erfahrungen maximale positive oder negative Wirkungen haben. 77 Gebiet E: Pädagogisch-psychologische Diagnostik und Evaluation E – 1: Grundbegriffe E – 2: Gütekriterien E – 3: Fähigkeits- und Leistungstests E – 4: Verschiedene Erhebungsverfahren E – 5: Standardisierte und nicht-standardisierte Formen der Beurteilung E – 6: Schulnoten E – 6 – 1: Schulnoten / Zensuren (Quelle: HPP S. 805-810) Funktionen von Schulnoten: (a) Sie dienen der Skalierung pädagogisch bedeutsamer Leistungs- und Verhaltensmerkmale. Sie stellen Indikatorvariablen für das Konstrukt Schulleistung dar. (b) Sie sollen individuelle Unterschiede und intraindividuelle Veränderungen erkennbar machen. (c) Funktion der biographischen Steuerung: Sie sind Grundlage wichtiger privater Entscheidungen. (d) Soziale Funktion: Schulnoten und Schulzeugnisse sind Grundlage wichtiger öffentlicher Entscheidungen (Weichenstellungsfunktion). Noten setzen damit auch die gesellschaftliche Forderung nach Auslese gemäß dem Leistungsprinzip um. Sie steuern die Arbeitsplatzvergabe und die Vergabe von Zugangsberechtigungen mit (Klassifikations-, Allokations-, Selektions- und Effizienzsicherungsfunktion). (e) Die Notengebung gehört zu den Amtspflichten eines Lehrers. Das Zustandekommen unterliegt administrativer und gerichtlicher Kontrollen. (f) Pädagogische Funktion: Zensuren machen Schüler mit Leistungsvergleichen und Normen vertraut. (g) Feedback-Funktion: Zensuren stellen wertende Rückmeldungen dar. Ihre Informationen stellen damit eine Erziehungshilfe dar. (h) Anreizfunktion: Zensuren können motivieren und disziplinieren. (i) Kontrollfunktion: Sie machen die Einhaltung der Schulpflicht sowie die Ergebnisse der schulpolitischen Maßnahmen transparent und kontrollierbar. In seiner amtlichen Definition handelt es sich bei Zensuren um ein verbindliches Klassifikationsschema mit einer verbal verankerten numerischen Schätzskala. Sie ist nicht am Durchschnitt orientiert, sondern daran, inwieweit eine bestimmte Leistung einer bestimmten Anforderung entspricht (sachliche Bezugsnormorientierung und keine soziale). Ermittlung von Noten und Urteilsbildung: Leistungen sind nicht durch bloßes Beobachten erkennbar. Sie müssen noch auf Normen bezogen und gewichtet werden. Die diagnostische Kompetenz des Lehrers bildet sich sowohl aus sachgerechter Beobachtung, als auch aus der zutreffenden Deutung der Schülerleistung. Gütekriterien für die Notengebung: (a) Objektivität (Beurteilerunabhängigkeit). Das Problem hierbei ist die mangelnde Vergleichbarkeit und der Mangel an klassen- und schulübergreifenden Maßstäben. (b) Reliabilität (zeitliche Stabilität und Urteilskonstanz): Die Verteilungen der Zensuren weisen einige zeitlich und regional stabile Charakteristika auf. Aber es gibt auch charakteristische Verschiebungen in der Notengebung, z. B. Verschlecherung der Noten im Verlauf der Grundschule und beim Übertritt in die Sekundarstufe. Außerdem werden die Hauptfächer strenger beurteit als R, Sp, Ku. 78 Die Retest-Reliabilität liegt in der Grundschule bei r > 0,8 und in der Sekundarstufe I bei r > 0,7. Die Reliabilität ist v. a. zur Legitimierung der sozialen Funktion von Zensuren wichtig. Fehlerquellen bei der Notenvergabe: (a) Begrenzte Speicherkapazität von Daten über Schulleistung im Unterricht. (b) Beobachtungsmängel (z. B. selektive Wahrnehmung des Lehrers). (c) Erinnerungsfehler. (d) Urteilstendenzen (z. B. Neigung zu Milde, zu Strenge, zur Nivellierung, zu Extremurteilen). (e) Fehlerhafte Attribuierung (z. B. Diagnose von „Begabungsmängeln“) (f) Vorurteils- und Erwartungseinflüsse. (g) Einflüsse von Sympathie und Antipathie. (h) Unterschiede in der Bezugsnorm bzw. Referenzfehler: Orientierung nicht an best. Leistungskriterien, sondern am Klassendurchschnitt. (i) Aktuelle Befindlichkeit des Lehrers. Kritik wird an den Zensuren auch deshalb geübt, weil sie v. a. bei schlechten Zensuren keine Aussagen über die Art und Weise der Schwächen machen. Hier ist eine Ergänzung durch Kommentare notwendig. E – 7: Evaluation 79 Gebiet F: Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen F – 1: Auffälligkeiten im Bereich des Lernens F – 1 – 1: Lernstörungen (Quelle: HPP S. 418-423 / Zielinski) F – 1 – 1 – 1: Begriffsexplikation zu „Lernstörung“ Wird unterschiedlich verwendet, z. B. im Sinn von „Lernbehinderung“, „Lernschwäche“, „Lernbeeinträchtigung“, „Lernversagen“, „Leistungsbeeinträchtigung“ etc... Zumeist wird der Begriff institutionell-pragmatisch (und nicht psychologischtherapeutisch) verwendet: Es geht um das Versagen von Schülern bei der Bewältigung kognitiver Leistungsanforderungen. Lernschwierigkeiten nach Hamill (1990): „Ein allgemeiner Ausdruck für eine heterogene Gruppe von Störungen, die sich in bedeutsamen Schwierigkeiten beim Erwerb oder Gebrauch des Hörverständnisses, Sprechens, Lesens, Schreibens, Denkens oder Rechnens manifestieren. Diese Störungen liegen im Individuum selbst begründet, sind vermutlich auf Dysfunktionen des zentralen Nervensystems zurückzufuhren und können über die gesamte Lebensspanne hinweg auftreten.“ Sie können mit Problemen der Selbstregulation, der sozialen Wahrnehmung und des sozialen Verhaltens gekoppelt sein. Externe Umstände (z. B. Unterricht; soziokulturelle Faktoren) moderieren lediglich den Charakter der Begleitphänomene. Eine Lernstörung liegt dann vor, wenn eine Leistung erbracht wird, die unterhalb der tolerierbaren Abweichung von der Bezugsnorm liegt. Bezugsnormen sind: (a) sachlich-institutionell: Vergleich mit den Lernzielen, z. B. des Lehrplans. (b) sozial: Vergleich mit der Leistung der Klassenkameraden. (c) individuell-personenbezogen: Vergleich mit bisherigen Leistungen eines Schülers. Bedeutung des Phänomens Lernschwierigkeiten / Konsequenzen, die ein Schüler zu erwarten hat nach Höhn (1967): (a) Ermahnung, Tadel, Bestrafung durch die Lehrenden, Vorwürfe (b) negative Einschätzungen durch Klassenkameraden (dumm, faul, laut, unruhig, böse etc.) (c) langfristig beeinflussen Misserfolge das Selbstvertrauen des Schülers, Stigmatisierung Eine Lernstörung liegt auch dann vor, wenn das Erreichen einer Leistung mit schwerwiegenden unerwünschten Belastungen und Nebenwirkungen im Erleben und Verhalten der Schüler verbunden ist. Unterscheidung zwischen Lernstörungen... (a) ...beim Erwerb und Aneignen von Unterrichtsstoff (Lernen) (b) ...beim Problem- und Aufgabenlösen. Weitere Unterscheidung in (a) eine produktorientierte Sichtweise von Lernstörung und (b) eine prozessorientierte. Die Schwere der Lernstörung bemisst sich (a) nach dem Grad der Normabweichung, (b) nach der Dauer (kurzzeitig bis chronisch), (c) nach dem Verallgemeinerungsgrad (partielle Störung bei best. Lerninhalten bis generelle) und (d) nach dem Grad der Beeinflussbarkeit / Behandelbarkeit. Beispiel: Lese-Rechtschreib-Schwäche: Schwerwiegende, chronische, partielle und nur bedingt beeinflussbare Lernstörung. Ein Zusammenhang von Lernstörung und einem niedrigen IQ kann zwar gegben sein. Nach Sander ist aber in der Regel davon auszugehen, dass das lernbehinderte Kind über eine durchschnittliche Intelligenz verfügt. Konzept der „erwartungswidrigen Schulleistung“ (Thorndike, Kemmler): Lernstörung liegt dann vor, wenn Schulleistungen von der gemessenen Intelligenz erheblich abweichen („overachiever“, „underachiever“) Kritik an diesem Konzept: Als einzige Determinante wird die Intelligenz herangezogen. F – 1 – 1 – 2: Grundlegende Erklärungsperspektiven von Lernstörungen Personorientierte Erklärungsperspektive: Hier werden die Ursachen in den allg. Dispositionen des Kindes gesucht, in der Intelligenz, der Begabung, im Selbstbild, in motivationalen oder emotionalen Aspekten etc... Es können aber auch spezielle Dispositionen wie Schulphobie oder mangelndes Interesse zur Erklärung herangezogen werden. 80 (a) Mangelndes Instruktionsverständnis, z. B. verlangsamter Ablauf sprachlicher Kodierungen, mangelhafte oder fehlende Anwendung kognitiver Strategien, Tendenz zum Raten, defizitäre Kontrollprozesse bei der Kurzzeitspeicherung. (b) Mangelnde Vorkenntnisse, z. B. durch Störungen der selektiven Aufmerksamkeit und motivationale Faktoren. (c) Mangelnde Lernmotivation: Aufwand-Nutzen-Bilanz erscheint für den Schüler unrentabel. Misserfolgserlebnisse. Inkompetenzgefühle, gelernte Hilflosigkeit. Keine Lernfreude. Negative Kontrollüberzeugungen. (d) Ontogenetische und aktualgenetische Erklärungsanteile: Kompetenzdefizite: Fehlende Problembewältigungsstrategien aufgrund von chronisch wirksamen Bedingungen, z. B. im kognitiven Bereich (mangelnde Vorkenntnisse etc...) oder im nichtkognitiven Bereich (z. B. kumulierte schulische Misserfolge, Selbstbildaspekte). Kompetenzstörung: Sie liegt dann vor, wenn eine vorhandene Kompetenz in einer aktuellen Situation nicht erfolgreich eingesetzt werden kann. Es ist auch möglich, dass ein Schüler nicht erkennt, dass er über Lösungsmöglichkeiten verfügt oder dass aktuelle Bedingungen die Kompetenzentfaltung blockieren (z. B. aufgrund von Angst, Impulsivität, Desinteresse). Situationistische Erklärungsperspektive: Lernstörungen aufgrund von situativen Besonderheiten der aktuellen Lernsituation, z. B. (a) Faktoren der schulischen Lernumwelt, gestörte Beziehungen zwischen den Schülern, das Klassenklima, das Lehrerverhalten, die Schüler-LehrerInteraktion, ATI-Aspekte, nicht ausreichende Lernzeit, mangelnde Unterrichtsqualität. (b) Beeinträchtigungen im familiären Umfeld. (c) Einfluss von Medien. Interaktionistische Erklärungsperspektive: Wechselwirkungen von Schülerdisposition und aktueller Lernumwelt. Lernstörung als Resultat einer PersonUmwelt-Interaktion. Erklärungsperspektive des Etikettierungsansatzes: Lernstörung ist hier ein Konzept, das erst ein Beobachter von Lernverhalten aufgrund von subjektiven (und intersubjektiv variablen) Kriterien herstellt. F – 1 – 1 – 3: Prävention und Intervention bei Lernstörungen Verschiedene Ansätze setzen an versch. Sichtweisen an: (a) An der personorientierten: z. B. spezielles kognitives Training. (b) An der situationistischen: z. B. effektive Unterrichtsgestaltung nach didaktischen Grundprinzipien. (c) An der interaktionistischen: Gestaltung pädagogisch-therapeutischer Maßnahmen. Individualisierter, personzentrierter, fördernder, differenzierter, gezielt unterstützender Unterricht (vgl. ATI-Aspekte). Verbesserung des sozio-emotionalen Klassenklimas. Anwendung von Ermutigungstechniken. Familieninteraktion. (d) An der kognitiv-behavioralen: z. B. operante Konditionierungsmethoden. F – 2: Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen F – 2 – 1: Hyperaktivität und Impulsivität (Quelle: HPP S. 260-265) Def.: Hyperaktivität ist eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und impulsive motorische Aktivität, die besonders in strukturierten und organisieren Situationen auftritt, die ein hohes Maß an eigener Verhaltenskontrolle erfordern. Hyperaktivität kann sich grobmotorisch, feinmotorisch und in einer großen inneren Unruhe äußern. Diagnose von Hyperaktivität. Sie liegt dann vor, wenn folgende Merkmale überdurchschnittlich häufig oder intensiv auftreten: (a) Zappeln mit Händen oder Füßen. Herumrutschen auf dem Stuhl. (b) Häufiges Aufstehen in der Klasse, wenn Sitzenbleiben erwartet wird. (c) Verstärktes Herumlaufen und Herumklettern. Exzessive motorische Aktivitäten. Hyperkinetische Symptome. (d) Unruhe bei ruhigen Situationen. Häufiges Sich-wie-getrieben-fühlen. (e) Ist von der sozialen Umwelt nur schwer zu „bändigen“. Hyperaktivität zeigt sich schon im Vorschulalter. Erst im Jugendalter kommt es zu einer Verminderung hyperaktiven Verhaltens, wobei sehr oft eine innere Unruhe erhalten bleibt. 81 Def.: Impulsivität ist das plötzliche, unüberlegte Handeln bzw. die Unfähigkeit abzuwarten und Bedürfnisse aufzuschieben. Formen von Impulsivität: (a) Kognitive Implusivität: Tendenz, dem ersten Handlungsimpuls zu folgen und eine kognitive Tätigkeit zu beginnen, bevor sie hinreichend durchdacht worden ist. (b) Motivationale Impulsivität: Schwierigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben oder abzuwarten, bis man an der Reihe ist. Diagnose von Impulsivität. Sie liegt dann vor, wenn folgende Merkmale überdurchschnittlich häufig oder intensiv auftreten: (a) Platzt mit Antworten heraus, ohne dass eine Frage zu Ende gestellt worden ist. (b) Kann nur schwer warten, bis er/sie an der Reihe ist. (c) Unterbricht und stört andere häufig. Platzt z. B. in Gespräche anderer hinein. (d) Redet häufig übermäßig viel, ohne angemessen auf soziale Schranken zu reagieren. Sowohl Hyperaktivität, als auch Impulsivität können sich entwicklungshemmend auswirken und zu einer erheblichen Belastung für das soziale Umfeld werden. Auch wenn Hyperaktivität und Impulsivität häufig miteinander verbunden sind, lassen sie sich empirisch voneinander trennen. Zudem treten diese beiden Phänomene häufig in Verbindung zu anderen Aufmerksamkeitsstörungen, wie oppositionellem oder aggressivem Verhalten auf. Zu den Auffälligkeitskriterien ist zu sagen, dass sie z. T. auch im Rahmen anderer Persönlichkeitsstörungen (Aggressives Verhalten, Angst, Depression) auftreten können. Bei Jungen treten Hyperaktivität und Impulsivität häufiger auf als bei Mädchen. Hyperaktivität und Impulsivität treten häufig auch situationsspezifisch auf, z. B. in der Schule eher als beim Lieblingshobby. Ursachen von Hyperaktivität und Impulsivität: (a) Biologische Ursachen: genetische Einflüsse, neurologische Störungen, Störungen des Immunsystems. Biologische Merkmale spielen eine entscheidende Rolle bei der Genese der Störung. Die große Bedeutung gene- tischer Faktoren wurde sowohl durch Zwillingsstudien, als auch durch molekulargenetische Untersuchungen belegt. (b) Psychosoziale Ursachen: Die psychosozialen Faktoren beeinflussen wesentlich den Verlauf der Störung. V. a. die Situationsabhängigkeit des Auftretens von Hyperaktivität und Impulsivität verweist auf den Einfluss psychosozialer Bedingungen, zumindest im Hinblick auf die unmittelbare Auslösung. D. h. auch, dass motivationale Faktoren beim unmittelbaren Auftretens hyperaktiven Verhaltens eine Rolle spielen. Zusammenfassend könnte man dem Modell eines neuropsychologischen Ursachenkomplexes folgen. Dieses geht davon aus, dass hier die Fähigkeit zur Hemmung von Impulsen und Handlungsabläufen defizitär ist („Störung exekutiver Funktionen“). Dies trifft sowohl auf das Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis zu, als auch auf den Bereich der Selbstregulation von Affekten. Diagnosemethoden: Beobachtung, Gespräch mit dem Kind und den Eltern, testpsychologische Untersuchungen. Eine Intervention sollte versch. Strategien umfassen: (a) Aufklärung und Beratung. Gespräche mit dem Kind und den Eltern. (b) Kognitive Therapie zur Verminderung von impulsivem und unorganisiertem Aufgabenlösen. Steigerung der Konzentrationsfähigkeit. Selbstinstruktionstraining. Einsatz von lernpsychologischen Verstärkungen. (c) Verhaltenstherapeutische Intervention. (d) Pharmakotherapie zur Verminderung hyperkinetischer Symptome in der Schule bei extremer und situationsübergreifender Hyperaktivität. F – 2 – 2: Aufmerksamkeit, Konzentration und ADHS (Quelle: HPP S. 42-47 / Petermann Kap. 6) Def. „Aufmerksamkeit“: Selektion und Strukturierung eines Wahrnehmungsund Aufgabenfeldes. Die Aufmerksamkeitsprozesse können mit Filter-, Kapazitäts- und Ressourcenmodellen erklärt werden. Aufmerksamkeit ist die Voraussetzung für Konzentration. Diese zeichnet sich aus durch: (a) Intentionalität. (b) Integration der selektierten Reize in vorhandene kognitive Strukturen. (c) Beanspruchung energetischer Ressourcen. Aufmerksamkeit und Konzentration sind hypothetische Konstrukte. 82 Die Reizaufnahme (visuell, akustisch, haptisch, kognitiv) vermittelt durch Aufmerksamkeitsprozesse kann (a) ohne Intention erfolgen (präattentiv). (b) durch Offenheit gegenüber unerwarteten Reizen erfolgen (Bereitschaft). (c) durch Erwartung erfolgen. (d) durch gezielte Suche erfolgen. F – 2 – 2 – 1: Diagnostik Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom Jungs haben häufiger Aufmerksamkeitsstörungen bzw. ADHS als Mädchen. Störung der Aufmerksamkeit: Aufgaben werden vorzeitig abgebrochen oder nicht beendet. Tritt häufig dann auf, wenn Tätigkeiten fremdbestimmt sind, z. B. bei Hausaufgaben oder wenn sie sich über eine längere Zeitspanne erstrecken. Die Aufmerksamkeitsstörung kann in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Bei neuen Tätigkeiten oder Lieblingstätigkeiten treten sie kaum auf. Unterscheidung zwischen situationsübergreifender Aufmerksamkeitsstörung und situationsspezifischer. Methode: Schüler sollen weitgehend intelligenzunabhängige Routineaufgaben lösen, die als Schnelligkeitstests angelegt sind, z. B. Durchstreichverfahren, Sortiertests, einfache Rechenaufgaben. gute Leistung: Kein ADHS. schlechte Leistung: weitere diagnostische Verfahren notwendig: Schülerbefragung, Verhaltensanalyse, Unterrichtsbeobachtung. In Verbindung mit Impulsivität und Hyperaktivität: Hyperkinetische Störung. Zur Diagnose wichtig: Dauer länger als 6 Monate, Störungen schon vor dem 7. Lebensjahr, Beeinträchtigung in sozialen oder schulischen Funktionsbereichen. F – 3: Teilleistungsstörungen F – 3 – 1: Teilleistungsstörungen als umschriebene Entwicklungsstörungen (Quelle: Petermann, Kapitel 15) F – 2 – 2 – 2: Trainingsprogramme zur Verbesserung der Aufmerksamkeit Modell-Lernen: Interaktion mit aufmerksamkeitsstarken und relevanten Bezugspersonen. Übertragung von Verhalten und Einstellungen dieser Personen. Verbesserung der Situationsvariablen zur Aktualisierung von konzentriertem Verhalten: (a) Physischer Zustand: gute Ernährung, gutes Frühstück, Ausgeschlafenheit. (b) Motivation: Interesse und positive Erwartungen. (c) Erlernen internalisiereter Kontrollen und von Selbststeuerung. Bei neurophysiologischer Beeinträchtigung: ärztliche und medikamentöse Behandlung. Maßnahmen in der Schule und im Unterricht: (a) Rhythmisierung des Unterrichts durch Aktivitäts- und Entspannungsphasen. (b) Aktive Überwachung und Begleitung bei Einzelarbeit der Schüler. (c) Hohe Nutzung der Unterrichtszeit. (d) Strukturierungshilfen anbieten. (e) Selbstinstruktionstraining. Def.: Umschriebene Entwicklungsstörungen kennzeichnen Leistungsdefizite in begrenzten Funktionsbereichen, die aufgrund der allg. Intelligenz, Förderung sowie körperlicher und seelischer Gesundheit des Betroffenen nicht erklärt werden können. Sie haben eine hohe Bedeutung für Schulleistungsprobleme und meist sekundär auch für psychische Störungen. Zwei Annahmen, die dem Konzept der umschriebenen Entwicklungsstörung zugrunde liegen: (a) Die Normalitätsannahme: Kinder mit umschriebener Entwicklungsstörung verfügen über eine normale Intelligenz, haben keine Sinnesschädigung und keine neurologische Störung. Eventuell bestehende emotionale Probleme dürfen nur Folge und nicht Ursache der Störung sein. (b) Die Diskrepanzannahme: Sie fordert eine bedeutende Differenz zwischen dem allgemeinen Leistungsniveau und der spezifischen Teilleistung bzw. zwischen den aufgrund von Intelligenz und Lerngeschichte zu erwartenden und den realisierten Leistungen. Formen umschriebener Entwicklungsstörungen: (a) Artikulationsstörungen. (b) Expressive und rezeptive Sprachstörung. 83 (c) (d) (e) (f) Landau-Kleffner-Syndrom (Aphasie, Verlust des Sprechvermögens) Rechenstörung. Umschriebene Entwicklungsstörungen der motorischen Funktionen. Legasthenie. F – 3 – 2: Rechen- und Mengenschwäche / Akalkulie (Quelle: Petermann Kap. 15) Beschreibung der Störung: (a) Beeinträchtigung der Rechenfertigkeit, die nicht durch eine mangelnde Förderung erklärt werden kann. (b) Hervorstechend: Probleme in den grundlegenden mathematischen Operationen Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation. (c) Probleme, Rechenprozeduren zur Lösung arithmetischer Probleme anzuwenden. (d) Fehlerhafte oder nicht vorhandene Repräsentationen beim Abruf von grundlegenden mathematischen Fakten aus dem Langzeitgedächtnis. Grissemann und Weber (1993) sehen verschiedene neuropsychologische Funktionsstörungen als Grundlage für Rechenstörungen: (a) Fehlendes operatives Verständnis bei der mechanisch assoziativen Automatisierung des Rechenvorgangs. (b) Auditive Kurzzeitgedächtnisschwäche. (c) Richtungsstörungen im Umgang mit den Ziffern. (d) Fehlleistungen im Kodieren und Dekodieren mathematischer Symbole. (e) Schwierigkeiten des Sprachverständnisses beim Übertragen von Textaufgaben in den praktischen Rechenvorgang. (f) Graphomotorische Behinderungen (Störungen des Zahlenschreibens). (g) Konzentrationsschwierigkeiten bei komplexeren Rechenvollzügen. Unterscheidung zwischen Kindern, deren Rechenschwäche als Folge einer ausgeprägten Lese-Rechtschreibschwäche bzw. der ihr zugrunde liegenden neuropsychologischen Defizite anzusehen ist und Rechenschwächen, die bei guten Lese-Rechtschreibleistungen auftreten. (a) 1. Fall: generalisierte Sprachschwäche. Kinder mit gleichzeitig vorhandenen Rechendefiziten und starker LRS weisen eine relative Beeinträchtigung der linkshemisphärischen Funktionen auf, ihre Schwierigkei- ten scheinen auf den verbalen Bereich beschränkt zu sein, während sie beim nichtsprachlichen Problemlösen gute Ergebnisse bringen. (b) 2. Fall: visuoräumliche Defizite. Die Defizite von Kindern mit Rechenschwäche bei guten Lese-Rechtschreibleistungen sind auf den nonverbalen Bereich begrenzt, was eine relative Dysfunktion der rechten Hemisphäre nahe legt. Abgrenzung gegen Intelligenzminderungen und gegen schwere Formen der Lese-Rechtschreibschwäche ist notwendig. ( Anwenden von Verfahren, die auch das sprachlich-schlussfolgernde Denken umfasst, eine Prüfung des Kurzzeitgedächtnisses, Verfahren zum Zahlennachsprechen sowie Verfahren, die die Reihenfolge von Symbolen berücksichtigen oder solche, die die Zuordnung von Zahlen zu Symbolen erfassen.) Definitionskriterien für Rechenschwäche (Lewis et al. 1994): Nonverbale Intelligenz und Leseleistung entsprechen einem IQ von mindestens 90 und Rechenfertigkeiten liegen unter einem IQ von 85. Diagnostik nach den allgemeinen Richtlinien für umschriebene Entwicklungsstörungen. Interventionsverfahren bzw. pädagogische Therapieansätze bei Rechenstörungen (Grissemann und Weber, 1993) umfassen vier Stufen: (a) Förderung anschaulich praktischer Intelligenzleistungen, ein visuelles Wahrnehmungstraining, die Sicherung des Zahlbegriffs und die Förderung der Einsicht in das dekadische Positionssystem. (b) Verstehen der bildlichen Darstellung von Operationen unter Vorstellung des Vollzugs, insbesondere Training des anschaulichen Gedächtnisses. (c) Verstehen der Zifferngleichungen unter Ausblendung der Vorstellung. (d) Maßnahmen zur Festigung und Automatisierung arithmetischer Grundbeziehungen. Erklärungsansätze bzw. -annahmen: Unangemessene Lehrpläne, pathologische Ängstlichkeit, Störungen im sprachlichen und visuoräumlichen Bereich (Hinweise, dass genetische Faktoren bei der Weitergabe eine Rolle spielen). 84 F – 3 – 3: Lese- und Rechtschreibstörung / Legasthenie (b) (Quelle: Petermann Kap. 17 / Legasthenie-Leitfaden für die Praxis) Lesen: Übersetzung graphischer Zeichen in akustisch-sprachliche Infos. Rechtschreiben: Transformation akustisch wahrgenommener Sprache in visuell-sprachliche Zeichen. F – 3 – 3 – 1: Charakteristika von Lese- und Rechtschreibschwächen Das Störungsbild des Lesens (Symptome der Lesestörung nach ICD-10): (a) Auslassen, Ersetzen, Verdrehen, Hinzufügen von Worten, Wortteilen. (b) Niedrige Lesegeschwindigkeit. (c) Startschwierigkeiten beim Vorlesen, langes Zögern, Verlieren der Zeile im Text, ungenaues Phrasieren. (d) Vertauschen von Wörtern im Satz oder von Buchstaben in den Wörtern. (e) Defizite, Gelesenes wiederzugeben, aus Gelesenem Schlüsse zu ziehen. Das Störungsbild des Rechtschreibens (Rechtschreibfehler sind vom schulischen Entwicklungsstand des Kindes abhängig. Sie bauen sich mit der Zeit normalerweise ab.) (a) Reversionen: Verdrehungen von Buchstaben im Wort (b-d; p-q; u-n). (b) Reihenfolge- oder Sukzessionsfehler: Umstellungen von Buchstaben im Wort (die-dei). (c) Auslassung von Buchstaben (auch - ach). (d) Einfügung falscher Buchstaben. (e) Regelfehler (Dehnung, Groß- und Kleinschreibung). (f) Fehlerinkonstanz: ein Wort wird immer wieder unterschiedlich fehlerhaft geschrieben. (g) Bei schwergradiger Rechtschreibstörung: keine Fehlererkennung und Korrektur nach Hinweis auf einen Rechtschreibfehler. Unterschiedliche Varianten: (a) Klassische Lese- und Rechtschreibstörung (Diagnose meist im 2. Schuljahr). (b) Isolierte Rechtschreibstörung (ohne Lesestörung) / Störung des schriftlichen Ausdrucks. Lesestörung und Rechtschreibstörung sind häufig miteinander verknüpft. (a) Schon mit 2,5 Jahren: Geringere Äußerungslänge (defizitäres phonologisches Arbeitsgedächtnis). Niveau der Lese- und Rechtschreibentwicklung eines Schülers erscheint hochgradig stabil. Lese- und rechtschreibschwach diagnostizierte Kinder auch am Ende der Volksschulzeit noch schriftsprachlich beeinträchtigt. (c) Ab der 2. Klasse: Enorm reduzierte Lesegeschwindigkeit. Primäre Begleitstörungen: (a) 60-80%: Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache. (b) 5-10%: visuelle und visuo-motorische Symptome (z. B. gestörte Figurgrundwahrnehmung). (c) Oft komorbide Verknüpfung mit Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität, Impulsivität. Sekundäre Begleitstörungen: (a) Chronische psychische Überforderung, irrtümliche Einschätzung als minderbegabt, Leidensdruck. (b) Psychische Begleitstörungen: Hyperkinetische Symptomatik: Konzentrationsstörungen. Lern- und Leistungsstörungen, Motivationsverlust, Überehrgeiz, Leistungsversagen. Emotionale Symptome wie Schul- oder Versagensangst, depressive Verstimmungen, suizidale Äußerungen meist im Jugendalter. Psychosomatische Symptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Störungen im Sozialverhalten, Disziplinschwierigkeiten. (c) Hausaufgabenkonflikte: Familiäre Schwierigkeiten eskalieren meist in der Hausaufgabensituation (ist zeitintensiv, Überforderung, Unkonzentration, vergebliches Bemühen der Eltern...) Verbreitung: (a) Im deutschen Sprachraum: 2,7% lese- und rechtschreibschwache Schüler im Alter von 8 Jahren. (b) Signifikant häufigeres Auftreten der Lese- Rechtschreibschwäche bei Verwandten 1. Grades. (c) Jungen mit 60-80% häufiger als Mädchen betroffen. (d) Problem kann in allen sozialen Schichten auftreten (vgl. neurobiologische Ursachen.) 85 F – 3 – 3 – 2: Diagnostik von Legasthenie Bei Diagnose wichtig: Klassifikatorische Abgrenzung gegenüber umfassenderen Krankheitsbildern, wie z. B. einer Hirnschädigung, einem IQ unter 70 oder einer psychiatrischen Erkrankung. Prognosen der Sekundärsymptomatik: (a) Prognose psychischer Entwicklung: oft emotional auffallig und verhaltensgestört. Höhere Suizidgefährdung. (b) Schulische und berufliche Entwicklung: Gefahr, in anderen Schulleistungsbereichen schlecht abzuschneiden. Geringere Abiturientenquote. Oft Ausbildungen, in denen Lese- und Rechtschreibfähigkeiten keine wesentliche Rolle spielen. Höhere Arbeitslosigkeitsgefahr. (c) Soziale Entwicklung: Häufigere Delinquenz, dissoziales Verhalten, Straftaten. Diagnostik: Individuell durchgeführte, standardisierte Tests mit (a) Basisdiagnostik: 1. Leseprüfung; 2. Rechtschreibprüfung; 3. Buchstabenlesen; 4. Buchstabendiktat; 5. Abschreiben von Wörtern und Texten; 6. Zahlenlesen; 7. Lesenlassen von neuen Wörtern oder Pseudowörtern. (b) Zusatzdiagnostik: 1. Intelligenzdiagnostik; 2. Sprachentwicklungsdiagnostik; 3. Diagnostik der motorischen Entwicklung, Visumotorik, Konzentration; 4. Internistische und neurologische Untersuchung z. B. Sehund Hörfunktion; 5. Anamnese (Krankheitsvorgeschichte) und Exploration (Befragung der Eltern und Lehrer). Erklärungsansätze (LRS ist ein heterogenes Syndrom): (a) Genetische Dispositionen. Eine polygene Vererbung ist anzunehmen. Befunde deuten daraufhin, dass nicht LRS, sondern schriftsprachimmanente Funktionen, die für das Erlernen des Lesens und Schreibens unabdingbar sind, veranlagt sind. (Vgl. verlangsamte Infoverarbeitung im visuellen Kortex; ungünstige Verhaltensdispositionen wie Impulsivität.) (b) Somatogene Begründung: Peri- und postnatal entstandene Hirnfunktionsstörungen. (c) Psychogene und soziokulturelle Begründung: psychosoziale Einflüsse, psychogene Lernhemmungen, defizitäre Förderung. (Vgl. Fehlen kognitiver Strukturen und sprachlichen Vorwissens.) Hypothese gestörter sprachlicher Informationsverarbeitung. Beeinträchtigung in folgenden Feldern: (a) Phonologische Bewusstheit: Fähigkeit, sprachliche Einheiten (Wort, Reime, Silben, Phoneme) zu erkennen und mit ihnen zu operieren. Bei LRS-Kindern: mangelhafte Ausbildung dieser phonologischen Bewusstheit, unfähig zu Phonemanalyse und Phonemsynthese. (b) Phonologisches Rekodieren: Beim Zugriff auf das semantische Gedächtnis gibt es Probleme: Fähigkeit, schriftliche Symbole oder Dinge aus der Umwelt zu rekodieren (in eine lautsprachliche Struktur zu übertragen). LRS-Kinder: geringere Geschwindigkeit dieses Prozesses. Probleme auch bei Enkodierung von Schriftwörtern. Beeinträchtigtes orthographisches Lexikon (defizitäre abstrakte Repräsentationen von Phonemen). Hypothese gestörter visueller Informationsverarbeitung: Bei 5-10% LRSKinder sind visuell-räumliche Wahmehmungsschwierigkeiten diagnostizierbar. Besonderheiten der Anatomie und Hirnfunktion des Systems visueller Informationsverarbeitung. D. h. es gibt keine eindeutige Symptomatik und Ursache, sonderen es bestehen Lese- und Rechtschreibstörungen unterschiedlicher Ätiologie und Ausprägung. F – 3 – 3 – 3: Prävention, Intervention und Fördermaßnahmen Prävention und vorschulische Förderung: (a) Steigerung der phonologischen Bewusstheit: Aufgaben zur Silbensegmentierung, Reimerkennung, Lautanalyse, Lautsynthese. Reimerkennung. Lausch- und Flüsterspiele. (b) Verbesserung des phonetischen Rekodierens im Arbeitsgedächtnis: Aufgaben zum schnellen Benennen. Aber: Legasthenie lässt sich nicht einfach wegtherapieren. Früherkennung z. B. durch Bielefelder Screening-Verfahren. Frühförderung z. B. durch Würzburger Trainingsprogramm zur phonologischen Bewusstheit. Intervention im Schulalter: (a) Hauptbehandlungsaufgaben: (1.) Funktionelle Behandlung des Lesens und Rechtschreibens. (2.) Unterstützung des Kindes bei der psychischen Bewältigung der bestehenden LRS. Ziele: Realistische Einstellung. Gute Lern-Rahmenbedingungen. Erwerb von Lerntechniken. Selbstbestärkung. 86 (3.) Behandlung der begleitenden psychischen Symptome. Vs. Angststörungen, depressive Störungen, hyperkinetische Störungen, Störungen des Sozialverhaltens. (4.) Evtl. Behandlung von Seh- und Hörstörungen. (b) Ansatzpunkte: (1.) Einzeltherapie mit dem Kind, mindestens wöchentlich. Systematische Förderprogramme, z. B. zur Verknüpfung von Phonemen und Graphemen, zur Lautanalyse und Lautsynthese oder zur Stützung der Lernfreude. (Eine medikamentöse Behandlung für Legasthenie gibt es nicht, höchstens für sekundäre Begleiterscheinungen.) Hilfe auch bei zusätzlichen Teilleistungsstörungen. Anwendung speziell operationalisierter Förderprogramme oder von speziellen Computerprogrammen (wenngleich diese kein handschriftliches Training leisten können. – Dafür aber individuelle Anpassung und exakte Evaluation möglich.) (2.) Elterntraining und Familienberatung. Aufklärung und Erklärung der Diagnose (Legasthenie hat genetische Ursachen. Keine Schuld der Eltern oder des Kindes.) Kind in seinen Begabungen und Hobbies unterstützen. Dem Kind Verständnis und Geduld entgegenbringen. Entschärfung der Hausaufgabenkonfliktsituation durch gutstrukturierte Rahmenbedingungen, Empathie, Pausen und positive Verstärkungen. Aber auch: Anleitung zur Selbständigkeit. (3.) Sozialrechtliche Maßnahmen für eine umfassende Betreuung. Fördermaßnahmen und Hilfen im schulischen Bereich: (a) LRS-Kinder haben Anspruch auf besondere Förderung, z. B. klassenübergreifende Förderkurse bis zur 10. Klasse. (b) Nachteilausgleich: Zeitzuschlag bei schriftlichen Aufgaben bis zu 50 Prozent. Bei schriftlichen Arbeiten sollten Rechtschreibfehler nicht gewichtet werden (auch in Fremdsprachen!). In Fremdsprachen Gewichtung von mündlichen und schriftlichen Noten im Verhältnis 1:1. (c) Versetzungsentscheidungen werden in pädagogischer Verantwortung der Lehrer getroffen. Schulversetzungen sollten nicht von der LRS abhängig gemacht werden. (Sowohl bei einem eventuellen Sitzenbleiben, als auch beim Übertritt auf eine weiterführende Schule.) (d) Vermerk im Zeugnis: „Aufgrund einer fachärztlich festgestellten Legasthenie wurden Rechtschreibleistungen nicht bewertet.“ F – 4: Störungen des Sozialverhaltens F – 4 – 1: Gewalt und Aggression in der Schule (Quelle: HPP S. 225-230 und Grundkurs Psychologie 2000/01) Gewalt und Aggression in der Schule umfasst verschiedene Phänomene: (a) Gewalt von Schülern gegenüber Mitschülern oder Lehrern (b) Gewalt von Schülern gegenüber der Schuleinrichtung (Vandalismus) (c) Institutionelle, psychische oder physische Gewalt von Lehrern gegenüber Schülern Aggressive Verhaltensweisen liegen dann vor, wenn Individuen (oder Sachen) zielgerichtet Schaden zugefügt wird, wenn diese geschwächt oder in Angst versetzt werden. F – 4 – 1 – 1: Ursachen und Motive für aggressives Verhalten Instinktive Aggression, z. B. zur Verteidigung eines bestimmten Status oder eines Privilegs. Auf Freud zurückgehende Triebtheorie: Der Thanatos (Todestrieb und Teil des „Es“) kann in Gestalt der Aggression nach außen auf andere umgelenkt werden. Ähnlich sieht das auch die vergleichende Verhaltensforschung (K. Lorenz): „Dampfkesseltheorie“: Aggression als evolutionär erworbene genetische Eigenschaft. In dieser Form ist weder Freuds, noch Lorenz´ Hypothese haltbar, verweist aber auf genetische Faktoren. Ärger-Aggression: Abreagieren von Frust oder einer negativen Stimmung (Frustrations-Aggressions-Hypothese). Aggression beruht auf aggressiven Impulsen, die als Reaktion auf unangenehme Ereignisse entstehen. Ursprüngliche Annahme von Dollard et. al. (1939): Aggression ist immer eine Folge von Frustration. Frustration führt immer zu einer Form von Aggression. Frustration entsteht (1.) durch Störung einer zielgerichten Aktivität, (2.) durch 87 Mangelzustände oder (3.) durch Angriffe und Provokationen. Kritik: Hier handelt es sich um einen unhaltbaren Determinismus. Bandura modifizierte diese Hypothese zur Frustrations-Antriebs-Hypothese: Frustration bewirkt einen Antrieb, der sich entweder konstruktiv oder destruktiv auswirkt. D. h.: Es sind kognitive Prozesse über Handlungsalternativen, Reaktionsweisen und deren Folgen etc... dazwischengeschaltet! Instrumentelle Aggression: Aggression als Instrument um z. B. Aufmerksamkeit, Respekt, Macht, Zuwendung oder materielle Vorteile zu erreichen. Aggression als erlerntes Verhalten: Agression wurde modellhaft anhand von aggressiven Vorbildern erlernt (vgl. Bandura) oder beruht auf der Erfahrung, dass aggressives Verhalten zum Erfolg führt (Verstärkungslernen, operante Konditionierung). Aggression als Nervenkitzel oder Selbstzweck: Theorie des „sensationseeking“: Lustgewinn aus Streit oder sadistischem Verhalten. Aggression aufgrund von Autoritätsgehorsam (vgl. die Experimente von Milgram!). Motive und konkrete Auslöser für die Gewaltanwendung: (a) Starkes Bedürfnis nach Machtausübung. Genuss, andere zu kontrollieren. (b) Familiäre Bedingungen. Negative Grundeinstellung der Eltern, v. a. der ersten Bezugsperson (meist die Mutter). Fehlende Wärme und Anteilnahme. Zu hohe Toleranz und Freizügigkeit der ersten Bezugsperson. Machtbetonte Erziehungsmethoden, z. B. körperliche Züchtigung und heftige Gefühlsausbrüche der Eltern. Auch häufige Konflikte, Zwietracht und offene Auseinandersetzungen zwischen den Eltern haben negative Auswirkungen auf das Kind; ebenso Alkoholismus, Krankheiten. (c) Instrumentelle Komponente: Opfer werden gezwungen, für die Täter wertvolle Dinge zu beschaffen, z. B. Bier, Zigaretten, Geld etc... (d) Allgemeines sozialfeindliches und verhaltensgestörtes Verhaltensmuster. Hitzköpfiges Temperament des Kindes. Erbliche Faktoren. (e) Gewalttätigkeit als Gruppenphänomen: Soziale Ansteckung. Unsichere und abhängige Kinder nehmen sich Gewalttätige als Rollenvorbild. (f) Konditionierungseffekte: Nachlassen der Kontrolle und der Hemmungen gegen aggressive Tendenzen, wenn der Beobachter das aggressive Verhalten belohnt sieht, z. B. Sieg über das Opfer. Ähnliche Effekte sind durch Gewalt in den Medien möglich. F – 4 – 1 – 2: Aggressives Verhalten in der Schule Gewalt in der Wahrnehmung der Lehrkräfte (empirische Ergebnisse): (a) Zumeist werden verbale oder indirekte Formen von Aggression – und weniger körperliche Gewalt – wahrgenommen. (b) Die Ursachen werden oftmals außerhalb der Schule (in der Familie) angenommen und als kaum beeinflussbar angesehen. Statistiken über Gewalt und Verletzungen in der Schule: (a) Es kommt zu etwa 12 Verletzungen aufgrund von Gewalt pro 1000 Schüler/innen, wobei physische Gewalt an Hauptschulen etwas häufiger vorkommt als an Gymnasien. (b) Verletzungsorte: Auf dem Schulhof (39 %) / In Fluren und in Klassenräumen (27 %) / im Sportunterricht (23 %) / auf dem Schulweg (10%). (c) Aggressives Verhalten von Schülern gegenüber Lehrern kommt sehr selten vor. (d) 30 % der Schüler der Klassen 7 bis 13 berichten von verbalen Angriffen durch Lehrer. (e) Die körperliche Aggression ist während der Sekundarstufe I relativ konstant und sinkt danach leicht ab, während die verbale Aggression leicht ansteigt. (f) Die Aggression ist unabhängig von der Größe der Schule oder einer Stadtoder Landlage. (g) Schulversagen weist nur einen bedingten Zusammenhang zu aggressivem Verhalten auf. (h) Kinder von Alleinerziehenden sind nicht aggressiver als Kinder aus vollständigen Familien. (i) Ein Mangel an internalisierten Kontrollen, eine erhöhte Reizbarkeit und eine Tendenz zu riskanten Aktivitäten weisen einen Zusammenhang zu häufigem aggressivem Verhalten auf. (j) Schüler berichten, dass Lehrer und Eltern relativ wenig gegen Mobbing und Bullying unternehmen. Mit erhöhter Lehrerpräsenz sinkt Mobbing. Bullying (Schikanieren, Mobbing in der Schule). Def.: Bullying liegt dann vor, wenn Schüler/innen regelmäßig und über einen längeren Zeitraum hinweg eine bestimmte andere Person, die sich aufgrund einer klaren Unterlegenheit kaum zur Wehr setzen kann, körperlich, verbal und/oder mit Hilfe indirekter Strategien (Ausgrenzung, Gerüchte verbreiten etc...) angreifen. 88 Olweus verdichtete die Ergebnisse verschiedener Studien in schwedischen Schulen zur Beschreibung typischer Täter- und Opferpersönlichkeiten. (a) Typische Bullies: Generell aggressiver Verhaltensstil (auch z. B. gegen Eltern...). Selbstbewusst, selbstsicher und weniger ängstlich. Streben nach Dominanz und Überlegenheit. Positive Einstellung zur Aggression. Körperliche Stärke. Wenig Mitgefühl für das Opfer. Wenig Empathie. Durchschnittliche Beliebtheit in der Klasse. Oftmals gibt es eine kleine Gruppe von Bewunderern der Bullies (passive Gewalttäter). (b) Typische Opfer („whipping boy“, Prügelknabe) Ängstlich und unsicher. Vorsichtig. Empfindsam. Still. Negative Selbstwahrnehmung. Mangelndes Selbstgefühl. Eher unbeliebt. Körperlich eher schwach. (c) Seltener Fall: Provokative Opfer („Täter/Opfer“): Sie provozieren Angriffe gegen sich selbst. Oft Konzentrationsprobleme oder Hyperaktivität. Merkmale, nach denen ein Bully seine Opfer auswählt: (a) Isolation in der Klasse. (b) Unsicherheit. Ängstlichkeit. Geringes Selbstwertgefühl. (c) Rückzug und Weinen nach Angriffen. (d) Negative Einstellung gegenüber Gewalt. (e) Weniger: Nationalität, besondere körperliche Merkmale, Sprache usw..., auch wenn der Bully diese als Vorwand nennt. Sowohl die Anwesenheit eines typischen Bully, als auch die eines typischen Opfers erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Bullying. F – 4 – 1 – 3: Das Interventionsprogramm nach Olweus Allgemeine Voraussetzung: Problembewusstsein und Betroffensein der Erwachsenen. Maßnahmen auf der Schulebene: (a) Fragebogenerhebung: Den Ist-Zustand zur Gewalt feststellen. (b) Pädagogischer Tag mit Thema „Gewalt und Gewaltprävention in der Schule“. Teilnehmer: Schulleiter, Lehrkräfte, Experten, Vertreter des El- ternbeirats und der Schüler/innen. Vorstellung und Erörterung des Fragebogens. Festlegen eines Handlungsplans. (c) Schulkonferenz: Verabschiedung des Schulprogramms zur Gewaltprävention. Gemeinschaftliche Verpflichtung und Verantwortung für das gewählte Programm. (d) Bessere Aufsicht während der Pause und des Essens. Bereitschaft, in Gewaltsituationen schnell und entschlossen einzugreifen. Klare Signale gegen Gewalt setzen. Einstellung, dass Gewalt nicht akzeptiert wird. (e) Kontakttelefon für Schüler, die ihre Situation anonym erörtern möchten. Gewährleistung von Beistand, Ermutigung z. B. durch Vetrauenspersonen. (f) Kooperation Lehrkräfte / Eltern. Auch die Schüler sollten zunehmend an diesen Kontakten teilnehmen. (g) Gemeinsame Einstellungen gegen Gewalt. Etablierung von Gruppennormen gegen Aggression (Schulethos, Regeln des sozialen Zusammenlebens) als Prävention. Maßnahmen auf der Klassenebene: (a) Klassenregeln gegen Gewalt: Diese sollten so konkret wie möglich ausgedrückt sein und sich sowohl gegen mittelbare als auch gegen unmittelbare Gewalt richten und an sichtbarer Stelle angebracht werden. Basisregeln: (1.) Wir werden andere Schüler nicht mobben. (2.) Wir werden versuchen, Schülern, die gemobbt werden, zu helfen. (3.) Wir werden uns Mühe geben, Schülern, die ausgegrenzt werden, zu helfen. (b) Lob: Verhaltensbeeinflussung, prosoziales Verhalten, Zivilcourage etc... Auch aggressive Schüler sollten gelobt werden, wenn sie sich nicht aggressiv verhalten haben. (c) Strafen: Sie sollten unangenehm, aber nicht feindlich und dem Alter, Geschlecht und der Persönlichkeit angemessen sein, z. B. ernsthafte persönliche Gespräche, Pausenverbot, Klassenversetzung, gewisse Privilegien vorenthalten. (d) Regelmäßige Klassengespräche, evtl. im Stuhlkreis, um Blickkontakte herzustellen. (e) Ansprechbarkeit des Lehrers bei Problemen und Konflikten zwischen Schülern. (f) Kooperatives Lernen: Gruppenarbeit mit Einzelverantwortlichkeit tragen zur Konfliktmilderung und gegenseitigen Akzeptanz bei. (g) Gemeinsame positive Aktivitäten wie Parties, Ausflüge, Zelten etc.. . 89 (h) (i) (j) (k) Zusammenarbeit Klassenelternbeirat und Lehrkräfte. Vermeidung einer Laissez-faire-Atmosphäre in der Klasse. Emotionale und empathische Momente in den Unterricht einbauen. Unterricht: Aggression und Gewalt thematisieren. Frustration und Langeweile im Unterricht vermeiden. (l) Lehrerfortbildung: Verbesserung von Konfliktlösungsfähigkeiten. Erweiterung der sozialen Kompetenzen. Sensibilisierung gegenüber Warnsignalen. (m) Wohnliche Gestaltung der Schule und der Klassenräume. Maßnahmen auf der persönlichen Ebene: (a) Ernsthafte Gespräche mit den Mobbern: Einzelgespräche müssen klare Einstellung gegen Gewalt zeigen. Maßnahmen zur Erhöhung der Empathie, v. a. gegenüber dem Opfer. Widergutmachen von Schäden (TäterOpfer-Ausgleich). Trainieren von Ärgerbewältigung. (b) Gespräche mit den Gemobbten: Selbstwertstärkung. Unterstützung zur Integration in die Klasse. (c) Gespräche mit den Eltern, sowohl mit den Eltern des gemobbten als auch des mobbenden Schülers. (d) Externe Experten sollten möglicherweise miteinbezogen werden. Maßnahmen in der Familie: (a) Bei Eltern des Täters: Konsequente und sichtbare Einstellung gegen Gewalt. Familienregeln festlegen. Bei Einhaltung: Lob und Anerkennung; beim Brechen der Regeln: Strafe oder negative Konsequenz. (b) Bei Eltern des Opfers: Dem Kind helfen, sich besser zu integrieren. Helfen, Begabungen auszubauen. Körpertraining (z. B. Sport). Unterstützung, Ermutigung für den Aufbau neuer Beziehungen. Keine übermäßig beschützende Einstellung. Evtl. zusätzliche Hilfe eines Psychologen oder Psychiaters wahrnehmen. (c) Wechsel der Klasse oder der Schule: Wenn es keine andere Lösung gibt, ist es von Vorteil, den aggressiven Schüler zu versetzen. Strategien zur Vermeidung von Vandalismus und Sachbeschädigungen: (a) Erhöhung der Wohnlichkeit des Klassenzimmers. (b) Beobachtung und ggf. Intervention gegenüber „devianten Cliquen“. (c) Verantwortlichkeit der Schüler für die Klassenräume stärken, z. B. durch aktive Mitgestaltung des Zimmers, gemeinsames Kümmern um Pflanzen. F – 4 – 2: Medien und Gewalt (Quelle: Winterhoff-Spurk, Medienpsychologie S. 105-111) Gerbner erstellte von 1967-1993 „violence profiles“ von US-Primetime und Wochenendsendungen und maß dabei die Quantität offener und physischer Gewalt. Ergebnisse: (1.) 70 % dieser Sendungen enthalten Gewalt. (2.) 5,7 Gewaltakte pro Stunde. (3.) In Kindersendungen wie Comics sogar 17 Gewaltakte pro Stunde. Schon bei niedrigem oder mittlerem TV-Konsum hat ein Kind schnell Tausende oder Zehntausende von Gewaltakten gesehen. „Kinder sehen Gewalt in Form von Action und Spannung, aber sie sehen selten realistische Gewalt von extremer Intensität.“ (Krüger 1996) Andererseits wird auch viel nicht-physische Gewalt gesehen, die psychische, soziale oder ökologische Schäden nach sich zieht. Theoretische Konzepte zur Gewalt im TV Fördernd Erregungsthese: Häufiges Neutral Katharsis-Hypothese: Häufiges Gewaltsehen Feshbach (1961): Erregung, die sich dann führt zur Abstumpfung Mitvollziehen der Gewalt selbst in Gewalt gegenüber Gewalt – in der Phantasie mache die ausdrücken kann. sowohl im TV, als auch in tatsächliche Gewalt- Stimulationsthese: Basiert der Realität. Aber: Dies anwendung überflüssig. auf der Frustrations- führt auch zur Ist empirisch widerlegt, Aggressions-Hypothese: Deindividuation von wird auch von Feshbach Gewalt stimuliert dazu, Menschen, was Aggression eingestanden. Katharsis eher begünstigt. funktioniert nur bei These der ethischen und kognitiven umzusetzen. Sozial-kognitive Lerntheorie: Hemmend Gewaltsehen erhöhe die Frustration in Aggression Habitualisierungsthese: Reflexionsprozessen. Wirkungslosigkeit Inhibitionshypothese: Nachahmungslernen Gewaltdarstellungen führen Waffeneffekt (vgl. Experi- zu Angst vor Aggression ment von Berkowitz) und zur Hemmung der eigenen Aggressivität. 90 Ergebnis: Gewaltdarstellungen im TV sind im besten Fall wirkungslos, können aber negative Folgen haben. Aggressionsfördernd sind: (a) Kontinuierlicher und häufiger TV-Konsum in Verbindung mit negativen Umweltfaktoren oder individuellen Anlagefaktoren wie Impulsivität. (b) Geringe Selbstaufmerksamkeit beim TV-Konsum (unkritisches Sich-berieseln-lassen). (c) Schwache normative Einstellungen. Aber: Es gibt auch TV-Programme, die prosoziales Verhalten fördern und positive Modelle liefern (z. B. Spendengalas etc...). F – 4 – 3: Verhaltensstörungen / Disziplin- und Erziehungsschwierigkeiten (Quelle: HPP S. 767-772) Begriffsverwendung: (a) eher phänomenal-deskriptiv oder bei leichtem Grad: Verhaltensauffälligkeiten. (b) eher funktional oder bei schwererem Grad: Verhaltensstörungen. I. d. R. handelt es sich hierbei um eine Störung des Regelkreises der PersonUmwelt-Beziehung. Psychohygienischer Aspekt: Welches Erleben und Verhalten liegt im jetzigen und zukünftigen Interesse des Kindes? Wie hoch ist dessen Leidensdruck? Soziohygienischer Aspekt: Welches Erleben und Verhalten liegt im Interesse der sozialen Umgebung und der Gemeinschaft des Kindes? Verhaltensstörungen grenzen sich von Lern-, Sprach- und Denkstörungen ab und umschließen: (a) Extreme Verhaltensstile (z. B. Vermeidung von Sozialkontakt etc...) (b) Hyperaktivität (c) Impulsivität, Aggressivität (d) Mangel an internalisierten Kontrollen, Disziplinschwierigkeiten (e) Übergroße Feldunabhängigkeit F – 4 – 3 – 1: Erklärungsansätze für Verhaltensstörungen Personorientierte Erklärung: (a) Charakteristische Reaktionstendenzen des Individuums (b) Genetische Dispositionen (c) Durch Entwicklungs- und Sozialisationsprozesse erworbene Verhaltensmuster: (1.) mangelnde emotionale Integration, mangelnder Ausgleich zwischen pers. Bedürfnissen und den Bedingungen der Realität. (2.) Entwicklung von Emotions- und Angst-Reflexen durch klassische Konditionierung. (3.) Operante Konditionierungsmechanismen. (4.) Unrealistisches Selbstkonzept. (5.) Inadäquate Systeme der Handlungskontrolle. Situationistische Erklärung: (a) Ist nur dann eine sinnvolle Erklärung, wenn die Situation ausreichend „mächtig“ ist, d. h. mit einem sehr hohen Aufforderungscharakter. (b) Auftreten kritischer und stressender Situationen: (1.) Komplexität, Mehrdeutigkeit, Indifferenz und Unstrukturiertheit der Situation. (2.) Erwartungsbrüche (3.) Hoher Grad an Bedürfnisstimulation (4.) Hoher Grad an Vereitlung von konkreten Zielvorgaben und Frustration. (5.) Über- oder Unterforderung. Interaktionistische Erklärung: Soziohygienisch ungünstige Formen des Stresserlebens und der Stressbewältigung. Gegenseitiges Aufschaukeln dysfunktionaler Verhaltensweisen. Gegenseitige negative Erwartungen. Eintritt in einen vicious circle. Etikettierungstheorie: Das gleiche Verhalten kann als „couragiert, selbstbewusst, kritisch“ oder als „vorlaut, aggressiv“ aufgefasst werden. 91 F – 4 – 3 – 2: Prävention und Intervention F – 5 – 1 – 1: Ursachen von Leistungsängstlichkeit Personorientierte Erklärung: Maßnahmen zur Erreichung dauerhaft ungestörter Erlebnis- und Reaktionstendenzen. Situationistische Erklärung: Schaffung eines „therapeutischen Milieus“ in Familie, Schule etc... mit wenig verhaltensauffälligkeitenprovozierenden Anlässen. Aber: Es können nie alle kritischen Situationen entschärft werden. Interaktionistische Erklärung: Verlassen dysfunktionaler Interaktionsmuster, z. B. durch paradoxe Reaktionen oder so was wie Einsatz von Humor zum Durchbrechen des Teufelskreises. F – 5: Persönlichkeitsstörungen F – 5 – 1: Leistungsängstlichkeit (Quelle: HPP S. 405-412) Def.: Leistungsängstlichkeit ist ein Spezialfall eines Erregungs- und Spannungszustandes mit spezifischen somatischen, psychischen und behavioralen Reaktionen und Empfindungen. Es handelt sich um eine situationsbezogene Stressreaktion. Es liegen (reale oder vorgestellte) Vorstellungen, Empfindungen oder Antizipationen vor, die persönlich bedeutsame Gefahren beinhalten. Leistungsängstlichkeit ist eine dispositionelle Tendenz bzw. ein Persönlichkeitsmerkmal. Unterscheidung: Angst (Impuls von innen) vs. Furcht (Impuls von außen). Äußerungsformen von Leistungsängstlichkeit: (a) Physiologische Indikatoren: z. B. erhöhter Puls, beschleunigte Atmung, Schweißausbruch etc... (b) Emotional-subjektive Indikatoren: Erlebnis der Selbstwertbedrohung, Unwohlsein, innere Angespanntheit, Depressivität. (c) Beobachtbare Indikatoren: Unruhe, Zittern, Artikulationsstörungen, Verkrampfungen, Aggression. Leistungsängstlichkeit ist abzugrenzen von Schulphobie (anhaltende Schulbesuchsverweigerung) und von Schulschwänzen (das nicht mit körperlichen Beschwerden verbunden ist). Lehrerverhalten: Autortäres und extrem dirigistisches Verhalten. Straforientierung. Demütigung. Nichtbeachtung. Inhalt und Vermittlung des Lehrstoffs: Komplizierte und unverständliche Informationsvermittlung. Verwirrende Strukturierung. Fehlende oder unpräzise Lernziele. Fehlende Individualisierung (vgl. ATI-Aspekte). Schulbezogene Fähigkeiten und Fertigkeiten: Überforderung oder Überbeanspruchung von Intelligenz und Begabung des Schülers. Schulleistungsbewertung: Strenge Zensuren und scharfe Auslese. Soziale statt inhaltliche Bezugsnormorientierung. Mangelnde Transparenz und Inkonsequenz der Bewertungskriterien. Gestaltung von Prüfungssituationen: Ungewohnte Arbeitsumgebung. Hoher Zeitdruck. Unfaire Aufgaben. Schüler-Schüler-Verhältnis: Rivalität und Konkurrenz statt Kooperation und Unterstützung. Hänseleien und Spott. Schlechtes Klassenklima. Verhalten und Einstellungen der Eltern: Zuwendung ausschließlich an Leistung gekoppelt. Inkonsistentes Erziehungsverhalten. Überhöhte Anforderungen. Desinteresse an Schule und Unterricht. Ablehung des Lehrerverhaltens. Sehr unterschiedliche Gründe sind möglich. Disposition von Hochängstlichkeit beim Schüler: Negatives Selbstbild. Soziometrisch niedriger Rang. Passivität. Unangepasstheit. Nervosität. Schlechte Arbeitshaltung. Mangelnde Aufgabenzuwendung. Hilflosigkeit. Unsicherheit. Tendenziell geringerer IQ und schlechtere Schulleistung. Häufiges Fehlen im Unterricht. Negative Erfolgsattribuierung. Temperament: Tendenz zu internalisiernden Störungen (und nicht zu externalisierenden Störungen wie Aggressivität etc...) F – 5 – 1 – 2: Theoretische Erklärungsansätze für Leistungsängstlichkeit Tiefenpsychologischer Ansatz: (a) Primäre Angst: Nacherleben und Aktualisierung des Geburtstraumas. Begleiterscheinung von Minderwertigkeitskomplexen. Angst als Autoaggression. (b) Sekundäre Angst: Angst ist Resultat unzureichend verarbeiteter Konflikte aus der frühen Kindheit, die in Stresssituationen aktualisiert werden. Vo- 92 rausgegangen sind: Konflikte mit dem „Es“ (neurotische Angst) oder mit dem „Über-Ich“ (moralische Angst) oder mit der Umwelt (reale Angst). (c) Dieser Ansatz spielt heute eine untergeordnete Rolle, nur für Bewältigungsstrategien kann er herangezogen werden. Ansatz des Modell-Lernens: Siehe die entsprechende Stelle in Kapitel C – 6 – 1! Behavioraler Ansatz: (a) Angst als eine Reaktionstendenz aufgrund von klassischen, operanten oder sozialkognitiven Lernvorgängen (vgl. Watson und sein Experiment mit dem „kleinen Albert“ in A – 2 – 2 – 2!) (b) Extremform: Trauma bzw. katastrophentheoretische Erklärung. Angst als in Katastrophenmomenten erworbene Reaktionstendenz, z. B. nach sexuellem Missbrauch, Verlust einer nahestehenden Person etc... (c) Bei einfachen und mechanischen Lernaufgaben lernen Ängstliche besser und schneller, bei schweren Aufgaben hingegen Nicht-Ängstliche. Kognitivistische Ansätze: (a) Grundsätzliche Annahme hier: Betonung der Bedeutung subjektiver Erwartungen und Einschätzungen. Nicht der physiologische Zustand ist entscheidend für das Auftreten von Ängstlichkeit, sondern die kognitive Interpretatation durch das Individuum. Durch Erfahrung und Wissen können best. Stimuli situationsangemessen oder eben -unangemessen gedeutet werden. Von besonderer Relevanz sind hier die Selbstaufmerksamkeit und der Grad der Erfolgserwartung. (b) Anspruchsniveau-Kompetenz-Diskrepanz-Theorie (Jakob): Angst tritt auf, wenn ein hohes Anspruchsniveau vorliegt und gleichzeitig eine geringe subjektive Kompetenz Hohes Kompetenzdefizit Hohe Misserfolgswahrscheinlichkeit. Wenn hier noch eine hohe Motivation vorliegt, das eigene Anspruchsniveau unbedingt erreichen zu wollen, kommt es in der Prüfungssituation zu einer hohen Angst. Je größer die Diskrepanzen zwischen Anspruchsniveau und Kompetenz bzw. zwischen Misserfolgswahrscheinlichkeit und Motivation sind, desto größer ist auch die Angst. (c) Kognitive Angsttheorie von Lazarus: Angst ist das Ergebnis eines subjektiven Bewertungsprozesses: (1.) Primacy appraisal (Erstbewertung): „Ist die Situation bedrohlich?“ (2.) Secondary appraisal (Zweitbewertung): „Wie kann ich die Bedrohung abbauen?“ (3.) Coping (Bewältigung): Durchführen von Maßnahmen zum Abbau der Bedrohung. (4.) Reappraisal (Neubewertung): „Waren die Maßnahmen erfolgreich?“ Erster Weg: Das Konzept der Bedrohung ist wichtig Antizipation eines Schadens Vorstellung, dass wichtige Motive nicht befriedigt werden Eine Situation ist dann bedrohlich, wenn wichtige Motive auf dem Spiel stehen und eine Motivfrustrierung möglich oder wahrscheinlich ist. Zweiter Weg: Eine Situation ist mehrdeutig und unüberschaubar Zweifel, Unsicherheit Wenn die Person hier über keine geeigneten Bewältigungsstrategien verfügt Hilflosigkeit und Angst. F – 5 – 1 – 3: Diagnostik von Leistungsängstlichkeit Verfahren: Physiolog. Messungen. Interviews. Standardisierte Fragebögen. Beobachtung und Fremdeinschätzung (z. B. durch Eltern oder Lehrer). Sarason (1984) will vier Faktoren erfassen, nämlich „worry“ (während der Prüfung an Misserfolg denken), „irrelevante Gedanken“ (auch während der Prüfung), „Anspannung“ und „körperliche Symptome“. Sehr unsystematischer Ansatz. Die Differenzielle Leistungsängstlichkeitsdiagnostik nach Rost und Schermer (1997) testet (a) die Angstauslösung (aufgaben-, wissens- oder sozialbezogen?) (b) die Angsterscheinungsweisen (physiologische, emotionale, kognitive Manifestationen) (c) die Angstverarbeitung (Gefahren-, Situations- und Angstkontrolle, Angstunterdrückung) (d) die Angststabilisierung (internale und externale Bewältigungsstrategien). F – 5 – 1 – 4: Empirische Belege / Korrelationen zur Leistungsängstlichkeit Intelligenzkorrelation: Hochängstliche leisten in fast allen Schulfächern weniger. Vgl. zur Informationsverarbeitungskapazität das Yerkes-DodsonGesetz: Bei zu hoher emotionaler Aktiviertheit sinkt die Informationsverarbeitungskapazität. 93 Aufgabenirrelevante, selbstwertbedrohende und grübelnde Kognitionen: Diese korrelieren negativ mit Leistungsmaßen. Mädchen sind anfälliger für Leistungsängstlichkeit, empfinden schulische Leistungssituationen als angstinduzierender, gestehen aber Leistungsängstlichkeit auch eher ein. Ein niedriger Sozialstatus begünstigt tendenziell die Leistungsängstlichkeit. Leistungsängstliche tendieren zu einer misserfolgsorientierten Attribuierung ihrer Leistung. F – 5 – 1 – 5: Prävention und Modifikation Lehrer und Schule: (a) Reduzierung von Unsicherheiten. (b) Prüfungsgestaltung: Faire Fragen, Eher leichter Einstieg, Berechenbarkeit, Transparenz, prüfungsanaloge Übungsphasen, Infos über das Stoffgebiet der Prüfung geben. (c) Leistungsbewertungsprozess: Transparente, objektive, reliable und valide Bewertungskriterien anlegen. Elemente prozessorientierter und individualorientierter Bewertungen einbauen, z. B. durch mündliche Noten. (d) Aufbau von erfolgsorientierten, aber realistischen Leistungserwartungen. (e) Emotional warmes Klassenklima. Entspannungsmomente einbauen. Vertrauensklima schaffen durch emotionale Zuwendung. (f) Bedingungsloses Wertschätzen, Akzeptieren und Empathie gegenüber den Schülern. Kritik sachlich und nicht persönlich formulieren. (g) Kongruenz und Echtheit des Lehrerverhaltens. (h) Entschärfung von typischen Krisensituationen (besonders Schulwechsel). (i) Thematisierung von „Angst und Angstabbau“, Aufzeigen und Einüben von Bewältigungsstrategien, aber auch von Lern- und Arbeitstechniken wie Zeitmanagement, rechtzeitige Prüfungsvorbereitungsplanung. Schülerpersönlichkeit: (a) Nach den behavioristischen Theorien: Expositionsbehandlung: Konfrontation mit dem Angstreiz, erst in der Vorstellung, dann im Alltag, ggf. schrittweise als systematische Desensibilisierung. Positive Verstärkung bei der Bewältigung angstauslösender Situationen, dadurch Optimierung von Bewältigungskompetenzen. (b) Nach dem Modell-Lernen: Reales Training mit wenig ängstlichen Modell-Personen. (c) Nach den kognitivistischen Theorien: Maßnahmen zum Erwerb von Arbeits- und Lerntechniken (da Leistungsängstlichkeit oft mit mittelmäßigen Leistungen verbunden ist). Ziel: Erfolgserlebnisse wahrscheinlicher machen. Motivänderung, Veränderung in der Selbstattribuierung. Elternhaus: (a) Kooperation zwischen Elternhaus und Schule. (b) Passung der elterlichen Anforderungen an den Entwicklungsstand und die Ressourcen des Schülers. Das Maßnahmenbündel von Strittmatter (1993) belegte eine im Vergleich zu einer Kontrollgruppe abnehmende Leistungsängstlichkeit. Er verbesserte: (a) die Lehrer-Schüler-Interaktion, (b) den Angstumgang und den Angstabbau, (c) den Leistungsbewertungsprozess (realistische Anpassung), (d) und die Lern- und Arbeitstechniken. F – 5 – 2: Schulphobie (Quelle: HPP S. 596-600) Schulschwänzen Leitsymptomatik Schulangst Vermeidung unlustbehafter Schulsituationen Ausweichen auf Ersatzbereiche Schulphobie Ausweichen von kränkenden Schulsituationen Angst- und Anspannungszustände Panikattacken Beginn der Entwicklung Beginn der Pubertät Mit zunehmenden Bewertungsaspekten Häufig schon im Einschulungsalter Begleiterscheinungen delinquente und asoziale Handlungen subkulturelle Orientierung somatoforme Störungen (z . B. Bauch- oder Kopfschmerzen) somatoforme Störungen Anklammerungstendenzen 94 Lern- und Leistungsaspekte Beteiligung des Umfelds Werden grundsätzlich in Frage gestellt Oft geringe Frustrationstoleranz Desinteresse Duldung Häufige Überforderung Sehr hohe Motivation Ehrgeizige Grundhaltung Verschärfte Drucksituation Oft gute Schulleistungen Aber: Unrealistische Leistungserwartungen Ambivalente Grundhaltung gegenüber Trennung Soziale Orientierung Relativ gering Hoch Hoch Einbindung in Peergroup Gering Evtl. Einbindung in delinquente Peergroup Meist gut Rudimentäre Kontakte Def.: Schulphobie gehört zu den schulvermeidenden Verhaltensweisen, die sich im Spannungsfeld innerer Konfliktlagen und sozialer Sanktionierung bewegen. Sie ist von Nachbarphänomenen scharf abzugrenzen: Frühe Kindheit: (a) Veränderungsängstliches Kind, Stubenhocker. (b) Sehr starke Bindung zu nahen Angehörigen und Nahestehenden unter den Erwachsenen. Primär-sozialisatorische Orientierung. (c) Wenig Kontakt zu Gleichaltrigen. Kindergartenzeit: (a) Anklammerungstendenzen. (b) Somatoforme Störungen. (c) Schädlich: Elternintervention mit übertriebener Härte oder überprotektiver Haltung. Krisensituation Einschulung: Einem schulphoben Kind fehlen alterstypische Verhaltensweisen. Anklammerungs- und Rückzugstendenzen. F – 5 – 2 – 2: Erscheinungsformen von Schulphobie F – 5 – 2 – 1: Genese der Schulphobie Schulphobie tritt gehäuft (aber nicht nur) in der Einschulungszeit, in der Grundschulzeit und beim Wechsel auf eine weiterführende Schule auf. Sie tritt vermehrt am Wochenbeginn und nach Ferien auf, am stärksten morgens beim Aufwachen. Vermehrtes Auftreten nach Kränkungserfahrungen im Schulgeschehen. Die klassische Panikreaktion: Zittern, Herzrasen, Schweißausbrüche, amorphe Angst- und Spannungszustände bis hin zu Anklammerungstendenzen, Schreien und suizidalen Krisen. Insgesamt panische Gestimmtheit. Auftreten von sekundären Verhaltensauffälligkeiten: Rückzug, Weinerlichkeit, Initiativverarmung, Kommunikationsreduzierung, Zwangshandlungen. F – 5 – 2 – 3: Maßnahmen gegen Schulphobie Staatliche Sanktionierungsbemühungen (vgl. Schulpflicht!) können hilfreichen Ansätzen im Weg stehen. Die Maßnahmen müssen individualpsychologische Aspekte des Kindes mit schulischen, familiären und verhaltensmodifikatorischen Gesichtspunkten verbinden. Maßnahmen: (a) Stärkung von Autonomie, Selbstkonzept. (b) Unterstützung von Trennungskompetenzen. (c) Wiedereingliederungshilfen in die Schule, ggf. zeitlich befristetes Aussetzen der Notenvergabe. (d) Notlösung: Medikamentöse Behandlung: tranquillisierende oder antidepressive Medikamente. 95 F – 5 – 3: Suizid und Suizidalität im Jugendalter (b) Abwägung: Präsuizidales Syndrom: Starke Ambivalenz zwischen konstruktiven und destruktiven Tendenzen. Ankündigung von Suizidabsichten. Einengung der Aufmerksamkeit und der Kognitionen auf den Suizid. Suizidphantasien, z. B. Vorstellung des Betrauertwerdens am Grab. Beschäftigung mit dem Tod. Fazit-Tendenz: Entweder in Richtung Suizid oder in Richtung Leben. (c) Entschluss: Überschreiten des Rubikon. Vorbereitungen für den Suizid (Mittel, Zeitpunkt, Methode). Geheimhalten der Absicht, um das Projekt nicht zu gefährden. Äußerliche Unauffälligkeit. (Quelle: Oerter / Montada S. 359f) F – 5 – 3 – 1: Fakten zum Suizidverhalten Suizidale Verhaltensweisen gründen in Identitätskrisen, sind bei der Mehrheit der Jugendlichen weniger stark ausgeprägt und stellen i. d. R. keine existenzbedrohenden Krisen dar. Suizid ist bei deutschen Jugendlichen die zweithäufigste Todesursache. Suizidverteilung in Deutschland: Männer 3:2 Frauen (USA 3:1) Verteilung der Suizidversuche in Deutschland: Männer 1:2 Frauen (USA 1:3) Etwa 80 % der suizidalen Akte werden vorher angekündigt. Etwa 25 % wiederholen einen Suizidversuch innerhalb der nächsten 2 Jahre. Die Suizide werden in Deutschland v. a. durch Medikamente oder Erhängen durchgeführt (in den USA v. a. mit Schusswaffen). Außerdem gibt es auch zahlreiche „maskierte Suizide“: Beabsichtigte Verkehrsunfälle, Drogen („goldener Schuss“). Kritisches Alter für Suizid: 15 bis 35 Jahre. Motive für Suizidversuche: (a) Soziale Konflikte, v. a. in der Familie (b) Liebeskummer, Partnerprobleme (c) Gewinnenwollen von Beachtung und Aufmerksamkeit (d) Psychose (e) Keine Perspektive für sich sehen F – 5 – 3 – 2: Entwicklungsstadien der Suizidhandlung Pöldinger (1968) geht von 3 Entwicklungsstadien aus: (a) Erwägung: Wirken psychodynamischer Faktoren wie soziale Isolierung, Stress, Identitätsverletzung, Aggressionshemmung... Starker Einfluss von Modellen aus der Umwelt (Familie, Bekannte...), aber auch durch symbolische Modelle in den Medien und der Literatur (vgl. Goethes Werther). Suizidale Erwägungen sind nicht unüblich, sie sind v. a. situativ und führen nicht zwingend zu Suizidversuchen. F – 5 – 3 – 3: Prävention und Intervention Anbieten von Strategien zur Bewältigung von Identitätskrisen. (Vgl. Marcia). Aufbrechen der sozialen Isolation. Maßnahmen zur Verbesserung des sozialen Klimas im Umfeld eines Suizidankündigenden. Suizidankündigen ernst nehmen und dessen Ursachen aufspüren. Anbieten positiver Kognition (Steigerung der Selbstwertschätzung...), um die Einengung auf suizidale Gedanken aufzubrechen. F – 6: Abweichendes Verhalten F – 6 – 1: Delinquenz (Quelle: Oerter / Montada S. 1024-1036) F – 6 – 1 – 1: Begriffe und Erfassungsmethoden Def.: Delinquenz ist straffälliges Verhalten. Bei delinquentem Verhalten muss ein rechtlich definierter Straftatbestand vorliegen. Dies hat zur Voraussetzung: Verantwortlichkeit und Strafmündigkeit des Täters. Delinquenz liegt z. B. vor bei Eigentumsdelikten, Gewaltdelikten, gemeingefährlichen Straftaten, Sexualdelikten, organisierten Verbrechen, Wirtschaftskriminalität etc... Riesige Heterogenität 96 Es gibt keine einheitliche Entwicklung zur Delinquenz und keine einheitliche Täterpersönlichkeit. Psychologische Analyse von Straftatbeständen nach folgenden Kriterien: (a) Handlungsziele (b) Handlungssituation und Verfügbarkeit von Handlungsalternativen (c) Normative Überzegungen des Täters (d) Selbstkontrollkompetenzen des Täters Einzelfalldiagnose ist unerlässlich. Ein großer Teil der Straftaten wird von einer kleinen Zahl von Vielfachtätern begangen. F – 6 – 1 – 3: Delinquenz und Lebensalter F – 6 – 1 – 2: Delinquenzprognosen auf der Basis von Risikofaktoren und Schutzfaktoren Risikofaktoren: (a) Elternfamilie: Kriminalität der Eltern. Zerbrochene Ehen. Wirtschaftliche Schwierigkeiten. Konfliktreiche, feindseilige, inkonsistente Interaktion in der Familie. (b) Kontakte zu Delinquenten. (c) Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressivität, Problemtrinken, Drogenmissbrauch, Impulsivität, aber z. T. auch unauffälliges Verhalten. Personale Prädispositionen. (d) Niedrige Internalisierung von Normen. (e) Hoher Stellenwert von Statussymbolen und symbolischem Besitz (v. a. bei Eigentumsdelikten). (f) Hoher Grad der Möglichkeit zu deviantem (abweichendem) Verhalten. Schwache familiäre oder soziale Supervision, große Anonymität. Schutzfaktoren: (a) Gutes Familienklima (b) Erfolg in der Schule und schulische Motivation Aber: Prognosen über Nicht-Delinquenten (aufgrund von prosozialem Verhalten) sind wesentlich zuverlässiger als Prognosen über zukünftiges delinquentes Verhalten (z. B. aufgrund von antisozialem Verhalten). Kontinuitätshypothese: Delinquenzgrad in einer niedrigeren Altersstufe ist ein Prädikator für Delinquenzgrad einer höheren Altersstufe. Insgesamt gibt es aber hohe Werte falscher positiver und negativer Prognosen (d. h. prognostizierte Delinquenten, die keine geworden sind und vice versa). Kriminalität erreicht zwischen 16 und 20 einen Höhepunkt und flaut danach stark ab. Moffit (1993) unterteilt Delinquenz in zwei Kategorien (die sich auch empirisch bewährt haben. Beleg: Das antisoziale Verhalten von 10-Jährigen kann die Delinquenz eines 25-Jährigen besser prognostizieren als eine vergleichbare Messung bei einem Jugendlichen.): (a) Persistente Delinquenz: Kontinuierlich antisozialer Typus. Etwa 5 % pro Jahrgang. Beispiel: Erst kleine Diebstähle, dann Einbrüche, dann Vergewaltigung, Ehegewalt, illegale Geschäfte. Oft soziale Außenseiterrolle. Oft niedriger IQ. Geht auf biogenetische und frühkindliche Einflüsse zurück. Korreliert positiv mit ADHS, Impulsivität, Lernstörungen, antisozialem Verhalten: „Syndrom des schwierigen Kindes“. Das Ensemble der Störungen und die Reaktion der Umwelt darauf tragen zur Aufschaukelung des Problems bei. Persistent Delinquente werden während der Adoleszenz häufig zu Modellen für Gleichaltrige. (b) Jugenddelinquenz oder adoleszenzlimitierte Delinquenz: Ist nur von der Adoleszenz bis ins frühe Erwachsenenalter beobachtbar. Keine Pathologie, sondern ein verbreitetes Phänomen. Oft gute soziale Integriertheit. Erwächst aus der besonderen Situation der Jugendlichen in modernen Gesellschaften: Sehr frühe biologische und sexuelle Reife und sehr spätes kulturell-gesellschaftliches Erwachsenwerden. Lange Phase ohne existenzielle Verantwortung. Delinquenz als Kompensation für mangelnde Autonomie. Risiken der Jugenddelinquenz: (a) Entwicklungsunfälle: Drogen, Stigmatisierungen aufgrund von strafrechtlichen Verurteilungen. Selbstbild als Krimineller aufgrund gesellschaftlicher Etikettierung. (b) Abbruch der Schule oder Ausbildung. F – 6 – 1 – 4: Prävention und Verhaltensmodifikation Heterogenität delinquenten Verhaltens Heterogenität präventiver Maßnahmen. Frühzeitige Identifikation von individuellen und sozialen Risikofaktoren. Arbeit an deren Abschaffung. Förderung der Schutzfaktoren. 97 Modifikation devianten Verhaltens. Verhaltensmodifikatorische Programme. Verhinderung eines Rückfalls bei schon straffällig gewordenen Jugendlichen. Spezialprävention bei schon Straffälligen: Individualisierung der Behandlung. Vermeidung von Schulabbrüchen bei Jugenddelinquenten. Kompensatorische Programme. Empathiestärkung und Erwerb der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Förderung prosozialen Verhaltens. Generalpräventive Abschreckungswirkung von Rechtsstrafen ist belegt. F – 6 – 2: Alkohol- und Drogenkonsum F – 6 – 2 – 2: Verbreitung von Alkohol- und Drogengebrauch (Quelle: Oerter / Montada S. 1056-1068) Der verantwortliche Umgang mit Alkohol und Drogen gehört zu den Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen. Kinder machen i. d. R. ihre ersten Alkoholerfahrungen mit etwa 10 Jahren. Die „Verbrauchsspitze“ ist zu Beginn des Erwachsenenalters. Def. „Problemtrinken“: Regelmäßiges, schweres Trinken mit negativen Verhaltenskonsequenzen. Zu Alkohol hat praktisch jeder Jugendliche Kontakt, zu illegalen Drogen etwa 10 %, davon etwa 5 % akuten Gebrauch. Etwa 25 % haben ihre ersten Alkoholerfahrungen vor dem 11. Lebensjahr, dann steiler Anstieg in der Jugend, dann Abfall ab dem frühen Erwachsenenalter. Die zeitlichen Verläufe beim Drogenkonsum sind ähnlich. Partnerschaft und Ehe haben einen mäßigenden Einfluss auf Alk- und Drogenkonsum. Drogenkonsum erreichte Ende der 70er-Jahre einen Höhepunkt, flaute dann ab und steigt seit Anfang der 90er-Jahre wieder an (besonders LSD im Zusammenhang mit der Technokultur). Drogenkonsum korreliert negativ dem Grad der Ablehnung von Drogenkonsum durch die Peergroup und die Massenmedien. „Problemtrinken“: Jungen 5:1 Mädchen. Aber: Nur geringe Geschlechtsunterschiede beim Konsum von Marihuana. Stadtgebiete sind tendenziell stärker betroffen als Landgebiete. Ethnisch-kulturelle Einflüsse, z. B. trinken Asiaten weniger, auch wenn sie in westlichen Gesellschaften wohnen. F – 6 – 2 – 1: Kriterien zur Unterscheidung von Gebrauch und Missbrauch F – 6 – 2 – 3: Risikofaktoren Grundsätzlich: Der Missbrauch sollte weitgehend unabhängig von den Substanzen gesehen werden. Unterscheidungskriterien: (a) Ausmaß negativer psychologischer und physiologischer Wirkungen sowohl kurzfristig als auch längerfristiges gesundheitliches Risikopotenzial. (b) Alter des Jugendlichen. Sind die Voraussetzungen für einen verantwortlichen Gebrauch gegeben? (c) Grad der physischen Abhängigkeit. Dosissteigerungen wegen nachlassenden Wirkungen? Entzugserscheinungen? (d) Schädigende Umweltfolgen gegenüber Sachen und der Gesellschaft. (e) Illegalität: Illegal sind Cannabis (Haschisch oder Marihuana), Hallizunogene (LSD, Ecstasy), Opiate (Heroin oder Kokain), viele Stimulanzien und Tranquilizer, Inhalantien (Schnüffelstoffe). (f) Situative Aspekte: Angemessene Situation oder kurz vor dem Autofahren oder auf dem Arbeitsplatz? Bei Drogenmissbrauch spielen häufig psychopathologische Aspekte eine entscheidende Rolle. Ähnlich wie für delinquentes Verhalten kann man auch beim Alkohol- und Drogenmissbrauch (nach Moffit) von persistentem Missbrauch und von adolestenzlimitiertem Missbrauch ausgehen (siehe F – 6 – 1 – 3 zur Erklärung!). Harte Spirituosen und Marihuana gelten als „gateway-drugs“ (Türöffnerdrogen). Oft komplexes Problemverhalten: Drogen + Delinquenz + riskantes Sexualverhalten. Bei Alkoholmissbrauch häufig genetisch begründete Vulnerabilität, die unter ungünstigen Umweltbedingungen aktiviert werden kann. Ähnliche Persönlichkeitsdisposition wie bei delinquenzanfälligen Jugendlichen. 98 Einflüsse des Erziehungsverhaltens: alk- und drogenmissbrauchsfördernd sind Permissivität der Eltern, geringe Einflussnahme, wenig Unterstützung, Desinteresse, Instabilität, Inkonsistenz. Einflüsse von Peergroups: Jugendliche stützen sich gegenseitig bei der Normübertretung. „Gleich und gleich gesellt sich gern.“ Auch kann die Orientierung an älteren Jugendlichen in dieser Hinsicht problematisch sein. F – 6 – 2 – 4: Konsequenzen für die psychosoziale Entwicklung Bei gelegentlichem und adoleszenzlimitiertem Missbrauch i. d. R. keine langfristigen Schäden. Bei fortgeschrittenem adoleszenzlimitiertem Missbrauch kommt es zur Beschleunigung psychosozialer Übergänge in Erwachsenenrollen (z . B. frühe Mutter- oder Vaterschaft oder Beruf statt Ausbildung), mitunter zu negativen Folgen bei Schwangerschaften oder zum Scheitern jugendtypischer Entwicklungsaufgaben. F – 7: Innerschulische und außerschulische Prävention und Intervention F – 7 – 1: Gesundheitsförderung, Prävention, Intervention (Quelle: Petermann Kap. 5) F – 6 – 2 – 5: Prävention Erfolgskriterien: Hinausschieben, Reduzieren oder Einstellen des Konsums. Nicht Abstinenz, sondern altersspezifisch verantwortlicher Umgang mit Alkohol und Drogen ist das Ziel. Präventive Maßnahmen: (a) Anregen zum Nachdenken über die eigenen Ziele. (b) Lernen, dem Druck Gleichaltriger zum Alkohol- und Drogengebrauch zu widerstehen. Vermittlung von „life skills“. Interaktionsstrategien, um ohne Gesichtsverlust „Nein“ sagen zu können. (c) Sekundärprävention für Jugendliche, die zu chronischem Missbrauch neigen: Vermittlung sozialer Kompetenzen. Gesundheitsförderung: Sie betrifft die gesamte Population. Sie möchte die Entstehung von Störungen und Krankheiten verhüten und die Schutz- und Abwehrkräfte stärken. Es ist somit eine generelle und unspezifische Prävention, vgl. Schutzimpfungen, Gesundheitserziehung, Ernährungsberatung, soziales Kompetenztraining etc... Prävention: Sie richtet sich an potentielle Risikogruppen, die z. B. durch Herkunftsmilieu, kritische Lebensumstände oder Lebensereignisse oder andere Kriterien als besonders anfällig zu bezeichnen sind. Sie möchte durch Beeinflussung von früh identifizierten Risikofaktoren gezielt vorbeugen. Es handelt sich somit um eine spezifische Prävention, z. B. Früherkennungstests (Screenings), Selbstuntersuchungen, gezielte Kompetenz- und Leistungsförderung bei sozial Benachteiligten. Distale Ziele von Interventionen konzentrieren sich auf die ökologischen und sozialen Lebensbedingungen sowie auf den institutionellen und sozialen Kontext und auf die sozialen Ressourcen (Netzwerke von Beziehungen). Die Verwirklichung dieser Ziele ist erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung messbar. Proximale Ziele sind dagegen auf die direkte subjektive Lebenswelt, den biographischen Kontext und die individuellen Ressourcen (persönliche Fertigkeiten, Handlungskompetenzen) eines Menschen gerichtet. Fortschritte innerhalb dieser Zielvorgaben sollten bereits während der Intervention erkennbar werden. Zur Planung und Durchführung von Präventionsmaßnahmen: Man sollte dafür sorgen, dass in der Zielgruppe Homogenität herrscht, z. B. in Bezug auf Alter, Fähigkeitsdefizit, Lebenserfahrung, Entwicklungsstand und Motivation, denn so kann ein Programm leichter angepasst werden. 99 F – 7 – 2: Verhaltensanalyse (Quelle: HPP) Ausgangslage und Konzept: Verhaltenstheoretische Modellvorstellungen gehen davon aus, dass individuelle Verhaltensweisen durch spezifisch vorausgehende Reizkonfigurationen und nachfolgende Ereignisse bedingt sind. Man konzentriert sich auf die Identifikation dieser Stimuli und Verhaltenskonsequenzen. Hauptquellen der Informationsgewinnung: Gezielte Verhaltensbeobachtung, Befragungen mit Kind, Eltern, Lehrern, Soziometrie etc... Angewandte Verhaltensanalyse in 5 (6) Schritten SORKC(E) (a) Stimuluskomponente „S“: Gesamtheit aller relevanten externen und internen Reizbedingungen, die dem Problemverhalten vorausgehen; meist komplexere Umweltbedingungen. Die Stimuluskonstellation ist schwer zu differenzieren, Auslöser können sein: (1.) Unterrichts- oder Erziehungssituation, Erziehungsstrategien des Lehrers, der Eltern. (2.) Sachstrukturelle Gegebenheiten (Curriculum; Stofffülle; Aufgabenschwierigkeit). (3.) Äußere Faktoren (Klassengröße; Raum; Beleuchtung; farbliche Gestaltung...) (b) Organismuskomponente „O“: Sie umfasst diejenigen biologischen Faktoren, die den Zustand einer Person beeinflussen (z. B. Kurzsichtigkeit; Kinderkrankheiten), fachärztliche Untersuchungen, äußere Erscheinung (z. B. Dickleibigkeit; Ungepflegtheit; Unausgeschlafenheit), individualtypisch stabile Reaktionstendenzen. „O“ ist deshalb besonders wichtig, um die Verhaltensmodifikation nicht am Durchschnittsverhalten anzupassen, sondern damit auch nach der Modifikation die Individualität zum Ausdruck gebracht werden kann. (c) Reaktionskomponente „R“: Bezieht sich auf die problemrelevante Ausgangslage (operationalisiertes Ist-Verhalten) und auf das erwünschte Modifikationsziel (op. Soll-Verhalten). Eine „Ausgangsverhaltenstopographie“ bildet eine graphische Darstellung der Auftretenshäufigkeit des Problemverhaltens über mehrere Erhebungszeitpunkte ab. (d) Kontingenzkomponente „K“: Sie beschreibt, wie konsequent und wie systematisch die Verhaltensfolgen eintreffen. Wichtig: Zeitabstand zwischen Reaktion und nachfolgender Verstärkung/Bestrafung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Festlegung der optimalen Zeitspanne zwischen Bekräftigung und erneuter Reaktion; dabei muss der Lernende genug Zeit haben, die informationshaltige Rückmeldung zu verarbeiten. Zusätzlich zum zeitlich-räumlichen Abstand zwischen Verhalten und Konsequenz wird das System thematisiert, d. h. die Regelmäßigkeit, mit der auf ein Verhalten eine pos./neg. Verstärkung oder eine pos./neg. Bestrafung folgt. (e) Konsequenzkomponente „C“: Sie bezieht sich auf die nachfolgenden Bedingungen (alle verstärkenden Ereignisse, die dem Verhalten unmittelbar oder längerfristig folgen). Sie beeinflussen Intensität, Dauer, Stabilität des Verhaltens und bestehen i. d. R. aus spezifischen Reaktionen der Interaktionspartner. (f) Evaluationskomponente „E“. F – 7 – 3: Pädagogische Verhaltensmodifikation, Tokensysteme und Kontingenzverträge (Quelle: HPP) Vorläufer: Aktivitäten zur Verbesserung von Lehrprozessen und zur Maximierung von Lehrerfolgen (Skinner 1953ff): behaviour analysis in education. Definition: Pädagogische Verhaltensmodifikation ist ein Sammelbegriff für empirisch-experimentelle und lernpsychologisch orientierte Methoden zur gezielten Beeinflussung von Verhaltensweisen im pädagogischen Feld durch (1.) systematische Veränderungen situativer Rahmenbedingungen. (2.) Änderung von Verhaltenskonsequenzen sowie (3.) durch Verhaltensmodelle. Bausteine der Verhaltensmodifikation: (a) Empirische Orientierung: SORKC(E)-Analyse. (b) Lernpsychologische Orientierung: Klassisches bzw. operantes Konditionieren. (c) Modell-Lernen anhand von relevanten Bezugspersonen. F – 7 – 3 – 1: Tokensysteme Methode der Token-Ökonomien: Sie bündeln Motivations- und Modifikationstechniken. In seinem Zentrum stehen die Token (münzartige Marken), die unmittelbar auf positive Verhaltensweisen vergeben oder bei unerwünschten Reaktionen wieder entzogen werden („response – cost“). Sie können später durch 100 verschiedene Eintauschverstärker („back-up-reinforcer“) eingewechselt werden. Der Ablauf des Tokensystems erfolgt in 6 Phasen: 1. Definition: Präzisierung, pädagogische Begründung von Verhalten: genaue Operationalisierung des Ausgangs- und des erwünschten Endverhaltens, da nur das konkretisierte Zielverhalten mit Token zu vergüten ist. 2. Auswahl von Eintauschverstärkern: je nach Verhaltensweisen sollten die Verstärker in Qualität und Quantität spezifiziert werden. 3. Zuordnung von Verhaltensweisen und Tokenvergütung: Festlegung von Kontrollprozeduren. Ausbalancierung des Verhältnisses von Token zu Verhaltensweisen und zu Eintauschverstärkern. Es wird das erreichbare Token-Maximum definiert. Zugleich Vereinbarung von empirischen Kontrollprozeduren (z. B. Strichlisten). 4. Einführung: Die tief greifende organisatorische Vorbereitung dieses Systems erfordert, dass man nach einem natürlichen Zeitabschnitt (nach den Ferien) beginnen sollte. 5. Korrektur: Notwendigkeit, das System immer wieder zu optimieren, erneuter Durchlauf vorausgehender Phasen. Typischer Fehler z. B. Ausschluss eines Schülers für längere Zeit, sich Token zu verdienen, Verzicht auf Eintauschverstärker. 6. Ausblendung und Generalisierung: Es bieten sich verschiedene Maßnahmen für den Übergang zur Abschaffung des Systems an: Beendigung des Interventionsprogramms verschleiern; Trainingsbedingungen vielfältig variieren; zunehmend Selbstkontrolle anbahnen; Zielverhalten auswählen, dass natürliche Verstärkungen nach sich zieht. F – 7 – 3 – 2: Kontingenzverträge Kontingenzverträge sind verständlich formulierte Übereinkommen zwischen (meist 2) Partnern (Kind/Schüler und Eltern/Lehrer), die sich im Sinne eines gegenseitigen Austausches über Verpflichtungen und Gratifikationen des Miteinanderumgehens einigen. Verhaltenssicherheit durch schriftliche Fixierung der jeweiligen Erwartungen, Ziele, Methoden und Konsequenzen ihrer Interaktion. Grundprinzipien: (a) Gratifikation: positive Verstärkung, Belohnung (b) Reziprozität: wirkungsvolle Vereinbarungen binden alle Parteien. (c) Optimierung: Maximierung positiver Interaktionen. (d) Demokratie: Freiräume in menschlichen Beziehungen setzen faire Regeln voraus. (e) Gerechtigkeit (im Bezug auf Verstärkung und Leistung) (f) Eindeutigkeit (g) Freiwilligkeit (h) Gewohnheit: Intendiertes Verhalten soll zur Gewohnheit werden. Phasen des Vertragsmanagments: (a) Ausgangsverhalten (Ist) und Endverhalten (Soll) klären. (b) Vertrag aushandeln: gegenseitiges Vertrauen; gemeinsame Belohnungen identifizieren; Einfühlungsvermögen; Vertragsbedingungen spezifizieren. (c) Vertrag formulieren und in Kraft setzen: Schriftliche Konkretisierung von Zielen, Konsequenzen und Verantwortlichkeiten zur Vorbeugung von Streitereien. (d) Vertragstreue kontrollieren und ggf. Vertrag korrigieren. Ziel ist das Schließen von Eigenverträgen (Vertragsabschluss mit sich selbst zur autonomen Verhaltenskontrolle). Kognitivistische Ansätze zur SelbstKontrolle: (a) Selbst-Überwachung (Metakognition): durch Selbst-Beobachtung den IstZustand und den Abstand zum Soll-Zustand klären. Zunächst: Lautes Aussprechen von Metakognitionen, dann leises. (b) Selbstbewertung des Verhaltens. (c) Positive Gedanken über sich selbst; Selbstverstärkung durch interne Bekräftigungen (z. B. Dinge, Genussmittel, Lob, Anerkennung...). (d) Eigenvertrag: Selbststeuerung muss allmählich durch sukzessive Verhaltensformung aufgebaut werden. Ziel: Anbahnung eines lehrerunabhängigen, d. h. autonomen Lernverhaltens mit eigenen Zielen und Ausrichtung des Verhaltens auf diese Ziele. 1. Schritt: Der vom Erzieher kontrollierte Vertrag / 2. Schritt: Übergangsstufe: variierend Schüler - und Lehrerkontrolle / 3. Schritt: Der vom Schüler kontrollierte Vertrag: Schüler definiert erforderlichen Verhaltensfortschritt selbst.