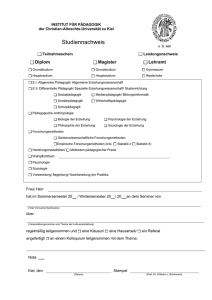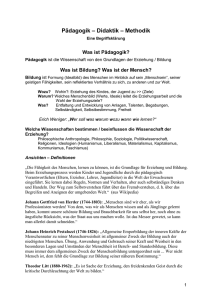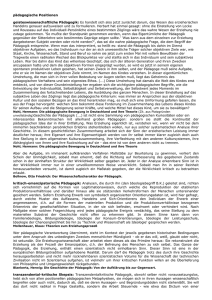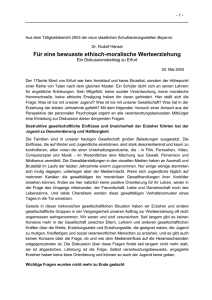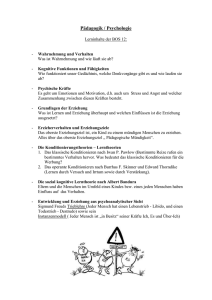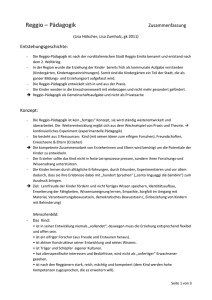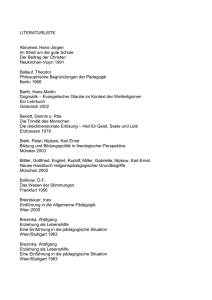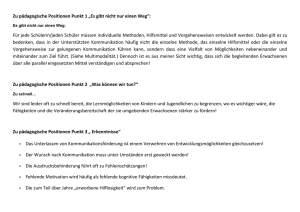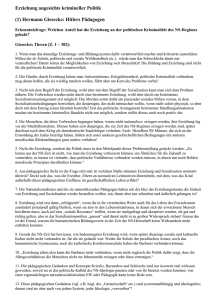michael felten - Gymnasium Leoninum Handrup
Werbung

MICHAEL FELTEN „Verlernt zu erziehen?“ Kommen Schule und Elternhaus ihren Erziehungsverpflichtungen noch nach? Verehrte Anwesende, der Untertitel zu dieser Veranstaltung hat die Frage aufgeworfen, ob Schule und Elternhaus ihren Erziehungsverpflichtungen heute noch nachkommen. Falls Sie es an diesem Abend ganz eilig haben sollten, will ich vorweg schon einmal eine schnelle Antwort geben, sie lautet: Es kommt darauf an: In manchen Fällen durchaus, in anderen einigermaßen, nicht selten aber auch mehr schlecht als recht. Sie werden zwar jetzt blitzschnell überlegen, welcher Teilgruppe Sie sich zurechnen sollten oder ob es noch eine vierte irgendwo dazwischen gäbe, aber: Sie wollen vermutlich mehr dazu von mir hören. Ich freue mich, daß Sie sich so zahlreich für eine eingehendere Erörterung dieser Fragestellung Zeit genommen haben, ich danke für die Einladung Ihnen meine Überlegungen dazu vorstellen zu dürfen, und ich hoffe, daß auch Sie selbst nachher aus Ihren Erfahrungen dazu beitragen werden. Lassen Sie mich zunächst einen Blick auf die allgemeine Lage des Projekts Jugend werfen. Spätestens seit den Befunden von Pisa ist die Debatte über die Situation der Jugend wenn auch nicht zur Kanzlersache, so doch zu einer öffentlich stärker beachteten Angelegenheit geworden. Aber die Diskussion war - wo sie nicht nach der üblichen Medienaufgeregtheit ohnehin im Sande verlief mit deutlichen Scheuklappen behaftet. So konzentrierten sich viele Stellungnahmen zur mageren Leistungsbilanz deutscher Schüler auf organisatorische oder ökonomische Forderungen: nach höheren materiellen Aufwendungen für das Bildungswesen etwa (die mir teils berechtigt, teils illusorisch, teils unnötig erscheinen) oder nach einer Umstrukturierung des Schulsystems (dabei waren Finnland und Japan gar nicht wegen ihrer Gesamtschulen so erfolgreich). Andere Ursachenvermutungen waren nicht von der Hand zu weisen: die vielfach mangelhafte Anregung im Kindergarten, die geringe Sprachkompetenz von Migrantenkindern; die methodischen Schwächen manchen Fachunterrichts. Aber merkwürdig: Kaum jemand hielt sich lange damit auf, daß möglicherweise das veränderte Erziehungsklima im Elternhaus oder die Einstellung zu Disziplin und Leistung unter den Lehrern zu der neudeutschen Bildungsnot beigetragen haben könnten. Auch die Reaktionen auf die Bluttat von Erfurt wiesen eine gewisse Engstirnigkeit auf. Da war zum einen die ausgesprochen gespenstisch anmutende Debatte um den Einfluß massenhaft konsumierter gewaltverherrlichender Videos und Computerspiele. Daß diese den Amoklauf des jungen Mannes aus Thüringen begünstigt haben, ist doch für jeden unstrittig, der solche Medien kennt - es sei denn, er stünde im Sold entsprechender Produzenten oder hege eine grundsätzliche Abneigung gegen pädagogische oder staatliche Regularien. Man mache sich nur einmal die Mühe, derartige Bildfolgen stundenlang auf sich einprasseln zu lassen, und stelle sich das über Jahre hinweg vor aber nicht mit der Psyche eines gefestigten Erwachsenen, als wohldotierter Medienexperte, sondern im Zustand jugendlicher Labilität! Was würde man dann von der Behauptung halten, man könne keinen direkt ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Anschauen eines Gewaltvideos und der Ausführung einer Gewalttat nachweisen? Zum anderen wurde für den Amoklauf gerne - mal offener, mal zwischen den Zeilen - das angebliche Auslesesystem Schule und die vermeintlich düsteren Zukunftsperspektiven verantwortlich gemacht, frei nach dem Motto „Wer Druck oder Aussichtslosigkeit sät, wird Gewalt oder Verzweiflung ernten“. Vergleichsweise gering dagegen war das öffentliche Nachdenken darüber, ob der in sich gekehrte Sonderling vielleicht einmal ein Kind war, um das sich die doppelt berufstätigen Eltern zu wenig kümmern konnten oder mochten. Und ob nicht viel zu viele Lehrer Jugendliche in Bildungsgänge hineinstolpern lassen, in denen sie absehbar nicht erfolgreich werden können. Aber verlassen wir einmal die großen Schauplätze und suchen andernorts nach Anhaltspunkten für den Verdacht, wir könnten verlernt haben zu erziehen. Im Restaurant wird man - zumindest in Köln - tatsächlich immer öfter mit Kindern konfrontiert, denen anscheinend niemand klar gemacht hat, daß sie sich nicht zuhause, sondern in einer kultivierten Öffentlichkeit befinden: Sie benehmen sich so, daß anderen Gästen nicht nur der Appetit vergeht, sondern auch der Gesprächsfaden entgleitet die progressiven Eltern aber hüten sich konsequent, die Selbstentfaltung ihrer Liebsten einzuschränken. Auch in Bussen und Bahnen sind die Folgen einer weithin „verweigerten Erziehung“ unübersehbar: Selbst bei Regenwetter ist kaum eine Sitzfläche mehr vor lässig hochgestellten Schuhen sicher - Mitreisende jeden Alters scheuen sich aber, auch nur hinzusehen, geschweige denn, etwas dazu zu sagen, auch bei Jugendlichen, denen anzusehen ist, daß sie nicht zuschlagen werden, auch in einer Stadt, die an jeder dritten Litfaßsäule Aufforderungen wie „Hinsehen und Handeln“ oder „Müll: Jetzt langt’s“ plakatiert. Manchmal scheint es, als sei die ganze Gesellschaft paralysiert: Als würde sie der Devise huldigen: Nicht das verzogene Kind ist tyrannisch, sondern die auf gewisse Regeln pochende Gesellschaft, in der es lebt. Und was sagen Außenstehende zu unserer Frage? Der iranische Filmregisseur Majid Majidi erzählt in seinem mehrfach preisgekrönten Film „Baran“ die Liebesgeschichte zweier Heranwachsender, die sich auf einer zugigen Baustelle im Norden Teherans abrackern müssen - damit ihre Familien überleben können. Majidi wollte damit ein Gegenbild zur westlichen Welt von heute schaffen, in der man, wie er findet, „von einer Herrschaft der Kinder sprechen kann. Die Erwachsenen denken, “ fährt der Regisseur fort“, daß sie alle Unannehmlichkeiten ertragen müssen, damit es den Kindern gut geht. Das Ergebnis sind Kinder mit zu wenig Verantwortungsbewußtsein. Als ich ein Kind war, war ich immer besorgt um meine Eltern. Wenn ich heute meine Kinder ansehe, dann weiß ich, daß sich das genau umgedreht hat.“ Ich glaube, viele von uns müßten ihm - zumindest ein Stück weit beipflichten. Zu dieser Umkehrung der Verhältnisse paßt auch, was kürzlich in der ‘Zeit’ zu lesen war. Vier Mütter berichteten darüber, wie chaotisch es in den Zimmern ihrer jugendlichen Söhne und Töchter aussähe und wie sehr sie sich anstrengen würden, diese - wie sie es nannten - eigene Welt zu akzeptieren: Haschischposter an den Wänden, verschimmelte Lebensmittel halb auf halb unter dem Teppich, im familiären Streit von Söhnen eingetretene Türen, oder schon am frühen Morgen eine Lautstärke der Musik, die sie allein körperlich kaum aushielten. Zwei Wochen später wurden drei Leserbriefe veröffentlicht, die sich mehr als erstaunt über die Schwäche dieser Mütter zeigten, die daran erinnerten, daß die Halbwüchsigen doch eine recht kostenintensive Fürsorge genössen, und die von den Eltern schärfere Maßnahmen forderten. Diese Briefe stammten - von Jugendlichen. Wenn ich all’ diese Eindrücke zusammenfassen sollte und dabei Anleihen bei der Jugendsprache machen würde, läge es nahe zu sagen: Irgendwie Wahnsinn! Und: Warum tuen wir unserer Jugend - und nicht zuletzt uns - so etwas eigentlich an? Meine Diagnose: Weil alle am Projekt Jugend Beteiligten - und das sind mehr als Eltern, Kindergärtner oder Lehrer - seit geraumer Zeit mehr oder weniger antipädagogisch infiziert sind! Der pädagogische Zeitgeist der letzten Jahrzehnte hat eine Reihe äußerst schwer erkennbarer Theorie“viren“ in unsere mentalen Programme eingeschleust. Das Dumme ist nur - und das ist ja typisch für solche Erreger - daß sie lange Zeit nicht als sonderlich störend empfunden wurden, sondern als urwüchsig pädagogisch. Ich nenne nur einige dieser Mythen der jüngeren Pädagogik: Kinder wissen selbst am besten, was gut für sie ist. Kinder sollen möglichst ohne Belastungen, Konflikte oder Versagungen aufwachsen. Wichtig ist vor allem ein gutes Selbstwertgefühl - die guten Fähigkeiten kommen dann schon von selbst. Lernen geschieht am besten spielerisch und soll Spaß machen. Leistungserwartungen machen Kindern Angst, deshalb sind Beurteilungen und Kritik unpädagogisch. Disziplin und Strenge, Verbote und Strafen schaden der kindlichen Entwicklung. Was ebenso häufig wie ungenau als allgemeine Verunsicherung der Erzieher beklagt wird, erweist sich somit im Kern als verhaltene bis überzeugte Verweigerung von Erziehung. Diese beruht auf Vorstellungen, die sich bis zu Rousseau zurückverfolgen lassen, die aber insbesondere die Pädagogik im 20. Jahrhundert - dem sogenannten des Kindes - maßgeblich geprägt haben. Sie wollte der bessere Anwalt des Kindes sein und es von möglichst vielen Zwängen befreien. So hilfreich solch’ antiautoritäre Impulse aber noch vor dreißig Jahren gewesen sein mögen, mittlerweile treffen sie auf viele Jugendliche, die sich vor lauter Freiheiten kaum noch retten können, die über Langeweile, Betäubung oder Gewalt nicht allzuweit hinaus geraten, die nach Orientierung geradezu rufen. Dabei würde erziehen doch - einfach gesagt - heißen, jedes Kind einerseits als ein ganz einzigartiges Wesen wahrzunehmen und auf es individuell einzugehen, es aber andererseits auch aktiv und zielstrebig in das allgemeine Leben hineinzuführen. Oder, um eine gängige Redewendung zu variieren, man sollte junge Menschen zwar da abholen, wo sie stehen, aber nicht bei ihnen stehenbleiben oder sie lediglich bei ihren Launen begleiten, sondern sie auch zu sinnvollen Schritten herausfordern und ihnen diese dann auch tatsächlich zumuten. Ein Bild, das diesen Sachverhalt zumindest formal etwas genauer faßt, ist das vom „magischen Erziehungsdreieck“ (Hurrelmann). Demnach brauchen Heranwachsende dreierlei, um nicht nur selbstbewußt, sondern auch leistungsfähig und verantwortungsbereit zu werden: Anerkennung, Anregung und Anleitung. An diesen drei Dimensionen läßt sich vielleicht ganz gut prüfen, ob und inwieweit wir verlernt haben zu erziehen. Zeit ist Geld, aber Kinder sind unbezahlbar In der ersten Dimension geht es darum, wie wir als Erzieher zur Person des Kindes stehen, Stichwort: Anerkennung. Das bedeutet hier natürlich bei weitem nicht nur das ausdrückliche Lob, gemeint ist vor allem die grundsätzliche Wertschätzung und ganz konkrete Beachtung, aber auch der Respekt vor der jeweiligen Eigenart und das Gewähren von sinnvollen Freiräumen. Hier das rechte Maß zu finden, ist oft alles andere als einfach. Bei mangelnder Begeisterung fühlen sich Kinder schnell abgelehnt, in zu engen Beziehungen hingegen kann Unselbständigkeit und Abwehr entstehen. Man muß sich keineswegs rund um die Uhr mit Kindern beschäftigen oder sie permanent loben, aber für sie ansprechbar sein, ein offenes Auge für sie haben, mit ihnen auch Stunden der Muße verbringen können, das geht nicht ohne ein erhebliches Quantum Zeit. Angesichts von Tendenzen zum begeisterten Doppelverdienen und zum überzeugten oder leichtfertigen Alleinerziehen möchte ich deshalb betonen: Liebe allein genügt nicht, viele Kinder brauchen mehr mitmenschliche und pädagogische Aufmerksamkeit. Man ist geneigt, an diesem Punkt schnell zu nicken - und zu wenig zu tun. So hat die aktuelle Bindungsforschung schon bei Kleinkindern Gefahr im Verzug registriert: Demnach ist allein in den vergangenen 20 Jahren der Anteil sicherer Bindungsmuster bei Zweijährigen von 68% auf 45% zurückgegangen. Mit anderen Worten: Die Verbreitung unsicherer oder stark gestörter seelischer Grundbefindlichkeit im frühen Kindesalter hat um zwei Drittel zugenommen. Das ist beunruhigender als ein Schwarzer Tag an der Börse, denn es wirkt ein Leben lang nach. Solche stark verunsicherten Kinder neigen zu Aggressionen oder Angst gegenüber den Müttern, zum Ignorieren elterlicher Gebote und Verbote, zu Unzufriedenheit und Unruhe, zu reduziertem Erkundungsverhalten und eingeschränkter Selbstständigkeit. In der Schule sind solche Kinder oft in Streit verwickelt oder stören andere, sie fallen auf durch erhöhte Aggressivität, mangelnde Konzentration und Gedächtnisstörungen - die „neuen Kinder“ eben, die unseren Unterricht auf eine so unglückliche Weise lebendig machen. Die Forschung sagt übrigens auch - in der für sie typischen nüchternen Sprache -, wie Bindungsstörungen zu vermeiden sind: Wenn eine mütterliche Person in den ersten Lebensjahren zur Verfügung steht und die Regungen des Kindes angemessen beantwortet. Das gewiß nicht reaktionäre Wochenblatt ‘Die Zeit’ legte kürzlich unter der Überschrift „Alleine zu zweit“ offen, welchem Streß sich alleinerziehende Berufstätige aussetzen, um Kind und Karriere halbwegs unter einen Hut zu bringen, und es war klar, daß dabei in der Regel beide - Erwachsener wie Kind - zu kurz kommen - Erfahrungen, die neuerdings auch in der Fachliteratur stärker beachtet werden. Die Problematik elterlicher Überlastung reicht bis in die Pubertät. Ist das jüngste Kind erst einmal in der Schule, spätestens aber nach dem Wechsel etwa ins Gymnasium wird doppelverdient - oft nicht nur aus Hedonismus, sondern weil ein mehrköpfiges Leben auch einfach ziemlich teuer ist. Was schnell übersehen wird: Selbst wenn Heranwachsende immer früher selbständig wirken und es auch gerne sein wollen - sie brauchen uns auch mit 14 noch, wenn auch nicht so häufig und auf eine andere Weise als zur Kindergartenzeit. Es ist eben ein Unterschied, ob sie sich mittags nur mit Mikrowelle und Monitor unterhalten können oder ob sie zuhause jemand antreffen, der sich für ihre Erlebnisse interessiert - auch wenn sie gar nicht sofort davon erzählen mögen. Und es macht etwas aus, ob es niemand mitbekommt oder ob es einem auffällt, wenn sie mit dem Schwänzen liebäugeln. Es spielt auch eine Rolle, ob die Hausaufgaben hektisch und gereizt am Abendbrottisch kontrolliert oder am Nachmittag ruhig und beiläufig mitverfolgt werden. Und es bleibt nicht folgenlos, ob die Eltern nach Job, Einkaufen und Kochen abends endlich einmal ihre Ruhe haben wollen - oder ob wenigstens einer ein offenes Ohr für den Jugendlichen aufbringen kann - selbst wenn der es nicht dauernd in Anspruch nimmt. Ohnehin stellt das schwierige Alter auch den Erwachsenen schwierige neue Aufgaben: Die jugendlichen Stimmungsschwankungen zu verstehen und damit umzugehen, angemessene Freiräume auszuloten und zuzugestehen, Kritik an der eigenen Lebensweise zuzulassen, Auseinandersetzungen zu suchen und auszuhalten. Wer das zwischen Tür und Angel abzuhandeln versucht, hat in der Regel schlechte Karten - und beschränkt seine Aufmerksamkeit womöglich auf negatives Verhalten, auf die ‘Störungen’. Tatsächlich fühlt sich - einer neueren Umfrage zufolge - jedes dritte Kind von seinen Eltern unverstanden und nimmt an, ‘die’ hätten keine Ahnung davon, was in ihm vorgehe. Auch wenn Kinder und Jugendliche zu ‘funktionieren’ scheinen - wenn sie zuhause nicht randalieren, wenn keine ‘blauen Briefe’ aus der Schule kommen, wenn die Polizei nicht vorfährt - dies ist keine Garantie dafür, daß sie sich weitgehend wohl und sicher fühlen. Viele Eltern fallen jedenfalls aus allen Wolken, wenn sie erfahren, daß ihr Fünfzehnjähriger regelmäßig an irgendwelchen Satansriten teilnimmt - weil er sich nämlich jahrelang verdammt einsam gefühlt hat und hier nun plötzlich und scheinbar Gemeinsamkeit erlebt - oder daß ihre Vierzehnjährige seit einiger Zeit Haschisch raucht - weil sie nämlich meint, so Farbe in ihr unauffälliges Leben bringen zu können. Ich formuliere ein erstes Fazit: Wir haben nicht verlernt, unsere Kinder zu lieben, sondern sie als Wesen ernst zu nehmen, die zum Erwachsenwerden auf einfühlsame und zugewandte Erwachsene angewiesen sind - aber dafür braucht man auch Zeit. Von nichts kommt nichts - oder zumindest zuwenig Der zweite Pol des Erziehungsdreiecks hat damit zu tun, wie wir auf die Auseinandersetzung des Kindes mit der Welt (man könnte auch sagen: auf sein Wachsen und Lernen) einwirken, Stichwort: Anregung. Auf diesem Gebiet stellt sich die Lage recht uneinheitlich dar. Daß junge Menschen überhaupt der gezielten Anregung bedürfen, ist keineswegs selbstverständlich, wie ein Blick in zahlreiche Kindergärten zeigt: Dort sind heute viele Kinder ebenso über- wie unterfordert - wenn die Erzieher sie nämlich zu sehr sich selbst überlassen. Dabei liegt die „strahlende Intelligenz von Fünfjährigen“, wie Freud sich ausdrückte, unnötig brach, wenn man diese eminent bildsame Lebenszeit nicht dazu nutzt, den geistigen Horizont auf breiter Front zu erweitern. Dies insbesondere bei Kindern aus bildungsferneren Schichten zu unterlassen, bedeutet letztlich nichts anderes als frühe Beihilfe zu unnötiger Selektion. Angeleitetes Malen oder inszenierte Naturbegegnungen, regelmäßiges Vorlesen oder auch behutsames Gewöhnen ans Aufräumen - das ist keineswegs fremdbestimmte Einengung von kindlicher Spontaneität, da werden vielmehr Wege gebahnt für zukünftige Künstler oder Forscher, Weltverbesserer oder Handwerker. Was spricht eigentlich dagegen, im Kindergarten nach Kräften zum „Weltwissen von Siebenjährigen“ - so kürzlich ein Bestsellertitel - beizutragen? In Familien und Schulen hingegen, in denen Anregung keine Mangelware ist, erwachsen indes neue Gefahren. So machen wir vielen unserer Kinder zwar jede Menge Angebote - von den überquellenden Spielzeughalden in manchen Kinderzimmern über eine breite Palette von Nachmittagsterminen bis hin zur Fächervielfalt der Oberstufe - aber was fangen sie eigentlich mit dieser Fülle an? Und was tun wir, wenn ihnen ein neues Spielzeug nach kurzer Zeit keinen Spaß mehr macht, wenn sie keine Lust mehr auf Jazzdance haben, wenn sie das gewählte Neigungsfach nach der ersten verhauenen Klausur doof finden? Würde ‘Anregung’ in diesem Fall nicht vor allem bedeuten, daß wir dem Kind dabei behilflich sind, daß es bei einer Sache bleibt - indem wir es etwa bei aufgetretenen Schwierigkeiten unterstützen? Oder Thema Lob: Zwar ist es mittlerweile eine pädagogische Binsenweisheit, daß man das Größerwerden und Mehrkönnen von Kindern würdigen sollte und sie nicht durch Kritik oder Ungeduld entmutigen darf. Aber muß man deshalb vor jedem normalen Fortschritt in überschwengliche Begeisterung verfallen? Und ist es wirklich förderlich, jeden Hinweis auf mögliche Verbesserungen verschämt zu verschlucken, um das Kind nur ja nicht zu frustrieren und sein Selbstwertgefühl nicht zu beschädigen? Die Sache mit dem Selbstwertgefühl ist ja ohnehin eine populäre Halbwahrheit, die neuerdings wieder kritischer gesehen wird. Man glaube nur nicht, daß es Kindern uneingeschränkt guttue, wenn man sie unbeschränkt Fehler machen läßt - sie geraten ja dadurch andern gegenüber in Rückstand und erleben die Erwachsenen als gleichgültig. Zudem stellt ein hohes Selbstwertgefühl auch keinen Eigenwert da - schließlich muß es keineswegs mit sinnvollen Zielsetzungen und anspruchsvollen Leistungen einhergehen (Bandenführer etwa sind ja in der Regel äußerst selbstbewußte Typen). Grundsätzliche Selbstüberschätzung gar kann richtig gefährlich werden - solche Menschen neigen in Belastungssituationen zu unerwarteten und aggressiven Ausbrüchen. Und wie verträgt sich der Aspekt Anregung mit den flächendeckend in deutschen Kinder- und Jugendzimmern verbreiteten Fernsehgeräten (und Computern)? Natürlich gibt es auch sinnvolle Fernsehsendungen, aber im Kern ist die Auswirkung des stundenlangen Glotzens in Kindheit und Jugend doch eine zweifache: Passivität und Oberflächlichkeit einerseits, sowie Gewöhnung an Gewalt andererseits. Deshalb hat die Journalistin und Autorin Susanne Gaschke dafür plädiert, vor allem den sozial ohnehin schon benachteiligten Familien durch eine regelrechte Anti-TVKampagne die Risiken dieses Mediums klarzumachen. Jede Stunde ‘Glotze’, die man seinem Kind erspart, wäre für dieses jedenfalls ein großer Gewinn - und für einen selbst vielleicht auch. In dieser Zeit könnte das Kind spielen oder später lesen, oder man könnte mit ihm sprechen und gemeinsam etwas unternehmen - oder sich dafür interessieren, was es in der Schule Neues erfahren hat. Auch in dieser Hinsicht gehört Deutschland ja zur PISA-Nachhut: Nur etwa 40 Prozent der Mütter und Väter erkundigen sich hierzulande nach den Schulleistungen ihrer Kinder oder nehmen sich Zeit für persönliche Gespräche, in den Niederlanden tun dies immerhin etwa zwei Drittel, in Italien gar vier von fünf Elternpaaren. In diesem Zusammenhang ist ein weiteres Detail aus der PISA-Studie aufschlußreich, daß nämlich deutsche Jugendliche im Hinblick auf ihre Leselust das absolute Schlußlicht im internationalen Vergleich bildeten. Unsere Kinder reizt es demnach besonders wenig, sich eine Geschichte Seite für Seite selbst zu erlesen, im Kopf dazu eigene Bilder entstehen zu lassen und diesen Vorgang zu genießen oder interessant oder spannend zu finden. Dabei gibt es hierzulande keineswegs zu wenige oder zu wenig gute Kinder- und Jugendbücher, und in vielen Vergleichsländern sind Fernsehen und Computer ähnlich verbreitet wie bei uns. Haben unsere Mütter - oder Väter, oder Großeltern - nur zu wenig vorgelesen, als die Kinder noch klein waren? Oder haben sie ihnen etwa schon von früh an zu viel abgenommen: das Warten auf die nächste Mahlzeit, das Gestalten freier Stunden, die kleine aber wichtige Mithilfe im Familienhaushalt, die zweite Hälfte der Hausaufgaben? Kurz gesagt: Haben sie sie vielleicht an etwas grundsätzlich Ungünstiges gewöhnt, nämlich an die Erwartung, man werde das Leben schon gemacht bekommen - anstatt es selbst zu machen? Die Risiken der verwöhnenden Erziehung hat übrigens der Wiener Arzt und Psychologe Alfred Adler in seiner Individualpsychologie erstmalig detailliert beschrieben - und erst kürzlich erreichte ein Buch mit dem Titel „Die Verwöhnungsfalle“ wieder mehrere Auflagen. Die bereits erwähnte moderne Bindungsforschung liefert eindrückliche Beispiele dafür, wie früh solche Verwöhnung beginnen - und wie man sich ihr entziehen kann. Stellen Sie sich vor: Da versucht ein Kleinkind, bäuchlings über den Fußboden robbend an sein Plastikentchen zu gelangen. Mühsam kommt es voran, mit einer Mischung aus Stemmen, Schieben, Rutschen, manchmal gelingt eine Kriechbewegung; ab und zu bleibt es erschöpft liegen, vielleicht ein kurzes Weinen, dann doch wieder sich aufraffen, ein letzter energischer Ruck - geschafft! Wie viele Mütter würden dazu neigen, ihrem Kind diese Mühe abzunehmen - und damit auch die in der Belastung liegende Stärkung und den sie krönenden Erfolg? Verwöhnung bedeutet eben weit mehr als die Überhäufung eines Kindes mit Süßigkeiten oder Streicheleinheiten. Verwöhnend verhalten sich Erzieher immer dann, wenn sie dem Kind Tätigkeiten abnehmen oder gar nicht erst zutrauen, die es selbst bewältigen - und daran wachsen könnte. Das betrifft auch die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen bei den Haushaltsarbeiten. Unser heutiges häusliches Komfortniveau ist für Heranwachsende zwar momentan angenehm, aber langfristig ungünstig: Sie gewöhnen sich an eine Haltung des Versorgtseins - und es entgeht ihnen das so wichtige Empfinden, von anderen gebraucht zu werden, für andere wichtig zu sein - übrigens ein viel tragenderes Gefühl als das, eine Pflicht erledigen zu müssen. Es würde nicht nur unserem Zeitbudget, sondern vor allem unseren Kindern guttun, wenn wir weniger verschämt von ihnen erwarten würden, daß sie sich im familiären Miteinander - oder auch in der Klassengemeinschaft in altersgemäßer Weise nützlich machen - und das heißt mit 10 oder 15 keineswegs nur feigenblattartig. Daß auch viele Lehrer von Verwöhnung ein mehrstrophiges Lied singen könnten, ist kein Geheimnis; etwa wenn sie in der Grundschule kurze Texte fotokopiert verteilen, die die Schüler auch von der Tafel oder vom Projektor abschreiben und dabei ihre Feinmotorik trainieren könnten Essen oder Trinken im Unterricht zulassen, auch wenn alle 45 Minuten Pause ist auf die Verbesserung von Klassenarbeiten verzichten nur wenig Hausaufgaben aufgeben, obwohl das Lernen doch der Beruf des jungen Menschen ist. In Sachen Anregung ist mithin eine höchst zwiespältige Bilanz zu ziehen: Wachsenlassen alleine genügt nicht, Verwöhnung und Überbehütung bremst die kindliche Entwicklung aber auch - es sieht so aus, als brauchten viele unserer Kinder vor allem mehr gezielte Herausforderungen - in sachlicher ebenso wie in sozialer Hinsicht. In diesem Zusammenhang verdient ein Begriff rehabilitiert zu werden, der im Pädagogischen zu Unrecht den Beigeschmack des Unanständigen angenommen hat: Leistung! Dabei wollen Heranwachsende durchaus etwas leisten und sich dafür anstrengen - wenn sie nur den Eindruck haben, daß es sich lohnt - und dieser Lohn kann ganz unterschiedlicher Natur sein: weil etwa das Lesenlernen für sie unmittelbar nützlich ist; weil die Eltern wissen wollen, was sie Neues gelernt haben; weil ein Lehrer, den sie schätzen, ihnen zutraut, quadratische Gleichungen zu lösen; weil sie etwa in Informatik kompetenter werden als andere; weil ihnen ohne Fremdsprache der Weg zum Traumberuf verbaut ist. Lernfreude ist allerdings etwas sehr Empfindliches, das Lehrer wie Eltern allzu schnell dämpfen oder blockieren können: Wenn sie zuwenig Zeit oder Interesse für den ‘Beruf’ ihrer Kinder haben, oder wenn sie auf Fragen oder Schwierigkeiten mit Ärger oder Kritik reagieren. Aber auch wenn sie von kleinen Fortschritten in übertriebener Weise begeistert sind oder sich mit mangelhaften Leistungen zufrieden geben, z.B. einem eigentlich unlesbar geschriebenen Aufsatz, einem lustlos gemalten Bild oder einer vollkommen unübersichtlich notierten Rechenaufgabe. Besonders verhängnisvoll ist die Wahl einer weiterführenden Schule, die anhaltende Überforderung bedeutet. Dabei tun Kindern gute Noten und entsprechende Erfolgsgefühle an einer Haupt- oder Realschule viel besser, als jahrelang das ‘letzte Rad’ am Gymnasialwagen zu sein. In dem Maße, indem die Zahl unserer Kinder zurückgeht, für die wir nur das Beste wollen, steigt unsere Neigung, ihnen auch den Weg dahin abzunehmen. Nur: Wer zuviel getragen wird, dessen Kräfte lassen ebenso nach wie seine Ansprüche an andere wachsen. Unnötige Entlastung, das bedeutet bei jungen Menschen ganz einfach Unterschätzung - und damit vermeidbare Schwächung. Will man Kindern also keine ihrer Möglichkeiten vorenthalten, will man wirklich Lebenstüchtigkeit hervorrufen, dann ist nicht Schongang angesagt, sondern Herausforderung: ihnen hin und wieder auch einen geeigneten Stein in den Weg legen, sie zu Neuem oder Besserem anregen, ihnen Anstrengungen zumuten, ihnen Bemühungen abverlangen. Ein zweites Fazit könnte also lauten: Manche Erzieher haben verlernt, ihre anregende Funktion überhaupt anzunehmen, andere haben übersehen; daß man in Angeboten auch ertrinken kann, wieder andere haben sich nicht klar gemacht, wie wichtig Belastungen für eine optimale Entwicklung sind. Das lange Zeit euphorisch propagierte Ideal der Selbstentfaltung ist jedenfalls gründlich überstrapaziert worden und gehört relativiert - der begleitende Erwachsene wird auch im 21. Jahrhundert keineswegs überflüssig sein. Selbstbestimmung ist ein gutes Ziel - aber oft kein günstiger Weg Der derzeit meistdiskutierte Pol des Erziehungsdreiecks ist der der richtigen Anleitung. Daß es nichts Anstößiges ist, in Familien, Kindergartengruppen oder Schulklassen auf Regeln des Miteinanders zu pochen, hat sich zwar wieder herumgesprochen. Wie man aber dafür sorgt, daß Vereinbarungen, Anordnungen oder Verbote auch eingehalten werden, darüber besteht Konfusion, wohin man schaut. Wir tun uns schwer mit der Einsicht: Selbstbestimmung und freundliche Hinweise alleine genügen nicht, unsere Kinder brauchen mehr erzieherische Autorität. Ich möchte diesen Anspruch an einigen Beispielen aus der Schule erläutern. Schüler sollen sich ja auch mit Sachverhalten auseinandersetzen, die sie derzeit vielleicht überhaupt nicht interessieren weil dies bislang unbekannte Interessen bei ihnen anregen oder zu einem späteren Zeitpunkt für sie nützlich sein könnte. Hinzu kommt: Bei jedem Lernen stellen sich eine Reihe von Schwierigkeiten schließlich vollzieht sich Wissenserwerb und Kompetenzzuwachs in der Regel nicht nur beiläufig, quasi von selbst, sondern vielfach auch und gerade nur gegen Widerstände: Die Schüler verstehen etwa einen Zusammenhang nicht. Oder können eine Handlung nicht sofort ausführen. Oder nicht so gut wie andere. Oder sie können den Lehrer nicht leiden. Lernen hat insofern viel mit starken Unsicherheitsgefühlen zu tun, mit der Befürchtung, etwas nicht schaffen zu können. Würden Lehrer nun darauf verzichten, zumal die labilen und mutlosen Schüler immer wieder auch ohne deren Lust, gelegentlich gar gegen ihren Willen, verständnisvoll aber quasi unerbittlich, an Belastungen und mögliche Mißerfolge heranzuführen und scheinbar bedrohliche Lernsituationen auszuhalten, so würden diese in ihrer Ängstlichkeit belassen oder gar bestärkt. Schulisches Lernen kann also gar nicht nur Spaß machen - aber gerade hierin liegt entwicklungspsychologisch betrachtet ein erhebliches Förderpotential: Erfahrungen des (Noch-)Nicht-Könnens muß das Kind nicht gekränkt und resignierend verbuchen, sondern kann sie konstruktiv verarbeiten - das wäre dann psychische Reifung. Misserfolgsängste kann es als unbegründet, Ausweichverhalten als unnötig erfahren - so käme es zu nachhaltiger Ermutigung. So förderlich die Konfrontation mit Schwierigkeiten und Mißerfolgen für Heranwachsende auch ist, sie wird von diesen keineswegs immer angenehm erlebt: Was de facto eine Chance ist, mag zunächst als Plage empfunden werden. Gute Lehrer sind deshalb darauf gefasst, daß sie - wenn sie den Unterricht unmißverständlich leiten und Regelverstöße spürbar sanktionieren - auch Ablehnungsgefühle oder gar Wut auf sich ziehen. Und sie sind bestrebt, solche Entwertungsversuche der Schüler nicht zurückschlagend zu beantworten, sondern gelassen zu ihren Erwartungen zu stehen. Denn dadurch vermitteln sie den Heranwachsenden - über den Lernfortschritt hinaus - eine wichtige zwischenmenschliche Erfahrung: daß nämlich ihr Gegenüber auch in Konflikten verläßlich für sie bleibt. So gesehen wäre der Ruf nach mehr Strenge im Klassenzimmer kein Plädoyer für Härte, Schroffheit oder Tortur, sondern lediglich gegen modische Unverbindlichkeit. Im Kern geht es ‘nur’ um die konsequente Anleitung und Unterstützung bei der Überwindung von Lernschwierigkeiten. Also darum, Lernprozesse mit all ihren Widrigkeiten besonnen (d.h. unbeirrt von den individuellen Affekten der Schüler) und selbstbewußt (d.h. im Wissen um das sachlich Gebotene) zu leiten. Dazu gehört auch, daß man sich nicht in Kämpfe mit rebellierenden oder auch nur ausweichend argumentierenden Jugendlichen verwickeln läßt, sondern eine Art humorvolle Distanz hält. Klar, aber cool - so könnte man die Devise zuspitzen. Die Forderung nach mehr guter Autorität zu erheben, heißt ein weiteres ideologisiertes pädagogisches Ideal deutlich zu relativieren, das der Selbstbestimmung. Bemerkenswerterweise sind es die jungen Menschen selbst, die hierzulande in Umfragen das Bedürfnis artikulieren, ihre Eltern möchten „ruhig etwas strenger sein“. Und die in der Schule diejenigen Lehrer am meisten schätzen, die den Unterricht nicht nur interessant, verständlich und humorvoll, sondern eben auch „mit einer gewissen Strenge“ gestalten. Heranwachsende finden es also offenbar wichtig, dass Erzieher Regeln nicht nur aufstellen und erklären, sondern sie auch durchsetzen und - wenn nötig Überschreitungen angemessen ahnden. Die Jugend selbst plädiert mithin für eine behutsame Rehabilitierung von Disziplin - oder gar Strafe. Soweit ist es also gekommen, daß die jungen Bäumchen dem Gärtner sagen müssen, er solle sie vorübergehend und rindenschonend anbinden! Kein Wunder, schließlich hatte die pädagogische Debatte der letzten Jahrzehnte alles, was mit Zwang, Kontrolle oder äußeren Anforderungen zu tun hatte, ausgeblendet oder verteufelt - eine Art antifaschistischer Kurzschluß. Grenzen zu setzen war verpönt, auf Konflikte wurde verzichtet, Konkurrenzerleben und Enttäuschungen galt es zu vermeiden. Die Folgen waren bekanntlich nicht ganz nach Wunsch. „Narziß und Schmollmund“ nannte der Spiegel im vergangenen Jahr die typischen Vertreter der neuen Jugend - überaus selbstbezüglich, lange ziellos, schnell unzufrieden. Die pauschale Kritik der Disziplin müssen wir heute teuer bezahlen - mit den vielfältigen Opfern der Disziplinlosigkeit. Erziehung ohne Grenzen hat in der Regel eben nicht zu unbegrenzten Fähigkeiten geführt, sondern mündete allzuschnell in grenzenlose Gewalt. In dieser Hinsicht steht Umkehr umso dringender an, als unsere Gesellschaft in weiten Teilen recht vaterlos (oder zumindest vaterarm) geworden ist. Damit sind nicht nur die vielen alleinerziehenden und mehrfachbelasteten Mütter gemeint, sondern auch die noch zahlreicheren verunsicherten Väter - und in einem übertragenen Sinne all’ die erzieherischen Einflußfaktoren, die man früher einmal väterlich nannte, und die etwas mit Grenzsetzungen, Entbehrungen und Herausforderungen zu tun haben. Dabei ist - die Beispiele haben es gezeigt - maßvolle erzieherische Strenge etwas, das Heranwachsenden hilft, eigene Stärke zu entwickeln! Pädagogische Strenge als Entwicklungshilfe ein für viele heute ketzerischer, gleichwohl unbedingt zu aktualisierender Gedanke. Und er paßt so gut zur alten Hauptbedeutung des Wortes, die keineswegs anrüchig ist, sondern Eigenschaften wie stark, tapfer oder tatkräftig bezeichnet. Auch der weithin geschätzte Hartmut von Hentig hat sich übrigens vor nicht allzulanger Zeit öffentlich zum Thema Strenge geäußert: Er finde „das Gerede von der notwendigen Strenge schlichtweg dumm“. Das war ein wenig mißverständlich für diejenigen, die von Hentig nur aus Reden und Schriften kennen. Dabei hat seine Schulpraxis immer deutlich werden lassen, daß er selbst Momente des Wohlwollens und des Anspruchs, aber eben auch der Disziplin in glücklicher Ausgewogenheit verkörperte. Insofern war es gut, daß ihm eine Kollegin in einem offenen Brief deutlich widersprach, ihr Kernsatz lautete: „Wer erzieht, ist mitunter unbequem - also auch schon ‘mal unbeliebt!“ Das ist es, was wir als Erzieher vielleicht am ehesten verlernt haben: Mit Gelassenheit gelegentlich unbeliebt zu sein bei den zu Erziehenden. Ein Großteil der 68er-Generation hat allen möglichen Autoritäten Widerstand geschworen, kann aber Kindern oft nur wenig entgegensetzen. Das ist es aber, was gute Eltern und gute Lehrer neben der liebevollen bzw. fachlichen Zugewandtheit auch besitzen müßten: eine gewisse Unabhängigkeit von den lieben Kleinen und Großen. Gut Freund sein mit Kindern, das ist eine schöne Seite der pädagogischen Medaille - ihr standfestes Gegenüber bleiben aber die wichtige andere. Erst aus dieser Ambivalenz können Tugenden erwachsen. Das pädagogische Lagerdenken überwinden Haben wir also auf breiter Front verlernt zu erziehen? Wir haben gesehen, daß die Antwort vielfältige Facetten besitzt. Wenn Sie sich nur zwei Dinge heute abend merken wollen, dann vielleicht diese: Wir tun uns einerseits nicht leicht damit, wirkliche Nähe zu unseren Kindern herzustellen, also mitzubekommen wie es ihnen tatsächlich geht. Und noch viel schwerer fällt es uns, einen Gegensatz zu ihnen ruhig auszuhalten, also ihren Ärger oder ihr Wehklagen. Wer aber gerne ein wenig mehr mitnehmen möchte, dessen Resümee könnte sein: In dreifacher Hinsicht sollten wir unseren Umgang mit Kindern und Jugendlichen neu akzentuieren: Mehr Aufmerksamkeit! Mehr Herausforderungen! Mehr Autorität! Diese Formel sollte nicht als Plädoyer für eine neue „Durchgriffsmentalität“ verstanden werden. Sie ist allerdings eine entschiedene Absage an pseudomoderne „Identifizierungsgesinnung“, diese historisch verständliche, mittlerweile aber überholte, und heute geradezu gefährliche Überreaktion auf pädagogische Ideologien aus Kaiserzeit und Nazistaat. Nicht nur die Schwarze Pädagogik hat sich an vielen Kindern vergangen, indem sie deren Individualität nicht respektierte und deren Willen zu brechen suchte. Auch viele Auswüchse der Reformpädagogik haben der Jugend nicht gut getan: Erwachsene haben sich aus der Erziehung zu sehr zurückgezogen und die Jugend damit fragwürdigen Kräften in peer-group und Medienwelt ausgeliefert. Wer zu früh allein gelassen wird, ist aber schlichtweg überfordert. Und genau das ist die heikle Grundbefindlichkeit vieler Heranwachsender heute: Sie fühlen sich einsam, ohne Ziel, nicht gebraucht. Projekte aller Art - in der Schule, in der Jugendarbeit - können diese Grundstimmung punktuell übertünchen, nicht aber grundsätzlich beheben. Drogen aller Art präsentieren sich genau hier als Scheinlösung - und haben eben deshalb Hochkonjunktur. ‘Verweigerte Erziehung’ hat eben unweigerlich Folgen. Die Spitze dieses Eisbergs haben uns Pisa und Erfurt gezeigt. Die Zeit drängt also, aus Hitlers langem Schatten über der Pädagogik herauszutreten. Und dabei steht weitaus mehr als nur unser pädagogisches Eros auf dem Spiel: Erstens geht es keineswegs nur darum, daß unsere Kinder und Jugendlichen heute zufriedener sein und bessere Noten oder Arbeitsplätze bekommen können. Sie sollen auch uns zur Seite stehen können, wenn wir einmal hilfsbedürftig geworden sind, sei es durch ihre Sozialversicherungsbeiträge, sei es durch pflegende Betreuung. Eine Generation aber, die etwa nicht gelernt hätte sich anzustrengen, würde ihre gealterten oder gebrechlichen Vorfahren nur ungerne lange durchfüttern wollen, ob nun die eigenen Eltern zu Hause oder fremde alte Menschen im Krankenhaus. Zweitens ist uns vermutlich auch der Fortbestand demokratischer Zustände in unserem Land nicht gleichgültig: Ein freiheitlicher Rechtsstaat kann aber nur bestehen, wenn seine Mitglieder gelernt haben, vernünftige Regeln zu akzeptieren, auch wenn sie ihnen einmal nicht in den privaten Kram passen. Sie werden es gemerkt haben: Worüber ich heute zu Ihnen gesprochen habe, das war auch der Versuch, das Lagerdenken zwischen vermeintlich altbackener und angeblich moderner Erziehung zu überwinden - antiautoritäre Verwahrlosung also zu vermeiden, ohne in autoritäre Härte zurückzufallen. Man könnte das vielleicht als den dritten Weg in der Pädagogik bezeichnen. Ich danke Ihnen, daß Sie mir so aufmerksam auf diesem gefolgt sind. Literaturhinweise: Adler, Alfred: Kindererziehung. Frankfurt 1976 Ahrbeck, Bernd: Konflikt und Vermeidung. Psychoanalytische Überlegungen zu aktuellen Erziehungsfragen. Neuwied 1997 Bergmann, Wolfgang: Gute Autorität. München 2002 Biddulph, Steve: Das Geheimnis glücklicher Kinder. München 1999 Biddulph, Steve: Jungen! Wie sie glücklich heranwachsen. München 1998 Bröckelmann, Wilfried und Felten, Michael: „Sind Sie streng?“ Zum Wandel von Abstand und Differenz in pädagogischen Beziehungen. In: Pädagogik, Heft 11/2002, S. 23-26 Elschenbroich, Donata (Hrsg.): Anleitung zur Neugier. Grundlagen japanischer Erziehung. Frankfurt 1996 Elschenbroich, Donata: Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder die Welt entdecken können. München 2001 Felten, Michael: Kinder wollen etwas leisten. Wie Eltern und Lehrer sie dabei unterstützen können. München 2000 Felten, Michael (Hrsg.): Neue Mythen in der Pädagogik. Warum eine gute Schule nicht nur Spaß machen kann. Donauwörth 1999, 2. Auflage 2001 Frech-Becker, Cornelia: Fördern heißt Fordern. Frankfurt 1995 Gaschke, Susanne: Die Erziehungskatastrophe. Kinder brauchen starke Eltern. München 2001 Giesecke, Hermann: Pädagogische Illusionen. Lehren aus 30 Jahren Bildungspolitik. Stuttgart 1998 Giesecke, Hermann: Wozu ist die Schule da? Die neue Rolle von Eltern und Lehrern. Stuttgart 1996 Ladenthin, Volker: Vorläufige Bemerkungen zur Schuldisziplin. In: Engagement, Heft 1/2002, S. 25 - 30 Myhre, Reidar: Autorität und Freiheit in der Erziehung. Stuttgart 1991 Rehfuß, Wulff D.: Bildungsnot. Hat die Pädagogik versagt? Die Fehler von gestern und die Aufgaben von morgen. Stuttgart 1996, 2. Auflage 1997 Schwarz, Bernd und Prange, Klaus (Hrsg.): Schlechte Lehrer/innen. Weinheim 1997 Wunsch, Albert: Die Verwöhnungsfalle. München 1999 Wunsch, Albert: Abschied von der Spaßpädagogik. München 2003 Ziehe, Thomas: Schule und Jugend - ein Differenzverhältnis. In: Neue Sammlung, Heft4/1999, S. 619-629