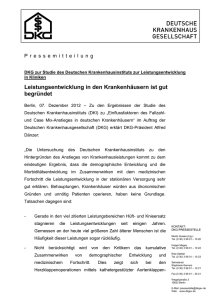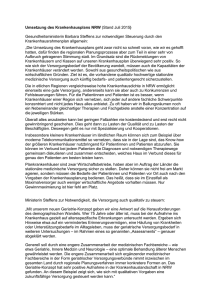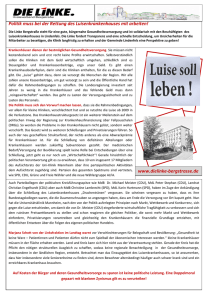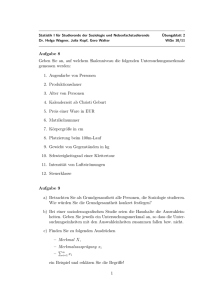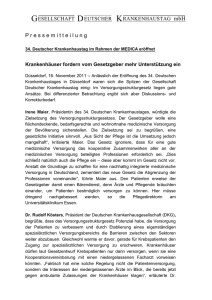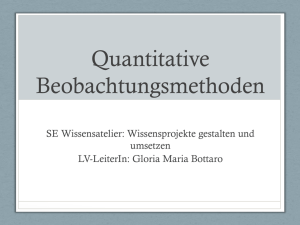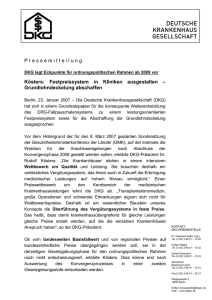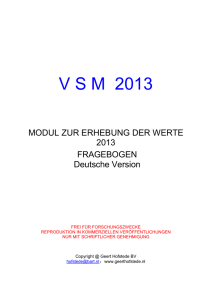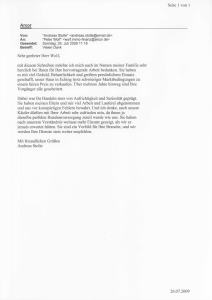Seminararbeit im Schwerpunkt Marketing
Werbung

Seminararbeit im Schwerpunkt Marketing Primärforschung im Rahmen der Studie „Wege für Krankenhäuser zur Gewinnung internationaler Patienten“ Seminararbeit von Stefanie Wolf SS 2004 Die Primärforschung 1 Gliederung Seminararbeit im Schwerpunkt Marketing .......................................................................... 1 1 Gliederung ................................................................................................................... 2 2 Einleitung ..................................................................................................................... 3 3 Expertenbefragung ...................................................................................................... 4 3.1 Die Experten ......................................................................................................... 4 3.2 Erstellung der Expertenfragebögen ...................................................................... 5 3.3 Die Ergebnisse der Befragung .............................................................................. 5 3.3.1 Statistik zu „Antworten und Absagen“ ............................................................ 5 3.3.2 Auswertung Deutschland ............................................................................... 6 3.3.3 Auswertung Schweiz ................................................................................... 11 4 Operationalisierung und Thesengenerierung ............................................................. 14 4.1 Operationalisierung............................................................................................. 15 4.2 Thesengenerierung............................................................................................. 17 5 Fragebogen ............................................................................................................... 18 5.1 Preversion des Fragebogens .............................................................................. 18 5.2 Pretest des Fragebogens ................................................................................... 20 5.3 Überarbeitung und Korrektur .............................................................................. 20 5.4 Endversion Fragebogen ..................................................................................... 21 6 Erstellung des Sample Plan ....................................................................................... 21 6.1 Definition der Grundgesamtheit .......................................................................... 22 6.2 Festlegung des Auswahlverfahrens .................................................................... 24 6.2.1 Vollerhebung oder Teilerhebung ................................................................. 24 6.2.2 Repräsentativität der Stichprobe ................................................................. 24 6.2.3 Auswahlverfahren – Quotenauswahl ........................................................... 25 6.2.4 Auswahl der zu befragenden Krankenhäuser .............................................. 26 7 Rücklauf bei der Befragung und Vorgehensweise ..................................................... 26 7.1 Rücklauf Deutschland ......................................................................................... 26 7.2 Rücklauf Schweiz ............................................................................................... 28 7.3 Vorgehensweise bei der Befragung .................................................................... 28 8 Resumée ................................................................................................................... 29 Stefanie Wolf 2 Die Primärforschung 2 Einleitung In der Marketingforschung erfolgt die Primärforschung stets nach der Sekundärforschung. Der Unterschied zwischen Sekundär – und Primärforschung ist, dass es sich bei der Primärforschung um die Gewinnung originärer Daten handelt, während man bei der Sekundärforschung auf bereits erhobene Daten zurückgreift. Dies stellt eine optimale Ergänzung dar, falls die Informationen, die aus der Sekundärforschung gewonnen werden, nicht ganz zutreffend bzw. ausreichend sind. Auch zur Erarbeitung der Studie „Wege für Krankenhäuser zur Gewinnung internationaler Patienten“ wurden Daten durch Primärforschung gewonnen. Zuerst wurde eine Expertenbefragung durchgeführt, um das Thema genauer zu konkretisieren. Als nächstes erfolgte die Operationalisierung, um später die Erstellung des Fragebogens zu erleichtern. Gleichzeitig wurden auch Thesen generiert, die durch das Auswertungsteam überprüft wurden. Als nächstes wurde ein Fragebogen erstellt. Um festzustellen, an wie viele und welche Krankenhäuser der Bogen verschickt werden sollte, wurde im Anschluss daran der Sample Plan aufgestellt. Außerdem werden im letzen Kapitel noch die Vorgehensweise der Befragung und einige wichtige Daten der Befragung bzgl. Deutschland sowie der Schweiz präsentiert. Die einzelnen Schritte der Primärforschung und deren Ergebnisse sowie die Ergebnisse der Befragung werden im Folgenden näher beschrieben. Stefanie Wolf 3 Die Primärforschung 3 Expertenbefragung Um von Anfang an Expertenmeinungen in die Projektarbeit mit einzubeziehen, wurde eine Expertenbefragung durchgeführt. Ziel der Expertenbefragung war es, für das sekundäre Marktforschungsteam das Thema und die Aufgabenstellung besser zu erfassen und zu konkretisieren, da bei Projektstart die Aufgabenstellung noch nicht klar umrissen war. Ursprünglich lautete der Projektauftrag, noch relativ vage: „Identifikation und Analyse möglicher strategischer Kooperationsformen für Krankenhäuser zur Gewinnung internationaler Patienten“ Außerdem sollte die Expertenbefragung dem primären Marktforschungsteam die Erstellung des Fragebogens erleichtern. Als Ergebnis der Expertenbefragung sollten spezielle Themen wie Kooperationen zwischen Krankenhäusern, Vermittlung und Segmentierung internationaler Patienten sowie quantitative Angaben hierzu, aber auch Möglichkeiten zur Segmentierung von Krankenhäusern, beantwortet werden können. Die Expertenfragebögen, die ausgefüllt und zurückgesendet wurden, enthielten erste wichtige Informationen, welche die nachfolgenden Schritte der Erhebung stark erleichterten. Bei der Erstellung des Fragebogens konnten zum Teil die Antworten der Experten als Antwortkategorien übernommen werden. Außerdem kristallisierte sich die endgültige Form des Projektauftrages heraus. Dieser lautete: „Analyse indirekter Wege für Krankenhäuser zur Gewinnung von internationalen Privatpatienten 3.1 Die Experten Da für das Projekt ausschließlich der deutsche und schweizerische Markt betrachtet wurde, recherchierte man lediglich dort nach entsprechenden Experten. Die Expertenliste für Deutschland bestand unter anderem aus Beratungsunternehmen, die speziell auf dem Gebiet „Kooperationen zwischen Krankenhäusern“ Beratungsleistungen anbieten. Neben Privatkliniken, sind sehr viele Universitätskliniken vertreten sowie einige kleinere Krankenhäuser, die mindestens eine Bettenanzahl von 400 erreichen und internationale Patienten behandeln. Des Weiteren wurden einige Vermittlungsagenturen und sonstige Organisationen, die unter Anderem Dienstleitungen für internationale Patienten anbieten (z.B. HanseMed), befragt. Die Experten aus der Schweiz kamen aus einigen Privatkliniken, Universitätsspitälern und ebenso aus ein paar (Kanton-)Spitälern. Leider waren für den schweizerischen Markt nur wenige Vermittlungsagenturen bekannt, die befragt werden konnten. Stefanie Wolf 4 Die Primärforschung 3.2 Erstellung der Expertenfragebögen Bei der Expertenbefragung wurden standardisierte Fragebögen verwendet, da die Befragung schriftlich durchgeführt wurde und der Umfang der Fragen für ein telefonisches Interview zu groß bzw. zum Teil nicht sofort zu beantworten gewesen wäre. Standardisiert bedeutet, dass die Antwortmöglichkeiten vorgegeben waren und die Reihenfolge der Fragen feststand. Für Experten aus Deutschland und der Schweiz, mit denen zuerst telefonisch Kontakt aufgenommen wurde, erstellte man insgesamt vier verschiedene Fragebögen: Für Krankenhäuser, Vermittlungsagenturen, Organisationen und sog. Spezialfragebögen. Letztere wurden dem jeweiligen Experten entsprechend angepasst, um eine doppelte Erwähnung der Fragen zu vermeiden, wenn sie bereits im Vorfeld telefonisch geklärt wurden. Die Fragebögen deckten spezielle Themen wie Kooperationen zwischen Krankenhäusern, Vermittlung und Segmentierung internationaler Patienten sowie quantitative Angaben ab. Die Anzahl der Fragen und Fragenformulierungen weichen bei den unterschiedlichen Expertengruppen, (Krankenhäuser, Vermittlungsagenturen, Organisationen) etwas voneinander ab. Die Fragebögen wurden den Experten per E-mail oder Fax zugesandt. 3.3 Die Ergebnisse der Befragung An Experten aus Deutschland, wurden insgesamt 42 Fragebögen versendet. In die Schweiz wurden insgesamt 13 Fragebögen per E-Mail geschickt. Von den insgesamt 55 versendeten Fragebögen, kamen leider nur 15 ausgefüllt zurück. Folgende Statistik soll einen Überblick über die zur Auswertung stehenden Fragebögen geben. 3.3.1 Statistik zu „Antworten und Absagen“ Deutschland: 12 ausgefüllte Fragebögen Beratungsunternehmen Privatkliniken Universitätskliniken Krankenhäuser Vermittlungsagenturen Sonstige Organisationen - 3 Antworten von 6 Befragten - 1 Antworten von 4 Befragten - 3 Antworten von 22 Befragten - 0 Antworten von 4 Befragten - 3 Antworten von 12 Befragten - 2 Antworten von 2 Befragten Schweiz: 3 ausgefüllte Fragebögen Privatkliniken Universitätsspitäler (Kanton-) Spitäler Vermittlungsagenturen Stefanie Wolf - 1 Antwort von - 1 Antwort von - 1 Antwort von - 0 Antworten von 5 Befragten 4 Befragten 2 Befragten 2 Befragten 5 Die Primärforschung 3.3.2 Auswertung Deutschland Im Folgenden werden die stichpunktartig präsentiert. Ergebnisse der Expertenbefragung in Deutschland 3.3.2.1 Kernaussagen der Krankenhäuser Hier sind die Expertenfragebögen der Universitätsklinik München-Großhadern, des Universitätsklinikum Carl Gustav Carus and der TU Dresden und der Universitätsklinik Rostock ausgefüllt zurückgekommen. Anhand des Fragebogens der Universitätsklinik München-Großhadern, der vom Informationsgrad am aufschlussreichsten war, werden die Kernaussagen nachfolgend demonstriert. München-Großhadern (2.448 Betten, 510.000 Patienten) - Internationale Patientengewinnung über – Botschaften, Patientenvermittler, Generalkonsulate (durch Gesundheitsbüros z.B. Gesundheitsbüro der Vereinigten Arabischen Emirate) - Zustandekommen der Zusammenarbeit – durch Zuweisung von Patienten (Botschaften, Patientenvermittler), Mund-zu-Mund-Propaganda (direkte Kontaktaufnahme durch Patienten) - Kooperationen Vertrag mit German Health, weitere Partner Med.Dienst f- Patientenbetreuung, GerMedic; Botschaften entscheiden von Fall zu Fall über Zuweisung, andere Vermittlungsagenturen entscheiden über Kriterien wie z.B. Krankheitsbild, Wartezeit… Die Kooperationspartner sind auf die Klinik gekommen – Initiative eines Staatsministeriums Keine weiteren Kooperationen Die Kooperationspartner wählen nach Kriterien wie, Spezialisierung, Krankheitsbild, Wartezeit, Seriosität,… - Segmentierung – nicht vorhanden - Serviceangebot für int. Patienten – nicht speziell; German Health hat aber ein Büro um sich bei Bedarf um die Belange der int. Patienten zu kümmern. Quantitative Angaben 2003 484 internationale Patienten pro Jahr 3.843.803,89 € Umsatz Woher: Vereinigte Arabische Emirate 31,39 %, Saudi-Arabien 11,85 %, Österreich & Russland zu je 6,44 %, Italien 5,61 % …. Selbstzahler : 47,94 %, Botschaften 40,86 %, Ausländische Kassen 11,2 % Lukrative wenn, nicht über Sozialversicherungsabkommen abgerechnet (Einnahmen außerhalb des Budgets) Stefanie Wolf 6 Die Primärforschung - Stärken des KH Fachübergreifende multifunktionale Versorgung Sehr hoher Qualitätsstandart der Behandlungen, ärztliche Kompetenz Engagierte Mitarbeiter Internationaler Ruf & Zufriedenheit der Patienten - Verbesserungspotential Dolmetscherdienst / Übersetzungsdienst (hat z.B. HH schon) Eigene Stationen für int. Patienten Bessere Abstimmung der Küche auf Essgewohnheiten Service… - Probleme mit internationalen Patienten Abrechnung (fristgerechte Zahlung von Botschaften & Vermittlern) Kulturelle Probleme - Auswahlkriterien / Anforderungen seitens int. Patienten und Patientenvermittlern fachübergreifende multifunktionale Versorgung, Guter Ruf & Kompetenz, Krankheitsbild, Wartezeiten… 3.3.2.2 Kernaussagen privater Krankenhäuser Der Fragebogen wurde auch an Experten in Privatkliniken verschickt. Im Folgenden nun die Aufschlüsselung der Ergebnisse der Privatklinik – Alphaklinik. Privatklinik – Alphaklinik (20 Betten, keine Angabe zu Patienten) - Internationale Patientengewinnung – über Patientenvermittler - Zustandekommen der Zusammenarbeit – über Mund-zu-Mund Propaganda - Kooperationen mit Vermittlungsagenturen – Europe Health - Serviceangebot für int. Patienten – Essen von 5 Sterne Hotel, nur Einbettzimmer in 5 Sterne Kategorien mit Plasma-Fernseher etc.. Quantitative Angaben 2003: - Wie viele int. Patienten – ca. 300 pro Jahr - Woher – Golf-Anrainerstaaten: 40% Kuwait, 20% Saudi Arabien, 20% VAE - Bezahlung – 50% Selbstzahler, 50% Botschaften - Warum internationale Patienten – international ausgerichtete Klinik - Stärken des KH Alle Sprachen vertreten Stefanie Wolf 7 Die Primärforschung Patient = König 5 Sterne Ambiente - Verbesserungspotential – keine Angabe - Probleme mit internationalen Patienten – keine 3.3.2.3 Kernaussagen der Vermittlungsagenturen Hierzu sind die Expertenfragebögen der Vermittlungsagenturen „MedGermany“, „RelocTeam“ und von „Ars Medico Mundi“, ausgefüllt zurückgekommen. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Agenturen in Stichpunkten zusammenfassen. - Zusammenarbeit mit Kliniken Inländische Akut-, Universitäts-, Privat- und Rehakliniken; je circa 50% 20 % Akut-, 10 % Universitäts-, 70 % Privat-, 0 % Rehakliniken - Zustandekommen der Zusammenarbeit Patient wird auf Agentur aufmerksam durch Mund-zu-Mund- Propaganda, Ärzte in Agenturen, Botschaften, etc. Zusammenarbeit mit Versicherungen, internationalen Patientenvermittlern, Reisebüros, Ärzte in Kliniken und Praxen, Mund-zu-Mund-Propaganda bereits betreuter Patienten - Segmentierung internationaler Patienten nach Herkunftsland (siehe unten), Einkommensschichten (Privatpatienten, Nachweis, dass Behandlungskosten geleistet werden können) nach Medizinischen Krankheitsbildern (2 Varianten): Schmerztherapie 30% Gynäkologie 10% Orthopädie 30% Orthopädie 30% Herzchirurgie 20% Herzchirurgie 40% Sonstiges 20% Neurologie / Onkologie je 10% Sonstiges: Visumspflicht - Serviceangebot – für int. Patienten – nach kulinarischen und kulturellen Bedürfnissen Quantitative Angaben 2003 - Anzahl der vermittelten int. Patienten – Zwischen 50 und 100 / pro Jahr (Ars Medico Mundi) ca. 75 (RelocTeam) - Woher – Arabische Länder 40 %, GUS-Staaten 20 % … Stefanie Wolf 8 Die Primärforschung - Bezahlung – Hauptsächlich Selbstzahler 80% Selbstzahler, 20% Versicherung - Probleme mit internationalen Patienten Das System der Fallpauschalen, dass ab Januar 2004 für alle (öffentlichen) Kliniken und Universitätskliniken bindend ist, ist nicht bundeseinheitlich, was eine Voraus-Kalkulation der Behandlungskosten erschwert. - Auswahlkriterien / Anforderungen Seitens Vermittlungsagenturen: Attraktivität von Unikliniken, Spezialisierung, Schwierigkeitsgrad der OP, Infrastruktur (Stadt, Umland der Klinik) Seitens internationaler Patienten: Attraktivität von Unikliniken, Spezialisierung, Behandlung möglichst vieler Krankheitsbilder, Infrastruktur (Stadt, Umland der Klinik, etc.) 3.3.2.4 Kernaussagen der Organisationen Es sind die Expertenfragebögen folgender Organisationen ausgefüllt worden: Beratungsunternehmen, wie Hospital Management GmbH, Institut für Gesundheitsökonomik, Strategie Team Candidus Sonstige Organisationen, wie HanseMed (DL für int. Patienten), Kuratorium zur Förderung deutscher Medizin im Ausland e.V. Die wichtigsten Ergebnisse sind in Stichpunkten zusammenfassen gefasst. - Internationale Kooperationsmodelle Krankenhaus + ausländisches Krankenhaus Kooperationen auf ärztlicher Ebene (z.B. Austausch von Fachärzten) Medizinische Spezialprojekte (Versorgung spezieller Krankheitsbilder, z.B. Transplantationen) Vereinbarungen zwischen Kostenträgern im Ausland und inländischen Kliniken Übernahme von grenznahen Kliniken zur Umsetzung der integrierten Versorgung Humanitäre Projekte / Aktivitäten Übernahme von ausländischen Patienten zum Abbau von Wartezeiten Krankenhaus + Vermittlungsagenturen Krankenhaus + Kommunen Krankenhaus + Regierungen / Ministerien / Botschaften - Auswahl Kooperationspartner spezielle Operationsmethoden und –verfahren Spezialisierung einzelner Fachabteilungen Ausstattung der leistenden Kliniken (Patientenzimmer, Therapiebereiche, aber auch Sonderleistungen wie z.B. Wellness / Hotellerie) klinisches Leistungsspektrum insgesamt Spezialisten Politische Lage Stefanie Wolf 9 Die Primärforschung Räumliche Lage (Infrastruktur) bereits bestehende Netzwerke (z.B. mit anderen Kliniken) Nach Bedarf / Defizite im Bereich der Versorgung - Zusammenarbeit mit Kooperationspartner Internationale Kongresse, Tagungen, Messen Präsenz vor Ort für Direkt-Kontakte Internationale medizinische Fachforen Facharztaustausch Verträge mit Vermittlern Internet / mehrsprachige Homepage, Suchmaschinen Anzeigenschaltung (kostenaufwendig, nicht zielgruppenorientiert) Durch Aktivitäten auf Verbandsebene (z.B. Krankenhaustag, VKD) bestehende internationale Städtepartnerschaften berufsgruppenspezifische Aktivitäten humanitäre Aktivitäten / Projekte Über Kuratorium (Klinikzusammenschlüsse) - Segmentierung internationaler Patienten nach Herkunftsland Medizinische Krankheitsbilder Stand der medizinischen Versorgung / Behandlungsqualität im Herkunftsland Wartelisten / Behandlungsmöglichkeiten im Herkunftsland Kulturelle und religiöse Bedürfnisse Können kulturelle und soziale Ansprüche / Bedürfnisse erfüllt werden? Können Leistungen bezahlt werden? Gehobene Einkommensschichten Kostenübernahme (z.B. durch Botschaften) Persönliche Verbindung zum „behandelnden Land“ (z.B. Deutschland) - Segmentierung Kliniken ab 400 Betten Patientenentwicklung, -anzahl (ab 10.000 Patienten pro Jahr) Spezialisierungen Leistungsprofil bestehende Kooperationen internationale Reputationen der "eigenen" Ärzte / Ruf der Klinik Infrastruktur und Standort der Klinik Stand der Informationstechnologien (KIS, RIS/PACS, Vernetzung, Internetpräsenz) Stand der DRG / AR-DRG Medizintechnik Ausstattung (u. a. besondere klinische Angebote) Hotelleistungen (Service für Angehörige) Krankheitsbilder: Erkrankungen des Bewegungsapparates, Kreislaufsystem, Onkologische Erkrankungen, Erkrankungen im Bereich des Sehvermögens, Orthopädie, Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie, Urologie Patientenzufriedenheit Stefanie Wolf 10 Die Primärforschung - Auswahlkriterien / Anforderungen Seitens Vermittlungsagenturen: Erfahrungen mit ausländischen Patienten Fachspezialisierung / Therapien / Diagnosemöglichkeiten Geschultes / fremdsprachiges Personal Ansprechpartner für alle Abläufe in der Klinik, Projektkoordinator, der von der Rezeption über die einzelnen Abteilungen bis hin zur Abrechnung jedes individuellen Patienten zuständig ist Attraktivität des Hauses / Erscheinungsbild / Service mehrsprachige Infobroschüren Infrastruktur (z.B. Anbindung an Flughafen oder ICE-Bahnhof) Internationale Kapazitäten / Fachärzte / Professoren Seitens internationaler Patienten: wie zuvor… Kosten für die Behandlung Dauer der Behandlung Wartezeit Service (des Krankenhauses, d.h. der Ärzte, des Pflegepersonals, Verpflegung) Betreuung des Patienten (24 Stunden!) von der Vorbereitungsphase, der Ankunft bis hin zur Abreise / Abrechnung Betreuung der Begleitpersonen (Programm / Unterstützung während des Aufenthaltes) 3.3.3 Auswertung Schweiz Im Folgenden werden nun die ersten Ergebnisse der Expertenbefragung in der Schweiz stichpunktartig präsentiert und die jeweiligen Quellen bzw. Experten genannt, auf welchen die Ergebnisse beruhen. 3.3.3.1 Kernaussagen der Krankenhäuser Hier sind die Expertenfragebögen der Universitätsklinik Balgrist, der Privatklinik Hirslanden Holding AG (Verbund 12 Privatkliniken) und des Kantonsspitals Bruderholz, ausgefüllt zurückgekommen. Die Wichtigsten Informationen wurden nachfolgend zusammengefasst. - Internationale Patientengewinnung über Patientenvermittler diese wiederum mit Touristikbüros, Firmen etc. in ihren Akquisitionsländern Botschaften Patientenkontakt via Internet Internationale Großfirmen persönlicher Kontakt der Chefärzte zu Berufskollegen im Ausland Stefanie Wolf 11 Die Primärforschung (Mund-zu-Mund Propaganda) - Zustandekommen der Zusammenarbeit – Mund-zu-Mund-Propaganda, über Internet Vermittler, - Kooperationen Kooperation mit Universitätskliniken Vermittleragenturen Ausländische Krankenversicherer Administrative Zentren für ausländische Krankenversicherer Botschaften Internationale Großfirmen - Kooperationspartner BUPA PPP AXA Healthcare Blue Assistance World Access International Health Insurance Allianz Worldwide Care Aetna Global Benefit UBS AG - Zustandekommen der Zusammenarbeit Anfragen seitens Kooperationspartner durch Mund-zu-Mund Propaganda Vermittler genereller Bekanntheitsgrad des Klinikums - Weitere Kooperationen geplant? Weitere Vermittleragenturen Service-Centers internationaler Firmen - Auswahl Kooperationspartner Ähnliche Kundensegmente (Privatkunden) Zur Abdeckung medizinischer Dienstleistungen (z.B. Transplantationen, Pädiatrie) Spezialisierung - Segmentierung internationaler Patienten nach Herkunftsland (siehe unten) Einkommensschichten (mittlere bis obere Einkommen) Häufigste Krankheitsbilder: Orthopädie Herzchirurgie bzw. Kardiologie - Serviceangebot für int. Patienten Dienstleistungen für nicht Deutsch- oder Französisch sprechende Patienten (Dolmetscher, Zeitungen) Betreuung vor und nach der Behandlung (z.B. Organisation von Hotel für Angehörige, Flughafentransfer, Organisation von verlängerten Aufenthalten in der Schweiz etc.) Stefanie Wolf 12 Die Primärforschung Betreuung der Angehörigen des Patienten in Einzelfällen Unterstützung bei der Nachbehandlung Quantitative Angaben 2003 - Wie viele internationale Patienten? Ca. 870 Halbprivat- und Privatpatienten mit Wohnsitz im Ausland (Hirslanden) Ca. 100 ausländische Patienten (Universitätsspital Balgrist) - Umsatz mit internationalen Patienten ca. 8 Mio. CHF = ca. 5 Mio. EUR (bei 1 CHF = 1,54 EUR) (Hirslanden) ca. 2 Mio. CHF = ca. 1,3 Mio. EUR (Balgrist) - Woher: Hirslanden Europa (ca. 80%) Libyen Saudi Arabien, Emirate Russische Föderation Balgrist 60 % Westeuropa 20 % Südosteuropa 10 % Afrika, Arabien 10 % Rest der Welt - Bezahlung Kassenpatienten 70%, Selbstzahler 30% - Wann ist ein internationaler Patient „lukrativ“? nach abzurechnender Leistung Patienten mit wenig Betreuungsintensität (deutscher- bzw. französischer Sprachraum) Patienten die bei Partner-Krankenversicherer versichert sind (reduzierter administrativer Aufwand) wenn keine Verlustrisiken bestehen Preise höher als einheimische Patienten die Vor- und Nachbehandlung in Einklang mit der Behandlung - Warum internationale Patienten Nachfrage ist vorhanden Fördert die Internationalisierung / Bekanntheitsgrad Diversifikation - Stärken des KH Breites medizinisches Angebot Akkurate Kostenabklärung im Vorfeld der Hospitalisation Grosses Netzwerk an Ärzten und Krankenhäusern schneller Zugang für Patienten zu Spezialisten Gute Betreuung vor-, während und nach dem Krankenhausaufenthalt - Verbesserungspotential persönlichere Betreuung in der entsprechenden Sprache durch Krankenhauspersonal während dem Aufenthalt schnellere Rechnungsstellung (im Idealfall beim Austritt des Patienten abgeschlossen) Stefanie Wolf 13 Die Primärforschung Klinikinformationsmaterial in mehreren Sprachen Mehr Maßnahmen zur Kundenbindung - Problem mit internationalen Patienten Ungeplante Kostenentwicklung Inkassoschwierigkeiten Grosse Erwartungshaltung an die medizinischen Leistungserbringer (VIP-Kunden) Zugang zum Versicherer vor Ort z. T. schwierig aufgrund Sprachprobleme - Auswahlkriterien / Anforderungen Seitens internationaler Patienten: Bekanntheitsgrad und Ruf des Klinikums Akkreditierte Ärzte Spezialisierung Interdisziplinäre Zentren Seitens Patientenvermittlern: Kundenwunsch in der Klinik behandelt zu werden Speditive Kostenabklärung / Offertenstellung Terminabsprachen werden durch Call Center organisiert rascher Zugang zu Spezialisten und Op-Terminen Zentrale Informationsstelle über die Kliniken Unterstützung bei Zusatzleistungen (Visa-Anträgen etc.) 3.3.3.2 Kernaussagen der Vermittlungsagenturen Es liegen leider keine ausgefüllten Fragebögen aus Vermittlungsagenturen in der Schweiz vor. 4 Operationalisierung und Thesengenerierung Als nächster Schritt in der Erhebung erfolgte die Operationalisierung und Thesengenerierung. Die Operationalisierung der Aufgabenstellung muss während eines Forschungsprojektes durchgeführt werden, um einen sinnvollen Fragebogen erstellen zu können. Dies setzt eine zweckmäßige Aufschlüsselung des Ziels und der Problematik der Aufgabenstellung voraus. Die Themenstellung muss also definiert, eindeutig und anschaulich werden. Dies wiederum kann durch die Operationalisierung des Projektgegenstands erreicht werden. Bei der Operationalisierung überlegt man eingangs, in welche Oberpunkte das Thema segmentiert werden kann. Anschließend werden die Begriffe bzw. Probleme in Indikatoren unterteilt, welche zum Schluss durch Variablen genauer beschrieben werden. Stefanie Wolf 14 Die Primärforschung Begriff / Problem Indikator Variablen Indikator Variablen In diesem Projekt gelang es nicht vollends, die vorgegebene Reihenfolge der Erhebung einzuhalten. Die Operationalisierung musste im Nachhinein noch an den bereits fertiggestellten Fragebogen angepasst werden. (Im Idealfall wird der Fragebogen auf Basis der bereits abgeschlossenen Operationalisierung erstellt.) ies ist jedoch ein häufiges Problem bei der Durchführung einer Studie und hat keinerlei Qualitätseinbrüche zur Folge gehabt. In unserem Fall ergaben sich während der Erstellung des Fragebogens noch etwaige Änderungen, weshalb einige Punkte der ursprünglichen Operationalisierung nochmals geändert und an den „besiegelten“ Fragebogen angepasst werden mussten. 4.1 Operationalisierung Es sollten schon bald nach Projektstart erste Thesen gebildet werden, damit sich bei den Teilnehmern ein Gefühl für die Thematik entwickeln konnte. Es wurden also etwa 50 Thesen generiert bzw. Behauptungen aufgestellt, die nach eigenem Ermessen interessant für die Aufgabenstellung sein könnten. Dies waren lediglich die ersten Bausteine, auf denen Stück für Stück ein zunehmend komplexeres Operationalisierungsmodell aufgebaut wurde. Bis der konkrete Projektauftrag feststand und somit eine klare Aufgabenstellung vorhanden war, wurde die Operationalisierung stetig angepasst und verbessert. Mit Hilfe der Resultate der vorab durchgeführten Expertenbefragung haben sich schließlich folgende Begriffe bzw. Probleme herauskristallisiert: Demografie / Ausstattung / Struktur Krankenhaus Demografie Patienten Patientenakquisition Nachdem diese Begriffe herausgearbeitet wurden, musste nun versucht werden, sie anhand weiterer Indikatoren zusätzlich aufzuschlüsseln. Mit sogenannten Indikatoren werden die Begriffe genauer beschrieben. Stefanie Wolf 15 Die Primärforschung Indikatoren Indikator Begriff / Problem Demografie / Ausstattung / Struktur KH quantitativ qualitativ Demografie Patienten Patientensegmentierung Patientenbedürfnisse Patientenakquisition Direkte Wege Kooperationen Variablen Bei den Variablen mussten bis zur Fertigstellung der endgültigen Version am meisten Fingerspitzengefühl bewiesen werden und über Wochen hinweg immer wieder Änderungen vorgenommen werden. Hier war die (rückwirkende) Abstimmung mit dem Fragebogen besonders wichtig, da aufgrund der im Fragebogen vorkommenden Variablen später während der Auswertung festgestellt werden konnte, ob sich die ebenfalls generierten Thesen falsifiziert oder verifiziert haben. Die Variablen wurden anschließend noch durch Ausprägungen näher beschrieben. Operationalisierungsbeispiel: Variablen des Fragebogens Begriff / Problem Patientenakquisition Stefanie Wolf Indikator Direkte Wege • Ärztekontakte • Homepage • Weiterempfehlungen • Printmedien • Messeauftritte Ausprägungen Mehrsprachig 16 Die Primärforschung 4.2 Thesengenerierung Im Rahmen des Projektes wurden im Wesentlichen Zusammenhangshypothesen gebildet. Diese Thesen enthalten eine Aussage über den erwarteten Zusammenhang zwischen mindestens zwei Variablen. Jede generierte These verknüpft also zwei verschiedene Variablen der zuvor durchgeführten Operationalisierung. Beispielthese: Je mehrsprachiger die Homepage, desto mehr internationale Patienten werden gewonnen in Relation zu den gesamten Patienten.“ Hier werden die beiden Variablen „Homepage“ und „Patienten gesamt“ miteinander verknüpft. Wie bereits zuvor erwähnt, wurden bereits kurz nach Projektstart erste Thesen generiert. Dies erfolgte also vor der Operationalisierung. Die Thesen sollten Aussagen bzw. Behauptungen enthalten, die für den Projektauftrag interessant sein könnten. Die Generierung der Thesen wurde – mit der fortschreitenden Operationalisierung – immer konkreter. Für das Projekt sollten endgültig insgesamt 30 Thesen aufgestellt werden. Viele der anfänglich aufgestellten Thesen wurden allerdings nicht in die endgültige Ausführung übernommen, da sie die entsprechenden Kriterien (z.B. Prüfbarkeit, Relevanz, etc.) bzw. die Anforderungen nicht erfüllten. Bis zur endgültigen Fertigstellung wurden die Thesen mehrfach überarbeitet. Diese Aufgabe war dann mit Hilfe der abgeschlossenen Operationalisierung auch wesentlich einfacher zu bewältigen, da auf Basis der entwickelten Variablen nun aussagekräftige, relevante und prüfbare Thesen generiert werden konnten. Das Auswertungsteam wurde hierbei mit hinzugezogen, da für die anschließende Auswertung wesentliche Kriterien bei der Thesenbildung berücksichtigt werden mussten. Sie wurden untergliedert je nach Zugehörigkeit zu den entsprechenden Begriffen / Problemen und Indikatoren. Beispielthese: Demografie Patienten / Patientenbedürfnisse Werden eigene Stationen / Zimmer für internationale Patienten eingerichtet ist der Umsatz außerhalb des Budgets in Relation zum Gesamtumsatz höher Aufschlussreich bei der Bildung von Thesen ist, dass sie sich durch die Auswertung der Befragungsergebnisse falsifizieren oder verifizieren können. Stefanie Wolf 17 Die Primärforschung 5 Fragebogen Nach der Operationalisierung erfolgt die Erstellung des Fragebogens. Auch hier waren mehrere „Anläufe“ nötig, bis der Fragebogen in seiner Endversion stand. 5.1 Preversion des Fragebogens Durch die Einteilung des Themas in Begriffe/Probleme (siehe Operationalisierung) konnte ein Grobgerüst des zukünftigen Fragebogens geschneidert werden, das wie folgt aussah. A. A.Einleitung Einleitung B. B. AllgeAllgemeiner meiner Teil Teil 1.Demografie 1.Demografie des desKrankenKrankenhauses hauses C. C.Hauptteil Hauptteil D. D. SchlussSchluss- 2. 2.Demografische Demografische Angaben Angabenüber überPatienten Patienten teil teil 3. 3.Patientenbedürfnisse Patientenbedürfnisse 5.Trend 5.Trend 4. 4.Patientengewinnung Patientengewinnung Aus den Variablen der Operationalisierung und aus den Ergebnissen der Expertenbefragung wurden erste Fragen des Fragebogens für die jeweiligen Untersuchungsobjekte gebildet. Es ist wichtig, für jede Variable eine Frage im Fragebogen zu erstellen. Beispiele dazu: Begriff/Problem: Demografie/Struktur/Ausstattung des Krankenhauses Indikator: Quantitativ Variable: Trägerschaften (Frage 1.3.), Mitarbeiter (Frage 1.5.), Umsatz gesamt (Frage 1.8) Stefanie Wolf 18 Die Primärforschung 1.3 Welcher Art ist der Träger Ihres Krankenhauses? öffentlich privat gemeinnützig freigemeinnützig (kirchlich) 1.5 Wie viele Mitarbeiter beschäftigte Ihr Krankenhaus im abgelaufenen Kalenderjahr 2003? .............. Mitarbeiter (Anzahl auf Vollzeitkräfte umgerechnet) 1.8 Wie hoch war Ihr Gesamtumsatz (Patientenerlöse) im abgelaufenen Kalenderjahr 2003 (Bei mehreren Krankenhäusern bitte die Summe angeben)? ……………………………………. € Diese Vorgehensweise zog sich durch den ganzen Fragebogen. Für die Antwortkategorien konnte man teilweise Antworten aus der Expertenbefragung heranziehen. In der Expertenbefragung kam z.B. heraus, dass sich die internationalen Patienten hinsichtlich des Herkunftslandes einteilen lassen. Die Experten gaben an, die meisten internationalen Patienten stammten aus den Golf-Anrainer-Staaten, USA, Russland und Europa. In der Frage 2.1.wurde dies mit berücksichtigt und eingebaut. 2.1 Woher kommen die internationalen Patienten in Ihrem Hause (Bitte geben Sie Schätzungen an, falls keine exakten Zahlen zur Hand) ? 2.1.1) Golf-Anrainerstaaten ………. % USA ………. % Russland ………. % Europa ………. % Sonstige (mit jeweils prozentualen Anteilen): ……………………………………………………... In den Projektsitzungen wurden die ersten Versuche zur Diskussion gestellt und abgestimmt, welche Fragen im Fragebogen bestehen bleiben sollten, welche Fragen nicht relevant bzw. falsch erschienen und welche Fragen noch fehlten, um den Fragebogen fertig stellen zu können. Zusätzlich wurden Formatierungen und Grammatikfehler verbessert. Nach einigen Nachbesserungen und zusätzlichen Fragen stand die Preversion des Fragebogens fest. Stefanie Wolf 19 Die Primärforschung 5.2 Pretest des Fragebogens Nachdem die Preversion für den Fragebogen fertig gestellt war, musste der Fragebogen durch einen sogenannten „Pretest“ auf seine Verständlichkeit, Aussagekraft und Durchführbarkeit hin geprüft werden, bevor er für die repräsentative Befragung benutzt werden konnte. In diesem Pretest haben ausgewählte Befragte den Fragebogen kritisch betrachten und die Fragen beurteilt. Für diesen Test wurden Krankenhäuser ausgewählt, die schon bei der Expertenbefragung mitgewirkt hatten. Für die Schweiz testete und betrachtete kritisch Frau Pils, die Auftraggeberin vom Kantonspital Basel, den Fragebogen. Insgesamt wurde der Fragebogen an 5 Krankenhäusern pre-getestet. 5.3 Überarbeitung und Korrektur Nachdem die ausgewählten Experten die Fragebögen mit Ihren Kritiken und Anregungen zurückgeschickt hatten, wurden die Änderungsvorschläge überprüft und größtenteils auch umgesetzt. Es wurde beschlossen, für die Schweiz einen eigenen Fragebogen zu erstellen. Dieser Fragebogen unterschied sich zum Deutschen nur hinsichtlich der Geldeinheiten. Im Deutschen wurden EURO (€) angegeben und in der Schweiz Schweizer Franken (CHF). Auf die restlichen Änderungen wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen. Stefanie Wolf 20 Die Primärforschung 5.4 Endversion Fragebogen Unten stehende Graphik soll einen Überblick über das endgültige Fragebogengerüst mit Themengebiete geben. Der gesamte Fragebogen beträgt 12 Seiten. A. A.Demografische Demografische Daten Daten 1.1.Allgemeine AllgemeineAngaben Angaben B. B.Hauptteil Hauptteil 2.2.Demografische Demografische Angaben Angabenüber überPatienten Patienten I. Trägerschaft und Art I. Herkunftsland internationaler Patienten II. Bettenzahl und Umsatz II. Einteilung der Patienten hinsichtlich der Bezahlung C. C.Schlussteil Schlussteil 3.3.Patientenbedürfnisse Patientenbedürfnisse 5.5.Zum ZumSchluss Schluss I. Wichtigkeit und Realisierung von Kriterien zu Patientenbedürfnissen I. Risiken und Verbesserungspotenzial II. Informationen über ausländische Fachärzte II. Zukunftsaussichten III. Prozentualer Anteil der internat. Patienten in den Fachrichtungen III. Besonderheiten bei der Bedienung internationaler Patienten/arabischer Patienten 4.4.Patientengewinnung Patientengewinnung IV. Beurteilung der Kriterien für internationalen Patienten bei der Auswahl eines Krankenhauses I. Direkte Wege II. Kooperation mit Reha-Kliniken, Krankenhäusern/Versicherungen/ Krankenkassen, Vermittlungsagenturen, Botschaften/Ministerien/ Regierungen 6 Erstellung des Sample Plan Im nächsten Schritt des Marketingforschungsprozesses wurde der sog. Stichprobenplan (Sample Plan) erstellt. Der Stichprobenplan sagt aus, wie viele und welche Untersuchungssubjekte befragt werden müssen, damit die Studie repräsentativ ist. Bei der Erstellung eines Stichprobenplans muss man Entscheidungen über die Grundgesamtheit, die Größe der Stichprobe und das Auswahlverfahren treffen. Danach kann man schließlich die zu befragenden Elemente aus der Grundgesamtheit auswählen und mit der Befragung beginnen. Der Stichprobenplan umfasst im Wesentlichen folgende drei Schritte: Stefanie Wolf 21 Die Primärforschung Festlegung der Grundgesamtheit Festlegung des Auswahlverfahrens Auswahl der zu befragenden Krankenhäuser Abb. 1: Schritte des Stichprobenplans 6.1 Definition der Grundgesamtheit Zunächst wird bei der Erstellung des Stichprobenplans die Grundgesamtheit definiert. Grundsätzlich versteht man unter einer Grundgesamtheit (= Gesamtmasse) die Gesamtheit der Untersuchungssubjekte, über welche die geplante Marktforschung Daten liefern soll. Im vorliegenden Projekt waren das diejenigen Krankenhäuser, die bereits internationale Patienten haben bzw. deren Aufnahme in Zukunft planen. Das Vorgehen bei der Definition der Grundgesamtheit wird nun anhand des Beispiels Deutschland erläutert: Zunächst benötigten die Projektteilnehmer einen Überblick über den Krankenhausmarkt und dessen Segmentierung in Deutschland, um davon ausgehend die Grundgesamtheit zu bilden. Dieser Überblick ist im Folgenden dargestellt. allgemeine Krankenhäuser sonstige Krankenhäuser 1.995 245 196 49 ausschl. psychiatr. / psychiatr. u. neurol. Betten reine Tages- oder Nachtkliniken Abb. 2: Krankenhausmarkt in Deutschland (Stand: 2001) Quelle: http://www.bge.bund.de Stefanie Wolf 22 Die Primärforschung Aus der Expertenbefragung ergab sich, dass von den oben abgebildeten 2240 Krankenhäusern in Deutschland nur die allgemeinen Krankenhäuser relevant für die Untersuchung waren. Von diesen 1995 Stück haben allerdings nicht alle internationale Patienten bzw. planen deren Aufnahme. Demnach kamen laut Expertenaussage hierfür nur Krankenhäuser in öffentlicher und freigemeinnütziger Trägerschaft ab 400 Betten sowie Krankenhäuser in privater Trägerschaft ab 20 Betten in Frage. Somit konnte die Grundgesamtheit in Deutschland auf 750 Krankenhäuser festgelegt werden. Betten 20-99 100-199 200-399 ab 400 Gesamt 250 250 (36) (36) 11 366 134 134 395 750 Träger Öffentlich (inkl.Uni-Kliniken) Privat 222 91 42 freigemeinnützig Gesamt 222 91 42 Abb. 3: Grundgesamtheit Deutschland Die Definition der Grundgesamtheit für die Schweiz verlief ähnlich wie die Deutschlands. Ein Unterschied bestand jedoch darin, dass aufgrund der insgesamt kleineren Bettenkapazität der Schweizer Krankenhäuser auch Krankenhäuser mit öffentlichem oder sonstigem Träger von 200-399 Betten in die Grundgesamtheit aufgenommen wurden. Ein weiterer Unterschied war, dass sich bei der Befragung auf die deutschsprachige Schweiz beschränkt wurde, da eine Übersetzung des Fragebogens unter anderem aus Zeitgründen nicht möglich war. Somit wurde für die Schweiz eine Grundgesamtheit von 58 Krankenhäusern definiert. Betten 20-99 100-199 200-399 ab 400 Gesamt 9 10 19 Träger Öffentlich Privat 16 15 sonst. Gesamt 16 15 4 35 4 4 17 10 58 Abb. 4: Grundgesamtheit Schweiz Stefanie Wolf 23 Die Primärforschung 6.2 Festlegung des Auswahlverfahrens Im Anschluss an die Definition der Grundgesamtheit wurde das Auswahlverfahren festgelegt. Hierzu gibt es, wie man der nachfolgenden Grafik entnehmen kann, verschiedene Möglichkeiten: Auswahlverfahren Vollerhebung Teilerhebung Willkürliche Auswahl Repräsentative Auswahl bewusste Auswahl Zufallsauswahl einfache Zufallsauwahl Uneingeschränkte Zufallsauswahl: Lotterieauswahl Auswahltechniken: z.B. systematische Zufallsauswahl Quotenauswahl Sonderformen Geschichtete Auswahl proportional Auswahl nach Konzentrationsprinzip Typische Auswahl Klumpen Auswahl disproportional Abbildung 5: Grundformen von Auswahlverfahren Quelle: Berekhoven, Eckert, Ellenrieder, Marktforschung, S. 62 6.2.1 Vollerhebung oder Teilerhebung Im Rahmen der durchzuführenden Studie wurde sich für eine Teilerhebung entschieden, man beschränkte sich also auf einen kleineren Kreis (= Stichprobe) der Grundgesamtheit. Eine Vollerhebung , bei der alle Subjekte der Grundgesamtheit befragt werden, kam aus zeitlichen und organisatorischen Aspekten nicht in Frage. 6.2.2 Repräsentativität der Stichprobe Eine Teilmasse ist „repräsentativ, wenn sie einen zutreffenden Rückschluss auf die Grundgesamtheit zulässt“1. Da in diesem Projekt Stichproben gebildet werden sollten, die möglichst repräsentativ für die jeweiligen Grundgesamtheiten sind, entschied sich das Team für die repräsentative Auswahl. 1 Berekhoven/Eckert/Ellenrieder: Marktforschung – Methodische Grundlagen und praktische Anwendung. Gabler, Wiesbaden 1996, S. 50 Stefanie Wolf 24 Die Primärforschung 6.2.3 Auswahlverfahren – Quotenauswahl Aufgrund der Beschaffenheit des Datenbestandes entschied sich das Projektteam für die Quotenauswahl. Wie aus der oberen Graphik ersichtlich, gehört die Quotenauswahl zur Rubrik der bewussten Auswahl. Bei diesen wird versucht, die Stichprobe so zu gestalten, dass sie „hinsichtlich der interessierenden Merkmale möglichst repräsentativ für die Grundgesamtheit ist“2. Bei der Quotenauswahl wurden die Krankenhäuser so ausgewählt, dass bestimmte Merkmale der Krankenhäuser in der Stichprobe in exakt der gleichen Häufigkeit vorkamen wie in der Grundgesamtheit. Aus der Expertenbefragung konnten die geeigneten Quotenmerkmale „Trägerschaft“ und die „Bettenzahl“ ableitet werden. Unter Berücksichtigung der Häufigkeiten in der Grundgesamtheit sollte also eine Stichprobe konstruiert werden, die ein bewusst ausgewähltes verkleinertes Modell der Grundgesamtheit darstellt und daher auch repräsentativ für diese Grundgesamtheit ist. Schließlich legte man als Stichprobengröße für Deutschland und Schweiz 100 bzw. 15 Krankenhäuser fest: Somit ergaben sich folgende Stichprobenpläne: Betten 20-99 100-199 200-399 ab 400 Gesamt 33 33 (12) (12) 1 49 18 18 6 52 100 200-399 ab 400 Gesamt 3 3 6 Träger öffentlich (inkl.Uni-Kliniken) privat 30 12 6 freigemeinnützig Gesamt 30 12 Abb. 6: Stichprobenplan Deutschland (in Stück und Prozent) Betten 20-99 100-199 Träger öffentlich Privat 4 3 sonst. Gesamt 4 3 1 8 1 1 5 3 15 Abb. 7: Stichprobenplan Schweiz 2 Berekhoven/Eckert/Ellenrieder: Marktforschung – Methodische Grundlagen und praktische Anwendung. Gabler, Wiesbaden 1996, S. 55 Stefanie Wolf 25 Die Primärforschung 6.2.4 Auswahl der zu befragenden Krankenhäuser Nach der Festlegung des Auswahlverfahrens wurde anschließend das Quotenverfahren angewendet. Dabei wurden aus den zwei zur Verfügung stehenden Excel-Listen (mit den Adressen der Krankenhäuser von Deutschland und Schweiz) die zu befragenden Krankenhäuser gemäß den Stichprobenplänen ausgewählt. Da davon ausgegangen wurde, von 100 kontaktierten Krankenhäusern 30 ausgefüllte Fragebögen zurück zu erhalten, wurde die Anzahl der Krankenhäuser in den Stichprobenplänen jeweils mit drei multipliziert. So erhielt das Projektteam als Ergebnis eine Liste mit insgesamt 300 allgemeinen Krankenhäusern aus Deutschland und 45 allgemeinen Krankenhäusern aus der deutschsprachigen Schweiz. Die darin enthaltenen Krankenhäuser wurden auf alle Teammitglieder aufgeteilt, so dass jeder eine bestimmte Anzahl von Krankenhäusern in seiner Verantwortung hatte. Somit konnte nun mit der Befragung begonnen werden. Bereits nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass es bei der Befragung aufgrund von mehreren Absagen nicht den geplanten Rücklauf geben würde. Daher wurde beschlossen, sowohl in Deutschland, als auch in der Schweiz noch einmal Krankenhäuser aus der Grundgesamtheit zu ziehen, um mehr ausgefüllte Fragebögen zu erhalten. Mit den zusätzlichen 59 bzw. 18 Krankenhäusern für Deutschland bzw. Schweiz kontaktierten wir also aus der jeweiligen Gesamtmasse insgesamt 359 allgemeine Krankenhäuser in Deutschland und 63 in der Schweiz. 7 Rücklauf bei der Befragung und Vorgehensweise Zuerst wird nun auf den Rücklauf der Fragebögen eingegangen. Wie bereits in Kapitel 5.2.4. beschrieben, ging man im Vorfeld der Befragung von einer Rücklaufquote von ca. 30% aus. Der tatsächliche Rücklauf für Deutschland und Schweiz wird in den folgenden zwei Gliederungspunkten behandelt. 7.1 Rücklauf Deutschland Von den 359 kontaktierten Krankenhäusern in Deutschland erhielten wir 259 Absagen und 100 Zusagen. Von den 100 Zusagen erhielten wir letztendlich doch nur 40 ausgefüllte Fragebögen, deren Verteilung in Abbildung 8 zu sehen ist Stefanie Wolf 26 Die Primärforschung Betten 20-99 100-199 200-399 ab 400 Gesamt 15 15 (6) (6) 4 17 8 8 Träger öffentlich (inkl.Uni-Kliniken) privat 8 4 1 freigemeinnützig Gesamt 8 4 1 27 40 100-199 200-399 ab 400 Gesamt Abbildung 8: Rücklauf Deutschland (in Stück) Betten 20-99 Träger Öffentlich (inkl.Uni-Kliniken) Privat 20 -10% 10 -2% 3 -3% freigemeinnützig Gesamt 20 -10% 10 -2% 3 -3% 37 4% 37 (15) (3%) (15) 10 9% 43 20 2% 20 67 15% 100 Abbildung 9: Rücklauf Deutschland (prozentual und Abweichung von der Quote in Prozentpunkten) In Abbildung 9 ist zu erkennen, dass der Rücklauf von der Quote um maximal zehn Prozentpunkte abweicht und die relativen Gewichtungen der aus der Expertenbefragung abgeleiteten Quoten trotz des geringeren Rücklaufs weitestgehend erhalten blieben. Weiterhin ist in der folgenden Abbildung zu sehen, dass von den 359 von uns kontaktierten Krankenhäusern nur 216 angaben, internationale Patienten zu haben. Daraus schlussfolgerte man, dass die relevante Grundgesamtheit nicht 750, sondern ca. 450 Krankenhäuser beträgt. Somit erfasst die Studie in Deutschland ca. 9 % der relevanten Krankenhäuser (40 von 450 Krankenhäusern). Nein 143 : 216 Abb. 10: Internationale Patienten Ja der kontaktierten Krankenhäuser Stefanie Wolf 27 Die Primärforschung 7.2 Rücklauf Schweiz Von den 63 kontaktierten Krankenhäusern in der Schweiz erhielt das Projektteam 55 Absagen und acht Zusagen, wobei letztere zugleich den Rücklauf darstellten. Die Verteilung der acht Krankenhäuser, welche den Fragebogen ausgefüllt haben, ist in Abbildung 11 zu sehen. Zu beachten ist, dass von den acht Krankenhäusern lediglich sechs aus der Grundgesamtheit stammen. Die restlichen zwei sind nicht in der Grundgesamtheit, weil in der „Ur-Liste“, das heißt derjenigen Liste, die alle Krankenhäuser der deutschsprachigen Schweiz enthält und von der schließlich die Grundgesamtheit der Schweiz abgeleitet wurde, nicht allen Krankenhäusern ein Träger zugeordnet werden konnte. Als schließlich alle 58 Krankenhäuser aus der Grundgesamtheit bereits kontaktiert waren, entschloss sich das Projektteam, auch diejenigen Krankenhäuser zu befragen, deren Träger noch nicht bekannt waren und die somit auch noch nicht in der Grundgesamtheit vertreten waren. nicht in der Grundgesamtheit Betten 20-99 100-199 200-399 ab 400 Gesamt 2 3 0 5 1 1 1 3 Träger Öffentlich Privat 0 0 Sonst. Gesamt 0 Abbildung 11 : Rücklauf Schweiz (in Stück) 3 4 0 1 8 in der Grundgesamtheit, aber kein Rücklauf In der Schweiz ermöglichen die 8 zurückerhaltenen Fragebögen zwar keine Schlüsse auf die Grundgesamtheit, allerdings ermöglichen sie eine gute Trendaussage und Vergleichsmöglichkeit. 7.3 Vorgehensweise bei der Befragung Jeder der teilnehmenden Studenten bekam eine Liste von Krankenhäusern (inkl. Adressen, Bettenzahl). Die sog. „ Half-Studenten“ (Studenten mit einem Arbeitskontingent von 80 Stunden) haben ca. 13 Krankenhäuser befragt. Die sog. „Full-Studenten“ (Studenten mit einem Arbeitskontingent von 130 Stunden) bekamen ca. 25 Krankenhäuser zugeteilt, die sie befragen sollten. Innerhalb des Projektteam entschied man sich, an die Befragung telefonisch heranzutreten. Die Krankenhäuser bzw. die Verantwortlichen sollten mittels des Stefanie Wolf 28 Die Primärforschung vorangehenden Telefongesprächs auf die Thematik vorbereitet werden und der erste persönliche Kontakt konnten auf diese Art und Weise hergestellt werden. Die allgemeine Vorgehensweise war wie folgt: - Anruf bei der Telefonzentrale des Krankenhauses - Kurze Erklärung des Anliegens und anschließende Bitte um Weiterverbindung zur zuständiger Person aus den Bereichen Marketing, Verwaltung oder Öffentlichkeitsarbeit - Sobald der Verantwortlichen erreicht war, erklärte jeder Projektteilnehmer, wer er/sie war weshalb er/sie anrufe und erläuterte das Projekt. - Anschließend wurde das Interesse abgefragt, an einer anonymen Befragung teilzunehmen, wobei als Gegenleistung Auszüge aus der fertigen Studie angeboten wurden. An dieser Stelle gab es drei verschiedene Möglichkeiten: 1. Zum einen wurde sofort die Absage an der Studie erteilt. Dies war meistens aus Zeitgründen der Fall oder weil die Krankenhäuser mit der Thematik, die der Fragebogen behandelte, nicht ausreichend konfrontiert waren. 2. Es wurde die Teilnahme an der Studie zugesichert. Manchmal nahmen die Zuständigen in den Krankenhäusern die Möglichkeit eines „Telefoninterviews“ in Anspruch, d.h der Fragebogen wurde per Gespräch mit dem Studenten gleich am Telefon ausgefüllt. Die meisten jedoch wollten den Fragebogen selbständig ausfüllen, um die Fragen in Ruhe durchlesen zu können und die richtigen Informationen für die Antworten einzusetzen. Die Fragebögen wurden in diesen Fällen per Post oder per Fax an die Fachhochschule Ingolstadt zurückgesandt. 3. Die meisten der zuständigen Befragten konnten sich nicht sofort entscheiden, ob sie an der Studie teilnehmen wollten oder mussten erst die Erlaubnis eines Vorgesetzten einholen. In diesen Fällen mussten die Studenten des Öfteren „hinterhertelefonieren“, um endlich eine konkrete Entscheidung bzgl. Teilnahme oder Absage zu erhalten. Des Öfteren wurde man auch an mehrere andere Kontaktpersonen in den Krankenhäusern weitervermittelt, bis man eine endgültige Antwort bekam. 8 Resumée Zu Beginn des Projekts wusste keiner der Teilnehmer, was ihn erwartete, und konnte sich abgesehen von der Theorie, noch nichts Detailliertes unter dem Begriff „Marketingforschung“ vorstellen. Das Verständnis für die Vorgehensweise und die Reihenfolge bzw. Abhängigkeit der einzelnen Arbeitsschritte wurde jedoch durch das auszuführende Projekt vergrößert. Bemerkenswert war auch die Entwicklung des Teamgeistes innerhalb der Gruppe. Stefanie Wolf 29