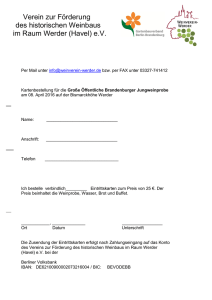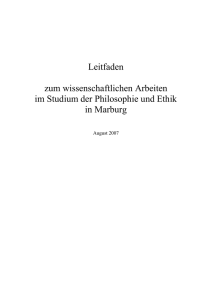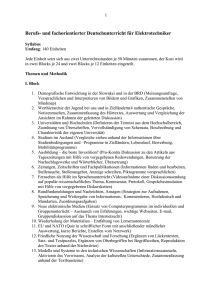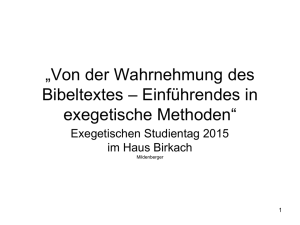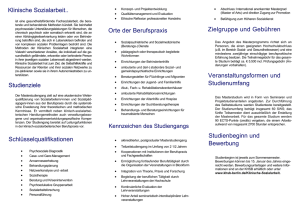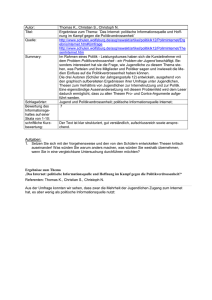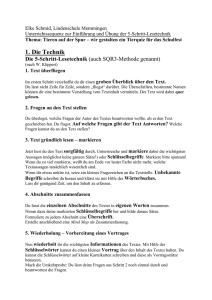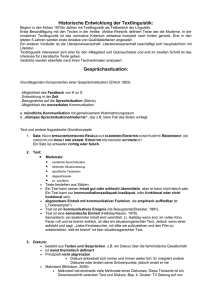Wichtige Fachzeitschriften für das Gebiet der Sozialen Arbeit
Werbung

Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin - University of Applied Sciences - Prof. Dr. Heiko Kleve Grundlagen des wissenschaftliches Arbeitens Einführende Übersichten und Arbeitsblätter Motto: Die „Verfahren der Wissenschaften [fügen] sich keinem gemeinsamen Schema [...] – sie sind nicht ‘rational’ im Sinne solcher Schemata. Kluge Menschen halten sich nicht an Maßstäbe, Regeln, Methoden, auch nicht an ‘rationale’ Methoden, sie sind Opportunisten, das heißt, sie verwenden jene geistigen und materiellen Hilfsmittel, die in einer bestimmten Situation am ehesten zum Ziele zu führen scheinen“ (Paul Feyerabend, Erkenntnis für freie Menschen, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1980, S. 9). (c) Prof. Dr. Heiko Kleve, Berlin im Sommer 2003 Raum/App: 402 E-Mail: [email protected] http://www.asfh-berlin.de/hsl/kleve 1 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ................................................................................. 2 Grundlagen-Literatur für das wissenschaftliche Arbeiten in der Sozialen Arbeit / Sozialarbeitswissenschaft ...................................................................................... 3 Wichtige Fachzeitschriften für das Gebiet der Sozialen Arbeit/Sozialarbeitswissenschaft .......................................................................... 4 I. Wissenschaftliches Lesen .................................................................................. 5 1. Differenzierung von Alltags-, Poesie- und Wissenschaftsdiskurs ... 5 2. Auswertung wissenschaftlicher Literatur ........................................ 7 3. Lesen und Verstehen/Interpretieren (Hermeneutik) wissenschaftlicher Texte ...................................................................... 8 4. Methoden des Lesens von wissenschaftlichen Texten .................. 11 5. Paraphrasieren von Texten ............................................................. 12 II. Wissenschaftliches Schreiben......................................................................... 13 1. Das akademische Journal ............................................................... 13 2. Protokollieren ................................................................................. 14 3. Aufbau einer wissenschaftlichen Seminararbeit ............................ 15 4. Gliederung sozialwissenschaftlicher Texte.................................... 19 5. Zitieren und Verweisen .................................................................. 20 6. Thesen und Hypothesen ................................................................. 22 7. Techniken zum Finden von Themen und Thesen .......................... 23 8. Techniken zum Erforschen der Themen und Thesen .................... 25 9. Rhetorische Argumentationsmuster für wissenschaftliche Texte.. 26 10. Formen des wissenschaftlichen Schreibens ................................. 28 A. Beobachten, Beschreiben, Erklären, Bewerten ....................... 28 B. Deduktion, Induktion, Abduktion............................................ 31 C. Dekonstruktion ........................................................................ 32 III. Wissenschaftliches Präsentieren ................................................................... 33 2 Grundlagen-Literatur für das wissenschaftliche Arbeiten in der Sozialen Arbeit / Sozialarbeitswissenschaft Bango, J. (2000): Wissenschaftliches Arbeiten in der Sozialarbeit. Opladen: Westdeutscher Verlag Badry, E. u. a. (1998): Arbeitshilfen für Studium und Praxis der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Neuwied/Kriftel/Berlin: Luchterhand Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge: Fachlexikon der sozialen Arbeit. Frankfurt/M.: Eigenverlag Eberhard, K. (1987): Einführung in die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. Stuttgart: Kohlhammer Eco, U. (1991): Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt. Heidelberg Engelke, E. (1992): Soziale Arbeit als Wissenschaft. Eine Orientierung. Freiburg/Br.: Lambertus Kleve, H. (2000): Die Sozialarbeit ohne Eigenschaften. Fragmente einer postmodernen Professions- und Wissenschaftstheorie Sozialer Arbeit. Freiburg/Br.: Lambertus Klüsche, W. (Hrsg.) (1999): Ein Stück weitergedacht... . Beiträge zur Theorie- und Wissenschaftsentwicklung der Sozialen Arbeit. Freiburg/Br.: Lambertus Mühlum, A. u. a. (1997): Sozialarbeitswissenschaft. Pflegewissenschaft. Gesundheitswissenschaft. Freiburg/Br.: Lambertus Müller, C. W. (1988): Wie Helfen zum Beruf wurde. Band 1: Eine Methodengeschichte der Sozialarbeit 1883-1945. Weinheim/Basel: Beltz Müller, C. W. (1997): Wie Helfen zum Beruf wurde. Band 2: Eine Methodengeschichte der Sozialarbeit 1945-1995. Weinheim/Basel: Beltz Standop, E.; Meyer, M. L. G. (1998): Die Form der wissenschaftlichen Arbeit. Wiesbaden: Quelle & Meyer Werder, L. v. (1993): Lehrbuch des wissenschaftlichen Schreibens. Ein Übungsbuch für die Praxis. Berlin/Milow: Schibri Werder, L. v. (1995): Grundkurs des wissenschaftlichen Schreibens. Berlin/Milow: Schibri 3 Wichtige Fachzeitschriften für das Gebiet der Sozialen Arbeit/Sozialarbeitswissenschaft Archiv für Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit, Eigenverlag des Vereins für öffentliche und privat Fürsorge, Frankfurt/M. GISA, rundbrief gilde soziale arbeit, Herausgeber: Gilde Soziale Arbeit, Lüneburg neue praxis, Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik, Herausgeber: Paul Hirschauer, Hans-Uwe Otto, Hans Thiersch, Luchterhand Verlag, Neuwied Soziale Arbeit, Deutsche Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, Eigenverlag Deutsches Institut für soziale Fragen (DZI), Berlin Sozialmagazin, Die Zeitschrift für Soziale Arbeit, Herausgeber: JuventaVerlag, Weinheim Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit, Herausgeber: Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. Bonn, VOTUM-Verlag 4 I. Wissenschaftliches Lesen 1. Differenzierung von Alltags-, Poesie- und Wissenschaftsdiskurs (nach Werder, L. v., Grundkurs des wissenschaftlichen Schreibens, Milow 1995, S. 20) Alltagssprache Poetische Sprache Wissenschaftliche Sprache Umgangswörter Metaphern Fachbegriffe Klischee Konkretion Abstraktion Behauptung Eindrücke Begründungen Narration Expression Systematik Konvention Gefühl Ratio Ungereimtheiten Widerspruch im Stil keine Widersprüche Regeln ästhetische Normen Gesetze Unterhaltung Katharsis Information Tradition des Geredes Poetische Tradition Wissenschaftliche Fachtradition „In der internationalen Schreibforschung wird die flüssige Bewegung zwischen allen drei Schreibdiskursen als entscheidendes Kriterium für extrafunktionale höhere Arbeitsleistungen und für gute Arbeitsmarktchancen eingeschätzt“ (L. v. Werder, a.a.O.) 5 Aufgabe 1: Formulieren Sie drei beliebige Sätze in Ihrer Alltagssprache. Machen Sie dann aus diesen drei Sätzen erst poetische und dann wissenschaftliche Sätze. Untersuchen Sie dann mit Hilfe der Tabelle die Differenz zwischen den drei Diskursen! Aufgabe 2: Jedes der nachfolgenden Textbeispiele lässt sich entweder dem Alltags-, dem Poesieoder dem Wissenschaftsdiskurs zuordnen. Treffen Sie die aus Ihrer Sicht passenden Zuordnungen! Textbeispiel A: „[...] Glauben Sie, die Vergangenheit sei, nur weil sie schon geschehen ist, fertig und unabänderlich? Ach nein, ihr Kleid ist aus schillerndem Taft geschneidert, und jedes Mal, wenn wir uns nach ihr umdrehen, sehen wir sie in einer anderen Farbe. [...]“ Textbeispiel B: „[...] Sozialarbeiter reden eigentlich immer ziemlich viel herum. Hauptsache ist, sie haben darüber geredet. Worüber weiß man eigentlich nie so genau. Dabei weiß man doch, dass das, was die können, eigentlich jeder kann. Irgendwie sind die auch noch ziemlich uncool, die wollen immer alles ausdiskutieren. Und dafür kassieren die unsere Steuergelder, na ja, die produzieren doch nichts – außer bla bla bla ... Neulich traf ich aber einen, der sagte mir, eine Sozialarbeiterin hätte ihm geholfen. Der hatte total viele Schulden, und wusste nicht mehr, wie er seine Wohnung bezahlen kann, der hatte kein Geld, alles ausgegeben. Die Sozialarbeiterin, sagte er, hat dann zusammen mit ihm einen Finanzplan aufgestellt, wie man die Schulden langsam wieder loswerden kann. Und dann hat sie noch beim Sozialamt zusammen mit ihm einen Antrag gestellt, damit die Mietschulden erst mal übernommen werden. Na ja, ich weiß auch nicht so genau; warum brauchen wir eigentlich Sozialarbeiter? [...]“ Textbeispiel C: „[...] Die Paradoxie des Individualismus stellt sich als moderne Gleichzeitigkeit individueller Freiheit und Abhängigkeit dar. Obwohl die Moderne den Menschen befreit hat von verfestigten traditionalen (sozialen, moralischen, religiösen etc.) Einbindungen und Integrationsformen, wird er beispielsweise abhängiger denn je von einer öffentlichen, institutionalisierten Teilnahme an gesellschaftlichen (verrechtlichten und bürokratischen) Organisationen, z.B. der Erziehung/Bildung, der Therapie, der Medizin und der Sozialen Arbeit. Mit anderen Worten, die Menschen waren wohl noch nie – gleichzeitig – so frei und so unfrei wie heute. [...]“ An welchen Textmerkmalen erkennen Sie die Zugehörigkeit zu den jeweiligen Diskursarten? Listen Sie diese Merkmale auf. 6 2. Auswertung wissenschaftlicher Literatur Ein „Buch [ist] wie eine Brille [...]: probiert, ob sie euch paßt; ob ihr mit ihr etwas sehen könnt, was euch sonst entgangen wäre; wenn nicht, dann laßt [...das] Buch liegen und sucht andere, mit denen es besser geht. Findet die Stellen in einem Buch, mit denen ihr etwas anfangen könnt. Wir lesen und schreiben nicht mehr in der herkömmlichen Weise. Es gibt keinen Tod des Buches, sondern eine neue Art zu lesen. In einem Buch gibt’s nichts zu verstehen, aber viel, dessen man sich bedienen kann. Nichts zu interpretieren und zu bedeuten, aber viel, womit man experimentieren kann“ (Gilles Deleuze; Felix Guattari, Rhizom, Berlin: Merve 1976, S. 40) Schritte der Literaturauswertung Prüfungsergebnisse 1. Buch äußerlich prüfen - Titel - Klappentext - Impressum - Literaturangaben - Register - Verlag 2. Buch innerlich prüfen - Vorwort - Nachwort - Zusammenfassung - Kapitelanfänge - wichtige Registerstichworte im Text (nach-) lesen - Belege prüfen 3. Kommentar im Journal 4. Buch in die bibliographische Datei aufnehmen (nach Werder, L. v., Grundkurs des wissenschaftlichen Schreibens, Milow 1995, S. 37) 7 3. Lesen und Verstehen/Interpretieren (Hermeneutik) wissenschaftlicher Texte „[...] wenn Verstehen und Verständigung gelingen, Verstehen und Verständigung mißlingen. Frisch Verliebte, die in jeder Weise auf (Ver)Einigung und Wechseldurchdringung aus sind, wissen ein Lied davon zu singen. Wenn sie dumm sind, haben sie sich bald nichts mehr zu sagen. Denn sie haben sich ja immer schon verstanden. Wenn sie ein wenig klüger sind, halten sie sich gerade rituell an die alte Regel: ‚Was sich liebt, das neckt sich’. Und das heißt: Sie stellen, weil sie sich auch weiterhin etwas mitzuteilen haben wollen, Mißverständnisse lustvoll her.“ (Jochen Hörisch, Die Wut des Verstehens. Zur Kritik der Hermeneutik, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1988, S. 105) Mögliches Raster zur Textbearbeitung: 1. Erkunden Sie den Kontext des Textes (Angaben zum Autor, Erscheinungsjahr, Ort der Veröffentlichung etc.). 2. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Thesen/Leitgedanken/Fragen des Textes? 3. Wie ist der Text inhaltlich gegliedert? 4. Wie werden die Thesen/Leitgedanken/Fragen diskutiert, mit welchen Beispielen oder Verweisen auf andere Texte bzw. AutorInnen werden sie belegt bzw. beantwortet? 5. Ist die Diskussion bzw. das Belegen der Thesen und Leitgedanken bzw. das Beantworten der Fragen aus Ihrer Sicht nachvollziehbar und schlüssig? 6. Was ist an Thesen/Leitgedanken/Fragen offen geblieben? 7. Welche Fragen hat der Text bei Ihnen hinterlassen? 8. Woran möchte Sie weiterarbeiten, um die offenen Fragen einer Antwort zuzuführen? 8 Aufgabe 1: Auszug aus einem sozialarbeiterischen Fachartikel von Peter Fuchs: Systemtheorie und Soziale Arbeit, veröffentlicht in: Roland Merten (Hrsg.): Systemtheorie Sozialer Arbeit. Neue Ansätze und veränderte Perspektiven, Opladen: Leske+Budrich 2000: S. 157-175 Peter Fuchs Systemtheorie und Soziale Arbeit Seit einiger Zeit wird die Frage diskutiert, ob Soziale Arbeit ein Funktionssystem der modernen Gesellschaft sei.1 Spielt sie mit im Spiel der funktionalen Differenzierung dieser Weltgesellschaft? Bedient sie eine genuine (schlanke) Funktion, oder ist sie eine Art Streuphänomen, eine Diffusität in der Welt, die sich nur unter hohen Schärfeverlusten auf eine und nur eine Funktion, auf einen und nur einen Code reduzieren läßt? Ist sie, auch so wird gefragt, ein Parasit der Gesellschaft (im Sinne Serres), der seine Ressourcen aus den dysfunktionalen Nebeneffekten funktionaler Differenzierung schöpft? Oder gar ein Getümmel von Partisanen und Saboteuren, die im Dienste der Gleichheitsverteilung der Chancen für Inklusion und der Reparatur mißlingender Inklusion die Zentralstruktur der Gesellschaft (laufend anfallende Ungleichheiten im Kernbereich trotz Gleichheitgebotes) zu unterlaufen trachten?2 Oder, auch das könnte erörtert werden, ist sie auf dem Wege, ein wirtschaftlicher Superkonzern zu werden, eine Organisation von Organisationen, deren Marktchancen genau darin liegen, daß die Gesellschaft der Moderne massenhaft Ungleichheiten auswirft?3 Das könnte bedeuten, daß es eine andere Subversion gibt, die Subversion der zunehmenden Wirtschaftsförmigkeit oder Wirtschaftsabhängigkeit der Sozialen Arbeit, eine Subversion, für die sich die Anzeichen mehren, zum Beispiel der Einbau von Sozialökonomie/Sozialmanagement in die Curricula einschlägiger Studiengänge. Und ist dann diese Subversion ein Segen oder ein Fluch? Wie immer man optieren mag, Fragen solcher Art setzen jedenfalls schon voraus, daß es um Systeme geht, sei es um Funktionssysteme und/oder Entscheidungssysteme (Organisationen), sei es um parasitäre, partisanenhafte, sabotierende Systeme, die im Rücken der Weltgesellschaft zäh und mutig ihre Operationen durchführen. Die Crux ist dann, daß 1 Vgl. nur Baecker, D., Soziale Hilfe als Funktionssystem der Gesellschaft, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg.23, 1994, S.93110; Fuchs, P./Schneider, D., Das Hauptmann-von-Köpenick-Syndrom, Überlegungen zur Zukunft funktionaler Differenzierung, in: Soziale Systeme, H.2, 1995, S.203-224. Ich habe mich im übrigen hier entschieden, ausschließlich vom System Sozialer Arbeit zu sprechen, nicht, um eine große Vereinheitlichung zu erreichen, sondern weil ich vermute, daß die Differenz Sozialarbeit/Sozialpädagogik eine Differenz auf der Ebene der Programme ist. 2 Vgl. Fuchs, P. Das Phantasma der Gleichheit, in: Merkur 570/571, 1996, S.959-964. Zur Parasitologie siehe Serres, M., Der Parasit, Frankfurt 1991; zu entsprechenden Diskussionen für die Sozialarbeit siehe Bardmann, Th., Parasiten nichts als Parasiten! Zu einer Parasitologie der Sozialarbeit, in: ders./Hansen, S., Die Kybernetik der Sozialarbeit. Ein Theorieangebot, Aachen 1996, S.141-155. 3 Vgl. dazu Halfar, B., Wettbewerbsstrategien im Sozialbereich: Marketing ohne Marken?, in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, H.1, 1998. 9 Antworten auf diese Fragen und Entscheidungen zwischen den Antworten ihre Konsistenz und ihre Plausibilität aus einer allgemeinen Theorie sozialer Systeme beziehen müßten, daß aber auf dem Markt der Wissenschaften (und Halbwissenschaften) Systemtheorien in Fülle angeboten werden. Es ist nicht gelungen, das Wort System als Begriff sakrosankt zu stellen: Es ist, man verzeihe diese Wortbildung, prostituabel geworden — ähnlich wie Kommunikation, ähnlich wie Holismus. Nun kann man (und Soziale Arbeit scheint dafür prädestiniert zu sein) Pluralität schätzen, verschiedene Theorien aus verschiedenen Disziplinen kasuistisch einsetzen, und fraglos müssen dabei auftretende Inkonsistenzen nicht unbedingt schädlich sein. Die Praxis, die immer eine Praxis der kleinzeitigen, der ceteris-paribus-Beobachter ist,4 könnte durch universalistisch konzipierte, strikt monolithische Theorien hoffnungslos überfordert, sie könnte beschädigt werden. Schließlich offerieren solche Theorien extreme Fernsichten, in denen jede Nahsicht sofort verschwimmt. Papier aber, so heißt es jedenfalls in der Praxis der Theoretiker, ist geduldig, und deshalb möchte ich im weiteren eine und nur eine Theorie mit universalen Ambitionen einsetzen, die Theorie sozialer Systeme, die Systemtheorie der Bielefelder Schule.5 Die dabei unvermeidbaren Härten sind gemildert durch eine besondere Fragehaltung, die Haltung des „Was wäre, wenn...“. Was wäre, wenn die Axiome und Prämissen der Bielefelder Schule auf Soziale Arbeit angewandt würden? Was ließe sich sehen? Was verschwände aus der Sicht? Wo lägen die Klarheitsgewinne, wo die Schärfeverluste, wo die Anschlüsse? Die Einstellung des Textes ist daher in einem sehr genauen Sinne essayistisch, sie ist die der kontrollierten Spekulation. [...] Angaben zum Autor: Fuchs, Peter, Jg. 1949, Prof. Dr. rer. soc., M.A., Fachhochschule Neubrandenburg, Fachbereich Sozialwesen, Lehrgebiete: allgemeine Soziologie, Soziologie der Behinderung, zahlreiche Veröffentlichungen zur Systemtheorie der Bielefelder Schule und deren Anwendung in unterschiedlichen Disziplinen und Professionen. Bearbeiten Sie den Text mit Hilfe des oben vorgeschlagenen Rasters. 4 Vgl. Fuchs, P., Intervention und Erfahrung, Ms. Groß Wesenberg 1998. Luhmann würde sich entschieden gegen diese Bezeichnung gewehrt haben, aber ich brauche ein Wort für diese Theorie, die sich mittlerweile deutlich absetzt von Theorieangeboten derselben Branche. Im übrigen muß man das Wort Schule nicht von den Schülern her denken oder von Orten der Lehre, man kann es von ihm selbst aus denken als schola. 5 10 4. Methoden des Lesens von wissenschaftlichen Texten Lesemethode Intuitives Lesen Lesetechnik 1. Lesen 2. Resultate aufschreiben SQ 3 R Kürzel für fünf Schritte: 1. Survey - Überblick über den Text (Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Überschriften, Zusammenfassungen); 2. Question - Stellen von Fragen an den Text (Wer [Autor]? Was [Verständnis der Begriffe]? Wozu [schreibt er]? Warum [Ergebnisse]? Wie [Wirkung des Textes]?); 3. Read Lesen des Textes zum Beantworten der Fragen; 4. Recite - Formulieren der Antworten; 5. Review abschließenden Text-Überblick verschaffen. 1. Überblick über den Text 2. Fragen stellen 3. Lesen 4. Antworten auf Fragen notieren 5. Überblick kontrollieren und revidieren Mind-Map-Lesen 1. Überblick über den Text 2. I. Mind-Map des Textes 3. Lesen 4. II. erweitertes Mind-Map Kreatives Lesen Lesen 1. Bild zum Thema zeichnen 2. Lesen und Cluster zum gewählten Text machen 3. Schnelles Schreiben zum gelesenen Text 4. Ergebnisse zusammenfassen M(arkieren) E(xzerpieren)-Methode „Das Exzerpt ist eine auszugsweise Wiedergabe des gelesenen Textes. Exzerpte können wörtliche oder sinngemäße Wiedergaben sein. Exzerpte entstehen meist unter vorher gehörten Fragestellungen“ (Werder 1995, a.a.O.). Kombinierte Methode 1. Text lesen 2. Markieren 3. Exzerpieren wichtiger Stellen 1. (Intuitives) Lesen 2. Resultate/Fragen aufschreiben 3. erneutes Lesen des Textes 4. Kernthesen des Textes mit eigenen Worten zusammenfassen 5. Belege für die Thesen aus dem Text notieren 6. persönliches Resümee zum Text schreiben (Vgl. Werder, L. v., Grundkurs des wissenschaftlichen Schreibens, Milow 1995, S. 37) 11 5. Paraphrasieren von Texten Paraphrasieren bedeutet, dass man gelesene Texte mit eigenen Worten wieder gibt. Dabei wird – in einem ersten Schritt – über das Lesen ein fremder Text, d.h. fremde äußere Sprache „aufgenommen“ und kognitiv in eigene innere Sprache umgewandelt. Im zweiten Schritt muss nun durch das Paraphrasieren, durch das Schreiben die eigene innere Sprache in eigene äußere Sprache umgewandelt werden, und zwar so, dass LeserInnen das nachvollziehen können, was geschrieben wurde. Aufgabe 1: „[...] Die Menschen sind von der Scholle losgelöst. Sie müssen der Arbeit dorthin nachwandern, wo sie Gelegenheit zum Unterhalt finden. Die Familie ist aufgerissen. Wie Flugsand, wie Blätter, die im Winde verweht werden, treibt die Arbeit sie von Ort zu Ort. Der Begriff der ‚Heimat’ ist dem Städter verloren gegangen. Auch das Wort ‚Beruf’ hat für viele seinen Sinn eingebüßt. An Stelle des Berufs tritt ein immer wieder wechselndes Arbeitsverhältnis. Die Jugend ist entwurzelt, heimat- und familienfremd. Sie ist nicht nur bei wirtschaftlichen Notlagen gefährdet. Sie ist sich selbst überlassen, in dem Alter, in dem der Mensch am meisten Führung bedarf. Das gilt nicht nur für die alleinstehenden, von Hause abgewanderten jungen Leute. Die wirtschaftliche Selbständigkeit der früh verdienenden jungen Menschen macht sie erziehlichen Einflüssen oft auch dann unzugänglich, wenn sie noch im Elternhaus leben. [...]“ 1. Wann wurde der Text Ihrer Meinung nach geschrieben? Begründen Sie ihre Entscheidung. 2. Paraphrasieren Sie den Text. 3. Bewerten Sie den Text anhand Ihrer eigenen Kriterien. 4. Anhand welcher Kriterien haben Sie den Text bewertet. 5. Versuchen Sie Gegenthesen zu den Thesen des Textes zu bilden. 12 II. Wissenschaftliches Schreiben 1. Das akademische Journal Übungen zum Lesen wissenschaftlicher Texte - Lesen, Markieren von Texten und Sammlung von Exzerpten (eigenen Textnotizen, kurzen, thesenhaften Textzusammenfassungen) im Journal. - Kritische persönliche Kommentare zu gelesenen wissenschaftlichen Texten. Sammlung offener Fragen zu gelesenen Texten. Übungen zur Reflexion des eigenen wissenschaftlichen Schreibens - Identifikation mit wissenschaftlichen Schreibern. - Schreiben im akademischen Tagesablauf. - Schreiberfolge an der FH. - Akademische Schreiblehrer. - Schreibkrisen und Schreibhilfen an der FH. Übungen zur akademischen Kommunikation - Einspaltiges Journal, Kommentar in der leeren Spalte durch Mitstudierende. - Einspaltiges Journal, Kommentar in der leeren Spalte durch ProfessorInnen bzw. Lehrbeauftragte. - Austausch gegenseitiger Kommentare von ProfessorInnen- und StudentInnenjournalen. Übungen zur Aufarbeitung der Seminarerfahrungen - Beschreiben Sie in Ihrem Journal die menschlichen Beziehungen, die Kommunikationsform und die persönlichen Eindrücke aus akademischen Seminaren (nach Werder, L. v., Grundkurs des wissenschaftlichen Schreibens, Milow 1995, S. 13f.) Vorschlag: Legen Sie sich bereits im ersten Semester Ihres Studiums ein akademisches Journal an. Dieses Journal – eine Mischung aus Tage- und Notizbuch – soll von Fall zu Fall Ihre Erlebnisse, Gedanken, Gefühle an der Hochschule aufnehmen. 13 2. Protokollieren Es lassen sich zwei Arten von Protokollen unterscheiden: das Verlaufsprotokoll und das Ergebnisprotokoll. In unserem Kontext erstellen wir in der Regel Ergebnisprotokolle. Das Verfassen eines Ergebnisprotokolls dient dazu, eine Seminarsitzung mit ihren zentralen Themen und Ergebnissen schriftlich festzuhalten, damit die Sitzung ausgewertet und nachbereitet werden kann und damit außerdem nicht anwesende Studierende sich über die betreffende Seminarsitzung informieren können. Ein Protokoll sollte so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein. Es geht darum, dass die im Seminar stichpunktartig mitnotierten (protokollierten) Themen und Ergebnisse der Sitzung und möglicherweise auch der Diskussionsverlauf kurz aus der Sichtweise der Protokollantin / des Protokollanten wiedergegeben werden. Da man ohnehin nicht wiedergeben kann, wie es ‚wirklich’ war, sondern lediglich seine eigene Perspektive, sollte man sich trauen, selbständig Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden; notfalls sollte man eher etwas weglassen, als zu viel aufzuschreiben. Ob die Auswahl in der Seminargruppe auf Konsens stößt, kann nur in einer diskursiven Auswertung des Protokolls geprüft werden. 14 3. Aufbau einer wissenschaftlichen Seminararbeit Eine wissenschaftliche Seminararbeit (Hausarbeit) sollte aus sechs Teilen bestehen: einem Kopfblatt, einem Inhaltsverzeichnis, einer Einleitung, einem Hauptteil, einem Schlusskapitel und einer Literaturliste. Das Kopfblatt sollte die wesentlichen Angaben zur Verfasserin / zum Verfasser, den Ort (Hochschule und Seminar) sowie das Thema der Arbeit enthalten (als Beispiel siehe beigefügtes Deckblatt). Im Inhaltsverzeichnis sollten alle Kapitelüberschriften übersichtlich gegliedert aufgelistet sein (als Beispiel siehe beigefügtes Inhaltsverzeichnis). Günstig und von DozentInnen gern gesehen ist es, wenn man auch die Seitenzahlen der einzelnen Kapitel mit aufführt. Die Einleitung soll einen Einstieg in die Arbeit bieten, so dass man sie beispielsweise beginnen kann mit der Darstellung der persönlichen Interessen am Thema (Warum interessiert mich dieses Thema? Warum habe ich gerade dieses Thema gewählt? Warum gerade zu dieser Zeit? etc.). Wichtig ist, dass man seine (zentrale/n) These/n in der Einleitung ausformuliert. Des weiteren sollte sich am Ende der Einleitung eine kurze Zusammenfassung der Inhalte der folgenden Kapitel befinden. Z.B.: Es geht mir mit diesen Zeilen darum zu zeigen, dass es unwahrscheinlich ist, dass staatliche Steuerungsbestrebungen in der Art und Weise wirken, wie sie von den staatlichen Akteuren intendiert (beabsichtigt) sind. Um diese These zu belegen, werden zunächst einige zentrale Vorstellungen der sozialwissenschaftlichen Systemtheorie referiert (2.), die mir als Grundlage für die weiteren Kapitel der Arbeit wichtig erscheinen. Im Anschluss daran soll jenes Steuerungsverständnis, welches aus handlungstheoretischen Konzeptionen resultiert, mit seinen Erklärungsdefiziten konfrontiert werden (3.), um im weiteren zu zeigen, welche Erkenntnisgewinne verbucht werden können, wenn Steuerung systemtheoretisch erklärt wird (4.). In der Schlussbetrachtung werden die zentralen Ergebnisse der Arbeit noch einmal zusammengefasst (5.). Im Hauptteil werden zumeist in mehreren Kapiteln die Argumentationen zur Begründung der These/n ausformuliert. Die Kapitel sollten übersichtlich gegliedert sein; mehr als drei Unterdifferenzierungen sind nicht zu empfehlen (also z.B. nur 2.; 2.1; 2.1.1). Wie man die Bezeichnung der Unterabschnitte vornimmt, ob numerisch mit arabischen oder römischen Zahlen oder gemischt bzw. alphanumerisch, obliegt den Vorlieben der VerfasserInnen. 15 Im Schlussteil sollten noch einmal die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst werden. Beispielsweise kann man sich auf die in der Einleitung formulierte These beziehen und zeigen bzw. behaupten, dass man aus den vor allem im Hauptteil genannten Gründen die These belegt (validiert) hat. Die Literaturliste soll in übersichtlicher alphabetisch geordneter Form alle Literaturquellen (z.B. Bücher, Zeitschriftenbeiträge, Zeitungsartikel, Manuskripte etc.) enthalten, aus denen im Text zitiert bzw. auf die verwiesen wurde (siehe dazu weiterführend Arbeitsblatt III). Eine wissenschaftliche Hausarbeit sollte in der Regel nicht länger als 15 bis maximal 25 Seiten lang sein, 1 ½ zeilig geschrieben und mit Seitenrändern von 2,5 bis 3,5 cm versehen werden. Wichtig ist außerdem: Die Arbeit ist im Präsens (Gegenwartsform) zu schreiben. Auch wenn man sich auf Autoren bezieht, die bereits verstorben sind, wird in der Regel die Gegenwartsform benutzt. Z.B.: Sigmund Freud (1938) zeigt in seiner Kulturtheorie, dass wir, um mit dem Todes- bzw. Aggressionstrieb umgehen zu können, auf die Sitten, Gebräuche, Moralen etc. des Abendlandes angewiesen sind. 16 Beispiel für ein Deckblatt einer Hausarbeit Berlin im September 1994 Hanno Sozialisierer 4.Semester [email protected] Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik HAUSARBEIT: SOZIALE SELBSTHILFE zwischen neokonservativer Sparpolitik und sozialökologischer Neuorientierung Seminar: Sozialverwaltung bei Prof. Weißbescheid 17 Beispiel für ein Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis: Seite 1 1. Einleitung 2 2. Soziale Selbsthilfe - Eine Begriffsbestimmung 3 2.1. Selbsthilfebewegung - Entstehung und Bedeutung 5 2.2. Selbsthilfegruppen - Bestimmungselemente und Bedeutung 8 3. Selbsthilfe im Spannungsfeld sozialpolitischer Rationalität 8 3.1. Das Subsidiaritätsprinzip - Missbrauch und Bedeutung 10 3.2. Selbsthilfeförderung und neokonservative Sozialpolitik 12 4. Selbsthilfe und sozialökologische Reformansätze 13 4.1. Bestimmungselemente sozialökologischer Reformpolitik 15 4.2. Kommunitäre Subsistenzwirtschaft als Perspektive sozialökologischer Selbsthilfe 15 16 18 20 21 21 22 23 24 25 26 4.2.1. Grundidee 4.2.2. Die Aussichten in den neuen Bundesländern 4.2.3. Prinzipien einer subsistenzwirtschaftlichen Kultur 4.2.4. Anschubfinanzierung und Starthilfe 4.3. Das selbsthilfeorientierte Subsistenzprojekt Pommeritz 4.3.1. Ziele des Projektes 4.3.2. Personelle Zusammensetzung 4.3.3. Arbeitsbereiche 4.4. Sozialökologische Selbsthilfe als Ansatz ganzheitlicher Sozialarbeit 5. Schlussbetrachtungen Literaturquellen 18 4. Gliederung sozialwissenschaftlicher Texte Dreiteilige Gliederung Eigene Ideen 1. Einleitung: - Thema kurz darstellen (was, wer, wo) - eigene Absichten (warum, wozu) - Darstellung der (Hypo-)These(n) 2. Hauptteil: - Entfaltung der (Hypo-)These(n) - Belege für die (Hypo-)These(n) - Ergebnisse 3. Schluss - Zusammenfassung - Grenzen der Forschung - Bezug zur Einleitung (Vgl. dazu Werder, L. v., Grundkurs des wissenschaftlichen Schreibens, Milow 1995, S. 32f.) Aufgabe 1: Wählen Sie ein sozialarbeiterisches/sozialarbeitswissenschaftliches Thema und fassen Sie die eigenen Ideen zum Thema in die drei o.g. Abschnitte - Einleitung, Hauptteil und Schluss kurz zusammen. Benutzen Sie dabei für die Einleitung drei Sätze, für den Hauptteil sechs Sätze und für den Schluss drei Sätze. 19 5. Zitieren und Verweisen Wissenschaftliche Arbeiten leben von anderen wissenschaftlichen Arbeiten, z.B. großer WissenschaftlerInnen, von den Büchern, Aufsätzen etc. der ‘Riesen’ des Fachs, auf deren Schultern wir ‘Zwerge’ uns stellen dürfen, wenn wir eigene wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Gerade das ‘Neuzusammenmixen’ von bereits Geschriebenem, von Zitaten, Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen in den eigenen Themen- und Thesenzusammenhängen macht das wissenschaftliche Schreiben aus. Das wiss. Können besteht darin, dass man ein für sich selbst interessantes Thema findet, dazu Thesen formuliert und diese Thesen mit dem verschiedensten Material (z.B. mit den Aussagen anderer WissenschaftlerInnen) versucht zu bestätigen bzw. diskutiert. Daher ist das Einhalten der Regeln richtigen Zitierens und Verweisens eine der wichtigsten Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens. 1. Ein Zitat ist in Anführungszeichen zu setzen und mit dem Autorennamen, dem Erscheinungsjahr des Textes und der Seitenzahl zu kennzeichnen. Z.B. „Zu wissen, wo es lang geht, zu wissen, was der Fall ist, und damit die Ansicht zu verbinden, man habe einen Zugang zur Realität und andere müssten dann folgen oder zuhören oder Autorität akzeptieren, das ist eine veraltete Mentalität, die in unserer Gesellschaft einfach nicht mehr adäquat ist“ (Luhmann 1987, S. 29). Die Literaturangabe hinter dem Zitat verweist auf die Quelle des Zitats, die in der alphabetisch geordneten Literaturliste am Ende der Arbeit aufgeführt ist. Die Literaturangabe kann folgendermaßen erfolgen: Autorennachname, -vorname (Erscheinungsjahr): Titel: Erscheinungsort: Verlag Z.B.: Luhmann, Niklas (1987): Archimedes und wir. Interviews. Berlin: Merve In der Literaturliste sollten die Titel mit Autorennamen, Erscheinungsjahr, -ort und -verlag angegeben werden. Literatur aus dem Internet kann ebenso wie andere, herkömmlich veröffentlichte Literatur verwendet werden. Allerdings ist die besondere Angabe in der Literaturlist zu bebachten: Nachname des Autors, Vorname des Autors (Jahreszahl): Titel. URL: http://www. ..., Datum des Abrufs. 20 2. Zitate müssen nach Inhalt und Form genau sein. D.h.: Jedes Zitat muss bei der Übernahme in den eigenen Text seine Form und seinen Inhalt behalten. Auslassungen, Ergänzungen, Erläuterungen, Anpassungen oder Hervorhebungen sind zu kennzeichnen. Jeder zitierte Text ist in seiner Rechtschreibung und Zeichensetzung genau wiederzugeben, selbst wenn sie veraltet oder falsch sind. 3. Zitate sollen in der Regel unmittelbar sein. Wenn man ‘aus zweiter Hand’ zitieren muss, ist dies gesondert zu kennzeichnen und die Quelle des ‘Zweite-Hand-Zitats’ anzugeben. Z.B.: „........“ (Luhmann, z. n. Baecker 1994, S. 155). „z. n.“ heißt: zitiert nach. 4. Einschübe und Auslassungen in Zitaten sind zu kennzeichnen. Einschub Auslassung Z.B. „Die TsS [Theorie selbstreferentieller Systeme; d. Verf.] ist mittlerweile [...] sehr bekannt.“ nicht nur in Deutschland Verweise auf andere Quellen, aus denen nicht direkt zitiert wird, sondern auf die lediglich hingewiesen wird oder aus denen Textstellen mit eigenen Worten zusammengefasst werden, sind mit siehe (Abkürzung: s.) bzw. mit vergleiche (Abkürzung: vgl.) zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung erfolgt nach dem Verweis bzw. nach der eigenen Zusammenfassung in Klammern. z.B. (s. Freud 1938); (vgl. Luhmann 1984, S. 167). Wenn mehrmals hintereinander auf dieselben Texte verwiesen wird, muss nicht jedes Mal erneut die Quelle angeführt werden, sondern es kann sich mit ebenda (Abkürzung: ebd.) Schreibarbeit gespart werden. 21 6. Thesen und Hypothesen „Hypothese, empirisch gehaltvolle Aussage, die einer Klasse von Einheiten bestimmte Eigenschaften zuschreibt oder gewisse Ereigniszusammenhänge oder -folgen behauptet, d. h. das Vorliegen einer Regelmäßigkeit im untersuchten Bereich konstatiert. Sie gilt stets nur vorläufig und muss so beschaffen sein, daß ihre Überprüfbarkeit durch Beobachtung und Experiment gewährleistet ist. Hypothesen sind die wichtigsten Bestandteile wissenschaftlicher Erklärungen“ (Lexikon zur Soziologie, S. 320f.) „[...] Die Grenzen, innerhalb deren H. als ‘richtig’ unterstellt werden können, beruhen auf Konventionen. Sie sind also wissenschaftliche Vereinbarungen. Die Prüfung der H. zielt [...] nicht auf den Beweis, daß der angenommene Bedeutungszusammenhang richtig ist, sondern darauf, daß er nicht widerlegt werden kann (Falsifikationsprinzip nach Popper). Eine H. hat nur solange Gültigkeit, solange sie nicht widerlegt werden kann. [...]“ (Fachlexikon der sozialen Arbeit, S. 481). „[...] Sozialarbeiter arbeiten sowohl in ihrer diagnostisch-begutachtenden als auch in der beratenden und intervenierenden Arbeit ständig mit – meist alltagstheoretisch formulierten – Hypothesen. Im diagnostisch-begutachtenden Bereich formulieren sie Erklärungshypothesen – etwa über die Entstehungsbedingungen devianter Karrieren im JGH-Bereich. In der intervenierenden und beratenden Arbeit formulieren sie explizit oder implizit H. über die wahrscheinlichen Interventionseffekte [...]“ (Fachlexikon der sozialen Arbeit, S. 481) „Hypothese, heuristische, unüberprüfte Vermutung über bestimmte Zusammenhänge, die nur die Funktion hat, zu weiteren Überlegungen anzuregen“ (Lexikon zur Soziologie, S. 321). 22 7. Techniken zum Finden von Themen und Thesen Brainstorming / freies Assoziieren / Freewriting - spontanes Aufschreiben - freies Assoziieren (nach Sigmund Freud 1856-1939) - von (z.B. fünf) Begriffen zu einem Themengebiet, das man bearbeiten möchte (z.B. Sozialarbeitswissenschaft). Dabei bietet es sich an, das (häufig zusammengesetzte) Wort, welches das Themengebiet bezeichnet, aufzugliedern in seine verschiedenen begrifflichen Bestandteile (z.B. Sozial-Arbeit[s]Wissenschaft). So kann man zu jedem der einzelnen Begriffe ein Brainstorming durchführen. Ein nächster Schritt kann sein, dass man die frei assoziierten Begriffe - im Sinne des Freewriting - dazu nutzt, um mit ihnen kleine Texte zu schreiben. Wichtig: Bei diesen Methoden sollte man das Unbewusste (weitgehend) unzensiert sprechen und schreiben lassen; denn das Unbewusste produziert mitunter die besten und kreativsten Ideen. Jede Idee sollte also willkommen sein, auch die vermeintlich unvernünftigste. Weiterhin sind verschiedene Modifikationen der Methoden möglich: z.B. Brainstorming in der Gruppe - jede/r schreibt zu einem Thema Begriffe auf und reicht das beschriebene Blatt an die Nachbarn weiter, die ebenfalls frei assoziierte Begriffe aufschreiben etc. (sog. ‘Roulettes’); z.B. Reih-Um-Text jede/r schreibt einen Satz auf dasselbe Blatt zu einem bestimmten Thema. Mind-Mapping - Karl Marx (1818-1883), der Erfinder des Mind-Mapping hat mit dieser Methode die zentralen Begriffe seiner Abhandlungen (z.B. Arbeit, Kapital, Arbeitslohn, Mehrwert etc.) in Beziehung zueinander gesetzt. Das In-Beziehung-Zueinander-Setzen von Begriffen dient dazu, ein Thema als ein dynamisches System Begriffszusammenhänge und -ordnungen als Schreibhilfen anzufertigen. darzustellen, Thesen: Das Suchen der zentralen Thesen ist wichtig, wenn man wissenschaftliche Texte liest. Gute wissenschaftliche Texte zeichnen sich dadurch aus, dass die Thesen in der Einleitung des Textes deutlich erkennbar (als Thesen) ausformuliert sind bzw. im weiteren Verlauf des Textes zusammengefasst werden. Das Bilden eigener Thesen ist einer der ersten Schritte, wenn man mit dem Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit beginnt. Neben der (vorläufigen) das zu bearbeitende Thema prägnant (treffend, bündig, genau) bezeichnenden Überschrift sollte/n die These/n Ausgangspunkt sein, um die weitere Arbeit (Erstellen der Gliederung, Literatursuche etc.) zu organisieren. 23 Schreibtechnik Methoden Assoziationstechnik Assoziationskette: 10-Wort-Reihe - Thema formulieren - Einfälle auflisten - Einfälle bewerten - Beste Ideen auswählen - Augen schließen - Mit der linken Hand über ein gewähltes Thema schreiben - Sinnvolle Textteile unterstreichen - Thema benennen - Alle Einfälle auflisten - Wichtiges unterstreichen - Thema in Kernwort verwandeln - Assoziationsketten zum Kernwort visualisieren - Text verfassen - Thema in Kernwort verwandeln - Hauptthesen im Uhrzeigersinn um Kernwort schreiben - Ideenäste erweitern - Text nach Hauptästen schreiben - Thema benennen - 5 W-Fragen (was, wer, wo, warum, wie) zum Thema stellen - Antworten zu den W-Fragen als Text zusammenfassen - Interview von Fachleuten zum Thema vorbereiten - Interview durchführen - Interview auswerten Individuelles Brainstorming Automatisches Schreiben Listen-Technik Clustern Mind-Mapping W-Fragen Interview Thema (nach Werder, L. v., Grundkurs des wissenschaftlichen Schreibens, Milow 1995, S. 21f.) 24 8. Techniken zum Erforschen der Themen und Thesen Schreibstafette Resultate Meditieren Sie, um ein Thema zu finden. Assoziieren Sie frei zu Ihrem Thema (z.B. mittels Brainstorming). Schreiben Sie ohne Zensur so schnell Sie können über Ihr Thema. Machen Sie ein Cluster zu Ihrem Thema. Malen Sie ein Mind-Map zu Ihrem Thema. Zeichnen Sie induktive und deduktive Leitern zum Kennwort Ihres Themas. Gliedern Sie Ihr Thema systematisch. Stellen Sie alle W-Fragen an Ihr Thema. Suchen Sie Orte auf, an denen Ihr Thema in der Realität praktiziert wird. (nach Werder, L. v., Grundkurs des wissenschaftlichen Schreibens, Milow 1995, S. 23) „Leitern sind lineare Listen, die ausgehend von ihrem Kennwort deduktiv vom Abstrakten zum Konkreten oder induktiv vom Konkreten zum Abstrakten sich aufschichten. Der Deduktiv- und Induktivprozess wird unterstützt, wenn Sie vielstufige Leitern aufs Papier zeichnen und ihre Stufen mit Ihrer Abstraktion oder Konkretion zu Ihrem Kennwort ausfüllen“ (v. Werder, a.a.O.). 25 9. Rhetorische Argumentationsmuster für wissenschaftliche Texte Rhetorische Grundmuster Abstrakte Argumentations- Konkrete Argumentationsmuster muster Deduktion: Vom Allgemeinen zum Besonderen Allgemeine These Konkretisierung 1 Konkretisierung 2 Konkretisierung n Induktion: Vom Besonderen zum Allgemeinen Konkretisierung 1 Konkretisierung 2 Konkretisierung n Allgemeine These Erörterung: These Argument Beispiel Dialektische Ordnung These Antithese Synthese Nach der Zeit Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase n Ursache/Wirkungen Ursache 1 Wirkung 2 Ursache 2 Wirkung 2 Ursache n Wirkung n Gleichheit/Unterschiede Fall A+B: Gleichheit Fall A+B: Unterschiede 26 Ganzes/Teile allgemeine Erkenntnisse spezielle Erkenntnisse im Wechsel Analyse/Kritik Vorstellung eines Textes Kritik eines Textes Nach dem Gefühl Wichtiges Besonders Wichtiges Ganz Wichtiges Sachliche bzw. systematische Ordnung Element 1 Element 2 Element 3 Element 4 Element n des Themas (siehe dazu auch Lutz von Werder, Grundkurs des wissenschaftlichen Schreibens, Berlin/Milow 1995, S. 35f.) Aufgabe 1: Schreiben Sie einen kleinen Text (10 bis 15 Sätze) zum Thema Funktion Sozialer Arbeit in der modernen Gesellschaft. Orientieren Sie sich bei Ihrer Argumentation an die o.g. rhetorischen Grundmuster wissenschaftlichen Schreibens, d.h. wählen Sie ein oder mehrere Muster aus, nach dem bzw. denen Sie die Argumentation(en) Ihres Textes strukturieren wollen. 27 10. Formen des wissenschaftlichen Schreibens A. Beobachten, Beschreiben, Erklären, Bewerten Beobachten heißt aus wissenschaftstheoretischer Sicht etwas von etwas anderem zu unterscheiden und es zu bezeichnen. Beobachten lässt sich dreifach differenzieren: in Beschreiben, Erklären und Bewerten. Beschreiben (Deskription) ist die interpretations- und bewertungsfreie Bezeichnung. Es handelt sich im Idealfall also um eine ‘reine’ Datenerhebung, m.a.W. um die Beobachtung von Phänomenen, die in welchen Hinsichten auch immer ‘einfach nur’ beschrieben werden. Erklären (Explikation) ist das Miteinander-In-Beziehung-Setzen von Beschreibungen, also von Beobachtungen (von Phänomenen). Erklärungen sind individuell konstruierte oder sozial ausgehandelte Zusammenhänge von Beschreibungen, die z.B. eine ‘Ursache’ und eine ‘Wirkung’ im Sinne der Kausalität verknüpfen. Allgemein akzeptierte Erklärungen wurden zumeist durch die Wissenschaft und das heißt durch einen nach bestimmten (Spiel-)Regeln ablaufenden sozialen Aushandlungsprozess gültig gemacht (validiert). Thesen sind in dieser Hinsicht Erklärungen, die im wissenschaftlichen Text noch validiert werden müssen. Bewerten ist das Einordnen von Beobachtungen / Beschreibungen nach bestimmten Maßstäben bzw. Kriterien: z.B. nach sozialen, moralischen, politischen, ökonomischen, ästhetischen etc. Maßstäben und Kriterien. Zum Thema Beschreiben, Erklären, Bewerten schreibt der Sozialwissenschaftler und Psychiater Fritz B. Simon: „Die Relevanz dieser drei Beobachtungsdimensionen [Beschreiben, Erklären, Bewerten; H.K.] wird deutlich, wenn wir Phänomene betrachten, die unter dem Etikett ‘psychische Krankheit’ zusammengefasst werden. Nehmen wir als Beispiel das Verhalten eines Individuums, das sozial auffällig und störend ist. Die Bezeichnungen ‘störend’ und ‘auffällig’ stellen bereits Bewertungen, wenn auch unterschiedlicher Art, dar. Wenn die Störung so weit geht, dass bei irgendwem das Bedürfnis entsteht, sie zu beseitigen, dann beginnt die Suche nach einer Erklärung. Das Verhalten könnte zum Beispiel bewusst gewählt sein (Erklärung: Bosheit eines eigenverantwortlichen Individuums) oder aber Ergebnis einer Krankheit sein (Erklärung: Wirkung eines vom individuellen Willen des ‘Täters’ unabhängigen, autonomen Prozesses). Die ursprüngliche Bewertung induziert die Suche nach einer Erklärung, und die jeweils gewählte Erklärung verändert die Bewertung. In der Folge werden viele (Be-) Handlungskonsequenzen davon abhängen, wie Beschreibungen, Bewertungen und 28 Erklärungen sich gegenseitig beeinflussen [...]. Das diese drei Ebenen für Theorie und Praxis [nicht nur; H.K.] der Therapie von zentraler Bedeutung sind, dürfte deutlich sein“ (Simon, Fritz B., 1995: Die andere Seite der Gesundheit. Ansätze einer systemischen Krankheits- und Therapietheorie. Heidelberg: Auer, S. 20; Hervorhebungen von mir; H.K.). Und dass Erklärungen bzw. Erklärungsprinzipien mit sozialen Einigungs- bzw. Aushandlungsprozessen mehr zu tun haben als mit irgend etwas anderem, verdeutlicht der Philosoph Gregory Bateson in einem fiktiven Dialog mit seiner Tochter: „Tochter: Papi, was ist ein Instinkt? Vater: Ein Instinkt, meine Liebe, ist ein Erklärungsprinzip. T: Aber was erklärt es? V: Alles - fast alles überhaupt. Alles, was man damit erklären will. T: Sei nicht albern. Es erklärt doch nicht die Schwerkraft. V: Nein. Aber nur deshalb, weil niemand will, dass ein ‘Instinkt’ die Schwerkraft erklärt. Wollte man es, dann würde er auch das erklären. Wir könnten einfach sagen, dass der Mond einen Instinkt hat, dessen Stärke sich umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung verändert ... T: Aber das ist Unsinn, Pappi. V: Ja, sicher. Aber du hast doch mit ‘Instinkt’ angefangen, nicht ich. T: Na gut. Aber was erklärt denn dann wirklich Schwerkraft? V: Nichts, mein Schatz, weil Schwerkraft ein Erklärungsprinzip ist. T: Oh. T: Meinst Du, dass man nicht ein Erklärungsprinzip verwenden kann, um ein anderes zu erklären? Niemals? V: Hmmm... kaum jemals. Genau das meinte Newton, als er sagte ‘hypotheses non fingo.’ T: Und was heißt das, bitte? V: Also Du weißt doch, was Hypothesen sind. Jede Behauptung, die zwei deskriptive Behauptungen [Beschreibungen; H.K.] miteinander verbindet, ist eine Hypothese. Wenn Du sagst, dass am 1. Februar und am 1. März Vollmond war und diese Beobachtungen irgendwie miteinander verbindest, ist die verbindende Behauptung eine Hypothese. T: Ja - und ich weiß, was non bedeutet. Was aber heißt fingo? V: Nun - fingo, fingere ist das lateinische Wort für ‘erdichten’, ‘erfinden’. Es bildet ein Verbalsubstantiv fictio, von dem wir das Wort Fiktion herleiten. T: Pappi, meinst du, dass Sir Isaac Newton dachte, dass alle Hypothesen einfach wie Geschichten erfunden werden? V: Ja - genau das. T: Aber hat er denn nicht die Schwerkraft entdeckt? Mit dem Apfel? V: Nein, Liebling. Er hat sie erfunden. 29 T: Oh... Pappi, wer hat den Instinkt erfunden? V: Ich weiß nicht. Vielleicht ist er biblisch. T: Aber wenn die Idee Schwerkraft zwei deskriptive Behauptungen miteinander verbindet, dann muss sie eine Hypothese sein. V: Das stimmt. T: Dann hat Newton also doch eine Hypothese erfunden. V: Ja - in der Tat hat er das getan. Er war ein sehr großer Wissenschaftler. T: Oh“ (Bateson, Gregory, 1969: Metalog: Was ist ein Instinkt?, in: ders.: Ökologie des Geistes. Frankfurt/M.: Suhrkamp: S. 73f.) Aufgabe: Der folgende Text ist ein (verfremdeter) Auszug aus einem sozialarbeiterischen Bericht. Wo und wie wird im Text beschrieben, bewertet und erklärt? Finden Sie die jeweiligen Textstellen und begründen Sie jeweils, warum es sich um die speziellen Beobachtungsformen handelt? „[...] Aufgrund der bereits im letzten Bericht konstatierten (ausgesprochen positiven) Entwicklung in der Familie Müller kann die Erziehungshilfe (§ 31 KJHG) – auf Wunsch von Frau Müller und im Einvernehmen mit mir als zuständige sozialpädagogische Fachkraft – mit dem Ende des kommenden Monats beendet werden. Nicht zuletzt aufgrund ihrer offenen kommunikativen Art konnte Frau Müller sich inzwischen ein eigenes soziales Unterstützungsnetz – auch bezüglich der Erziehung ihres Sohnes Maik – organisieren. So hält sie engen Kontakt mit den Lehrern und der Horterzieherin ihre Sohnes. Des weiteren ließ sie sich über den Vermittlungsdienst für ehrenamtlich Engagierte einen engagierten älteren Herrn („Großvater“) vermitteln, der Maik mehrmals wöchentlich, d.h. während der Spätschicht der Mutter betreut, was von Maik sehr gut angenommen wurde. Auch ist der „Großvater“ zu einem vertrauten Ansprechpartner für Frau Müller geworden, der in der Familie konstruktiv und stützend zu wirken scheint. [...] Maik besucht weiterhin die psychologische Spieltherapie und wird dorthin von seiner Mutter regelmäßig begleitet. Die Mutter ist mit seiner derzeitigen Entwicklung zufrieden. So sei er inzwischen konzentrierter in der Schule und auch weniger vergesslich (siehe zu diesen Symptomen Maiks den letzten Bericht), er hat gute bis befriedigende Schulleistungen. Auch in meiner Arbeit mit Maik, die sich seit einigen Monaten auf zwei bis drei Termine im Monat beschränkte, um einen allmählichen Abschied einzuleiten, beobachtete ich einige Verhaltensänderungen. So wirkte er gelassener auf mich, konnte sich langfristig und ausdauernd auch auf körperlich zum Teil anstrengende Spiele und Unternehmungen (z.B. Fußball, längere Fahrradtouren etc.) einlassen, ohne sich vorschnell erschöpft zu zeigen. Schließlich lässt sich konstatieren, dass die Aufträge der Hilfe erfüllt wurden: Die Mutter ist weiterhin psychisch stabil und konnte – nicht nur in der Hilfe, sondern vor allem auch in einer bereits abgeschlossenen ambulanten Psychotherapie – die aus ihren langjährigen Depressionen resultierenden körperlichen, emotionalen, psychischen und sozialen Folgen 30 thematisieren. Dies führte nicht zuletzt zu einem klareren und eher abgegrenzten, für Frau Müller problemfreieren Verhältnis zu ihrer Herkunftsfamilie. Des weiteren hat sie in der Hilfe und insbesondere auch in der psychologischen Spieltherapie, an der sie als Beobachterin teilnimmt, neue Verhaltensmöglichkeiten kennen gelernt, die sie in der Erziehung von Maik zugleich konsequenter und gelassener werden lassen. Letztlich hat Frau Müller durch ihre positiven Erfahrungen mit sozialpädagogischen und psycho-sozialen Angeboten gelernt, Hilfe anzunehmen und diese auch konstruktiv für sich selbst und für ihre Familie, insbesondere für ihren Sohn zu nutzen. [...]“ B. Deduktion, Induktion, Abduktion Deduktion (‘Vom Allgemeinen zum Besonderen’) bezeichnet eine Grundform des logischen Schließens, bei der aus allgemeinen Theorien konkrete Aussagen abgeleitet werden. (Beispiel - theoretische Grundannahme: „Alle Alkoholiker haben rote Nasen.“ „Diese Menschen sind Alkoholiker.“ Schlussfolgerung: „Diese Menschen haben rote Nasen.“) Bei einer deduktiven Ordnung einer wissenschaftlichen Arbeit entwickelt sich der Text von einer allgemein gehaltenen Leitidee eines Themas (These) hin zu besonderen Themenaspekten, die die Leitidee stützen (validieren) sollen. Induktion (‘Vom Besonderen zum Allgemeinen’) bezeichnet eine Grundform des logischen Schließens, bei der aus besonderen Beobachtungen / Beschreibungen allgemeine theoretische Erklärungen abgeleitet werden. (Beispiel - Beobachtung / Beschreibung: „Diese Menschen sind Alkoholiker.“ „Diese Menschen haben rote Nasen.“ Theoretische Schlussfolgerung: „Alle Alkoholiker haben rote Nasen.“) Bei einer induktiven Ordnung einer wissenschaftlichen Arbeit entwickelt sich der Text durch eine Reihe konkreter Beschreibungen, um schließlich eine theoretische Idee darzustellen. Abduktion (‘Vom besonderen Vielen zum allgemeinen Einen’) bezeichnet eine Form des Schließens, bei der es darum geht, viele verschiedene Beobachtungen / Beschreibungen zu finden, die in einer Begriffsklasse zusammengefasst werden können. (Beispiel - „Alle Alkoholiker haben rote Nasen.“ Beobachtung / Beschreibung: „Diese Menschen haben rote Nasen.“ Schlussfolgerung: „Diese Menschen sind Alkoholiker.“) Bei einer abduktiven Ordnung einer wissenschaftlichen Arbeit werden ausgehend von einer allgemeinen Leitidee (These) so viele Beobachtungen wie möglich beschrieben, um mit diesen die Leitidee stützen zu können (oder aufgeben zu müssen). Es geht bei der Abduktion also um die Zuordnung von besonderen Beobachtungen / Beschreibungen (Merkmalen) zu allgemeinen Klassen oder Begriffen. 31 C. Dekonstruktion Dekonstruktion ist eine Form wissenschaftlichen Schreibens, bei der es darum geht zu beobachten, wie wissenschaftliche Theorien ihren Gegenstandsbereich beschreiben und welche Beschreibungsmöglichkeiten sie aufgrund ihrer Ausgangsunterscheidungen von vornherein ausschließen (müssen). Das Besondere einer Dekonstruktion ist, dass sie wissenschaftliche Beobachtungen (Texte) beobachtet (beschreibt) und diese mit ihren ‘blinden Flecken’ konfrontiert. Ein ‘blinder Fleck’ geht quasi automatisch mit jeder Beobachtung einher; denn er ist deren momentan benutzte Unterscheidung, die Operation, die erst das Anschließen weiterer Unterscheidungen ermöglicht, er ist also, metaphorisch formuliert, das Auge, das sich selbst nicht sehen kann beim Sehen. Aber nicht nur das sehende Auge ist für sein eigenes Sehen unsichtbar, denn es gilt grundsätzlich: „Etwas zu sehen heißt stets, etwas anderes zu übersehen. Es gibt kein Sehen ohne blinden Fleck“ (Wolfgang Welsch). Dekonstruktionen sensibilisieren „für Differenzen und Ausschlüsse“; es geht ihnen um eine Leseweise, die das Ausgegrenzte wieder ans Licht bringt, die das Ausgeblendete einblendet. In dieser Hinsicht verkomplizieren sie trivialisierte wissenschaftliche Positionen, sie befragen sie auf allzu selbstverständliche Argumentationslinien, um neue Theorieansätze und alternative Perspektiven zu ermöglichen. 32 III. Wissenschaftliches Präsentieren Beim mündlichen Referieren geht es darum, zu einem bestimmten Thema, einer Fragestellung oder einem Autor / einer Autorin mündlich das (aus der jeweiligen persönlichen Sicht) Wesentliche vorzutragen. Da die Aufnahmekapazität der zuhörenden Studierenden begrenzt ist und in der Regel eine längere Diskussion des Referats geplant ist, sollte ein Referat kurz sein, d.h. nicht länger als 30, bestenfalls 15 bis 20 Minuten. Tipps zum Referieren: Ein Referat sollte zur Vorbereitung schriftlich ausformuliert werden. Während des Vortrags empfiehlt es sich zu versuchen, so frei wie möglich zu sprechen. Allerdings ist ein langsames und betontes (nicht monotones) Ablesen mit häufigen Blickwechseln vom Vortragsblatt zum Publikum und umgekehrt besser als ein ‚ Äh... und Ah...’-Stammeln zwischen der ‚freien’ Rede. Ein Referat sollte eine Struktur / Gliederung besitzen (‘roter Faden’), die zu Beginn des Vortrags in Zusammenhang mit dem Austeilen des Thesenpapiers vorzustellen ist. Der Übergang von einem Teil des Referats zum nächsten sollte ausdrücklich betont werden (z.B. „Ich komme jetzt zu Punkt ... meines Vortrags“). Neben dem Thesenpapier können OHFolien die Anschaulichkeit von Referaten verbessern. Als Referierende/r sollte man zu Beginn des Vortrags seine Regeln bezüglich der Möglichkeit von Zwischenfragen artikulieren. Wenn das Referat kurz gehalten wird, ist zu empfehlen, keine Zwischenfragen zuzulassen, sondern am Ende alle inhaltlichen oder Verständnisfragen zu beantworten. Es ist zu empfehlen, Referate zu Hause probeweise (vor dem Spiegel, vor Freunden etc.) vorzutragen und insbesondere bezüglich der zeitlichen Dauer zu testen. Das Thesenpapier ist eine schriftliche Aufbereitung der Gliederung / Struktur des Referats sowie der wichtigsten Fakten, Thesen und Erklärungen für die Zuhörer. Daher ist es an jeden Seminarteilnehmer auszuteilen oder als OH-Folie während des Referats an „die Wand zu werfen“. 33 Beispiel für ein Thesenpapier für ein Referat ASFH Berlin Hanno Sozialisierer 5. Semester Seminar: Methoden Sozialer Arbeit Seminarleiter: Prof. Weißbescheid Thesenpapier zum Referat: Paradigmenwechsel in den Humanwissenschaften (am Beispiel der Psychologie) nach F. Capra 1. Begriff Paradigma: Konstellation von Überzeugungen, Wertvorstellungen und Techniken, die alle Mitglieder eines bestimmten Wissenschaftsgebietes teilen; 2. Das kartesianisch-newtonsche Paradigma oder Weltbild (R. Descartes 1596-1650 / I. Newton 1643-1727) Ausgangsannahmen: Geist und Materie bzw. Körper und Bewusstsein existieren getrennt voneinander; die Realität ist objektiv, d.h. unabhängig von unserem Bewusstsein gegeben Methoden des wiss. Arbeitens: Analyse (Zerlegung, Auflösung); Reduktionismus (komplexe Ganzheiten werden in die Funktionsweise ihrer Einzelteile zerlegt); Denken in linearen Ursache/Wirkungs-Ketten; Zentrale Aussage: Das gesamte Universum (die Natur, die Gesellschaft, der Mensch) funktioniert wie eine riesige komplizierte Maschinerie (‘mechanistisches Weltbild’) 2.1 Die klassische Psychologie des kartesianisch-newtonschen Paradigmas. 2.1.1 Behaviorismus: "Psychologie wie sie der Behaviorist sieht, ist ein streng objektiver Zweig der Naturwissenschaft. Ihr theoretisches Ziel ist die Vorhersage und Kontrolle des Verhaltens. Introspektion (Selbstbeobachtung) spielt keine wesentliche Rolle." (Zitat: John Watson 1913, zit. nach Fachlexikon der sozialen Arbeit 1993, S. 125) 2.1.2 Die Psychoanalyse: "Analytiker...können ihre Herkunft aus der exakten Naturwissenschaft und ihre Gemeinschaft mit deren Repräsentanten nicht verleugnen...Analytiker sind im Grunde unbelehrbare Mechanisten und Materialisten." (Zitat: Sigmund Freud, zit. nach Capra 1982, S. 194) 3. Ein neues Paradigma - Die ganzheitliche Sicht der menschlichen Wirklichkeit Ausgangsannahmen (inspiriert durch die ‘neue’ Physik): Komplementaritätsprinzip - unkontrollierbare Wechselbeziehung zwischen Beobachtungsgegenstand und Beobachtungsmethode; Bewusstsein und Materie existieren abhängig voneinander; Ablösung des linearen Ursache-Wirkungs-Denkens durch ein Denken von zirkulär rückgekoppelt wirkenden Prozessen; Zentrale Aussage: Alle Phänomene - physikalische, biologische, psychische, gesellschaftliche und kulturelle sind grundsätzlich miteinander verbunden und voneinander abhängig und lassen sich nach einheitlichen Kriterien beschreiben (‘ganzheitliches Weltbild’ bzw. ‘Systembild des Lebens’); 3.1 Die ganzheitliche Psychologie Ausgangsannahme: Ein Mensch wird in seiner Sozialisation und Lebensweise gleichermaßen von körperlichen, seelischen, sozialen und spirituellen Bedingungen und Bedürfnissen geprägt. 3.1.1 Psychosomatischer Ansatz von Wilhelm Reich (1897-1957) Ausgangsannahme: Körper und Psyche funktionieren trotz ihrer Gegensätzlichkeit identisch, denn ihnen liegt dieselbe lebensenergetische Quelle zugrunde. 3.1.2 Transpersonaler Ansatz von Carl Gustav Jung (1875-1961): Das individuelle Unbewusste sowie das Bewusste entstammen dem kollektiven Unbewussten, an dem die gesamte Menschheit teilhat. 3.1.3 Systemischer Ansatz von Gegory Bateson (1904-1980) Psychische Probleme (z.B. ‘Neurosen’, ‘Psychosen’ etc.) haben mehr mit der Interaktion, der Kommunikation, den Regeln und Mustern des menschlichen Miteinanders innerhalb von sozialen Systemen (z.B. der Familie) zu tun als mit der individuellen Psyche der Betroffenen. Literatur: Capra, Fritjof (1982): Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. dtv. Stuttgart (1991) 34