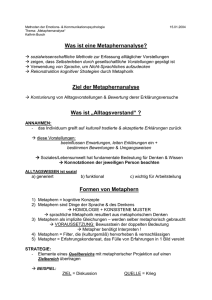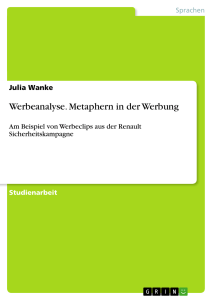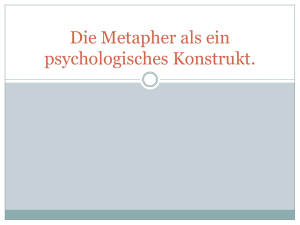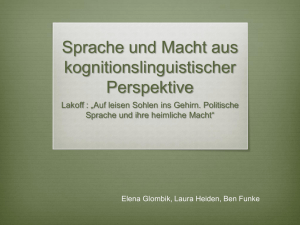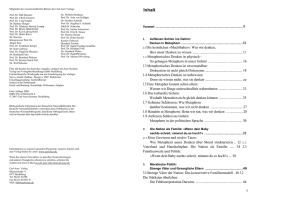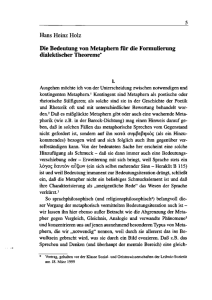Die Geburt der Tragödie
Werbung
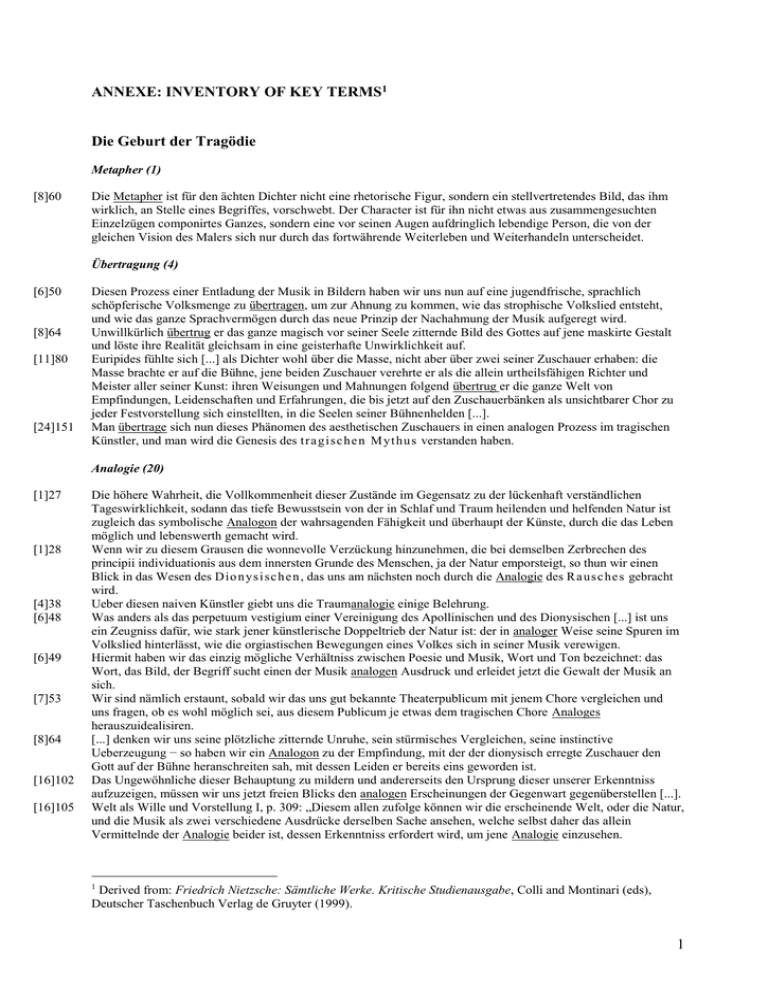
ANNEXE: INVENTORY OF KEY TERMS1 Die Geburt der Tragödie Metapher (1) [8]60 Die Metapher ist für den ächten Dichter nicht eine rhetorische Figur, sondern ein stellvertretendes Bild, das ihm wirklich, an Stelle eines Begriffes, vorschwebt. Der Character ist für ihn nicht etwas aus zusammengesuchten Einzelzügen componirtes Ganzes, sondern eine vor seinen Augen aufdringlich lebendige Person, die von der gleichen Vision des Malers sich nur durch das fortwährende Weiterleben und Weiterhandeln unterscheidet. Übertragung (4) [6]50 [8]64 [11]80 [24]151 Diesen Prozess einer Entladung der Musik in Bildern haben wir uns nun auf eine jugendfrische, sprachlich schöpferische Volksmenge zu übertragen, um zur Ahnung zu kommen, wie das strophische Volkslied entsteht, und wie das ganze Sprachvermögen durch das neue Prinzip der Nachahmung der Musik aufgeregt wird. Unwillkürlich übertrug er das ganze magisch vor seiner Seele zitternde Bild des Gottes auf jene maskirte Gestalt und löste ihre Realität gleichsam in eine geisterhafte Unwirklichkeit auf. Euripides fühlte sich [...] als Dichter wohl über die Masse, nicht aber über zwei seiner Zuschauer erhaben: die Masse brachte er auf die Bühne, jene beiden Zuschauer verehrte er als die allein urtheilsfähigen Richter und Meister aller seiner Kunst: ihren Weisungen und Mahnungen folgend übertrug er die ganze Welt von Empfindungen, Leidenschaften und Erfahrungen, die bis jetzt auf den Zuschauerbänken als unsichtbarer Chor zu jeder Festvorstellung sich einstellten, in die Seelen seiner Bühnenhelden [...]. Man übertrage sich nun dieses Phänomen des aesthetischen Zuschauers in einen analogen Prozess im tragischen Künstler, und man wird die Genesis des tr a g i sc he n M yt h u s verstanden haben. Analogie (20) [1]27 [1]28 [4]38 [6]48 [6]49 [7]53 [8]64 [16]102 [16]105 Die höhere Wahrheit, die Vollkommenheit dieser Zustände im Gegensatz zu der lückenhaft verständlichen Tageswirklichkeit, sodann das tiefe Bewusstsein von der in Schlaf und Traum heilenden und helfenden Natur ist zugleich das symbolische Analogon der wahrsagenden Fähigkeit und überhaupt der Künste, durch die das Leben möglich und lebenswerth gemacht wird. Wenn wir zu diesem Grausen die wonnevolle Verzückung hinzunehmen, die bei demselben Zerbrechen des principii individuationis aus dem innersten Grunde des Menschen, ja der Natur emporsteigt, so thun wir einen Blick in das Wesen des Dio n ys i sc h e n , das uns am nächsten noch durch die Analogie des R a us c he s gebracht wird. Ueber diesen naiven Künstler giebt uns die Traumanalogie einige Belehrung. Was anders als das perpetuum vestigium einer Vereinigung des Apollinischen und des Dionysischen [...] ist uns ein Zeugniss dafür, wie stark jener künstlerische Doppeltrieb der Natur ist: der in analoger Weise seine Spuren im Volkslied hinterlässt, wie die orgiastischen Bewegungen eines Volkes sich in seiner Musik verewigen. Hiermit haben wir das einzig mögliche Verhältniss zwischen Poesie und Musik, Wort und Ton bezeichnet: das Wort, das Bild, der Begriff sucht einen der Musik analogen Ausdruck und erleidet jetzt die Gewalt der Musik an sich. Wir sind nämlich erstaunt, sobald wir das uns gut bekannte Theaterpublicum mit jenem Chore vergleichen und uns fragen, ob es wohl möglich sei, aus diesem Publicum je etwas dem tragischen Chore Analoges herauszuidealisiren. [...] denken wir uns seine plötzliche zitternde Unruhe, sein stürmisches Vergleichen, seine instinctive Ueberzeugung − so haben wir ein Analogon zu der Empfindung, mit der der dionysisch erregte Zuschauer den Gott auf der Bühne heranschreiten sah, mit dessen Leiden er bereits eins geworden ist. Das Ungewöhnliche dieser Behauptung zu mildern und andererseits den Ursprung dieser unserer Erkenntniss aufzuzeigen, müssen wir uns jetzt freien Blicks den analogen Erscheinungen der Gegenwart gegenüberstellen [...]. Welt als Wille und Vorstellung I, p. 309: „Diesem allen zufolge können wir die erscheinende Welt, oder die Natur, und die Musik als zwei verschiedene Ausdrücke derselben Sache ansehen, welche selbst daher das allein Vermittelnde der Analogie beider ist, dessen Erkenntniss erfordert wird, um jene Analogie einzusehen. 1 Derived from: Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Colli and Montinari (eds), Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter (1999). 1 [16]106 [16]107 [16]107 [17]112 [19]128 [20]130 [21]138 [24]151 Man könnte demnach die Welt ebensowohl verkörperte Musik, als verkörperten Willen nennen: daraus also ist es erklärlich, warum Musik jedes Gemälde, ja jede Scene des wirklichen Lebens und der Welt, sogleich in erhöhter Bedeutsamkeit hervortreten lässt; freilich um so mehr, je analoger ihre Melodie dem innern Geiste der gegebenen Erscheinung ist. Wann nun im einzelnen Fall eine solche Beziehung wirklich vorhanden ist, also der Componist die Willensregungen [...] in der allgemeinen Sprache der Musik auszusprechen gewusst hat: dann ist die Melodie des Liedes, die Musik der Oper ausdrucksvoll. Die vom Componisten aufgefundene Analogie zwischen jenen beiden muss aber aus der unmittelbaren Erkenntniss des Wesens der Welt, seiner Vernunft unbewusst, hervorgegangen [...]. Wir verstehen also, nach der Lehre Schopenhauer’s, die Musik als die Sprache des Willens unmittelbar und fühlen unsere Phantasie angeregt, jene zu uns redende, unsichtbare und doch so lebhaft bewegte Geisterwelt zu gestalten und sie in einem analogen Beispiel uns zu verkörpern. Denn wenn sie unsere Ergetzung nur dadurch zu erregen sucht, dass sie uns zwingt, äusserliche Analogien zwischen einem Vorgange des Lebens und der Natur und gewissen rhythmischen Figuren und charakteristischen Klängen der Musik zu suchen, wenn sich unser Verstand an der Erkenntniss dieser Analogien befriedigen soll, so sind wir in eine Stimmung herabgezogen, in der eine Empfängniss des Mythischen unmöglich ist [...]. [...] wohin weist uns das Mysterium dieser Einheit zwischen der deutschen Musik und der deutschen Philosophie, wenn nicht auf eine neue Daseinsform, über deren Inhalt wir uns nur aus hellenischen Analogien ahnend unterrichten können? Denn diesen unausmessbaren Werth behält für uns, die wir an der Grenzscheide zweier verschiedener Daseinsformen stehen, das hellenische Vorbild, dass in ihm auch alle jene Uebergänge und Kämpfe zu einer classisch-belehrenden Form ausgeprägt sind: nur dass wir gleichsam in u mg e k e hr ter Ordnung die grossen Hauptepochen des hellenischen Wesens analogisch durcherleben und zum Beispiel jetzt aus dem alexandrinischen Zeitalter rückwärts zur Periode der Tragödie zu schreiten scheinen. [...] in welcher peinlichen Verwirrung müssen die derartig Gebildeten einer solchen Gegenwart jenes Phänomen anstarren, das nur etwa aus dem tiefsten Grunde des bisher unbegriffnen hellenischen Genius analogisch zu begreifen wäre, das Wiedererwachen des dionysischen Geistes und die Wiedergeburt der Tragödie? Was vermöchte der Wortdichter Analoges zu bieten, der mit einem viel unvollkommneren Mechanismus, auf indirectem Wege, vom Wort und vom Begriff aus, jene innerliche Erweiterung der schaubaren Bühnenwelt und ihre innere Erleuchtung zu erreichen sich abmüht? Man übertrage sich nun dieses Phänomen des aesthetischen Zuschauers in einen analogen Prozess im tragischen Künstler, und man wird die Genesis des tr a g i sc he n M yt h u s verstanden haben. Ähnlich (20) [1]25 [1]26 [2]32 [7]56 [8]58 [8]61 [8.]63 [11]80 [12]86 [12]87 [14]94 [...] dass die Fortentwicklung der Kunst an die Duplicität des Ap o l li n i sc he n und des D io n ys i sc he n gebunden ist: in ähnlicher Weise, wie die Generation von der Zweiheit der Geschlechter [...] abhängt. [...] der hellenische Dichter, um die Geheimnisse der poetischen Zeugung gefragt, würde ebenfalls an den Traum erinnert und eine ähnliche Belehrung gegeben haben, wie sie Hans Sachs in den Meistersingern giebt [...]. Bedenklichter und sogar unmöglich wurde dieser Widerstand, als endlich aus der tiefsten Wurzel des Hellenischen heraus sich ähnliche Triebe Bahn brachen [...]. In diesem Sinne hat der dionysische Mensch Aehnlichkeit mit Hamlet: beide haben einmal einen wahren Blick in das Wesen der Dinge gethan [...]. Der Contrast dieser eigentlichen Naturwahrheit und der sich als einzige Realität gebärdenden Culturlüge ist ein ähnlicher wie zwischen dem ewigen Kern der Dinge, dem Ding an sich, und der gesammten Erscheinungswelt [...]. Hier ist etwas Anderes als der Rhapsode, der mit seinen Bildern nicht verschmilzt, sondern sie, dem Maler ähnlich, mit betrachtendem Auge ausser sich sieht [...]. Denken wir uns Admet mit tiefem Sinnen seiner jüngst abgeschiedenen Gattin Alcestis gedenkend und ganz im geistigen Anschauen derselben sich verzehrend − wie ihm nun plötzlich ein ähnlich gestaltetes, ähnlich schreitendes Frauenbild in Verhüllung entgegengeführt wird [...]. Von ihm [Euripides] könnte man sagen, dass die ausserordentliche Fülle seines kritischen Talentes, ähnlich wie bei Lessing, einen productiv künstlerischen Nebentrieb wenn nicht erzeugt, so doch fortwährend befruchtet habe. [...] in ähnlicher Weise, wie Descartes die Realität der empirischen Welt nur durch die Appellation an die Wahrhaftigkeit Gottes und seine Unfähigkeit zur Lüge zu beweisen vermochte. Und wenn Anaxagoras mit seinem „Nous“ unter den Philosophen wie der erste Nüchterne unter lauter Trunkenen erschien, so mag auch Euripides sein Verhältniss zu den anderen Dichtern der Tragödie unter einem ähnlichen Bilde begriffen haben. Wirklich hat für die ganze Nachwelt Plato das Vorbild einer neuen Kunstform gegeben, das Vorbild des Ro ma n ’s: der als die unendlich gesteigerte aesopische Fabel zu bezeichnen ist, in der die Poesie in einer 2 [14]96 [16]104 [16]105 [17]109 [19]126 [22]143 [23]149 [24]153 ähnlichen Rangordnung zur dialektischen Philosophie lebt, wie viele Jahrhunderte hindurch dieselbe Philosophie zur Theologie: nämlich als ancilla. Das war etwas der dämonischen warnenden Stimme Aehnliches, was ihn zu diesen Uebungen drängte [...]. [...] obgleich eine irrige Aesthetik, an der Hand einer missleiteten und entarteten Kunst, von jenem in der bildnerischen Welt geltenden Begriff der Schönheit aus sich gewöhnt habe, von der Musik eine ähnliche Wirkung wie von den Werken der bildenden Kunst zu fordern, nämlich die Erregung d e s Ge fal le n s a n s c hö ne n Fo r me n. [...] dennoch kann er [der Mensch], wenn er sich besinnt, keine Aehnlichkeit angeben zwischen jenem Tonspiel und den Dingen, die ihm vorschwebten. Das Gefüge der Scenen und die anschaulichen Bilder offenbaren eine tiefere Weisheit, als der Dichter selbst in Worte und Begriffe fassen kann: wie das Gleiche auch bei Shakespeare beobachtet wird, dessen Hamlet z.B. in einem ähnlichen Sinne oberflächlicher redet als er handelt [...]. [...] wo das höchste Ziel bestenfalls auf eine umschreibende Tonmalerei gerichtet sein wird, ähnlich wie ehedem im neuen attischen Dithyrambus? Oder es würde vom Dramatiker eine grossartigere, mindestens aufregende Tendenz der politischen und sozialen Gegenwart so deutlich vorgetragen, dass der Zuhörer seine kritische Erschöpfung vergessen und sich ähnlichen Affecten überlassen konnte, wie in patriotischen oder kriegerischen Momenten […]. Aber nie möge er glauben, ähnliche Kämpfe ohne seine Hausgötter [...] kämpfen zu können. Jenes Streben in’s Unendliche, der Flügelschlag der Sehnsucht, bei der höchsten Lust an der deutlich percipirten Wirklichkeit, erinnern daran, dass wir in beiden Zuständen ein dionysisches Phänomen zu erkennen haben, das uns immer von Neuem wieder das spielende Aufbauen und Zertrümmern der Individualwelt als den Ausfluss einer Urlust offenbart, in einer ähnlichen Weise, wie wenn von Heraklit dem Dunklen die weltbildende Kraft einem Kinde verglichen wird […]. Gleich (93)2 Vers[3]14 Nochmals gesagt, heute ist es mir ein unmögliches Buch, – ich heisse es schlecht geschrieben, schwerfällig, peinlich, bilderwüthig und bilderwirrig, gefühlsam, hier und da verzuckert bis zum Femininischen, ungleich im Tempo [...]. Vers[4]15 Eine Grundfrage ist das Verhältniss des Griechen zum Schmerz, sein Grad von Sensibilität, − blieb dies Verhältniss sich gleich? Vers[4]16 [K]önnte vielleicht [...] der Sieg des Op t i mi s mu s , die vorherrschend gewordene V er n ü n fti g ke it , der praktische und theoretische U til it ar i s mu s , gleich der Demokratie selbst, mit der er gleichzeitig ist, – ein Symptom der absinkenden Kraft, des nahenden Alters, der physiologischen Ermüdung sein? Vers[5]17 In der That, das ganze Buch kennt nur einen Künstler-Sinn un –Hintersinn hinter allem Geschehen, − einen „Gott", wenn man will, aber gewiss nur einen gänzlich unbedenklichen und unmoralischen Künstler-Gott, der im Bauen wie im Zerstören, im Guten wie im Schlimmen, seiner gleichen Lust und Selbstherrlichkeit inne werden will […]. Vers[6]20 [...] wie müsste eine Musik beschaffen sein, welche nicht mehr romantischen Ursprungs wäre, gleich der deutschen, − sondern d io n ys is c he n ?... [Vorw]23 [...] um auch die Einleitungsworte zu derselben mit der gleichen beschaulichen Wonne schreiben zu können [...]. [Vorw]23 Sie werden dabei sich erinnern, dass ich zu gleicher Zeit, als Ihre herrliche Festschrift über Beethoven entstand [...] mich zu diesem Gedanken sammelte. [1]27 [...] vielleicht erinnert sich mancher, gleich mir, in den Gefährlichkeiten und Schrecken des Traumes sich mitunter ermuthigend und mit Erfolg zugerufen zu haben: „Es ist ein Traum! Ich will ihn weiter träumen!" [1]29 Auch im deutschen Mittelalter wälzten sich unter der gleichen dionysischen Gewalt immer wachsende Schaaren, singend und tanzend, von Ort zu Ort […]. [2]31 [...] wie sich ihm nun, durch apollinische Traumeinwirkung, sein eigener Zustand, d.h. seine Einheit mit dem innersten Grunde der Welt in ei ne m g le ic h n is sa rt i ge n T rau mb i ld e offenbart. [2]31 […] wird man sich nicht entbrechen können […] eine ihren besten Reliefs ähnelnde Folge der Scenen vorauszusetzen, deren Vollkommenheit uns, wenn eine Vergleichung möglich wäre, gewiss berechtigen würde, die träumenden Griechen als Homere und Homer als einen träumenden Griechen zu bezeichnen: in einem tieferen Sinne als wenn der moderne Mensch sich hinsichtlich seines Traumes mit Shakespeare zu vergleichen wagt. [2]32 Sehen wir aber, wie sich unter dem Drucke jenes Friedensschlusses die dionysische Macht offenbarte, so erkennen wir jetzt, im Vergleiche mit jenen babylonischen Sakäen und ihrem Rückschritte des Menschen zum Tiger und Affen, in den dionysischen Orgien der Griechen die Bedeutung von Welterlösungsfesten und Verklärungstagen. [2]33 […] die erschütternde Gewalt des Tones, der einheitliche Strom des Melos und die durchaus unvergleichliche Welt der Harmonie. 2 Words like ‘gleichsam’ (as it were) and ‘zugleich’ (at the same time) have been excluded from this inventory. 3 [2]34 [3]36 [4]38 [4]39 [4]39 [5]42 [5]44 [5]44 [5]45 [5]48 [6]49 [6]50 [6]51 [6]51 [6]51 [7]53 [7]53 [7]55 [7]55 [7]56 [8]59 [8]60 [8]64 [8]64 [9]67 [9]69 [9]71 […] der dithyrambische Dionysusdiener wird somit nur von Seinesgleichen verstanden! Wenn die Klage einmal ertönt, so klingt sie wieder vom kurzlebenden Achilles, von dem blättergleichen Wechsel und Wandel des Menschengeschlechts, von dem Untergang der Heroenzeit. So gewiss von den beiden Hälften des Lebens, der wachen und der träumenden Hälfte, uns die erstere als die ungleich bevorzugtere, wichtigere, würdigere, lebenswerthere, ja allein gelebte dünkt […]. Ra fael , selbst einer jener unsterblichen „Naiven“, hat uns in einem gleichnissartigen Gemälde jenes Depotenziren des Scheins zum Schein […] dargestellt. Aus diesem Schein steigt nun, wie ein ambrosischer Duft, eine visionsgleiche neue Scheinwelt empor […]. [...] in der sicheren Empfindung, das nur diese beiden gleich völlig originalen Naturen […] zu erachten seien. [...] jetzt aber wird diese Musik ihm wieder wie in einem gl eic h n is sa rt i ge n T ra u mb i ld e , unter der apollinischen Traumeinwirkung sichtbar. Jener bild- und begrifflose Wiederschein des Urschmerzes in der Musik, mit seiner Erlösung im Scheine, erzeugt jetzt eine zweite Spiegelung, als einzelnes Gleichniss oder Exempel. Der lyrische Genius fühlt aus dem mystischen Selbstentäusserungs- und Einheitszustande eine Bilder- und Gleichnisswelt hervorwachsen, die eine ganz andere Färbung, Causalität und Schnelligkeit hat als jene Welt des Plastikers und Epikers. In Wahrheit ist Archilochus, der leidenschaftlich entbrannte liebende und hassende Mensch nur eine Vision des Genius, der bereits nicht mehr Archilochus, sondern Weltgenius ist und der seinen Urschmerz in jenem Gleichnisse vom Menschen Archilochus symbolisch ausspricht [...]. [...] denn in jenem Zustande ist er, wunderbarerweise, dem unheimlichen Bild des Märchens gleich, das die Augen drehn und sich selber anschaun kann [...]. Vom Standpunkte des Epos ist diese ungleiche und unregelmässige Bilderwelt der Lyrik einfach zu verurtheilen [...]. [...] so sind das ebenfalls nur gleichnissartige, aus der Musik geborne Vorstellungen [...]. [...] unter dem Triebe, in apollinischen Gleichnissen von der Musik zu reden, versteht er die ganze Natur und sich in ihr nur als das ewig Wollende, Begehrende, Sehnende. [...] sein eignes Wollen, Sehnen, Stöhnen, Jauchzen ist ihm ein Gleichniss, mit dem er die Musik sich deutet. Ihr gegenüber ist vielmehr jede Erscheinung nur Gleichniss [...]. Wir sind nämlich erstaunt, sobald wir das uns gut bekannte Theaterpublicum mit jenem Chore vergleichen und uns fragen, ob es wohl möglich sei, aus diesem Publicum je etwas dem tragischen Chore Analoges herauszuidealisiren. Und das sollte die höchste und reinste Art des Zuschauers sein, gleich den Okeaniden den Prometheus für leiblich vorhanden und real zu halten? Dabei ist es doch keine willkürlich zwischen Himmel und Erde hineinphantasirte Welt; vielmehr eine Welt von gleicher Realität und Glaubwürdigkeit, wie sie der Olymp sammt seinen Insassen für den gläubigen Hellenen besass. Vielleicht gewinnen wir einen Ausgangspunkt der Betrachtung, wenn ich die Behauptung hinstelle, dass sich der Satyr, das fingirte Naturwesen, zu dem Culturmenschen in gleicher Weise verhält, wie die dionysische Musik zur Civilisation. In gleicher Weise, glaube ich, fühlte sich der griechische Culturmensch im Angesicht des Satyrchors aufgehoben [...]. [...] so spricht bereits die Symbolik des Satyrchors in einem Gleichniss jenes Urverhältniss zwischen Ding an sich und Erscheinung aus. Der Charakter [der Metapher] ist für ihn nicht etwas aus zusammengesuchten Einzelzügen componirtes Ganzes, sondern eine vor seinen Augen aufdringlich lebendige Person, die von der gleichen Vision des Malers sich nur durch das fortwährende Weiterleben und Weiterhandeln unterscheidet. [...] denken wir uns seine plötzliche zitternde Unruhe, sein stürmisches Vergleichen, seine instinctive Ueberzeugung – so haben wir ein Analogon zu der Empfindung, mit der der dionysisch erregte Zuschauer den Gott auf der Bühne heranschreiten sah […]. Dies ist der apollinische Traumeszustand, in dem die Welt des Tages sich verschleiert und eine neue Welt, deutlicher, verständlicher, ergreifender als jene und doch schattengleicher, in fortwährendem Wechsel sich unserem Auge neu gebiert. Was uns hier der Denker Aeschylus zu sagen hatte, was er aber als Dichter durch sein gleichnissartiges Bild uns nur ahnen lässt, das hat uns der jugendliche Goethe in den verwegenen Worten seines Prometheus zu enthüllen gewusst: “Hier sitz ich, forme Menschen Nach meinem Bilde, Ein Geschlecht, das mir gleich sei […]” Und so stellt gleich das erste philosophische Problem einen peinlichen unlösbaren Widerspruch zwischen Mensch und Gott hin und rückt ihn wie einen Felsblock an die Pforte jeder Cultur. „Alles Vorhandene ist gerecht und ungerecht und in beidem gleich berechtigt.“ 4 [10]71 [10]72 [10]72 [11]79 [11]81 [12]82 [12]84 [12]85 [12]87 [14]95 [15]97 [16]105 [16]106 [16]107 [16]107 [17]109 [17]110 [17]112 [18]116 [19]121 [19]123 [19]125 [19]128 [20]129 [20]131 [21]132 [21]132 [21]134 [21]134 Aber mit der gleichen Sicherheit darf behauptet werden, dass niemals bis auf Euripides Dionysus aufgehört hat, der tragische Held zu sein [...]. [...] und dass er [der erscheinende Gott] überhaupt mit dieser epischen Bestimmtheit und Deutlichkeit er sc he i nt , ist die Wirkung des Traumdeuters Apollo, der dem Chore seinen dionysischen Zustand durch jene gleichnissartige Erscheinung deutet. [...] wobei angedeutet wird, dass diese Zerstückelung, das eigentlich dionysische Le id e n, gleich einer Umwandlung in Luft, Wasser, Erde und Feuer sei [...]. Nun aber ist „Publicum“ nur ein Wort und durchaus keine gleichartige und in sich verharrende Grösse. Wie ungleichmässig die Vertheilung von Glück und Unglück! [...] um am Ende desselben mit einer Glorification seines Gegners und einem Selbstmorde seine Laufbahn zu schliessen, einem Schwindelnden gleich [...]. So ist das euripideische Drama ein zugleich kühles und feuriges Ding, zum Erstarren und zum Verbrennen gleich befähigt [...]. Was wir im Vergleich mit der sophokleischen Tragödie so häufig dem Euripides als dichterischen Mangel und Rückschritt anzurechnen pflegen […]. Auch der göttliche Plato redet vom schöpferischen Vermögen des Dichters, insofern dies nicht die bewusste Einsicht ist, zu allermeist nur ironisch und stellt es der Begabung des Wahrsagers und Traumdeuters gleich [...]. Er wagt es nicht mehr, dem Chor den Hauptantheil der Wirkung anzuvertrauen, sondern schränkt sein Bereich dermaassen ein, dass er jetzt fast den Schauspielern coordinirt erscheint, gleich als ob er aus der Orchestra in die Szene hineingehoben würde [...]. Im Sinne dieser letzen ahnungsvollen Fragen muss nun ausgesprochen werden, wie der Einfluss des Sokrates, bis auf diesen Moment hin, ja in alle Zukunft hinaus, sich, gleich einem in der Abendsonne immer grösser werdenden Schatten, über die Nachwelt hin ausgebreitet hat [...]. Sie [die Musik] gleicht hierin den geometrischen Figuren und den Zahlen [...]. Denn die Melodien sind gewissermaassen, gleich den allgemeinen Begriffen, ein Abstractum der Wirklichkeit. [...] die Musik reizt zum gle i ch n i ss ar t i ge n An s c ha u e n der dionysischen Allgemeinheit, die Musik lässt sodann das gleichnissartige Bild in hö c hs ter B ed e u ts a m ke it hervortreten. Aus diesen […] Thatsachen erschliesse ich die Befähigung der Musik, d e n M yt h u s d.h. das bedeutsamste Exempel zu gebären und gerade den tr a gi sc he n Mythus: den Mythus, der von der dionysischen Erkenntnis in Gleichnissen redet. [...] wie das Gleiche auch bei Shakespeare beobachtet wird [...]. Wir freilich müssen uns die Uebermacht der musikalischen Wirkung fast auf gelehrtem Wege reconstruiren, um etwas von jenem unvergleichlichen Troste zu empfangen, der der wahren Tragödie zu eigen sein muss. [...] wenn er [Aristophanes] Sokrates selbst, die Tragödie des Euripides und die Musik der neueren Dithyrambiker in dem gleichen Gefühle des Hasses zusammenfasste [...]. Wie unverständlich müsste einem ächten Griechen der an sich verständliche moderne Culturmensch Fa u st erscheinen, der durch alle Facultäten unbefriedigt stürmende, aus Wissenstrieb der Magie und dem Teufel ergebene Faust, den wir nur zur Vergleichung neben Sokrates zu stellen haben [...]. [...] dies rasch wechselnde Bemühen, bald auf den Begriff und die Vorstellung, bald auf den musikalischen Grund des Zuhörers zu werken, ist etwas so gänzlich Unnatürliches und den Kunsttrieben des Dionysischen und des Apollinischen in gleicher Weise so innerlich Widersprechendes [...]. Ich stelle daneben noch eine eben so deutliche Bestätigung meiner Ansicht, dass die Oper auf den gleichen Prinzipien mit unserer alexandrinischen Cultur aufgebaut ist. [...] wobei man vielleicht einmal ahnt, dass diese vermeinte Wirklichkeit nichts als ein phantastisch läppisches Getändel ist, dem jeder, der es an dem furchtbaren Ernst der wahren Natur zu messen und mit den eigentlichen Urscenen der Menschheitsanfänge zu vergleichen vermöchte, mit Ekel zurufen müsste: Weg mit dem Phantom! Erinnern wir uns sodann, wie dem aus gleichen Quellen strömenden Geiste d er d e u t sc h en P h ilo so p hi e , durch Kant und Schopenhauer, es ermöglicht war, die zufriedne Daseinslust der wissenschaftlichen Sokratik, durch den nachweis ihrer Grenzen, zu vernichten [...]. [...] das Streben, auf einer gleichen Bahn zur Bildung und zu den Griechen zu kommen [...]. Ein solcher Dürerscher Ritter war unser Schopenhauer: ihm fehlte jede Hoffnung, aber er wollte die Wahrheit. Es giebt nicht Seinesgleichen. [...]dass nur von den Griechen gelernt werden kann, was ein solches wundergleiches plötzliches Aufwachen der Tragödie für den innersten Lebensgrund eines Volkes zu bedeuten hat. Wer würde gerade bei diesem Volke […] noch einen so gleichmässig kräftigen Erguss des einfachsten politischen Gefühls […] vermuthen? [...] der dann, einem mächtigen Titanen gleich, die ganze dionysische Welt auf seinen Rücken nimmt [...]. Die Tragödie stellt zwischen die universale Geltung ihrer Musik und den dionysisch empfänglichen Zuhörer ein erhabenes Gleichniss, den Mythus [...]. 5 [21]136 [21]137 [21]138 [22]141 [22]143 [22]144 [22]144 [23]146 [23]149 [24]150 [24]150 [24]152 [24]153 [24]153 [25]154 Hier drängt sich zwischen unsre höchste Musikerregung und jene Musik der tragische Mythus und der tragische Held, im Grunde nur als Gleichniss der alleruniversalsten Thatsachen, von denen allein die Musik auf directem Wege reden kann. Als Gleichniss würde nun aber der Mythus [...] gänzlich wirkungslos und unbeachtet neben uns stehen bleiben [...]. [...] wie das Gleichnissbild des Mythus [...]. [...] und zahllose Erscheinungen jener Art dürften an der gleichen Musik vorüberziehn [...]. [...] gleich einer üppigen Gottheit der individuatio [...]. [...] der Student, der Schulknabe, ja selbst das harmloseste weibliche Geschöpf war wider sein Wissen bereits durch Erziehung und Journale zu einer gleichen Perception eines Kunstwerks vorbereitet. Dagegen dürfte mancher edler und zarter von der Natur Befähigte, ob er gleich in der geschilderten Weise allmählich zum kritischen Barbaren geworden war, von einer eben so unerwarteten als gänzlich unverständlichen Wirkung zu erzählen haben [...]. [...] so dass auch jene unbegreiflich verschiedenartige und durchaus unvergleichliche Empfindung […] vereinzelt blieb […]. Man müsste auch an unserem deutschen Wesen schmerzlich verzweifeln, wenn es bereits in gleicher Weise mit seiner Cultur unlösbar verstrickt, ja eins geworden wäre [...]. [...] welche gleichen Symptome auf einen gleichen Mangel im Herzen dieser Cultur zu rathen geben [...]. Wir schauten das Drama an und drangen mit bohrenden Blick in seine innere bewegte Welt der Motive – und doch war uns, als ob nur ein Gleichnissbild an uns vorüberzöge [...]. [...] und während es mit seiner gleichnissartigen Offenbarung zum Zerreissen des Schleiers [...] aufzufördern schien […]. Die Lust, die der tragische Mythus erzeugt, hat eine gleiche Heimat, wie die lustvolle Empfindung der Dissonanz in der Musik. Es ist nun, bei dieser engsten Verwandtschaft zwischen Musik und Mythus, in gleicher Weise zu vermuthen, das mit einer Entartung und Depravation des Einen eine Verkümmerung der Anderen verbunden sein wird [...]. [...] in einer zur Ergetzlichkeit herabgesunkenen Kunst, wie in einem vom Begriff geleiteten Leben, hatte sich uns jene gleich unkünstlerische, als am Leben zehrende Natur des sokratischen Optimismus enthüllt. Zu unserem Troste aber gab es Anzeichen dafür, dass trotzdem der deutsche Geist in herrlicher Gesundheit, Tiefe und dionysischer Kraft unzerstört, gleich einem zum Schlummer niedergesunknen Ritter [...]. Musik und tragischer Mythus sind in gleicher Weise Ausdruck der dionysischen Befähigung eines Volkes und voneinander untrennbar. Bild3 (141) Vers[3]14 Nochmals gesagt, heute ist es mir ein unmögliches Buch, – ich heisse es schlecht geschrieben, schwerfällig, peinlich, bilderwüthig und bilderwirrig, gefühlsam, hier und da verzuckert bis zum Femininischen […]. Vers[4]16 […] das Verla n g e n na c h d e m Hä s s lic h e n , der gute strenge Wille des älteren Hellenen zum Pessimismus, zum tragischen Mythus, zum Bilde alles Furchtbaren, Bösen, Räthselhaften, Vernichtenden, Verhängnissvollen auf dem Grunde des Daseins [...]. [1]25 An ihre beiden Kunstgottheiten, Apollo und Dionysus, knüpft sich unsere Erkenntniss, dass in der griechischen Welt ein ungeheurer Gegensatz, nach Ursprung und Zielen, zwischen der Kunst des Bildners, der apollinischen, und der unbildlichen Kunst der Musik, als der des Dionysus, besteht […]. [1]26 [...] Schopenhauer bezeichnet geradezu die Gabe, dass Einem zu Zeiten die Menschen und alle Dinge als blosse Phantome oder Traumbilder vorkommen, als das Kennzeichen philosophischer Befähigung. Wie nun der Philosoph zur Wirklichkeit des Daseins, so verhält sich der künstlerisch erregbare Mensch zur Wirklichkeit des Traumes; er sieht genau und gern zu: denn aus diesen Bildern deutet er sich das Leben, an diesen Vorgängen übt er sich für das Leben. Nicht etwa nur die angenehmen und freundlichen Bilder sind es, die er mit jener Allverständigkeit an sich erfährt: auch das Ernste, Trübe, Traurige, Finstere […]. [1]28 Aber auch jene zarte Linie, die das Traumbild nicht überschreiten darf, um nicht pathologisch zu wirken, widrigenfalls der Schein als plumpe Wirklichkeit uns betrügen würde – darf nicht im Bilde des Apollo fehlen: jene maassvolle Begrenzung, jene Freiheit von den wilderen Regungen, jene weisheitsvolle Ruhe des Bildnergottes. [1]28 […] man möchte selbst Apollo als das herrliche Götterbild des principii individuationis bezeichnen […]. [1]29 Man verwandele das Beethoven’sche Jubellied der „Freude“ in ein Gemälde und bleibe mit seiner Einbildungskraft nicht zurück […]. [2]30 Wir haben bis jetzt das Apollinische und seinen Gegensatz, das Dionysische, als künstlerische Mächte betrachtet, die aus der natur selbst […] hervorbrechen, und in denen sich ihre Kunsttriebe zunächst und auf directem Wege befriedigen: einmal als die Bilderwelt des Traumes [...], andererseits als rauschvolle Wirklichkeit […]. 3 Derivations from the verb “bilden” (Bildung, Bildner, Gebilde, gebildet) are not included in this inventory. 6 [2]31 [2]31 [3]35 [3]37 [3]38 [5]42 [5]43 [5]43 [5]44 [5]44 [5]44 [5]47 [5]48 [6]49 [6]49 [6]49 [6]50 [6]50 [6]51 […] wie sich ihm nun, durch apollinische Traumeinwirkung, sein eigener Zustand d.h. seine Einheit mit dem innersten Grunde der Welt in ei ne m g le ic h n is sa rt i ge n T rau m b i ld e offenbart. […] wodurch wir in den Stand gesetzt werden, das Verhältniss des griechischen Künstlers zu seinen Urbildern, oder, nach dem aristotelischen Ausdrucke, „die Nachahmung der Natur“ tiefer zu verstehn und zu würdigen. […] dass, wohin sie sehen, Helena, das „in süsser Sinnlichkeit schwebende“ Idealbild ihrer eignen Existenz, ihnen entgegenlacht. Das wahre Ziel wird durch ein Wahnbild verdeckt […]. Dies ist die Sphäre der Schönheit, in der sie ihre Spiegelbilder, die Olympischen, sahen. Hierüber giebt uns das Alterthum selbst bildlich Aufschluss, wenn es als die Urväter und Fackelträger der griechischen Dichtung Ho me r u nd Ar c h ilo c h us auf Bildwerken, Gemmen u. s. w. neben einander stellt […]. […] er gesteht nämlich als den vorbereitenden Zustand vor dem Actus des Dichtens nicht etwa eine Reihe von Bildern, mit geordneter Causalität der Gedanken, vor sich und in sich gehabt zu haben, sondern vielmehr eine mu s i k al is c he St i m mu n g [...]. […] der gegenüber unsre neuere Lyrik wie ein Götterbild ohne Kopf erscheint […]. […] und producirt das Abbild dieses Ur-Einen als Musik […]. [...] jetzt aber wird diese Musik ihm wieder wie in einem gl eic h n is sa rt i ge n T ra u m b i ld e , unter der apollinischen Traumeinwirkung sichtbar. Jener bild- und begrifflose Wiederschein des Urschmerzes in der Musik, mit seiner Erlösung im Scheine, erzeugt jetzt eine zweite Spiegelung, als einzelnes Gleichniss oder Exempel. Seine Subjectivität hat der Künstler bereits in dem dionysischen Prozess aufgegeben: das Bild, das ihm jetzt seine Einheit mit dem Herzen der Welt zeigt, ist eine Traumscene, die jenen Urwiderspruch und Urschmerz, sammt der Urlust des Scheines, versinnlicht. Das „Ich“ des Lyrikers tönt also aus dem Abgrunde des Seins: seine „Subjectivität“ im Sinne der neueren Aesthetiker ist eine Einbildung. Die dionysisch-musikalische Verzauberung des Schläfers sprüht jetzt gleichsam Bilderfunken um sich, lyrische Gedichte, die in ihrer höchsten Entfaltung Tragödien und dramatische Dithyramben heissen. Der Plastiker und zugleich der ihm verwandte Epiker ist in das reine Anschauen der Bilder versunken. Der dionysische Musiker ist ohne jedes Bild völlig nur selbst Urschmerz und Urwiederklang desselben. Der lyrische Genius fühlt aus dem mystischen Selbstentäusserungs- und Einheitszustande eine Bilder- und Gleichnisswelt hervorwachsen, die eine ganz andere Färbung, Causalität und Schnelligkeit hat als jene Welt des Plastikers und Epikers. Während der Letztgenannte in diesen Bildern und nur in ihnen mit freudigem Behagen lebt und nicht müde wird, sie bis auf die kleinsten Züge hin liebevoll anzuschauen, während selbst das Bild des zürnenden Achilles für ihn nur ein Bild ist, dessen zürnenden Ausdruck er mit jener Traumlust am Scheine geniesst […] so sind dagegen die Bilder des Lyrikers nichts als er selbst und gleichsam nur verschiedene Objectivationen von ihm, weshalb er als bewegender Mittelpunkt jener Welt „ich“ sagen darf: nur ist diese Ichheit nicht dieselbe, wie das wachen, empirisch-realen Menschen, sondern die einzige überhaupt wahrhaft seiende und ewige, im Grunde der Dinge ruhende Ichheit, durch deren Abbilder der lyrische Genius bis auf jenen Grund der Dinge hindurchsieht. Nun denken wir uns einmal, wie er unter diesen Abbildern auch si c h sel b s t als Nichtgenius erblickt […]. [...] wohl aber dürfen wir von uns selbst annehmen, dass wir für den wahren Schöpfer derselben schon Bilder und künstlerische Projectionen sind und in der Bedeutung von Kunstwerken unsre höchste Würde haben […]. […] denn in jenem Zustande ist er, wunderbarer Weise, dem unheimlichen Bild des Mährchens gleich […]. [...] wie die fortwährend gebärende Melodie Bilderfunken um sich aussprüht [...]. Vom Standpunkte des Epos ist diese ungleiche und unregelmässige Bilderwelt der Lyrik einfach zu verurtheilen […]. Hiermit haben wir das einzig mögliche Verhältniss zwischen Poesie und Musik, Wort und Ton bezeichnet: das Wort, das Bild, der Begriff sucht einen der Musik analogen Ausdruck und erleidet jetzt die Gewalt der Musik an sich. In diesem Sinne dürfen wir in der Sprachgeschichte des griechischen Volkes zwei Hauptströmungen unterscheiden, jenachdem die Sprache die Erscheinungs- und Bilderwelt oder die Musikwelt nachahmte. Wir erleben es immer wieder, wie eine Beethoven’sche Symphonie die einzelnen Zuhörer zu einer Bilderrede nöthigt, sei es auch dass eine Zusammenstellung der verschiedenen, durch ein Tonstück erzeugten Bilderwelten sich recht phantastisch bunt, ja widersprechend ausnimmt […]. Ja selbst wenn der Tondichter in Bildern über eine Composition geredet hat, [...] so sind das ebenfalls nur gleichnissartige, aus der Musik geborne Vorstellungen […] die über den d io n ys i s c he n Inhalt der Musik uns nach keiner Seite hin belehren können, ja die keinen ausschliesslichen Werth neben anderen Bildern haben. Diesen Prozess einer Entladung der Musik in Bildern […]. Dürfen wir also die lyrische Dichtung als die nachahmende Effulguration der Musik in Bildern und Begriffen betrachten, so können wir jetzt fragen: „als was er sc h ei n t die Musik im Spiegel der Bildlichkeit und der Begriffe?“ Denn um ihre Erscheinung in Bildern auszudrücken, braucht der Lyriker alle Regungen der Leidenschaft […]. Insofern er aber die Musik in Bildern deutet, ruht er selbst in der stillen Meeresruhe der apollinischen Betrachtung […]. Ja wenn er sich selbst durch dasselbe Medium erblickt, so zeigt sich ihm sein eignes Bild im Zustande des unbefriedigten Gefühls: sein eignes Wollen, Sehnen, Stöhnen, Jauchzen ist ihm ein Gleichniss, mit dem er die 7 [6]51 [8]58 [8]58 [8]58 [8]58 [8]60 [8]60 [8]60 [8]61 [8]62 [8]63 [8]63 [8]64 [8]64 [9]64 [9]65 [9]65 [9]66 [9]67 [9]67 [9]68 [10]71 [10]72 [11]76 [12]84 [12]87 [13]89 Musik sich deutet. Dies ist das Phänomen des Lyrikers: als apollinischer Genius interpretirt er die Musik durch das Bild des Willens, während er selbst, völlig losgelöst von der Gier des Willens, reines ungetrübtes Sonnenauge ist. Diese ganze Erörterung hält daran fest, dass die Lyrik eben so abhängig ist vom Geiste der Musik als die Musik selbst, in ihrer völligen Unumschränktheit, das Bild und den Begriff nicht b ra u c ht , sondern ihn nur neben sich erträ g t . Die Dichtung des Lyrikers kann nichts aussagen, was nicht in der ungeheuersten Allgemeinheit und Allgültigkeit bereits in der Musik lag, die ihn zur Bilderrede nöthigte. [...] wie verschämt und weichlich tändelte der moderne Mensch mit dem Schmeichelbild eines zärtlichen flötenden weichgearteten Hirten! [...] es war das Urbild des Menschen, der Ausdruck seiner höchsten und stärksten Regungen, als begeisterter Schwärmer […], als Sinnbild der geschlechtlichen Allgewalt der Natur, die der Grieche gewöhnt ist mit ehrfürchtigem Staunen zu betrachten. […] hier war die Illusion der Cultur von dem Urbilde des Menschen weggewischt [...]. [...] der Chor ist eine lebendige Mauer gegen die anstürmende Wirklichkeit, weil er – der Satyrchor – das Dasein wahrhaftiger, wirklicher, vollständiger abbildet als der gemeinhin sich als einzige Realität achtende Culturmensch. [...] welches Phänomen am deutlichsten durch den Prozess des Schauspielers zu machen ist, der, bei wahrhafter Begabung, sein von ihm darzustellendes Rollenbild zum Greifen wahrnehmbar vor seinen Augen schweben sieht. […] die Architektur der Scene erscheint wie ein leuchtendes Wolkenbild, welches die im Gebirge herumschwärmenden Bacchen von der Höhe aus erblicken, als die herrliche Umrahmung, in deren Mitte ihnen das Bild des Dionysus offenbar wird. Die Metapher ist für den ächten Dichter nicht eine rhetorische Figur, sondern ein stellvertretendes Bild, das ihm wirklich, an Stelle eines Begriffes, vorschwebt. Hier ist etwas Anderes als der Rhapsode, der mit seinen Bildern nicht Verschmilzt […]. Nach dieser Erkenntniss haben wir die griechische Tragödie als den dionysischen Chor zu verstehen, der sich immer von neuem wieder in einer apollinischen Bilderwelt entladet. So entsteht denn jene phantastische und so anstössig scheinende Figur des weisen und begeisterten Satyrs, der zugleich „der tumbe Mensch“ im Gegensatz zum Gotte ist: Abbild der Natur und ihrer stärksten Triebe […]. Denken wir uns Admet [...] − wie ihm nun plötzlich ein ähnlich gestaltetes, ähnlich schreitendes Frauenbild in Verhüllung entgegengeführt wird […]. Unwillkürlich übertrug er das ganze magisch vor seiner Seele zitternde Bild des Gottes auf jene maskirte Gestalt und löste ihre Realität gleichsam in eine geisterhafte Unwirklichkeit auf. Die apollinischen Erscheinungen […] sind [...] nicht mehr jene nur empfundenen, nicht zum Bilde verdichteten Kräfte […]. In diesem Sinne ist der Dialog ein Abbild des Hellenen […]. […] der im Grunde nichts mehr ist als das auf eine dunkle Wand geworfene Lichtbild d.h. Erscheinung [...]. [...] umgekehrt sind jene Lichtbilderscheinungen des sophokleischen Helden, kurz das Apollinische der Maske, nothwendige Erzeugungen eines Blickes in’s Innere und Schreckliche der Natur […]. […] und hier zeigt sich, dass die ganze Auffassung des Dichters nichts ist als eben jenes Lichtbild, welches uns, nach einem Blick in den Abgrund, die heilende Natur vorhält. Was uns hier der Denker Aeschylus zu sagen hatte, was er aber als Dichter durch sein gleichnissartiges Bild uns nur ahnen lässt, das hat uns der jugendliche Goethe in den verwegenen Worten seines Prometheus zu enthüllen gewusst: „Hier sitz ich, forme Menschen Nach meinem Bilde, Ein Geschlecht das mir gleich sei [...]“ […] vielmehr ist die Werdelust des Künstlers, die jedem Unheil trotzende Heiterkeit des künstlerischen Schaffens nur ein lichtes Wolken- und Himmelsbild, das sich auf einem schwarzen See der Traurigkeit spiegelt. In der That scheinen sie so empfunden zu haben: wie überhaupt jene platonische Unterscheidung und Werthabschätzung der „Idee“ im Gegensatze zum „Idol“, zum Abbild tief im hellenischen Wesen begründet liegt. [...] wie es der Mythus durch die in ewige Trauer versenkte Demeter verbildlicht […]. […] was Euripides mit Menander und Philemon gemein hat und was für jene so aufregend vorbildlich wirkte […]. Der Dichter des dramatisirten Epos kann eben so wenig wie der epische Rhapsode mit seinen Bildern völlig verschmelzen: er ist immer noch ruhig unbewegte, aus weiten Augen blickende Anschauung, die die Bilder vo r sich sieht. Und wenn Anaxagoras mit seinem „Nous“ unter den Philosophen wie der erste Nüchterne unter lauter Trunkenen erschien, so mag auch Euripides sein Verhältniss zu den anderen Dichtern der Tragödie unter einem ähnlichen Bilde begriffen haben. […] während er [Sokrates], auf seiner kritischen Wanderung durch Athen, bei den grössten Staatsmännern, Rednern, Dichtern und Künstlern vorsprechend, überall die Einbildung des Wissens antraf. 8 [13]91 [14]92 [14]93 [14]93 [14]93 [14]95 [14]96 [15]99 [15]100 [15]102 [16]104 [16]104 [16]106 [16]106 [16]107 [16]107 [16]107 [16]107 [16]108 [17]109 [17]110 [17]112 [17]113 [18]116 [18]118 [19]121 [19]122 [19]123 [19]124 [19]128 Der st erb e nd e So kr at es wurde das neue, noch nie sonst geschaute Ideal der edlen griechischen Jugend: vor allen hat sich der typische hellenische Jüngling, Plato, mit aller inbrünstigen Hingebung seiner Schwärmerseele vor diesem Bilde niedergeworfen. „Du siehst an mir, wozu sie nützt, Dem, der nicht viel Verstand besitzt, Die Wahrheit durch ein Bild zu sagen“. Der Hauptvorwurf, den Plato der älteren Kunst zu machen hatte, – dass sie Nachahmung eines Scheinbildes sei […]. […] das litterarische Bild des „rasenden Sokrates“ […]. [...] auf einen engen Raum zusammengedrängt und dem einen Steuermann Sokrates ängstlich unterthänig fuhren sie jetzt in eine neue Welt hinein, die an dem phantastischen Bilde dieses Aufzugs sich nie satt sehen konnte. Wirklich hat für die ganze Nachwelt Plato das Vorbild einer neuen Kunstform gegeben, das Vorbild des Ro ma n ’s […]. […] sie zerstört das Wesen der Tragödie, welches sich einzig als eine Manifestation und Verbildlichung dionysischer Zustände […] interpretiren lässt. [...] es war seine apollinische Einsicht, dass er wie ein Barbarenkönig ein edles Götterbild nicht verstehe […]. [...] das Bild des ster b e nd e n So kr a te s als des durch Wissen und Gründe der Todesfurcht enthobenen Menschen […]. Angesichts dieses praktischen Pessimismus ist Sokrates das Urbild des theoretischen Optimisten [...]. [...] so gewahren wir die in Sokrates vorbildlich erscheinende Gier der unersättlichen optimistischen Erkenntniss in tragische Resignation und Kunstbedürftigkeit umgeschlagen […]. [...] weil sie nicht, wie jene alle, Abbild der Erscheinung, sondern unmittelbar Abbild des Willens selbst sei [...] […] wie verhält sich die Musik zu Bild und Begriff? Denn die Musik ist, wie gesagt, darin von allen anderen Künsten verschieden, dass sie nicht Abbild der Erscheinung, [...] sondern unmittelbar Abbild des Willens selbst ist und also zu allem Physischen der Welt das Metaphysische, zu aller Erscheinung das Ding an sich darstellt. Solche einzelne Bilder des Menschenlebens […]. […] sonst spricht die Musik nicht das innere Wesen, den Willen selbst aus; sondern ahmt nur seine Erscheinung ungenügend nach; wie dies alle eigentlich nachbildende Musik thut“. Andrerseits kommt Bild und Begriff, unter der Einwirkung einer wahrhaft entsprechenden Musik, zu einer erhöhten Bedeutsamkeit. […] die Musik lässt sodann das gleichnissartige Bild i n hö c h st er B ed e u t sa mk e it hervortreten. An dem Phänomen des Lyrikers habe ich dargestellt, wie die Musik im Lyriker darnach ringt, in apollinischen Bildern über ihr Wesen sich kund zu geben: denken wir uns jetzt, dass die Musik in ihrer höchsten Steigerung auch zu einer höchsten Verbildlichung zu kommen suchen muss […]. Die metaphysische Freude am Tragischen ist eine Uebersetzung der instinctiv unbewussten dionysischen Weisheit in die Sprache des Bildes […]. Das Gefüge der Scenen und die anschaulichen Bilder offenbaren eine tiefere Weisheit, als der Dichter selbst in Worte und Begriffe fassen kann […]. Jenes Ringen des Geistes der Musik nach bildlicher und mythischer Offenbarung […]. […] jenes anschauliche Ereigniss, das sich in diesem Spiegel bricht, erweitert sich sofort für unser Gefühl zum Abbilde einer ewigen Wahrheit. Umgekehrt wird ein solches anschauliches Ereigniss durch die Tonmalerei des neueren Dithyrambus sofort jedes mythischen Charakters entkleidet; jetzt ist die Musik zum dürftigen Abbilde der Erscheinung geworden und darum unendlich ärmer als die Erscheinung selbst [...]. […] während durch die dionysische Musik die einzelne Erscheinung sich zum Weltbilde bereichert und erweitert. Unsere ganze moderne Welt ist in dem Netz der alexandrinischen Cultur befangen und kennt als Ideal den mit höchsten Erkenntnisskräften ausgerüsteten, im Dienste der Wissenschaft arbeitenden t h e o reti sc h e n Me n sc he n, dessen Urbild und Stammvater Sokrates ist. Mit dieser Erkenntniss ist eine Cultur eingeleitet [...], die sich, ungetäuscht durch die verführerischen Ablenkungen der Wissenschaften, mit unbewegtem Blicke dem Gesammtbilde der Welt zuwendet […]. […] die äusserlichste mosaikartige Conglutination, wie etwas Derartiges im Bereich der Natur und der Erfahrung gänzlich vorbildlos ist. Es ist für uns jetzt gleichgültig, dass mit diesem neugeschaffnen Bilde des paradiesischen Künstlers die damaligen Humanisten gegen die alte kirchliche Vorstellung [...] ankämpften […]. Mit der laienhaft unmusikalischen Rohheit dieser Ansichten wurde in den Anfängen der Oper die Verbindung von Musik, Bild und Wort behandelt […]. [...] von welchem vollkommnen Urmenschen wir alle abstammen sollten, ja dessen getreues Ebenbild wir noch wären […]. […] das hellenische Vorbild […]. 9 [21]134 [21]135 [21]135 [21]136 [21]137 [21]138 [21]138 [21]141 [23]145 [23]145 [23]147 [24]150 [24]150 [24]151 [24]152 [25]154 Dafür verleiht die Musik, als Gegengeschenk, dem tragischen Mythus eine so eindringliche und überzeugende metaphysische Bedeutsamkeit, wie sie Wort und Bild, ohne jene einzige Hülfe, nie zu erreichen vermögen […]. Bei diesem Beispiele darf ich mich nicht auf jene beziehn, welche die Bilder der scenischen Vorgänge, die Worte und Affecte der handelnden Personen benutzen, um sich mit dieser Hülfe der Musikempfindung anzunähern […]. An diesen ächten Musiker richte ich die Frage, ob sie sich einen Menschen denken können, der den dritten Act von „Tristan und Isolde“ ohne alle Beihülfe von Wort und Bild rein als ungeheuren symphonischen Satz zu percipiren im Stande wäre […]. So gewaltig auch das Mitleiden in uns hineingreift, in einem gewissen Sinne rettet uns doch das Mitleiden vor dem Urleiden der Welt, wie das Gleichnissbild des Mythus uns vor dem unmittelbaren Anschauen der höchsten Weltidee [...] rettet. […] es führt an uns Lebensbilder vorbei und reizt uns zu gedankenhaftem Erfassen des in ihnen enthaltenen Lebenskernes. Mit der ungeheuren Wucht des Bildes, des Begriffs, der ethischen Lehre, der sympathischen Erregung reisst das Apollinische den Menschen aus seiner orgiastischen Selbstvernichtung empor und täuscht ihn über die Allgemeinheit des dionysischen Vorganges hinweg zu dem Wahne, dass er ein einzelnes Weltbild, z.B. Tristan und Isolde, sehe [...]. [...] die Musik ist die eigentliche Idee der Welt, das Drama nur ein Abglanz dieser Idee, ein vereinzeltes Schattenbild derselben. […] und zahllose Erscheinungen jener Art dürften an der gleichen Musik vorüberziehn, sie würden nie das Wesen derselben erschöpfen, sondern immer nur ihre veräusserlichten Abbilder sein. Der tra gi s c he M yt h u s ist nur zu verstehen als eine Verbildlichung dionysischer Weisheit durch apollinische Kunstmittel […]. Daran nämlich wird er messen können, wie weit er überhaupt befähigt ist, den M yt h u s, das zusammengezogene Weltbild, zu verstehen […]. Die Bilder des Mythus müssen die unbemerkt allgegenwärtigen dämonischen Wächter sein […]. Von ihnen haben wir bis jetzt, zur Reinigung unserer aesthetischen Erkenntniss, jene beiden Götterbilder entlehnt […]. Freilich erreichte das apollinische Lichtbild gerade bei der inneren Beleuchtung durch die Musik nicht die eigenthümliche Wirkung der schwächeren Grade apollinischer Kunst […]. […] und doch war uns, als ob nur ein Gleichnissbild an uns vorüberzöge, dessen tiefsten Sinn wir fast zu errathen glaubten und das wir, wie einen Vorhang, fortzuziehen wünschten, um hinter ihm das Urbild zu erblicken. Die hellste Deutlichkeit des Bildes genügte uns nicht […]. […] was verklärt er aber, wenn er die Erscheinungswelt unter dem Bilde des leidenden Helden vorführt? Wenn aber nicht, worin liegt dann die aesthetische Lust, mit der wir auch jene Bilder an uns vorüberziehen lassen? Ich frage nach der aesthetischen Lust und weiss recht wohl, dass viele dieser Bilder ausserdem mitunter noch eine moralische Ergetzung [...] erzeugen können. [Musik und tragischer Mythus] verklären eine Region, in deren Lustaccorden die Dissonanz eben so wie das schreckliche Weltbild reizvoll verklingt […]. 10 KSA 7 [19] Metapher (28) [174]473 Im Philosophen setzen sich Thätigkeiten fort, durch Metapher. Das Streben nach e i n hei tl ic he m Beherrschen. [….] [178]474 [...] Zwei zu verschiedenen Zwecken nöthige Eigenschaften – die W ahrh a ft i g ke it – und die Metap her – haben den Hang zur Wahrheit erzeugt. Also ein moralisches Phänomen, aesthetisch verallgemeinert, erzeugt den intellektuellen Trieb. [...] [192]479 Der p o lit is c he Sinn der älteren griechischen Philosophen, ebenso nachzuweisen als ihre Kraft zur M etap h er . [209]483 [...] Ein empfundener Reiz und ein Blick auf eine Bewegung, verbunden, ergeben die Kausalität zunächst als Erfahrungssatz: zwei Dinge, nämlich eine bestimmte Empfindung und ein bestimmtes Gesichtsbild erscheinen immer zusammen: da das Eine die Ursache des Andern ist, ist ei n e Me tap h er , e n tl e h nt a u s Wi lle u nd T hat : eine Analogieschlu. [...] [210]484 Zeit Raum und Kausalität sind nur Erkenntnimetap h er n , mit denen wir die Dinge uns deuten. Reiz und Thätigkeit verbunden: wie das ist, wissen wir nicht, wir verstehn keine einzige Kausalität, aber wir haben unmittelbare Erfahrung von ihnen. Jedes Leiden ruft ein Thun hervor, jedes Thun ein Leiden – dies das allgemeinste Gefühl bereits schon M etap h er . [...] Raumempfindung erst durch Metapher aus der Zeitempfindung abzuleiten – oder umgekehrt? [...] [217]487 [...] Die Ver wec h sl u n g ist das Urphänomen. – Dies setzt voraus das Ge st al te n se he n . Das Bild im Auge ist für unser Erkennen magebend, dann der Rhythmus unseres Gehörs. [...] Das Tastgefühl, und zugleich das Gesichtsbild geben zwei Empfindungen nebeneinander empirisch, diese, weil sie immer mit einander erscheinen, erwecken die Vorstellung eines Zusammenhangs (durch Met ap her – denn nicht alles Miteinander-Erscheinende hängt zusammen). [...] [225]489 Unwahrheit des Menschen gegen sich selbst und gegen andere: Voraussetzung die Unkenntniß – nöthig, um zu existiren (selbst – und in Gesellschaft). In das vacuum stellt sich die Täuschung der Vorstellungen. [...] Metonymien. Reize, nicht volle Erkenntnisse. Das Auge giebt Gestalten. Wir hängen an der Oberfläche. Die Neigung zum Schönen. Mangel an Logik, aber Metaphern. Religionen. Philosophien. Na ch a h me n . [226]490 [...] Das Nachahmen setzt voraus ein Aufnehmen und dann ein fortgesetztes Übertragen des aufgenommenen Bildes in tausend Metaphern, alle wirkend. […] [227]490 Welche Macht zwingt zur Nachahmung? Die Aneignung eines fremden Eindrucks durch Metaphern. Reiz – Erinnerungsbild durch Metapher (Analogieschlu) verbunden. Resultat: es werden Ähnlichkeiten entdeckt und neu belebt. An einem Erinnerungsbilde spielt sich der wi ed er ho l te Reiz noch einmal ab. Re iz p ercip ir t – j etz t wi ed er ho l t , in vielen Metaphern, wobei verwandte Bilder, aus den verschiedenen Rubriken, herbeiströmen. Jede Perception erzielt eine vielfache Nachahmung des Reizes, doch mit Übertragung auf verschiedene Gebiete. [...] [228]490 Das Na c ha h me n ist darin der Gegensatz des Er ke n n e n s , da das Erkennen eben keine Übertragung gelten lassen will, sondern ohne Metapher den Eindruck festhalten will und ohne Consequenzen. Zu diesem Behufe wird er petrificirt: der Eindruck durch Begriffe eingefangen und abgegränzt, dann getödet, gehäutet und als Begriff mumisirt und aufbewahrt. Nun aber giebt es keine „eigentlichen“ Ausdrücke und ke i n e i ge n tl ic he s Er ke n ne n o h ne Me tap her . Aber die Täuschung darüber besteht, d. h. der Glaub e an eine W ahr h ei t des Sinneneindrucks. Die gewöhnlichsten Metaphern, die usuellen, gelten jetzt als Wahrheiten und als Maa für die seltneren. An sich herrscht hier nur der Unterschied zwischen Gewöhnung und Neuheit, Häufigkeit und Seltenheit. Das Er ke n ne n ist nur ein Arbeiten in den beliebtesten Metaphern, also ein nicht mehr als Nachahmung empfundenes Nachahmen. Es kann also natürlich nicht ins Reich der Wahrheit dringen. Das Pathos des Wahrheitstriebes setzt die Beobachtung voraus, da die verschiedenen Metaphernwelten mit einander uneins sind und kämpfen [...]. [229]491 In der politischen Gesellschaft ist eine feste Übereinkunft nöthig, sie ist auf den usuellen Gebrauch von Metaphern gegründet. Jeder ungewöhnliche regt sie auf, ja vernichtet sie. Also jedes Wort so brauchen, wie es die Masse braucht, ist politische Convenienz und Moral. W ahr sein heißt nur nicht abweichen vom usuellen Sinn der Dinge. [...] [229]492 [...] Unter „wahr“ wird zuerst nur verstanden das, was usuell die gewohnte Metapher ist – also nur eine Illusion, die durch häufigen Gebrauch gewohnt worden ist und nicht mehr als Illusion empfunden wird: vergessene Metapher, d. h. eine Metapher, bei der vergessen ist, da er eine ist. [230]492 Der T rieb zur W a hr he it beginnt mit der starken Beobachtung, wie entgegengesetzt die wirkliche Welt und die der Lüge ist und wie alles Menschenleben unsicher ist, wenn die Conventions-Wahrheit nicht unbedingt gilt: es ist eine moralische Überzeugung von der Nothwendigkeit einer festen Convention, wenn eine menschliche 11 [237]494 [249]498 [321]517 [329]520 Gesellschaft existiren soll. […] Der Lügner gebraucht die Worte, um das Unwirkliche als Wirklich erscheinen zu machen, d. h. er mißbraucht das feste Fundament. Andernseits ist der Trieb zu immer neuen Metaphern da, er entladet sich im Dichter, im Schauspieler usw., in der Religion vor allem. Der Me ns c h als Maaß der Dinge ist ebenfalls der Gedanke der Wissenschaft. Jedes Naturgesetz ist zuletzt eine Summe von anthropomorphischen Relationen. Besonders die Zahl: die Auflösung aller Gesetze in Vielheiten, ihr Ausdruck in Zahlenformeln ist eine μεταφορά, wie jemand, der nicht hören kann, die Musik und den Ton nach den Chladnischen Klankfiguren beurtheilt. Met ap her heißt etwas als g l eic h behandeln, was man in einem Punkte als ä h nl ic h erkannt hat. Die Methode der Philosophen zum Letzten zu kommen rubrizirt. Der unlogische Trieb. Wahrhaftigkeit und Metapher. [...] Erste Stufe der Kultur: der Glaube an die Sprache, als durchgehende Metapherbezeichnung. Zweite Stufe der Kultur: Einheit und Zusammenhang der Metapherwelt durch Anlehnung an Homer. Übertragung (22) [21]422 [107]454 [118]457 [118]458 [134]462 [177]473 [177]474 [185]477 [209]483 [215]486 [223]489 [226]490 [227]490 [...] Der Germane hat alle seine Beschränktheiten durch die Wissenschaften verklärt, indem er sie übertrug: [...] sein unbeschränkter Erkenntnißtrieb ist die Folge eines dürftigen Lebens: er würde, ohne ihn, kleinlich und boshaft und ist es oft, trotz ihrer. [...] [...] Dies ist aber das Schluverfaheren des beschaulichen Philosophen und des Künstlers. Er thut dasselbe, was Jeder in physiologischen persönlichen Antrieben thut, übertragen auf eine unpersönliche Welt. [...] Der Mensch kommt erst ganz langsam dahinter, wie unendlich complicirt die Welt ist. Zuerst denkt er sie sich ganz einfach, d. h. so oberflächlich als er selbst ist. [...] [...] So glaubt er mit dem Wort „Instinkt“ irgendetwas erklärt und er überträgt wohl gar die unbewuten Zweckhandlungen auf das Urwerden der Dinge. [...] Von Thales bis Sokrates – lauter Übertragungen des Menschen auf die Natur – ungeheure Schattenspiele des Menschen auf der Natur, wie auf Gebirgen! [...] Die Noth erzeugt, unter Fällen, die Wahrhaftigkeit, als Existenzmittel einer Societät. Durch häufige Übung erstarkt der Trieb und wird jetzt durch Metastase, unberechtigt, übertragen. Er wird zum Hang an sich. [...] [...] Der gute Mensch will nun auch wahr sein und glaubt an die Wahrheit aller Dinge. Nicht nur der Societät, sondern der Welt. Somit auch an die Ergründbarkeit. Denn weshalb sollte die Welt ihn täuschen? Also er übertragt seinen Hang auf die Welt und glaubt, da auch die Welt wahr gegen ihn sein mu . Unsre Gewohnheiten werden zu Tugenden durch eine freie Übertragung ins Reich der Pflicht, d. h. dadurch daß wir die Unverbrüchlichkeit mit in den Begriff hineinnehmen [...]. [...] Die einzige Kausalität, die uns bewut ist, ist zwischen Wollen und Thun – diese übertragen wir auf alle Dinge und deuten uns das Verhältni von zwei immer beisammen befindlichen Veränderungen. [...] Zuerst entsteht das Wort für die Handlung, von da das Wort für die Qualität. Dies Verhältni übertragen auf alle Dinge ist Ca u sa li tä t . Zuerst „sehen“, dann „Gesicht“. Das „Sehende“ gilt als Ursache des „Sehens“. Zwischen dem Sinn und seiner Funktion empfinden wir ein regelmäiges Verhältni: Causalität ist die Übertragung dieses Verhältnisses (von Sinn auf Sinnesfunktion) auf alle Dinge. [...] Der innere Zusammenhang von R ei z und T hä ti g k ei t übertragen auf alle Dinge. [...] [...] Alles Erklären und Erkennen ist eigentlich nur ein Rubriziren. – Nun mit kühnem Schwung: die Vielheit der Dinge wird unter einen Hut gebracht, wenn wir sie gleichsam als unzählige Handlungen e in er Qualität betrachten z. B. als Handlungen des W a s ser s , wie bei Thales. Hier haben wir eine Übertragung: eine Abstraktion fat zahllose Handlungen zusammen und gilt als Ursache. Die Moralitätsinstinkte: die Mutterliebe – allmählich zur Liebe überhaupt. Ebenso die Geschlechtsliebe. Überall erkenne ich Üb er tr a g u n ge n . [...] Das Nachahmen setzt voraus ein Aufnehmen und dann ein fortgesetztes Übertragen des aufgenommenen Bildes in tausend Metaphern, alle wirkend. [...] Re iz p ercip ir t – jetzt wi e d er ho lt , in vielen Metaphern, wobei verwandte Bilder, aus den verschiedenen Rubriken, herbeiströmen. Jede Perception erzielt eine vielfache Nachahmung des Reizes, doch mit Übertragung auf verscheidene Gebiete. Reiz empfunden übertragen auf verwandte Nerven dort, in Übertragung, wiederholt usw. 12 [228]490 [229]492 [242]495 [318]516 Es findet ein Übersetzen des einen Sinneseindrucks in den andern statt: manche sehen etwas oder schmecken etwas bei bestimmten Tönen. Dies ein ganz allgemeines Phänomen. Das Na c ha h me n ist darin der Gegensatz des Er ke n ne n s , da das Erkennen eben keine Übertragung gelten lassen will, sondern ohne Metapher den Eindruck festhalten will und ohne Consequenzen. Zu diesem Behufe wird er petrificirt: der Eindruck durch Begriffe eingefangen und abgegränzt, dann getödtet, gehäutet und als Begriff mumisirt und aufbewahrt. [...] […] Aber der Trieb wahr zu sein, übertragen auf die Na t ur , erzeugt den Glauben, da auch die Natur gegen uns wahr sein mu. Erkenntnitrieb beruht auf dieser Übertragung. […] Das Wesen der Definition: der Bleistift ist ein länglicher usw. Körper. A ist B. Das was länglich ist, ist hier zugleich bunt. Die Eigenschaften enthalten nur Relationen. Ein bestimmter Körper ist gleich so und so viel Relationen. Relationen können nie das Wesen sein, sondern nur Folgen des Wesens. Das synthetische Urtheil beschreibt ein Ding nach seinen Folgen, d h. W ese n und Fo l g e n werden id e nt i fi cir t , d.h.eine Meto n y mi e . Also im Wesen des synthetischen Urtheils liegt eine Meto n y mi e , d. h. es ist eine f al sc he G lei ch u n g . D. h. die s yn t he ti s c he n Sc hl ü s se s i nd u nlo g i sc h . Wenn wir sie anwenden, setzen wir die populäre Metaphysik voraus, d. h. die, welche Wirkungen als Ursachen betrachtet. Der Begriff "Bleistift" wird verwechselt mit dem "Ding" Bleistift. Das „ist“ im synthetischen Urtheil ist falsch, es enthält eine Übertragung, zwei verschiedene Sphären werden neben einander gestellt, zwischen denen nie eine Gleichung stattfinden kann. [...] [...] Die Übertragungen des Menschen auf die Natur. [...] Analogie (7) [75]444 [149]466 [178]474 [186]477 [209]483 [226]490 [227]490 [...] Was ist aber eine solche "Möglichkeit"? Ein Einfall z. B. „es könnte vielleicht". Aber wie ko m mt der Einfall? Mitunter zufällig äuerlich: ein Vergleichen, das Entdecken irgend einer Analogie findet statt. [...] Der Gang der Philosophie: es werden zuerst Menschen als Urheber aller Dinge gedacht – allmählich erklärt man sich die Dinge nach Analogie einzelner menschlicher Eigenschaften – zuletzt langt man bei der E mp fi nd u n g an. [...] [...] Zwei zu verschiedenen Zwecken nöthige Eigenschaften – die W ahrh a ft i g ke it – und die Metap her – haben den Hang zur Wahrheit erzeugt. Also ein moralisches Phänomen, aesthetisch verallgemeinert, erzeugt den intellektuellen Trieb. Instinkt ist hier eben Gewohnheit, oft so zu schlieen und daraus κατα άνάλογον eine Pflicht überhaupt immer so schlieen zu müssen. Es wirkt nicht etwa Gedanke auf Gedächtniß, sondern der Gedanke durchläuft zahllose feine Metamorphosen, d.h. d e m Ge d a n ke n entspricht e in D i n g a n s ic h , das nun das analoge Ding an sich im Gedächtni erfat. [...] Ein empfundener Reiz und ein Blick auf eine Bewegung, verbunden, ergeben die Kausalität zunächst als Erfahrungssatz: zwei Dinge, nämlich eine bestimmte Empfindung und ein bestimmtes Gesichtsbild erscheinen immer zusammen: da das Eine die Ursache des Andern ist, ist ei n e Me tap h er, e n tl e h nt a u s Wi lle u nd T hat : eine Analogieschlu. [...] Das Nachahmen setzt voraus ein Aufnehmen und dann ein fortgesetztes Übertragen des aufgenommenen Bildes in tausend Metaphern, alle wirkend. Das Analoge – Welche Macht zwingt zur Nachahmung? Die Aneignung eines fremden Eindrucks durch Metaphern. Reiz – Erinnerungsbild durch Metapher (Analogieschlu) verbunden. [...] Ähnlich (22) [63]439 [70]442 [75]444 [77]445 Sonderbares Problem: das sich Verzehren der philosophischen Systeme! Unerhört für die Wissenschaft wie für die Kunst! Äh n li c h steht es mit den Religionen: das ist merkwürdig und bezeichnend. [...] Dagegen waltet in den älteren Philosophen zum Theil ein ähnlicher Trieb, wie der, welcher die Tragödie schuf. [...] Was ist aber eine solche "Möglichkeit"? Ein Einfall z.B. „es könnte vielleicht". Aber wie kommt der Einfall? Mitunter zufällig äußerlich: ein Vergleichen, das Entdecken irgend einer Analogie findet statt. Nun tritt eine Er we ite r u n g ein. Die Phantasie besteht im sc h n el le n Ä h nl ic h k ei te n sc ha u e n. Die Reflexion mit nachher Begriff an Begriff und prüft. Die Äh nl ic h ke it soll ersetzt werden durch C a u sal it ät . [...] Die Phantasieerzeugung kann man im Auge beobachten. Ähnlichkeit führt zur kecksten Fortbildung: aber auch ganz ändre Verhältnisse, Contrast den Contrast, und unaufhörlich. Hier si e ht man die auerordentliche Produktivität des Intellekts. Es ist ein Bilderleben. 13 [78]445 [93]450 [179]475 [217]487 [226]489 [227]490 [236]493 [249]498 [252]498 [285]508 […] Es ist viel mehr von Bilderreihen im Gehirn, als zum Denken verbraucht wird: der Intellekt wählt schnell ähnliche Bilder: das Gewählte erzeugt wieder eine ganze Fülle von Bildern: schnell aber wählt er wieder eines davon usw. Das bewußte Denken ist nur ein Herauswählen von Vorstellungen. Es ist ein langer Weg bis zur Abstraktion. 1) Die Kraft, die die Bilderfülle erzeugt 2) die Kraft, welche das Ähnliche auswählt und betont. [...] Auch das Moralische hat keine andere Quelle als den Intellekt, aber die verbindende Bilderkette wirkt hier anders als bei dem Künstler und Denker: sie reizt zur T h at. Ganz gewiß ist das Empfinden des Ähnlichen, das Id en ti fic ire n nothwendige Voraussetzung. Sodann Erinnerung an eignen Schmerz. Gut sein hieße also: s e hr lei c ht identificiren und sehr sc h ne l l. Es ist also eine Verwandlung, ähnlich wie bei dem Schauspieler. [...] [...] Das Ähnliche erinnert an das Ähnliche und vergleicht sich damit: das ist das Erkennen, das schnelle Subsumiren des Gleichartigen. Nur das Ähnliche percipirt das Ähnliche: ein physiologischer Proze. Dasselbe, was Gedächtniß ist, ist auch Perception des Neuen. Nicht Gedanke auf Gedanke – – – Tropen sind’s, nicht unbewute Schlüsse, auf denen unsre Sinneswahrnehmungen beruhn. Ähnliches mit Ähnlichem identificiren – irgend welche Ähnlichkeit an einem und einem andern Ding ausfindig machen ist der Urproze. [...] Das Na c ha h me n ist das Mittel aller Kultur, dadurch wird allmählich der Instinkt erzeugt. All es Ve r gle ic he n (Urd e n ke n) i st ei n Na c h ah me n . So bilden sich Ar te n, da die ersten nur ähnliche Exemplare stark nachahmen [...]. Welche Macht zwingt zur Nachahmung? Die Aneignung eines fremden Eindrucks durch Metaphern. Reiz – Erinnerungsbild durch Metapher (Analogieschlu) verbunden. Resultat: es werden Ähnlichkeiten entdeckt und neu belebt. [...] Das Erkennen, ganz streng genommen, hat nur die Form der Tautologie und ist leer . Jede uns fördernde Erkenntni ist ein id e n ti f ic i r en d e s N ic h t gle ic h e n , des Ähnlichen, d.h. ist wesentlich unlogisch. [...] Met ap her heißt etwas als gl eic h behandeln, was man in einem Punkte als ä h nl ic h erkannt hat. Das Kunstwerk verhält sich ähnlich zur Natur, wie sich der mathematische Kreis zum natürlichen Kreis verhält. [...] Das ist unsre M yt he n we lt , sie reicht bis zur Reformation. Der Glaube an sie ist dem der Griechen an ihre Mythen sehr ähnlich. [...] Gleich (45) [10]419 [11]419 [13]420 [21]422 [28]425 [43]433 [67]440 [69]441 [75]444 [76]444 [82]447 [83]447 [84]448 [...] Der Wille allein ist unsterblich – damit zu vergleichen, wie elend es mit jener Unsterblichkeit des Intellekts, durch die Bildung, aussieht, die Menschenhirne voraussetzt: man sieht, in welcher Linie dies für die Natur kommt. – Wie kann aber das Genie zugleich das höchste Ziel der Natur sein! [...] Der Erkenntnißtrieb o h ne A u s wa h l steht gleich dem wahllosen Geschlechtstrieb – Zeichen d e r G e me i n hei t ! [...] Die Absicht ist die gleiche, wie bei der Kunst – seine eigne Verklärung und Erlösung. [...] [...] die Gefahr ist groß, daß die Individuen schlecht werden, deshalb werden ihre Interessen gewaltsam an Erkenntnißobjekte gefesselt, gleichviel welche. [...] [...] Wunderbare Einheit Wagner's und Schopenhauer's! Sie entstammen dem gleichen Triebe. [...] Wenn es auf den W er t h der Erkenntniß ankommt, anderseits ein schöner Wahn, wenn nur an ihn geglaubt wird, ganz den gleichen Werth wie eine Erkenntniß hat, so sieht man, daß das Leben Illusionen braucht, d.h. für Wahrheiten gehaltene Unwahrheiten. [...] Es ist eine Kraft in uns, die die gr o ß e n Züge des Spiegelbildes intensiver wahrnehmen läßt, und wieder eine Kraft, die den gleichen Rhythmus auch über die wirkliche Ungenauigkeit hinweg betont. Dies muß eine K u ns t kra ft sein. Denn sie s ch a f ft . Ihr Hauptmittel ist weg la s se n und üb er se he n und üb er hö re n. Also antiwissenschaftlich: denn sie hat nicht für alles Wahrgenommene ein gleiches Interesse. [...] Unser öffentliches staatliches und sociales Leben läuft auf ein Gleichgewicht der Egoismen hinaus […]. [...] Aber wie ko m mt der Einfall? Mitunter zufällig äußerlich: ein Vergleichen, das Entdecken irgend einer Analogie findet statt. [...] Es giebt kei n e ap ar t e P h il o so p hi e, ge tr e n n t vo n d e r W i ss e ns c ha ft: d o r t wie h ier wird gle ic h ged ac ht . [...] Vielleicht kann der Mensch nichts ver g e ss e n. Die Operation des Sehens und des Erkennens ist viel zu complicirt, als daß es möglich wäre, sie völlig wieder zu verwischen, d. h. alle Formen, die einmal vom Gehirn und Nervensystem erzeugt sind, wiederholt es von jetzt ab so oft. Eine gleiche Nerventhätigkeit erzeugt das gleiche Bild wieder. Das philosophische Denken ist spezifisch gleichartig mit dem wissenschaftlichen, aber bezieht sich auf gro ß e Dinge und Angelegenheiten. [...] […] das, was Empfindung ist, projicirt zugleich Fo r me n , die dann wieder neue Empfindungen erzeugen. […] 14 [93]450 [95]451 [100]452 [118]458 [147]465 [157]468 [158]468 [179]475 [187]477 [199]480 [201]481 [216]486 [226]489 [236]493 [236]494 [242]495 [248]497 [249]498 [253]499 [258]500 [291]510 [313]515 [...] Alle Rechtschaffenheit und alles Recht dagegen kommt aus einem Gleichgewicht der Egoismen: gegenseitige Anerkennung sich nicht zu schädigen. […] Dagegen ist die christliche Ethik der Gegensatz: sie beruht auf dem Identificiren seiner selbst mit dem Nächsten, anderen wohlthun ist hier ein Sich-selbst-wohlthun, mit anderen leiden ist hier gleich dem eignen Leid. [...] Ich nehme in diesem Buche auf die gegenwärtigen Gelehrten keine Rücksicht und errege dadurch den Schein, als ob ich sie den gleichgültigen Dingen zurechne. […] Jetzt wende ich meine Augen mit Widerstreben auf sie, um ihnen zu sagen, daß sie mir nicht gleichgültig sind, daß ich aber wünschen möchte, sie wären's mir. Sehr lehrreich, wenn Heraclit seine Sprache mit Apollo und Sibylle vergleicht. [...] Er nimmt die W ir k u n ge n d er co mp li cir te st e n M ec ha ni s me n , des Gehirns, an, als seien die Wirkungen seit Uranfang gleicher Art. [...] Die sogenannten u nb e wu ß te n Sc h l üs s e sind zurückzuführen auf das a ll es a u fb e wa hre nd e G ed äc h t niß , das Erfahrungen paralleler Art darbietet und somit die Folgen einer Handlung schon ke n n t . Es ist nicht Anticipation der Wirkung, sondern das Gefühl: gleiche Ursachen gleiche Wirkungen, hervorgebracht durch ein Gedächtnißbild. [...] Der ungeheure Consensus der Menschen über die Dinge beweist die volle Gleichartigkeit ihres Perceptionsapparates. […] Natürlich ist es nur eine W ied er sp i e ge l u n g , eine immer deutlichere. Der Spiegel selbst ist aber nichts ganz Fremdes und dem Wesen der Dinge Ungehöriges, sondern selbst langsam entstanden als Wesen der Dinge gleichfalls. [...] Das Ähnliche erinnert an das Ähnliche und vergleicht sich damit: das ist das Erkennen, das schnelle Subsumiren des Gleichartigen. [...] [...] Alle Qualitäten sind ursprünglich nur e i n ma li ge Ak ti o ne n , dann, in gleichen Fällen öfter wiederholte, endlich Gewohnheiten. [...] Die Deutschen sind wahrer Kunstschöpfungen gar nicht würdig: denn irgend eine politische Gans, so eine Art Gervinus, setzt sich gleich mit anmaßlicher Brütegeschäftigkeit darauf, als ob diese Eier nur für sie gerade hingelegt wären. […] […] Der Philister und der windige „Gebildete“ unserer Zeitungsatmosphäre reichen sich brüderlich die Hand und unter dem gleichen Jauchzen vernichtet der Bonner Afterphilosoph Jürgen Bona-Meyer den Pessimismus und Riehl Jahn oder Strauß die neunte Symphonie. […] [...] Aber durch das Nebeneinander verschiedener mit gleichem Pathos aufgestellter Philosophien (oder religiöser Systeme) entstand ein sonderbarer Kampf. [...] Das Na c ha h me n ist das Mittel aller Kultur, dadurch wird allmählich der Instinkt erzeugt. All es Ve r gle ic he n (Urd e n ke n) i st ei n Na c h ah me n . [ . ..] Das Erkennen, ganz streng genommen, hat nur die Form der Tautologie und ist leer . Jede uns fördernde Erkenntniß ist ein I d e nt i fi ci r en d e s N ic h t gle ic h e n, des Ähnlichen d. h. ist wesentlich unlogisch. [...] [...] Viele einzelne Züge bestimmen uns ein Ding, nicht alle: die Gleichheit dieser Züge veranlat uns viele Dinge unter einen Begriff zusammenzunehmen. [...] Das Wesen der Definition: der Bleistift ist ein länglicher usw. Körper. A ist B. Das was länglich ist, ist hier zugleich bunt. Die Eigenschaften enthalten nur Relationen. Ein bestimmter Körper ist gleich so und so viel Relationen. [...] Also im Wesen des synthetischen Urtheils liegt eine Meto n y mi e , d.h. es ist eine f al sc h e G le i ch u n g. [...] Das „ist“ im synthetischen Urtheil ist falsch, es enthält eine Übertragung, zwei verschiedene Sphären werden neben einander gestellt, zwischen denen nie eine Gleichung stattfinden kann. [...] [...] Das als Wahrheit verehrte Phantom hat die gleichen Wirkungen, gilt ebenfalls als Metaphysikum. Met ap her heißt etwas als g l eic h behandeln, was man in einem Punkte als ä h nl ic h erkannt hat. [...] Gegen die r ei ne, fo l ge nlo s e Er ke n n t niß d er W a hr he it ist der Mensch gl eic h g ü lti g. [...] Die Wahrheit ist dem Menschen gleichgültig: dies zeigt die Tautologie, als die einzig zugängliche Form der Wahrheit. [...] […] ich meine so, wie sie die Römer verstanden haben: zum Sc h mu c k e , beliebig hineinzusetzen, Gewächshaus im Vergleich zum Walde. [...] […] und wenn es wahr ist daß die Griechen von dem Sprachtone fremdländischer Völker wie von einem Gequake sprachen und daher mit einem gleichen Namen die Frösche benannten, so sind Barbaren also Quäker […] Bild (53) [1]417 [7]418 [10]419 [...] Es ist zu zeigen, wie das ganze Leben eines Volkes unrein und verworren das Bild widerspiegelt, das seine höchsten Genien bieten: diese sind nicht das Produkt der Masse, aber die Masse zeigt ihre Reperkussion. [...] [...] Bild der Aufgabe der neueren philosophischen Generation. [...] [...] Sie hat nur von dem Großen und Einzigen zu reden, von dem Vorbild. [...] 15 [35]428 [...] Für den tragischen Philosophen vollendet es das B i ld d es Da se i ns , daß das Metaphysische nur anthropomorphisch erscheint. [...] [62]439 [...] Heraklit kann nie veralten. Es ist die Dichtung außer den Grenzen der Erfahrung, Fortsetzung des m yt h i sc h e n T r ieb e s ; auch wesentlich in Bildern. [...] [66]440 Unser Verstand ist eine Flächenkraft, ist o b er fl äc hl ic h . Das nennt man auch „subjektiv“. Er erkennt durch B egr i ffe : das heit unser Denken ist ein Rubrizieren, ein Benamsen. […] Was kann der Zweck einer solchen Flächenkraft sein? Dem Begriff entspricht zuerst das Bild, Bilder sind Urdenken d. h. die Oberflächen der Dinge im Spiegel des Auges zusammengefat. Das B ild ist das eine, das Re ch e ne xe mp el das andre. Bilder in menschlichen Augen! Das beherrscht alles menschliche Wesen: vom Au g e aus! Subjekt! das O hr hört den Klang! Eine ganz andere wunderbare Conception derselben Welt. [...] [67]440 Es ist eine Kraft in uns, die die gr o ß e n Züge des Spiegelbildes intensiver wahrnehmen läßt, und wieder eine Kraft, die den gleichen Rhythmus auch über die wirkliche Ungenauigkeit hinweg betont. [...] [67]441 [...] Das Wort enthält nur ein Bild, daraus der Begriff. Das Denken rechnet also mit künstlerischen Gröen. Alles Rubriziren ist ein Versuch zum Bilde zu kommen. Zu jedem wahren Sei n verhalten wir uns oberflächlich, wir reden die Sprache des Symbols, des Bildes: sodann thun wir etwas hinzu, mit künstlerischer Kraft, indem wir die Hauptzüge verstärken, die Nebenzüge vergessen. [69]441 [...] Wir wollen euch die Welt noch so umstellen mit Bildern, daß euch schaudert. [...] [75]443 Das philosophische Denken ist mitten in allem wissenschaftlichen Denken zu spüren: selbst bei der Conjektur. Es springt voraus auf leichten Stützen: schwerfällig keucht der Verstand hinter drein und sucht bessere Stützen, nachdem ihm das lockende Zauberbild erschienen ist. [...] [77]445 Die Phantasieerzeugung kann man im Auge beobachten. Ähnlichkeit führt zur kecksten Fortbildung: aber auch ganz andre Verhältnisse, Contrast den Contrast, und unaufhörlich. Hier si e ht man die außerordentliche Produktivität des Intellekts. Es ist ein Bilderleben. [78]445 Man muß beim Denken schon haben, was man sucht, durch Phantasie – dann erst kann die Reflexion es beurtheilen. Dies thut sie, indem sie es an gewöhnlichen und häufig erprobten Ketten mißt. Was ist eigentlich "logisch" beim Bilderdenken? –.[...] Es ist viel mehr von Bilderreihen im Gehirn, als zum Denken verbraucht wird: der Intellekt wählt schnell ähnliche Bilder: das Gewählte erzeugt wieder eine ganze Fülle von Bildern: schnell aber wählt er wieder eines davon usw. Das bewußte Denken ist nur ein Herauswählen von Vorstellungen. Es ist ein langer Weg bis zur Abstraktion. 1) Die Kraft, die die Bilderfülle erzeugt 2) die Kraft, welche das Ähnliche auswählt und betont. [...] [79]445 Es ist zwiefach eine künstlerische Kraft da, die bildererzeugende und die auswählende. [...] [79]446 [...] Die Traumeswelt beweist die Richtigkeit: der Mensch geht hier nicht bis zur Abstraktion weiter, oder: er wird nicht von den Bildern, die durch's Auge einströmen, geleitet und modificirt. Sieht man jene Kraft näher an, so ist hier auch kein künstlerisches ganz freies Erfinden: das wäre etwas Willkürliches, also Unmögliches. Sondern die feinsten Ausstrahlungen von Nerventhätigkeit auf einer Fläche gesehn: sie verhalten sich wie die Chladni'schen Klangfiguren zu dem Klang selbst: so diese Bilder zu der darunter sich bewegenden Nerventhätigkeit. [...] [81]447 Das Träumen als die auswählende Fortsetzung der Augenbilder. [...] [82]447 [...] Eine gleiche Nerventhätigkeit erzeugt das gleiche Bild wieder. [84]448 [...] Es ist das Wesen der Lust- und Unlustempfindung, sich in adäquaten Bewegungen auszudrücken: dadurch daß diese adäquaten Bewegungen wieder andere Nerven zur Empfindung veranlassen, entsteht die Empfindung des B ild e s. [87]448 Auch bei dem Bilderdenken hat der Darwinismus Recht: das kräftigere Bild verzehrt die geringeren. [93]450 Auch das Moralische hat keine andere Quelle als den Intellekt, aber die verbindende Bilderkette wirkt hier anders als bei dem Künstler und Denker: sie reizt zur T h at. [...] [107]454 Die unbewußten Sc h l ü ss e erregen mein Bedenken: es wird wohl jenes Übergehn von B i l d zu B ild sein: das letzterreichte Bild wirkt dann als Reiz und Motiv. Das unbewußte Denken muß sich ohne Begriffe vollziehn: also in An sc h a u u n ge n . Dies ist aber das Schlußverfahren des beschaulichen Philosophen und des Künstlers. Er thut dasselbe, was Jeder in physiologischen persönlichen Antrieben thut, übertragen auf eine unpersönliche Welt. Dieses Bilderdenken ist nicht von vorn herein streng l o gi sc her Natur, aber doch mehr oder weniger logisch. Der Philosoph bemüht sich dann, an Stelle des Bilderdenkens ein Begriffsdenken zu setzen. Die Instinkte scheinen auch ein solches Bilderdenken zu sein, das zuletzt zum Reiz und Motiv wird. [147]465 Die sogenannten u nb e wu ß te n Sc h l üs s e sind zurückzuführen auf das al le s a u fb e wa hre nd e G ed äc h t niß , das Erfahrungen paraleller Art darbietet und somit die Folgen einer Handlung schon ke n n t . Es ist nicht Anticipation der Wirkung, sondern das Gefühl: gleiche Ursachen gleiche Wirkungen, hervorgebracht durch ein Gedächtnißbild. 16 [158]468 [...] Nun hat sich der Mensch langsam entwickelt und die Erkenntniß entwickelt sich noch: also das Weltbild wird immer wahrer und vollständiger. [...] [161]469 [...] Das Bewußtsein hebt an mit der Kausalitätsempfindung d. h. das Gedächtniß ist älter als das Bewußtsein. Z.B. bei der Mimosa haben wir Gedächtniß, aber kein Bewußtsein. Gedächtniß natürlich ohne B ild , bei der Pflanze. [...] [162]470 Gedächtniß hat nichts mit Nerven, mit Gehirn zu thun. Es ist eine Ureigenschaft. Denn der Mensch trägt das Gedächtniß aller vorigen Generationen mit sich herum. Das Gedächtnißb i ld etwas sehr Künstliches und Se lt e ne s . [181]476 [...] Unsere Ku n st ist Abbild der desperaten Erkenntniß. [209]483 […] Ein empfundener Reiz und ein Blick auf eine Bewegung, verbunden, ergeben die Kausalität zunächst als Erfahrungssatz: zwei Dinge, nämlich eine bestimmte Empfindung und ein bestimmtes Gesichtsbild erscheinen immer zusammen [...]. [212]485 [...] Vorbildlich Schopenhauers Fragen zur Philosophie und Kritik Kants. [...] [217]487 [...] Das Bild im Auge ist für unser Erkennen maßgebend, dann der Rhythmus unseres Gehörs. Vom Auge aus würden wir ni e zur Zeitvorstellung kommen, vom Ohre aus nie zur Raumvorstellung. Dem Tastgefühl entspricht die Kausalitätsempfindung. Von vorn herein sehen wir ja die Bilder im Auge nur i n u n s , wir hören den Ton nur i n u n s – von da zur Annahme einer Außenwelt ist ein weiter Schritt. Die Pflanze z. B. empfindet keine Außenwelt. Das Tastgefühl, und zugleich das Gesichtsbild geben zwei Empfindungen nebeneinander empirisch, diese, weil sie immer mit einander erscheinen, erwecken die Vorstellung eines Zusammenhangs (durch Met ap her – denn nicht alles Miteinander-Erscheinende hängt zusammen). [...] [221]488 [...] Merkwürdig, daß die Griechen philosophirt haben. Die schöne Lüge. Aber noch merkwürdiger, daß der Men sc h überhaupt zum Wahrheitspathos gekommen. Die Bilder in ihm sind ja viel mächtiger als die Natur um ihn: wie bei den deutschen Malern des 15ten Jhs., die, trotz der sie umgebenden Natur, so spinnenartige Glieder schaffen – von der alten frommen Tradition bestimmt. [...] [226]490 [...] Das Nachahmen setzt voraus ein Aufnehmen und dann ein fortgesetztes Übertragen des aufgenommenen Bildes in tausend Metaphern, alle wirkend. [...] [227]490 Welche Macht zwingt zur Nachahmung? Die Aneignung eines fremden Eindrucks durch Metaphern. Reiz – Erinnerungsbild durch Metapher (Analogieschluß) verbunden. Resultat: es werden Ähnlichkeiten entdeckt und neu belebt. An einem Erinnerungsbilde spielt sich der wi ed er ho l te Reiz noch einmal ab. Re iz p ercip ir t – jetzt wied er ho lt , in vielen Metaphern, wobei verwandte Bilder, aus den verschiedenen Rubriken, herbeiströmen. [...] [289]509 [...] vorbildliche Wirkungen der Alten [...] [299]511 [...] Die Erzieh u n g eines Volkes z ur B i ld u n g ist wesentlich Gewöhnung an gute Vorbilder und Bildung edler Bedürfnisse. 17 Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen Metapher (4) [3]817 [4]818 [6]827/8 [11]847 Was hier der Vers für den Dichter ist, ist für den Philosophen das dialektische Denken: nach ihm greift er, um sich seine Verzauberung festzuhalten, um sie zu petrificiren. Und wie für den Dramatiker Wort und Vers nur das Stammeln in einer fremden Sprache sind, um in ihr zu sagen, was er lebte und schaute, so ist der Ausdruck jeder tiefen philosophischen Intuition durch Dialektik und wissenschaftliches Reflektiren zwar einerseits das einzige Mittel, um das Geschaute mitzutheilen, aber ein kümmerliches Mittel, ja im Grunde eine metaphorische, ganz und gar ungetreue Übertragung in eine verschiedene Sphäre und Sprache. [...] wer, wie Schopenhauer, auf den „Höhen der indischen Lüfte“ das heilige Wort von dem moralischen Werthe des Daseins gehört hat, der wird schwer davon abzuhalten sein, eine höchst anthropomorphische Metapher zu machen und jene schwermüthige Lehre aus der Beschränkung auf das Menschenleben herauszuziehen und sie auf den allgemeinen Charakter alles Daseins, durch Übertragung, anzuwenden. Die dritte, für Heraklit allein zurückbleibende Möglichkeit wird niemand mit dialektischem Spürsinn und gleichsam rechnend errathen können: denn was er hier erfand, ist eine Seltenheit selbst im Bereiche mystischer Unglaublichkeiten und unerwarteter kosmischer Metaphern. Den Begriff des Seins! Als ob der nicht den ärmlichsten empirischen Ursprung bereits in der Etymologie des Wortes aufzeigte! Denn esse heißt ja im Grunde nur „athmen“: wenn es der Mensch von allen anderen Dingen gebraucht, so überträgt er die Überzeugung, daß er selbst athmet und lebt, durch eine Metapher, das heißt durch etwas Unlogisches, auf die anderen Dinge und begreift ihre Existenz als ein Athmen nach menschlicher Analogie. Übertragung (11) [3]817 [4]818 [5]824/5 [5]825 [10]840 [11]847 [14]852 [15]858 Und wie für den Dramatiker Wort und Vers nur das Stammeln in einer fremden Sprache sind, um in ihr zu sagen, was er lebte und schaute, so ist der Ausdruck jeder tiefen philosophischen Intuition durch Dialektik und wissenschaftliches Reflektiren zwar einerseits das einzige Mittel, um das Geschaute mitzutheilen, aber ein kümmerliches Mittel, ja im Grunde eine metaphorische, ganz und gar ungetreue Übertragung in eine verschiedene Sphäre und Sprache. [...] wer, wie Schopenhauer, auf den „Höhen der indischen Lüfte“ das heilige Wort von dem moralischen Werthe des Daseins gehört hat, der wird schwer davon abzuhalten sein, eine höchst anthropomorphische Metapher zu machen und jene schwermüthige Lehre aus der Beschränkung auf das Menschenleben herauszuziehen und sie auf den allgemeinen Charakter alles Daseins, durch Übertragung, anzuwenden. Es gehörte eine erstaunliche Kraft dazu, diese Wirkung in das Entgegengesetzte, in das Erhabne und das beglückte Erstaunen zu übertragen. [...] es ist der Wettkampfgedanke des einzelnen Griechen und des griechischen Staates, aus den Gymnasien und Palästren, aus den künstlerischen Agonen, aus dem Ringen der politischen Parteien und der Städte miteinander, ins Allgemeinste übertragen, so daß jetzt das Räderwerk des Kosmos in ihm sich dreht. Denn der Ursprung jener Einheitsconception ist bei dem Einen ein ganz andrer, ja entgegengesetzter als bei dem Anderen; und wenn Einer die Lehre des Andern überhaupt kennen gelernt hat, so mußte er sie sich, um sie nur zu verstehen, erst in seine eigne Sprache übertragen. Bei dieser Übertragung gieng aber jedenfalls gerade das Spezifische der andern Lehre verloren. Den Begriff des Seins! Als ob der nicht den ärmlichsten empirischen Ursprung bereits in der Etymologie des Wortes aufzeigte! Denn esse heißt ja im Grunde nur „athmen“: wenn es der Mensch von allen anderen Dingen gebraucht, so überträgt er die Überzeugung, daß er selbst athmet und lebt, durch eine Metapher, das heißt durch etwas Unlogisches, auf die anderen Dinge und begreift ihre Existenz als ein Athmen nach menschlicher Analogie. Nun verwischt sich bald die originale Bedeutung des Wortes: es bleibt aber immer so viel übrig, daß der Mensch sich das Dasein andrer Dinge nach Analogie des eignen Daseins, also anthropomorphisch, und jedenfalls durch eine unlogische Übertragung, vorstellt. Selbst für den Menschen, also abgesehn von jener Übertragung, ist aber der Satz „ich athme, also giebt es ein Sein“ gänzlich unzureichend: als gegen welchen derselbe Einwand wie gegen das ambulo, ergo sum oder ergo est gemacht werden muß. Jetzt war vielmehr das eigentliche Problem aufgestellt, die Lehre vom ungewordnen und unvergänglichen Sein auf diese vorhandene Welt zu übertragen, ohne zur Theorie des Scheins und der Täuschung durch die Sinne seine Zuflucht zu nehmen. Genug, er hatte ein regulatives Schema für die Bewegung in der Welt, die er jetzt entweder als eine Bewegung der wahren, isolierten Wesenheiten durch das Vorstellende, den Nous, oder als Bewegung durch bereits Bewegtes dachte. Daß die letztere Art, die mechanische Übertragung von Bewegungen und Stößen bei seiner Grundannahme ebenfalls ein Problem in sich enthalte, ist ihm wahrscheinlich entgangen: die Gemeinheit und Alltäglichkeit der Wirkung durch Stoß stumpfte wohl seinen Blick gegen die Räthselhaftigkeit desselben ab. 18 Analogie (3) [11]844 [11]847 Wir wollen uns ja davor hüten, eine solche merkwürdige Thatsache nach falschen Analogien zu deuten. Denn esse heißt ja im Grunde nur „athmen“: wenn es der Mensch von allen anderen Dingen gebraucht, so überträgt er die Überzeugung, daß er selbst athmet und lebt, durch eine Metapher, das heißt durch etwas Unlogisches, auf die anderen Dinge und begreift ihre Existenz als ein Athmen nach menschlicher Analogie. Nun verwischt sich bald die originale Bedeutung des Wortes: es bleibt aber immer so viel übrig, daß der Mensch sich das Dasein andrer Dinge nach Analogie des eignen Daseins, also anthropomorphisch und jedenfalls durch eine unlogische Übertragung, vorstellt. Ähnlich (8) [3]814 [7]830 [11]846 [15]857 [15]859 [17]867 Was bringt also das philosophische Denken so schnell an sein Ziel? Unterscheidet es sich von dem rechnenden und abmessenden Denken etwa nur durch das raschere Durchfliegen großer Räume? Nein, denn es hebt seinen Fuß eine Fremde, unlogische Macht, die Phantasie. Durch sie gehoben springt es weiter von Möglichkeit zu Möglichkeit, die einstweilen als Sicherheiten genommen werden: hier und da ergreift es selbst Sicherheiten im Flüge. Ein genialisches Vorgefühl zeigt sie ihm, es erräth von ferne, daß an diesem Punkte beweisbare Sicherheiten sind. Besonders aber ist die Kraft der Phantasie mächtig im blitzartigen Erfassen und Beleuchten von Ähnlichkeiten: die Reflexion bringt nachher ihre Maßstäbe und Schablonen heran und sucht die Ähnlichkeiten durch Gleichheiten, das Nebeneinander-Geschaute durch Kausalitäten zu ersetzen. [...] für [den contuitiven Gott] läuft alles Widerstrebende in eine Harmonie zusammen, unsichtbar zwar für das gewöhnliche Menschenauge, doch dem verständlich, der, wie Heraklit, dem beschaulichen Gotte ähnlich ist. Durch Worte und Begriffe werden wir nie hinter die Wand der Relationen, etwa in irgend einen fabelhaften Urgrund der Dinge, gelangen und selbst in den reinen Formen der Sinnlichkeit und des Verstandes, in Raum Zeit und Kausalität gewinnen wir nichts, was einer veritas aeterna ähnlich sähe. Wenn jene Gegner aber einwenden wollten: „aber in eurem Denken selbst giebt es doch Succession, also könnte auch euer Denken nicht real sein und somit auch nichts beweisen können“, so würde Parmenides vielleicht ähnlich wie Kant in einem ähnlichen Falle, bei einem gleichen Vorwurfe, geantwortet haben: „ich kann zwar sagen, meine Vorstellungen folgen einander: aber das heißt nur: wir sind uns ihrer als in einer Zeitfolge, das heißt nach der Form des inneren Sinnes bewußt. [...] während es fast gleichgültig schien, wie nun diese Selbstbewegung zu denken sei, etwa ähnlich wie das Sichhin- und -herschieben von ganz zarten und kleinen runden Quecksilber-Kügelchen. „Ich genieße das Vergnügen, sagt Kant, ohne Beihülfe willkürlicher Erdichtungen, unter der Veranlassung ausgemachter Bewegungsgesetze, sich ein wohlgeordnetes Ganze erzeugen zu sehen, welches demjenigen Weltsysteme, das das unserige ist, so ähnlich sieht, daß ich mich nicht entbrechen kann, es für dasselbe zu halten. [...]“. Gleich (37) 801/2 [1]808 [2]809 [2]811 [3]814 [3]815 [4]821 [5]822 [5]822 [5]824 [...] es ist ein Anfang, um jene Naturen durch Vergleichung wieder zu gewinnen und nachzuschaffen und die Polyphonie der griechischen Natur endlich einmal wiedererklingen zu lassen [...]. Gleich das erste Erlebniß der Philosophie auf griechischem Boden, die Sanktion der sieben Weisen, ist eine deutliche und unvergeßliche Linie am Bilde des Hellenischen. Mit Plato beginnt etwas ganz Neues; oder, wie mit gleichem Rechte gesagt werden kann, seit Plato fehlt den Philosophen etwas Wesentliches, im Vergleich mit jener Genialen-Republik von Thales bis Sokrates. [...] die Schriften des Demokrit, den die Alten dem Plato gleichstellen [...]. Besonders aber ist die Kraft der Phantasie mächtig im blitzartigen Erfassen und Beleuchten von Ähnlichkeiten: die Reflexion bringt nachher ihre Maßstäbe und Schablonen heran und sucht die Ähnlichkeiten durch Gleichheiten, das Nebeneinander-Geschaute durch Kausalitäten zu ersetzen. [...] so daß er zum Beispiel wagt, die Erde mit einer geflügelten Eiche zu vergleichen [ ]. [...] die Bedingungen zu dem Abfall von jenem Sein zu einem Werden in Ungerechtigkeit sind immer die gleichen [...]. Und was schaute ich? Gesetzmäßigkeiten, unfehlbare Sicherheiten, immer gleiche Bahnen des Rechtes, hinter allen Überschreitungen der Gesetze richtende Erinnyen [...]. Aus dieser Intuition entnahm Heraklit zwei zusammenhängende Verneinungen, die erst durch die Vergleichung mit den Lehrsätzen seines Vorgängers in das helle Licht gerückt werden. [...] daß aber, wie die Zeit, so der Raum, und wie dieser, so auch alles, was in ihm und der Zeit zugleich ist, nur ein relatives Dasein hat, nur durch und für ein Anderes, ihm Gleichartiges, d. h. wieder nur ebenso Bestehendes sei. 19 [7]830 [7]832 [8]833 [8]835 [9]837 [10]840 [10]841 [10]841 [10]841 [10]842 [10]843 [11]846 [12]850 [14]852 [14]853 [14]855 [16]863 [16]863 [...] und selbst jener cardinale Anstoß, wie das reine Feuer in so unreine Formen einziehen könne, wird von ihm durch ein erhabnes Gleichnis überwunden. Ein Werden und Vergehen, ein Bauen und Zerstören, ohne jede moralische Zurechnung, in ewig gleicher Unschuld, hat in dieser Welt allein das Spiel des Künstlers und des Kindes. In dem höchsten und in dem verkehrtesten Menschen offenbart sich die gleiche immanente Gesetzmäßigkeit und Gerechtigkeit. Seine Begabung ist die seltenste, in einem gewissen Sinne unnatürlichste, dabei selbst gegen die gleichartigen Begabungen ausschließend und feindselig. Ob es gleich von ihm „ohne Lächeln Putz und Salbenduft“, vielmehr wie mit „schäumendem Munde" verkündet wird, es mu ß zu den tausenden Jahren der Zukunft dringen. Einen ganz verschiednen Blick that Parmenides; er verglich die Qualitäten miteinander und glaubte zu finden, daß sie nicht alle gleichartig seien, sondern in zwei Rubriken eingeordnet werden müßten. Im Übrigen scheint es mir rein zufällig, daß gerade am gleichen Orte, in Elea, zwei Männer eine Zeitlang zusammen lebten [...]. War er auch keine so umwälzende Persönlichkeit wie Pythagoras, so hat er doch, auf seinen Wanderungen, den gleichen Zug und Trieb, die Menschen zu bessern, zu reinigen, zu heilen. In der kühnen Mißbilligung der bestehenden Sitten und Schätzungen hat er in Griechenland nicht seines Gleichen [...]. Die einzige Form der Erkenntniß aber, der wir sofort ein unbedingtes Vertrauen schenken und deren Leugnung dem Wahnsinne gleichkommt, ist die Tautologie A = A. Zwar urtheilt, wie er sich besann, die ganze große Menge der Menschen mit der gleichen Perversität [...]. So schwebt es, begrenzt, vollendet, unbeweglich, überall im Gleichgewicht, in jedem Punkte gleich vollkommen, wie eine Kugel, aber nicht in einem Raume: denn sonst wäre dieser Raum ein zweites Seiendes. [...] ich kann von einem Baume sowohl sagen: „er ist“, im Vergleiche mit allen übrigen Dingen, als „er wird“, im Vergleich zu ihm selbst in einem anderen Zeitmomente [...]. So war der überverwegne Einfall nothwendig geworden, Denken und Sein für identisch zu erklären; keine Form der Anschaulichkeit, kein Symbol, kein Gleichniß konnte hier zu Hülfe kommen [...]. [...] aber ebenfalls und aus den gleichen Gründen ein Entstehen des Vielen aus dem Einen [...]. Dagegen behauptet nun Anaxagoras daß aus dem Gleichen nie das Ungleiche hervorgehen könne und daß aus dem einen Seienden die Veränderung nie zu erklären sei. Unter dieser Voraussetzung nahm Anaxagoras wie später Demokrit an, daß sie sich stoßen müßten, wenn sie in ihren Bewegungen auf einander geriethen, daß sie sich den gleichen Raum streitig machen würden, und daß dieser Kampf eben alle Veränderung verursache. Mit anderen Worten: jene ganz isolirten, durch und durch verschiedenartigen und ewig unveränderlichen Substanzen waren doch nicht absolut verschiedenartig gedacht, sondern hatten sämmtlich, außer einer spezifischen, ganz besonderen Qualität, doch ein ganz und gar gleichartiges Substrat, ein Stück raumfüllender Materie. In der Teilnahme an der Materie standen sie alle gleich und konnten deshalb aufeinander wirken, das heißt sich stoßen. Nach diesen Voraussetzungen stellt sich Anaxagoras die Urexistenz der Welt vor, etwa gleich einer staubartigen Masse von unendlich kleinen erfüllten Punkten [...]. [...] soweit reicht die Gleichheit des Anaximandrischen Unbestimmten und der Anaxagorischen Urmischung. Abgesehn aber von dieser negativen Gleichheit unterscheiden sie sich positiv dadurch, daß die Letztere zusammengesetzt, das Erstere eine Einheit ist. Bild (15) 801 803 [1]808 [3]813 [4]817 [4]821 Wer dagegen an großen Menschen überhaupt seine Freude hat, hat auch seine Freude an solchen Systemen, seien sie auch ganz irrthümlich: sie haben doch einen Punkt an sich, der ganz unwiderleglich ist, eine persönliche Stimmung, Farbe, man kann sie benutzen, um das Bild des Philosophen zu gewinnen: wie man vom Gewächs an einem Orte auf den Boden schließen kann. Aus drei Anecdoten ist es möglich, das Bild eines Menschen zu geben [...]. Wenn wir das gesammte Leben des griechischen Volkes richtig deuteten, immer würden wir doch nur das Bild wiedergespiegelt finden, das in seinen höchsten Genien mit lichteren Farben strahlt. Gleich das erste Erlebnis der Philosophie auf griechischem Boden, die Sanktion der sieben Weisen, ist eine deutliche und unvergeßliche Linie am Bilde des Hellenischen. [...] erstens weil der Satz etwas vom Ursprung der Dinge aussagt und zweitens weil er dies ohne Bild und Fabelei thut [...]. Während der allgemeine Typus des Philosophen an dem Bilde des Thales sich nur wie aus Nebeln heraushebt, spricht schon das Bild seines großen Nachfolgers viel deutlicher zu uns. In alle dem war er das große Vorbild des Empedokles. 20 [8]834 [8]835 [9]836 [9]837 [11]844 [19]870 [19]870 [...] in einem abgelegnen Heiligthum, unter Götterbildern, neben kalter ruhig-erhabener Architektur mag so ein Wesen begreiflicher erscheinen. Was er aber aus diesem Orakel heraushörte, das hielt er für unsterbliche und ewig deutenswerthe Weisheit, von unbegrenzter Wirkung in die Ferne, nach dem Vorbild der prophetischen Reden der Sibylle. [...] ist ihm in seinem Zeitgenossen P ar me n id e s ein Gegenbild an die Seite gestellt [...]. Seine Methode hierbei war folgende: er nahm ein paar Gegensätze, zum Beispiel leicht und schwer, dünn und dicht, thätig und leidend, und hielt sie an jenen vorbildlichen Gegensatz von Licht und Dunkel [...]. Einem Griechen war es damals möglich, aus der überreichen Wirklichkeit, wie aus einem bloßen gauklerischen Schematismus der Einbildungskräfte zu flüchten − nicht etwa, wie Plato, in das Land der ewigen Ideen, in die Werkstätte des Weltenbildners, um unter den makellosen unzerbrechlichen Urformen der Dinge das Auge zu weiden − sondern in die starre Todesruhe des kältesten, Nichts sagenden Begriffs, des Seins. [...] dann war er die Abbreviatur des anaxagorischen Kosmos, das Bild des Nous [...]. [...] so erschien wohl die Wirkung der perikleischen Rede dem horchenden Anaxagoras oftmals als ein Gleichnisbild jener kreisförmigen Urbewegung [...]. 21 Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne Metapher (24) [1]879 [1]879 [1]880 [1]881 [1]882 [1]883 [1]884 [1]886 [2]887 [2]887 [2]888 [2]888 [2]889 Das „Ding an sich“ (das würde eben die reine folgenlose Wahrheit sein) ist auch dem Sprachbildner ganz unfasslich und ganz und gar nicht erstrebenswerth. Er bezeichnet nur die Relationen der Dinge zu den Menschen und nimmt zu deren Ausdrucke die kühnsten Metaphern zu Hülfe. Ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild! erste Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in einem Laut! Zweite Metapher. Und jedesmal vollständiges Ueberspringen der Sphäre, mitten hinein in eine ganz andere und neue. Wir glauben etwas von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reden und besitzen doch nichts als Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen. Wie der Ton als Sandfigur, so nimmt sich das rätselhafte X des Dings an sich einmal als Nervenreiz, dann als Bild, endlich als Laut aus. Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden, und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken: die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen in Betracht kommen. Wir wissen immer noch nicht, woher der Trieb zur Wahrheit stammt: denn bis jetzt haben wir nur von der Verpflichtung gehört, die die Gesellschaft, um zu existiren, stellt, wahrhaft zu sein, d. h. die usuellen Metaphern zu brauchen, also moralisch ausgedrückt: von der Verpflichtung nach einer festen Convention zu lügen, schaarenweise in einem für alle verbindlichen Stile zu lügen. Alles, was den Menschen gegen das Thier abhebt, hängt von dieser Fähigkeit ab, die anschaulichen Metaphern zu einem Schema zu verflüchtigen, also ein Bild in einen Begriff aufzulösen [...]. Während jede Anschauungsmetapher individuell und ohne ihresgleichen ist und deshalb allem Rubriciren immer zu entfliehen weiss, zeigt der grosse Bau der Begriffe die starre Regelmässigkeit eines römischen Columbariums und athmet in der Logik jene Strenge und Kühle aus, die der Mathematik zu eigen ist. Wer von dieser Kühle angehaucht wird, wird es kaum glauben, dass auch der Begriff, knöchern und 8eckig wie ein Würfel und versetzbar wie jener, doch nur als das Re s id u u m e i ner M etap he r übrig bleibt, und dass die Illusion der künstlerischen Uebertragung eines Nervenreizes in Bilder, wenn nicht die Mutter so doch die Grossmutter eines jeden Begriffs ist. Er vergisst also die originalen Anschauungsmetaphern als Metaphern und nimmt sie als die Dinge selbst. Nur durch das Vergessen jener primitiven Metapherwelt, [..........] nur dadurch, dass der Mensch sich als Subjekt, und zwar als k ü n st ler is c h s ch a f fe nd e s Subjekt vergisst, lebt er mit einiger Ruhe, Sicherheit und Consequenz [...]. Aber das Hart- und Starr-Werden einer Metapher verbürgt durchaus nichts für die Nothwendigkeit und ausschliessliche Berechtigung dieser Metapher. Dabei ergiebt sich allerdings, dass jene künstlerische Metapherbildung, mit der in uns jede Empfindung beginnt, bereits jene Formen voraussetzt, also in ihnen vollzogen wird; nur aus dem festen Verharren dieser Urformen erklärt sich die Möglichkeit, wie nachher wieder aus den Metaphern selbst ein Bau der Begriffe constituiert werden sollte. Dieser ist nämlich eine Nachahmung der Zeit- Raum- und Zahlenverhältnisse auf dem Boden der Metaphern. Jener Trieb zur Metapherbildung, jener Fundamentaltrieb des Menschen, den man keinen Augenblick wegrechnen kann, weil man damit den Menschen selbst wegrechnen würde [...]. Fortwährend verwirrt er die Rubriken und Zellen der Begriffe dadurch dass er neue Übertragungen, Metaphern, Metonymien hinstellt, fortwährend zeigt er die Begierde, die vorhandene Welt des wachen Menschen so bunt unregelmässig folgenlos unzusammenhängend, reizvoll und ewig neu zu gestalten, wie es die Welt des Traumes ist. Mit schöpferischem Behagen wirft er die Metaphern durcheinander und verrückt die Gränzsteine der Abstraktionen, so dass er z. B. den Strom als den beweglichen Weg bezeichnet, der den Menschen trägt, dorthin, wohin er sonst geht. Von diesen Intuitionen aus führt kein regelmässiger Weg in das Land der gespenstischen Schemata, der Abstraktionen: für sie ist das Wort nicht gemacht, der Mensch verstummt, wenn er sie sieht, oder redet in lauter verbotenen Metaphern und unerhörten Begriffsfügungen, um wenigstens durch das Zertrümmern und Verhöhnen der alten Begriffsschranken dem Eindrucke der mächtigen gegenwärtigen Intuition schöpferisch zu entsprechen. Wo einmal der intuitive Mensch, etwa wie im älteren Griechenland seine Waffen gewaltiger und siegreicher führt, als sein Widerspiel, kann sich günstigen Falls eine Kultur gestalten, und die Herrschaft der Kunst über das Leben sich gründen: jene Verstellung, jenes Verläugnen der Bedürftigkeit, jener Glanz der metaphorischen Anschauungen und überhaupt jene Unmittelbarkeit der Täuschung begleitet alle Aeusserungen eines solchen Lebens. 22 Übertragung (6) [1]878 [1]879 [1]880 [1]882 [1]884 [2]887 Wir theilen die Dinge nach Geschlechtern ein, wir bezeichnen den Baum als männlich, die Pflanze als weiblich: welche willkürlichen Übertragungen! Wie weit hinausgeflogen über den Canon der Gewissheit! Ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild! erste Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in einem Laut! Zweite Metapher. Und jedesmal vollständiges Ueberspringen der Sphäre, mitten hinein in eine ganz andere und neue. Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden [...] Wer von dieser Kühle angehaucht wird, wird es kaum glauben, dass auch der Begriff, knöchern und 8eckig wie ein Würfel und versetzbar wie jener, doch nur als das Re s id u u m ei ne r Me tap h er übrigbleibt, und dass die Illusion der künstlerischen Uebertragung eines Nervenreizes in Bilder, wenn nicht die Mutter so doch die Grossmutter eines jeden Begriffs ist. […] denn zwischen zwei absolut verschiedenen Sphären wie zwischen Subjekt und Objekt giebt es keine Causalität, keine Richtigkeit, keinen Ausdruck, sondern höchstens ein ä st h et is c he s Verhalten, ich meine eine andeutende Uebertragung, eine nachstammelnde Uebersetzung in eine ganz fremde Sprache. Wozu es aber jedenfalls einer frei dichtenden und frei erfindenden Mittelsphäre und Mittelkraft bedarf. Fortwährend verwirrt er die Rubriken und Zellen der Begriffe dadurch, dass er neue Übertragungen, Metaphern, Metonymien hinstellt [...]. Analogie (0) Ähnlich (4) [1]878 [1]879 [1]883 [2]887 In einem ähnlichen beschränkten Sinne will der Mensch auch nur die Wahrheit. Er begehrt die angenehmen, Leben erhaltenden Folgen der Wahrheit; gegen die reine folgenlose Erkenntnis ist er gleichgültig [...]. Denken wir besonders noch an die Bildung der Begriffe: jedes Wort wird sofort dadurch Begriff, dass es eben nicht für das einmalige ganz und gar individualisirte Urerlebnis, dem es sein Entstehen verdankt, etwa als Erinnerung dienen soll, sondern zugleich für zahllose, mehr oder weniger ähnliche, d. h. streng genommen niemals gleiche, also auf lauter ungleiche Fälle passen muss. Jeder Begriff entsteht durch Gleichsetzen des NichtGleichen. Aehnlich wie der Astrolog die Sterne im Dienste der Menschen und im Zusammenhange mit ihrem Glück und Leid betrachtet, so betrachtet ein solcher Forscher die ganze Welt [...]. Der wache Tag eines mythisch erregten Volkes, etwa der älteren Griechen, ist durch das fortwährend wirkende Wunder, wie es der Mythus annimmt, in der That dem Traume ähnlicher als dem Tag des wissenschaftlich ernüchterten Denkers. Gleich (12) [1]876 [1]879 [1]880 [1]882 [1]885 [2]890 Seine allgemeinste Wirkung ist Täuschung – aber auch die einzelsten Wirkungen tragen etwas von gleichem Charakter an sich. Denken wir besonders noch an die Bildung der Begriffe: jedes Wort wird sofort dadurch Begriff, dass es eben nicht für das einmalige ganz und gar individualisirte Urerlebnis, dem es sein Entstehen verdankt, etwa als Erinnerung dienen soll, sondern zugleich für zahllose, mehr oder weniger ähnliche, d. h. streng genommen niemals gleiche, also auf lauter ungleiche Fälle passen muss. Jeder Begriff entsteht durch Gleichsetzen des NichtGleichen. So gewiss nie ein Blatt einem andern ganz gleich ist, so gewiss ist der Begriff Blatt durch beliebiges Fallenlassen dieser individuellen Verschiedenheiten, durch ein Vergessen des Unterscheidenden gebildet und erweckt nun die Vorstellung, als ob es in der Natur ausser den Blättern etwas gäbe, das „Blatt“ wäre [...]. Wir wissen ja gar nichts von einer wesenhaften Qualität, die die Ehrlichkeit hiesse, wohl aber von zahlreichen individualisirten, somit ungleichen Handlungen, die wir durch Weglassen des Ungleichen gleichsetzen und jetzt als ehrliche Handlungen bezeichnen; zuletzt formulieren wir aus ihnen eine qualitatis occulta mit dem Namen: die Ehrlichkeit. Während jede Anschauungsmetapher individuell und ohne ihres Gleichen ist und deshalb allem Rubriciren immer zu entfliehen weiss, zeigt der grosse Bau der Begriffe die starre Regelmässigkeit eines römischen Columbariums [...]. Wie wenig gleicht dies einem Phantasieerzeugniss: denn wenn es dies wäre, müsste es doch irgendwo den Schein und die Unrealität errathen lassen. Wie anders steht unter dem gleichen Missgeschick der stoische, an der Erfahrung belehrte, durch Begriffe sich beherrschende Mensch da! 23 Bild (23) [1]876 [1]878 [1]879 [1]879 [1]880 [1]880/1 [1]881 [1]882 [1]883 [1]883 [1]884 Sie sind tief eingetaucht in Illusionen und Traumbilder, ihr Auge gleitet nur auf der Oberfläche der Dinge herum und sieht „Formen“, ihre Empfindung führt nirgends in die Wahrheit, sondern begnügt sich Reize zu empfangen und gleichsam ein tastendes Spiel auf dem Rücken der Dinge zu spielen. Was ist ein Wort? Die Abbildung eines Nervenreizes in Lauten. Ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild! erste Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in einem Laut! Zweite Metapher. Und jedesmal vollständiges Ueberspringen der Sphäre, mitten hinein in eine ganz andere und neue. Wie der Ton als Sandfigur, so nimmt sich das rätselhafte X des Dings an sich einmal als Nervenreiz, dann als Bild, endlich als Laut aus. So gewiss nie ein Blatt einem andern ganz gleich ist, so gewiss ist der Begriff Blatt durch beliebiges Fallenlassen dieser individuellen Verschiedenheiten, durch ein Vergessen des Unterscheidenden gebildet und erweckt nun die Vorstellung, als ob es in der Natur ausser den Blättern etwas gäbe, das „Blatt“ wäre, etwa eine Urform, nach der alle Blätter gewebt, gezeichnet, abgezirkelt, gefärbt, gekräuselt, bemalt wären, aber von ungeschickten Händen, so dass kein Exemplar correkt und zuverlässig als treues Abbild der Urform ausgefallen wäre. [...] die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen in Betracht kommen. Alles, was den Menschen gegen das Thier abhebt, hängt von dieser Fähigkeit ab, die anschaulichen Metaphern zu einem Schema zu verflüchtigen, also ein Bild in einen Begriff aufzulösen [...]. Wer von dieser Kühle angehaucht wird, wird es kaum glauben, dass auch der Begriff, knöchern und 8eckig wie ein Würfel und versetzbar wie jener, doch nur als das Re s id u u m ei ne r Me tap h er übrig bleibt, und dass die Illusion der künstlerischen Uebertragung eines Nervenreizes in Bilder, wenn nicht die Mutter so doch die Grossmutter eines jeden Begriffs ist. Innerhalb dieses Würfelspiels der Begriffe heisst aber „Wahrheit“ – jeden Würfel so zu gebrauchen, wie er bezeichnet ist; genau seine Augen zu zählen, richtige Rubriken zu bilden und nie gegen die Kastenordnung und gegen die Reihenfolge der Rangklassen zu verstossen. Aehnlich wie der Astrolog die Sterne im Dienste der Menschen und im Zusammenhange mit ihrem Glück und Leid betrachtet, so betrachtet ein solcher Forscher die ganze Welt als geknüpft an den Menschen, als den unendlich gebrochenen Wiederklang eines Urklanges, des Menschen, als das vervielfältigte Abbild des einen Urbildes, des Menschen. Nur durch das Vergessen jener primitiven Metapherwelt, nur durch das Hart- und Starr-werden einer ursprünglich in hitziger Flüssigkeit aus dem Urvermögen menschlicher Phantasie hervorströmenden Bildermasse, nur durch den unbesiegbaren Glauben, d ie se Sonne, d i es es Fenster, dieser Tisch sei eine Wahrheit an sich, kurz nur dadurch, dass der Mensch sich als Subjekt, und zwar als k ü n st ler is c h sc ha ffe nd e s Subjekt vergisst, lebt er mit einiger Ruhe, Sicherheit und Consequenz [...]. Ein Maler, dem die Hände fehlen und der durch Gesang das ihm vorschwebende Bild ausdrücken wollte, wird immer noch mehr bei dieser Vertauschung der Sphären verrathen, als die empirische Welt vom Wesen der Dinge verräth. Selbst das Verhältnis eines Nervenreizes zu dem hervorgebrachten Bilde ist an sich kein notwendiges; wenn aber eben dasselbe Bild Millionen Mal hervorgebracht und durch viele Menschengeschlechter hindurch vererbt ist, ja zuletzt bei der gesammten Menschheit jedesmal in Folge desselben Anlasses erscheint, so bekommt es endlich für den Menschen dieselbe Bedeutung, als ob es das einzig nothwendige Bild sei und als ob jenes Verhältniss des ursprünglichen Nervenreizes zu dem hergebrachten Bilde ein strenges Causalitätsverhältniss sei; wie ein Traum, ewig wiederholt, durchaus als Wirklichkeit empfunden und beurtheilt werden würde. 24