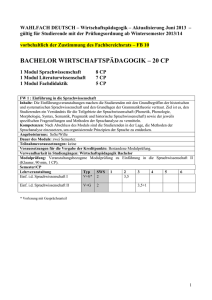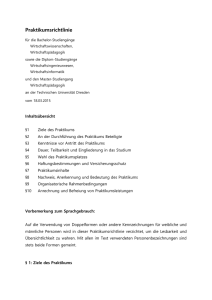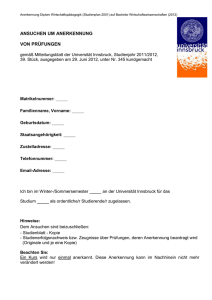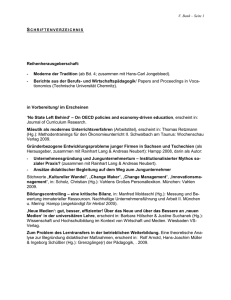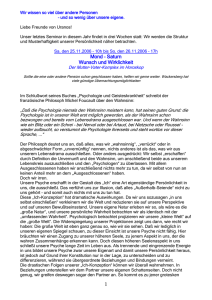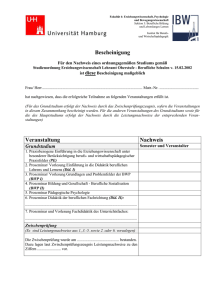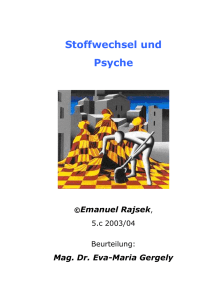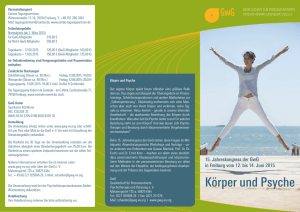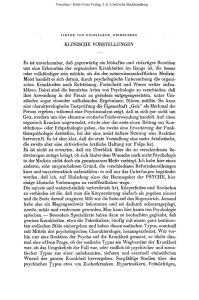Zeit- und Grundprobleme der Wirtschaftspädagogik
Werbung
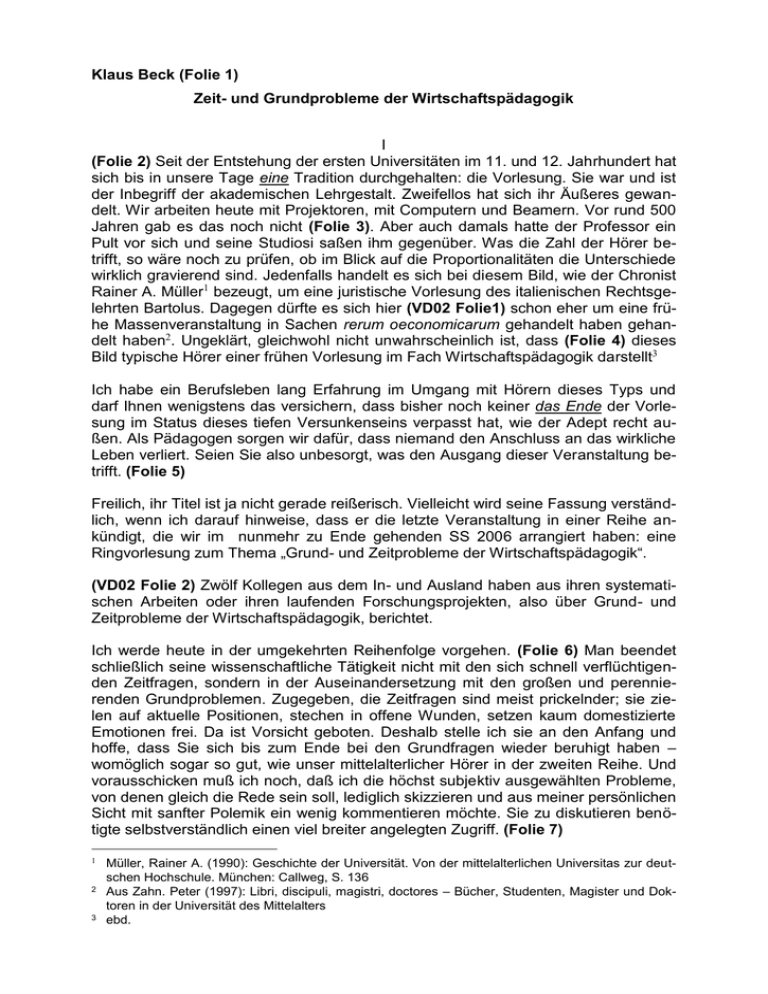
Klaus Beck (Folie 1) Zeit- und Grundprobleme der Wirtschaftspädagogik I (Folie 2) Seit der Entstehung der ersten Universitäten im 11. und 12. Jahrhundert hat sich bis in unsere Tage eine Tradition durchgehalten: die Vorlesung. Sie war und ist der Inbegriff der akademischen Lehrgestalt. Zweifellos hat sich ihr Äußeres gewandelt. Wir arbeiten heute mit Projektoren, mit Computern und Beamern. Vor rund 500 Jahren gab es das noch nicht (Folie 3). Aber auch damals hatte der Professor ein Pult vor sich und seine Studiosi saßen ihm gegenüber. Was die Zahl der Hörer betrifft, so wäre noch zu prüfen, ob im Blick auf die Proportionalitäten die Unterschiede wirklich gravierend sind. Jedenfalls handelt es sich bei diesem Bild, wie der Chronist Rainer A. Müller1 bezeugt, um eine juristische Vorlesung des italienischen Rechtsgelehrten Bartolus. Dagegen dürfte es sich hier (VD02 Folie1) schon eher um eine frühe Massenveranstaltung in Sachen rerum oeconomicarum gehandelt haben gehandelt haben2. Ungeklärt, gleichwohl nicht unwahrscheinlich ist, dass (Folie 4) dieses Bild typische Hörer einer frühen Vorlesung im Fach Wirtschaftspädagogik darstellt3 Ich habe ein Berufsleben lang Erfahrung im Umgang mit Hörern dieses Typs und darf Ihnen wenigstens das versichern, dass bisher noch keiner das Ende der Vorlesung im Status dieses tiefen Versunkenseins verpasst hat, wie der Adept recht außen. Als Pädagogen sorgen wir dafür, dass niemand den Anschluss an das wirkliche Leben verliert. Seien Sie also unbesorgt, was den Ausgang dieser Veranstaltung betrifft. (Folie 5) Freilich, ihr Titel ist ja nicht gerade reißerisch. Vielleicht wird seine Fassung verständlich, wenn ich darauf hinweise, dass er die letzte Veranstaltung in einer Reihe ankündigt, die wir im nunmehr zu Ende gehenden SS 2006 arrangiert haben: eine Ringvorlesung zum Thema „Grund- und Zeitprobleme der Wirtschaftspädagogik“. (VD02 Folie 2) Zwölf Kollegen aus dem In- und Ausland haben aus ihren systematischen Arbeiten oder ihren laufenden Forschungsprojekten, also über Grund- und Zeitprobleme der Wirtschaftspädagogik, berichtet. Ich werde heute in der umgekehrten Reihenfolge vorgehen. (Folie 6) Man beendet schließlich seine wissenschaftliche Tätigkeit nicht mit den sich schnell verflüchtigenden Zeitfragen, sondern in der Auseinandersetzung mit den großen und perennierenden Grundproblemen. Zugegeben, die Zeitfragen sind meist prickelnder; sie zielen auf aktuelle Positionen, stechen in offene Wunden, setzen kaum domestizierte Emotionen frei. Da ist Vorsicht geboten. Deshalb stelle ich sie an den Anfang und hoffe, dass Sie sich bis zum Ende bei den Grundfragen wieder beruhigt haben – womöglich sogar so gut, wie unser mittelalterlicher Hörer in der zweiten Reihe. Und vorausschicken muß ich noch, daß ich die höchst subjektiv ausgewählten Probleme, von denen gleich die Rede sein soll, lediglich skizzieren und aus meiner persönlichen Sicht mit sanfter Polemik ein wenig kommentieren möchte. Sie zu diskutieren benötigte selbstverständlich einen viel breiter angelegten Zugriff. (Folie 7) 1 2 3 Müller, Rainer A. (1990): Geschichte der Universität. Von der mittelalterlichen Universitas zur deutschen Hochschule. München: Callweg, S. 136 Aus Zahn. Peter (1997): Libri, discipuli, magistri, doctores – Bücher, Studenten, Magister und Doktoren in der Universität des Mittelalters ebd. 2 II Beginnen möchte ich mit einem Zeitproblem, das in der Wirtschaftspädagogik freilich schon lange einen Namen trägt. Hier galt es allerdings bis vor wenigen Jahren gar nicht mehr als Problem, weil es als einigermaßen befriedigend gelöst angesehen werden konnte. Erst dadurch, dass die Bildungspolitik es für sich entdeckt hat und nun mit ihren bescheidenden Mitteln auch noch zu lösen versucht, ist es erneut zum Problem geworden. (Auf ein ähnliches Muster werden wir übrigens gleich nachher noch einmal stoßen). Der Name dieses wiederbelebten Problems wird Ihnen nicht geläufig sein, weil es heute etwas anders firmiert. Aber er bezeichnet den wichtigen Kernpunkt der ganzen Angelegenheit und lautet so (click): Valenzproblem. Hinter diesem Etikett verbirgt sich die Frage nach jener Studiengangsstruktur der Wirtschaftspädagogik, die den Absolventen ein polyvalentes Kompetenzprofil sichert. Sie war dadurch erreicht worden, dass Ende der 90er Jahre, wie auch bei Kaufleuten und Volkswirten, eine bundesweit gültige Rahmenordnung für die Diplomprüfung etabliert wurde. Sie schrieb eine breite thematische Ausrichtung des Studiums fest über die Wirtschaftspädagogik als Fach hinaus in die Wirtschaftswissenschaften und in vielfältige Wahlpflichtbereiche hinein. Die so erreichte breite Valenz des Diploms erstreckte und erstreckt sich noch auf den Zugang zu den berufsbildenden Schulen ebenso wie zum betrieblichen Ausbildungswesen, zu Kammern, Verbänden, zur Bildungsverwaltung bis hin zur Entwicklungshilfe und zur unternehmerischen Selbständigkeit. Dieser äußere Rahmen wurde durch ein bald danach verabschiedetes Basiscurriculum Berufs- und Wirtschaftspädagogik inhaltlich ausgefüllt, auf das sich alle deutschen Fachvertreter geeinigt hatten. Der Studiengang war konsolidiert und polyvalent profiliert. – Dann kam der schwarze Tag von Bologna. Unter dem Vorzeichen der Herstellung eines einheitlichen europäischen Bildungsraumes verpflichteten sich die Bildungsminister zur flächendeckenden Einführung der Bachelor-Master-Struktur für alle Studiengänge. Der politische Umsetzungsdruck wurde in Deutschland besonders stark gemacht, wenn auch die einzelnen Bundesländer kraft ihrer Kulturhoheit unterschiedliche, aber fast durchweg knappe Terminbedingungen setzten. Nun haben wir – in diesem doppelten Sinne – ein Zeitproblem. Es ist ein bisschen so, als hätten sich die zuständigen Politiker geeinigt, allen europäischen Gaststätten vorzuschreiben, sich „restaurant“ zu nennen, die Speisenfolge einheitlich als „first course“, „second course“ usf. zu bezeichnen und alle weiteren Differenzierungen zu unterlassen. Was hätte man damit erreicht? Selbstverständlich würden unter diesem einheitlichen Namensdach die Köche faktisch doch ihr eigenes Süppchen kochen. Aber man könnte im Prospekt nicht mehr so leicht erkennen, ob es sich um eine Spelunke oder ein nobles Haus handelt und man müsste erst selbst mal dort einkehren, um zu wissen, wo und wie man kulinarisch dran ist. Natürlich hinkt dieser Vergleich in einigen Hinsichten. Aber offenkundig ist doch längst, dass die europäische Vereinheitlichungsaktion einen paradoxen Effekt erzeugt. Unter den je spezifischen lokalen Randbedingungen produziert jetzt jede Hochschule ihre eigenen besonderen Bachelor- und Masterprogramme und gibt ihnen obendrein auch unterschiedliche Namen. Die zuvor erreichte Einheitlichkeit ist dahin. Und das gilt ja nicht nur für die Wirtschaftspädagogik. Zwar wird man künftig in der Tat nicht mehr zwischen Kneipen, Kantinen und Edelrestaurants, sprich: zwischen Berufsakademien, Fachhochschulen und Universitäten unterscheiden. Und 3 schon allein dieser Umstand macht es schwer verständlich, warum die Universitäten nicht selten sogar mit Enthusiasmus an der Zerstörung ihrer institutionellen Identität mitarbeiten. Aber mit der Preisgabe der strukturellen und der weitgehenden substantiellen Einheitlichkeit des Produkts, also der Studienabschlüsse, erschwert man darüber hinaus die Mobilität der Absolventen ganz erheblich. Die unterhalb des Bachelor- und Masteretiketts entstehende Hyperdifferenzierung führt à la longue, wie Marketingleute vielleicht sagen würden, zum Verlust der Marke und in der Folge zur Paralyse des Fachprofils. Die aus allen Ecken sprießenden Management-Bachelors und -Masters sind dafür ein unübersehbares Signal. So habe ich vor wenigen Tagen im Internet schon das Angebot eines „Doctors of Church Management“ entdeckt. In der Valenzfrage sind die Studierenden der Wirtschaftspädagogik eindeutig die Verlierer: Ihr Examen, das künftig auf ganz unterschiedlichen Ausbildungsgängen beruhen wird, braucht von keinem anderen Bundesland als Zugangsberechtigung zum Schuldienst anerkannt zu werden. Und Rheinland-Pfalz setzt noch eins obendrauf. Es erkennt nicht einmal den Master seiner eigenen Landesuniversitäten als Zugangsvoraussetzung für den Staatsdienst an, wie das mit dem Diplom bislang stets eine Selbstverständlichkeit war. Vielmehr verlangt es jetzt eine zusätzliche Erste Staatsprüfung unmittelbar im Anschluss an das Masterexamen. Diese Idee – meine Kollegen aus anderen Bundesländern schreiben sie der fünften mainzer Jahreszeit zu –muss man sich in einer Stunde der Ernüchterung, um nicht zu sagen: Ausnüchterung vor das ungetrübte Auge halten. Wie wird Rheinland-Pfalz mit Absolventen aus anderen Bundesländern umgehen – von anderen europäischen Staaten ganz zu schweigen? Wie werden diese ihrerseits die Zulassungsvoraussetzungen regeln? Unter dem Vereinheitlichungskonzept von Bologna entstehen europaweit hunderte, wenn nicht tausende neuer Studiengänge, die Fächer zersplittern und die in einem langen Prozess landauf landab erreichte Polyvalenz verkommt unter dem Vorzeichen europa-, ja weltweiter Mobilitätsphantasien naiver Bildungspolitiker zu einer hoch partmentalisierten Nischenvalenz. Da haben wir also ein handfestes Zeitproblem, das womöglich zum identitätskritischen Grundproblem mutieren könnte. Das zweite der drei Zeitprobleme, auf das ich Sie hinweisen möchte, befindet sich zwar auf einem ganz anderen Terrain, ist jedoch mit dem ersten eine innige Verbindung eingegangen. Es firmiert unter dem Etikett „Anspruchsniveau“ (Folie 8) und fungiert damit als Label für das Problem der Bestimmung von Leistungsuntergrenzen im Bildungswesen überhaupt, des akademischen Studiums im Besonderen. Was hat es damit auf sich? Nun, seit dem Tage, an dem das Akronym PISA in aller Munde und das Niveau der Deutschlandbefunde in allen Schlagzeilen ist, wissen unsere Bildungspolitiker auch schon, wie alles zum besseren gewendet werden kann. Die Zauberformel, mit deren Hilfe das Problem des zu niedrigen Anspruchsniveaus von Bildung und Ausbildung aufgelöst werden soll, heißt „Bildungsstandards“. Ich gebe Ihnen dazu gleich ein Beispiel. Zuvor sei darauf hingewiesen, dass solche Bildungsstandards von der KMK, der Kultusministerkonferenz, erlassen werden, von jenem Gremium also, das auch die EUVorstellungen von der Bachelor-Master-Struktur in Deutschland vollstreckt – die Brüsseler Spitze sozusagen. Die KMK betreibt – was der Studentenbewegung der 1968er „von unten“ nur in Ansätzen gelungen ist – eine Revolution der Universitäten „von oben“, effizient und wirkungsvoll. Dabei wird sie nicht selten von der HRK, der Hochschulrektorenkonferenz, sogar unterstützt – eine Konstellation, die mich – etwas 4 zugespitzt ausgedrückt – anmutet, als wandere die Verurteilte, nämlich die HRK als Vertreterin der Hochschulen, heiter Arm in Arm mit ihrem Henker zum Galgen. So betreiben beide Gremien für die neuen Studiengangsstrukturen das Akkreditierungsgeschäft, wonach ein Bachelor-Master-Gang nur anerkannt wird, wenn er die Erreichung bestimmter Standards gewährleistet. Damit sind wir wieder beim Thema Anspruchsniveau. Wie lauten solche Bildungsstandards für Wirtschaftspädagogen? Zum Beispiel so (Folie 9): „Die … Absolventen wecken und stärken bei Schülerinnen und Schülern Lernund Leistungsbereitschaft“ (KMK 2004, S. 7, Sp. 2). Man muss sich den Anspruch, dies sei ein Minimalstandard für ein erfolgreiches wirtschaftspädagogisches Studium, auf der intellektuellen Zunge zergehen lassen. Was bislang hier und da und im günstigen Falle gelungen sein mag, wird von der KMK nun einfach als Standard befohlen. Damit wird zugleich unterstellt, die Hochschullehrer hätten es bisher schlicht vergessen oder sie hätten keine Lust gehabt, diese Kompetenz an ihre Adressaten zu vermitteln. Man müsse sie nur darauf verpflichten und schon hätten wir in der Folge lauter lern- und leistungsbereite Schüler. Ein weiteres Beispiel (click): „Die Absolventen ... wissen, wie man Lernende aktiv in den Unterricht einbezieht und Verstehen und Transfer unterstützt.“ (KMK 2004, S. 8, Sp. 1) Ganz abgesehen davon, dass die Formulierung sinnverschleiernd misslungen ist (gemeint war wohl „Die Absolventen wissen, wie man Lernende im Unterricht aktiviert“), wird hier ein Kausalzusammenhang zwischen „aktiver Unterrichtsteilnahme“ (was immer das bedeuten mag) und „Verstehen“ bzw. „Transfer“ suggeriert, an dessen Geltungsbedingungen die Erziehungswissenschaft erst immer noch forscht. Was wir noch gar nicht klar durchschauen, glaubt die KMK einfach vorschreiben zu können: Kausalität per ordre sozusagen. Wer so etwas für möglich hält, wird auch gerne glauben, das Gesetz von Angebot und Nachfrage sei vom Parlament beschlossen worden! Die makabre Pointe dieses Steuerungszugriffs auf den WirtschaftspädagogikStudiengang und natürlich auch auf alle weiteren akkreditierungsbedürftigen Studiengänge besteht nun aber in einer doppelten Unmöglichkeit: Zum einen summieren sich die zu erfüllenden Standards dieses Kalibers in der Handelslehrerausbildung, für die sie schon weitgehend fixiert worden sind, auf, sage und schreibe, rund 130 bis 150. Zum anderen gibt es nicht im entferntesten eine auch nur in Ansätzen zuverlässige Diagnostik, um ihre Erfüllung festzustellen. „Na wunderbar“, mag man spontan denken, „dann bleibt ja alles offen“. In der Tat. Die Entscheidung über das Anspruchsniveau eines Examens wird aber schnell brisant, wenn man fragt, wer die Beweislast für die Behauptung seiner Erfüllung trägt. Bindet man nämlich die Erreichung des Studienziels an rund 100 bis 150 Einzelkriterien, die nicht gemessen werden können, so ist der Prüferwillkür Tür und Tor geöffnet und man darf gespannt sein, wie die einschlägige Rechtsprechung diese neuen Fragen bewältigen wird. Mit dem Hinweis auf ein drittes Zeitproblem kommen wir dem näher, was die Wirtschaftspädagogik nicht als Studiengang, sondern als wissenschaftliche Disziplin betrifft. Es handelt von einer Forschungsalternative, die in den Wirtschafts- und Sozial- 5 wissenschaften schon lange umstritten ist und gegenwärtig in der Wirtschaftspädagogik – erneut unter dem Einfluss der Politik – auf eine, wie ich finde, ungute Weise fehlbalanciert wird. Das pointierende Stichwort lautet (Folie 10): Laborforschung oder Feldforschung. Man sollte meinen, das sei eine Sache der Hypothesenbildung und des Untersuchungsdesigns, mithin eine Angelegenheit, die vom einzelnen Forscher unter Wahrung seiner grundgesetzlichen Freiheit autonom getroffen werde. Und selbstverständlich verhält es sich im Prinzip auch so. Wirtschaftspädagogische Laborforschung gestaltet experimentelle Lehr-Lern-Situationen und variiert systematisch sorgfältig kontrollierte Kontextbedingungen. So haben wir bspw. u.a. Blickbewegungsanalysen bei Lernern in der Computerinteraktion durchgeführt, um deren kognitive Stile der Informationsrezeption zu untersuchen. Und in Unternehmenssimulationen, wie sie u.a. von Herrn Kollegen Breuer durchgeführt werden, erfolgen detaillierte Analysen von experimentell stimulierten beruflichen Lernprozessen und ihren kognitiven Effekten. Die Feldforschung agiert dagegen vorwiegend in berufsbildenden Schulen und Ausbildungsbetrieben, wo sie sozusagen im Getümmel der Fakten, Personen, Verordnungen und Spezialitäten Orientierung zu finden hofft und zu geben versucht. Nun muss man wissen, dass es in der Berufsbildungspolitik stets Interessen gibt, bestimmte Formen der beruflichen Ausbildung zu fördern und andere nicht, bestimmte Varianten neu zu etablieren und andere eher auszutrocknen. Es geht hier keineswegs immer nur um junge Menschen, sondern auch um Macht und Einfluss. Solche Interessen finden am ehesten die nötige politische Gefolgschaft, wenn sie auf irgendwie erfolgreiche Realisierungsversuche verweisen können. Woher aber kriegt man sie? Nun, man führt sog. Modellversuche durch, richtet also beispielgebende Arrangements ein und lässt sie wissenschaftlich begleiten. Damit ein Modellversuch als erfolgreich gelten kann, ergreift man zwei Maßnahmen: Erstens benennt man kein Kriterium, an dem sich das Scheitern des Versuchs bemessen ließe und zweitens fordert man die wissenschaftlichen Begleitforscher auf, aktiv beratend und gestaltend das Vorhaben zu unterstützen. Es gibt gute Gründe dafür, dass man als politischer Auftraggeber damit rechnen darf, der Bericht der Begleitforschung falle infolge ihrer Involvierung am Ende nicht ungünstig aus und liefere so die Legitimation für die flächendeckende Ausdehnung des Modells. Nun bedarf es nur noch einer letzten Zutat, damit das Ganze funktioniert: Viel Geld. Damit gewinnt man bei den Forschern, die in den Hochschulen unter einem ganz erheblichen Druck zur Drittmittelbeschaffung stehen, leichter die erforderliche Kooperationsbereitschaft. Für den einzelnen Wissenschaftler ist das Angebot, an einem Modellversuch mitzuwirken, außerordentlich reizvoll. Er erhält die Chance, Berufsbildungspraxis mitzugestalten, kann Mitarbeiter beschäftigen, seine Sachausstattung verbessern, erreicht einen leichten, weil politisch gewolltenn Feldzugang und er gewinnt Material für Publikationen. Mehrere kritische Analysen haben nun aber inzwischen gezeigt, dass die sog. Modellversuchsforschung allzu oft unter teilweise ganz erheblichen Qualitätsmängeln leidet. Das liegt häufig an der bereits erwähnten Verquickung von gestalterischem Eingriff ins Feld und scheinbar unabhängiger Beobachtung. Es liegt weiterhin daran, dass es um die ausgeschriebenen Mittel nicht wirklich einen Qualitätswettbewerb gibt, sondern dass sie vom politischen Geldgeber nach dessen undurchsichtigen Kriterien verteilt werden. Im übrigen ist schon lange klar, dass das gesamte Modellversuchsprogramm daran leidet, dass dort in aller Regel gar keine generalisierbaren Erkenntnisse gewonnen werden können, weil die jeweiligen Versuchsbedingungen viel zu spezifisch sind. 6 Warum ist das ein Problem? Die Politik hat seit den 1970er Jahren umgerechnet insgesamt annähernd eine Milliarde Euro in solche Modellversuchsprogramme gesteckt und sie bindet bis in die Gegenwart hinein damit gut und gern 80 bis 90 % der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschungskapazität. Das bedeutet nicht allein, dass systematisch wichtige Gebiete viel zu wenig beforscht werden, dass etwa die Laborforschung nach meinem Urteil viel zu kurz kommt. Es bedeutet auch, dass der wissenschaftliche Nachwuchs hier und da in Modellversuchsmilieus ausgebildet wird, in denen kränkelnde Designs und Methoden regieren. Standards guter empirischer Forschung würden gar nicht tradiert, wenn es nicht auch Standorte gäbe, an denen solide meist DFG-gestützte wirtschaftspädagogische Forschung betrieben würde – so wie etwa in Mainz ... III. Lassen Sie uns jetzt schnell von den Zeit- zu den wirklich spannenden Grundproblemen übergehen. Auch hier möchte ich Ihnen in aller Kürze drei ungelöste Probleme vorstellen, die vom einen zum nächsten mit Sicherheit auch einen zunehmenden Bezug zu Ihnen selbst aufweisen könnten. Beginnen wir mit dem vergleichsweise speziellsten, (Folie 11) dem Problem der „Eignung wirtschaftswissenschaftlicher Aussagen zur Lehrzielbestimmung“ in der Berufsausbildung. Verbreitet unter Wirtschaftswissenschaftlern und sogar auch unter Wirtschaftsdidaktikern findet man die Auffassung, es sei Aufgabe der Wirtschaftslehrer, ihren Adressaten, den Lehrlingen etwa oder den Berufsfachschülern, beizubringen, was von den Wirtschaftswissenschaften erforscht und herausgefunden worden ist. Allerdings müssten die wissenschaftlichen Aussagen auf das intellektuelle Niveau der jeweiligen Adressaten heruntertransferiert werden. Dabei dürfte man sie aber nicht verfälschen, sie in ihrer Substanz keinesfalls verändern, sondern allenfalls vereinfachen, so dass die jungen Leute, wenn sie später einmal die Dinge auf einem höheren Niveau reflektierten, etwa wenn sie Wirtschaftswissenschaften studierten, nicht alles umlernen, sondern nur hinzulernen müssten. Obwohl es nicht aus den Wirtschaftswissenschaften stammt, möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, an dem man das Problem sehr schön erkennen kann. Es handelt sich um das von Gustav Grüner entwickelte, für diese Auffassung nachgerade als klassisch zu bezeichnende Beispiel des physikalischen Hebelgesetzes, das er per didaktischer Reduktion von der wissenschaftlichen Originalform Schritt für Schritt für jeweils weniger anspruchsvolle Adressatengruppen vereinfacht (Folie 12, 6 x click). Nun, so hübsch sich insbesondere das vorläufige Ende dieser Reduktionsreihe präsentiert, so offensichtlich ist, dass es mit dem Original kaum noch etwas zu tun hat. Eine genauere logische Analyse zeigt, dass schon beim Übergang von V3 nach V4 eine ganze Reihe unzulässiger Veränderungen vorgenommen werden, wenn man den Anspruch aufrechterhält, nur zu vereinfachen, aber nicht substantiell zu verändern. So kann man sich auch leicht vorstellen, was am Ende von analogen wirtschaftswissenschaftlichen Reduktionsketten stünde. Sätze wie „Geld regiert die Welt“ oder „Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“ wären sicherlich nicht das, was man guten Gewissens lehren wollte. Und auch solche Allerweltsweisheiten, wie die, dass mit einer hohen Staatsquote stets eine geringe Sparquote einhergehe oder dass man durch Zölle die Binnenwirtschaft wirklich schützen könne, erweisen sich bei genauerem Hinsehen als hoch problematisch bzw. in ihrer Uneingeschränktheit als ganz unhaltbar. 7 Ohne auf Details einzugehen, lässt sich sagen, dass jede substantielle Vereinfachung wirtschaftswissenschaftlicher Aussagen letztlich nur um den Preis ihrer Verfälschung zu haben ist. Dies ergibt sich schon daraus, dass – umgekehrt – der wissenschaftliche Fortschritt im Wesentlichen durch Falsifikation solcher simplen Aussagen erzielt wird. Wie soll man in der Didaktik damit umgehen? Welches Maß an vereinfachender Verfälschung ist noch vertretbar? Wo liegt diese Grenze und wie lässt sie sich bestimmen? Es kommt nun noch hinzu, daß man angesichts der unüberschaubaren und immer weiter wachsenden Fülle wirtschaftswissenschaftlicher Aussagen zusätzlich eines tragfähigen Auswahlkriteriums bedarf, daß man bei konkurrierenden wirtschaftswissenschaftlichen Erklärungsansätzen sich für einen von ihnen entscheiden muss, daß die zentralen quantitativen mathematisch-statistischen Modelle i.d.R. weit jenseits des Fassungsvermögens von Schülern liegen und daher irgendwie substituiert werden müssen. Allein schon um dies alles auf eine vertretbare Weise zu bewältigen und umzusetzen, brauchen unsere Handelslehrerstudenten eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung auf möglichst hohem Niveau. Aber es gibt noch eine weitere systematische Schwierigkeit. Aufgabe der kaufmännischen Berufserziehung ist es nämlich, ihre Adressaten beruflich handlungsfähig zu machen. Das bedeutet, dass sie Entscheidungen treffen können müssen, die freilich stets auf unhintergehbar subjektiven Wertungen beruhen. Ohne Entscheidung keine Handlung und ohne Wertung keine Entscheidung. Die Wirtschaftswissenschaften sind jedoch – jedenfalls prinzipiell – auf objektsprachlicher Ebene wertfrei und können daher in Fragen des Sollens und Dürfens gar nicht liefern, was die Didaktik der Wirtschaftskunde unter dem Ziel der Handlungsertüchtigung des kaufmännischen Nachwuchses braucht. Sie beschäftigen sich endlich auch längst nicht mit allem, was ein junger Industriekaufmann oder eine junge Einzelhandelskauffrau lernen müssen: Welches sind die schnellsten Zahlungswege? Wo findet man Speditionstarife und wie liest man die Tabellenwerke? Welche Rabattierungen sind üblich und wie behandelt man Kunden, die reklamieren? Das und natürlich noch viel mehr gehört zu demjenigen Berufswissen von Kaufleuten, das man vergeblich bei den Wirtschaftswissenschaftlern suchen würde. Wissenschaftsorientierung in der Wirtschaftsdidaktik deckt demnach weder das ganze Feld dessen ab, was es zu vermitteln gilt, noch kann man umstandslos auf irgendwie zu vereinfachende wissenschaftliche Aussagen rekurrieren. Zwar ist klar, dass man das ganze Inhaltsproblem der Berufsausbildung aus der Lebensperspektive der Auszubildenden und nicht etwa aus der Wissenschaftsperspektive zu lösen versuchen muss, aber für dieses Problem haben wir keine in irgendeinem weiteren Sinne fertige regelhafte Lösung. Mit dem zweiten Grundproblem, über das ich Ihnen berichten möchte, können wir an einen soeben erwähnten Gesichtspunkt anknüpfen. Es geht um die allen Handlungen überhaupt und mithin auch um die den beruflichen Handlungen zugrunde liegenden Entscheidungen. Dass sie auf Wertungen beruhen, wurde schon gesagt. Für die Wirtschaftspädagogik stellt sich hier die Frage, wie sich im Individuum jene entscheidungsbedingenden Wertkonzepte entwickeln und wie sie ggf. in der Berufserziehung zu beeinflussen wären. Um das Problem herauszupräparieren, müssen wir nur ein kleines bisschen genauer den Prozess der Entscheidungsbildung betrachten (und ich verschone Sie erneut vor Details). Es ist nämlich so, dass die internalisierten Werte, die personinterne Wert- 8 hierarchie nicht als solche handlungswirksam werden. Der Akteur muss sich in einer gegebenen Situation jeweils auf einen dieser Werte verpflichtet fühlen. Er muss – mit anderen Worten – bei jeder einzelnen, konkreten Entscheidung den Wert, auf dem sie beruht, als seine Maxime, als sein Handlungsprinzip, anerkennen und zugleich zur Geltung bringen wollen. In der Wirtschaftspädagogik – und nicht nur hier – sprechen wir in diesem Zusammenhang von einer emotional fundierten Richtigkeitskognition als dem Kernstück individueller Moralität – in einer sehr weiten Fassung des Moralitätsbegriffs. (Folie 13) Wohlgemerkt, welche Werte es sind, auf die sich der einzelne faktisch jeweils verpflichtet fühlt, ist damit weder gesagt noch – erst recht – gefordert. Es kommen also nicht etwa nur altruistische Prinzipien in Frage, wie z.B. Hilfsbereitschaft, Wohlwollen oder Mitleid, sondern ebenso Vorteilsstreben, Rache oder Lustgewinn. In der deskriptiven pädagogisch-psychologischen Einstellung geht es ja zunächst nur darum, die Anatomie solcher Entscheidungsprozesse freizulegen. Dass sie in aller Regel eher spontan, ohne Einschaltung eines bewussten Reflexionsprozesses erfolgen, macht ihre Erforschung zwar etwas schwieriger, ändert aber nichts an ihrer Prozessstruktur. Tatsächlich scheinen wir normalerweise auf der Grundlage schnell aufspringender Intuitionen zu entscheiden und erst dann, wenn wir dazu aufgefordert werden, sei es durch einen Kontrahenten oder vor Gericht, Rationalisierungen, also Entscheidungsgründe nachzuschieben. Jonathan Haidt hat sich dafür ein hübsches Bild einfallen lassen, das uns als einen emotionalen Hund beschreibt, der bei Bedarf mit seinem rationalen Schwanz wedelt. Die Frage ist nun freilich, auf welche Werte wir uns tatsächlich verpflichtet fühlen, sei es intuitiv oder sei es im rationalen Kalkül. Nehmen Sie beispielsweise den folgenden Fall: Beim Versicherungsangestellten Weber erscheint eines Morgens die Witwe Danz und beantragt die Auszahlung der Lebensversicherung für ihren kürzlich an Herzversagen verstorbenen Mann. Am Abend desselben Tages kommt man am Stammtisch der Kleinstadt, den Herr Weber regelmäßig aufsucht, ganz zufällig auf den verstorbenen Herrn Danz zu sprechen. Dessen Hausarzt, auch ein Stammtischteilnehmer, erwähnt beiläufig, dass ihn der Tod von Herrn Danz nicht sonderlich überrascht habe, weil bei ihm schon vor über zehn Jahren ein Herzleiden diagnostiziert worden sei. Die Versicherungspolice weist ein Abschlussdatum auf, das nur fünf Jahre zurückliegt und auf dem Fragebogen hatte Herr Danz die Herzerkrankung nicht angegeben. Soll Herr Weber sein zufällig und privatim gewonnenes Wissen per Aktenvermerk dem Auszahlungsantrag beifügen und damit die Auszahlung stoppen? Wie wäre es, wenn Frau Danz eine attraktive und charmante junge Frau wäre? Und wie, wenn sie ganz im Gegenteil, arrogant, hochnäsig und abstoßend auf Herrn Weber gewirkt hätte? Meine Mitarbeiter und ich haben solche Fragen angehenden Versicherungskaufleuten vorgelegt und uns dabei allerdings nicht so sehr für den Ausgang ihrer Entscheidung, sondern für die Qualität der Begründungen interessiert, die sie dafür lieferten. Man kann deren Qualität (Folie 14) – entlang der Moralentwicklungstheorie von Lawrence Kohlberg – nach aufsteigenden Stufen ordnen, von einer rein ich-bezogenen, das Umfeld und die Konsequenzen ausblendenden ersten Stufe bis zu einer umsichtigen und auf verallgemeinerbare Prinzipien rekurrierenden Stufe 6. Nun, mit welcher Qualität urteilen unsere jungen Versicherungskaufleute (Folie 15)? Man sieht, dass unsere 431 Fälle durchaus eher auf den unteren Qualitätsstufen argumentieren, dass die Urteile über fast alle Stufen hinweg jedoch auch sichtbar 9 streuen. Besonders interessant ist aber weiterhin, dass die Qualität der Entscheidungsbegründungen offenbar bei ein und derselben Person von Situation zu Situation stark schwanken kann (Folie 16). In den vier verschiedenen Konfliktgeschichten, die unsere Probanden bearbeiten mussten, orientieren sie ihre Entscheidungen situationsabhängig an unterschiedlichen Urteilsprinzipien: Etwa zwei Drittel, nämlich 63,9 %, auf drei verschiedenen Niveaustufen, rund ein Fünftel, nämlich 17,5 % plus 2,6 %, sogar auf mehr als drei Niveaustufen. An zwei Einzelfällen, die (Folie 17) hier dokumentiert sind, kann man den Wechsel der Urteilsprinzipien zwischen Situationen gut erkennen. Soweit der Übersichtsbefund. Wie ist er aus einer normativen Perspektive zu beurteilen? (Folie 18) Auf der einen Seite neigen wir dazu zu konstatieren, dass man eine in sich gefestigte Persönlichkeit auch daran erkenne, dass sie über alle Situationen und Lebenslagen hinweg ihr Handeln stets von ein und demselben – qualitativ möglichst hoch stehenden – Urteilsprinzip leiten lässt, also im Idealfalle etwa vom Kategorischen Imperativ, vom Dekalog oder von weiteren derartigen Grundsätzen. Wir können die Vertreter dieser Sichtweise zusammenfassend als „moralische Universalisten“ bezeichnen. Ihrer Ansicht nach gibt es moralische Regeln, die immer und überall Gültigkeit beanspruchen dürfen. Diese Auffassung findet man auch in weiten Teilen der philosophischen Ethik und sie prägt das christlich-abendländische Selbstverständnis des Menschen bis in unsere Tage hinein. Unsere Daten geben nun aber Anlass, eine alternative ethische Sicht in Erwägung zu ziehen, ohne dass wir damit einem naturalistischen Fehlschluss verfallen. Diese Sicht anerkennt zwar, kurz gesagt, dass Universalmoralen möglicherweise unter den Bedingungen kleinräumiger sozialer Verbände funktioniert haben mögen. Unsere modernen Großgesellschaften seien jedoch subsystemisch ausdifferenziert. Die Subsysteme wie Recht, Wohlfahrt, Politik, Wirtschaft usw. hätten ihre je eigene Rationalität und auch Moralität ausgebildet. Der moderne Mensch sei über verschiedene Rollen, die er zu spielen habe, in diese Subsysteme integriert. Und so sei er etwa im Subsystem Familie auf die ethische Norm wohlwollender Kooperation der Stufe 3 verpflichtet. Als Wirtschaftssubjekt am Konkurrenzmarkt müsse er sich jedoch von einer eigeninteressierten Vorteilssuche der Stufe 2 leiten lassen, die ihn letztlich zu Kostenminimierung und damit zu Ressourcenschonung zwinge. Die Bändigung des insoweit moralisch gebotenen Vorteilsstrebens sei hier durch die Implementation sanktionsbewehrter Regeln zu erreichen, wie die Vertreter der Neuen Institutionenökonomik vorschlagen. Es macht, wie man sich leicht vorstellen kann, einen erheblichen Unterschied, auch für die kaufmännische Berufserziehung, ob man Wirtschaftshandeln auf die eben skizzierte, allerdings noch ganz unausgearbeitete ethische Grundlage von Bereichsmoralen stellt oder ob man es im ethischen Zwielicht von Universalmoralen belässt, die das kaufmännische Gewinnstreben allenfalls augenzwinkernd als lässliche Sünde betrachten, aber letztlich, zumindest jenseits einer prinzipiell unbestimmbaren Grenze, doch als moralisch defizient beurteilen. Ich beeile mich mit der Skizze eines letzten Problemfeldes der Wirtschaftspädagogik, das freilich erneut über unsere Disziplin hinausreicht. Wieder können wir – das ist angesichts des Fundamentalcharakters von Grundproblemen nicht überraschend – anknüpfen an etwas, das gerade eben schon zur Sprache gekommen war. Wir sahen, dass bei Entscheidungen stets je subjektive Wert- und Richtigkeitsvorstellungen im Spiel waren und fragen nun, welchen Status diese Vorstellungen in einem Modell 10 der menschlichen Persönlichkeit haben. Anders ausgedrückt: Wo und wie sind eigentlich unsere Wertvorstellungen und überhaupt unsere Gedanken, unser Wissen und unser Wollen, auch unsere moralischen Reflexionen in uns selbst lokalisiert? Kurz: Welchen Status hat unser Bewusstsein, unsere Psyche? Für Wirtschaftspädagogen ist die Beantwortung dieser Frage schon deshalb wichtig, weil sie in der Ausbildungspraxis ja letztlich nichts anderes versuchen, als auf die psychischen Leistungen ihrer Lehrlinge und Schüler einzuwirken, sie irgendwie zu verbessern. Und natürlich versuchen wir etwas Analoges hier in der Universität an unseren Studierenden und überhaupt in jeder pädagogischen Praxis. Wäre es da nicht von Vorteil, ja ist es nicht sogar eine conditio sine qua non, dass man den Gegenstand, auf den sich die professionelle pädagogische Berufspraxis richtet, die Psyche, kennt? Tatsächlich scheinen wir in unserem Alltagsdenken mit dieser Frage kaum ein Problem zu haben. Wir sind uns unseres Denkens und Fühlens nicht nur sicher. Wir „wissen“ auch, dass beides Einfluss auf unsere physische Befindlichkeit nimmt, dass etwa die psychische Angst uns den physischen Schweiß auf die Stirn treibt und dass die physische Verletzung der Haut mit dem Messer das psychische Schmerzempfinden hervorruft. Hat nicht schon Karl Marx zutreffend gesagt, das Sein – das Physische also – bestimme das Bewusstsein? Und folgen wir – umgekehrt – nicht gerne Sigmund Freud, der uns verkündet, Über-Ich, Ich, und Es, dieses psychische Triumvirat, regiere unerbittlich unsere gesamte Körperlichkeit? Nun, so fraglos uns dieser Zusammenhang in unserem Selbstverständnis erscheint, so fragwürdig, ja widersprüchlich sind doch die Voraussetzungen seiner Geltung. Niemand meint heute noch im Ernst, Krankheiten würden von Hexen verbreitet, böse Geister ließen Felsbrocken auf Straßen purzeln oder Brücken einstürzen, gute Geister beförderten den Ball ins Tor oder kleine Teufelchen veranlassten das Waldsterben. Mit anderen Worten: In der Deutung der Außenwelt lassen wir immaterielle und nicht lokalisierbare Instanzen als Kausalkräfte nicht zu. Vielmehr beruht unser modernes und offenbar in dieser Hinsicht gut bewährtes Weltbild auf dem Energieerhaltungssatz, der nicht nur ausschließt, dass irgendwelche energielose Entitäten energetisch registrierbare Prozesse auslösen können, sondern umgekehrt auch besagt, dass Energie nicht in ein Nirwana der Geister entweichen oder verschwinden kann. Wilhelm Wundt, der große Arzt und Psychologe, hat dieses Verständnis von unserer Welt als das Konzept von der „geschlossenen Naturkausalität“ bezeichnet. Nichts ist in ihr ohne prinzipiell erkennbare und messbare Ursache und alles hat ebenfalls prinzipiell beobachtbare Wirkungen. Mit der Annahme, es gebe eine Wechselwirkung unserer Physis mit einer immateriellen und nicht lokalisierbaren Psyche setzen wir eben dieses bewährte Konzept von der geschlossenen Naturkausalität außer Kraft. Ausgerechnet das, was wir als aufgeklärte Gegenwartsmenschen für die Erklärung der Welt da draußen vehement oder verächtlich als reinen Unsinn abweisen, lassen wir als Vorstellung zum Verständnis unserer selbst quasi unbesehen zu! Freilich, so ganz unbesehen und vor allem unhinterfragt ist unser Alltagsverständnis über das Verhältnis von Physis und Psyche nie gewesen. Seit dem Altertum bis in die Gegenwart hinein brodelt eine heiße Diskussion darüber und die neuere Hirnforschung hat diesen Diskurs weiter angeheizt. Natürlich haben die einschlägigen Denker schon immer versucht, zunächst unsere Alltagsvorstellung zu rehabilitieren und 11 zu rationalisieren. So hat etwa Descartes (1596-1650) eine recht differenzierte Vorstellung von der Wechselwirkung zwischen Körper und – wie er es nannte – Seele entwickelt. (Folie 19) Er sah ihren Sitz im corpus pineale, also in der Zirbeldrüse, die sich im Zwischenhirn befindet. Dort betrachte sie unsere Sinneseindrücke (click) und sende durch die Nervenröhren portionsweise den Lebensgeist, der unsere Muskeln bewege und uns etwa, wie hier in seinem Beispiel, die Flucht vor dem Feuer ermögliche. Auf uns Heutige wirkt Descartes’ Vorstellung noch etwas naiv. Und doch steht sie in ihrer entscheidenden Qualität einer Konzeption, die von dem Gehirnphysiologen und Nobelpreisträger John C. Eccles zusammen mit Karl R. Popper vor wenigen Jahren vorgeschlagen wurde, (Folie 20) nicht nach. Es ist nachgerade erstaunlich und irritierend, dass sich der strikte Naturwissenschaftler Eccles und der strenge Denker Popper auf die Annahme eingelassen haben, es gebe über eine Art Liaisonhirn eine Verbindung zwischen Körper (Welt 1) und Psyche (Welt 2), obwohl sich in der Energiebilanz unseres Gehirns weder offene Zugänge noch Abgänge registrieren lassen. Charakterisiert man den psycho-physischen Interaktionismus, wie diese Sichtweise häufig genannt wird, schematisch, so lässt er sich auch so darstellen (Folie 21): Ein äußerer Reiz wird physisch aufgenommen (Phi1), an die Psyche weitergegeben (Psi1), dort verarbeitet zu Psi2 und an die Physis zurückgegeben (Phi2), die ein Verhalten emittiert. Es ist der behauptete, vermutete, erwünschte oder erhoffte Übergang von Phi nach Psi und zurück, der uns Probleme bereitet und den Interaktionismus suspekt macht. Viele Denker konnten sich mit einer solch waghalsigen und letztlich mystischen These nicht abfinden. Und so finden wir in der Literatur alternative Konzeptionen: Etwa den Leibnizschen (1646-1716) Parallelismus (click), in dem das Verhältnis von Physis und Psyche gesehen wird wie das zwischen zwei Uhren, die – zur gleichen Zeit angestoßen – völlig übereinstimmende Zustände aufweisen, obwohl sie nicht miteinander interagieren und nicht identisch sind; oder den monistischen Materialismus eines Thomas Hobbes (1588-1679) (click), der in Gestalt des auf Watson (18781958) und Skinner (1904-1990) zurückgehenden Behaviorismus viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, weil er das Interaktionsproblem von vornherein vermeidet. Oder den Phänomenalismus (click) eines Berkely (1685-1753) und Ernst Mach (18381960), der die Existenz der Materie leugnet; oder die Identitätsthese von Herbert Feigl (1902-1988) (click), der beide Existenzformen, die physische und die psychische, kurzerhand in eins setzt, oder, um noch einen weiteren prominenten Modellierungsversuch zu nennen, den sog. Epiphänomenalismus, der auf Thomas Henry Huxley (1825-1895) zurückgeht. (click) Huxley schließt sich einerseits unserer Selbstwahrnehmung an, nach der wir uns der Existenz unserer eigenen Psyche vollständig sicher sind, ist jedoch ein Skeptiker, was die Behauptung ihrer Wirksamkeit auf unsere Physis betrifft. Er betrachtet die Psyche als so etwas wie einen kausalen Sackbahnhof, ein funktionsloses emergentes Endstück oder, wie er auch sagt, lediglich als ein internes label für unsere wechselnden physischen Zustände. Psyche, Bewusstsein, Geist oder Seele – das alles habe mit unserem physischen Leben gerade so viel zu tun wie das Pfeifen der Dampflokomotive mit ihrer Fortbewegung. Nun, auch gegen diese letzte Position gibt es offenkundig erhebliche Einwendungen. Ich selbst halte sie dennoch für pragmatisch interessant. (Folie 22) Meines Erachtens liegen die Dinge nämlich einerseits so, dass wir letztlich die uns vertraute Vorstellung von der Existenz unserer Psyche preisgeben müssen. Dieser Gedanke er- 12 schreckt uns zwar, vermutlich im gleichen Maße, wie es einen mittelalterlichen Menschen erschreckt hat oder hätte, wenn man ihm sagte, es gäbe weder den Teufel noch andere gute oder böse Geister. Damals waren diese Wesen im Leben der Menschen ebenso präsent wie für uns unser Bewusstsein. Vermutlich hängt unser Glaube an die Existenz der Psyche ganz eng mit unserer Sprache zusammen, die durchwoben ist von begrifflichen Hinweisen auf unser spirituelles Innenleben. Insoweit sind wir womöglich in einer Art Sprachplatonismus gefangen, der den psychologischen Begriffen quasi automatisch unterstellt, sie seien empirisch deutbar, sie bezeichneten also etwas Reales. Auf der anderen Seite fällt es uns unendlich schwer, uns selbst zu verstehen, ohne annehmen zu dürfen, dass wir beseelte, mit einer essentiellen Psyche ausgestattete Wesen seien. Der Epiphänomenalismus könnte eine intellektuelle Durchgangsstation sein, eine Heuristik, auf dem langen und beschwerlichen Weg vom unhaltbaren Interaktionismus zu einem in sich schlüssigen und eleganten monistischen Materialismus, der im übrigen keineswegs in eins gesetzt werden muß mit einem Determinismus, der das, was wir als Willensfreiheit zu bezeichnen pflegen, korrumpierte. Aber das ist eine weitere Debatte, die ich hier ja ebenso wenig führen kann, wie die zu den bereits ebenfalls lediglich geschilderten Problemen. Die Wirtschaftspädagogik, die im Kreise der übrigen erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen sich durch Ideologieresistenz und Nüchternheit auszeichnet, könnte auf diesem Wege vom Interaktionismus zum Materialismus durchaus eine Schrittmacherfunktion übernehmen, indem sie versucht, ihre Problemlagen auf dem soliden Fundament eines Modells von der geschlossenen Naturkausalität zu rekonstruieren. Sie wäre mit einem solchen Programm für den wissenschaftlichen Fortschritt nach meiner persönlichen Einschätzung jedenfalls besser positioniert als etwa die Psychologie, die mit ihrem unerschütterlichen Glauben an eine kausal wirksame, immaterielle und nicht lokalisierbare interne Wesenheit letztlich mit beiden Beinen fest in der Luft steht. Nun, ich bin sicher, dass nach so langer Zeit des Zuhörens sich bei Ihnen allen eine Befindlichkeit eingestellt hat, die zumindest an der materiellen Körperlichkeit Ihrer Existenz keinerlei Zweifel mehr zulässt. Bewegungsdrang, Hunger und Durst sind elementare Zustandsmodi unserer Natur. Für dieses Problem wird sich gleich draußen vor der Tür eine Lösung anbieten, zu der ich Sie einladen darf. Ungelöst dagegen sind die Probleme, von denen ich zu Ihnen gesprochen habe (Folie 23). Man darf auf ihre weitere Bearbeitung gespannt sein und ich selbst werde – zunehmend in der Beobachterposition – die Lösungsversuche mit großer Anteilnahme verfolgen. Im Übrigen fügt es sich, dass ihre Anfangsbuchstaben sich zu jenem Gruß formieren (Folie 24), der das Motto einer Abschiedsvorlesung, der valedictoria, bildet und den ich Ihnen mithin zurufen möchte: Valete! Leben Sie wohl!