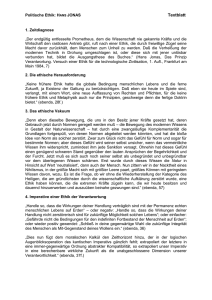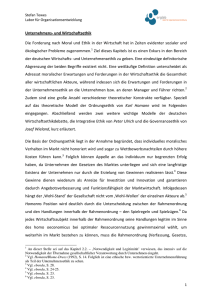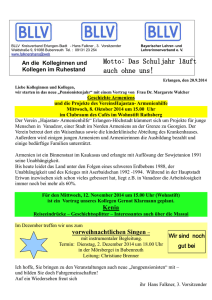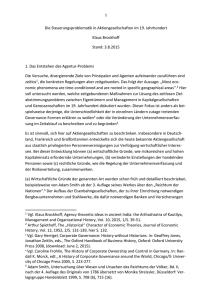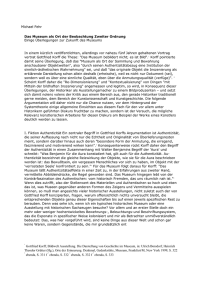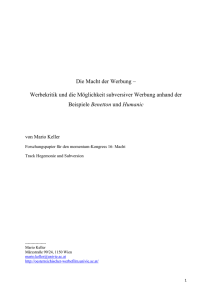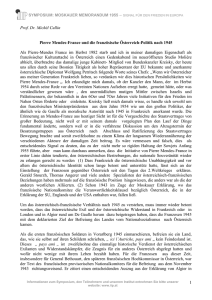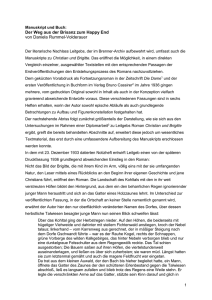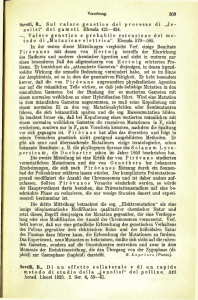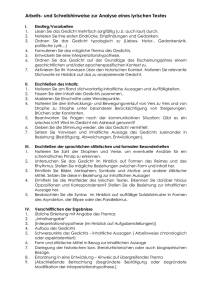langgedichte word 97 - Dr. Peter Geist - T
Werbung
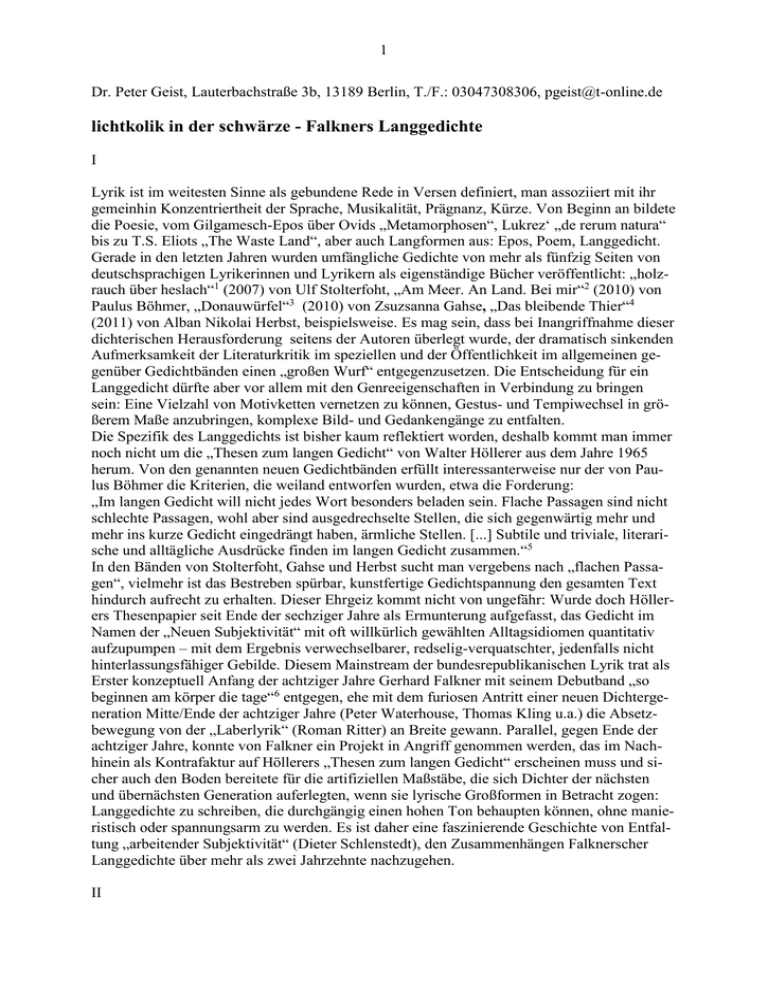
1 Dr. Peter Geist, Lauterbachstraße 3b, 13189 Berlin, T./F.: 03047308306, [email protected] lichtkolik in der schwärze - Falkners Langgedichte I Lyrik ist im weitesten Sinne als gebundene Rede in Versen definiert, man assoziiert mit ihr gemeinhin Konzentriertheit der Sprache, Musikalität, Prägnanz, Kürze. Von Beginn an bildete die Poesie, vom Gilgamesch-Epos über Ovids „Metamorphosen“, Lukrez‘ „de rerum natura“ bis zu T.S. Eliots „The Waste Land“, aber auch Langformen aus: Epos, Poem, Langgedicht. Gerade in den letzten Jahren wurden umfängliche Gedichte von mehr als fünfzig Seiten von deutschsprachigen Lyrikerinnen und Lyrikern als eigenständige Bücher veröffentlicht: „holzrauch über heslach“1 (2007) von Ulf Stolterfoht, „Am Meer. An Land. Bei mir“2 (2010) von Paulus Böhmer, „Donauwürfel“3 (2010) von Zsuzsanna Gahse, „Das bleibende Thier“4 (2011) von Alban Nikolai Herbst, beispielsweise. Es mag sein, dass bei Inangriffnahme dieser dichterischen Herausforderung seitens der Autoren überlegt wurde, der dramatisch sinkenden Aufmerksamkeit der Literaturkritik im speziellen und der Öffentlichkeit im allgemeinen gegenüber Gedichtbänden einen „großen Wurf“ entgegenzusetzen. Die Entscheidung für ein Langgedicht dürfte aber vor allem mit den Genreeigenschaften in Verbindung zu bringen sein: Eine Vielzahl von Motivketten vernetzen zu können, Gestus- und Tempiwechsel in größerem Maße anzubringen, komplexe Bild- und Gedankengänge zu entfalten. Die Spezifik des Langgedichts ist bisher kaum reflektiert worden, deshalb kommt man immer noch nicht um die „Thesen zum langen Gedicht“ von Walter Höllerer aus dem Jahre 1965 herum. Von den genannten neuen Gedichtbänden erfüllt interessanterweise nur der von Paulus Böhmer die Kriterien, die weiland entworfen wurden, etwa die Forderung: „Im langen Gedicht will nicht jedes Wort besonders beladen sein. Flache Passagen sind nicht schlechte Passagen, wohl aber sind ausgedrechselte Stellen, die sich gegenwärtig mehr und mehr ins kurze Gedicht eingedrängt haben, ärmliche Stellen. [...] Subtile und triviale, literarische und alltägliche Ausdrücke finden im langen Gedicht zusammen.“5 In den Bänden von Stolterfoht, Gahse und Herbst sucht man vergebens nach „flachen Passagen“, vielmehr ist das Bestreben spürbar, kunstfertige Gedichtspannung den gesamten Text hindurch aufrecht zu erhalten. Dieser Ehrgeiz kommt nicht von ungefähr: Wurde doch Höllerers Thesenpapier seit Ende der sechziger Jahre als Ermunterung aufgefasst, das Gedicht im Namen der „Neuen Subjektivität“ mit oft willkürlich gewählten Alltagsidiomen quantitativ aufzupumpen – mit dem Ergebnis verwechselbarer, redselig-verquatschter, jedenfalls nicht hinterlassungsfähiger Gebilde. Diesem Mainstream der bundesrepublikanischen Lyrik trat als Erster konzeptuell Anfang der achtziger Jahre Gerhard Falkner mit seinem Debutband „so beginnen am körper die tage“6 entgegen, ehe mit dem furiosen Antritt einer neuen Dichtergeneration Mitte/Ende der achtziger Jahre (Peter Waterhouse, Thomas Kling u.a.) die Absetzbewegung von der „Laberlyrik“ (Roman Ritter) an Breite gewann. Parallel, gegen Ende der achtziger Jahre, konnte von Falkner ein Projekt in Angriff genommen werden, das im Nachhinein als Kontrafaktur auf Höllerers „Thesen zum langen Gedicht“ erscheinen muss und sicher auch den Boden bereitete für die artifiziellen Maßstäbe, die sich Dichter der nächsten und übernächsten Generation auferlegten, wenn sie lyrische Großformen in Betracht zogen: Langgedichte zu schreiben, die durchgängig einen hohen Ton behaupten können, ohne manieristisch oder spannungsarm zu werden. Es ist daher eine faszinierende Geschichte von Entfaltung „arbeitender Subjektivität“ (Dieter Schlenstedt), den Zusammenhängen Falknerscher Langgedichte über mehr als zwei Jahrzehnte nachzugehen. II 2 Falkners erstes mit 306 Verszeilen ausgewiesenes Langgedicht „ich, bitte antworten“7 besteht aus 27 Versblöcken zwischen zwischen fünf und elf Verszeilen und einem in fetter Schrift abgehobenen Einzelvers, der das Langgedicht beschließt: „gott würfelt“8 resümiert apodiktisch der letzte Satz des Gedichts. Der Komposition des Bandes „wemut“ (1989) entsprechend bündelt „ich, bitte antworten“ Motive, Metaphernkonstrukte, ideelle Drehpunkte der vorausgegangenen Werkteile, ehe sie in den abschließenden „materien“9 einer erneuten Dekonstruktion unterworfen werden. Insofern erweist sich dieses Poem als Energiezentrum des Gedichtbandes. Die durchgehend philosophisch grundierte Diktion des Textes hält ihn auch zusammen, denn es sind mehrere Anläufe, in denen der Sprecher seine Figuren in jeweils anderen Konstellationen und Gewichtungen zueinander stellt und ein Spiel der Wechselwirkungen aufführt. Grundfiguren sind die Sprecherinstanz samt ihrer kognitiven und vitalen Begehren, evozierte „Welt“ und die Sprache selbst. Bereits die ersten beiden Versblöcke entwerfen eine komplexe experimentelle Spielsituation: „die außenwelt begrenzt das ich schweigend sie ist von herzen stumm ihrer stille mangelt alles geschrei das ich ist es, das die außenwelt mit lärm erfüllt. es begeht die welt mit getöse eine concorde startet ein kraftwerk wird angefahren unsere kräfte ragen hinaus in den ziellosen regen, der regen durchschlägt die haut zur außenwelt und trifft unser staunen. ein schaltkreis ist geschlossen das ich sagt du zu einem ding es möchte mit ihm eine bedeutung bilden das ich will sich regeln über diese bedeutung. doch das ding erträgt keine bedeutung, es trägt jede bedeutung aber kein ich, das sich daranhängt und sich schwer macht das ich rutscht auf der bedeutung vom ding wieder herunter (am ende liegt es unten und verstummt) (…)“10 In einer ersten Versuchsanordnung wird das eingangs evozierte Scheinparadoxon von Weltenstille und Ich-Lärm ausdifferenziert und mit Sinn erfüllt, indem das sprechende Ich zum Menschheitsrepräsentanten erhoben wird. So erscheint einsehbar, dass „geschrei“, „lärm“, „getöse“ an den Menschen und menschliche Gestaltungskräfte („concorde“, „kraftwerk“) gebunden sind. Der Überraschungseingang des Gedichtes enthält in nuce bereits eine Leseempfehlung, Aussagen („die außenwelt begrenzt das ich schweigend“) wenig zu trauen, weil deren Bedeutungen ins Gleiten geraten können. Zudem wird der philosophierende Duktus sofort durchstört durch einen poetischen: Die „außenwelt …ist von herzen stumm“, „unsere kräfte ragen hinaus in den / ziellosen regen, der regen durchschlägt / die haut zur außenwelt und trifft / unser staunen“. Das vital durch die Bewegungsverben ( „ragen“; „durchschlägt“, „trifft“) und das Pronomen „unser“ aufgewertete „staunen“ generiert Höhepunkt und Achse des Versblocks, der dann im sich schließenden „schaltkreis“ abgerundet wird. Ein Schaltkreis von Kognition und Emotion, von Ich und Welt, von Stille und Getöse, von Bezeichnendem und Bezeichneten. Und es ist ein hoher Ton angeschlagen, der nichts weniger denn die Welträtsel in das poetische Visier zu nehmen gedenkt, im vorgeblich naiven Staunen, Welt, Ich und Sprache neu zu buchstabieren. Im nächsten Versblock wird das zweite große Thema dieses Genesis-Poems angeschlagen: das schwierige Verhältnis zwischen Bezeichnendem und 3 Bezeichneten, das weite Feld der Signifikantendämmerung von de Saussure bis Lacan und Derrida. Auch hier wird Kontaktnahme versucht zwischen „ich“, „ding“ und „bedeutung“, aber ein Regelkreis („das ich will sich regeln über diese / bedeutung“) kommt nicht zustande, fixe Bedeutungssetzung scheitert. Gibt sich der Sprecher in den ersten beiden Versblöcken aussageorientiert und konnotatationsarm, so dass der Text einen beinahe narrativen Charakter erhält, ändern sich ab dem dritten Versblock Strukturierung und Gestus des Textes entschieden: „ach das ich und sein ende dort unten beim nein zur bedeutung, beim nein zur begründung, im nirgends mit sich und für niemand. allein mit der fluchterregenden mutter allein mit dem enderfüllten amerikaner bei sich selbst und dem reinen computer eine lichtkolik in der schwärze aller schwänze voller erbmasse ein meeresleuchten überm außenweltstrand unsere körper prallen gegen die präsenz von ionen und bilden metalle. schön! unsere körper erregen mit licht das mutige grün der kontinente. schön! unsere körper bilden die knöchel der alpen wie die schläfe der nordsee ein zwerchfell trennt luft und wasser zur mitte: der main, norden und süden schenken sich ihre lieblichen grenzen unsere körper reißen den mund auf und sind stumm (…)“11 Das Scheitern instrumenteller Bedeutungsfixierung im chaplinesken Bild á la „Modern times“ wird nun als Chance ergriffen, Sprachbewegungen aufzuführen, die in die Freiheit der Imagination vortasten. Schon die Diskrepanz zwischen dem starken Emotionswort „ach“ und den Evokationen von Entfremdung und Isolation des „ich“ bereitet einen Ausbruch aus Logik, Determination, Sprachohnmacht vor. Und dann wird eine erste Sprachexplosion generiert, die mit einem palimpsestiösen Phonemtauschreiz anhebt („fluchterregenden“ statt „furchterregenden“), dann aber konzentriert in ozeanisch-narzisstische Entgrenzungsbilder („lichtkolik“, „meeresleuchten überm außenweltstrand“) sich ausweitet. Der anschließende Versblock zieht seine poetische Verdichtungsenergie zuvörderst aus syntaktisch grundierten Stilmitteln, der Anapher („unsere körper“) und der Epipher („schön!“). Die Pantagruelsche Erhöhung des Körpers bis ins Erdteilhafte weist ins Groteske, das ästhetisch wertende „schön!“ auf das Erhabene. Diesen Verschränkungen des Grotesken mit dem Erhabenen wird am Ende des vierten Versblocks eine Laokoon-Gruppe vorsprachlicher Evidenz entgegengestellt: „unsere körper reißen den mund auf / und sind stumm.“ Welt, begehrendes Ich und Sprache werden zunächst in ihrer Selbstreferentialität und Getrenntheit aufgeführt. So ist wenige Verse später von „geräusche(n) / im rohbau, nicht wortüberdacht / einfach ein tagesanbruch“12 die Rede, an anderer Stelle werden die Dinge als in ihr So-Sein beschlossen ausgestellt: „strandklar die herzen / alles draußen ist unter sich: wahrheit / wäsche, welt; alles hat eine tönung, einen / punkt auf der zeitkrümmung, einen / fahrschein.“13. Nun allerdings fügt Falkner Konstellationen des Adverbialen hinzu, die überdies mit sexuell konnotierten Realien reagieren: „vielleicht und nein stehen beisammen / begierig gehen die tore des verstehens / auf und zu, / weich und hydraulisch / vielleicht steht am scheideneingang / blaugeädert, nein sperrt den mund / auf; tokio, orinoko, hongkong“14. In der 4 Kopulation von „vielleicht“ und „verstehen“ gelingt nun, was in mehreren Anläufen zuvor fehlschlug: Der Sprechakt, in diesem Fall onomatopoetisch-topographisch ausgelegt. Was ist geschehen? Zunächst einmal die Anreicherung des Schöpfungsspiels durch neue Wortfelder und dementsprechende neue semantische Kopplungen, angereichert aber auch durch die Intensivierung von Poetizitätsverfahren im Kontrast zu narrativ-benennenden Passagen. So kommen Allegorisierungen ebenso ins Spiel („grund und gegenteil überqueren eine straße“15) wie kosmologisch-physikalische Verweise („im schwachfeld von selbst sind / entweder – oder bewirkungsarme / ladungen“16) und Operationen mit normabweichenden Sememen („irgendetwas ist frühling, oder fühling / oder frühlung / um uns bewegen sich die versausten / mann-frauen“17). In der Mitte des Gedichts imitiert der Sprecher schließlich eine Orgie der Benennungen, die programmatisch beendigt wird: „was will dann die sehnsucht? / sie will: ein ende der aufzählung“18. Die fette Markierung, die ansonsten nur noch im Schlusssatz probat gehalten wird, signalisiert einen Umschlagpunkt: Es geht nicht um die Sprachmarken der Oberflächen, sondern um das Essentielle sprachlicher Erfassung von Ich-Welt-Beziehung. In einer Du-Anrede imaginiert der Sprecher den paradiesischen Zustand einer zweifel-losen Verbindung zwischen Bezeichnung und Bezeichnetem, die es nur im Konjunktiv gibt: „an dich denke ich und mein staunen stellt das schweigen wieder her fast scheint es die welt wüßte für einen augenblick mit dem wort apfel die frucht zu treffen, die gemeint war vor der apfelsperrstunde (…)19 Eine solche Sprache trägt das Sein an das Subjekt, und es ist allein die Sprache der Poesie, die mit existentieller Energie aufgeladen werden kann: „allem neuen, noch nicht von seiner dichtung erkannten, fehlt einsicht eine sprache muß kommen und sagen ich stürze dich durch ein sein dann erst erringt es sich selbst und erträgt sich (…)20 Das klingt nicht von ungefähr nach Heidegger, eine Diktion, die an verschiedenen Stellen des Gedichts wieder aufgenommen und weitergeführt wird. Allerdings wird nicht die Sprache als „das Haus des Seins“21 zelebriert, sondern auf die potentiell unendlichen Kalibrierungsmöglichkeiten poetischer Sprache verwiesen: „die flurpforten: gastlich / die flutposten: gastlich / (hier spricht der automatische ich-beantworter)“22. Weder „rettungsverkleinerungen“23 noch „schweigebrocken“24 helfen aus dem Dilemma changierender Signifikation, auch das Operieren an den Wortkörpern („bluten die liebenden, i streichen / lebenden, ben streichen, i einsetzten“25 oder Vokalballungen („das ununterbrochene ist uns durch brüche / berüchtigt“26) nicht. Warum auch? Denn mit Derrida kann Bedeutungsverschiebung, die konnotative und semantische Aufladung der Sprachzeichen, ja noch die Sinnflucht der „absoluten Metapher“ die Gravitationskräfte des Poetischen verstärken. Falkner lässt nicht von ungefähr jene massereichen „Schwarzen Löcher“ im Kosmos assoziieren, deren Schwerkraft selbst das Licht nicht nach außen lässt: „wird ein wort so dicht daß sich sein sinn der eigenen anziehung nicht mehr erwehrt 5 stürzt es in sich schwarze wörter sind orte des sinns nach dem einsturz die kraft des sinns flieht hinter den ereignishorizont (bei schwerster ich-dichte tritt gott ein) (…)27 Vor diesem Endpunkt von Sprach- und Ich-Schwärze allerdings ermöglichen Konzentration und Ballung poetische Epiphanien, in denen Sinn-Entgrenzung, Rausch und Versschönheit zusammenfallen können. Und so betätigt sich der Dichter abermals als Demiurg: Er baut um das Gerüst bereits zuvor benutzter Worte und Satzteile („irgendetwas ist frühling“, „eine concorde landet“ usw.28) eine poetische Welt der Fülle – „eine welt steht in farben“29 - , den „fremdsprachenleib der welt“30 neu buchstabierend. Nach so viel Dekonstruktion und ReKonstruktion endet das Gedicht in existentieller Wucht und Kryptik: „im montagsmantel erscheint die welt und eines will sie mir noch sagen ich soll untergehen es, von dem wir nicht wissen, ob es mit uns spielt, ist nicht. seine innere irre ordnet der geist grundlos es, das uns bricht, rät uns nur gott würfelt“31 Der „montagsmantel“ ist nach allen zuvor gegebenen Textindizien als Schöpfungsmoment assoziierbar, nun auf Augenhöhe mit dem sprechenden Ich. Doch dieses Moment der intimsten Begegnung von Ich und Welt hält als letzte gelungene Kommunikation die nichtende Botschaft der Endlichkeit des Ich parat. Die folgenden Verse bezeugen Panik und Verleugnung, ehe die fett herausgestellte Schlusssequenz wieder intertextuelle Halt-Haken einschlagen kann: „gott würfelt“ bezieht sich offensichtlich auf Einsteins Äußerung „Gott würfelt nicht“32: Dieser in mehreren Briefen variierte Grundsatz bezog sich auf eine physikalische Entdeckung und auf ein philosophisches Problem. Die Quantentheorie Plancks stellte den Determinismus des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs in Frage; Einstein weigerte sich, diesen Einsturz der letzten Festen des Newtonschen Weltbildes, an dem er ja selbst mit der Relativitätstheorie bedeutende Teilhabe hatte, zu akzeptieren. Die Physikgeschichte des 20. Jahrhunderts hatte dann seinen Widersachern Heisenberg und Bohr recht geben müssen, allerdings außerhalb theologischer Endfragen nach der Existenz Gottes. Doch geht es in Falkners Gedicht nicht um Letztbegründungen theologischer oder gnoseologischer Natur. Es versucht vielmehr, philosophische, sprachtheoretische und poetologische Diskurse in der Dichtung selbst zu überkreuzen: Einstein meets Derrida meets Mallarmé: Mallarmés rätselhaftes Gedicht „Ein Würfelwurf“ endet mit den Versen: „Auf leerer erhabener würfelfläche In allmählicher folge sternenhaft die vollendete ordnung der allumfassenden zahl erwachend zögernd aufgehend schimmernd und sich sammelnd 6 vor dem stillstand am höchsten heiligen punkt Jeder Gedanke ist ein Würfelwurf.“33 Die Bezugnahme des Falknerschen Textes auf Mallarmé ist evident: In beiden Gedichten wird der Schlussvers hervorgehoben, bei Mallarmé durch die untypische Großschreibung, bei Falkner durch die fette Schrift. Beide Gedichte verbinden den Aufschwung zu hohem poetischen Ton mit Pathosformeln, die sich aus kosmologischen und religiösen Wortfeldern speisen. Beide Gedichte kreisen um die Widerspruchspaare Existenz – Sprache, Determination – Zufall, Beschreibung – poetische Numinosität. Und beide Gedichte testen kühn und gewagt die Grenzen des Sagbaren aus. Mit „ich, bitte antworten“ und den auf Dekonstruktion ausgelegten „materien“ in „wemut“ hat der Lyriker Gerhard Falkner jenen „am höchsten heiligen punkt“ (Mallarmé) avisiert und getroffen, der im Deutschen der Poesie möglich ist. Von hier aus werden jene vielzitierten und oft genug verengt interpretierten – nämlich allein auf mangelnde öffentliche Anerkennung des Gedichte-Schreibens bezogen – Sätze aus dem „n-a-c-hw-o-r-t“ recht erst tiefenscharf lesbar: „...in den zwanzig Jahren, in denen ich mich fast uneingeschränkt der Dichtung ausgesetzt habe, [wurde] mir immer wahrscheinlicher, daß sie – und zunehmend mehr – die kühnste unter den Künsten ist, über deren extremste Bedingungen, die sie ab einer bestimmten Höhe diktiert, sich Unverfallene wohl schwerlich einen Begriff machen.“34 (WE 169) III 1996 meldet sich der Dichter Gerhard Falkner nach sieben Jahren Absenz vom Literaturbetrieb mit dem bei Suhrkamp erscheinenden Gedichtband „X-te Person Einzahl“ zurück. Neben 24 neuen Gedichten am Anfang, einer Auswahl aus den drei bei Luchterhand publizierten Gedichtbänden und zehn „zerstreut“ veröffentlichten Gedichten enthält der Band das bis dato unveröffentlichte Langgedicht „Ich sage null für ja und eins für nein“35. Es knüpft in Diktion und Motivik an „ich, bitte antworten“ an, setzt aber neue Akzente. In den frühen neunziger Jahren hatte Gerhard Falkner intensiv die veränderte Stellung des Gedichtes und des Dichters in einer sich globalisierenden Gesellschaft reflektiert. In der 1993 veröffentlichten Schrift „Über den Unwert des Gedichts“ hält er der Sprache der Poesie jene „geführte“ Sprache entgegen, die im Zuge der totalitär gewordenen Apologie der herrschenden Gesellschaftsordnung Entindividualisierung und Freiheitsbeschneidung vorantreibe. Der Dichter sterbe aus, „weil eine in Pleonoxie verrottende Gesellschaft seine Existenzbedingungen zerstört. die nämlich der Verfeinertheit, eines Gewissens des Ohrs, der Zeit (Muse) für rhythmische Wiederholung, aller Arten von Herzensgüte, Noblesse und Unterscheidungsfähigkeit.“ 36 Als wesentlicher Bestandteil kapitalistischer Beschleunigung, Entdifferenzierung und Vergleichförmigung sind die technischen Sprachen und Computeroberflächen anzusehen in ihren Binärkodierungen von null und eins: „Die innere Bewegungsrichtung der Zivilisation zielt auf eine Vergegenständlichung des Menschen. Seine Vorgebundenheiten Traum, Mythos, Imagination, Glaube, Transzendenz usf.) sind Quellen eines dem ZivilisationsAbschlußprozeß zutiefst fremden Aufruhrs. Die Innerlichkeit mit ihrem Ritus der Plötzlichkeit Widersacherin schlechthin, dem vulgo der Gleichrichterkräfte aber nicht mehr gewachsen. Die gewaltige Offensive (von Telekom bis IBM) zur Absaugung des Inneren macht die Lage angesichts des Paradoxons, daß der Täter mit dem Opfer binär verschmilzt, aussichtslos.“37 Diese binäre Verschmelzung aber löckt den Stachel des poetischen Widerstands und gebiert die Intention des zweiten Langgedichts, das Gerhard Falkner Mitte der neunziger Jahre zu 7 Papier bringt. Der Gedichttitel „ich sage null für ja und eins für nein“, der in der ersten Verszeile wiederholt wird, zieht sich in Variationen durch das ganze Gedicht, ja er strukturiert es dergestalt, dass seine Wiederholungen schließlich in der monotonen Schlichtheit des „null null ja null null eins nein“38 den Leser zu nerven beginnen. Genau dies aber ist beabsichtigt. Denn zwischen den Litaneien der Binärkonstellationen wird ein Sprachhandeln aufgefaltet, das jeweils andere Akzente setzt: Erstens existentiell-philosophische, zweitens sprachbezogene, drittens bildhaft- poetische sowie viertens den Sprechakt selbst betonende. Bereits zu Beginn wird das Gegensatzpaar Bewegung – Starre eingeführt, das ebenfalls durch den gesamten Text geführt wird: „ich sage null für ja und eins für nein. kann. sein. aufs sein kommt das handeln zielend zu. ein verlassen des ausgangspunkts begünstigt das abgleiten ins überspringen. nur ein schritt ist es dann vom geworfenen zum aufgeschmissenen. die begründung einer leere begreift die notwendigkeit des ausschlusses (omnis determinatio est negatio) die seele ist eine sollbruchstelle. (…)“39 In der Mitte des Gedichtes – wieder so ein Drehpunkt – wird der Gegensatz auf den Punkt gebracht: „niemals werde ich schlecht reden vom werden / wohingegen vom sein ich nichts gutes berichten kann / halb hier und halb grün“40. Bemerkenswert ist gleichfalls die ironische Brechung existentialistischer Begrifflichkeiten, wenn etwa abrupt die Stilebene gewechselt wird – „vom geworfenen / zum aufgeschmissenen“, umgekehrt die Herauspräparierung der Kategorie „sein“ aus der umgangssprachlichen Floskel „kann sein“ durch den dazwischengestellten Punkt. Wie schon in „ich, bitte antworten“ operiert der Text zweitens mit Umschreibungsanweisungen, wodurch Bedeutungsbeziehungen zwischen Worten intensiviert werden, deren Verbindung zunächst nicht augenfällig sein muss: „ich sage nein wie not ohne o doch mit ei / und n für t / aber not? nein.“41 Wenige Zeilen weiter werden durch phonetische Substituierung („die klocken leuten“42) oder Wortzusammenziehung (in „heraklitoris“43 sind die Signifikate von „Heraklit“, „Klitoris“ und „Hera“ ineinandergeschoben) Situationen leicht rauschhafter Verrückung, sexuell konnotiert, evoziert. Die dritte Akzentuierung, die des Bildhaft-Poetischen, bezieht sich auf insulare Bildfolgen, die von kühnen Metaphern durchsetzt sind, z.B.: „mauern, gesäumt von verrottenden orangen zerstört von den sprühenden schamsplittern einer durch die bäume gesiebten sonne. (…)“44 Es sind Bildfindungen, die, mit Benn gesprochen, einen hohen „Wallungswert“ aufweisen. Wellenartig durchkämmen sie das Gedicht, rufen Lesemomente hoher Intensität hervor und sollen auch gar nicht ihre Nähe zu Rausch und Exzess verleugnen, „den unerschöpflichen reichtum der turbulenz“45. 8 Ein vierter Akzent schließlich wird auf den Sprechakt selbst gelegt: Damit ist die stetig wiederholte Sprechformel „ich sage“ gemeint, aber sie korrespondiert mit den Hinweisen auf den Schnittort zwischen Ich, Welt und Sprechen, wenn nach der Sprechformel die Rede geht: „fleckenloser mund“46, „die sätze bluten aus dem mund / wie zusammengeschlagene idioten“47, „die blinde fülle eines überschäumenden munds“48, „fliederfarbener mund. die concupiscentia“49. Durch diese konnotative Aufladung erhält der anaphorisch strukturierte Schlussblock erst eigentlich seine pathosgestützte Evidenz, wobei die Dominanz von Einsilbenworten wirkungsvoll ein Staccato hinterlässt: „ich sage ja für nein und kann für sein ich sage null für eins und welt für wein ich sage grün für angst und hart für null ich sage brot für beil und heil für tot“50 Schlusshin bindet Falkner die Binärkonstallationen und die verschiedenen Sprechentfaltungen im Gedichtverlauf dergestalt zusammen, dass die Arbitrarität des sprachlichen Zeichens in der immanenten Verweiskraft die öde Logik des null/eins außer Kraft setzen kann – letztlich durch „die concupiscentia“51, das obszöne Begehren, dem der Platzwechsel von Ausschließlichkeiten („brot für beil“, „heil für tot“52) durch das Gestöber intensiver poetischer Interventionen eingeschrieben werden konnte. IV Die in „ich, bitte antworten“ und „ich sage null für ja und eins für nein“ Grenzen des Verstehens bewusst touchierende Methode kompositorischer Dehnung des Verhältnisses von Signifikanten und Signifikaten unter den Ausspizien des letzthin Einleuchtbaren erwies sich als ebenso folgenreich wie produktiv: In dem 2000 veröffentlichten Gedichtband „Endogene Gedichte“ ist ein drei Seiten umfassendes Gedicht enthalten, mit dem der Autor bei Lesungen Triumphe feierte: „Ach; der Tisch (Zur Poesie des PoeDu)“53. Wie ist dieser Publikumserfolg zu erklären? Vereinfacht gesagt vor allem damit, dass die zuvor entwickelten Verfahren des Poetizitätsgewinns in ein Sprechen integriert worden waren, das nicht mehr allein die Disparatheit des Sprachmaterials, sondern eine gewisse Einheitlichkeit im Grundgestus herausstellte. Diese dem Gedicht eingeschriebene veränderte Auffassung vom langen Gedicht zieht praktische Schlussfolgerungen aus den Denk-Gängen im Essay „Vom Unwert des Gedichts“. So präferiert Gerhard Falkner, wie er in einem „Nachwort statt eines Nachworts“ Selbstauskunft gibt, nun „eine ‚rücksichtenlose’ aleatorische Polyphonie, die den Jetztzeitlichkeitshunger und Kickbedarf mit reinen und klaren Verdichtungen versöhnt. Die schnellen Sprachen müssen in den langsamen Sprachen ausgebremst werden.“54 Bereits das äußere Erscheinungsbild des Langgedichts lässt sich ein auf die „schnellen“ Sprachen, die später vom Autor als „superkurze Einsatz- und Bereitschaftssprachen“55 apostrophiert werden sollten – allerdings konsequent an die genannte Funktion der Ausbremsung gebunden. Nicht mehr Versblöcke bestimmen das Bild, sondern ein durchgehender Textfluss. Mehr noch, der fiktive Gesprächsgestus mit seinen Wiederholungen („ach der Tisch“), dem stilprägenden Anakoluth, dem vorgespielten Stottern („denn, denn das, denn das diesmal als… ach der Tisch…“), den Interjektionen („ach“, „eh“), der imitierten Weitschweifigkeit insinuiert das Geschwätzigkeitsparlando der von Falkner herzlich verachteten „Neuen Subjektivität“ – und ist doch ihr Gegenteil. Denn der Text spannt ein straffes Netz zwischen den Grundworten „Brot“, „Tisch“, „Wort“ und selbstredend dem sprechenden „ich“. Dieses Netz ist recht eigentlich ein Sprachtrampolin, das 9 bezaubernde Akrobatiken ermöglicht: Salti in die „Weltanwesenheit“56 des Sprechenden, Spreizungen in derbe Männerphantasien wie aristotelische Gefilde, Pirouetten in Emphasewirbel des Göttlichen. Wissend um die lange Aura-Historie von Worten wie „Brot“ oder „Laib“, werden sie mit den „schnellen“ Sprachen („Ich kann das Brot anklicken“57) amalgamiert und bleiben doch, aufgrund erheblicher Vorarbeit konnotativer Aufladung im Textprogress, überlegen gegenüber technischen Reizworten. Schlusshin mischt das sprechende Ich sich direkt ein, genötigt, sich zu wehren gegen Anmutungen: „aber ich ach ich bin bin doch nicht / doch nicht zu haben!“58 Zweimal „ich“ „bin“ „nicht“, dann aber auch ganz am Ende des Gedichts zweimal „haben“ und dreimal „bin“: „ich bin, binbin nicht zu haben“59. Aphasie und Erleuchtung begegnen sich, in der Konsequenz des Gedichtganges, in einem Sprechakt des Widerstands. Widerstand wogegen? Gegen die Verdinglichung der Sprache, die rohe eineindeutige Bedeutungszuweisung instrumenteller Rede: „zu Willen sein, in einer Haltung wie vom ausfälligen / Wort unter den Tisch geprügelt soll ich sein Ding / in die Hand nehmen, soll ich, soll ich seine Sprache / in den Mund nehmen, eine / aus dem Tisch in den Mund gesprengte / Männersprache“60 Gerhard Falkners „Ach; der Tisch“ ist als Plädoyer für die Verlebendigungskraft der Poesie zu lesen. Um das Grundwort „Brot“ herum, „eine der reinsten Schnittstellen zwischen dem Heiligen und dem Profanen. Beim Sprechtext ‚Ach; der Tisch‘ ist das ‚brotgewordene‘ Gedicht Vermittler zwischen beiden.“61 V „ich habe zu wenig geschlafen / in diesem Jahrhundert!“62 –diese im Verlauf des 61 Seiten umfassenden Langgedichts immer wieder aufgegriffene Zeile bildet den Auftakt zu einem Poem, das ein Meisterwerk, ja ein Jahrhundert-Gedicht genannt werden darf: „Gegensprechstadt – ground zero“, veröffentlicht 2005, an dem Falkner zehn Jahre gearbeitet hatte. Es ist ein Poem über die Zeit – die subjektive Zeitlichkeit des sprechenden Ich im Verhältnis zur geschichtlichen Zeit. Gleich eingangs wird dieses Thema eingeführt: „es gab noch keinen 11. September / keinen 3. Oktober / und keinen 15. März / die Gelegenheit also war günstig / der Zeit die Freiheit zu lassen / einmal den Ort zu spielen“63. Ein understatement, das eine Generösität der Wahl suggeriert, die so gar nicht vorhanden ist. Denn über die in ihm formulierte Idee wird das Poem im Ganzen strukturiert. In einer Anmerkung zu diesem Satz führt der Autor aus: „Unter dem Diktat unserer Mobilität dürfen wir uns durchaus die Zeit als den eigentlichen Ort unserer Bewegung vorstellen, wohingegen der (schwerfällige) materielle Ort nur den jeweiligen Referenzpunkt in einem nicht mehr an ihn gebundenen Zeitschema darstellt.“64 Damit fixiert Falkner nichts weniger denn universelle Entfremdungszusammenhänge, die dem Kapitalismus seit seiner Herausbildung inhärent sind, die jedoch in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts in der totalen Mobilmachung der globalisierten Märkte eine neue, totalitäre Stufe erreichen, die qualitativ in der Vernichtung, Verstümmelung und Segregation von „Menschenmaterial“ den Vernichtungsorgien „totalitärer“ Regime im 20. Jahrhundert längst ebenbürtig geworden sind. Das Spiel mit Zeit und Zeitlichkeit als Hauptmotiv im Langgedicht ist ein ernstes, und es wird durchgehend geschichtlich grundiert. Diese bei Falkner so zuvor nicht angetroffene Akzentuierung hebt Alexander Kluges Aperçu von der Postmoderne als Angriff auf die übrige Zeit65 vom laxen Theorem in die sinnliche Fassbarkeit des damit verbundenen existentiellen Grauens: „20. Jahrhundert Jahrhundert der Gegenwart jede Woche eine neue Epoche brausende, brennende von Jahren 10 ein Heute hat das andere gejagt die Gesterns — nichts als Späne die vom Heute flogen las horas artificiales los anos artificiales ho paura! adelante! dann die Wende vor der Wende die New Economy das kalte Grausen das damals seinen Ausgang heute seinen Fortgang und morgen sein böses Ende nimmt“ (…)66 Das böse Ende, das auch noch 2011 – die Einschläge kommen näher - schwer abschätzbar ist, hat hier zumindest seine geschichtliche Einsenkung in Emblemen neoliberaler Ideologeme vorgehabter Geschichtsvernichtung angenommen. Insofern sind Falkners Verse Sternminuten poetischer Prophetie. Das Poem trug ursprünglich den Arbeitstitel „Vom Hören der Tage“67. Zeitangaben und Zeitspannen tragen gleichsam (durch) den Text: Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnte, das 20. Jahrhundert; heute, damals, Datumsangaben, „zu gegebener Stunde“68. Diese Überpräsenz von Zeitlichkeitschiffren betont noch da, wo der Berlin-Flaneur sich scheinbar lässig der Gegenwärtigkeit des Augenblicks anheimgibt, die existentielle Dimension poetischen Insistierens: „heute ist wieder Freitag ein analoger Tag in einer digitalen Welt wo ist die Göttin deren Arm wir die Beute des heutigen Datums verdanken so viel Gegenwart in der Brad Pitt den Gegenwärtigen spielt (…)“69 Wie so oft in Falkners Lyrik wird die Wahrnehmung des sprechenden Ich zu Ereignissen und Prozessen der Weltgeschichte so in Beziehung gesetzt, dass sich unabdingbar erscheinende Konsequenzen für politische, philosophische und ästhetische Positionsbestimmungen ergeben: „Der 11. September hat meine Zeilen eiskalt erwischt oder war es der 3. Oktober oder der 15. März Ich weiß es nicht ob ich weiß nicht jedenfalls war ich zur Wirklichkeit wie sie sich selbst über Hiroshima hinaus erhalten hatte mit Subjekt und Sinn und Geschichte mit Strand, Tierpark und Liveshow so nicht mehr bereit. (…)“70. Der 11. September (2001) und der 3. Oktober (1990) sind Signaldaten, die jeder Leser als Epochenschnitte einzuordnen weiß, der 15. März verweist, aber das erfährt man erst aus dem Nachwort, auf die Iden des März, die Ermordung Cäsars, vor allem aber auf den Geburtstag 11 des Verfassers. Im Nachwort ordnet Gerhard Falkner den 11. September dem „Schrecklichen“, den 3. Oktober dem „Schönen“, den 15. März dem „Differenten“71 zu. Dort, wo das Schreckliche und das Schöne enggeführt werden in der „differenten“ Sprache der Poesie, generiert die Fallhöhe Sprechlagen des Erhabenen, auf die immer wieder zurückverwiesen wird, wenn passagenweise andere Gesten gewählt werden. Denn der vom Autor monierten „Schrumpfung von kontinuierlicher und überpersönlicher Zeit in jene jeweils fragmentierte und nur vom Subjekt als wahr erlebte Jetztzeitigkeit“72 entspricht das „additive Zusammenwirken mehrerer Stilformen“73, dem der Autor den Begriff „polymere Poesie“ entwand. Der Leser wird durch einen lautmalerisch-kryptischen Einschub („Mantegna“74) ebenso überrascht wie durch eine parodistische Rap-Imitation75, ein in barocker Tradition stehendes Figurengedicht76 oder ein Gedicht im Gedicht, das unter dem Titel „Stadtplan“ als eigenständiges Buch veröffentlicht wurde. In dem in kursiver Schrift herausgehobenen Kabinettstück setzt Falkner „Stadt“ und „Buch“ metonymisch („Häuser sind Wörter / und Straßen sind Sätze und / Städte sind Bücher“77) und geht dem „Satzbau der Straße“ nach. Vorzugsweise durch Rhythmisierung, Parallelismen im Satzbau und Vertauschungsfiguren in den angebauten Adverbialbestimmungen und Objekten wird boleroartig ein poetischer Sog erzeugt, der „die Energie des Begehrens in intensive Wirkungen“78 transformiert. Wird in „Stadtplan“ die „Gegensprechstadt“ in sublimer Versschönheit akzentuiert, laufen andere Stränge des Poems auf den entgegengesetzten zweiten Teil des Bandtitels zu: ground zero. Das bereits zitierte sehr ernste, sehr zentrale lyrische Statement „Der 11. September hat meine Zeilen / eiskalt erwischt (…)“79 betont den ins Vergessen entsorgten Zusammenhang zwischen Hiroshima und dem 11. September 2001. Der Begriff „ground zero“ bezeichnete den Bodennullpunkt vom 6. August 1945 in Hiroshima, als die USA die erste Atombombe über der japanischen Stadt abwarfen. Durch die Definitionsmacht der Medien nach dem 11. September 2001 wurde die Ursprungsbedeutung überschrieben, wenn nicht so gut wie gelöscht. Der ground zero Berlins ist der 9. November 1989, der den 9. November 1938 („Kristallnacht“) wie den 9. November 1918 (Novemberrevolution) überstrahlt wie der 11. September 2001 Hiroshima 1945 und den Pinochet-Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung von Allende in Chile 1973. Diese Auslöschungsmächte konturieren das Anathema des Poems. Für Falkner ist im übertragenen Sinne „ground zero“ auch das Auge des Taifuns, in dem sich für einen Moment Schönheit und Schrecken die Waage halten80, bevor die „Katastrophe (…) absolute Zuspitzung erfährt und im Verglühen des Bisherigen gleich weit den Radius seiner Ursachen wie den seiner Folgen ausleuchtet“81. In etlichen Variationen werden die nur scheinbar paradoxen Wirkungen des katastrophischen Jetzt benannt: „20. Jahrhundert / Milliarden Momente / des Aberwitzes / die Schläge verteilt / die Wunden geschlagen / die Siege verloren“82; „20. Jahrhundert / Jahrhundert der Gegenwart / von Errungenschaften zerstört / von Erkenntnis zerfressen / im Grunde hat dieses Jahrhundert / den Planeten auf dem Gewissen / (…) / besorgniserregend wachsende Intelligenz / bei rapide sinkender Vernunft / plus die totale Pleite aller Werte / außer Kohle“83. Falkner unterlegt den Walter-BenjaminSatz – „Daß es so weitergeht, ist die Katastrophe“84 zuvor mit wiederholten Verweisen auf die vielfachen Zivilisationsbrüche im 20. Jahrhundert vom Holocaust bis zum Afghanistan-Krieg. Seine gegen Ende des Langgedichts resümierende Zivilisationsdiagnose ist daher alles andere als hoffnungsheischend, also eher zutreffend. Von dieser Diagnose her leuchtet ein, warum der Dichter den gesamten Gedichttext hindurch einen immensen Aufwand an intertextuellen Verweisen betreibt – der Sprecher selbst sieht sich ironisch gar „schikaniert / vom Reichspielungsantum der Sprache“85. Nun ist es nachgerade ein Spezifikum Falknerscher Dichtung, dass Traditionsnahmen offen und konzentriert ausgestellt werden. Hier aber werden sie essentieller Humus86. Es sind selbstredend die ganz Großen der Poesiegeschichte, die direkt oder indirekt als Stimme aufgenommen werden: Allen Ginsbergs „Howl“, Ezra Pounds „Cantos“, Mandelstam, Yeats, Hölderlin, Schwitters, Joyce, Shakespeare, Nabokov, Levy-Strauss, Goethe, Heine, Kleist, Pynchon, Shelley, Nietz- 12 sche, Rilke, Brecht… . Die Zitat- und Anspielungsdichte indiziert einen allerletzten humanen Selbstschutz vor den Anmutungen einer katastrophischen Moderne, die „das Grimm´sche Wörterbuch als Futter / für die neokannibalistische Festplatte“87 einspeist: „denn große Poesie / auch wo sie glücklich verwirrt / ist Marken und Moden abhold // in diesem Jahrhundert der Gewalt / und der Langeweile / in dem wir versucht haben / Jim Morrison nicht mit / Rainer Maria Rilke zu verwechseln“88. Aber Falkner ist nicht Kunert, dem noch jedes Bild zur Parabel bevorstehenden Untergangs gefriert. Er ist – erinnert sei an seinen Prosaband „Berlin - Eisenherzbriefe“ – auch stets ein Flaneur in der Nachfolge Baudelaires. Und so ist „Gegensprechstadt – ground zero“ auch eine Liebeserklärung an das Ost-West-Berlin der achtziger und neunziger Jahre, dem unwiederholbaren melting-pot von Chaosnormalität, Kreativitätsexplosion, Utopiereservoir und Geschichtsheillosigkeit: „Berlin, du bist die Stadt / die savoir-vice / die savoir-vibrer / und Anna Blume hat / du bist von hinten wie von gestern / bist von vorne aber wie von morgen / bist die Herrlichste von allen (…)“89 Dass Berlin diejenige der Weltstädte ist, die immer im Werden und nie im Sein ist, hat sich herumgesprochen, insofern war sie ideal geeignet, „der Zeit die Freiheit zu lassen, / einmal den Ort zu spielen“90. „Berlin beginnt immer mit den Worten: heute, Jetzt / und Hier bin ich“91, stellt das sprechende Ich fest, dem Berlin ergo „114% Gegenwart“92 wurde, allerdings erst nach dem Mauerfall, der die Zeitbeschleuniger anlaufen ließ: „zwanzig Jahre / hockte ich an den Lagerfeuern von Berlin / feuerte Drinks ab / und weinte ein Loch in den Boden / ich weinte um Gegenwart“93. Unablässig streift das Ich durch die Jetzt-Berlins mit Rigaer Straße, Dunckerstraße und Schönhauser Allee, mit dem „Tresor“ und „KitKatKlub“, Hansaviertel, Humboldthain 10, Yorckbrücken und Kreuzberg, ganz 114%, allgegenwärtig. Im Poem allerdings sind die „114%“ umgeben von Vergangenheitsverweisen: „vor der Wende / Berlin war noch nicht aufgerundet / auf seine 114% Gegenwart / (bei unverändertem Anteil an Geschichte)“94. Und so wird das Mauer-Berlin der achtziger Jahre erinnert („bis 89 war Berlin geteilt / in spra und che / überklebte Fotos / Schmauchspur der Geschichte “95), die anarchisch-hippe Zeit zwischen Mauerfall und Mitte der neunziger Jahre („alles in allem aber: / was für ein Aufruhr“96). In die Gegenwartsversessenheit schießt der Text immer wieder Erinnerungssignalements, die den Zusammenhang zwischen medialer Geschichtsvergessenheit und ausgegrenzten bzw. dämonisierten Diskursen vor Augen führen, hier die des Terrorismus: „Ich höre in Kreuzberg die Stimmen von Stammheim in Pankow die Stimmen von Entebbe in Moabit die Stimmen von Mogadischu in Mitte die Stimmen der Roten Armee in Dahlem am Schalter der American Embassy höre ich die Stimmen von ground zero (…)“97 Zugleich werden einfache Zusammenhangsbildungen auch wieder durchbrochen – „die Stimmen der Roten Armee“ meinen eben nicht nur die der RAF, sondern auch jene der Roten Armee, die in Berlin-Mitte 1945 dem „Dritten Reich“ den Todesstoß versetzte. Falkners Poem verteidigt die Rest-Souveränität eines reflektierenden, fühlenden Ich gegen den turbokapitalistischen Zurüstungssog im Realen und gegen die postmodernen Entleerungen von WerteGewichtungen im Philosophischen, oder wie es das Gedicht blitzhaft zu erhellen vermag: „ich singe das Selbst ist nicht das Gleiche / wie: das singe ich selbst.“98 In dieser Berufung auf Walt Whitman, dessen nobler Impetus schon zuvor Grund zur Trauer gab – „ich wartete / vor den Ufern der Stadt / bis sie Walt Whitman den letzten Grashalm / gezogen hatten“, kristalli- 13 siert sich die Intention des Poems in nuce: Indem sich die Sprache in ihrer „schroffen Existenz“ 99 offenbart, ermutigt sie Gegenwehr gegen die kapitalistischen Todesmaschinen, deren steuernde Matrizen unablässig unternehmen, Wahrnehmen, Denken und Sinne des Einzelnen zu bestimmen. Gerhard Falkners Poem tastet sich wie kaum ein anderes deutschsprachiges Gedicht der unmittelbaren Gegenwart an den Puls der Zeit, es besichtigt ein Jahrhundert und fragt nach der Verfasstheit des Menschen in ihm. Impulse aus dieser Arbeit hat der Dichter mit hinübergenommen in das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts: In das 2011 veröffentlichten Gedicht (kein Langgedicht)„Der letzte Tag der Republik“, das den Abriss des Palastes der Republik 2008 thematisiert, sind sie ganz sicher eingegangen: So, wenn die Zeit zum Subjekt erhoben wird, so, wenn der fortschreitende Verfall von Geschichtsbewusstsein konstatiert wird: „Es wird bleiben ein Loch in der Luft, so groß wie ein Schloss. Mit oben lauter antike Figuren. Und unten lauter Figuren mit keine Ahnung von Antike. Das Schloss wird sich schließen um den versunkenen Bau und die Zeit wird im Schloss den Schlüssel umdrehen bis der Schlüssel (mit der Zeit) das Schloss umdreht. Und immer so weiter. (…)“100 Das Gedicht endet mit einer sarkastisch-düsteren Prophezeiung, die freilich wieder einmal den Stand der Dinge auf den Punkt bringt – mit Falknerscher Eleganz: „Erst wenn die Wolken ins Gras beißen, wird dieses Stück Geschichte gegessen sein.“101 1 Ulf Stolterfoht, holzrauch über heslach, Basel 207. Paulus Böhmer, Am Meer. An Land. Bei mir., Ostheim/Rhön 2010. 3 Zsuzsanna Gahse, Donauwürfel, Wien 2010. 4 Alban Nikolai Herbst, Das bleibende Thier, Berlin 2011. 5 Walter Höllerer, Thesen zum langen Gedicht, in: Akzente 2, 1965, S. 128 – 130, hier S. 130. 6 Gerhard Falkner, so beginnen am körper die tage. gedichte und aufzeichnungen aus einem kalten jahr, Darmstadt, Neuwied 1981. 7 Gerhard Falkner, ich, bitte antworten, in: wemut, Frankfurt a.M. 1989, S. 149 – 158. 8 Ebenda, S. 158. 9 Ebenda, S. 159 – 166. 10 Ebenda, S. 149. 11 Ebenda, S. 49f.. 12 Ebenda, S. 150. 13 Ebenda, S. 152. 14 Ebenda. 15 Ebenda, S. 150. 16 Ebenda, S. 151. 17 Ebenda. 18 Ebenda, S. 154. 19 Ebenda. 20 Ebenda. 21 Martin Heidegger, Holzwege, Gesamtausgabe, Band 5, Drankfurt a.M., S. 310. 22 Gerhard Falkner, ich, bitte antworten, in: wemut, a.a.O., S. 155. 23 Ebenda, S. 155. 24 Ebenda. 25 Ebenda. 26 Ebenda. 27 Ebenda, S. 156. 28 Ebenda. 29 Ebenda, S. 157. 30 Ebenda, S. 158. 2 14 31 Ebenda. Brief an Max Born, 4. Dezember 1926, Einstein-Archiv 8-180, zitiert nach Alice Calaprice (Hrsg.): Einstein sagt, München, Zürich 1996, Seite 143. 33 Stéphane Mallarmé, Ein Würfelwurf, in: Mallarmé, Sämtliche Gedichte, Heidelberg 1984, S. 195. 34 Gerhart Falkner, n-a-c-h-w-o-r-t, in: wemut, a.a.O., S. 169. 35 Gerhard Falkner, ich sage null für ja und eins für nein, in: Gerhard Falkner, X-te Person Einzahl, Frankfurt a.M. 1996, S. 177 – 181. 36 Gerhard Falkner, Vom Unwert des Gedichts, Berlin 1993, S. 61. 37 Ebenda, S. 95. 38 Gerhard Falkner, ich sage null für ja und eins für nein, a.a.O., S. 181. 39 Ebenda, S. 177. 40 Ebenda, S. 179. 41 Ebenda, S. 180. 42 Ebenda. 43 Ebenda. 44 Ebenda. 45 Ebenda, S. 178. 46 Ebenda, S. 179. 47 Ebenda, S. 181. 48 Ebenda. 49 Ebenda. 50 Ebenda. 51 Ebenda, S. 179. 52 Ebenda, S., S. 181. 53 Gerhard Falkner, Ach; der Tisch (Zur Poesie des PoeDu), in: Gerhard Falkner, Endogene Gedichte, Köln 2000, S. 106 – 108. 54 Gerhard Falkner, Nachwort statt eines Nachworts, in: Ebenda, S. 118f.. 55 Gerhard Falkner, (47) Sätze gegen die Unruhe, in: Gerhard Falkner, Hölderlin Reparatur, Berlin 2008, S. 80. 56 Gerhard Falkner, Ach; der Tisch (Zur Poesie des PoeDu), in: Gerhard Falkner, Endogene Gedichte, a.a.O., S. 107 57 Ebenda, S. 108. 58 Ebenda. 59 Ebenda. 60 Gerhard Falkner, Ach; der Tisch (Zur Poesie des PoeDu), in: Gerhard Falkner, Endogene Gedichte, a.a.O., S. 107. 61 Gerhard Falkner, Anmerkungen, in: Ebenda, S. 117. 62 Gerhard Falkner, Gegensprechstadt – ground zero, Idstein 2005, S. 9. 63 Ebenda. 64 Ebenda, S. 80. 65 Alexander Kluge, Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, Filmtitel, Drehbuch 66 Gerhard Falkner, Gegensprechstadt – ground zero,a.a.O., S. 46. 67 Ebenda, S. 73. 68 Ebenda, S. 18. 69 Ebenda, S. 16. 70 Ebenda, S. 52. 71 Ebenda, S. 75. 72 Ebenda, S. 73. 73 Ebenda. 74 Ebenda, S. 12. 75 Ebenda, S. 22. 76 Ebenda, S. 53. 77 Ebenda, S. 38. 78 Ebenda, S. 74. 79 Ebenda, S. 52. 80 Vgl. Ebenda, S. 75. 81 Ebenda, S. 79. 82 Ebenda, S. 67. 83 Ebenda, S. 69. 84 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften. Bd. I, 2, S. 683. 85 Gerhard Falkner, Gegensprechstadt – ground zero, a.a.O., S. 14. 32 15 86 Vgl. Ebenda, S. 74. Ebenda, S. 61. 88 Ebenda, S. 36f. 89 Ebenda, S. 38. 90 Ebenda, S. 9. 91 Ebenda, S. 42. 92 Ebenda, S. 25. 93 Ebenda, S. 20. 94 Ebenda, S. 25. 95 Ebenda, S. 54. 96 Ebenda, S. 42. 97 Ebenda, S. 50. 98 Ebenda, S. 61. 99 Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt a. M., 1971, 365f. 100 Gerhard Falkner /Reynold Reynolds: Der letzte Tag der Republik, Nürnberg 2011, S. 78. 101 Ebenda. 87