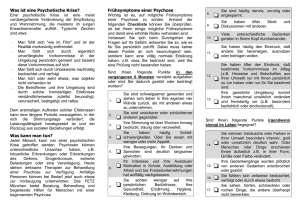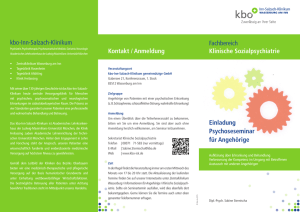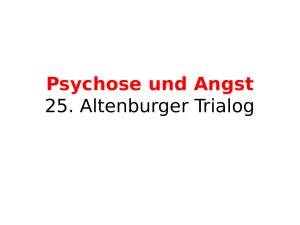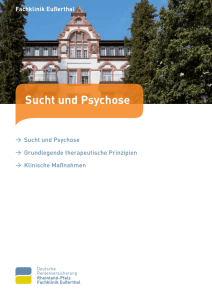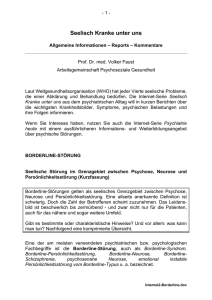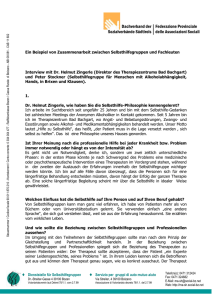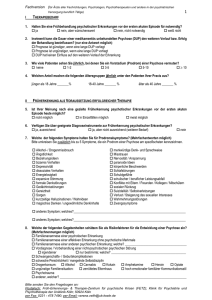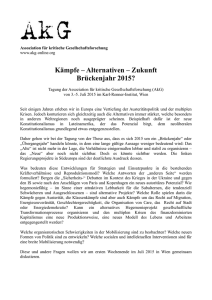Ruth Fricke
Werbung
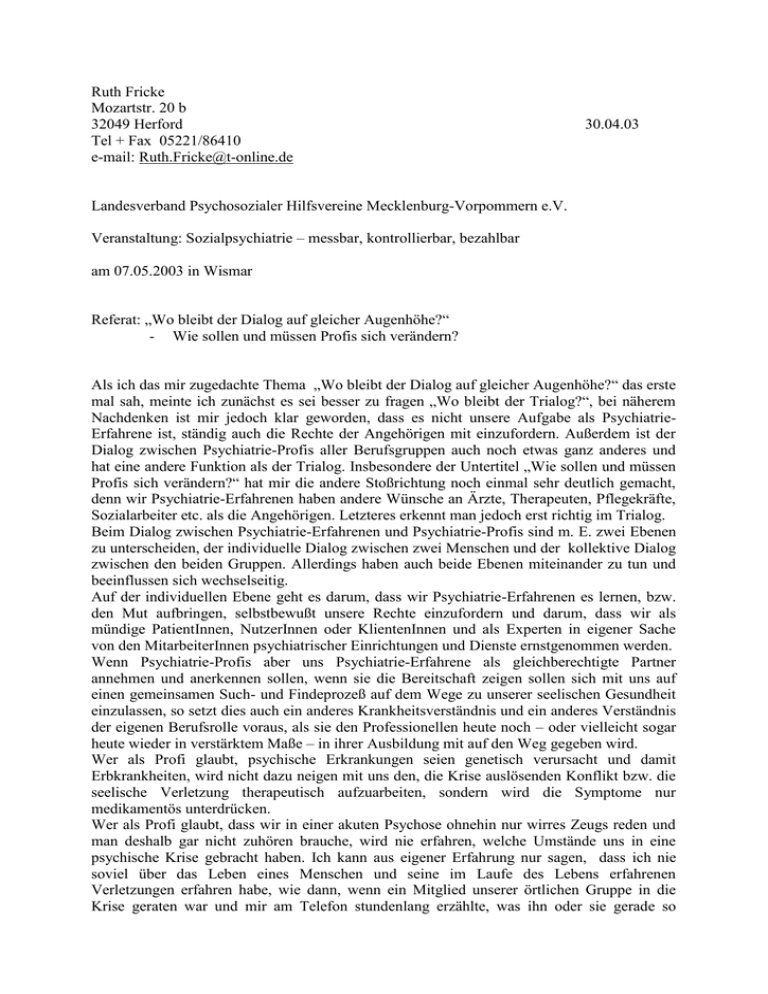
Ruth Fricke Mozartstr. 20 b 32049 Herford Tel + Fax 05221/86410 e-mail: [email protected] 30.04.03 Landesverband Psychosozialer Hilfsvereine Mecklenburg-Vorpommern e.V. Veranstaltung: Sozialpsychiatrie – messbar, kontrollierbar, bezahlbar am 07.05.2003 in Wismar Referat: „Wo bleibt der Dialog auf gleicher Augenhöhe?“ - Wie sollen und müssen Profis sich verändern? Als ich das mir zugedachte Thema „Wo bleibt der Dialog auf gleicher Augenhöhe?“ das erste mal sah, meinte ich zunächst es sei besser zu fragen „Wo bleibt der Trialog?“, bei näherem Nachdenken ist mir jedoch klar geworden, dass es nicht unsere Aufgabe als PsychiatrieErfahrene ist, ständig auch die Rechte der Angehörigen mit einzufordern. Außerdem ist der Dialog zwischen Psychiatrie-Profis aller Berufsgruppen auch noch etwas ganz anderes und hat eine andere Funktion als der Trialog. Insbesondere der Untertitel „Wie sollen und müssen Profis sich verändern?“ hat mir die andere Stoßrichtung noch einmal sehr deutlich gemacht, denn wir Psychiatrie-Erfahrenen haben andere Wünsche an Ärzte, Therapeuten, Pflegekräfte, Sozialarbeiter etc. als die Angehörigen. Letzteres erkennt man jedoch erst richtig im Trialog. Beim Dialog zwischen Psychiatrie-Erfahrenen und Psychiatrie-Profis sind m. E. zwei Ebenen zu unterscheiden, der individuelle Dialog zwischen zwei Menschen und der kollektive Dialog zwischen den beiden Gruppen. Allerdings haben auch beide Ebenen miteinander zu tun und beeinflussen sich wechselseitig. Auf der individuellen Ebene geht es darum, dass wir Psychiatrie-Erfahrenen es lernen, bzw. den Mut aufbringen, selbstbewußt unsere Rechte einzufordern und darum, dass wir als mündige PatientInnen, NutzerInnen oder KlientenInnen und als Experten in eigener Sache von den MitarbeiterInnen psychiatrischer Einrichtungen und Dienste ernstgenommen werden. Wenn Psychiatrie-Profis aber uns Psychiatrie-Erfahrene als gleichberechtigte Partner annehmen und anerkennen sollen, wenn sie die Bereitschaft zeigen sollen sich mit uns auf einen gemeinsamen Such- und Findeprozeß auf dem Wege zu unserer seelischen Gesundheit einzulassen, so setzt dies auch ein anderes Krankheitsverständnis und ein anderes Verständnis der eigenen Berufsrolle voraus, als sie den Professionellen heute noch – oder vielleicht sogar heute wieder in verstärktem Maße – in ihrer Ausbildung mit auf den Weg gegeben wird. Wer als Profi glaubt, psychische Erkrankungen seien genetisch verursacht und damit Erbkrankheiten, wird nicht dazu neigen mit uns den, die Krise auslösenden Konflikt bzw. die seelische Verletzung therapeutisch aufzuarbeiten, sondern wird die Symptome nur medikamentös unterdrücken. Wer als Profi glaubt, dass wir in einer akuten Psychose ohnehin nur wirres Zeugs reden und man deshalb gar nicht zuhören brauche, wird nie erfahren, welche Umstände uns in eine psychische Krise gebracht haben. Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass ich nie soviel über das Leben eines Menschen und seine im Laufe des Lebens erfahrenen Verletzungen erfahren habe, wie dann, wenn ein Mitglied unserer örtlichen Gruppe in die Krise geraten war und mir am Telefon stundenlang erzählte, was ihn oder sie gerade so bewegte, fertigmachte, ja aus der Bahn warf. Menschen, die in der Gruppe kein Interesse daran gezeigt hatten mit dem Vorsorgebogen zu arbeiten, die eigenen Frühwarnzeichen aufzuspüren und im Erfahrungsaustausch mit Mitbetroffenen unter der Fragestellung „Was tut mir gut?“ und „Was tut mit nicht gut? Welche Situationen sollte ich lieber meiden?“ das aufzuspüren was sie krank gemacht und aus der Bahn geworfen hat, redeten in der Krise plötzlich wie ein Wasserfall. Alle Verletzungen, die sie in Jahrzehnten erfahren hatten, darunter auch Traumata, die ihnen die Psychiatrie zugefügt hatte, brachen plötzlich aus ihnen heraus. Und mir wurde klar, hier haben sich im Laufe des Lebens so viele Traumata übereinander gepackt, dass sie kaum noch entwirrbar sind und der Alltag nur noch dann halbwegs bewältigt werden kann, wenn man das alles möglichst weit wegpackt und gar nicht mehr dran rühren will. Nur in der akuten Psychose kommen die Dinge wieder an die Oberfläche, die man in stabilen Zeiten verdrängt hat, die irgendwo eingekapselt schlummern und immer dann wieder wie ein Vulkanausbruch aus dem Unterbewußtsein nach außen drängen, wenn eine Situation an die Ursprungsverletzung – das Ursprungstrauma – erinnern. Die Menschen sind dann gar nicht zu stoppen. Es sprudelt nur so aus Ihnen heraus und dies mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ich selbst habe bei den ersten dieser Gespräche den Fehler gemacht, nachzufragen, weil mir irgendetwas nicht ganz klar war. Aber bis ich soweit war mich soweit in das Problem hinein zu denken, dass ich eine auf Problemlösung zielende Frage stellen konnte, war mein Gesprächspartner schon längst beim übernächsten Problem. Mir ist dann ein Erlebnis eingefallen, welches ich in meiner ersten Psychose hatte: Ich habe die Vögel in Zeitlupe fliegen sehen. Selbstverständlich sind die Vögel nicht in Zeitlupe geflogen, aber diese meine damalige Wahrnehmung verdeutlicht doch, wie rasend schnell wir in der akuten Krise sind. Dies erklärt auch unsere Ungeduld in dieser Phase. Weil wir selbst so schnell mit unseren Gedanken und Erkenntnissen sind, glauben wir , dass andere uns nicht oder nicht schnell genug helfen wollen. Diese Erkenntnis hat mich dazu gebracht, dass ich in vergleichbaren Fällen nur noch zugehört habe und das erworbenen Wissen später genutzt habe, um mit dem Betroffen über sein Leben zu reden, um so nach und nach die verschütteten Schichten in gesunden Zeiten wieder ins Bewußtsein zu rücken. Ein dem Ursprungstrauma ähnliches Erlebnis wirkt also als trigger (Auslöser) für eine erneute Psychose. Diese könnte vermieden werden und damit auch das was Profis Chronifizierung nennen, wenn das Ursprungstrauma bei Erstmanifestation richtig aufgearbeitet worden wäre. Wer als Profi meint, er habe die alleinige Definitionsmacht und er müsse auf alles eine richtige Antwort haben, wird nie eine demokratischen und gleichberechtigten Umgang mit seinen Patienten oder Klienten pflegen können. Profis und hier insbesondere Ärzte und Therapeuten müssen, den Mut haben zu sagen, dass auch Sie nur auf der Suche nach einer richtigen Lösung sind, dass ein Rat nur eine Vorschlag ist, von dem auch sie nicht genau wissen, ob er zur Problemlösung führt. Sie müssen klar machen, dass man sich auf einem gemeinsamen Such- und Findeprozeß befindet, dass es das einfache Rezept „man nehme“ und dann ist alles wieder gut nicht gibt. Sie müssen auch sagen / zugeben wenn sie hilflos sind, wenn ihnen eine Situation Angst macht. Viele Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie passieren nur deshalb, weil der behandelnde Arzt unsicher ist und Angst hat, nicht mehr Herr der Lage zu sein, nicht weil der Patient wirklich fremd- oder selbstgefährdend wäre. Der einfache Satz „Sie machen mir Angst:“ würde die Situation total verändern, die Situation entspannen und den Weg für Lösungen frei machen, mit dem beide Arzt und Patient besser leben könnten. Dieser schlichte, einfache Satz würde Vertrauen schaffen, Zwangsmaßnahmen dagegen bewirken eine zusätzliche Traumatisierung und sie zerstören genau das Vertrauen was gebraucht wird, damit man gemeinsam nach dem jeweils sehr individuellem Weg zur Wiedererlangung seelischer Stabilität suchen kann. Eigene Ängste und Hilflosigkeit zuzugeben ist keine Schwäche, im Gegenteil, dazu gehört wahre Größe! Gerade der demokratische und gleichberechtigte Umgang in der Arzt Patienten Beziehung ist entscheidend für einen möglichen Genesungsprozess. Die erlebten seelischen Verletzungen und die daraus resultierende psychische Krise, haben das Selbstbewußtsein der Betroffenen arg in Mitleidenschaft gezogen. Aufgabe von Psychiatrie-Profis aller Berufsgruppen muß es daher zuvörderst sein, das Selbstbewußtsein der Betroffenen zu fördern und (wieder) aufzubauen. Dies bedeutet dass alle Behandlung, Therapie und sonstige Hilfen sich ressourcenorientiert und nicht defizitorientiert ausgerichtet sein müssen. Im Mittelpunkt darf nicht die Frage stehen was kann dieser Mensch nicht oder nicht mehr, sondern was kann dieser Mensch, was kann er vielleicht sogar besser als viele andere. Denn Erfolge und Anerkennung stärken Selbstbewußt-sein. Selbstbewußtsein bewirkt eine Stärkung der seelischen Stabilität und gibt auch den Mut und die Kraft, die Hilfen selbst zu definieren und einzufordern, die man zeitweise oder evtl. auch dauerhaft benötigt. Jede professionelle Hilfe muß Hilfe zur Selbsthilfe sein, sie muß emanzipatorisch wirken und darauf hinzielen, dass der professionelle Helfer sich bezogen auf den Einzelfall selbst überflüssig macht. Hilfe, die den Betroffenen alles abnimmt, auch das was sie sehr gut selbst tun könnten ist keine wirkliche Hilfe. Sie schafft Abhängigkeiten und wirkt de facto als Entmün-digung auch wenn de jure keine Betreuung eingerichtet wurde. D.h. es ist nicht Aufgabe des Sozialarbeiters in der Teestube oder der Wohnbetreuung den Betroffenen die Knöpfe an die Jacke zu nähen, den Kaffee oder Tee zu kochen, für sie Anträge auszu-füllen etc. sondern ihnen zu zeigen wie es geht, solange bis sie es (wieder) alleine können. Ich möchte an einem kleinen Beispiel verdeutlichen was diese „Rundumsorglosversorgung“ aus einem Menschen machen kann und diese Beispiel steht für viele. Als wir in Herford mit unserer Selbsthilfegruppenarbeit anfingen war u. A. ein damals ca. 35jähriger Mann dabei – ich nenne in einmal Klaus -, der kurz vor seinem ersten Staatsexamen für das Lehramt der Sekundarstufe I seine erste Psychose bekommen hatte und seither voll in das psychiatrische Netz „integriert“ worden war – wahrscheinlich wäre es besser zu sagen er hatte sich darin verheddert -. Er arbeitete in einer WfB und ging nach Feierabend in den Klinkentreff und saß dort bis dort zugemacht wurde. In der WFB fühlte sich Klaus fehl an Platz und durch die Tätigkeiten dort total unterfordert, so dass er den Tag mehr mit hoch geistigen Gesprächen mit den dortigen Sozialarbeitern verbrachte, als Stückzahlen zu produzieren, wodurch sein Verdienst äußerst gering ausfiel. Wir haben viele Gruppenabende damit verbracht, zu überlegen ob er sein Studium wieder aufnehmen und abschließen könnte oder welche anderen beruflichen Perspektiven für Klaus sonst noch möglich wären. Wir tagten zu dieser Zeit Freitagsabends im Arbeitslosenzentrum. Da dort ab mittag offiziell geschlossen war, hatten wir eine Art Dauerbestellung für Getränke aufgegeben, die uns in den Tagungsraum gestellt wurden. Weil sich der Tagungsraum im 3. Stock befand, hatten wir es uns zur Gewohnheit werden lassen, auf dem Hof vor der Haustür so lange zu warten, bis alle da waren, um nicht immer wieder zum Tür öffnen nach unten gehen zu müssen. So sassen wir an einem lauen Sommerabend auf dem Mäuerchen vor dem Haus und Klaus sagte: „Es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wir statt der Kanne Kaffee eine Kanne Tee bekommen könnten.“ Ich antwortete: „ Das ist sicher kein Problem. Du müßtest dann nur nächsten Freitag vor 12.00 Uhr im Arbeitslosenzentrum anrufen, damit das geändert wird. Ich kann von der Schule aus nicht telefonieren, aber Du müßtest das von der Werkstatt aus doch regeln können.“ Was meinen Sie was unser Klaus geantwortet hat???? „Ach, so wichtig ist das nun auch wieder nicht.“ Was lernen wir aus dieser kleinen Episode???? M. E. Folgendes: In der Teestube, in der WfB braucht man nur einen Wunsch äußern, und schon flitzt der Sozialarbeiter, um selbigen zu erfüllen. Er ist sich dabei wahrscheinlich gar nicht dessen bewußt, dass er auf diese Weise die Betroffenen zum reinen Konsumverhalten und zur Unselbständigkeit erzieht. Am Ende dieses „Erziehungsprozesses“ haben die Betroffenen dann alles verlernt, was sie einmal gekonnt haben und der Hilfebedarf ist enorm gestiegen. Ich will nicht so bösartig sein zu sagen, dass dies eine bewußte Strategie zur Arbeitsplatzsicherung der Psychiatrieprofis ist, aber de facto wirkt dieser defizitorierte Ansatz so. Natürlich geht es einfacher und es ist weniger nervig, wenn man den Kaffee eben kocht oder den Knopf gerade mal annäht, als wenn man dies 99 mal zeigt und erklärt. Aber das „Tun für...“ ist eben keine Hilfe zur Selbsthilfe und ebnet eben nicht den Weg in ein wirklich selbständiges, unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Der Dachverband psychosozialer Hilfsvereinigungen hatte seine Jahrestagung im letzten Jahr unter das Motto gestellt „Der Chef bin ich!“ Nach der gerade erzählten Episode kommt man doch ins grübeln, wie das wohl gemeint war. – Der flitzende Sozialarbeiter, der alles für die Betroffenen tut, was dieser sehr gut selbst machen könnten und sie mit der „Rundumsorglosversorgung“ zur Unselbständigkeit zur Unselbständigkeit erzieht, oder wie??? – Und noch eins liegt mir am Herzen, wir sollten darauf verzichten unnötige Subkulturen aufzubauen. Was es in der Gemeinde an Angeboten gibt, sollte auch genutzt werden, möglichst schon von der Klinik aus. Warum müssen z.B. in der Ergotherapie der Klinik Seidenmalerei, Holzarbeiten etc. gemacht werden, wenn die VHS dies auch anbietet. Warum wird Sport und Gymnastik im Rahmen einer gesonderten Sporttherapie angeboten, warum nutzt man hier nicht die Angebote der örtlichen Sportvereine? Wäre es nicht ein besserer Schritt zur Integration diese Angebote zu nutzen??? Warum wird es immer noch häufig versäumt, bei Patienten, die im Erwerbsleben stehen, schon von der Klink aus die in allen Kreisen vorhandenen Außenstellen der Hauptfürsorgestellen – in NRW heissen sie psychosoziale Fachdienste – einzuschalten, um den bestehenden Arbeitsplatz zu erhalten? Warum verlieren immer noch viele Betroffene mit qualifizierter Berufsausbildung durch dieses Versäumnis ihren Arbeitsplatz und landen dann oft schon in jungen Jahren nach dilletantisch vorbereiteten Arbeitsversuchen in einer WfB oder in der Frührente? Findet hier nicht in Wahrheit erst eine teure Ausgliederung in eine statt, mit dem Ergebnis, dass mindestens eben so teure Wiedereingliederungsversuche kläglich scheitern müssen, wenn die betroffenen Menschen lange genug in der „Fast wie im richtigen Leben“ Subkultur mit „Rundumsorglosversorgung“ verbracht haben? Zum Schluß noch ein paar Worte zum kollektiven Dialog zwischen Psychiatrie-Profis und den Selbsthilfegruppen der Psychiatrie-Erfahrenen vor Ort. Ich würde mir wünschen, dass sowohl die niedergelassenen Psychiater als auch die Klinikärzte ihre Patienten zum regelmäßigen Besuch einer Selbsthilfegruppe ermuntern würden. Um vorurteilen oder Ängsten vorzubeugen: die Selbsthilfegruppen der Psychiatrie-Erfahrenen nehmen i.d.R. nicht für sich in Anspruch, professionelle Hilfe ersetzen zu wollen, aber sie stellen eine sinnvolle, m.E. sogar unverzichtbare Ergänzung zum professionellen Hilfesystem dar. Vor einem mündigen, aufgeklärten Patienten braucht doch wohl kein Arzt Angst haben, oder?? Ich kenne etliche Fälle, in denen sich Psychiatrie-Erfahrene erst gestärkt durch den regelmäßigen Besuch einer Selbsthilfegruppe dazu durchringen konnten eine Psychotherapie zu beginnen. Der Erfahrungsaustausch in den Selbsthilfegruppen trägt auch dazu bei, dass sich Betroffene rechtzeitig in Behandlung begeben, weil sie es gelernt haben in sich reinzuhorchen, ihre eigenen höchst individuellen Frühwarnzeichen entdeckt haben und sich ihr eigenes Krisennetz aufgebaut haben. Selbsthilfegruppen der Psychiatrie-Erfahrenen betreiben an vielen Orten auch eine sehr effektive Interessenvertretung, an etlichen anderen Orten wären sie dazu bereit, wenn man sie als Experten in eigener Sache denn nur z. B. bei psychiatrischen Planungspro-zessen, Konzeptionsentwicklungen oder Mitarbeiterfortbildungen mitwirken ließe. In meinem Heimatkreis wird z.B. derzeit der vollstationäre Bereich der psychiatrischen Abteilung des Kreisklinikums gebaut – der letzte Mosaikstein einer psychiatrischen Vollversorgung im Kreisgebiet -. Diese Klink ist wahrscheinlich die erste in Deutschland, die von Anfang an gemeinsam mit Vertretern der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen sowohl baulich als auch konzeptionell geplant wurde. Wir sind seit vielen Jahren in der PSAG aktiv, haben aus der PSAG heraus eine trialogisch besetzte trägerunabhängige Beschwerdestelle Psychiatrie gegründet, arbeiten im AK Pflegestandards der Klinik Lübbecke und in den Beiräten der westf. Klinik Gütersloh mit und sind dort seit Jahren in die Vorbereitung der Güterloher Fortbildungswoche sowie in die Mitarbeiterfortbildungen eingebunden. Ich will aber hier auch nicht verschweigen, dass es noch längst nicht überall aktive Selbsthilfegruppen der Psychiatrie-Erfahrenen gibt, so dass eine Interessenvertretung durch Psychiatrie-Erfahrene in Mitbestimmungsgremien auf den ersten Blick nicht möglich erscheint. Aber dafür das dies nur auf den ersten Blick so erscheint, bin ich selbst auch ein gutes Beispiel. Ich wurde eines Tages angesprochen, ob ich nicht Lust hätte mitzuarbeiten, man wolle in der Abteilung II der westf. Klinik einen Abteilungsbeirat einrichten und suche eine Patientenvertreterin. Ich sagte zu, fragte mich aber bald, für wen ich hier eigentlich spreche. Meine Mitarbeit im Beirat war für mich der Anlass mich nach Gleichgesinnten umzuschauen und den Versuch zu unternehmen eine Selbsthilfegruppe für PsychiatrieErfahrene zu gründen. So herum kann es eben manchmal auch gehen.