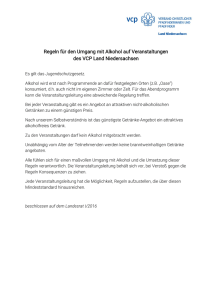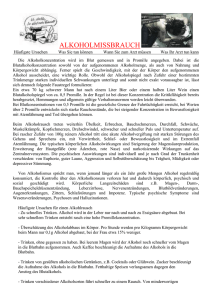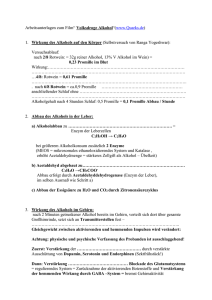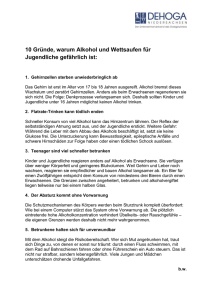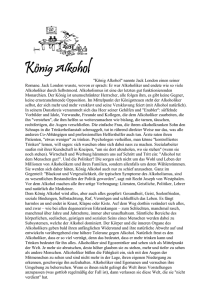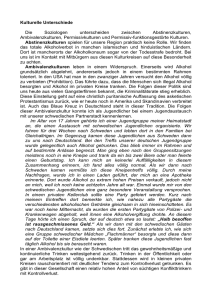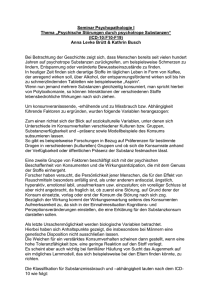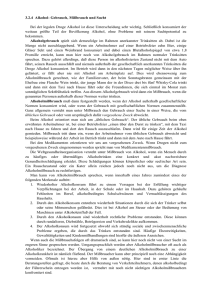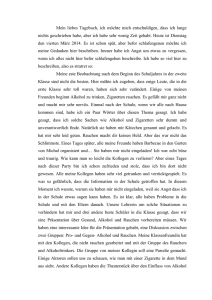2 Alkohol
Werbung
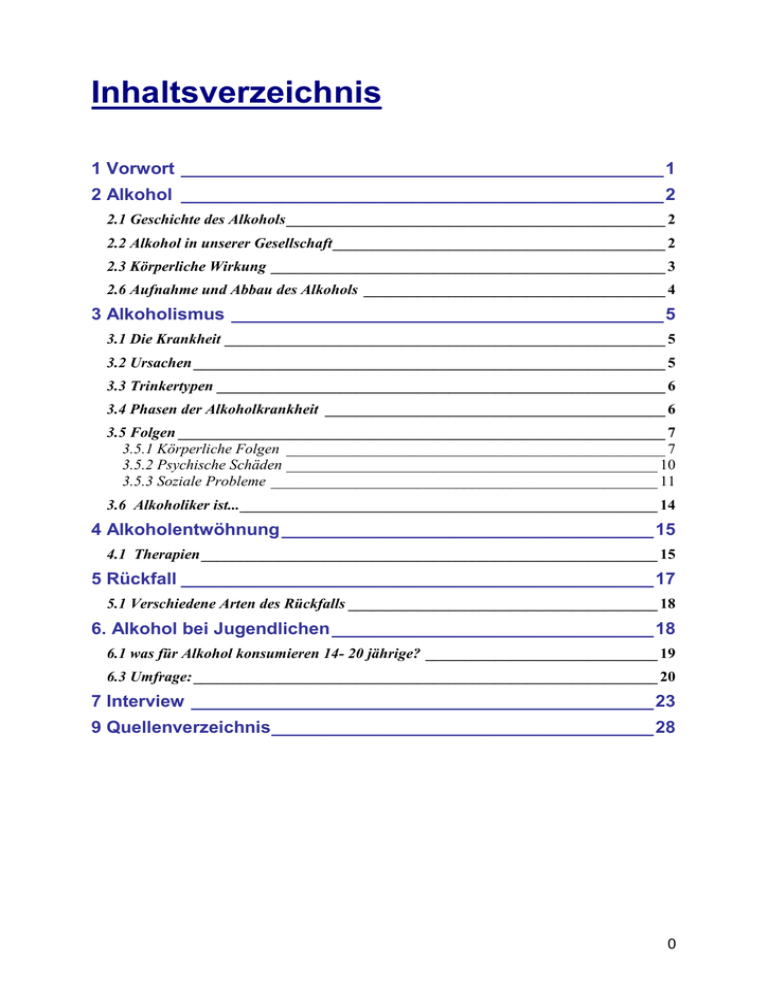
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ________________________________________________ 1 2 Alkohol ________________________________________________ 2 2.1 Geschichte des Alkohols _________________________________________________ 2 2.2 Alkohol in unserer Gesellschaft___________________________________________ 2 2.3 Körperliche Wirkung ___________________________________________________ 3 2.6 Aufnahme und Abbau des Alkohols _______________________________________ 4 3 Alkoholismus ___________________________________________ 5 3.1 Die Krankheit _________________________________________________________ 5 3.2 Ursachen _____________________________________________________________ 5 3.3 Trinkertypen __________________________________________________________ 6 3.4 Phasen der Alkoholkrankheit ____________________________________________ 6 3.5 Folgen _______________________________________________________________ 7 3.5.1 Körperliche Folgen _________________________________________________ 7 3.5.2 Psychische Schäden ________________________________________________ 10 3.5.3 Soziale Probleme __________________________________________________ 11 3.6 Alkoholiker ist...______________________________________________________ 14 4 Alkoholentwöhnung _____________________________________ 15 4.1 Therapien ___________________________________________________________ 15 5 Rückfall _______________________________________________ 17 5.1 Verschiedene Arten des Rückfalls ________________________________________ 18 6. Alkohol bei Jugendlichen ________________________________ 18 6.1 was für Alkohol konsumieren 14- 20 jährige? ______________________________ 19 6.3 Umfrage: ____________________________________________________________ 20 7 Interview ______________________________________________ 23 9 Quellenverzeichnis ______________________________________ 28 0 1 Vorwort Schon immer beschäftigte und interessierte mich das Problem Alkohol. Ich hätte jedoch nie gedacht, dass dieses mein Thema für mein Abschlussprojekt werden würde. Dieser Gedanke kam mir erst, als ich ein Vorstellungsgespräch in St. Urban hatte. Dort sah ich einen Film über das Leben eines Alkoholikers. Als ich mir nach diesem Film so Gedanken über den Alkohol machte, wurde mir bewusst, dass dies ein großes Gesellschaftsproblem ist. Viele Leute sind sich der Gefahr gar nicht bewusst oder wollen dies nicht wahrhaben. Über das Thema Alkohol könnte man natürlich unendlich viel schreiben. Ich habe mich am Anfang für vier verschiedene Hauptthemen entschieden. Dies war eine gute Grundlage, auf dem ich mein Projekt aufbauen konnte. Im Internet fand ich viele gute Informationen, die ich für meine Arbeit nutzen konnte. Auch verschiedene gute Bücher und Prospekte habe ich gefunden. Beim Internet musste ich immer aufpassen, dass ich mich nicht ganz verlor und stundenlang herumsurfte. Ein anderes Problem war auf jeden Fall auch, dass verschiedene Seiten unterschiedliche Werte hatten. Ich legte mich einfach auf die Statistiken und Zahlen fest, die auf Seiten standen, wo wirklich seriös zu sein schienen. Auch wollte ich unbedingt einen Therapeuten interviewen, was ich am Dienstag dem 8. März 2005 durchführen konnte. In dieser Hinsicht möchte ich dem Stationsleiter von St. Urban Christoph Bänder meinen herzlichen Dank aussprechen. Auch eine Schülerumfrage war eines meiner Ziele. Allen die sich Zeit nahmen, um mir einen solchen Fragebogen auszufüllen, vielen Dank. Frau Werro meine Lehrerin im Projektunterricht, war mir mit ihren wertvollen Tipps und Gesprächen eine sehr große Stütze. Auch Ursina Wittwer die ebenfalls ein Projekt über Alkohol macht, hatte mir durch Angaben von guten Informationsquellen viel geholfen. Alle die mir in irgend einer Weise geholfen haben und mich unterstützten, möchte ich ganz herzlich danken. Sie haben mir diese Arbeit ermöglicht. 1 2 Alkohol Setzt man einer Katze oder einem Hund Cognac vor, dann verkriecht sich das Tier. Tiere haben noch den Instinkt, dass dies Gift ist und verhalten sich danach. Auch wir Menschen haben diesen Instinkt, doch wir leben nicht mehr danach. An Bier- und Weingeschmack kann man sich vielleicht gewöhnen, an Schnaps gewöhnt sich keiner. Da kann einer zwanzig Jahre in seinem Leben getrunken haben, er schüttelt sich immer wieder beim ersten Schnaps. Die Natur ist wach in uns und zeigt uns, was richtig ist. Beim zweiten, dritten Schnaps erst sagen die Leute, es schmeckt, es schmeckt eigentlich immer noch nicht, der Geschmack des Getränks hat sich ja nicht geändert, sondern die Geschmacksnerven sind betäubt. So schnell wirkt der Alkohol auf das Gehirn ein. Was dann ein Mensch in sich hineinkippt, dafür hat er kein Gefühl mehr. Es ist, als ob sie alle Sand und Wasser in die (menschliche) Maschine schütten und sich dann noch wundern, wenn diese nicht mehr läuft. _Wir wundern uns oft, wie lange sie läuft. Da hat es jedes Auto besser: Stundenlang können die Männer ihre Autos pflegen. Da wird Öl gewechselt, da wird geschmiert. Für das Auto, für diese Maschine wird alles getan. Das Auto hätte bei einer alkoholischen Behandlung längst gestreikt. 2.1 Geschichte des Alkohols Alkohol gibt es nicht erst seit 10 Jahren. Die Wurzeln dieses Getränks hegen schon weit zurück. Jahrtausendelang waren alkoholische Getränke das tägliche Hauptgetränk des Menschen. Wie selbstverständlich dienten sie als Durstlöscher und wegen ihres hohen Kaloriengehalts, oft auch als Nahrungsmittel. Ihre Bedeutung als hauptsächliche Flüssigkeitsquelle für den Menschen, erklärt sich u.a. durch eine Umwelt, in der die Menschen nur schwer sauberes Trinkwasser gewinnen bzw. darüber verfügen konnten. Als die Menschen langsam sesshaft wurden, begannen sie mit der bewussten Herstellung von einer Art Bier, besonders in Gebieten mit reichlicher Getreideernte, wo der erste Schritt mit der Vergärung der Weizen oder Gersten bereits vorhanden war. Auch die süßen Trauben eigneten sich hervorragend zum Vergären. Fachleute vermuten, dass die ersten Rebberge für die gezielte Weinherstellung vor ca. 8'000 Jahren in Armenien stattfanden. Um Christi Geburt war vor allem der Wein bekannt. Spezielle Feste wie Hochzeiten, wurden damals schon mit Wein begossen. In der Bibel können wir von der Hochzeit zu Kanaa lesen, wie Jesus sechs volle Wasserkrüge in Wein umwandelte. Im Laufe der Entwicklung des Alkohols, entstand eine "gesellschaftliche Trennung" des Weines und des Bieres. Der Wein war besonders den Reichen vorbehalten. Er war edler und teurer. Das Bier breitete sich mehr beim einfachen Volk aus. Um das 12. Jahrhundert entdeckten die Mediziner die Wirkung des Alkohols für ihre Arbeit als schmerzstillendes Mittel für die Vernichtung von Bakterien und als Aufbewahrungsflüssigkeit. 2.2 Alkohol in unserer Gesellschaft Der Alkohol hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Bei den meisten Anlässen werden alkoholhaltige Getränke serviert. Besonders gerne trinkt die Schweizer Bevölkerung während gemütlichen Stunden und zum Essen. Auch im Ausgang gehört Alkohol dazu. In jeder Bar, jedem Restaurant wird Alkohol mit meist 2 verlockenden Namen ausgeschenkt. Oft dient er dabei zum Unterstreichen oder zum Verbessern der Stimmung. Bei vielen Veranstaltungen kann man den Alkohol gar nicht mehr wegdenken. Wie würden zum Beispiel die meisten Fasnächtler diese Zeit ohne Bier, Schnäpse und all die "Hausmittelchen“ überstehen? Eine Tradition, welche eine (eigene) Trinkkultur aufgebaut hat. Teilweise wird jedoch die Wirkung auch benützt, um die Sorgen zu vergessen und ausgelassen zu feiern. Wie wir alle wissen, können wir unsere Probleme für einen Abend im Alkohol ertränken und durch ihn eine gelöste Stimmung gewinnen. Für jeden Geldbeutel gibt's ein preiswertes, alkoholisches Getränk. Bier, Wein und Spirituosen bieten die Verkäufer in allen möglichen Varianten an. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Deswegen darf es uns auch nicht wundern, dass die reiche Schweiz einen sehr hohen Alkoholkonsum aufzeigt. Seit den 80er Jahren ist der Konsum der alkoholischen Getränke jedoch stetig gesunken. Eine angetrunkene Person kann in ihrem Zustand nicht mehr ihren eigentlichen Charakter zum Vorschein bringen, sie ist in ihrer Persönlichkeit verändert- Das zeigt uns, dass wir den Alkohol zu den Drogen zählen können. Und weil er legal überall erhältlich ist, sobald man das 18. Lebensjahr gefeiert hat (beim Bier bereits ab 16 Jahren), ist der Übername "Volksdroge Nummer l" sicherlich auch berechtigt. 2.3 Körperliche Wirkung Ein geringer Alkoholkonsum kann sich schützend auf die Entwicklung von bestimmten Herz-Kreislauf-Krankheiten auswirken. Eher älteren Menschen wird daher bis höchstens ein Standardglas pro Tag empfohlen. Doch die Gesundheit kann mit guter Ernährung und Bewegung genau so gefordert werden. Ein Standardglas entspricht dem, was in einem Restaurant pro Glas ausgeschenkt wird. Bier 1 Standartglas = 3 dl (ca. 12 g) Wein 1 Standartglas = 1.5 dl (ca. 12 - 15 g) Schnaps 1 Standartglas = 0.2 dl (Ca. 7 g) Likör 1 Standartglas = 0.5 dl (ca. 10 - 14 g) 3 Bei 0,3 - 0,5 Promille verschwinden die Hemmungen, die Angst und die Spannungen. Es verbessert sich die Stimmung und das Selbstvertrauen erhöht sich zunehmend. Die Muskelkontrolle gerät bei etwa 1 Promille sehr fest ins Schwanken und das erhöhte Selbstvertrauen greift in Selbstüberschätzung über. Die ersten Sehstörungen machen sich bemerkbar. Jetzt, bei 2 Promille, sind die Sinnesfunktionen stark herabgesetzt. Auch das Sehvermögen und das Gehör sind sehr geschwächt. Die "gute Stimmung" kann sich in Reizbarkeit, Ärger oder Zorn umschlagen. Bei 4 Promille sind die Muskelbewegungen völlig außer Kontrolle und das Kleinhirn ist gelähmt. Die Schließung des Darms und der Blase funktionieren nicht mehr. Bald darauf wird das verlängerte Rückenmark gelähmt und die Atmung und der Puls können nicht mehr kontrolliert werden, worauf der Tod eintritt. 2.5 Wie kann ich die Promille berechnen? Für die Berechnung Ihrer Blutalkohol-Konzentration gibt es eine Formel, die jedoch nur einen rechnerischen Annährungswert darstellt. In Wirklichkeit hängt die Blutalkohol-Konzentration von einer ganzen Reihe von Faktoren ab wie z.B. - von der Art und Menge des Getränkes, das Sie eingenommen haben - von Ihrem Körpergewicht, Geschlecht und Körperbau - von der Geschwindigkeit des Alkoholabbaus - von Trinkverlauf (in welchem Zeitraum haben Sie den Alkohol getrunken?) Berechnung der Promille Männer Getrunkene Menge Alkohol in Gramm Körpergewicht in kg x 0.7 Frauen Getrunkene Menge Alkohol in Gramm Körpergewicht in kg x 0.6 - Das Resultat ist die Blutalkohol-Konzentration in Promillen 2.6 Aufnahme und Abbau des Alkohols Alkohol wird im gesamten Magen-Darm -Trakt aufgenommen. Dies beginnt bereits in der Mundschleimhaut. Der dort aufgenommene Alkohol geht direkt ins Blut und wird damit über den gesamten Körper einschließlich des Gehirns verteilt. Der im Darm aufgenommene Alkohol gelangt dagegen zunächst mit dem Blut in die Leber, wo er teilweise abgebaut wird. Die Alkoholaufnahme wird durch Faktoren 4 beeinflusst. Bei Wärme zum Beispiel wird sie verschnellert bei Fett dagegen verlangsamt. Etwa 5 Prozent des Alkohols werden über Urin, Schweiß und Atemluft ausgeschieden. In einer Stunde werden zwischen 0,1 und 0,15 Promille des giftigen Stoffes abgebaut. Wenn 1 Promille Alkohol im Blut ist, dauert es ca. 10 Stunden, bis der Alkohol vollständig abgebaut ist! Bei Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen dauert der Abbau länger! 3 Alkoholismus "Warum trinkst du?“ „Weil ich mich schäme“. „Warum schämst du dich?“ „Weil ich trinke.“ (Aus dem Buch „Der kleine Prinz“) 3.1 Die Krankheit Früher galten die Alkoholiker als willensschwach, charakterlos und unkontrolliert. Und diejenige, die dem Alkohol vollkommen verfallen waren, steckte man in eine Irrenanstalt. Erstmals wurde Alkoholismus im Jahre 1774 von dem amerikanischen Arzt Benjamin Rush als Krankheit des Willens beschrieben. Doch an diese These glaubte man noch lange nicht. Es brauchte sehr viel Zeit, bis die Ärzte Alkoholismus als Krankheit akzeptierten. 1942 entwickelte E.M.Jellinek erstmals ein KrankheitsModell der Alkoholabhängigkeit. Seit 1968 ist Alkoholismus endlich gesetzlich als Krankheit anerkannt. Die Betroffenen haben Anspruch auf eine Behandlung. Trotzdem werden Alkoholprobleme in der heutigen Gesellschaft immer noch als schuldhaftes Fehlverhalten abgestempelt. Man schätzt, dass in der Schweiz 300`000 alkoholkranke Menschen leben. Aber es könnten noch viel mehr sein. Registriert werden nur jene Menschen, die einen Entzug in der Klinik oder in einer ambulanten Therapie gemacht haben. Alle, die den Ausstieg ohne fremde Hilfe geschafft haben, werden nirgends erfasst. Deswegen ist dies eine grobe Schätzung. Mindestens doppelt so viele leiden unter den Auswirkungen des Alkoholismus (Ehepartner, Kinder, Verwandte, Bekannte). Also fast jeder zehnte Schweizer ist direkt oder indirekt vom Alkoholismus betroffen! 3.2 Ursachen Was die genauen Ursachen des Alkoholismus sind, kann man nicht genau sagen. Hier spielen wiederum verschiedene Faktoren eine Rolle. Selbst die Alkoholkranken wissen nicht immer, welches jetzt genau der ausschlaggebende Punkt für ihre Sucht ist. 5 Ursachen können Probleme in der Familie sein (Fehlende Liebe der Eltern, Streit, Todesfälle, Missbrauch ... ), am Arbeitsplatz (Stress, schlechte Arbeitsbedingungen, fehlende Integration ... ) oder von persönlicher Natur (Konfliktunfähigkeit, Beziehungsunfähigkeit ... ). Dabei tritt meistens das „Trinken um die Sorgen zu vergessen“ auf. Aber auch die gesellschaftlichen Verhältnisse spielen eine Rolle. Besonders die Trinksitten eines Landes, einer Religion oder einer Gesellschaft haben Einfluss auf die Alkoholabhängigkeit. In einem Land, wo zum Mittagessen und zum Abendessen Wein oder Bier getrunken wird oder wo das Wetttrinken mit alkoholischen Getränken als Pflicht zum Erwachsenwerden gehört (wie beim Volk der Truk auf den Südseeinseln), ist der Missbrauch viel höher, als in religiösen Ländern, wo der Alkohol durch ihren Glauben verpönt ist. Auch die Trinksitten des Kollegenkreises spielen eine Rolle. Dort tritt häufig das Trinken als Gruppenzwang auf. 3.3 Trinkertypen Konflikttrinker (Alpha-Trinker) Die Konflikttrinker nehmen den Alkohol zur Überwindung seelischer Spannungszustände und Minderwertigkeitsgefühle zu sich. Sie sind vom Alkohol nur psychisch abhängig und verlieren, zunächst jedenfalls, kaum die Kontrolle über das Trinken. Gelegenheitstrinker (Beta-Trinker) Die Gelegenheitstrinker, weder psychisch noch physisch vom Alkohol abhängig, berauschen sich nur an besonderen Anlässen, z.B. an festlichen Ereignissen oder in Gesellschaften. Süchtiger Trinker (Gamma-Trinker) Die süchtigen Trinker (oft zuerst Konflikttrinker) sind körperlich und geistig alkoholabhängig. Sie trinken, zumindest teilweise, unkontrolliert. Phasen mit geringem und selbst ohne Alkoholkonsum können bei ihnen mit Phasen des völligen Kontrollverlustes ( etwa in Problemsituationen) abwechseln. Gewohnheitstrinker (Delta-Trinker) Die Gewohnheitstrinker nehmen Alkohol regelmäßig und bei deutlicher physischer Abhängigkeit. Sie haben aber meistens keinen Kontrollverlust. Quartalstrinker (Epsilon-Trinker) Der Quartalstrinker hat auch, wie beim Gamma- Trinker verschiedene Phasen. Nach einer Phase der Trockenheit, folgt meist eine Phase mit großem Trinkzwang und völligem Kontrollverlust. Er ist meistens physisch vom Alkohol abhängig. 3.4 Phasen der Alkoholkrankheit Der ganze Verlauf der Alkoholkrankheit wird in vier Phasen (nach Jellinek) unterschieden: 6 Voralkoholische Phase Diese Phase bezieht sich auf die landesüblichen Trinksitten wie Alkohol beim Essen, während gemütlichen Stunden, im Ausgang usw. Die meisten Menschen verbleiben immer in dieser Phase. Solchen Alkoholkonsum nennen wir auch „normal“. Hier ahnt auch noch keiner von uns, dass gerade er vielleicht mal Probleme mit dem Alkohol haben könnte. Deswegen wird kaum darüber gesprochen. Aber einige setzten den Weg in Richtung Alkoholmissbrauch fort. Sie beginnen immer mehr zu trinken. Für sie zählt jetzt die Wirkung des Alkohols und nicht mehr der Genuss. Die Steigerung der Trinkmenge fährt geradezu zur Anfangsphase. Anfangsphase Hier wird der Alkoholgefährdete zum Alkoholabhängigen. Es werden Gelegenheiten gesucht, um Alkohol zu trinken. Auch „heimliches Trinken“ kann ab jetzt auftreten. Die Gedanken kreisen oft um Alkohol und der Betroffene wird durch seinen hohen Alkoholkonsum verunsichert, was wiederum zum Trinken führt. Die Kontrolle über den Alkohol geht langsam verloren und die Sucht beginnt. Kritische Phase Jetzt beginnt der Alkoholsüchtige sein Trinken zu rechtfertigen. Es werden Gründe und Erklärungen gesucht. Immer mehr Freizeitbeschäftigungen werden vernachlässigt und man beginnt den Alkohol vor dem Partner zu verstecken und zu verheimlichen. So kann es auch zu Konflikten am Arbeitsplatz kommen. Die Freunde ziehen sich zurück. Sie können dem Alkoholkranken nichts mehr sagen. Das häufige Trinken weitet sich aus, indem der Abhängige bereits am Morgen nach dem Aufstehen Alkohol zu sich nehmen muss. Sobald der Alkohol abgesetzt wird, treten verschiedene Entzugserscheinungen auf (zittern, schwitzen), "Neben der psychischen Abhängigkeit hat der Kranke jetzt auch die körperliche Abhängigkeit entwickelt. Chronische Phase Die chronische Phase kennzeichnet das letzte Stadium der Alkoholkrankheit. Jetzt setzen oft tagelange Rauschzustände ein, wobei die Schädigung des Gehirns nicht lange ausbleibt. Der Alkoholkranke trinkt mit Personen, die unter seinem Niveau sind, d.h. mit solchen er vorher nicht an einen Tisch gesessen wäre. Auch wird versucht, mit allen Mitteln an Alkohol zu kommen. Das Erklärungssystem des Schwerkranken bricht zusammen und er gesteht die Machtlosigkeit dem Alkohol gegenüber. Es folgen jetzt mehrere seelische Zusammenbrüche. Achtung Hier muss noch beigefügt werden, dass nicht alle Alkoholkranken alle vier Phasen durchlaufen. Viele merken früher, dass der Alkohol für sie ein Problem darstellt und begeben sich in Behandlung oder schaffen es alleine Auch die Dauer der einzelnen Phasen kann nicht mit einer Zeitangabe festgehalten werden 3.5 Folgen 3.5.1 Körperliche Folgen Alkoholiker sind in erhöhtem Masse von einer Vielzahl gesundheitlicher Schädigungen bedroht. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO haben die alkoholbezogene Krankheiten den ersten Platz in ihrer Häufigkeit erreicht. 7 Alkoholkonsum kann auf dreierlei Weise, einzeln oder in Kombination, Gewebe zerstören Erstens: Alkohol und seine Abbauprodukte können eine zerstörende Wirkung auf die Zellen und das Gewebe haben. Zweitens: Viele Alkoholiker nehmen zu wenig oder gar keine nahrhaften Speisen zu sichAlkohol deckt zwar den Kalorienbedarf, senkt aber den Appetit. Er liefert dem Körper keine Proteine, Vitamine und Mineralstoffe. Chronische Alkoholiker sind deshalb anfällig für Mangelerkrankungen aller Art. Drittens: Ein kontinuierlich hoher Alkoholspiegel im Blut und in den Geweben führt zu weitreichenden Störungen der gesamten Körperchemie. Hier treten besonders häufig Blutunterzuckerung oder ein erhöhter Blutfettspiegel auf, was wiederum zu Folgeerkrankungen und Funktionsstörungen zahlreicher Organe, besonders des Herzens, der Leber, des Hirns oder der Blutgefässe, führen kann. Irreparable Schäden an den genannten Organen sind in der Regel Ursache eines vorzeitlichen Todes. Statistisch kann chronisch übermäßiger Alkoholkonsum das Leben um etwa 10- 15 Jahre verkürzen. 8 Gehirn Bei jedem Rausch sterben Hirnzellen ab. Was bei ständigem Konsum zu einer allmählichen Schrumpfung des Gehirns (Atrophie) führen kann. Dies bleibt lange Zeit ohne Einfluss auf die geistige Leistungsfähigkeit, da wir ca. 100 Milliarden Hirnzellen haben. Die Aufgaben der abgestorbenen Zellen werden von "Reservezellen" übernommen, die diese Aufgaben jedoch erst "lernen" müssen. Der Vorrat an Reservezellen wird durch Alkoholtrinken systematisch verringert. Hirnschäden durch Alkohol sind die häufigsten und bedeutendsten, sie sind viel ernster zu nehmen als z.B. Leberschäden. Vor allem das Kurzzeitgedächtnis leidet darunter, auch die Konzentration, und die Aufmerksamkeit schwinden, es treten Gehbehinderungen usw. auf. Viele schwerwiegende psychisch bedingte Krankheiten, wie z.B. Halluzinationen, können die Folge des Trinkens sein (siehe unter „Psychische Schäden“). Lebererkrankungen Der Alkohol übt eine direkte Giftwirkung auf die Leber aus. Die Schäden, die entstehen können, zeigen sich meistens zuerst als Fettleber und als Alkoholhepatitis. Bei fortgesetztem Konsum kommt es zur Leberzirrhose (Leberschrumpfung). Bei der Leberzirrhose ist die einzige Überlebenschance der absolute Verzicht auf Alkohol. Es gibt auch hier jährlich sehr viele Tote. Herzerkrankungen Durch übermäßigen Alkoholkonsum können Erkrankungen der Herzkranzgefässe, zu hoher Blutdruck und ein Schlaganfall begünstigen. Auch durch den Thiaminmangel (Vitamin B) kann es zu einer Herzsuffizienz (nachlassende Pumpkraft des Herzens) führen, was eine Flüssigkeitsansammlung in den Geweben zur Folge hat und auch zum Tode führen kann. Krebs Starker Alkoholkonsum erhöht das Risiko von Mund-, Zungen, Kehlkopf- und Speiseröhrenkrebs. Auch die Gefahr, an Leber oder Magenkrebs zu erkranken ist bei Alkoholikern deutlich erhöht. Alkoholische Embryoapathie Über 40% der alkoholabhängigen Frauen geben auch während einer Schwangerschaft das Trinken nicht auf. Ein Drittel dieser Frauen hatte überdies schon Früh-, Tot- oder Fehlgeburten, bevor sie ein geschädigtes Kind zur Welt brachten. Nerven Als Zellgift schädigt Alkohol direkt das Nervenmark. Folge: Schmerzen in den Beinen und Oberarmen, Wadenkrämpfe, Kribbeln oder Ausfall des Hautgefühls, Unsicherheit beim Gehen, Lähmungserscheinungen usw. Diese Schäden können sich bei Abstinenz erst nach vielen Monaten zurückbilden. Einzige Therapie: Gabe von Vitamin-B-Präparaten. Weitere Schädigungen Sexualhormone, Lunge, Haut, Knochen und Gelenke, Magengeschwüre, Diabetes, Bauchspeicheldrüseentzündung usw. 9 Anmerkung: Natürlich gibt es noch viel mehr Erkrankungen und Schädigungen. Wenn ich jedoch alle aufzählen würde, würde mein Projekt einen übergroßen Umfang erhalten. 3.5.2 Psychische Schäden Durch den langjährigen, enormen Alkoholkonsum treten auch psychische Störungen auf. Die Veränderung des Gemütslebens macht sich früh bemerkbar. Dies erscheint in Form von Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit oder depressiver Verstimmung. Auch die Belastbarkeit ist sehr herabgesetzt, was schnell zu aggressivem Verhalten des alkoholkranken Menschen führt. Das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, vom Alkoholiker, gehen mehr und mehr verloren, da die Angehörigen sein Verhalten gegenüber Außenstehenden entschuldigen und er dadurch keine Verantwortung mehr übernehmen muss. Weitere Folgen der Hirnschädigungen können sein: Verlangsamung und Störung der Motorik, Beeinträchtigung des Gedächtnisses sowie Nachlassen der Urteils- und Kritikfähigkeit. Es können häufig auch Störungen auftreten, die in den Bereich der Geisteskrankheiten gehören, wie zum Beispiel Sinnestäuschungen (Halluzinationen), Verwirrtheitszustände mit Verlust der Orientierung von Raum und Zeit sowie Wahnideen (zum Beispiel Verfolgungs- oder Eifersuchtswahn). Korsakow-Syndrom Damit bezeichnet man die schwerste Form der Gehirnschädigung durch Alkohol. Benannt wurde sie nach dem russischen Psychiater Sergej Korsakow, der diesen Zustand erstmals 1854 beschrieb. Durch das Absterben bestimmter Gehirnregionen erleidet der Betroffene einen weitgehenden Gedächtnis- und Orientierungsverlust. Das heißt, für ihn gibt es im Extremfall überhaupt kein "gestern" und kein "morgen" mehr. Er weiß nicht mehr, wer oder wo er ist, und kann manchmal auch engste Bezugspersonen nicht wiedererkennen. Dieser Zustand ist in der Regel durch das Absetzen des Alkohols kaum noch heilbar. Die meisten Korsakow-Patienten werden für immer auf einer geschlossenen Psychiatriestation untergebracht. Falls ein Alkoholiker nicht rechtzeitig aufhört zu trinken oder vorher stirbt, ist das Korsakow-Syndrom der zwangsläufige Endzustand. Alkoholdelir (Delirium tremens) Bei plötzlichem Absetzen des Alkohols, kann es nach 1 - 3 Tagen zu einer dramatischen Fehlschaltung im Gehirn kommen. Das Delirium tremens ist somit eine besonders schwere Form von Entzugserscheinungen. Merkmale sind: Halluzinationen, Unruhe, d.h. aufgeregt und orientierungslos, "nestelnde Bewegungen", Gefahr von Kreislaufkollaps usw. Das Delirium wird auch als Einbruch von Traumphasen im Wachzustand interpretiert. Es dauert gewöhnlich 2 - 5 Tage und klingt spontan ab. Im schlimmsten Fall kann es aber auch in ein Korsakow-Syndrom, eine alkoholische Demenz oder in andere psychische Folgeerkrankungen übergehen. Das Delirium tremens kann nur auf einer Intensivstation behandelt werden. Etwa 20 % der Delirien verlaufen tödlich. 10 Krampfanfälle Die Anfälle gleichen denen der Epilepsie. Sie treten ebenfalls häufig bei plötzlichem Entzug (20-30 % der Abhängigen) auf, allein oder als Begleiterscheinung des Delirs. Es gibt auch "nasse Krämpfe" während der Trinkphasen. Ist einmal ein Krampfanfall aufgetreten, bleibt die Neigung dazu chronisch. Bei jedem epileptischen Anfall kommt es zu einem Massensterben von Gehirnzellen. Vorbeugend werden Krampfanfälle bei den dazu neigenden Patienten (falls bekannt) mit verschiedenen Medikamenten behandelt. Halluzinosen Bei dieser selteneren Psychose bestimmen vorwiegend akustische Wahnvorstellungen das Krankheitsbild. Das Bewusstsein ist klar. Der ängstlichgequälte Alkoholiker hört meist Stimmen mehrerer nicht anwesender Personen, die in seiner Einbildung über ihn zu diskutieren und zu schimpfen scheinen. Manche Kranke versuchen, den "Stimmen" zu entfliehen (Sie verstecken sich z.B. In ihrem Zimmer). Die Alkoholhalluzinose tritt meist im mittleren Lebensalter auf, oft nach einer Periode von Trinkexzessen. Wird der Alkohol abgesetzt, so klingt die Halluzinose in den meisten Fällen innerhalb weniger Tage ab. Trinken die Kranken wieder, so kommt es leicht zu einer Wiederholung. Bei einem Fünftel der Fälle wird die Alkoholhalluzinose chronisch. In seltenen Fällen ist der Endzustand eine Demenz. Eifersuchtswahn Eifersuchtsvorstellungen sind bei Alkoholikern häufig. Bei einem kleinen Teil verdichten sie sich zur Entwicklung eines Eifersuchtswahns. Faktoren der Wahnentwicklung sind die begreifliche Abkehr des Partners wegen des Trinkens, das gestörte Verhältnis zur Umwelt und die oft alkoholbedingte Impotenz bei vorübergehend gesteigerten sexuellen Wünschen. Die Schuld am eigenen Versagen wird abgewehrt und auf den Partner übertragen. Die Verdächtigungen nehmen oft übergroße Formen an. Der Eifersuchtswahn kann chronisch werden und auch bei späterer Abstinenz fortbestehen. Wernicke-Krankheit Die Wernicke-Encephalopatie ist eine schwere alkoholbedingte Psychose. Das Krankheitsbild kann auch nach einem Delir auftreten. Kennzeichen sind: Schläfrigkeit, Augenmuskellähmung und Störung im Ablauf der Muskelbewegungen (Gelegentlich finden sich Pupillenträgheit und Krampfanfälle). Die Prognose ist schlecht. Wenn der Patient überlebt, bleibt meist ein Korsakow-Syndrom (siehe oben Beschreibung des Korsakow-Syndroms)zurück. 3.5.3 Soziale Probleme Ein übermäßiger Alkoholkonsum verursacht früher oder später soziale Probleme. Sei das in der Familie und im engsten Bekanntenkreis, im Beruf und in finanziellen Situationen oder wegen Konflikten mit dem Gesetz. Doch wie schwer die Probleme sind, hängt ganz von dem Trinkmuster, vom sozialen Umfeld und vom Abhängigkeitsgrad ab. Je mehr und je häufiger der Kranke trinkt, desto größer sind seine Probleme. 11 Familie Die engsten Angehörigen bemerken die Alkoholabhängigkeit meistem am frühesten. Sie machen ihn auf ihre Beobachtungen aufmerksam und versuchen, ihm zu helfen. Doch der Betroffene weist alles zurück und streitet den übermäßigen Konsum ab. Oft trifft er dabei einen sehr harten Ton gegenüber der Familie und nicht selten greift er zu körperlicher Gewalt. Aber er kann auch der beste Vater/ die beste Mutter sein. Mit diesem extremen Stimmungsschwankungen haben Kinder besonders Mühe. Sie wissen nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Aber auch die Partnerin/ der Partner zeigt mit diesen schnell ändernden Verhaltensweisen ihre Mühe. Trotzdem wird der Alkoholiker gegen außen in Schutz genommen. Seine Krankheit wird versteckt, bagatellisiert oder sogar verleugnet. Das bewirkt, dass die Angehörigen alle Probleme selber bewältigen müssen. Seine Aufgaben und Verpflichtungen vernachlässigt der Alkoholkranke immer mehr, wodurch auch hier mehr Arbeit auf die Familie fällt. Wenn der Kranke nicht bald zu seiner Sucht steht und bereit ist, sie zu behandeln, so wird die Ehe mit größter Wahrscheinlichkeit in die Brüche gehen. Die psychische Belastung für die Angehörigen wird einfach zu groß. Engste Bekannte Die engsten Freunde ziehen sich langsam zurück, weil sie wie die Angehörigen, nicht an den Alkoholiker rankommen. Im Rausch beginnt er sie bloss zu stellen, sie lächerlich zu machen. Wenn ich in der Disco von einem Freund angebrüllt werde, nur weil ich ihn dran mahne, dass er bereits genug Alkohol zu sich genommen hat, so fühle ich mich nicht mehr sehr wohl. Auch wenn es schwer fällt, entfernt man sich von jener Person immer mehr. Was jedoch nicht als falsche Handlung angesehen werden darf! Weil sich die Familienangehörigen, die Freunde und Bekannten vom Alkoholiker distanzieren, ändert sich der Freundeskreis des Süchtigen. Zunehmend bekundet er nur noch Freunde, die einen gleich hohen Alkoholkonsum haben, wie er selber. Beruf Die berufliche Leistung kann durch die Krankheit negativ beeinflusst werden. Hohes Konzentrationsvermögen, Geschicklichkeit und genaue Sehleistung lassen sich nicht mit dem Alkoholismus vereinbaren. Bei einigen Berufen fällt dies sehr schnell auf, bei anderen wiederum wird eine Alkoholabhängigkeit erst sehr spät erkannt (wie zum Beispiel bei einem Gastwirt, der täglich mit alkoholischen Getränke arbeitet). Weiterhin bewirkt Alkoholismus häufig ein entschuldigtes oder unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit, was meistens mit dem Auskurieren des Rausches vom Vorabend erklärt werden kann. Durch die vermehrte Unzuverlässigkeit folgen oftmals mehrere Ermahnungen und letztlich eine Entlassung. Dies führt dann zu geringerem Einkommen und Arbeitslosigkeit. Finanzielle Situation Wie wir alle wissen, sind alkoholische Getränke im Ausgang teurer als Mineralwasser. Genau gleich zeigt sich das auch beim Einkauf im Laden. Dies spürt auch der Alkoholiker. In der chronischen Phase, wenn sich alles aufs Beschaffen von 12 Alkohol konzentriert, ist er arbeitsunfähig. Das Geld wird immer knapper. Rechnungen von Versicherungen, die Miete Strom- und Wasserrechnungen werden beiseite gelegt und auf Grund des fehlenden Geldes nicht mehr bezahlt. Der Schuldenberg häuft sich an. Oftmals muss die Sozialhilfe eingreifen. Alkohol am Steuer Dieses Problem möchte ich noch speziell ansprechen, da es in unserer Gesellschaft ein großes Thema ist. Jedes Jahr gibt es in der Schweiz und weltweit sehr viele Verkehrsunfälle durch Alkohol am Steuer. Häufig werden unschuldige Leute in einen Verkehrsunfall verwickelt, weil ein anderer betrunken ist. Bei Alkohol am Steuer werden also sehr viele unschuldige Leute in Gefahr gebracht, oder sogar getötet. Genau dies möchte das nächste Gedicht vermitteln. Alkohol am Steuer: Tod einer Unschuldigen Ich ging zu einer Party, Mami, und dachte an Deine Worte. Du hattest mich gebeten, nicht zu trinken, und so trank ich keinen Alkohol. Ich fühlte mich ganz stolz, Mami, genauso, wie Du es vorhergesagt hattest. Ich habe vor dem Fahren nichts getrunken, Mami, auch wenn die anderen sich mokierten. Ich weiß, dass es richtig war, Mami, und dass Du immer recht hast. Die Party geht langsam zu Ende, Mami, und alle fahren weg. Als ich in mein Auto stieg, Mami, wusste ich, dass ich heil nach Hause kommen würde: aufgrund Deiner Erziehung - so verantwortungsvoll und fein. Ich fuhr langsam an, Mami, und bog in die Strasse ein. Aber der andere Fahrer sah mich nicht, und sein Wagen traf mich mit voller Wucht. Als ich auf dem Bürgersteig lag, Mami, hörte ich den Polizisten sagen, der andere sei betrunken. Und nun bin ich diejenige, die dafür büßen muss. Ich liege hier im Sterben, Mami, ach bitte, komm doch schnell. Wie konnte mir das passieren? Mein Leben zerplatzt wie ein Luftballon. Ringsherum ist alles voll Blut, Mami, das meiste ist von mir. Ich höre den Arzt sagen, Mami, dass es keine Hilfe mehr für mich gibt. Ich wollte Dir nur sagen, Mami, ich schwöre es, ich habe wirklich nichts getrunken. Es waren die anderen, Mami, die haben einfach nicht nachgedacht. Er war wahrscheinlich auf der gleichen Party wie ich, Mami. Der einzige Unterschied ist nur: Er hat getrunken, und ich werde sterben. Warum trinken die Menschen, Mami? Es kann das ganze Leben ruinieren. Ich habe jetzt starke Schmerzen, wie Messerstiche so scharf. Der Mann, der mich angefahren hat, Mami, läuft herum, und ich liege hier im Sterben. Er guckt nur dumm. Sag' meinem Bruder, dass er nicht weinen soll, Mami. Und Papi soll tapfer sein. Und wenn ich dann im Himmel bin, Mami, schreibt "Papis Mädchen" auf meinen Grabstein. Jemand hätte es ihm sagen sollen, Mami, nicht trinken und dann fahren. Wenn man ihm das gesagt hätte, Mami, würde ich noch leben. Mein Atem wird kürzer, Mami, ich habe große Angst. Bitte, weine nicht um mich, Mami. Du warst immer da, wenn ich Dich brauchte. Ich habe nur noch eine letzte Frage, Mami, bevor ich von hier fortgehe: Ich habe nicht vor dem Fahren getrunken, warum bin ich diejenige, die sterben muss? ANMERKUNG: Dieser Text in Gedichtform war an der Springfield High School (Springfield, VA, USA) 13 in Umlauf, nachdem eine Woche zuvor zwei Studenten bei einem Autounfall getötet wurden. Unter dem Gedicht steht folgende Bitte: „Jemand hat sich die Mühe gemacht, dieses Gedicht zu schreiben. Gib es bitte an so viele Menschen wie möglich weiter. Wir wollen versuchen, es in der ganzen Welt zu verbreiten, damit die Leute endlich begreifen, worum es geht.“ 3.6 Alkoholiker ist... - wer bei seelischen Spannungen nach Alkohol verlangt. - wer meint, zu gewissen Zeiten und bei gewissen Anlässen Alkohol nötig zu haben, oder wer meint, seine Lebensaufgabe ohne Alkohol nicht bewältigen zu können. - wer nach durchschnittlichem Alkoholkonsum nicht jederzeit die Kraft hat, aufzuhören, sondern weitertrinken muß bis zur Euphorie (gehobener Gemütszustand) oder bis zur Trunkenheit. - wer entgegen seinem Vorsatz zeitweise unmäßig trinkt, obwohl er weiß, dass er sich oder andere dadurch schädigt - wer anfängt, Alkohol heimlich und allein zu trinken. - wer feststellt, dass sich wiederholt Gedächtnislücken eingestellt haben über Vorgänge beim trinken. - wer schon bei geringem regelmäßigem Tageskonsum alkoholischer Getränke alkoholbedingte Schäden an den inneren Organen und am Nervensystem erleidet. - wer zunehmend von schwache auf konzentriert alkoholhaltige Getränke übergeht - Wer vorsorglich Alkohol versteckt - wer schon frühmorgens das Bedürfnis verspürt, Alkohol zu trinken - wer seinen Tageskonsum fortschreitend steigert, so dass eine charakterliche Veränderung auftritt und seine Arbeitsleistung nachlässt; - wer dadurch seine zwischenmenschlichen Beziehungen gefährdet. - wer das Trinken selbst nicht aufgeben kann, weil nach dem Absetzen des Alkohols Entzugserscheinungen auftreten (Zittern, Schweißausbrüche, Erregungszustände). Beachte bitte: Schon wenige dieser Merkmale zeigen an, dass eine Alkoholabhängigkeit besteht. 14 4 Alkoholentwöhnung Um Alkoholkranken zu helfen, sich vom Alkohol zu befreien, ist eine annehmende, einfühlende und verstehende Haltung notwendig. Alkoholkranke suchen meistens aufgrund unangenehmer Folgen ihrer Abhängigkeit oder auf Druck ihres Umfeldes den Arzt auf und deshalb sind sie eher bereit, sich zu rechtfertigen, als sich zu verändern. Gelingt es dem Arzt, im Kopf des Patienten zu denken, mit seinem Herzen zu fühlen, in seine Haut zu schlüpfen und zu versuchen, mit seinen Augen zu sehen und ihm dann das „Gefühlte“ mitzuteilen, so gelingt es auch dem Alkoholkranken, Ängste abzubauen, Abwehrmechanismen aufzugeben, Realität anzunehmen und Behandlungsbereitschaft zu entwickeln. Aufgrund der Verschiedenartigkeit des Krankenbildes und der unterschiedlich ausgeprägten Folgeschäden benötigen Alkoholkranke ein breites Therapieangebot, das von der ambulanten über kurz- und mittelfristige bis zur langfristigen stationären Behandlung reichen muss. Vor Behandlungsbeginn liegen oft Jahre der Krankheitsentwicklung mit entsprechenden Folgeschäden vor. So, dass für den Genesungsprozess in der Regel eine langfristige Behandlung notwendig ist. 4.1 Therapien Folgende Behandlungsarten stehen dem Alkoholabhängigen zur Verfügung: Stationäre Behandlung Ein Teil Alkoholiker bedarf stationärer Behandlung. Alkoholiker mit schwerem Entzugssyndrom, erheblichen körperlichen Folge- und Begleitkrankheiten, stark verminderter Sozialisierung und damit mangelnder sozialer Kompetenz, schweren Verhaltensstörungen und massiven milieubezogenen Belastungen benötigen stationäre Behandlung. Stationäre Behandlung kann erfolgen durch Allgemeinkrankenhäuser, Allgemeinkrankenhäuser mit Spezialabteilungen, Psychiatrische Krankenhäuser und Fachkrankenhäuser. Nach Behandlungsende sind Nachsorgeeinrichtungen unerlässlich, um die Rückfallgefahr des Alkoholikers zu minimieren. Damit ihr euch die Therapie besser vorstellen könnt, habe ich hier wieder einen Bericht: Mit sehr gemischten Gefühlen bin ich am 4. August 2003 zur Langzeittherapie in die Berghofklinik nach Bad Essen (Deutschland) gefahren. Was wird mich dort erwarten? In der ersten Woche auf der Aufnahmestation wurden die Abläufe in der Klinik erklärt und wir "Neuen" hatten genug Zeit, um uns einzuleben. Dann wurden wir auf die einzelnen Gruppen (insgesamt 9 mit jeweils 10-12 Patienten) verteilt. Die Therapie bestand aus 3 Einheiten pro Tag: Gruppentherapie, Sporttherapie oder Arbeitstherapie/Funktionsdienst (im Wechsel), Kunst- oder Beschäftigungstherapie (im Wechsel). Hinzu kamen bei Bedarf oder nach Absprache Einzelgespräche mit 15 dem Therapeuten. Die Gruppentherapie war anstrengend. Hier ging es ans Eingemachte und es war eine offene Gruppe, also ein Kommen und Gehen. Aber je mehr Neue kamen und Alte gingen, desto angenehmer wurde die Therapie. Es hat lange gedauert, bis ich offen wurde, mich nicht mehr versteckt habe und auch die Hilfe meiner Gruppe und meiner Therapeutin annehmen konnte. Daher habe ich meine Therapie auch um vier Wochen verlängert und war insgesamt 20 Wochen in der Berghofklinik. Insgesamt verging die Zeit wie im Flug und ich habe viele nette Menschen kennen gelernt, zu denen ich teilweise immer noch Kontakt habe. Rückblickend war die Therapie für mich eine anstrengende Zeit, die sich aber gelohnt hat. Ich habe Verantwortung für mich übernommen, achte auf meine Gefühle und bin an meine Grenzen gestoßen, ohne zu trinken. Ambulante Behandlung Während der ambulanten Behandlung bleibt der Patient in seinem Umfeld und entfremdet sich dadurch nicht vom Partner und Familie, er bleibt auf seinem Arbeitsplatz und wird vermehrt in die Eigenverantwortlichkeit gestellt. Ambulante Behandlung kann erfolgen durch niedergelassene Ärzte, Fachambulanzen, Beratungsstellen und Selbsthilfe- und Abstinenzgruppen. 4.2 Selbsthilfegruppen - Wege zur Selbsthilfe ! Heutzutage leben immer mehr Menschen alleine. Die Hektik unserer schnelllebigen Zeit hat zur Folge, dass Familie oder Nachbarn nicht mehr genügend Zeit aufbringen, um sich der ihnen nahestehenden Menschen so anzunehmen, wie es eigentlich nötig wäre. In Selbsthilfegruppen, in denen Gleichbetroffene den Schwerpunkt auf Erfahrungsaustausch über gemeinsame Probleme legen, werden die Vorteile für jeden meist schon nach kurzer Zeit sichtbar. In Selbsthilfegruppen treffen sich Menschen mit gleichen Anliegen oder ähnlichen Problemen, um sich untereinander auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen. Sie wollen von den Erfahrungen der anderen lernen und setzen auf das Motto: Gemeinsam erreichen wir mehr! Das bringt echtes Verständnis, Trost und neuen Mut mit sich. Die Mitarbeit in Selbsthilfegruppen lohnt sich bei fast jedem Anliegen oder in jeder schwierigen Lebenssituation: bei andauernden seelischen oder sozialen Belastungen, bei gesundheitlichen Problemen, bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder in besonderen Lebensphasen. Konkret gesehen sind Selbsthilfegruppen eine wertvolle Stütze zum Beispiel für Alleinerziehende oder Stiefeltern, für chronisch Kranke und Behinderte, für Eltern kranker oder behinderter Kinder, für Menschen mit Suchterkrankungen, für psychisch Kranke und deren Angehörige oder auch für Senioren und Hausfrauen. So manche Erleichterung im öffentlichen und sozialen Bereich geht auf die Initiative und den Einsatz einer Selbsthilfegruppe zurück. Die einzige Voraussetzung, die Sie mitbringen müssen, ist der Wille, sich selbst zu helfen. Zwar fällt diese Entscheidung nicht immer leicht, doch generell gilt: Jeder kann sich einer Gruppe anschließen, und jeder kann die Initiative ergreifen, eine ”eigene” Selbsthilfegruppe zu gründen. 16 Wie arbeitet eine Selbsthilfegruppe? Die Gruppe trifft sich regelmäßig. meist einmal pro Woche, manchmal aber auch nur ein- oder zweimal im Monat - im Wohnzimmer eines Gruppenmitglieds bis hin zu eigenen Räumlichkeiten. Die Teilnahme ist kostenlos. Experten wirken in der Gruppe nicht mit, es sei denn, die Gruppe bittet sie ausdrücklich für einzelne Treffen hinzu. Verschwiegenheit ist wichtig für vertrauensvolle Gespräche. Alles, was besprochen wird, bleibt in der Gruppe. Diskretion ist das allerwichtigste! Jeder ist in der Selbsthilfegruppe gleichberechtigt und bringt sich mit seinen persönlichen Sorgen und Ansichten ein. In aller Regel arbeiten Selbsthilfegruppen daher ohne festen Gruppenleiter. Hin und wieder wählen einzelne Gruppen - für eine bestimmte Zeit - ein Mitglied für diese Funktion. Wo finde ich eine Selbsthilfegruppe? Entsprechende Informationen erhalten Sie, bei Gesundheitsämtern, Gemeinden, Kirchen, Krankenhäusern und Ärzten. Vieles können Sie auch der Presse entnehmen. Denn die meisten örtlichen Tageszeitungen veröffentlichen Kontaktadressen, Termine oder Veranstaltungen von Selbsthilfegruppen in ihrer Region. Besonders günstig ist es; wenn es eine Selbsthilfekontaktstelle in Ihrer Nähe gibt. Denn diese Einrichtungen sind bei der Suche nach einer speziellen Selbsthilfegruppe oder auch - falls es in Ihrer Nähe noch keine passende Anlaufstelle gibt - beim Aufbau einer neuen Gruppe gerne behilflich. Gut Ding will Weile haben Natürlich wünscht sich jeder in einer Selbsthilfegruppe eine schnelle Lösung seiner Schwierigkeiten. Doch Ängste und Depressionen, Kontaktschwierigkeiten und Partnerprobleme, Familienkonflikte Körper- und seelisch bedingte Beschwerden, Schlafstörungen und Suchtprobleme haben häufig einige Jahre -und zum Teil sogar jahrzehntelange Entstehungsgeschichte. Deshalb braucht die Lösung, Bewältigung oder Milderung solcher Probleme ebenfalls lange Zeit, manchmal sogar Jahre. Und wenn auch in einer Selbsthilfegruppe (gerade in der Anfangsphase) manche Erwartungen nicht gleich erfüllt werden und vieles nicht reibungslos läuft, sollte man die Flinte nicht gleich ins Korn werfen. Mit Geduld, Offenheit und Einfühlungsvermögen lernen Sie, sich und anderen zu helfen 5 Rückfall Alkoholkrankheit ist nicht heilbar, man kann sie nur zum Stillstand bringen. Die meisten Alkoholkranken glauben, nach einer Phase der Abstinenz wieder mit Alkohol umgehen zu können. Leider vermuten das auch die Angehörigen. Das ist ein fataler Irrtum! Die Alkoholkrankheit ist wie ein "Chip" im Kopf gespeichert. Der Kranke fängt dort wieder an, wo er einst aufgehört hat. Haben Sie selber einen Rückfall, werden Sie schnell feststellen, dass Ihnen der Alkohol wahrscheinlich nicht mehr schmeckt. Auch die erhoffte Wirkung tritt nicht mehr ein. Es ist schwer zu glauben, aber jeder, der einen Rückfall hatte, wird Ihnen das bestätigen. Die Abhängigkeit ist jedoch sofort wieder da. 17 5.1 Verschiedene Arten des Rückfalls Der sofortige Rückfall Manche Alkoholkranke haben nach einer Zeit der Abstinenz ein starkes Verlangen nach Entspannung und Erleichterung. Hat sich das Gedankenspiel (soll ich trinken oder nicht?) letztlich zum ersten Schluck durchgesetzt, gibt es kein Halten mehr. Es wird hemmungslos getrunken, bis die eventuelle Zufriedenheit wieder da ist. Das heißt im Klartext, nur starkes "Volllaufenlassen" kann die vermeintliche volle Befriedigung schenken. Der Alkoholkranke hat Nachholbedarf. Der stufenweise Rückfall Er beginnt wie der sofortige Rückfall. Doch meist können die Betroffenen ziemlich schnell wieder von der Droge ablassen. Jedoch in Gedanken malt sich der Betroffene wieder aus, wie schön es sein könnte, wieder Entspannung zu finden und greift wieder zur Flasche. Meist liegen zwischen dem ersten und zweiten Rückfall Wochen. Jetzt werden jedoch die Abstände zwischen den einzelnen Rückfällen immer kürzer und irgendwann wird jeglicher Widerstand aufgegeben. Der Alkoholkranke fällt in sein altes Trinkverhalten zurück. Der schleichende Rückfall Es gibt Alkoholkranke, die irgendwann meinen, wieder kontrolliert trinken zu können. Folgendes Beispiel soll den schleichenden Rückfall verdeutlichen: Herr X hat vor einem halben Jahr seine Langzeittherapie abgeschlossen. Abends besucht er nach wie vor regelmäßig seine Skatrunde im Gasthaus. Seit seiner Therapie hat er dort immer Wasser getrunken. An einem Abend, als es besonders fröhlich und ausgelassen zuging, bestellte er sich ein Bier. Es blieb auch bei diesem Bier. Da es ja nun einmal gut gegangen ist, bestellte sich Herr X fortan jeden Abend zum Stammtisch ein Bier. Das ging über Wochen gut. In dieser Zeit erlebte Herr X jedoch in sich einen gewaltigen Druck. Könnte er nicht, wie die anderen auch, zwei oder drei Bier trinken? Er verwarf diese Gedanken wieder, weil er ja wusste, was damals mit ihm passiert war, als er mehr getrunken hat. Mit der Zeit wurde jedoch der Wunsch nach mehr zur Quälerei. Er gab dem Wunsch nach und verfiel wieder in sein früheres Trinkmuster. 6. Alkohol bei Jugendlichen Missbrauch und/oder Sucht beginnen fast immer in der ohnehin komplizierten Zeit der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen, einer Zeit, die durch widerstreitende Gefühle, schwer beherrschbaren Launen, Selbstunsicherheit und rasch wechselnde Beziehungen gekennzeichnet ist. Nicht selten werden die heftigen Gefühle der Pubertät mit dem übermässigen Konsum von Wein, Bier, Sekt und anderen alkoholischen Getränken unterdrückt. Wer im ersten Alkoholrausch im Kampf gegen Pickel. Babyspeck und dem Gefühl. „nie gut genug zu sein“. Erleichterung findet. Wird diesen Rausch mit Großer Wahrscheinlichkeit wiederholen. Wer sich auf Partys dem anderen Geschlecht gegenüber nur mit einem leichten Schwips locker und selbstbewusst geben kann, wird immer wieder zur Krücke Alkohol greifen, um diese Stimmung entstehen zu lassen. In keiner anderen Lebensphase wird es je wieder so wichtig, den gerade herrschenden Normen und Spielregeln zu entsprechen, „in“ und „cool“ zu sein. Wer glaubt, nicht mithalten zu können, fühlt sich schnell als 18 Außenseiter und ist leicht versucht, Zweifel, Unsicherheiten und Minderwertigkeitsgefühle „wegzuspülen“. In vielen Cliquen ist vor allem für die Jungen ein Rausch mit anschließendem Filmriss schon zum Statussymbol geworden. Die Kids wollen Abenteuer erleben, Neues ausprobieren und sich aus der Routine des Alltags ausklinken, ohne zugleich zu gesellschaftlichen Aussteigern zu werden. Besonders Mädchen und junge Frauen trinken am Wochenende und in ihrer Freizeit erheblich mehr als noch vor einigen Jahren. Oft sind Jugendliche, die viel Alkohol vertragen, so stolz auf ihre gute Kondition, dass sie häufig trinken, um sich mit Gleichaltrigen zu messen. Doch nur schwache Reaktionen des Körpers auf Alkohol signalisieren ein erhöhtes Risiko für die mögliche spätere Abhängigkeit – und dies ist eine der am schwierigsten zu behandelnden Krankheitsformen überhaupt! Während Erwachsene ihren Alkoholkonsum reduziert haben, greifen immer mehr Jugendliche zur Flasche. Über 12'000 Kinder zwischen 11-16 Jahren trinken in der Schweiz täglich alkoholische Getränke. Diese Zahl ist alarmierend!!! 6.1 was für Alkohol konsumieren 14- 20 jährige? 6.2 Berichte von Jugendlichen: "Ich frage mich, warum überhaupt Alkohol getrunken wird... wer zum Geier kam auf die Idee, halbvergammeltes Zeug zu trinken? Und warum hört es nicht auf! Wenn man ehrlich ist, hat es beim ersten mal doch nicht wirklich geschmeckt... aber es war cool, weil es verboten war (zumindest in meinem Alter damals) Ich könnte mir denken, wäre Alkohol für Jugendliche/Kinder nicht verboten, wäre der Reiz, anzufangen, wesentlich geringer. Wenn ein 11 bis 14- jähriger einmal so richtig vom Alkohol gekotzt hat, und ihm dann keiner erzählt, das sei cool gewesen, kommt er auf den Trichter bestimmt nicht von selbst! Es ist schade, dass man komisch angeguckt wird, wenn man keinen Alkohol trinken möchte... DAS ist doch eigentlich das normale... Trotzdem werd ich am Wochenende wieder losziehen und mir die Kante geben ;o) ... In diesem Sinne... PROST! :o)" "Gestern abend habe ich einen Freund getroffen, der nun mehr völlig betrunken in der Ecke lag. Da ist mir aufgefallen, dass ich ihn kaum jemals nüchtern angetroffen habe, wenn auch noch nie in diesem Zustand. Das hat mir sehr zu denken gegeben, denn er ist erst 16!!! 19 "Ein 15-Jähriger (!) schrieb: "Ich war zweimal auf Entzug. Bin 14 Wochen stationär zum Teil tagesstationär behandelt worden und mache jetzt noch eine Therapie, welche wahrscheinlich ein Jahr lang dauern wird" "was ich eigentlich nur loswerden wollte, ist, dass ich denke, dass Alkohol bei uns schon zur Gesellschaftsdroge geworden ist die so gut wie jeder konsumiert und das die Gefahren, die der Alkohol birgt, oft gar nicht gesehen oder verharmlost werden. Schließlich ist es nicht stark "dazuzugehören" und zu trinken, sondern stark ist man erst dann, wenn man sich von seinem Standpunkt nicht abbringen lässt und trotzdem nichts trinkt wenn die anderen einen dazu überreden wollen...... das ist wirkliche Stärke und wenn man die besitzt dann kann man stolz auf sich sein!!!" "Mein Vater ist Alkoholiker. Er war 10 Jahre trocken und ist jetzt rückfällig geworden. Meine kleine Schwester und ich habe eine Aversion gegen Alkohol entwickelt. Alkohol als Droge wird einfach unterschätzt und ich hasse Menschen, die sich ständig besaufen. Besoffene Menschen sind pervers und eklig!" "Ich glaube nicht, dass es falsch ist, wenn man in meinem Alter gelegentlich Alkohol konsumiert und es nicht übertreibt. Doch das Problem ist, dass manche nicht wissen, wo ihre Grenzen sind!" "Ich finde es verdammt ätzend, dass es bloß noch so wenige Partys gibt, wo Alkohol NICHT unbedingt ein MUSS ist!!!!! 6.3 Umfrage: Ich hatte nach den Fasnachtsferien in der Schule eine Umfrage über Alkohol gestartet. Natürlich war ich sehr gespannt auf die Antworten. Ich habe die Umfrage danach bewertet. Wenn man alle Umfragen zählt waren es 115. Antworten zu den Fragen: Hast du schon mal Alkohol Konsumiert? Schülerzahl Noch nie Ab und zu Jedes bis fast jedes Wochenende Auch unter der Woche Jeden Tag 21 63 25 5 1 Kennst du jemanden in deinem Umfeld der Probleme mit Alkohol hat? Ja: 47 Nein: 68 1.Oberstufe 20 Ich habe dort 39 Umfragen verteilt (Sek B und Sek C) Antwort zu den Fragen: Hast du schon mal Alkohol Konsumiert? Schülerzahl Noch nie Ab und zu Jedes bis fast jedes Wochenende Auch unter der Woche Jeden Tag 13 20 2 3 1 Kennst du jemanden in deinem Umfeld der Probleme mit Alkohol hat? Ja: 20 Nein: 19 2. Oberstufe In dieser Stufe wurden 37 Umfragen verteilt (Sek B und Sek C) Antwort zu den Fragen: Hast du schon mal Alkohol Konsumiert? Schülerzahl Noch nie Ab und zu Jedes bis fast jedes Wochenende Auch unter der Woche Jeden Tag 7 25 4 1 -- Kennst du jemanden in deinem Umfeld der Probleme mit Alkohol hat? Ja: 13 Nein: 24 21 3.Oberstufe Ich habe wieder 39 Umfragen verteilt Antwort zu den Fragen: Hast du schon mal Alkohol Konsumiert? Schülerzahl Noch nie Ab und zu Jedes bis fast jedes Wochenende Auch unter der Woche Jeden Tag 1 18 19 1 0 Kennst du jemanden in deinem Umfeld der Probleme mit Alkohol hat? Ja: 14 Nein: 25 Bei den anderen Fragen habe ich ein paar Zitate die geschrieben wurden aufgelistet. Wurdest du über die Gefahr von Alkohol informiert? Ja durch Erfahrung, Schule und Eltern. Mir ist bewusst was Alkohol anrichten kann. Ja schon aber das stört mich nicht, dringe immer noch. Nein nicht wirklich, ich musste mir die Informationen selber beschaffen. Ja, im TV gibt es manchmal Sendungen in dem die Gefahr von Alkohol geschildert wird. Auch Zeitschriften schreiben mal darüber. Ja, habe es selber Erfahren was Alkohol mit Menschen anrichten kann. Was denkst du über Alkohol bei Jugendlichen? Unter 13-14 Jahren finde ich den Konsum von Alkohol übertrieben, aber wenn dies in einem gewissen Maß konsumiert wird, finde ich es ok. Ich habe nichts dagegen. Trinke ja selber Alkohol. Das muss jeder selber wissen. Es ist IHR Leben und nicht MEINES! Alkohol kann bei Jugendlichen schnell außer Kontrolle geraten. Darum kann es eine Gefahr darstellen. Ist mir ziemlich egal. 22 Alkohol bei Jugendlichen ist ganz normal. Einmal muss man es ausprobieren. Es trinkt ja fast jeder so ab und zu. Man sollte aber seine Grenzen kennen und nicht übertreiben. Ich finde es bei Jugendlichen wie auch bei Erwachsenen sinnlos. Ich finde es Übertrieben. Jugendliche trinken um cool zu sein. Deswegen habe ich früher auch mitgetrunken. Denke das Trinken ist zum größten Teil Gruppenzwang. Denkst du, dass Jugendliche leicht an Alkohol gelangen? Ja ich finde schon. Man bekommt alkoholische Getränke so gut wie immer, auch wenn man noch unter 16 Jahren ist. Ja das ist ganz einfach. Zum größten Teil bekommt man es selbst. Vor allem an Partys wird fast nie nach dem Alter gefragt. Auch über Beziehungen (Ältere Geschwister und Kollegen) gelangt man an Alkohol. Wie könnte man das Problem Alkohol in unserer Gesellschaft bekämpfen? Man sollte das Alter besser kontrollieren. Das ist gar nicht möglich. Man kann den Alkohol nicht einfach abschaffen. Keine Ahnung. Vielleicht würde es ja helfen, wenn man die Preise erhöhen würde. Jeder sollte zuerst an die Konsequenzen denken, bevor er trinkt. 7 Interview Am 8.3.2005 hatte ich und Ursina, eine Kollegin von Menznau, die auch ein Projekt über Alkohol macht, ein Gespräch mit Herrn Bänder vereinbart. Natürlich war ich neugierig darauf, wie wohl der Nachmittag werden würde. Um halb Fünf kamen wir endlich im St. Urban an. Wir wurden sehr freundlich empfangen. Nachdem lud uns Herr Bänder, ein junger Mann, in sein Büro ein und wir konnten mit unserem Interview beginnen. Der Stationsleiter war offen und gesprächig und so war es kein Problem für uns, mit ihm ins Gespräch zu kommen und viel über die Klinik aber auch über Allgemeines des Alkohols zu erfahren. Zum Interview: Name: Vorname: Beruf : Bänder Christoph Stationsleiter der BAM- Abteilung. 23 Wer kommt alles auf ihre Station? Es sind Medikament- und Alkoholabhängige. Die Patienten mit einer Sucht von härteren Drogen sind in einer Station die besser überwacht ist und weniger Freiheit bietet. Wie viele Patienten sind auf der Station? Eigentlich wäre diese Station für 12 Personen gedacht, jetzt haben wir aber 19 Patienten. Dieser Abteil ist immer überbelegt. Wie viele Eintritte gibt es denn im Jahr ungefähr? Es werden ungefähr so um die 180 Eintritte sein. Wie läuft eigentlich so eine Entwöhnung ab? Zuerst gibt es einen körperlichen Entzug. Dieser dauert nur etwa eine Woche. Nachdem gibt es eine Orientierungsphase, wo man mit der Vergangenheit abschließt und sich auf die Zukunft vorbereitet. Viele Alkoholiker wissen gar nicht mehr, wie man seine Freizeit gestalten sollte. Wir geben ihnen wertvolle Tipps und unterstützen sie so gut es eben geht. Wann finden sie, dass jemand Alkoholiker ist? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich finde jemand ist dann süchtig wenn Alkohol zum Hauptthema wird und alles andere Nebensache wird (Familie, Umgebung, Finanzen, Freizeit u.s.w....) Wie lange dauert denn so eine Alkoholtherapie? Bei 80% dauert die Entwöhnung etwa 8-10 Wochen. Ca 13% machen nachher noch ein Anschlussprogramm, das zum Beispiel in Meggen am Südhang angeboten wird. Dort lernen Leute die sich noch nicht bereit fühlen selbstständig ohne Alkohol zu leben, noch besser damit umzugehen. Was macht man, damit der Alkoholentzug weniger schlimm ist für den Betroffenen? Man gibt ihm bestimmte Medikamente gegen Krämpfe und Schlafmittel, weil man beim Entzug meistens unter Schlafstörungen leidet. Nach sieben Tagen beginnt man die Medikamente aber wieder zu reduzieren, damit nicht die Gefahr von einer Abhängigkeit besteht. Was ist, wenn jemand einen Rückfall während des Entzugs in der Klinik hat? 24 Einmal kann das jedem passieren. Da sind wir nicht so streng. Erst beim zweitenmal wird es schwerere Konsequenzen haben. Beim Eintritt eines Patienten geben wir immer ein Blatt ab, bei dem er oder sie sich eine Bestrafung ausdenkt. Ihre Gedanken von einer Bestrafung sind meistens schlimmer als die, die wir uns ausgedacht haben. Wie kann man sonst einen Rückfall beschreiben? Der Begriff Rückfall ist schwer zu definieren. Es gibt Leute die 20 Jahre nichts trinken, denken dass sie kontrolliert trinken können und wieder zu einem Glas Wein greifen. Weil sie aber doch dann einen Drang nach Alkohol bemerken, kommen sie wieder für ein paar Tage in unsere Klinik. Bei so einer Situation merkt man auch, dass ein Alkoholkranker, immer alkoholkrank sein wird. Die psychische Abhängigkeit wird immer bestehen, egal was man machen wird. Man kann die Sucht zwar eindämmen und unterdrücken. Aber immer wieder, wird man in bestimmten Situationen versucht sein nach Alkohol zu greifen. Die Klinik ist eigentlich dazu da, damit man lernt zu verzichten und sich selbst unter Kontrolle zu haben. Haben diejenigen, die hier sind wegen ihrer Alkoholprobleme, irgendwie körperliche oder psychische Probleme? Ja natürlich gibt es Fälle bei denen zum Beispiel die Leber beschädigt ist oder ein anderes Organ. Auch das Kurzzeitgedächtnis leidet sehr unter dem Alkohol, weil durch den Konsum von Alkohol sehr viele Hirnzellen absterben die unersetzbar sind. Ein Arzt kommt aber häufig vorbei um nach dem Rechten zu sehen. Wie verbringen die Patienten ihren Tag hier auf dieser Station? Die Alkoholkranken haben einen Wochenplan der streng einzuhalten ist. Hier ist alles inbegriffen, von den Ämtlis bis hin zu Freizeitbeschäftigungen und Übungen. Wie viel Freiheit wird denn betroffenen während dem Aufenthalt in der Klinik gegeben? Die Alkoholkranken können jeden Tag in den Ausgang. So werden sie mit Situationen konfrontiert, die sie nach dem Aufenthalt in der Klinik immer wieder erleben werden. Dies ist eine sehr gute Therapie, die von mir aus gesehen sehr sinnvoll ist. Gibt es solche die gegen ihren Willen in die Klinik eingewiesen werden? Ja, das sind aber nur etwa 5%.die entweder eine Selbst- und/ oder Fremdgefährdung darstellen oder durch die Polizei eingewiesen werden. 25 Gab es auch schon Leute die einfach aus der Klinik abgehauen sind? Das kommt selten bis nie vor. Weil ja die meisten freiwillig hier sind und sich wirklich vom Alkohol lösen wollen. Es ist erst einmal vorgekommen ,dass ein Mann ausbrach und in ein anderes Land flüchtete. Wie Viele Patienten leben jeweils zusammen in einem Stationszimmer? In einem Stationszimmer leben immer etwa zwei bis drei Patienten unterschiedlicher Altersgruppen zusammen. Das ist meiner Meinung nach sehr vernünftig. Da bei gleichaltrigen Leuten die Gefahr besteht, dass sie mal so richtig Party machen. Und ein solches Risiko wollen wir auf keinen Fall eingehen. Wie ist es mit anderen schwächeren Drogen zum Beispiel dem Rauchen? Wir haben extra ein „Raucherrüümli“ in dem die Leute ihre Zigaretten verdrücken können. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir den Standort des Raumes gewechselt. Früher war der Raum direkt neben dem Wohnzimmer. Da war es sehr angenehm während dem Fernsehen schnell aufzustehen und im Nebenraum eine Zigarette zu genießen. Dazu kommt noch , dass der Raum sehr schön und gemütlich war. Jetzt haben wir den Raum in eine Ecke verlegt, der ziemlich weit von den Zimmern entfernt liegt und erst noch recht ungemütlich ist. Dadurch ist bei den meisten der Konsum von Zigaretten stark zurück gegangen. 26 8 Rückblick Bei meinem ersten Gespräch über mein Abschlussprojekt, das ich mit Herrn Müller führte, stand die Frage offen, ob mich dieses Projekt wirklich stärken würde. Jetzt am Ende meiner Arbeit kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass dieses Projekt mir gezeigt hat, wie viele Leute überhaupt von der Alkoholsucht betroffen sind. Auf keinen Fall überforderte mich diese Arbeit, obschon sie zum Teil etwas tragischwar. Ich möchte in meinem Rückblick nicht vergessen die Leute zu erwähnen, die wirklich von dieser Krankheit betroffen sind. Auch nicht diejenigen, die in ihrer Familie Alkoholkranke haben. Mit diesem Projekt ist mir bewusst geworden, was betroffene und ihre Angehörigen von Alkoholikern alles durchmachen. Welch großes Leid diese Sucht mit sich bringt. Zum Teil haben mich all die Probleme sehr betroffen gemacht. Doch hat es sich wirklich gelohnt dieses Thema zu wählen. Für dieses Projekt habe ich viele Stunden meiner Freizeit investiert. Das war aber überhaupt nicht schlimm. Es war sehr spannend und manchmal vergass ich Zeit und Raum. Das Interesse gegenüber dem Thema ist eine der Grundlagen um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dies war bei mir auf jeden Fall vorhanden. Das nächste mal würde ich von Anfang an intensiver arbeiten und nicht warten bis ich unter Zeitdruck stehe. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass meine Arbeiten eine bessere Qualität aufweisen, wenn ich unter Druck arbeite. Im Grossen und Ganzen bin ich recht zufrieden und stolz auf mich, dass ich alles in der vorgeschriebenen Zeitspanne schaffen konnte. Ich habe das Gefühl, dass ich viel dazugelernt habe. All die Informationen und Berichte haben mir geholfen, das Problem Alkohol etwas besser zu verstehen. 27 9 Quellenverzeichnis Internet: http://www.alkohol-hilfe.de/alkoholhilfe.htm http://www.50plus.at/Default.htm?http%3A//www.50plus.at/gesund/alkohol.htm http://www.gnade.de/index_l/brisant/005.htm http://www.suchtprobleme.de/stories/stories.shtml http://www.alkoholsucht.btonline.de/hinweise/alkhinweise03.html#phase1 http://www.sprechzimmer.ch/sprechzimmer/Fokus/Alkoholabhaengigkeit/Krankheit/V oralkoholismus.php http://www.apawelzik.de/Alkohol/Wie_Alkohol_wirkt_/Wie_Alkohol_wirkt/wie_alkohol_wirkt.html http://de.wikipedia.org/wiki/Alkohol http://www.sfaispa.ch/index.php?IDtheme=39&IDarticle=873&IDcat16visible=1&langue=D Bücher: „Ich bin doch keine Flasche“ von Katja Doubek Prospekte: „Alkohol- wie viel ist zu viel?“ 28