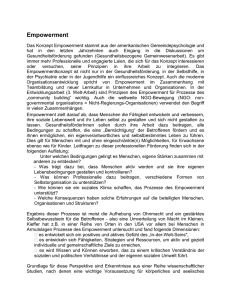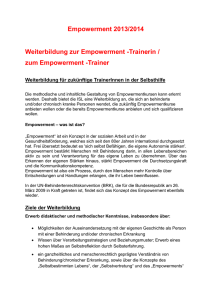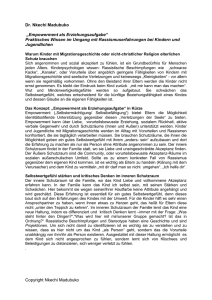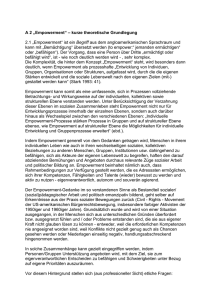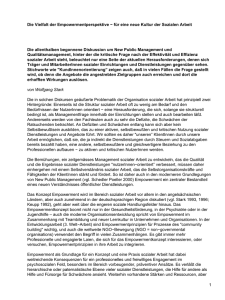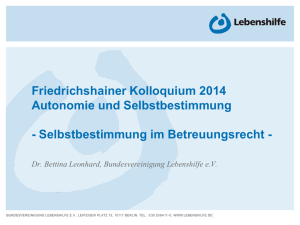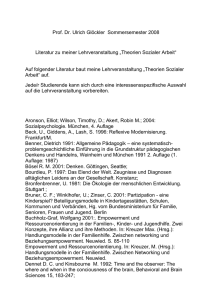Bericht
Werbung
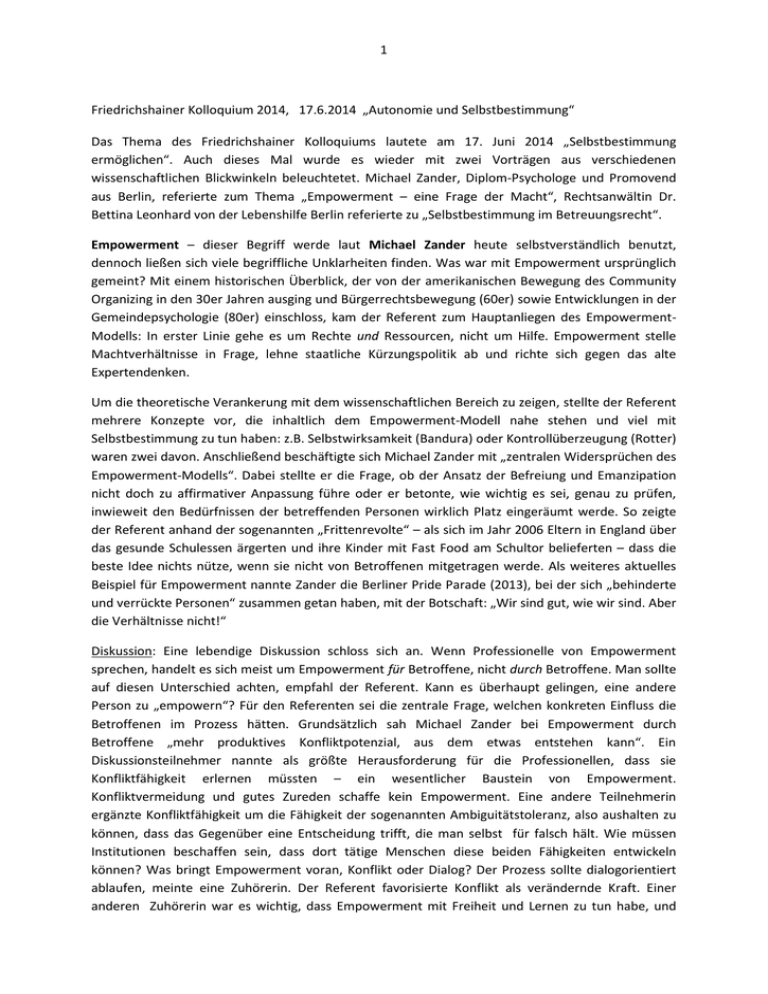
1 Friedrichshainer Kolloquium 2014, 17.6.2014 „Autonomie und Selbstbestimmung“ Das Thema des Friedrichshainer Kolloquiums lautete am 17. Juni 2014 „Selbstbestimmung ermöglichen“. Auch dieses Mal wurde es wieder mit zwei Vorträgen aus verschiedenen wissenschaftlichen Blickwinkeln beleuchtetet. Michael Zander, Diplom-Psychologe und Promovend aus Berlin, referierte zum Thema „Empowerment – eine Frage der Macht“, Rechtsanwältin Dr. Bettina Leonhard von der Lebenshilfe Berlin referierte zu „Selbstbestimmung im Betreuungsrecht“. Empowerment – dieser Begriff werde laut Michael Zander heute selbstverständlich benutzt, dennoch ließen sich viele begriffliche Unklarheiten finden. Was war mit Empowerment ursprünglich gemeint? Mit einem historischen Überblick, der von der amerikanischen Bewegung des Community Organizing in den 30er Jahren ausging und Bürgerrechtsbewegung (60er) sowie Entwicklungen in der Gemeindepsychologie (80er) einschloss, kam der Referent zum Hauptanliegen des EmpowermentModells: In erster Linie gehe es um Rechte und Ressourcen, nicht um Hilfe. Empowerment stelle Machtverhältnisse in Frage, lehne staatliche Kürzungspolitik ab und richte sich gegen das alte Expertendenken. Um die theoretische Verankerung mit dem wissenschaftlichen Bereich zu zeigen, stellte der Referent mehrere Konzepte vor, die inhaltlich dem Empowerment-Modell nahe stehen und viel mit Selbstbestimmung zu tun haben: z.B. Selbstwirksamkeit (Bandura) oder Kontrollüberzeugung (Rotter) waren zwei davon. Anschließend beschäftigte sich Michael Zander mit „zentralen Widersprüchen des Empowerment-Modells“. Dabei stellte er die Frage, ob der Ansatz der Befreiung und Emanzipation nicht doch zu affirmativer Anpassung führe oder er betonte, wie wichtig es sei, genau zu prüfen, inwieweit den Bedürfnissen der betreffenden Personen wirklich Platz eingeräumt werde. So zeigte der Referent anhand der sogenannten „Frittenrevolte“ – als sich im Jahr 2006 Eltern in England über das gesunde Schulessen ärgerten und ihre Kinder mit Fast Food am Schultor belieferten – dass die beste Idee nichts nütze, wenn sie nicht von Betroffenen mitgetragen werde. Als weiteres aktuelles Beispiel für Empowerment nannte Zander die Berliner Pride Parade (2013), bei der sich „behinderte und verrückte Personen“ zusammen getan haben, mit der Botschaft: „Wir sind gut, wie wir sind. Aber die Verhältnisse nicht!“ Diskussion: Eine lebendige Diskussion schloss sich an. Wenn Professionelle von Empowerment sprechen, handelt es sich meist um Empowerment für Betroffene, nicht durch Betroffene. Man sollte auf diesen Unterschied achten, empfahl der Referent. Kann es überhaupt gelingen, eine andere Person zu „empowern“? Für den Referenten sei die zentrale Frage, welchen konkreten Einfluss die Betroffenen im Prozess hätten. Grundsätzlich sah Michael Zander bei Empowerment durch Betroffene „mehr produktives Konfliktpotenzial, aus dem etwas entstehen kann“. Ein Diskussionsteilnehmer nannte als größte Herausforderung für die Professionellen, dass sie Konfliktfähigkeit erlernen müssten – ein wesentlicher Baustein von Empowerment. Konfliktvermeidung und gutes Zureden schaffe kein Empowerment. Eine andere Teilnehmerin ergänzte Konfliktfähigkeit um die Fähigkeit der sogenannten Ambiguitätstoleranz, also aushalten zu können, dass das Gegenüber eine Entscheidung trifft, die man selbst für falsch hält. Wie müssen Institutionen beschaffen sein, dass dort tätige Menschen diese beiden Fähigkeiten entwickeln können? Was bringt Empowerment voran, Konflikt oder Dialog? Der Prozess sollte dialogorientiert ablaufen, meinte eine Zuhörerin. Der Referent favorisierte Konflikt als verändernde Kraft. Einer anderen Zuhörerin war es wichtig, dass Empowerment mit Freiheit und Lernen zu tun habe, und 2 zwar bei Klienten wie bei professionellen Fachkräften. Auf Einrichtungsseite müsse man noch stärker lernen Klienten tatsächlich zu fragen. Auf individueller Ebene bedeute Empowerment von der erlernten Hilflosigkeit zur erlernten Zuversicht zu kommen, was nur durch viele Erfolgserlebnisse geschehen könne. Das gelinge nicht durch ein einzelnes Erfolgserlebnis. Die Moderatorin frage, welche Rolle heute Empowerment spiele? Der heutige Zeitgeist sei sehr an Rezeptwissen interessiert, so Michael Zander – welchen Lösungsansatz gibt es für das Problem X? So werde Empowerment schnell auf eine Technik reduziert. Die Haltung „Wir können alles schaffen, wenn wir die richtige Methode haben.“ sei illusionär und führe zu Dauerüberforderung. Wie lässt sich vermeiden, dass mit Empowerment Kürzungen durchgesetzt werden, fragte zum Schluss eine Zuhörerin. Ob man sich gegen diese Politik durchsetzen könne, sei nicht immer die Frage von guten Argumenten, sagte Referent Michael Zander. Der nächste Vortrag von Dr. Bettina Leonhard schaute aus juristischer Perspektive auf das aktuelle Thema „Selbstbestimmung und Betreuungsrecht“ mit dem Schwerpunkt auf Menschen mit geistiger Behinderung. Ausgehend vom BGB, in dem „Rechtliche Betreuung“ in § 1896 folgendermaßen definiert wird („…wenn jemand aufgrund einer psychischen Erkrankung oder Behinderung seine Angelegenheiten nicht mehr selbst besorgen kann…“), stellte die Referentin die Frage, wie es mit dem Selbstbestimmungsrecht im Betreuungsrecht aussieht. Bis 1992 gab es Entmündigungen nach dem Vormundschaftsrecht, aus denen eine volle Geschäftsunfähigkeit resultierte. Die Betroffenen konnten nicht mehr selbst rechtlich handeln. Eine fundamentale Änderung fand durch das Betreuungsrecht 1992 statt: Seitdem steht der Mensch mit seinem Unterstützungsbedarf im Vordergrund; Einschränkungen der Freiheitsrechte lassen sich nur rechtfertigen, wenn der Betroffene bei seinem Recht auf Selbstbestimmung gefördert wird. Es gibt keine Betreuung gegen den freien Willen des Betroffenen, das Handeln des Betreuers muss sich am Wille und Wohl des Betreuten orientieren. Solange der Betreute etwas möchte, in der Lage ist, darüber mit seinem freien Willen zu entscheiden, und kein anderer dadurch geschädigt werde, gelte der Wille des Betreuten. Das stoße in Einrichtungen allerdings oft an Grenzen. Nach dem sog. Erforderlichkeitsgrundsatz gehen andere Hilfen (z.B. durch Nachbarn, die Familie..) der Einrichtung einer Betreuung vor. Der Erforderlichkeitsgrundsatz besagt auch, dass die Betreuung nur so umfangreich sein darf und so lange dauern darf, wie sie unbedingt notwendig ist. Außerdem soll ein Betreuer den Betreuten beraten und unterstützen und nur dann stellvertretend tätig sein, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Doch die Praxis sei oft mangelhaft, da gebe es z.B. Anordnungen zur Betreuung von „sehr fürsorglichen Richtern“, die Betreuungen in allen Angelegenheiten einrichten würden, damit die betreuenden Eltern es einfacher hätten. . Einige berufliche Betreuer würden „schnelle Entscheidungen“ favorisieren und daher häufig stellvertretend tätgi sein, statt das zeitintensive Gespräch mit dem Betreuten zu suchen. Manche Eltern versäumen aufgrund einer überfürsorglichen Haltung den Ablöseprozess und behandeln den erwachsenen Betreuten immer noch wie ein Kind, für das man als Eltern entscheidet. Theoretisch sei viel möglich und gesetzlich auch so vorgesehen, praktisch werde allerdings zu wenig davon gelebt. Als neuen wichtigen Schub für das Betreuungsrecht bezeichnete Dr. Leonhard die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) mit ihrer menschenrechtlichen Ausrichtung. Im Artikel 12 wird die Rechts- und Handlungsfähigkeit von Menschen mit Behinderung geregelt (gleiche Anerkennung vor dem Recht). Die UN-BRK verbiete grundsätzlich stellvertretende Entscheidungen und Systeme, zulässig sei nur Assistenz. Hier gelte Selbstbestimmung als oberstes Primat. Die Referentin hielt diesmit Blick auf schwerste 3 Beeinträchtigungen bei geistiger Behinderung für problematisch. Die Radikalität der UNBRK würde konsequenterweise bedeuten, dass ein Mensch keine Behandlung erhalte, wenn er – trotz Unterstützung – keinen freien Willen bilden könne. Dennoch: Die Radikalität der UNBRK treibe in vielen Ländern, vor allem dort, wo noch unvorstellbare Zustände existieren, die Auseinandersetzung um Selbstbestimmung produktiv voran. Aber auch für das deutsche Betreuungsrecht in seiner gelebten Praxis gebe es noch genügend Veränderungsbedarf. Zum Betreuungsrecht, zu abgelehnten Betreuungen oder über die Gesamtzahl der Betreuungen sei keinerlei Zahlenmaterial vorhanden. Zukünftige Forschung müsse an diesen Stellen ansetzen, so Leonhard. Die Referentin schloss ihren Vortrag mit einem Hinweis auf die „Vereinbarungen über gute gesetzliche Betreuung“, die auf der Webseite der Lebenshilfe heruntergeladen werden können. Diskussion: Aus dem Publikum gab es anfänglich zunächst mehrere sachliche Fragen: Wer stellt die Eignung von Betreuern fest? Grundsätzlich überprüft die Eignung der zuständige Richter, der sich laufend angemessen fortbilden sollte. Nur wenn keine geeigneten ehrenamtlichen Betreuer gefunden werden, kommen Berufsbetreuer in Frage, so die Referentin. Die ehrenamtlichen Betreuer sollten mehr durch Betreuungsvereine in ihren Grundkompetenzen geschult werden. Wenn emotionale Verstrickungen entstanden sind, sollten Berufsbetreuer oder andere ehrenamtliche Betreuer eingesetzt werden. Laut UNBRK dürfte es überhaupt keine Betreuung geben, so ein anderer Zuhörer. Welche Veränderungen würden beim Betreuungsrecht in Richtung UNBRK unternommen? Die Referentin zählte dazu einige Beispiele auf, in denen – mit ausdrücklichem Bezug auf die UNBRK – die Wünsche der Betreuten stärker mit einbezogen werden müssen. Die Radikalität der Forderung des Artikels 12 hielt die Referentin für „nicht zielführend“. Nach der UNBRK zähle nur der Wille einer Person, nicht das, was dem „Wohl oder Interesse“ entspreche. Das sei „praxisfern“. Praxis sei leider auch, die gesetzlichen Betreuer hätten zu wenig Zeit für ausführliche Kommunikation mit den Betreuten. Assistenz und Unterstützung nach der UNBRK müsse „soweit wie möglich ausgedehnt werden“, so die Referentin, und Betreute sollten noch vielmehr - selbst bei kleinsten – Entscheidungen mitwirken. Andererseits brauche man „einen Rest an Schutz“. Auf eine bedenkliche Entwicklung in Berlin in dem Betreuungsrechtzusammenhang wies eine weitere Zuhörerin hin: Immer mehr alte Menschen würden in Berlin nach BGB oder PsychKG zwangsuntergebracht. Zum Abschluss formulierte Michael Zander: „Wir reden alle über schöne Begriffe wie Inklusion und Empowerment und vergessen darüber, dass es die Praxis der Zwangsunterbringung bzw. behandlung noch gibt. Diese Phänomene werden im aktuellen Diskurs ausgeblendet.“ Je größer die Diskrepanz von UNBRK und Praxis sei, desto stärker könne der Zynismus gegenüber der Konvention werden. Die UNBRK sei ein gutes Beispiel für Empowerment, meinte Zander. Dr. Bettina Leonhard ergänzte: „Die Betroffenen können untereinander sehr gut selbst Empowerment betreiben“, was am Beispiel der Werkstatträte bei Menschen mit geistiger Behinderung deutlich werde. Die Radikalität der UNBRK, z.B. die Abschaffung der Werkstätten, zwinge alle zum Ausloten bisher ungenutzter Möglichkeiten. Abschließend gab noch ein Betroffener, der 30 Jahre im Heim lebte, sein Statement: „Heime gehören abgeschafft!“ Und: „Was können wir gegen dumme Gutachter machen?“