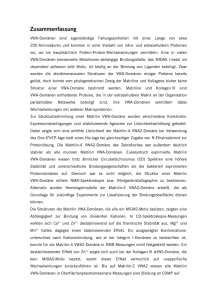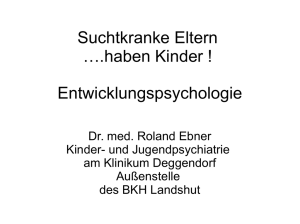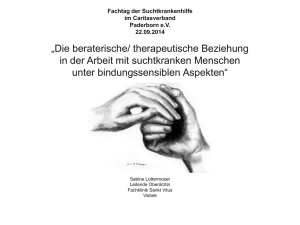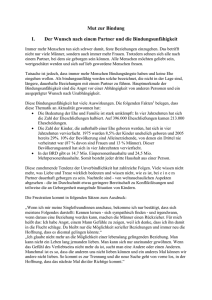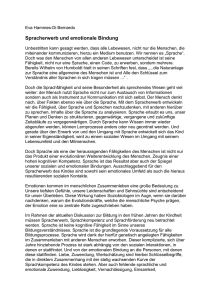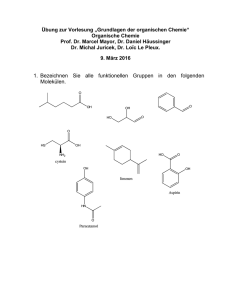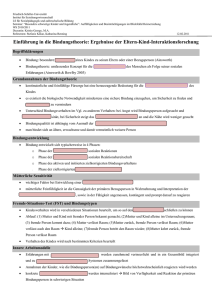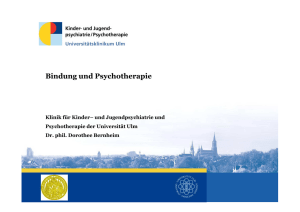Dr. Claus Koch Beziehungskompetenz – bindungstheoretische
Werbung

Dr. Claus Koch Beziehungskompetenz – bindungstheoretische Überlegungen zum Umgang mit herausfordernden Schülern im Unterricht Vortrag auf dem Beltz Bildungsforum am 6. November 2015 (Dieses Vortragsmanuskript ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. © Claus Koch 2015) Ein respektvoller, authentischer, die Integrität des Schülers achtender Umgang in Schule und Unterricht erscheint vielen von uns wie eine Selbstverständlichkeit. Spätestens aber in der alltäglichen Begegnung mit herausfordernden Schülern merken wir, dass dem keineswegs so ist. Wir bemerken bei uns selbst Gefühle und Reaktionen, die wir eigentlich gar nicht zeigen wollen, verlieren manchmal die Geduld, suchen die Schuld beim Schüler, seinen Eltern oder im „System“, wir regen uns auf, resignieren, verzweifeln, versuchen es noch einmal, sind frustriert und fühlen uns unendlich wohl, wenn es trotzdem gelingt, die Situation zu meistern. Der folgende Vortrag will dieser in Schule und Unterricht nahezu ständig auftretenden Dynamik, der viele Lehrerinnen und Lehrer häufig hilflos entgegenstehen, ein hilfreiches Handwerkszeug aus der Bindungstheorie und der skandinavischen Forschung über „Beziehungskompetenz“ beiseite stellen. Sein Ausgangpunkt ist die mittlerweile noch selten, aber theoretisch wie praktisch gut belegte These, dass neben didaktischen Fähigkeiten, neben der fachkundigen Stoffvermittlung und dem, was man gemeinhin als „Classroom Management“ bezeichnet, eine weitere Komponente aufseiten der Pädagogen mitentscheidend für eine gelungene Schule und gelungenen Unterricht ist - und für einen entsprechendem Lernerfolg aufseiten der Schüler. Diese Komponente bezeichnen wir im Folgenden als Beziehungskompetenz der Lehrerin und des Lehrers, die auf den Kenntnissen darüber beruht, wie man eine gut funktionierende Beziehung zum Schüler aufbaut, die auf Empathie, Respekt und Toleranz gründet, mit anderen Worten, wie man zwischen Schüler und Lehrer ein positives Resonanzverhältnis herstellt, das beide Seiten in ihrer Beziehung zueinander „zum Klingen“ bringt. Die bisherige Forschung hat diesen Beziehungsaspekt im klassischen didaktischen Dreieck bislang sträflich vernachlässigt, und ebenso findet er in der Lehrerausbildung nur ungenügend Berücksichtigung. „Beziehungen“ würden und sollten in der Schule keine Rolle spielen, zum einen, weil sie sich ja irgendwie wie von selbst ergeben würden, bzw. jede Lehrerin und jeder Lehrer nun mal so sei, wie sie oder er ist. Zum anderen weil man in der Art, zwischenmenschliche Beziehungen herzustellen, eher die Persönlichkeitseigenschaft eines Lehrers sieht als eine, vielleicht sogar die entscheidende Variable für erfolgreiches Lernen. Der Vortrag soll aufzeigen, dass es sich bei der Beziehungskompetenz des Lehrers, der Lehrerin keinesfalls um eine „angeborene“ Eigenschaft handelt, sondern dass sie sich, wenn man so will, lernen und ausbilden lässt. Dazu bedarf es 1 1. bestimmter entwicklungspsychologischer Kenntnisse vom Kind und seinem Verhalten, die zum Verständnis des Schülerverhaltens beitragen und 2. der Reflexion des eigenen Fühlens und Denkens in dem zum Kind gerade gegebenen Verhältnis. Zur Erläuterung nutzen wir zum einen die von dem Briten John Bowlby in kritischer Auseinandersetzung zur Psychoanalyse in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte Bindungstheorie sowie die theoretischen wie praktischen Arbeiten der „skandinavischen Gruppe“ zum Paradigmenwechsel in der Entwicklungspsychologie und zur pädagogischen Beziehungskompetenz um Helle und Elsebeth Jensen, Jesper Juul und Marie Luise Schibbye. In diesem Vortrag führen wir beide Ansätze erstmalig zusammen. Ausgehend von diesen beiden Ansätzen lässt sich „Beziehungskompetenz“ zunächst wie folgt definieren: „Beziehungskompetenz ist die professionell ausgeübte Fähigkeit, das einzelne Kind in seiner individuellen Eigenheit zu sehen, es zu verstehen, ihm mit Offenheit und Respekt zu begegnen und das eigene Verhalten darauf abzustimmen. Beziehungskompetenz zeigt sich u.a. in der Fähigkeit zu einem authentischen Umgang mit dem Kind und in der Annahme und Achtung seiner Integrität. Die Verantwortung für die Qualität der Beziehung liegt bei der Pädagogin bzw. dem Pädagogen.“ Koch, nach Jensen u.a. (2015) Das klingt anspruchsvoll und auf den ersten Blick fast nicht zu bewerkstelligen, aber wir werden sehen, dass es mit dem nötigen Rüstzeug gar nicht so schwierig ist, sich dieser tragenden Säule im Verhältnis zwischen Lehrer, Schüler und Stoffvermittlung zumindest anzunähern. Ausgangpunkt unserer Überlegungen sind (1) die wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnis, dass alle Kinder mit sozialen Kompetenzen geboren werden und von Geburt an das existenzielle Bedürfnis haben, mit anderen eine Bindung, und dafür Beziehungen, einzugehen. (2) dass es für ihre gesunde körperliche und psychische Entwicklung notwendig ist, dass ihre nächsten Bezugspersonen auf ihren Beziehungswunsch fürsorglich mit Gesten und Worten eingehen, und sich auf diese Weise zwischen Mutter/Vater und Kind ein ursprüngliches Resonanzverhältnis herstellt, das beim Kind zu einer Art Urvertrauen in sich selbst und seine Umgebung führt. (3) dass die Kinder, um sich in diesem Resonanzverhältnis als wertvoll und anerkannt zu fühlen, immer wieder den Kontakt mit den Erwachsenen suchen in der Hoffnung auf ein liebevolles und positives Feedback ihres Verhaltens und hierfür von Geburt an bereit sind zur Kooperation. Verhaltensauffälligkeiten, die Kinder in Schule und Unterricht zu herausfordernden Schülern werden lassen, beruhen zum großen Teil auf einer Störung solcherart Beziehungsdynamik, sich angenommen, respektiert, wertvoll und anerkannt zu fühlen. Zumeist liegt ihnen eine Beziehungsstörung zugrunde, deren Ursprung in der frühen Bindungsgeschichte des Kindes zu suchen ist. Im Schul- und Unterrichtsgeschehen leben solche Beziehungsstörungen wieder auf, da die Dynamik der Beziehung zwischen Kind und Lehrerin bzw. Lehrer der zwischen Kind und Eltern in mancherlei Hinsicht nicht unähnlich ist. In beiden Fällen haben wir es mit einer asymmetrischen Beziehung zu 2 tun, der ein Macht- und Abhängigkeitsverhältnis zugrunde liegt. In beiden Beziehungen spielen – übrigens nicht nur bei den jüngeren Schülern - Zuneigung und der Wunsch, bestätigt zu werden und damit die Angst vor ungerechter Behandlung eine bedeutende Rolle; hinzukommt, insbesondere bei den jüngeren Schülern, das Bedürfnis, sich auch in der Schule sicher und geborgen zu fühlen. Anhaltende und tiefgreifende Störungen im Unterricht lassen sich deswegen dauerhaft nicht „technisch“ oder „verhaltenstherapeutisch“ (durch Strafen, Notengebung, Sitzordnung etc.) beheben, zumal das auffällige Verhalten des Kindes ja „unter verkehrtem Vorzeichen“ durchaus sinnvoll ist, indem es seinem Wunsch entspricht, Vertrauen geschenkt zu bekommen, beachtet zu werden, Resonanz herzustellen und zu kooperieren, auch wenn sein Verhalten diesem Ziel äußerlich scheinbar entgegensteht. Disziplinarische Mittel mit dem Ziel, das Verhalten des Schülers zu verändern, bedrohen ihn zusätzlich in ihrer oder seiner Integrität (Juul/Jensen 2012) und verstärken in den meisten Fällen nach kurzfristigen Erfolgen sein auffälliges Verhalten. Diese auf den ersten Blick nicht immer zu erkennende Beziehungsdynamik gilt es im Umgang mit herausfordernden Schülern zu berücksichtigen. Dazu sind Kenntnisse, die sich aus der von John Bowlby und Mary Ainsworth entwickelten und in Deutschland von Karin und Klaus Grossmann bzw. Karl Heinz Brisch empirisch validierten Bindungstheorie nützlich, Kenntnisse, die sich mühelos auch auf den Schulalltag übertragen lassen. Exkurs Bindungstheorie „Bindungen sind ein fundamentales menschliches Bedürfnis und eine Quelle der emotionalen, sozialen, sogar kulturellen Identität des Menschen.“ Grossmann/Grossmann (S.17) „Bindung ist das gefühlsgetragene Band, das eine Person zu einer anderen spezifischen Person anknüpft und das sie über Raum und Zeit verbindet.“ Mary Ainsworth Sehen wir uns zunächst an, wodurch sich Bindungsverhalten definiert und welche Auswirkungen es hat: „Bindungsverhalten begreift man als jegliche Form von Verhalten, das zum Ergebnis hat, dass eine Person die Nähe zu einem anderen bevorzugten Individuum erlangt oder aufrechterhält.“ John Bowlby Bindungsverhalten ist verschieden von Fütterverhalten und Sexualverhalten und ist im menschlichen Leben mindestens ebenso bedeutsam. Durch Angst und Trennung wird das Bindungsbedürfnis aktiviert. Durch körperliche Nähe und zunehmend durch Gesten und Worte wird das Bindungsbedürfnis wieder beruhigt. Im Verlauf einer gesunden Entwicklung führt Bindungsverhalten zu affektiven Banden und Bindungen, anfangs zwischen Kind und Elternteil und später zwischen Erwachsenen und Erwachsenen. Die Verhaltensformen und die Bande, zu denen sie führen, sind über den ganzen Lebenslauf gegenwärtig und aktiv. Das Verhalten, das dem Bindungsverhalten komplementär ist und einer ergänzenden Funktion dient, ist das Fürsorgeverhalten. Die hauptsächlichen Faktoren, die über den Weg entscheiden, an dem entlang sich das Bindungsverhalten eines Individuums entwickelt, und über das Muster, in dem es organisiert wird, sind Erfahrungen mit Bindungsfiguren im Säuglingsalter, in der Kindheit und in der Adoleszenz. 3 Ausgangspunkt der Bindungstheorie ist die Beobachtung, dass der Säugling seit seiner Geburt, anfangs allein aus dem Grund zu überleben, und bereits in den ersten Lebensmonaten eine spezifische emotionale Bindung zu seinen engsten Bezugspersonen herstellt, zumeist zur Mutter und etwas später (ab 3 bis 6 Monaten) zum Vater. Wichtig in unserem Zusammenhang ist die Tatsache, dass das Kleinkind diese Bindung aktiv betreibt, sie zunächst mithilfe von Gesten, Weinen, Lachen usw. herstellt und aufrechterhält, später mit Worten und immer differenzierteren Handlungen. Abhängig von der Resonanz, die das Kind auf seine Bemühungen bekommt, eine Bindung in einem aktiven Austauschprozess zu seinen Bezugspersonen herzustellen, wird die Bindungsperson zu einem „Basislager“, das ihm die nötige Sicherheit vermittelt, von sich aus die Welt zu erkunden. Mit der gelingenden Bindung entwickelt sich eine Art Urvertrauen in die Bezugspersonen, das sich im Laufe der Entwicklung des Kindes als internalisiertes und affektiv konnotiertes Bild auch auf andere Menschen, die eine Beziehung mit ihm eingehen, übertragen werden kann. Im umgekehrten Fall, wenn die Bindung in der frühen Kindheit nicht gelingt, fehlt dem Kind das Vertrauen sowohl in sich selbst wie in den „Anderen“. Über eine „sichere Bindung“ entscheiden maßgeblich die ersten Lebensjahre, trotzdem bleibt das Kind auch anderen Erwachsenen außerhalb seiner primären Bezugsperson offen. So kann ein unsicher gebundenes Kind mit sechs Jahren und später durchaus eine sichere Bindung an eine Betreuerin oder einen Lehrer entwickeln. Das Konzept der „Feinfühligkeit“ Das Konzept der Feinfühligkeit geht zurück auf die Bindungsforscherin Mary Ainsworth und ihr klassisches Experiment „Fremde Situation“. Feinfühligkeit spielt die bedeutendste Rolle im Bindungsgeschehen und drückt sich aus über Berührung, Blickkontakt, Gesten, Gesichtsausdruck und Sprache. Feinfühligkeit sorgt für eine sichere Bindung und auch für die Beziehungskompetenz des Kindes. Mütterliche Feinfühligkeit in der Kommunikation mit dem Baby bedeutet: 1. 2. 3. 4. Die Wahrnehmung des Befindens des Säuglings, das Kind „im Blick“ haben Die richtige Interpretation der Äußerungen des Säuglings aus seiner Sicht Eine unmittelbare Reaktion, die die Wirksamkeit seines Verhaltens bestätigt Einen angemessenen Wechsel von Beruhigung oder Anregung. Aus der Art des Bindungsgeschehens, das sie bei den Müttern zusätzlich durch Interviews, Beobachtungen und Fragebögen ermittelte, hat die Bindungsforscherin Margaret Ainsworth empirisch vier Bindungstypen ermittelt, und zwar Die sichere Bindung Die unsicher - vermeidende Bindung Die unsicher - ambivalente Bindung Die desorganisierte Bindung Diese „Bindungstypen ließen sich anhand von Tiefeninterviews, Fragebögen usw. sowohl bei Kindern wie auch bei Jugendlichen du Erwachsenen empirisch bestätigen. 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In dem Experiment „Fremde Situation“ wurde, sehr verkürzt dargestellt, getestet, wie ein etwa einjähriges Baby darauf reagiert, dass eine fremde Person in den Raum kommt, in dem es sich zunächst mit seiner Mutter allein aufhielt. Immer dabei ist die Testleiterin, die sich auch an das Kind wendet. Wie reagierte das Kind? War es in der Lage, zu der Peron eine Beziehung einzugehen? Dann verließ die Mutter den Raum für kurze Zeit. Wie reagierte das Kind darauf? Zeigte es Trennungsschmerz, suchte es nach seiner Mutter? Danach betrat die Mutter wieder den Raum und die fremde Person verließ ihn. Wie reagierte das Baby? Schließlich wurde das Baby für kurze Zeit ganz allein gelassen, dann nur mit der fremden Person und am Ende kam die Mutter zurück. Hauptkennzeichen einer sicheren Bindungsqualität: Ist die Mutter im Raum, erforscht das Kind neugierig seine Umwelt Bleibt die Mutter trotz Rufens weg, erstirbt seine Erkundungslust Kehrt die Mutter zurück, suche sie ihre Nähe Nach kurzen Trösten können sie ihr Spiel fortsetzen Das Kind kann insgesamt Nähe und Distanz der Bezugsperson angemessen regulieren Verhalten der Mütter: Suchen die affektive Nähe des Kindes, beobachten sein Verhalten und stellen sich darauf ein. „Unsicher vermeidend“ Die Kinder zeigen eine Pseudounabhängigkeit von der Bezugsperson. Sie zeigen auffälliges Kontakt-Vermeidungsverhalten und beschäftigen sich primäre mit dem Spielzeug im Sinne einer Kompensationsstrategie. Die Kinder lassen kaum Trennungsleid erkennen, weinen nicht, solange noch jemand bei ihnen ist und vermeiden, der zurückkehrenden Bindungsperson gegenüber Bindungsgefühle zu zeigen Verhalten der Mütter: Aversion gegen Bindungssignale der Säuglinge; Besorgnis, das Kind zu verwöhnen; Wünsche nach Zärtlichkeit werden, wenn überhaupt, nur sporadisch und kurz erfüllt Unsicher – ambivalente Bindung: Die Kinder verhalten sich widersprüchlich anhänglich an die Bezugsperson. Die Kinder wirken bei der Trennung massiv verunsichert, weinen, laufen zur Tür, lassen sich kaum beruhigen. Bei Wiederkehr der Bezugsperson zeigen sie abwechselnd anklammerndes und aggressivabweisendes Verhalten. Die Kinder sind hyperaufmerksam, sie verfolgen jede Bewegung der Mutter, ob sie ein Zeichen für eine Trennungsabsicht verrät. Die Kinder scheinen in einer neuen Umgebung ständig Angst davor zu haben, die Bindungsperson zu verlieren. Verhalten der Mütter: Widersprüchliches, übertriebenes und dramatisch wirkendes Verhalten, theatralisch, eine Mischung aus Angst, Aggressivität und Ärger. Sie reagieren selten, und wenn, völlig unvorhersehbar auf die Signale des Kindes. Desorganisierte Bindung Psychopathologisches Bindungsmuster, das zu schweren Bindungsstörungen führt 5 Die Kinder zeigen in der Testsituation bizarres Verhalten wie Erstarren, im Kreis gehen, stereotype Bewegungen usw. Gründe für die desorganisierte Bindung: Plötzlicher Verlust der Bindungsperson Massive Vernachlässigung Sexuelle Gewalt Körperliche Gewalt Zeuge von massiven Konflikten zwischen den primären Bezugspersonen, zumeist Mutter und Vater ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uns interessieren in unserem Zusammenhang nun insbesondere die Auswirkungen der unterschiedlichen Bindungsmuster: Sicher gebundene Kinder reagieren mit Zuversicht und Hoffnung, dass sie erfolgreich sein können (Selbstwirksamkeit). Bindungs- und Explorationsverhalten halten sich die Waage. Die Bezugsperson ist als sichere Basis internalisiert. Die sichere Bindung dient als Schutzfaktor bei Belastungen. Die Kinder sind mit zunehmendem Alter in der Lage, sich Hilfe zu holen, sie zeigen Mut und Neugierde, Beziehungen einzugehen, sie können sich in andere einfühlen und Rückschläge und Enttäuschungen gut bewältigen. Kinder mit einer unsicher-ambivalenten Bindung haben die Erfahrung gemacht, einmal angenommen und dann wieder abgewiesen worden zu sein, ohne dass sie dafür bei der Bezugsperson Gründe ausmachen können. In der Folge sind sie sich unsicher, ob die Eltern gerade ansprechbar sind oder nicht. Sie sind dadurch anfällig für Trennungsangst, zeigen sich ängstlich bei der Erkundung der Welt, manchmal weinerlich-anklammernd. Derart unsicher gebundene Kinder zeigen später schnell Anzeichen von Hilflosigkeit und Rückzug bei der Bewältigung von Aufgaben. Auf der anderen Seite werden sie als Kinder beschrieben, die übermäßige Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, sie wirken angespannt, impulsiv und leicht frustrierbar oder passiv und hilflos. Kinder mit einer unsicher vermeidenden Bindung haben die Erfahrung gemacht, ihre Gefühle wenig gespiegelt zu bekommen, ihre Bezugspersonen sind eher distanziert und gefühlsabweisend. Sie entwickeln deswegen kaum oder gar keine Zuversicht, dass man hilfreich auf sie reagiert, sie versuchen, ohne Liebe zu leben, sind distanzwahrend, bevorzugen als Schüler und Heranwachsende Aufgaben, die abstrakt sind und wenig mit ihnen selbst zu tun haben. Die Kinder wahren Distanz, sind oft schlecht gelaunt, und neigen dazu, andere Kinder zu schikanieren. Sie wirken empathielos. Lehrer nehmen die ängstlich (unsicher) vermeidenden Kinder als feindselig, isoliert wahr, und die meisten der ängstlich-ambivalenten Kinder als impulsiv oder hilflos (Sroufe (1983) (S. 332). Kinder mit einer desorganisierten Bindung sind sozial sehr auffällig, zeigen häufig ein pathologisch geprägtes bizarres Verhalten, in das sich ihre Umgebung kaum verständnisvoll einfühlen kann. Der Psychoanalytiker und Bindungsforscher Karl Heinz Brisch schätzt auf der Grundlage empirischer Studien, das 60% aller Menschen eine sichere Bindung aufweisen, 20% ein vermeidendes Bindungsmuster zeigen und 10% ein ambivalentes Bindungsmuster. Zu dem desorganisierten, pathologischen Bindungsmuster gehören etwa 5 bis 10%. Das bedeutet: Gut die Hälfte der Kinder entwickelt eine sichere Bindung zur primären Bezugsperson und genießt damit eine Reihe von Vorteilen. Die restlichen Kinder (und Lehrer!) entwickeln eine unsichere Bindung mit vorherrschend vermeidenden und ambivalenten Verhalten. 6 Bindung, Bildung, Lernen und Unterricht Bindung und Bildung gehören in der Tradition der akademischen Psychologie und Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft nicht zusammen, zumal es zwischen beiden Disziplinen nur selten oder gar nicht zu einem fachlichen Austausch kommt. Das behindert bis heute unser Verständnis von den emotionalen Prozessen, wie sie sich auf der Beziehungsebene zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen abspielen und die interessiertes, aufmerksames und erfolgreiches Lernen ermöglichen. Wenn Psychologie Eingang in die Lehrerausbildung findet, dann meistens unter dem Gesichtspunkt der Motivationspsychologie, die einen widerspenstigen bzw. arbeitsunwilligen Schüler quasi implizit voraussetzt. Bindungstheoretische Überlegungen zu erfolgreichem Lernen bzw. Störungen im Lernprozess des Einzelnen hingegen berücksichtigen besonders die existenziellen Bedürfnisse von Kindern, wie das Bedürfnis nach Anerkennung, Kooperation und Resonanz als Grundlage für jede Art von menschlichem Lernen. In dieser Hinsicht wird, wie zahlreiche empirische Studien belegen, das Lernen nachweislich sowohl durch positive, aber auch durch unzureichende Bindungserfahrungen der Kinder im Elternhaus und in der Schule gefördert bzw. beeinträchtigt. Empirische Studien zeigen, dass gute Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit das Selbstvertrauen des Kindes in seine eigenen Fähigkeiten (Selbstwirksamkeit) stärken und einen feinfühligen sozialen Umgang mit Mitschülern fördern (Grossmann und Grossmann 2008). Noch einmal zusammenfassend: Beim Lernen haben sicher gebundene Kinder keine Angst, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben, ihre Beziehung zum Lehrer/zur Lehrerin ist zu Beginn ihrer Schulzeit meistens positiv gestimmt, Zurückweisung, wie sie in der Schule unvermeidbar ist, und Enttäuschungen können sie gut verkraften. Kinder mit unsicheren oder ambivalenten Bindungserfahrungen hingegen suchen häufig übertrieben nach Bindung zur Lehrerin oder zum Lehrer und wenden sich enttäuscht oder wütend ab, wenn ihre Suche nach Resonanz nicht belohnt wird. Zurückweisung löst bei ihnen häufig heftige Gefühle aus, sowohl aggressives Verhalten, aber auch kompletten Rückzug vom Unterrichtsgeschehen. Beim Lernen zeigen sie häufig Angst, sich auf neues, d.h. unsicheres Terrain zu begeben, und sie leiden besonders unter disziplinarischen Maßnahmen und schlechter Benotung, weil sie diese als Angriff auf ihre ganze Person empfinden und weniger auf ein bestimmtes Verhalten. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder zeigen sich oft bewusst autonom, wirken manchmal arrogant und distanziert – hinter diesem Verhalten steht aber auch das Bedürfnis nach Anerkennung. Obwohl das Bindungsgeschehen also auf Verhalten und Lernprozesse einen großen Einfluss hat, ist das heutige Schulsystem – vielleicht mit Ausnahme der ersten Grundschulklassen - überwiegend bindungsvermeidend organisiert. Überfüllte Klassenräume, hierarchische Strukturen, der erzwungene Gleichschritt im Lernen und eine permanente Bedrohung durch schlechte Noten verstärken besonders die negativen Bindungserfahrungen von Kindern, was bei ihnen, den bindungsunsicheren Kindern, schnell zu Ohnmachtsgefühlen, Interesselosigkeit und Apathie, aber ebenso auch zu Verhaltensauffälligkeiten führt, die meistens dazu dienen, mit unterschiedlichen Mitteln die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. 7 Führt solches Verhalten dann zu keinem Erfolg oder wird bestraft, gerät das Kind durch die erneute Erfahrung, nicht akzeptiert, nicht „wertvoll“ zu sein, in einen Teufelskreis, aus dem es allein nicht mehr herausfinden kann. Lehrerinnen und Lehrer stehen der ihnen jetzt zufallenden Aufgabe, dem Kind aus diesem Teufelskreis herauszuhelfen, oft hilflos gegenüber, wobei ihre Hilflosigkeit zum Teil auch auf ihre eigenen Bindungserfahrungen als Kind zurückzuführen ist. Das klassische didaktische Dreieck wird leider immer noch so definiert, dass es im Unterricht hauptsächlich um die Sache, also die Beziehung aller Beteiligten zum Lerngegenstand geht, ein Prozess, der die Beziehungsebene zwischen den verschiedenen, beteiligten oder nicht beteiligten Akteuren in diesem Geschehen oft komplett ausblendet. Der Soziologe Hartmut Rosa stellt in diesem Zusammenhang einem „Resonanzdreieck“, in dem der Lehrer seine Schüler erreicht, ein „Entfremdungsdreieck“ gegenüber, in welchem der Lehrer den Schüler eher als Bedrohung empfindet und sich der Schüler dem Lernstoff gegenüber völlig indifferent verhält. Die Beziehung zum Kind als ein von Geburt an sozialem Wesen Bis weit in die 70er Jahre des letzten Jahrzehnts war die Vorstellung von einem Kind als bei seiner Geburt asozialem und triebgesteuerten Wesen vorherrschend, eine Auffassung, die besonders durch die Wiederentdeckung der Psychoanalyse neue Nahrung erhielt. Ein zweiter Ansatz, der Behaviorismus, sah das Kind eher als „black box“, die es mithilfe von Konditionierung und Verstärkung zu füllen und formen galt. Beiden Konzepten ist eigen, dass sie den Auftrag pädagogischer Institutionen vor allem darin sehen, aus Kindern soziale Wesen zu machen. Gemäß dieser Logik, die sich in populären Konzepten und mancher didaktischen Handreichung bis heute gehalten hat, liegt der Ursprung sozial abweichender Handlungsmuster beim Kind. Damit werden Eltern und Lehrer/innen zu mächtigen Akteuren im Erziehungs- und Bildungsprozess, kommt ihnen doch die Rolle zu, die Kinder dem Sozialkodex der Erwachsenen anzupassen. Erstaunlich viele Vorstellungen gehen bis heute noch auf diese wissenschaftlich längst überholte Sichtweise zurück. Andererseits aber befindet sich derzeit dieses alte Paradigma mit der zunehmenden Auflösung einer „Gehorsamskultur“ in einer Krise (Juul/Jensen 2012). In pädagogischen Institutionen sorgt dies für zunehmende Unsicherheit und auch Hilflosigkeit. Als Alternative zu den hergebrachten Auffassungen lassen sich die neuen Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, wie sie sich aus der Bindungstheorie und Beziehungsforschung in den letzten drei Jahrzehnten ergeben haben, aber für Lehrer und Lehrerinnen gut nutzen. Das Kind als von Anfang an auf wechselseitigen Austausch mit seinen Bezugspersonen hin motiviertes soziales Wesen - dies ist auch der Kern des von der „skandinavischen Gruppe“ beschriebenen Paradigmenwechsels in der Entwicklungspsychologie. Damit aber wird der Entwicklungsprozess von Kindern in hohem Maße von der – guten oder schlechten - Qualität solcher reziproken Beziehungen abhängig, denn davon, und das lassen Resonanzkonzepte häufig unberücksichtigt, hängt ihre Resonanzfähigkeit ab. Dass eine solche Sicht einen ganz anderen erzieherischen und pädagogischen Einsatz erfordert, liegt auf der Hand. Resonanzprozesse und ihre Wirkung im pädagogischen Raum Als besonders wichtig in Hinblick auf pädagogische Prozesse folgt aus dem angesprochenen Paradigmenwechsel, dass das Kind sein soziales Handeln nicht nur einfach als wirksam, sondern auch als wertvoll inszeniert, indem es beabsichtigt, darüber eine entsprechend positive Resonanz beim 8 Gegenüber zu erzeugen („der/die andere mag mich, deshalb geht sie/er auf mich ein“). Ängste, dass das eigene Handeln zu Nichtbeachtung („ich bin nicht wirksam“ oder zu Tadel oder Bestrafung („mein Verhalten ist nicht wertvoll“) führt, blockieren selbstständige Handlungs- und Lernprozesse des Kindes und provozieren auffällige Verhaltensweisen. In diesem Zusammenhang ist noch ein weiterer, für pädagogische Prozesse zentraler und bereits angesprochener Gesichtspunkt zu betrachten, nämlich der seit der Geburt des Kindes unbedingte Wille des Kindes zur Kooperation und den daraus entstehenden innerpsychischen Konflikten, wenn es dem Kind an Resonanz und Beachtung mangelt. Ein Kind hat das existenzielle Bedürfnis zusammenzuarbeiten, um sich positiv zu entwickeln. Quasi instinktiv weiß das Neugeborene, dass es kooperieren muss, nicht nur, um zu überleben, sondern auch, um in die soziale Gemeinschaft, die es umgibt, aufgenommen zu werden. Die empirisch vielfach bestätigte Auffassung, dass Kinder von Anfang an sozial kompetent sind und kooperieren wollen, impliziert also, dass Kinder zunächst bestrebt sind, immer nur ihr Bestes tun, um mit ihrer Umgebung zusammenzuarbeiten! Nimmt die Umgebung des Kindes dieses Angebot an, reagiert entsprechend emphatisch und feinfühlig, entsteht daraus ein auf gegenseitiger Anerkennung beruhender wechselseitiger Prozess von Lernen und Entwicklung – eine für alle förderliche und fruchtbare Resonanzbeziehung. Das Bedürfnis des Kindes, immer sein Bestes zu geben, um sich in der Beziehung zum nahen Erwachsenen wertvoll zu fühlen bedeutet aber auch, dass es versucht, mit jeder Form von erwachsenem Verhalten zusammenzuarbeiten, egal ob es für sein eigenes Leben konstruktiv oder destruktiv ist. Ist letzteres der Fall, gerät das Kind in einen Konflikt, sowohl sein existenzielles Bedürfnis nach Anerkennung zu befriedigen wie auch seine persönliche Integrität zu wahren. Das kann zum einen darauf hinauslaufen, dass es sich in solchen Situationen, in denen es sein Verhalten nur danach ausrichtet, „um zu gefallen“, immer mehr anstrengen muss, wenn die Anerkennung von außen ausbleibt – es passt sich noch mehr an, bis sein eigenes Ich förmlich erlischt und die Kraft nicht mehr vorhanden ist, die Situation zu steuern. Oder es geht den umgekehrten Weg und versucht auf den inneren Konflikt, der es bewegt, aufmerksam zu machen, indem es sich wehrt – und zwar durch sozial auffälliges Verhalten jedweder Art. Dieses Verhalten ist insofern sinnvoll, als das Kind versucht, seine existenzielle Integrität zu wahren, mit anderen Worten darauf aufmerksam macht, dass es sich in seiner Identität bedroht fühlt. Die meisten Störungen des Verhaltens, der Konzentration und der Aufmerksamkeit von Kindern haben somit ihre Wurzeln in frühkindlichen Beziehungen, die in der Schule wieder aufleben. Denn im Unterricht spielen im Rahmen der Wissensvermittlung Anerkennung (nicht zu verwechseln mit Lob), Akzeptanz, Achtung der Integrität des Schülers, das Gefühl des “Angenommenseins“ etc. eine wesentliche Rolle – übrigens „auf beiden Seiten“! Herausfordernde Schüler Für viele herausfordernde Kinder sind Lehrer die erste Erfahrung von stets anwesenden, zuverlässigen Erwachsenen. Darin besteht eine große Chance – wiederholen sich allerdings frühkindliche, für das Kind schädliche Bindungsmuster, zum Beispiel durch Ignoranz, Ablehnung, Zynismus oder Zurückweisung, wird das auffällige Verhalten des herausfordernden Kindes entweder gestärkt oder das Kind zieht sich vom Schulgeschehen vollständig zurück. 9 Obwohl die herausfordernden Kinder nur einen geringen Teil der Schülerschaft ausmachen, nehmen sie einen sehr großen Teil der Aufmerksamkeit des Lehrers in Anspruch. Man könnte auch von, wie vielerorts noch üblich, „anstrengenden“, „störenden“, „ungezogenen“ Kindern sprechen, oder von Kindern mit sozialen Problemen, Kindern mit Lernstörungen usw. – ich selbst bevorzuge den von Juul und Jensen benutzten Begriff „herausfordernde Kinder“ (Juul/Jensen 2012), weil er ein beziehungsmäßiges Phänomen beschreibt, statt Kinder nach ihrem Verhalten zu kategorisieren und stigmatisieren und weil er andeutet, dass die pädagogische Verantwortung zur Lösung der Probleme beim Lehrer oder der Lehrerin liegt. Gerade Kinder haben oft Schwierigkeiten, ihre Probleme so mitzuteilen, dass sie der andere versteht. Oft aus Schuld- und Schamgefühlen, häufig aber auch, weil sie in destruktive Prozesse mit ihren nächsten Bezugspersonen verwickelt sind, die sie als solche nicht anerkennen wollen, von mangelnder Aufmerksamkeit bis hin zu Vernachlässigung und Missbrauch. Auch äußere Ereignisse können über ein Kind „hereinbrechen“ und es fühlt sich unfähig, darüber zu sprechen, sei es Trennung der Eltern, der Tod eines nahestehenden Verwandten, der Wegzug eines Freundes etc. Allerdings zeigen sie häufig über ihr Beziehungsverhalten, zu dem sämtliche Ausdrucksmöglichkeiten von Gesten, Bewegungen bis zu sprachlichem Ausdruck zählen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Unruhe, Konzentrationsmängel, Rückzug, Aggression, Streitlust, ständige Suche nach Aufmerksamkeit, Beleidigungen, Mobbing usw. dienen dazu, auf sich und das Problem, welches unausgesprochen bleibt, hinzuweisen. In diesem Sinne ist jedes Verhalten sinnvoll. Es ist Aufgabe des Lehrers, einer solch fehlgeleiteten Kommunikationsform Sinn zu geben, indem er zunächst die Integrität des Schülers wahrt, was heißt, seine – „falsche“ Ausdrucksform nicht sofort „bekämpft“, sondern sie als an ihn gerichtete Botschaft des Kindes oder Jugendlichen annimmt und ihn oder sie damit zunächst in seiner oder ihrer aktuellen psychischen Verfassung akzeptiert, wie er oder sie ist. Gründe für herausforderndes Verhalten aus bindungstheoretischer Sicht: Kommen wir noch einmal auf die Dynamik guter Bindung und sich daraus ergebender Kernkompetenzen für das Kind zurück. In der in den Bindungsprozess eingebetteten Kommunikation fängt das Kind an etwas über sich zu lernen und Gefühle gegenüber anderen zu entwickeln effektiv zu kommunizieren, es gibt und bekommt zurück Vertrauen in Exploration und Lernen zu bekommen Widerstandsfähigkeit gegen Ablehnung zu entwickeln, aber auch nach anderen zu suchen, wenn es Hilfe benötigt Selbstwert zu entwickeln sich auf andere wechselseitig zu beziehen Das alles sind Kernkompetenzen, die dem Kind bei einer gesunden emotionalen Entwicklung mitgegeben werden. Die tägliche Erfahrung verstanden zu werden und dass Ängste und Unsicherheit in Gesten und Worte transformiert werden ist der Kern dessen, was eine Mutter dem Neugeborenen und sich entwickelnden Kind anbieten kann. Das Kind lernt mit seiner Erfahrung, bei Kummer und Unsicherheit getröstet zu werden, gleichsam „vorauszudenken“, es kann eine für es belastende Situation eine Zeit lang gut aushalten, selbst wenn 10 es nicht sofort getröstet wird und fühlt sich dennoch beschützt und aufgehoben. Es hat das Bild der „guten Mutter“ oder des „guten Vaters“ internalisiert, weshalb es bei Ängsten der Ablehnung nicht gleich „handeln“ muss. Fehlt diese Sicherheit, wird meistens sofort reagiert. Herausfordernde Kinder haben folgende Schlüsselerfahrungen gemacht, die zu vermeidenden, ambivalenten und im schlimmsten Fall sogar zu desorganisierten Bindungsmustern geführt haben: Ablehnung statt Zuwendung (fehlende Feinfühligkeit der Mütter) Fehlende Resonanz auf ausgesandte emotionale Signale, weswegen es wenig oder nichts über seine eigenen Gefühle weiß, weil sie ihm nie gespiegelt wurden. Es erwartet einfach nicht, verstanden zu werden. Gefühlsebene Solche oder ähnliche Erfahrungen haben u.a. zur Folge: tiefsitzendes Misstrauen gegenüber Erwachsenen Verhalten, das nur auf Kampf oder Flucht geeicht ist mit wenig anderen Verhaltensoptionen, wenn die Kinder sich unsicher oder ängstlich fühlen unverarbeitete Traumata wenig Bewusstsein für die eigenen Gefühle oder die anderer einen verwirrten Sinn von dem was richtig und falsch, wahr und unwahr ist Stark erhöhte Vigilanz (immer auf der Hut sein), um sich gegen Unsicherheit und vor Risiken zu schützen Ein Gefühl der Herabsetzung und Wertlosigkeit, für niemanden zu zählen Ein tiefer Verlust von Selbstrespekt Das Bedürfnis, Angst und Furcht zu verleugnen, um die Kontrolle im Anblick von Unzuverlässigkeit und tiefer Ungewissheit zu behalten – omnipotentes Verhalten Verhaltensebene Mit all diesen Gefühlen kommen die Kinder in der Schule an – und verhalten sich entsprechend: Draufgängerisches Verhalten, Ängste und Unsicherheiten werden verleugnet Herumlaufen, nicht still sitzen zu können, aus Angst, hilflos bei einem möglichen Angriff zu sein oder um von inneren Ängste abzulenken Immer beobachten, was gerade in der Klasse passiert – dabei große Probleme, dem Lehrer zuzuhören Abwesenheit von Vertrauen und Respekt für Erwachsene und die Autorität, die sie repräsentieren Reaktives und konfrontatives Verhalten Extreme Sensitivität, wenn sie Erniedrigung erfahren oder Fehler machen, die meistens in Aggression umschlägt Sich nicht in andere hineinversetzen zu können Ablehnung und Zurückweisung werden zu Triggern für frühere Verhaltensweisen Unfähigkeit, Nichtwissen zu tolerieren (Unsicherheit) Sich nicht vorstellen können, dass andere wirklich für sie da sind und wenn, dieser Erfahrung nicht zu trauen. 11 Von anderen etwas zu „lernen“ geht nicht, auch nicht, dass andere mir positiv etwas „beibringen“. Schreibblock, aus Angst, etwas von sich mitzuteilen Die Abwesenheit von Vertrauen in die Unterstützung eines Erwachsenen unterstützt die Furcht, sich im Lernen zu engagieren, besonders wenn es unbekannt ist (Angst) oder sogar die eigene Gefühlsebene anspricht – woraus sich regelrechte Lernhemmungen ergeben können und letztendlich sozialer Ausschluss. Beispiele und „Hinweise“ für „sinnvolles“ Verhalten: Nachlassende Schulleistungen in einem Fach: Das Kind will einen Konflikt (zum Beispiel Verlust, Trennung) nicht zeigen bzw. es hat Angst, von seinen Gefühlen überwältigt zu werden, und weigert sich zu schreiben, dafür ist es gut in Mathe. Abwesenheit im Unterricht, Reizbarkeit, Trauer, ohne dass Außenstehende erkennen, worum es geht. Manchmal sind Familien nicht in der Lage oder unwillig, wichtige Ereignisse, zum Beispiel eine Trennung, zu besprechen, und die Kinder tragen Gefühle in sich, die sie nicht ausdrücken können, die sie aber beherrschen und verwirren. Ständiges Herumwandern in der Klasse. Das Kind hat von einem Familiengeheimnis erfahren, dass sein Vater trinkt und seine Arbeit verloren hat. Es will seine Mutter beschützen. Herumzuwandern drückt seine Sorgen und Ängste um die Mutter aus, um das, was außerhalb der Schule passiert, in seiner „anderen“ Welt. Mobbing. Der Mobber erzählt uns vielleicht etwas darüber, selbst Opfer eines anderen zu sein, eventuell auch eines Familienangehörigen, dem man es nie recht machen kann. Andere zu mobben kann auch die Angst ausdrücken, selbst zum Opfer von ungerecht empfundenen Äußerungen zu werden. Schüler, die sich über die Fehler anderer ständig lustig machen. Sie wollen uns vielleicht etwas darüber sagen, wie es sich anfühlt, von anderen ausgelacht und erniedrigt zu werden. Scheinbar grundlose Aggression gegen andere. Aus Angst, selbst angegriffen zu werden, weil der Schüler diese Erfahrung in seinem häuslichen Umfeld ständig macht, kommt er in der Schule den anderen damit zuvor, um nicht wieder „Opfer“ zu sein. Hyperaktivität bei Mädchen. Die Mädchen sind ständig auf der Hut, zeigen sich bei geringen Anlässen aggressiv um einer Missbrauchssituation zuvorzukommen. Umgang mit herausfordernden Kindern „Den Ungehorsamen begleiten, damit er den Weg zu sich selber findet.“ Um Veränderungen in Gang zu setzen, muss man sich bewusst sein, dass man an den einfachsten, den existenziellen Bedürfnissen der Kinder ansetzen muss: Zunächst gehe ich damit auf das Bedürfnis nach Anerkennung und die Angst vor Zurückweisung ein. Anerkennung und Zurückweisung Anerkennung und Zurückweisung sind Schlüsselkategorien für das Verhalten herausfordernder Kinder. 12 Anerkennung Das Bedürfnis nach Wertschätzung ist in der Lehrer- Schüler Beziehung von zentraler Bedeutung, und zwar wechselseitig. Es ist die Aufgabe des Lehrers, diesen Prozess zu organisieren, die Verantwortung dafür liegt bei ihm. Was auch bedeutet: Die Wahrnehmung der Wirklichkeit durch das Kind hat den gleichen Stellenwert wie die Wahrnehmung durch den Erwachsenen. Der Erwachsene muss seine Kontrolle und Macht abgeben, um die „Wirklichkeit“ des Kindes selbst empfinden zu können und darüber eine gleichwürdige Beziehung aufbauen. D. h. er muss offen sein, neugierig, erstaunt, emphatisch, kritisch sich selbst und den eigenen spontanen Gefühlen gegenüber, usw. Zurückweisung Ein Minderwertigkeitsgefühl entsteht oft in Zusammenhang mit Zurückweisung. Während des Heranwachsens und im Laufe des Lebens überhaupt wird es viele Situationen geben, in denen sich der Einzelne zurückgewiesen fühlt oder zurückgewiesen wird, weil es ganz einfach nicht möglich ist, eine Beziehung zu haben, in der die Bedürfnisse beider oder aller Personen jederzeit erfüllt werden können. Das ist im Übrigen auch nicht wünschenswert, denn selbst wenn wir oft nach Harmonie streben, so sind Unterschiedlichkeit und Konflikte die Triebkräfte, die Dynamik und Entwicklung in die verschiedenen Gemeinschaften bringen, die wir bilden. Aber halten wir uns trotzdem kurz dabei auf, wie das Muster herausgebildet wird, mit Zurückweisung und Minderwertigkeitsgefühl fertig zu werden. So sieht es typischerweise aus: Erlebt ein Kind Zurückweisung, spürt das gesunde, kompetente Kind einen Schmerz. Das ist ganz natürlich und ungefährlich, und gehört zur Entwicklung von Persönlichkeit, Selbstgefühl, Selbstverständnis und Empathie dazu. Es ist also nicht die Zurückweisung an sich, die das Ganze für uns später im Leben schwierig gestaltet, sondern die Art und Weise, wie die Umgebung uns gegenüber reagiert, wenn wir als Kinder unseren Schmerz infolge einer Zurückweisung ausdrücken. (Natürlich spielen auch die Häufigkeit und die Intensität der Zurückweisungen eine Rolle.) Zuerst werden Kinder auf die Zurückweisung mit Weinen reagieren und das Kind ist darauf angewiesen, dass die Umgebung diese Reaktion anerkennt und das Weinen des Kindes ernst nimmt. Das heißt nicht, dass das Kind dann das bekommen soll, was zum Gefühl der Zurückweisung geführt hat, sondern dass seine daraus resultierende Traurigkeit anerkannt und angenommen wird. Viele Menschen, natürlich auch Lehrer und Erzieher, haben nicht erlebt, auch für die Gefühle anerkannt zu werden, die das unerfüllte Bedürfnis, sich wertvoll zu fühlen, hervorbringt. Das bedeutet, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt im Leben dazu genötigt waren, sich einige Strategien anzueignen (auch Überlebensstrategien genannt, Juul & Jensen 2002), die sie von dem Schmerz, mit dem ein Kind bei Zurückweisung nicht allein fertig werden kann, ablenken konnten. Diese Strategien sind von Person zu Person verschieden, aber der gemeinsame Zweck ist es, den Schmerz zu vermeiden, den man bei Zurückweisung spürt oder wenn man sich minderwertig oder wertlos fühlt. Hinzukommt, dass meistens eine solche Intensität in diesen frühen Erlebnissen steckt, dass man auch noch als längst Erwachsener so reagiert, als ginge es noch immer um eine Frage von Leben und Tod (oder Überleben), in allen Beziehungen als wertvoll zu gelten. Das heißt, dass unsere Reaktionen auf mangelnde Wertschätzung oder erlebte Zurückweisung im Verhältnis dazu, wie wir sonst »funktionieren«, häufig als kindisch erscheinen. Integrität Das zweite existenzielle Bedürfnis eines jeden Kindes ist, seine Integrität – sein „So-Sein“ zu wahren Bei provozierenden, arbeitsunwilligen oder Chaos produzierenden Kindern klingt das zunächst paradox, genau bei dem anzufangen, was einen am meisten stört. 13 Gehen wir aber einmal ganz in uns und überlegen, was die eigentliche Botschaft des Kindes ist. Sie ist nicht „Bring mir bei, wie ich mich möglichst schnell und reibungslos deinen Vorstellungen unterwerfe“, sondern: „Kümmere dich um mich, so, wie ich gerade bin, und dann bring mir bei, wie ich mir selbst vertraut werden kann und wie andere Menschen es aushalten können, mit mir, so wie ich bin, zusammen zu sein.“ Das heißt nicht, das störende Verhalten des Kindes in einer Art von „Laisser faire“-Verhalten einfach hinzunehmen. Vielmehr geht es jetzt, in diesem Augenblick, zunächst einmal darum, dass dem Kind eine Brücke gebaut wird, indem es eine pädagogische Beziehung erlebt, in der es sich anerkannt und aufgehoben fühlt. Dass sich die oder der Erwachsene für es interessiert, so, wie es gerade ist, dass er in der Lage ist, in seiner pädagogischen Beziehung zu ihm von seinem unmittelbaren Verhalten zu abstrahieren, um es überhaupt erst einmal erreichen zu können und ihm sein Selbstwertgefühl zurückzugeben. Es geht darum, dass sich zwischen Kind und Lehrerin ein kontinuierlicher Prozess zwischen der Sehnsucht des Kindes nach Integrität und dem pädagogischen Interesse, dass es nicht weiterhin den Unterricht stört, entwickelt. Das aber gelingt nur, wenn die existenziellen Bedürfnisse des Kindes anerkannt werden, denn genau darunter leidet es ja, dass dies bislang nicht oder nur unzureichend geschah. Ohne solche „Rückendeckung“ mag das Kind infolge äußeren Drucks zwar sein Verhalten kurzfristig – ändern, aber Kern und Auslöser dieses Verhaltens bleiben unberührt und es tritt bei nächster Gelegenheit wieder auf. Das klingt zunächst kompliziert, aber lässt sich auf der Gefühlsebene viel leicht nachvollziehen: Stellen Sie sich vor, sie sind wütend und aufgebracht, weil Sie sich von jemandem durch sein Verhalten oder seine Worte sehr verletzt und angegriffen fühlen. In dieser Stimmung sagt jemand zu Ihnen: Jetzt ist aber Schluss mit Deiner dauernden Gereiztheit, nimm dich mal zusammen, ich halte dich nicht länger aus. Wie würden Sie reagieren? Richtig: Sie würden dem anderen sagen: Hau doch ab, wenn du mich nicht so erträgst wie ich gerade bin. Ich bin nun mal wütend und gereizt. Akzeptiere das. Und dann sehen wir weiter. Genau in dieser Stimmung befindet sich der betreffende Schüler. Nur dass er oder sie sich nicht nur im Moment gereizt, frustriert oder wertlos fühlt, sondern dass dieses Gefühl ihn und seine Persönlichkeit ganz ausmacht. Mit anderen Worten: Verhält sich der Pädagoge verlässlich und responsiv, steht sie oder er die vielen Krisen und Gefühlsausbrüche des Kindes mit ihm durch und versteht dabei, sein Grenzen setzendes Verhalten Bindungsgesichtspunkten unterzuordnen, was bedeutet, das Kind zunächst in seinem So-Sein anzuerkennen und ihm das Gefühl zu geben, nicht verlassen zu werden, kann ein Kind ein neues, internales Arbeitsmodell von Beziehung aufbauen. Gerade Provokationen und aggressives Verhalten bieten eine gute Gelegenheit, dem Kind in Versorgungs- und Lernsituationen durch neue Beziehungserlebnisse zu zeigen, dass es weiterhin wertvoll ist. Noch einmal: Um Veränderungen in Gang zu setzen muss man sich bewusst sein, dass man an den einfachsten Bedürfnissen ansetzen muss: dem nach Anerkennung! Ablehnung durch Tadel, Noten und bindungslose Beziehungen sind Gift. Einige langfristige Strategien, die herausfordernden Schülern helfen: 14 Im Folgenden möchte ich einige beispielhafte nur einige langfristige ansprechen, die herausfordernden Schülern nutzen: Sicherheit herstellen und Unsicherheit reduzieren. Die Erfahrung sicher zu sein ist das grundlegendste Bedürfnis, um mit Herausforderungen, die immer Unsicherheit mitbringen, adäquat umgehen zu können. Lernen ist nur in einer sicheren Umgebung möglich. Dazu gehören: Vorhersehbarkeit herstellen Zuverlässige Rituale, wenn etwas anfängt, endet, sich verändert Eine Art Wochentagebuch, das alle zukünftigen Geschehnisse klar und konkret benennt Wenn sich an der Schulstunde etwas verändert, ankündigen Körperliches Containment (Aufgehobensein) Im Schulgebäude und Klassenraum für Übersichtlichkeit sorgen, keine Enge zulassen, eine beruhigende Atmosphäre schaffen Wenn sich ein Kind unter dem Tisch versteckt – ihm eine kleine sichere Zone anbieten Die Sicherheit der Aufgabe Schüler die kein Vertrauen in den Erwachsenen haben, wollen autonom arbeiten und vermeiden es, um Hilfe zu bitten. Dadurch umgehen sie etwaige Enttäuschungen. Also muss die Aufgabe auch allein zu bewältigen sein, was auch für die Hausaufgaben gilt. Lerninhalte Geschichten als Metapher für Gefühle und Ängste, emotionale Buchstaben lernen, fremde Themen Projekte ums Haus, Wohnen, sich „geborgen fühlen“. Beruhigende Aktivitäten (Musik, Kunst, Theater) Als Bindungsperson fungieren: Am meisten wird das Verhalten des herausfordernden Kindes von Gefühlen der Angst und Unsicherheit begleitet. Mit Lehrern machen herausfordernde Kinder oft die erste Erfahrung, stets anwesende und zuverlässige Erwachsene zu haben, Erwachsene, die über sie nachdenken und ihrem Denken und Handeln einen Sinn geben. Daraus kann sich nach einer gewissen Zeit die Erfahrung ergeben, verstanden zu werden, Vertrauen erwerben zu können, weil man Tag für Tag die Erfahrung macht, dass sich die Lehrerin als Bezugspersonen an einen erinnert und damit im Leben Konstanz und Kontinuität schafft – alles Voraussetzungen, die überhaupt erst Lernen und Wissen ermöglichen. Dabei ist es für Lehrer wichtig, auch mit seinen eigenen emotionalen Bedürfnissen zu arbeiten. Fühlt sich der Lehrer zum Beispiel nicht geachtet, ängstlich, wütend, nutzlos oder entwertet, sind dies beste Voraussetzungen, um mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Denn jetzt sieht er an sich selbst, 15 was im Kind, seinem Gegenüber, vor sich geht. Diese Gefühle vor dem Kind zuzugeben fördert das Verständnis des Kindes – und eine reziproke Reaktion. Dazu gehört auch das Vertrauen in die Kollegen. Fehlt dieses, fühlt sich auch der Lehrer unsicher, zurückgestoßen, abgelehnt. Er erlebt dasselbe wie das Kind. Fragen an die Schülerin oder den Schüler können in diesem Zusammenhang sein: Kannst du mir helfen … Ich verstehe dich nicht … Ich kann dich nicht ausstehen – Aber was sollte ich tun, dass du mich magst? Es tut mir leid, dass du dich so schlecht fühlst – hat dich irgendetwas sehr traurig gemacht? Lehrer müssen immer auch ihre eigene gefühlte Hilflosigkeit dem Schüler gegenüber zum Ausdruck bringen können und dabei ihre eigene Bindungsgeschichte im Auge behalten sowie die Situation, in der sie sich gerade gefühlsmäßig befinden (zum Beispiel Trennung vom Partner, Schwierigkeiten mit dem eigenen Kind, Angst, Verantwortung zu übernehmen etc.). Gleichzeitig müssen Lehrer es fertig bringen, sich emotional vom Verhalten des Schülers nicht unmittelbar treffen zu lassen, was mit das schwierigste ist, da hier die Bindungserfahrungen aus der eigenen Kindheit eine zentrale Rolle spielen. Dabei hilft auch zu wissen, dass sich die aggressiven Attacken einer Schülerin, eines Schülers nicht gegen sie richten, sondern gegen die, die früher das Glück der Kinder zerstört haben. Wir müssen den Kindern das Recht (zurück)geben, ihre Gefühle auszudrücken, auch wenn sie negativ sind, ihnen damit das Gefühl geben, anerkannt und angenommen zu werden. Die Geschichte von Frank Frank ist ein eher stiller, zurückhaltender Schüler, 10 Jahre alt und vor einem halben Jahr in die 5. Klasse einer Gesamtschule gekommen. Das erste Halbjahr fiel er in seiner Klasse nicht besonders auf, oder, wie seine Lehrerin Marion fand, im Gegensatz zu den vielen anderen munteren Schülern fast zu wenig. Irgendwie blieb er für sie unsichtbar, nicht „greifbar“, durchsichtig. Am Unterricht beteiligte er sich nur, wenn er aufgerufen wurde, und dann wirkte er häufig geradezu erschrocken, so als wäre er ganz woanders mit seinen Gedanken. Als die Osterferien vorbei waren fing Frank an, während des Unterrichts in der Klasse immer wieder von seinem Platz aufzustehen und herumzuwandern. Als ihn seine Lehrerin zunächst freundlich bat, sich doch wieder an seinen Platz zu setzen, tat er es schweigend, um kurze Zeit darauf wieder aufzustehen. Marion ging freundlich auf ihn zu und bat ihn, ihr und den anderen zu erzählen, warum er es auf seinem Platz nicht aushalten würde. Im Grunde wäre daran ja nichts Schlimmes, aber sie würde gerne verstehen, was ihn dazu bringen würde, immer wieder aufzustehen. Frank bekam einen roten Kopf, schaute zu Boden und setzte sich an seinen Platz. Am nächsten Tag fing Frank wieder an, aufzustehen und in der Klasse herumzuwandern. Einige der anderen Kinder tippten sich an die Stirn und fingen an zu tuscheln. Der sonst so schüchterne Frank stürzte sich darauf auf einen Jungen, der gerade neben ihm saß, und versuchte ihn mit aller Kraft vom Stuhl zu schubsen. Jetzt wurde es in der Klasse laut und chaotisch. 16 Die Lehrerin bat um Ruhe und stellte sich zunächst neben Frank, der allein und völlig aufgelöst mitten im Klassenzimmer stand. Sie bat Frank, sich bei dem anderen Schüler zu entschuldigen, denn der habe ihm ja nichts getan. Und dann fuhr sie mit leiser, aber bestimmter Stimme fort: „Ich weiß nicht warum, aber offensichtlich kannst du zur Zeit einfach nicht auf deinem Platz sitzen bleiben. Deswegen darfst du ab jetzt, wenn du willst, immer aufstehen, wann du willst und in der Klasse herumwandern, aber möglichst ohne die anderen beim Lernen zu stören.“ In der Klasse blieb es still. Marion war bei den Kindern eine beliebte Lehrerin, die Schüler fühlten sich von ihr angenommen und verstanden; zwar wunderten sie sich über ihre Großzügigkeit, aber akzeptierten sie, so, wie sie Marion akzeptierten. Und Marion hatte ja auch zu Frank gesagt, mit ihm in der Pause sprechen zu wollen. In der Pause bat sie Frank zu sich und fragte ihn, ob er ihr dabei helfen könne, herauszufinden, warum er im Unterricht ständig herumwandern müsse. „Vielleicht verstehe ich nicht, was du damit meinst, du sprichst ja auch so wenig, aber vielleicht kannst du mir dennoch helfen?“ Frank blieb stumm. Am nächsten Tag wiederholte sich die Szene, Frank wanderte ab und zu in der Klasse herum, was seine Mitschüler weiterhin irritierte. Als er in der letzten Stunde kaum noch damit aufhören konnte, ging Marion auf ihn zu, legte ihren Arm kurz um ihn, entschuldigte sich bei den anderen Schülern, bat sie einen Moment ruhig sein, denn sie wolle mit Franz draußen allein sprechen. Sie sagte ihm, dass er immer noch weiter herumlaufen dürfe, aber damit zunehmend Schwierigkeiten bekommen würde. Bei seinen Mitschülern, aber auch, weil er so viel vom Unterricht verpassen würde. Frank sah zu Boden, dann blickte er zu ihr auf und sagte: „ Aber er schlägt sie doch.“ Zunächst verstand Marion nicht – wer schlägt wen? – aber dann kam ihr ein Verdacht. „Wer schlägt wen?“ „Nun ja, der Vater, aber nur ganz manchmal – sonst ist er lieb, auch zu mir und meinem Bruder.“ Marion sah Frank lange an. „Und du hältst es in der Schule nicht mehr aus und willst ihr helfen, nicht wahr?“. Frank fing an, zu weinen. „Ja, brach es aus ihm hervor, sie muss doch arbeiten können, Papa hat ja keine Arbeit mehr. Wir brauchen doch Geld, für die Wohnung und so.“ Die Geschichte braucht nicht zu Ende erzählt zu werden. Wir wissen nicht, wie sie ausging. Was wir jedoch wissen ist, dass Marion, die Lehrerin, sehr viel richtig gemacht hat. Und dass Frank nach kurzer Zeit damit aufhörte, in der Klasse herumzulaufen. Weil er, wie er – fast stolz – sagte, „mit der Lehrerin gesprochen habe“. Margot ist eine vor ihrer Klasse einfühlsam und authentisch auftretende Lehrerin, die die Schüler respektieren, aber auch – und sicherlich gerade deswegen –, weil sie das Gefühl haben, auch von ihr respektiert zu werden. Dies merkt man auch daran, dass sie ihr und ihrer Führungskraft weiterhin vertrauen, trotz der für die meisten Schüler ja ungewöhnlichen Maßnahme, Frank weiterhin in der Klasse herumlaufen zu lassen. Auch hatte Marion schon vor dem herausfordernden Verhalten von Frank das Gefühl, dass bei ihm irgendetwas nicht stimmig ist, weswegen sie auch nicht die Sorge hatte, von ihm wegen ihrer Großzügigkeit jetzt ausgenutzt zu werden. Sie hat die Integrität von Frank dadurch bewahrt, dass sie sein Verhalten als sinnvoll interpretierte, statt ihm zu befehlen, er solle sofort mit dem Herumlaufen aufhören. Damit kam sie seinen existenziellen Bedürfnissen nach Anerkennung, Wertschätzung und Kooperation entgegen. Frank fühlte sich von seiner Lehrerin, so, wie er gerade war, akzeptiert und nicht (schon wieder!) zurückgestoßen. Marion hat mit ihm das Gespräch gesucht, ohne ihn in eine Rechtfertigungsposition für sein Verhalten zu bringen. Sie hat ihm zu verstehen gegeben, dass er sich dauerhaft nicht so verhalten kann, dass sie aber auch Geduld mit ihm habe, um ihn besser zu verstehen. Indem sie ihn gebeten hat, ihn zu verstehen, hat sie ihm eine aktive Rolle in der Kommunikation zugewiesen. 17 Als es zu dem Zwischenfall mit dem Schüler kam, den Frank umstieß, weil er die Ablehnung seiner Mitschüler nicht mehr ertrug, hat sie einerseits darauf bestanden, dass sich Frank bei ihm entschuldigt. Indem sie sich aber spontan neben ihn – sozusagen auf seine Seite – gestellt hat, im Bewusstsein dafür, dass er in der ganzen Klasse trotz seines aggressiven Verhaltens in diesem Moment die schwächste Position einnahm, gab sie ihm auch körperlich das Gefühl, beschützt zu sein, was in dieser Situation, in der Frank völlig hilf- und schutzlos war, von enormer Bedeutung war. Nachdem Frank zu Marion nach und nach eine gelungene Bindung oder „Resonanzbeziehung“ hergestellt hatte– die Geschichte ist an dieser Stelle natürlich verkürzt wiedergegeben – war er am Ende in der Lage, darüber zu erzählen, was ihn bewegt hatte, nicht mehr still sitzen zu können. Sehr gut sieht man auch hier, wie er lange und über seine Kräfte hinaus versucht hat, seine Eltern, vor allem den Vater, zu „schützen“, indem er dazu schwieg, dass dieser seine Mutter manchmal schlug. Als er dann aber eine Szene mitbekommen hat, in der die Mutter so laut aufschrie, dass er Angst bekam, sie könnte sterben, wurde sein Erregungspegel so hoch, dass er herumrennen musste, weil er ihn nicht mehr anders abbauen konnte. Außerdem wollte er seine Mutter beschützen und war deswegen innerlich wie äußerlich „immer auf dem Sprung“. Sein auffälliges Verhalten war also nicht nur sinnvoll, sondern zeugte auch von einer hohen menschlichen Sensibilität dieses 10-Jährigen. Vielleicht erzählt er später seinen Kindern, dass genau diese Lehrerin damals, als alles so schwierig und aussichtslos für ihn erschien, sein Leben gerettet hat, ganz einfach, weil sie ihn verstand. Der Lehrer ist Lehrer und kein Therapeut In Schule und Unterricht eine Bindung zum Schüler aufzubauen bedeutet nicht, den Schüler zu therapieren, ganz im Gegenteil. Therapie (die Überweisung des Schülers an den Schulpsychologen oder Therapeuten) bedeutet immer, zunächst beim Kind den Auslöser für das auffällige Verhalten zu suchen, es von den anderen zu isolieren und zu therapieren. Beim Aufbau einer Bindung zwischen Pädagoge und Schüler geht es genau nicht darum, eine therapeutischen Intervention vorzunehmen, sondern um die Herstellung einer Beziehung, in der sich das Kind sicher und geborgen fühlt, angenommen und nicht zurückgewiesen, seine Integrität geachtet wird und die Ausdrucksform seiner Schwierigkeiten als zu ihm gehörig angenommen werden. So, wie auch die Beziehung von Eltern zu ihrem Kind keine therapeutische Beziehung ist, gehören zum Aufbau einer guten Bindung vonseiten des Lehrers hauptsächlich Empathie und Feinfühligkeit. Im Gegensatz zu Eltern handelt es sich bei der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler jedoch um eine Beziehung, der ein professioneller Auftrag zugrunde liegt, weshalb die Reflexion dieser Beziehung auch immer professionell begleitet sein sollte, am besten durch Supervisionsgruppen. Lehrer und Lehrerinnen brauchen Beziehungskompetenz Kommen wir noch einmal auf unsere eingangs zitierte Definition von Bindungskompetenz zurück: „Beziehungskompetenz ist die professionell ausgeübte Fähigkeit, das einzelne Kind in seiner individuellen Eigenheit zu sehen, es zu verstehen, ihm mit Offenheit und Respekt zu begegnen und das eigene Verhalten darauf abzustimmen. Beziehungskompetenz zeigt sich u.a. in der Fähigkeit zu einem authentischen Umgang mit dem Kind und in der Annahme und Achtung seiner Integrität. Die Verantwortung für die Qualität der Beziehung liegt bei der Pädagogin bzw. dem Pädagogen.“ 18 In Schule und Unterricht spielen also in vielerlei Hinsicht Beziehungs- und Bindungsprozesse eine große Rolle, die es besonders im Umgang mit herausfordernden Schülern zu beachten gilt, eine Tatsache, die bis heute in Erziehungswissenschaft und Pädagogik sträflich vernachlässigt wird, obwohl sie doch, blickt man in jedes x-beliebige Klassenzimmer, auf der Hand liegt. Wenn wir also unser Wissen darüber ernst nehmen wollen, dass die Beziehungserfahrungen des Kindes mit seinen nächsten Bezugspersonen das Fundament für seine Entwicklung und sein Lernen bilden, folgt daraus, dass beim Umgang insbesondere mit herausfordernden Schülern der Fokus auf der Beziehung und nicht mehr auf dem Verhalten des Kindes liegen sollte. Fokussiert die Lehrerin oder der Lehrer nach wie vor nur das auffällige Verhalten der Schülerin oder des Schülers und sieht in diesem nicht den Versuch des Kindes, sein existenzielles Bedürfnis nach Integrität zu wahren, kann das tatsächlich existierende Problem kaum gelöst werden. Dabei hilft, dass für manche der herausfordernden Schüler Lehrer die erste Erfahrung von stets anwesenden, zuverlässigen Erwachsenen sind, worin eine große Chance besteht, aber auch eine große Gefahr. Wiederholen sich im Umgang mit dem Schüler nämlich seine schädlichen frühkindlichen Beziehungsmuster, wie es im Schulalltag häufig vorkommt - zum Beispiel durch Ignoranz, Ablehnung oder Zurückweisung - wird sein auffälliges Verhalten dadurch eher verstärkt oder das Kind resigniert. Zur Beziehungskompetenz des Pädagogen zählt also besonders, nicht vorschnell auf das Verhalten des Kindes zu reagieren, sondern sich Zeit zu lassen und sich in Geduld zu üben, um sich in das Kind einzufühlen, seine Sicht der Dinge herauszuarbeiten, zu erkennen und zu respektieren. Eine solche „emphatische Einstellung“ hat im Übrigen, wie zuletzt betont, mit einer therapeutischen Intervention nichts zu tun. Im Grunde entspricht sie ganz einfach der Haltung, sich in den anderen hineinversetzen zu können, seine Integrität anzuerkennen und darüber mit ihm ins Gespräch zu kommen. Dazu aber müssen wir auch mehr über unsere eigenen psychischen Mechanismen wissen, zum Beispiel, wie wir selbst auf Abwertung oder das Gefühl von Bedrohung reagieren, auch um gängige Narrative vom „schlechten Schüler“ bzw. „schlechten Lehrer“ mit den damit verbundenen Schuldvorwürfen, aufzulösen. Für eine neue Kultur des Umgangs in der Schule Die Beziehungskompetenz des Lehrers setzt eine Kultur des Umgangs voraus, die es ermöglicht, seine verwundbaren Seiten zu zeigen, ohne zu Schaden zu kommen, und in der man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann, ohne unangebrachter Nabelschau beschuldigt zu werden. Hier ist besonders die Leitung, aber auch die kollegiale Gemeinschaft von großer Bedeutung. In der Lehrerausbildung und in der Schule selbst ist es nicht Tradition, die eigenen Schwachstellen zum Thema zu machen. Man wird vornehmlich ausgebildet und später angestellt, um einen Job zu erledigen, und sollte statt Unsicherheit über die eigene Rolle am besten zeigen, dass man ihn beherrscht. Vielleicht ist die Tatsache, dass der Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns kaum oder gar keine Zeit eingeräumt wird, die zurzeit größte Schwachstelle in der derzeitigen Ausbildung zum Pädagogen. Dieser Beitrag auf dem Beltz Forum soll bei aller Notwendigkeit pragmatischen Handelns in Schule und Unterricht allen Mut machen, die Schule auch zu einem Ort authentischer, gegenseitiger Begegnungen werden zu lassen – und dies nicht nur im Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schüler. Quellen und Literatur 19 Brisch, Karl Heinz: Die Bedeutung von Bindung im Lernprozess. http://www.qusnet.de/pdf_2011/Folien_Brisch_JT_2010.pdf (Abfrage Oktober 2015) Dornes, Martin: Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen. Frankfurt a. Main: Fischer 1993 Geddes, Heather, Hanko, Gerda: Behavior and the Learning of Looked-After and other vulnerable Children http://www.familieslink.co.uk/download/july07/Behaviour,%20attachment%20and%20communicati on.pdf (Abfrage Oktober 2015) Grossmann, Klaus E./Grossmann, Karin (Hrsg.): Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie. Stuttgart: Klett-Cotta 2003 Grossman, Klaus E., Grossmann, Karin: Bindung und Bildung http://ligakind.de/fruehe/606_grossmann.php (Abfrage Oktober 2015) Herbst, Theresia: Bindung und Bildung. Psychologie in Österreich 5/2012 http:// www.sicherebindung.at/download/PIOe_05_12_Herbst.pdf.pdf Jensen, Elsebeth, Jensen Helle: Schule braucht Beziehung. Gelungene Lehrer-Eltern-Gespräche. Weinheim und Basel: Beltz 2016 (in Vorbereitung) Juul, Jesper, Jensen, Helle: Vom Gehorsam zur Verantwortung. Für eine neue Erziehungskultur. Weinheim und Basel: Beltz 2012 Koch, Claus: Bindung und Anderssein. Aspekte der Vulnerabilität im frühen Kindealter. In: Andresen, Sabine, Koch, Claus, König, Julia (Hrsg.): Vulnerable Kinder. Interdisziplinäre Annäherungen Rosa, Hartmut: Schule als Resonanzraum. Vortrag auf dem Kongress „Theater träumt Schule“ München, Februar 2015 © Claus Koch 2015 20