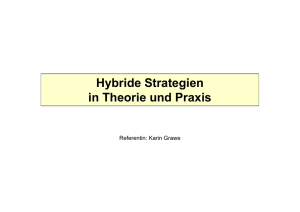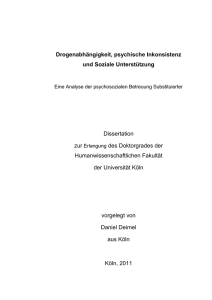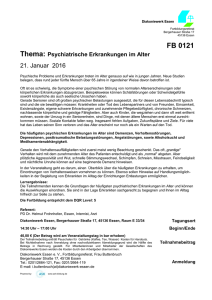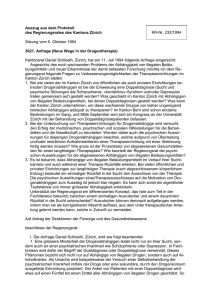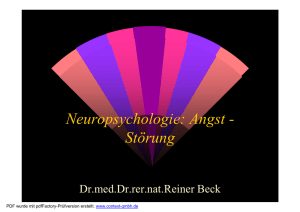„Fragebogen zur Analyse Motivationaler Schemata - psb
Werbung
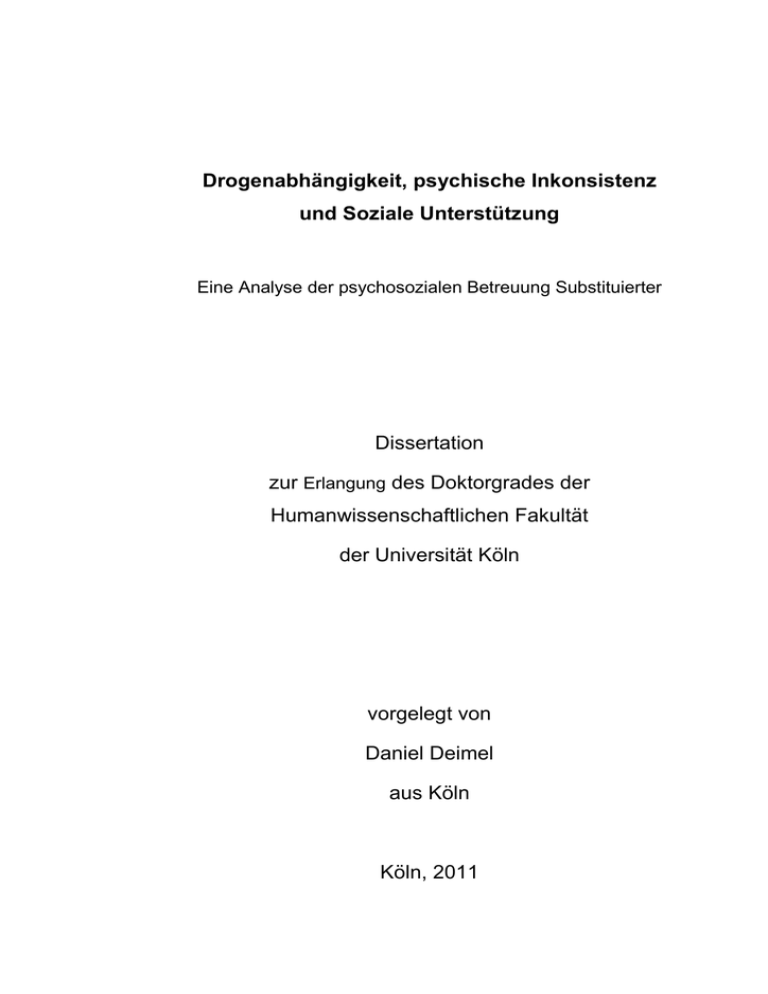
Drogenabhängigkeit, psychische Inkonsistenz und Soziale Unterstützung Eine Analyse der psychosozialen Betreuung Substituierter Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln vorgelegt von Daniel Deimel aus Köln Köln, 2011 Erster Gutachter: Professor Dr. Jörg Fengler Zweiter Gutachter: Professor Dr. XXX Tag der Disputation: 11.11.2011 2 „Man kann den Wind nicht ändern, aber die Segel richtig setzen“ (Aristoteles, 384-322 v. Chr., griech. Philosoph). Vorwort Die Idee zu dieser Dissertation entstand während des Master-Studiengangs „Suchthilfe“ an der Katholischen Hochschule in Köln. Im Rahmen der Masterthesis beschäftigte ich mich mit der psychosozialen Situation und Behandlung substituierter Drogenabhängiger. Durch die praktischen Erfahrungen meiner Berufstätigkeit als Sozialarbeiter und Suchttherapeut in unterschiedlichen Einrichtungen der Drogenhilfe sowie die Ergebnisse der im Rahmen der Masterthesis durchgeführten Untersuchung entwickelte sich die Idee zu der vorliegenden Studie. Seit meinem Studium der Sozialarbeit beschäftigt mich die Frage, wie Sozialarbeit wirkt. Bei wem sind welche Interventionen sinnvoll und erfolgsversprechend? Um in dem Bild des oben genannte Zitates zu bleiben: Bei welchem Wind muss wie das Segel gesetzt werden um zum Ziel zu gelangen? Welche Beschaffenheit muss das Boot für die bevorstehende Reise haben? Wie kann ich als Lotse den Kapitän auf seiner Reise unterstützen? Mit dieser Arbeit möchte ich einen Beitrag zu der Beantwortung dieser Fragestellungen leisten. Dank an soziales Netzwerk: Fengler und Familie, Freunde, Kolloquium etc. Unterstützung Casu. 3 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 6 2. Fragestellung 7 3. Stand der Forschung: Situationsanalyse substituierter Opiatabhängiger 3.1 Opiatabhängigkeit 3.1.1 Ätiologie der Abhängigkeit 3.1.2 Folgen der Opiatanhängigkeit 3.1.3 Epidemiologie 3.1.4 Familiäre Situation Drogenabhängiger und Elternschaft 12 27 Exkurs: Opiatkonsum im historischem Kontext 3.2 Stress, Coping und Soziale Unterstützung 3.2.1 Begriffsedinition 3.2.2 Stresskonzepte 3.2.4 Stress und Krankheit 3.2.4 Coping-Strategien 3.2.5 Soziale Unterstützung 28 Formen von Sozialer Unterstützung Effekte Sozialer Unterstützung 3.2.7 Soziale Unterstützung und Krankheit 3.3 Bedürfnisbefriedigung und psychische Gesundheit 41 4 3.3.1 Konsistenztheorie psychischen Geschehens 3.3.2 Konsequenzen für die Behandlung Opiatabhängiger 57 65 3.4 Substituionsbehandlung Opiatabhängiger 3.4.1 Definition der substitutionsgestützten Behandlung 3.4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Indikation 3.4.3 Medizinischen Behandlung 3.4.4 Psychosoziale Behandlung 3.4.5 Wirksamkeit der substitutionsgestützten Behandlung 3.4.6 Schlussfolgerungen: Psychosoziale Behandlung zwischen Sozialer Unterstützung und Psychotherapie 4. Analyse der Psychosozialen Betreuung Substituierter – Die PSB-Studie 4.1 Modell der Untersuchung & Fragestellungen 4.2 Hypothesen & Evaluationskriterien 4.3 Untersuchungsplanung 4.3.1 Untersuchungsdesign 4.3.2 Messinstrumente 4.3.3 Auswertungsmethodik 4.3.4 Zeitplanung 4.4 Untersuchungsverlauf 5 Abbildungsverzeichnis Abbildung 3.1 Trias Modell nach Kielholz & Ludewig Abbildung 3.2 Exemplarischer Störungsverlauf Abbildung Psychosoziale Folgen der Opiatabhängigkeit Abbildung Allgemeines Anpassungssyndrom (AAS) nach Selye Abbildung Transaktionales Stressmodell nach Lazarus Abbildung 3.3 Konsistenztheoretisches Modell psychischen Geschehens Abbildung 3.4 Prozentuale Verteilung von AAI-Klassifikationen in unterschiedlichen Stichproben Abbildung 3.5 Das Inkongruenzniveau im psychischen Geschehen Abbildung 3.6 Vulnerabilitäts-Stress-Modell psychischer Störungen Abbildung 3.7: Funktionale Rolle bedürfnisbefriedigender Erfahrungen im Therapieprozess Abbildung 3.8 Schematische Darstellung der Psychologischen Therapie nach Grawe 6 Tabellenverzeichnis Tabelle 3.1 Durchschnittsalter Opiatabhängiger bei Betreuungsbeginn; Deutsche Suchthilfestatistik 2006 Tabelle 3.2 Arbeitssituation und Bildungsniveau Opiatabhängiger: Deutsche Suchthilfestatistik 2006 999 Unterschiede zwischen akutem und chronischem Stress Inhaltliche Typologie sozialer Beziehungen. Skalen des FAMOS 7 Einleitung Platzhalter für den Einleitungstext. Es folgt die Beschreibung der einzelnen Kapitel und der Aufbau der Arbeit. 8 Fragestellung Primäres Ziel der vorliegenden Untersuchung ist eine Analyse der psychosozialen Betreuung substituierter Opiatabhängiger. Die substitutionsgestützte Behandlung kann als Regelbhandlung Opiatabhängiger angesehen werden. Innerhalb dieser integrierten medizinischen und psychosozialen Behandlung, nimmt die psychosoziale Betreuung eine nicht unerhebliche Stellung ein. Strukturell und konzeptionell existiert keine einheitliche Basis auf deren Grundlage die psychosoziale Betreuung durchgeführt wird. Zudem ist dieses Behandlungssegment bisher wenig gut evaluiert. Die Untersuchung möchte dazu beitragen, diese Kenntnislücke zu schließen und zu einer Weiterentwicklung der psychosozialen Betreuung beitragen. Im Rahmen einer Voruntersuchung (n=30) konnte gezeigt werden, das substituierte Drogenabhängige sich in komplexen und hochbelasteten Lebenssituationen befinden. Sie äußerten einen psychosozialen Hilfebedarf in den evaluierten Lebensbereichen Arbeit, Finanzen, Justiz und soziale Beziehungen. Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der psychosozialen und der psychischen Situation der Substituierten. Patienten ohne eine psychische komorbide Störung und Patienten in tagesstrukturierenden Maßnahmen erzielten bessere Behandlungsergebnisse. Die psychosoziale Betreuung wurde von den Patienten als gut bewertet (Deimel, 2008 & 2009). Die Ergebnisse dieser Voruntersuchung waren Grundlage für die Entwicklung der weiteren Fragestellungen. Eine zentrale Grundannhame der gegenwärtigen Untersuchung ist, dass der Erfolg der psychosozialen Behandlung mit einer Reduktion von psychischer Inkongruenz (Grawe, 2004), einer bedeutenden Form von psychischer Inkonsistenz, einhergeht. Diese sollte sich in den evaluierten Parametern, dem Stressniveau sowie der psychischen und psychosozialen Belastungssituation 9 der Patienten, wieder spiegeln. Darüber hinaus sollte sich der Erfolg der psychosozialen Behandlung in der Zufiedenheit der Patienten mit dieser Behandlungsform zeigen. Im Rahmen der Studie werden die Ergebnisse der Substituierten mit den zwei Referenzguppen „unbehandelte Drogenabhängige“ in Differenzierung Bezug hinsichtlich Drogenabhängige“ gesetzt. des Darüber und hinaus Behandlungssettings, „nicht findet Behandlung eine in Substitutionsambulanzen und Behandlung bei einem niedergelassenen Arzt in Kombination mit Suchtberatungsstellen, statt. Folgende Fragestellungen stehen im Einzelnen im Fokus der vorliegenden Untersuchung: Inwiefern substituierte unterscheiden sich Drogenabhängige, unbehandelte und Nicht – Drogenabhängige, Drogenabhängige hinsichtlich ihrer psychosozialen und psychischen Situation sowie ihres Stress- und Inkongruenzniveaus? Inwiefern verändern sich die psychische und psychosoziale Situation sowie das Stress- und Inkongruenzniveau der Drogenabhängigen im Verlauf der substitutionsgestützten Behandlung? Welche Patienten sind mit der psychosozialen Betreuung zufrieden, welche sind mit ihr nicht zufrieden? Welche Patientengruppen weisen hinsichtlich der psychosozialen Betreuung bessere Behandlungsergebnisse auf? 10 Inwiefern unterscheiden sich die beiden Behandlungstypen, Substitution in einer Fachambulanz und Substitution bei einem niedergelassenen Arzt in Kombination mit Drogenberatung, hinsichtlich der psychischen und psychosozialen Situation sowie des Stress- und Inkonsistenzniveaus der Patienten? 11 Stand der Forschung: Situationsanalyse substituierter Drogenabhängiger Das folgende Kapitel gibt den Stand der Forschung wieder. Es wird eine Übersicht über die Entstehung, Epidemiologie und Folgen der Opiatabhängigkeit gegeben. Es folgt eine Übersicht über die Forschung zu Stress, Coping und sozialer Unterstützung. Ferner wird Inkonsistenztheorie psychischen Geschehens von Grawe dargestellt. Sie wird in den Bezug zur Opiatabhängigkeit gesetzt. Danach erfolgt eine Darstellung der substitutionsgestützen Behandlung Opiatabhängiger. 3.1 Opiatabhängigkeit Unter dem Begriff „Opiate“ versteht man Substanzen, die dreierlei Herkunft haben können: sie können aus dem Saft der Mohnpflanze gewonnen werden (Rohopium). Des Weiteren können sie halb- bzw. vollsynthetisch hergestellt werden oder sie können auch im Körper von Menschen oder Säugetieren gebildet werden (Endorphine) (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2006). Neben Opium existieren eine Reihe Derivate. Diese werden im Rahmen der medizinischen Forschung und Behandlung entwickelt und genutzt. So extrahierte 1804 der Apotheker Friedrich Sertürmer aus Opium das noch stärker wirkende Morphium. Dieses wurde als Schmerz-, Beruhigungs- und Schlafmittel eingesetzt. Im weiteren Verlauf der Entwicklung stellte man jedoch fest, das Morphium, ebenso wie Opium, süchtig macht. Daher entwickelte man im Jahr 1898 aus dem Morphium eine neue Substanz. Diese sollte über kein Abhängigkeitspotential verfügen. Der Name dieser Substanz ist Heroin. Auch hier stellte man zu einem späteren Zeitpunkt ein sehr hohes Suchtpotential fest. Neuere Derivate, wie das synthetisch hergestellte Methadon, kamen deutlich später auf den Markt. Inzwischen sind Opiate, außer im Rahmen der medizinischen Behandlung, in Deutschland verboten (Comer, 2001). 12 Die körpereigenen Endorphine wirken, ähnlich wie die dem Körper von außen zugefügten Opiate, schmerzlindernd. Über ihre Aktivierung des Dopaminsystems sprechen sie das Belohnungssystem (Nucleus accumbens) im Gehirn an (Comer, 2001). „Der Nucleus accumbens (…) ist maßgeblich am Lernen von Verhalten beteiligt, das angenehme Zustände herbeiführt und Furcht reduziert. Er spielt also eine wichtige Rolle bei den Vorgängen, die in den behavioristischen Lerntheorien als positive und negative Verstärkung bezeichnet wurden.“ (Grawe, 2004; S. 289) Das Dopaminsystem spielt eine entscheidende Rolle für motivationale Anreize und Belohnungen (Bierbaumer & Schmidt, 1991; Grawe, 2004). Der Mensch empfindet durch Dopamin Glücksgefühle. Des Weiteren beeinflussen Opiate die Atmung. Sie wird durch die Einnahme von Opiaten reduziert. Die körpereigenen Endorphine wirken deutlich kürzer als die von außen eingenommenen Opiate. Daher haben sie nur ein sehr geringes Abhängigkeitspotential. Die körpereigenen Endorphine haben aus evolutionsbedingter Sicht eine sehr sinnvolle Funktion: bei Verletzungen lindern sie den Schmerz und ermöglichen so Flucht oder Kampf. Die regelmäßige Einnahme von Opiaten kann zu einem Abhängigkeitssyndrom führen. Nach Definition des ICD-10 der WHO, liegt das Abhängigkeitssyndrom vor, wenn bei einem Menschen drei oder mehr der folgenden Kriterien zusammen mindestens einen Monat lang Bestand haben. Falls sie nur für eine kürzere Zeit gemeinsam auftreten, sollten sie innerhalb von zwölf Monaten wiederholt auftreten: 1. Ein starkes Verlangen oder eine Art Zwang, die Substanz zu konsumieren. 2. Die verminderte Kontrolle über den Substanzgebrauch, d.h. über Beginn, Beendigung oder die Menge des Konsums. Dies wird daran deutlich, dass 13 die Substanz oft in größeren Mengen oder über einen längeren Zeitraum als geplant konsumiert wird. Auch der anhaltende Wunsch oder erfolglose Versuche, den Substanzkonsum zu verringern oder zu kontrollieren, sind hierfür Indikatoren. 3. Das Auftreten eines körperlichen Entzugssyndroms, wenn die Substanz reduziert oder abgesetzt wird, mit den für die Substanz typischen Entzugssymptomen. Es wird auch nachweisbar durch den Gebrauch derselben oder einer sehr ähnlichen Substanz, um die Entzugssymptome zu mildern oder zu vermeiden. 4. Durch den Aufbau einer Toleranzentwicklung gegenüber den Wirkungen der Substanz. Für eine Intoxikation oder um den gewünschten Effekt zu erreichen, müssen größere Mengen der Substanz konsumiert werden, oder es treten bei fortgesetztem Konsum derselben Mengen deutlich geringere Effekte auf. 5. Einengung auf den Substanzgebrauch, deutlich an der Aufgabe oder Vernachlässigung anderer wichtiger Vergnügungen oder Interessensbereiche wegen des Substanzgebrauches; oder ein hoher Zeitaufwand, die Substanz zu beschaffen, zu konsumieren oder sich davon zu erholen. 6. Anhaltender Substanzgebrauch trotz eindeutig schädlicher Folgen, deutlich an dem fortgesetzten Gebrauch, obwohl der Betreffende sich über die Art und das Ausmaß des Schadens bewusst ist oder bewusst sein könnte (Weltgesundheitsorganisation, 2004). Bereits kurz nach dem Absetzen der Substanz kann es zu typischen Entzugssymptomen kommen. Diese sind: das Verlangen nach Opiaten, Ängstlichkeit, Gähnen, Schwitzen und Schlafstörungen. Dazu können dann im weiteren Verlauf zusätzlich Glieder- und Muskelschmerzen, Heiß-Kalt-Wallungen und Appetitlosigkeit kommen. Später kann es zu Fieber, Muskelkrämpfen, Bauch- 14 krämpfen, Diarrhö, Erbrechen, und Kreislaufversagen kommen (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2006). Das ICD-10 bietet lediglich eine Beschreibung der gegenwärtigen Situation. Es gibt keinerlei Auskunft über die Ätiologie der Erkrankung. Über die Beschreibung der aktuellen Situation, also des aktuellen Krankheitsbildes, herrscht in der Fachwelt weitgehender Konsens. Diesen Konsens findet man jedoch nicht in der Begründung der Krankheitsursache. 3.1.1 Ätiologie der Abhängigkeit Es existiert kein allgemeingültiges monokausales Erklärungsmodell zur Entstehung von Sucht und Abhängigkeit. Vielmehr bestehen eine Vielzahl von Erklärungsmodellen zur Entstehung von Sucht und Abhängigkeit nebeneinander. Je nach Perspektive des Verfassers werden verschiedene Elemente in den Fokus gesetzt und durch diese die Ursache von Sucht und Abhängigkeit begründet. So entstanden eindimensionale Konzepte, die ihren Fokus auf die Person legen. In ihr wird die Ursache der Suchterkrankung gesehen. Neben der so genannten „Suchtpersönlichkeit“ entstand die Vorstellung einer Persönlichkeitsstörung, die ursächlich für die Entstehung einer Suchterkrankung ist. Die Spanne reicht hier von unangepassten Persönlichkeiten über psychisch gestörte Persönlichkeiten bis hin zu Personen, die sich auf der Suche nach immer höheren Stimulationen befinden (so genannte „sensationseeker“). Daneben existieren Risikofaktoren-Konzepte, die einzelne Faktoren als mögliche Ursachen für Suchterkrankungen sehen. Markante Einflüsse sind demnach biologische, familiäre oder psychische Risikofaktoren. So konnten bei ca. 40% der Drogenabhängigen suchtkranke Eltern ermittelt werden (Klein, 2003). Das Risiko selber suchterkrankt zu werden, ist von Kindern aus alkoholbelasteten Familien im Vergleich zu Kindern aus unbelasteten Familien um bis zu dem Sechsfachen erhöht (Klein & Zobel, 2001). entwicklungsdynamische Theorien gehen davon aus, dass das elterliche Verhalten und familiäre Besonderheiten einen starken Einfluss auf den Konsumeinstieg in der Kindheit ausüben. Dagegen werden Peer-Einflüsse 15 sowie soziale und kulturelle Einflüsse in der Adoleszenz bedeutsamer (Tossmann & Baumeister, 2008). Systemische Konzepte verstehen die Suchterkrankung im Kontext einer Mehrgenerationperspektive. Drogenabhängigkeit wird demnach als Ausdruck einer generationsübergreifenden familiären Entwicklung und Prozesses verstanden (Stachowske, 2008). Prozess- und interaktionsorientierte Konzepte legen ihren Fokus auf die Wechselwirkungen der Person mit ihrer Umwelt. Soziologische Ansätze sehen die Auseinandersetzung des Individuums mit seiner sozialen Umwelt als mögliche Ursache der Suchterkrankung. Dem Menschen gelingt es nicht, bestimmte kulturell bedingte Ziele auf sozial erwünschten Wegen zu erreichen. Er reagiert darauf mit abweichendem Verhalten, wozu auch der Suchtmittelkonsum gehört. Neben lerntheoretischen Konzepten, die davon ausgehen, dass normales wie abweichendes Verhalten über die gleichen Wege erlernt werden kann, existieren sozialpsychologische und entwicklungspsychologische Konzepte der Entstehung der Suchterkrankung. Eine weite Verbreitung hat das Trias-Modell von Kielholz und Ladewig (1973) gefunden. Im Rahmen dieses Globalkonzeptes geht man davon aus, dass durch die Beeinflussung und Interaktion von biologischen, sozialen und psychischen Faktoren, Sucht und Abhängigkeit entstehen können. Da dieses Konzept sehr grob gehalten wurde, besteht die Möglichkeit, andere Ansätze unterschiedlichster Herkunft in dieses Konzept zu integrieren. Es ist lediglich möglich, einzelne Variablen aufzuzeigen, die unter die Kategorien „Person“, „Umwelt “ und „Droge “ fallen. Ihre einzelnen Interaktionsweisen und explizite Ursachengefüge können mit diesem Modell nicht herausgestellt werden (Künzel-Böhmer, Bühringer & Janik-Konecny, 2005). 16 Person: Prämorbide Persönlichkeit, sexuelle Entwicklung, aktuelle Stresssituation, frühkindliches Milieu, Erwartungshaltung, etc. Drogenabhängigkeit Umwelt: Soziales Milieu, Beruf, familiäre Situation,Wirtschaftslage, Religion, Gesetzgebung, etc. Droge: Applikationsart, Dosis, Dauer, Griffnähe, Gewöhnung, individuelle Reaktion, etc. Abb. XXX: Trias Modell nach Kielholz & Ladewig. Dieses Modell ist meines Erachtens für die Praxis dennoch sehr gut geeignet. Mit Hilfe dieses Konzeptes ist es möglich, Betroffenen eine individuelle und plausible Begründung ihrer Erkrankung verständlich zu machen. Nach dieser Begründung fragen die Patienten. Sie wollen verstehen, wie und warum es zu ihrer Erkrankung gekommen ist. Eine berechtigte Frage, die jedoch oft unterschätzt und zu wenig berücksichtigt wird. Des Weiteren ist ein schlüssiges Konzept der Ätiologie sowie der Phatogenese einer Erkrankung notwendig, um an ihm orientiert bzw. von ihm abgeleitet, ein Behandlungskonzept der Erkrankung zu entwickeln. Im weiteren Verlauf nehme ich dieses Konzept als Grundlage für meine Ausführungen. Der Konsum von psychotropen Substanzen setzt in der Regel in der frühen Jugend ein. Dies zeigt sich in den Ergebnissen der bereits erwähnten Voruntersuchung zu dieser Studie. In ihr wurden 30 substituierte Opiatabhängige unter anderem nach dem ersten Konsum von unterschiedlichen psychotropen Substanzen befragt. Abbildung XXX stellt einen exemplarischen Störungsverlauf auf Grund der erhobenen Daten dar. In der Untersuchung wurde deutlich, dass der polyvalente Drogenkonsum regelhaft ist. Die Heroinabhängigkeit entwickelt sich im Verlauf der Suchtkarriere. 17 Alter Erstkonsum 24 22 21.6 20 23.2 22.6 18.8 18 16 15.4 14 14.4 12 10 Substanz Abb. XXX: Exemplarischer Störungsverlauf Betrachtet man diese Ergebnisse aus der entwicklungspsychologischen Perspektive ergibt sich folgendes Bild: Oerter & Dreher (1998) beschreiben die Altersspanne zwischen dem 11. und 18. Lebensjahr als Jugendalter, zwischen dem 18. Und 21. Lebensjahr als späte Adoleszenz und die Zeitspanne zwischen dem 21. und 25. Lebensjahr als frühes Erwachsenenalter. Der Mensch durchläuft in dieser Zeitspanne verschiedene sehr beutsame Entwicklungsaufgaben: Neben der körperlichen Entwicklung vollziehen sich die Identitätsentwicklung, die Entwicklung eines Körperselbstbildes, die sexuelle Orientierung sowie eine starke Auseinandersetzung des Jugendlichen mit seiner Umwelt (Familie, Peergroup). In der Regel findet in dieser Zeit der Übergang in das Arbeitsleben statt. Kommt es in dieser Lebensspanne zu einem fortgeschrittenen Konsum von psychotropen Substanzen, muß mit einem beschleunigten Übergang zur Erwachsenenrolle gerchnet werden. Dies zeigt sich durch eine frühe Mutter- oder Vaterschaft oder dem Einstig in ein Arbeitsverhältnis in einem Alter, in dem andere noch ihre Ausbildungspläne verfolgen. Die Folge ist eine nicht ausgeschöpfte Identitätsbildung sowie Verlust an Qualität und Flexibilität der weiteren Entwicklung. Dies kann langfristig bis zu einem gänzlichen Scheitern in der Bewältigung der jugendtypischen Entwicklungsaufgaben führen (Silbereisen, 1998). 18 3.1.2 Folgen der Opiatabhängigkeit Aufgrund des oft lang andauernden Opiatkonsums lässt sich eine Vielzahl von physischen und psychosozialen Folgen ausmachen. Der Großteil der Heroinabhängigen konsumiert die Drogen intravenös. Schätzungen, die im Rahmen der Heroinstudie in Deutschland durchgeführt wurden gehen von einem Anteil von 82,4% der intravenös konsumierenden Abhängigen aus (Buhk, Zeikau & Koch 2006). Diese Konsumform und die Konsumbedingungen (unsaubere Spritzbestecke, Konsum an öffentlichen Plätzen und dementsprechend unter Stress), führen zu zum Teil schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie z. B. Abszesse, Thrombosen, abzedierende Pneumonien, und Endokarditis (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2006). Etwa 70 – 90% aller intravenös konsumierenden Drogenabhängigen weisen eine Hepatitis C Infektion auf. Sie bilden damit die am stärksten betroffene Risikogruppe dieser Infektionskrankheit (Maier, 2002). Die Durchseuchungsrate in Bezug auf die Hepatitis A- und B-Viren liegt bei 50-80% (Deutsche Aidshilfe, 2004). Der Anteil der durch den Drogenkonsum an AIDS erkrankten Personen wird vom Robert-Koch-Institut (2007) für den Zeitraum von 2004 – 2007 mit 15% angegeben. Somit gehören intravenös konsumierende Drogenabhängige auch hier zu einer Hochrisikogruppe. Das von den Abhängigen konsumierte Heroin hat mit 15 – 50% einen sehr geringen Reinheitswert (Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, 2007). Beimischungen mit Substanzen (Tabletten, Instant-Tee, etc.) sind die Regel. Dies bedingt, dass das Heroin mit Hilfe von Ascorbinsäure in Wasser gelöst werden muss, um es sich injizieren zu können. Dieser Konsum führt zu Verletzungen der Venen. Bedingt durch das hektische und aggressive Leben in der Drogenszene vernachlässigen viele Abhängige ihre Körperpflege. Zudem fällt bei vielen eine ausgewogene und gesunde Ernährung weg. Die Folge ist ein schlechter körperlicher Gesundheitszustand. Neben Heroin konsumieren viele Abhängige zusätzlich Kokain, Benzodiazepine, Alkohol, Amphetamine, THC und Tabak je nach Verfügbarkeit der Substanz, Präferenz oder persönlicher Situation. Dieser polyvalente Konsum hat zur Folge, dass 19 sich der Schweregrad des süchtigen Verhaltens deutlich verstärkt und es zudem zu schwerwiegenden Wechselwirkungen der einzelnen Substanzen untereinander kommen kann. So verstärkt zum Beispiel Alkohol die sedierende Wirkung von Benzodiazepinen oder Opiaten. Als Folge des Mischkonsums kann eine Atemdepression auftreten (Reymann & Gastpar, 2006). Ein polyvalenter Substanzkonsum hat eine schlechtere Prognose hinsichtlich der mittelfristigen Abstinenz gegenüber einer Einzelabhängigkeit (Gastpar, Heinz, Poehlke & Raschke, 2002). Ein großer Teil der Opiatabhängigen leidet an einer zweiten psychiatrischen Erkrankung. Je nach Untersuchung geht man von einer Quote von 50 – 70% der Abhängigen mit einer komorbiden psychischen Störung aus. In einer Untersuchung einer Gruppe von 350 Patienten wurde festgestellt, dass 5% eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis aufwiesen, damit etwa fünfmal mehr als in der Normalbevölkerung. 32% hatten eine affektive Störung oder wiesen eine solche, vorwiegend depressiv geprägte in ihrer Vorgeschichte auf. Insgesamt 46% der Patienten hatten eine Angststörung (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2006). Diese Erkrankungen können zum Teil auch als Auslöser für die Drogenabhängigkeit angenommen werden und bedürfen daher einer entsprechenden Behandlung, da sonst die Suchterkrankung nicht erfolgreich behandelt werden kann. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, dass der Drogenkonsum der Auslöser für den Ausbruch weiterer psychiatrischer Erkrankungen ist. Bei einer Reihe von Opiatabhängigen kann der Konsum von psychotropen Substanzen im Sinne der „Self-medication-These“ von Khantzian als ein erfolgloser Versuch der Selbsttherapie aufgefasst werden (Gastpar et al., 2002). Opiatabhängige haben ein hohes Risiko, an den Folgen ihrer Sucht zu versterben. So sind im Jahr 2008 in Deutschland 1449 Menschen direkt an den Folgen ihrer Drogenabhängigkeit gestorben (Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2009). Die Mortalitätsquote Drogenabhängiger wird mit 1- 20 2% angegeben. International wird das Todesrisiko von Drogenabhängigen auf 10-30mal höher im Vergleich zur Normalbevölkerung eingeschätzt. Eine Untersuchung über die Hintergründe der einzelnen drogenbedingten Todesfälle kam zu dem Schluss, dass es sich bei 72% der Fälle um unbeabsichtigte Überdosierungen, bei 11% um Suizid und bei 2% um Unfälle gehandelt haben muss. Bei 5% lag eine andere Erkrankung vor und bei 10% konnte kein Grund ausfindig gemacht werden (Küfner & Rösner, 2005). Neben diesen schwerwiegenden psychischen Folgen übt die Drogenabhängigkeit massiven Einfluss auf die psychosoziale Situation eines Menschen aus: Da der Besitz und der Handel von Heroin illegal sind, machen sich die Konsumenten strafbar. Hinzu kommt, dass für das Suchtmittel ein hoher Preis auf dem Schwarzmarkt bezahlt werden muss. Die Folge ist ein Abrutschen in die Beschaffungskriminalität. In einer im Jahr 2008 durchgeführten Szenebefragung wurden 791 Opiatabhängige in 13 verschiedenen Städten hinsichtlich ihrer gesundheitlichen und sozioökonomischen Situation befragt. 78% der Befragten Personen hatten bereits Hafterfahrungen (Thane, 2009). Die Situation in den Justitzvollzugsanstallten stellt sich wie folgt dar: Von den in Deutschland ca. 80.000 Inhaftierten sind ca. 10.000 - 15.000 opiatabhängig. Nach Schätzungen des Bundesgesundheitsministeriums setzen davon ca. 40% den Konsum in der Haft fort (Niemann & Soyka, 2007). Die Zahl der Drogenabhängigen unter den Inhaftierten nahm jedoch in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Inzwischen sind mehr als ein Drittel der in Nordrhein-Westfalen inhaftierten Personen drogenabhängig (Justizministerium NRW, 2006). Dieser Trend wurde mit der Veröffentlichung von zwei deutschen multizentrischen epidemiologischen Studien bestätigt. Demnach liegt der Anteil intravenöser Drogenkonsumenten zwischen 22 und 30%. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, der Anteil liegt dort bei 0,3%, ist dies eine Steigerungsfaktor um das 73-98fache. Lediglich 500-700 Opiatabhängige befinden sich in Haft in einer dauerhaften Substitutionsbehandlung. (Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2009; Eckert & Weilandt, 2008; Eckert et al., 2008). 21 Insbesondere Frauen gehen oftmals der Prostitution nach, um ihre Drogenkonsum zu finanzieren. Sie bewegen sich zudem in einem kriminellen Umfeld und erleben in diesen Bezügen immer wiederkehrende traumatische Verletzungen. Der Großteil der drogenabhängigen Menschen ist verschuldet. Die Stiftung „Integrationshilfe für ehemals Drogenabhängige“ ermittelte für den von ihr verwalteten „Marianne von Weizsäcker Fonds“ für das Jahr 2007 eine durchschnittliche Schuldenhöhe eines Drogenabhängigen von 9.070 (Stiftung Integrationshilfe, 2008). Bei 62-70% aller Drogenabhängigen ist von einer Überschuldung auszugehen (Meyer, 2008; Stiftung Integrationshilfe, 2000). Aufgrund der angespannten finanziellen Situation vieler Abhängiger kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten bei der Zahlung der Wohnungsmiete. Folgen sind oft der Verlust der Wohnung und die damit verbundene Obdachlosigkeit. Da der Beginn der Suchterkrankung in der Regel in der Jugend und im frühen Erwachsenenalter auszumachen ist, haben die Betroffenen oftmals nur ein sehr geringes Bildungsniveau. Hierdurch ist eine Entwicklung hinsichtlich einer erfüllten Arbeitsbiographie deutlich erschwert. Durch den aktuellen Drogenkonsum ist es dem überwiegenden Teil der Abhängigen nicht möglich, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Sie sind daher arbeitslos und befinden sich im Bezug von Sozialhilfe oder Leistungen für Arbeitslose (ALG I und ALG II). Dieses äußerst geringe Einkommen stellt per se einen Risikofaktor hinsichtlich der Gesundheitssituation dar. Soziale Unterschiede, abhängig vom Einkommen, haben einen erheblichen Einfluss auf das Mortalitätsrisiko von Menschen. So wurde für die englische Bevölkerung eine Differenz von sieben Jahren in der Mortalität in Abhängigkeit von Einkommen, Bildungsgrad und Sozialstatus ermittelt (Badura & Feuerstein, 1994). Zudem stellt die Arbeitslosigkeit selbst eine Quelle unkontrollierbaren und chronischen psychosozialen Stresses dar. Zudem weisen Langzeitarbeitslose eine geringere Selbstwirksamkeitserwartung und ein geringeres Selbstwertgefühl auf als 22 Beschäftigte. Dies mündet in einer höheren Angst- und Depressivitätsquote (Ertl et al., 2006; Weber et al., 2007). Durch den Aufenthalt in der Drogenszene und durch Prostitution befinden sich die Betroffenen in pathogenen sozialen Netzwerken. Aufgrund von Gewalterfahrungen und des Einflusses der Illegalität ist ein Verlust von Werten und Normen die Folge. Als Folge der Drogenabhängigkeit haben viele Betroffene protektive und unterstützende soziale Beziehungen verloren oder konnten sie nicht entwickeln. Die Kontakte zu anderen Betroffenen aus der Drogenszene sind oftmals die einzigen sozialen Beziehungen, die sie haben. Das Herauslösen aus solchen Bezügen und der Wechsel in eine Welt, in der andere Normen und Werte als sinnvoll und erstrebenswert angesehen werden, ist für viele Betroffene dadurch erschwert. Drogenabhängige stellen eine Randgruppe in unserer Gesellschaft dar. Sie sind sozial ausgegrenzt und haben dadurch einen erschwerten Zugang zum Hilfesystem. Ein Teil der Drogenabhängigen ist obdachlos. Diese Situation führt zu einer doppelten Stigmatisierung. Der Anteil der Drogenabhängigen unter den Obdachlosen wird auf 15 – 27% geschätzt (Stimmer nach Drogenhilfeverein Indro e.V., 2004). In der bereits zitierten deutschlandweiten Szenebefragung im Jahr 2008 hatten etwa Eindrittel der Abhängigen keine gesicherte Wohnsituation (Thane et al., 2009). In unterschiedlichen Studien konnte ein zum Teil deutlich höherer Anteil der Obdachlosen ermittelt werden. So waren in einer Analyse der Substitutionstherapie in Hamburg im Jahr 1994 rund 40% der Drogenabhängigen zu Beginn der Substitutionsbehandlung ohne festen Wohnsitz. Dieser Status subsumiert drei Stufen der Obdachlosigkeit: die temporäre Unterkunft bei Freunden und Bekannten, die öffentliche Unterbringung in Einrichtungen und die Opbdachlosigkeit ohne jede Unterbringung (Janczak & Wendelmuth, 1994). Im Rahmen einer weiteren Untersuchung wurden 323 Drogenabhängige der offenen Drogenszene in Hamburg hinsichtlich verschiedener soziodemograßhischer Paramenter interviewt. Rund die Hälfte der Befragten war zu dem Untersuchungszeitraum obdachlos (Thiel, G., Friedrich, E., Wiese, K., 1997). 23 Es wird deutlich, dass Drogenabhängigkeit in vielerlei Hinsicht schädigend wirkt. Die Betroffenen haben es mit multifaktorellen Problemlagen zu tun. Diese Faktoren sind aber nicht nur Folge der Erkrankung. Vielmehr können sie den Beginn der Erkrankung begünstigen, deren weiteren Verlauf und die Genesung des Betroffenen massiv beeinflussen. Schulden Arbeitslosigkeit Beschaffungskriminalitä t Drogenabhängigkeit Niedriger Bildungsstand Obdachlosigkeit Abb. 3.2: Prostitution Gewalterfahrunge n Soziale Ausgrenzun g Psychosoziale Folgen der Drogenabhängigkeit Aufgrund dieses Hintergrundwissens lässt sich ohne Zweifel feststellen, dass es sich bei Opiatabhängigen um sehr schwer erkrankte Menschen handelt, die sich in hochkomplexen und vielerlei Hinsicht massiv beeinträchtigten Lebenssituationen befinden. 3.1.3 Epidemiologie Schätzungen über die Zahl der Heroin- und Opiatabhängigen variieren je nach Untersuchung sehr stark. Man kann jedoch von rund 170.000 – 200.000 regelmäßigen bzw. problematischen Opiatkonsumenten in Deutschland ausgehen (Wittchen, Apelt & Mühling, 2005). Es ist ebenso schwierig eindeutige Zahlen vorzulegen, die die Gruppe der Opiatabhängigen näher beschreibt. Die Problematik liegt in der Datenerhebung. Da Opiatabhängigkeit keine meldepflichtige 24 Erkrankung ist, kann man sich lediglich auf Schätzungen über die Zahl und jeweilige Situation der Erkrankten machen. Im Weiteren beziehe ich mich auf die Daten der Deutschen Suchthilfestatistik. Die dieser Statistik zu Grunde liegenden Daten stammen von den in Deutschland behandelten Personen aus dem Jahr 2006 XXX neuere Quelle und wurden durch das Institut für Therapieforschung in München ausgewertet (Sonntag, Bauer & Hellwich, 2007). Ich habe mich auf die Daten aus den ambulanten Suchthilfeeinrichtungen konzentriert, da diese im Zusammenhang mit der ambulant durchgeführten Substitutionsbehandlung am aussagekräftigsten sind. Opiatabängigkeit ist vornehmlich ein Problem von Männern. Ihr Anteil bei den Opiatstörungen liegt bei 77%. Das durchschnittliche Alter beim Erstkonsum liegt für Heroin bei 20,1 Jahren. Das durchschnittliche Erstkonsumalter für Methadon liegt bei 26,3 Jahren und entspricht dem durchschnittlichen Alter bei Beginn einer Substitutionsbehandlung. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Altersstruktur von Opiatabhängigen, die sich 2006 in ambulanter Behandlung befanden: Tab. 3.1: Durchschnittsalter Opiatabhängiger bei Betreuungsbeginn; Deutsche Suchthilfestatistik 2006 Alter MW SD N Männer Frauen Gesamt 32,6 7,7 21.422 31,3 8,2 6.352 32,3 7,9 27.823 Da die Klienten mit Opiatstörungen in der Regel polyvalent konsumieren, ist davon auszugehen, dass der Anfang ihrer Suchtkariere zu einem früheren Alter und mit einer anderen Substanz lag. Genauere Angaben hierzu können allerdings nicht gemacht werden. Die von Klienten mit der Hauptdiagnose Opiate zusätzlich konsumierten Substanzen sind vornehmlich Cannabis (34%), Kokain (24%), Alkohol (22,5%), sowie Benzodiazepine und Barbiturate mit 14,5%. Laut einer Untersuchung aus den USA liegt die Rate der Komorbidität zwischen Tabakabhängigkeit und Opiatabhängigkeit bei über 80% (Kalman, Morissette, Georg, 2005). 25 Opiatabhängige weisen den höchsten Arbeitslosenanteil bei Suchterkrankten auf. Haben noch 52% der Personen mit einer Alkoholstörung einen Arbeitsplatz, so liegt diese Zahl bei den Opiatabhängigen bei nur 26,7%. Diese Situation spiegelt sich im Bildungsniveau dieses Personenkreises wieder. 71,4% der Opiatabhängigen haben keinen oder lediglich einen Hauptschulabschluss. Ihre beruflichen Perspektiven sind somit sehr eingeschränkt. Tabelle 2 gibt über diese Situation einen Überblick: Tab. 3.2: Arbeitssituation und Bildungsniveau Opiatabhängiger; Deutsche Suchthilfestatistik 2006 Arbeitssituation Männer Frauen Gesamt Arbeitslos 53,6 % 55,1 % 53,9 % Arbeitsplatz vorhanden 28,7 % 19,7 % 26,7 % Nicht erwerbstätig 11,3 % 17,2 % 12,7 % Schüler, Azubi, Student 3,9 % 5,8 % 4,3 % Berufliche Reha 1,0 % 1,1 % 1,0 % 56,2 % 45,3 % 53,7 % 17,5 % 27,0 % 19,7 % 17,7 % 18,0 % 17,7 % (Fach-) Abitur 4,0 % 6,3 % 4,5 % Sonderschulabschluss 2,4 % 1,5 % 2,2 % Hochschulabschluss 1,0 % 1,3 % 1,1 % Anderer Schulabschluss 1,2 % 0,6 % 1,1 % Schulabschluss Haupt-/ Volksschulabschluss Realschulabschluss/ Polytech. Ohne Schulabschluss/ in Schulausbildung 3.1.4 Familiäre Situation Opiatabhängiger und Elternschaft Der überwiegende Anteil (74,1%) dieser Klientel ist ledig. Weniger als 14% leben in formal stabilen Beziehungen. Mit 18% lebt ein erheblicher Anteil der Klientinnen mit Kindern aber ohne Partner zusammen. Ein erheblicher Teil der Drogenabhängigen hat Kinder. Die Zahlen schwanken je nach Untersuchung zwischen 29-50%. Konservative Schätzungen gehen von 26 40.000-50.000 Kinder von Drogenabhängigen aus (Klein, 2008). Seit dem in Deutschland flächenddeckend sich die Substitutionsbehandlung etabliert hat, hat sich die Zahl der drogenabhängigen Frauen, die ein Kind gebären erhöht. Dies wird auf die günstigen Bedingungen des Substituts auf die Empfängnisfähigkeit der drogenabhängigen Frau zurück geführt. Die Tatsache, dass die wenigsten Opiatabhängigen in formal stabilen Beziehungen leben ist prikär und wird durch eine Elternschaft verschärt: In unterschiedlichen Studien konnte gezeigt werden, das drogenabhängige Mütter eine schlechtere sozioökonomische Lage, ein höheres Stresserleben, eine stärkere soziale Isolation und eine geringere soziale Unterstützung als bei demografisch vergleichbaren Müttern in den gleichen Wohngebieten hatten. Dabei ist das Vorhandensein sozialer Unterstützung im Falle Alleinerziehender besonders wichtig, da dadurch psychosozialer Stress abgemildert werden kann. In einer weiteren Untersuchung konnten bei Mütter in Substitutionsprogrammen die Merkmale Kindheitstrauma, psychische Störungen, niedriger sozioökonomischer Status und eine ambivalente Ausführung der Mutterrolle gehäuft ermittelt werden (Klein, 2008). Insbesondere die Themen Missbrauch und Vernachlässigung sowie das Elternverhalten und die Eltern-Kind-Beziehung wurden bisher in Studien zu drogenabhängigen Eltern erforscht. Demnach kommen Kindesmissbrauch und –vernachlässigung bei Kindern heroinabhängiger Eltern häufiger vor, als bei Kindern gesunder Eltern. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass diese Rate bei Kindern aus extrem armen Familien ähnlich hoch ist. Die Opiatabhängigkeit kann daher nicht als verursachender Faktor angesehen werden. In einer Untersuchung zum Erziehungsverhalten konnte gezeigt werden das Mütter mit Methadon-Substitution im Vergelich zu Kontrollmüttern eine größere Häufigkeit aversiver Verhaltensweisen wie mehr Kommandieren, Nichtzustimmen, Provozieren und Drohen zeigten. Andere Studien erbrachten wiederholt das Ergebniss, dass drogenabhängige Mütter insgesammt härtere verbale Verhaltensweisen gegenüber ihren Kindern ausführten, das heißt sie häufiger anschrieen und sie scharf tadelten (Klein, 2008). 27 Auf Grund dieser Datenlage fordert Klein (2008) das insbesondere in Substitutionsprogrammen und Entwöhnungsbehandlungen ein Einstig in das Thema „Elternschaft Drogenabhängiger“ erfolgen sollte. Ferner sollte eine kontinuierliche Betreuung und Kontrolle der Eltern und ihrer Kinder sichergesetllt sein, um möglichst gute Entwicklungsergebnisse sicher zu stellen und Schäden zu verhindern. Hierzu können spezielle Programme zur Förderung der Erziehungskompetenz substituierter Drogenabhängiger Mütter sowie eine Kooperation und Vernetzung zwischen den Trägern des Gesundheitswesens sowie der Sucht- und Jugendhilfe dienen. 28 3.2 Stress, Coping und Soziale Unterstützung Betrachtet man die Lebensbedingungen, Lebensbiografien sowie das psychische und somatische Befinden von Opiatabhängigen, so wird deutlich, dass sie sich in vielerlei Hinsicht in einer prekären Situation befinden. Schwerwiegende Begleit- und Folgeerkrankungen, traumatische Erlebnisse in der Biografie, drohende Inhaftierung, oftmals ungesicherte finanzielle Verhältnisse, drohende Obdachlosigkeit und geringe berufliche Perspektiven sind immer wieder Bestanteile der aktuellen Lebenssituation von Opiatabhängigen und Themen in der Behandlung. Diese Lebensbedingungen und gemachten Lebenserfahrungen stellen massiven psychosozialen Stress für die Betroffenen dar. Im Folgenden möchte ich näher auf die Aspekte des Stresses und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit eines Menschen eingehen. Zudem werde ich auf die Konzepte der Stressbewältigung, insbesondere der sozialen Unterstützung eingehen. Dies geschieht unter der besonderen Berücksichtigung des Verlaufes und der Behandlung der Suchterkrankung. 3.2.1 Begriffsdefinition In der Wissenschaft existiert keine allgemeingültige Definition für Stress. Einen Überblick über die Geschichte des Stressbegriffes und der verschiedenen Ansätz ist in Laux (1983) zu finden. Ich beziehe mich im weiteren auf die Definition von Kaluza (2004; S. 15). Er definiert Stress als: „ (…) ein[en] psychophysischer Zustand, bei dem Abweichungen von der Homöostase vorliegen, die durch die verfügbaren, routinemäßigen Reaktionen nicht kompensiert werden können.“ Der zentrale Ort des Geschehens liegt somit in der Person. Aufgrund einer Diskrepanz zwischen ihrer bisher erfolgreich angewendeten Bewältigungsstrategien und der aktuellen ungelösten Situation entsteht ein Konflikt und somit Stress als Resultat dieses Prozesses. Die Folge ist eine Reihe von physiologischen Vorgängen, die für das Stressgeschehen charakteristisch sind. Diese sind z. B. die Aktivierung und Durchblutung des Gehirns, die Reduzierung des 29 Speichelflusses und ein trockener Mund, die Erweiterung der Bronchien und eine Atembeschleunigung, eine erhöhte Muskelspannung und verbesserte Reflexe, ein erhöhter Blutdruck und ein schnellerer Herzschlag. Der Körper stellt über Zucker und Fette mehr Energie bereit, die Hände und Füße sind kalt und es kommt zu einer erhöhten Gerinnungsfähigkeit des Blutes. 3.2.2 Stresskonzepte In der Stressforschung werden drei verschiedene Stresskonzepte unterschieden. Es sind das reizorientierte, das reaktionsbezogene und das interaktionsbezogene Stresskonzept (Lazarus & Launier, 1981; Schulz et al., 2004). Im Folgenden stelle ich die wichtigsten Ansätze dar. Reizorientierte Stresskonzepte gehen davon aus, dass Stress ein Ereignis darstellt, das eine Störungsreaktion induziert. Stressreize schließen demnach verschiedene Umweltereignisse wie Lärm, Umwelkatastrophen, Übervölkerung, Haft, Krankheit, Trauerfälle etc. mit ein. Dieser konzeptionelle Ansatz enstpricht der Logik der behavioristischen Stimulus-ResponsePsychologie (Lazarus & Launier, 1981). Vertreter reaktionsbezogene Stresskonzepte sehen im Stress eine Antwort oder Reaktion aud die Umwelt oder Lebensereignisse. Einer der bedeutesten Vertreter dieses Konzeptes ist der Stressforscher Hans Selye. Er definiert Stress als „ (...) der Zustand, der sich als ein spezifisches Syndrom kundtut, das aus allen unspezifischen hervorgerufenen Veränderungen innerhalb eines biologischen Systems besteht.“ (Selye 1991, S. 81). Den unspezifischen Auslösereiz nennt Selye „Stressor“. Er fasst die körperlichen Reaktionen im Rahmen einer Stressreaktion als allgemeines Anpassungssyndrom (AAS) zusammen (Selye 1936, 1981 & 1991; Neylan, 1998). Demnach verläuft eine Stressreaktion in drei Phasen. Zu Beginn steht die „Alarmreaktion“ mit der Schock- und Gegenschockphase. In ihr wird der 30 Köper in einem Schockzustand versetzt. In dieser Phase werden die Kräfte mobilisiert, die der Organismus in der „Widerstandphase“ für die Bewältigung der Situation benötigt. Dauert die Stresssituation eine längere Zeit an, werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen des Organismus aufgebraucht. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich die Person in der „Erschöpfungsphase“. In ihr fällt die Widerstandskraft unter das Ausgangsniveau. Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb der Erschöpfungsphase die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Erkrankungen steigt oder sie tödlich enden kann (Selye, 1991; Kaluza & Vögele, 1999). Normales Widerstandsniveau Schockphase GegenSchockphase Alarmreaktion Abb. X: Widerstandsphase Erschöpfungssphase Allgemeines Anpassungssyndrom (AAS) nach Selye. Selye postuliert innerhalb seines Konzeptes die Unspezifischheit des Stressors, er differenziert jedoch Stress hinsichtlich seiner Qualität und Wirkung für den Betroffenen. Unter „Eustress“ versteht er Stress in Verbindung mit positiven Folgen, unter „Distress“ fasst er Stress mit seinen negativen Konsequenzen (Selye, 1981). Das Stresskonzept von Selye wurde insbesondere wegen Unspezifischheit des Stressors kritisiert und als unzureichend bezeichnet worden (Lazarus & Launier, 1981). 31 Im weiteren gehe ich detalierter auf das transaktionalen Stresskonzept von Lazarus und die Theorie der Ressourcenerhaltung von Hobfoll ein. Für mich stellen sie die Grundlage für die weiteren Überlegungen dar. Das von Richard Lazarus 1974 entwickelte transaktionale Stressmodell beruht auf der Annahme, dass ein Mensch nicht einfach passiv Stressoren ausgesetzt ist, sondern sich mit seiner Umwelt in einem aktiven Austausch befindet und sich somit selber mit ihr in ein Verhältnis setzten kann (Lazarus & Folkmann, 1984; Lazarus, 1990). Eine entscheidende Rolle kommt hierbei den kognitiven Prozessen in Form von bewertenden Wahrnehmungen, Gedanken und Schlussfolgerungen zu (Kaluza, 2004). Abbildung XXX stellt eine schematische Darstellung dieses Modells dar. Primäre Bewertung Motivation Bedürfnisse Ziele Erwartungen Werte Situation Person Ressourcen Erfahrungen Kontrollüberzeugung Selbstwirksamkeitserwartung Sekundäre Bewertung Abb. XXX: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus. Eine Person bewertet eine Situation hinsichtlich ihrer gemachten Erfahrungen, Bedürfnisse und Ziele. Sieht sie die Befriedigung ihrer Bedürfnisse oder das Erreichen ihrer Ziele als gefährdet an, wird sie die Situation als Stress empfinden. Nach Lazarus kann diese primäre Bewertung der Situation in „Bedrohung“, „Schaden-Verlust“ oder „Herausforderung“ unterteilt werden. Unter Schaden-Verlust sind Wahrnehmungen einer bereits eingetretenen Schädigung 32 (z. B. eine körperliche Verletzung), der Verlust einer nahe stehenden Person oder auch nicht kontrollierbare Störungen gemeint. Sieht eine Person ihre persönlichen „Sollwerte“ durch diese Schadens- oder Verlustereignisse gefährdet, reagiert sie mit Gefühlen von Ärger, Wut oder auch mit Trauer, Hilflosigkeit und Verzweiflung. Unter Bedrohung sind Schädigungen zu verstehen, die noch nicht eingetreten sind aber befürchtet werden. Das Erreichen von bestimmten Zielen und die Befriedigung von Bedürfnissen könnten durch das Eintreten dieser Schädigungen in Gefahr geraten und somit eine Bedrohung darstellen. Angst kann als Emotion daraus resultieren. Diese Kategorie kann mit einem Schaden-Verlust-Ereignis einhergehen und sich somit vermischen. Die dritte Kategorie, Herausforderung, unterscheidet sich von den beiden Vorangegangenen deutlich. Eine Person schätzt die Situation nicht als direkte Gefahr ein. Das Überwinden einer Situation kann zwar mit einem gewissen Aufwand und Risiken verbunden sein, am Ende werden aber positive Erwartungen an die Situation oder deren Bewältigung verbunden. In der Situation wird somit eine Chance gesehen. Diese Kategorie ist zumindest zeitweise mit positivem emotionalen Befinden verbunden. Für das Auftreten einer Stressreaktion ist diese erste, primäre Bewertung der Situation nicht ausreichend. Entscheidend ist vielmehr eine weitere, sekundäre Bewertung hinsichtlich der zu erwarteten Bewältigung der Situation. Es handelt sich hierbei um die Bewertung der eigenen Bewältigungsfähigkeiten. Die Einschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit und der zur Verfügung stehenden Ressourcen, die zum Bewältigen der Situation nützlich sind, stellen entscheidende Faktoren dar. Weiterhin spielen die bisher gemachten Erfahrungen einer Person eine entscheidende Rolle. Die beiden Bewertungsprozesse können sich zeitlich überlappen und gegenseitig beeinflussen. Nach diesem Prozess erfolgt eine dritte Bewertung, in der die Person die affektive Bewertung der Situation in Abhängigkeit von der gewählten Bewältigungsstrategie neu bewertet. Aufgrund dieser Bewertung kann eine Situation als subjektiv bewältigt gelten, oder der Prozess wird erneut in Gang gesetzt (Lazarus & Folkman, 1984; Lazarus 1990; Kaluza & Vögele, 1999). 33 Erweiterung des Modells durch das Konzept von Hobfoll zum Ressourcenerhalt. Buch KFH! Flight und fight Ansatz: Common. (Buch KFH!) In der Stressforschung werden zwei verschiedene Formen von Stress näher beschrieben. Es gibt Stress, der durch kritische Lebensereignisse oder Krisen (critical live events) hervorgerufen wird sowie tägliche Belastungssituationen (daily hassles), die Stress auslösend wirken. Unter kritischen Lebensereignissen werden außergewöhnliche Situationen (z. B. Tod des Partners, Geburt eines Kindes, Trennung oder Scheidung und Umzug etc.) verstanden, die in einem gewissen Zeitraum als Stressoren wirken. Holes und Rahe haben ein mit der Social Readjustment Rating Scale (SRRS) einen Fragebogen entwickelt, der 43 solcher Ereignisse auflistet. Diese Ereignisse wurden mit Hilfe eines Streßindikators (life change unit = LCU) qualitativ gewertet. Dieser Ansatz ist stark kritisiert worden und wird heute kaum noch vertreten (Schwarzer, 2000). Unter „daily hassles“ sind dagegen tägliche Belastungen gemeint, die irritierend, entmutigend, mit quälenden Anforderungen oder konfliktreichen Beziehungen verbunden sind. Von besonderer Bedeutung sind chronische und immer wiederkehrende Belastungen im Alltag (Kaluza, 2004; Schwarzer 2000). Neben dieser Typologie des Stresses, lässt sich eine Differenzierung zwischen akutem und chronischem Stress vornehmen. Chronischer Stress steht in Verbindung mit lang andauernder oder häufig wiederkehrender Alltagsbelastung und phatogenen Auswirkungen. Nach McEwen entspricht chronischem Stress dem wiederholten Auftreten unterschiedlicher Stressoren oder einem Ausbleiben normaler adaptiver Mechanismen bei wiederholtem Auftreten desselben Stresses (Schulz et al., 2004). In der Tabelle XXX sind die Unterschiede zwischen akutem und chronischem Stress aufgeführt. Tab. XXX: Unterschiede zwischen akutem und chronischem Stress. (aus Schulz et al., 2004; S.11) 34 Akuter Stress Chronischer Stress Einmalige, oft aßergewöhnliche Belastungen Beginn abrupt mit erkennbarem Anfang Episodisch wiederkehrende Belastungen Belastung von relativ kurzer Dauer und erkennbarem Ende Mit neuen Anforderungen und wechselnden Umgebungsbedingungen verbunden Mangel bezüglich der Befriedigung spielt eine untergeordnete Rolle Tendenz sichtbar, besondere Bewältigungsmaßnahmen zur Stressreduktion einzusetzen Beginn kann schleichend ohne erkennbarem Anfang sein Belastung von meist langer Dauer ohne erkennbares Ende Mit täglicher Routine und eher gleichbleibenden Umgebungsbedingungen verbunden Mangel an einer Befriedigung relevanter Bedürfnisse ist bedeutsam Keine Veranslassung, besondere Bewältigungsmaßnahmen zur Stressreduktion einzusetzen Je nach Art des wahrgenommenen Stressors werden verschiedene an der Stressreaktion beteiligte Hormonsysteme in unterschiedlicher Weise aktiviert. Aufgrund dieses Hintergrundes entwickelte Henry (1986), ein psychoneuroendokrinologische Stressmodell. Henry unterscheidet in seinem Modell drei Formen von Stressreaktionen. Abbildung XXX stellt dieses Modell vereinfacht dar. 35 Stressor Verarbeitung im fronto-kortalen Kortex Emotionen Ärger Furcht Depression/ Hilflosigkeit Limbisches System Zentrale Amygdala Basale Amygdala Hippokampus Septum Verhalten Kampf Anstrengung Flucht Anstrengung Unterordnung Passivität Noradrenalin + Noradrenalin + Noradrenalin + Neuroendokrine Reaktion + Adrenalin + + Adrenalin +/ - Adrenalin + Kortisol + - Kortisol - - Kortisol + - Testosteron + - Testosteron + + Testosteron + + Abb. XXX: Psychoneuroendokrinologisches Stressmodell nach Henry. (modifiziert nach Henry, 1986, S. 688) Eine Stressreaktion, die innerhalb des Gehirns über den Hippokampus Septum verläuft und mit den Emotionen Depression und Hilflosigkeit erlebt wird, zeigt sich demnach mit einem passiven Verhalten. Macht ein Mensch diese Erfahrungen immer wieder, wird dies mit großer Sicherheit weitgehende Konsequenzen für seine psychische Gesundheit haben. Im Folgenden werde ich darauf explizit eingehen. 36 3.2.3 Stress und Krankheit Stress ist für den menschlichen Organismus generell nicht schädlich. Wiederholte Erfahrungen mit dem Aushalten von begrenztem Stress können positive Auswirkungen auf die spätere Stresstoleranz haben. Entscheidend ist hierfür die Kontrollierbarkeit des Stresses. „Als kontrollierbaren Stress empfindet man eine Belastung oder Anforderung in der Regel dann, wenn man glaubt, sie im Prinzip bewältigen zu können, wenn man aber des dafür notwendigen Verhaltens noch nicht so sicher ist, dass die Anforderung überhaupt keine Stressreaktion mehr auslöst. Man könnte eine solche Situation z. B. als Herausforderung empfinden.“ (Grawe, 2004, S. 239) Wenn nun der Stress als unkontrollierbar wahrgenommen wird, kann dies erhebliche Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben. Eine solche Situation ist z. B. ein andauerndes Missbrauchserlebnis. Das menschliche Gehirn reagiert aufgrund seiner neuronalen Plastizität empfindlich auf solche Ereignisse. In einer solchen Situation kommt es zu einer Reihe von neuronalen Prozessen im Gehirn des Betroffenen, die zu einer allgemeinen Destabilisierung des neuronalen/psychischen Geschehens führen. Vor allem die Stresshormone Noradrenalin und Kortisol spielen hier eine entscheidende Rolle (Hüther 2001 & 2007). Da die bisher in der Stressreaktion aktivierten Verhaltensweisen sich als nicht geeignet erwiesen haben, den Stress zu kontrollieren, werden sie durch das Gehirn „gelöscht“, um sie durch andere, wirksamere zu ersetzen. Eines der Hirnareale, das in dieser Phase besonders aktiv und „lernbereit“ ist, ist die Amygdala. Dieser Hirnregion wird eine große Bedeutung bei der Entstehung von Angst zugesprochen. So ist es nicht verwunderlich, dass bei einer anhaltenden unkontrollierbaren Stresssituation eine Entwicklung von Angst bis hin zu Depressionen und gelernter Hilflosigkeit festzustellen ist. An dieser Entwicklung dürften klassische Konditionierungsprozesse maßgeblich beteiligt sein. Die Forschergruppe um Alloy konzipiert, dass jemand in einem Zustand erregter Angst gerät, der sich über seine Fähigkeiten, Kontrolle über eine Bedrohung zu gewinnen, unsicher ist. Diese Phase wird als „ungewisse Hilflosigkeit“ beschrieben. Hält diese 37 unkontrollierte Bedrohung an, geht dieser Angstzustand in einen ängstlichdepressiven Zustand (Phase der „sicheren Hoffnungslosigkeit“) über, bis sie schließlich in einem depressiven Zustand, der Phase der „tiefen Hoffnungslosigkeit“ endet. Somit kann unkontrollierbarer Stress zu dauerhaften Veränderungen des menschlichen Gehirns und zu einem vermehrten Auftreten von Depressionen führen (Grawe, 2004; Kaluza, 2004). Dem Konsum von Drogen im Zuge einer Stressreaktion kann eine hohe Funktionalität zugesprochen werden. Der Drogenkonsum kann als dysfunktionale Bewältigungsstrategie angesehen werden. Durch das Rauscherleben und die Aktivierung der verschiedenen Neurotransmittersysteme werden die durch die Stressreaktion hervorgerufenen aversiven Gefühle reguliert oder zumindest kurzfristig ausgeschaltet. Wird dieses Verhalten in Stresssituationen wiederholt, entstehen Konditionierungsprozesse. Der Konsument lernt, in solchen Belastungssituationen seine negativen Gefühle durch Drogen zu beheben. Diese erlernten Erfahrungen führen zu einer erhöhten Auftretenswahrscheinlichkeit dieses Verhaltens in zukünftigen Situationen. Zudem wird den eigenen funktionalen Bewältigungsstrategien eine immer geringere Funktion und Wirkung zugesprochen. Dies hat schließlich eine geringere Selbstwirksamkeitserwartung des eigenen Handelns zu Folge. Es entstehen kognitive, emotionale und physische Teufelskreise, die wiederum zur Aufrechterhaltung des Suchtmittelkonsums beitragen. Das Erlernen und Erleben von alternativen, funktionalen Bewältigungsstrategien sind daher zentrale Themen in der Behandlung von Suchtkranken. 3.2.4 Coping-Strategien Ab hier Literatur und Quellen in Liste übertragen! Der Begriff Coping (engl. to cope with = umgehen mit) umfasst alle kognitiven und verhaltensmäßigen Versuche eines Individuums, eine ausgelöste Stresssituationen zu bewältigen. Man kann daher auch von Stressbewältigungsstrategien sprechen. Copingprozesse können automatisch, das heißt unbewusst ablaufen. Sie sind aber dennoch als kognitive und handlungsorientierte Strate- 38 gien des Ichs anzusehen. Es handelt sich dabei also um Prozesse, in deren Verlauf eine aktive Auseinandersetzung mit der Bedrohungssituation stattfindet (Misek-Schneider, 1998). Insbesondere bei der Bewältigung von schweren Krankheiten kommt den Coping-Strategien eine entscheidende Funktion zu (Filipp & Aymanns, 1996). Lazarus (1984) differenziert Coping hinsichtlich einer emotionsorientierten und einer problemorientierten Form. Unter emotionsorientiertem Coping können eine Vielzahl von Strategien verstanden werden, die durch kognitive Prozesse auf die Minimierung des Stresses hinwirken. Hierzu zählen Strategien wie Vermeiden, Distanzieren, Minimalisieren oder auch eine veränderte selektive Aufmerksamkeit innerhalb einer Stresssituation. Ebenso kann die positive Bewertung oder ein positives Fazit der Stresssituation eine solche Bewältigungsstrategie sein. Diese Strategien haben alle gemein, dass durch eine kognitive Neubewertung der Situation eine Entlastung eintritt. Die Stresssituation an sich wird nicht verändert. Der Prozess findet ausschließlich innerhalb der Person statt. Das problemorientierte Coping beinhaltet den Prozess des Problemlösens. Hierzu zählen die Beurteilung des Problems bzw. der Situation und das Finden von alternativen Lösungsstrategien. Es folgt ein Abwägen zwischen Kosten und Nutzen verschiedener Lösungswegen, eine Auswahl der vermeintlich besten Strategie sowie deren Umsetzung in die Praxis. Der Fokus liegt hier auf der Veränderung der Stresssituation durch einen objektiven, analytischen und zielgerichteten Prozess. Beide Formen, emotionsorientiertes und problemorientiertes Coping, können miteinander verbunden auftreten, sich gegenseitig begünstigen aber auch behindern. Entscheidend für die Bewältigung einer Situation sind die der Person zur Verfügung stehenden Coping-Ressourcen. Im Folgenden gebe ich einen Überblick über sechs verschiedene Bereiche von Coping-Ressourcen (Lazarus, 1984): 1. Gesundheit und Energie Gesundheit an sich ist eine wichtige Coping-Ressource. Eine kranke, gebrechliche und angeschlagene Person wird nicht so viel Kraft und Energie haben, eine stressreiche Situation zu bewältigen, wie dies bei einer gesunden, robusten Person der Fall ist. 39 2. Positiver Glaube Der positive Glaube ist eine ebenso fundamentale psychische Ressource. Die Zuversicht, dass eine bestimmte Behandlung oder kompetente Person (z. B. Arzt oder Therapeut) einem weiterhilft, eine belastende Situation zu bewältigen, hat einen großen Einfluss auf den weiteren Verlauf des Stressgeschehens. Auch der Glaube an Gott kann eine entlastende Funktion haben. Entscheidend ist jedoch, inwiefern die Person ihre Kontrollüberzeugung (locus of control) gegenüber der Stresssituation einschätzt: Sieht sie sich nicht im Stande, die Situation von innen heraus zu kontrollieren, dann schreibt sie äußeren Faktoren („das ist halt mein Schicksal“) eine hohe Kontrolle über die Situation zu. Ein externaler „locus of control“ kann in Hilflosigkeit münden und ist daher keine Coping-Ressource. Ebenso kann ein schwacher Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit sich negativ auf das Bewältigungsgeschehen auswirken. 3. Problemlösefähigkeiten Die Fähigkeit, eine Situation zu analysieren, neue Informationen zu beschaffen und alternative Handlungsabläufe zu finden und diese umzusetzen, sind wichtige Problemlösefähigkeiten und stellen demzufolge eine wichtige Coping-Ressource dar. Die Grundlage hierfür stellen vor allem die bisher gemachten positiven Erfahrungen in der Bewältigung von ähnlichen Situationen dar. Dies hat wiederum einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstkontrolle einer Person. 4. Soziale Fertigkeiten Die Fähigkeit, Kontakt mit anderen Personen aufzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren, stellt eine wichtige Grundvoraussetzung dar, um soziale Unterstützung zu erhalten. 5. Materielle Ressourcen Der Zugang zu materiellen Ressourcen wie Geld und der zum Teil erst dadurch mögliche Zugang zu weiteren unterstützenden Dienstleistungen stellt ebenso 40 eine wichtige entlastende Ressource dar. Gerade im Hinblick auf den Zugang zu medizinischen oder sozialen Leistungen stellt dies ein entscheidendes Element dar. 6. Soziale Unterstützung Die Unterstützung durch andere Personen in belastenden Situationen stellt eine sehr wichtige Ressource dar. Sie kann auf verschiedenen Ebenen wirken: neben einer emotionalen Unterstützung durch andere Personen kann sie über direkte, greifbare Unterstützung durch andere wirken oder auch durch die Beschaffung von und den Zugang zu Informationen durch andere Personen. Diese Ressource stellt eine Kernfunktion der Arbeit mit Drogenabhängigen dar. Daher gehe ich im Folgenden auf diesen Bereich näher ein. 41 3.2.5 Soziale Unterstützung Der sozialen Unterstützung oder auch „Social Support“ kommt bei der Bewältigung von Belastungssituationen eine besondere Bedeutung zu. Badura (1981, S. 157) definiert soziale Unterstützung als: „Fremdhilfen, die dem einzelnen durch Beziehungen und Kontakte mit seiner sozialen Umwelt zugänglich sind und die dazu beitragen, daß die Gesundheit erhalten bzw. Krankheiten vermieden, psychische oder somatische Belastungen ohne Schaden für die Gesundheit überstanden und die Folgen von Krankheiten bewältigt werden.“ Auf Basis dieser Definition lässt sich eine inhaltliche Typologie sozialer Unterstützung (Diewald, 1991) erstellen. Wie in Tabelle X dargestellt, zeigt sich sehr deutlich, dass das Spektrum der einzelnen Maßnahmen sehr groß ist. Eine Einteilung kann in die Kategorien „Konkrete Interaktionen“, „Vermittlung von Kognitionen“ sowie „Vermittlung von Emotionen“ vorgenommen werden. Tab. X: Inhaltliche Typologie sozialer Beziehungen. Konkrete Interaktionen (Verhaltensaspekte) 1. Arbeitshilfen 2. Pflege 3. Materielle Unterstützung Vermittlung von Koginitionen 9. Vermittlung von 14. Vermittlung von Anerkennung Geborgenheit 10. Orientierung 11. Vermittlung eines 4. Intervention Zugehörigkeitsbe- 5. Information wusstseins 6. Beratung 7. Geselligkeit 8. Alltagsinteraktion Vermittlung von Emotionen 15. Vermittlung von Liebe und Zuneigung 16. Motivationale Unterstützung 12. Erwartbarkeit von Hilfen 13. Ort für den Erwerb sozialer Kompetenz Soziale Unterstützung lässt sich neben dieser inhaltlichen Differenzierung auch auf der Strukturebene differenzieren: Die geleistete und erhaltene Unterstützung findet in informellen (z. B. Freunde und Bekannte) oder formellen (z. B. Beratungsstelle) sozialen Netzwerken statt. Für das Ausmaß der gewährten und erhaltenen 42 Unterstützung ist entscheidend, in welcher Qualität und Quantität Personen über soziale Beziehungen verfügen. Das Konstrukt soziales Netzwerk eignet sich, um die Qualität und das Ausmaß an sozialer Unterstützung zu untersuchen. Da der Netzwerkbegriff inflationär verwendet wird, verstehe ich hierunter in Anlehnung an Laireiter (1993a), Systeme interpersonaler Beziehungen und egozentrierte oder personale Netzwerke, in deren Mittelpunkt das Individuum steht. Die Wirkung von sozialer Unterstützung wird in zweierlei Hinsicht untersucht und beschrieben. Zum einen als direkte Einflussgröße auf das Wohlbefinden oder als Puffereffekt zwischen Stress und Belastungsreaktion. Unterschiedliche Studien haben beide Effekte sozialer Unterstützung hinsichtlich ihrer protektiven Funktion im Bezug auf die Entstehung von Störungen belegt. Hauptsächliche oder direkte Effekte werden in erster Linie durch Strukturparameter sozialer Beziehungen vermittelt. Hierzu gehören Größenparameter wie soziale Integration, Größe des Netzwerkes, Anzahl der verfügbaren Unterstützer, Verfügbarkeit von Freunden. Puffereffekte sind durch vier Merkmalgruppen gekennzeichnet: 1. emotional nahe stehende Personen (z. B. Ehepartner oder sehr enge Freunde), 2. die emotionale Qualität sozialer Beziehungen (z. B. Grad der partnerschaftlichen Intimität und Nähe), 3. die Stabilität enger Beziehungen über den Belastungszeitraum hinweg und 4. von engen und wichtigen Personen wahrgenommene emotionale, kognitive und Selbstwertunterstützung (Laireiter, 1993b). Die soziale Unterstützung von Drogenabhängigen ist durch mehrere Studien hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Entstehung, den Verlauf und die Behandlung der Abhängigkeitserkrankung evaluiert worden. Ein entscheidendes Merkmal der sozialen Unterstützung Drogenabhängiger ist, dass sie deutlich geringer ausfällt, als bei nicht Abhängigen. Neben einer geringeren Personenzahl im sozialen Netzwerk der Erkrankten ist zudem von einer geringeren Anzahl von Kontakten zu Bezugspersonen auszugehen. Weiterhin werden ein reduziertes Maß an erlebter Unterstützung sowie eine geringere Zufriedenheit mit der erhaltenen Unterstützung festgestellt (Feineis, 1998). 43 Feineis (1998) definiert die Mikrosysteme Arbeit und Familie als „tägliche Basis sozialer Beziehungen“. Fallen diese Bereiche weg, so besitzt die Person keine vorgegebenen täglichen Kontakte mehr. Weiter heißt es dort (S. 127): „Der Verlust der täglichen Basis führt zu einer immer stärkeren Isolierung der Betroffenen und durch den Verlust von wichtigen drogenfreien Bezugspersonen zu einer starken Orientierung hin zu suchtbezogenen Kontakte. Dieser soziale Teufelskreis trägt stark zur Chronifizierung der Abhängigkeit bei.“ Ein weiteres Merkmal der sozialen Unterstützung von Drogenabhängigen ist die Verschiebung der Unterstützung von informellen hin zu formellen Netzwerken. Private unterstützende Kontakte werden mit der Zeit der Abhängigkeit immer seltener, wohingegen professionelle, öffentliche Helfer eine immer größere Rolle spielen. Aufgrund der hohen Rate an psychiatrischer Komorbidität, des oftmals frühen Störungsbeginns und durch die gemachten Erfahrungen von inkonsistenten Beziehungen, dürfte eine Erklärung dafür sein, dass viele Drogenabhängige Schwierigkeiten haben, mit anderen Personen in Kontakt zu treten und soziale Unterstützung effektiv zu nutzen. Dies könnte ebenso eine Erklärung für die geringere Anzahl an informellen supportiven Netzwerken sein. Betrachtet man die psychosoziale Betreuung von Drogenabhängigen unter dem Aspekt der sozialen Unterstützung, so kann sie durch ihre Direkt- und Pufferwirkung eine wichtige entlastende Funktion darstellen. Bei der Auseinandersetzung mit Stress und dessen auslösenden Bedingungen, ist eine Betrachtung der Motivation bzw. der Motive einer Person zwingend erforderlich. Stress ist, wie bereits beschrieben, eine Reaktion des Organismus auf unspezifische Ausgangssituationen. Es ist davon auszugehen, dass eine Gefährdung von individuell wichtigen Zielen einer Person mit einem höheren Stresserleben verbunden ist. Aber was sind nun „wichtige Ziele“? Im weiteren Verlauf der Arbeit werde ich in diesem Zusammenhang auf die Konsistenztheorie von Klaus Grawe näher eingehen. Durch sie wird sehr gut deutlich, welche grundlegenden Bedürfnisse des Menschen sein Handeln motivieren und es zur Entwicklung bringen, was also „wichtige Ziele“ sind. 44 Es wird zudem deutlich, wie eine Nichtbefriedigung dieser Bedürfnisse der Person schadet und sie krank macht. 45 3.3 Bedürfnisbefriedigung und psychische Gesundheit Bereits 1954 entwickelte der amerikanische Psychologe Abraham Maslow (2005) seine Theorie zur Motivation und Bedürfnisbefriedigung. Deutlich später, Ende der 90er Jahre, entwickelte Klaus Grawe die Konsistenztheorie. Grundlegend ist in beiden Theorien die Annahme, dass die Befriedigung von Bedürfnissen die Motivation und damit das Handeln eines Menschen determiniert. Werden wichtige Bedürfnisse einer Person nicht befriedigt, kann sie daran psychisch erkranken. Stress kann in diesem Zusammenhang zum einen als Indikator für Situationen, in denen die Grundbedürfnisse nicht ausreichend befriedigt werden und zum anderen als Verstärker der phatogenen Wirkung dieser Situationen angesehen werden. Im Folgenden werde ich auf diese Zusammenhänge näher eingehen. 3.3.1 Konsistenztheorie psychischen Geschehens Klaus Grawe (1998 & 2004) konzepierte die Konsistenztheorie psychischen Geschehens. Diese Theorie beinhaltet die Hypothese, dass der meschliche Organismus nach der Übereinstimmung oder Vereinbarkeit der gleichzeitig ablaufenden neuronalen/psychischen Prozesse strebt. Diesen Zustand beschreibt Grawe als Konsistenz. Die „Cognitive-Experiential Self-Theory (CEST)“ von Seymour Epstein sowie die Kontrolltheorie von William T. Powers stellen für Grawe das theroretische Fundament der Konsistenztheorie dar. Die Konsistenztheorie basiert auf der Annahme, dass das menschliche Handeln durch die vier Grundbedürfnisse Bindung, Orientierung & Kontrolle, Selbstwerterhöhung & Selbstwertschutz sowie Lustgewinn & Unlustvermeidung determiniert ist. Diese psychischen Grundbedürfnisse sind eher abstrakt formulierte und breit gefasste Absichten. Teilweise interagieren sie miteinander und lassen sich nicht klar voneinander abgrenzen. Deren Befriedigung ist jedoch für das psychische Wohlergehen aller Menschen sehr bedeutsam. Im Laufe der Lebensspanne entwickelt der Mensch auf Grund seiner gemachten Erfahrungen verschieden Strategieen um eine erfolgreiche Bedürfnisbefriedigung zu realisieren oder sie vor mögliche Verletzungen zu 46 schützen. Diese Strategieen differenziert Grawe und benennt sie als Annäherungs- und Vermeidungsschemata. Der Mensch versucht eine möglichst gute Bedürfnisbefriedigung zu realisieren, mit dem Ziel, das sein Organsimus konsistent ist. Können die Grundbedürfnisse nicht ausreichend befriedigt werden, ensteht ein psychischer Zustand den Grawe als Inkongruenz bezeichnet. Ein erhötes Inkongruenzniveau ist als ein höchst komplexer Stresszustand zu bezeichnen. Ist die Realisierung eines Grundbedürfnisses mit motivationalen Konflikten verbunden, dies ist Vermeidungsschemata z. B. der gleichzeitig Fall aktiviert wenn Annäherungs- sind, entsteht und psychische Diskordanz. Beide Zustände, Inkongruenz oder Diskordanz führen zu psychischer Inkonsistenz. Die Entstehung psychischer Störungen wird im Kontext zum Vulnerabilitäts-Stress-Modell (Wittchen & Hoyer, 2006) verstanden. Vulnerabilität beinhaltet die Bereitschaft zu negativen Emotionen wie z. B. schlechte Emotionsregulation, geringe Kontrollerwartungen, starke Vermeidungstendenzen und unsichere Bindungsmuster. Treffen diese interpersonellen Voraussetzungen auf hohe Belastungen in der aktuellen Lebenssituation, entsteht Ingongruenz und Stress. Die Folge sind psychische Störungen. In Abbildung 3.3 ist die Inkonsistenstheorie schematisch darggestellt und die einzelnen Konstrukte zueinander in Beziehung gesetzt. Es wird deutlich, dass die einzelnen Ebenen hierachsich organisiert sind. Im Nachfolgenden gehe ich auf die einzelnen Elemente des Konzeptes detaliert ein. 47 Abb. 3.3: Konsistenztheoretisches Modell des psychischen Geschehens. (aus Grawe, 2004; S. 189) Das Bindungsbedürfnis Das Bindungsbedürfnis kann als das empirisch am besten abgesicherte Grundbedürfnis angesehen werden. Unter dem Bindungsbedürfnis ist das Angewiesensein des Menschen auf eine nahe Bezugsperson zu verstehen. Durch frühe kindliche Beziehungserfahrungen werden Bindungsstile entwickelt. „Das Kind verinnerlicht seine frühen dyadischen Beziehungserfahrungen. Sie schlagen sich in seinem impliziten Gedächtnis in Form von Wahrnehmungs-, Verhaltens-, emotionalen Reaktionsbereitschaften und motivationalen Bereitschaften nieder“ (Grawe, 2004; S. 193). Durch mehere Untersuchungen konnten bei Kindern, die von ihren primären Bezugspersonen getrennt wurden, vier immer wieder vorkommende Bindungsmuster festgetsellt werden: 48 1. Kinder mit sicheren Beziehungsverhalten Sie reagierten mit Beunruhigung auf eine Trennung mit der Mutter und suchen sofort ihre Nähe, wenn sie wiederkommt. Dieses Bindungsmustergeht mit einem guten Urvertrauen einher und ermöglicht die Entwicklung konfliktfreier Annäherungsschemata zur Befriedigung des Bindungsbedürfnisses. 2. Kinder mit unsicherer Bindung und vermeidenden Beziehungsverhalte Sie vermeiden nach der Trennung Nähe und Kontakt zur Mutter und reagieren schon auf die Trennung selbst nicht mit der bei sicher gebundenen Kindern üblichen Beunruhigung. Bei diesem Bindungsmuster überwiegen die Vermeidungsschemata die Annäherungsschemata. Das Individuum setzt sich keinen Verletzungen mehr aus, indem es sich auf Nähe nicht mehr einlässt. Der Preis dafür ist eine schlechte positive Befriedigung des Bindungsbedürfnisses. 3. Kinder mit unsicherer Bindung und ambivalentem Beziehungsverhalten Diese Kinder sind während der Trennung sehr verängstigt und wechseln nach Rückkehr der Mutter zwischen einer aggressiven Ablehnung des Kontaktes und der Suchenach Nähe. Diese Kinder sind nach der Trennung ganz mit der Beziehung beschäftigt und unfrei für andere Aktivitäten. Dieses Bindungsmuster ist durch konflikthafte motivationale Schemata gekennzeichnet. Bei Nähe entstehen Befürchtungen, sie zu verlieren, und bei fehlender Nähe entsteht Angst vor dem Alleinsein. 4. Kinder mit unsicherer Bindung und desorganisiert/desorganisiertem Beziehungsverhalten Diese Kinder reagieren auf Trennung von und Rückkehr der Bindungsperson mit bizarren und stereotypen Verhaltensweisen. Dieses Bindungsmuster kommt wenig häufig vor als die anderen. Es beruht auf einer schweren Verletzung des Bindungsbedürfnisses durch eine felende oder missbrauchteBeziehung zu einer primären Bezugsperson mit schwerwiegenden Folgen für die intrapsychische Regulation. 49 Die Nichtbefriedigung des Bindungsbedürfnisses kann schwerwiegende Schäden zur Folge haben. Diese machen insbesondere Ergebnisse aus der Tierforschung deutlich: so zeigen junge sozial lebende Tiere wie Küken oder Rhesusaffen die man in einer fremden Umgebung alleinlässt, typische Muster von Reaktionen die zusammenfassend als „Protestreaktion“ beschrieben werden kann. Diese Reaktionen bestehen aus Klanglauten, die dem Weinen ähnlich sind, verstärkte motorische Aktivität und wachsames Absuchen der Umgebung, beschleunigter Herzschlag; gesteigerte Körpertemperatur sowie Ausschüttung von Stresshormonen. In Untersuchungen bei denen man junge Tiere über einen längeren Zeitraum von der Mutter getrennt hatte, ging diese „Protestphase“ in eine „Verzweiflungsreaktion“ über. Diese Reaktion stellt in vielem das Gegenteil der Protestphase dar: die motorische Aktivität, die Klagelaute, der Kontakt und das Spielen mit anderenTieren lassen nach. Die Tiere haben eine schlaffe Körperhaltung, einen traurigen Ausdruck und nehemn kaum noch etwas zu sich. Es zeigten sich Verhaltensweisen, die an Hospitalismus erinnern. Zudem ist die „Verzweiflungsreaktion“ durch verlangsamten, unregelmäßigen Herzschlag, erniedrigte Körpertemperatur, veringertem Sauerstoffverbrauch, Gewichtsverlust, verringerte REM-Phasen im Schlaf bei erhötem Aroussl, durch eine verringerte Ausschüttungvon Wachstumshormonen und eine verschelchterte Immunabwehr gekennzeichnet In anderen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass eine relativ milde Störung der Bindungsbeziehung zu einer langfristig erhöhten Stressanfälligkeit führt (Grawe, 2004). In mehreren Untersuchungen wurde der Zusammenhang zwischen den verschiednenen Bindungsmustern und psychischen Störungen bei Erwachsenen erforscht. Zum Einsatz kam dabei fast immer das Adult Attachment Interview (AAI). Es handelt sich dabei um ein semistrukturiertes Interview, das die aktuelle Repräsentation der Bindungserfahrungen in der Vergangenheit und Gegenwart erfasst. Aus dem AAI resultiert eine Zuordnung in die folgenden fünf Bindungstypen: 50 1. Sicher autonome Person ( F) 2. Unsicher-distazierte Person (Ds) 3. Unsicher-verstrickte Personen (E) 4. Personen mit ungelösten Trauma/ungelöster Trauer (U) 5. Nicht klassifizierbare Person (CC) In einer Metaanalyse von Dozier, Stovall und Albus (Schauenberg & Strauß, 2002) wurden klinische Studien hinsichtlich der psychischen Störungen und der Verteilung der AAI-Bindungstypen analysiert. Die Ergebnisse sind wie in Abbildung 3.4 dargestellt, eindeutig: der Anteil der sicher gebundenen Patienten lag bei den meisten Störungen etwas über 10%. Bei der Mehrheit der Störungen überwiegt der unsicher-verstrickte Bindungstyp deutlich den vermeidenden. Sehr deutlich ist dies bei der Borderline-Störung. Bei der Schizophrenie herrscht allerdings umgekehrt in einem noch extremen Ausmaß der vermeidende Bindungstyp vor. In der Untersuchung konnte zudem gezeigt werden, dass sich bei den meisten der Störungen für 70-90% der Patienten deutliche Hinweise auf schwerwiegende traumatische Erfahrungen ergeben, wenn sie über ihre Beziehungsgeschichte erzhählen. 51 Abb. 3.4: Prozentuale Verteilung von AAI-Klassifikationen in unterschiedlichen Stichproben. (in %; F = sicher; E = verstrickt; Ds = distanziert; BPS = Borderline-Persänlichkeitsstörung; APS = Antisoziale Persönlichkeitsstörung) (aus Strauß et al., 2002, S. 283). Das Bedürfnis nach Orientierung & Kontrolle Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle ist das grundlegenste Bedürfnis des Menschen. Jeder Mensch entwickelt mit der Zeit ein Modell der Realität, an dem er seine realen Erfahrungen anpasst. Der Mensch setzt sich mit seiner Umwelt aktiv auseinander und versucht die Realität hinsichtlich der Realisierung der jeweils aktualisierten Ziele abzugleichen. Dieser Prozesses geht mit dem Versuch einher, Konrolle über die Warnehmungen zu erziehlen. „Die realen Lebenserfahungen gehen notwendigerweise entweder mit der Erfahrung einher, dass man erreicht, was man jeweils angestrebt hat, oder dass man es nicht erreicht. Man macht also notwendigerweise positive oder negative Kontrollerfahrungen. Der Kontrollaspekt ist mit der zielorientierten Aktivität untrennbar verbunden“ (Grawe, 2004; S. 231). Positive Kontrollerfahrungen, also Erfahrungen, dass man bestimmte Ziele durch sein eigenes Verhalten erreichen konnte, führen zu positiven 52 Kontrollüberzeugungen oder zu positiven Selbstwirksamkeitserwartungen. Das Kontrollbedürfnis bezieht sich demnach auf den Kompetenzaspekt der psychischen Aktivität. Wenn eine Person etwas im Sinne ihrer eigenen für wichtig empfundenen Ziele nicht kontrollieren kann erlebt sie eine schwerwiegende Verletzung des Bedürfnisses nach Kontrolle. Psychische Störungen, die von den Betroffenden als unkontrollierbar erlebt werden, stellen daher auch immer eine Verletzung des Kontrollbedürfnisses dar. Werden die anderen Grundbedürfnisse verletzt, waren die Kontrollmechanismen nicht ausreichend wirksam. Diese Verletzungen gehen daher oft mit einer Verletzung des Kontrollbedürfnisses einher. Insbesondere in der frühen Kindheit ist das Kontrollbedürfnis stark mit dem Bindungsbedürfnis gekoppelt, da Kinder versuchen über Bezugspersonen Kontrolle über Situationen auszuüben. Erst in späteren Jahren differenzieren sich die Bedürfnisse voneinander. Der Kontrollaspekt ist insbesondere hinsichtlich der Kontrollierbarkeit von Inkongruenz die daraus resultierenden Folgen für das psychische Befinden sehr bedeutsam. Ich werde darauf zu einem späteren Zeitpunkt näher eingehen. Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung & Selbstwertschutz Dieses Grundbedürfnis unterscheidet sich in mehrer Hinsicht von den anderen genannten Bedürfnissen. Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz ist ein spezifisches menschliches Bedürfnis. Es setzt Qualitäten wie ein Bewusstsein seiner selbst als Individuum und reflexivem Denken voraus. Das Selbstbild entwickelt sich in der Interaktion mit andren Menschen. Dies geschieht insbesondere über die sprachliche Kommunikation. Bei der Selbstwertregulation handelt es sich um neuronale Regelkreise der höchsten Stufe der hierachischen Informationsverarbeitung. Es existieren zur Selbstwertregulation bisher keine neurowissenschaftlichen 53 Forschungsarbeiten. Was bisher zu diesem Thema empirisch fundierte gesagt werden kann, stammt aus sozialpsychologischen Untersuchungen mit erwachsenen menschlichen Versuchspersonen. Für die Entwicklung des Bedürfnisses nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz eine ausreichende Befriedigung des Bindungs- und Kontrollnedürfnisses von entscheidender Bedeutung. Dies wird an dem folgenden Beispiel deutlich: ein Kind erlebt eine schlechte oder unzureichende Bindung zu seiner Mutter. Es kann sein Bindungsbedürfnis nicht ausreichend befriedigen. In der Denkweise des Kindes gibt es zwei Möglichkeiten: Ich bin gut und die Mutter ist schlecht oder ich bin schlecht und die Mutter ist gut. Für ein kleines Kind, das von der Mutter abhängig ist, mag die erste Alternative die weitaus schlimmere sein. Ein Kind, das von einer „schlechten“ Mutter abhängig ist, ohne die Hoffnung, das es selbst etwas an der Situation ändern kann, erlebt Gefühle wie Angst, Hilflosigkeit, ständige Enttäuschungen, Wut auf die Mutter und Hoffnungslosigkeit. Die andere Alternative ist aus der Sicht des Kindes besser: Wenn das Kind das Verhalten der Mutter auf sein eigenes „schlechtes“ Verhalten attribuiert, geht dies zwar auch mit negativen Geühlen und dem Gedanken einher, nicht mehr Wert zu sein besser behandelt zu werden. Es bleibt aber die Hoffnung, die Situation in Zukunft selbst ändern zu können. Es bleibt ein gewisses Gefühl der Kontrolle. Ein kleines Kind wird in einer solchen Situation dazu neigen sich schlecht und wertlos zu fühlen. Wiederholt sich diese Situation immer wieder, baut das Kind ein stabiles-negatives Selbstbild und Selbstwertgefühl auf. Menschen, die ein schlechtes Selbstwertgefühlbesitzen, zeigen häufig Verhaltensweisen, die dieses schlechte Selbstwertgefühl aufrecht erhalten. Diese Verhaltensweisen können als Resulatat vorwegnehmender und schützender Vermeidungsstrategien angesehen werden. Ihr Ziel ist es Schmerzen zu vermeiden und im Sinne des Kontrollprinzips das Kontrollbedürfnis ausreichend zu befriedigen. 54 Selbstwerterhöhendes Verhalten korreliert positiv mit dem Grad der psychischen Gesundheit. Dies geht sogar über das Maß der real gegebenen Gegebenheiten hinaus. Gesunde Menschen neigen zu Selbstwertillusionen. Dagegen nehmen Depressive und Personen mit niedrigem Selbstwertgefühl positive und negative Aspekte bei sich wahr und stimmen ihre Selbstbeurteiliung mehr mit der Fremdbeurteilungen überein. Grawe geht davon aus, dass die fehlende Tendenz zur Selbstwerterhöhung bei Depressiven mit zur Aufrechterhaltung des depressiven Zustandes beiträgt. Er sieht in ihr jedoch nicht die Urache der Depression. Vermutlich hängt dies mit der Überaktivierung des Vermeidungssystems im Gehirn zusammen, dass das Annäherungssystem aktiv hemmt. Die Selbstwertillusion ist kann daher als ein Zeichen guter seelischer Gesundheit angesehen werden. Das Bedürfnis nach Lustgewinn & Unlustvermeidung Das Grundbedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung ist das dem Erleben am besten zugängliche Bedürfnis. Grundlegend ist die Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt. Er identifiziert und kategorisiert automatisch sämtliche Erfahrungen hinsichtlich der Qualität „gut“ oder „schlecht“. Wie ein Reiz emotional bewertet wird, hängt nicht von seinen objektiven Merkmalen sondern von den bisher gemachten Erfahrungen und des aktuellen Zutands des Individuums ab. Dinge die man gerne macht, die einem Lust verschaffen gehen mit einem inttinsisch motivierten Zustand einher. Eine vollkommende Befriedigung dieses Bedürfnisses kann im Sinne der Konzeption von Csikszentmihalyi als „flow experience“ angesehen werden. Es ist aus der Sicht der Konsistenztheorie ein Zustand der völligen Übereinstimmung der gleichzeitig ablaufenden psychischen und physischen Prozesse. Aktuelle Warnehmungen und Ziele stimmen völlig miteinander überein. Zudem existiert keine konkurrierende störende Intention. Die beschriebenen Grundbedürfnisse lassen sich nur schwer durch Beobachtungen oder Messungen operationalisieren. Auf der Ebene des Individuums finden sie ihren Ausdruck in dessen Motivationalen Zielen und 55 Schemata. Sie dienen einer guten Bedürfnisbefriedigung. Der Mensch entwickelt sie im Laufe seiner Sozialisation. Genetische Bereitschaften und Präferenzen, kulturelle und geselschaftliche Lebensbedingungen sowie die konkreten individuellen Sozialisationsbedingungen innerhalb der jeweiligen Gesellschaft nehmen auf die Entwicklung der individuellen Ziele sowie der zur Verfügung stehenden Mittel zu ihrer Realisierung Einfluss (Grosse Holforth, Grawe & Tamcan; 2004). Annäherungs- & Vermeidungsziele Annäherungs- und Vermeidungsziele bilden keine Gegenpole, es handelt sich dabei vielmehr um qualitativ unterschiedliche Zieltypen. Bei Annäherungszielen geht es darum, die Diskrepanz zu einem positiv besetzten Ziel zu verringern. Bei Vermeidungszielen wird dagegen versucht, die Diskrepanz zu seinem negativ bewerteten Ziel zu vergrößern. Annäherungsziele sind klar formuliert, gehen mit positiven Emotionen einher, können mit intrinsischer Motivation verfolgt werden und deren Realisierung liegt in der Hand des Individuums. Es wird zudem sehr schnell klar, ob man sich dem Ziel annähernd. Vermeidungsziele sind dagegen breiter gefasst. Sie benötigen eine verteilte Aufmerksamkeit und ein erhöhtes Maß an Kontrolle. Vermeidungsziele gehen häufig mit neativen Emotionen einher, da die Warnehmung darauf ausgerichtet ist, Negatives auszumachen, um es abzuwehren und vermeiden zu können. Vermeidungsziele sind keine günstigen Ziele, was eine gute Zielerreichung und gute Bedürfnisbefriedigung angeht. In mehreren Studien konnte der positive Zusammenhang zwischen körperlichen Sypmtomen und Vermeidungszielen festgestellt werden. Probanden, bei denen unter den von ihnen frei genannten Zielen mehr Vermeidungsziele enthalten waren, hatten signifikant mehr körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen, Kurzatmigkeit, Brustoder Herzschmerzen, Magenschmerzen, Schweindel- und Schwächegefühle (Grawe, 2004). Das Team um Grawe entwickelte den „Fragebogen zur Analyse Motivationaler 56 Schemata“ (FAMOS) um die motivationaler Zielkomponenten einer Person zu erfassen. Auf Grund der durch das Instrument erhobenen Informationen wird eutlich, welche Ziele für eine Person besonders wichtig bzw. schlimm sind. In Tabelle 3.3 sind die einzelenen Skalen des FAMOS aufgeführt (Grosse Holforth & Grawe, 2004). Tab. 3.3: Skalen des FAMOS (aus Grosse Holforth & Grawe, 2004, S. 13) Skalen Annäherungsziele Intimität/Bindung Geselligkeit Anderen helfen Hilfe bekommen Anerkennung/Wertschätzung Überlegensein/Imponieren Autonomie Leistung Kontrolle haben Bildung/Verstehen Glauben/Sinn Das Leben auskosten Selbstvertrauen/Selbstwert Selbstbelohnung Skalen Vermeidungsziele Alleinsein/Trennung Geringschätzung Erniedrigung/Blamage Vorwürfe/Kritik Abhängigkeit/Autonomieverlust Spannungen mit anderen Sich verletzbar machen Hilflosigkeit/Ohnmacht Versagen Zusammenfassende Skalen Intensität Annäherungsziele Intensität Vermeidungsziele Vermeidungsdominaz Annäherungs- und Vermeidungsschemata Im Laufe der Lebensspanne eines Menschen bilden sich motivationale Schemata heraus die als Ordnungsmuster der psychischen Aktivität angesehen werden können. Sie sind hierachisch Organisiert und dienen der Befriedigung von Grundbedürfnissen. Analog zu den Zielen, die ein Mensch verfolgt, können sie in motivationale Annäherungs- und Vermeidungsschemata differenziert werden. Ausschlaggebend sind hierfür die gemachten Lebenserfahrungen des Individuums. „Wächst ein Mensch in einer Umgebung auf, die ganz auf die ganz auf die Befriedigung seiner Bedürfnisse eingestellt ist, wird er hauptsächlich annähernde motivationale Ziele entwickeln und erwirbt viel Erfahrung mit positiver Befriedigung. Dazu gehören entsprechende Erwartungen und ein differenziertes Verhaltensrepertoire zur Realisierung der Ziele unter verschiedenen Bedingungen. Wächst ein Mensch dagegenin einer Umgebung auf, in der seine Grundbedürfnisse immer wieder verletzt, bedroht oder 57 enttäuscht werden, entwickelt er Vermeidungsschemata, um sich vor weiteren Verletzungen zu schützen“ (Grawe, 2004; S. 188). Vermeidende Schemata führen zu einer schlechten Bedürfnisbefriedigung, gehen mit und gehen mit einer ungünstigen psychischen Gesundheit einher (Grawe, 2004; Fries, 2005). Nicht nur die Entwicklung der motivationlen Schemata unterliegt dem Einfluss der menschlichen Umgebung. Auch das menschliche Gehirn verändert sich auf Grund von Umwelt- und sensorischen Einflüssen, indem sich seine synaptischen Verbindungen umorganisieren. Dieser sich strukturell Veränderungsprozess oder in findet ihrer auch Effizienz noch im Erwachsenenalter statt (Gauggel, 2006). Auf Grund der gemachten Erfahrungen werden im Gehirn des Menschen neuronale Kaskaden in Gang gesetzt. Das Ziel ist eine gute Bedürfnisbefriedigung bzw. Schutz vor Bedürfnisverletzungen. Wiederholen sich die gemachten Lebensefahrungen, werden ebenfals die selben neuronalen Erregungsmuster aktiviert. Durch diesen Lernprozess werden neuronale Strukturen „gebahnt“, die in der Zukunft in ähnlichen Situattionen leicht aktiviert und abgerufen werden können. Diese neuronalen Bahnungen korrespondieren mit der Entwicklung von Annäherungs- und Vermeidungsschemata. Inkonsistenz psychischen Geschehens Die Unvereinbarkeit gleichzeitig ablaufender psychischer Prozesse miteinander wird als Inkonsistenz bezeichnet. Sie kann unterschiedliche Formen haben, die Grawe wie folgt differenziert: 1. Interferenz zweier oder mehrer psychischer Prozesse Dies ist der Fall, wenn z. B. zwei unterschiedliche Reaktionstendenzen ausgelöst werden, die sich widersprechen. Man bekommt beispielsweise in blauer Schrift das Wort „rot“ dargeboten. 58 2. Kognitive Dissonanzen Dies beinhaltet, dass zwei Kognitionen füreinander relevant, aber nicht miteinander vereinbar sind. Eine Frau hat eine starke Ablehnung gegenüber einer Partei. Sie verliebt sich in einen Mann und erfährt nach einiger Zeit, dass er dieser Partei angehört. 3. Motivationale Konflikte – Diskordanz Grundlegend ist, dass es zu Konflikten kommt, da sich der Mensch zwischen verschiedenen Situationen entscheiden muss. Aus der klinischen Perspektive haben die motivationalen Konflikte die größte Relevanz, bei denen Annäherungs- und Vermeidungsschemata gleichzeitig aktiviert sind. 4. Inkongruenz motivationaler Ziele Inkongruenz bezeichnet den Zustand, indem die motivationalen Ziele und der realen Wahrnehmungen stark auseinander gehen und somit die Bedürfnisse der Person nicht ausreichend befriedigt werden. Hohe Diskordanz und Interferenz psychischer Prozesse führen unmittelbar zu Inkongruenz, da durch sie die Grundbedürfnisse nicht gut befriedigt werden können (Grosse Holforth & Grawe, 2004). Grawe misst insbesondere der Inkongruenz einer großen Bedeutung bei der Entstehung von psychischen Erkrankungen zu. Inkongruenz steht mit einer Vielzahl von Lebensbereichen in einem direkten oder indirektem Zusammenhang. Dies wird in Abbildung 3.5 deutlich. „Inkongruenz kann sehr unterschiedliche Gründe haben, z. B. allgemein ungünstige Lebensbedingungen wie finanzielle Probleme, keine Arbeit oder schlechte Bildung, oder z. B. Defizite, mangelnde individuelle Ressourcen. Diskordanz meint gleichzeitig unvereinbare motivationale Tendenzen, also innere Konflikte, z. B. der Wunsch nach etwas, z. B. Nähe, aber Angst vor Zurückweisung, oder zwei verschiedene Wünsche, die sich gleichzeitig nicht 59 verwirklichen lassen, z. B. der Wunsch, Karriere zu machen und gleichzeitig der Wunsch, viel Zeit für die Familie zu haben.“ (Heiniger Haldimann, 2007). Abb. 3.5: Das Inkongruenzniveau im psychischen Geschehen. (aus Grawe, 2004, S. 347). Einer großen Bedeutung wird der Kontrollierbarkeit von Inkongruenz eingeräumt. XXX Bezug zu Seite 28 herstellen! Entstehung psychischer Erkrankungen „Bei der Frage der lebensgeschichtlichen Entstehung psychischer Störungen kann die Entstehung von Vulnerabilitäten demnach als Zusammenspiel von genetischen Voraussetzungen und bedürfnisverletzenden Lebenserfahrungen, die zu unkontrollierbarer Inkongruenz führen, betrachtet werden.“ (Heiniger Haldimann, 2007) Psychische Erkrankungen enstehen demnach im Sinne des Vulerabilitäts- 60 Stress-Modells. Vulerabilität in Kombination mit Stress führt zu einer Störung, wobei Stress als Inkonsistenz verstanden werden kann. Vulnerabilität oder Diathese meint eine erhöhte Anfälligkeit für psychische Erkrankungen. Diese können, wie in Abbildung 3.6 zu sehen ist, in der Person liegen (Intraindividuell) oder durch die soziale Umwelt begünstigt werden (Wittchen & Hoyer, 2006). Abb. 3.6: Vulnerabilitäts-Stress-Modell psychischer Störungen. (aus Wittchen & Hoyer, 2006, S. 20). Die Forschergruppe um Klaus Grawe hat in mehreren Untersuchungen den Zusammenhang zwischen motivationalen Ziele, Inkongruenzniveau und psychischen Befinden untersucht (Grosse Holforth, Grawe & Tamcan, 2003; Grawe, 2004). Die Ergebnisse sind eindeutig: In einer Stichprobe von 283 Psychotherapiepatienten konnte eine Korrelation zwischen Inkongruenz und dem Wohlbefinden von -.78 ermittelt werden. Bei einer gemischten Stichprobe (n = über 1000) von Personen verschiedener klinischer Gruppen und Normalpersonen lag die Korrelation sogar bei -.87. Das Wohlbefinden hängt demnach sehr deutlich davon ab, inwieweit es jemanden gelingt seine motivationalen Ziele Annäherungsinkongruenz zu lag realisieren. dabei noch Die Korrelation etwas höher als für für die die 61 Vermeidungsinkongruenz (-.77 gegenüber -.63). Das psychische Wohlergehen eines Menschen ist also noch mehr davon abhängig, wie gut es ihm gelingt seine Annäherungsziele zu realisieren, als wie gut es ihm gelingt negative Situationen zu vermeiden. XXX Konsistenzsicherungsmechanismen sind Awehrmechanismen, Coping, Emotionsregulation etc. S. 191 3.3.2 Konsequenzen für die Behandlung Opiatabhängiger Grawe entwickelte auf Grund der Konsistesnztheorie psychischen Geschehens die Psychologische Therapie, ein Therapieschulen übergreifendes Therapiekonzept (Grawe, 1998 & 2004). Im weiteren Verlauf werde ich darauf näher eingehen und sich daraus ableitende Konsequenzen für die Behandlung Opiatabhängiger benennen. Grawe beschreibt den Ansatz seines Behandlungskonzeptes wie folgt: „Ich bezeichne das als Inkonsistenzbehandlung, als eine Verbesserung der Bedürfnisbefriedigung. Man muss sich die fragen: Was hat denn diesen Menschen so verletzlich gemacht, dass es zu dieser schlechten Bedürfnisbefriedigungssituation gekommen ist, die man auch als Stress bezeichnen könnte. Das kann z. B. eine schlechte Emotions- und Stressregulation sein, also eine Bereitschaft, auf Belastungen sehr leicht und schnell mit negativen Emotionen zu reagieren, verbunden mit der Schwierigkeit, sie wieder herunterzuregulieren“ (Grawe, 2005a). Auf Grund dieses Ansatzes postuliert Grawe drei Komponenten auf die sich die Psychotherapie integriert ausrichten sollte: 1. die Symptomatik oder Störung mit ihrer Eigendynamik, 62 2. die unmittelbate Entstehungsbedingungen der Symptomatik, also der Inkonsistenz erzeugende Lebenskontext, indem sich die Störungen entwickelt haben und 3. den Ansatz an den Ursachen für Verletzlichkeiten, unsicheren Bindungsmuster, schlechte Emotionsregulation, schlechte Kontroll- und Kompetenzerwartungen etc. Es stellt sich die Frage, was das für die Behandlung Opiatabhängiger bedeutet. In diesen drei Komponenten spiegeln sich die drei Faktoren Droge, Person und Umwelt des bereits erwähnten Trias-Konzeptes von Kielholz und Ladewig wieder. In der Behandlung Opiatabhängiger müssen diese Bestandteile integriert werden: Die Störung mit ihrer Eigendynamik beinhaltet die Effekte der Droge, auftretende Entzugssymptome, neurobiologische Effekte des Substanzkonsums und vieles mehr. Die unmittelbaren Enstehungsbedingungen der Symptomatik beinhalten unter anderem die soziale Umwelt, die familiäre Situation sowie dem Milieu in dem die Abhängigkeit ensteht. Zudem beinhalten sie die aktuelle Lebenssituation (Arbeitssituation, Schuldensituation, juristische Situation etc.) des Betroffenen. Zudem müssen in der Behandlung individuelle personelle Faktoren wie z. B. dysfunktionale Kognitionen, unsichere Bindungsmuster, schlechte Emotionsregulation sowie schelchte kompetenz- und Kontrollerwartungen berücksichtigt und in die Behandlung integriert werden. Es wird deutlich, dass die Behandlung Opiatabhängiger sehr vielschichtig ist und einer Mehrperspektivität bedarf. In seinem Therapiekonzept formuliert Grawe (2005) die Notwendigkeit dieser Mehrpespektivität des Therapeuten als Grundlage für eine erfolgreiche Psychotherapie: Die Störungsperspektive Es exestieren störungsspezifische Interventionen, die bereits gut evaluiert und wirksam sind. Ein Therapeut sollte sich dieser Maßnahmen bedienen. 63 Die interpersonale Perspektive Die interpersonale Perspektive bezieht sich zum einen auf die TherapeutenPatienten-Beziehung. Andereseits bezieht sie sich auch auf das Eingebettet sein des Patienten in sein interpersonales Umfeld. Die Bedeutung von sozialen Netzwerken kommt hier zum tragen. Die motivationale Perspektive Es stellt sich die Frage, wozu der Patient bereit ist. Wie sieht seine Veränderungsmotivation aus? In welcher Phase des therapeutsichen Geschehens befindet er sich? Zudem sollte berücksichtigt werden inwiefern und welche motivationalen Konflikten der Patient hat. Der Fokus liegt in der motivationalen Konsistenz des psychischen Geschehens. Die entwicklungsgeschichtliche Perspektive Die Frage nach der Entsehung der Störung beschäftigt viele Patienten. Wie ist es dazu gekommen? Sie wollen wissen wo sie stehen und sich einordnen können. Die Klärung dieser Frage ist für die Behandlung der Störung hilfreich, da der Patient ein eigenes Krankheitskonzept entwickeln und sie angehen kann. Die Ressourcenperspektive Der Patient soll nicht alleine auf seine Probleme und Defizite reduziert werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass seine Fähigkeiten und Kompetenzen im Therapieprozess berücksichtigt werden. Dies beinhaltet auch seine Wünsche, was er erreichen möchte und zu was er motivational bereit ist (Gassmann & Grawe, 2009). Das Ziel der psychotherapeutischen Behandlung ist, wie erwähnt, eine Verbesserung der Konsistenz psychischer Prozesse. Grawe sieht die größten Möglichkeiten der Konsistenzverbesserung in der Realisierung der folgenden drei Ansätze: Konsistenzverbesserung durch störungsorientierte Behandlung 64 Psychische Erkrankungen stellen an sich eine zusätzliche Inkonsistenzquelle dar. Sie behindern die Realisierung motivationelr Ziele und stellen eine Verletzung der Grundbedürfnisse dar. Durch eine störungsorientierte Behandlung kann eine Störung reduziert werden. Gelingt dies, wird eine verbesserte Konsistenz im psychischen Geschehen realisiert. Zudem können motivationale Ziele können besser erreicht werden. Grawe (2004) konnte empirisch eine Korrelation zwischen der Abnahme psychophatologischer Symptome und der Abnahme der Inkongruenz von .64 ermitteln. Er misst dem positiven Effekt einer gelungenen störungsorientierten Behandlung eine große Bedeutung zu. Durch ihn werden weitere Rückkopplungsprozesse ausgelöst, die sich in einer Verringerung von Vermeidungszielen, verbesserter Kompetenzerwartung und Coping-Verhalten sowie einer besseren Nutzung von Ressourcen führt. Interpersonale Konfikte sollten demnach schwächer werden. Konsistenzverbesserung durch positive Erfahrungen im Therapieprozess Insbesondere zu Beginn der Behandlung erleben Patientienten auf Grund ihrer Störung Kontrollverlust. Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle sind aktiviert. Hier sollte der Therapeut durch sein Vorgehen klar und transparent gestalten. Er kann ein plausibles Verständnis der Störung vermitteln und dem Patienten erklären, was er selber tun kann, damit es ihm besser geht. Der Therapeut sollte hierbei auf die Erfahrungen, Anregungen und Vorschläge des Patienten eingehen und diese Berücksichtigen. Der Patient sollte die Erfahrung machen, zwischen verschiedenen Möglichkeiten selber wählen zu können. Erlebt er zudem, dass er einzelne Aufgaben im Rahmen der Behandlung gut umsetzen kann wird sein Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle befriedigt. Der Therapeut sollte bei seinem Vorgehen die Fähigkeiten des Patienten als Ressource nutzen und positiv herausstellen. Dieses ressourcenaktivierende Vorgehen wirkt sich positiv auf den Therapieerfolg aus. Im Rahmen der Behandlung können z. B. Techniken wie die Hypnose, Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson und Autogenes Training eingesetzt werden, um bei dem Patienten positive Zustände hervor zu rufen. 65 Macht der Patient in der Zusammenarbeit mit dem Therapeuten viele solcher positiven Erfahrungen, findet ein motivationales Priming statt. Dies beinhaltet, dass das Annäherungssystem durch emotional positive Erfahrungen aktiviert und vorgebahnt wird. Es besteht die tendenz zu posiziven emotionen und zu annähernden Verhalten. Negative Emotionen und Vermeidungsreaktionen werden dagegen abgeschwächt. Durch diese Erfahrungen wird der Patient offener für therapeutische Interventionen. Offenheit des Patienten ist nach Grawe (2004) einer der wichtigsten Therapieerfolg. Abbildung 3.7 Prädiktoren für einen guten macht die funktionale Rolle von bedürfnisbefriedigenden Erfahrungen im Therapieprozess deutlich. Ressourcenaktivierung und maßgeschneiderte Beziehungsgestaltung Störungs- und problemspezifische Intervention Positive Erfahrungen für das Bindungs-, Kontroll-, Selbstwertund Lustbedürfnis Annäherungspriming, Aktivierung des Annäherungsmodus Abnahme von Ingongruenz Bahnung neuer neuronaler Erregungsmuster, die das Problemverhalten hemmen oder ersetzen Verringerung der Symptome und Probleme Verbessertes Wohlbefinden Abb. 3.7: Funktionale Rolle bedürfnsbefriedigender Erfahrungen im Therapieprozess. (aus Grawe, 2004, S. 408). 66 Psychische Erkrankungen, insbesondere die Suchterkrankung, sind oftmals mit einem negativen Selbstwertgefühl der Betroffenden verbunden. Sie erleben ihre Erkrankung als persönliches Versagen. Gerde deswegen sind die Patienten für selbstwerterhöhende Erfahrungen empfänglich. Der Therapeut sollte dies berücksichtigen und die Stärken und Ressourcen des Patienten wahrnehmen, diese widerspiegeln und ihm selbstwerterhöhende Erfahrungen ermöglichen. Konsistenzverbesserung durch Behandlung individueller Inkongruenzquellen Psychische Störungen sind das Resultat von zu hoher Inkongruenz im psychischen Geschehen und tragen selber wieder zu einer Erhöhung des Inkongruenzniveaus bei. Sie wären aber ohne eine Inkongruenzquelle nicht entsanden. Im Rahmen einer Therapie sollte daher eine Inkongruenzanalyse durchgeführt werden um zum einen festzustellen ob überhaubt ein erhöhtes Inkongruenzniveau vorliegt und worin gegebenenfalls die Inkongruenzquelle liegt. Ursachen erhöhter Inkongruenz sind nach Grawe: 1. Ungünstige gegenwärtige Lebensbedingungen wie Armut, Arbeitslosigkeit, schlechte soziale Umgebung, geringe Unterstützungsmöglichkeiten, Krankheiten und körperliche Beeinträchtigungen, 2. Ungünstige Beziehungen in denen der Patient gegenwärtig lebt, 3. Ungünstiges Beziehungsverhalten des Patienten, 4. Ungünstige Konsistenzsicherungsmechanismen, 5. Ungünstige Kognitionen, 6. Übermäßig ausgeprägte Vermeidungsschemata. Berücksichtigt man bei der Betrachtung dieser Aufzählung die Lebenssituation von Drogenabhängigen, wird sehr schnell klar, dass sie sich in Situationen erhöhter Inkongruenz befinden die durch sehr viele und unterschiedliche Quellen gespeisst wird. Die Behandlung sollte sich insgesamt auf eine Verringerung von Inkongruenz ausrichten. 67 Die Wirksamkeit einer psychotherapeutischen Behandlung schreibt Grawe nicht Therapieschulen und einzelnen Therapiemethoden sondern allgemein formulierten therapeutischen Wirkfaktoren zu (Grawe, 2005b). Sein Team hat im Rahmen von Metaanalysen fünf Wirkfaktoren kenntlich gemacht die als gemeinsame Merkmale in erfolgreichen Therapieen zum tragen kamen. 1. Wirkfaktor Ressourcenaktivierung Das Nutzen der Fähigkeiten des Patienten als Ressource, insbesondere seiner motivationalen Bereitschaften für die Therapie. Einen guten Überblick bietet hierzu das von Flückiger und Wüsten (2009) entwickelte Manual zur Ressourcenaktivierung. 2. Wirkfaktor Problemaktualisierung Probleme, die im Rahmen der Behandlung bearbeitet werden sollen unmittelbar Erfahrbar gemacht werden. Dies kann durch Aufsuchen von speziellen Orten erfolgen, durch Rollenspiele oder die Einbindung von wichtigen Bezugspersonen. 3. Wirkfaktor Problembewältigung Im Rahmen der Behandlung erlebt der Patient eine direkte Unterstützung bei der aktiven Bewältigung seiner Probleme. 4. Wirkfaktor motivationale Klärung Der Patient erhält ein klareres Bild von seinen Problemen. Ihm werden die Zusammenhänge und Bestandteile seines problematischen Erlebens und Verhaltens bewusst. 5. Wirkfaktor Therapiebeziehung Eine vom Patienten erlebte positive Beziehung zu seinem Therapeuten wirkt sich signifikant positiv auf das Therapieergebnis aus. Es wird deutlich, dass es sich bei der Psychologischen Therapie um ein therapieschulen und störungsunabhängiges Globalkonzept handelt. Grawe 68 erfasst den Patienten in seiner aktuellen und entwicklungsgeschichtlichen Situation durch mehrere Perspektiven. Auf diesem Hintergrund ist ein ganzheitliches Therapiekonzept entstanden, das mehrere parallel ablaufender Behandlungsstrategieen und Ansätze beinhaltet. Abbildung 3.7 stellt das Therpiekonzept in einer Übersicht dar. Therapeut Patient Setting Institution Soziales Umfeld Lebensbedingungen Interaktion Ausrichtung der Therapie auf die drei Komponenten: Symptomatik mit ihrer Eigendynamik Entstehungsbedingungen der Symptomatik/Lebenskontext Ansatz für die Ursachen von interpersonellen Problemen Wahrnehmung des Patienten in fünf Perspektiven: Störungsperspektive Interpersonale Perspektive Motivationale Perspektive Entwicklungsgeschichtliche Perspektive Ressourcenperspektive Konsistenzverbesserung durch drei Ansätze: Konsistenzverbesserung durch störungsorientierte Behandlung Konsistenzverbesserung durch Erfahrungen im Therapieprozess Konsistenzverbesserung durch Behandlung individueller Inkonsistenquellen Therapeutischen Wirkprinzipien: Ressourcenaktivierung Problemaktualisierung Problembewältigung Motivationale Klärung Therapeutische Beziehung Ziel der Therapie: Konsistenzverbesserung Abb. 3.8: Schematische Darstellung der Psychologischen Therapie nach Grawe. 69 Was bedeutet dies für die Behandlung Opiatabhängiger? Auch wenn dieses therapeutische Konzept nicht expliziet für die Behandlung Suchterkranker erstellt wurde kann es als Grundlage für diese angesehen werden. Wie bereits beschrieben, leben Opiatabhängige in hoch belasteten inkongruenzauslösenden Lebenssituationen. Da diese Problemlagen sehr vielfältig und komplex sind, sollte sich die Behandlung integrativ verschiedene Maßnahmen beinhalten um möglichst eine gute Konsistenzverbesserung zu erziehlen. Dies macht multiprofessionelles Handeln notwendig. Auf Grund der oftmals bereits langen Krankheitsdauer und der damit manifestierten Problemlage ist eine intensive und kontinuierliche Behandlung notwendig. Die Konfrontation mit den hochbelasteten Lebenssituation des Opiatabhängigen hat für den Therapeuten oft zur Folge das seine Warnhemung sich auf die Probleme fokussiert. Die Fähigkeiten und Ressourcen des Patienten werden in einer leicht übersehen und nicht wahrgenommen. Aktuelle Problemlagen wie Wohnungslosigkeit, Schulden, juristsiche Schwierigkeiten oder akut auftretende Entzugsymptome stellen massive Inkongruenzquellen dar und behindern die psychotherapeutische Behandlung massiv. Daher sollten im Rahmen einer integrativen Behandlung diese Bereiche „abgesichert“ werden um in einem nächsten Schritt weitere Inkonsitenzquellen anzugehen. Des weiteren sollte das soziale Umfeld des Drogenabhängigen in die Behandlung integriert werden. Sie haben im Sinne der Sozialen Unterszützung eine wichtige Funktion innerhalb des Krankheitsprozesses. 70 Wirksamkeit von psychiatrischer Behandlung unter Substitution: Aus: Comorbid mental disorders and substance use disorders: epidemiology, prevention and treatment S. 105/106 als PDF im Ordner Komorbdiatät Medications for opiate dependence Depressive and anxiety disorders are common in people with narcotic dependence who are treated with methadone maintenance (Mason et al., 1998).Woody and colleagues (1987; 1984) randomly assigned 110 male war veterans enrolled in a low dose methadone maintenance program to one of three conditions: supportiveexpressive psychotherapy (SE) plus drug counselling (DC); CBT plus DC; and DC alone. Therapy sessions were scheduled weekly for six months. Significantimprovements were found at seven months for low psychiatric severity (as measuredby the ASI) patients in all three groups and the addition of SE or CBT offered noadvantage. However, in the patients with medium and high psychiatric severity, there were clear benefits of psychotherapy on numerous measures.Woody and colleagues recommended that psychotherapy can be beneficial to patients enrolled in methadone maintenance programs with severe psychiatric symptoms. Some cases of psychotic episodes during methadone tapering have been reported (Levinson, Galynker, & Rosenthal, 1995), suggesting increased monitoring for exacerbations may be required in comorbid schizophrenia or other psychoses during withdrawal. Methadone may also alter neuroleptic requirements in schizophrenia (McKenna,1982;Verebey,Volavka, & Clouet, 1978). 71 4. Literatur Badura, B. (1981) Sozialpolitik und Selbsthilfe aus traditioneller und aus sozialepidemiologischer Sicht. In: Badura, B., Ferber, C. v. (Hrsg.) Selbsthilfe und Selbstorganisation im Gesundheitswesen. (S. 147-160). München: Oldenbourg. Badura, B., Feuerstein G. (1994) Gesundheit und Gesundheitswesen. In: Joas, H. (Hrsg.) Lehrbuch der Soziologie (S. 363-388). Frankfurt/Main: Campus. Bierbaumer, N., Schmidt, R. F. (1991) Biologische Psychologie. Berlin: Springer. Buhk H., Zeikau, T, Koch U. (2006) Versorgungsforschung: Implementierung und Transfer des Behandlungsangebots. Spezialstudie im Rahmen des bundesdeutschen Modellprojekts zur heroingestützten Behandlung Schwerstabhängiger. Hamburg. Im Internet zu finden unter: http://www.heroinstudie.de/Versorgungsfo_Heroin_Kurzf.pdf Homepage vom 26.12.2007. Comer, R. J. (2001) Klinische Psychologie. 2. deutsche Auflage. Heidelberg: Spektrum Verlag. Deimel, D. (2008) Stressreduzierende Einflussfaktoren der psychosozialen Betreuung Substituierter. Eine empirische Analyse sozialer Unterstützung. Unveröffentlichte Masterthesis. Deimel, D. (2009) Die psychosoziale Situation und Behandlung substituierter Opiatabhängiger. Eine Analyse der psychosozialen Betreuung Substituierter. In: Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehablititation. 22. Jahrgang. Nr. 85. S. XXX Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (2006) Drogenabhängigkeit. Suchtmedizinische Reihe Band 4. Hamm. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung (2009) Drogen- und Suchtbericht 2009. Berlin. Diewald, M. (1991) Soziale Beziehungen: Verlust oder Liberalisierung? Soziale Unterstützung in informellen Netzwerken. Berlin: edition sigma. Drogenhilfeverein Indro e.V. (2004) Ambulantes Betreutes Wohnen für Substituierte und drogenabhängige Obdachlose. Rahmenkonzeption und Leistungsbeschreibung. Im Internet zu finden unter: http://www.indro-online.de/bewokonzeption.pdf Homepage vom 12.04.2008. Eckert, J., Weilandt, C., (2008) Infektionserkrankungen unter Gefangenen in Deutschland – Kenntnisse, Einstellungen und Risikoverhalten. Wissenschaftliches Institut der Ärzte Deutschlands e.V. (WIAD). Bonn: Eigendruck. Eckert, J., Weilandt, C., Radun, D. (2008) Infektionserkrankungen unter Gefangenen in Deutschland – Kenntnisse, Einstellungen und Risikoverhalten. In: Akzept e.V., Deutsche AIDS Hilfe e.V., WIAD e.V. (Hrsg.): 3. Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft. Dokumentation. 7.-9.11.2007. Berlin: Eigendruck. Ertl, M., Giacomuzzi, S., Riemer, Y., Vigl, A., Kemmler, G., Hinterhuber, H., Kurz, M. (2006) Abstinenzzuversicht und Beikonsumverhalten substituierter Drogenabhängiger in Abhängigkeit vom Beschäftigungsstatus. In: Neuropsychiatrie. Band 20. Nr. 4 2006. S. 265272. Flückiger, C., Wüsten, G. (2009) Ressourcenaktivierung. Ein Manual für die Praxis. Bern: Hans Huber. Fries, A. (2005) Konsistenz und Inkonsistenz im psychischen Geschehen des Menschen. Konzepte und Zusammenhänge mit der Gesundheit. Inauguraldissertation. Bern: Selbstverlag. Gauggel, S. (2006) Neuropsychologische Grundlagen. In: Wittchen, H.-U., Hoyer, J. (Hrsg.) Klinische Psychologie & Psychotherapie, (S. 227-253). Heidelberg: Springer. Gassmann, D., Grawe, K. (2009) Ressourcenorientierte Psychotherapie – Schwerpunkt soziale Ressourcen. In: Röhrle B., Laireiter A.-R. (Hrsg.) Soziale Unterstützung und Psychotherapie. Tübingen: dgvt-Verlag. Gastpar, M., Heinz, W., Poehlke, Th., Raschke, P. (2002) Glossar: Substitutionstherapie bei Drogenabhängigen. Berlin: Springer. Grawe, K. (1998) Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe. Grawe, K. (2004) Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe. Grawe, K. (2005a) „Ich glaube nicht, dass eine Richtung einen Wahrheitsanspruch stellen kann!“ Klaus Grawe im Gespräch mit 73 Steffen Fliegel. In: Psychotherapie im Dialog. 6. Jahrgang. Nr.: 2. S. 128135. Grawe, K. (2005b) (Wie) kann Psychotherapie durch empirische Validierung wirksamer werden? In: Psychotherapeutenjournal. Nr. 12005. S. 4-11 Grosse Holforth, M., Grawe, K. (2004) Inkongruenz und Fallkonzeption in der Psychologischen Therapie. In: Verhaltenstherapie & psychosoziale Praxis. 36. Jahrgang. Nr. 1. S. 9-21. Grosse Holforth, M., Grawe, K., Tamcan, Ö. (2004) Inkongruenzfragebogen. Manual. Göttingen: Hogrefe. Heiniger Haldimann, B. (2007) Konsistenztheorie und Ressourcenaktivierung in der Psychotherapie. Fachklinik Wilhelmsheim. Fachtagung am 24.10.2007. Vortrags-Manuskript im Internet zu finden unter: www.ahg.de/AHG/Standorte/Wilhelmsheim/Service/Archiv/pdfs_Arc hiv/HeinigerHaldimannVortrag__241007.pdf Homepage vom 02.05.2008 Henry, J. P. (1986) Mechanisms by which stress can lead to coronary heart disease. In: Postgraduate Medical Journal. Nr. 62. S. 687-693. Hüther, G. (2001) Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Hüther, G. (2007) Biologie der Angst. Wie aus Stress Gefühle werden. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Janczak, H. & Wendelmuth, F. (1994) Die gesundheitliche, psychische und soziale Situation der L-Polamidon-KlientInnen. In: Raschke, P. Substitutionstherapie. Ergebnisse langfristiger Behandlung Opiatabhängiger (S. 98-139). Freiburg im Breisgau: Lambertus. Justizministerium NRW (2006) Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. Kalman, D., Baker Morissette, S., George, T. P. (2005) Co-Morbidity of Smoking in Patients with Psychiatric and Substance Use Disorders. In: American Journal of Addiction. 14. Jahrgang. Nr. 2 vom März 2005. S. 106-123. Kaluza, G., Vögele, C.. (1999). Stress und Stressbewältigung. In: Flor H., Bierbaumer, N., Hahlweg, K. (Hrsg.) Enzyklopädie der Psychologie: Klinische Psychologie – Band 3. (S. 351-388), Göttingen: Hogrefe. 74 Kaluza, G. (2004). Stressbewältigung. Heidelberg: Springer. Kielholz, P., Ladewig, D. (1973) Die Abhängigkeit von Drogen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. Klein, M. (1993) Kinder drogenabhängiger Eltern. Fakten, Hintergründe, Perspektiven. In: Report Psychologie. Nr. 6 vom Juni 2003. S. 358-371. Klein, M., Zobel, M. (2001) Prävention und Frühintervention bei Kindern aus suchtbelasteten Familien – Ergebnisse einer Modellstudie. In: Zobel, M. (Hrsg.). Wenn Eltern zu viel trinken. Risiken und Chancen für die Kinder. (S. 90-104). Bonn: Psychiatrie Verlag. Klein, M. (2008) Kinder drogenabhängiger Eltern. In: Klein, M. (Hrsg.). Kinder und Suchtgefahren. (S 128-139). Stuttgart: Schattauer Küfner, H., Rösner, S. (2005) Forschungsstand 2005 zur Substitutionsbehandlung: Ergebnisse zur Evaluation und Indikation. In: Gerlach, R., Stöver, H. Vom Tabu zur Normalität. (S. 29-63). Freiburg im Breisgau: Lambertus. Künzel-Böhmer, J., Bühringer, G., Janik-Konecny T. (1993) Expertise zur Primärprävention des Substanzmissbrauchs. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit. Band 20. Baden-Baden: Nomos. Laux, L. (1983) Psychologische Stresskonzeptionen. In: Thomae, H. (Hrsg.) Theorien und Formen der Motivation. Enzyklopädie der Psychologie. Band C/IV/1. S. 453-535. Göttingen: Hogrefe. Lazarus, R. S., Launier R. (1981) Streßbezogene Transaktion zwischen Person und Umwelt. In: Nitsch, J. R. (Hrsg.) Stress: Theorien, Untersuchungen, Massnahmen. Bern: Hans Huber. Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984) Stress, Appraisel and Coping. New York: Springer. Lazarus, R. S. (1990) Streß und Streßbewältigung – Ein Paradigma. In: Filipp, S.-H. (Hrsg.) Kritische Lebensereignisse. München: Psychologie Verlags Union. Maier, K.-P. (2002) Hepatitis C – Hepatitisfolgen. Stuttgart: Thieme. Meyer, G. (2008) Glücksspiel. Zahlen und Fakten. In: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.). Jahrbuch Sucht 2008. (S. 120-137). Geesthacht: Neuland. Maslow, A. H. (2005) Motivation und Persönlichkeit. Reinbeck: Rovolt. 75 Neylan, Th. C., (1998) Hans Selye and the field of Stress Research. In: Neuropsychiatry. Vol. 10, Nr. 2, p. 230-231. Niemann Th., Soyka M. (2007) 6. Parlamentarischer Abend: Substitutionsbedingungen in der Haft. Ärzte diskutieren mit Politikern über aktuelle Probleme in der Substitutionsbehandlung Heroinabhängiger. Tagungsbericht. In: Suchtmedizin. 9. Jahrgang. Nr. 4. S. 228-231. Oerter, R., Dreher, E. (1998) Jugendalter. In: Oerter, R., Montada L. (Hrsg.) Entwicklungspsychologie. 4. Auflage. S. 310-395. Weinheim: Psychologie Verlags Union. Reymann, G., Gastpar, M. (2006) Opioidbezogene Störungen. In: Schmidt, L.G., Gastpar, M., Falkai, P., Gaebel, W. (Hrsg.). Evidenzbasierte Suchtmedizin, (S. 171-193), Köln: Deutscher Ärzte-Verlag. Robert Koch-Institut (2007) Epidemiologisches Bulletin. Sonderausgabe B 2007. HIV-Infekionen und AIDS-Erkrankungen in Deutschland. Aktuelle epidemiologische Daten. Halbjahresbericht II/2005. Berlin. Selye, H. (1936) A Syndrome produced by Diverse Nocuous Agents. In: Nature. Vol. 138, July 4, p. 32. Selye, H. (1981) Geschichte und Grundlage des Stresskonzeptes. In: Nitsch, J. R. (Hrsg.) Stress: Theorien, Untersuchungen, Massnahmen. (S. 163-187). Bern: Hans Huber. Selye, H. (1991) Stress beherrscht unser Leben: Das Standardwerk des Pioniers der Stressforschung. München: Heyne. Schauenberg, H., Strauß, B., (2002) Bindung und Psychotherapie. In: Strauß, B., Bucheim, A., Kächele, H. (Hrsg.) Klinische Bindungsforschung (S.: 281-292). Stuttgart: Schattenauer. Schulz, P., Schlotz, W., Becker, P. (2004) Trierer Inventar zum chronischen Stress. Göttingen: Hogrefe. Schwarzer, R. (2000). Streß, Angst und Handlungsregulation. Stuttgart: Kohlhammer. Silbereisen, R. K. (1998) Entwicklungspsychologische Aspekte von Alkohol- und Drogengebrauch. In: Oerter, R., Montada L. (Hrsg.) Entwicklungspsychologie. 4. Auflage. S. 1056-1068. Weinheim: Psychologie Verlags Union. Stachowske, R. (2008) Drogenabhängigkeit. In: Klein, M. (Hrsg.). Kinder und Suchtgefahren. (S 329-335). Stuttgart: Schattauer. 76 Stiftung Integrationshilfe (2000) Schuldnerberatung in der Drogenhilfe. Geesthacht: Luchterhand. Stiftung Integrationshilfe (2008) Jahresbericht Marianne von Weizsäcker Fonds 2007. Hamm. Thane, K., Wickert, C., Verthein, U., (2009) Abschlussbericht Szenebefragung in Deutschland 2008. Insitut für Interdisziplinäre Sucht- & Drogenforschung – ISD, Hamburg. Thiel, G., Friedrich, E., Wiese, K. (1997) Aspekte der Lebenswirklichkeit, Nutzung von Drogenhilfeeinrichtungen sowie drogenpolitische Forderungen von 323 Personen der Hamburger Drogenszene. In: Wiener Zeitschrift für Suchforschung. 20. Jg. 1997. Nr. 1/2. S. 35-41. Tossmann, P., Baumeister, S., (2008) Früher Substanzkonsum. In: Klein, M. (Hrsg.). Kinder und Suchtgefahren. (S 181-189). Stuttgart: Schattauer. Weber, A., Hörtmann, G., Heipertz, W. (2007) Arbeitslosigkeit und Gesundheit aus sozialmedizinischer Sicht. In: Deutsches Ärzteblatt. 104. Jg. Nr. 43. S. A2957-A2962. Weltgesundheitsorganisation (2004) Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Dritte Auflage. Bern: Hans Huber. Wittchen, H.-U., Apelt S. M., Mühling S. (2005) Die Versorgungslage der Substitutionstherapie. In: Gerlach, R., Stöver, H. Vom Tabu zur Normalität, (S. 64-77), Freiburg im Breisgau: Lambertus. Wittchen, H.-U., Hoyer, J. (2006) Was ist Klinische Psychologie? Definitionen, Konzepte und Modelle. In: Wittchen, H.-U., Hoyer, J. (Hrsg.) Klinische Psychologie & Psychotherapie, (S. 4-23). Heidelberg: Springer. 77