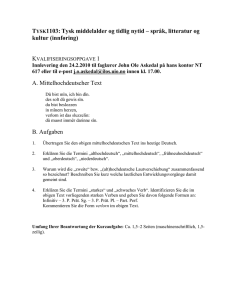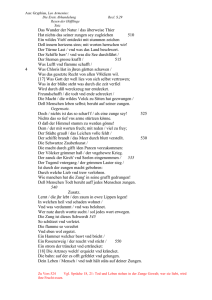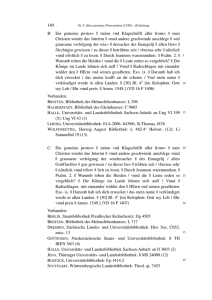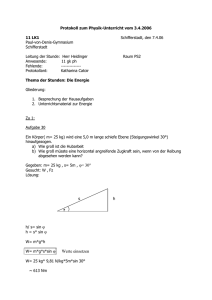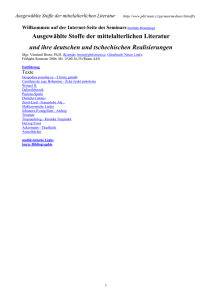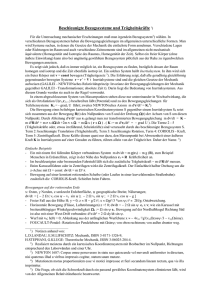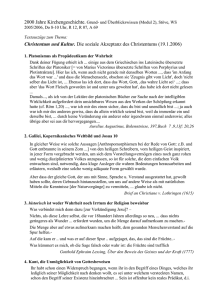Chronologie der deutschen Literatur
Werbung
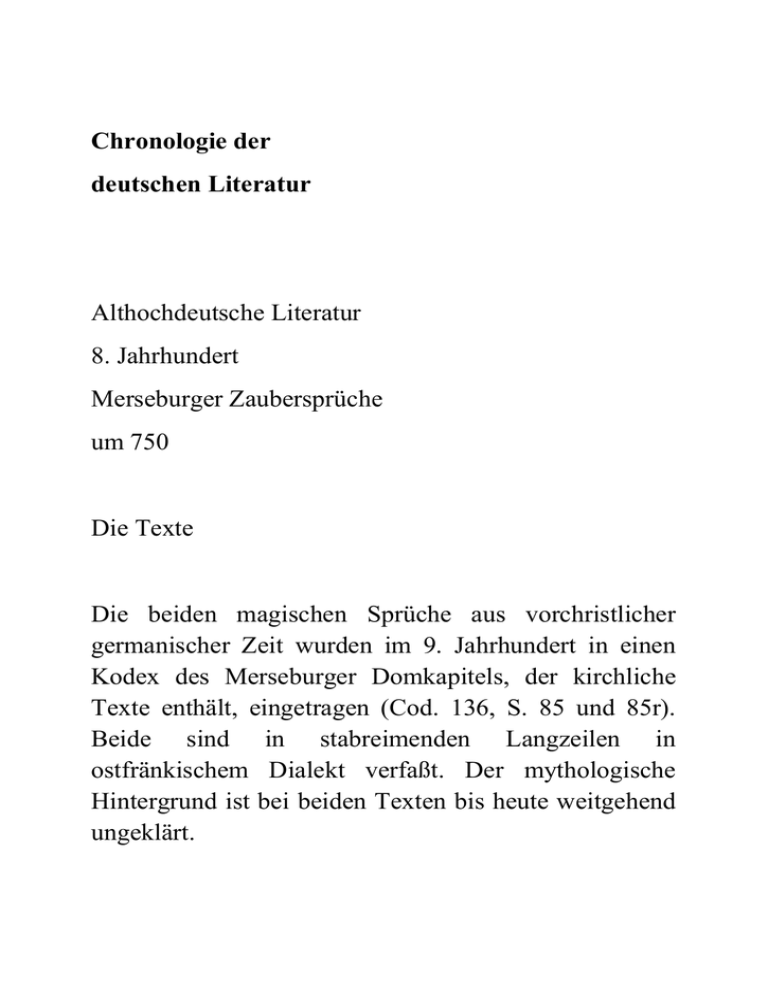
Chronologie der deutschen Literatur Althochdeutsche Literatur 8. Jahrhundert Merseburger Zaubersprüche um 750 Die Texte Die beiden magischen Sprüche aus vorchristlicher germanischer Zeit wurden im 9. Jahrhundert in einen Kodex des Merseburger Domkapitels, der kirchliche Texte enthält, eingetragen (Cod. 136, S. 85 und 85r). Beide sind in stabreimenden Langzeilen in ostfränkischem Dialekt verfaßt. Der mythologische Hintergrund ist bei beiden Texten bis heute weitgehend ungeklärt. Merseburger Zaubersprüche Textgrundlage: Althochdeutsche Literatur Herausgegeben, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Horst Dieter Schlosser Frankfurt am Main 1970, S. 252-255 _____________________________________________ __________________________ Erster Merseburger Zauberspruch Eiris sazun Idisi, sazun hera duoder. suma hapt heptidun, suma clubodun suma heri lezidun, umbi cuoniouuidi: insprinc haptbandun, inuar uigandun! – .H. [Hagalrune ?] Zweiter Merseburger Zauberspruch Phol ende Uuodan uuorun zi holza. du uuart demo Balderes uolon thu biguol en Sinthgunt, thu biguol en Friia, Sunna era suister, Uolla era suister;, thu biguol en Uuodan, sose benrenki, sin uuoz birenkit. so he uuola conda: sose bluotrenki, sose lidirenki, ben zi bena, lid zi geliden, bluot zi bluoda, sose gelimida sin! – Merseburger Zaubersprüche Textgrundlage: Althochdeutsche Literatur Herausgegeben, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Horst Dieter Schlosser Frankfurt am Main 1970, S. 252-255 _____________________________________________ __________________________ Erster Merseburger Zauberspruch Eiris sazun Idisi, sazun hera duoder. suma hapt heptidun, suma clubodun suma heri lezidun, umbi cuoniouuidi: insprinc haptbandun, inuar uigandun! – .H. [Hagalrune ?] Zweiter Merseburger Zauberspruch Phol ende Uuodan uuorun zi holza. du uuart demo Balderes uolon thu biguol en Sinthgunt, thu biguol en Friia, Sunna era suister, Uolla era suister;, thu biguol en Uuodan, sose benrenki, sin uuoz birenkit. so he uuola conda: sose bluotrenki, sose lidirenki, ben zi bena, lid zi geliden, bluot zi bluoda, sose gelimida sin! – Wessobrunner Gebet um 790 Das Werk Das Wessobrunner Gebet ist in einer um 814 im südlichen Bistum Augsburg entstandenen lateinischen Sammelhandschrift überliefert (Bay. Staatsbibliothek München, Signatur: Clm 22053, III, Bl.65v/66r). Der Text besteht aus zwei Teilen: einem stabreimenden Fragment eines Schöpfungsgedichts und einer Gebetsformel in Prosa. In den ersten fünf Zeilen des Gedichts wird die christliche Genesis mit Elementen germanisch-heidnischer Kosmogonie dargestellt. Die erste Niederschrift dieses für die Heidenmission bestimmten Textes könnte - als Adaption einer angelsächsischen Vorlage - aus Fulda stammen und etwa 790 entstanden sein. Das Wessobrunner Gebet Textgrundlage: Althochdeutsche Literatur Herausgegeben, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Horst Dieter Schlosser Frankfurt am Main 1970, S. 28 De poeta. Dat gafregin ih mit firahim Dat ero ni uuas noh paum firiuuizzo meista, noh ufhimil, noh pereg ni uuas, ni ‹sterro› nohheinig noh sunna ni scein, 5 noh der maręo seo. noh mano ni liuhta, Do dar niuuiht ni uuas enti do uuas der eino manno miltisto, inan cootlihhe geista. enteo ni uuenteo, almahtico cot, enti dar uuarun auh manake mit enti cot heilac. Cot almahtico, du himil enti erda gauuorahtos enti du mannun so manac coot forgapi: forgip mir in dino ganada rehta galaupa enti cotan uuilleon, uuistóm enti spahida enti craft, tiuflun za uuidarstantanne enti arc za piuuisanne enti dinan uuilleon za gauurchanne. 9. Jahrhundert kasseler Gespräche um 810 Die Texte In einer Kasseler Handschrift theologischen Inhalts (Cod. Cassell. theolog. 4° 24, wohl aus Fulda stammend) sind sachlich geordnet Glossen eingetragen, die zum Teil mit dem St. Galler Vocabularius übereinstimmen. Sie beinhalten auch einige kurze Gesprächssätze und lassen sich auf etwa 810 datieren. Text: Althochdeutsches Lesebuch Herausgegeben von Wilhelm Braune und Ernst A. Ebbinghaus, Tübingen 1968, S. 8 f. _____________________________________________ Gloss. III, 9, 17-19: Skir min fahs. Skir minan hals. Skir minan part. Gloss. III, 12, 24-66: Sage mir uueo namun habêt desêr man. Uuanna pist dû ? Uuanna quimis ? Fona uuelîheru lantskeffi sindôs ? Foor, fôrun, farant. Quâmut ? Quâmum. Uuâr uuârut ? Uuaz sôhtut ? Sôhtum daz uns durft uuas. Uuaz uuârun durfti ? Manago. Durft ist uns dîna huldî za hapênne. Firnimis ? Ni ih firnimu. Ih firnimu. Firnâmut ? Firnemamês. Caputî ? Capaot. Ih auar capiutu. Dû capiut anti ih tôm. Uuanta ni tôis ? Sô mac uuesan. Gloss. III, 12, 67-13,11: Spâher man. sapiens homo. toler. stultus Tole sint Uualhâ, spâhe sint Peigira; luzîc ist spâhi in Uualhum, mêra hapênt tolaheitî denne spâhi. Stulti sunt Romani, sapienti sunt Paioari, modica est sapientia in Romana, plus habent stultitia quam sapientia. Gloss. III, 13, 15-19: Hogazi cogita pî dih selpan de temet ipsum. Ih hogazta ego cogitavi simplun semper fona mir selpemo de me ipsum. Petruslied um 900 Das Werk Das Petruslied ist neben dem Georgslied das einzig erhaltene Beispiel althochdeutscher Heiligenpoesie. Die Strophen bestehen aus zwei binnengereimten Langzeilen und enden mit einem ebenfalls vierhebigen Refrain «Kyrie eleyson, Christe eleyson». Der Text wurde um 900 von einer anonymen Hand in altbairischer Sprache auf das untere Ende der Schlußseite einer um 870 in Freising angefertigten Abschrift des Genesiskommentars von Hrabanus Maurus geschrieben. Über den Textzeilen stehen Neumen, die den Verlauf der Melodie skizzieren. Der Hymnus diente wohl als Prozessions- oder Wallfahrtlied. Der Vers «daz er uns firtânên giuuerdo ginâdén» findet sich auch in Otfrids Evangelienbuch «tház er uns firdánen giwerdo ginádon» (1, 7, 28), wobei offen ist, wer von wem den Vers übernommen hat, auch wäre ein Rückgriff beider auf eine ältere Tradition denkbar. Petruslied Textgrundlage: Deutsche National-Litteratur, 1. Band: Die älteste deutsche Litteratur bis um das Jahr 1050. Hrsg.: Paul Piper, Berlin/Stuttgart: W. Spemann 1900 _____________________________________________ _________________________________ Bayerische Staatsbibliohek, Clm 6260, fol. 158v Omnipotens dominis cunctis sua facta rependit (von anderer Hand) Unsar trohtîn hât farsalt daz er mac ginerian | kyrie eleyson. sancte pêtre giuualt, ze imo dingênten man. christe eleyson. | Er hapêt ouh mit vuortun dar in mach er skerian | himilriches portûn; den er uuili nerian. kirie eleison. christe eleison. | Pîttêmês den gotes trût daz er uns firtânên kirie eleyson. allâ samant uparlût, giuuer|do ginâdén. christe eleison. Unser Herr hat überliefert Gewalt, dem heiligen Petrus daß er kann erretten zu ihm hoffenden Mann. Herr, erbarme dich! Christus, erbarme dich! Er hält auch mit (seinen) Worten Pforte, dahinein mag er scharen Herr, erbarme dich! den er will erhalten. Christus, erbarme dich! Bitten wir den Gottes Trauten daß er uns Verlorenen Herr, erbarme dich! des Himmelreiches allesamt überlaut, geruhe gnädig zu sein. Christus, erbarme dich! ――――――――――――――― 10. Jahrhundert Notker Labeo um 950 - 1022 Der Autor Notker III., Labeo oder Teutonicus genannt, geboren um 950, war Leiter der Klosterschule von St. Gallen. Für diese Lehrtätigkeit übersetzte und kommentierte er antike Literatur zu den artes liberales in althochdeutscher Prosa unter reicher Verwendung lateinischer und griechischer Fremdwörter. Er entwickelte auch eine phonetisch konsequente Rechtschreibung des Deutschen (Notkersches Anlautgesetz) für seinen volkssprachlichen Unterricht. Am 29. Juni 1022 ist er in St. Gallen an der Pest gestorben. Kommentierende Psalmenübersetzung Text: Die Werke Notkers des Deutschen (Altdeutsche Textbibliothek 32. 33. 34. 37. 40. 42. 43) Hrsg.: Edward H. Sehrt/Taylor Starck , Halle 1934ff. Abbildungen: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 21, 70; 21, 242 Psalm 22 Psalm 69 Psalm 138 _____________________________________________ _______________ Psalmus David XXII (Psalm 22) 1 Dominus regit me et nihil mihi deerit. Truhten selbo rihtet mih, chît aecclesia de christo, unde nîehtes ne brístet mir. 2 In loco pascuae ibi me collocavit. In déro stéte dar uuéida ist, hábet er mih kesezzet. Er habet mir in lege et prophetis (an eo unde an uuizzegon) kéistlicha fûora gegében. Super aquam refectionis educavit me. Er hábet mih kezógen bi démo uuazere dero labo. Daz ist baptismum (tóufi), mit démo diu sêla gelábot uuírdet. 3 Animam meam convertit. Hábet mîna sêla fóne úbele ze gûote bechêret. Deduxit me super semitas iustitiae propter nomen suum. Léita mih after dîen stîgon des rehtes, umbe sînen námen, nals umbe mîne frêhte. 4 Nam etsi ambulavero in medio umbrae mortis. Gange ih óuh hîer in míttemo scáteuue des tôdes, daz chît inter hereticos er scismaticos (under geloub-írren unde síto-uángiren), die bilde des tôdes sint. Non timebo mala quoniam tu mecum es. Noh danne nefúrhte ih mir des léides, daz sie mih keargeroên, uuanda du sáment mir bist, uuanda du in minemo herzen bist. Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt. Din rûota unde din stáb, daz chît, dîne fíllâ unde dîne chéstiga, de hábent mih ketrôstet, nals keléidegot, uuanda ih fóne in gebezerot pin. 5 Parasti in conspectu meo mensam, adversus eos qui tribulant me. Nah dien chéstigon ríhtost du mir tíske, daz ih keâzzet uuurde mit stárcherun fûoro danne diu milih sî uuíder dîen, die mih pînont. Du brahtost mih fóne inperfectione (undurnohte) ze perfectione (durnohte), dia chraft kâbe du mir uuíder in. Inpinguasti in oleo caput meum. Sálbotost min muot mit kéistlichero fréuui. Et poculum tuum inebrians, quam preclarum est. Vnde uuîo harto mâre din trang ist, daz mennisken irtrénchet, unde sie tûot ergezen iro êrerun lústsami. Daz poculum ist gratia (genâda) sancti spiritus. 6 Et misericordia tua subsequetur me omnibus diebus vitae meae. Vnde din gnâda fóllegât mir alle tága mînes lîbes. Si hûotet min unz ih lébo. Ut inhabitem in domo domini, in longitudine dierum. Daz ih dára-nah in celesti (dero hímiliscun) ierusalem bûe, in lengi dero tágo, die in plurali numero (in mánigzalo) éinen dag êuuigen bezéichenet. Psalmus David LXIX (Psalm 69) 1 Vox martyrum ad Christum. 2 Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum me festina. Got sih ze mînero helfo. Île. Uuára zuô? Mir ze hélfenne. Sús chéde mánnelîh, so chéde er állero mêist dánne er in nôte si. Dísa díge hábe gemeîna sáment martyribus. Vuanda oûh ímo persecutionis niêht nebrístet, úbe er guôt uuíle sîn. Cottidiana (tágelîche) scandala (uuerra) chéllent animam iusti (des rehten muôt), nelîde er oûh neheîne tormenta corporis (uuîzze lîchamin). 3 Confundantur et revereantur qui querunt animam meam. Scámeg uuérden, unde in uórhtun chômen, diê mîna sêla suôchent, non ad limitandum (nals ze bíldonne) sed ad perdendum (sunder ze ferliêssene). Sô uuégoe mánnoloíh sînen fíenden, sús uuóla uuúnsce ín. Avertantur retrorsum et erubescant qui cogitant mihi mala. Tána uuérden geuuéndet hínter rúkke unde mîden síh, diê mir úbelo uuéllen. Nâh kángen siê, nals fóre, diê dîa ecclesiam prauis consiliis (Christis sámenunga mit úbelen râten) írren uuellen. Also Petrus úbelo uuolta fóre gân, do ín christus uuanta, sús chédendo. Redi retro me satanas (iruuínt híndir mih fiánt). 4 Avertantur statim et erubescentes qui dicunt mihi euge euge. Tána chêren siê sâr scámege, diê mir zuô chédend adulando (slech sprachondo): vvola vvola (uuola tuôsto uuola tuôsto). Daz sint diê, diê in úntriûuuon den mán lóbont, gratiam (huldi) suôchendo nals ueritatem (uuarheit). Diê sint diê frêisígosten persecutores (âhtara). 5 Exultent et iocundentur in te omnes qui querunt te, et dicant, semper magnificetur dominus, qui diligunt salutare tuum. Fréuuen sih, unde geuuúnnesámôt uuérden an dír, diê dih suôchent, unde sús chéden, diê dînen háltare mínnont christum. Vuieo? Truhten uuérde iéo gemíchellichot. In sól man míchellichon, áber sih selben nesol niêman míchellichon. Vuiêo sól ér chéden fóne ímo selbemo? 6 Ego vero egenus et pauper sum. Ih pín dúrftig unde arm. Ziú sól, ube ímo sîna súnda fergében sint? Vuanda iz chît. Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis mee (ih kesiêho eîn andra êa an mînen lîden uuíderbréchenta mînis muotis eô). Dánnân ist er siêh, unde arm. Deus adiuva me. Gót hílf mir. Daz chíd dû díccho, daz sî dír in muôte und in munde, des neirdriêzze díh. Adiutor meus esto domine ne tardaveris. Chíd oûh dâr míte. Hélfâre mîner uuís dû trúhten, des netuuéle dû. Daz ist uox martyrum, daz si uox (stimma) omnium (allero). Psalmus David CXXXVIII (Psalm 138) Secundum Augustinum Christus ad patrem de se ipso loquitur: 1 Domine probasti me et cognovisti me. Hêrro mîn dû besûohtost mih in passione únde bechandôst mih. Daz chît: tâte, daz mih ándere bechénnent. 2 Tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam. Du bechándôst min nídersízzon in tôde únde mîn ûfstân nah tôde. (Aut ex persona sui corporis loquitur:) Dû bechándôst mîna níderi in paenitentiam. dô ih in éllende uuas, únde mîna ûfirríhteda do ih chám unde áblaz keuuán. 3 Intellexisti cogitationes meas de longinquo. Dû bechándost mîne gedáncha férrenân do ih idolorum culturam begonda léidezen. Semitam meam et limitem meum investigasti. Mina leîdûn stîga, an déro ih kîeng fóne dir, unde daz ende, daz mortalitas ist, ze déro ih follecham, daz irspêhotost dû: iz neuuas ferborgen fóre dír. 4 Et omnes vias meas praevidisti. Unde alle mîne uuéga, in dien ih írrôta, fóreuuíssost dû. Du hangtost mir sîe ze gânne, ube ih hína nemahti, daz ih iruuúnde ze dir. Quoniam non est dolus in lingua mea. Uuanda nu neíst trúgeheit in minen uuórten. 5 Ecce, domine, tu cognovisti omnia novissima et antiqua. Du uueîst mîniu iúngesten ding, dô ih tôdig uuard, unde diu alten ding, do ih sundon gestûont. Tu finxisti me et posuisti super me manum tuam. Dû scáffotost mih, do ih sundota, ze arbeîten, in dîen ih fore neuvas unde legetost mih ána dîna hant, uuanda dô drúhtost du mih. 6 Mirificata est scientia tua ex me. Fone mînen sculden ist mir uuúnderlîh unde únsémfte uuorden din bechénneda. Invaluit non potero ad illam. Si ist mir ze stárch, ih nemag iro zûo, aber du maht mih iro genáhen. 7 Quo ibo a spiritu tuo? Uuára mag ih fore dînemo geîste des diu uuerlt fol íst? Also iz chit: Spiritus domini repleuit orbem terrarum. Et quo a facie tua fugiam? Unde uuára fliêho ih fóre dír? Uuara mag ih indrínnen dînero abolgi? 8 Si ascendero in caelum, tu illic es. Héue ih mih hóho, dâr drúcchest du mih uuídere. Si in infernum descendero, ades. Pirgo ih mih, daz ih mînero sundon iéhen neuuíle, dû geiíhtest mih íro. 9 Si recipiam pennas meas in directum et habitabo in extrema maris (id est saeculi). Ube ih mîne féttacha (daz chit: amorem dei et proximi) ze mir nímo in geríhti unde ih púuuo daz chit: râmen mit kedingi ze ende dírro uuérlte, so dies iudicii ist, uuanda dar ist ende dísses uuerltméres, ze déro uuîs indrinno ih dînero abolgi. 10 Etenim illuc manus tua deducet me et tenebit me dextera tua. Dára ze demo ende bringet mih dîn hant unde dîn zeseuua habet mih, daz ih ín den mére nesturze, êr ih ín uberfliege. 11 Et dixi: fortasse tenebrae conculcabunt me. Unde chad ih fórhtendo: ódeuuâno fínisterîna trêttônt mih . unde írrent mih. Uuaz sint die finstri ane díser lîb? Et nox illuminatio in deliciis meis. Unde bedíu ist min naht, daz chit: min lîb lîeht uuorden an minero lússami, daz ist: Christus. Er chám in disa naht, daz er sie irlîehti. 12 Quia tenebrae non tenebrantur a te. Uuanda fón dir, Christe, nefinstrent dir fínstri nube fone démo, der sîne sunda bírget unde iro neiiehet. Der zuífaltôt diê finstri. Et nox tamquam dies illuminabitur. Unde rehtemo man uuirt diu naht sámo lîehte so der tag, daz chit: aduersitas netárot imo nieht mêr danne prosperitas. Sicut tenebrae eius ita et lumen eius. Imo gant prospera unde aduersa gelicho. 13 Quia tu possedisti renes meos, domine. Uuanda dû habest pesézzen, mîne láncha, du nehengest mir únchíusce gelúste. Suscepisti me ex utero matris meae. Dû habest mih kenómen uzer mînero muoter uuombo. Daz ist díu zâliga Babylonia, dero chint Ierusalem caelestem neminnont. 14 Confitebor tibi, domine, quoniam terribiliter mirificatus es. Ih iîeho dir, tróhten, daz du egebâro uns uuunderlih uuorden bist. Mira opera tua, deus, et anima mea cognoscet nimis. Daz ist one díu, uuanda diniu uuerch uuunderlih sint, gót, unde siu nu min sêla harto uuóla bechénnet, souuio ih in fore nieht zuo nemahti. 15 Non est absconditum os meum, s. a te, quod fecisti in abscondito. Dir ist únferbórgen min stárchi die du mir tâte tougeno. Fóne dero chad Paulus: Non solum autem sed et gloriamur in tribulationibus. Et substantia mea in inferioribus terrae, id est: in carne. (Item ex persona capitis:) Unde ist min sela in dero tiefi des lîchamen, doh iro diu starchi gegében si. 16 Inperfectum meum uiderunt oculi tui. Mînen úndúrnohten, Petrum gesáhen diniu oûgen. Er gehiez, daz er geleîsten nemahta, doh kesáh in gót, also iz chit: Et respexit dominus Petrum. Et in libro tuo omnes scribentur. Unde an dinemo bûoche uuerdent sie alle gescriben, perfecti unde inperfecti. Per diem errabunt. An Christo míssenément sîe, uuanda sie in écchert hominem uuanent uuésen, unde ferlâzent ín in passione. Et nemo in eis. Unde iro neheîn nefollehábet sih ze imo. Noh derdar chad: Tecum usque ad mortem. 17 Mihi autem valde honorificati sunt amici tui, deus. Aber dîne friûnt uuórdene nâh mînero passione sint sie mir fílo êrháfte. Valde confortati sunt principatus eorum. Iro apostolatus ist harto gefestenôt. 18 Et numerabo eos et super harenam multiplicabuntur. Unde zello ih sîe unde ist íro mêr danne méregriêzes. So mánig uuirdet déro nah mînero passione, dero fore nehein neuuas. Exsurrexi et adhuc tecum sum. Ih pin irstanden nâh tôde, unde noh pin ih, fáter, sament dir. Noh nebin ih in chunt nube écchert dir. 19 Si occideris, deus, peccatores, viri sanguinum, declinate a me. (Constructio: Si occideris, deus, peccatores, accipient in vanitate civitates suas. Quia dices in cogitatione: «Viri sanguinum, declinate a me.» 20 quia dices in cogitatione: «accipient in vanitate civitates suas.») Ube du, got, sláhest, daz chit: plendest die súndigen, so besuîchent sie íro folgeâra in úppigheite, uuanda du chist stíllo in dero gûoton gedánche: skeident iûh, mánslekken, fone mir. Got lêret, daz sih kûote skeîden fone úbelen in iro uuerchen unde sie doh kemínne sîn; fone diu ist dero irslágenon, ih meîno: dero irblanton lêra uanitas. Uueliu ist diu lera ane daz sîe íro gelîchen lêrent, die iro burge sint, házen die réhten? Zíu tûont sîe daz? Uuanda in íro gûoti ubeli gedúnchet. Uuéle sint uiri sanguinum ane die, qui oderunt fratres suos? 21 Nonne eos, qui oderant te, domine, odio habui? et super inimicos tuos tabescebam? Ziu skeîdent sîe sih fone mir, samoso ih ubel si ? Nehazeta ih die dih hazent trohten? unde neséreuuêta ih umbe dine fienda. uuanda mir iro unreht ando uuas fúre dih? 22 Perfecto odio oderam illos. In durnohtemo háze házeta ih sîe. Daz chit: ih házeta sîe rehto, uuanda ih iro úbeli házeta nals sîe selben. Inimici facti sunt mihi. Sie sint mir fíent uuanda ih iro unreht házeta. 23 Proba me, deus, et scito cor meum. Pesuoche du mih, got, ube ih daz kesculdet hábe, daz sie sih skeîdên fóne mir, unde uuizîst du min hérza, uuanda sie iz uuízen neuuéllen. Scrutare me et cognosce semitas meas, Scródo mih unde bechénne mîne stîga 24 et vide, si via iniquitatis in me est. unde sih, ube in mir unreht fád si. Et deduc me in via aeterna. Unde rihte mih ze démo euuîgen uuége, Christo an démo nehéin únreht neist. Mittelhochdeutsche Literatur 11. Jahrhundert Der Ältere Physiologus um 1070 Der Autor Der Physiologus, dieses «Volksbuch des europäischen Mittelalters» geht auf eine griechisch-christliche Vorlage zurück, die wohl gegen Ende des zweiten Jahrhunderts entstanden ist. Um 1070 hat ein Unbekannter den Physiologus einer lateinischen Version - der sogenannten Dicta Chrysostomi - ins Deutsche übersetzt, vielleicht im Kloster Hirsau. Von diesem «Älteren Physiologus» haben sich zwölf der ursprünglich wohl 27 Kapitel erhalten. <De leone> Hier begin ih einna reda umbe diu tier, uuaz siu gesliho bezehinen. Leo bezehinet unserin trohtin turih sine sterihchi, unde bediu uuiret er ofto an heligero gescrifte genamit. Tannan sagita Iacob, to er namæta sinen sun Iudam. Er choat «Iudas min sun ist uuelf des leuin». Ter leo hebit triu dinc ann imo, ti dir unserin trotinin bezeichenint. Ein ist daz: so ser gat in demo uualde un er de iagere gestincit, so uertiligot er daz spor mit sinemo zagele, ze diu, daz sien ni neuinden. So teta unser trotin, to er an der uuerilte mit menischon uuas, ze diu, daz ter fient nihet uerstunde, daz er gotes sun uuare. Tenne so der leo slafet, so uuachent sinu ougen. An diu, daz siu offen sint, dar anna bezeichenit er abir unserin trotin, als er selbo quad an demo buhohe cantica canticorum «Ego dormio et cor meum uigilat». Daz er rasta an demo menisgemo lihamin un er uuahcheta an der gotheite. So diu leuin birit, so ist daz leuinchelin tot, so beuuard su iz unzin an den tritten tag. Tene so chumit ter fater unde blaset ez ana, so uuirdit ez erchihit. So uuahta der alemahtigo fater sinen einbornin sun uone demo tode an deme triten tage. II <De pantera> Ein tier heizzit pantera un ist miteuuare un ist manegero bilido un ist uile scone un ist demo drachen fient. Tes sito ist so gelegin, so ez sat ist misselihes, so legit iz sih in sin hol unde slafæt trie taga. Tene so stat ez uf unde furebringit ummezlihche lutun unde hebit so suzzen stanc, daz er uberuuindit alle bimentun. Tene so diu tier uerro unde naho tie stimma gehorrint, so samenont siu sih unde uolgen imo turih di suzzi des stanhes. Unde der dracho uuiret so uordtal, daz er liget, alsor tot si, under der erdo. Pantera diu bezeichenet unsirin trotin, ter al manchunne zu zimo geladita turih tie suzi sinero genadon. Er uuas miteuuare, also Esaias chat «Gaude et letare, Hierusalem, quia rex tuus uenit tibi mansuetus&gaquo;. Er uuas, alsor manigero bilido uuare, turih sinen manicualten uuistuom unde durih tiu uunder, diu er uuorhta. Er uuas schone den imen io uurde. After diu, do er gesatot uuard mit temo harme unde mit temo spotte unde mit uillon der Iudon un er gecrucigot uuard, to raster in demo grabe trie taga, also dir tet panttera, un an demo triten tage dorstun er uon dien toton, vnde uuard daz sar so offenlihin gehorit uber alle disa uuerilt, unde uberuuand den drachin, den mihchelin tieuel. III <De unicorni> So heizzit ein andir tier rinocerus, daz ist einhurno, un ist uile lucil un ist so gezal, daz imo niman geuolgen nemag, noh ez nemag ze neheinero uuis geuanen uuerdin. So sezzet min ein magitin dar tes tiris uard ist. So ez si gesihit, so lofet ez ziro. Ist siu denne uuarhafto magit, so sprinet ez in iro parm unde spilit mit iro. So chumit der iagere unde uait ez. Daz bezeichenet unserin trotin Christin, der dir lucil uuas durih di deumuti der menischun geburte. Daz eina horin daz bezeichenet einen got. Also demo einhurnin niman geuolgen nemag, so nemag ouh nehein man uernemin daz gerune unsiris trotinis, noh nemahta uone nehenigemo menislichemo ougin geseuin uuerdin, er er uon der magede libe mennesgen lihhamin finc, dar er unsih mite losta. IV <De hydro> In demo uuazzere Nilo ist einero slahta natera, diu heizzit idris un ist fient demo korcodrillo. denne so beuuillet sih diu idris in horuue unde sprinet imo in den munt unde sliuffet in in. so bizzet siun innan, unzin er stirbit, unde uerit siu gesunt uz. Ter corcodrillus bezeichenet tot unde hella. Tu idris bezechenet unsirin trohtin, der an sih nam den menischen lihhamin, ze diu, daz er unsirin tot feruuorfe un er hella rouboti under sigehaf heim chame. V <De sirenis et onocentauris> In demo mere sint uunderlihu uuihtir, diu heizzent sirenæ unde onocentauri. Sirenæ sint meremanniu unde sint uuibe gelih unzin ze demo nabilin, dannan uf uogele, unde mugin uile scono sinen. So si gesehint <man> an demo mere uarin, so sinen sio uilo scono, unzin si des uunnisamin lides so gelustigot uuerdin, daz si inslafin. So daz mermanni daz gesihit, so uerd ez in unde brihit si. An diu bezeinet ez den fiant, der des mannis muot spenit ze din uueriltlihen lusten. Ter onocentaurus, er ist halb man, halb esil, unde bezeichinet di dir zuiualtic sint in ir zunon un in iro herzon, unde daz pilide des rehtis habin un ez doh an ir uuerchin niht eruullint. VI <De hyaena> Ein tier heizzit igena un ist uuilon uuib, uuilon man, unde durih daz ist ez uile unreine. solihe uuarin, di der erist Crist petiton un after diu abgot beginen. Daz bezeichenet di der neuuedir noh ungeloubige noh rehte geloubige nesint. Von diu chat Salomon «Di dir zuiualtic sint in iro herzin, die sint ouh zuiualtic in iro uuerchin». VII <De onagro> Ein tier heizzit onager, daz ist ein tanesil, der nerbellot nih, uuar uber daz futer eischoie, unde an demo zuenzigostimo tage mercin sorbellot er zuelf stunt tages, zuelf stunt nahtes: dar mag min ana uuizzen, daz denne naht unde tac ebinlanc sint. Ter onager bezeichenet ten fient; der tac undiu naht bezeichenet di dir rehto uuerchon sulin tages unde nahtes. VIII <De elephante> So heizzit ein tier eleuas, daz ist ein helfant, ter hebit mihela uerstannussida an imo unde nehebit neheina lihhamhaftiga geruna. Tenne soser chint habin uuile, so uerit er mit sinemo uuibe ze demo paradyse, dar diu mandragora uuasset, daz ist chindelina uurz: so izzit der helfant tie uurz unde sin uuib. Vnde so siu after diu gehiæn, so phaet siu. Tene so siu berin sol, gat siu in eina gruba uolla uuazzeres unde birit dar durih den drachen, der iro uaret. Ter helfant unde sin uuib bezeichenent Adam unde Euun, ti dir dirnun uuarin, er si daz obiz azzin, daz in got uerbot, unde fremede uuaren uon allen unrehlihon gerunon. Unde sar so siu daz azzin, so uurdin sio uertribin an daz ellende tes kagænuuartigen libes. Tiu gruba uolliu uuazzeres bezeichenet, daz er chat «Saluum me fac, deus». IX De avtvla Ein dier heizzet autula, daz ist so harto gezal, daz imo nihein iagere ginahen nemag, unde hebet uile uuassiu horen unde uile langiu, unde alle die zôge, die imo uuiderstant an sinemo loufte, die segot ez abo mit dero uuassi sinero horne. Den ez aber durstet, so gat hez zi einmo uuazzere, heizzet Eufrates, unde drinket: da bi stant ouh lielline gerta, so beginnet ez da mite spilen unde beuuindet diu horen so uasto, daz ez sih nieht erlosen nemag. So kumet der uueidæman unde slehet ez. Daz dier bezeihchenet den man, der dir giuuarnot ist mit allen dugeden, mit minne, mit driuuon, mit allero reinnussedo, den dir diuual nieht bidregen nemag, uuane uber sih selbo gihefte mit uuine unde mit hôre unde mit allen dien beuuollennussedon, die demo diuuele lihchent. X De serra In demo mere ist einez, heizzet serra, daz hebet vile lange dorne an imo. Sosez div schef gesihet, so rihted ez vf sine uedera unde sinen zagel vnde uuil die segela antderon. Denez so eine vuile geduot, so vuird ez sa môde unde globet sih. Daz mere bezeihchenet dise uuerelt, du schef bizeichenent die heiligen boten, die dir uberuoren unde vberuundan alliu diu uuideruuartdiu giuuel dirro uuerelde; diu serra bizeichenet den, der dir ist unstades muodes, der dir eine uuile schinet annen rehden uuerchan unde aber an dien nieht neuollestet. XI De vipera Ein sclahda naderon ist, heizzet uipera, fone dero zelet phisiologus, so siu suanger uuerdan scule, daz er sinen munt duoge in den iro: so uerslindet siu daz semen unde uuird so ger, daz siu imo abebizet sine gimaht under sa tod liget. So danne div iungide giuuahssent in iro uuanbe, so durehbizzent sie si unde gant so vz. die naderun sint gagenmazzot dien Iudon, die sih iu beuuullan mit unsuberen uuerchan vnde durehahton iro fader Christum unde iro muoter die heiligun christanheid. Ouh gibudet uns got in einemo euangelio, daz uuir also fruota sin same die selben naterun. Dria slahta nateron sint. ein slahta ist, so siu aldet, so suinet iro daz gisune: so uastad siu uerceg dago unde uierceg nahto, so loset sih alliu ire hut abo; so suohchet siu einen locherohten stein unde sliuffet dar dureh unde streifet die hud abo unde iunget sih so. Ein ander slahta ist, so siu uuile drinkan, so uzspiget siu zerest daz eiter. Den uurm sculen uuir biledon: so uuir uuellen drinkan daz geistliche uuazzer, daz uns giscenket uuirt fone demo munde unserro euuarton, so sculen uuir uzspiuuen zaller erist alle die unsuberheit, da mite uuir beuuollen sin. Diu dritta slahta ist, so diu den man gesihet nakedan, so fluhet siu in, gesihet siu in aber giuuatoten, so springet si annen in. Alsamo unser fater Adam, unz er nakeder uuas in paradyso, do negimahta der diufal nieht uuider imo. XII De lacerta So heizzet einez lacerta unde ist also zorftel, also diu sunna, unde fliugat. so daz altet, so gebristet imo des gesunes an beden ougon, daz ez sa die sunnvn gisehan nemag. so gat ez an eina heissci zeinero uvende, diu der ostert bikeret ist, unde kivset ein loh vnde sihet da dureh gegen dero sunnvn, unzin siniv ougan entlvhtet uverdant. Also duo du, christanig man: so dir bedvnkelet uuerde din gesune, so svohche die hosterlihchun stat vnde den sunnen des rehtes, dinen schephare, der dir ist ganemmet oriens, daz din herze intlvide dureh sinen geist vnde daz er dir . . . 12. Jahrhundert Frau Ava um 1060 - 1127 Die Autorin Frau Ava ist die erste namentlich bekannte Dichterin in deutscher Sprache. Am Schluß des «Jüngsten Gerichts» nennt sie ihren Namen und berichtet von ihren beiden Söhnen. Sie ist wohl identisch mit der «inclusa Ava», die 1127 in Melk gestorben ist. Das Jüngste Gericht Nu sol ich rede rechen vil vorhtlîchen von dem jungisten tage, alse ich vernomen habe, 5 unde von der êwigen corone, die got gibet ze lône swelhe wole gestrîten an dem jungisten zîte. Finfzehen zeichen gescehent, sô die wîsten jehent. wir nevernâmen nie niht mêre von sô bitterme sêre. sô bibenet allez daz der ist, sô nâhet uns der heilige Crist 15 An dem êrsten tage sô hebet sich diu chlage, sô wirt daz zeichen dâ ze stunt, diu wazer smiegent sich an den grunt vierzech clafter iz în gêt, einen tach iz alsô gestêt. An dem anderen tage, daz sule wir iu sagen, sô gêt iz aver wider ûz, vil hôhe leinet iz sich wider ûf. 25 sô biginnet iz bellen mit michelen wellen, daz iz alle die hôrent, die den sin dare chêrent. uber elliu diu rîche, sô stêt iz vorhtlîchen. An dem driten tage, alse ich vernomen habe, sô wider fliuzet ob der erde daz wazer al ze berge. 35 wider gêt im der strâm, daz sihet wîp unde man. sô trûret allez daz der ist, wande daz urteile nâhen ist. An dem vierden tage sô hevet sich diu chlage, sô hevet sich von grunde viske unde allez merwunder. ob dem mere si vehtent, vil lûte si brahtent. 45 sô wirt des luzel rât swaz flozen unde grât hât. An dem vinften tage sô wirt ein mêre chlage. sô hevet sich daz gevugele, daz ê flouch under himele ûfen daz gevilde, iz sî zam oder wilde. si wuofent unde weinent mit michelem gescreie. 55 si bîzzent unde chrouwent, ein ander si houwent. des tages harte zergât, swaz vettech unde chlâ hât. Sô chumet vil rehte mit sêre tach der sehste. der himel sich verwandelôt, er wirt tunchel unde rôt. an dem mânen unde an dem sunnen siht man michel wunder. 65 der tach wirt alse vorhtlich, in die erde bergent si sich. An dem sibenten tage sô wirt der luft al enwage. sô vihtet an daz trum, die winde an daz firmamentum, diu wazer dar widere diezent under dem himele. [an dem mânen unde an dem sunnen sihet man michel wunder.] 75 sô hôret man dicke doner unde blicke. sô chrimmet sich ze wâre der arme suntâre, deme sîn gewizzede daz saget, daz er gotes hulde niene habet. An dem ahtoden tage sô wirt diu erde elliu enwage. an der stunde si erweget sich von grunde. 85 sô nemach niwiht des gestan, des ûf der erde sol gân. sô trûret wîp unde man, si nemach getrôsten nieman. An dem niunten tage, alse ieh vernomen habe, brestent die steine, daz gescihet vor dem urteile. si chlibent sich envieren, sô zergêt iz allez sciere, 95 daz vurhtet wîp unde man unde swer sich iht verstên chan. An dem zehenten tage, vil luzel sul wir daz chlagen, sô zevallent die burge, die durch ruom geworht wurden. berge unde veste, daz muoz allez zebresten. sô ist got ze wâre ein rehter ebenâre. 105 An dem einleften tage, des sul wir unsich wol gehaben, sô zergêt vil sciere, da diu werlt mit ist gezieret: golt unde silber unde ander manech wunder, nusken unde bouge, daz gesmîde der frouwen, goltvaz unde silbervaz, chelche unde chirchscaz. 115 sô muoz daz allez zergân, daz von listen ist getân. nu wizet, daz iz wâr ist, valewisk. iz zergêt unde wirt ein An dem zwelften tage, sô hilfet uns daz vihe chlagen. sô diu tier gênt ûz dem walde wider daz vihe ûf dem velde, vil lûte si rêrent, sô si zesamene chêrent 125 mit lûteme gescreie ingegen dem urteile. An dem drîzehenten tage sô nemach sich niemen wol gehaben. sô tuont sich diu greber ûf, diu gebaine machent sich dâr ûz alle gemeine ingegen dem urteile. iz ist allen den forhtlîch, die gewizzen sint der sunden ane sich. 135 An dem vierzehenten tage sô wirt diu biterste chlage. sô gênt diu liute alle ûz, ir nebestêt neheinez in deme hûs. si wuofent unde weinent mit lûteme gescreie. in dem selben dinge sô zergênt in die sinne. sô nemach nieman gesagen dienôt, diu ist in den tagen, 145 uber swen got des verhenget, daz sich sîn leben dar gelenget. Sô chumet der vinfzehente tach, sô nâhet uns der gotes slach. sô sculn alle die ersterben, die der ie geborn wurden, alle gemeine vor dem urteile. sô hevent sich vier winde in allen den enden. 155 ein fiur sich enbrennet, daz dise werlt verendet. daz liuteret iz allez. sô brinnet stein unde holze, wazzer unde buhele, die der sint under dem himele. sô chumt der jungiste tach alsô sciere sô ein brâslach. Sô choment von Christe die vier êvangeliste. 165 daz gebeine si chukent, die tôten si wekent. sô samenent sich mit êren lîp unde sêle. daz ist vil wunnechlîch, die guoten sint dem sunnen gelîch. die engel vuorent scône daz criuce unde die corône vor Christe an daz tagedinch, daz werdent sorchlîchiu dinch. 175 Sô chumet Christ der rîche vil gewaltichlîchen, der ê tougen in die werlt quam: dâ sihet in wîp unde man. im ist sîn scare vil breit, wâ er die versmâcheit leit von sînen vîanden, dâ wil er iz anden. Sô chumet got in den luften in sîner magencrefte. 185 sô rihtet er rehte dem hêrren unde dem chnehte, der frouwen unde der diuwe; sô ist ze spâte diu riuwe, die wir haben solden, ob wir genesen wolden. sô werdent die vil harte gêret, die hie von der werlt chêrent. die sizent dâ ineben gote in der scare der zwelfpoten. 195 wande si durch gotes minne verchurn werltlîche wunne. die sint alle geheiligôt, die wirseren sint erteilôt. Sô wirdet der vil guot rât, die die werlt gezogenlîchen hânt, die gotes nie vergâzen, dô si ze wirtscefte sâzen. doch wil ich iu sagen da bî, wie der leben sol getân sîn. 205 Si sulen got minnen von allen ir sinnen, von allem ir herzen, in allen ir werchen. si sulen wârheit phlegen, ir almuosen wol geben, mit mâzen ir gewant tragen, mit chûske ir ê haben, bescirmen die weisen, die gevangen lôsen. 215 si sulen den vîanden vergeben, phlegen, gerihtes âne miete den armen tuon gnâde, die ellenden vâhen. si sulen ze chirchen gerne gên. bîhte unde buoze bestên. Swer niht vasten nemege, der sol sîn almuosen geben. nemege er des niht gewinnen, sînen besemen sol er bringen, 225 dâ mite er sich reine, der ist aller sâligiste, der sîne sunde weinet. Swer daz mit triwen begât, des wirt dâ vil guot rât. ze dem sprichet der gotesun: «var ze miner zeswen! venite benedicti! mines vater rîche ist iu gerihtet.» Daz gescihet an dem jungisten zorne da sceidet sich diu helewe von dem chorne, 235 diu guoten ze der zesewen, daz sint die genesenen, di ubelen ze der winstern, si werdent al gewindet an dem vrône tenne, dar denche, swer sô welle! Sô sprichet got mit grimme ze sînen widerwinnen. er zeiget in sîne wunden an den vuozen unde an den henden. 245 vil harte si bluotent, gebieten. si nemegen dâ niht widere von sîneme rehte sprichet er in zuo: newolt ir niht tuon. «mînes willen ir hêtet mîn vergezzen, ir negâbet mir trinchen noch ezzen, selede noch gewâte, ubel waren iuwere getâte. dem tievele dienotet ir mit flîze, êwigen wîze.» mit im habet diu 255 Dâ ist der tievel von helle gesellen, mit manegeme sînem sô vâhet er die armen, vil luzel si im erbarment. mit chetenen unde mit seilen, er bintet si algemeine. er fuoret si mit grimme zuo anderen sînen gesinden in den êwigen tôt, âne twâle lîdent si iemer nôt. 265 mit peche unde mit swebele dâ dwinget si furder des tieveles ubele. Dâ nehilfet golt noch scaz. ê bedahten wir iz baz! dâ ist viur unde swebel. wir sturben gerne unde muozen leben. durst unde hunger, aller slahte wunder, frost unde siechtuom gêt uns alle tage zuo. 275 fiurîn gebende dwinget uns die hende, machet uns die vuoze harte unsuoze. mit viurvarwen seilen bindet man si beide. man scenchet uns den wîn, des wir gerne ubere mohten sîn, ezzich unde gallen sam si viures wallen. 285 ezzen haizen si uns gebent, daz ist pech unde swebel. vil grôz wirt unser smerze, die wurme ezzent uns daz herze. daz ist uns gewizzenheit, diu tuot uns alsô michel leit. [Si stechent uns zedem nabele. mit eisnînen gabelen. ir angesiht tuot uns vil wê guot wær uns mohte wir zergên. 295 durch smæh geluste stechent sí uns an di bruste. eínen worm haizzet aspis, des sult ir sin vil gewis. der ander basiliscus, der gilt unrehtez huos. diu wír ofte taten, do wir sín stat heten. aítter daz grune, des git er uns genuge. 305 er spiet ez índen munt. er tuot uns alt sunde chunt. die wir níht chlagten den bîhtern di wir haten. daz gesun der ubeln geiste daz ist witze aller meist. vil michel weínen mít allen nôten ettwene sehent si di toten. in abrahames parme daz habent si ze harme.] 315 Sô der tievel danne gevert, vile wol unser dinch vert. sô scînet uns scône diu edele persône. sich zaiget got mit minnen allen sînen chinden. sô sint die arbeite fure, sô singe wir zwire alleluja, daz frôsanch, wir sagen got gnâde unde danch, 325 wir loben gotes êre mit lîbe unde mit sêle. Sô vâhet ane, daz ist wâr, Jubileus, daz guote wunnejar. sô beginne wir minnen di inren sinne, vernunst unde ratio, diu edele meditatio. dâ mit erchenne wir Crist, daz er iz allez ist. 335 sô habe wir vil michel wunne, sô sî wir siben stunde scôner denne der sunne. zuo der selben scône sô gibet uns got ze lône eine vil stâtige jugent unde manige hêrlîche tugent. wir suln starche werden. wolten wir di berge zebrechen alse daz glas, ze wâre sag ich iu daz, 345 die craft habent dâ diu gotes chint, die hie mit flîzeo guot sint. Dâ habe wir daz êwige lieht, nieht. neheines siechtuomes dâ ist diu veste winescaft, diu milteste trûtscaft, diu chunechlîche êre, die haben wir iemer mêre. daz unsagelîche lôn in dem himeliscen trôn 355 habent die gotes erben, die dâ nâch wolten werven. enphliehe wir hie die sunde, wir sîn dâ sneller denne die winde. Nu vernemet alle dâ bî: dâ sît ir edele ulule frî, dâ nedwinget iuch sunde noch leit, dâ ist diu ganze frîheit. dâ ergezet uns got sciere aller der sêre, 365 die wir manege stunde liten in ellende. Dâ ist daz êwige leben, daz ist uns alzoges gegeben, Crist, unser hêrtuom, wîstuom. unser vernunst unde unser der ist gechêret an in, vil edele ist unser sin. unser herze unde unseriu ougen tougen. sehent die gotes 375 vil zierlîch wirt daz selbe lieht, iz newirt zerganclîch nieht. Daz habent allez diu gotes chint, diu hie diemuote sint, diu ir scephâre lobent unde hie ir vîanden vergebent. diu versmâhent hie nidene, swie sô sî dâ ze himele mit gote geren ze habene, dâ ist vil guot ze lebene. 385 dâ wirt ir geloube ain wârheit, ir gedinge mit habenne ein sicherheit, ir minne vil innechlîche, si sint den engeln gelîche. daz habent si âne ende. nu weset vil wol gesunde in der selben râwe, dar muozet ir chomen. Amen. Dizze buoch dihtôte zweier chinde muoter. 395 diu sageten ir disen sin. michel mandunge was under in. der muoter wâren diu chint liep, der eine von der werlt sciet. nu bitte ich iuch gemeine, michel unde chleine, swer dize buoch lese, wunskende wese. daz er sîner sêle gnâden unde dem einen, der noch lebet unde der in den arbeiten strebet, 405 dem wunsket gnâden und der muoter, daz ist AVA. Ulrich von Zatzikhoven um 1200 Der Autor Das Leben des Ulrich von Zatzikoven bleibt im Dunkel. Wohl kaum ist er identisch mit einem 1214 urkundlich erwähnten Leutpriester im schweizerischen Kanton Thurgau. Sein «Lanzelet», wohl nach 1192 entstanden, ist in einer Wiener und in einer Heidelberger Handschrift (Hs. W, 13. Jahrhundert, bzw. Hs. P, um 1420) vollständig überliefert. Außerdem haben sich vier Fragmente erhalten. Generationen von Germanisten war der Versroman empörend unmoralisch und ein verdammenswertes Machwerk. Erst in jüngster Zeit erfolgt eine Neubewertung. So durch Wolfgang Spiewok: «Was Ulrich geschaffen hat, ist ein original deutscher Versroman..., eine der deftigsten Satiren der Zeit, Satire wider das Ideologem der sogenannten «Hohen Minne» (oder der «Fin amor» der Franzosen), Satire wider den darin angelegten hypertrophen Frauenkult.» Schon um 1230 urteilte Rudolf von Ems in seinem «Alexander»: «Von Zazichovn her Uolrich/ sol ouch an witzen bezzern mich,/ der uns daz mære und die getât/ künstlîche getihtet hât/ wie Lanzelet mit werdekeit/ mangen hôhen prîs erstreit.» (v. 3199-3204). Lanzelet ________________________ Vers 1 - 666 Prolog. König Pant, Vater des Lanzelet und tyrannischer Herrscher in Genewis. Sein Tod bei einem Aufstand der Untertanen. Flucht der Mutter mit dem kleinen Lanzelet. Seine Entführung durch eine Wasserfee auf eine nur von Frauen bewohnte Insel. Die Erziehung des Lanzelet. Sein Wunsch, die Welt zu erfahren. Rüstung und Aufbruch. Des «tumben Tors» Begegnung mit dem Zwerg. Unterweisung in den Ritterkünsten durch den Burgherrn Johfrit.de Liez. Vers 667 - 1356 Begegnung mit den Rittern Kuraus und Orphilet. Gemeinsamer Zug zur Burg des gestrengen Galagandreiz. Liebesnacht mit dessen brünstiger Tochter. Lanzelets Kampf mit Galagandreiz und dessen Tod. Durch die Heirat mit der Tochter Landesfürst. Vers 1357 - 2249 Heimlicher Aufbruch zu neuen Taten. Gefangennahme und Kerkerhaft bei dem Burgherrn Linier von Limors. Sieg über den Riesen, die Löwen und über Linier selbst bei einer Kampfprobe. Heirat mit Ade, der Nichte Liniers und wiederum Landesherr. Vers 2250 - 3474 Erneuter Aufbruch. Zweikampf mit Walwein, dem Artusritter. Sieg beim Turnier in Djofle. Ablehnung der Einladung von König Artus. Vers 3475 - 4673 Ritt zur Burg Schatel-le-mort. Der Zauber des Mabuz, des Sohns der Wasserfee. Auf dessen Geheiß Tötung des Iweret, Feind der Wasserfee. Heirat mit dessen Tochter Iblis. Vers 4674 - 5678 Die Botin der Wasserfee mit der Nachricht über Lanzelets Herkunft und seinen Namen. Lanzelet am Hof seines Onkels Artus. Kampf mit dem König Valerin. Dessen Unterwerfungsgelöbnis. Das Fest am Artushof. Lanzelet in der Hand der Königin von Pluris. Vers 5679 - 6562 Der Zaubermantel der Wasserfee. Lanzelots Befreiung aus der Hand der Königin von Pluris durch die Ritter Walwein, Karjet, Erec und Tristant. Vers 6563 - 7444 Entführung von Artus' Gattin Ginover durch den König Valerin. Seine uneinnehmbare Burg Verworrener Tann. Hilfeversprechen des Zauberers Malduc unter der Bedingung, Erec und Walwein an ihn auszuliefern. Eroberung von Valerins Burg, sein Tod und die Befreiung Ginovers. Vers 7445 - 8468 Eric und Walwein im Kerker auf Malducs Burg vom Tode bedroht. Befreiung der beiden durch Lanzelet und seine hundert Ritter. Tod des Malduc. Freudenfest am Artushof. Die in einen Drachen verzauberte Dame Elidia. Ihre Kußerlösung durch Lanzelet. Lanzelets Rückkehr auf den Thron von Genewis. Wiedersehen mit seiner Mutter. Vers 8469 - 9444 Rückkehr an den Artushof. Übernahme der Herrschaft im Land seiner Frau Iblis. Die Krönungsfeierlichkeiten in Dodone. Lanzelet als umsichtig regierender König in Dodone. Das Ende von Lanzelet und Iblis nach langer, glücklicher Zeit. Epilog. 13. Jahrhundert Gottfried von Straßburg um 1210 Der Autor Die Lebensumstände des Gottfried von Straßburg liegen im Dunkeln. Sein profundes Wissen läßt auf eine Ausbildung an einer Klosterschule oder Universität schließen. Über seine spätere berufliche Betätigung wahrscheinlich in Straßburg - gibt es nur Vermutungen. Vieles spricht dafür, daß «meister Gotfrid» dem Straßburger Stadtbürgertum und nicht dem Adel oder der Geistlichkeit angehörte. Die Niederschrift des Tristan erfolgte wohl zwischen 1205 und 1210. Als Vorlage diente ihm der Tristan des Thomas d'Angleterre, der um 1170 entstanden und nur fragmentarisch überliefert ist. Gottfrieds Werk blieb unvollendet und bricht mit Vers 19548 ab. Sprüche Die folgenden beiden Sprüche, die unter dem Namen Ulrichs von Lichtenstein überliefert sind, werden heute Gottfried von Straßburg zugewiesen. I Liut unde lant diu möhten mit genâden sîn wan zwei vil kleiniu wortelîn «mîn» und «dîn», diu briuwent michel wunder ûf der erde. wie gânt si früetend und wüetend über al 5 und trîbent al die werelt umbe als ein bal: ich waene ir krieges iemer ende werde. diu vertâne gîte diu wahset allez umbe sich dâ her sît Êven zîte und irret elliu herze und elliu rîche. 10 weder hant noch zunge dien meinent noch enminnent niht wan valsch und anderunge; lêr unde volge liegent offenlîche. II Gelücke daz gât wunderlîchen an und abe: man vindet ez vil lîhter danne manz behabe; ez wenket dâ man ez niht wohl besorget. swen ez beswaeren wil, dem gît ez ê der zît 5 und nimt ouch ê der zîte wider swaz ez gegît. ez tumbet den swem ez ze vil geborget. fröide gît den smerzen: ê daz wir âne swaere sîn des lîbes und des herzen, man vindet ê daz glesîne gelücke. 10 daz hât kranke veste: swenn ez uns under ougen spilt und schînet aller beste, sô brichet ez vil lîhte in kleiniu stücke. Süezkint der Jude von Trimperg um 1280 Der Autor Von Süezkint dem Juden von Trimperg (wohl Trimberg bei Bad Kissingen), wie er in der Großen Manessischen Liederhandschrift genannt wird, sind zwölf Sangsprüche in sechs Tönen überliefert. Sie dürften in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstanden sein. Süezkint ist der einzige bezeugte jüdische Dichter der deutschen Literatur des Mittelalters. Über sein Leben als fahrender Sänger ist nichts bekannt. Die Sangsprüche _______________________ I (1) Swer adellîchen tuot, den wil ich hân für edel, swie, man sîns adels achtet nicht gen eime zedel: nu sicht man doch bekomen rôsen von dem dorne swâ sich gemischet vil untugende zuo dem adel, 5 dâ mag daz adelkleit wol werden zeinem hadel: nicht guot wirt mel dâ vil getreffs ist under korne. swâ adel tuot adellîche tât, der adel liutert immer; swâ adel arkeit vil begât, 10 er houwet guot gezimmer. swer nicht sî von hôhem namen und sich untugende welle schamen, dar zuo sîn selbes dinc zem besten kan gezamen, den heize ich edel, swier nicht sî von adel der geborne. (2) Kein bezzer latewêrje nie gemachet wart, dann ich iuch lêre und künde, sinneclîcher art, gesunt ze lasters wunden und ze schanden süchten. mit fünf bîmenten rein sol sî gemenget sîn 5 triuw unde zuht, milt unde manheit hœrt dar în; dâ bî sol mâze et bülvern, smecken mit genüchten. diu latewêrje ist êre genant, ein balsme ob allen spîsen. mit ir wirt schanden nôt entrant, 10 si zimt nicht den unwîsen. swem si wonet stæte bî, der ist vor houbetschanden frî. wol im des lîp der latewêrjen büchse sî: sîn reinez lop, sîn hôher nam wirt blüejen unde früchten. (3) Swenn ich gedenke waz ich was ald waz ich bin ald waz ich werden muoz, sôst al mîn fröide hin, und wie die tage mîns lebennes loufen von mir swinde. und ist daz niht ein jâmer siuftebernder nôt 5 daz ich von tage ze tage fürchten muoz den tôt, wie er mich bringe in der unreinen würme gesinde? wie solte ich dâ bî frô gesîn? sô ich daz als betrachte, sô hân ich an dem herzen mîn 10 sîn michels grôzer achte, wie mîn sêl dort kummer dol: mit sünden was mir ê sô wol. almechtig herre, dû bist aller gnâden vol: nu hilf mir daz mîn sêle dort vor dir genâde vinde. II Gedenke nieman kan erwern den tôren noch den wîsen; dar umbe sint gedenke frî ûf aller hande sache. herz unde sinne dur gemach dem menschen sint gegeben. 5 gedenke sliefen dur den stein, dur stahel und durch îsen. gedanc klein achtet wie diu hant diz unde daz gemache. swie man gedenke nie gesach, si doch nâch horte streben. gedanc ist sneller über velt 10 denn der blic eines ougen. gedanc glust bringt nâch minne gelt, nâch der gesichte tougen. gedanc kan wol ob allen arn hôch in dien lüften sweben. III (1) Küng herre, hôchgelopter got, waz dû vermacht! du liuchtest mit dem tage und vinsterst mit der nacht, dâ von diu welt vil fröiden unde ruowe hât. küng, aller êren dir noch nie gebrast, 5 wie den tag du zierest mit der sunnen glast und ouch die nacht, der dînes mânen liecht wol stât. du hêrst den himel mit den stern, sîn schônheit iemer mag gewern. du hâst ze geben gâbe vil der nicht zergât. (2) Ir mannes krône ist daz vil reine kiusche wîp, wan iemer in wol êret ir vil werder lîp. er sælic man dem dâ diu guote sî beschert; der mag ân zwîvel mit ir sîniu jâr 5 willeclich vertrîben stille und offenbâr. er sich mit ir ie sünden unde schanden wert. mit hôher stæte ist sî bedacht, ir liecht fiur löschet nicht in nacht, ir hôhez lop mit volge der meisten menge vert. IV (1) Swie vil daz mensche zuo der welte guotes habe und ez gedenket wie ez scheiden muoz dar abe ze leste mit dem tôd, sô mag ez trûren sêre. dâ vor nicht frumt rîchtuom, gebulr von hôher art, 5 wîsheit, gewalt, daz müeze an des tôdes vart. ez darf dâ für nicht suochen weder rât noch lêre. kein meister in nigromanzî wart nie sô wîser ræte daz er ie wurde des tôdes frî, 10 noch heilig wîs prophête. dur den grôzen ungewin ich dicke gar betrüebet bin, daz nieman weiz nu wâ diu sêle kumet hin, sô tôt den lîp ermant daz er von leben kêre. (2) Vil manger muoz bescheiden wesen dur die nôt der unbescheiden wære, wan daz im gebôt sîn meisterschaft daz er unfuoge müeste lâzen. dâ bî sô næme ouch menger gerne den gesuoch; 5 daz lieze er nicht dur got noch dur der liute fluoch, wan daz er hât des houbetguotes al ze mâzen. und daz der esel hæte horn, die liute er nider stieze; möcht kokedrille sînem zorn, 10 nieman ez leben lieze; stüende an wolfen gar diu kür, vil schâfe man dar an verlür; diep wolte daz beslozzen wurde niemer tür; der bœse wolte daz der biderbe wær verwâzen. (3) Hât rîcher mel, der arme dâ bî eschen hât; dar an gedenke ein wîser man, daz ist mîn rât, und lâze im nicht den armen sîn ze smâch ze fründe: vil lîchte kumt diu stunde daz er sîn bedarf; 5 dâ von sî rîcher gen dem armen nicht ze scharf. kuo sunder hagen nicht wol getuon den sumer künde. swie man den esel hât unwert, doch was er ie gereite swâ sô man sînes dienstes gert, 10 daz er in nie verseite. het nieman zarmuote pflicht, der rîchtuom wære ein wicht: wer solt dann dienen, ob der arme wære nicht? guot was ie bast, daz man den sac dâ mit verbünde. V (1) Wâhebûf und Nichtenvint tuot mir vil dicke leide: her Bîgenôt von Darbîân der ist mir vil gevære. 5 des weinent dicke mîniu kint, bœs ist ir snabelweide. si hât si selten sat getân, Izzûf, diu froidenbære. in mînem hûs her Dünnehabe 10 mir schaffet ungeræte, er ist zer welt cin müelich knabe: ir milten, helfent mir des bœsewichtes abe, er swechet mich an spîse und ouch an wæte. (2) Ich var ûf der tôren vart mit mîner künste zwâre, daz mir die herren nicht went geben. des ich ir hof wil fliehen 5 und wil mir einen langen bart lân wachsen grîser hâre: ich wil in alter juden leben mich hinnân fürwert ziehen. mîn mantel der sol wesen lanc, 10 tief under einem huote, dêmüeteclich sol sîn mîn ganc und selten mê ich singe in hovelîchen sanc, sîd mich die herren scheiden von ir guote. VI Ein wolf vil jæmerlîchen sprach «wâ sol ich nû belîben, sîd ich dur mînes lîbes nar muoz wesen in der âchte. 5 dar zuo sô bin ich her geborn, diu schult diun ist nicht mîn. vil manic man hât guot gemach den man sicht valscheit trîben und guot gewinnen offenbar mit sündeclîcher trachte. 10 der tuot vil wirser danne ob ich mir næme ein genselîn. jon habe ich nicht des goldes rôt ze gebenn umb mîne spîse. des muoz ich rouben ûf den lîb durch hungers nôt. der valsche in sîner wîse 15 ist schedelîcher vil dann ich und wil unschuldig sîn.» 14. Jahrhundert Heinrich von Mügeln um 1320 - nach 1371 Der Autor Über Heinrich von Mügeln ist wenig bekannt. Geboren ist er wohl um 1320. Er nennt sich selbst: «Ich Hainreich von Müglein, gesessen pey der Elbe in dem land zü Meissen». Die Herkunftsbezeichnung Mügeln kann auf drei Orte dieses Namens bezogen werden. Als erstaunlich gelehrter «leie» war er vielleicht seit 1346 berufsmäßiger Dichter am Hofe Karls IV. in Prag, dann bei Ludwig I. von Ungarn, bei Rudolf IV. von Österreich und schließlich bei Hertneid von Pettau, dem Landesmarschall der Steiermark. Gestorben ist er nach 1371, das Todesdatum ist nicht bekannt. Der meide kranz Der Text folgt der Ausgabe: Heinrich von Mügeln, Der meide kranz, herausgegeben von Willy Jahr, Borna-Leipzig 1908 ___________________________________ In lop der höchsten wirdikeit, die nie der himmel überschreit noch nimmer ummesweifen kan, ich tummer fa zu tichten an. 5. got erster urhap aller ding: des himmels sterne, zirkel, ring, erd, engel, mer, nature stark floß durch dins milden herzen sark. der ding ein ummegende sweif, 10. naturen hant dich nie begreif, das sie dir, schepfer, gebe stat. kein sin erspüren mak din pfat, wie ader wo din wesen ist: das ist verborgen aller list. 15. Natura wenet doch, wie du in osten, here, wonest nu, sint dem das erste wegn sich nam, davon geburt den tiren quam. nicht das du sist nach bunde da: 20. kein maß der zit dich mißet gra. naturen bundes bistu fri, ouch stürt koin dink din edeli. du bist ouch aller formen an, wie formen orden uß dir ran: 25. pin unde müde bistu ler. zu dir stet aller geiste ger. drifaldik, doch eins wesens got, unwegelich gar sunder spot, vernunst dich nicht begrifet min, 30. doch muß von not ein keiser sin: darnach sint fürsten, darnach wart des ritters und gebures art. sust bistu, got, ein anefank: durch dines herzen klamme drank 35. naturen art in rechter saß. du linge, zirkel, winkelmaß: nach dir sich alles wesen mißt; ouch von dem zentrum fürt din list die lingen zu dem ummesweif. 40. wie menschen sin dich nie begreif, in dingen du doch bist bekant: dich murer bi der mur ich fant und doch dich leider nie gesach. min oug ist sam der ülen swach, 45. das nicht der sunnen mak gesen und küset doch irs lichtes bren. sust, her, in dingen kenn ich dich, die du, got, schepfest mechtiklich und gibst in leben unde nar, 50. die sust ertrenkte todes mar. ich ruf dich sam das küchel an des raben, das er hat gelan, das an dir eine suchet trost: es ruft dich an und wirt erlost. 55. sust löse, got, die sinne min von strenger unvernünste lin, das ich gesprechen müg ein ticht, davon der name werd gericht der tochter und der ammen din, 60. die dich gebar an alle pin. die selben maget ruf ich an zu stür uf mines tichtes ban, darnach den waren gottes frünt, künk Karlen, das sin leben künt: 65. er mochte brechen und enbricht: des gap im got sin war gericht, das er in volle geben mak der tugnde lon und bruches slak. Hie ist des buches anefank, geticht uß meisters sinne krank. Das buch das heißt der meide kranz, 70. die got gebar an allen schranz und bleip doch küscher vil dann e: das für tet nicht dem busche we, den Moises sach brinnen vor: got in irs reinen herzen ror 75. sin wort zu fleische werden liß, das Luciferes guft verstiß, eins armen sinnes ist der man, der stete ticht nach alder ban und selber findet nüwes nicht: 80. alsust der meister lere spricht. uf den spruch ein nüwes ticht ich schepf uß sinnes wage sicht in lop dem keiser Karlen ho, durch schult in allen landen, wo 85. gelesen wirt min krankes ticht, sint mich sin gabe hat gericht: wie das min kunst unwirdik was, doch mild er nach genaden maß. sins arn und sines leuwen mut 90. lacht, wann er adellichen tut. die der keiser beide fürt dem wißen leuwen stet gesnürt der sterz zwefaldik in dem schilt, der swarze ar in goltgefilt. 95. der leu bedütet Bemerlant, der ar zu Rome milde fant, trüw, ere, recht, genaden tich: des helt sin hant der werlde rich. Wip saßen in der sele sal, 100. der ere nie gefil zutal: sie waren schon und übergut, wem eine durch sin herze wut mit ires süßen blickes gank, zuhant der waren minne strank 105. den selben bant in winheit rich. der werlde lib ist ir unglich. ich ticht ir noch ensing ir nicht: uf irem stige nimant richt, sie krigen um die wirdikeit, 110. der ere tadel nie versneit, welch undr in sold die wirde han. das an den keiser wart gelan, sint im got und naturen ticht der erden und des mers gericht 115. gap, so vil ouch der künste list, das im damit gegeben ist die wisheit, das er mak verstan, welch undr in süll die wirde han. Hie künt Philosophi ir list, waruf ir grunt gebuwet ist, dem werden keiser Karlen rich, des frides und genaden tich. Die erst Philosophia hiß, 120. die ir ein urteil werden liß. da sie vor den keiser trat, sie sprach: «naturen urteil hat min ticht gegebn übr alle tir, die uß den elementen vir 125. sint: wie sie müßen liden pin und mugen ewik nicht gesin; wie kalt noch hitzik si die sper des himmels, doch sie hitzet ser die dink nach ires loufes art. 130. wie mensch uß sinem wider wart; wie alles wegen si in zit: du leser, nach dem sinne schrit und sprich, uß nichte werde nicht, als miner künste meister spricht. 135. wie himmel, engel, erd gesacht von gotte si und nicht gemacht; und wie das got hab keine stat, und wie der engel wegen gat gein im nach der naturen ler, 140. und wonet uß der achten sper. und wie die sel die erste tat des libes ist (der glider hat) und hand ist leben in gewalt und darbet last und der gestalt. 145. wie ewik si irs lebens louf, sint sie uß gottes herzen trouf. wie uß dem himmel si nicht stat, wie er nicht ledigs in im hat, und wie die erst materge si 150. zu nemen alle formen fri, wiß, in gewalt, und doch in tat sie bi ir keine forme hat: sie nem ouch keiner formen nicht, wer sie uf formen art gericht; 155. und was si der naturen grunt. ich mach ouch alle sitten kunt, uß den sich ware tugent souk: kunst ane sitten nicht entouk. sust macht min wares ticht bekant, 160. das alle kunst sich uß mir want. des treit ein hus die hende min, in dem ist angest, not und pin. des si gefragt der keiser fri, ab ich der künste mutter si, 165. und ab ich in der kronen stan sal nu der maget ane ban, die gottes kindes junk genas, das alt vor allen dingen was.» Hie künt Gramatica ir art, durch was das sie hie funden wart. Die ander kunst Gramatica 170. sprach zu dem waren keiser da: «ich bin ein mutter früchte rich: welch kint uß miner brüste tich trinket, das erkennet wol, wie es sin latin reden sol. 175. buchstaben, namen unde wort und alle teil han ich gelart: uß den teilen wirt gesmit der rede lip und ir gelit. nam ist das erste teil genant: 180. dink ane nam ist unbekant. nam ist mins ingesigels rink, damit gezeichent sint die dink. wie man die namen brechen sal nach iren fellen hin zutal: 185. man sprichet: Petrus kummet her, Petri des ist der rote sterr, und Petro sal man geben brot, Petrum se ich dort in not, o Petre, flüch von Petro her: 190. in allen namen halt die mer. wie nach dem namen vornam get, wan er oft vor den namen stet: wo dinges nam unkundik was, da sprach man der, die unde das. 186. und wie das wort bedütet tat, die zuwort ie volendet hat. und wie das participium uß zweierlei naturen kumm, uß namen und uß wortes art: 200. sulch mere wunder nie gewart, und wie das die coniunctio nam unde wörter bindet so: her Heinrich unde Jutte get, wo Peter bi her Paulen stet: 205. bi ist ein prepositio, ach ist ein interiectio: die klaget leit und forchte vil, smerz unde freud und wunders zil. sust macht min wares ticht bekant, 210. das ich der rede münze fant: des ge ich stet in richer lust, zwei kint ich ner an miner brust. des si gefragt der keiser stark, ab ich si aller künste sark, 215. und ab ich in der kronen stan nu sal der maget ane ban, in der herze sam ein lam der leuwe von dem himmel quam.» Die kunst hie kündet Loica, waruf irs tichtes zimmer sta. Die dritte kunst hiß Loica: 220. die hilt sich zu dem keiser na. bleich unde mager ir gestalt, in scharfen sprüchen was sie balt; ein tuben truk ir rechte hant, ein slang sich durch ir linken want. 225. sie sprach: «in aller rede gar ich kenne wol falsch unde war. ich trige, mich betrüget nicht, vil nüwer fünd ich han geticht, wie man die urteil bilden sal 230. gein swacher Sprüche widerswal, das red uß rede folgen muß nach wises herzen lingen schuß. wie namen wort nach willen sin bedütende: sich wie den win 233. ein reif bedüt und schellet wit von win, der in dem faße lit, universale heißt min list, dink in der sel, des predgen ist von dingen vil, die schelend sin 240. in zal, gestalt: nim zeichen min: wann ich dich frag: was ist der stir? mensch, ochse, fisch, du sprichst: ein tir: tir als ein künn: der name sal gemeinlich predgen von in al 245. nach eigen und nach underscheit die ler dich in sin künde leit: der esel ist unredelich, (sin wider helt her Friderich) gar lecherlich sin har gekrült; 250. der ochse eigentlichen brült. wiß heiß ich zufal unde swarz, daruß der narre tribet scharz. der fünfer wesen und ir kunst worcht in die sele die vernunst. 255. sie sint dink uß der sele nicht, als wan der alden meister spricht, min stik uf aller künste ban leitet: ich disputiren kan von aller hande künst beginst. 280. ab du das, keiser, recht besinst, so mag ich wol die wirde han, ab mirs din überwirde gan. ich bin ein kunst der redlichkeit, die kindes unvernunst versneit: 265. des mag ich in der kronen stan der meit, der kint wol reden kan und überdisputiret hat die meister uß der helle stat.» Sich wie das isen jungen tut des hammers und der flammen glut: sust junget wort Rethorica, vor grop gekleit in wete bla. Die virde kunst Rethorica 270. gink vor den werden keiser da. bla sam lasure was ir wat, darin gar meisterlich gesat vil manche blum von golde rich: nie ich gesach des kleides glich; 275. nimant es ouch vergelden kan, sint es vernunst der sele span. sie sprach: «uf tichten mir ist kunt in aller sprach matergen funt: wie man sie lengen, kürzen pflit, 280. wie man sie enget unde wit nach wises herzen lingen art, das tichtes bu ste ane schart, und wie man eigentlichen sal die farben in des tichtes gral 285. strichen mit sines pinsels ort, das tichtes bild icht ste vermort: nim zeichen diser kranken schrift: des zornes flamm weckt mordes gift. wo zornes swert des keisers reist, 290. da ist der finde guft verweist, in leides norden ouch zuhant ir freuden summer wird gewant. ab schult erwecket sinen zorn, uß sent er siner rache dorn, 295. damit er bruches sturm verhert und rechtes zinn sin fride wert, wo aber schult genaden gert, zu wachse wirt sins zornes swert: das vor sneit grimmer dann ein für, 300. das gibet schult genaden stür. wer tichten kan, der merket jo, wie das hie leuft transsumptio. der farben sechs und drißik sin der wörter nach der lere min, 305. die sinne vir und zweinzik han: manch tichter ir nicht zwelfe kan: damit er felschet mine kunst: sin tichten wirdik ist der brunst. er smit uß falscher münzen art, 310. dem nie min lere kundik wart des tichtes zimmer ist min werk. o keiser, cristentumes berk, in minen glesten wirstu stan, wann dich der werlde rich verlan. 315. ich bin ein stern der richen kron der meit, die vor sach in dem tron Johannes sten in richer lust, da er slif uf des heren brust.» Hie kündet Arismetica, wie das ir kunst uf zelen ga. Die fünfte Arismetica 320. die sprach zu keiser Karlen da: «ein iglich kunst die treit min kleit, als ichs ir nach genaden sneit: buchstaben hat Gramatica in zal, ir sprüche Loica, 325. der rethor farben hat in zal, der musicus fa unde sol, Geometria hat ir punt in zal: so hat der ziffer funt Astrologiam wol gericht, 330. als mir vernunst der künste bicht. des himmels stern und meres griß und alls das rechenunge hiß, das floß durch mines herzen rink: nach mir nature buwet dink. 335. ein dink vor allen dingen was, daruß sich alles zelen maß. eins ist kein zal, wißt ane wank, doch ist es zal ein anefank. vil mancher hande ist die zal, 340. als es min kunst bewisen sal: wo zweier gank uß einem reist, die zal der ordenunge heißt; uß drien vir und fürbaß me, die zal helt sulches ordens e. 345. wie man die zal denarius stetlich mit zehen zelen muß, und wie das zuwort habe zal, als zeimal zwir man sprechen sal; senarium nach minem sin 350. mit sechsen sal man zelen hin. wie drilich virlich bürdik ist, wie das man meren sal mit list. ich teil, ich zu und abe tu. o warer keiser, merke nu: 355. welch fürste, koufman min enpirt, des nutz in schaden ist verirt: ab im unkundik ist min ban, sin kouf, verkouf muß schaden han. han ich davon icht wirdikeit? 360. das weiß vernunst des keisers breit. ich zalt uß gottes herzen gar der engel und der geiste schar. des mag ich in der kronen stan, sint ich nach zal gegeben han 365. hie gottes kinde sin gelit, das in das herze wart gesmit der meit, von eines wortes kraft mit geistes füchtikeit durchsaft.» Geometria kündet hie, wie das sie pflak der maße ie, und leret das den keiser gut: darnach er frides maße tut. Die sechste kunst, ich tu bekant, 370. Geometria was genant. die truk ein rut von golde rot, damit sie sich zu meßen bot. die selbe zu dem keiser sprach: «ich mak wol sin der künste dach, 375. sint das min zirkel in sich sloß alles das uß naturen floß, des himmels sterne, speren, kreiß, wie hoch sie sint, min zirkel weiß; wie tif, wie hoch, wie wit, wie lank, 380. in formen sie min zirkel twank. das mer und erd nach maßes trift uß minem zirkel wart gerift. für, flamm ich meß und ouch die luft, dem fegefür und hellegruft 385. den meß ich irer tüfe zil. darinne wonen tire vil, die keiner maß sint undertan, wan sie nicht der matergen han: ich meße nicht wan das da hat 390. matergen same hie gesat. welch dink der maß ergibet sich, das mak man teilen ewiklich: ein iglich lip, seit dir min list, zu meßen und zu teilen ist. 395. ich meße ouch der sunnen rat, wie wit das uf den wolken gat der regenbogen unde blibt, wo im ein zil min linge schribt. kurz unde lank nach minem sin 400. die lingen von dem zentrum hin ich leite zu dem ummesweif uf aller speren zirkelreif von punt zu punt in rechter saß die ling uf alle winkelmaß. 405. nie lip an mine linge wart: da got sin kint in menschen art sant, ich maß im sin gelit nach rechter lingen art gesitt. darum es müst ein wunder sin, 410. wer nicht der künste wirde min: Handschrift der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. Germ. 14, Bl. 14v) sint das min zirkel, lingen ban den schepfer der naturen kan meßen sam ein ander dink, des bin ich aller künste rink 415. und mak ouch in der kronen stan der meide gottes ane ban, sint ich den sichtiklichen maß, der vor uß allem zirkel was.» Uns leret Musica hie schon, wie sich gebirt ein iglich don. Die sibnde, Musica genant, 420. die truk ein harf in irer hant. sie sprach: «min kunst ist richer lust: ich tote freud uß menschen brust ruf unde weck uß sorgen tif, die vor in leides banden slif. 425. freud unde lust wer gar verbut, hett ich nicht funden gamma ut, re unde fa und ouch das mi, sol unde la. - gesenge dri ich tu gar meisterlich bekannt, 430. wie man sie singet in der hant. der erste naturalis heißt, nach dem beduralis reist, bemollis stet der dritte ist: der hat uf döne fremde list. 435. und wie man eigentlichen kan die dön erkennen sunder wan, das ist den kindern min bekant wie sie min wares künnen fant: die noten die da loufend sin 440. in die oktaven uß der prim, der wise, wiße sunder wan, die ist genant diapason. die wise diapente sal han uß der quinten iren fal: 445. so sal sich uß der quarten lan die wise diatesseron. kunt sint die semitonia, doch kennt ir nicht der esel gra. die pfaffen die sint mine knecht, 450. und wolden sies besinnen recht, so wer ir lesen gar ein wicht, hort man mich in dem kore nicht. wo das ich swig, da ist der ban: des sint in fürsten undertan. 455. falseten, linde, grop und scharf, min pinsei alle dön entwarf. des si gefragt der keiser gut, sint ich uß leide ritters mut ruf, das er folget freuden ban, 460. ab ich die wirde sülle han. min sank was ewik von der meit, durch die dem menschen leben teit: min don der sluk und brach die luft, biß das ich in des herzen gruft 465. lokte got, als es im zam, und menscheit von der meide nam. des mag ich in der kronen stan, sint ich die wird ersungen han.» Die Astronomie mit einem Sextanten (Handschrift der Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 14, Bl. 14v) Astronomi, der künste kern, lert himmels lauf und ouch der stern. Darnach Astronomia quam, 470. in richem kleid als es ir zam: das was mit sternen gar durchsat, als es gots finger hat genat. sie sprach: «was tat zukünftik ist, das offent miner künste list: 475. Christi geburt nach menschen art kundik den küngen von mir wart; wann hunger, sterben kummen sal, von strite mensche wann zutal gemeinlich fallen muß durch not, 480. das ich der werld ie vor enpot: es offent des cometen list oft (wie der nicht ein sterne ist). wie das zwefaldik si der louf des himmels, der uß gotte trouf: 485. der erste louf von orient des himmels hin gein occident: nie kein wegen, als ich las, vor tegelichem wegen was. eins andern loufs die sterne pflegn. 490. die sich gein oriente wegn: die achte spere sunder spar leuft sechs und drißik tusent jar, Saturnus drißk, zwelf Jupiter, Mars zwei, gelöube mir der mer, 495. ein jar die sunne loufen muß, acht stunden minner hat Venus, Mercurius dri virtel jar, der man vir wochen sunder spar, wie man den polum articum 500. findet und ouch antarticum. ouch ler ich miner künste kint, wie das der zeichen zwelfe sint. und wie die sunn darinne get. Aquarius der erste stet, 505. Ster, Fische, Ochse, Gemini, nach dem krouch der Krebeß ie. der Leuwe, Meit und Scorpio, die Wage mit dem Schützen so, der Steinbok muß das letzte sin: 510. das ist Saturni hüselin. sust weiß ich louf und sternen art. von mir got menschen kundik wart. welch arzt hie miner künst enpirt, mit dem die sichen sint verirt. 515. des mag ich in der kronen stan der meit, die dri personen span uß einem worte sunder pin: nicht brach ir glas der sunnen schin.» Uns kündet Phisica nu, wie der kranke sich mak stüren hie. Die nünd was Phisica genant: 520. das leben truk ir rechte hant, die linke hant die truk den tot den tiren von naturen not. sie sprach: «das leben ist ein wegn: die wil ich se das tir sich regn, 525. so merk ich, das des lebens geist mit kraft in tires herzen reist, ich merk ouch wie ein iglich tir sich sacht uß elementen vir, uß erd, uß luft, uß wag, uß für: 530. darnach ich geb dem tire stür, ab dürre, fücht adr überkalt adr hitze hab das tir ersnalt, das sich sin leben neigen wil, min kunst es uf sin erstes zil 535. leitet, so das es sich enthelt. wo aber eins zu wit sich spelt uß der naturen wage snall, das tir muß fallen hin zutal: naturen urteil das gebot; 540. des lebens roup heißet der tot. got selber miner künste stap den tiren hie zu stüre gap, das die behalden sal min kunst, die sust verdempfte todes dunst. 545. du kranker, in min schule kum: ich ler dich, wie reubarbarum mak fegen alle colera, und ist dem ersten stapfen na in wurzen, die da hitzik sin: 550. der krank sie nutzet ane pin. die salbei helt die ander stuf: welch arzt es weiß, der ist kein luf. uf der dritten stufen ouch wil stete wonen knobelouch: 555. er derret unde hitzet dich und ist dir selden frumelich. der pfeffer und der safferan, die wollen uf der virden stan: wer überswenke nutzet die, 560. der mak nicht lange bliben hie. naturen urteil hat geteilt: von wider wider wirt geheilt. ich bin naturen hüterin: brunn adels, keiser, das besin, 565. das man vor mine schule quam und salben gottes kinde nam. des mag ich wird und ere han und ewik in der kronen stan.» Hie Alchimia kündet das, wie in naturen grunde was mensch, esel, pfert und ochse glich: des wirt uß kupfer gimme rich. Die zende Alchimia hiß, 570. die ir ein urteil werden liß. sie sprach: «ich bin der künste kunst, wie das mich flüt der toren gunst: ein iglich kunst ist in ir war, ab sie der tore nicht erfar: 575. es ist kein dink, des sache nicht recht elich orden hab geticht: die kunst die ist unschuldik dran, ab Heinrich nicht wol tichten kan. in der naturen grunde nicht 580. schelt kupfer, golt, nature spricht: ein iglich erz geboren wart uß swebels und queksilbers art: des himmels blik und ouch die stat zin unde golt gescheiden hat 585. das laß dir nicht ein wunder sin: kint, wer der sam des vaters din gegoßen in ein ander stat, ein ander form du hettst gehat: die stat gebürt ein anefank 590. ist sam der vater ane wank. die farben ler ich dich von erst, darnach zu den höchsten kerst. uß swebel und queksilber wirt zinober: daran nimant irt, 595. ab ers kan malen in den topf; lasure flicht den selben zopf mit salze armoniaco: die farben ler ich alle so. du merkest warheit miner kunst, 600. dempft dich nicht unvernünste dunst. das silber wandel ich in golt uß miner richen künste solt: alun ich nem und minium, mit salze armoniacum, 605. tutiam und den grünspan, sal nitri muß ich darzu han. ich sag: das ist der ware wek, ab du kanst finden minen stek: (der esel bi dem brunn erdürst, 610. des sin vernunst nicht hat gefürst). sust silber, gold ich machen kan, den alle kunst ist undertan; der werlde zir und ir gelit sich uß mir wirket unde smit. 615. des mag ich in der kronen stan, sint ich das golt gemachet han der maget, in der herzen touf gots kint von einem worte trouf.» Kunst gottes, Metaphisica, künt, wie der engel wegen ga. Die eilft hiß Metaphisica 620. die was vor der naturen gra. uß der selben rechten hant sich schonde der naturen want. die selbe sprach: «und wer ich nicht, so wer nie kunst noch dink geticht: 625. min kunst hat alle dink gesacht, die andern künste sint gemacht von dingen und uß dingen gen, und möchten ane dink gesten mit nichte, wiße sunder wan, 630. davon sie mir sint undertan. ich, gottes kunst, wer min enpirt, von dem ist selikeit gefirt. ich saß in gottes herzen rink, e ie geschepfet wurde dink. 635. ich lere nicht wan einen got: wer gotte setzt, das ist ein spot. nim zeichen warer lere min: es muß von not ein keiser sin, darnach sint fürsten, darnach wart 640. des ritters und gebures art. sust ist ein got unwegelich: der speren geiste wegen sich gein im nach miner künste guß. under mir der naturen fluß 645. ist, über mir der ware got, unwegelich gar sunder spot. got sam ein ende weget fri, kein dink nicht stürt sin edeli: zu im stet aller geiste ger, 650. pin unde müde sint sie ler; ir ußsatz der ist nicht getan uß formen und matergen ban: uß gottes herzen ist ir satz. des himmelriches freuden schatz, 655. welch geist den nicht beschouwet dort, des klag wirt endelos gehort. ouch ist das von der lere min, wie das der engel achte sin, die alle speren wegn in tat. 660. recht sam ein end wegt gottes rat, von dem man eigentlichen spricht: got ist und anders worte nicht. Nimant kunst mak geleren min, er müße dann durchlüchtet sin 665. von gottes geiste sunder wan. des mag ich in den kronen stan der maget und der mutter klar, der genzlich dint der engel schar.» Gelouben sunder zwifels art hie lert Theologia zart. Darnach Theologia quam. 670. mit siben hornen stunt ein lam an irer brust, sie sprach: «min list künt, wie das got drifaldik ist, eins wesens und personen dri. mer, himmel, engel, erde fri 675. der selb in sines wortes ruf, die creature ganz geschuf. und wie sin wort zu fleische wart (und spilt sich nie von gottes art) in ires reinen herzen ror, 680. der meit, die küscher vil dann vor bleip nach gebürt und bliben muß: da dempfte got naturen fluß. wie gottes kint naturen zins gap, wie das krüze hilt der flins, 685. daran das kint gezwicket wart: ein stram uß sines herzen schart mit überswenken ünden quam: davon sich reiß der helle tam. das kint den echter sust ersleich, 690. durch bruch der von dem himmel weich: der sich da muste binden lan, der falles strik uß bruche span. sin giftik dampf hett uns ertot, wer an das krüze nicht gelot 695. der meide kint und gottes wort: sich keiser, das han ich gelart, und wie der leuwe von Juda sin totes welf erweckte da: wie Jonas in dem fische was, 700. dri tage ganz und doch genas: sust rette er sin wares kint von grimmes todes bunde sint wie gottes kint die cristenheit un kleit mit siben heilikeit; 705. und wie der win wirt gottes blut; das brot in fleisch sin wandel tut: wer daran findet zwifels funt, des fal hat endelosen grunt. wie got zu richten kummen wirt: 710. welch man der regel dann enpirt und ist versumt in rechtes schul, der wirt in Flegetontis pful gesult mit manchen plagen hart, im helfe dann die maget zart, 715. von der ich ie getichtet han. des mag ich in der kronen stan, wan adelar, leuw unde lam von einem worte sloß ir wamm.» Hie fragt der keiser sinen rat, sint er gehort die künste hat. Der keiser gink in einen rat. 720. er sprach: «so wise red ir hat gehöret noch erfreischet nie, als uns die meide künden hie: in sitten ist ir wisheit groß. der fremden sinne bin ich bloß, 725. das ich von grunde müg verstan, was die und die gesaget han. darum so habt zu rate pflicht, das icht min urteil und gericht gestraft von der naturen wirt, 730. sint das sie keiner witz enpirt. mir tut min warer sin bekant: sie hat Natura her gesant, das sie erfar mins sinnes rat, (sint mich ir ticht gebuwet hat) 735. ab ich der eren wirdik si: darum mir rat, ir fürsten fri. ab ich das urteil fünde nicht, so wurd geswechet min gericht: was wisheit möcht ich dann gehan, 740. könd ich nicht wibes red vorstan. daruf ir sult gedenken all, und lert mich, wie ich teilen sal, welch undr in süll die wirde han, sint das es an mich ist gelan. 745. das widersag ich in zuhant und send sie in naturen lant, das sie die maget kröne rich, ab ich das urteil finde glich.» Der rat zu teilen weret sich das urteil vor dem keiser rich. Der rat der sprach: «du bist der bunt, 750. ein spigel, zirkel, lingen funt, nach dem sich rat, frid, ere mißt, sint du ein brunn des adels bist. uß dir ouch alles adel sprüßt: das fürbaß die nature güßt 755. in künge, fürsten, ritterschaft: irs adels stam din adel saft. du geben salt, nicht nemen rat, sint dich got und Natura hat gebut der werlde höchstes dink: 760. des sal din sin sin sam ein rink, der aller sin gar ummefar und menschen sinne gebe nar. darum es wer ein tummer sin, sestu uß fremdes sinnes zinn. 765. künk ane sin gelichet ist dem blinden, den eins hundes list muß leiten adr ein junges kint ader ein stap, der selb ist blint» sust werte sich der wise rat: 770. das in vernunst geheißen hat. Den meister dises buches fragt der keiser: der sich sust entsagt: Der keiser sprach: «von Mögelin Heinrich, was dunket dich gesin? welch undr in hab die wirdikeit?» er sprach: «min sin zu enge schreit, 775. das er die wisheit nie erlif. din wirde hoch, breit unde tif die sal von schulden das verstan, welch undr in sal die wirde han.» er sprach: «du salt nicht ledik sin: 780. ich wil vernunst nu hören din.» der ersten wold er gen den sik: da winkt im sines herzen blik, das wird und er und lobes art der letzten von dem keiser wart. 785. idoch der andern wirdikeit gebot des keisers nicht versneit: er liß sie in der kronen stan, doch musten sie zu hinderst gan. Hie teilt der ware keiser rich das urteil nach der warheit glich. Der keiser sprach: «sint das min rat 790. mir rates stür versaget hat, so muß ich nach dem besten sin das urteil selber teilen hin.» er sprach: «mich dunkt: die erste meit von stören und geberen seit, 795. und wozu hat nature pflicht, daruf sie buwet ir geticht; die letzte, wer des hersche gar und ouch naturell gebe nar. die ander meit die nutzet wort, 800. und teil der red sie hat gelart. eins worts sie hat vergeßen doch, (damit die letzt ir gibet schach) das in der meit zu fleische wart und spilt sich nie von gottes art. 805. die dritte, die die slangen treit, der trigen manchen hat verleit, das er des lammes gar vergaß, das uf der letzten brüste saß. die virde sechzik farben setzt, 810. damit sie blümet und veretzt, was rostes in dem tichte lak: die letzte, wie des himmels slak vertreip und blumte gottes blut, das durch sins herzen pforten wut. 815. bereit uf zal die fünfte was. sie zalte loup und ouch das gras, des himmels stern und meres griß: die letzte, wie der künk im liß slan wunden durch uns ane zal, 820. damit er stiß den fluch zutal. die sechste aller maße pflit: wie tif, wie hoch, wie breit, wie wit der himmel, mer und erde si: die letzte, wie der künik fri 825. sich meßen liß uf einen schrank, damit er unser not verdrank. die sibnde meit die wirket schon in quinten, quarten manchen don, wie uf die lingen und zutal 830. ein iglich note klimmen sal: eins dones sie doch konde nicht, den an dem krüze hat geticht der meide kint und gottes wort und uns die letzte hat gelart. 835. die achte lert der sterne gank und wie die zirkel haben schrank, wie die planeten sin gesipt: die letzte, wer die stern gestipt hab in des himmelriches gral 840. und mak sie rißen hin zutal. der nünden kunst ist hoher list: sie heilet, was zu heilen ist; wo todes blik das tir erspet, das sie gar ungesalbet let: 845. die letzte von dem arzte seit, des kraft dem toten leben treit. die zende silber machen kan, golt, farben; doch ich selden han gesen der selben kinder rich: 850. die letzte zu dem schatze glich des himmels füret mit der hant, den man nie ane trüwe fant. die eilften lobt ich immer me: nu dunkt mich, wie ir tichten ste 855. swerlich gein dem gelouben min: sie lert mich, wie acht engel sin: die letzte engel ane zal setzet: der ich geleuben sal. nie falschen spruch ich in ir fant: 860. darum üch allen si bekant, das sie die wirde sülle han.» das urteil fürsten, ritter, man da lobten und die wisheit groß, die uß des keisers herzen sproß. Der keiser nach dem besten sin Naturen sent die meide hin. 865. Da sust das recht geteilet was, vernunst der keiser nicht vergaß: er gap den meiden gabe rich und sprach: «ir sullet faren glich von mir in der Naturen lant, 870. und tut der frouwen min bekant, was ich üch hie geteilet han. und mak das urteil da bestan, so bit sie, das sie kröne die, der ich die wirde reichte hie, 875. das ir die andern undertan sint. so wil ich üch einen man ouch geben uß dem rate min: der selb sal üwer fürer sin. er weiß wol der Naturen lant: 880. der ritter Sitte ist genant. und folgt ir sinem spore glich, so mugt ir faren sicherlich. wann ir kumt in Naturen stat, der ritter da ein swester hat, 885. die ist gar rich und heißet Zucht: bi der ir findet all genucht. da selbest sult ir abestan, und bit die frouwen mit üch gan zu der Natur: das ist min rat. 890. wo Sitte, Zucht nicht mit üch gat, ir blibt versumet gar der mer, wo ir der zweier blibet ler. Natura spricht, es si ein ban, wer kunst wil ane sitten han; 895. kunst ane zucht sie achtet nicht, wann sie hat alle kunst geticht.» Hie urloub unde gabe glich den meiden gap der keiser rich. Urloup die meide namen da. des Sitten spor sie furen na und quamen in das schönste lant, 900. das blik vernünst nie schöners fant. in des landes mittel lak ein burk. der ersten pforten pflak ein rise groß und ungehür: der liß uß sinem halse für 905. in grimm übr alle berge gen: die meid in forchten bliben sten und torsten zu der pforten nicht, das tor gein norden was gericht. sie gingen fürbaß an ein tor: 910. da stunt ein ander rise vor, der was durchsichtik unde groß; ein stram im durch sin kele floß, der was gar tif, breit unde lank. (gein westen was des tores gank.) 915. sin stimme was gar fientlich. die meid begunden fürchten sich und ilten an das dritte tor: da stund ein ander rise vor, der was den meiden gar unkunt: 920. zwelf wind er liß durch sinen munt, das sie dar mochten kummen nicht. das tor gein süden was gericht. sie gingen an das virde tor; da lak in grüner wete vor 925. ein rise stark und lobelich, mit boumen groß er dakte sich. das virde tor gein osten gink: der selbe rise des verhink, das sie der bürge neten baß. 930. da durch die pforten kommen was der Sitte mit der meide schar, die Zucht sie funden offenbar, als in der keiser rich verjach, die Zucht enpfink sie unde sprach: 935. «was bracht üch edeln frouwen her?» die frouwen seiten ir die mer, was irs gescheftes sache was. die frouwe tugnde nicht vergaß: sie sprach: «so wil ich bi üch sin: 940. ir nemet keinen schaden min. quemt ir zu der Naturen dar an mich, ir blibt versumet gar.» Hie mit den künsten gink die Zucht vor die Natur in richer frucht. Die Zucht gink mit den meiden da. da sie dem huse quamen na, 945. darinne die Nature saß, ein anger vor dem huse was: daruf gepflanzet mannik boum. frucht leite der Naturen zoum durch ire sproßen meisterlich; 950. der ramen este kleiten sich mit mancher hande loube da. die blumen blank, die brun, die bla, und alles, das da farben heißt, damit der anger was bereißt, 955. die kurz, die lank, die lenger was, als sie Naturen linge maß. des touwes sprengel durch sie gink: sin saf der blumen kele fink. was man von zirde mochte sagn, 960. das sach man gar den anger tragn. da was ouch keiner hande we. volsprechen möcht ich nimmerme, was salden in dem huse was, darinne die Nature saß: 965. nie sinnes rechenunge fant, ab es vergolden alle lant möchten der werlt. manch edel stein in der Naturen kron erschein, das sich uß lichte schapfte licht. 970. in irem huse nimant sicht. man hort ouch aller stimmen schal: die uf, so swank sich die zutal. dem hören wart da spise rich gegeben von den stimmen glich: 975. gar übersüße was ir sank, das nie kein mensche wart so krank, das süche möchte twingen da, wann es der freude queme na. Hie künt des buches meister balt, wie die Nature wer gestalt. Ein maget in dem trone saß, 980. der aneblik so schone was, das mensche nie so schone wart: uß ir floß aller schonde art. von siben sternen was ir kron: rich in der sterne mittel schon 985. der crisolt und der adamas gar meisterlich gefelzet was, ouch in dem kranze sunder wan der rubin und topasion, der saffir und manch edel stein. 990. ir har in bruner farb erschein, ir löckel reid und dabi lank, darin sich reifte goldes blank, ir bran geornt in rechter far, ir ougen sam die sterne klar; 995. wohin die meit warf iren blik, da wart verschanzet sorgen strik. ir nase nach der lingen art vorn ufgewelbet sunder schart; der edlen formen münze, stunt 1000. ir wengel nach des zirkels funt; ir munt in röte stunt erhabn. des leben hink in zwifels klobn, vor freud ab er genese dann, wann sie in liplich blikte an. 1005. ir kinn, ir hals blank und ir kel, ir arme waren sinewel, ir finger lank und nicht zu klein: ein zeptrum truk die maget rein. ir brüste uf das herze glich 1010. gesmücket stunden lobelich. mir zimet nicht zu sagen das, wie das sie were niderbaß. ir gurt von golde was ein snur: des sinnes grabestickel fur 1015. uf iren heften hin und dar: was schone heißt, das was da gar: lib, adel, lust, freud ane zil. in ires mantels falden vil tir, fische, mensche wonte da. 1020. der gründe was ir feile na, wann anefank die grün bedüt: uß dingen dink Natura züt und ist des wegens anefank. ouch stunt uf irer achsel schrank 1025. die sunne und der mande klar und luchten ir zu dinste dar. was sinnes pinsel künste treit, die was gar an den tron geleit. Hie ruft die künste die Natur liplichen in irs trones mur. Da sie der meide wart gewar, 1030. sie winkt in unde rif in dar und sprach: «das dütet fremde mer, das ir sit alle kommen her.» die meide sprachen züchtiklich: «uns hat gesant der keiser rich 1035. zu dir, das du die meit gemeit salt krönen, die das lemlin treit an irer brust mit siben horn, vor uns er sie hat ußerkorn und hiß uns fürbaß dinen ir. 1040. darum wir kommen sint zu dir.» sie sprach: «darzu ich keine pflicht alleine mak gehaben nicht, es queme dann der tugnde schar und sie mir hülfen krönen gar.» Hie sendet die Nature gar ir boten nach der tugnde schar. 1045. Natura sante da zuhant ir boten in der tugnde lant und liß den tugnden künden gar, wie das Theologia dar wer kommen mit den künsten al, 1050. die man von schulden krönen sal, und hiß sie kummen durch gebot die tugnde sprachen sunder spot: «durch kein gebot wir kummen dar: wir sint von der Naturen gar 1055. gescheiden: got uns hat geticht, darum sie mak gebiten nicht. Natura gänzlich ist gewert, wes sie zu bete von uns gert: ab sie wil dinst von schulden han, 1060. von uns sie wird gesumt daran. das sult ir widersagen ir, das sust geantwurt haben wir.» die boten das vernamen sidr und ilten zu Naturen widr 1065. und seiten ir die mere glich. des wundert sich Natura rich und sprach: «nu faret wider dar und bit die tugentlichen schar, das sie her kummen uf den ban, 1070. ab es min ticht bewisen kan, das sie und ouch ir wesen gar sint kommen uß mins herzen mar, das sie zu minem dinste pflicht nu haben nach der ersten schicht. 1075. wo ich das nicht bewisen kan, ich sal sie dinstes wol erlan. got dinte mir und sante zins hoch uß des himmelriches flins: des wundert ser die sinne min, 1080. von wem das sie gefriet sin. darum so bit sie kummen her, das wir volenden dise mer: wann ich gekrön die maget rich, gein in so wil ich meisterlich 1085. bewisen vor den künsten dann, das sie ir wesen von mir han.» Hie sent ir boten wider dar Natura nach der tugnde schar. Die boten furen wider dar. da sie die tugnde funden gar, sie sprachen: «die Nature bit, 1090. das üwer herze ste gefrit, und wirdet üch zu kummen dar, das man die maget kröne klar, wann das geschit, so wil sie dann gein üch bewisen, ab sie kan, 1095. das ir von schult gebunden sit. bewist ir, wer üch hab gefrit, so gert sie keines dinstes nicht.» die tugnde sprachen in der schicht: «wir faren dar gar williklich.» 1100. ein wagen wart gar lobelich bereit: da gab die Warheit dar die dichsel, Kraft die achse zwar, das erste rat Gerechtikeit, das ander Frid, Barmherzikeit 1105. das dritt, so gap die Milde dar das virde rat von golde klar; die Sune bant den wagen glich, so gap die Zucht die decke rich; fünf ros Vernunst gap in den wagn: 1110. richlich man sach die meide zogn. Hie seit von der Vernünste pfert das buch, wer des zu hören gert. Das erste ros das hiß das Sen: rot was sin farbe, hör ich jen. das selb wart nimmer loufes sat: es manchen hie verfüret hat, 1115. das er reit in der helle grunt: es liß in da und bleip gesunt. das selbe ros vil tugnde hat; kein mensche siner füße pfat 1120. noch sinen trit erkisen kan: das gras es trit uf keiner ban. ouch es gar snelles loufes pflak, man dorft im geben keinen slak: wann die Vernunst die geisel swank, 1125. zuhant es in dem silen sprank. an keinem berg es widerstiß. Das ander pfert das Hören hiß. wer dem den zügel laßen wil, wann es leuft uf das krumme zil, es treit in in der helle gruft 1130. und leufet wider in die luft. vil na es sam das erste was, doch es sin sprünge treger maß. das selbe ros ouch snelle lif: kein bruch der luft wart nie so tif, 1135. es sprank darüber ane fal; zu berg es lif und ouch zu tal. doch nimant rechte merkt sin pfat, wo es den fuß gesetzet hat. das ros trank keines wages fliß, 1140. wan der sich uß den wolken liß: sin futer was der lüfte slak, das pfert nicht ander weide pflak. - Das dritte ros was stete gut; doch wer im liß den sinen mut, 1145. es truk in hin in kurzer zit, da Lucifer gefangen lit. wann es den stram der lüfte zouch, vil manchen underscheit es rouch der dinge, der es nie gesach. 1150. wie das sin hufe waren flach, doch man sin lützel merkte dann, wann es sin spise wolde han: sin schaden keine wise melt, ouch etzt es nicht der lüfte felt; 1155. sin farbe glich was in der schicht, als wann sich luft in nebel flicht das Richen hiß das selbe pfert. Das vird was großes geldes wert. das ros die Behim lobten ouch: 1160. gar ser es an dem naßen zouch; in fraße pflag es sprünge vil: wer im den zügel laßen wil und es zu halden nicht gerucht, dem ist von gotte wol verflucht. 1165. süß unde sur es smecken kan, und hett es die vernunst gelan, es wer gefallen in den grunt. Des fünften namen tu ich kunt. das selbe große sterke hat: 1170. wer im des willen sin gestat, es treit in oft in kummer groß, das er blibt aller salden bloß. doch lif es in der banen recht: wo das der wek was holsterecht 1175. ader die stige waren scharf, das ros sich uß der banen warf. wol unde we es prüfen kan. und hett das selbe ros getan. die andern pfert in keiner schicht 1180. den wagn gezogen hetten nicht. das selbe ros das Fülen hiß. Natur es nimmer irren liß: darum es was gespannen vor. sie quamen an das erste tor: 1185. davor so lak ein rise groß, der für uß sinem halse schoß. Vernunst die tugnde fragten all, was wunders das bedüten sal. Vernunst Bericht der tugnde schar des huses und der wunder gar. Vernunst die sprach: «der man bedüt 1190. (dem flamm uß sinem halse flüt) das für: von sines zirkels maß ist aller elementen sloß. sin schibe nimmer stille stet, sin fluß uß der naturen get. 1195. welch elemente sich verirt in sinen kreiß, es flammen wirt». sie lißen da die pforten stan und furen, da ein wißer man dort stunt, der gar durchsichtik was, 1200. und fragten: «was bedütet das?» Vernunst die sprach: «üch künt min list: der wiße man das waßer ist: das ist durchsichtik unde klar. die erd es ummereifet gar 1205. und muß ouch in dem zirkel stan, darin es hiß Natura gan: den kreiß es nimmer übertritt, manch wunder ist darin gesmit uf der naturen aneboß. 1210. des menschen sin ist des zu bloß, das er den underscheit verstan un müge, den die wunder han». dabi die selbe rede bleip. Vernunst den wagen fürbaß treip 1215. und furt sie an das dritte tor. da stund in blauwer wete vor ein man, der fientlichen blis: zwelf wind er uß dem munde liß, den hagel, sne, schur unde regn. 1220. die meid begunden aber fregn: «was düt des richen wunders guft?» Vernunst die sprach: «es ist die luft. den wak in ires flügels huf gein berg in kraft sie füret uf, 1225. und in der flügel münze sur sie wellet hagel unde schur: wann sie verstößet ir gefidr, so senkt sie die zu tale widr». sie furen an das virde tor. 1230. da lak in grüner wete vor ein man der ewiklichen slif. manch tir uf sinem halse lif und bark sich in des mannes wat, die im natur gespunnen hat. 1235. recht sam der kle, loup unde gras des mannes kleit geferbet was. die meide fragten alle glich: «was muß das wunder düten rich?» Vernunst die sprach: «üch seit min list: 1240. der man, des slafen ewik ist, das ist die erd, wann uf ir nu die tir gemeinlich suchen ru. der salamander in dem für nicht lebet sunder erden stür, 1245. noch in der luft gamalion, und sold der fisch die erde lan, tar er nicht von ir nemen nar, des wags er wer versumet gar. sie ist der elementen grunt, 1250. ir zukunft wart Naturen kunt». Hie stet uf die Nature klar und get nu gein der tugnde schar. Natura gein den meiden gink und sie gar williklich enpfink und furt sie in irs sales tron. der was so rich und ouch so schon: 1255. was man von schond ie vor gelas, recht sam ein nacht es gein im was. igliche sitzen an ir stat Natura züchtiklichen bat. ouch hatte got uf ir gewant 1260. geschriben mit sin selbes hant, das man offentlichen las, wie die und die genennet was. die künste saßen sunderlich und ouch die tugnde lobelich. 1265. zu mittelst in der selben schul erhaben stunt ein richer stul, daruf Theologia saß. die tugnde sprachen sunder haß, gemeinlich mit der künste pflicht: 1270. «die meit wir sullen krönen nicht, sie künd uns danne, wie das got drifaldik sie an allen spot, wie er die menscheit an sich nam von einer meid, als im gezam, 1275. und wie das sunder falschen rum bleip unversert der magetum, darin das kint geboren wart, gefleischet got in menschen art.» Theologia künt, wie das got drilich ist und ewik was. Theologia das vernam, 1280. das sust nach irer lere klam der tugend und der künste schar. sie sprach: «un wil ich offenbar üch künden, wie das mak gestan, das dri person ein wesen han, 1285. und wie das wort fleisch an sich nam, das uß der drier samen quam, die alles fleisches waren fri und fleischten doch ir edeli. dri zeichen die nature git, 1290. die doch got sehepfer übertrit: kern, schale mit des ramen soum, die dri die sachen einen boum, doch ir nature das nicht irt, uß in wie sich die frucht gebirt: 1295. die frucht die let gar ane schranz kern, schale, stam des boumes ganz, wie sie uß irem samen wut: ir milde der naturen tut ein ander forme sunder wan. 1300. sust von dem kind ir sult verstan, wie es die reine meit gebar und uß ir brüsten reichte nar: von einem worte sunder spot es fleischte sich und bleip doch got. 1305. gots wesen davon keinen schart leit, wie der sun gefleischet wart. und fint ir daran zwifels funt, so falt ir ewik ane grunt. Das ander zeichen si üch das, 1310. das irs gemerken müget baß: für, flamm und ouch sins zunders art, die dri ein spere hat gespart, dadurch ein licht Natura richt: sust menschen art in got sich flicht. 1315. das für gar unverseret stat, wie luft in sine schiben gat, sie blibet für: so sich das fleisch besloß in dri personen meisch, der wesen doch unschendik ist, 1320. der vater hat in keiner frist gegangen vor dem kinde sin: wo für, da flamm und ouch der schin. Ouch zeichen der naturen ist, set, wie des hohen gottes list 1325. und die natur geordnet han, das dri in einer sele stan und alle dri eins wesens sin. nu merket diese lere min: vernunst, gedechtniss unde will, 1330. gericht uf eines wesens zil, wo die die sele solde lan, kein wesen möchte sie gehan: eins wesens sint die selben dri unspeldik mit der sele fri: 1335. sie sint die sel, die sel ist sie, die sich gescheiden möchten nie. sust dri personen gottes sint verstrikt in eines wesens lint: unscheidelich ist ir natur 1340. geflochten in des herzen mur der meit von eines wortes hant, das von dem himmel wart gesant. uß gott, bi gott und got es was, das kint, des hie die meit genas. 1345. in klag muß ewiklichen stan sin ruf, der zwifel fint daran.» Natura, künst und tugnde rich dem ticht hie nigen alle glich. Die tugend und der künste schar des tichtes forme nigen gar und die Natur, und gink zuhant, 1350. da sie die richsten kronen fant, die alle schond gar übertrit, wann sie got selber hat gesmit, und kronte da die maget rich, zwelf sternen in der kronen glich 1355. da stunden; ewik war ir schin. hie sal des buches ende sin. Das ander buch das heb ich an, wie tugent in dem mittet stan sal und ußslißen nimmer das, was wisheit in dem zirkel maß. Hie in des buches anefan zu disputiren hebet an Natura mit den tugnden gar 1360. und wil bewisen offenbar, das sie ir wesen uß ir han, und hebet sust zu reden an: «welch dink sich uß dem andern sacht, des wirdikeit von nöten swacht 1365. gein dem das es gesachet hat. die gröste red bewiset stat, die minner Aristotiles in Ethicorum setzet des. er spricht: ‹uß werke tugent wirt, 1370. des wirken die natur gebirt; uf erden nie kein werk geschach, sin were jo natur ein sach›. die ander rede scharf und sur die wachet ouch vor die natur: 1375. welch dink das ander gwinnen kan fri, unde fri es mak gelan, das dink mer wirde hat dann das, das von im sust gewunnen was. die gröste red bewiset ist, 1380. die minner setzt des meisters list in Ethicorum unde spricht: ‹das laster und der tugnde ticht in willekor des menschen stan: er mak sie wirken unde lan. 1385. in klarheit der naturen stet oft dink das beider nicht beget›.» die dritte rede stark und scharf der pinsel der Natur entwarf. sie sprach: «nu merkt die rede klar, 1390. damit ich üch besliße gar: selbstendikeit, wir wißen all. mer wirde hat wann der zufal. her Heinrich möchte wol gesten, se man die röte von im gen; 1395. ab er ouch swerze were ler, idoch er wol ein mensche wer.» Natura mit der rede lint verstricken wil der tugnde kint, das sie ir wesen uß ir han 1400. und ir durch schult die wirde lan. Uns hie bewist der tugend art, das uß ir die nature wart. Gein der Naturen reden hie die tugend und bewisen, wie sie der Naturen edler sin, und tun das mit der rede schin: 1405. «was da volbrengt ein ander dink, das selb ist sines adels rink. Natur volbracht von tugent wart: des höher ist der tugend art. kunt ist die gröste rede des, 1410. die minner Aristotiles in Ethicorum hat geticht, wann er da offentlichen spricht: ‹wer tugent hat, der wirt volbracht und ouch sin werk von tugnde macht›. 1415. die ander red sich sust gebirt: durch was ein dink gelobet wirt und im ouch wird und ere git, naturen art es übertrit. die tugent ere wirken kan: 1420. des sal sie vor Naturen stan. die gröste red ist offenbar, die minner macht der meister war in Ethicorum, da er spricht: ‹man lobt uns von naturen nicht, 1425. sunder durch tugent lobes art dem menschen hie gegeben wart.› die dritte red ist wiser frucht: wer von naturen tugent, zucht, so das ir influß gebe die, 1430. so wer nimant zu loben hie. warumme sold ich loben den, ab tugent wurd von im gesen und in doch twüng natur dazu? damit ich wil beslißen nu, 1435. das tugnde fluß von gotte ist und nicht uß der Naturen list.» Theologia wirt gelan der krik von beider sit getan. Der krik von beider sit getan Theologia wart gelan: wem sie nach rechtes tichtes funt 1440. die wirde reichte da zustunt, der sold sie haben ewiklich. sie sprach: «nu wil ich sunderlich erforschen, wes die tugnde pflegn. darnach so reich ich gottes segn 1445. Naturen ad der tugnde schar, darnach ir tichten machet war.» sie sprach: «nu sag an sunder list, du Wisheit, was din tichten ist, sint das du salt die erste sin. 1450. so laß das werk mich hören din. das ich von grunde müg verstan, wem ich die wirde sülle lan.» Die Wisheit kündet, wie ir kint in sünde nie gefallen sint. Die Wisheit sprach: «ich künt min ticht: in vir sich alle tugent flicht, 1455. in mich und in gerechtikeit, in sterk und ouch in meßikeit, uß den sich gottes forcht gebar, die allem heile gibet nar: dabi man merken sal min kint. 1460. die sunder gottes forchte sint, den ist verborgen mine ban. zu gotte nimant kummen kan, der miner stüre nicht enhat ich ummereifet han das rat 1465. des himmels, da got alle dink liß flißen durch sins herzen rink. min schond übr alle himmel hort; ich wach an gottes herzen pfort, das nimant kummen mak darin, 1470. er brenge dann das zeichen min, gedechtniss, und bedenke das, wie nie min snur uf schaden maß. vernunst und die vorsichtikeit zu wat ich minen kinden sneit: 1475. welch man der selben wat enpirt, der ist mins weges gar verirt. er muß von gotte selik sin, der finden sal die stige min: man get darinne sunder we. 1480. mich kante nicht von Ninive der künk: des leit er kummer sint: er wart gelichet einem rint. wer mich verlet, der let sin heil, ab mich der tore findet feil, 1485. gar selden kouft er min geticht: min süße frucht im smecket nicht, süß und der süre underscheit dem lon, dem andern pin bereit: sust arger wille nicht verstan 1490. die wege siner salden kan in dingen, die zu tune sint: vernunst der arge wille blint des menschen nu gemachet hat. kint, wiltu hören minen rat? 1495. mins wisen herzen linge maß das hus, e es gebuwet was: sust sal dins herzen ouge sen das ende, e das si geschen die tat, und halt in eren das, 1500. das ursprink dines lebens was. bis in gewalt dem armen slecht; gip dim genoß das selbe recht, das du dir selber wilt geschen; din ougen uf die armen bren 1505. laß und in falschem wandel nicht durch gabe felsche gots gericht. du fürste, salt ein spigel sin in tat den underseßen din, das sie beschouwen sich in dir: 1510. zu warheit hab din rede gir; laß nicht din spotten halden die, der rat din ere suchet hie. dir, fürste, zimet wise tat: recht als dich got erhaben hat 1515. übr ander die genoßen din. also vil saltu wiser sin.» Gerechtikeit hie saget das, wie nie ir snur uf schaden maß. Theologia da began Gerechtikeit zu fragen an, waruf ir grunt gebuwet wer, 1520. das sie ir kunte dise mer. sie sprach: «ich und die Wisheit bin gericht uf eines endes sin, idoch wir haben underscheit: ir tat ist bi der redlichkeit, 1525. so ist min werk zu richten das, was krump der arge wille maß. ich wache durch gemeines gut; den bruch min recht verdammen tut: iglichem laß ich werden das, 1530. was im sin werk zu lone maß. die fürsten müßen vor mir stan gebunden sam der ackerman; dem richen und dem armen glich min wage mißet stetiklich. 1535. wer mine stige nicht enricht, der mak zu gotte kummen nicht. ich hüte gottes herzen pfort: scharf ist mins rütelinges ort, darin die hochfart sich versneit, 1540. das sie muß immer tragen leit: min hant sie und ir engel all treip von dem himmel hin zutal. da sie uf bruch ir wille truk. ouch uß dem paradis ich sluk 1545. den ersten menschen, da er brach den apfel von des boumes dach. der bruch der widerspenikeit muß von mir immer tragen leit. her Abel rif mich und sin blut: 1550. ein stral durch sinen morder wut: im wart gemeßen als er maß. gerechter lon ich nie vorgaß: ich gap es jo in milde dar und schankte pin der argen schar. 1555. der arm in not sich tröstet min: Susanna sal ein zeichen sin: geurteilt zu des todes rost, ir unschult von mir wart erlost. an mich mak nimant werden fri: 1560. ab mensche wol ein fürste si und er nicht heldet gottes recht, so ist er jo der sünden knecht. des keisers ere das bin ich: wo das die künge laßen mich, 1565. ir rich sich neiget hin zutal: künk Saul das ouch beweren sal und uß Egipten Pharao. darum, ir künge, richtet so, das ich üch in dem toten mer 1570. icht sterben dürfe sunder wer. des herzen influß in gelit sich güßet und in leben git: sust sult ir fürsten sin ein bach, daruß ein recht man flißen sach, 1575. davon getrenket werden die, die üch zu dinste wachen hie. des vaters werk, ich höre jen, das kint verblent und machet sen; der apfel nach dem ramen smekt, 1580. als in der fluß naturen wekt.» Uns kündet hie die Sterke das, was ires wirkens tugent was. Theologia fragte fort, da sie ersach die Sterke dort: «waruf gebuwet ist din grunt? das tu mir hie durch libe kunt.» 1585. sie sprach: «die Sterk bin ich genant; in nöten sam ein elefant ich ste und trage alle last, ich bin recht sam ein warer mast, der uß des wilden meres gil 1590. den kocken füret und den kil. des frevels und der forchte, sich, der zweier mittel, das bin ich: mich reißt zutal kein übermut, ouch mich kein forchte fallen tut. 1595. unwegelich recht sam ein turm, ich ste: von wanne das der sturm des lasters flügt mit winde scharf, min dach er selden niederwarf. kein tugent ist die türstikeit 1600. (die sunder zwifel brenget leit) noch forchte, wer vermidet das, von schulden was zu tune was: er mak kein wiser man gesin, der nicht das wirken libet min. 1605. ich bin ein ling und ouch ein maß, die rechtem werke gibet saß. der heißet stark, der uf dem wal die finde stößet hin zutal, ab er gerechte sache fürt 1610. und in nicht zwifels forchte rürt. an mich mak nimant werden stark. ich floß uß gottes herzen sark und kreftik in dem mittel gink, gots kint ouch in dem mittel hink 1615. und in des schrankes mittel starp, da er uns nach genaden warp: da tat er miner tugent schin, wie das ich sal ein mittel sin. mich laster zwei bezünet han, 1620. die turst und ouch der forchte schrann: in irem mittel ist min gank. der zweier uber ist so lank getemmet von der fürsten schar, das ich nu bin verdempfet gar. 1625. ir fürsten, hört die lere min: ir sult ein bild der sterke sin. nicht tummer turst, das ist min rat. gedenkt, wie das her Goliat von tummer turst betrogen ist 1630. (ich felze miner sterke list): gar sunder stür die türstikeit in liß, da in min <kint> versneit. uf üwer man nicht habet turst, so das ir lidet keinen durst 1635. zu nemen in wip ader kint. gedenket, das sie menschen sint und üch bereit zu dinste stan. den schafen sult ir wollen lan; welch her den hunden nimt ir brot, 1640. die jagen nicht durch hungers not: sal er den beren eine slan, davon er schaden mak enpfan. der starke freise fürchtet nicht, wo recht sin sache stet gericht.» Die Meßikeit nu kündet, wie ir kint in sünd gefilen nie. 1645. Darnach Theologia sprach, da sie die Meßikeit ersach: «sag, waruf ist gebut din grunt? das tu mir durch min libe kunt.» sie sprach: «tat aller tugent ist 1650. gevirt von gottes hoher list: die erste tat ist redelich, die ander glich, die dritte sich uf rechte sterke wegen wil, die virde wart der maße zil. 1655. die redlichkeit der Wisheit gip, glich ist Gerechtikeit gesipp, die kraft du salt der Sterke gebn, so sal ich meßiklichen lebn. ich gere keines dinges nicht, 1660. das elich orden widerspricht. vir eigenkeit min tugent hat: die küscheit und der schemde rat die hald ich glich zu aller zit: des ist min ere worden wit. 1665. die spis ich neme nach der maß: dem slund ich nicht den zügel laß und teugen williklichen mich, wo übermut zuplinset sich, mag ichs mit eren ummegan: 1670. in sulcher tat min tugnde stan. dabi man prüfen sal min kint, die wirker sulcher tugent sint. min küscheit wonet bi der tat, die schemde bi geberden stat. 1675. der eman rechter küsche pflit, der fluß naturen let in zit und ouch in ziten dempfet den, als es wirt redelich gesen, wie, wanne, wo, warumme das 1680. die küscheit in dem zirkel maß. zu gott er selden kummen mak, der miner werke nie gepflak. in gottes herz ich wart geticht: darum, ir fürsten, habet pflicht 1685. zu mir und leret mine ban: ir sullet er in tugend han. snit an üch mine meßikeit, sint das unmaße schaden treit, und habt zu keinem tranke fliß: 1690. set, wie das waßer dempfet is, sust dempfet ouch die trunkenheit: ir bach gegellet waßer treit. du fürste, salt ein forme sin, in der sich münze tugnde schin; 1695. drück in din herze wisen rat: er ane tugent nimant hat. welch mensche miner zucht enpirt, von dem ist selikeit gefirt. die tugent die volbrenget dich, 1700. ab du sie wirkest, sicherlich. der fürste, der nicht tugent hat, recht sam ein blindes ouge stat: es heißt ein oug und doch nicht kan der farben underscheit verstan. 1705. er ist an selikeit verblint, der nicht der tugnde wege fint. darum, ir fürsten und ir man: zucht klimmet uf der tugnde ban.» Hie offent uns die Mildikeit, wie riche frucht ir wirken treit. Theologia darnach sach 1710. die Mild in tugent mannikfach. sie sprach: «was mak din wirken sin? das künde nu der libe min.» die Milde sprach: «ich han geticht lib, adel, er sich in mich flicht, 1715. was diser werlde ere heißt: das hat min zirkel ummekreißt. welch man in rechten trüwen hat gefolget miner tugnde pfat, des ist er sunder falles far 1720. mit lobe rich durchpinselt gar. ich gottes herzen ingesigl bin und des hohen himmels rigl, davor die fürsten müßen stan, die hie min stige han gelan 1725. und werfen sich uf gizikeit: der klag muß immer tragen leit, ich bin der höchsten güte funt: von mir sich libe hat entzunt; ich han ouch oft versünet die, 1730. der nit einander wunte hie. min tugent alles wunder treit: den dritten uß der dri ich sneit und twank den waren adelar an einen schrank in menschen far. 1735. in mir sich alles adel stift, unadel in der kargen trift. der künge buch bewiset hat, wie das min kint in eren stat: hern David von dem hirtentum 1740. ich nam, das er gar sunder rum min werk in steter trüwe treip: davon in künges adel bleip sin sam und ewiklichen stat: min tugent sust gelonet hat 1745. trüw unde zucht: ich blüm ir felt, welch fürste kumt in min gezelt und wirt in miner tat gesen, dem ist von gotte wol geschen, ab er treit eines leuwen mut 1750. und lachet, wann er gabe tut, dabi der milde wirt erkant. got alle dink in milde fant. von bösem herzen was entzogn der milde wirt, das sit man tragn 1755. den argen in der schanden hant: sin gab in laster wirt gewant. des vogels art durch mildikeit dem arn zu dienste stet bereit. dem milden sik die finde lan: 1760. ich glich in gein dem pellican: sin herze der in milde spelt, sin blut der küchel leben helt. alsust der ware milde tut: er trenket in der milde flut 1765. die man und in sin gabe spelt: damit er lant und er behelt. der mild ist sam des leuwen lut, die ire welfer leben tut. sust saltu, fürste, dine man 1770. durch kummer nicht verderben lan. getrüwen gernden, weisen gen du salt durch ere, hör ich jen.» Hie kündet die Demütikeit, warin ir tugent si gekleit. Theologia darnach sprach, da sie Demütikeit ersach: 1775. «waruf gebuwet ist din grunt? das tu mir durch gehorsam kunt.» sie sprach: «ich bin der tugnde ticht; der falschen er ich gere nicht; ich han zu dinste dicke dem 1780. gewachet, der mich liß in schem sten und gar fientlichen sach uf mich in smehen blicken swach. ich lide, was zu liden ist, und darb ouch aller hinderlist 1785. und tu, ab mir nicht were kunt des bösen herzen lasters funt. gewalt gesen ist von mir nie; gefidert gut ich stete fli: welch gut in salden brenget frucht, 1790. daruf geneiget ist min zucht. welch mensche miner zucht enpirt, von dem ist selikeit gefirt. ich bin des höchsten gottes amm: uß sines herzen mild ich klam ; 1795. von mir gehot die maget wart, in der sich fleischte gottes art und liß doch sunder falschen rum an allen schranz den magetum: durch mich sie gottes muter hiß. 1800. min hant den ersten engel stiß gewaldik in der helle tal, darinn er ewik bliben sal: sust ich den menschen nider hie, der minen wek erkante nie. 1805. gewalt wer an mich halden wil, des fal hat endelosen zil. wo ich nicht vor dem menschen ge, zu gott er kummet nimmer me. hern Moises durch mich wart kunt, 1810. wie sich enpflammet und entzunt der himmel, mer und erde hat und alles das darinne stat. got nicht sin wisheit kündet den, die minen stik han übersen. 1815. ich bin die schönste gottes meit, gehorsam durch min herze teit: ie mer sich teugen mine kint, ie mer das sie von gotte sint gewirdet und gehaben uf; 1820. ich heil ouch aller sünden ruf. min kint das get gar sicherlich: darum, ir fürsten, leret mich, man lobet niemant wanne den, von dem hie tugent wirt gesen. 1825. dem vater ware tugent zimt, davon das kint ein zeichen nimt: es wirket, als es wirken sach: das kint sich nach dem vater brach, ir fürsten, veter sit der tugnt, 1830. davon der underseßen jugnt ein zeichen und ein bilde spen: sie wirken, als sie han gesen. ir fürsten, hüt in diser zit, sint ir des Volkes hirten sit, 1835. das glich die rechenunge stet, wann ir vor got gefangen get.» Die Warheit künt irs werkes tum, der irrem wirket richlich frum. Theologia darnach sprach, da sie die Warheit angesach. waruf ir grunt gebuwet wer, 1840. das sie ir kunte diese mer. die Warheit sprach gar sunder list: «min wirken bi den worten ist: die münz ich glich zu aller zit, des ist min lop in eren wit. 1845. in gottes herz ich bin gedrukt. e in der formen wurd verrukt ein wort und sold in bruche sten, e müst der himmel gar vergen und alles das darinne wer. 1850. min wort ist alles wandels ler: sten muß ich in der formen glich, darin mich twank der keiser rich, der in sins waren wortes ruf die creature ganz geschuf, 1855. ich bin sin wort und ouch sin kint: von mir gesat die himmel sint, die stern und ouch der speren kraft; das mer got in mir hat geschaft, die erde, für und ouch die luft, 1860. die engel und der helle gruft. got an mich möchte nicht gesin. des bin ich aller tugnde schrin. min hant der himmel geiste helt, welch mensche das sich von mir spelt 1865. und minen stik verleßet gar, das schert sich von der engel schar. an mich wirt nimant gottes segn: des hat die welt sich gar erwegn. sie temmet miner flüte bach: 1870. des ist min stram nu worden swach. ir nein ist ja, ir ja ist nein: davon ir heil ist worden klein. die lügen, sünden anefank, der sintflut worden ist so lank, 1875. das mensche sterbet sunder wer. sie ist recht sam das lebermer: wer von geschichte kumt darin, der muß da ewiklichen sin. wer von der lügen wirt verwunt, 1880. der wirt vil selden hie gesunt: ir stral ist sam der slangen gift: wo sie des menschen herze trift, vor gott er stirbet sunder spar, wo ich nicht snelle kumme dar. 1885. an mich nicht ere mak gestan: ir edeln fürsten, denkt daran und mit der werlde falschen rum. das wort ein evangelium lat sin, das von üch wirt gehort: 1890. den underseßen hie und dort ir sult der warheit zeichen gebn. die kinder nach dem vater lebn: wie das gewesen ist sin tat, darnach sich helt der kinder rat. 1895. der basiliscus noch sin art dem menschen nie so giftik wart sam falscher rum und lügen funt, davon die sele wirt verwunt und hie des menschen ere gar 1900. sich senket in der schanden mar.» Hie kündet die Barmherzikeit, wie riches lon ir wirken treit. Theologia darnach sprach, da sie Barmherzikeit ersach: «waruf gebuwet ist din grunt? das tu mir durch din wirde kunt.» 1905. sie sprach: «ich gottes tochter bin; uf nicht gebuwet ist min sin, wan das ich widerbrechte das, daran der mensche sich vergaß gein gott und hie gefallen ist 1910. in marter von des tüfels list, min ouge sit den armen an: ab ich in nicht gestüren kan und im gehelfen mak uß not, doch im min wille stüre bot: 1915. ich lide mit im, was er leit, sin not mich oft in jammer treit. der ware got mich gerne sit: min herz im anders nie gerit, wan das er widerbrechte das, 1920. durch bruch das hie versumet was. er folgte mir und an sich sneit von einer meit sins knechtes kleit; darnach min ware tugent twank den heren an des krüzes schrank; 1925. er zu dem sünder trat in not: uns leben koufte da sin tot. min tugent das gewirket hat, das mensche fri des bundes stat. ich mak wol sin der tugnde berk: 1930. die sichen trösten ist min werk, und die in not gefangen sin, den tu ich warer hülfe schin. in durst, in hunger und in not dem armen ich min stüre bot: 1935. von mir er stetlich ist gewert, was er durch gottes lib begert. übr alle gottes werk ich bin: welch mensche zu mir liben sin treit, das enmak verderben nicht: 1940. im ist genade vorgeticht. hern David salbte mine hant, an im da ich min trüwe fant: barmherzikeit die sach er gern: des lüchtet sam der morgenstern 1945. übr alle zit ewik sin kron vor gottes aneblicke schon. darum, ir fürsten, wirket mich: üch wirt von gotte sicherlich barmherziklichen dort getan, 1950. wann üch der werlde rich verlan. den armen den betrübet nicht und habt zu steter güte pflicht. üch zimet wol, ir fürsten rich, das ir in allen dingen glich 1955. der werld ein wares zeichen sit, so habt ir lop in eren wit. das kint sich nach dem vater richt, als im sin werk hat vorgeticht; der vater oft das kint verblent, 1960. ein bilde falsch wo er im sent. zu gotte er nicht kummen kan, der hie nicht folget miner ban, und teilt sin gut der armen schar in milde sam der adelar.» Der Fride kündet hie sin werk und spricht, er si der tugnde berk. 1965. Theologia darnach sprach, da sie den Fride rich ersach: «waruf gebuwet ist din ticht? das tu mir kunt in diser schicht.» er sprach: «ich. bin ein war rifir: 1970. in mir sich weiden alle tir. fisch, vogel, mensche geren min: des bin ich aller tugnde schrin. durch mich sint alle dink gesacht: der helle grunt der ist gemacht, 1975. das in dem himmel fride han, die gottes willen han getan. die engel wegten nimmer glich, wern sie nicht gottes fride rich. ich in dem himmel wart bekant, 1980. da ich den ersten engel bant und dampfte in der flammen glut der argen slangen übermut. wo min der mensche nicht engert, sin ere schranzet gottes swert: 1985. wann er in not mich rufet an, zu spot das rufen wird getan; wer mich nicht suchen wil in zit, von dem min stür sich firret wit. got durch mich von dem himmel klam: 1990. sin hant ußrotte fluches ram. der mensche were noch in pin, wer nicht gewest der fride min; mensch unde got versünet ist: das tichte mines frides list. 1995. die sele sunder frides ban mak keine wisheit nicht gehan: der mensche der nicht fride hat, der git vil selden guten rat. durch frid sint worden alle dink, 2000. des bin ich aller tugnde rink: der keiser und der babest wart geticht durch rechtes frides art; die künge, fürsten und ir kint durch fride gar geboren sint; 2005. was dörfte man der pristerschaft, wo das nicht fride hette kraft? irs wortes fride gibet stür der sele vor der flammen für. die werlde hette kein gericht, 2010. wo das nicht fride wer geticht, und wer ouch alles rechtes ler. darum, ir fürsten, habet ger zu fride, sint got üwer hant hie richten liß der werlde lant: 2015. darumme set, wie ir die schaf hie fürt, das ir icht liden straf dürft von des höchsten gottes kint: die fürsten gottes meier sint und sint bi gotte gar ein spot: 2020. sin warer fride rette Lot und ouch der Israhelen dit; unfride Pharao vorrit, das er starp in dem roten mer mit sinem volke sunder wer. 2025. die zen gebot gegeben sint durch fride diser werlde kint: die werlde möchte nicht gestan, wo sie nicht solde fride han». Die ware Libe künt ir pfat, die menschen bruch versünet hat. Theologia darnach sprach, 2030. da sie die Libe anesach: «waruf gebuwet ist din ticht? das saltu, meit, verhelen nicht» die Libe sprach: «ich bin ein grunt der tugnde gar und ouch ein funt: 2035. in mir sich sachen alle tir, die uß den elementen vir gemachet sint und ouch gesatzt. got hoch min wirken hat geschatzt, als ich es wol bewisen sal: 2040. er klam durch libe her zutal, das er min wirken möchte sen. gütlich min ougen liß ich bren und gap im manchen süßen blik, die wil ich span der salden strik, 2045. das er nicht mochte kummen dann, ein fremde forme zoch er an, das er bi mir bleip ungemelt: ein meit in furt in ir gezelt und druckt in an irs herzen brust: 2050. darzu gab ich min ware lust, so das der keiser hoher art da mit der meit getruwet wart; sie sneit im an ein rich gewant, davon er bleip gar unbekant: 2055. sulch wunder groß ich wirken kan. an mich kein tugent mak gestan: wer sich von minem werke firt, der ist des himmels gar verirt: was tugent möchte der gehan, 2060. der werk der libe nicht enkan! die werlt und ouch der werlde kint von libe gar versumet sint: ich bin der werlde hüterin. gein blicken blick ich werfe hin; 2065. der ougen boten künden gunst: darnach send ich mins füres brunst, das will in willen sich beslüßt, davon der libe frucht entsprüßt, die süß ist über alle frucht, 2070. wo das ir wachsen ist in zucht. trüw unde recht ich han geticht: wo das min libe were nicht, die werlt von not sich storte gar. dem küchel gibt durch libe nar 2075. der vogel: sunder libe kan die werlt in keiner schicht gestan. die libe mak gesünden nicht: wo lib in lib sin herze flicht, da wonet keiner sünde schur; 2080. ir trüw ist fester dann ein mur. zu gott er nimmer kummen mak, der warer libe nie gepflak: durch libe wirt gesuchet got, durch libe helt man sin gebot, 2085. man helt durch libe gottes e; der mensche gibet dicke me durch libe dann durch gottes will: die lib ist aller tugnde zil. darum, ir fürsten, folget mir, 2090. ab ir zu salden habet gir: habt gotte lip und üwer man: nicht baß ich üch geraten kan.» ...................... ...................... Theologia darnach sprach: da sie die Hoffenung ersach: 2095. «waruf gebuwet ist din grunt? das tu mir durch din libe kunt.» sie sprach: « ich bin der erste wek der salden und der höchste stek: wer minem spore folget nicht, 2100. der hat zu gotte keine pflicht; wem ganz sin herze zu mir stat, den selben got nicht fallen lat: er recket im sin ware hant und hilft im uß der nöte bant. 2105. von mir gink Peter uf dem mer; da er mich liß, gar sunder wer er wer in flut ertrunken da, wer im nicht Cristus kommen na. min hoffen gibet waren trost: 2110. das hoffen in Caldea lost die kinder von der flammen für; hern Isaac gap hoffen stür, das in das waffen nicht versneit, da er wart uf den rost geleit. 2115. das hoffen stürte sunder wan hern Josue vor Gabaon: die sunne stunt recht sam ein mur und luchte zu des strites schur. wie Jonas in dem fische lak 2120. vorslunden an den dritten tak, der ware got sin nie vergaß, da ganz sin hoffenunge was. in hoffenunge storte Bel zu Babilon her Daniel, 2125. im gap die hoffenunge trost: er von den leuwen wart erlost, in hoffenunge sunder wer her Moises fur durch das mer; der wak recht sam ein bulge stunt: 2130. durch hoffen trucken wart der grunt, set, wie den künk von Ninive sin wares hoffen stürte me, das unverstöret bleip die stat, wan alles fasten, das er tat. 2135. sust denket hin und denket dar und nemt der tat der werlde war, das der gar selden underlak, der warer hoffenunge pflak. des menschen leben wer ein wicht, 2140. stürt in die hoffenunge nicht, ein iglich tugent und ir art durch hoffenung getichtet wart: man leret wisheit umme das, das man zu leben hoffet baß; 2145. gerechtikeit man wirket schon, das man von gotte hoffet lon; die fürsten pflegen mildikeit, vor gotte das ir name breit werd, und ouch hie sie hoffen lon, 2150. das in gesprochen werde schon; man wirket hie barmherzikeit, das man dort hoft vermiden leit; der frünt dem fründe gibet brot: er hoffet, ab in drücke not, 2155. das er das selbe gein im tu. dabi die rede blibe nu.» Geloube künt sin wirken hie: an in wart heil den menschen nie. Theologia darnach sprach, da sie an den Gelouben sach: «wovon mak din geticht gesin? 2160. das künde nu der libe min.» Geloube sprach: «ich bin das seil, in das sich stricket menschen heil: ich leite nach der snure glich den menschen zu dem hiinmelrich. 2165. zu gotte mensche kummet nicht, ab im unkundik ist min ticht. der mensche sust geleuben sal, ab er nicht fallen wil zutal, wie gotts drifalt ein wesen si, 2170. und ere doch personen dri. den vater, sun, heiligen geist: die dri ein wesen ummekreißt, unspeldik, ewik an beginst. es ist kein not, das du besinst, 2175. wie dri in einem wesen stan, uß den die creature ran: es reichet keines sinnes ticht. kein lon hett der geloube nicht, wo redlichkeit bewiste das 2180. des menschen, wie got drilich was, personen, die eins herzen klamm besloß in eines wesens ram: das ist verborgen aller list. ein luter tat wie das got ist, 2185. geloube der bewiset das: urkundik das naturen was. geloub ist ein selbstendikeit, des wesen hoffenunge treit. kint, lerne den gelouben recht: 2190. geleube sunder wandel slecht, wie Cristus got und mensche ist, uß gottes herzen sunder frist geborn vor aller ewikeit; das fleisch er von der meide sneit 2195. an sich: in fremder formen art des geistes wort gekleidet wart; es mensche wart und bleip doch got. zu stür es in der helle not des ersten menschen bruche quam 2200. darnach es zu dem himmel klam und dannen widerkummen sal, zu richten diser werlde tal. zu siner zukunft werden sten die toten uf und vor in gen 2205. und geben rechenunge gar von aller hande missefar. der mensche fint sins werkes lon geschriben an der stirne schon: darnach die rechenunge stet. 2210. got zu den argen sprichet: ‹get verdammet in der helle für und hoffet fürbaß keiner stür.› den guten wirt gesprochen zu: ‹get, ir gebenediten, nu 2215. in gottes rich, das üch bereit ist von des himmels ewikeit.› geloub den fürsten, keisern zimt, von den die werlt ein zeichen nimt; geloub dem menschen hilft uß not: 2220. an in ist alle tugent tot.» Theologia teilt ein recht Naturen und den tuenden slecht. Theologia darnach sprach: «als es mins sinnes oug ersach und es mins herzen grunt verstet, von gott ein iglich tugent get 2225. und kumt uß der naturen nicht, als es bescheiden sal min ticht nach rechter formen; ab ich kan, und hebe sust zu reden an: wo tugent von naturen wer, 2230. so wer kein mensche tugnde ler und möcht ouch anders nicht getun wann trüwe, recht, frid unde sun: der fluß in twünge der natur, das er mit aller sünden schur, 2235. damit ich wil bewisen das, das tugend ie von gotte was und floß uß sines herzen grunt: natur von tugent ist entzunt. die ander red ich geben wil, 2240. das got si aller tugnde zil, und ewik uß im kummen muß und nicht uß der naturen fluß. wo tugent von naturen ist, durch was man lert sie alle frist? 2245. warum du lerest gottes recht, gein dem der arge wille frecht? wann nimant dürfte leren das, das im ie von naturen was. ist tugent von naturen fluß, 2250. so ist das kint ein musicus und kan ouch wol gramaticam, e das es in die schule quam. der rede wider das ist war: damit so stet bewiset klar, 2255. das tugent kumt uß gotte fri und nicht uß der naturen si. die dritte rede die si das: e die natur geschaffen was, der himmel, mer und alle dink, 2260. die engel und der sterne rink, da muste got ein tugent han, uß der naturen wesen ran: got mochte sunder tugent nicht gebuwen der naturen ticht. 2265. die tugent wirt gar sunder spot an mancher stat genennet got: man spricht: die tugent caritas gots tugent und got selber was. damit bewiset offenbar 2270. ist, das natura nam ir nar uß gottes tugent sunder wan: des sal die wird die tugent han. die red und ouch der rede punt, macht keisern, küngen, fürsten kunt, 2275. den grafen, frien, ritterschaft und allem das nach eren staft, das die natur ist gar ein troum, wo sie nicht fürt der tugnde zoum. des keisers kint ist edel nicht, 2280. wo das sin werk unadel ticht; untugent ist der eren tot: der mensche dörfte keine not nu liden, wer untugent nicht. darum, ir fürsten, habet pflicht 2285. zu tugent unde midet das, das fal dem ersten menschen maß: so lit ir keiner schanden pin.» hie sal des buches ende sin. Hie wil Natur bewisen das, wie sie vor allen tugnden was, sint uß ir kommen alle dink: des wil sie sin der tugnde rink. Natura sprach: «ich bin ein grunt 2290. der ding und irer tugnde funt: als in ir wesen uß mir ran, sust sie ir tugent von mir han: und was da heißet eigenkeit, darin min art sie hat gekleit. 2295. die erd ich stifte und ir recht, swer, trucken, kalt, swarz, schibelecht, und was der tir darinne ist, die hat gebuwet gar min list. der wak ouch in dem zirkel gat, 2300. den im min hant gekrißen hat, durchsichtik, kalt, swer unde naß. darum ich einen zirkel maß, klar unde bla: darinne gat die luft, die selden stille stat: 2305. weich unde warm sie macht min stür. um ire schiben get das für, licht, trucken, rot, weich unde heiß. das für beslüßt des manden kreiß und ouch die elementen gar. 2310. darnach Mercurius fürwar den manden ummereifen muß. die vorgenanten slüßt Venus. die sunne muß zu mittelst gan, dri under ir, dri oben lan. 2315. Mars darnach sunder lügenmer: den ummeslüßt her Jupiter. Saturnus muß der höchste sin: der ist der vorgenanten schrin: was die planeten wirken gar, 2320. das gap min kraft in milde dar. darnach das firmamentum get, darin manch stern gestippet stet. darnach die erste weglichkeit den louf den schiben gar bereit: 2325. wann sie von irem rucke gen und mugen stille nicht gesten. ir sult geleuben mir fürwar: die tir sich müsten stören gar, wo das der himmel stünde still, 2330. von dem ich fürbaß sagen wil. Hie von des himmelt zirkeln spricht. Natur, wie das sie sin gericht. Der himmel zwene zirkel hat: der erste hin gein süden stat von norden: equinoccial den selben kreiß ich nennen sal; 2335. tak unde nacht der zirkel glicht, als in min influß hat geticht. der selbe zirkel hat zwei punt adr zwene polus, ist mir kunt, an den der himmel ummereist: 2340. des süden punt das eine heißt, das ander heißt des norden punt: daran der segelstern entzunt stet unde lücht in sulchem zil, als es min influß haben wil. 2345. den andern nenn ich, ab ich mak: der ist geheißen zodiak und übern ersten ist geschrenkt, als in min finger hat gelenkt, und teilt in zwei den ersten glich: 2350. kint, von der lere nicht enwich. der zirkel nach der lingen seil sich teilet in zwelf gliche teil, die teil die zwelef zeichen sin: ir namen künt die lere min. Hie nent die zeichen alle gar Natur nach ordenlicher schar. 2355. Der Ster das erste zeichen heißt, nach dem die Fische, darnach reist der Ochse, darnach Gemini, nach dem krouch der Krebeß ie, der Leuwe, Meit und Scorpio, 2360. die Wag, darnach der Schütze jo, der Bok, darnach der Waßerman: von mir ir tugent alle han und wirken nicht wan das ich wil: min kraft ist ires wirkens zil. Natura seit, was tugent hat der Ster wann uf gein osten gat. 2365. Der Ster wann uf gein osten sit, als im min influß blicken rit, welch mensch darunder sich gebar, krusp unde dick wirt im sin har, sin ougen groß, sin oren klein, 2370. sin hals ist lank, krank sint sin bein, sin füße breit, sin dich sint lank, gar herlich ist des selben gank, sin kinne spitz, so ist vor sich die brust gebogen sicherlich, 2375. sin schuldern eng, sin zene grop, klein sint sin arm, groß ist sin kop. min kraft das alles wirken kan: des mag ich wol die wirde han. welch dink darinne anfank hat, 2380. des bu nicht lang in kreften stat. Hie künt Natur des Ochsen art, und menschen das darunder wart. Welch mensch das in dem Ochsen wirt geborn, es scharfer sinn enpirt. sin stirne breit, recht sam ein bloch, gar wit sint im die naseloch: 2385. es muß ouch große ougen han, ouch sint im brun die wimperan. stark ist sin hals und dabi dick, stet uf die erden ist sin blik. sin har ist swarz und dabi rach, 2390. ouch wirt die brust dem menschen flach. sin zorn der ist gar fientlich, und zürnt doch selden sicherlich, sin knorren grop, sin füß unlank, gar erlich ist desselben gank. 2395. welch dink darinne wirt gepflanzt, gar lang es blibet unverschranzt und wechset snelle mechtiklich: das sult ir wißen sicherlich, wan ich das alles wirken kan, 2400. des sal min art die wirde han. Uns kündet die Nature hie, was wirkens haben Gemini. Das dritte zeichen ist bekant: das selb der Zwillink ist genant, welch mensch darin geboren wirt, der argen list es gar enpirt: 2405. es ist getrüw und dabi gut, doch ist gar ruschende sin mut. sin hals und ouch sin nase lank, sin heubet groß, sin lip ist swank, breit ist sin brust, schon sin gestalt, 2410. und ist gern in der rede balt, sin füße groß, und libet sun und kan wol rechenunge tun. welch man darinne sune gert, der blibet selden ungewert, 2415. wo das der man darinne get und es gericht gein osten stet. Natura von dem Krebße spricht, wie das sin influß si gericht. Der Krebß das virde zeichen heißt, der stete hinderwertik reist, welch mensch darinne wirt geborn, 2420. in er es selden wirt gekorn. sin antlitz das ist slaferik, sin hüffe grop und dabi dick, sin ougen im zuplunsen sint, krank ist sin blick, wird es nicht blint. 2425. gar widerspenik ist sin tat, sin glücke rückelingen gat. ußsetzikeit und süchen vil es lit in siner tage zil. treg ist sin werk, der adem sin 2430. im stinket nach der lere min. es wirt ouch von geschichte rich, und snell den betteleren glich, wann in dem zeichen get der man, so saltu alle teiding lan: 2435. welch dink darinne wirt geborn, daran die arbeit ist verlorn. Hie künt Natur des Leuwen art und menschen, das darunder wart. Das fünfte tu ich üch bekant: der Leu das zeichen ist genant. welch mensch geboren wirt darin, 2440. vernunst es hat und scharfen sin und flißet sich an meisterschaft und hat in armen große kraft, sin brust ist stark, sin schuldern breit, in herzen gottes forcht es treit. 2445. und ist ouch mild und dabi gut, doch ist gar ernst des selben mut: ruch ist sin brust und zeret vil. wann er von hinnen scheiden wil, groß klagen wirt um in getan. 2450. den finden du gesigest an in diesem zeichen sunder list, ab du darin geboren bist. Natur uns kündet unde seit des zeichens art, genennet Meit. Das sechste zeichen heißt die Meit, von dem üch hie min lere seit. 2455. welch mensch darinne wirt geborn, das darbet list und midet zorn, gar gütik ist des selben mut, durch got es gerne gabe tut und ist gar senftiklich gesitt, 2460. ouch im behende sint die glit, und fürchtet got zu aller zit. sin antlitz schon und dabi wit, und kan gar minniklichen sen, wann es sin ougen leßet bren. 2465. die küsche und die reinikeit es stet in sinem herzen treit. im wirt gemeret sine frucht von gotte durch sin ware zucht. man sünet in dem zeichen das, 2470. das e gar ungesünet was. sin influß ist gar fridelich, das sult ir wißen sicherlich. Natura von der Wage spricht, wie das ir influß si gericht. Die Wag das sibnde zeichen heißt, das uf und ab unstetlich reist. 2475. welch mensch darinn geboren wirt, von dem ist selikeit gefirt: nach falschen dingen stet sin ger, und ist ouch aller trüwe ler. krusp unde swarz ist im sin har, 2480. die nase spitz, und tunkelfar sin ougen sind, und slaferik ist siner formen aneblik. was sachen im befolen ist, das wirket es in arger list; 2485. kein mensche tar sich zu im lan: ein arges ende muß es han. was in dem zeichen man begint, es selden ende gut gewint. Natur künt hie, wie Scorpio sins werkes influß habe so: Das achte zeichen ist bekant: 2490. es ist der Scorpio genant. welch mensch darin geboren wart, unbarmik was des selben art. der selbe mensche frißet vil und lüget sunder maßes zil; 2495. trüw unde recht er heldet nicht, er spot von gotte gerne spricht, got bet er mit dem munde, an, doch ist sin herze ferre dann, gar giftik ist sin arger will, 2500. sin blik ist mortlich unde schil, sin antlitz das ist zornes vol, sin füße knorrecht unde hol. wer in dem zeichen wirt verwunt, der wirt vil selden mer gesunt. 2505. nimant darinne suche tat, wann sie gar rückelingen gat. sint ich, Natur, das wirken kan, des mag ich wol die wirde han. Natura künt des Schützen art und menschen, das darunter wart. Das nünde zeichen ler ich dich: 2510. das heißt der Schütze sicherlich. welch mensch geboren wirt darin, von not es muß ein jeger sin. das selbe herschaft nicht enpirt: daruß es doch gedrungen wirt 2515. und kummet aber wider drin, ein heubt es muß der fründe sin, von im sich meret sin geslecht, und stet nach großen eren frecht, und doch nicht lange nüßet die. 2520. wann es zins der naturen hie muß geben, wißet sunder wan, um in groß jammer wirt getan. was in dem zeichen man begint, ein erlich end es nie gewint. Das zeichen, das der Bok genant, das tut Natur uns hie bekant. 2525. Der Steinbok muß das zende sin. das zeichen nach der lere min ist gut: welch mensch darinne wart, das lebte jo nach rechtes art. sin antlitz eng und dabi lank, 2530. sin lip ist mager unde swank; kein großes fleisch es ledet nicht, scharf unde stark ist sin gericht, und betet gern zu aller stunt. sin nas ist groß, eng ist sin munt, 2535. und hat zu keinem tranke pflicht und achtet überfraßes nicht, und tut gar endelichen das, von schulden was zu tune was. uf zorn er snelle wirt geweit, 2540. ouch snelle sich sin zorne leit, und trüget gar an sinen dank; wo das sin zorn gewinnet swank, so let er uß der snalle das, vor glich das sinnes wage maß. Natura von dem Waßerman hie kündet, was er wirken kan. 2545. Das eilfte zeichen sunder wan das ist genant der Waßerman. welch mensch gezilet wird darin, des lip muß wißer farbe sin und doch nach ascherfar gestalt, 2550. es wechset snell und kranket balt, der land es ummesweifet vil, und gnuk biß an sins endes zil uf diser werlde hie erwirbt, das mensche an dem heubte stirbt, 2555. darin im der naturen kunst fluß tribet unde steten dunst; der mensche wirt geklaget ser. kint, halt das vor ein ware ler: es gibet der Naturen art, 2560. was wunders ie gewirket wart. Uns kündet der Naturen list, wie das der Fische wirken ist. Des zwelften art ich lere dich: es heißt die Fische sicherlich, welch mensch geboren wirt darin, ein jeger und ein reuber sin 2565. es muß, und von des zeichens art es oft zu einem fischer wart, und in dem wage freislich ist, und findet nüwer fünde list. es ist ouch ark, und gizikeit 2570. es stet in sinem herzen treit. der mensche lützel wirt gekleit, wann das sin sterben wirt geseit. sint ich, Natur, das wirken kan, des mag ich wol die wirde han: 2575. recht als ich han die dink gemacht, sust ich ir tugent han gesacht. es ist kein tugent ane dink: des bin ich aller tugnde rink, und wil damit beslißen das, 2580. das ich vor aller tugent was.» Der meister dises buches spricht: got die nature hat geticht, die engel und die speren breit 2585. und was das zentrum wunders treit, in wisheit und in tugent, kraft: davon Naturen wirde slafft, und sal sich tugent glichen nicht, sint sie von tugent ist geticht: 2590. die tugent, in der got geschuf die dink in sines wortes ruf, die selbe tugent die was got und got die tugent sunder spot. Christi Leiden nach 1366 Der Autor Der Passionstraktat «Christi Leiden in einer Vision geschaut» wurde von einem unbekannten Autor gegen Ende des 14. Jahrhunderts verfaßt. «Das Werk hat in der Forschung bis heute kaum eine Form der Beachtung gefunden, die über das bloße Registrieren der Auffälligkeit seines Realismus hinausginge» (Aleksandra Prica, 2006). Christi Leiden in einer Vision geschaut Textgrundlage: Christi Leiden in einer Vision geschaut: A German mystic text of the fourteenth century; a critical account of the published and unpublished manuscripts with an edition based on the text of MS. BernkastelCues 115 ed. Frederick P. Pickering Manchester: Manchester University Press, 1952 Digitale Edition: Angus Graham University of Sharjah, United Arab Emirates ―――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――― Hie geit an eyne vurede in dat boichelgyn van vns heren Jhesu Christi mynnenclichen lyden. Elegit suspendium anima mea et mortem ossa mea. It geschach zo eynre zyt dat eyn gelert man predigers ordens dat lyden Christi in sin hertze nam mit andacht mit begerungen vnd mit ernste, Vnd bat dat vederliche hertze dat he in dar zo gewirdigde, dat he wurde eyn gewaire medelyder sins eyngeborenen soens vnd zo eme an sin cruce genegelt wurde, so wie wee eme auch hie van geschegen mochte. Darna vugte got dat eme dese schryft die herna steit van [67va] der pynen vnses heren wart geantwort, die gar eygentlich alle die erbermeliche wise [vffenbairet] die Christus hatte in synre steruender noit; vnd dat was eme vil lustlich zo lesen vnd zo betrachten, uff dat eme syne lydende dage da van die lichter wurden vnd syne moeliche iair. Vnd so wie dat sy, dat sin vil in dem ewangelio neit in ste, doch in der wisen als he van eme ernuwet vnd gerechtet vnd geordent ist, so in ist neit da dan dat gar mynnenclich ist vnd dat weder die heilige schryft neit in ist, vnd dat wal geoefften menschen an betrachtungen synre martelen gar geloufflich ist. Die vier ewangelisten schryuent dan aff kurtzelich vnd alleyne dat dat da noitdorfftich was, vnd liessen dat ander blyuen; vnd dat was gar zemelich in den dagen, do man den gecrucigten Christum kōme wulde hoiren nennen. Auer nu ist sy[n] gotliche ere wal vurgebrochen, beyde vffenbairlich in der cristenheit [vnd] in manichen mynnenden hertzen, Vnd darum in ist is neit vnze-[67vb]melich dat he auch sin menschelich lyden noch eygentlicher synen vsserwelten frunden wulde vffenbairen. Der sich dar an stoisset, der clage syne eygen blintheit, want den siechen augen ist is vnledelich den schoenen dach an zo sehen. He hiesch is synen wal erarnende spegele, dar vmb das eme sin vurganck fuyr was worden. Do it eme zo verstaen wart vnd in duchte dat is so reitzelich were zo andacht, Do hette he is gerne allen mynnenden hertzen gemeynsamet. Vnd dan aff wart vil groisses lydens vff in vallende. Do he in desem lyden was, do geschach auch dat he vff dem wege siech wart bis an den doit, dat eme wenich ieman dat leuen gehiesse. Vnd do he vil ellendenclich gelach eyns nachtes vnd van groissen noeden der suchten neit in mochte slaiffen, vnd dar zo lach van allen menschen vnbehulffen, Do wart he mit gode eyn lieffliche rechenunge her vurnemende vnd sprach also: „Ach gerechte got, wie kans du so wal mit der vnmaissen [68ra], da du wilt dat du myne crancke nature so gar ouerladen hais mit so bitterem lyden vnd myn hertze verwundet hais mit versmaheit, wanne wilt du an mir vff hoiren, mylde vader, Ouwe wanne duncket is dich genoich?“ Vnd nam in synen moit den engestelichen angeste den Christus leit vff dem berge do syne menscheliche nature mit eyme vereynigen willen zo lyden dem lyden gerne intwichen were, vnd wie he in der grymmer noit wart den bloedigen sweis so genoichsamlich swytzende, Als auch herna an desem boichelgyn steit geschreuen, vnd sleich also siech mit betrachtungen hyn zo Christum vff den berch an die stat da he gegenwortich kneede. Vnd der selue broder nam syne hant vnd lies sy Christum ouer syn treyffende bloedich angesichte gaen vnd ouer alle synen bloedigen swytzenden lyff, Vnd hoyff die hant an sich vnd bestreich synen siechen steruenden lyff mit desem hitzigen vffrechtenden gotlichen blode, vnd sprach mit begerden syns hertzen: [68rb] „Ach here, ist dit eyn wairheit dat dynre steruender noit so vil was als hie geschreuen ist, des laisse mich geneyssen an deser lydender stunden; vnd ist is dyn wille vnd din loff, so mache mich gesont mit deser saluen dyns reynen hytzigen blodes vnd laisse mich geneissen dat ich durch deser wairheit willen so vil haen erleden.“ Vnd intfur eme eyn alsulch worte vnd sprach: „Here, geneissen ich, zohantz so wil ich din grois lyden dir vnd dyme hemelschen vader zo eren gerne richten vnd zo liechte brengen. Ist auer dat ich neit balde geneissen, so wil ich it aen allen zwyuel in eyn vuyr werffen.“ In deser begerden krouch he van dem bette aff vff den stoel der vur dem bette stoent, want he was ellendich vnd in hatte nyeman der in hube ader lechte, vnd sas also da, want he in mochte van dem geswere dat he hatte neit gelygen. Vnd do he also ellendich sas, do was eme vur in eyme gesichte wie eyne groisse menige des hemelschen gesyndes queme eme zo [68va] troiste vnd vienge an zo syngen eynen hemelschen reyen, eyn ouernaturlich gotlich gesenge, vnd dat erclanck also soisselich in synen oren, dat alle syne nature verwandelt wart. Vnd do sy also vroelich sungen vnd deser broder also trurlich sas, do gienck eyn Jungelynck zo eme vnd sprach gar gutlich: „warum swyges du, warum in synges du auch neit mit vns? du kans doch wal den hemels sanck?“ Do antworte eme der broeder in eynre beseufticheit syns hertzen vnd sprach: „Ach, in syhes du neit wie we mir ist? wa gevreuwede sich ie eynich steruende hertze? Sal ich syngen, ich syngen den leyden iamersanck. Gesanck ich ie froelich, dat hait nu eyn ende, want ich warten nu der stunden myns endes.“ Do sprach der jungelinck gar froelich also: „Viriliter age! Gehalt dich wal, Sys vroelich, dir in wirret neit. Du wirdes noch sulchen sanck doende, dan aff got in der ewicheit wirt geloeft vnd manich lydende mensche getroist.“ In den worden do [68vb] flussen eme die augen vnd begunde weynen, vnd vff der stunden do brach die vnreynicheit van eme vnd wart eme vff der stat bas. Dar na mit eynre danckberheit syns hertzen gaff he dit zo lesen den menschen die sin intfencklich waren, na dem dat it got an eme geordent hatte. Hie begynnet die passie vns lieuen heren Ihesu Christi. Eyn mensche was eyns mails vur metten in syme gebede na irre gewaenheit als irre andacht was, Dat sy gewoenlich gerne wachte vur metten so wanne die crystenheit sleiffet. Nu begerde sy dat ir dat lyden Christi vns heren gruntlich zo hertzen gienge vnd arbeite sich darna mit vil begerden. Nu gedechte sy an syn komen in menscheliche nature, Nu an manche wunnencliche doegende die he dem menschen gedaen hatte, Nu an syn demoedich lyden dat he vmb syne doegent geleden hait, vnd gedechte hyn vnd her, so wat sy vant dat ir begerde reitzen solde zo Christus lyden. [69ra] Dat in wolde ir neit wal zo handen gaen na irre begerden. Do lies sy dan aff, doch mit bedroyffenysse irs hertzen vnd wulde sich an ir gebet haen gelecht. Do wart ir zo gesprochen van gode: „Wiltu alle dat lyden Christi sehen vnd hoiren vnd eyn deil bevynden, so wal her! du salt it allet sament sehen vnd hoiren, want dat is begerlichen dem hemelschen vader dat man syns kindes lyden bevyndet vnd bekennet.“ Also wart sy gevoirt an die stat, da Christus mit synen jungeren an sin gebet wulde gaen, Vnd sach in van den Jungeren gaen eynen gueden wech, vnd neygde sich neder vff syne knee vnd sprach mit worten. Zo metten zyt .'. „O Vader, mich geit an anxt vnd noit, mach it sin, so nym sy van mir, doch werde din wille.“ Vnd bete eyne lange wile darna. Der worte in hoirte sy neit, Sy hoirte auer wal die stymme. Do stunt he vff vnd gienge zo synen jongeren in der wysen als eyn mensche der vrdrussich ist syns [69rb] selues, Vnd vant sy slaiffende vnd weckde sy vnd sprach: „Ouwach, slaiffet ir? angest vnd noit heuet sich an des menschen kynde. Wachet vnd bedet dat uch der duuel iet bekore.“ Vnd he gienge auer weder an sin gebet vurbas dan vur vnd [merete sich sin angest mer dan vur vnd] kneede auer neder vnd sprach mit eynre groisser stymmen: „Vader sich an dyns kyndes noit; mach it sin so nym sy van mir, doch werde dyn wille vnd neit der myn.“ Do bete he auer vnd wart dat gebet langer dan vur mit luder stymmen die sy hoirte, doch in mirckte sy der worte neit. Do stunt he auer vff vnd gienck zo synen Jungeren. Do rieff eme des dodes vorte, vnd wulde sich haen etzwat ergetzet mit synen iongeren des lydens, dat he doch wal wiste dat he it lyden moiste. Vnd vant sy auer slaiffende. Do wart he bedroeuet van ouerigem lyden dat in inwendich drengde, vnd weckde sy hertlichen vnd sprach: „Ouwach, slaiffet ir? Steyt vff vnd bedet want he necket der mich da hyn [69va] gift. O Peter, sleiffes du auch? Du spreches doch, du wuldes mit mir in den doit gaen. Wachet vnd bedet, dat uch der duuel icht in ouerwynne. Wisset, uch wirt angeste vnd noit angaen in deser nacht, want der hirte wirt geslagen vnd werdent die schaiffe zo spreit.“ Vnd kerde sich do zo sente Peter vnd sprach: „Ich saen dir, Peter, so du weder kummes, so saltu sy weder samenen vnd stercken.“ Do mirckde sy dat he dese worte sprach zo sente Peter eme zo eyme troiste, want he wiste dat he leit hatte vmb syne traicheit vnd vmb synen slaiffe. Vnd gienck auer weder an sin gebet vil verrer dan vur an eynen berch. Vnd wart syne stymme also grois, dat he eynen groissen royff vss lies van vngestumer lydungen die alle syne nature vmbuangen hatte vnd durchdrungen vnd sprach: „Vader, sich an dat enxtliche lyden dyns soens; mach it syn, ader weist du in dynre wysheit eynen anderen wech, den lais vur gaen, dat ich gelediget werde des schentelichen dodes. Du weist wal myn [69vb] vleisch is kranck, vnd myn geist is bereit dynen willen zo vollenbrengen.“ Do he also gesprochen hatte, do durchgienge des dodes angeste alle syne nature vnd dat erzounte he an synre geberden, Want he warff sich seluer mit groisser vngestumicheit vff die erde vnd wart roiffende vnd murmelende vnd grysgrammende vnd van ynnigem hertzen weynende vnd sprach: „O getruwe mylde vader, neit in sich an dyns kyndes noit dan an dynen ewigen willen, der sal vur gaen.“ Vnd in dem seluen do was eme gegenwortich alle die angeste vnd pyne die he lyden solde van worten ader van wercken, als off he sy yntzunt lede, vnd hoiff sich eyn doeuende we in aller synre naturen, vnd streckde sich in crucis wyse vff die erde. Dat dreyff he also lange als dat man wal die seuen salme hette gesprochen, Vnd was syne geberde also enxstelich, dat sy mir sade dat it guet was dat it die jungeren neit in sagen noch in hoirten, dat [70ra] sy iecht verzagden van synen engesten vnd van synen lyden. Vnd do gelach he stille uff der erden als eyn mensche die van dodes angeste vnd van syme lyden synen geist vff wil geuen. Da vur hatte in eyne vngewoenliche kelde vnd frost durch gangen, Darna durch gienck in eyn vngewoenlich vuyr vnd hytzte, Als off die menscheit Jhesu Christi solde verenden, vnd durch brant alle die vuchticheit die in synre naturen was, Vnd ylte zo dem marcke in dem gebeyne, dat it verbrente vnd verderde, vnd zo dem blode in die aderen, dat it dat vsgusse vnd verswente, vnd drengde die got vereynigde menscheit so sere, dat dat bloit an allem synem licham vs dranck, Auch vss ouer alle synen lyff, dat he hin vlouss van blode. Vnd also in der doitlicher anxte quam eyn engele vnd sprach zo eme mit eynre gotlicher craft: „Stant vff vnd sys starck, du salt brechen dat bant Adamus, Vnd salt afflegen den zorn dyns [70rb] vaders, vnd salt alle sere heilen vnd salt versoenen menscheliche kunne. Ganck vnverzaget, die craft dyns vaders ist dyn vnderstant vnd intheldet dich.“ In dem seluen nu rechte sich Christus vff van der erden in sulchem iubilo als eyn mensche der van dem dode erstanden ist, vnd mit begerden stunt he uff. Do sach sy dat angesichte Christi, dat dat mit groissen blodes troppen beronnen was vnd yntzunt flous, vnd dat sin gewant bludes also vol was worden dat it neit me intfaen in mochte, vnd dat it vff die erde flous vnd droifde. Also stunt Christus vff mit gotlicher craft vnd gienge auer zo synen jongeren vnd vant sy auer slaiffende vnd sprach zo in mit eynre barmhertziger myldicheit: „Ouwe ir tregen vnd ir crancken an uch seluer, slaiffet ir auer? Steet vff, it is genoich geslaiffen, he is hie, erwecket vre gemoede vnd intfeit eyne gotliche craft, it geit uch an den strit vnd mir an die noit.“ Bynnen [70va] des quam Judas mit eynre duuelscher craft vnd gedursticheit vnd trat intgeen Christum vnd bout eme synen armen zo eyme vmvangen, Vnd synen mont zo eyme kusse. Vnd van der beroerunge, dat Iudas berurte Christum, do intweiche eme der duuel vnd he wart inthalden van gode vnd van dem duuel vnd wart also cranck dat he neder wulde sin gesturtz. Do sprach Christus zo eme: „vrunt [den he viant bekante], warum bistu comen? Du giffs mir eyn zeichen der vruntschaff vnd du weist wal dat du nye frunt in wurdes, vnd doch vil fruntschaff hais intfangen.“ Dat dede Iudas also we als der strick syns dodes, vnd gienge van eme. Vnd Christus keirde sich zo den die mit Iudas quamen; dat was dat aller boiste vulck dat vff ertrich einich was: Sy waren besessen mit nün dufelen die Lucefers neisten gesellen waren, vnd der was vil, Vnd also manich vndoegende irre iecklicher begeynck an Christo, Also manche düüel [70vb] was by in, die sy dreuen vnd reytzten ouer Christum mit doeuender wudender grymmicheit. Also quamen sy doeuende vnd wuedende vnd royffende gen dem soissen sanften lamme Christum. Do sprach he zo in mit eynre milder sanfter s[ty]mmen: „Wen suchet ir?“ Do reiffen sy mit eynre luder stymmen: „wir suchen Jhesum Nazarenum.“ Do sprach he zo in: „Ich bynt.“ Dat wort nam den duuelen vnd den luden alle ir craft, dat sy craftlois neder fielen vff die erde vnd lagen als sy doit weren. Do erquickde sy der vader van hemelrich, der Christus doit wulde durch des menschen loysunge, Vnd lies den duuelen ir craft weder, Vnd rechten die duuel die menschen vff vnd giengen noch mit groisser vngestumicheit weder zo Christus. He sprach auer: „wen soichet ir?“ Sy spraichen auer: „wir soichen Jhesum Nazarenum.“ Do sprach he auer: „Ich bynt.“ Do vielen sy auer neder. Also quamen sy weder vff als vur vnd quamen zo Christum. Der vragde sy auer: „wen soichet ir?“ Do [71ra] spraichen sy auer: „Jhesum Nazerenum.“ Do sprach he: „Ich haen it uch doch [ee] gesait dat ich it byn. Sint ir mich soichet, so laisset die anderen alle gaen Vnd nemet mich vnd doet mit mir alle wat ir willet.“ Van desen worten Christi viel ir van gode in: So wer geistelichen Christum wil soichen, der sal alle dynck vur laissen gaen, so vyndet he Christum vnd duet mit eme wat he wil. Also gryffen sy Christum an mit doeuender wudender vngestumer duuelscher geberden: Eme viele eynre in dat hair, der ander in die cleyder, der dritte in den bart. Dese dru waren an eme also vul hende, dat numme an eme gehangen in mochte. Vnd do der irste die hant an in lechte, do wart Christo benomen van gode dem vader alle die helffe die he van genaden ader van naturen hatte, Vnd wart gelaissen aen alle helffe vnd aen allen troist, dat doch nye menschen versait in wart in synen noeden. Also wart Christus hin gezogen mit vngestummer wilder doe[71rb]uender wuedender vnzucht, mit starcken slegen, mit gewapenden vusten vnd henden vff den nacken vnd tusschen die schulderen vnd ouer den rucke vnd vff dat houft Vnd an die wangen vnd vur die kele vnd vur die bruste mit wilder vnzucht, mit doeuender geberden, mit stercken slegen, wa sy in treffen mochten an alle syme lyue mit sulchem grymme, als off in eyn eicklich slach solde haen gedoet. Sy roufften eme dat hair van dem houffde, dat die locke des hairs vff der erden lagen zo strouwet, Eynre zouch in hyn mit dem hair, Der ander zouch in her weder mit dem barde, Eynre zouch in mit den oren Als he eyn aff ader eyn doir were. Sÿ wurffen eme ir seile an synen hals vnd bunden eme syne hende mit eyme seile ouer eyn ander. Eynre zouch in mit dem seile vnd slengerde in dort hyn, he mochte in haen erwurget, der ander zouch in her weder mit dem seile vmb die hende, als off he eme die ar[71va]men wulde vss ziehen, Eyn ander zouch in mit dem haire weder, Eyn ander begreyffe in mit dem bairde, vnd gebeirden mit eme als die eynen hunt wil wurgen. Etzelichen giengen hynden vnd namen den louff vur sich vnd an dem louffe steissen sy in mit iren voissen an syne voisse, an syne beyne vnd an synen rucke, Da the vff die erde struchelde. Vnd ee he vollen vur sich geviele, so zuckten in die anderen weder mit dem haire, dat he hynder sich struchelde. Vnd ee dan he vollen hinder sich geviele, so zuckten in die anderen weder zo ietweder syten, Der eyne mit dem haire, der ander mit dem barde. Also sleifften sy in den berch aff: Eynre zouch in mit dem hare, der ander mit den cleyderen, die anderen mit den seilen. Sy wurffen in dicke vnder sich vnd sprungen vff in mit wilder doeuender geberden vnd mit vngestumen vnseden vnd rieffen vnd doeueden, als off sy eynen wolff vnder henden hetten [71vb]. Also brachten sy in zo der portzen der stede, dat he nye eynen rechten trit mit synen voissen gedede, Dan sleiffen vnd kechen, bis sy in brechten in Annas huys. Do zoegen sy eme syne kleyder vss vnd daden eme stricke an syne hende vnd zoegen in also nackent mit den stricken vmb eyne mermelen steynen groisse suyl vnd flochten in also vaste an die sule, dat man tusschen synen licham vnd der sule eynen halm neit in mochte haen gestoissen. Die stricke an den henden die drungen dat vleisch vnd dat bloit also sere, dat man dat fleisch vnd dat bloit sach vff swellen ouer die stricke, Vnd dat bloit wulde zo den nailen der vinger vss sin gedrungen, vnd wurden die hende vnd die vinger vnd die nele swartz van dem blode als sy zo murselt weren. Sy giengen van eme vnd aissen vnd druncken vnd liessen Christum alleyne an der suyle gebunden als eynen ellenden vngetroisten [72ra] merteler staen. Do quam ie eynre na dem anderen vnd pinigeten in. Etzelichen brachten birnende eyerschalen vnd druckten eme die an maniche stat syns lyues vnd syns antzlitze, dat he rieffe mit luder stymmen, Vnd als schier sy die eyerschalen van der huyt daden, so hatte sich die hut erhauen mit groissen blateren. Etzelichen sprungen vff mit wilder vnzuchte vnd spuwen eme vnder sin antzlitz. Also verdaden sy alle die nacht mit wilder doeuender vnzuchte, Vnd mit grymmer vnsichter geberden vnd mit schemelicher vnzuchte: wat ir duuelsche hertzen erdachten, dat vollenbrachten sy an eme mit wysen vnd mit wercken. Sy handelden in also schentliche vnd also schemelich, dat it nummer zo grunde gevffenbairt wirt bis an den iungesten dach: so wirt von den boisen gevffenbairt ir boise meynunge vnd ir ouel wercke die sy an Christum begiengen, Vnd dat wirt den gueden eyne ere vnd eyn loff dem [72rb] vader, dat Christus also vil durch sy geleden hait van den boisen. Zo laudes .'. E Dan der dach vff gienge, do namen sy in van der sule vnd daden eme sin gewant weder an vnd voirten in mit manichen grymmen slegen vnd stoissen vnd roiffende mit wilder doeuender geberden in Cayphas huse. Wie schemelich vnd schentelich sy mit eme uff der straissen vnd in dem huse reden, dat in kan nyeman mit worten vurbrengen. Sy vurten in vur Cayphas mit manicher valscher loegen. Sy sprachen, he were eyn verkerer der werelt vnd eyn luegener vnd eyn affbrecher des güedes vnd were eyn vnkuyscher vnd were eyn vrais vnd eyn drencker vnd were eyn verderuer des vulcks vnd eyn zostoirrer der gesetze in der ee, Vnd he neme sich an he were got. Vnd alle die vndoegenden die sy vff in gereden mochten, die daden sy. Do sprach Caiphas zo eme: „bistu godes son, dat sage mir.“ Do sprach he: „du spriches is; also ist is.“ Do kerde sich [72va] Caiphas zo dem volcke vnd sprach: „Wat bedurffen mir me gezuchenysse? he hait seluer vergehit vnd hait gode an syne ere gesprochen; he is werlich schuldich des dodes, vnd eyns lesterlichen dodes.“ Vnd zo reis sin gewant vnd mit dem brach he alle die genade die he van Christo vnd van syme hemelschen vader vmmer solde intphaen. Die pryme Also namen sy in vnd voirten in zo Pilato, dat sy allet dat zweyueldich vff in beweren wolden, als sy vur gereit hatten. Dat Caiphas also gereit hatte weder Christum, Des vreude sich ir vergiftige hertze vnd gemoede. Also namen sy den verwonten Christum, den sy alle die nacht mit alle den vnselden die sy erzugen mochten, gepiniget hatten, Vnd bunden eme auer syne hende zo samen, Vnd vurten dat sanftmoedige lam als eynen schuldigen boisen dieff der alle boisheit begangen hait. Also waren ir vergifftige hertzen geen eme gerechtet mit alle den pinlichen worten vnd wercken als sy eme da vur hatten [72vb] gedaen. Vnd do sy in Pilato brachten, do luten sy vnd rieffen so duuelsche, als off sy brachten eynen verdoemden alle der werelt; vnd hette Pilatus den rait vur neit gewist vnd gedreuen, he hette gewenet dat man in wolde haen intsat van alle synre eren; Vnd also vngewoenlich was ir stymme vnd ir roiffen, Want he it do wal wiste vnd it allet sament halff dryuen vff Christus steruen. Do quam he als eyn sanftmoediger here vnd bewiste eyn velsche gelissenheit vnd sprach: „Wat hait deser mensche gedaen?“ Als off he vur neit dar aff in hette gewiste. Do saden sy yme grois vbel van Christo vnd saden eme wie sy van Cayphas weren gescheiden vnd wie he van eme geret hatte vnd wie he eyn vbeldedich mensche were, vnd dat hette Caiphas van syme monde gehoirt. Des was Pilatus vroe vnd nam Ihesum alleyne vnd sprach zo eme: „wer bistu? wat haistu gedaen?“ Do sweich Christus vnd in wolde eme neit antworten, want [73ra] he wiste wal dat is eme vur allet gesait was, wer he were, beide van Christus vrunden vnd vianden. Do sprach Pilatus zo Christus gar schelcklichen: „Warum swyges du vnd in antwortes du mir neit? Weistu neit dat ich gewalt haen ouer dich?“ Do sprach Christus: „ich weis wal dat du keyne gewalt hettes ouer mich, in were sy dir neit gegeuen van myme vader.“ Do sprach Pilatus: „also bistu godes son? Also hauen mir die gesait die dich mir hauen bracht, Dat Caiphas dat van dir haue gehoirt vnd dich haue verordelt zo dem dode. Bistu godes son? dat sage mir!“ Do sweich Christus. Do sprach auer Pilatus: „warum swygestu, warum in sages du mir neit die wairheit?“ Do sprach Christus: „sagen ich it dir, so in gelouues du mir neit, vragen ich dich, so in antwortes du mir neit, vnd da van hant die gesondiget me dan du die mich dir hant gegeuen.“ Darum sprach Christus do zo Pilato, want he bekante [73rb] wal dat he intfencklich were gewest der genaden, off he die hoffart vnd ydel worte neit in hette gehait. Auer dat getruwe worte Christi in vurvienck neit an Pilato. He sprach auer van eyme houertigen gemoede: „So hoiren ich wal, so bistu godes son.“ Do sprach Christus: „du spriches it vnd ich bin it.“ Do sprach auer Pilatus: „wat haistu gedaen, dat din vulck so gram ouer dich ist?“ Do sweich Christus vnd in wulde eme neit antworten. Do nam in Pilatus vnd gienge zo dem vulcke vnd sprach: „Wat hait deser mensche gedaen? Ich in vynden keyne sache des dodes an eme.“ Do rieffen sy alle vnd luten als vnsynnige doeuende lude vnd spraichen: „He hait alle die werelt in bewegunge bracht vnd wil die ee zo stoiren vnd prediget eyne andere ee, vnd spricht he sy got.“ Do nam Pilatus Christus vnd vurte in weder in vnd sprach zo eme: „Nu hoires du wal wie din vulck ouer dich gedaen hait.“ Christus sweich vnd in [73va] wulde eme neit antworten. Do wart Pilatus zo rade mit synen rytteren, wie he sich versunen wulde mit Herodes, want he hatte gehoirt sagen dat Herodes Christum gerne gesehen hette; Auch vorte Pilatus Herodes, want he groisser here was dan he vnd gedechte dat sin zorn dar aue geen eme gestillet wurde, vnd sante eme Christum den süner alle der werelt. Vnd do in Herodes gesach, do wart sin hertze ervreuwet, Want he in hatte in nyeme gesehen vnd vil wunders van eme gehoirt sagen; Vnd dat was ouch die irste vnd die leste vreude die eme van gode vnd van Christo vmmer weder varen solde, Want he intfeynge in vroelichen vnd lies in schemelichen. He intfeynck in neit als eynen heren der he doch was; he intfeynck in als eynen zouuerer van dem he wunderliche dinge wulde hauen gehoirt. Vnd nam Christum vnd vürte in heymelichen [in eyne kamer] vnd bat in dat he eyn zeichen vur eme dede, Vnd geloefde eme darum [73vb] vil guedes. Do sweich Christus vnd dede als he neit in kunde. Do vurte in Herodes weder zo synen ritteren vnd sprach: „he in wil mir eyn wort neit antworten.“ Sy vragden in wannen he were ader wer he were. Christus sweich. Herodes sprach: „In bistu neit der durch des willen myn vader die kynder alle doite, Vnd den die conynge van orienten suchten zo eren vnd van dem alle Jutsche vulck ire ere verliesen sulde? Bistu it, sage it mir: Ich wil dich eren vnd wil dich ergetzen aller der smaicheit die myn vader dir vnd alle dyme vulcke hait gedaen.“ Do sweich Christus vnd in wulde eme eyn wort neit antworten. Dat versmede Herodes, want he wulde eyn here sin vnd sprach zo synen rytteren: „Nemet hyn den doir.“ Vnd hiesch in voiren in sin palais, Vnd hiesch eme eynen wyssen mantel an doen, vnd eynen stroen schappele vff setzen vnd sprach: „vüeret in weder zo Pilato, he hait gedaen dat he mochte; he waende mir [74ra] eynen wisen man senden, Vnd hait mir eynen doir gesant.“ Vnd sprach zo Christus vyanden: „wat wilt ir desem menschen angewynnen? he ist eyn doir, laist in gaen.“ Herodes hielde den vur eynen doir des doir he was. Vnd schickde eynen boeden mit Christo zo Pilato vnd sprach, wat eme der doir solde, he in wulde nye wort mit eme gereden, he in vunde neit darum he eme lieff ader leit sulde doen. Do namen in auer dat vulck van Herodes mit groissen duuelschen vnseden vnd mit groisser vngestumer pynen als auch vur vnd vurten in weder zo Pilato, Vnd hetten sy gedorst vur den ritteren, sy hetten in mit iren zenden zo ryssen, want sy verdrous des weges mit erne zo gaen hyn vnd her, Vnd hatten auch vorte dat he gelediget wurde van dem dode, des leuen sy neit in wulden, Vnd handelden in vil ouel vff dem wege mit vloichen, mit slaen, mit stoissen, mit roiffen vnd mit manichen ydawysen die sy eme daden. Also brachten sy in weder [74rb] zo Pilato, Vnd rieffen zo eme mit vngestumen hertzen vnd worten: „Wie lange leisses du vns yrre gaen mit desem menschen? warum in dues du neit schier dat du doen salt?“ Do nam Pilatus Christum vnd sprach auer zo eme: „waiffen, wat haistu gedaen dyme vulcke, dat sy so ergrymmet sint ouer dich?“ Do sprach Christus: „ich haen in vil guedes gedaen, Ich haen in ir blynden sehende gemacht vnd ir dauuen hoirende vnd ir lamen vffgerechtet vnd ir vssetzigen gereiniget vnd ir doden leuendich gemacht; Ich geswigen alle des gutz dat ich in ie haen gedaen vur mynre geburte.“ Do sprach Pilatus: „wes nymmestu dich an dat in gudes geschiet is vur dynre geburte? dat dede in got; Auer du spriches, du sist got.“ In der reden Do sweich Christus. Do sprach Pilatus: „bistu got, dat sage mir?“ Do sprach Christus: „Ich sagen dir, ich werden sitzende zo gerechte an godes stat ouer menschelich kunne, Vnd wee allen den die mich dir geantwort hant.“ Do mirck[74va]de Pilatus dat dat wee ouer in neit insulde gaen vnd lies in staen vnd gienge zo dem vulcke vnd sprach: „Ich in vynden keyne sachen des dodes ouer desen menschen.“ Vnd sade in allet dat Christus mit eme geredet hatte, wat he in zo guede gedaen hatte. Do rieffen sy mit duuelschen vnseden vnd spraichen: „He is eyn zouuerer, he hait mit zouuer alle syne wercke gedaen vnd ist eyn loegener vnd eyn affbrechere des guedes vnd eyn zo stoirer der gesetze in der ee vnd redet weder den keyser vnd verbudet eme synen zyns; Vnd he hait weder got geredet vnd spricht he sy got Vnd wil den tempel zo brechen vnd in dryn dagen wedermachen. He ist mit dem duuel besessen vnd mit dem duet he wat he duet; were he neit eyn schedelich mensche, wir in hetten in dir neit bracht.“ Do gienck Pilatus weder zo Christo vnd sade eme allet dat sy geredet hatten. Do sweich Christus vnd in gaff eme nye antworte. [74vb] Do nam he in auer vnd vurte in weder zo dem vulcke vnd sprach zo in: „wat geit mich des an?“ Do spraichen sy weder mit grymmicheit irs hertzen: „dat geit dich an alle vnrechte zo rechten; he ist eyn vngerechter mensche, darum haen wir in dir bracht.“ Vnd traden her vur vil velscher gezuge vnd bezuchten ouer Christum echt sachen die na irem gesetze waren zo besseren, Iecklich sache van zweyn mannen, van iecklichem manne mit virtzich slegen: also wurden der manne sechtzehen. Also vurte he Christum weder in vnd hiesch eme syn gewant vss zehen vnd hiesch in bynden an eyne steynen suyl, Vnd eme wurden die hende ouer dat houfft gezoegen, Vnd gebonden an die suyle, vnd hiesse machen groisse lange beseme van den scharpsten dornen die man vant, Vnd mit sulchen besemen sluegen in ie echt man ie zwene vnd zwene iecklicher virtzich siege vnd sloegen in also sere, dat der lyff aller zo [75ra] schremet wart, Vnd dat bloit ouer alle synen lyff genoichlich ran. Darna sloegen in ander echte mit geisselen, die hatte Pilatus heissen machen van ryndes huden mit starcken knouffen vnd waren die knouffe ouergossen mit blye vnd waren also grois als eyne boum nus. Da mit sloegen sy in so sere, dat sy dat vleisch van dem beyne zo ryssen, dat die stucke des vleissches an dem lyue hiengen vnd man dat gebeyne sach vnd dat bloit ouer dat gebeyne vlous. Vnd darna namen sy in van der suyl vnd daden eme eynen wissen samit an. Do ergreyff dat bloit den weichen samit vnd zouch in in die wonden. Vnd dar ouer daden sy eme eynen harnesche schoipen als eyme vursten der eynen sturm vanen vuren sal an eyme stryde, Vnd druckde eme die schoipe den weichen samit in alle syne wunden, dat he dar ynne verbacken stunt, want dat meynten sy auch. Vnd satten in neder vff eynen stoil, Vnd hatten gemacht eyne krone van scharpen dornen, Vnd [75rb] was die krone geschafft als eyn hut, vnd was zosamen gefloichten mit gewapenden henden, vnd namen die krone mit stecken vnd hoeuen sy eme vff sin houft, dat die dome drungen durch dat verseirde verswollen heufft so vaste, dat sy durch dat gebeyne drungen vff dat dunne uelle der hyrnnen. Die kroene was also grois dat sy bedeckte dat houfft vnd den nacken vnd die styrne, dat man des antzlitz wenich sach. Sy [sc. die dorne] staichen in die styrne vnd in die augeleder vnd in die slaiffe aderen vnd durch die oren Vnd in die [!] nacken, dat dat rosenvarwen bloit Christi durch alle sin antzlitze vnd ouer synen nacken genoichlichen vss flous, vnd machte eynen starcken flusse durch sin antzlitze vnd ouer synen lyff, Want sy hatten eme dat antzlitze zo slagen vnd zo mordet vnd zo murselt, vnd die bladeren waren zo brochen die sy eme gebrant hatten mit den heyssen eyerschalen, Vnd hienge die huyt an den wangen, vnd was durch gossen [vnd durch flossen] mit blode [75va] Vnd ouerzogen mit speichelen die sy mit iren vnreynen munden an in gespuwen hatten, vnd was sin antzlitz engestlich geschafft. Sy hatten auch [eme] des nachtes, do sy in viengen eyne fackelen gestoissen vnder sin antzlitz, van dem alle syn [wunnencliche] antzlitz flecklicht was worden. Vnd sy kneden vur in vnd grutzten in spotlichen, Vnd nanten in here, des vnderdenigen sy doch neit sin in wulden, Vnd braichen eme synen mont vff vnd samenden alle den vnflait den sy van monde ader van nasen hauen mochten, vnd spuwen eme in synen mont so vaste vnd so vil, dat he mochte er erstricket ader erdruncken sin van dem spien, dan dat he eme seluer mit der zungen halff, dat it eme zo ietweder sytten des mondes vss ran. Vnd dat in van der nasen gienge, dat wurffen sy eme vnder sin antzlitz, dat dat wunnencliche antlitze so vnreynlichen gehandelt wart, dat he allen den weder stunt die in an sagen. Sy gauen eme auch eynen [75vb] staff in syn hant als eyn koenyncklich scepter vnd namen auch vss sinre hant den seluen staff vnd sloegen in vff die croene, dat die dorne diefer suncken. Ouwe wie lies Christus so maniche doit suftzen. Do nam Pilatus den verwunten steruenden Christum vnd vurte in [vss] zo dem vulcke vnd sprach zo eme: „Sehet vren konynck.“ Vnd do in dat vulck gesach, do was dat antzlitze Christi so engestelichen geschaft, dat ir dufelsch gemoede vnd ir vnsynniche doeuende nature spranck uff mit wilder doeuender doeuicheit, Vnd keirden ir angesichte van eme vnd rieffen zo Pilato: „Do in vns van den augen vnd hencke in an den galgen des cruces.“ Do sprach Pilatus: „vr rechte is dat man uch eynen laisse, Ich haen desen gezuchtiget, wilt ir in laissen ader Barrabam?“ Do rieffen sy alle gemeynlich mit eynre duuelscher stymmen: „O lais Barrabam gaen vnd hanck desen an eyn cruce. He hait verschuldiget den lesterlichen doit.“ Do Christus dat hoirte, do [76ra] gienck eyn doitschus durch alle syne verwunte [steruende] nature. Ouwe, wie we dat Christo dede, wie gunde he in so rechte ouel des roiffens: he hette in bas gegunt dat sin doit in eyn nutze dan eyn vloich were gewurden. die tercie Also nam in auer Pilatus vnd voirte in in dat recht huys vnd sas zo gerechte vnd sprach: „Ich geuen ordel ouer Christum, dat he steruen sal des schemelichen dodes an dem cruce.“ Do gienck auer eyn doit angeste durch alle Christus nature, dat he also cranck wart, dat he kūme vff synen beynen gestaen kunde. Do namen sy eme die croene van dem houfde mit arbeide, Want die dorne waren verswollen in dem vleische, Vnd was dat vleische vnd dat bloit so vaste verbacken an den dornen, dat sy eme vleisch vnd hairs vil mit der kroenen van dem houffde zuegen. Die wunden wurden alle anderwerff vliesende. Do zuegen sy eme auch den schoipen aff, die was durch ronnen mit bloede dat [76rb] eme van den wonden des houfdes flouß, vnd der wisse samit den he an hatte, der was gelich wurden eyme roeden zyndaile van syme blode, he was auch verbacken in dat vleisch, dat sy in kūme dar vss geryssen. Sy namen den samit neden by den voissen vnd zoegen in mit groissen vnseden vnd grymmicheit irs hertzen vss dem vleische vnd vss den wonden, dat groisse klotzer beronnens bloitz an dem samit hiengen. Ouwe do wurden Christus wunden alle sament erfrisschit vnd ernuwet, Vnd wurden alle fliessende van blode vngevoige vlusse. Eme gienge auch vss van eicklicher wunden eyn doit schos vnd eyn wudende smertze durch alle syne gebeyne vnd durch alle syne nature. Darvmb daden sy eme sin gewant an an den verwunten serenden lyff. Sy lachten eme auch vff eynen sweren last des cruces vff synen müden verwunten vermorten rucke. Dat cruce was also swere vnd Christus was also swach, dat he dar vnder neder solde sin geuallen. Also [76va] mit dem cruce vurte in Pilatus weder zo dem vulcke vnd sprach: „Nemet hin vren Christum, sin bloit musse ouer uch comen vnd neit ouer mich.“ Vnd nam wasser vnd wusch sine hende vnd liesse sin harte gemoede vngewesschen. Dat boise vulck spranck vff van vreuden, dat he in in ir hant gegeuen was, vnd des was eme gar noit dat sy in balde brachten an die stat da sy in doden wulden. Dat was die vngenemste stat die sy irgen wisten. Sy vurten in auch als vngestumelich, dat he dicke neder struchelde vnder dem cruce. Sy betwongen eynen, dat he eme hulfe dragen. Auer hie van geschach eme me gedrucks dan eme helffe geschege. Ouwe wie lies Christus so manichen grymmen doit ochtzen vnd so manigen dieffen erhoilten grymmem doit suftzen, vnd dat in was neit vnbilch, Want he droich alle der werelt sonden vnd eynen sweren boum des cruces. Sy vurten in mit schalle, mit stoissen, mit iagen, mit dryuen als doeuende hunde die eynen wulf iagent. [76vb] Sy idewisten dat sanftmoedige lam vnd grysgramden vnd grynnen in an vnd schulden in vnd fluchten eme, dat he neit balde in mochte gaen. Do sy in an die stat brachten die da hiesch Caluarie, die was als vnreyne vnd rouch als ouel van den [vulen] vnreynen schelmen vnd van den verworden diefen vnd morderen die da lagen, dat sich alle ir doeuende gemoede freude, dat sy so eyn vnreyne stat hatten, dat sy sich genoich an Christo gerechen, die [!] rache doch van irem lyue vnd van irre selen nummer insolde komen, Want sy begiengen doch den groisten mort der ie geschach. Die duuel vreuweden sich, dat sy sich an dem gerochen hatten, Des raiche van in nummer in solde genomen werden. Die sexte: · · Ouwe, do gienck it an die noit. Sy namen dat krutze [vnd wurffen it] van syme rucke vnd zoegen dem got vereynigen menschen sin gewant vss, Vnd namen in mit dem haire vnd wurffen in vff dat cruce, he mochte aller zo sprungen hauen, Vnd zoegen eme synen verwonten [77ra] vnd zurmurtin rucke ouer die knorren des cruces, dat die stumpe van dem hultze die wunden van eyn ander ryssen. Sy sprungen auch mit wilder doeunder vnzuchte mit iren vnreynen voissen vff den doit versierden lyff Christi, sy kneden eme vff syne bruste vnd zo dienden eme syne armen van eyn ander so sy allermeiste mochten. Sy namen eme die rechte hant vnd zoegen sy eme zo dem loche des astes vnd sloegen eme eynen nagel dar durch. Der nagel was stumpetich vnd drieckig, Vnd die ecken waren scharpe als eyn messer, vnd vurten eme die huyt in der hant vnd etzwie vil des vleissches durch dat loch des cruces, vnd sloegen den naile so vaste, dat der knouff des nagils in der hant geflecht stunt, Vnd vulte die wonde so vol, dat eyn bloitz troppe neit dar vs in mochte. Do namen sy do die ander hant vnd zoegen sy eme ouer des cruces aste. Do was die hant so verre van dem loche, dat sy is neit in mochten erlangen. Do namen sy seil vnd [77rb] daden eme eynen strick an die hant vnd zoegen in so vaste, dat die aderen vnd die geleder vss eyn ander giengen, dat die hant gereichte dat loch. Vnd sloegen auch dar durch eynen nagel als vur, dat eyn eynich troppen bloitz neit dar vss in mochte gaen. Vnd giengen do vff eme hyn zo den voissen vnd streckten eme die voisse vff dem boume des cruces. Do gebrach in dat syne voisse neit in mochten gelangen zo dem loche etzwie manche spanne eyns mans. Do namen sy seile vnd machten eme stricke an beyde syne voisse, Vnd zoegen in so vaste vnd dienden in so sere, dat nye keyne seite so sere ader so veste vff eyn breit wart gedenet, bis dat sy gereichten dat loch. Vnd traden eme do vff die beyne vnd satten eme do die voisse vff eyn ander. Vnd ee dat der vnder vois durch slagen wurde, do was der ouerste vois van eyn ander gesplissen, vnd sloegen auch den nail so vaste, dat der knouff in dem voisse gevloicht stunt. Sy duchten synre noit neit [77va] genoich, Vnd namen eynen anderen nagel, der was groisser vnd langer dan der andere eyniger: den satzten sy eme vff dat geruste des vois, vff die dickte by dem beyne, vnd sloegen so grymmelichen vff den nagel mit alle ire crafte, dat dem nagel wurden zwey vnd XXX starcker hamer slege, Vnd wurden die wunden des nagels also grois, dat eyn eynich troppe bloitz dar vss neit in mochte. Vnd hüeuen do dat cruce vff vnd staichen it in eynen steyn, den hatten sy dar zo gehoilt. Der steyn was hohe van der erden vil na eyme manne bis an synen gurtel, Vnd bewarden dat cruce neit wal, dat it vaste stunde, Vnd do sy da van giengen, do verwant der lyff dat cruce, dat it neder viele vff die erde, dat dat antz[l]itze Christi in der erden stach als eyn ingesegel in dem wasse, Vnd dat die erde an dem antzlitze cleüede, Vnd der swere boum des cruces vff syme verwonten rucke lach, he mochte in hauen zo murselt. Do spranck dat doeuende vulck vff mit wilder vnzucht vnd spraichen [77vb], Sin vnselde in hette noch neit eyn ende genomen, vnd rechten dat cruce weder uff vnd satzten it do vestlichen in den steyne, dat sy sin aen sorge weren vur valle. Vnd do der lyff an dem cruce begunde hangen, do braichen die wunden uff, vnd vlouß genoichlichen dat bloit van den henden vnd van den voissen. Vnd was der lyff so gar verdenet, dat man alle syne geleder vnd alle syne rippen wal hette gezalt, Vnd da die geleder zosamen stiessen an schulderen vnd an armen, da hette man wal eyne hant dar intusschen gestoissen, Also was he zo denet. Vnd alle syne wunden daden sich vff, want der lyff Christi versegen was. Do giengen sy vmb dat cruce vnd lachten vnd spotten vnd rieffen alle vnd hatten alle duuelsche gebierde vnd giengen ir do eyn deil van eme, Vnd eyn deil bleyff alle da. Vnd do vnse frauwe sach dat kint dat sy mit gode gemeyne hatte so an dem cruce hangen vnd sweuen, do quam eyne doit gicht in alle ir gebeyne, vnd in [78ra] allet dat bloit irre aderen vnd ylte balde zo irem hertzen vnd begreyff die crafft yrs hertzen so sere, dat sy duchte dat eyn furich swert durch alle die craft irre selen gienge, Vnd alle die nature irs lyfs doitlich wurde. Vnd viel da hin als eyn mensche der van doits noit yntzunt verenden wil, dat alle die frauwen die by ir waren neit anders in waenden sy in wulde yntzunt steruen, vnd rieffen mit luder stymmen vnd spraichen: „O selige Maria, haen wir neit lydens genoich an dyns kyndes dode, du in willes ouch vns yntzunt van doedes noit verderuen vnd steruen?“ Do brach der steruende Christus syne augen vff die eme verbacken waren van blode vnd van vnreyner speicholter, vnd sach sinre moder noit. Do gienck eme auch eyne doitliche gicht durch alle syne nature vnd sprach: „Vrauwe, sich an din kint wie lesterlich it henget vnd wie pynlich it stiruet, hilff eme mitlyden.“ Dese worte hoirte Maria vnd viel auer hin in vnmacht. Do sprach Christus zo ir mit seriger stymmen: „Ouwe lieue vrau[78rb]we vnd moder, Wie duet mir dyn noit so wee! Nym dich an Iohannes zo eyme troiste, du in machs mich neit me hauen.“ Vnd kerde sich zo sente Iohannes mit dem worte vnd sprach: „Nym dich mynre moder an, Vnd der getruwester vnd der reynster frauwen die ie geboren wart; Lieue frunt Johannes, intwiche ir neit.“ Dese worte daden sente Iohannes also wee, dat in des duchte dat eme der doit neit also swere in were. Do dese worte gesprochen waren van Christo, do hoiff he eyn lange gebet an dat gienge an: Deus, deus meus respice, vnd was die stymme rederinde vnd zederende, nu was sy cleyne, dan was sy grois, nu was sy weynende gelich, dan was sy roiffende gelich. Do dat vss quam, do begunde he royffende vnd schriende mit eynre heysser durstiger stymmen. Nu warff he den lyff hyn, nu warff he sich her weder, dar zo dreyff in des dodes angeste. Do spraichen die mordere vnder eyn ander: „Wir solen eme dryncken geuen, so stiruet he die ee [78va], so werden wir sin ledich.“ Also gienck eynre hin vnd bant zosamen eynen vnreynen wusch van stroe vnd van gemulle, als he it vant, Vnd bant dat vestenclich zosamen, dat it vil des drancks inthalden mochte. Vnd machten eynen vergiftigen vnreynen dranck in eyme vnreynen vasse: Eynre der brechte essich, der ander brachte vische galle, Der dritte brachte ruysse, der virte brachte saltz, als eyns eicklichen gemude gestalt was mit grymme uff Christum, vnd rurten dat vnder eyn ander vnd brachten it zo dem cruce. Vnd bunden do den vnreynen wusch an eyn hultze vnd steissen in in den vnreynen dranck vnd druckden in veste dar in, dat he sin vil in sich intfaen mochte. Vnd stiessen [vnd sloegen?] it eme an den mont, dat he des vnreynen drancks mochte versuchen. Vnd der dranck der vlouß eme durch den mont in die kele, vnd da van so wart die kele inwendich verseret, die vur nochtant vnverseret gewest was, Vnd wart also verwont vnd verseret, dat an Christus personen neit in [78vb] was inwendich noch vswendich, is were verseret beyde van des dodes grymmicheit inwendich vnd van der pynlicher martelen vswendich. die noene DO rieff he mit vngestumer stymmen zo dem vader vnd sprach zo eme: „Vader, warum haistu mich gelaissen? ich haen doch dynen willen vullen vurt vnd menschelich kunne ist erloist, Getruwe vader, sich an dyns kyndes noit vnd lais mich dir beuoelen sin, Vnd ich laissen mynen geist in dyne geweldige hende.“ Do he dat wort gesprach, do begunde mit syme gotlichen willen der doit ylen zo dem hertzen, want he hatte dat marck vnd die aderen alle gederret, Vnd quam mit vngestumen doitschussen zo dem hertzen, dat he it doiden wulde, Want der lyff der was aller doit, dan ocker dat hertze: dat bestunt der doit so wuedende dat die doitstiche in dat hertze den doiden mont Vnd die doide augen vff braichen vnd den doiden lyff Christi aller erschutte vnd bewegde. Vnd do dat geschach [79ra] do verleschte die sonne, Vnd erbeude die erde vnd zo spielt der steyn, da dat cruce ynne stunt, vnd zo reys der vmbhanck des tempels, Vnd do zo spielde auch dat hertze Christi. Vnd da vur was so groisse noit an Christus licham vnd [liue] dat eyn doit vinsternysse wart, Dat nyeman insach noch in mirkde dat engestliche steruen Christi, Vff dat dat da van nyeman verzagde noch verzwyuelde. Dat vynsternysse was also grois vnd dick, dat neit van dem hemel ader van der luft schyns gienck vff dat ertrich, Vnd in dem steruen Christi was alle leuendige creature vnder dem hemel in vorten: Der voegel in der lufte, der visch in dem wage, der wurme in der erden, Vnd geschach in der seluer stunden dat menschen vnd andere creaturen vil starff, Vnd sonderlich die die he zo der stunden kranck vant, van der groister angeste die durch aller creaturen nature dranck. Vnd do Christus geiste van eme geschiede, do quam eyn furich schus in alle vy[79rb]ande, sy weren in der hellen ader in buyssen in dodes gelicheit, Want der der dem dode angeseget hatte, der schickde do dit wee an sy, dat in nummer benomen wirt, Vnd dat ist dat ander dodes we, Want dat irste intfeyngen sy mit fryer willekure do sy sich van gode geschieden, Auer dat dritte werden sy intfangen an dem jungesten gerechte. Vnd also als die duuel intfeyngen eyne [!] dodes wee, Also intfiengen in der seluer stunden die selen die in der vurburge der hellen waren eyne leuendige vreude die in nummer benomen sal werden, Vnd die selue vreude wart gezweyueldiget, do sy mit Christo zo hemel vuren, Vnd wirt gedryueldiget in dem Jungesten dage, so lyff vnd sele zosamen koment. Vnd do dat vynsternysse vergienck vnd dat liecht weder quam, want alle creaturen in dodes anxt waren, Vnd sonderlichen die syn wederwortigen by dem cruce, die waren gelegen als sy doit weren, die wurden weder erquicket [79va] Vnd stunden weder vff, vnd wurden irre vergiftige hertzen also vnmylde vnd also hart geen Christum als vur, Vnd were he neit doit gewesen, sy hetten eme anderwerue gedaen wat sy gemocht hetten. Also sagen sy ouer sich, Vnd sagen Christum an, Vnd sagen dat eme der munt vnd die augen aen wencken vffen stunden, vnd sprachen: „He leuet noch, he erhoilet sich, wat solen wir doen?“ Do sprach eynre: „wir solen eme durch syne syte stechen, so sehen wir off he sich rure.“ Dat in wulde ire keynre doen. Also was eyn blynder man dar geuoirt, dat he wulde hoiren van den wunderen die an Christo begangen wurden, Want he in mochte irre neit gesehen. Vnd do he die rede vnder in gehoirte, do bat he dat man eme eyn sper geue, vnd trat hyn naire zo dem steyne, da dat cruce in stunt, vnd bat dat man eme dat spere setzte an Christus sitte, da die zwa nederste rippen synt, die da reyme[n]t geen dem hertzen, Vnd he druckte dat spere van grymme syns [79vb] hertzen vnd van vngunst die he gen Christum hatte mit alle synre crafte durch die site. Vnd do he dat sper druckte durch die ryppe in die sitte, Do crachte it van der durricheit des lyues, als der eynen durren sliemen reisst mit crafte, Vnd wunte dat doede hertze Christi also, dat allet dat bloit vnd die vuchticheit die sich inthalden hatte vmb Christus hertze vnd in syme hertzen – dat dat gewan eynen groissen sturmigen flus vnd schus zo der wunden vss, Also dat it van dem sper aueran eme vff syne hende also warm, als off it gienge van eyme leuendigen lamme. Also streich he die hende mit dem blode mit vngeschichte vur die augen, Vnd do giengen eme die augen vff vnd wart sehende, Vnd do sach he ouer sich vnd sach Christum bouen eme hangen. Vnd do wurden eme die ynnre augen vf gedaen, Vnd do rieff he mit eynre luder stymmen vnd sprach: „Ouwe myn grymme ouel hertze, dat sich gevreuwet wolde haen an dem doden [80ra] Christo, Wie ist mir dat zo so groissem heile comen, Want sin heilsam bloit hait mich blynden sehende gemacht, vnd sin doede hertze dat ich gedoit wulde haen, dat hait myn doide hertze leuendich gemacht, want ich erkennen dat syne guede myn vbel hait verdreuen.“ Die vesper DArna namen in Joseph vnd Nychodemus vnd Johannes vnd anderen vil die in iet erkanten, die eme huluen Christum van dem cruce heuen, Vnd lachten in vff die erde, vnd der licham was swartz, durre vnd durch gerunnen, Vnd die wonden zo kynen vnd die geleder van eyn ander gewydet vnd dat gebeyne zo schrundelt an dem lyue. Vnd do he vff der erden also lach, do quam die iemerliche moder vnd wulde sich haen geneyget vff den doiden Christum, Vnd van dem angesichte yrs kyndes do quam eyn doitschus durch alle die craft ire selen, balde ylende zo irem hertzen, dat ir aller craft gebrach, Vnd ersturuen ir alle irre geleder, dat ir ade[80rb]ren vnd ire hende wurden als strackis erstabet als eyn hultz van des dodes engesten die ir hertze do begryffen. Dat clagen dat sy da begienge vnd die geberde die sy da hatte, dat in kan nyeman mit worten wal gesagen, dat bedencke eyn eicklich getruwe hertze seluer. Sy viele neder vff ir dode kint. Do namen sy auer die frauwen vnd sente Johannes vnd hoeuen sy vff vnd lechten sy dahyn. Vnd do sy weder zo ir seluer quam, do sach sy ir kint da vur ir lygen, do wolde sy auer zo eme sien, do in hatte sy der craft neit. Vnd do hoeuen sy vf die vrauwen vnd sente Johannes: Van den wolde sy sich intbrechen vnd wolde weder zo irem kynde sien. Do sprach der mylde getruwe here sente Iohannes: „O reyne getruwe vrauwe vnd moder, gedencke dat ich dir zo eyme kinde gegeuen byn vnd ere mich vnd blyff sitzende, ich wil dir dyn kynt in dynen schois geuen.“ Also namen Joseph vnd Nychodemus vnd Johannes den verwonten verdorreden Christo [!] [80va] van der erden, Vnd lechten in in der jemerlicher moder schois. Ouwe, wie we irem hertzen wart, do sy dat angesichte an sach so engestelichen geschaft, dat sy da vur mit groissen vreuden dicke hatte angesehen, Want it was verswollen doitbluedich, Vnd die hut vnder dem antzlitz was zo brochen van der byrnender fackelen, Vnd van den bladeren die eme van den [gebranten] eyerschalen waren wurden, Vnd in den bruchen van der huyt waren renffte worden van dem blode vnd van dem speicholter. Ach wie dicke sy lies ir reyne augen vnd ire hende ouer dat antzlitze vnd ouer den verwonten lycham gaen. Sy wulden in ir nemen vnd in die erde legen. Do sloich sy ir hende vnd irre armen vmb in so vaste vnd druckte in an ir hertze so begerlichen, vnd hatte ir moederliche hertze so groisse quale, dat sy eyn eynich wort neit geleisten in kunde. Vnd alle die by ir waren wurden schryende, do sy dat engestliche ryngen sagen [80vb] van der moder. Sy zoegen in hin, Sy zoege in her weder. Sy hatte in so beslossen in den armen, als off sy mit yseren benden an in gebonden were. Sy huuen sy an dem doeden Ihesum mit gewalt vff, Vnd zuegen sy etzwie verre mit eme na zo dem graue. Die compeleta DO sy dat jamer an ir sagen dat sy neit erwynden wulde, do intslussen sy ir [die hende van eyn ander vnd braichen ir] die armen vff vnd namen ir den doiden Ihesus mit gewalt, Vnd do sy berouuet was yrs kyndes, do viele sy in amecht vnd lach also [lange] in der kranckheit aen alle bewegunge, bis dat der licham in eyn doich bewunden wart vnd der steyn vur dat graff gestoissen wart, Dat sy sin neit gesien in mochte. Vnd do ir engelsche gemoede weder quam vnd sy irs kyndes neit in sach, do houff sich an eyn worte in irem moederlichen hertzen, eyne altzo jemerliche clage. Sy sprach ir irem geiste: „O du dicker harter steyn, nu haistu mir myn kynt [ver-] [81ra] verborgen. Och du gotliche nature, wie mochtestu dat gelyden an dyme soene vnd an myme kynde? O du harter steyn, nu haistu beslossen die ere des vaders, die vreude der engel, dat heil aller menschen, mynen eynigen troist.“ Do sprach dat vederliche gemoede [in dat mynnenclich gemoede Marien]: „O vreude vnd frauwe vnd moder myn, in dyme kinde din grois krefftich gelouue, dyn vnverstoirt zouersicht, dyne furige demuedige mynne: die hait gelanget bis in die hoide mynre gewalt, vnd hait gegrundet die dieffte mynre clairheit, Vnd hait genomen den son van mynre gotlicher gelust vnd hait in in die erde gelecht. Gehalt dich wal, freude vnd frauwe aller seliger geiste! ich wil in dir werlich weder geuen in aller clairheit.“ Do sweich dat moederliche getruwe hertze vnd lies sich do die vrauwen vuren in die stat als eynen halff doden menschen. Sy lechten sy neder zo bette vnd hutten sy mit vlysse als eynen menschen der yntzunt verenden [81rb] wil, Want sy bevunden wenich leuens in ir. Also lach dat engelsche gemoede in der kranckheit aen alle lyffliche narunge, bis dat ir son erstunt van den doiden. Eyn wenich na mytter nacht na dem samsdage, do quam die gewalt des hemelschen vaders mit dem leuendigen geiste Christi, Vnd sprach mit gotlicher begerden zo dem licham Christi: „Stant vff myne freude! stant vff myne ere! stant vff myne wunne aen allen smertzen, aen alle pyne, Nym weder in dich den leuendigen geiste mynre ewiger geluste.“ Also rechte sich Christus lyff vff mit vnzusturlicher wunnen, mit ewiger clairheit, mit ewiger gewalt, in gotlicher mancraft, vnd alle die doit mail die an Christo waren, die wurden durch gossen mit gotlicher wunnen, mit gotlicher eren, vnd wart gedrungen in alle die nature des lyues Christi, Vnd also die nature Christi wart durch gedrungen mit gotlicher clairheit, Want der selue got was mensche, Vnd der selue [81va] mensche was got, Want die gotheit in geschiede nye van selen noch van lyue, so wie dat sy zwey in dem dode gescheiden wurden. Do Christus was erstanden do ylte he zo synre vngetroister moder vnd sprach zo ir: „Sich vrauwe vnd moder dyn kynt mit aller eren vnd gewalt. Gehalt dich wal vnd sys vroe vnd rechte dich vff van allem leyde, der doit in hait an mir keyne gewalt me.“ Ouwe wie mit groissen freuden die moder dat kynt an sach. Do sprach he ir auer zo: „troiste die anderen vnd sage in dat du mich gesehen hais, vnd ich sagen dir: In der eren vnd in der freuden da du mich ynne gesehen hais in werden ich dir nummer benomen in der zyt mit rechter zo versichte vnd in der ewicheit mit ewiger vreuden vnd stedicheit.“ Also schiede Christus van ir, Vnd do quamen die frauwen zo ir vnd saden ir dat sy in gesehen hatten, Vnd mit groisser vreuden sade sy in weder dat he by ir we[81vb]re gewest, Vnd wie he mit ir geret hatte. Hie hait die passie eyn ende. Frühneuhochdeutsche Literatur 15. Jahrhundert Johannes von Tepl 1342/50 - um 1414 Der Autor Johannes von Tepl, wurde zwischen 1342 und 1350 im böhmischen Tepl (Teplá) geboren. Nach dem Studium in Prag - vielleicht auch in Bologna, Padua oder Paris war er etwa von 1373 an in Saaz als notarius civitatis und später auch als rector scholarium, als Leiter der örtlichen Lateinschule tätig. 1411 ging er als Protonotar nach Prag, wo er um 1414 gestorben ist. Um 1401 verfasste er das Streitgespräch eines Ackermanns mit dem Tod, dessen erstes Exemplar er 1402 mit einem lateinischen Begleitschreiben an seinen Jugendfreund, den jüdischen Gelehrten Petrus Rother schickte. Daß dem «Ackerman» persönliches Erleben zugrunde liegt, ist eher unwahrscheinlich, da seine urkundlich belegte Ehefrau Clara - nicht Margaretha - ihn mit mehreren, 1415 bereits erwachsenen Kindern überlebt hat. Möglicherweise handelt es sich um eine fingierte Person oder um eine nicht bekannte Jugendliebe. Der Text ist in 16 Handschriften und 15 Frühdrucken überliefert, die älteste Handschrift stammt allerdings erst aus dem Jahre 1449. Daneben hat sich eine alttschechische Bearbeitung aus dem Jahre 1408 erhalten. Im Schlußkapitel des Textes findet sich ein Akrostichon mit den Initialen JOHANNES MA. Der Ackerman 1401 Der Text folgt der Ausgabe: Johannes von Saaz, Der Ackermann aus Böhmen, hg. v. Günther Jungbluth, Band I, Germanische Bibliothek, 4. Reihe: Texte, Heidelberg: Winter 1969 Textgrundlage ist die digitale Ausgabe der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, die leider nicht mehr im Netz ist. Das lateinische Begleitschreiben an den jüdischen Jugendfreund sowie die Überschrift sind der Ausgabe von Christian Kiening im Reclam-Verlag entnommen (Stuttgart 2002). _____________________________________________ _______________ Titel des Basler Drucks von 1473 (Karlsruhe, Bad. Landesbibliothek) Epistola oblata Petro Rothers ciui Pragensi cum Libello ackerman de nouo dictato. Grato gratus, suo suus, socio socius, Petro de Tepla Johannes de Tepla, ciui Pragensi ciuis Zacensis philorticam karitatem et fraternam. Karitas que nos horis floride iuuentutis vniuit, me hortatur et cogit vestri memoria consolari et quia postulabatis nuper per me de et ex agro rethoricalis iocunditatis, in quo cum messem neglexerim spicas colligo, nouitatibus munerari, ideo hoc incomptum et agreste ex teutunico ligwagio consertum agregamen, quod iam uadit ab incode, vobis dono. Jn eo tamen per preasumptum grosse materie jnueccio contra fatum mortis ineuitabile situatur, jn qua rethorice essencialia exprimuntur. Jbi longa breuiatur, ibi curta materia prolongatur, ibidem rerum, ymmo quoque vnius et eiusdem rei laus cum vituperio continentur. Succisa inuenitur, jnvenitur sibi construccio suspensiua, cum equiuocacione sinonimacio. Illic currunt cola, coma, periodus modernis situacionibus; illic ludunt vna sede retinentj cum serio palponia. Methaphora famulatur, arenga invehitur et demollitur, yrronia sorridet; verbales et sentencionales colores cum figuris sua officia execuntur. Multa quoque alia et tamquam omnia utcumque inculta rethorice accumina, que possunt fieri in hoc ydeomate jndeclinabili, ibi vigent que intentus inveniet auscultator. Tandem uos latinis de agro meo sterili enuditibus stipilis recreabo. Jnter cetera Nicolaum Iohlinni, oblatorem presencium, amari et alumpnum meum vobis tamquam me recomendo intentis et fidelibus effectibus preessendum. Reliqua stent ut stabant, nisi fuerint in uberius reformata. Datum sub mei signetj euidencia uigilia beatj Bartholomei Anno 1428uo. [Datum einer Abschrift des Originalbriefs (ca. 1402)] Jn dem buchlein ist beschrieben ein krieg, wie einer, dem sein liebes gestorben ist, schiltet den Tot, so verantwortt sich der Tot. Also seczt der clager je ein cappittel vnd der Tot das ander bis an das ende. Der cappittel seint vier vnd dreyssig, dorjnn man hubsches synnes getichtes behendigkeit wol findet, vnd begynnet also der ackerman mit seyner clage anzuvahen. DER ACKERMAN. Das erste capitel. Grimmiger tilger aller lande, schedlicher echter aller werlte, freissamer morder aller guten leute, ir Tot, euch sei verfluchet! got, ewer tirmer, hasse euch, vnselden merung wone euch bei, vngeluck hause gewaltiglich zu euch: zumale geschant seit immer! Angst, not vnd jamer verlassen euch nicht, wo ir wandert; leit, betrubnuß vnd kummer beleiten euch allenthalben; leidige anfechtung, schentliche zuversicht vnd schemliche verserung die betwingen euch groblich an aller stat; himel, erde, sunne, mone, gestirne, mer, wag, berg, gefilde, tal, awe, der helle abgrunt, auch alles, das leben vnd wesen hat, sei euch vnholt, vngunstig vnd fluchend ewiglichen! In bosheit versinket, in jamerigem ellende verswindet vnd in der vnwiderbringenden swersten achte gotes, aller leute vnd ieglicher schepfung alle zukunftige zeit beleibet! Vnuerschampter bosewicht, ewer bose gedechtnuß lebe vnd tauere hin on ende; grawe vnd forchte scheiden von euch nicht, wo ir wandert vnd wonet: Von mir vnd aller menniglich sei stetiglichen vber euch ernstlich zeter geschriren mit gewundenen henden! DER TOT. Das ander capitel. Horet, horet, horet newe wunder! Grausame vnd vngehorte teidinge fechten vns an. Von wann die komen, das ist vns zumale fremde. Doch drowens, fluchens, zetergeschreies, vnd allerlei angeratung sein wir an allen enden vnz her wol genesen. Dannoch, sun, wer du bist, melde dich vnd lautmere, was dir leides von vns widerfaren sei, darvmb du vns so vnzimlichen handelst, des wir vormals vngewonet sein, allein wir doch manigen kunstenreichen, edeln, schonen, mechtigen vnd heftigen leuten sere vber den rein haben gegraset, davon witwen vnd weisen, landen vnd leuten leides genugelich ist geschehen. Du tust dem gleiche, als dir ernst sei vnd dich not swerlich betwinge. Dein klage ist one reime; davon wir prufen, du wellest durch donens vnd reimens willen deinem sin nicht entweichen. Bistu aber tobend, wutend, twalmig oder anderswo one sinne, so verzeuch, enthalt vnd bis nicht zu snelle, so swerlich zu fluchen, den worten das du nicht bekummert werdest mit afterrewe. Wene nicht, das du vnser herliche vnd gewaltige macht immer mugest geswechen. Dannoch nenne dich vnd versweig nicht, welcherlei sachen dir sei von vns so twenglicher gewalt begegent. Rechtfertig wir wol werden, rechtfertig ist vnser geferte. Wir wissen nicht, wes du vns so frevellichen zeihest. DER ACKERMAN. Das III. capitel. Ich bins genant ein ackerman, von vogelwat ist mein pflug, vnd wone in Behemer lande. Gehessig, widerwertig vnd widerstrebend sol ich euch immer wesen: wann ir habt mir den zwelften buchstaben, meiner freuden horte, aus dem alphabet gar freissamlich enzucket; ir habt meiner wunnen lichte sumerblumen mir aus meines herzen anger jemerlichen ausgereutet; ir habt mir meiner selden haft, mein auserwelte turteltauben arglistiglichen entfremdet: ir habt vnwiderbringlichen raub an mir getan! Weget es selber, ob ich icht billich zurne, wute vnd klage: von euch bin ich freudenreiches wesens beraubet, tegelicher guter lebetage enterbet vnd aller wunnebringender rente geeussert. Frut vnd fro was ich vormals zu aller stunt; kurz vnd lustsam was mir alle weile tag vnd nacht, in gleicher masse freudenreich, geudenreich sie beide; ein iegliches jar was mir ein genadenreichs jar. Nu wirt zu mir gesprochen: schab ab! Bei trubem getranke, auf durrem aste, betrubet, sware vnd zeherend beleibe ich vnd heul one vnderlaß! Also treibet mich der wint, ich swimme dahin durch des wilden meres flut, die tunnen haben vberhant genumen, mein anker haftet ninder. Hiervmb ich one ende schreien wil: Ir Tot, euch sei verfluchet! DER TOT. Das IIII. capitel. Wunder nimpt vns solcher vngehorter anfechtung, die vns nimmer hat begegent. Bistu es ein ackerman, wonend in Behemer lande, so dunket vns, du tust vns heftiglichen vnrecht; wann wir in langer zeit zu Behem nicht endeliches haben geschaffet, sunder nu newlich in einer festen hubschen stat, auf einem berge werlich gelegen; der haben vier buchstaben, der achzehende, der erste, der dritte vnd der drei vnd zwenzigste in dem alphabet einen namen geflochten. Da haben wir mit einer erberen seligen tochter vnser genade gewurket; ir buchstabe was der zwelfte. Sie was ganz frum vnd wandelsfrei; wir mugen wol sprechen wandelsfrei, wann wir waren gegenwurtig, do sie geboren wart. Do sante ir fraw Ere einen erenmantel vnd einen erenkranz; die brachte ir fraw Selde. Vnzerissen vnd vngemeiligt den mantel, den erenkranz brachte sie ganz mit ir vnz in die gruben. Vnser vnd ir gezeuge ist der erkenner aller herzen. Guter gewissen, frunthold, getrew, gewere vnd zumale gutig was sie gen allen leuten. Werlich, so stete vnd so geheure kam vns zu handen selten. Es sei dann die selbe, die du meinest: anders wissen wir keine. DER ACKERMAN. Das V. capitel. Ja herre, ich was ir friedel, sie mein amye. Ir habt sie hin, mein durchlustige eugelweide; sie ist dahin, mein frideschilt vur vngemach; enweg ist mein warsagende wunschelrute. Hin ist hin! Da ste ich armer ackerman allein; verswunden ist mein lichter leitestern an dem himel; zu reste ist gegangen meines heiles sunne, auf geet sie mir nimmermer! Nicht mer get auf mein flutender morgensterne, gelegen ist sein schein, kein leidvertreib han ich mer: die finster nacht ist allenthalben vor meinen augen. Ich wene nicht, das icht sei, das mir rechte freude immermer muge widerbringen; wann meiner freuden achtber banier ist mir leider vndergangen. Zeter! waffen! von herzen grunde sei immermer geschriren vber den verworfen tag vnd vber die leidigen stunde, darin mein herter, steter diamant ist zerbrochen, darin mein rechte furender leitestab vnbarmherziglich mir aus den henden wart gerucket, darin zu meines heiles vernewendem jungbrunnen mir der weg ist verhawen. Ach one ende, we one vnderlaß immermer! Versinken, gefelle vnd ewiger fal sei euch, Tot, zu erbeigen gegeben! Lastermeiliger schandung wurdelos vnd grisgramig ersterbet vnd in der helle erstinket! got beraube euch ewrer macht vnd lasse euch zu puluer zerstieben! One zil habet ein teufelisch wesen! DER TOT. Das VI. capitel. Ein fuchs slug einen slafenden lewen an den backen, darvmb wart im sein balg gerissen; ein hase zwackte einen wolf, noch heute ist er zagellos darvmb; ein katze krelte einen hunt, der da slafen wolte, immer muß sie des hundes feintschaft tragen. Also wiltu dich an vns reiben. Doch gelauben wir, knecht knecht, herre beleibe herre. Wir wellen beweisen, das wir rechte wegen, rechte richten vnd rechte faren in der werlte: niemandes adels schonen, grosser kunst nicht achten, keinerlei schone ansehen, gabe, liebes, leides, alters, jugent vnd allerlei sachen nicht wegen. Wir tun als die sunne, die scheinet vber gute vnd bose: wir nemen gute vnd bose in vnsern gewalt. Alle die meister, die die geiste kunnen twingen, mussen vns ire geiste antwurten vnd aufgeben; die bilwisse vnd die zauberinne kunnen vor vns nicht beleiben, sie hilfet nicht, das sie reiten auf den krucken, das sie reiten auf den bocken; die erzte, die den leuten das leben lengen, mussen vns zu teile werden, wurze, kraut, salben vnd allerlei apotekenpuluerei kunnen sie nicht gehelfen. O solten wir allen den feifaltern vnd hewschrecken rechnung tun vmb ir geslechte, an der rechnung wurden wir nicht genugen. O solten wir durch aufsatzes, alafantzes, liebes oder leides willen die leute lassen leben, aller der werlte keisertum were nu vnser, alle kunige hetten ir krone auf vnser haubet gesetzet, ir zepter in vnser hant geantwurt, des babstes stul mit seiner dreikronter infel weren wir nu gewaltig. Laß sten dein fluchen, sage nicht von Poppenfels newe mere; hawe nicht vber dich, so reren dir die spene nicht in die augen! DER ACKERMAN. Das VII. capitel. Kunde ich euch gefluchen, kunde ich euch geschelten, kunde ich euch verpfeien, das euch wirs dann vbel geschehe, das hettet ir snodlichen wol an mir verdienet. Wann nach grossem leide grosse klage sol folgen: vnmenschlich tet ich, wo ich solch lobeliche gotes gabe, die niemant dann got allein geben mag, nicht beweinte. Zware trauren sol ich immer; entflogen ist mir mein erenreicher falke; mein tugendhafte frawen billichen klage ich, wann sie was edel der geburte, reich der eren, schone, frut vber alle ire gespilen gewachsener persone, warhaftig vnd zuchtig der worte, keusche des leibes, guter vnd frolicher mitwonung. Ich sweige als mer, ich bin zu swach, alle ir ere vnd tugent, die got selber ir hat mitgeteilt, zu volsagen; herre Tot, ir wisset es selber. Vmb solch groß herzeleit sol ich euch mit rechte zusuchen. Werlich, were icht gutes an euch, es solte euch selber erbarmen. Ich wil keren von euch, von euch nicht gutes sagen, mit allem meinem vermugen wil ich euch ewiglich widerstreben; alle gotes tirmung sol mir beistendig wesen wider euch zu wurken; euch neide vnd hasse alles das reich, das da ist im himel, auf erden vnd in der helle! DER TOT. Das VIII. capitel. Des himels tron den guten geisten, der helle abgrunt den bosen, irdische lant hat got vns zu erbeteile gegeben. Dem himel fride vnd lon nach tugenden, der helle pein vnd strafung nach sunden, der erden, luft vnd meres strame mit aller irer behaltung hat vnstetigkeit der mechtig aller werlte herzog beschiden vnd sie vns befolhen, den worten das wir alle vberflussigkeit ausreuten vnd ausjeten sollen. Nim vur dich, tummer man, prufe vnd grab mit sinnes grabestickel in die vernunft, so findestu: hetten wir sider des ersten von leime gekleckten mannes zeit leute auf erden, tiere vnd wurme in wustung vnd in wilden heiden, schuppentragender vnd slipferiger fische in dem wage zuwachsung vnd merung nicht ausgereutet, vor kleinen mucken mochte nu niemant beleiben, vor wolfen torste nu niemant aus; es wurde fressen ein mensche das ander, ein tier das ander, ein ieglich lebendige beschaffung die ander, wann narung wurde in gebrechen, die erde wurde in zu enge. Er ist tumb, wer beweinet den tot der totlichen. Laß ab! Die lebendigen mit den lebendigen, die toten mit den toten, als vnz her ist gewesen. Bedenke baß, du tummer, was du klagen sullest! DER ACKERMAN. Das VIIII. capitel. Vnwiderbringlichen mein hochsten hort han ich verloren; sol ich nicht wesen traurig? Ja, jamerig muß ich bis an mein ende harren, entweret aller freuden. Der milte got, der mechtige herre, gereche mich an euch, arger traurenmacher! Enteigent habt ir mich aller wunnen, beraubet lieber lebetage, entspenet micheler eren. Michel ere het ich, wann die guten die reinen tochter engelten mit iren kindern, in reinem neste gefallen. Tot ist die henne, die da auszoch solche huner. O got, du gewaltiger herre, wie liebe sach ich mir, wann sie so zuchtiges ganges pflag vnd alle ere bedenken kunde vnd sie menschliches geslechte do lieblich segente, sprechend: «Dank, lob vnd ere habe die zarte tochter; ir vnd iren nestlingen gunne got alles gutes!» Kunde ich darvmb gote wol gedanken, werlich ich tet es willichen. Welchen armen man hette er balde so reichlich begabet? Man rede, was man welle: wen got mit einem reinen, zuchtigen vnd schonen weibe begabet, der ist volkomenlich begabet, vnd die gabe heisset gabe vnd ist ein gabe vor aller irdischer auswendiger gabe. O aller gewaltigster himelgrave, wie wol ist dem geschehen, den du mit einem reinen, vnuermeiligten gaten hast begatet! Frewe dich, ersamer man, reines weibes, frewe dich, reines weib, ersames mannes: got gebe euch freude beiden! Was weiß davon ein tummer man, der aus disem jungbrunnen nie hat getrunken? Allein mir twenglich herzeleit ist geschehen, dannoch danke ich got inniglich, das ich die vnuerruckten tochter han erkant. Euch, boser Tot, aller leute feint, sei got ewiglich gehessig! DER TOT. Das X. capitel. Du hast nicht aus der weisheit brunnen getrunken, das prufen wir an deinen worten. In der naturen wurken hastu nicht gesehen, in die mischung werltlicher stende hastu nicht geluget, in irdische Verwandelung hastu nicht gegutzet; ein vnuerstendig welf bistu. Merke, wie die leuchtigen rosen vnd die starkriechenden lilien in den gerten, wie die kreftigen wurze vnd die lustgebenden blumen in den awen, wie die feststeenden steine vnd die hochwachsenden baume in wildem gefilde, wie die krafthabenden beren vnd die starkwaltigen lewen in entrischen wustungen, wie die hochmachtigen starken recken, wie die behenden, abentewerlichen, hochgelerten vnd allerlei meisterschaft wol vermugenden leute vnd wie alle irdische creature, wie kunstig, wie listig, wie stark sie sein, wie lange sie sich enthalten, wie lange sie es treiben, mussen zu nichte werden vnd verfallen allenthalben. Vnd wann nu alle menschgeslechte, die gewesen sint, sint oder noch werden, mussen von wesen zu nichtwesen kumen, wes solte die gelobte, die du beweinest, geniessen, das ir nicht geschehe als andern allen vnd allen andern als ir? Du selber wirst vns nicht entrinnen, wie wenig du des ietzund getrawest. Alle hernach! muß ewer ieglicher sprechen. Dein klage ist enwicht; sic hilfet dich nicht, sie geet aus tauben sinnen. DER ACKERMAN. Das XI. capitel. Got, der mein vnd ewer gewaltig ist, getrawe ich wol, er werde mich vor euch beschirmen vnd vmb die verwurkten vbeltat, die ir an mir begangen habet, strengelich an euch gerechen. Gaukelweise traget ir mir war vnder, falsch mischet ir mir ein vnd wellet mir mein vngehewer sinneleit, vernunftleit vnd herzeleit aus den augen, aus den sinnen vnd aus dem mute slahen. Ir schaffet nicht, wann mich rewet mein serige verlust, die ich nimmer widerbringen mag. Vur alles wee vnd vngemach mein heilsame erzenei, meines gutes dienerin, meines willens pflegerin, meines leibes auswarterin, meiner eren vnd irer eren tegelich vnd nechtlich wachterin was sie vnuerdrossen. Was ir empfolhen wart, das wart von ir ganz reine vnd vnuerseret, oft mit merung widerreichet. Ere, Zucht, Keusche, Milte, Trewe, Masse, Sorge vnd Bescheidenheit wonten stete in irem hofe; Scham trug stete der Eren spiegel vor iren augen. Got was ir gunstiger hanthaber. Er was auch mir gunstig vnd genedig durch iren willen; Heil, Selde vnd Gelucke stunden mir bei durch iren willen. Das het sie an got erworben vnd verdienet, die reine hausere. Lon vnd genedigen solt gib ir, milter loner aller trewen soldener, aller reichster herre! Tu ir genediglicher, wann ich ir kan gewunschen! Ach, ach, ach! vnuerschämter morder, herre Tot, boser lasterbalg! Der zuchtiger sei ewer richter vnd binde euch, sprechend: «vergib mir!» in sein wigen! DER TOT. Das XII. capitel. Kundestu rechte messen, wegen, zelen oder tichten, aus odem kopfe liessestu nicht solche rede. Du fluchest vnd bittest rachung vnuerfenglich vnd one notdurft. Was taug solch eselschrei? Wir haben vor gesprochen: kunstenreich, edel, erhaft, frutig, ertig vnd alles, was lebet, muß von vnserer hende abhendig werden. Dannoch klaffestu vnd sprichest, alles dein gelucke sei an deinem reinen, frumen weibe gelegen. Sol nach deiner meinung gelucke an weiben ligen, so wellen wir dir wol raten, das du bei gelucke beleibest, den worten das es nicht zu vngelucke gerate! Sage vns: do du am ersten dein lobelich weib namest, fandestu sie frum oder machtestu sie frum? Hastu sie frum funden, so suche vernunftiglichen: du findest noch vil frumer, reiner frawen auf erden, der dir eine zu der ee werden mag; hastu sie aber frum gemachet, so frewe dich: du bist der lebendig meister, der noch ein frum weib geziehen vnd gemachen kan. Wir sagen dir aber ander mere: ie mer dir liebes wirt, ie mer dir leides widerfert. Hettestu dich vor liebes vberhaben, so werestu nu leides vertragen; ie grosser lieb zu bekennen, ie grosser leit zu enberen. Lieb, weib, kint, schatz vnd alles irdisch gut muß etwas freuden am anfang haben vnd mer leides am ende bringen; alles irdisch ding vnd lieb muß zu leide werden. Leit ist liebes ende, der freuden ende trauren ist, nach lust vnlust muß kumen, willens ende ist vnwillen. Zu solchem ende laufen alle lebendige ding. Lerne es baß, wiltu von klugheil gatzen! DER ACKERMAN. Das XIII. capitel. Nach schaden folget spotten; des empfinden wol die betrubten. Also geschicht von euch mir beschedigtem manne. Liebes entspenet, leides gewenet habet ir mich; als lange got wil, muß ich es von euch leiden. Wie stumpf ich bin, wie wenig ich han zu sinnereichen meistern weisheit gezucket, dannoch weiß ich wol, das ir meiner eren rauber, meiner freuden dieb, meiner guten lebetage steler, meiner wunnen vernichter vnd alles des, das mir wunnesam leben gemachet vnd gelubet hat, zerstorer seit. Wes sol ich mich nu frewen? Wo sol ich nu trost suchen? Wohin sol ich nu zuflucht haben? Wo sol ich nu heilstet finden? Wo sol ich nu trewen rat holen? Hin ist hin! Alle meine freude ist mir e der zeit verswunden; zu fru ist sie mir entwischet. Allzu schiere habt ir mir enzucket die teuren, die geheuren, wann ir mich zu witwer vnd meine kinder zu weisen so vngenediglich habet gemachet. Ellende, allein vnd leides vol beleibe ich von euch vnergetzet, besserung kunde mir von euch nach grosser missetat noch nie widerfaren. Wie ist dem, herre Tot, aller e brecher? An euch kan niemant icht gutes verdienen noch finden; nach vntat wellet ir niemant genug tun, niemant wellet ir ergetzen. Ich prufe: barmherzigkeit wonet bei euch nicht; fluchens seit ir gewonet; genadenlos seit ir an allen orten. Solche guttat, so ir beweiset an den leuten, solche genade, so die leute von euch empfahen, solchen lon, so ir den leuten gebet, solch ende, so ir den leuten tut, schicke euch der, der des todes vnd lebens gewaltig ist. Furste himelischer massenei, ergetze mich vngeheurer verluste, michels schadens, vnsegeliches trubsals vnd jemerliches weisentums! Dabei gerich mich an dem erzschalke Tot, got, aller vntat gerecher! DER TOT. Das XIIII. capitel. One nutz geredet, als mer geswigen, wann nach torlicher rede krieg, nach kriege feintschaft, nach feintschaft vnruwe, nach vnruwe serung, nach serunge wetag, Nach wetage afterrewe muß iedem verworren manne begegnen. Krieges mutestu vns an. Du klagest, wie wir dir leit haben getan an deiner zumale lieben frawen. Ir ist gutlich vnd genediglich geschehen: bei frolicher jugend, bei stolzem leibe, in besten lebetagen, in besten wirden, an bester zeit, mit vngekrenkten eren haben wir sie in vnser genade empfangen. Das haben gelobet, des haben begeret alle weissagen, wann sie sprachen: am besten zu sterben, wann am besten liebet zu leben. Er ist nicht wol gestorben, wer sterben hat begeret; er hat zu lange gelebet, wer vns vmb sterben hat angerufet; wee vnd vngemach geschach im, wer mit alters burden wirt vberladen: bei allem reichtum muß er arm wesen! Des jares, do die himelfart offen was, an des himels torwertels kettenfeiertag, do man zalte von anfang der werlte sechstausent funfhundert neun vnd neunzig jar, bei kindes geburt tausend vierhundert der selbigen, die seligen martrerin hiessen wir raumen dis kurze schemende ellende, auf die meinung das sie solte zu gotes erbe in ewige freude, in immerwerendes leben vnd zu vnendiger ruwe nach gutem verdienen genediglichen kumen. Wie hessig du vns bist, wir wellen dir wunschen vnd gunnen, das dein sele mit der iren dort in himelischer wonung, dein leib mit dem iren bein bei beine alhie in der erden gruft wesen solten. Burge wolten wir dir werden: irer guttat wurdestu geniessen. Sweig, enthalt! Als wenig du kanst der sunnen ir licht, dem mone sein kelte, dem fewer sein hitze oder dem Wasser sein nesse benemen, also wenig kanstu vns vnserer macht berauben! DER ACKERMAN. Das XV. capitel. Beschonter rede bedarf wol schuldiger man. Also tut ir auch. Susse vnd sawer, linde vnd herte, gutig vnd scharpf pfleget ir euch zu beweisen den, die ir meinet zu betriegen. Das ist offen an mir schein worden. Wie sere ir euch beschonet, doch weiß ich, das ich der erenvollen, durchschonen von ewerer swinden vngenade wegen kummerlich enberen muß. Auch weiß ich wol, das solches gewaltes sunder got vnd ewer niemant ist gewaltig. So bin ich von gote nicht also geplaget: wann hette ich mißgebaret gen gote, als leider dicke geschehen ist, das hette er an mir gerochen, oder es hette mir widerbracht die wandelsone. Ir seit der vbelteter. Darvmb weste ich gern, wer ir weret, was ir weret, wie ir weret, von wann ir weret vnd warzu ir tuchtig weret, das ir so vil gewaltes habet vnd on entsagen mich also vbel gefodert, meinen wonnereichen anger geodet, meiner sterke turn vndergraben vnd gefellet habet. Ach got, aller betrubten herzen troster troste mich vnd ergetze mich armen, betrubten, ellenden, selbsitzenden man! Gib, herre, plage, tu widerwerte, leg an klemnuß vnd vertilge den greulichen Tot, der dein vnd aller vnser feint ist! Werlich, herre, in deiner wurkung ist nicht greulichers nicht scheußlichers, nicht schedlichers, nicht herbers, nicht vngerechters dann der Tot! Er betrubet vnd verruret dir alle dein irdische Herschaft; ee das tuchtig dann das vntuchtig nimt er hin schedliche, alte, sieche, vnnutze leute lesset er oft alhie, die guten vnd die nutzen zucket er alle hin. Richte, herre, rechte vber den falschen richter! DER TOT. Das XVI. capitel. Was bose ist, das nennen gut, was gut ist, das heissen bose sinnelose leute. Dem gleiche tustu auch. Falsches gerichtes zeihestu vns; vns tustu vnrecht. Des wellen wir dich vnderweisen. Du fragest, wer wir sein. Wir sein gotes hantgezeuge, herre Tot, ein rechte wurkender meder. Vnser segens geet vur sich. Weiß, swarz, rot, braun, grun, blaw, graw, gel vnd allerlei glanzes blumen vnde gras hewet sie vur sich nider, ires glanzes, irer kraft, irer tugent nicht geachtet. Da geneusset der veiol nicht seiner schonen farbe, seines reichen ruches, seiner wolsmeckender safte. Sich, das ist rechtfertigkeit. Vns haben rechtfertig geteilet die Romer vnd die poeten, wann sie vns baß dann du bekanten. Du fragest, was wir sein. Wir sein nichts vnd sein doch etwas. Deshalben nichts, wann wir weder leben weder wesen, noch gestalt noch vnderstant haben, nicht geist sein, nicht sichtig sein, nicht greiflich sein, deshalben etwas, wann wir sein des lebens ende, des wesens ende, des nichtwesens anfang, ein mittel zwischen in beiden. Wir sein ein geschickte das alle leute fellet. Die großen heunen musten vor vns fallen; alle wesen, die leben haben, mussen verwandelt von vns werden, in hohen schulden werden wir gesigen. Du fragest, wie wir sein. Vnbescheidenlich sein wir, wann vnser figure zu Rome in einem tempel an einer wand gemalet was als ein man sitzend auf einem ochsen, dem die augen verbunden waren. Der selbe man furte ein hawen in seiner rechten hant vnd ein schaufel in der linken hant; damit facht er auf dem ochsen. Gegen im slug, warf vnd streit ein michel menige volkes. Allerlei leute, iegliches mensche mit seines hantwerkes gezeuge - da was auch die nunne mit dem psalter -, die slugen vnd wurfen den man auf dem ochsen. In vnser bedeutnuß bestreit der vnd begrub sie alle. Pictura gleichet vns zu eines mannes scheine, der hat basilisken augen, vor des gesichte sterben muß alle lebendige creature. Du fragest, von wann wir sein. Wir sein von allenthalben vnd sein doch von ninder. Deshalben von allenthalben, wann wir wandern an allen enden der werlte; deshalben von ninder, wann wir sein ninder her komen vnd aus nichte. Wir sein von dem irdischen paradise. Da tirmete vns got vnd nante vns mit vnserm rechten namen, da er sprach zu dem ersten menschen: Welches tages ir der frucht enbeisset, des todes werdet ir sterben. Darvmb wir vns also schreiben: Wir Tot, herre vnd gewaltiger auf erden, in der luft vnd meres strame. Du fragest, warzu wir tuchtig sein. Nu hastu vor gehoret, das wir der werlte mer nutzes dann vnnutzes bringen. Hor auf, laß dich genugen vnd danke vns, das dir von vns so gutlich ist geschehen! DER ACKERMAN. Das XVII. capitel. Alter man newe mere, geleret man vnbekante mere, ferre gewandert man vnd einer, wider den niemant reden tar, gelogen mere wol sagen turren, wann sie von vnwissender sachen wegen sint vnstreflich. Wann ir dann auch ein solcher alter man seit, so muget ir wol tichten. Allein ir in dem paradise gefallen seit ein meder vnd rechtes remet doch hawet ewer segens vneben. Rechte mechtig blumen reutet sie aus, die distel lesset sie steen; vnkraut beleibet, die guten kreuter mussen verderben. Ir jehet, ewer segens hawe vur sich. Wie ist dann dem, das sie mer distel dann guter blumen, mer meuse dann zamer tiere, mer boser leute dann guter vnuerseret lesset beleiben? Nennet mir mit dem munde, mit dem finger weiset mir: wo sint die frumen, achtberen leute, als vor zeiten waren? Ich wene, ir habet sie hin. Mit in ist auch mein lieb, die ubeln sint joch vber beliben. Wo sint sie hin, die auf erden wonten vnd mit gote redeten, an im hulde, genade vnd rechtung erwarben? Wo sint sie hin, die auf erden sassen vnder der gestirne vmbgengen vnd entschieden die planeten? Wo sint sie hin, die sinnereichen, die meisterlichen, die gerechten, die frutigen leute, von den die kroniken so vil sagen? Ir habet sie alle vnd mein zarte ermordet; die snoden sint noch alda. Wer ist daran schuldig? Torstet ir der wahrheit bekennen, herre Tot, ir wurdet euch selber nennen. Ir sprechet faste, wie rechte ir richtet, niemandes schonet, ewer segense haw nach einander fellet. Ich stund dabei vnd sach mit meinen augen zwo vngeheure schar volkes - iede het vber dreitausent man mit einander streiten auf einer grunen heide; die wuten in dem blute bis vnder den waden. Darvnder snurretet ir vnd burretet gar gescheftig an allen enden. In dem here totetet ir etelich, etelich liesset ir sten. Minre knechte dann herren sach ich tot ligen. Da klaubetet ir einen aus den andern als die teigen biren. Ist das rechte gemeet? Ist das rechte gerichtet? Geet so ewer segens vor sich? Wol her, lieben kinder, wol her! Reiten wir engegen, enbieten vnd sagen wir lob vnd ere dem Tode, der also rechte richtet! Gotes gerichte ist kaum also gerecht! DER TOT. Das XVIII. capitel. Wer von sachen nicht enweiß, der kan von sachen nicht gesagen. Also ist vns auch geschehen. Wir westen nicht, das du als ein richtiger man werest. Wir haben dich lange zeit erkant, wir hetten aber dein vergessen. Wir waren dabei, do fraw Sibilla dir die weisheit mitteilte, do her Salomon an dem totbette dir sein weisheit verreichte; do got allen den gewalt, den er hern Moysi in Egipten lant verlihen het, dir verlech, do du einen lewen bei dem weinwachs von Thamnatha slugest. Wir sahen dich die sterne zelen, des meres grieß vnd sein fische rechnen, die regentropfen reiten. Wir sahen gern, das du gewanst den wetlauf an Asael. Zu Susan sahen wir dich koste vnd trank in grossen wirden credenzen. Do du das banier vor Alexandro furtest, do er Darium bestreit, do lugten wir zu vnd gunden dir wol der eren. Do du in Academia zu Athenis mit hohen kunstenreichen meistern, die auch in die gotheit meisterlichen sprechen kunden, ebenteure disputiertest vnd in so kunstelichen oblagest, do sahen wir vns zumale liebe. Do du Neronem vnderweisetest, das er guttete vnd gedultig wesen solte, do horten wir gutlichen zu. Vns wunderte, do du keiser Iulium in einem roren schiffe vber das wilde mer furtest one dank aller sturmwinde In deiner werkstat sahen wir dich ein edel gewant von regenbogen wurken; darein wurden engel, vogel, tier, fische vnd allerlei gestalt - da was auch die eule vnd der affe - in wefels weise getragen. Zumale sere lachten wir vnd wurden des vur dich rumig, do du zu Paris auf dem geluckes rade sassest, auf der heute tantetest, in der swarzen kunst wurketest vnd bannetest die teufel in ein seltsam glas. Do dich got berufte in seinen rat zu gespreche vmb frawen Eve fal, aller erste wurden wir deiner grossen weisheit innen. Hetten wir dich vor erkant, wir hetten dir gefolget, wir hetten dein weib vnd alle leute ewig lassen leben. Das hetten wir dir allein zu eren getan, wann du bist zumale ein kluger esel! DER ACKERMAN. Das XVIIII. capitel. Gespotte vnd vbelhandelung mussen dicke aufhalten durch warheit willen die leute. Gleicher weise geschicht mir. Vnmugelicher dinge rumet ir mich, Vngehorter werke wurkens. Gewaltes treibet ir zumale vil, gar vbel habt ir an mir gefaren, das muet mich alzu sere. Wann ich dann darvmb rede, so seit ir mir gehessig vnd werdet zornes vol. Wer vbel tut vnd wil nicht vndertan strafung aufnemen vnd leiden, sunder mit vbermut alle ding vertreiben, der sol gar eben aufsehen, das im nicht vnwillen darnach begegne! Nemet beispil bei mir! Wie zu kurze, wie zu lange, wie vngutlich, wie vnrechte ir mir mit habet gefaren, dannoch dulte ich vnd riche es nicht, als ich zu rechte solte. Noch heute wil ich des besserer sein, han ich icht vngleiches oder vnhubsches gen euch gebaret. Des vnderweiset mich; ich wil sein gernwilliglich widerkumen. Ist des aber nicht, so ergetzet mich meines schadens oder vnderweiset mich, wie ich widerkume meines grossen herzeleides. Werlich, also zu kurze geschach nie manne! Vber das alles mein bescheidenheit sullet ir ie sehen. Eintweder ir widerbringet, was ir an meiner traurenwenderin, an mir vnd an meinen kindern arges habet begangen, oder kumet des mit mir an got, der da ist mein, ewer vnd aller werlte rechter richter. Ir mochtet mich leichte erbitten, ich wolte es zu euch selber lassen. Ich traute euch wol, ir wurdet ewer vngerechtigkeit selber erkennen, darnach mir genugen tun nach grosser vntat. Begeet die bescheidenheit, anders es muste der hamer den amboß treffen, herte wider herte wesen, es kume, zu wo es kume! DER TOT. Das XX. capitel. Mit guter rede werden gesenftet die leute; bescheidenheit behelt die leute bei gemache; gedult bringet die leute zu eren; zorniger man kan den man nicht entscheiden. Hettestu vns vormals gutlich zugesprochen, wir hetten dich gutlich vnderweiset, das du nicht billich den tod deines weibes klagen soltest vnd beweinen. Hastu nicht gekant Senecam den weissagen, der in dem bade sterben wolte, oder seine bucher gelesen, das niemant sol klagen den tod der totlichen? Weistu des nicht, so wisse: als balde ein mensche geboren wirt, als balde hat es den leikauf getrunken, das es sterben sol. Anfanges geswistreit ist das ende. Wer ausgesant wirt, der ist pflichtig wider zu kumen. Was ie geschehen sol, des sol sich niemant widern. Was alle leute leiden mussen, das sol einer nicht widersprechen. Was ein mensche entlehent, das sol es widergeben. Ellende bawen alle leute auf erden. Von ichte zu nichte mussen sie werden. Auf snellem fusse leufet hin der menschen leben; iezunt lebend, in einem hantwenden gestorben. Mit kurzer rede beslossen: iedes mensche ist vns ein sterben schuldig vnd es anerbet zu sterben. Beweinestu aber deines weibes jugent, du tust vnrecht; als schiere ein mensche lebendig Wirt, als schiere ist es alt genug zu sterben. Du meinest leichte, das alter sei ein edel hort. Nein, es ist suchtig, arbeitsam, vngestalt, kalt vnd allen leuten vbel gefallend; es taug nicht vnd ist zu allen sachen enwicht: zeitig epfel fallen gern in das kot; reifende biren fallen gern in die pfutzen. Klagestu dann ir schone, du tust kintlich; eines ieglichen menschen schone muß eintweder das alter oder der tot vernichten. Alle rosenfarbe mundlein mussen abgefarb werden, alle rote wenglein mussen bleich werden, alle lichte euglein mussen tunkel werden. Hastu nicht gelesen, wie Ieronimus, der weissage, leret, wie sich ein man huten sol vor schonen weiben, vnd sprichet: Was schone ist, das ist mit tegelicher beisorge sware zu halten, wann sein alle leute begeren; was scheußlich ist, das ist leidelich zu halten, wann es mißfellet allen leuten? Laß faren! Klage nicht verlust, die du nicht kanst widerbringen. DER ACKERMAN. Das XXI. capitel. Gute strafung gutlich aufnemen, darnach tun sol weiser man, hore ich die klugen jehen. Ewer strafung ist auch leidelich. Wann dann ein guter strafer auch ein guter anweiser wesen sol, so ratet vnd vnderweiset mich, wie ich so vnsegeliches leit, so jemerlichen kummer, so aus der masse grosse betrubnuß aus dem herzen, aus dem mute vnd aus den sinnen ausgraben, austilgen vnd ausjagen sulle. Bei got vnuolsagenlich herzeleit ist mir geschehen, do mein zuchtige, trewe vnd stete hausere mir so snelle ist enzucket, sie tot, ich witwer, meine kinder weisen worden sint. O herre Tot, alle werlt klaget vber euch vnd auch ich, das nie so boser man wart. Doch seint den malen das nie man so bose wart, er were an etwe gut, ratet, helfet vnd steuret, wie ich so sweres leit von herzen werfen muge vnd meine kinder einer solchen reinen muter ergetzet werden; anders ich vnmutig vnd sie traurig immer wesen mussen. Vnd das sullet ir mit nichten vbel verfahen, wann ich sihe, das vnder vnuernunftigen tieren ein gate vmb des andern tot trauret von angeborenem twange. Hilfe, rates vnd widerbringens seit ir mir pflichtig, wann ir habt mir getan den schaden. Wo des nicht geschehe, dann got hette in seiner almechtigkeit ninder rachung. Gerochen muß es werden inder, vnd solte darvmb hawe vnd schaufel noch eines gemuet werden! DER TOT. Das XXII. capitel. Ga! ga! ga! snatert die gans, lamb! lamb! sprichet der wolf, man predige, was man welle: solch fadenricht spinnest auch du. Wir haben dir vor entworfen, das vnklegelich wesen sulle der tot der totlichen. Seint den malen das wir ein zolner sein, dem alle menschen ir leben zollen vnd vermauten mussen, wes widerstu dann dich? Wan werlich, wer vns teuschen wil, der teuschet sich selber. Laß dir eingen vnd vernim: das leben ist durch sterbens willen geschaffen. Were leben nicht, wir weren nicht, vnser geschefte were nicht; damit were auch nicht der werlte ordenung. Eintweder du bist sere leidig oder vnuernunft hauset zu dir. Bistu vnuernunftig, so bitte got, vernunft dir zu verleihen; bistu aber leidig, so brich ab, laß faren, nim das vur dich, das ein wint ist der leute leben auf erden! Du bittest rat, wie du leit aus dem herzen bringen sullest. Aristotiles hat dich es vor geleret, das freude, leit, forchte vnd hoffenung die viere alle werlt bekummern vnd gerlich die, die sich vor in nicht kunnen huten. Freude vnd forchte kurzen, leit vnd hoffenung lengen die weile. Wer die viere nicht ganz aus dem mute treibet, der muß alzeit sorgende wesen. Nach freude trubsal, nach liebe leit muß ie auf erden kumen. Lieb vnd leit mussen mit einander wesen. Eines ende ist anfang des andern. Leit vnd lieb ist nicht anders, dann wann icht ein mensche in seinen sinn vurfasset, das es nicht austreiben wil, gleicher weise als mit genugen niemant arm vnd mit vngenugen niemant reich wesen mag; wann genugen vnd vngenugen nicht an habe noch an auswendigen sachen sint, sunder in dem mute. Wer altes lieb nicht aus dem herzen treiben wil, der muß gegenwurtiges leit alzeit tragen. Treib aus dem herzen, aus dem sinne vnd aus dem mute liebes gedechtnuß, alzuhant wirstu traurens vberhaben. Als balde du icht hast verloren vnd es nicht kanst widerbringen, tu, als es dein nie sei worden: hin fleuchet alzuhant dein trauren. Wirstu des nicht tun, so hastu mer leides vor dir; wann nach iegliches kindes tode widerfert dir herzeleit, nach deinem tode auch herzeleit in allen, dir vnd in, wann ir euch scheiden sollet. Du wilt, das sie der muter ergetzet werden. Kanstu vergangene jar, gesprochene wort vnd verruckten magettum widerbringen so widerbringestu die muter deiner kinder. Wir haben dir genug geraten. Kanstu es versteen, stumpfer pickel? DER ACKERMAN. Das XXIII. capitel. In die lenge wirt man gewar der warheit als: lange gelernet, etwas bekundet. Ewer spruche sint susse vnd lustig, des ich nu etwas empfinde. Doch solte freude, lieb, wunne vnd kurzweil aus der werlte vertriben werden, vbel wurde steen die werlt. Des wil ich mich ziehen an die Romer. Die haben es selbes getan vnd haben das ire kinder geleret, das sie lieb vnd in eren haben solten turnieren, stechen, tanzen, wetlaufen, springen vnd allerlei zuchtige hubscheit bei mussiger weile, auf die rede das sie die weile bosheit weren vberhaben. Wan menschliches mutes sin kan nicht mussig wesen. Eintweder gut oder bose muß alzeit der sin wurken, in dem slafe wil er nicht mussig sein. Wurden dann dem sinne gute gedanke benumen, so wurden im bose eingeen. Gute aus, bose ein; bose aus, gute ein: die wechselung muß bis an das ende der werlte weren. Sider freude, zucht, scham vnd ander hubscheit sint aus der werlte vertriben, sider ist sie bosheit, schanden, vntrewe, gcspottes vnd verreterei zumale vol worden. Das sehet ir tegelichen. Solte ich dann die gedechtnuß meiner aller liebsten aus dem sinne treiben, bose gedechtnusse wurden mir in den sin wider kumen: als mer wil ich meiner aller liebsten alweg gedenken. Wann grosses herzelieb in grosses herzeleit wirt verwandelt, wer kan des balde vergessen? Bose leute tun das selbe; gute freunde stete gedenken an einander. Ferre wege, lange jar scheiden nicht geliebe. Ist sie mir leiblichen tot, in meiner gedechtnuß lebet sie mir doch immer. Herre Tot, ir musset treulicher raten, sol ewer rat icht nutzes bringen, anders, ir fledermaus, musset als vor der vogel feintschaft tragen! DER TOT. Das XXIIII. capitel. Lieb nicht alzu lieb, leit nicht alzu leit sol vmb gewin vnd vmb verlust bei weisem manne wesen: des tustu nicht. Wer vmb rat bittet vnd rates nicht folgen wil, dem ist auch nicht zu raten. Vnser gutlicher rat kan an dir nicht geschaffen. Es sei dir nu lieb oder leit, wir wellen dir die warheit an die sunnen legen, es hore, wer da welle. Dein kurze vernunft, dein abgesniten sin, dein holes herze wellen aus leuten mer machen, dann sie gewesen mugen. Du machest aus einem menschen, was du wilt, es mag nicht mer gesein, dann als vil wir dir sagen wellen mit vrlaub aller reinen frawen. Ein mensche wirt in sunden empfangen, mit vnreinem, vngenantem vnflat in muterlichem leibe generet, nacket geboren vnd ist ein besmireter binstock, ein ganzer vnlust, ein kotfaß, ein wurmspeise, ein stankhaus, ein vnlustiger spulzuber, ein faules as, ein schimelkaste, ein bodenloser sack, ein lockerete tasche, ein blasebalk, ein geitiger slund, ein stinkender leimtigel, ein vbelriechender harnkrug, ein vbelsmeckender eimer, ein betriegender tockenschein, ein leimen raubhaus, ein vnsetig leschtrog vnd ein gemalte begrebnuß. Es merke, wer da welle: ein iegliches ganz gewurktes mensche hat neun locher in seinem leibe, aus den allen fleusset so vnlustiger vnd vnreiner vnflat, das nicht vnreiners gewesen mag. So schones mensche gesahestu nie, hettestu eines linzen augen vnd kundest es inwendig durchsehen, dir wurde darob grawen. Benim vnd zeuch ab der schonsten frawen des sneiders farbe, so sihestu ein schemliche tocken, ein schiere swelkende blumen von kurze taurendem scheine vnd einen balde faulenden erdenknollen. Weise vns ein hantvol schone aller schonen frawen, die vor hundert jaren haben gelebt, ausgenomen der gemalten an der wende, vnd habe dir des keisers krone zu eigen! Laß hin fliehen lieb, laß hin fliessen leit! Laß rinnen den Rein als ander Wasser! Eseldorf! weiser gotling! DER ACKERMAN. Das XXV. capitel. Pfei euch, boser schandensack! Wie vernichtet, vbelhandelt vnd vneret ir den werden menschen, gotes aller liebste creature, damit ir auch die gotheit swechet! Aller erste prufe ich, das ir lugenhaftig seit vnd in dem paradise nicht getirmet, als ir sprechet. Weret ir in dem paradise gefallen, so westet ir, das got den menschen vnd alle ding geschaffen hat, sie alle zumale gut beschaffen hat vnd den menschen vber sie alle gesetzet, im ir aller herschaft befolhen vnd sie seinen fussen vndertenig gemachet hat, also das der mensche den tieren des ertreichs, den vogeln des himels, den fischen des meres vnd allen fruchten der erden herschen solte, als er auch tut. Solte dann der mensche so snode, bose vnd vnrein sein, als ir sprechet, werlich so hette got gar vnreinlichen vnd gar vnnutzlichen gewurket. Solte gotes almechtige vnd wirdige hant so ein vnreines vnd vnfletiges menschwerk haben gewurket, als ir schreibet, streflicher vnd gemeilter wurker were er. So stunde auch das nicht, das got alle ding vnd den menschen vber sie alle zumale gut hette beschaffen. Herre Tot, lasset ewer vnnutz klaffen! Ir schendet gotes aller hubschestes werk. Engel, teufel, schretlein, klagemuter, das sint geiste in gotes twange wesend: der mensche ist das aller achtberest, das aller behendest vnd das aller freiest gotes werkstuck. Im selber gleiche hat in got gebildet, als er auch selbes in dem ersten vrkunde der werlte hat gesprochen. Wo hat ie werkman gewurket so behendes vnd reiches werkstuck, einen so werkberlichen kleinen kloß als eines menschen haubet? In dem ist kunstereiche kunst, allein gote ebenteur, verborgen: da ist in des augen apfel das gesichte, das aller gewissest zeuge, meisterlich in spiegels weise verwurket; bis an des himels klare zirkel wurket es. Da ist in den oren das ferre wurkende gehoren, gar durchnechtiglichen mit einem dunnen felle vergitert, zu prufung vnd merkung vnderscheit mancherlei susses gedones. Da ist in der nasen der ruch, durch zwei locher ein vnd aus geend, gar sinniglichen verzimmert zu behegelicher senftigkeit alles lustsames vnd wunnesames riechens, das da ist nar der sele. Da sint in dem munde zene, alles leibfuters tegeliches malende einsacker; darzu der zungen dunnes blat, den leuten zu wissen bringend ganz der leute meinung; auch ist da des smackes allerlei koste lustsame prufung. Dabei sint in dem kopfe aus herzengrunde geende sinne, mit den ein mensche, wie ferre er wil, gar snelle reichet; in die gotheit vnd daruber gar klimmet der mensche mit den sinnen. Allein der mensche ist empfahend der vernunft, des edelen hortes. Er ist allein der lieblich kloß, dem gleiche niemant dann got gewurken kan, darin also behende werk mit aller kunste meisterschaft vnd weisheit sint gewurket. Lat faren, herre Tot! Ir seit des menschen feint; darvmb ir kein gutes von im sprechet! DER TOT. Das XXVI. capitel. Schelten, fluchen, wunschen, wie vil der ist, kunnen keinen sack, wie kleine der ist, gefullen. Darzu: wider vil redende leute ist nicht zu kriegen mit worten. Es gee nur vur sich mit deiner meinung, das ein mensche aller kunste, hubscheit vnd wirdigkeit vol sei, dannoch muß es in vnser netze fallen, mit vnserem garne muß es gezucket werden. Gramatica, gruntfeste aller guten rede, hilfet da nicht mit iren scharfen vnd wol gegerbten worten. Rhetorica, bluender grunt der liebkosung, hilfet da nicht mir iren bluenden vnd reine geferbten reden. Loica, der warheit vnd vnwarheit vursichtige entscheiderin, hilfet da nicht mit irem verdackten verslahen, mit der warheit verleitung vnd krummerei. Geometria, der erden pruferin, schetzerin vnd messerin, hilfet da nicht mit irer vnfelender masse, mit iren rechten abgewichten. Arismetrica, der zale behende ausrichterin, hilfet da nicht mit irer rechnung, mit irer reitung, mit iren behenden ziffern. Astronomia, des gestirnes meisterin, hilfet da nicht mit irem sterngewalte, mit einflusse der planeten. Musica, des gesanges vnd der stimme geordente hantreicherin, hilfet da nicht mit irem sussen gedone, mit iren feinen stimmen. Philosophia, acker der weisheit, zwirund in naturlicher erkantnuß vnd in guter siten wurkung geackert vnd geseet vnd volkumenlich gewachsen; Physica mit iren mancherlei steurenden trenken; Geomancia, mit satzung der planeten vnd des himelsreifes zeichen auf erden allerlei frage behende verantwurterin, Piromancia, sleunige vnd warhaftige warsagens aus fewr wurkerin; Idromancia, in wassers gewurke der zukunftigkeit entwerferin; Astroloia mit oberlendischer sachen macht irdisches laufes auslegerin; Ciromancia, nach henden vnd nach des teners kreisen hubsche warsagerin; Nigromancia, mit totenopfer, fingerlein vnd mit sigel der geiste gewaltige twingerin; Alchimia mit der metalle seltsamer verwandelung; Notoria, die kunst mit iren sussen gebeten, mit irem starken besweren; Augurium, der vogelkose vernemer vnd daraus zukunftiger sachen warhafter zusager; Aruspicium, nach altaropfers rauche witze kund tuende ausrichtung; Pedomancia mit kinder gedirme vnd Ornomancia mit aurhanen dermen luplerin; Iura, wandelberes vnd widerspruchiges recht, vnd Iuriste, der gewissenlos criste, mit rechtes vnd vnrechtes vursprechung, mit seinen krummen articlen - die vnd ander, den vorgeschriben anhangende kunste helfen zumale nicht. Iedes mensche muß ie von vns vmbgesturzet, in vnserem walktroge gewalken vnd in vnserem rollfasse gefeget werden. Das glaube, du uppiger geuknecht! DER ACKERMAN. Das XXVII. capitel. Man sol nicht vbel mit vbel rechen; gedultig sol ein man wesen, gebeitend der tugend lere. Den pfat wil ich nach treten, ob ir leichte noch nach vngedult gedultig werdet. Ich vernim an ewer rede, ir meinet, ir ratet mir gar trewlich. Wonet trewe bei euch, so ratet mir mit trewen in gesworenes eides weise. In was wesens sol ich nu mein leben richten? Ich bin vormals in der lieben lustigen e gewesen; warzu sol ich mich nu wenden? In werltlich oder in geistlich ordenung? Die sint mir beide offen. Ich nam vur mich in den sin allerlei leute wesen, schatzte vnd wug sie mit fleisse: vnuolkumen, bruchig vnd etwe vil mit sunden fant ich sie alle. In zweifel bin ich, wo ich hin keren sulle; mit gebrechen ist bekummert aller leute anstal. Herre Tot, ratet! Rates ist not! In meinem sinne finde, wene vnd glaube ich vur war, das nie so reines, gotliches nest vnd wesen kume nimmermer. Bei der sele, ich spriche: Weste ich, das mir in der e gelingen solte als e. in der e wolte ich leben, die weile lebend were mein leben. Wunnesam, lustsam, fro vnd wolgemut ist ein man, der ein biderb weib hat, er wandere, wo er wander. Einem ieden solchen man ist auch lieb, nach narung z.u stellen vnd zu trachten. Im ist auch lieb, ere mit eren, trewe mit trewen, gute mit gute widergelten. Er bedarf ir nicht huten; wann sie ist die beste hut, die ir ein frumes weib selber tut. Wer seinem weibe nicht glauben vnd trawen wil, der muß stecken in steten sorgen. Herre von oberlanden, furste von vil selden, wol im, wen du so mit reinem bettegenossen begabest! Er sol den himel ansehen, dir mit aufgerackten henden danken alle tage. Tut das beste, herre Tot, vil vermugender herre! DER TOT. Das XXVIII. capitel. Loben one ende, schenden one zil, was sie vurfassen, pflegen etelich leute. Bei loben vnd bei schenden sol fuge vnd masse sein; ob man ir eines bedurfe, das man sein stat habe. Du lobest sunder masse eeliches leben; iedoch wellen wir dir sagen von eelichem leben, vngeruret aller reinen frawen. Als balde ein man ein weib nimpt, als balde ist er selbander in vnserer gefengnuß. Zuhant hat er einen hantslag, einen anhang, einen hantsliten, ein joch, ein kumat, ein burde, einen sweren last, einen fegeteufel, ein tegeliche rosfeilen, der er mit nichte nicht enberen mag, die weile wir mit im nicht tun vnser genade. Ein beweibeter man hat doner, schawer, fuchse, slangen alle tage in seinem hause. Ein weib stellet alle tage darnach, das sie man werde. Zeuchet er auf, so zeuchet sie nider; wil er so, so wil sie sust; wil er dahin, so wil sie dorthin. Solches spiles wirt er sat vnd sigelos alle tage. Triegen, listen, smeichen, spinnen, liebkosen, widerburren, lachen, weinen kan sie wol in einem augenblicke; angeboren ist es sie. Siech zu arbeit, gesunt zu wollust, darzu zam vnd wilde ist sie, wann sie des bedarf. Vmb werwort finden bedarf sie keines ratmannes. Geboten ding nicht tun, verboten ding tun fleisset sie sich alzeit. Das ist ir zu susse, das ist ir zu sawr, des ist ir zu vil des ist ir zu wenig; nu ist es zu fru, nu ist es zu spate, also wirt es alles gestrafet. Wirt dann icht von ir gelobet, das muß mit schanden in einem drechselstule gedret werden; dannoch wirt das loben dicke mit gespotte gemischet. Ein man, der in der e lebet, kan kein mittel aufhaben: Ist er zu gutig, ist er zu scharpf, an in beiden wirt er mit schaden gestrafet. Er sei nur halb gutig oder halb scharpf, dannoch ist da kein mittel, schedlich oder streflich wirt es ie. Alle tage newe anmutung oder keifen, alle wachen fremde aufsatzung oder murmeln, alle monat newen vnlustigen vnflat oder grawen, alle jar newes kleiden oder tegeliches strafen muß ein beweibeter man haben, er gewinne es, wo er welle. Der nacht gebrechen sei aller vergessen; von alters wegen schemen wir vns. Schonten wir nicht der biderben frawen, von den vnbiderben kunden wir vil mer singen vnd sagen. Wisse, was du lobest; du kennest nicht golt bei bleie! DER ACKERMAN. Das XXVIIII. capitel. Frawen schender mussen geschendet werden, sprechen der warheit meister. Wie geschicht euch dann, herre Tot? Ewer vnuernunftiges frawen schenden, wie wol es mit frawen vrlaub ist, ist werlich euch schentlich vnd den frawen schemlich. In maniges weisen meisters geschrifte findet man, das one weibes steure niemant mag mit selden gesteuret werden, wann weibes vnd kinder habe ist nicht das minste teil der irdischen selden. Mit solcher warheit hat sein trostbuch ein Romer Boecius hin geleget. Philosophia, die weise meisterin, vnd ieder abentewerlicher vnd sinniger man ist mir des zeuge: kein mannes zucht kan wesen, sie sei dann gemeistert mit frawen zuchte. Es sage, wer es welle: ein zuchtiges, schones, keusches vnd an eren vnuerrucktes weib ist vor aller irdischer eugelweide. So manlichen man gesach ich nie; der rechte mutig wurde, er wurde dann mit frawen troste gesteuret. Wo der guten samenung ist, da sihet man es alle tage; auf allen planen, auf allen hofen, in allen turnieren, in allen herfarten tun die frawen ie das beste. Wer in frawen dienste ist, der muß sich aller missetat anen. Rechte zucht vnd ere leren die werden frawen in irer schule. Irdischer freuden sint gewaltig die frawen; sie schaffen, das in zu eren geschieht alle hubscheit vnd kurzweil auf erden. Einer reinen frawen fingerdrowen strafet vnd zuchtiget vur alle waffen einen frumen man. One liebkosen mit kurzer rede: aller werlte aufhaltung, festung vnd merung sint die werden frawen. Iedoch bei golde blei, bei weize raden, bei allerlei munze beislege vnd bei weibe vnweib mussen wesen; dannoch die guten sullen der bosen nicht engelten. Das glaubet, haubetman von kriege! DER TOT. Das XXX. capitel. Einen kolben vur einen kloß goldes, eine koten vur einen topasion, einen kisling vur einen rubin nimt ein narre; die hewschewer eine burg, die Tunaw das mer, den mausar einen falken nennet der tore. Also lobestu der augen lust, der vrsachen schetzestu nicht; wann du weist nicht, das alles, das in der werlte ist, ist eintweder begerung des fleisches oder begerung der augen oder hohe des lebens. Die begerung des fleisches zu wollust, die begerung der augen zu gute, die hohe des lebens zu ere sint geneiget. Das gut bringet girung vnd geitigkeit, die wollust machet geilheit vnd. vnkeuscheit, die ere bringet hochfart und rum Von gute turstigkeit vnd forchte, von wollust bosheit vnd sunde, von ere guft vnd eitelkeit mussen ie kumen. Kundestu das vernemen, du wurdest eitelkeit in aller werlte finden; vnd geschehe dir dann liebe oder leide, das wurdestu dann gutlichen leiden, auch vns vngestrafet lassen. Aber als vil als ein esel leiren kan, als vil kanstu die warheit vernemen. Darvmb so sein wir so sere mit dir bekummert. Do wir Pyramum den jungeling mit Tisben der meide, die beide ein sele vnd willen hetten, schieden, do wir kunig Alexandrum aller werlte herschaft entenigten, do wir Paris von Troja vnd Helenam von Kriechen zerstorten, do wurden wir nicht also sere als von dir gestrafet. Vmb keiser Karel, markgraven Wilhelm, Dietrich von Berne, den starken Boppen vnd vmb den hurnen Seifrid haben wir nicht so vil mue gehabet. Aristotilem vnd Avicennam klagen noch heute vil leute, dannoch sein wir vngemuet. Do Davit der gedultig vnd Salomon, der weisheit schrein, starben, do wart vns mer gedanket dann gefluchet. Die vor waren, die sint alle dahin; du vnd alle, die nu sint oder noch werden, mussen alle hinnach. Dannoch beleiben wir Tot hie herre! DER ACKERMAN. Das XXXI. capitel. Eigene rede verteiler dicke einen man vnd gerlich einen, der ietzund eines vnd darnach ein anderes redet. Ir habet vor gesprochen, ir seit etwas vnd doch nicht ein geist vnd seit des lebens ende vnd euch sein alle irdische lant empfolhen. So sprechet ir nu, wir mussen alle dahin, vnd ir Tot beleibet hie herre. Zwo widerwertig rede mugen mit einander nicht war gewesen. Sullen wir von leben alle dahin scheiden vnd irdisch leben sol alles ende haben vnd ir seit, als ir sprechet, des lebens ende, so merke ich: wann nimmer lebens ist, so wirt nimmer sterbens vnd todes. Wo kumpt ir dann hin, herre Tot? In himel muget ir nicht wonen, der ist gegeben allein den guten geisten. Kein geist seit ir nach ewer rede. Wann ir dann auf erden nimmer zu schaffen habet vnd die erde nimmer weret, so musset ir gerichtes in die helle; darinnen musset ir one ende krochen. Da werden auch die lebendigen vnd die toten an euch gerochen. Nach ewer wechselrede kan sich niemant gerichten. Solten alle irdische ding so bose, snode vnd vntuchtig sein, als ir sprechet, so musten sie von gote vntuchtig sein beschaffen vnd gewurket. Des ist er von anfang der werlte nie gezigen. Tugent lieb gehabet, bosheit gehasset, sunde vbersehen vnd gerochen hat got vnz her. Ich glaube, hinnach tue er auch das selbe. Ich han von jugent auf gehoret lesen vnd gelernet, wie got alle ding gut beschaffen habe. Ir sprechet, wie alle irdische leben vnd wesen sullen ende nemen; so sprichet Plato vnd ander weissagen, das in allen sachen eines zeruttung des andern berung sei vnd wie alle sache auf vrkunde sein gebawet vnd wie des himels lauf, aller planeten vnd der erden von einem in das ander verwandelt werde vnd ewig sei. Mit ewer wankelrede, darauf niemant bawen sol, weller it mich von meiner klage schrecken. Des berufe ich mich mit euch an got, meinen heilant, herre Tot, mein verderber! Damit gebe euch got ein boses amen! DER TOT. Das XXXII. capitel. Oft ein man, wann et der anhebet zu reden, im werde dann vnderstossen, nicht aufgehoren kan. Du bist auch aus dem selben stempfel gewurket. Wir haben gesprochen vnd sprechen noch, damit wellen wir ende machen: die erde vnd alle ir behaltung ist auf vnstetigkeit gebawet. In diser zeit ist sie wandelber worden, wann alle ding haben sich verkeret, das hinder hervur, das voder hin hinder, das vnder gen berge, das ober gen tale. Das ebich an das rechte hat die meist menige volkes gekeret. Zu feures flammen stetigkeit kan icht alles menschliches geslechte getreffen; einen schein zu greifen, einen guten, trewen, beistendigen freunt zu finden, ist nahent gleich mugelich auf erden worden. Alle menschen sint mer zu bosheit dann zu gute geneiget. Tut nu iemant icht gutes, das tut er vns besorgend. Alle leute mit allem irem gewurke sint vol eitelkeit worden. Ir leib, ir weib, ir kinder, ir ere, ir gut vnd alles ir vermugen fleuchet alles dahin, mit einem augenblicke verswindet es, mit dem winde verwischet es, noch kan der schein noch der schate nicht beleiben. Merke, prufe, sich vnd schawe, was nu der menschen kinder auf erden haben: wie sie berg vnd tal, stock vnd stein, awe vnd gefilde, der Alpen wiltnuß, des meres grunt, der erden tiefe durch irdisches gutes willen durchgrunden in regen, winden, doner, schawer, sne vnd in allerlei vngewiter, wie sie schechte, stollen vnd tiefe funtgruben in die erden durchgraben, der erden adern durchhawen, glanzerze suchend, die sie durch seltsenkeit willen vur alle ding lieb haben, wie sie holz wellen, gewant zewen, heuser den swalben gleiche klecken, pflanzen vnd pelzen baumgarten, ackern das ertreich, bawen weinwachs, machen mulwerk, zunden zinsel, bestellen fischerei, weitwerk vnd wiltwerk, grosse herte vihes zusamen treiben, vil knechte vnd meide haben, hohe pfert reiten, goldes, silbers, edel gesteines, reiches gewandes vnd allerlei ander habe heuser vnd kisten vol haben, wollust vnd wunnen pflegen, darnach sie tag vnd nacht stellen vnd trachten. Was ist das alles? Das alles ist eitelkeit vber eitelkeit vnd beswerung der sele, vergenglich et als der gesterig tag, der vergangen ist. Mit kriege vnd mit raube gewinnen sie es; wann ie mer gehabet, ie mer geraubet. Zu kriegen vnd zu werren lassen sie es nach in. O die totliche menscheit ist stete in engsten, in trubsal, in leide, in besorgen, in forchten, in scheuhung, in weetagen, in siechtagen, in trauren, in betrubnuß, in jamer, in kummer vnd in mancherlei widerwertigkeit; vnd ie mer ein man irdisches gutes hat, ie mer im widerwertigkeit begegent. Noch ist das das aller groste, das ein mensche nicht gewissen kan, wann, wo oder wie wir vber es vrplupfling fallen vnd es jagen, zu laufen den weg der totlichen. Die burde mussen tragen herren vnd knechte, man vnd weib, reich vnd arm, gut vnd bose. O leidige zuversicht, wie wenig achten dein die tummen! Wann es zu spate ist, so wellen sie alle frum werden. Darvmb laß dein klagen, sun! Trit in welchen orden du wilt, du findest gebrechen vnd eitelkeit darinnen. Iedoch kere von dem bosen vnd tue das gute, suche den fride vnd tue in stete; vber alle irdische ding habe lieb rein vnd lauter gewissen! Vnd das wir dir rechte geraten haben, des komen wir mit dir an got, den ewigen, den grossen vnd den starken. Des fursten rede von vil selden, des almechtigen gotes vrteil. Das XXXIII. capitel. Der lenze, der sumer, der herbest vnd der winter, die vier erquicker vnd hanthaber des jares, die wurden zwifertig mit grossen kriegen. Ir ieder rumte sich, vnd wolte ieglicher in seiner wurkung der beste sein. Der lenze sprach, er erquickte vnd machte guftig alle fruchte; der sumer sprach, er machte reif vnd zeitig alle fruchte; der herbest sprach, er brechte vnd zechte ein beide in stedel, in keller vnd in die heuser alle fruchte; der winter sprach, er verzerte vnd vernutzte alle fruchte vnd vertribe alle gifttragende wurme. Sie rumten sich vnd kriegeten faste; sie hetten aber vergessen, das sie sich gewaltigter herschaft rumten. Ebengleiche tut ir beide. Der klager klaget sein verlust, als ob sie sein erberecht were; er wenet nicht, das sie im von vns were verlihen. Der Tot rumet sich herschaft, die er doch allein von vns zu lehen hat empfangen. Der klaget, das nicht sein ist; diser rumet sich herschaft, die er nicht von im selber hat. Iedoch der krieg ist nicht gar one sache: ir habet beide wol gefochten. Den twinget leit zu klagen, disen die anfechtung des klagers, die warheit zu sagen. Darvmb: klager, habe ere, Tot, habe sige, seit ieder mensche das leben dem Tode, den leib der erden, die sele vns pflichtig ist zu geben. Hie bittet der ackerman vur seiner frawen sele. Der roten buchstaben der grosse nennet alse den klager. Dis capitel stet in eines betes weise vnd ist das XXXIIII. capitel. Immer wachender wachter aller werlte; got aller goter; herre wunderhaftiger; herre aller herren,. almechtigster aller geiste; furste aller furstentume; brunne, aus dem alle gutheit fleusset, heiliger aller heiligen; kroner vnd die krone; loner vnd der lon; kurfurste, in des kure sten alle kure; wol im wart wer manschaft von dir empfehet! Der engel freude vnd wunne; eindruck der aller hochsten formen: altgreiser jungeling, erhore mich! O licht, das da nicht empfehet ander licht; licht, das da verfinstert vnd verblendet alles auswendiges licht; schein, vor dem verswindet aller ander schein; schein, zu des achtung alle licht sint finsternuß; licht, zu dem aller schein ein schate ist, dem alle finsternuß licht sint, dem aller schate erscheinet; licht, das in der beginstnuß gesprochen hat: werde licht!; fewer, das vnuerloschen alweg brinnet; anfang vnd ende, erhöre mich! Heil vnd selde vber alles heil vnd selde; weg one allen irrsal zu dem ewigen leben, bestes, one das dann nicht bessers ist; leben, dem alle ding leben; warheit vber alle warheit, weisheit, vmbsliessende alle weisheit; aller sterke gewaltiger; rechtes vnd gerechter hant beschawer; widerbringer aller bruche; ganz vermugender in allen kreften; nothaft, zu dem alle gute ding als zu dem weisel der bin nehen vnd halten sich; vrsache aller sache, erhore mich! Aller seuchten widerbringender arzet; meister aller meister; allein vater aller schepfung; alweg vnd an allen enden gegenwurtiger zuseher; aus der muter leibe in der erden gruft selbmugender geleiter; bilder aller formen; gruntfeste aller guten werke; aller werlte warung; hasser aller vnfletigkeit, loner aller guten dinge; allein rechter richter; einig, aus des anfange alle sache ewiglich nimmer weichen mag, erhore mich! Nothelfer in allen engsten; fester knote, den niemant aufbinden mag; volkumenes wesen, das aller volkumenheit mechtig ist, aller heimlicher vnd niemandes wissender sachen warhaftiger erkenner; ewiger freuden spender, irdischer wunnen storer; wirt, ingesinde vnd hausgenosse aller guten leute; jeger, dem alle spor vnuerborgen sint; aller sinne ein feiner einguß; rechter vnd zusamenhaltender mittel aller zirkelmasse; genediger erhorer aller zu dir rufender, erhore mich! Nahender beistendiger aller bedurftigen; traurenwender aller in dich hoffender; der hungerigen widerfuller, satung der durstigen, labung der kranken; sigel der aller hochsten maiestat; besliessung des himels armonei; einiger erkenner aller menschen gedanke; vngleicher bilder aller menschen antlitze; planete gewaltiger aller planeten; ganz wurkender einfluß alles gestirnes; des himels hofes gewaltiger vnd wunnesamer hofemeister; twang, vor dem alle himelische ordenung aus irem geewigten angel nimmer treten mag; lichte sunne, erhore mich! Ewige lucerne; ewiges immerlicht; rechte farender marner, des kocke vndergeet nimmer; banierfurer, vnder des banier niemant sigelos wirt; der helle abgrundes stifter; der erden klosses bawer; des meres strames tremer; der luft vnstetigkeit mischer; des feures hitze kreftiger, aller elemente tirmer; doners, blitzens, nebels, schawers, snees, regens, regenbogens, miltawes, windes, reifes vnd aller irer mitwurkung einiger essemeister; alles himelischen heres gewaltiger herzog; vnuersagenlicher keiser; aller senftiglichster, aller sterkster, aller barmherzigster schepfer, erbarme dich mein vnd erhore mich! Schatz, von dem alle schetze entspriessen; vrsprung, aus dem alle reine ausflusse fliessen; leiter, nach dem niemant irre wirt; aus nichte ichts, aus ichte nichts allein vermugender wurker; aller weilwesen, zeitwesen vnd immerwesen ganz mechtiger erquicker, aufhalter vnd vernichter, des wesen joch, als du in dir selber bist, ausrichten, visieren, entwerfen vnd abnemen niemant kan; ganzes gut vber alles gut; aller wirdigster ewiger herre Ihesu, empfahe genediglichen den geist, empfahe gutlichen die sele meiner aller liebsten frawen! Die ewigen ruwe gib ir, mit deiner genaden tawe labe sie, vnder den schaten deiner flugel behalt sie! Nim sie, herre, in dein volkumen genuge, da genuget den minsten als den meisten! Laß sie, herre, von dannen sie kumen ist, wonen in deinem reiche bei den ewigen seligen geisten! Mich rewet Margaretha, mein auserweltes weib. Gunne ir, genadenreicher herre, in deiner almechtigen vnd ewigen gotheit spiegel sich ewiglichen ersehen, beschawen vnd erfrewen, darin sich alle engelische kore erleuchten! Alles, das vnder des ewigen fanentragers fanen gehoret, es sei, welcherlei creature es sei, helfe mir aus herzen grunde seliglichen mit innigkeit sprechen: amen! 16. Jahrhundert Sebastian Brant 1458 - 1521 Der Autor Sebastian Brant, Jurist, Verleger, Schriftsteller und Pädagoge, wurde 1458 in Straßburg geboren. Er studierte in Basel und promovierte dort 1489 zum Doktor beider Rechte. Später war er Dekan der juristischen Fakultät. 1494 erschien die Satire «Das Narrenschiff», die zu einem europäischen Bestseller wurde. 1499 kehrte er in seine Vaterstadt zurück und war dort in verschiedenen Ämter tätig. 1521 ist er in Straßburg gestorben. De fulgetra anni 1492 Vom Donnerstein des Jahres 1492 Lateinische Fassung Deutsche Fassung Textgrundlage: Lateinische Gedichte deutscher Humanisten Hrsg.: H. C. Schnur, Stuttgart 1966, S. 22-25 _____________________________________________ ______ De fulgetra immani iam nuper anno [14]92 prope Basileam in agros Suntgaudiae iaculata Perlegat antiquis miracula facta sub annis qui volet, et nostros comparet inde dies, visa licet fuerint portenta horrendaque monstra: lucere e caelo flamma, corona, trabes, 5 astra diurna, faces, tremor et telluris hiatus et bolides, Typhon, sanguineusque polus. circulus et lumen nocturno tempore visum, ardentes clipei et nubigenesque ferae. montibus et visi quondam concurrere montes, 10 armorum et crepitus et tuba terribilis. lac pluere e caelo visum est frugesque calybsque, ferrum etiam et lateres et caro, lana, cruor. et sescenta aliis ostenta ascripta libellis, prodigiis ausim vix similare novis. 15 visio dira quidem Friderici tempore primi et tremor in terris lunaque solque triplex. hinc cruce signatus Friderico rege secundo excidit inscriptus grandinis imbre lapis. Austria quem genuit senior Fridericus in agros 20 tertius hunc proprios et cadere arva videt. nempe quadringentos post mille peregerat annos sol, noviesque decem signifer atque duos, septem praeterea dat Idus metuenda Novembris, ad medium cursum tenderat illa dies, 25 cum tonat horrendum crepuitque per aethera fulmen multisonum: hic ingens concidit atque lapis, cui species deltae est aciesque triangula: obustus est color et terrae forma metalligerae. missus ab obliquo fertur, visusque sub auris 30 Saturni qualem mittere sidus habet. senserat hunc Enßheim, Suntgaudia sensit; in agros illic insiluit depopulatus humum, qui licet in partes fuerit distractus ubique, pondus adhuc tarnen hoc continet: ecce vides. 35 quin mirum est potuit hiemis cecidisse diebus aut fieri in tanto frigore congeries? et nisi Anaxagorae referant monimenta, molarem casurum lapidem credere et ipse negem. hic tunc auditus fragor undique litore Rheni, 40 audiit hunc Uri proximus Alpicola, Norica vallis eum, Suevi Rhaetique stupebant, Allobroges timeant, Francia mota tremit. quicquid id est, magnum portendit, crede, futurum omen: at id veniat hostibus, oro, malis. In schedia eodem anno (MCDXCII) typis expressa hae lectiones variae inveniuntur: 18: grammate ab imbre. 38: et ista negem. 42: Francia certe tremit. ___________ Von dem erschröcklichen Donnerstein, so bei Ensisheim vom Himmel gefallen Sich wundert mancher fremder gschicht, der merck vnd leß ouch diß bericht. Es sint gesehen wunder vil im lufft / comet vnd fůrenpfil, 5 brinnend fackel / flammē vnd kron, wild kreiß vnd zirckel vmb den mon am hymel, blůt / vnd füren schilt / regen noch form der hier gebildt. Stoß-bruch des hymels vnd der erd / 10 und ander vil seltzen geberd tratzlich zerstiessen sich zwen berg / grüßlich trũmmen / vnd harnesch werck / isen / milch / regen stahel korn ziegel / fleisch / woll / von hymels zorn 15 als ouch ander der wunder glich dann by dem ersten Friderich noch ert bydem vnd finsterniß sach man drij sünn vnd mon gewiß. Und vnder keyser Friderich 20 dem andern / fiel ein stein grüßlich sin form was groß / ein crütz darjnn und ander geschrifft vnd heimlich synn. By wil des dritten Friderich geboren herr von Osterich 25 regt har jn diß sin eigen landt / der stein der hie ligt an der wandt. Als man zalt viertzehenhundert Jar, uff sant Florentzen tag ist war nüntzig vnd zwei vmb mittentag 30 geschach ein grusam donnerschlag / drij zentner schwer fiel diser stein hie in dem feld vor Ensißhein / drij eck hat der verschwerzet gar wie ertz gestalt vnd erdes var 35 ouch ist gesehen in dem lufft slymbes fiel er in erdes klufft. Klein stück sint komen hin vnd har, und wit zerfüert süst sichst in gar Tůnow / Necker / Arh / Jll / vnd Rin 40 Switz / Uri / hort den klapff der Jn. Ouch doent er den Burgundern ver jn forchten die Franzosen ser rechtlich sprich ich das es bedüt ein bsunder plag der selben lut. Hans Sachs 1494 - 1576 Der Autor Hans Sachs, Meistersinger und Schuhmacher, wurde 1494 in Nürnberg geboren. Nach fünfjährigen Walz, kehrte er 1516 in seine Vaterstadt zurück und starb dort 1576. Sein literarisches Werk umfaßt über 6000 Titel, darunter etwa 4200 Meistergesänge, etwa 1800 Spruchgedichte, 80 Fastnachtsspiele, 63 Tragödien, 65 Komödien und 5 Prosadialoge. Die insel Bachi. Im rosenton Hans Sachsen. Als ich das neu weltbuch durchlase Wie vil insel durchfaren wase Die neu schiffart von Portugal, Darein ich wunder ane zal 5 Funt, gar von seltsamen refieren, Von menschen, vögel, fisch und tieren; Zu nachts trieb mich die fantaseie In ein schwere melancholeie, Nach zu gründen den dingen tief, 10 Bis ich entlich darin entschlief. Do traumet mir so eigentleiche, Wie ich in Portugal dem reiche Ausfüre auf das weite mer In einer naue mit eim her 15 Für manche insel groß und weite. Entlich kam wir in kurzer zeite Zu der insel Bachi mit nam Auf eim klar glaslauterem stram: Da weet Zephirus der wint, 20 Die naue gieng stil senft und lint. Die bletter gleich den harfen klungen, Die vögel lustiklichen sungen, Das frei gewilt sprang in dem hag, Die fisch schnalzten in warmer wag; 25 Die insel stunt voller weinreben: In hohen freuden war wir schweben. Kürzlich war unser freud uns bitter; Ein sturmewint und ungewitter Her durch die schwarzen Wolken hal, 30 Licht blitzen, grausam donnerstral, Die wellen an die naue schlugen, Mit kreften wir die ruder zugen. Der stram war eitel blut und schwarz; Schlangen, kröten sach ich aufwarz 35 Schwimmen; fledermaus und die eulen, Löwen, wölf, beren hort wir heulen; Verdorrt waren reben und baum, Die vögel schwiegen in dem traum; Unser naue war schwach und kracht; 40 Im augenblick ich auferwacht. Ich dacht: der straum vergleicht sich eben Bacho, dem got, welcher tut geben Eßen und trinken auf das best, Macht frölich beide wirt und gest; 45 Auch tut er allen wollust bringen Mit saitenspil, pfeifen und singen, Mit tanzen, spil, schwenk mancher weis, Sam sei man in dem paradeis, Bis das man gar feucht wirt vom wein; 50 So schlegt entlich der donner drein Mit ungestüme, gleich den toren, Die zanken, schreien und rumoren. Aus füllerei auch folgen tut Schant, laster und auch die armut, 55 Kopfwe, krankheit aller gelider; Vernunft und sin ligen darnider, Sterk und gedechtnus sie abstürzen, Des menschen leben sie verkürzen. Doctor Freidank spricht: mer leut sterben 60 Von füll, dan durch das schwert verderben. Johannes Harsch um 1530 - nach 1562 Der Autor Johannes Harsch von Schor(e)ndorf, evangelischer Lieddichter, ist wohl um 1530 in Schorndorf in Württemberg geboren. Wahrscheinlich hat er in Tübingen Theologie studiert. Dort veröffentlicht er 1562 ein 25-strophiges Lied im Bremberger Ton, auf acht Oktavblättern gedruckt. Die letzte Strophe enthält am Anfang der Verszeilen seinen Namen: «Johannes Harsch von Schorendorff». Weitere Lieder von ihm sind nicht überliefert. Ob er mit einem Pfarrer Johannes Harsch identisch ist, der von 1562 bis 1567 die Pfarrei von Langenbrand im Landkreis Calw betreute, ist nicht bekannt. Ein Gaistlicher Bremberger 1562 Textgrundlage: Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts, Vierter Band (S. 196 ff. Nr. 288) von Philipp Wackernagel Leipzig: B. G. Teubner, 1874 Faksimile: Internet-Archive _____________________________________________ _______________ Ein Gaistlicher Bremberger, Klag, warnung vnd weissagung uber die vndanckbare vnd verkerte welt, auch die zukunftige straaff, raach vnd Gottes zorn uber die selbigen, aus göttlicher Schrift gezogen vnd in gesangs weiß verfaßt. 1 WAch auff, o welt, aus deinem schlaff, das bitt ich dich, vnnd bis ain weile munderhafft, bis ich dir klag mein kummer: Ich bin betrübt, das ich dich so vermessen sich, 5 wahrlich der solches in dir schafft, das wurdt je thun kein frommer. Weil dir Gott gibt sein hailigs Wort, das leuchtet wie der morgenstern, klarer denn ein carfunckel: 10 Das solt je sein dein höchster hort, vnnd deinen füßen ein latern, das du nit giengst im tunckel. So bist verkert vn blind' dan ein aichner stock, zu allen gutten tugenden feüler dann ain block: 15 durch dich sein großmechtiger Nam solt werden preißt, so wurdt im durch dein böße art all schmach vnnd groß vnehr beweißt. b Esaias singt seinem volck ain liedlin schon, wie im der Herr ain Weingart zart an aim faißt ort hab zogen, Hab in vmbmaurt, ain keller darein bawen lon, 5 vnnd hab auff frucht vnnd trauben gwart, er aber hab in trogen, Vnd hab doch nichts dann herling bracht, darumb die von Jerusalem das vrtheil solten geben: 10 Der Herr sprach “Ich hab selbs bedacht, was seinem Weingart wol gezäm, wie er mit im wott leben: Sein wend vnd zeun werde gerissen zu d'Erd, dz er wiest lig, nicht gehackt noch beschnite werd, 15 darmit er hinfurt nicht den dorn vnnd distel tragt, kein taw noch reg kompt vber in,” hatt der Herr Zebaoth gesagt. 3 Jesus Christus des höchste eingeborner son, vom gschlecht David vnnd Abraham ein warer Mensch geboren, Er ka auff Erd wol aus de höchste himels thro, 5 vnnd wolt da an des Creutzes stamm stillen seins Vatters zoren. Er hatt solchs mit gutthat beweyßt, in Galilea frue vnnd spatt, mit mirackeln vnd wunder: 10 Er hatt sie inn der wůsten gspeißt, macht sie gesund, erweckt vom Todt, noch wurden sie nit munder. Da schrey er wee, wee vber alle solche Stett, da Er sein wunderwerck erzaiget vn predgt hett, 15 das sie sich nit bekert vnnd buß hetten gethon, er sprach, Sodom vnnd Gomorrha am letsten gricht wurdt baß ergohn. 4 Als der Herr zu Jerusalem ein reutten sölt, bald er die statt ansichtig war, da waint Er bitterlichen: Er sprach “wie offt hab ich dich vnterschleuffen gwölt 5 wie ain brůthenn jr junge schar, almal bist mir entwichen; Jerusalem, du bist im bann, du mordest die ich zu dir send, solt ich dir das vergessen? 10 Alles grecht blut von Abel an will ich fordern von deiner hend vnnd will dirs als zu messen. Jerusalem, wißtest, was zu deim frid gehört, das du durch rechte buß zu mir wurdest bekoert, 15 es ist laider vor deine gsicht verborgen gar, dein feind werden umbgeben dich vnnd bringen inn groß noth vnnd gfar.” 5 Was Gott seim volck durch die Propheten hatt verkundt, das wurden sie mit schmertzen gwar, weil sie Gott thett verlassen: Salmannessar fierts inn Syriam durch sein gesind, 5 vnnd brachte ander völcker dar, die Israhel besassen. Juda hatt woll gesehen das, wie Gott Israhel hett gethon, wolten sich doch nit keren, 10 Darumb in Gott auch wurdt gehaß, vnnd schickt sie hin gehn Babilon, jr unglück thet sich mehren. Letzlich als Gott sie haimsuchte durch seine son, sie wolten in kurtzumb zu keinem könig hon, 15 da musten sie all jemerlich gantz gen zu grund durch Titum, des Vespasi Sohn, als vns Josephus das thut kundt. 6 Nur sagt Christus, die warheit selbs, mit seinem mund “so das am grienen holtz geschicht, was will am dirren werden?” So gott laßt gen die naturliche zweyg zu gr[u]nd, 5 als wie der hailig Paulus spricht, so steht die Impf in gferden. Das laß dir, welt, zu hertzen gohn: was dirr zukunfftig gschehen soll ist an den juden zsehen: 10 Gott gibt das Euangelion, wie mans annimpt, das sicht man woll, wer köndt doch anders jehen, Wan das du, wellt, must bsten ainen heftige stand, vnd du zuuor vnd furnemlich, o Teutsches land, 15 weil dich Gott hatt aus de letste zu erste gmacht: wie mainstn, das du werdest bstehn, weil du sein wort nit hast in acht? 7 Hör zu, O welt, wz der Herr fur ein antwort gab, die jm sagten von Pilato, wie er hat blut vergossen: Er sprach zu jn “was habt jr fur verwunderung drab? 5 es wurdt euch gschehen aach also, so jr die sund nit lassen.” Er sagt “maint jr, das die allain gesundet hand zu Siloha die der thurn hatt erschlagen?” 10 Er sprach “laßt euch ein warnung sein: es sind noch ander straffen da, die jr müssen ertragen.” Dz merck, O welt, vn faß es in dein steinen hertz, laß dirs bej leib in keine weg nur sein ein schertz, 15 dan wz Got vor zu ander zeit der welt hat tho, weil du den lebst in gleichem fall, so must du auch die gferd beston. 8 Auch sagt Petrus, Gott hab der Engel nit verschot, habs mit ketten der finsternus gar hart vnnd starck gebunden, Hab auch der welt zur zeit Noah greulich gelont, 5 vnnd sie ertrenckt mit dem sundfluß weil sie fleischlich erfunden. Auch Sodoma vnnd gomorrha mit schwebel, bech vnnd fewr verbrent weil sie den Lott verachten, 10 Quellten ein grechte seele da, da er sie straafft vnnd hoch ermant: o welt, thu das betrachten! So Gott die welt ertrenckt vnd die Stett hatt umbkeert, vnd sie doch nur ein ainiger prediger leert, 15 wie wiltu dan am jungste tag vor Gott beston? du hast doch mer dann tausent Lott, auch bawt Noa die Archen schon. 9 Ich bitt durch Gott, habt mein gesang fur keinen spott, denckt nit, das ichs aus zoren thüe, euch darmit zu stumpfieren: Was mich bewegt, das waißt allein der Ewig Gott, 5 dieweil ich sich dich spat vnd frühe, o welt, so jubelieren, Weil dir Gott zaigt am firmament durch wunderwerck sein grossen zorn mit vilfeltigen zaichen, 10 Darzu er dir vil plagen sendt: es ist laider an dir verlorn, er kan dich nit erwaichen. O welt, o welt, es ist fürwar nun kinder rutt: weil du dan nit aus solcher zucht bist worde gut, 15 so wirt er dich regiren mit dem eisnen stab, nit hie allain, auch ewiglich, du thuest dann buß vnnd bittsts im ab. 10 O welt, denck nit, du habst kain wasser nie betrübt, derhalben dich der höchste Gott ohn vrsach mueste straffen: Aus hertzen grund hatt dir vor allen dingen gliebt 5 was gwesen ist widder sein gbott, bist ganz in sund entschlaffen: Es darff je nit beweisens vil, all deine werck sind offenbar vnnd laider vnuerborgen: 10 Dann wer den bawm erkennen will, derselbig nemb der fruchten war, er urtheilt ohne sorgen: Furwar, du bist d' feigenbau, d' kein frucht tregt, dir ist die art schon vnden an die wurzel glegt, 15 hast nichts den laub vnnd doch kein frucht nie recht verbracht, darumb ist dein in diser zeit jm himmels thron vor Gott bedacht. 11 Wer es betracht, wie Gott hatt thon zu aller zeit, der wurt daraus erlernen wol, das groß straff seind vorhanden: Sie sind schon reiff, auch grausam schwer vnd nimer weit, 5 ein jeder das betrachten soll, das er nit werd zu schanden. Ernsthafft vnnd grecht ist vnser Gott, dem Gottloß wesen nit gefalt, er mag es auch nit dulden; 10 Doch wil er nit des sünders todt, sein zoren laßt er fallen bald, so mir jm nur thun hulden. Welt, merck sein art: so er will straffe stet vn land, hat ers zwar alle weg durch seine knecht ermant, 15 ob sie villeicht oder zum thail buß hetten thon, wie es zu Niniue geschach, das er sein straaff thet vnterlon. 12 Zu Nohas zeit ließ er der welt verkunde bueß zuuor hundert vnnd zweintzig Jar, ob er sie möcht bekeren: Zu diser zeit man aber diß betrachten muß, 5 das wir nit hand so lang beuor, wie Christus selbs thut leren. Denk, wie du, welt, in viertzig Jar inn geitz, hofart, schand, üppigkait vnnd vntrew hast zů gnommen: 10 Hetstn noch achtzig Jar beuor, als es geschach zů Nohas zeit, ach warzu wurt es kommen? Der Herr sagt selbs, dein tag mueßen werden verkurtzt, aller hochmůt, falsch vn betrug werde gesturtzt, 15 auff das die ausserwelten nit werden verfuert: wo das nit gschech, sagt selbs der Herr, kain mensch auff erd mehr selig wurdt. 13 Merk auf, o welt, vnnd nimb der zeit gantz eben war, darin der Herr sein buß verkunt, das will ich jetzt erzelen. Das ist gmainglich alwegen gwesen viertzig Jar, 5 wie ich es oft geschriben find, die im Gott thut erwelen. Als Moises alt war viertzig jar, da zeigt Er an mit einer that, er wolt Ißrahel loesen, 10 Aber sie wurdens nit gewar, wie Steffanus actorum sagt, ist ein buß predig gewesen Dem Pharao vnnd dem gantzen Egipten land, dan jn der Herr doch widerum zu pharao sand, 15 nach de die zeit wurdent erfullt, die viertzig jar, weil sie es nit wolten verstehn, jm rotten meer ersoffens gar. 14 Die grewlich thatt, die in Egipte Gott hat gthan, das wirt den Cananitern sein ain recht buß predg gwesen: Sie achtens nit, vnd kerten sich gantz nicht daran, 5 biß das das viertzigst jar erschein, da mochten sie nit gnesen. Elias hat bey viertzig jar dem Achab vnnd der Ißabel zuuor buß thun verkunden, 10 Desgleichen Esaias jwar dem gantzen hauß von Ißrahel, als wir es klerlich finden. Jeremias auch viertzig jar zuuor ermant, eh das die Stat Jerusalem ward gar verbrant, 15 gar hart vnnd starck on vnterlaß er jnen trewt, aber sie woltens glauben nit, biß das die statt wurdt gar zerstrewt. 15 Als der Herr Christ den rechten pharon hat ertrenckt, durch sein leiden vnd bittern todt, sund, Helle, tod vnnd Teuffel, Vnd sonderlich der Herr sich zu den Juden lenckt, 5 aber sie hieltens für ein spot, das bracht in grossen zweiffel: Er gab in fristung viertzig jar, ließ in das Euangelion die zeit gar woll verkunden, 10 Darzu auch wunderzaichen zwar sach man woll an dem himmel stehn, kain besserung thett sich finden: Da kamen sie in jamer, angst vnnd große not, vn blibe mehr dan ailffmal hundert tausent tod, 15 wurde verkaufft, veracht, verspot vn gantz zertrennt, Josephus das beschriben hatt, vnnd namen gar ein grewlich endt. 16 Dieweil vns Gott sein hailigs wort zur letsten zeit zu einer zeugnus hatt gesendt, wie Christus selbs thut sagen: Wir achtens nit, wie vnser wanndel zeugnus geit, 5 drumb ist die welt schon an dem endt, geht an die letsten plagen. Gott hatt vnns wol vil straffen gsendt, mit krieg, teurung, brand, Tod vnnd mord, wie man es thut erfaren: 10 Vil zaichen an dem firmament zu kainer zeit ist nie erhoert als jetz bey dreissig jaren. Wer nimpts zu hertz, das Gott sein gůt in zoren kert, all creatur im wasser, lufft, himel vnnd Erdt, 15 die haben sich gegn dir, o welt, zur raach gewent: so du es nit erkennen wilt, furwar so bist wie Pharo blendt. 17 Christus vns selbs seiner zukunfft ain zaichen geit: wan er die welt haimsuchen werdt, kain glauben werd Er finden. Er spricht “gleich wie es ist gangen zu Nohas zeit, 5 also werd sie auch sein verkert, genaigt zu allen sunden.” Ob man sich schon vil glaubens riempt von Christo vnnd der seligkait, wie man artlich kan sagen, 10 All sachen seind mit gschrifft verbluembt, doch verrath vns die vppigkait, dan wir ein falsch hertz tragen: Das ist genaigt auff zeitlich gut, wollust vn bracht, hand aus der Erd vnnb Sathans Raich ain himmel gmacht, 15 so es doch Gott vnd Christus nie benothen hat, es hats auch kain Apostel glert, kain Patriarch thett solche that. 18 Warlich Gott hat sein letsten zorn schon gnomen fur, die Engel mit den siben schaln anthon mit rainer seiden: Glaubs oder nit, sie seind dir lengest vor der thür, 5 dein boßheit wurt er dir bezaln, so du sie nit wilt [m]eiden. Du waist den weg vnnd gehst in nit, dich hatt verblendt das jrrdisch gut, bringt dir ein nagend gwissen, 10 Deim glauben volgt kain tugent nit, das muestn zalen mit deim blut, der Sathan hatt dich bschissen. Gwalt, kunst, weißheit braucht niemand nit zu Gottes Ehr, allain zum geytz vnd leibs wollust, drumb zurnt der Herr, 15 sendt zeitlich straf, ob er vns bringe möcht zur buß, drum lestert man den hoechste Gott, sein hailigs wort dschuld haben muß. 19 O wee, Achab: die Jessabel hatt dich verfuert, Ramath das ligt in irem sinn, dein Priester dich verkurtzen: Furwar, Gott hatt dem Jehn schon sein hertz beruert, 5 der Jessabel mit seinem grim von der zinnen wurt sturtzen. O Josabat, du gibst die flucht, die vile dich betrogen hatt, Micha der hat nichts golten: 10 Will das bej dier nicht schaffen frucht, so wais ich ich[t] dir hinfur kain rath, der Herr hat Achab gscholten: Der streyt geschicht jm reyßthal zu hormagedon, da wurt jrn schein verliern die Son vnnd auch der Mon, 15 vnd auch die stern werden verhalten jren schein, doch wurdt der aller hoechste Gott seim volck ain grosse zuflucht seinn. 20 O Magistrat, die jr euch nennten Gottes knecht, wie euch die schrift des zeugnus geit vnnd ich euch auch bekenne: Habt acht auff euch, das Gott durch euch nit werd geschwecht! 5 der welt pracht wert ein kurtze zeit, die Hell thut ewig brennen. Besecht durch Gott die hailig gschrifft, all Histori durch leßt mit vleis, so werd jr gwiß drinn finden, 10 Wie ewer stand ein sueße gifft vnnd ewer weg glat wie ein eyß, dem wenig volgen könden. Was dvrsach ist, des stehnd doch alle bucher vol, vnd ist nit ohn, der mehrer thail der waißt es wol, 15 –––––––––––– noch hat euch geitz, wollust verblendt, das jr den selben weg auch gehnd. 21 Wacht auff, wacht auff, jr, die man Gottes Hirten nent! es geht ein grosses gwülck daher: thund schaaff inn pferrich treiben. Saumpt euch nit lang, vnd nembt den stab in ewer hand, 5 es darff furwar nit schlaffens mer, will man vorm wetter bleiben. Tracht nit nach ruw vnnd gutter zeit, nach wollust, Ehr vnd müssigang, die zeit mags nimmer leiden: 10 Warlich, der Herr ist nimmer weit, er wurdt doch nit verziehen lang, wurdt seine feind austreiben. Dann findt Er euch schlemmen, brassen mit jhenem knecht, vnnd als die jm sein Ewigs Reich habend verschmecht, 15 weil jr auff Erd euch widerum ein and's bawt, furwar, jr gebt da mit vrkund, das jr im nicht vmbs Ewig trawt. 22 Nun blasend starck mit der pufaunen zu Zion, das sich darnon das land bewegt: des Herren tag ist kommen! Ist finster, schwartz, wölckig, neblig, das zeigen an, 5 ein grausam volck sich jetzund regt, dergleichen nie vernomen: Vor jhm geht ein verzerent fewr, vnnd nach jm ain brinnender flam, niemand mag jm entrinnen. 10 Warlich, all frewd wurdt werden tewr, dieweil jm niemands weren kann, das wurdt groß weehklag bringen: Vor jm zitert dz land, d'himl wurdt bewegt, Son, Mon vnnd stern werden mit finsternus bedeckt, 15 vor seinem heer laßt d'Herr seinen donder gehn, grewlich, schrecklich wurdt sHerren tag: ach, wer will doch vor jm bestehn? 23 So spricht der Herr “kert euch zu mir mit hertz vnnd gmueth, zerreyst die hertz, die klaider nit, mit fasten, wainen, klagen.” Gnedig ist er, barmhertzig vn von grosser guet, 5 jnn rewt die straff, so man jn bitt, vnnd thut mitleiden tragen. Drumb hailg ein fasten in der gmein, baid, jung vnnd alt, samlet zu hauff, auch die jungen seuglingen; 10 Der breutigam laß die kammer sein, jr priester, hept die hende auff, laßt euch zu hertzen tringen, Vnd bitten Gott, das er sein straaf in guete lend, Vn sich mit gnad, wie sein art ist, her zů vns went, 15 das er den feind vnnd was vns btruebt treib von vns ferr, auff das wir jm hin für vnnd für sagen groß lob, preyß, danck vnnd ehr. 24 Zeuch aus, zeuch aus, o Gottes volck, aus diser welt, mit gantzem hertzen, sin vnnd můht, seel, Leib vnd allen krefften! Wend ab dein hertz von wollust, pracht, geitz, gůt vnnd gelt, 5 betracht allein das hoechste gůt, daran dein hertz thu hefften. Gedenck, wie bist so thewr erkaufft durch des vnschuldig lambes blůt, am creutz fur dir gestorben. 10 Darumb bist auff sein namen taufft, das du thail habst an seinem gůtt, sonst werst ewig verdorben. Drum laß dirs sein de hoechste schatz, dz hoechste gůt, betracht es recht, so bringt es dir frid, frewd vn můt, 15 vnd sprich mit hertz “Herr, dein will gschech, der vnser nit, dein Reich allein kom zu vns, Herr, so sind wir grosser sorgen quit.” 25 Ich bitt durch Gott, dz ma mir dz zum besten halt, ob ich nit hab ains jeden gaist hie inn meim gsang getroffen. Alweil ich wais, das Gott ein ainfalt gwissen gfalt, 5 nach seiner maß, wie ers im laist, neben dem thu ich hoffen, Es werd doch nit gantz leer abgon, sonder es werd etlicher leut hertz, gmueht vnnd sinn erwaichen. 10 Aber wer sich nit kert daran, raach vnnd Gottes zorn ist nit weit, schmach schand wurdt jn errichen. Von hertze grud so bitte gott vo himelreich, schreit, růft zu jn, dz er vns vnser sind verzeich, 15 oren, hertz, sin vn gmuet machet jm vntertho, dorffen wir vns gantz förchte nit, so schon sein zorn werd ahne gohn. ___________ Anmerkungen von Philipp Wackernagel: Erstausgabe: 8 Blätter in 8°, Tübingen 1562. Die letzte Strophe enthält in den Anfangsbuchstaben, zum Teil den Anfangswörtern, der Verszeilen den Namen Johannes Harsch von Schorendorff. Vers 1.2 Bis, 2.3 ain, 2.15 tregt, 3.11 mach, 3.12 mit wunder für n. m., 3.17 ger., 4.1 ain für ein. 4.10 vom, 4.13 deinem, 5.7 hatte, 5.14 inn für in, 6.8 gesch. 6.13 ain. 7.3 fehlt blut, 7.13 steine, 7.17 fehlt du, 8.17 Noe, 11.11 zorn, 11.15 villeucht, 12.11 Nahos, 14.1 Die Gott in Egipte hat gethan, 14.14 ehe, 15.3 Hell, 15.11 ann für an dem, 16.6 ahn, 16.17 Pharao, 17.7 sie für sich, 17.16 giert, 18.4 vor thür, 18.14 leibes, dran für drumb, 20.10 süß, hinter 20.14 fehlt eine Zeile: ich habe angenommen, es sei 20.15, es könnte sich aber auch so verhalten, daß 20.16 fehle und innerhalb der vorangehenden (mit verblendt endigenden) Zeile vier Sylben zu ergänzen seien; Vers 22.16 des, 23.7 hailge, 23.14 sich für her, 23.15 betrübt, 23.17 eher, 25.15 macht. Der aus dem Ende des 13. Jahrhunderts stammende Ton, den man im Verlauf der Zeit kurzweg den Brennenberger oder Bremberger nannte, erscheint hier noch einmal in sehr später Zeit: ich kenne kein noch späteres Vorkommen. Die Art der Abweichungen desselben in diesem Gedicht von dem Strophenbau in anderen spricht für das höhere Alter der hier aufbewahrten Form. Neuhochdeutsche Literatur 17. Jahrhundert Paul Gerhardt 1607 - 1676 Der Autor Paul Gerhardt wird 1607 als zweiter Sohn des Gastwirts und Bürgermeisters Christian Gerhardt in Gräfenhainichen (Henichen) geboren. Nach dem Besuch der Fürstenschule in Grimma studiert er ab 1628 an der theologischen und philosophischen Fakultät der Universität Wittenberg. Dort ist er nach dem Studium als Hauslehrer tätig und verfaßt seine ersten Gedichte. Er erlebt die Schrecken des Kriegs und die Pest. Um 1643 tritt er bei einem Kammergerichtsrat in Berlin die Stelle eines Hauslehrers an und befreundet sich mit dem Kantor der Berliner Nikolaikirche, Johann Crüger. Dieser hatte 1640 das Gesangbuch «Praxis Pietatis Melica» herausgegeben. Bis 1653 veröffentlicht Paul Gerhardt hier in weiteren Auflagen 82 seiner Lieder. 1651 erhält er die Stelle eines Probstes an der Pfarrkirche von Mittenwalde, 1657 kehrt nach Berlin zurück, als Diakon an der Nikolaikirche. Das Brandenburgische Kurfürstenhaus war 1622 vom lutherischen zum calvinistischen Glauben übergetreten und es kam vor allem unter dem Großen Kurfürsten immer wieder zu Auseinandersetzungen mit den Lutheranern. Im Verlauf dieser Konflikte wurde auch Paul Gerhardt 1666 vom Dienst suspendiert. Als der Große Kurfürst auf Grund vieler Eingaben auf Wiedereinsetzung Gerhardts die Entlassung zurücknimmt, verzichtet dieser auf eine Weiterführung des Amtes und geht 1668 als Archidiakon an die Pfarrkirche in Lübben im Spreewald. Dort ist er 1676 gestorben. Sogenanntes «Testament» Paul Gerhardts für seinen Sohn Frühjahr 1676 Text: Das deutsche evangelische Kirchenlied des 17. Jahrhunderts, 6 Bände Hrsg.: A. Fischer/W. Tümpel, Gütersloh 1904-1916/Hildesheim 1964 _____________________________________________ _______________ Nachdem ich nunmehr das 70. Jahr meines Alters erreichet, auch dabey die fröhliche Hoffnung habe, daß mein lieber frommer Gott mich in kurzem aus dieser Welt erlösen und in ein besseres Leben führen werde, als ich bisher auf Erden gehabt habe, so danke ich ihm zuvörderst für alle seine Güte und Treue, die er mir von meiner Mutter Leib an bis auf jetzige Stunde an Leib und Seele und an allem, was er mir gegeben, erwiesen hat. Daneben bitte ich ihn von Grund meines Hertzens, er wolle mir, wenn mein Stündlein kommt, eine fröhliche Abfahrt verleihen, meine Seele in seine väterlichen Hände nehmen und dem Leibe eine sanfte Ruhe in der Erde bis zu dem lieben jüngsten Tage bescheren, da ich mit allen Meinigen, die vor mir gewesen und auch künftig nach mir bleiben möchten, wieder erwachen und meinen lieben Herrn Jesum Christum, an welchen ich bisher gegläubet und ihn doch nie gesehen habe, von Angesicht zu Angesicht schauen werde. Meinem ein[z]igen hinterlassenen Sohn überlasse ich von irdischen Gütern wenig, dabei aber einen ehrlichen Namen, dessen er sich sonderlich nicht wird zu schämen haben. Es weiß mein Sohn, daß ich ihn von seiner zarten Kindheit an dem Herrn meinem Gott zu eigen gegeben, daß er ein Diener und Prediger seines heiligen Wortes werden soll. Dabey soll er nun bleiben und sich daran nicht kehren, daß er nur wenige gute Tage dabey haben möchte, denn da weiß der liebe Gott schon Rath zu und kann das äußerliche Trübsal mit innerlicher HerzensLust und Freudigkeit des Geistes genugsam ersetzen. Die heilige Theologiam studire in reinen Schulen und auf unverfälschten Universitäten und hüte dich ja vor Syncretisten, denn die suchen das Zeitliche und sind weder Gott noch Menschen treu. In deinem gemeinen Leben folge nicht böser Gesellschaft, sondern dem Willen und Befehl deines Gottes. Insonderheit 1. thue nichts Böses in der Hoffnung, es werde heimlich bleiben, denn es wird nichts so klein gesponnen, es kommt an die Sonnen. 2. Außer deinem Amte und Berufe erzürne dich nicht. Merkst du denn, daß der Zorn dich erhitzet habe, so schweige stockstill und rede nicht eher ein Wort, bis du erstlich die zehn Gebote und den christlichen Glauben bei dir ausgebetet hast. 3. Der fleischlichen Lüste schäme dich, und wenn du dermaleinst zu solchen Jahren kommst, daß du heirathen kannst, so heirathe mit Gott und gutem Rath frommer, getreuer und verständiger Leute. 4. Thue Leuten Gutes, ob sie dir es gleich nicht zu vergelten haben, denn was Menschen nicht vergelten können, das hat der Schöpfer Himmels und der Erden längst vergolten, da er dich erschaffen hat, da er dir seinen lieben Sohn geschenket hat und da er dich in der heiligen Taufe zu seinem Kinde und Erben auf- und angenommen hat. 5. Den Geiz fleuch als die Hölle, laß dir genügen an dem, was du mit Ehren und gutem Gewissen erworben hast, ob es gleich nicht allzuviel ist. Bescheret dir aber der liebe Gott ein Mehres, so bitte ihn, daß er dich vor dem leidigen Mißbrauche des zeitlichen Gutes bewahren wolle. Summa: bete fleißig, studire was Ehrliches, lebe friedlich, diene redlich und bleibe in deinem Glauben und Bekennen beständig, so wirst du einmal auch sterben und von dieser Welt scheiden willig, fröhlich und seeliglich. Amen. Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 - 1716 Der Autor Gottfried Wilhelm Leibniz, Philosoph und Mathematiker, Diplomat, Politiker und Ökonom, Ingenieur, Jurist und Wissenschaftsorganisator, wird 1646 in Leipzig geboren. Er studiert Jura und Philosophie in Leipzig und Jena und promoviert 1667 an der Nürnberger Universität in Altdorf. 1670 wird er kurfürstlicher Rat beim Revisionsgericht in Mainz. In diplomatischer Mission reist er 1672 und 73 nach Paris und London. Dort trifft er Huygens, Arnauld, Malebranche, Boyle und Newton. 1676 wird er Hofrat und Bibliothekar des Welfenhauses in Hannover, dessen Geschichte er schreibt. Mit einer Vielzahl von Plänen und Projekten ist er befaßt: die Entwicklung der Differentialrechnung und der Dualzahlen, die Entwässerung von Gruben mit Hilfe von Windkraft, die Konstruktion einer Rechenmaschine, der Entwurf einer Idealsprache, die Errichtung einer deutschen Akademie der Wissenschaften, deren Präsident er 1700 wird. Zu seinen Lebzeiten erscheinen neben der Theodicee und den Nouveaux Essais nur kleinere Werke. Er stirbt 1716 in Hannover. Wichtige Werke - lateinisch, deutsch und französisch geschrieben - werden erst nach seinem Tode publiziert. Auf Meisches deutsches Florilegium __________________________________ Verse, so ich 1667 in Frankfurt am Main auf Herrn Christian Meische vorhabendes deutsches Florilegium gemacht. Den Blumensaft gepresset Herr Meisch hier mischen lässet, Zu füllen mit Geruch die Welt. Wie mancher süßer Zungen 5 Der Honigseim gelungen Bei ihm allein zu kosten fällt. Was lobt man viel die Griechen? Sie müssen sich verkriechen, Wenn sich die t e u t s c h e Muse regt. 10 Was sonst die Römer gaben, Kann man zu Hause haben, Nachdem sich Mars bei uns gelegt. Horaz in F l e m i n g lebet, In O p i t z Naso schwebet, 15 In G r e i f f Senecens Traurigkeit. Nur Maro wird gemisset, Hier hat man eingebüsset, Aeneis uns nicht weichen will. Doch wenn die teutsche Degen 20 D i e werden niederlegen, So uns jetzt stolz zu Leibe gehn, Wird sich auch einer finden, Auch sie zu überwinden, Und A u s t r i a s soll höher gehn. 25 Er aber wird verdienen, Herr Meisch, den Ruhm der Bienen, Daß er der Blumen Kraft trägt ein. Wem werd' ich ihn vergleichen? Er soll zum Lobeszeichen 30 S t o b ä u s bei den Teutschen seyn. 18. Jahrhundert Johann Wolfgang Goethe 1749 - 1832 Der Autor Johann Wolfgang Goethe wurde 1749 in Frankfurt geboren. Er studierte von 1765-1771 Jura in Leipzig und Straßburg. Danach ist er als Jurist in Frankfurt und Wetzlar tätig. 1775 beruft ihn Herzog Karl August als Minister und Erzieher nach Weimar. Im literarischen Kreis der Hofgesellschaft lernt er Charlotte von Stein kennen. Von 1786 bis 1788 bereist er Italien. Seit 1794 arbeitet er eng mit Friedrich Schiller zusammen, den er nach Weimar geholt hatte. In dieser Zeit beschäftigt er sich verstärkt mit naturwissenschaftlichen Fragen. Nach 1800 unterhält er vielfältige Verbindungen zum Kreis der Romantiker. Den politischen Wirren der nachnapoleonischen Zeit entfliehend entdeckt er Mittelalter und orientalische Literatur und beschäftigt sich autobiographisch mit einzelnen Abschnitten des eigenen Lebens. 1832 ist er in Weimar gestorben. Über den Zwischenkiefer _____________________________________________ _ Versuch aus der vergleichenden Knochenlehre daß der Zwischenknochen der oberen Kinnlade dem Menschen mit den übrigen Thieren gemein sey. Jena 1784 Einige Versuche osteologischer Zeichnungen sind hier in der Absicht zusammen geheftet worden, um Kennern und Freunden vergleichender Zergliederungskunde eine kleine Entdeckung vorzulegen, die ich glaube gemacht zu haben. Bei Thierschädeln fällt es gar leicht in die Augen, daß die obere Kinnlade aus mehr als einem Paar Knochen besteht. Ihr vorderer Theil wird durch sehr sichtbare Nähte und Harmonien mit dem hintern Theile verbunden und macht ein Paar besondere Knochen aus. Dieser vorderen Abtheilung der oberen Kinnlade ist der Name Os intermaxillare gegeben worden. Die Alten kannten schon diesen Knochen *), und neuerdings ist er besonders merkwürdig geworden, da man ihn als ein Unterscheidungszeichen zwischen dem Affen und Menschen angegeben. Man hat ihn jenem Geschlechte zugeschrieben, diesem abgeläugnet **), und wenn in natürlichen Dingen nicht der Augenschein überwiese, so würde ich schüchtern sein aufzutreten und zu sagen, daß sich diese Knochenabtheilung gleichfalls bei dem Menschen finde. Ich will mich so kurz als möglich fassen, weil durch bloßes Anschauen und Vergleichen mehrerer Schädel eine ohnedieß sehr einfache Behauptung geschwinde beurtheilet werden kann. Der Knochen von welchem ich rede, hat seinen Namen daher erhalten, daß er sich zwischen die beiden Hauptknochen der oberen Kinnlade hinein schiebt. Er ist selbst aus zwei Stücken zusammengesetzt, die in der Mitte des Gesichtes an einander stoßen. Er ist bei verschiedenen Thieren von sehr verschiedener Gestalt und verändert, je nachdem er sich vorwärts streckt oder sich zurücke zieht, sehr merklich die Bildung. Sein vorderster, breitester und stärkster Theil, dem ich den Namen des Körpers gegeben, ist nach der Art des Futters eingerichtet, das die Natur dem Thiere bestimmt hat, denn es muß seine Speise mit diesem Theile zuerst anfassen, ergreifen, abrupfen, abnagen, zerschneiden, sie auf eine oder andere Weise sich zueignen; deßwegen ist er bald flach und mit Knorpeln versehen, bald mit stumpfern oder schärferen Schneidezähnen bewaffnet, oder erhält eine andere, der Nahrung gemäße Gestalt. Durch einen Fortsatz an der Seite verbindet er sich aufwärts mit der obern Kinnlade, dem Nasenknochen und manchmal mit dem Stirnbeine. Inwärts von dem ersten Schneidezahn oder von dem Orte aus den er einnehmen sollte, begibt sich ein Stachel oder eine Spina hinterwärts, legt sich auf den Gaumenfortsatz der oberen Kinnlade an und bildet selbst eine Rinne worin der untere und vordere Theil des Vomers oder Pflugscharbeins sich einschiebt. Durch diese Spina, den Seitentheil des Körpers dieses Zwischenknochens und den vorderen Theil des Gaumenfortsatzes der obern Kinnlade werden die Canäle (Canales incisivi oder naso-palatini) gebildet, durch welche kleine Blutgefäße und Nervenzweige des zweiten Astes des fünften Paares gehen. Deutlich zeigen sich diese drei Theile mit Einem Blicke an einem Pferdeschädel auf der zweiten Tafel, Fig. 1. A. Corpus. B. Apophysis maxillaris. C. Apophysis palatina. An diesen Haupttheilen sind wieder viele Unterabtheilungen zu bemerken und zu beschreiben. Eine lateinische Terminologie, die ich mit Beihülfe des Herrn Hofrath Loder verfertigt habe und hier beilege, wird dabei zum Leitfaden dienen können. Es hatte solche viele Schwierigkeiten, wenn sie auf alle Thiere passen sollte. Da bei dem einen gewisse Theile sich sehr zurückziehen, zusammenfließen und bei andern gar verschwinden, so wird auch gewiß, wenn man mehr in's Feinere gehen wollte, diese Tafel noch manche Verbesserung zulassen. Os intermaxillare. A. Corpus. a) Superficies anterior, 1. Margo superior in quo spina nasalis. 2. Margo inferior seu alveolaris. 3. Angulus inferior exterior corporis. b) Superficies posterior, qua os intermaxillare jungitur apophysi palatinae ossis maxillaris superioris. c) Superficies lateralis exterior, qua os intermaxillare jungitur ossi maxillari superiori. d) Superficies lateralis interior, qua alterum os intermaxillare jungitur alteri. e) Superficies superior. Margo anterior, in quo spina nasalis. vid. 1. 4. Margo posterior sive ora superior canalis nasopalatini. f) Superficies inferior. 5 . Pars alveolaris. 6. Pars palatina. 7. Ora inferior canalis naso-palatini. B. Apophysis maxillaris. g) Superficies anterior. h) Superficies lateralis interna. 8. Eminentia linearis. i) Superficies lateralis externa. k) Margo exterior. l) Margo interior. m) Margo posterior. n) Angulus apophyseos maxillaris. C. Apophysis palatina. o) Extremitas anterior. p) Extremitas posterior. q) Superficies superior. r) Superficies inferior. s) Superficies lateralis interna. t) Superficies lateralis externa. Die Buchstaben und Zahlen, durch welche auf vorstehender Tafel die Theile bezeichnet werden, sind bei den Umrissen und einigen Figuren gleichfalls angebracht. Vielleicht wird es hier und da nicht sogleich in die Augen fallen, warum man diese und jene Eintheilung festgesetzt und eine oder die andere Benennung gewählt hat. Es ist nichts ohne Ursache geschehen, und wenn man mehrere Schädel durchsieht und vergleicht, so wird die Schwierigkeit, deren ich oben schon gedacht, noch mehr auffallen. Ich gehe nun zu einer kurzen Anzeige der Tafeln. Übereinstimmung und Deutlichkeit der Figuren wird mich einer weitläuftigen Beschreibung überheben, welche ohnedieß Personen, die mit solchen Gegenständen bekannt sind, nur uunöthig und verdrießlich sein würde. Am meisten wünschte ich, daß meine Leser Gelegenheit haben möchten, die Schädel selbst dabei zur Hand zu nehmen. Die Ite Tafel stellt den vorderen Theil der oberen Kinnlade des Ochsen, des Rehes und des Kameles verkleinert dar. fig. 1 a b c vom Reh. fig. 2 a b c vom Ochsen. fig. 3 a b c vom Kamel. ____________________ Die IIte Tafel das Os intermaxillare des Pferdes und des Babirussa verkleinert. ____________________ Tab. III. fig. 1. Das Os intermaxillare des Löwen von oben und unten. Man bemerke besonders die Sutur, welche Apophysin palatinam maxillae superioris von dem Osse intermaxillari trennt. fig. 2. vom Eisbär, fig. 3. vom Wolf. ____________________ Tab. IV. fig. 1. Das Os intermaxillare vom Walroß. fig. 2. Dasselbe von einem ganz jungen Walroß. fig. 3. Superficies lateralis interior des Ossis intermaxillaris des jungen Walrosses. ____________________ Tab. V. fig. 1 zeigt einen Affenschädel von vorn und von unten. Man sehe, wie die Sutur aus den Canalibus incisivis herauskommt, gegen den Hundszahn zuläuft, sich an seiner Alveole vorwärts wegschleicht und zwischen dem nächsten Schneidezahne und dem Hundszahne, ganz nah an diesem letzteren, durchgeht und die beiden Alveolen trennt. fig. 2 sind die Theile eines Menschenschädels. Man sieht ganz deutlich die Sutur, die das Os intermaxillare von der Apophysi palatina maxillae superioris trennt. Sie kommt aus den Canalibus incisivis heraus, deren untere Öffnung in ein gemeinschaftliches Loch zusammen fließt, das den Namen des Foraminis incisivi oder palatini anterioris oder gustativi führt, und verliert sich zwischen dem Hunds- und zweiten Schneidezahn. Jene erste Sutur hatte schon Vesalius bemerkt ***) und in seinen Figuren deutlich angegeben. Er sagt, sie reiche bis an die vordere Seite der Hundszähne, dringe aber nirgends so tief durch, daß man dafür halten könne, der obere Kinnladenknochen werde dadurch in zwei getheilt. Er weist, um den Galen zu erklären, der seine Beschreibung bloß nach einem Thiere gemacht hatte, auf die erste Figur pag. 46, wo er dem menschlichen Schädel einen Hundeschädel beigefügt hat, um den an dem Thiere gleichsam deutlicher ausgeprägten Revers der Medaille dem Leser vor Augen zu legen. Die zweite Sutur, die sich im Nasengrunde zeigt, aus den canalibus naso-palatinis herauskommt und bis in die Gegend der conchae inferioris verfolgt werden kann, hat er nicht bemerkt. Hingegen finden sich beide in der großen Osteologie des Albinus bezeichnet. Er nennt sie Suturas maxillae superiori proprias. In Cheselden's Osteographia finden sie sich nicht, auch in John Hunter's Natural history of the human teeth ist keine Spur davon zu sehen; und dennoch sind sie an einem jeden Schädel mehr oder weniger sichtbar, und wenn man aufmerksam beobachtet, ganz und gar nicht zu verkennen. Tab. V. fig. 2 ist ein halber Oberkiefer eines gesprengten Menschenschädels und zwar dessen inwendige Seite, durch welche beide Hälften mit einander verbunden werden. Es fehlten an dem Knochen, wonach er gezeichnet worden, zwei Vorderzähne, der Hunds- und erste Backenzahn. Ich habe sie nicht wollen suppliren lassen, besonders da das Fehlende hier von keiner Bedeutung war, vielmehr kann man das Os intermaxillare ganz frei sehen. Man kann die Sutur von den Alveolen des Schneide- und Hundszahnes bis durch die Canäle verfolgen. Jenseits der Spinae oder Apophysi palatinae, die hier eine Art von Kamm macht, kommt sie wieder hervor und ist bis an die Eminentiam linearem sichtbar, wo sich die Concha inferior anlegt. Man halte diese Tafel gegen Tab. IV und man wird es bewundernswürdig finden, wie die Gestalt des ossis intermaxillaris eines solchen Ungeheuers, wie der Trichechus rosmarus ist, lehren muß denselben Knochen am Menschen zu erkennen und zu erklären. Auch Tab. III fig. 1 gegen Tab. IV fig. 2 gehalten, zeigt dieselbe Sutur bei'm Löwen wie bei'm Menschen auf das deutlichste. Ich sage nichts vom Affen, weil bei diesem die Übereinstimmung zu auffallend ist. Es wird also kein Zweifel übrig bleiben, daß diese Knochenabtheilung sich sowohl bei Menschen als Thieren findet, ob wir gleich nur einen Theil der Grenzen dieses Knochens an unserm Geschlechte genau bestimmen können, da die übrigen verwachsen und mit der oberen Kinnlade auf das genaueste verbunden sind. So zeigt sich an den äußeren Theilen der Gesichtsknochen nicht die mindeste Sutur oder Harmonie, wodurch man auf die Muthmaßung kommen könnte, daß dieser Knochen bei dem Menschen getrennt sei. Die Ursache scheint mir hauptsächlich darin zu liegen: dieser Knochen, der bei Thieren so außerordentlich vorgeschoben ist, zieht sich bei dem Menschen in ein sehr kleines Maß zurück. Man nehme den Schädel eines Kindes, oder Embryonen vor sich, so wird man sehen, wie die keimenden Zähne einen solchen Drang an diesen Theilen verursachen und die Beinhäutchen so spannen, daß die Natur alle Kräfte anwenden muß, um diese Theile auf das innigste zu verweben. Man halte einen Thierschädel dagegen, wo die Schneidezähne so weit vorwärts gerückt sind und der Drang sowohl gegen einander als gegen den Hundszahn nicht so stark ist. Inwendig in der Nasenhöhle verhält es sich eben so. Man kann, wie schon oben bemerkt, die Sutur des ossis intermaxillaris aus den canalibus incisivis bis dahin verfolgen, wo die ossa turbinata oder conchae inferiores sich anlegen. Hier wirkt also der Trieb des Wachsthumes dreier verschiedener Knochen gegeneinander und verbindet sie genauer. Ich bin überzeugt, daß denjenigen die diese Wissenschaft tiefer durchschauen, dieser Punct noch erklärbarer sein wird. Ich habe verschiedene Fälle, wo dieser Knochen auch bei Thieren zum Theil oder ganz verwachsen ist, bemerken können und es wird sich vielleicht in der Folge mehr darüber sagen lassen. Auch gibt es mehrere Fälle, daß Knochen, die sich bei erwachsenen Thieren leicht trennen lassen, schon bei Kindern nicht mehr abgesondert werden können. Bei den Cetaceis, Amphibien, Vögeln, Fischen, habe ich diesen Knochen theils auch entdeckt, theils seine Spuren gefunden. Die außerordentliche Mannichfaltigkeit, in der er sich an den verschiedenen Geschöpfen zeigt, verdient wirklich eine ausführliche Betrachtung und wird auch selbst Personen auffallend sein, die an dieser so dürr scheinenden Wissenschaft sonst kein Interesse finden. Man könnte alsdann mehr in's Einzelne gehen und bei genauer stufenweiser Vergleichung mehrerer Thiere, vom Einfachsten auf das Zusammengesetztere, vom Kleinen und Eingeengten auf das Ungeheure und Ausgedehnte fortschreiten. Welch eine Kluft zwischen dem os intermaxillare der Schildkröte und des Elephanten! Und doch läßt sich eine Reihe Formen dazwischen stellen, die beide verbindet. Das, was an ganzen Körpern niemand läugnet, könnte man hier an einem kleinen Theile zeigen. Man mag die lebendigen Wirkungen der Natur im ganzen und großen übersehen, oder man mag die Überbleibsel ihrer entflohenen Geister zergliedern: sie bleibt immer gleich, immer mehr bewundernswürdig. Auch würde die Naturgeschichte einige Bestimmungen dadurch erhalten. Da es ein Hauptkennzeichen unseres Knochens ist, daß er die Schneidezähne enthält: so müssen umgekehrt auch die Zähne, die in denselben eingefügt sind, als Schneidezähne gelten. Dem Trichechus rosmarus und dem Kamele hat man sie bisher abgesprochen, und ich müßte mich sehr irren, wenn man nicht jenem vier und diesem zwei zueignen könnte. Und so beschließe ich diesen kleinen Versuch mit dem Wunsche, daß er Kennern und Freunden der Naturlehre nicht mißfallen und mir Gelegenheit verschaffen möge, näher mit ihnen verbunden, in dieser reizenden Wissenschaft, soviel es die Umstände erlauben, weitere Fortschritte zu thun. ____________________ *) Galenus Lib. de ossibus. Cap. III. **) Campers sämmtliche kleinere Schriften, herausgegeben von Herbell. Ersten Bandes zweites Stück. S. 93 und 94. Blumenbach, De varietate generis humani nativa, pag. 33. ***) Vesalius de humani corporis fabrica (Basil. 1555) Libr. I. Cap. IX. Fig. 11. pag. 48, 52, 53. Karl Philipp Moritz 1756 - 1793 Der Autor Karl Philipp Moritz wird 1756 in Hameln geboren. In ärmlichen und streng pietistischen Familienverhältnissen verbringt er eine qualvolle Kindheit, die er in seinem «Anton Reiser» autobiographisch verarbeitet. Nach einer Hutmacherlehre ist er 1777 Schauspieler in Leipzig. später Student der Theologie in Wittenberg, von 1778 an dann in Berlin im Schuldienst tätig. 1782 reist er nach England, 1786 nach Italien, dort befreundet er sich mit Goethe. 1788 kehrt er zurück und wird 1789 als Professor an die Akademie der Künste in Berlin berufen. 1791 wird er Mitglied der KöniglichPreußischen Akademie der Wissenschaften. 1793 ist er sechsunddreißigjährig in Berlin an einem chronischen Lungenleiden gestorben. Ideal einer vollkommnen Zeitung Diese programmatische Schrift über die Gestaltung einer Zeitung ist 1784 als 16-seitige Broschüre (ein Druckbogen) bei Christian Friedrich Voß und Sohn in Berlin erschienen. Diese waren Herausgeber der «Berlinischen Privilegirten Zeitung», der späteren «Vossischen Zeitung». Am 1. September 1784 hatte Moritz die Redaktion dieser Zeitung übernommen und versucht einige Punkte seines Konzepts zu verwirklichen; so erschienen zum erstenmal in einer Zeitung Artikel über Gerichtsverhandlungen, und berühmte Zeitgenossen wurden in Abbildungen vorgestellt. Allerdings ließ der Erfolg auf sich warten, und Moritz bekam Schwierigkeiten wegen seiner Theaterkritiken. So gab er im Frühsommer 1875 die Redaktion der Zeitung wieder ab. _______________________________________ Schon lange habe ich die Idee mit mir herumgetragen, ein Blatt für das Volk zu schreiben, das wirklich von dem Volke gelesen würde, und eben dadurch den ausgebreitetsten Nutzen stiftete. Diesen Gedanken, nahm ich mir vor, erst hinlänglich bei mir reif werden zu lassen, ehe ich ihn je zur Ausführung brächte. Seitdem ist aber diese Idee durch verschiedene elende Schmierer so oft gemißbraucht und herabgewürdigt worden, daß ich es manchmal nicht ohne Ärger und Unwillen habe mit ansehen können. Endlich fiel ich darauf, daß eine einmal eingeführte und gelesene Zeitung vielleicht das beste Vehikel sei, wodurch nützliche Wahrheiten unter das Volk gebracht werden könnten. Dies bewog mich vor einigen Monaten zu dem Entschluß, mit den Herrn Voß und Sohn in Verbindung zu treten, um die hiesige Zeitung, welche in deren Verlage herauskommt, zu schreiben. Seitdem ist mir meine erste Idee immer lebhafter und immer wichtiger geworden, so daß ich mich nicht enthalten konnte, mir zuweilen in reizenden Träumen der Phantasie das Ideal einer vollkommnen Zeitung zu denken, und einige Züge davon zu entwerfen. Mag ich dann dieses Ideal auch nie erreichen, so wird es doch immer das höchste Ziel bleiben, wornach ich strebe, und komme ich ihm jemals nahe, so glaube ich schon dadurch einen der edelsten Zwecke des Schriftstellers erreicht zu haben. Die Buchdruckerei ist schon irgendwo als ein Bildnis der verbreiteten Kultur angenommen worden, und mir deucht, daß ihr, nicht bloß als Bild, sondern im ganz eigentlichen Verstande, der Ehrenname verbreitete Kultur gebühre. Nun ist aber vielleicht unter allem, was gedruckt wird, eine öffentliche Zeitung oder Volksblatt, aus dem rechten Gesichtspunkte betrachtet, bei weitem das wichtigste. Sie ist der Mund, wodurch zu dem Volke gepredigt, und die Stimme der Wahrheit, so wohl in die Paläste der Großen, als in die Hütten der Niedrigen dringen kann. Sie könnte das unbestechliche Tribunal sein, wo Tugend und Laster unparteiisch geprüft, edle Handlungen der Mäßigkeit, Gerechtigkeit und Uneigennützigkeit gepriesen, und Unterdrückung, Bosheit, Ungerechtigkeit, Weichlichkeit und Üppigkeit mit Verachtung und Schande gebrandmarkt würden. Sie sollte die Werke des Geschmacks in der Baukunst, Musik, Malerei, Schauspiele und so weiter vor ihren unparteiischen Richterstuhl ziehen, und sie vorzüglich in Rücksicht ihres Einflusses auf die Bildung und den Charakter der Nation, und nicht bloß als Gegenstände der Belustigung, betrachten. Aus dem ungeheuren Umfange der Wissenschaften sollte sie dasjenige herausheben, was nicht bloß den Gelehrten, oder gar nur eine besondere Klasse der Gelehrten, sondern die ganze Menschheit interessiert. Was nicht bloß hinzugetragene Materialien zu dem großen Gebäude irgendeiner Wissenschaft, sondern etwas Vollendetes, von Schlacken gesäubertes, und durch den echten Stempel der Wahrheit ausgeprägtes Gold ist, das nun unter dem Volke, unbeschadet der Ruhe und Glückseligkeit desselben, in wohltätigen Umlauf kommen kann. Sie sollte in alle Fugen der menschlichen Verbindungen einzudringen, und aufzudecken suchen, was in jedem Zweige derselben Lobens- oder Tadelnswertes, Verachtungsoder Nachahmungswürdiges sei. Ihr sollte kein Gewerbe, kein Stand, selbst der Stand des verachteten und grö§tenteils unterdrückten und tyrannisch behandelten Lehrburschen des gemeinen Handwerkers nicht unwichtig sein. Weder die Privaterziehung noch die öffentliche in den Schulen und die Belehrung der Erwachsenen in den Kirchen müßte ihrem spähenden Blick entgehen. Sie müßte die Mängel derselben rügen, wo sie nur irgend dürfte und könnte. Und hingegen jede Nachricht auch von der kleinsten Verbesserung in dieser für die Menschheit so wichtigen Angelegenheit sorgfältig zu verbreiten suchen. Eltern, Erzieher, Menschen, die in einer Stadt zusammen, oder entfernt leben, könnten sich einander ihre wichtigsten Vorschläge und Entdeckungen mitteilen, und sich durch die Zeitung miteinander über die angelegentlichsten Dinge besprechen. Jede nützliche Erfindung, sie sei so klein sie wolle, müßte ein Hauptgegenstand der Aufmerksamkeit werden, um den guten Kopf zu neuen Entdeckungen aufzumuntem, um den erfindrischen Fleiß, ein Eigentum der Deutschen, aufs neue zu beleben. Jede öffentliche Handhabung der Gerechtigkeit, wobei uns erlaubt ist, Zuschauer zu sein, müßte einen reichen Stoff zu wichtigen Beobachtungen hergeben. Und würde gewiß, gehörig bearbeitet, einen sehr interessanten Artikel in einer Zeitung für das Volk ausmachen. Die kurze Geschichte der Verbrecher aus den Kriminalakten gezogen, wie belehrend müßte sie sein, wenn die allmählichen Übergänge von kleinen Vergehen, bis zum höchsten Grade der moralischen Verderbtheit, mit einigen treffenden, allgemein auffallenden Zügen darin gezeichnet wären! Die feierlichen und festlichen Zusammenkünfte des Volks, ja sogar seine Ausschweifungen in öffentlichen Häusern müßten nicht unbemerkt bleiben, sondern zur öffentlichen Beschämung unsrer weichlichen entnervten Generation mit lebhaften Farben geschildert werden. Aber auch das Elend und die Armut in den verborgnen Winkeln muß aufgedeckt, und nicht aus einer falschen Empfindsamkeit vor unserm Blick in Dunkel eingehüllt werden. Das Elend, wenns einmal da ist, muß unter uns zur Sprache kommen, und auf Mittel gedacht werden, wie man demselben abhelfen kann! Also edle Beispiele; Künste; Theater; Kenntnisse, die zum Umlauf reif sind; Erziehung; Predigtwesen; nützliche Erfindungen; Handhabung der Gerechtigkeit; Geschichte von Verbrechern; menschliches Elend im Verborgnen; - welche wichtige Artikel zu einer Zeitung für das Volk! Und wie viel mehrere lassen sich nicht doch denken, als: Volksvorurteile; Volksirrtümer; religiöse Schwärmerei; unerkanntes Verdienst, und so weiter. Wahrlich es ist zu verwundern, da man bisher so viel von Aufklärung geredet und geschrieben hat, daß man noch nicht auf ein so simples Mittel, als eine Zeitung, gefallen ist, um sie in der Tat zu verbreiten. Freilich aber müßte nun eine Zeitung, wodurch dieser Zweck erreicht werden soll, ganz anders beschaffen sein als irgendeine, die jemals noch bis jetzt ist geschrieben worden. Sie müßte aus der immerwährenden Ebbe und Flut von Begebenheiten dasjenige herausheben, was die Menschheit interessiert, den Blick auf das wirklich Große und Bewundernswürdige, das Gefühl für alles Edle und Gute schärfen, und den Schein von der Wahrheit unterscheiden lehren. Die Aufmerksamkeit müßte daher vorzüglich auf den einzelnen Menschen geheftet werden: denn nur da ist die wahre Quelle der großen Begebenheiten zu suchen, nicht in Kriegsheeren und Flotten, die oft nur wie zwei entgegengesetzte Elemente gegeneinander wirken, worunter das Stärkere allemal über das Schwächere den Sieg behält. Auch sind ja das nicht immer die größten Begebenheiten, wobei die meisten Menschen beschäftigt sind, sondern diejenigen, wobei sich irgendeine menschliche Kraft am meisten entwickelt. Dergleichen suche man unter dem Schwall von Kriegsrüstungen, Fürstenreisen, und politischen Unterhandlungen herauszuheben, damit das Volk nicht mehr Titel und Ordensbänder, fürstlichen Stolz und fürstliche Torheiten mit dummer Verehrung anstaune, sondern den wirklich großen Mann auch im Kittel und hinter dem Pfluge schätzen lerne. Sobald man zu viele Menschen zusammenfaßt, um von ihnen etwas zu sagen, so muß das, was man sagt, notwendig unbestimmt, schwankend, und trocken werden. Denn in einer Gesellschaft von Menschen, sie sei, welche sie wolle, handeln doch nur immer einzelne Menschen, und diese sind es nur, welche unsere Teilnehmung erwecken, nicht die ganze Gesellschaft. Diese ist höchstens ein abstrakter Begriff, dessen wir uns aus Not bedienen müssen, der uns aber nicht mitdenken, empfinden und handeln läßt. Da wir selbst nur einzelne und nicht aus mehrern zusammengesetzte Wesen sind, so können wir auch mit einem so vielköpfigen zusammengesetzten Dinge, als irgendeine menschliche Gesellschaft ist, sie heiße nun Staat oder wie sie wolle, im eigentlichen Verstande nicht sympathisieren, wenn wir sie nicht wieder bis auf das Individuum vereinzeln. Abstrakte Begriffe können ja die Seele nicht erwärmen. Bloß die verschiednen Gesinnungen und Charaktere der einzelnen Mitglieder des Englischen Parlaments, machen die Verhandlungen desselben so interessant, und zum Gegenstande der allgemeinen Aufmerksamkeit auch solcher Nationen, die mit der Englischen in wenig oder gar keiner Verbindung stehen. Sicher erwecken die Beratschlagungen an sich selber mehr unsre Teilnehmung, als die Resultate, welche daraus entstehen. Denn was heißt es nun, wenn man sagt: Frankreich hat dieses oder jenes beschlossen, usw. als ob Frankreich ein selbständiges handelndes Wesen wäre, das so wie ein einzelner Mensch, wirklich etwas beschließen könnte. Gibt mir dies nun wohl Stoff zum Nachdenken, als wenn es heißt: in Paris ist ein starker Hagel gefallen, oder in Metz hat das Gewitter eingeschlagen? Und ist nicht das Hinarbeiten auf einen Zweck im menschlichen Leben ebenso wichtig und vielleicht wichtiger, als die Erreichung des Zwecks selber? Macht nicht die Tätigkeit selbst unser Wesen aus? und läßt uns nicht vielleicht eine wohltätige Täuschung diese Tätigkeit bloß deswegen, als das Mittel zu irgendeinem Zwecke betrachten, damit dieser anscheinende Zweck das Mittel werde, uns eine Zeitlang in eine bestimmte, zweckmäßige Tätigkeit zu versetzen? Ist es also nicht wichtiger, einzelne Fakta von einzelnen Menschen zu sammlen, woraus einmal künftig große Begebenheiten entstehen können, als eine Menge von großen Begebenheiten zu erzählen, ohne zu wissen, wie sie entstanden sind? - Dies soll auf keine Weise, die großscheinenden Begebenheiten von der öffentlichen Bekanntmachung ausschließen, nur müssen sie nicht der wichtigste Gegenstand der Aufmerksamkeit werden. Denn, ein Vergleich zwischen zwei Sackträgern, die sich auf der Straße gezankt haben, kann, insofern er den Charakter der Nation bezeichnet, für den Menschenbeobachter wichtiger sein, als ein Vergleich zwischen Rußland und der ottomanischen Pforte, wo es größtenteils bloß auf die stärkere Macht an Soldaten, Schiffen, oder festen Plätzen ankömmt, wohin sich das Übergewicht lenken wird; wo man die geheimen Triebfedern ebenso wenig erfährt, als die erste Ursach von dem Ungewitter, welches gerade heute, und nicht eher, über unsern Horizont heraufgezogen ist; wo man nicht sowohl handelnde Wesen, als vielmehr bloße Ereignisse, wie in der Natur, Stürme, Erdbeben, Überschwemmungen sieht. Demohngeachtet muß eine vollkommne Zeitung auch in Ansehung der eigentlichen politischen Ereignisse mit der Zeit gleichen Schritt halten, aber doch mehr in einzelnen Beispielen zu zeigen suchen, was diese Ereignisse nun eigentlich auf das Wohl oder Weh der Menschheit für einen Einfluß haben. Denn nur das Einzelne ist wirklich, das Zusammengefaßte besteht größtenteils in der Einbildung. Vorzüglich muß also eine vollkommne Zeitung aus der gegenwärtigen würklichen Welt, die man täglich vor Augen sieht herausgeschrieben werden, und zu dem Ende notwendig in einer großen Stadt herauskommen, wo wegen der Menge der Menschen auch die größte Mannigfaltigkeit in ihren Charakteren, Beschäftigungen, und Verbindungen herrscht; wo ein beständiger Zufluß von Merkwürdigkeiten stattfindet, und wo sie sogleich von vielen tausend Menschen gelesen werden kann, ohne erst versandt werden zu dürfen. Wer eine solche Zeitung schreiben will, muß selbst, so viel er kann, mit eignen Augen beobachten, und wo er das nicht kann, muß er sich an die Männer halten, die eigentlich unter das Volk, und in die verborgensten Winkel kommen, wo das Edelste und Vortrefflichste sowohl, als das Häßlichste und Verabscheuungswürdigste, sehr oft versteckt zu sein pflegt. Er muß sich an die Prediger und Ärzte wenden, die das verborgene menschliche Elend, und die verborgenen menschlichen Tugenden oft am besten kennen zu lernen Gelegenheit haben. Er muß sich an die Richter des Volks wenden, um durch ihre Verhandlungen den großen Umfang des menschlichen Eigennutzes, und aller seinen kleinen Listen und Ränke kennen zu lernen. Er muß wenigstens mit einigen Personen aus jeder verschiedenen Klasse von Menschen insofern in Verbindung stehen, daß er von ihnen über das Innere ihrer Verfassung belehrt werden kann. Er muß sich aber auch selber unter das Volk mischen, um seine Urteile, seine Gesinnungen zu hören, und seine Sprache zu lernen. Er muß nichts weniger als ein einseitiger Gelehrter sein, sondern sich für alles interessieren können, was ihm nur irgend aufstößt, und sich täglich in der schweren Kunst üben, alles Vielfache unter irgend einen großen und wichtigen Gesichtspunkt zu bringen. Er muß die gegenwärtige Welt vorzüglich kennen lernen, und von der alten, so viel als nötig ist, um das Gegenwärtige daraus zu erklären. Und was noch das allerwichtigste ist, er muß sich eines unbescholtnen Charakters befleißigen, denn nur das berechtigt, mit einer edlen Freimütigkeit öffentlich vor dem Volke zu reden und zu schreiben. Daß ich nun gerade der Mann sei, eine solche Zeitung zu schreiben, wäre freilich Unverschämtheit von mir zu glauben; deswegen aber darf ich den Wunsch nicht verleugnen, es zu werden: ich darf es sagen, daß ich alle mein Denken, mein Studieren, mein Leben darauf verwenden will, um eine Zeitung zu liefern, die dem Ideale, welches ich mir entworfen habe, so nahe, wie möglich kommt. Seit dem Monat September habe ich angefangen, zu diesem Unternehmen die ersten Schritte zu tun. Ich habe nach einer kürzer gefaßten Anzeige der politischen Ereignisse, die Aufmerksamkeit mehr auf einzelne merkwürdige Menschen zu lenken gesucht; ich habe Beispiele edler Handlungen aus dem Dunkeln gezogen; ich habe durch die gelehrten Anzeigen, zum Umlauf reif gewordne Kenntnisse zu verbreiten, und in dem Theaterartikel das Vortreffliche vor dem Mittelmäßigen, das Mittelmäßige von dem Schlechten, auszuzeichnen gesucht. Mit den übrigen im Anfange dieser Schrift von mir erwähnten Artikeln, als öffentliche und Privaterziehung Kunstsachen, als: Baukunst, Malerei, Musik und so weiter; Handhabung der Gerechtigkeit; Missetäter; Volksvorurteile; Volksirrtümer; Predigtwesen; und so weiter werde ich von Zeit zu Zeit den Anfang machen, so wie sich mir die Gelegenheit dazu darbieten wird; und mit Anfang des künftigen Jahres denk' ich dieser Zeitung, in Ansehung aller dieser Artikel, eine dauerhaftere Einrichtung zu geben, ohne dieserwegen noch künftige Verbesserungen auszuschließen. Auch ist schon mit einem hiesigen berühmten Künstler Abrede genommen worden, das Äußere dieser Zeitung vom künftigen Neujahr an, so geschmackvoll wie möglich einzurichten. Denn da sie den guten Geschmack auch in Kleinigkeiten soll verbreiten helfen, so versteht sich, daß sie selbst vom Gegenteil kein Beispiel hergeben muß. Ich erwarte nun über meine Vorschläge das Urteil des Publikums, mit welchem ich mich vor dem Schlusse des Jahres noch einmal über diese Angelegenheit zu unterreden gedenke, um zu erfahren, inwieweit ich mich, mit der Zufriedenheit desselben, meinem Ideale nähern darf. ______________ Text nach dem Abdruck in «DIE ZEIT» Nr. 1 vom 1. Januar 1988 durch Benedikt Erenz. Er schrieb damals : «Selten ist so viel über ‹die Medien› geredet worden wie 1987. Ob neue Kommerzsender, ob ‹Schrifstellertaz›, ob Barschel/Springer-Affäre - immer wieder ging es darum, wie Presse, Funk und Fernsehen Öffentlichkeit herstellen oder aber zerstören. Eine Diskussion ist in Gang gekommen, die auch den Blick zurücklenkt in die Epoche, in der bürgerliche Öffentlichkeit ‹erfunden› und erstritten wurde: in das Zeitalter der Aufklärung. Im Rahmen der Moritz-Editon der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist dieser Text in der Original-Orthographie veröffentlicht. 19. Jahrhundert Johann Gottlieb Fichte 1762 - 1814 Der Autor Johann Gottlieb Fichte wird 1762 in Rammenau in der Oberlausitz als Sohn eines Bandwirkers geboren. Ein adliger Gönner ermöglicht ihm den Besuch der Fürstenschule in Schulpforta. Anschließend studiert er Theologie in Jena und Leipzig und besucht juristische Vorlesungen in Wittenberg. 1784 ist er gezwungen, sein Studium abzubrechen, da sein Förderer verstorben war. In den folgenden Jahren muß er sich seinen Lebensunterhalt als Hauslehrer verdienen. So 1788 in Zürich, wo er mit Pestalozzi bekannt wird und Marie Johanna Rahn - eine Nichte Klopstocks - kennenlernt, die er 1793 heiratet. Nach literarischen Versuchen wendet er sich der Philosophie Kants zu und besucht diesen 1791 in Königsberg. Kant vermittelt die Drucklegung von Fichtes Erstlingswerks «Versuch einer Kritik aller Offenbarung», und das Buch wird zu einem überwältigenden Erfolg. 1793, in seiner Schrift «Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution» erscheinen Fichtes unsägliche antisemitischen Äußerungen, daß den Juden zwar ein Menschenrecht zu gewähren sei, nicht aber ein Bürgerrecht, da sie körperlich schlaff seien und die übrigen Bürger ökonomisch ausplünderten, «dazu sehe ich wenigstens kein Mittel, als das, in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden, und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee sei». Auch im Umgang mit seinen Freunden ist er nicht zimperlich und mit vielen überwirft er sich, so mit Goethe, Schelling und sogar Kant. Goethe notiert: «Daß doch einem sonst so vorzüglichen Menschen immer etwas fratzenhaftes in seinem Betragen ankleben muß». 1794 wird er als Professor für Philosophie nach Jena berufen. Im gleichen Jahr erscheint sein Hauptwerk, «Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre». In dieser Programmschrift des «Subjektiven Idealismus» überwindet Fichte die Kantische Lehre vom «Ding an sich» mit der Annahme, daß das Selbstbewußtsein die Welt setzt. «Das Ich setzt sich selbst», so der Grundsatz. Von Gott ist nicht mehr die Rede. Großen Einfluß gewinnen seine Gedanken bei der romantischen Bewegung, bei den Gebrüdern Schlegel, bei Novalis und Tieck. Doch auch die Gegner formieren sich, und es kommt zum Atheismusstreit: 1799 verliert Fichte seinen Lehrstuhl in Jena. Er geht nach Berlin. Hier veröffentlicht er im Jahre 1800 sein wirtschaftspolitisches Werk «Der geschlossene Handelsstaat», worin er ein nahezu sozialistisch anmutendes Staatswesen beschreibt. In Berlin hält er als Privatgelehrter Vorträge, so die «Reden an die deutsche Nation» während der Besetzung Berlins durch Napoleons Truppen. In dieser Zeit findet in seinem Denken eine Wende zum Religiösen und Mystischen statt. Das Ich wird durch das Absolute, durch Gott ersetzt, ein nur mystisch erfahrbares All-Leben. 1810 wird er als Professor an die neugegründete Berliner Universität berufen. Fichte stirbt 1814 an der Lazarettseuche, mit der ihn vermutlich seine bei der Pflege von Kriegsverletzten tätige Frau angesteckt hatte. Das Nachwirken von Fichtes Philosophie reicht von Max Stirner über Proudhon, Marx und Lassalle bis hin zu Max Weber und Jean-Paul Sartre. Das Thal der Liebenden 1786/87 Textgrundlage: Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke, 8 Bde. Hrsg. von I. H. Fichte, Berlin: Veit & Comp., 1845/46 Band VIII, Vermischte Schriften und Aufsätze (Gallica/Bibliothèque nationale de France) _____________________________________________ _________________________________ Das Thal der Liebenden. Eine Novelle. [Geschrieben zu Zürich] [im Jahre 1786 oder 1787.] In der anmuthigsten Gegend der Veltelin, ohnweit der Grenze von Italien, liegt ein kleines Thal, das Thal der Liebenden genannt. Haine von Lorbeeren und Pomeranzen und Citronen, die ohne Pflege wachsen, erfüllen es, und duften Sommer und Winter die angenehmsten Gerüche: in der Mitte desselben ist ein kleines Myrtenwäldchen, und im Myrtenwäldchen ein grosser Grabhügel, von immer blühenden Rosen umgeben. Vom hohen waldigen Gebirge bedeckt, von Felsen eingezäunt, erblickt es selten das Auge eines Sterblichen, verirrt dahin sich selten der Fuss des Wanderers. Nur wenige sind hineingekommen. Ein geistiges Wehen, wie Küsse eines Engels, fühlten sie an ihren Wangen; eine sanfte Wehmuth erfüllte ihre Seele; unvermerkt enttröpfelten ihren Augen Thränen. und das war ihnen so süss! Die Bilder ihrer verstorbenen Freunde oder Geliebten gingen vor ihrer Seele vorüber, und Ahnungen von Wiedersehen, Vorgefühle des ewigen Lebens erfüllten sie, wenn sie auf dem Grabeshügel im Myrtenwäldchen fünf Flämmchen blinken sahen, Symbole wiedervereinigter Treue nach dem Tode. Einst drang ein Landvogt auf der Jagd einem verwundeten Rehe nach, das hieher seine Zuflucht genommen hatte, in das Thal ein. Bangigkeit und Angst überfiel ihn, kalter Schweiss rollte über seine Stirn herab, er musste den geweihten Boden verlassen. In diese Gegenden hatte sich vor Jahrhunderten, erzählen die Hirten, ein junger Ritter verirrt. Im hohen Walde verloren, ermattet und hungrig, erblickte er durch die Nacht hin von ferne ein Feuer. Es waren Hirten, die bei ihrem Vieh wachten. Sie theilten willig mit ihm ihre geringe Kost, und er wärmte sich an ihrem Feuer. – «Wie es dort wieder im Gebüsch heult!» sagte der eine, der jetzt eben zu ihnen hinzukam; «wie der Geist des armen Einsiedlers wieder winselt und ächzt! weiss Gott, die Haut schauert mir allemal, wenn ich da vorbeigehe.» – «Mir auch, sagte der andere, ich mache lieber einen Umweg von einer Stunde. Und es war doch ein so guter frommer Mann, der Einsiedler: betete so fleissig, grüsste jedes Kind so freundlich, und wies zurechte und half. Weisst du noch, wie er mir den kranken Fuss heilte, den ich mir beim Herabstürzen von jenem Felsen zerquetscht hatte?» – «Und wie er mir meine verirrten Lämmer wiederbrachte? Ach! wie wird es erst unser einem einmal gehen? Komm, wir wollen ein Vaterunser für seine arme Seele beten.» Wehmuth und Mitleiden erfüllten den Ritter. – «Kommt, führet mich an den Ort.» Sie führten ihn hin. Es war eine trübe Nacht; der Wind sausete durch den Busch dem Ritter entgegen; es winselte und ächzte dumpf im Gebüsch. – «Wer du auch seyest, unglückliche Seele, die im Fegefeuer leidet; können Gaben oder Seelenmessen, oder das Gebet irgend eines Sterblichen deine Qualen lindern, so entdecke dich mir: meine Seele liebt und bedauert dich,» sagte der Ritter, und plötzlich stieg unter dem Hügel eine Gestalt hervor. Ein langer Bart wallte ihm herab bis auf den Gürtel; sein Auge war eingefallen und erloschen, seine Wange abgewelkt, nagender Kummer war über sein Gesicht verbreitet; aber durch die dicke Wolke des Grams, die auf ihm lag, blickte ein einziger schwacher Zug von Ruhe und entfernter Hoffnung hindurch. Sein Anblick erfüllte die Seele mit Mitleid, aber nicht mit Grauen. «Jüngling,» so redete der Geist, «schaudere nicht vor mir zurück! Noch sind es nicht zehn Jahre, so war ich ein Ritter, jung und feurig, und mannhaft wie du – solltest du nie den Namen Rinaldo gehört haben? – und ach! wie glücklich! Nicht umsonst vielleicht führte dich das Schicksal zu meiner Gruft, die noch nie ein Sterblicher so in der Nähe betrat. Höre die Geschichte meiner Leiden, und beklage mich.» «In meinen ersten Jünglingsjahren, jeder Tropfen Bluts in mir Feuer, und jede Nerve Kraft, kam ich an den Hof nach Paris. In jedem Turnier war der Preis für mich. Ich gefiel; die Ritter verleumdeten mich, und die Damen sprachen nur unter sich allein von mir. Einer der schönsten Tage meines Lebens war der Vermählungstag der Königstochter. Aus allen Ländern der Franken hatte die Krone der Ritter sich versammelt zum feierlichen Turnier. Wir kämpften drei Tage, und ich war Sieger. Die neidischen Blicke der Ritter und das laute Zujauchzen des Volkes von den Schranken her, beides war mir gleich festlich. Im Taumel der Freude sah ich rund um mich her, um alle Blicke des Beifalls einzusaugen, und sahe in der ersten Reihe in den Schranken ein Fräulein; ihr trübes schwimmendes Auge zur Erde gesenkt, ihr Haupt nach einer Seite geneigt, wie eine Lilie vor der Sonnenhitze sich herabbeugt; Ernst und tiefes Nachdenken in ihren sanften schwärmerischen Zügen. Kein fröhliches Händeklatschen, kein Lächeln, kein verlorener Seitenblick auf mich; – sie allein unter den Tausenden, die sie umgaben, kalt und ernsthaft! – Ich ward tief herabgeschleudert. – Warum verachtet sie dich? eben sie, die vollkommenste unter den Mädchen?» «Ein Tanz beschloss den Tag. Alle drängten sich zu dem Sieger, stolz an seiner Seite die Reihen durchzuwallen, seine Blicke aufzufangen, und er suchte die in einem Winkel verborgene Verächterin. Sie flog mir entgegen, – und auf einmal, wie aufgehalten, schien sich ihr unwilliger Fuss zu sträuben. Schüchtern und verscheucht tanzte sie; riss sich los, entfernte sich, tanzte mit andern, und feuriger. Sie verachtet dich, tönte es im Innersten meiner Seele, aber warum? – Ich hätte mich selbst verachten mögen. – Jetzt empörte sich beleidigter Stolz, sie zu meiden; jetzt sprach Liebe und Neugier, sie zu suchen. Ich schwur mir tausendmal, sie nie wieder zu sehen, und ging den ersten Morgen an einen Ort, wo ich sie zu finden hoffte. Sie war heiter bei meiner Ankunft; ihre Stirn umwölkte sich, sobald sie mich sah. So war sie immer.» «Ich beschloss, Paris zu verlassen, und sie nie wieder zu sehen. Ich beurlaubte mich vom Hofe. Schon war ich die Stufen herabgestiegen, als die Zofe mir ein Blatt folgenden Inhalts in die Hand drückte: ‹Dank euch, edler Ritter, dass ihr Paris verlasset, und durch eure Entfernung einer Unglücklichen die Ruhe wiedergebt, die eure Gegenwart ihr raubte: ein Geständniss, das während derselben keine irdische Macht mir würde entrissen haben. Würdiget Eures Andenkens, Eurer Thränen, Eures Gebets die unglückliche Maria.›» «Wonnegefühl engte meine Brust, ich musste ihr Luft machen. Ich eilte auf den Flügeln der Liebe zu ihr. Ich fand sie nicht; – Unmuth ergriff mich. Die Falsche, sie lockt mich an, und stösst mich wieder zurück! – Ich konnte nach meinem Abschiede vom Hofe nicht mehr öffentlich erscheinen; stellte mich krank, um einen Vorwand für mein längeres Bleiben zu haben; und wards vor Liebe und Schmerz. Verlangen nach ihr gab mir das Leben wieder. Ich ging, und überraschte sie in einer einsamen Laube. Sie sass über einer Stickerei, in Trübsinn versunken. Noch ehe sie mich erblickte, lag ich zu ihren Füssen. – ‹Verlasst mich, grossmüthiger Ritter, rief sie: verlasst die Gegend, in der ich lebe. O das unselige Geständniss! warum musste es sich doch aus diesem Herzen heraufdrängen, das bei Euch nur einer flüchtigen Neigung zu begegnen fürchtete!› Ich besänftigte sie. Bebend hörte sie meine Schwüre, auf ewig der ihrige zu seyn; bebend empfing sie meine heissen Küsse. Ein trauriges Vorgefühl schien ihre Seele zu durchschauern.» «Ihr Herz war offener; es kämpfte noch, aber es unterlag allmählig dem Gefühle der Liebe. Ich sah sie öfters in dieser Laube. Ein feindlicher Dämon gab mir ein, es gehöre unter die Trophäen eines Ritters, die Unschuld zu morden. Es war die Moral, die bei festlichen Gelagen oft an der Tafel meines Vaters ertönt hatte. – In süsse Schwärmereien versunken, überraschte uns einst die schönste Sommernacht in unserer lieben Laube. Ich bestürmte ihre Tugend, und ich merkte mit jeder Minute ihren Widerstand schwächer werden. Schon glaubte ich gesiegt zu haben, als sie in Thränen zerfliessend meine Füsse umschlang. – ‹Mann mit der stärkeren Seele, schluchzte sie, schone die schwächere weibliche. Siehe, ich bin in deiner Gewalt; du kannst der Schwachen, die jetzt ihr Leben für dich verbluten würde, das rauben, was ihr mehr ist als das Leben; aber schone der Armen, sey grossmüthig und thu' es nicht.› – Kalter Schauer überfiel mich; die Tugend fing an, in mein Herz zurückzukehren; aber – ‹besiegst du sie jetzo nicht, so entfernt sie dich nun auf immer von sich› – flüsterte der feindliche Dämon, und – er siegte.» «Ich verliess sie in Thränen gebadet. In meiner Wohnung traf ich Boten von meinem Vater: er erwarte seinen Tod; ich solle eilen, ihn noch lebendig zu finden. – Ich verliess Paris sogleich, ohne sie sehen, ohne ihr ein Lebewohl sagen zu können. Mein Herz zog mich gewaltig zurück: aber der Zug ward schwächer, als neue, unerwartete Eindrücke mich bestürmten. Mein Vater starb in meinen Armen. Das Bild eines sterbenden geliebten Vaters, neue Sorgen, andere Gegenstände, alles vereinigte sich, das Andenken an Marien in meiner Seele zurückzudrängen. Eine dumpfe, theilnahmlose Trauer hielt lange meine Seele umfangen. Da sah ich Laura, das Meisterwerk des Schöpfers, und mit dem ersten Blicke waren unsere Seelen Eins. Heilige Bande verknüpften uns; wir tranken die Seligkeit der Liebe in vollen Zügen.» «Innige Liebe liebt keine Zuschauer: wir verliessen das Geräusch der Stadt, um in der einsamsten Gegend am Fusse der Alpen unseren Himmel aufzuschlagen. Wir durchirrten Arm in Arm die paradiesischen Fluren. Sie ging einst allein aus, um eine Gegend hinter einem angenehmen Hügel, der immer das Ziel unserer Wanderungen gewesen war, zu sehen. Ich war durch einen Zufall zu Hause geblieben. Ihre Zurückkunft verzog sich. Ich lauschte an der Laube, die ich ihr unterdessen an ihrem Lieblingsplatze bereitet hatte, um sie bei ihrer Rückkunft angenehm zu überraschen. Bei jedem Rauschen eines Blattes, jedem leisen Fusstritte glaubte ich sie zu hören. Es kam ein Bote von ihr. Zitternd eröffnete ich das Blatt, das er mir gab, und las folgende Worte: ‹Wie könnte ich Rinaldo'n besitzen, indess Maria verlassen weint? Rührt dich ihr Elend nicht, so lass die Bitten der Laura – ach deiner Laura! – dich rühren, an ihr tief verwundetes, noch immer nur für dich schlagendes Herz zurückzukehren. Vergiss Lauren und störe die Ruhe nicht, der ich entgegeneile. Gehe ostwärts von deiner Wohnung, nach dem Hügel zu, den wir heute früh von der Morgensonne so schön vergoldet sahen, wo ein früher geliebtes Weib und eine süsse Tochter, ganz das Ebenbild Rinaldo's, auf deine Umarmungen warten.›» «Der Schlag war fürchterlich. Nach geraumer Zeit erst erhielt ich meine Besonnenheit wieder. Die Scham hielt mich ab, Marien aufzusuchen: Laura war mir durch ihre Grossmuth doppelt theuer geworden. Ich wandte Alles an, sie wieder zu finden; kein Kloster, keine Einsiedelei, keine einsame Gegend wurde undurchsucht gelassen: ich durchstreifte selbst als Pilger die halbe Erde: ich hoffte sie durch meine Bitten zu erweichen; aber vergebens, ich fand sie nicht. Ich kam endlich in dieses Thal, lebte als Eremit in demselben, errichtete meiner Laura, die ich für längst todt hielt, ein Grab, betete und weinte auf ihrem Hügel, und starb auf ihm.» «Wenn der Geist die irdischen Fesseln verlassen, und von aller Zumischung der Sinnlichkeit frei ist, sieht er alles in einem anderen Lichte. Taumel dieser Sinnlichkeit berauschte mich, im Leben Marien zu vergessen; jetzt fühlte ich ihre Schmerzen, die Schmerzen Laurens und die Schmerzen der Armen, die unter Thränen geboren, dem Elende geweiht, nie den Vaternamen gestammelt hat; die vielleicht bestimmt ist, eine Beute des Elendes oder des Lasters zu werden. Ich leide alle Qualen, die ich diesen verursacht habe, im Fegefeuer, das die Reue eben gebiert und das stete Gedächtniss der unabänderlichen Vergangenheit, – bis Laura und Maria glücklich sind, bis ich mein Kind an dem Arme eines Mannes sehe, der nur sie liebt. Ach! wird meine Qual wohl je aufhören? – Aber ich fühle das Wehen der Morgenluft, Nicht umsonst vielleicht führte dich das Schicksal an meine Gruft. Lerne die Unschuld verehren, und rührt dich das Elend der Seele des armen Rinaldo, so bete für mich, und wallfahrte zum heiligen Grabe.» – Hiermit verschwand der Geist. Schauder ergriff Don Alfonso; so hiess der junge Ritter. Er kniete nieder, und legte auf Rinaldo's Grabe das heilige Gelübde ab, nicht zu ruhen, bis er etwas zur Befreiung der armen Seele beigetragen, und die Unschuld immer zu verehren. Die Hirten versichern, dass er dieses Gelübde nie gebrochen. Durch seinen natürlichen Hang zur Andacht sowohl, als durch die Empfindungen, die an der Gruft Rinaldo's sich seiner bemächtigt hatten, begeistert, trat er die Reise nach dem heiligen Grabe an. Er besuchte alle die Oerter, wo der Weltheiland gelitten. Als er einst, sich selbst und die Welt um sieh vergessend, auf dem heiligen Grabe in warmer Andacht kniete, und für die Seele des armen Rinaldo betete, überfiel ein Haufen sarazenischer Räuber Jerusalem, und führte ihn gefangen weg. Man brachte ihn unter die Sklaven des Emir von Medina. Je mehr seine Gestalt die Herzen der Heiden für ihn eingenommen hatte, desto heftiger wurden sie durch seine standhafte Weigerung, die Lehre ihres Propheten anzunehmen, erbittert. Er wurde mit den niedrigsten der Sklaven gebraucht, in den Gärten des Emir zu graben. Die Härte der ungewohnten Arbeit, die Strenge, mit der er behandelt wurde, und das brennende Klima verzehrten seine Kräfte. Er fiel an einem Abende, zur Zeit, da die Gärten geschlossen und die Arbeiter herausgelassen wurden, ohnmächtig nieder, und erwartete das Ende seiner Leiden. Niemand bemerkte den Vorfall. Eine süsse klagende Stimme, die in einem Zimmer des Serail, das an die Gürten stiess, in französischer Sprache ein Lied an die Jungfrau Maria sang, und durch öfteres Weinen und Schluchzen sich unterbrach, brachte ihn wieder zum Bewusstseyn. – «O holde Mutter! seufzte die Stimme, wo bist du, um die Blume welken zu sehen, die du so zärtlich pflegtest? theure Cölestina! die du jedes Gefiihl der Tugend in mir wecktest, wo bist du, um den letzten Trost in meine Seele zu giessen, und dies brechende Auge zu schliessen?» Sie schloss mit einem rührenden Gebete an die heilige Jungfrau, worin sie mit schwärmerischer Andacht ihren Entschluss entdeckte, sich den Dolch in das Herz zu stossen, ehe sie sich der Wollust des Emir aufopfere, die ihr diese Nacht drohe; und sie bat, ihr für diese That entweder Gnade bei Gott zu erflehen, oder ihr Hülfe zu senden. «Sie hat sie dir gesendet;» rief der Ritter, dem fremdes Elend die Kräfte wiedergab, die sein eigenes ihm genommen hatte, – «hier ist mein Arm, und wenn tausende in Waffen gegen mich ständen, so rettete er dich!» – «Eiserne Riegel und Gitter verwahren mich, edler Fremdling, ein Heer von Wächtern lauert auf mich. Dein Arm ist zu schwach, mich zu retten. Habe Dank für dein Mitleiden, habe Dank, dass ich nicht unbedauert sterben werde; und bist du ein Franke und ein Christ, wie deine Sprache zu zeigen scheint, so bete für die Seele der armen Marie.» Er ergriff zwei Baumleitern, und band sie zusammen, um das Zimmer Marions zu ersteigen. Indessen war von dem Aufseher der Sklaven seine Abwesenheit bemerkt worden. Der erste Verdacht fiel auf den Garten. Man ging hinein, und traf ihn mitten in seiner Unternehmung. Die Absicht derselben war nicht zweideutig. Es wurde sogleich dem Emir gemeldet. Sein Zorn war grimmig; er bestimmte den nächsten Morgen zu seiner Hinrichtung. In jeder anderen Lage wäre vielleicht der Tod dem Alfonso willkommen gewesen, er hätte ihn nur als seinen Retter aus einer Sklaverei betrachtet, die ihm ebenso erniedrigend als hart schien; und hätte ihn gern gegen ein thatenloses Leben umgetauscht: aber jetzt kränkte das Schicksal der armen Marie, die er nicht retten konnte, ihn mehr, als sein eigenes, und auch jener Wunsch, vor seinem Ende noch etwas zur Befreiung der Seele Rinaldo's beizutragen, wurde lauter, je mehr er sich demselben zu nähern glaubte. Er ging, mehr unerschrocken als freudig, seinem Tode entgegen. Die Werkzeuge seiner Hinrichtung waren bereitet. Im Hofe des Serail war ein Scheiterhaufen errichtet. Der Pöbel strömte dem Schauspiele zu, und der Emir erschien mit seiner neuesten Favorite, Alzire, auf einem Balkon, um die Hinrichtung mit anzusehen. Er kam eben von dem ersten Genusse ihrer höchsten Gunst, und sein Feuer war dadurch gegen sie nicht erkaltet. Er war ihr ergebener, als er es seit langer Zeit einem Weibe gewesen war, und hatte ihr versprochen, ihr die erste Bitte, die sie an ihn thun würde, sie betreffe, was sie wolle, uneingeschränkt zu gewähren. War es ein geheimes Wohlwollen, das das Herz der Alzire bei Alfonso's Anblick plötzlich zu ihm neigte; oder konnte sie die That, dem Emir diejenige rauben zu wollen, von der allein sie ihren Sturz befürchten durfte, nicht sehr strafbar finden; oder war es eine unmittelbare Wirkung der Vorsehung, die Alfonso'n erhalten wollte: Alzire bat um sein Leben. Unwillig, aber ehrliebend genug, um sein Wort nicht zu brechen, und zu schwach, um Alzirens Bitte widerstehen zu können, gab der Emir sogleich Befehl, den Alfonso über die Grenze zu bringen. Der Ritter, untröstlicher, diejenige ihrem Schicksal zu überlassen, die er so gern mit Verlust seines Lebens gerettet hätte, als erfreut über die unvermuthete Rettung seines Lebens, durchirrte die rauhen Wüsten Arabiens. Wurzeln, die er sparsam fand, waren seine einzige Nahrung, und der heisse Sand brannte seine Füsse, und trocknete seine Kräfte aus. In der vierten Nacht, indess der Sturm ihn umheulte, und die Wolken den Schimmer des letzten Sterns vor seinem Auge verdeckten, arbeitete er sich mühsam durch verwachsene Büsche hindurch; und eben waren seine letzten Kräfte im Schwinden, als er aus einer Felsenkluft ein mattes Licht schimmern sah. Hoffnung belebte die Kraft, die ihm noch übrig war: er erreichte die Grotte. Ein Weib, weiss gekleidet, von schlankem Wuchse, trat ihm entgegen. Die ehemalige Schönheit der Jugend schien auf ihrem Gesichte einer erhabenern Schönheit Platz gemacht zu haben. Die geistigste Andacht flammte in ihrem grossen, zum Himmel emporgewöhnten Auge, und verbreitete sich über ihr ganzes Gesicht. Nichts liess in ihr die Sterbliche errathen, als die sanfte Wehmuth, von der alle diese Züge gemildert waren, und welche die Spur ehemaliger Leiden verwischt zu haben schien. Sehr verzeihbar war also der Irrthum des Ritters. – «Heilige Jungfrau, redete er sie an, und sank auf seine Kniee; wunderthätige Helferin! – wer bin ich, dass du mich würdigest, den Himmel zu verlassen, um mich zu retten?» – «O steh auf! rief ihm jene zu, und entweihe nicht den Namen der Heiligen. Ich bin eine Sterbliche, wie du; glücklich, wenn die Mutter Gottes sich meiner bedienen will, dir zu helfen! Aber welches Schicksal treibt dich in diese unzugängliche Wüste, wo ich seit vielen Jahren keinen Wanderer erblickte? Kann ich und womit kann ich dir dienen?» Die Entkräftung des Bitters erlaubte ihm nicht, auf die erste dieser Fragen zu antworten; aber sie nöthigte ihn, es auf die andere zu thun. *) Er bat sie um einen Trank Wasser und um etwas Speise. *) «Voltairisch!» (Randglosse des Verfassers.) Sie ging und schöpfte ihm aus der Quelle, die hart an ihrer Grotte aus dem Felsen rieselte, und brachte milde Früchte, die sie selbst gezogen hatte. – «Erquickt euch, Fremdling; sagte sie zu ihm, mit dem wenigen, was ich euch geben kann; und nehmet dann dieses Lager ein. Ich werde schon auch einen Platz finden. Wer wollte sich durch eine falsche Anständigkeit abhalten lassen, die Pflichten der Menschlichkeit zu erfüllen, wenn es nicht gegen unser eigenes Geschlecht ist?» Der Ritter war durch alles, was er sah und hörte, wie betäubt. Erst nachdem er von seiner Entkräftung sich ein wenig erholt, und einer ruhigen Besinnung mächtig war, fing die Neugierde und Verwunderung an, an die Stelle dieser Betäubung zu treten; aber seine Unbekannte, die allein sie hätte befriedigen können, war verschwunden. Wunderbare Ahnungen strömten durch seine Seele; noch konnte er sich nicht überreden, ein sterbliches Weib gesehen zu haben: aber bald wurden alle seine Zweifel durch einen festen Schlaf gefesselt. Das Erste, was seine Sinne, traf, als er wieder erwachte, war die Melodie des Liedes, das die arme Maria gesungen hatte. Es war ihm, als ob ein Traum ihn wieder in die Gärten des Emir versetzte; er brauchte Zeit, um sich zu überzeugen, er wache; er horchte und horchte genauer; der Gesang kam vom Eingange der Grotte her. Die Unbekannte sass an der Morgensonne, und sang mit der rührendsten Stimme jenes Lied. Seine ganze Seele lauschte auf ihren Gesang: wie wär' es ihm möglich gewesen, sich selbst durch Muthmaassungen und Untersuchungen zu unterbrechen! – Das Lied schloss und die Stimme schwieg. Eben war er im Begriff, sich seinem Erstaunen und seiner Begierde, sich diese Begebenheiten alle zu erklären, von neuem zu überlassen, als ein anderer Vorfall seine Betrachtungen unterbrach. «Bist du es wirklich, meine Tochter?» sagte die Unbekannte zu einem jungen Frauenzimmer, das sich sprachlos und schluchzend in ihre Arme warf, und ihr weinendes Gesicht an ihrem Busen verbarg; – «schenkt die heilige Jungfrau die als todt Beweinte mir wieder? – Ja, du bist es, ich fühls an dem starken Schlagen deines Herzens gegen das meinige, an deinem freudigen Zittern in meinen Armen. Wer, als meine holde Maria, könnte mich so lieben? Aber, sieh mich an, lass mich dies so lang entbehrte Antlitz wieder sehen; lass michs auch in deinen Augen, in allen den wohlbekannten Zügen deines Gesichts lesen, dass du es bist, die mich so liebt. – So sollte ich denn auch diese Freude noch auf der Erde haben, dich wieder zu sehen; sollte noch nicht von allem Irdischen mein Herz losreissenl Ich hatte auch diesen Wunsch daraus vertilgt, dich wieder zu haben; das ward mir schwer. – Heiliger Gott, und du, gnadenvolle Mutter desselben, diese Belohnung meiner Leiden wagte ich nicht zu hoffen. Ich dankte dir für den Seelenfrieden und die Heiterkeit, die du mir gabst, meinen letzten und härtesten Verlust zu ertragen. Aber jetzt hilf mir die Freude tragen, dass sie mein Herz nicht von dir abziehe; und – sieh auf mich herab, – wenn du mir die Holde wieder nehmen willst, oder wenn ich sie nicht mehr rein und nur dir treu wiedergefunden hätte: hier bin ich, – ich ergebe mich in deinen Willen! – Und jetzt, liebe Tochter, erzähle mir: wo warst du seit jenem traurigen Tage, der dich von mir trennte, und was trennte dich von mir?» «Du warst, seitdem meine gute erste Mutter gestorben war, gütige Cölestina!» – hörte der Ritter jene Stimme sagen, die er schon in den Gärten zu Medina gehört hatte, – «nicht mehr immer so ganz heiter, als du es vorher warest. Ich bemerkte zuweilen, dass, wenn du mich an dein Herz drücktest, du plötzlich dich abwandtest, und dann kam es mir vor, als ob du eine Thräne unterdrücktest. Du gingest dann hinaus auf meiner Mutter Grab, und betetest, und bliebst oft lange; und wenn du zurückkamst, war so ein Glanz und so eine Heiterkeit in deinem Gesichte, und du warst so sanft und so feierlich froh, und mir war so wehmüthig wohl an deiner Seite, dass mich dünkte, du seyest auf dem Grabe verklärt worden, und seyest nicht mehr meine Mutter Cölestina, sondern ein heiliger Engel. – Doch vernimm das Schicksal, das mich von dir getrennt hat. Einst an einem Morgen – du ruhtest noch – war ich ausgegangen, Blumen zu suchen, und meiner Mutter Grab damit zu schmücken. Ich hatte mich wohl zu weit entfernt, denn plötzlich erschienen die Räuber der Wüste, die mich mit Gewalt fortschleppten, und als ich schrie, damit du mir helfen solltest, mir den Mund verstopften. Sie hörten nicht auf mein Weinen noch Bitten, sondern brachten mich durch lange Wüsteneien in eine Stadt. Die Stadt hiess Medina, wie ich nachher erfuhr. Hier bedeckten sie mein Angesicht mit einem Schleier, bis sie mich zu einem reichen Manne brachten, der den Räubern Geld gab, und mich seinen Weibern übergab.» «Heilige Mutter Gottes! was waren dies für Weiber! Schön waren sie; einige dünkten mich noch schöner, als du, meine Mutter; aber doch sah ich sie nicht gern, und es war mir nie recht wohl, wenn sie mir ins Gesicht sahen. Man sah es nicht, ob sie mich liebten, oder ob sie sich untereinander liebten. Sie liebten mich wohl auch nicht? – Wenn ich redete, so lachten sie. Ich musste ihre Sprache lernen; und ich lernte sie so gerne und so fleissig, damit ich mit ihnen reden könnte, und damit sie meine Freundinnen würden. – Kaum lernte ich sie verstehen, so hörte ich, dass sie nichts vom Weltheilande und von seiner Mutter wussten; und als ich ihnen davon sagen wollte, und ihnen erzählen, wie gütig und huldreich sie wären, verlachten sie mich abermals, und redeten dagegen viel von einem grossen Propheten, der wohl ein falscher Prophet seyn muss, weil du mir nichts von ihm gesagt hast. – Endlich kam einst jener reiche Mann wieder, der den Männern, die mich geraubt hatten, Geld gegeben hatte, und verlangte, ich sollte ihn lieben; und das konnte ich doch nicht: denn er sah so wild und grausam, und wusste ebensowenig vom Weltheilande, als seine Weiber, und that allerhand Dinge mit mir, die wohl schändlich seyn müssen, weil er sie that, und weil er so verstört dazu aussah. Ich stiess ihn zurück: die Mutter Gottes gab mir eine Kraft, die ich nie gefühlt hatte, dass ich Schwache dem starken Manne Widerstand leisten konnte. Ich weinte bitterlich; da ward der Mann sehr zornig, und sagte mir mit wildem Gesichte: er würde diese Nacht wiederkommen, und da würde mich nichts vor ihm retten.» «Mir war sehr eng ums Herz. Ich betete inbrünstig zur Mutter Gottes, mich zu erleuchten, was ich thun sollte; und wie ich feuriger betete, wurde ich immer muthiger. Es war, als ob eine geheime Stimme mir ins Herz flüsterte, es sey schändlich und sehr schändlich, was dieser Mann mit mir thun wolle, und ich müsse eher sterben, ehe ich es ertrüge. Ich wusste, dass eine meiner Gespielinnen ein Werkzeug hatte, – sie nannte es einen Dolch – wovon sie mir einst sagte, man könne jemand damit tödten. Damit kann man ja wohl auch sich selbst tödten, dachte ich. – Sage mir, liebste Mutter, that ich unrecht, dass ich es ihr heimlich wegnahm? Sie konnte es ja dann immer wieder haben, glaubte ich.» – «Erzähle weiter,» sagte Cölestina. – «Der Entschluss mich zu tödten, ehe ich mich der Gewalttätigkeit des Mannes überliesse, wurde nun immer fester in mir; und nachdem ich ihn der heiligen Jungfrau vorgetragen hatte, wurde mir innerlich wohl dabei, und ich glaubte gewiss, dass sie mir für diese That Gnade bei Gott erflehen werde; als plötzlich jemand unter dem Fenster rief: er wolle mich retten, und einige Leitern zusammenband, wie ich hörte. Gleich darauf aber vernahm ich, dass er ergriffen und unter tausend Verwünschungen weggeführt wurde. War es ein Sterblicher, – er musste es ja wohl seyn. weil er sich ergreifen und fortführen liess, und mich nicht retten konnte, – wie wird es dem Armen ergangen seyn, der um meinetwillen sich in diese Gefahr stürzte! Wie er ergriffen wurde, verschwand meine Ruhe. Sein Schicksal hat seitdem mir mehr Kummer gemacht, als das meinige.» «Er ist gerettet» –rufte der Ritter, der jetzt erst es wagte, Theil an der Unterredung zu nehmen, weil er sich unter alten Bekannten zu seyn dünkte; – «und hatte seit jener Nacht den ersten angenehmen Augenblick, da er auch dich gerettet sah.» Maria warf einen schüchternen, aber dankbaren Blick auf den Ritter, um sich – schien es – von der Wahrheit dessen zu überzeugen, was er sagte: und Alfonso erblickte ein Gesicht, auf welchem alle Reize der aufblühenden Jugend sich vereinigten, den reinsten Abdruck ihres unschuldigen Herzens darzustellen. Cölestina reichte ihm die Hand: «Seyd mir nochmals willkommen, edler Fremdling! – aber erzähle weiter, du meine Tochter." «Wunderbare Hülfe ward mir gesandt: erzählte sie; ich blieb diese Nacht über unbeunruhigt.» – «Ja, sagte der Ritter, denn der Emir hat sie bei einer anderen neu angekommenen Schönen des Serail zugebracht, die ihn mit dem ersten Blicke gefesselt hatte, und die ihm weniger Schwierigkeiten entgegenstellte.» – «Ich fühlte mich sogar nach einigen Stunden so ruhig, dass ein sanfter Schlaf auf mich herabsank. Ich wurde am Morgen durch ein Getümmel im Hofe des Serail aufgeweckt.» – «Es war das Volk, das sich versammelte, mich verbrennen zu sehen;» sagte der Ritter. – «Euch verbrennen wollte man? und der Todesgefahr, die Ihr ausgestanden, sollte ich meine Rettung verdanken? Doch, Gott Lob, dass Ihr gerettet seyd! – das Getümmel nahm ab; es entstand eine lange, fürchterliche, erwartende Stille» – «Alzire, so hiess die neue Favorite des Emir, sagte der Ritter, bat um mein Leben. Der Emir begnadigte mich, und liess mich sogleich über die Grenze bringen; daher entstand wahrscheinlich diese Stille.» – «Jetzt erhob sich ein Gemurmel, fuhr Maria fort; nun ward es lauter; nun brausete es, wie das tobende Meer. – Wie? dem Hunde von Franken das Leben schenken? Er soll nicht verbrannt werden? Wir sind vergebens hieher geladen worden? Leidet es nicht! schienen einige Stimmen, die das Getümmel überschrien, zu sagen. Der Aufruhr verbreitete sich über die ganze Stadt: alles lief zu den Waffen. Die Wachen verliessen die Thüren des Serail, und stürzten sich bewaffnet gegen das Volk. – War es ein unsichtbares Wesen, das mir den Entschluss eingab, mich jetzt durch die Flucht zu retten? ich fand alle Zugänge unbesetzt; ich drängte mich durch das Volk, das nichts sahe, als die Gegenstände seiner Rache. Ich kam – ob ich mich noch dunkel des ehemaligen Weges erinnerte, oder ob unsichtbar Engel mich leiteten, – ich kam durch die lange Wüste wieder zu deiner Grotte, theuerste Mutter; bin wieder dein, um mich nimmer von dir zu trennen.» «Gott sey gelobt, dass ich dich wieder habe, meine Tochter, sagte Cölestina, und dass ich dich so wieder habe, wie ich dich verlor. Und er sey gelobet, dass er auch Euch erhielt, edler Fremdling! und Euch hieher brachte, dass ich Euch für den Antheil danken kann, den Ihr an dieser Unschuldigen nahmt.» «Schon lange scheint eine Frage auf Eurer Lippe zu schweben, und es ist billig, dass ich Eure Neugier befriedige, insoweit ich darf. Ich bin ein Weib, welches einst in der Welt sehr glücklich war. Aber vielleicht hatte ich mein Herz zu sehr in diesem Erdenglück verloren: Gott entzog es mir, um mir zu zeigen, dass nur Er es sey, in welchem man befriedigende und dauerhafte Glückseligkeit finde. – Ich trennte mich von der Welt und von dem, der in ihr mein Abgott war. In der Stunde der Begeisterung, da ich dieses Opfer, das Tugend und Ehre und mein eigenes wahres Wohl heischte, begann, schien es mir so leicht, und nachdem es geschehen war, wollte mein Herz brechen. Ich suchte Trost und Ruhe an den heiligen Oertern, wo uns allen die Seligkeit erworben wurde. Da traf ich die Gesellin meiner Leiden, mit diesem ihrem Kinde. Ich hatte sie durch mein Elend glücklich machen wollen. Auf die Art, wie ich es mir gedacht hatte, sollte es nicht seyn. Wir sollten beide durch längeres Leiden zu einer reineren Glückseligkeit eingehen.» «Wir waren beide für die Welt, und sie für uns, auf immer verloren. In der heiligen Stadt und in ihrer Nähe waren wir kaum den sarazenischen Räubern entgangen. Wir beschlossen, uns in diese Wüsten, durch welche Gott einst sein auserwähltes Volk führte, zu begeben, und kamen in die Nähe des Gebirges, das Ihr hier vor Euch erblickt. Es ist das Gebirge Sinai.» – «Gott hatte uns den Platz unserer Ruhe sehon bereitet. Wir fanden hier diese Grotte, und dort das Gärtchen; zwar damals verwildert, aber durch eine geringe Arbeit war es wieder in Stand gesetzt. Vielleicht dass ohnlängst hier ein frommer Einsiedler sein Gott geweihtes Leben beschlossen hatte.» «Hier haben wir geweint und gelitten. – So lange noch eine geliebte Freundin gleiche Leiden mit mir litt, wurden die meinigen mir leichter. Ich stärkte meine Kräfte, um ihren Kummer tragen zu helfen, und vergass des meinigen, um Trost in ihre Seele zu giessen, und fand ihn dadurch selbst. Aber sie schlummerte bald in eine bessere Ruhe hinüber, und liess mich allein. Ich segnete ihr Geschick; aber – du hattest es wohl gesehen, meine Tochter, – das meinige ward mir schwerer. Nur die Zärtlichkeit gegen dich, und deine kindliche Liebe zu mir, holdes Kind, hielten mich aufrecht. Aber du konntest meine Leiden nicht mit mir fühlen.» «Noch hing mein Herz an etwas Irdischem; es hing an dir. Du musstest mir genommen werden. Musste durch so rauhe Wege Gott mich zu meinem Heile führen? – Nichts war mir nun übrig, als Er. Nur in sein Herz konnte ich meine Empfindungen ausgiessen; nur von ihm Gegenliebe erwarten. O, hätte ich es doch eher gewusst, welchen süssen Frieden dies über mein Herz ausgiesset, wie völlig dies eine Seele befriedigt! – welch eine Menge von Leiden hätte ich mir ersparen können!» «Aber verzeiht, guter Fremdling! dass ich so flüchtig über die näheren Umstände meiner Geschichte hinwegeilen musste. Es ist nicht Mistrauen. Wer so lange, als ich, sich nur mit Gott unterhalten hat, kennt dieses nicht; und in ein Antlitz, wie das Eurige, setzt es niemand. – Ich habe Ruhe gefunden: aber noch lebt vielleicht Einer, der mir einst nur zu theuer war. Kann ich ihm den Seelenfrieden nicht geben, wenn er ihn noch nicht errungen hat, so will ich ihm doch denselben auch nicht nehmen, wenn er ihn etwa errungen hätte. Ihr kehrt in die Welt zurück, und seyd, wenn mich nicht Alles täuscht, von eben dem Stande und aus eben den Ländern, in denen er lebte. Ihr könntet ihn antreffen; ihn vielleicht antreffen, ohne ihn zu kennen. Gutherzigkeit oder ein von ohngefähr entfahrendes Wort könnte alle die Kämpfe in seiner Seele erneuern, die er vielleicht längst ausgekämpft hat.» «Ich muss freilich wieder von Euch weg, und in die Welt zurück: sagte der Ritter; aber Verehrung gegen Euch wird, mich allenthalben begleiten, und Euer Wille wird immer mein Gesetz seyn.» Er sagte das Erstere so, als ob ihn dieser Entschluss etwas koste. Die Lage, in der er Marien in den Gärten von Medina zuerst gefunden, hatte so etwas Romantisches; Mitleiden und Theilnehmung an ihrem Schicksale hatten sich sogleich seines ganzen Herzens bemächtigt. Seine Phantasie hatte nicht gezögert, sie, die er nur gehört, nie gesehen hatte, in einen Körper zu kleiden; sie hatte ihn freigebig mit allen Reizen, die ihrer Silberstimme angemessen wären, ausgeschmückt. Er sah sie jetzt; und sie war weit über das Bild erhaben, das er sich von ihr gemacht hatte. Die blühende Wange, das sanfte Auge, das weiche, wallende Haar konnte er seinem Bilde geben; aber nicht jenen lebendigen Ausdruck der Unschuld, der Treue, der kindlichen Zärtlichkeit, weil es ihm dazu am Urbilde fehlte. Er sah sie jetzt, und sah sie in aller Freude des Wiedersehens an den Busen derjenigen, die ihr das Theuerste auf der Welt war, hingegossen; sah, wie sie in stummen Gefühlen an ihren Augen hing, gleichsam um alle die geliebten Züge wieder zu spähen, und die alte Vertraulichkeit mit ihnen zu erneuern. War es ein Wunder, dass seine Seele von eben den Gefühlen ergriffen wurde, deren reizendsten Abdruck er vor sich sah, und dass er sie mit der zu theilen wünschte, die ihm zuerst das schönste Bild derselben darstellte? Maria hatte den Unbekannten, der sich für sie in Lebensgefahr stürzte, bedauert, und, wie sie gewissenhaft war, sich den Vorwurf gemacht, die Ursache seines Todes zu seyn. Diese Empfindung allein hatte die Freude über ihre Errettung getrübt. Hier fand sie ihn unvermuthet wieder, an dem Orte, der ihr der liebste auf der Erde war. Nun erst getraute sie sich, sich ganz dem Gefühle, dass sie ihrer Pflegemutter wiedergegeben sey, zu überlassen; und es ist möglich, dass die Freude über seine Gegenwart unvermerkt einigen Antheil an dem stärkeren Ausdrucke ihrer Zärtlichkeit gegen ihre Pflegemutter hatte; und dass sie, ohne es zu wissen, einen Theil dessen, was sie bloss für Cölestinen zu empfinden glaubte, für Alfonso empfand. «Aber, kann ich, darf ich zurückkehren – fuhr der Ritter fort – ohne Trost für die Seele des armen Rinaldo gefunden zu haben? Ich hoffte doch gewiss am heiligen Grabe –» «Rinaldo? fiel Gölestina ihm in die Rede. Wer ist dieser Rinaldo? was wisst Ihr von ihm?» Alfonso erzählte, was er von seinem geängsteten Geiste selbst an seiner Gruft gehört hatte; erzählte die Bedingungen, unter welchen seine Qualen enden sollten; Cölestina hörte seine Erzählung mit stummer Betrübniss, und Maria mit Thränen an. «O möchten sie enden, die Qualen der unglücklichen Seele! und vielleicht sind sie schon grösstentheils geendet, sagte Cölestina. Maria hat ihre Leiden längst beschlossen; sie war die Freundin, die mir hier starb; sie ruht unter jenem Hügel. Das ist ihre und Rinaldo's Tochter. – Ich habe aufgehört zu leiden. Ich habe die Wege der Vorsehung erkannt; sie waren nichts als Güte. – Ich bin Laura: Maria wollte mich nicht anders als Cölestina nennen; drum habt Ihr mich hier so nennen hören.» «Und die letzte Bedingung seiner Erlösung – sagte Alfonso – möchte doch auch sie erfüllt werden! – Ja, edle würdige Frau, ich darf es Euch sagen; – ich habe nie geliebt; aber seitdem ich die Stimme dieses holden Geschöpfes gehört, seitdem ich sie hier an Eurem Herzen gesehen habe, – entweder ich weiss nicht, was Liebe ist, oder ich liebe sie über Alles. Lasst mich – o, Ihr seyd ja auch ihre Mutter, lasst mich sie an meinem Arme an die Gruft ihres Vaters führen; der Anblick wird den Geist erlösen.» Maria verbarg ihr Gesicht an Laurens Busen. Ihr Herz schlug stärker. «Fremdling, sagte Laura – nehmt nicht etwa eine flüchtige Rührung, ein mattes Wohlbehagen, einige sich unwillkürlich Euch aufdringende Wünsche sogleich für Liebe. – Ihr habt nie geliebt, sagt Ihr; – Euer Herz ist unerfahren und leicht zu bewegen. Ihr habt dieses Kind im Leiden gesehen, und habt gewünscht, habt Euch bemüht, sie zu retten. Ihr seyd durch den Antheil, den Ihr an ihr nahmt, in Gefahr gekommen. Das kettet edle Seelen an den Gegenstand ihrer Grossmuth: aber diese Anhänglichkeit ist noch nicht Liebe. Ihr habt sie hier in allen Rührungen der zärtlichen Tochter gesehen; das hat sich Euch mitgetheilt. Uebereilet Euch nicht, edler Fremdling.» «Grossmüthige Frau, versetzte der Ritter, was ich fühle, fühl' ich so wahr und so stark, dass ich für die ewige Dauer desselben gut bin. Es ist wie mit Flammenschrift in mein Herz geschrieben, dass diese Mein seyn muss, dass sie Mir bestimmt ist, und dass ohne sie es kein Glück mehr auf der Erde für mich giebt.» «Ich glaube Euch, edler Mann, sagte Laura: Ihr scheint wahr und gut; ich glaube, dass Ihr mich nicht täuschen wollt: aber weder ich, noch selbst Ihr könnt wissen, ob Ihr nicht vielleicht Euch selbst täuschet. Erwartet es, bis Eure Empfindungen sich Euch selbst aufklären und entwickeln; und kommt Ihr dann, und sagt noch eben das, so ist sie Euer.» «Verzeiht, edle Frau, versetzte der Ritter: wie könnte ich in dem, was ich so innig und so warm fühle, mich täuschen? Täusche ich mich vielleicht auch, wenn ich mein Daseyn empfinde? – Aber, ich soll warten, soll Euch verlassen, in Länder gehen, die weite Meere von Euch trennen? Wie werde ich das ertragen?» «Ihr sollt nicht allein gehen, sagte Laura. Dunkle Ahnung einer höheren Glückseligkeit, ein geheimes Verlangen, auf dem Grabe Rinaldo's zu seyn, durchströmt meine Seele. Ihr werdet mich und diese dahin begleiten, und dann – wenn Ihr dann noch so denkt, ist diese Euer.» Sie hatten keine langen Zubereitungen zur Abreise zu machen. Es waren noch einige Juwelen von denen, die Maria bei ihrer Abreise aus Paris mit sich genommen hatte, vorhanden. – «Hätte ich glauben können, dass ihr noch einst einen Werth für mich haben würdet?» sagte Laura, als sie sie zu sich nahm. Sie zogen unbeschädigt durch Arabien und Palästina, und setzten sich zu Damaskus auf ein Schiff. Ein günstiger Wind leitete sie; sie landeten bald an der europäischen Küste. In einer angenehmen Sommernacht kamen sie zu Rinaldo's Grabe. Ein sanfter Wind säuselte: Rosenduft erfüllte die Lüfte. Ruhe und Heiterkeit im Gesichte, glänzend und verklärt entstieg der Geist seiner Gruft. «Sey mir gesegnet, Alfonso! sagte er; du hast dein heiliges Gelübde gehalten. Du bist seiner werth, meine Tochter. In heiligeren Gefilden sehen wir uns wieder. – Deine unglückliche Mutter hat ihre Leiden beschlossen; ihr Leib ruht weit von dem meinigen, aber ihr Geist ist bei mir: und du, meine Laura, wirst sie bald beschliessen.» Der Geist verschwand. Laura sank in süsser Wehmuth auf das Grab, und schlummerte in ein besseres Leben hinüber. Sanfte Trauer erfüllte Mariens und Alfonso's Seele. Die Klagen über den Verlust der Glückseligen wurden ihnen süss. Sie lebten in diesen Gegenden das Leben der Zärtlichkeit und der Liebe. Jeder Unglückliche segnete ihr Haus; es war Zuflucht jedes Hülfslosen. Am fünfzigsten Gedächtnisstage ihrer Vermählung, nachdem sie schon die Kinder ihrer Enkel zu ihren Füssen hatten spielen sehen, sassen sie in stummer Zärtlichkeit auf der Gruft, und das Andenken der Begebenheiten ihres Lebens ging vor ihrer Seele vorüber. Ein sanfter Schauer überfiel sie, sie umarmten sich, und ihre Seelen gingen vereint in das Vaterland der Liebe. Die Hirten fanden sie erstarrt auf dem Grabe liegen, und begruben sie nebeneinander, da, wo sie lagen. Rosenstöcke und Vergissmeinnicht und Tausendschön entsprossten dem Boden um das Grab herum und blühten. Ahnungen von Wiedersehen der Freunde erfüllten die Seelen der Hirten. Ihren Augen enttröpfelten Thränen. Sie gingen, und als sie hinter sich sahen, sahen sie fünf Flämmchen auf dem Grabe blinken. Hinter ihnen schloss sich das Thal. Sie hatten den Weg dahin nicht wieder gefunden. Sie nannten es das Thal der Liebenden. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 1775 -1854 Zum 150. Todestag am 20. August 2004 Der Autor Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, wird 1775 im württembergischen Leonberg als Sohn eines Pfarrers geboren. Nach Landexamen und Seminar in Bebenhausen beginnt er 1790 am Tübinger Stift mit dem Studium der Theologie und Philosophie. Dort freundet er sich mit den Kommilitonen Hegel und Hölderlin an. Man begeistert sich für die französische Revolution. Nach dem Abschluß des Studiums 1795 nimmt er eine Hauslehrerstelle an. 1798 erhält er durch die Vermittlung Goethes eine Professur an der Universität Jena, wohin 1801 auch Hegel berufen wird. 1803 heiratet er Caroline, die geschiedene Frau August Wilhelm Schlegels, die damals im Mittelpunkt des Jenaer Romantikerkreises steht. Im gleichen Jahr folgt er einem Ruf an die Universität Würzburg als Professur für Philosophie. 1806 wird Würzburg österreichisch, und Schelling muß als protestantischer Professor die Universität verlassen. Er wird Mitglied der Akademie der Wissenschaften in München, bleibt jedoch ohne Lehramt. 1809 stirbt seine Frau Caroline. Zu ihrem Andenken verfaßt er das Gespräch «Clara oder über den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt». Von 1820 bis 1826 ist er Gastprofessor an der Erlanger Universität. 1827 wird er als Vorstand der Bayrischen Akademie der Wissenschaften und als Universitätsprofessor nach München berufen. 1841 übernimmt er den Lehrstuhl Hegels an der Berliner Universität. Der König von Preussen möchte mit ihm «die Drachensaat des Hegelianismus ausreuthen». Unter den Zuhörern der ersten Vorlesung sind Carl von Savigny, Friedrich A. Trendelenburg, Sören Kierkegaard, Friedrich Engels, Alexander von Humboldt, Michael Bakunin, Ferdinand Lassalle, Johann Gustav Droysen, Henrik Steffens, Jacob Burckhardt und Leopold Ranke. Seine mystischspekulative Spätphilosophie findet jedoch immer weniger Interesse. 1854 stirbt er während eines Kuraufenthalts in Bad Ragaz in der Schweiz. Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit 1809/34 Text: Schellings Werke Nach der Originalausgabe in neuer Anordnung herausgegeben von M. Schröter, München 1927 ff. Vierter Hauptband, S. 223-308 _____________________________________________ __ V o r b e r i c h t . 1) Ueber die folgende Abhandlung findet der Verfasser nur weniges zu bemerken. Da zum Wesen der geistigen Natur zunächst Vernunft, Denken und Erkennen gerechnet werden, so wurde der Gegensatz von Natur und Geist billig zuerst von dieser Seite betrachtet. Der feste Glaube an eine bloß menschliche Vernunft, die Ueberzeugung von der vollkommenen Subjektivität alles Denkens und Erkennens und der gänzlichen Vernunft- und Gedankenlosigkeit der Natur, sammt der überall herrschenden mechanischen Vorstellungsart, indem auch das durch Kant wiedergeweckte Dynamische wieder nur in ein höheres Mechanisches überging und in seiner Identität mit dem Geistigen keineswegs erkannt wurde, rechtfertigen hinlänglich diesen Gang der Betrachtung. Jene Wurzel des Gegensatzes ist nun ausgerissen, und die Befestigung richtigerer Einsicht kann ruhig dem allgemeinen Fortgang zu besserer Erkenntniß überlassen werden. Es ist Zeit, daß der höhere oder vielmehr der eigentliche Gegensatz hervortrete, der von Nothwendigkeit und Freiheit, mit welchem erst der innerste Mittelpunkt der Philosophie zur Betrachtung kommt. Da der Verfasser nach der ersten allgemeinen Darstellung seines Systems (in der Zeitschrift für speculative Physik), deren Fortsetzung leider durch äußere Umstände unterbrochen worden, sich bloß auf naturphilosophische Untersuchungen beschränkt hat, und nach dem in der Schrift: Philosophie und Religion 2) gemachten Anfang, der freilich durch Schuld der Darstellung undeutlich geblieben, die gegenwärtige Abhandlung das Erste ist, worin der Verfasser seinen Begriff des ideellen Theils der Philosophie mit völliger Bestimmtheit vorlegt, so muß er, wenn jene erste Darstellung eine Wichtigkeit gehabt haben sollte, ihr diese Abhandlung zunächst an die Seite stellen, welche schon der Natur des Gegenstandes nach über das Ganze des Systems tiefere Aufschlüsse als alle mehr partiellen Darstellungen enthalten muß. Obgleich der Verfasser über die Hauptpunkte, welche in derselben zur Sprache kommen, über Freiheit des Willens, Gut und Bös, Persönlichkeit usw. sich bisher nirgends erklärt hatte (die einzige Schrift Philosophie und Religion ausgenommen), so hat dieß nicht verhindert, ihm bestimmte, sogar dem Inhalt dieser - wie es scheint, gar nicht beachteten - Schrift ganz unangemessene Meinungen darüber nach eignem Gutdünken beizulegen. Auch mögen unberufene sogenannte Anhänger, vermeintlich nach den Grundsätzen des Verfassers, manches Verkehrte wie über andere so auch über diese Dinge vorgebracht haben. Anhänger im eigentlichen Sinn sollte zwar, so scheint es, nur ein fertiges, beschlossenes System haben können. Dergleichen hat der Verfasser bis jetzt nie aufgestellt, sondern nur einzelne Seiten eines solchen (und auch diese oft nur in einer einzelnen, z.B. polemischen, Beziehung) gezeigt; somit seine Schriften für Bruchstücke eines Ganzen erklärt, deren Zusammenhang einzusehen, eine feinere Bemerkungsgabe, als sich bei zudringlichen Nachfolgern, und ein besserer Wille, als sich bei Gegnern zu finden pflegt, erfordert wurde. Die einzige wissenschaftliche Darstellung seines Systems ist, da sie nicht vollendet wurde, ihrer eigentlichen Tendenz nach von niemand oder höchstwenigen verstanden worden. Gleich nach Erscheinung dieses Fragments fing das Verleumden und Verfälschen auf der einen, und das Erläutern, Bearbeiten und Uebersetzen auf der andern Seite an, wovon das in eine vermeintlich genialischere Sprache (da zu gleicher Zeit ein ganz haltungsloser poetischer Taumel sich der Köpfe bemächtigt hatte) die schlimmste Gattung war. Jetzt scheint sich wieder eine gesundere Zeit einfinden zu wollen. Das Treue, Fleißige, Innige wird wieder gesucht. Man fängt an, die Leerheit derer, die sich mit den Sentenzen der neuen Philosophie wie französische Theaterhelden gespreizt oder wie Seiltänzer geberdet haben, allgemein für das zu erkennen, was sie ist; zugleich haben die andern, die das erhaschte Neue auf allen Märkten wie zur Drehorgel absangen, endlich einen so allgemeinen Ekel erregt, daß sie bald kein Publikum mehr finden werden; besonders, wenn nicht bei jeder unverständigen Rhapsodie, worin einige Redensarten eines bekannten Schriftstellers zusammengebracht sind, von übrigens nicht übelwollenden Beurtheilern gesagt wird, sie sey nach dessen Grundsätzen verfaßt. Behandeln sie lieber jeden solchen als Original, was doch im Grunde jeder seyn will, und was in gewissem Sinne auch recht viele sind. So möge denn diese Abhandlung dienen, manches Vorurtheil von der einen, und manches lose und leichte Geschwätz von der andern Seite niederzuschlagen. Schließlich wünschen wir, es mögen die, welche den Verfasser von dieser Seite, offen oder verdeckt, angegriffen, nun auch ihre Meinung ebenso unumwunden darlegen, als es hier geschehen ist. Wenn vollkommene Herrschaft über seinen Gegenstand die freie kunstreiche Ausbildung desselben möglich macht, so können doch die künstlichen Schraubengänge der Polemik nicht die Form der Philosophie seyn. Noch mehr aber wünschen wir, daß der Geist eines gemeinsamen Bestrebens sich immer mehr befestige, und nicht der die Deutschen nur zu oft beherrschende Sektengeist die Gewinnung einer Erkenntniß und Ansicht hemme, deren vollkommene Ausbildung von jeher den Deutschen bestimmt schien, und die ihnen vielleicht nie näher war als jetzt. München, den 31. März 1809. __________ Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit können theils den richtigen Begriff derselben angehen, indem die Thatsache der Freiheit, so unmittelbar das Gefühl derselben einem jeden eingeprägt ist, doch keineswegs so sehr an der Oberfläche liegt, daß nicht, um sie auch nur in Worten auszudrücken, eine mehr als gewöhnliche Reinheit und Tiefe des Sinns erfordert würde; theils können sie den Zusammenhang dieses Begriffs mit dem Ganzen einer wissenschaftlichen Weltansicht betreffen. Da jedoch kein Begriff einzeln bestimmt werden kann, und die Nachweisung seines Zusammenhangs mit dem Ganzen ihm auch erst die letzte wissenschaftliche Vollendung gibt; welches bei dem Begriff der Freiheit vorzugsweise der Fall seyn muß, der, wenn er überhaupt Realität hat, kein bloß untergeordneter oder Nebenbegriff, sondern einer der herrschenden Mittelpunkte des Systems seyn muß: so fallen jene beiden Seiten der Untersuchung hier, wie überall, in eins zusammen. Einer alten, jedoch keineswegs verklungenen Sage zufolge soll zwar der Begriff der Freiheit mit dem System überhaupt unverträglich seyn, und jede auf Einheit und Ganzheit Anspruch machende Philosophie auf Leugnung der Freiheit hinauslaufen. Gegen allgemeine Versicherungen der Art ist es nicht leicht zu streiten; denn wer weiß, welche beschränkende angetroffen werde, weit früher aber von Empedokles ausgesprochen worden sey), werde verstehen, daß der Philosoph eine solche (göttliche) Erkenntniß behaupte, weil er allein, den Verstand rein und unverdunkelt von Bosheit erhaltend, mit dem Gott in sich den Gott außer sich begreife 3) . Allein es ist bei denen, welche der Wissenschaft abhold sind, einmal herkömmlich, unter dieser eine Erkenntniß zu verstehen, welche, wie die der gewöhnlichen Geometrie, ganz abgezogen und unlebendig ist. Kürzer oder entscheidender wäre, das System auch im Willen oder Verstande des Urwesens zu leugnen; zu sagen, daß es überhaupt nur einzelne Willen gebe, deren jeder einen Mittelpunkt für sich ausmache, und nach Fichtes Ausdruck eines jeden Ich die absolute Substanz sey. Immer jedoch wird die auf Einheit dringende Vernunft, was das auf Freiheit und Persönlichkeit bestehende Gefühl, nur durch einen Machtspruch zurückgewiesen, der eine Weile vorhält, endlich zuschanden wird. So mußte die Fichtesche Lehre ihre Anerkennung der Einheit, wenn auch in der dürftigen Gestalt einer sittlichen Weltordnung, bezeugen, wodurch sie aber unmittelbar in Widersprüche und Unstatthaftigkeiten geriet. Es scheint daher, daß, so viel auch für jene Behauptung von dem bloß historischen Standpunkt, nämlich aus den bisherigen Systemen, sich anführen läßt - (aus dem Wesen der Vernunft und Erkenntniß selbst geschöpfte Gründe haben wir nirgends gefunden) - der Zusammenhang des Begriffs der Freiheit mit dem Ganzen der Weltansicht wohl immer Gegenstand einer nothwendigen Aufgabe bleiben werde, ohne deren Auflösung der Begriff der Freiheit selber wankend, die Philosophie aber völlig ohne Wert seyn würde. Denn diese große Aufgabe allein ist die unbewußte und unsichtbare Triebfeder alles Strebens nach Erkenntniß von dem niedrigsten bis zum höchsten; ohne den Widerspruch von Nothwendigkeit und Freiheit würde nicht Philosophie allein, sondern jedes höhere Wollen des Geistes in den Tod versinken, der jenen Wissenschaften eigen ist, in welchen er keine Anwendung hat. Sich durch Abschwörung der Vernunft aus dem Handel ziehen, scheint aber der Flucht ähnlicher als dem Sieg. Mit dem nämlichen Rechte könnte ein anderer der Freiheit den Rücken wenden, um sich in die Arme der Vernunft und Nothwendigkeit zu werfen, ohne daß auf der einen oder der andern Seite eine Ursache zum Triumph wäre. Bestimmter ausgedrückt wurde die nämliche Meinung in dem Satz: das einzig mögliche System der Vernunft sey Pantheismus, dieser aber unvermeidlich Fatalismus 4) . Es ist unleugbar eine vortreffliche Erfindung um solche allgemeine Namen, womit ganze Ansichten auf einmal bezeichnet werden. Hat man einmal zu einem System den rechten Namen gefunden, so ergibt sich das übrige von selbst, und man ist der Mühe, sein Eigentümliches genauer zu untersuchen, enthoben. Auch der Unwissende kann, sobald sie ihm nur angegeben sind, mit deren H�lfe über das Gedachtetste aburtheilen. Dennoch kommt bei einer so außerordentlichen Behauptung alles auf die nähere Bestimmung des Begriffs an. Denn so möchte wohl nicht zu leugnen seyn, daß, wenn Pantheismus weiter nichts als die Lehre von der Immanenz der Dinge in Gott bezeichnete, jede Vernunftansicht in irgend einem Sinn zu dieser Lehre hingezogen werden muß. Aber eben der Sinn macht hier den Unterschied. Daß sich der fatalistische Sinn damit verbinden läßt, ist unleugbar; daß er aber nicht wesentlich damit verbunden sey, erhellt daraus, daß so viele gerade durch das lebendigste Gefühl der Freiheit zu jener Ansicht getrieben wurden. Die meisten, wenn sie aufrichtig wären, würden gestehen, daß, wie ihre Vorstellungen beschaffen sind, die individuelle Freiheit ihnen fast mit allen Eigenschaften eines höchsten Wesens im Widerspruch scheine, z.B. der Allmacht. Durch die Freiheit wird eine dem Princip nach unbedingte Macht außer und neben der göttlichen behauptet, welche jenen Begriffen zufolge undenkbar ist. Wie die Sonne am Firmament alle Himmelslichter auslöscht, so und noch viel mehr die unendliche Macht jede endliche. Absolute Kausalität in Einem Wesen läßt allen andern nur unbedingte Passivität übrig. Hierzu kommt die Dependenz aller Weltwesen von Gott, und daß selbst ihre Fortdauer nur eine stets erneute Schöpfung ist, in welcher das endliche Wesen doch nicht als ein unbestimmtes Allgemeines, sondern als dieses bestimmte, einzelne, mit solchen und keinen andern Gedanken, Bestrebungen und Handlungen producirt wird. Sagen, Gott halte seine Allmacht zurück, damit der Mensch handeln könne, oder er lasse die Freiheit zu, erklärt nichts: zöge Gott seine Macht einen Augenblick zurück, so hörte der Mensch auf zu seyn. Gibt es gegen diese Argumentation einen andern Ausweg, als den Menschen mit seiner Freiheit, da sie im Gegensatz der Allmacht undenkbar ist, in das göttliche Wesen selbst zu retten, zu sagen, daß der Mensch nicht außer Gott, sondern in Gott sey, und daß seine Thätigkeit selbst mit zum Leben Gottes gehöre? Gerade von diesem Punkt aus sind Mystiker und religiöse Gemüther aller Zeiten zu dem Glauben an die Einheit des Menschen mit Gott gelangt, der dem innigsten Gefühl ebensosehr oder noch mehr als der Vernunft und Spekulation zuzusagen scheint. Ja die Schrift selbst findet eben in dem Bewußtseyn der Freiheit das Siegel und Unterpfand des Glaubens, daß wir in Gott leben und sind. Wie kann nun die Lehre nothwendig mit der Freiheit streiten, welche so viele in Ansehung des Menschen behauptet haben, gerade um die Freiheit zu retten? Eine andere, wie man gewöhnlich glaubt näher treffende, Erklärung des Pantheismus ist allerdings die, daß er in einer völligen Identifikation Gottes mit den Dingen, einer Vermischung des Geschöpfs mit dem Schöpfer bestehe, woraus noch eine Menge anderer harter und unerträglicher Behauptungen abgeleitet werden. Allein eine totalere Unterscheidung der Dinge von Gott, als in dem für jene Lehre als klassisch angenommenen Spinoza sich findet, läßt sich kaum denken. Gott ist das, was in sich ist und allein aus sich selbst begriffen wird; das Endliche aber, was nothwendig in einem andern ist, und nur aus diesem begriffen werden kann. Offenbar sind dieser Unterscheidung zufolge die Dinge nicht, wie es nach der oberflächlich betrachteten Lehre von den Modifikationen allerdings scheinen könnte, bloß gradweise oder durch ihre Einschränkungen, sondern toto genere von Gott verschieden. Welches auch übrigens ihr Verhältniß zu Gott seyn möge, dadurch sind sie absolut von Gott getrennt, daß sie nur in und nach einem Aendern (nämlich Ihm) seyn können, daß ihr Begriff ein abgeleiteter ist, der ohne den Begriff Gottes gar nicht möglich wäre; da im Gegentheil dieser der allein selbständige und ursprüngliche, der allein sich selbst bejahende ist, zu dem alles andere nur wie Bejahtes, nur wie Folge zum Grund sich verhalten kann. Bloß unter dieser Voraussetzung gelten andere Eigenschaften der Dinge, z.B. ihre Ewigkeit. Gott ist seiner Natur nach ewig; die Dinge nur mit ihm und als Folge seines Daseyns, d.h. abgeleiteterweise. Eben dieses Unterschieds wegen können nicht, wie gewöhnlich vorgegeben wird, alle einzelnen Dinge zusammen Gott ausmachen, indem durch keine Art der Zusammenfassung das seiner Natur nach Abgeleitete in das seiner Natur nach Ursprüngliche übergehen kann, so wenig als die einzelnen Punkte einer Peripherie zusammengenommen diese ausmachen können, da sie als Ganzes ihnen dem Begriff nach nothwendig vorangeht. Abgeschmackter noch ist die Folgerung, daß bei Spinoza sogar das einzelne Ding Gott gleich seyn müsse. Denn wenn auch der starke Ausdruck, daß jedes Ding ein modificirter Gott ist, bei ihm sich fände, so sind die Elemente des Begriffs so widersprechend, daß er sich unmittelbar im Zusammenfassen wieder zersetzt. Ein modificirter, d.h. abgeleiteter, Gott ist nicht Gott im eigentlichen eminenten Sinn; durch diesen einzigen Zusatz tritt das Ding wieder an seine Stelle, durch die es ewig von Gott geschieden ist. Der Grund solcher Mißdeutungen, welche auch andere Systeme in reichem Maß erfahren haben, liegt in dem allgemeinen Mißverständniß des Gesetzes der Identität oder des Sinns der Kopula im Urtheil. Ist es gleich einem Kinde begreiflich zu machen, daß in keinem möglichen Satz, der der angenommenen Erklärung zufolge die Identität des Subjekts mit dem Prädicat aussagt, eine Einerleiheit oder auch nur ein unvermittelter Zusammenhang dieser beiden ausgesagt werde - indem z.B. der Satz: dieser Körper ist blau, nicht den Sinn hat, der Körper sey in dem und durch das, worin und wodurch er Körper ist, auch blau, sondern nur den, dasselbe, was dieser Körper ist, sey, obgleich nicht in dem nämlichen Betracht, auch blau: so ist doch diese Voraussetzung, welche eine völlige Unwissenheit über das Wesen der Kopula anzeigt, in bezug auf die höhere Anwendung des Identitätsgesetzes zu unsrer Zeit beständig gemacht worden. Es sey z.B. der Satz aufgestellt: das Vollkommene ist das Unvollkommene, so ist der Sinn der: das Unvollkommene ist nicht dadurch, daß und worin es unvollkommen ist, sondern durch das Vollkommene, das in ihm ist; für unsre Zeit aber hat er diesen Sinn: das Vollkommene und Unvollkommene sind einerlei, alles ist sich gleich, das Schlechteste und das Beste, Torheit und Weisheit. Oder: das Gute ist das Böse, welches so viel sagen will: das Böse hat nicht die Macht, durch sich selbst zu seyn; das in ihm Seyende ist das (an und für sich betrachtet) Gute: so wird dieß so ausgelegt: der ewige Unterschied von Recht und Unrecht, Tugend und Laster werde geleugnet, beide seyen logisch das Nämliche. Oder wenn in einer andern Wendung Nothwendiges und Freies als Eins erklärt werden, wovon der Sinn ist: dasselbe (in der letzten Instanz), welches Wesen der sittlichen Welt ist, sey auch Wesen der Natur, so wird dieß so verstanden: das Freie sey nichts als Naturkraft, Springfeder, die wie jede andere dem Mechanismus unterworfen ist. Das Nämliche geschieht bei dem Satz, daß die Seele mit dem Leib eins ist; welcher so ausgelegt wird: die Seele sey materiell, Luft, Aether, Nervensaft u. dgl., denn das Umgekehrte, daß der Leib Seele, oder im vorigen Satz, daß das scheinbar Nothwendige an sich ein Freies sey, ob es gleich ebensogut aus dem Satze zu nehmen ist, wird wohlbedächtig beiseite gesetzt. Bei solchen Mißverständnissen, die, wenn sie nicht absichtlich sind, einen Grad von dialektischer Unmündigkeit voraussetzen, über welchen die griechische Philosophie fast in ihren ersten Schritten hinaus ist, machen die Empfehlung des gründlichen Studiums der Logik zur dringenden Pflicht. Die alte tiefsinnige Logik unterschied Subjekt und Prädicat als vorangehendes und folgendes (antecedens et consequens), und drückte damit den reellen Sinn des Identitätsgesetzes aus. Selbst in dem tautologischen Satz, wenn er nicht etwa ganz sinnlos seyn soll, bleibt dieß Verhältniß. Wer da sagt: der Körper ist Körper, denkt bei dem Subjekt des Satzes zuverlässig etwas anderes als bei dem Prädicat; bei jenem nämlich die Einheit, bei diesem die einzelnen im Begriff des Körpers enthaltenen Eigenschaften, die sich zu demselben wie Antecedens zum Consequens verhalten. Eben dieß ist der Sinn einer andern älteren Erklärung, nach welcher Subjekt und Prädicat als das Eingewickelte und Entfaltete (implicitum et explicitum) entgegengesetzt wurden. 5) Allein, werden nun die Verteidiger der obigen Behauptung sagen, es ist überhaupt beim Pantheismus nicht davon die Rede, daß Gott alles ist (was nach der gewöhnlichen Vorstellung seiner Eigenschaften nicht gut zu vermeiden steht), sondern davon, daß die Dinge nichts sind, daß dieses System alle Individualität aufhebt. Es scheint zwar diese neue Bestimmung mit der vorigen im Widerspruch zu stehen; denn wenn die Dinge nichts sind, wie ist es möglich, Gott mit ihnen zu vermischen? es ist dann überall nichts als reine ungetrübte Gottheit. Oder, wenn außer Gott (nicht bloß extra, sondern auch praeter Deum) nichts ist, wie kann er anders als dem bloßen Wort nach Alles seyn; so daß also der ganze Begriff überhaupt sich aufzulösen und in nichts zu verfliegen scheint. Ohnehin fragt sich, ob mit der Auferweckung solcher allgemeinen Namen viel gewonnen sey, die in der Ketzerhistorie zwar in Ehren zu halten seyn mögen, für Produktionen des Geistes aber, bei denen, wie in den zartesten Naturerscheinungen, leise Bestimmungen wesentliche Veränderungen verursachen, viel zu grobe Handhaben scheinen. Es ließe sich noch zweifeln, ob sogar auf Spinoza die zuletzt angegebene Bestimmung anwendbar sey. Denn wenn er außer (praeter) der Substanz nichts anerkennt als die bloßen Affektionen derselben, wofür er die Dinge erklärt, so ist freilich dieser Begriff ein rein negativer, der nichts Wesentliches oder Positives ausdrückt. Allein er dient auch bloß zunächst das Verhältniß der Dinge zu Gott zu bestimmen, nicht aber, was sie für sich betrachtet seyn mögen. Aus dem Mangel dieser Bestimmung kann aber nicht geschlossen werden, daß sie überall nichts Positives (wenn gleich immer abgeleiteterweise) enthalten. Spinozas härtester Ausdruck ist wohl der: das einzelne Wesen sey die Substanz selbst, in einer ihrer Modifikationen, d.h. Folgen, betrachtet. Setzen wir nun die unendliche Substanz = A, dieselbe in einer ihrer Folgen betrachtet = A/a: so ist das Positive in A/a allerdings A; aber es folgt nicht, daß deswegen A/a = A, d.h. daß die unendliche Substanz in ihrer Folge betrachtet mit der unendlichen Substanz schlechthin betrachtet einerlei sey; oder mit andern Worten, es folgt nicht, daß A/a nicht eine eigne besondere Substanz (wenn gleich Folge von A) sey. Dieß steht freilich nicht bei Spinoza; allein erstens ist hier die Rede vom Pantheismus überhaupt; sodann fragt sich nur, ob die gegebene Ansicht mit dem Spinozismus an sich unverträglich sey. Man wird dieß schwerlich behaupten, da man zugegeben hat, daß die Monaden des Leibniz, die ganz das sind, was im obigen Ausdruck A/a ist, kein entscheidendes Mittel gegen den Spinozismus sind. Räthselhaft bleiben ohne eine Ergänzung der Art manche Aeußerungen des Spinoza, z.B. daß das Wesen der menschlichen Seele ein lebendiger Begriff Gottes sey, der als ewig (nicht als transitorisch) erklärt wird. Wenn daher auch die Substanz in ihren andern Folgen A/b, A/c .... nur vorübergehend wohnte, so würde sie doch in jener Folge, der menschlichen Seele = a, ewig wohnen, und daher als A/a auf eine ewige und unvergängliche Weise von sich selbst als A geschieden seyn. Wollte man nun weitergehend die Leugnung - nicht der Individualität, sondern - der Freiheit als eigentlichen Charakter des Pantheismus erklären, so würden eine Menge von Systemen, die sich doch sonst wesentlich von jenem unterscheiden, mit unter diesen Begriff fallen. Denn bis zur Entdeckung des Idealismus fehlt der eigentliche Begriff der Freiheit in allen neuern Systemen, im Leibnizischen so gut wie im Spinozischen; und eine Freiheit, wie sie viele unter uns gedacht haben, die sich noch dazu des lebendigsten Gefühls derselben rühmen, wonach sie nämlich in der bloßen Herrschaft des intelligenten Princips über das sinnliche und die Begierden besteht, eine solche Freiheit ließe sich, nicht zur Noth, sondern ganz leicht und sogar bestimmter, auch aus dem Spinoza noch herleiten. Es scheint daher die Leugnung oder Behauptung der Freiheit im allgemeinen auf etwas ganz anderem als der Annahme öder Nichtannahme des Pantheismus (der Immanenz der Dinge in Gott) zu beruhen. Denn wenn es freilich auf den ersten Blick scheint, als ginge die Freiheit, die sich im Gegensatz mit Gott nicht halten konnte, hier in der Identität unter, so kann man doch sagen, dieser Schein sey nur Folge der unvollkommenen und leeren Vorstellung des Identitätsgesetzes. Dieses Princip drückt keine Einheit aus, die sich im Kreis der Einerleiheit herumdrehend, nicht progressiv, und darum selbst unempfindlich und unlebendig wäre. Die Einheit dieses Gesetzes ist eine unmittelbar schöpferische. Schon im Verhältniß des Subjekts zum Prädicat haben wir das des Grundes zur Folge aufgezeigt, und das Gesetz des Grundes ist darum ein ebenso ursprüngliches wie das der Identität. Das Ewige muß deswegen unmittelbar, und so wie es in sich selbst ist, auch Grund seyn. Das, wovon es durch sein Wesen Grund ist, ist insofern ein Abhängiges und nach der Ansicht der Immanenz auch ein in ihm Begriffenes. Aber Abhängigkeit hebt Selbständigkeit, hebt sogar Freiheit nicht auf. Sie bestimmt nicht das Wesen, und sagt nur, daß das Abhängige, was es auch immer seyn möge, nur als Folge von dem seyn könne, von dem es abhängig ist; sie sagt nicht, was es sey, und was es nicht sey. Jedes organische Individuum ist als ein Gewordenes nur durch ein anderes, und insofern abhängig dem Werden, aber keineswegs dem Seyn nach. Es ist nicht ungereimt, sagt Leibniz, daß der, welcher Gott ist, zugleich gezeugt werde, oder umgekehrt, so wenig es ein Widerspruch ist, daß der, welcher der Sohn eines Menschen ist, selbst Mensch sey. Im Gegentheil, wäre das Abhängige oder Folgende nicht selbständig, so wäre dieß vielmehr widersprechend. Es wäre eine Abhängigkeit ohne Abhängiges, eine Folge ohne Folgendes (Consequentia absque Consequente), und daher auch keine wirkliche Folge, d.h. der ganze Begriff höbe sich selber auf. Das Nämliche gilt vom Begriffenseyn in einem andern. Das einzelne Glied, wie das Auge, ist nur im Ganzen eines Organismus möglich; nichtsdestoweniger hat es ein Leben für sich, ja eine Art von Freiheit, die es offenbar durch die Krankheit beweist, deren es fähig ist. Wäre das in einem indem Begriffene nicht selbst lebendig, so wäre eine Begriffenheit ohne Begriffenes, d.h. es wäre nichts begriffen. Einen viel höheren Standpunkt gewährt die Betrachtung des göttlichen Wesens selbst, dessen Idee eine Folge, die nicht Zeugung, d.h. Setzen eines Selbständigen ist, völlig widersprechen würde. Gott ist nicht ein Gott der Todten, sondern der Lebendigen. Es ist nicht einzusehen, wie das allervollkommenste Wesen auch an der möglich vollkommensten Maschine seine Lust fände. Wie man auch die Art der Folge der Wesen aus Gott sich denken möge, nie kann sie eine mechanische seyn, kein bloßes Bewirken oder Hinstellen, wobei das Bewirkte nichts für sich selbst ist; ebensowenig Emanation, wobei das Ausfließende dasselbe bliebe mit dem, wovon es ausgeflossen, also nichts Eignes, Selbständiges. Die Folge der Dinge aus Gott ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Gott aber kann nur sich offenbar werden in dem, was ihm ähnlich ist, in freien aus sich selbst handelnden Wesen; für deren Seyn es keinen Grund gibt als Gott, die aber sind, sowie Gott ist. Er spricht, und sie sind da. Wären alle Weltwesen auch nur Gedanken des göttlichen Gemüthes, so müßten sie schon eben darum lebendig seyn. So werden die Gedanken wohl von der Seele erzeugt; aber der erzeugte Gedanke ist eine unabhängige Macht, für sich fortwirkend, ja, in der menschlichen Seele, so anwachsend, daß er seine eigne Mutter bezwingt und sich unterwirft. Allein die göttliche Imagination, welche die Ursache der Spezifikation der Weltwesen ist, ist nicht wie die menschliche, daß sie ihren Schöpfungen bloß idealische Wirklichkeit ertheilt. Die Repräsentationen der Gottheit können nur selbständige Wesen seyn; denn was ist das Beschränkende unsrer Vorstellungen als eben, daß wir Unselbständiges sehen? Gott schaut die Dinge an sich an. An sich ist nur das Ewige, auf sich selbst Beruhende, Wille, Freiheit. Der Begriff einer derivirten Absolutheit oder Göttlichkeit ist so wenig widersprechend, daß er vielmehr der Mittelbegriff der ganzen Philosophie ist. Eine solche Göttlichkeit kommt der Natur zu. So wenig widerspricht sich Immanenz in Gott und Freiheit, daß gerade nur das Freie, und soweit es frei ist, in Gott ist, das Unfreie, und soweit es unfrei ist, nothwendig außer Gott. So ungenügend auch für den tiefer sehenden eine so allgemeine Deduktion an sich selbst ist, so erhellt doch so viel aus ihr, daß die Leugnung formeller Freiheit mit dem Pantheismus nicht nothwendig verbunden sey. Wir erwarten nicht, daß man uns den Spinozismus entgegensetzen werde. Es gehört nicht wenig Herz zu der Behauptung, das System, wie es in irgend eines Menschen Kopf sich zusammengefügt, sey das Vernunftsystem κατ᾽ ἐξοχήν das ewige unveränderliche. Was versteht man denn unter Spinozismus? Etwa die ganze Lehre, wie sie in den Schriften des Mannes vorliegt, also z.B. auch seine mechanische Physik? Oder nach welchem Princip will man hier scheiden und abtheilen, wo alles so voll außerordentlicher und einziger Konsequenz seyn soll? Es wird immer in der Geschichte deutscher Geistesentwicklung ein auffallendes Phänomen bleiben, daß zu irgend einer Zeit die Behauptung aufgestellt werden konnte: das System, welches Gott mit den Dingen, das Geschöpf mit dem Schöpfer vermengt (so wurde es verstanden) und alles einer blinden gedankenlosen Nothwendigkeit unterwirft, sey das einzige der Vernunft mögliche - aus reiner Vernunft zu entwickelnde! Um sie zu begreifen, muß man sich den herrschenden Geist eines früheren Zeitalters vergegenwärtigen. Damals hatte die mechanische Denkweise, die in dem französischen Atheismus den Gipfel ihrer Ruchlosigkeit erstieg, nachgerade alle Köpfe eingenommen; auch in Deutschland fing man an, diese Art zu sehen und zu erklären für die eigentliche und einzige Philosophie zu halten. Da indes ursprünglich deutsches Gemüth nie die Folgen davon mit sich vereinigen konnte, so entstand daher zuerst der für die philosophische Literatur der neueren Zeit charakteristische Zwiespalt von Kopf und Herz: man verabscheute die Folgen, ohne sich von dem Grund der Denkweise selbst befreien oder zu einer bessern erheben zu können. Aussprechen wollte man diese Folgen: und da deutscher Geist die mechanische Philosophie nur bei ihrem (vermeintlich) höchsten Ausdruck fassen konnte, so wurde auf diese Art die schreckliche Wahrheit ausgesprochen: alle Philosophie, schlechthin alle, die nur rein vernunftmäßig ist, ist oder wird Spinozismus! Gewarnt war nun jedermann vor dem Abgrund; er war offen dargelegt vor aller Augen; das einzige noch möglich scheinende Mittel war ergriffen; jenes kühne Wort konnte die Krisis herbeiführen und die Deutschen von der verderblichen Philosophie überhaupt zurückschrecken, sie auf das Herz, das innere Gefühl und den Glauben zurückführen. Heutzutage, da jene Denkweise längst vorüber ist, und das höhere Licht des Idealismus uns leuchtet, würde die nämliche Behauptung weder in gleichem Grade begreiflich seyn, noch auch die nämlichen Folgen versprechen 6) . Und hier denn ein für allemal unsre bestimmte Meinung über den Spinozismus! Dieses System ist nicht Fatalismus, weil es die Dinge in Gott begriffen seyn läßt; denn, wie wir gezeigt haben, der Pantheismus macht wenigstens die formelle Freiheit nicht unmöglich; Spinoza muß also aus einem ganz andern und von jenem unabhängigen Grund Fatalist seyn. Der Fehler seines Systems liegt keineswegs darin, daß er die Dinge in Gott setzt, sondern darin, daß es Dinge sind - in dem abstrakten Begriff der Weltwesen, ja der unendlichen Substanz selber, die ihm eben auch ein Ding ist. Daher sind seine Argumente gegen die Freiheit ganz deterministisch, auf keine Weise pantheistisch. Er behandelt auch den Willen als eine Sache, und beweist dann sehr natürlich, daß er in jedem Fall des Wirkens durch eine andere Sache bestimmt seyn müsse, die wieder durch eine andere bestimmt ist usf. ins Unendliche. Daher die Leblosigkeit seines Systems, die Gemüthlosigkeit der Form, die Dürftigkeit der Begriffe und Ausdrücke, das unerbittlich Herbe der Bestimmungen, das sich mit der abstrakten Betrachtungsweise vortrefflich verträgt; daher auch ganz folgerichtig seine mechanische Naturansicht. Oder zweifelt man, daß schon durch die dynamische Vorstellung der Natur die Grundansichten des Spinozismus wesentlich verändert werden müssen? Wenn die Lehre vom Begriffenseyn aller Dinge in Gott der Grund des ganzen Systems ist, so muß sie zum wenigsten erst belebt und der Abstraktion entrissen werden, ehe sie zum Princip eines Vernunftsystems werden kann. Wie allgemein sind die Ausdrücke, daß die endlichen Wesen Modifikationen oder Folgen von Gott sind; welche Kluft ist hier auszufüllen, welche Fragen sind zu beantworten! Man könnte den Spinozismus in seiner Starrheit wie die Bildsäule des Pygmalion ansehen, die durch warmen Liebeshauch beseelt werden müßte; aber dieser Vergleich ist unvollkommen, da es vielmehr einem nur in den äußersten Umrissen entworfenen Werk gleicht, in dem man, wenn es beseelt wäre, erst noch die vielen fehlenden oder unausgeführten Züge bemerken würde. Eher wäre es den ältesten Bildern der Gottheiten zu vergleichen, die, je weniger individuell-lebendige Züge aus ihnen sprachen, desto geheimnißvoller erschienen. Mit Einem Wort, es ist ein einseitig-realistisches System, welcher Ausdruck zwar weniger verdammend klingt als Pantheismus, dennoch aber weit richtiger das Eigentümliche desselben bezeichnet, und auch nicht jetzt das erste Mal gebraucht wird. Es würde verdrießlich seyn, die vielen Erklärungen zu wiederholen, die sich über diesen Punkt in den ersten Schriften des Verfassers finden. Wechseldurchdringung des Realismus und Idealismus war die ausgesprochene Absicht seiner Bestrebungen. Der Spinozische Grundbegriff, durch das Princip des Idealismus vergeistigt (und in Einem wesentlichen Punkte verändert), erhielt in der höheren Betrachtungsweise der Natur und der erkannten Einheit des Dynamischen mit dem Gemüthlichen und Geistigen eine lebendige Basis, woraus Naturphilosophie erwuchs, die als bloße Physik zwar für sich bestehen konnte, in bezug auf das Ganze der Philosophie aber jederzeit mir als der eine, nämlich der reelle Theil, derselben betrachtet wurde, der erst durch die Ergänzung mit dem ideellen, in welchem Freiheit herrscht, der Erhebung in das eigentliche Vernunftsystem fähig werde. In dieser (der Freiheit) wurde behauptet, finde sich der letzte potenzirende Akt, wodurch sich die ganze Natur in Empfindung, in Intelligenz, endlich in Willen verkläre. - Es gibt in der letzten und höchsten Instanz gar kein anderes Seyn als Wollen. Wollen ist Urseyn, und auf dieses allein passen alle Prädicate desselben: Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhängigkeit von der Zeit, Selbstbejahung. Die ganze Philosophie strebt nur dahin, diesen höchsten Ausdruck zu finden. Bis zu diesem Punkt ist die Philosophie zu unsrer Zeit durch den Idealismus gehoben worden: und erst bei diesem können wir eigentlich die Untersuchung unsres Gegenstandes aufnehmen, indem es keineswegs unsre Absicht sein konnte, alle diejenigen Schwierigkeiten, die sich aus dem einseitig-realistischen oder dogmatischen System gegen den Begriff der Freiheit erheben lassen und vorlängst erhoben worden sind, zu berücksichtigen. Allein der Idealismus selbst, so hoch wir durch ihn in dieser Hinsicht gestellt sind, und so gewiß es ist, daß wir ihm den ersten vollkommenen Begriff der formellen Freiheit verdanken, ist doch selbst für sich nichts weniger als vollendetes System, und läßt uns, sobald wir in das Genauere und Bestimmtere eingehen wollen, in der Lehre der Freiheit dennoch ratlos. In der ersten Beziehung bemerken wir, daß es in dem zum System gebildeten Idealismus keineswegs hinreicht, zu behaupten, «daß Thätigkeit, Leben und Freiheit allein das wahrhaft Wirkliche seyen», womit auch der subjektive (sich selbst mißverstehende Idealismus Fichtes bestehen kann); es wird vielmehr gefordert, auch umgekehrt zu zeigen, daß alles Wirkliche (die Natur, die Welt der Dinge) Thätigkeit, Leben und Freiheit zum Grund habe, oder im Fichteschen Ausdruck, daß nicht allein die Ichheit alles, sondern auch umgekehrt alles Ichheit sey. Der Gedanke, die Freiheit einmal zum Eins und Alles der Philosophie zu machen, hat den menschlichen Geist überhaupt, nicht bloß in bezug auf sich selbst, in Freiheit gesetzt und der Wissenschaft in allen ihren Theilen einen kräftigem Umschwung gegeben als irgend eine frühere Revolution. Der idealistische Begriff ist die wahre Weihe für die höhere Philosophie unsrer Zeit und besonders den höheren Realismus derselben. Möchten doch die, welche diesen beurtheilen oder sich zueignen, bedenken, daß die Freiheit die innerste Voraussetzung desselben ist; in wie ganz anderm Licht würden sie ihn betrachten und auffassen! Nur wer Freiheit gekostet hat, kann das Verlangen empfinden, ihr alles analog zu machen, sie über das ganze Universum zu verbreiten. Wer nicht auf diesem Weg zur Philosophie kommt, folgt und tut bloß andern nach, was sie thun; ohne Gefühl weswegen sie es thun. Es wird aber immer merkwürdig bleiben, daß Kant, nachdem er zuerst Dinge an sich von Erscheinungen nur negativ, durch die Unabhängigkeit von der Zeit, unterschieden, nachher in den metaphysischen Erörterungen seiner Kritik der praktischen Vernunft Unabhängigkeit von der Zeit und Freiheit wirklich als korrelate Begriffe behandelt hatte, nicht zu dem Gedanken fortging, diesen einzig möglichen positiven Begriff des An-sich auch auf die Dinge überzutragen, wodurch er sich unmittelbar zu einem höhern Standpunkt der Betrachtung und über die Negativität erhoben hätte, die der Charakter seiner theoretischen Philosophie ist. Von der andern Seite aber, wenn Freiheit der positive Begriff des An-sich überhaupt ist, wird die Untersuchung über menschliche Freiheit wieder ins Allgemeine zurückgeworfen, indem das Intelligible, auf welches sie allein gegründet worden, auch das Wesen der Dinge an sich ist. Um also die spezifische Differenz, d.h. eben das Bestimmte der menschlichen Freiheit, zu zeigen, reicht der bloße Idealismus nicht hin. Ebenso wäre es ein Irrthum, zu meinen, daß der Pantheismus durch den Idealismus aufgehoben und vernichtet sey; eine Meinung, die nur aus Verwechslung desselben mit einseitigem Realismus entspringen könnte. Denn ob es einzelne Dinge sind, die in einer absoluten Substanz, oder ebenso viele einzelne Willen, die in einem Urwillen begriffen sind, ist für den Pantheismus, als solchen, ganz einerlei. Er ist in dem ersten Falle realistisch, in dem andern idealistisch, der Grundbegriff aber bleibt derselbe. Eben hieraus ist vorläufig zu ersehen, daß die tiefsten Schwierigkeiten, die in dem Begriff der Freiheit liegen, durch den Idealismus für sich genommen so wenig auflösbar seyn werden als durch irgend ein anderes partielles System. Der Idealismus gibt nämlich einerseits nur den allgemeinsten, andererseits den bloß formellen Begriff der Freiheit. Der reale und lebendige Begriff aber ist, daß sie ein Vermögen des Guten und des Bösen sey. Dieses ist der Punkt der tiefsten Schwierigkeit in der ganzen Lehre von der Freiheit, die von jeher empfunden worden, und die nicht bloß dieses oder jenes System, sondern, mehr oder weniger, alle trifft 7): Am auffallendsten allerdings den Begriff der Immanenz; denn entweder wird ein wirkliches Böses zugegeben, so ist es unvermeidlich, das Böse in die unendliche Substanz oder den Urwillen selbst mitzusetzen, wodurch der Begriff eines allervollkommensten Wesens gänzlich zerstört wird; oder es muß auf irgend eine Weise die Realität des Bösen geleugnet werden, womit aber zugleich der reale Begriff von Freiheit verschwindet. Nicht geringer jedoch ist die Schwierigkeit, wenn zwischen Gott und den Weltwesen auch nur der allerweiteste Zusammenhang angenommen wird; denn wird dieser auch auf den bloßen sogenannten concursus, oder auf jene nothwendige Mitwirkung Gottes zum Handeln der Creatur beschränkt, welches vermöge der wesentlichen Abhängigkeit der letzten von Gott angenommen werden muß, wenn auch übrigens Freiheit behauptet wird: so erscheint doch Gott unleugbar als Miturheber des Bösen, indem das Zulassen bei einem ganz und gar dependenten Wesen doch nicht viel besser ist als mitverursachen; oder es muß ebenfalls auf die eine oder die andere Art die Realität des Bösen geleugnet werden. Der Satz, daß alles Positive der Creatur von Gott kommt, muß auch in diesem System behauptet werden. Wird nun angenommen, es sey in dem Bösen etwas Positives, so kommt auch dieß Positive von Gott. Hiergegen kann eingewendet werden: das Positive des Bösen, soweit es positiv ist, sey gut. Damit verschwindet das Böse nicht, ob es gleich auch nicht erklärt wird. Denn wenn das im Bösen Seyende gut ist, woher ist denn das, worin dieses Seyende ist, die Basis, welche eigentlich das Böse ausmacht? Ganz verschieden von dieser Behauptung (obgleich öfters, auch neuerlich, mit ihr verwechselt) ist die, daß im Bösen überall nichts Positives sey, oder anders ausgedrückt, daß es gar nicht (auch nicht mit und an einem andern Positiven) existire, sondern alle Handlungen mehr oder weniger positiv, und der Unterschied derselben ein bloßes Plus und Minus der Vollkommenheit sey, wodurch kein Gegensatz begründet wird, und also das Böse gänzlich verschwindet Es wäre dieß die zweite mögliche Annahme in bezug auf den Satz, daß alles Positive von Gott herkommt. Dann wäre die Kraft, die im Bösen sich zeigt, zwar vergleichungsweise unvollkommener als die welche im Guten, an sich aber, oder außer der Vergleichung betrachtet, doch selbst eine Vollkommenheit, die also, wie jede andere, von Gott abgeleitet werden muß. Das, was wir Böses daran nennen, ist nur der geringere Grad der Perfektion, der aber bloß für unsre Vergleichung als ein Mangel erscheint, in der Natur keiner ist. Es ist nicht zu leugnen, daß dieß die wahre Meinung des Spinoza sey. Es könnte jemand versuchen, jenem Dilemma durch die Antwort zu entgehen: das Positive, was von Gott herkommt, sey die Freiheit, die an sich gegen Böses und Gutes indifferent sey. Allein wenn er nur diese Indifferenz nicht bloß negativ denkt, sondern als ein lebendiges positives Vermögen zum Guten und zum Bösen, so ist nicht einzusehen, wie aus Gott, der als lautere Güte betrachtet wird, ein Vermögen zum Bösen folgen könne. Es erhellt hieraus, im Vorbeigehen zu sagen, daß, wenn die Freiheit wirklich das ist, was sie diesem Begriff zufolge seyn muß (und sie ist es unfehlbar), daß es alsdann auch mit der oben versuchten Ableitung der Freiheit aus Gott wohl nicht seine Richtigkeit habe; denn ist die Freiheit ein Vermögen zum Bösen, so muß sie eine von Gott unabhängige Wurzel haben. Hierdurch getrieben kann man versucht werden, sich dem Dualismus in die Arme zu werfen. Allein dieses System, wenn es wirklich als die Lehre von zwei absolut verschiedenen und gegenseitig unabhängigen Principien gedacht wird, ist nur ein System der Selbstzerreißung und Verzweiflung der Vernunft. Wird aber das böse Grundwesen in irgend einem Sinn als abhängig von dem guten gedacht, so ist die ganze Schwierigkeit der Abkunft des Bösen von dem Guten zwar auf Ein Wesen koncentrirt, aber dadurch eher vermehrt als vermindert. Selbst wenn angenommen wird, daß dieses zweite Wesen anfänglich gut erschaffen worden und durch eigne Schuld vom Urwesen abgefallen sey, so bleibt immer das erste Vermögen zu einer Gottwiderstrebenden That in allen bisherigen Systemen unerklärbar. Daher, wenn man auch endlich nicht nur die Identität, sondern jeden Zusammenhang der Weltwesen mit Gott aufheben, ihr ganzes gegenwärtiges Daseyn und somit das der Welt als eine Entfernung von Gott ansehen wollte, die Schwierigkeit nur um einen Punkt weiter hinausgerückt, aber nicht aufgehoben wäre. Denn um aus Gott ausfließen zu können, mußten sie schon auf irgend eine Weise daseyn, und am wenigsten könnte daher die Emanationslehre dem Pantheismus entgegengesetzt werden, da sie eine ursprüngliche Existenz der Dinge in Gott und somit jenen offenbar voraussetzt. Zur Erklärung jener Entfernung aber könnte nur Folgendes angenommen werden. Sie ist entweder eine unwillkürliche von seiten der Dinge, aber nicht von seiten Gottes: so sind sie durch Gott in den Zustand der Unseligkeit und Bosheit verstoßen, Gott also ist Urheber dieses Zustandes. Oder sie ist unwillkürlich von beiden Seiten, etwa durch Ueberfluß des Wesens verursacht, wie einige es ausdrücken: eine ganz unhaltbare Vorstellung. Oder sie ist willkürlich von seiten der Dinge, ein Losreißen von Gott, also die Folge einer Schuld, auf die immer tieferes Herabsinken folgt: so ist diese erste Schuld eben schon selbst das Böse, und gewährt daher keine Erklärung seines Ursprungs. Ohne diesen H�lfsgedanken aber, der, wenn er das Böse in der Welt erklärt, dagegen das Gute völlig auslöscht, und anstatt des Pantheismus einen Pandämonismus einführt, verschwindet gerade im System der Emanation jeder eigentliche Gegensatz des Guten und Bösen; das Erste verliert sich durch unendlich viele Zwischenstufen durch allmähliche Abschwächung in das, was keinen Schein des Guten mehr hat, ungefähr so wie Plotinos 8) spitzfindig, aber ungenügend den Uebergang des ursprünglichen Guten in die Materie und das Böse beschreibt. Nämlich durch eine beständige Unterordnung und Entfernung kommt ein Letztes hervor, über das hinaus nichts mehr werden kann, und dieß eben (das zu weiterem Produciren Unfähige) ist das Böse. Oder: wenn etwas nach dem Ersten ist, so muß auch ein Letztes seyn, das nichts mehr von dem Ersten an sich hat, und dieß ist die Materie und die Nothwendigkeit des Bösen. Diesen Betrachtungen zufolge scheint es eben nicht billig, die ganze Last dieser Schwierigkeit nur auf Ein System zu werfen, besonders da das angeblich höhere, was ihm entgegengesetzt wird, so wenig Genüge leistet. Auch die Allgemeinheiten des Idealismus können hier keine H�lfe schaffen. Mit solchen abgezogenen Begriffen von Gott als Actus purissimus, dergleichen die ältere Philosophie aufstellte, oder solchen, wie sie die neuere, aus Fürsorge Gott ja recht weit von aller Natur zu entfernen, immer wieder hervorbringt, läßt sich überall nichts ausrichten. Gott ist etwas Realeres als eine bloße moralische Weltordnung, und hat ganz andere und lebendigere Bewegungskräfte in sich, als ihm die dürftige Subtilität abstrakter Idealisten zuschreibt. Der Abscheu gegen alles Reale, der das Geistige durch jede Berührung mit demselben zu verunreinigen meint, muß natürlich auch den Blick für den Ursprung des Bösen blind machen. Der Idealismus, wenn er nicht einen lebendigen Realismus zur Basis erhält, wird ein ebenso leeres und abgezogenes System, als das Leibnizische, Spinozische, oder irgend ein anderes dogmatisches. Die ganz neu-europäische Philosophie seit ihrem Beginn (durch Descartes) hat diesen gemeinschaftlichen Mangel, daß die Natur für sie nicht vorhanden ist, und daß es ihr am lebendigen Grunde fehlt. Spinozas Realismus ist dadurch so abstrakt als der Idealismus des Leibniz. Idealismus ist Seele der Philosophie; Realismus ihr Leib; nur beide zusammen machen ein lebendiges Ganzes aus. Nie kann der letzte das Princip hergeben, aber er muß Grund und Mittel seyn, worin jener sich verwirklicht, Fleisch und Blut annimmt. Fehlt einer Philosophie dieses lebendige Fundament, welches gewöhnlich ein Zeichen ist, daß auch das ideelle Princip in ihr ursprünglich nur schwach wirksam war: so verliert sie sich in jene Systeme, deren abgezogene Begriffe von Aseität, Modifikationen usw. mit der Lebenskraft und Fülle der Wirklichkeit in dem schneidendsten Kontrast stehen. Wo aber das ideelle Princip wirklich in höhern Maße kräftig wirkt, aber die versöhnende und vermittelnde Basis nicht finden kann, da erzeugt es einen trüben und wilden Enthusiasmus, der in Selbstzerfleischung, oder, wie bei den Priestern der phrygischen Göttin, in Selbstentmannung ausbricht, welche in der Philosophie durch das Aufgeben von Vernunft und Wissenschaft vollbracht wird. Es schien nötig, diese Abhandlung mit der Berichtigung wesentlicher Begriffe anzufangen, die von jeher, besonders aber neuerdings, verwirrt worden. Die bisherigen Bemerkungen sind daher als bloße Einleitung zu unsrer eigentlichen Untersuchung zu betrachten. Wir haben es bereits erklärt: nur aus den Grundsätzen einer wahren Naturphilosophie läßt sich diejenige Ansicht entwickeln, welche der hier stattfindenden Aufgabe vollkommen Genüge tut. Wir leugnen darum nicht, daß diese richtige Ansicht nicht schon längst in einzelnen Geistern vorhanden gewesen sey. Aber eben diese waren es auch, die ohne Furcht vor den von jeher gegen alle reelle Philosophie gebräuchlichen Schmähworten, Materialismus, Pantheismus usw., den lebendigen Grund der Natur aufsuchten, und im Gegensatz der Dogmatiker und abstrakten Idealisten, welche sie als Mystiker ausstießen. Naturphilosophen (in beiderlei Verstande) waren. Die Naturphilosophie unsrer Zeit hat zuerst in der Wissenschaft die Unterscheidung aufgestellt zwischen dem Wesen, sofern es existirt, und dem Wesen, sofern es bloß Grund von Existenz ist. Diese Unterscheidung ist so alt als die erste wissenschaftliche Darstellung derselben 9). Unerachtet es eben dieser Punkt ist, bei welchem sie aufs bestimmteste von dem Wege des Spinoza ablenkt, so konnte doch in Deutschland bis auf diese Zeit behauptet werden, ihre metaphysischen Grundsätze seyen mit denen des Spinoza einerlei; und obwohl eben jene Unterscheidung es ist, welche zugleich die bestimmteste Unterscheidung der Natur von Gott herbeiführt, so verhinderte dieß nicht, sie der Vermischung Gottes mit der Natur anzuklagen. Da es die nämliche Unterscheidung ist, auf welche die gegenwärtige Untersuchung sich gründet, so sey hier Folgendes zu ihrer Erläuterung gesagt. Da nichts vor oder außer Gott ist, so muß er den Grund seiner Existenz in sich selbst haben. Das sagen alle Philosophen; aber sie reden von diesem Grund als einem bloßen Begriff, ohne ihn zu etwas Reellem und Wirklichem zu machen. Dieser Grund seiner Existenz, den Gott in sich hat, ist nicht Gott absolut betrachtet, d.h. sofern er existirt; denn er ist ja nur der Grund seiner Existenz, Er ist die Natur - in Gott; ein von ihm zwar unabtrennliches, aber doch unterschiedenes Wesen. Analogisch kann dieses Verhältniß durch das der Schwerkraft und des Lichtes in der Natur erläutert werden. Die Schwerkraft geht vor dem Licht her als dessen ewig dunkler Grund, der selbst nicht actu ist, und entflieht in die Nacht, indem das Licht (das Existirende) aufgeht. Selbst das Licht löst das Siegel nicht völlig, unter dem sie beschlossen liegt 10). Sie ist eben darum weder das reine Wesen noch auch das aktuale Seyn der absoluten Identität, sondern folgt nur aus ihrer Natur 11); oder ist sie, nämlich in der bestimmten Potenz betrachtet: denn übrigens gehört auch das, was beziehungsweise auf die Schwerkraft als existirend erscheint, an sich wieder zu dem Grunde, und Natur im Allgemeinen ist daher alles, was jenseits des absoluten Seyns der absoluten Identität liegt 12). Was übrigens jenes Vorhergehen betrifft, so ist es weder als Vorhergehen der Zeit nach, noch als Priorität des Wesens zu denken. In dem Zirkel, daraus alles wird, ist es kein Widerspruch, daß das, wodurch das Eine erzeugt wird, selbst wieder von ihm gezeugt werde. Es ist hier kein Erstes und kein Letztes, weil alles sich gegenseitig voraussetzt, keins das andere und doch nicht ohne das andere ist. Gott hat in sich einen innern Grund seiner Existenz, der insofern ihm als Existirendem vorangeht; aber ebenso ist Gott wieder das Prius des Grundes, indem der Grund, auch als solcher, nicht seyn könnte, wenn Gott nicht actu existirte. Auf dieselbe Unterscheidung führt die von den Dingen ausgehende Betrachtung. Zuerst ist der Begriff der Immanenz völlig zu beseitigen, inwiefern etwa dadurch ein todtes Begriffenseyn der Dinge in Gott ausgedrückt werden soll. Wir erkennen vielmehr, daß der Begriff des Werdens der einzige der Natur der Dinge angemessene ist. Aber sie können nicht werden in Gott, absolut betrachtet, indem sie toto genere, oder richtiger zu reden, unendlich von ihm verschieden sind. Um von Gott geschieden zu seyn, müssen sie in einem von ihm verschiedenen Grunde werden. Da aber doch nichts außer Gott seyn kann, so ist dieser Widerspruch nur dadurch aufzulösen, daß die Dinge ihren Grund in dem haben, was in Gott selbst nicht Er Selbst ist 13), d.h. in dem, was Grund seiner Existenz ist. Wollen wir uns dieses Wesen menschlich näher bringen, so können wir sagen: es sey die Sehnsucht, die das ewige Eine empfindet, sich selbst zu gebären. Sie ist nicht das Eine selbst, aber doch mit ihm gleich ewig. Sie will Gott, d.h. die unergründliche Einheit, gebären, aber insofern ist in ihr selbst noch nicht die Einheit. Sie ist daher für sich betrachtet auch Wille; aber Wille, in dem kein Verstand ist, und darum auch nicht selbständiger und vollkommener Wille, indem der Verstand eigentlich der Wille in dem Willen ist. Dennoch ist sie ein Willen des Verstandes, nämlich Sehnsucht und Begierde desselben; nicht ein bewußter, sondern ein ahndender Wille, dessen Ahndung der Verstand ist. Wir reden von dem Wesen der Sehnsucht an und für sich betrachtet, das wohl ins Auge gefaßt werden muß, ob es gleich längst durch das Höhere, das sich aus ihm erhoben, verdrängt ist, und obgleich wir es nicht sinnlich, sondern nur mit dem Geiste und den Gedanken erfassen können. Nach der ewigen That der Selbstoffenbarung ist nämlich in der Welt, wie wir sie jetzt erblicken, alles Regel, Ordnung und Form; aber immer liegt noch im Grunde das Regellose, als könnte es einmal wieder durchbrochen, und nirgends scheint es, als wären Ordnung und Form das Ursprüngliche, sondern als wäre ein anfänglich Regelloses zur Ordnung gebracht worden. Dieses ist an den Dingen die unergreifliche Basis der Realität, der nie aufgehende Rest, das, was sich mit der größten Anstrengung nicht in Verstand auflösen läßt, sondern ewig im Grunde bleibt. Aus diesem Verstandlosen ist im eigentlichen Sinne der Verstand geboren. Ohne dieß vorausgehende Dunkel gibt es keine Realität der Creatur; Finsterniß ist ihr nothwendiges Erbtheil. Gott allein - Er selbst der Existirende - wohnt im reinen Lichte, denn er allein ist von sich selbst. Der Eigendünkel des Menschen sträubt sich gegen diesen Ursprung aus dem Grunde, und sucht sogar sittliche Gründe dagegen auf. Dennoch wüßten wir nichts, das den Menschen mehr antreiben könnte, aus allen Kräften nach dem Lichte zu streben, als das Bewußtseyn der tiefen Nacht, aus der er ans Daseyn gehoben worden. Die weibischen Klagen, daß so das Verstandlose zur Wurzel des Verstandes, die Nacht zum Anfang des Lichtes gemacht werde, beruhen zwar zum Theil auf Mißverstand der Sache (indem man nicht begreift, wie mit dieser Ansicht die Priorität des Verstandes und Wesens dem Begriff nach dennoch bestehen kann); aber sie drücken das wahre System heutiger Philosophen aus, die gern fumum ex fulgore machen wollten, wozu aber selbst die gewaltsamste Fichtesche Präzipitation nicht hinreicht. Alle Geburt ist Geburt aus Dunkel ans Licht; das Samenkorn muß in die Erde versenkt werden und in der Finsterniß sterben, damit die schönere Lichtgestalt sich erhebe und am Sonnenstrahl sich entfalte. Der Mensch wird im Mutterleibe gebildet; und aus dem Dunkeln des Verstandlosen (aus Gefühl, Sehnsucht, der herrlichen Mutter der Erkenntniß) erwachsen erst die lichten Gedanken. So also müssen wir die ursprüngliche Sehnsucht uns vorstellen, wie sie zwar zu dem Verstande sich richtet, den sie noch nicht erkennt, wie wir in der Sehnsucht nach unbekanntem namenlosem Gut verlangen, und sich ahndend bewegt, als ein wogend wallend Meer, der Materie des Platon gleich, nach dunkelm ungewissem Gesetz, unvermögend etwas Dauerndes für sich zu bilden. Aber entsprechend der Sehnsucht, welche als der noch dunkle Grund die erste Regung göttlichen Daseyns ist, erzeugt sich in Gott selbst eine innere reflexive Vorstellung, durch welche, da sie keinen andern Gegenstand haben kann als Gott, Gott sich selbst in einem Ebenbilde erblickt. Diese Vorstellung ist das Erste, worin Gott, absolut betrachtet, verwirklicht ist, obgleich nur in ihm selbst, sie ist im Anfange bei Gott, und der in Gott gezeugte Gott selbst. Diese Vorstellung ist zugleich der Verstand - das Wort jener Sehnsucht 14), und der ewige Geist, der das Wort in sich und zugleich die unendliche Sehnsucht empfindet, von der Liebe bewogen, die er selbst ist, spricht das Wort aus, das nun der Verstand mit der Sehnsucht zusammen freischaffender und allmächtiger Wille wird und in der anfänglich regellosen Natur als in seinem Element oder Werkzeuge bildet. Die erste Wirkung des Verstandes in ihr ist die Scheidung der Kräfte, indem er nur dadurch die in ihr unbewußt, als in einem Samen, aber doch nothwendig enthaltene Einheit zu entfalten vermag, so wie im Menschen in die dunkle Sehnsucht, etwas zu schaffen, dadurch Licht tritt, daß in dem chaotischen Gemenge der Gedanken, die alle zusammenhängen, jeder aber den andern hindert hervorzutreten, die Gedanken sich scheiden und nun die im Grunde verborgen liegende, alle unter sich befassende Einheit sich erhebt; oder wie in der Pflanze nur im Verhältniß der Entfaltung und Ausbreitung der Kräfte das dunkle Band der Schwere sich löst und die im geschiedenen Stoff verborgene Einheit entwickelt wird. Weil nämlich dieses Wesen (der anfänglichen Natur) nichts anderes ist als der ewige Grund zur Existenz Gottes, so muß es in sich selbst, obwohl verschlossen, das Wesen Gottes gleichsam als einen im Dunkel der Tiefe leuchtenden Lebensblick enthalten. Die Sehnsucht aber, vom Verstande erregt, strebt nunmehr, den in sich ergriffenen Lebensblick zu erhalten, und sich in sich selbst zu verschließen, damit immer ein Grund bleibe. Indem also der Verstand, oder das in die anfängliche Natur gesetzte Licht, die in sich selbst zurückstrebende Sehnsucht zur Scheidung der Kräfte (zum Aufgeben der Dunkelheit) erregt, eben in dieser Scheidung aber die im Geschiedenen verschlossene Einheit, den verborgenen Lichtblick, hervorhebt, so entsteht auf diese Art zuerst etwas Begreifliches und Einzelnes, und zwar nicht durch äußere Vorstellung, sondern durch wahre Ein-Bildung, indem das Entstehende in die Natur hineingebildet wird, oder richtiger noch, durch Erweckung, indem der Verstand die in dem geschiedenen Grund verborgene Einheit oder Idea hervorhebt. Die in dieser Scheidung getrennten (aber nicht völlig auseinandergetretenen) Kräfte sind der Stoff, woraus nachher der Leib konfigurirt wird; das aber in der Scheidung, also aus der Tiefe des natürlichen Grundes, als Mittelpunkt der Kräfte entstehende lebendige Band ist die Seele. Weil der ursprüngliche Verstand die Seele aus einem von ihm unabhängigen Grunde als Inneres hervorhebt, so bleibt sie eben damit selbst unabhängig von ihm, als ein besonderes und für sich bestehendes Wesen. Es ist leicht einzusehen, daß bei dem Widerstreben der Sehnsucht, welches nothwendig ist zur vollkommenen Geburt, das allerinnerste Band der Kräfte nur in einer stufenweise geschehenden Entfaltung sich löst, und bei jedem Grade der Scheidung der Kräfte ein neues Wesen aus der Natur entsteht, dessen Seele um so vollkommener seyn muß, je mehr es das, was in den andern noch ungeschieden ist, geschieden enthält. Zu zeigen, wie jeder folgende Prozeß dem Wesen der Natur näher tritt, bis in der höchsten Scheidung der Kräfte das allerinnerste Centrum aufgeht, ist die Aufgabe einer vollständigen Naturphilosophie. Für den gegenwärtigen Zweck ist nur Folgendes wesentlich. Jedes der auf die angezeigte Art in der Natur entstandenen Wesen hat ein doppeltes Princip in sich, das jedoch im Grunde nur ein und das nämliche ist, von den beiden möglichen Seiten betrachtet. Das erste Princip ist das, wodurch sie von Gott geschieden, oder wodurch sie im bloßen Grunde sind; da aber zwischen dem, was im Grunde, und dem, was im Verstande vorgebildet ist, doch eine ursprüngliche Einheit stattfindet, und der Prozeß der Schöpfung nur auf eine innere Transmutation oder Verklärung des anfänglich dunkeln Princips in das Licht geht (weil der Verstand oder das in die Natur gesetzte Licht in dem Grunde eigentlich nur das ihm verwandte, nach ihnen gekehrte Licht sucht): so ist das seiner Natur nach dunkle Princip eben dasjenige, welches zugleich in Licht verklärt wird, und beide sind, obwohl nur in bestimmtem Grade, eins in jedem Naturwesen. Das Princip, sofern es aus dem Grunde stammt und dunkel ist, ist der Eigenwille der Creatur, der aber, sofern er noch nicht zur vollkommenen Einheit mit dem Licht (als Princip des Verstandes) erhoben ist (es nicht faßt), bloße Sucht oder Begierde, d.h. blinder Wille ist. Diesem Eigenwillen der Creatur steht der Verstand als Universalwille entgegen, der jenen gebraucht und als bloßes Werkzeug sich unterordnet. Wenn aber endlich durch fortschreitende Umwandlung und Scheidung aller Kräfte der Innerste und tiefste Punkt der anfänglichen Dunkelheit in einem Wesen ganz in Licht verklärt ist, so ist der Wille desselben Wesens zwar, inwiefern es ein Einzelnes ist, ebenfalls ein Particularwille, an sich aber, oder als das Centrum aller andern Particularwillen, mit dem Urwillen oder dem Verstande eins, so daß aus beiden jetzt ein einiges Ganzes wird. Diese Erhebung des allertiefsten Centri in Licht geschieht in keiner der uns sichtbaren Creaturen außer im Menschen. Im Menschen ist die ganze Macht des finstern Princips und in ebendemselben zugleich die ganze Kraft des Lichts. In ihm ist der tiefste Abgrund und der höchste Himmel, oder beide Centra. Der Wille des Menschen ist der in der ewigen Sehnsucht verborgene Keim des nur noch im Grunde vorhandenen Gottes; der in der Tiefe verschlossene göttliche Lebensblick, den Gott ersah, als er den Willen zur Natur faßte. In ihm (im Menschen) allein hat Gott die Welt geliebt; und eben dieß Ebenbild Gottes hat die Sehnsucht im Centro ergriffen, als sie mit dem Licht in Gegensatz trat. Der Mensch hat dadurch, daß er aus dem Grunde entspringt (creatürlich ist), ein relativ auf Gott unabhängiges Princip in sich; aber dadurch, daß eben dieses Princip - ohne daß es deshalb aufhörte dem Grunde nach dunkel zu seyn - in Licht verklärt ist, geht zugleich ein Höheres in ihm auf, der Geist. Denn der ewige Geist spricht die Einheit oder das Wort aus in die Natur. Das ausgesprochene (reale) Wort aber ist nur in der Einheit von Licht und Dunkel (Selbstlauter und Mitlauter). Nun sind zwar in allen Dingen die beiden Principien, aber ohne völlige Konsonanz wegen der Mangelhaftigkeit des aus dem Grunde Erhobenen. Erst im Menschen also wird das in allen andern Dingen noch zurückgehaltene und unvollständige Wort völlig ausgesprochen. Aber indem ausgesprochenen Wort offenbart sich der Geist, d.h. Gott als actu existirend. Indem nun die Seele lebendige Identität beider Principien ist, ist sie Geist; und Geist ist in Gott. Wäre nun im Geist des Menschen die Identität beider Principien ebenso unauflöslich als in Gott, so wäre kein Unterschied, d.h. Gott als Geist würde nicht offenbar. Diejenige Einheit, die in Gott unzertrennlich ist, muß also im Menschen zertrennlich seyn, - und dieses ist die Möglichkeit des Guten und des Bösen. Wir sagen ausdrücklich: die Möglichkeit des Bösen, und suchen vorerst auch nur die Zertrennlichkeit der Principien begreiflich zu machen. Die Wirklichkeit des Bösen ist Gegenstand einer ganz andern Untersuchung. Das aus dem Grunde der Natur emporgehobene Princip, wodurch der Mensch von Gott geschieden ist, ist die Selbstheit in ihm, die aber durch ihre Einheit mit dem idealen Princip Geist wird. Die Selbstheit als solche ist Geist, oder der Mensch ist Geist als ein selbstisches, besonderes (von Gott geschiedenes) Wesen, welche Verbindung eben die Persönlichkeit ausmacht. Dadurch aber, daß die Selbstheit Geist ist, ist sie zugleich aus dem Creatürlichen ins Uebercreatürliche gehoben, sie ist Wille, der sich selbst in der völligen Freiheit erblickt, nicht mehr Werkzeug des in der Natur schaffenden Universalwillens, sondern über und außer aller Natur ist. Der Geist ist über dem Licht, wie er sich in der Natur über der Einheit des Lichts und des dunkeln Princips erhebt. Dadurch, daß sie Geist ist, ist also die Selbstheit frei von beiden Principien. Nun ist aber diese oder der Eigenwille nur dadurch Geist, und demnach frei oder über der Natur, daß er wirklich in den Urwillen (das Licht) umgewandelt ist, so daß er zwar (als Eigenwille) im Grunde noch bleibt (weil immer ein Grund seyn muß) - so wie im durchsichtigen Körper die zur Identität mit dem Licht erhobene Materie deshalb nicht aufhört Materie (finsteres Princip) zu seyn - aber bloß als Träger und gleichsam Behälter des höheren Princips des Lichts. Dadurch aber, daß sie den Geist hat (weil dieser über Licht und Finsterniß herrscht) - wenn er nämlich nicht der Geist der ewigen Liebe ist - kann die Selbstheit sich trennen von dem Licht, oder der Eigenwille kann streben, das, was er nur in der Identität mit dem Universalwillen ist, als Particularwille zu seyn, das, was er nur ist, inwiefern er im Centro bleibt (so wie der ruhige Wille im stillen Grunde der Natur eben darum auch Universalwille ist, weil er im Grunde bleibt), auch in der Peripherie oder als Geschöpf zu seyn (denn der Wille der Creaturen ist freilich außer dem Grunde; aber er ist dann auch bloßer Particularwille, nicht frei, sondern gebunden). Dadurch also entsteht im Willen des Menschen eine Trennung der geistig gewordenen Selbstheit (da der Geist über dem Lichte steht) von dem Licht, d.h. eine Auflösung der in Gott unauflöslichen Principien. Wenn im Gegentheil der Eigenwille des Menschen als Centralwille im Grunde bleibt, so daß das göttliche Verhältniß der Principien besteht (wie nämlich der Wille im Centro der Natur nie über das Licht sich erhebt, sondern unter demselben als Basis im Grunde bleibt), und wenn statt des Geistes der Zwietracht, der das eigne Princip vom allgemeinen scheiden will, der Geist der Liebe in ihm waltet, so ist der Wille in göttlicher Art und Ordnung. - Daß aber eben jene Erhebung des Eigenwillens das Böse ist, erhellt aus Folgendem. Der Wille, der aus seiner Uebernatürlichkeit heraustritt, um sich als allgemeinen Willen zugleich particular und creatürlich zu machen, strebt das Verhältniß der Principien umzukehren, den Grund über die Ursache zu erheben, den Geist, den er nur für das Centrum erhalten, außer demselben und gegen die Creatur zu gebrauchen, woraus Zerrüttung in ihm selbst und außer ihm erfolgt. Der Wille des Menschen ist anzusehen als ein Band von lebendigen Kräften; solange nun er selbst in seiner Einheit mit dem Universalwillen bleibt, so bestehen auch jene Kräfte in göttlichem Maß und Gleichgewicht. Kaum aber ist der Eigenwille selbst aus dem Centro als seiner Stelle gewichen, so ist auch das Band der Kräfte gewichen; statt desselben herrscht ein bloßer Particularwille, der die Kräfte nicht mehr unter sich, wie der ursprüngliche, vereinigen kann, und der daher streben muß, aus den voneinander gewichenen Kräften, dem empörten Heer der Begierden und Lüste (indem jede einzelne Kraft auch eine Sucht und Lust ist) ein eignes und absonderliches Leben zu formiren oder zusammenzusetzen, welches insofern möglich ist, als selbst im Bösen das erste Band der Kräfte, der Grund der Natur, immer noch fortbesteht. Da es aber doch kein wahres Leben seyn kann, als welches nur in dem ursprünglichen Verhältniß bestehen konnte, so entsteht zwar ein eignes, aber ein falsches Leben, ein Leben der Lüge, ein Gewächs der Unruhe und der Verderbniß. Das treffendste Gleichniß bietet hier die Krankheit dar, welche als die durch den Mißbrauch der Freiheit in die Natur gekommene Unordnung das wahre Gegenbild des Bösen oder der Sünde ist. Universalkrankheit ist nie, ohne daß die verborgenen Kräfte des Grundes sich aufthun: sie entsteht, wenn das irritable Princip, das in der Stille der Tiefe als das innerste Band der Kräfte walten sollte, sich selbst aktuirt, oder der aufgereizte Archäus seine ruhige Wohnung im Centro verläßt und in den Umkreis tritt. So wie dagegen alle ursprüngliche Heilung in der Wiederherstellung des Verhältnisses der Peripherie zum Centro besteht, und der Uebergang von Krankheit zur Gesundheit eigentlich nur durch das Entgegengesetzte, nämlich Wiederaufnahme des getrennten und einzelnen Lebens in den innern Lichtblick des Wesens, geschehen kann, aus welcher die Scheidung (Krisis) wieder erfolgt. Auch die Particularkrankheit entsteht nur dadurch, daß das, was seine Freiheit oder sein Leben nur dafür hat, daß es im Ganzen bleibe, für sich zu seyn strebt. Wie die Krankheit freilich nichts Wesenhaftes und eigentlich nur ein Scheinbild des Lebens und bloß meteorische Erscheinung desselben - ein Schwanken zwischen Seyn und Nichtseyn - ist, nichtsdestoweniger aber dem Gefühl sich als etwas sehr Reelles ankündigt, ebenso verhält es sich mit dem Bösen. Diesen allein richtigen Begriff des Bösen, nach welchem es auf einer positiven Verkehrtheit oder Umkehrung der Principien beruht, hat in neueren Zeiten besonders Franz Baader wieder hervorgehoben und durch tiefsinnige physische Analogien, namentlich die der Krankheit, erläutert 15). Alle andern Erklärungen des Bösen lassen den Verstand und das sittliche Bewußtseyn gleich unbefriedigt. Sie beruhen im Grunde sämtlich auf der Vernichtung des Bösen als positiven Gegensatzes und der Reduktion desselben auf das sogenannte malum metaphysicum oder dem verneinenden Begriff der Unvollkommenheit der Creatur. Es war unmöglich, sagt Leibniz, daß Gott dem Menschen alle Vollkommenheit mittheilte, ohne ihn selbst zum Gott zu machen; das Nämliche gilt von den geschaffenen Wesen überhaupt; es mußten darum verschiedene Grade der Vollkommenheit und alle Arten der Einschränkung derselben stattfinden. Fragt man, woher das Böse kommt, so ist die Antwort: aus der idealen Natur der Creatur, sofern sie von den ewigen Wahrheiten, die im göttlichen Verstande enthalten sind, nicht aber von dem Willen Gottes abhängt. Die Region der ewigen Wahrheiten ist die ideelle Ursache des Bösen und Guten, und muß an die Stelle der Materie der Alten gesetzt werden 16). Es gibt, sagt er an einer andern Stelle, allerdings zwei Principien, aber beide in Gott, diese sind der Verstand und der Wille. Der Verstand gibt das Princip des Bösen her, ob er schon dadurch nicht selbst böse wird; denn er stellt die Naturen so vor, wie sie nach den ewigen Wahrheiten sind; er enthält in sich den Grund der Zulassung des Bösen, aber der Wille geht allein auf das Gute 17). Diese einzige Möglichkeit hat Gott nicht gemacht, da der Verstand nicht seine eigne Ursache ist 18). Wenn diese Unterscheidung des Verstandes und Willens als zweier Principien in Gott, wodurch die erste Möglichkeit des Bösen vom göttlichen Willen unabhängig gemacht wird, der sinnreichen Art dieses Mannes gemäß ist, und wenn auch die Vorstellung des Verstandes (der göttlichen Weisheit) als etwas, worin sich Gott selbst eher leidend als thätig verhält, auf etwas Tieferes hindeutet, so läuft das Böse, was aus jenem lediglich idealen Grunde abstammen kann, dagegen auch wieder auf etwas bloß Passives, auf Einschränkung, Mangel, Beraubung hinaus, Begriffe, die der eigentlichen Natur des Bösen völlig widerstreiten. Denn schon die einfache Ueberlegung, daß es der Mensch, die vollkommenste aller sichtbaren Creaturen ist, der des Bösen allein fähig ist, zeigt, daß der Grund desselben keineswegs in Mangel oder Beraubung liegen könne. Der Teufel nach der christlichen Ansicht war nicht die limitirteste Creatur, sondern vielmehr die illimitirteste 19). Unvollkommenheiten im allgemeinen metaphysischen Sinn ist nicht der gewöhnliche Charakter des Bösen, da es sich oft mit einer Vortrefflichkeit der einzelnen Kräfte vereinigt zeigt, die viel seltener das Gute begleitet. Der Grund des Bösen muß also nicht nur in etwas Positivem überhaupt, sondern eher in dem höchsten Positiven liegen, das die Natur enthält, wie es nach unserer Ansicht allerdings der Fall ist, da er in dem offenbar gewordenen Centrum oder Urwillen des ersten Grundes liegt. Leibniz versucht auf jede Weise begreiflich zu machen, wie aus einem natürlichen Mangel das Böse entstehen könne. Der Wille, sagt er, strebt nach dem Guten im Allgemeinen und muß nach Vollkommenheit verlangen, deren höchstes Maß in Gott ist; wenn er aber in den Wollüsten der Sinne mit Verlust höherer Güter verstrickt bleibt, so ist eben dieser Mangel des Weiterstrebens die Privation, in welcher das Böse besteht. Sonst, meint er, das Böse bedürfe so wenig eines besonderen Princips als die Kälte oder Finsterniß. Was im Bösen Bejahendes sey, komme nur begleitungsweise in dasselbe, wie Kraft und Wirksamkeit in die Kälte; frierendes Wasser zersprenge das stärkste einschließende Gefäß und doch bestehe Kälte eigentlich in einer Verminderung von Bewegung 20). Weil indes die Beraubung für sich gar nichts ist, und, selbst um bemerklich zu werden, eines Positiven bedarf, an dem sie erscheint, so entsteht nun die Schwierigkeit, das Positive zu erklären, welches dennoch im Bösen angenommen werden muß. Da Leibniz dasselbe nur von Gott herleiten kann, so sieht er sich genötigt, Gott zur Ursache des Materialen der Sünde zu machen, und nur das Formelle derselben der ursprünglichen Einschränkung der Creatur zuzuschreiben. Er sucht dieß Verhältniß durch den von Kepler gefundenen Begriff der natürlichen Trägheitskraft der Materie zu erläutern. Es sey diese, sagt er, das vollkommene Bild einer ursprünglichen (allem Handeln vorangehenden) Einschränkung der Creatur. Wenn durch den nämlichen Antrieb zwei verschiedene Körper von ungleicher Masse mit ungleichen Geschwindigkeiten bewegt werden, so liegt der Grund der Langsamkeit der Bewegung des einen nicht in dem Antrieb, sondern in dem der Materie angeborenen und eigentümlichen Hang zur Trägheit, d.h. in der innern Limitation oder Unvollkommenheit der Materie 21). Hierbei ist aber zu bemerken, daß die Trägheit selbst als keine bloße Beraubung gedacht werden kann, sondern allerdings etwas Positives ist, nämlich Ausdruck der innern Selbstheit des Körpers, der Kraft, wodurch er sich in der Selbständigkeit zu behaupten sucht. Wir leugnen nicht, daß auf diese Art die metaphysische Endlichkeit sich begreiflich machen lasse; aber wir leugnen, daß die Endlichkeit für sich selbst das Böse sey 22). Es entspringt diese Erklärungsart überhaupt aus dem unlebendigen Begriff des Positiven, nach welchem ihm nur die Beraubung entgegenstehen kann. Allein es gibt noch einen mittleren Begriff, der einen reellen Gegensatz desselben bildet und von dem Begriff des bloß Verneinten weit absteht. Dieser entspringt aus dem Verhältniß des Ganzen zum Einzelnen, der Einheit zur Vielheit, oder wie man es ausdrücken will. Das Positive ist immer das Ganze oder die Einheit; das ihm Entgegenstehende ist Zertrennung des Ganzen, Disharmonie, Ataxie, der Kräfte. In dem zertrennten Ganzen sind die nämlichen Elemente, die in dem einigen Ganzen waren; das Materiale in beiden ist dasselbe (von dieser Seite ist das Böse nicht limitirter oder schlechter als das Gute), aber das Formale in beiden ist ganz verschieden, dieses Formale aber kommt eben von dem Wesen oder Positiven selber her. Daher nothwendig im Bösen, wie im Guten, ein Wesen seyn muß, aber in jenem ein dem Guten entgegengesetztes, das die in ihm enthaltene Temperatur in Distemperatur verkehrt. Dieses Wesen zu erkennen, ist der dogmatischen Philosophie unmöglich, weil sie keinen Begriff der Persönlichkeit, d.h. der zur Geistigkeit erhobenen Selbstheit, sondern nur die abgezogenen Begriffe des Endlichen und des Unendlichen hat. Wollte daher jemand erwidern, daß ja eben die Disharmonie eine Privation sey, nämlich eine Beraubung der Einheit, so wäre, wenn selbst im allgemeinen Begriff der Beraubung der von Aufhebung oder Trennung der Einheit enthalten wäre, der Begriff dennoch an sich ungenügend. Denn es ist nicht die Trennung der Kräfte an sich Disharmonie, sondern die falsche Einheit derselben, die nur beziehungsweise auf die wahre eine Trennung heißen kann. Wird die Einheit ganz aufgehoben, so wird eben damit der Widerstreit aufgehoben. Krankheit wird durch den Tod geendigt, und kein einzelner Ton für sich macht eine Disharmonie aus. Aber eben jene falsche Einheit zu erklären, bedarf es etwas Positives, welches sonach im Bösen nothwendig angenommen werden muß, aber so lange unerklärbar bleiben wird, als nicht eine Wurzel der Freiheit in dem unabhängigen Grunde der Natur erkannt ist. Von der Platonischen Ansicht, soweit wir sie beurtheilen können, wird besser bei der Frage der Wirklichkeit des Bösen die Rede seyn. Die Vorstellungen unseres über diesen Punkt bei weitem leichteren und den Philanthropismus bis zur Leugnung des Bösen treibenden Zeitalters stehen mit solchen Ideen nicht in der entferntesten Verbindung. Jenen zufolge liegt der einzige Grund des Bösen in der Sinnlichkeit, oder in der Animalität, oder dem irdischen Princip, indem sie dem Himmel nicht, wie sich gebührte, die Hölle, sondern die Erde entgegensetzen. Diese Vorstellung ist eine natürliche Folge der Lehre, nach welcher die Freiheit in der bloßen Herrschaft des intelligenten Princips über die sinnlichen Begierden und Neigungen besteht, und das Gute aus reiner Vernunft kommt, wonach es begreiflicherweise für das Böse keine Freiheit gibt (indem hier die sinnlichen Neigungen vorherrschen); richtiger zu reden aber das Böse völlig aufgehoben wird. Denn die Schwäche oder Nichtwirksamkeit des verständigen Princips kann zwar ein Grund des Mangels guter und tugendhafter Handlungen seyn, nicht aber ein Grund positiv-böser und tugendwidriger. Gesetzt aber, die Sinnlichkeit oder das leidende Verhalten gegen äußere Eindrücke brächte mit einer Art von Nothwendigkeit böse Handlungen hervor, so wäre der Mensch in diesen doch selbst nur leidend, d.h. das Böse hätte in Ansehung seiner, also subjektiv, keine Bedeutung, und da das, was aus einer Bestimmung der Natur folgt, objektiv auch nicht böse seyn kann, hätte es überhaupt keine Bedeutung. Daß aber gesagt wird, das vernünftige Princip sey im Bösen unwirksam, ist auch an sich kein Grund. Denn warum übt es denn seine Macht nicht aus? Will es unwirksam seyn, so liegt der Grund des Bösen in diesem Willen, und nicht in der Sinnlichkeit. Oder kann es die widerstrebende Macht der letzten auf keine Art überwinden, so ist hier bloß Schwäche und Mangel, aber nirgends ein Böses. Es gibt daher nach dieser Erklärung nur Einen Willen (wenn er anders so heißen kann), keinen zweifachen, und man könnte in dieser Hinsicht die Anhänger derselben, nachdem bereits die Namen der Arianer u. a. mit Glück in die philosophische Kritik eingeführt sind, mit einem ebenfalls aus der Kirchengeschichte, jedoch in einem andern Sinne genommenen, Namen die Monotheleten nennen. Wie es aber keineswegs das intelligente oder Lichtprinzip an sich, sondern das mit Selbstheit verbundene, d.h. zu Geist erhobene, ist, was im Guten wirkt, ebenso folgt das Böse nicht aus dem Princip der Endlichkeit für sich, sondern aus dem zur Intimität mit dem Centro gebrachten finstern oder selbstischen Princip; und wie es einen Enthusiasmus zum Guten gibt, ebenso gibt es eine Begeisterung des Bösen. Im Thier, wie in jedem andern Naturwesen, ist zwar auch jenes dunkle Princip wirksam; aber es ist in ihm noch nicht ins Licht geboren, wie im Menschen, es ist nicht Geist und Verstand, sondern blinde Sucht und Begierde; kurz, es ist hier kein Abfall möglich, keine Trennung der Principien, wo noch keine absolute oder persönliche Einheit ist. Bewußtloses und Bewußtes sind im thierischen Instinkt nur auf eine gewisse und bestimmte Weise vereinigt, die eben darum inalterabel ist. Denn gerade deshalb, weil sie nur relative Ausdrücke der Einheit sind, stehen sie unter dieser, und es erhält die im Grunde wirkende Kraft die ihnen zukommende Einheit der Principien in immer gleichem Verhältniß. Nie kann das Thier aus der Einheit heraustreten, anstatt daß der Mensch das ewige Band der Kräfte willkürlich zerreißen kann. Daher Fr. Baader mit Recht sagt, es wäre zu wünschen, daß die Verderbtheit im Menschen nur bis zur Thierwerdung ginge; leider aber könne der Mensch nur unter oder über dem Thiere stehen 23). Wir haben den Begriff und die Möglichkeit des Bösen aus den ersten Gründen herzuleiten und das allgemeine Fundament dieser Lehre aufzudecken gesucht, das in der Unterscheidung liegt zwischen dem Existirenden und dem, was Grund von Existenz ist 24). Aber die Möglichkeit schließt noch nicht die Wirklichkeit ein, und diese eigentlich ist der größte Gegenstand der Frage. Und zwar ist zu erklären nicht etwa, wie das Böse nur im einzelnen Menschen wirklich werde, sondern seine universelle Wirksamkeit, oder wie es als ein unverkennbar allgemeines, mit dem Guten überall im Kampf liegendes Princip aus der Schöpfung habe hervorbrechen können. Da es unleugbar, wenigstens als allgemeiner Gegensatz, wirklich ist, so kann zwar zum voraus kein Zweifel seyn, daß es zur Offenbarung Gottes nothwendig gewesen; eben dieses ergibt sich auch aus dem früher Gesagten. Denn wenn Gott als Geist die unzertrennliche Einheit beider Principien ist, und dieselbe Einheit nur im Geist des Menschen wirklich ist, so würde, wenn sie in diesem ebenso unauflöslich wäre als in Gott, der Mensch von Gott gar nicht unterschieden seyn; er ginge in Gott auf, und es wäre keine Offenbarung und Beweglichkeit der Liebe. Denn jedes Wesen kann nur in seinem Gegentheil offenbar werden, Liebe nur in Haß, Einheit in Streit. Wäre keine Zertrennung der Principien, so könnte die Einheit ihre Allmacht nicht erweisen; wäre nicht Zwietracht, so könnte die Liebe nicht wirklich werden. Der Mensch ist auf jenen Gipfel gestellt, wo er die Selbstbewegungsquelle zum Guten und Bösen gleicherweise in sich hat: das Band der Principien in ihm ist kein nothwendiges, sondern ein freies. Er steht am Scheidepunkt; was er auch wähle, es wird seine That seyn, aber er kann nicht in der Unentschiedenheit bleiben, weil Gott nothwendig sich offenbaren muß, und weil in der Schöpfung überhaupt nichts Zweideutiges bleiben kann. Dennoch scheint es, er könne auch nicht aus seiner Unentschiedenheit heraustreten, eben weil sie dieß ist. Es muß daher ein allgemeiner Grund der Sollizitation, der Versuchung zum Bösen seyn, wäre es auch nur, um die beiden Principien in ihm lebendig, d.h. um ihn ihrer bewußt zu machen. Nun scheint die Sollizitation zum Bösen selbst nur von einem bösen Grundwesen herkommen zu können, und die Annahme eines solchen dennoch unvermeidlich, auch ganz richtig jene Auslegung der Platonischen Materie zu seyn, nach welcher sie ein ursprünglich Gott widerstrebendes und darum an sich böses Wesen ist. Solange dieser Theil der Platonischen Lehre im bisherigen Dunkel liegt 25), ist ein bestimmtes Urtheil über den angegebenen Punkt zwar unmöglich. In welchem Sinne jedoch von dem irrationalen Princip gesagt werden könne, daß es dem Verstande oder der Einheit und Ordnung widerstrebe, ohne es deswegen als böses Grundwesen anzunehmen, ist aus den früheren Betrachtungen einleuchtend. So läßt sich auch das Platonische Wort wohl erklären, das Böse komme aus der alten Natur; denn alles Böse strebt in das Chaos, d.h. in jenen Zustand zurück, wo das anfängliche Centrum noch nicht dem Licht untergeordnet war, und ist ein Aufwallen des Centri der noch verstandlosen Sehnsucht. Allein wir haben ein für allemal bewiesen, daß das Böse, als solches, nur in der Creatur entspringen könne, indem nur in dieser Licht und Finsterniß oder die beiden Principien auf zertrennliche Weise vereinigt seyn können. Das anfängliche Grundwesen kann nie an sich böse seyn, da in ihm keine Zweiheit der Principien ist. Wir können aber auch nicht etwa einen geschaffenen Geist voraussetzen, der, selbst abgefallen, den Menschen zum Abfall sollizitirte; denn eben wie zuerst das Böse in einer Creatur entsprungen, ist hier die Frage. Es ist uns daher auch zur Erklärung des Bösen nichts gegeben außer den beiden Principien in Gott. Gott als Geist (das ewige Band beider) ist die reinste Liebe, in der Liebe aber kann nie ein Willen zum Bösen seyn: ebensowenig auch in dem idealen Princip. Aber Gott selbst, damit er seyn kann, bedarf eines Grundes, nur daß dieser nicht außer ihm, sondern in ihm ist, und hat in sich eine Natur, die, obgleich zu ihm selbst gehörig, doch von ihm verschieden ist. Der Wille der Liebe und der Wille des Grundes sind zwei verschiedene Willen, deren jeder für sich ist; aber der Wille der Liebe kann dem Willen des Grundes nicht widerstehen, noch ihn aufheben, weil er sonst sich selbst widerstreben müßte. Denn der Grund muß wirken, damit die Liebe seyn könne, und er muß unabhängig von ihr wirken, damit sie reell existire. Wollte nun die Liebe den Willen des Grundes zerbrechen, so würde sie gegen sich selbst streiten, mit sich selbst uneins seyn, und wäre nicht mehr die Liebe. Dieses Wirkenlassen des Grundes ist der einzig denkbare Begriff der Zulassung, welcher in der gewöhnlichen Beziehung auf den Menschen völlig unstatthaft ist. So kann freilich der Wille des Grundes auch die Liebe nicht zerbrechen, noch verlangt er dieses, ob es gleich oft so scheint; denn er muß, von der Liebe abgewandt, ein eigner und besonderer Wille seyn, damit nun die Liebe, wenn sie dennoch durch ihn wie das Licht durch die Finsterniß hindurchbricht, in ihrer Allmacht erscheine. Der Grund ist nur ein Willen zur Offenbarung, aber eben, damit diese sey, muß er die Eigenheit und den Gegensatz hervorrufen. Der Wille der Liebe und der des Grundes werden also gerade dadurch eins, daß sie geschieden sind, und vor Anbeginn jeder für sich wirkt. Daher der Wille des Grundes gleich in der ersten Schöpfung den Eigenwillen der Creatur mit erregt, damit, wenn nun der Geist als der Wille der Liebe aufgeht, dieser ein Widerstrebendes finde, darin er sich verwirklichen könne. Der Anblick der ganzen Natur überzeugt uns von dieser geschehenen Erregung, durch welche alles Leben erst den letzten Grad der Schärfe und der Bestimmtheit erlangt hat. Das Irrationale und Zufällige, das in der Formation der Wesen, besonders der organischen, mit dem Nothwendigen sich verbunden zeigt, beweist, daß es nicht bloß eine geometrische Nothwendigkeit ist, die hier gewirkt hat, sondern daß Freiheit, Geist und Eigenwille mit im Spiel waren. Zwar überall, wo Lust und Begierde, ist schon an sich eine Art der Freiheit, und niemand wird glauben, daß die Begierde, die den Grund jedes besondern Naturlebens ausmacht, und der Trieb, sich nicht nur überhaupt, sondern in diesem bestimmten Daseyn zu erhalten, zu dem schon erschaffenen Geschöpf erst hinzugekommen sey, sondern vielmehr, daß sie das Schaffende selber gewesen. Auch der durch Empirie aufgefundene Begriff der Basis, der eine bedeutende Rolle für die ganze Naturwissenschaft übernehmen wird, muß, wissenschaftlich gewürdigt, auf den Begriff der Selbstheit und Ichheit führen. Aber es sind in der Natur zufällige Bestimmungen, die nur aus einer gleich in der ersten Schöpfung geschehenen Erregung des irrationalen oder finstern Princips der Creatur - nur aus aktivirter Selbstheit erklärlich sind. Woher in der Natur, neben den präformirten sittlichen Verhältnissen, unverkennbare Vorzeichen des Bösen, wenn doch die Macht desselben erst durch den Menschen erregt worden; woher Erscheinungen, die auch ohne Rücksicht auf ihre Gefährlichkeit für den Menschen dennoch einen allgemeinen Abscheu erregen. 26) Daß alle organischen Wesen der Auflösung entgegengehen, kann durchaus als keine ursprüngliche Nothwendigkeit erscheinen; das Band der Kräfte, welche das Leben ausmachen, könnte seiner Natur nach ebensowohl unauflöslich seyn, und wenn irgend etwas, scheint ein Geschöpf, welches das fehlerhaft Gewordene in sich durch eigne Kräfte wieder ergänzt, dazu bestimmt, ein Perpetuum mobile zu seyn. Das Böse inzwischen kündigt sich in der Natur nur durch seine Wirkung an; es selbst, in seiner unmittelbaren Erscheinung, kann erst am Ziel der Natur hervorbrechen. Denn wie in der anfänglichen Schöpfung, welche nichts anderes als die Geburt des Lichts ist, das finstere Princip als Grund seyn mußte, damit das Licht aus ihm (als aus der bloßen Potenz zum Aktus) erhoben werden könnte: so muß ein anderer Grund der Geburt des Geistes, und daher ein zweites Princip der Finsterniß seyn, das um so viel höher seyn muß, als der Geist höher ist denn das Licht. Dieses Princip ist eben der in der Schöpfung durch Erregung des finstern Naturgrundes erweckte Geist des Bösen, d.h. der Entzweiung von Licht und Finsterniß, welchem der Geist der Liebe, wie vormals der regellosen Bewegung der anfänglichen Natur das Licht, so jetzt ein höheres Ideales entgegensetzt. Denn wie die Selbstheit im Bösen das Licht oder Wort sich eigen gemacht hat, und darum eben als ein höherer Grund der Finsterniß erscheint: so muß das im Gegensatz mit dem Bösen in die Welt gesprochene Wort die Menschheit oder Selbstheit annehmen, und selber persönlich werden. Dieß geschieht allein durch die Offenbarung, im bestimmtesten Sinne des Worts, welche die nämlichen Stufen haben muß wie die erste Manifestation in der Natur, so nämlich, daß auch hier der höchste Gipfel der Offenbarung, der Mensch, aber der urbildliche und göttliche Mensch ist, derjenige, der im Anfang bei Gott war, und in dem alle anderen Dinge und der Mensch selbst geschaffen sind. Die Geburt des Geistes ist das Reich der Geschichte, wie die Geburt des Lichtes das Reich der Natur ist. Dieselben Perioden der Schöpfung, die in diesem sind, sind auch in jenem; und eines ist des anderen Gleichniß und Erklärung. Das nämliche Princip, das in der ersten Schöpfung der Grund war, nur in einer höheren Gestalt, ist auch hier wieder Keim und Samen, aus dem eine höhere Welt entwickelt wird. Denn das Böse ist ja nichts anderes als der Urgrund zur Existenz, inwiefern er im erschaffenen Wesen zur Aktualisirung strebt, und also in der That nur die höhere Potenz des in der Natur wirkenden Grundes. Wie aber dieser ewig nur Grund ist, ohne selbst zu seyn, ebenso kann das Böse nie zur Verwirklichung gelangen, und dient bloß als Grund, damit aus ihm das Gute durch eigne Kraft sich herausbildend, ein durch seinen Grund von Gott Unabhängiges und Geschiedenes sey, in dem dieser sich selbst habe und erkenne, und das als ein solches (als ein Unabhängiges) in ihm sey. Wie aber die ungetheilte Macht des anfänglichen Grundes erst im Menschen als Inneres (Basis oder Centrum) eines Einzelnen erkannt wird, so bleibt auch in der Geschichte das Böse anfangs noch im Grunde verborgen, und dem Zeitalter der Schuld und Sünde geht eine Zeit der Unschuld oder der Bewußtlosigkeit über die Sünde voran. Auf dieselbe Art nämlich, wie der anfängliche Grund der Natur vielleicht lange zuvor allein wirkte und mit den göttlichen in ihm enthaltenen Kräften eine Schöpfung für sich versuchte, die aber immer wieder (weil das Band der Liebe fehlte) zuletzt in das Chaos zurücksank (wohin vielleicht die vor der jetzigen Schöpfung untergegangenen und nicht wiedergekommenen Reihen von Geschlechtern deuten), bis das Wort der Liebe erging, und mit ihm die dauernde Schöpfung ihren Anfang nahm: so hat sich auch in der Geschichte der Geist der Liebe nicht alsbald geoffenbaret; sondern weil Gott den Willen des Grundes als den Willen zu seiner Offenbarung empfand, und nach seiner Fürsehung erkannte, daß ein von ihm (als Geist) unabhängiger Grund zu seiner Existenz seyn müsse, ließ er den Grund in seiner Independenz wirken, oder, anders zu reden, Er selbst bewegte sich nur nach seiner Natur und nicht nach seinem Herzen oder der Liebe. Weil nun der Grund auch in sich das ganze göttliche Wesen, nur nicht als Einheit, enthielt, so konnten es nur einzelne göttliche Wesen seyn, die in diesem für-sich-Wirken des Grundes walteten. Diese uralte Zeit fängt daher mit dem goldnen Weltalter an, von welchem dem jetzigen Menschengeschlecht nur in der Sage die schwache Erinnerung geblieben, einer Zeit seliger Unentschiedenheit, wo weder Gutes noch Böses war; dann folgte die Zeit der waltenden Götter und Heroen, oder der Allmacht der Natur, in welcher der Grund zeigte, was er für sich vermöchte. Damals kam den Menschen Verstand und Weisheit allein aus der Tiefe; die Macht erdentquollener Orakel leitete und bildete ihr Leben; alle göttlichen Kräfte des Grundes herrschten auf der Erde und saßen als mächtige Fürsten auf sichern Thronen. Es erschien die Zeit der höchsten Verherrlichung der Natur in der sichtbaren Schönheit der Götter und allem Glanz der Kunst und sinnreicher Wissenschaft, bis das im Grunde wirkende Princip endlich als welteroberndes Princip hervortrat, sich alles zu unterwerfen und ein festes und dauerndes Weltreich zu gründen. Weil aber das Wesen des Grundes für sich nie die wahre und vollkommene Einheit erzeugen kann, so kommt die Zeit, wo alle diese Herrlichkeit sich auflöst, und wie durch schreckliche Krankheit der schöne Leib der bisherigen Welt zerfällt, endlich das Chaos wieder eintritt. Schon zuvor, und ehe noch der gänzliche Zerfall da ist, nehmen die in jenem Ganzen waltenden Mächte die Natur böser Geister an, wie die nämlichen Kräfte, die zur Zeit der Gesundheit wohlthätige Schutzgeister des Lebens waren, bei herannahender Auflösung bösartiger und giftiger Natur werden: der Glaube an Götter verschwindet, und eine falsche Magie sammt Beschwörungen und theurgischen Formeln strebt die entfliehenden zurückzurufen, die bösen Geister zu besänftigen. Immer bestimmter zeigt sich das Anziehen des Grundes, der, das kommende Licht vorempfindend, schon zum voraus alle Kräfte aus der Unentschiedenheit setzt, um ihm in vollem Widerstreit zu begegnen. Wie das Gewitter mittelbar durch die Sonne, unmittelbar aber durch eine gegenwirkende Kraft der Erde erregt wird, so der Geist des Bösen (dessen meteorische Natur wir schon früher erklärt haben) durch die Annäherung des Guten, nicht vermöge einer Mittheilung, sondern vielmehr durch Vertheilung der Kräfte. Daher erst mit der entschiedenen Hervortretung des Guten auch das Böse ganz entschieden und als dieses hervortritt (nicht als entstünde es erst, sondern weil nun erst der Gegensatz gegeben ist in dem es allein ganz und als solches erscheinen kann); wie hinwiederum eben der Moment, wo die Erde zum zweitenmal wüst und leer wird, der Moment der Geburt des höheren Lichts des Geistes wird, das von Anbeginn in der Welt war, aber unbegriffen von der für sich wirkenden Finsterniß und in annoch verschlossener und eingeschränkter Offenbarung; und zwar erscheint es, um dem persönlichen und geistigen Bösen entgegenzutreten, ebenfalls in persönlicher, menschlicher Gestalt und als Mittler, um den Rapport der Schöpfung mit Gott auf der höchsten Stufe wiederherzustellen. Denn nur Persönliches kann Persönliches heilen, und Gott muß Mensch werden, damit der Mensch wieder zu Gott komme. Mit der hergestellten Beziehung des Grundes auf Gott ist erst die Möglichkeit der Heilung (des Heils) wiedergegeben. Ihr Anfang ist ein Zustand des Hellsehens, der durch göttliches Verhängniß auf einzelne Menschen (als hierzu auserwählte Organe) fällt, eine Zeit der Zeichen und Wunder, in welcher göttliche Kräfte den überall hervortretenden dämonischen, die besänftigende Einheit der Vertheilung der Kräfte entgegenwirkt. Endlich erfolgte die Krisis in der Turba gentium, die den Grund der alten Welt überströmen, wie einst die Wasser des Anfangs die Schöpfungen der Urzeit wieder bedeckten, um eine zweite Schöpfung möglich zu machen - eine neue Scheidung der Völker und Zungen, ein neues Reich, in welchem das lebendige Wort als ein festes und beständiges Centrum im Kampf gegen das Chaos eintritt, und ein erklärter, bis zum Ende der jetzigen Zeit fortdauernder Streit des Guten und des Bösen anfängt, in welchem eben Gott als Geist, d.h. als actu wirklich sich offenbart 27). Es gibt daher ein allgemeines, wenn gleich nicht anfängliches, sondern erst in der Offenbarung Gottes von Anfang, durch Reaktion des Grundes, erwecktes Böses, das zwar nie zur Verwirklichung kommt, aber beständig dahin strebt. Erst nach Erkenntniß des allgemeinen Bösen ist es möglich, Gutes und Böses auch im Menschen zu begreifen. Wenn nämlich bereits in der ersten Schöpfung das Böse mit erregt und durch das für-sich-Wirken des Grundes endlich zum allgemeinen Princip entwickelt worden, so scheint ein natürlicher Hang des Menschen zum Bösen schon dadurch erklärbar, weil die einmal durch Erweckung des Eigenwillens in der Creatur eingetretene Unordnung der Kräfte ihm schon in der Geburt sich mittheilt. Allein es wirkt der Grund auch im einzelnen Menschen unablässig fort und erregt die Eigenheit und den besonderen Willen, eben damit im Gegensatz mit ihm der Wille der Liebe aufgehen könne. Gottes Wille ist, alles zu universalisiren, zur Einheit mit dem Licht zu erheben, oder darin zu erhalten; der Wille des Grundes aber, alles zu particularisiren oder creatürlich zu machen. Er will die Ungleichheit allein, damit die Gleichheit sich und ihm selbst empfindlich werde. Darum reagirt er nothwendig gegen die Freiheit als das Uebercreatürliche und erweckt in ihr die Lust zum Creatürlichen, wie den, welchen auf einem hohen und jähen Gipfel Schwindel erfaßt, gleichsam eine geheime Stimme zu rufen scheint, daß er herabstürze, oder wie nach der alten Fabel unwiderstehlicher Sirenengesang aus der Tiefe erschallt, um den Hindurchschiffenden in den Strudel hinabzuziehen. Schon an sich scheint die Verbindung des allgemeinen Willens mit einem besondern Willen im Menschen ein Widerspruch, dessen Vereinigung schwer, wenn nicht unmöglich ist. Die Angst des Lebens selbst treibt den Menschen aus dem Centrum, in das er erschaffen worden; denn dieses als das lauterste Wesen alles Willens ist für jeden besondern Willen verzehrendes Feuer; um in ihm leben zu können, muß der Mensch aller Eigenheit absterben, weshalb es ein fast nothwendiger Versuch ist, aus diesem in die Peripherie herauszutreten, um da eine Ruhe seiner Selbstheit zu suchen. Daher die allgemeine Nothwendigkeit der Sünde und des Todes, als des wirklichen Absterbens der Eigenheit, durch welches aller menschlicher Wille als ein Feuer hindurchgehen muß, um geläutert zu werden. Dieser allgemeinen Nothwendigkeit unerachtet bleibt das Böse immer die eigne Wahl des Menschen; das Böse, als solches, kann der Grund nicht machen, und jede Creatur fällt durch ihre eigne Schuld. Aber eben wie nun im einzelnen Menschen die Entscheidung für Böses oder Gutes vorgehe, dieß ist noch in gänzliches Dunkel gehüllt, und scheint eine besondere Untersuchung zu erfordern. Wir haben überhaupt bis jetzt das formelle Wesen der Freiheit weniger ins Auge gefaßt, obgleich die Einsicht in dasselbe mit nicht geringeren Schwierigkeiten verbunden scheint als die Erklärung ihres realen Begriffs. Denn der gewöhnliche Begriff der Freiheit, nach welchem sie in ein völlig unbestimmtes Vermögen gesetzt wird, von zwei kontradiktorisch Entgegengesetzten, ohne bestimmende Gründe, das eine oder das andere zu wollen, schlechthin bloß, weil es gewollt wird, hat zwar die ursprüngliche Unentschiedenheit des menschlichen Wesens in der Idee für sich, führt aber, angewendet auf die einzelne Handlung, zu den größten Ungereimtheiten. Sich ohne alle bewegende Gründe für A oder -A entscheiden zu können, wäre, die Wahrheit zu sagen, nur ein Vorrecht, ganz unvernünftig zu handeln, und würde den Menschen von dem bekannten Thier des Buridan, das nach der Meinung der Verteidiger dieses Begriffes der Willkür zwischen zwei Haufen Heu von gleicher Entfernung, Größe und Beschaffenheit verhungern müßte (weil es nämlich jenes Vorrecht der Willkür nicht hat), eben nicht auf die vorzüglichste Weise unterscheiden. Der einzige Beweis für diesen Begriff besteht in dem Berufen auf die Thatsache, indem es z.B. jeder in seiner Gewalt habe, seinen Arm jetzt anzuziehen oder auszustrecken, ohne weitem Grund; denn wenn man sage, er strecke ihn, eben um seine Willkür zu beweisen, so könnte er ja dieß ebensogut, indem er ihn anzöge; das Interesse, den Satz zu beweisen, könne ihn nur bestimmen, eins von beiden zu thun; hier sey also das Gleichgewicht handgreiflich usw.; eine überall schlechte Beweisart, indem sie von dem Nichtwissen des bestimmenden Grundes auf das Nichtdaseyn schließt, die aber hier gerade umgekehrt anwendbar wäre; denn eben, wo das Nichtwissen eintritt, findet um so gewisser das Bestimmtwerden statt. Die Hauptsache ist, daß dieser Begriff eine gänzliche Zufälligkeit der einzelnen Handlungen einführt und in diesem Betracht sehr richtig mit der zufälligen Abweichung der Atomen verglichen worden ist, die Epikurus in der Physik in gleicher Absicht ersann, nämlich dem Fatum zu entgehen. Zufall aber ist unmöglich, widerstreitet der Vernunft wie der nothwendigen Einheit des Ganzen; und wenn Freiheit nicht anders als mit der gänzlichen Zufälligkeit der Handlungen zu retten ist, so ist sie überhaupt nicht zu retten. Es setzt sich diesem System des Gleichgewichts der Willkür, und zwar mit vollem Fug, der Determinismus (oder nach Kant Prädeterminismus) entgegen, indem er die empirische Nothwendigkeit aller Handlungen aus dem Grunde behauptet, weil jede derselben durch Vorstellungen oder andere Ursachen bestimmt sey, die in einer vergangenen Zeit liegen, und die bei der Handlung selbst nicht mehr in unserer Gewalt stehen. Beide Systeme gehören dem nämlichen Standpunkt an; nur daß, wenn es einmal keinen höheren gäbe, das letzte unleugbar den Vorzug verdiente. Beiden gleich unbekannt ist jene höhere Nothwendigkeit, die gleichweit entfernt ist von Zufall als Zwang oder äußerem Bestimmtwerden, die vielmehr eine innere, aus dem Wesen des Handelnden selbst quellende Nothwendigkeit ist. Alle Verbesserungen aber, die man bei dem Determinismus anzubringen suchte, z.B. die Leibnizische, daß die bewegenden Ursachen den Willen doch nur inkliniren, aber nicht bestimmen, helfen in der Hauptsache gar nichts. Ueberhaupt erst der Idealismus hat die Lehre von der Freiheit in dasjenige Gebiet erhoben, wo sie allein verständlich ist. Das intelligible Wesen jedes Dings, und vorzüglich des Menschen, ist diesem zufolge außer allem Kausalzusammenhang, wie außer oder über aller Zeit. Es kann daher nie durch irgend etwas Vorhergehendes bestimmt seyn, indem es selbst vielmehr allem andern, das in ihm ist oder wird, nicht sowohl der Zeit, als dem Begriff nach als absolute Einheit vorangeht, die immer schon ganz und vollendet da seyn muß, damit die einzelne Handlung oder Bestimmung in ihr möglich sey. Wir drücken nämlich den Kantischen Begriff nicht eben genau mit seinen Worten, aber doch so aus, wie wir glauben, daß er, um verständlich zu seyn, ausgedrückt werden müsse. Wird aber dieser Begriff angenommen, so scheint auch Folgendes richtig geschlossen zu werden. Die freie Handlung folgt unmittelbar aus dem Intelligibeln des Menschen. Aber sie ist nothwendig eine bestimmte Handlung, z.B. um das Nächste anzuführen, eine gute oder böse. Vom absolut-Unbestimmten zum Bestimmten gibt es aber keinen Uebergang. Das etwa das intelligible Wesen aus purer lauterer Unbestimmtheit heraus ohne allen Grund sich selbst bestimmen sollte, führt auf das obige System der Gleichgültigkeit der Willkür zurück. Um sich selbst bestimmen zu können, müßte es in sich schon bestimmt seyn, nicht von außen freilich, welches seiner Natur widerspricht, auch nicht von innen durch irgend eine bloß zufällige oder empirische Nothwendigkeit, indem dieß alles (das Psychologische so gut wie das Physische) unter ihm liegt; sondern es selber als sein Wesen, d.h. seine eigne Natur, müßte ihm Bestimmung seyn. Es ist ja kein unbestimmtes Allgemeines, sondern bestimmt das intelligible Wesen dieses Menschen; von einer solchen Bestimmtheit gilt der Spruch: Determinato est negatio, keineswegs, indem sie mit der Position und dem Begriff des Wesens selber eins, also eigentlich das Wesen in dem Wesen ist. Das intelligible Wesen kann daher, so gewiß es schlechthin frei und absolut handelt, so gewiß nur seiner eignen innern Natur gemäß handeln, oder die Handlung kann aus seinem Innern nur nach dem Gesetz der Identität und mit absoluter Nothwendigkeit folgen, welche allein auch die absolute Freiheit ist; denn frei ist, was nur den Gesetzen seines eignen Wesens gemäß handelt und von nichts anderem weder in noch außer ihm bestimmt ist. Es ist mit dieser Vorstellung der Sache wenigstens Eines gewonnen, daß die Ungereimtheit des Zufälligen der einzelnen Handlung entfernt ist. Dieß muß feststehen, auch in jeder höheren Ansicht, daß die einzelne Handlung aus innerer Nothwendigkeit des freien Wesens, und demnach selbst mit Nothwendigkeit erfolgt, die nur nicht, wie noch immer geschieht, mit der empirischen auf Zwang beruhenden (die aber selber nur verhüllte Zufälligkeit ist) verwechselt werden muß. Aber was ist denn jene innere Nothwendigkeit des Wesens selber? Hier liegt der Punkt, bei welchem Nothwendigkeit und Freiheit vereinigt werden müssen, wenn sie überhaupt vereinbar sind. Wäre jenes Wesen ein todtes Seyn und in Ansehung des Menschen ein ihm bloß gegebenes, so wäre, da die Handlung aus ihm nur mit Nothwendigkeit folgen kann, die Zurechnungsfähigkeit und alle Freiheit aufgehoben. Aber eben jene innere Nothwendigkeit ist selber die Freiheit, das Wesen des Menschen ist wesentlich seine eigne That; Nothwendigkeit und Freiheit stehen ineinander, als Ein Wesen, das nur von verschiedenen Seiten betrachtet als das eine oder andere erscheint, an sich Freiheit, formell Nothwendigkeit ist. Das Ich, sagte Fichte, ist seine eigne That; Bewußtseyn ist Selbstsetzen - aber das Ich ist nichts von diesem Verschiedenes, sondern eben das Selbstsetzen selber. Dieses Bewußtseyn aber, inwiefern es bloß als selbst-Erfassen oder Erkennen des Ich gedacht wird, ist nicht einmal das Erste, und setzt wie alles bloße Erkennen das eigentliche Seyn schon voraus. Dieses vor dem Erkennen vermuthete Seyn ist aber kein Seyn, wenn es gleich kein Erkennen ist; es ist reales Selbstsetzen, es ist ein Ur- und Grundwollen, das sich selbst zu etwas macht und der Grund und die Basis aller Wesenheit ist. Aber in viel bestimmterem als diesem allgemeinen Sinne gelten jene Wahrheiten in der unmittelbaren Beziehung auf den Menschen. Der Mensch ist in der ursprünglichen Schöpfung, wie gezeigt, ein unentschiedenes Wesen - (welches mythisch als ein diesem Leben vorausgegangener Zustand der Unschuld und anfänglichen Seligkeit dargestellt werden mag) -; nur er selbst kann sich entscheiden. Aber diese Entscheidung kann nicht in die Zeit fallen; sie fällt außer aller Zeit und daher mit der ersten Schöpfung (wenn gleich als eine von ihr verschiedene That) zusammen. Der Mensch, wenn er auch in der Zeit geboren wird, ist doch in den Anfang der Schöpfung (das Centrum) erschaffen. Die That, wodurch sein Leben in der Zeit bestimmt ist, gehört selbst nicht der Zeit, sondern der Ewigkeit an: sie geht dem Leben auch nicht der Zeit nach voran, sondern durch die Zeit (unergriffen von ihr) hindurch als eine der Natur nach ewige That. Durch sie reicht das Leben des Menschen bis an den Anfang der Schöpfung; daher er durch sie auch außer dem Erschaffenen, frei und selbst ewiger Anfang ist. So unfaßlich diese Idee der gemeinen Denkweise vorkommen mag, so ist doch in jedem Menschen ein mit derselben übereinstimmendes Gefühl, als sey er, was er ist, von aller Ewigkeit schon gewesen und keineswegs in der Zeit erst geworden. Daher, unerachtet der unleugbaren Nothwendigkeit aller Handlungen, und obgleich jeder, wenn er auf sich aufmerksam ist, sich gestehen muß, daß er keineswegs zufällig oder willkürlich böse oder gut ist, der Böse z.B. sich doch nichts weniger als gezwungen vorkommt (weil Zwang nur im Werden, nicht im Seyn empfunden werden kann), sondern seine Handlungen mit Willen, nicht gegen seinen Willen tut. Daß Judas ein Verräter Christi wurde, konnte weder er selbst noch eine Creatur andern, und dennoch verriet er Christum nicht gezwungen, sondern willig und mit völliger Freiheit 28). Ebenso verhält es sich mit dem Guten, daß er nämlich nicht zufällig oder willkürlich gut, und dennoch so wenig gezwungen ist, daß vielmehr kein Zwang, ja selbst die Pforten der Hölle nicht imstande wären, seine Gesinnung zu überwältigen. In dem Bewußtseyn, sofern es bloßes Selbsterfassen und nur idealisch ist, kann jene freie That, die zur Nothwendigkeit wird, freilich nicht vorkommen, da sie ihm, wie dem Wesen, vorangeht, es erst macht; aber sie ist darum doch keine That, von der dem Menschen überall kein Bewußtseyn geblichen; indem derjenige, welcher etwa, um eine unrechte Handlung zu entschuldigen, sagt: so bin ich nun einmal, doch sich wohl bewußt ist, daß er durch seine Schuld so ist, so sehr er auch Recht hat, daß es ihm unmöglich gewesen anders zu handeln. Wie oft geschieht es, daß ein Mensch von Kindheit an, zu einer Zeit, da wir ihm, empirisch betrachtet, kaum Freiheit und Ueberlegung zutrauen können, einen Hang zum Bösen zeigt, von dem vorauszusehen ist, daß er keiner Zucht und Lehre weichen werde, und der in der Folge wirklich die argen Früchte zur Reife bringt, die wir im Keime vorausgesehen hatten; und daß gleichwohl niemand die Zurechnungsfähigkeit derselben bezweifelt, und von der Schuld dieses Menschen so überzeugt ist, als es nur immer seyn könnte, wenn jede einzelne Handlung in seiner Gewalt gestanden hätte. Diese allgemeine Beurtheilung eines seinem Ursprung nach ganz bewußtlosen und sogar unwiderstehlichen Hangs zum Bösen als eines Aktus der Freiheit weist auf eine That, und also auf ein Leben vor diesem Leben hin, nur daß es nicht eben der Zeit nach vorangehend gedacht werde, indem das Intelligible überhaupt außer der Zeit ist. Weil in der Schöpfung der höchste Zusammenklang und nichts so getrennt und nacheinander ist, wie wir es darstellen müssen, sondern im Früheren auch schon das Spätere mitwirkt und alles in Einem magischen Schlage zugleich geschieht, so hat der Mensch, der hier entschieden und bestimmt erscheint, in der ersten Schöpfung sich in bestimmter Gestalt ergriffen, und wird als solcher, der er von Ewigkeit ist, geboren, indem durch jene That sogar die Art und Beschaffenheit seiner Korporisation bestimmt ist. Von jeher war die angenommene Zufälligkeit der menschlichen Handlungen im Verhältniß zu der im göttlichen Verstände zuvor entworfenen Einheit des Weltganzen, der größte Anstoß in der Lehre der Freiheit. Daher denn, indem weder die Präszienz Gottes noch die eigentliche Fürsehung aufgegeben werden konnte, die Annahme der Prädestination. Die Urheber derselben empfanden, daß die Handlungen des Menschen von Ewigkeit bestimmt seyn müßten; aber sie suchten diese Bestimmung nicht in der ewigen, mit der Schöpfung gleichzeitigen, Handlung, die das Wesen des Menschen selbst ausmacht, sondern in einem absoluten, d.h. völlig grundlosen, Ratschluß Gottes, durch welchen der eine zur Verdammniß, der andere zur Seligkeit vorherbestimmt worden, und hoben damit die Wurzel der Freiheit auf. Auch wir behaupten eine Prädestination, aber in ganz anderm Sinne, nämlich in diesem: wie der Mensch hier handelt, so hat er von Ewigkeit und schon im Anfang der Schöpfung gehandelt. Sein Handeln wird nicht, wie er selbst als sittliches Wesen nicht wird, sondern der Natur nach ewig ist. Es fällt damit auch jene oft gehörte peinliche Frage hinweg: warum ist eben dieser bestimmt, böse und ruchlos, jener andere dagegen fromm und gerecht zu handeln? denn sie setzt voraus, daß der Mensch nicht schon anfänglich Handlung und That sey, und daß er als geistiges Wesen ein Seyn vor und unabhängig von seinem Willen habe, welches, wie gezeigt worden, unmöglich ist. Nachdem einmal in der Schöpfung, durch Reaktion des Grundes zur Offenbarung, das Böse allgemein erregt worden, so hat der Mensch sich von Ewigkeit in der Eigenheit und Selbstsucht ergriffen, und alle, die geboren werden, werden mit dem anhängenden finstern Princip des Bösen geboren, wenn gleich dieses Böse zu seinem Selbstbewußtseyn erst durch das Eintreten des Gegensatzes erhoben wird. Nur aus diesem finstern Princip kann, wie der Mensch jetzt ist, durch göttliche Transmutation, das Gute als das Licht herausgebildet werden. Dieses ursprüngliche Böse im Menschen, das nur derjenige in Abrede ziehen kann, der den Menschen in sich und außer sich nur oberflächlich kennen gelernt hat, ist, obgleich in bezug auf das jetzige empirische Leben ganz von der Freiheit unabhängig, doch in seinem Ursprung eigne That, und darum allein ursprüngliche Sünde, was von jener, freilich ebenfalls unleugbaren, nach eingetretener Zerrüttung als Kontagium fortgepflanzten Unordnung der Kräfte nicht gesagt werden kann. Denn nicht die Leidenschaften an sich sind das Böse, noch haben wir allein mit Fleisch und Blut, sondern mit einem Bösen in und außer uns zu kämpfen, das Geist ist. Nur jenes durch eigne That, aber von der Geburt, zugezogene Böse kann daher das radikale Böse heißen, und bemerkenswert ist, wie Kant, der sich zu einer transzendentalen alles menschliche Seyn bestimmenden That in der Theorie nicht erhoben hatte, durch bloße treue Beobachtung der Phänomene des sittlichen Urtheils in späteren Untersuchungen auf die Anerkennung eines, wie er sich ausdrückt, subjektiven, aller in die Sinne fallenden That vorangehenden Grundes der menschlichen Handlungen, der doch selbst wiederum ein Aktus der Freiheit seyn müsse, geleitet wurde; indes Fichte, der den Begriff einer solchen That in der Spekulation erfaßt hatte, in der Sittenlehre wieder dem herrschenden Philanthropismus zufiel und jenes allem empirischen Handeln vorangehende Böse nur in der menschlichen Natur finden wollte. Trägheit der Es scheint nur Ein Grund zu seyn, der gegen diese Ansicht angeführt werden könnte: dieser, daß sie alle Umwendung des Menschen vom Bösen zum Guten, und umgekehrt, für dieses Leben wenigstens abschneide. Allein es sey nun, daß menschliche oder göttliche H�lfe - (einer H�lfe bedarf der Mensch immer) - ihn zu der Umwandlung ins Gute bestimme, so liegt doch dies, daß er dem guten Geist jene Einwirkung verstattet, sich ihm nicht positiv verschließt, ebenfalls schon in jener anfänglichen Handlung, durch welche er dieser und kein anderer ist. Daher in dem Menschen, in welchem jene Transmutation noch nicht vorgegangen, aber auch nicht das gute Princip völlig erstorben ist, die innere Stimme seines eignen, in bezug auf ihn, wie er jetzt ist, besseren Wesens, nie aufhört ihn dazu aufzufordern, so wie er erst durch die wirkliche und entschiedene Umwendung den Frieden in seinem eignen Innern, und, als wäre erst jetzt der anfänglichen Idea Genüge gethan, sich als versöhnt mit seinem Schutzgeist findet. Es ist im strengsten Verstande wahr, daß, wie der Mensch überhaupt beschaffen ist, nicht er selbst, sondern entweder der gute oder der böse Geist in ihm handelt; und dennoch tut dieß der Freiheit keinen Eintrag. Denn eben das in-sich-handeln-Lassen des guten oder bösen Princips ist die Folge der intelligiblen That, wodurch sein Wesen und Leben bestimmt ist. Nachdem wir also Anfang und Entstehung des Bösen bis zur Wirklichwerdung im einzelnen Menschen dargethan haben, so scheint nichts übrig, als seine Erscheinung im Menschen zu beschreiben. Die allgemeine Möglichkeit des Bösen besteht, wie gezeigt, darin, daß der Mensch seine Selbstheit, anstatt sie zur Basis, zum Organ zu machen, vielmehr zum Herrschenden und zum Allwillen zu erheben, dagegen das Geistige in sich zum Mittel zu machen streben kann. Ist in dem Menschen das finstere Princip der Selbstheit und des Eigenwillens ganz vom Licht durchdrungen und mit ihm eins, so ist Gott, als die ewige Liebe, oder als wirklich existirend, das Band der Kräfte in ihm. Sind aber die beiden Principien in Zwietracht, so schwingt sich ein anderer Geist an die Stelle, da Gott seyn sollte; der umgekehrte Gott nämlich; jenes durch die Offenbarung Gottes zur Aktualisirung erregte Wesen, das nie aus der Potenz zum Aktus gelangen kann, das zwar nie ist, aber immer seyn will, und daher, wie die Materie der Alten, nicht mit dem vollkommenen Verstande, sondern nur durch falsche Imagination (λογισμῶι νόθωι 29)) - welche eben die Sünde ist - als wirklich erfaßt (aktualisirt) werden kann; weshalb es durch spiegelhafte Vorstellungen, indem es, selbst nicht seyend, den Schein von dem wahren Seyn, wie die Schlange die Farben vom Licht, entlehnt, den Menschen zur Sinnlosigkeit zu bringen strebt, in der es allein von ihm aufgenommen und begriffen werden kann. Es wird daher mit Recht nicht nur als ein Feind aller Creatur (weil diese nur durch das Band der Liebe besteht) und vorzüglich des Menschen, sondern auch als Verführer desselben vorgestellt, der ihn zur falschen Lust und Aufnahme des Nichtseyenden in seine Imagination lockt, worin es von der eignen bösen Neigung des Menschen unterstützt wird, dessen Auge, unvermögend, auf den Glanz des Göttlichen und der Wahrheit hinschauend, standzuhalten, immer auf das Nichtseyende hinblickt. So ist denn der Anfang der Sünde, daß der Mensch aus dem eigentlichen Seyn in das Nichtseyn, aus der Wahrheit in die Lüge, aus dem Licht in die Finsterniß übertritt, um selbst schaffender Grund zu werden, und mit der Macht des Centri, das er in sich hat, über alle Dinge zu herrschen. Denn es bleibt auch dem aus dem Centro gewichenen immer noch das Gefühl, daß er alle Dinge gewesen ist, nämlich in und mit Gott; darum strebt er wieder dahin, aber für sich, nicht wo er es seyn könnte, nämlich in Gott. Hieraus entsteht der Hunger der Selbstsucht, die in dem Maß, als sie vom Ganzen und von der Einheit sich lossagt, immer dürftiger, ärmer, aber eben darum begieriger, hungriger, giftiger wird. Es ist im Bösen der sich selbst aufzehrende und immer vernichtende Widerspruch, daß es creatürlich zu werden strebt, eben indem es das Band der Creatürlichkeit vernichtet, und aus Uebermuth, alles zu seyn, ins Nichtseyn fällt. Uebrigens erfüllt die offenbare Sünde nicht wie bloße Schwäche und Unvermögen mit Bedauern, sondern mit Schrecken und Horror, ein Gefühl, das nur daher erklärbar ist, daß sie das Wort zu brechen, den Grund der Schöpfung anzutasten und das Mysterium zu profaniren strebt. Allein auch dieses sollte offenbar werden, denn nur im Gegensatz der Sünde offenbart sich jenes Innerste Band der Abhängigkeit der Dinge und das Wesen Gottes, das gleichsam vor aller Existenz (noch nicht durch sie gemildert), und darum schrecklich ist. Denn Gott selbst überkleidet dieses Princip in der Creatur und bedeckt es mit Liebe, indem er es zum Grund und gleichsam zum Träger der Wesen macht. Wer es nun durch Mißbrauch des zum Selbstseyn erhobenen Eigenwillens aufreizt, für den und gegen den wird es aktuell. Denn weil Gott in seiner Existenz doch nicht gestört, noch weniger aufgehoben werden kann, so wird nach der nothwendigen Korrespondenz, die zwischen Gott und seiner Basis stattfindet, eben jener in der Tiefe des Dunkels auch in jedem einzelnen Menschen leuchtende Lebensblick dem Sünder zum verzehrenden Feuer entflammt, so wie im lebendigen Organismus das einzelne Glied oder System, sobald es aus dem Ganzen gewichen ist, die Einheit und Konspiration selbst, der es sich entgegensetzt, als Feuer (= Fieber) empfindet und von innerer Glut entzündet wird. Wir haben gesehen, wie durch falsche Einbildung und nach dem Nichtseyenden sich richtende Erkenntniß der Geist des Menschen dem Geist der Lüge und Falschheit sich öffnet, und bald von ihm faszinirt der anfänglichen Freiheit verlustig wird. Hieraus folgt, daß im Gegentheil das wahre Gute nur durch eine göttliche Magie bewirkt werden könne, nämlich durch die unmittelbare Gegenwart des Seyenden im Bewußtseyn und der Erkenntniß. Ein willkürliches Gutes ist so unmöglich als ein willkürliches Böses. Die wahre Freiheit ist im Einklang mit einer heiligen Nothwendigkeit, dergleichen wir in der wesentlichen Erkenntniß empfinden, da Geist und Herz, nur durch ihr eignes Gesetz gebunden, freiwillig bejahen, was nothwendig ist Wenn das Böse in einer Zwietracht der beiden Principien besteht, so kann das Gute nur in der vollkommenen Eintracht derselben bestehen, und das Band, das beide vereinigt, muß ein göttliches seyn, indem sie nicht auf bedingte, sondern auf vollkommene und unbedingte Weise eins sind. Das Verhältniß beider läßt sich daher nicht als selbstbeliebige, oder aus Selbstbestimmung hervorgegangene Sittlichkeit vorstellen. Der letzte Begriff setzte voraus, daß sie nicht an sich eins seyen; wie sollen sie aber eins werden, wenn sie es nicht sind? außerdem führt er zu dem ungereimten System des Gleichgewichts der Willkür zurück. Das Verhältniß beider Principien ist das einer Gebundenheit des finstern Princips (der Selbstheit) an das Licht. Es sey uns erlaubt, dies, der ursprünglichen Wortbedeutung nach, durch Religiosität auszudrücken. Wir verstehen darunter nicht, was ein krankhaftes Zeitalter so nennt, müßiges Brüten, andächtelndes Ahnden, oder Fühlen-wollen des Göttlichen. Denn Gott ist in uns die klare Erkenntniß oder das geistige Licht selber, in welchem erst alles andere klar wird, weit entfernt, daß es selbst unklar seyn sollte; und in wem diese Erkenntniß ist, den läßt sie wahrlich nicht müßig seyn oder feiern. Sie ist, wo sie ist, etwas viel Substantielleres, als unsere Empfindungsphilosophen meinen. Wir verstellen Religiosität in der ursprünglichen, praktischen Bedeutung des Worts. Sie ist Gewissenhaftigkeit, oder daß man handle, wie man weiß, und nicht dem Licht der Erkenntniß in seinem Thun widerspreche. Einen Menschen, dem dieß nicht auf eine menschliche, physische oder psychologische, sondern auf eine göttliche Weise unmöglich ist, nennt man religiös, gewissenhaft im höchsten Sinne des Worts. Derjenige ist nicht gewissenhaft, der sich im vorkommenden Fall noch erst das Pflichtgebot vorhalten muß, um sich durch Achtung für dasselbe zum Rechtthun zu entscheiden. Schon der Wortbedeutung nach läßt Religiosität keine Wahl zwischen Entgegengesetzten zu, kein aequilibrium arbitrii (die Pest aller Moral), sondern nur die höchste Entschiedenheit für das Rechte, ohne alle Wahl. Gewissenhaftigkeit erscheint nicht eben nothwendig und immer als Enthusiasmus oder als außerordentliche Erhebung über sich selbst, wozu, wenn der Dünkel selbstbeliebiger Sittlichkeit niedergeschlagen ist, ein anderer und noch viel schlimmerer Hochmuthsgeist gerne auch diese machen möchte. Sie kann ganz formell, in strenger Pflichterfüllung, erscheinen, wo ihr sogar der Charakter der Härte und Herbheit beigemischt ist, wie in der Seele des M. Cato, dem ein Alter jene innere und fast göttliche Nothwendigkeit des Handelns zuschreibt, indem er sagt, er sey der Tugend am ähnlichsten gewesen, indem er nie recht gehandelt, damit er so handelte (aus Achtung für das Gebot), sondern weil er gar nicht anders habe handeln können. Diese Strenge der Gesinnung ist, wie die Strenge des Lebens in der Natur, der Keim, aus welchem erst wahre Anmuth und Göttlichkeit als Blüte hervorgeht; aber die vermeintlich vornehmere Moralität, welche diesen Kern verschmähen zu dürfen glaubt, ist einer tauben Blüte gleich, die keine Frucht erzeugt 30). Das Höchste ist, eben darum weil es dieß ist, nicht immer das Allgemeingültige; und wer das Geschlecht geistiger Wollüstlinge kennen gelernt, dem gerade das Höchste der Wissenschaft wie des Gefühls zur ausgelassensten Geistes-Un-Zucht und Erhebung über die sogenannte gemeine Pflichtmäßigkeit dienen muß, wird sich wohl bedenken, es als solches auszusprechen. Schon ist vorauszusehen, daß auf dem Wege, wo jeder früher eine schöne Seele als eine vernünftige seyn, und lieber edel heißen als gerecht seyn will, die Sittenlehre noch auf den allgemeinen Begriff des Geschmacks zurückgeführt werden wird, wonach sodann das Laster nur noch in einem schlechten oder verdorbenen Geschmack bestehen würde. 31) Wenn in der ernsten Gesinnung das göttliche Princip derselben, als solches, durchschlägt, so erscheint Tugend als Enthusiasmus; als Heroismus (im Kampf gegen das Böse), als der schöne freie Muth des Menschen, zu handeln, wie der Gott ihn unterrichtet, und nicht im Handeln abzufallen von dem was er im Wissen erkannt hat; als Glaube, nicht im Sinn eines Fürwahrhaltens, das gar als verdienstlich angesehen wird, oder dem zur Gewißheit etwas abgeht - eine Bedeutung, die sich diesem Wort durch den Gebrauch für gemeine Dinge angehängt hat -, sondern in seiner ursprünglichen Bedeutung als Zutrauen, Zuversicht auf das Göttliche, die alle Wahl ausschließt. Wenn endlich in den unverbrüchlichen Ernst der Gesinnung, der aber immer vorausgesetzt wird, ein Strahl göttlicher Liebe sich senkt, so entsteht die höchste Verklärung des sittlichen Lebens in Anmuth und göttliche Schönheit. Die Entstehung des Gegensatzes von Gut und Bös, und wie beides in der Schöpfung durcheinander wirkt, haben wir nun soviel möglich untersucht; aber noch ist die höchste Frage dieser ganzen Untersuchung zurück. Gott ist bis jetzt bloß betrachtet worden als sich selbst offenbarendes Wesen. Aber wie verhält er sich denn zu dieser Offenbarung als sittliches Wesen? Ist sie eine Handlung, die mit blinder und bewußtloser Nothwendigkeit erfolgt, oder ist sie eine freie und bewußte That? Und wenn sie das letzte ist, wie verhält sich Gott als sittliches Wesen zu dem Bösen, dessen Möglichkeit und Wirklichkeit von der Selbstoffenbarung abhängt? Hat er, wenn er diese gewollt, auch das Böse gewollt, und wie ist dieses Wollen mit der Heiligkeit und höchsten Vollkommenheit in ihm zu reimen, oder im gewöhnlichen Ausdruck, wie ist Gott wegen des Bösen zu rechtfertigen? Die vorläufige Frage wegen der Freiheit Gottes in der Selbstoffenbarung scheint zwar durch das Vorgehende entschieden. Wäre uns Gott ein bloß logisches Abstraktum, so müßte dann auch alles aus ihm mit logischer Nothwendigkeit folgen; er selbst wäre gleichsam nur das höchste Gesetz, von dem alles ausfließt, aber ohne Personalität und Bewußtseyn davon. Allein wir haben Gott erklärt als lebendige Einheit von Kräften; und wenn Persönlichkeit nach unserer früheren Erklärung auf der Verbindung eines Selbständigen mit einer von ihm unabhängigen Basis beruht, so nämlich, daß diese beiden sich ganz durchdringen und nur Ein Wesen sind, so ist Gott durch die Verbindung des idealen Princips in ihm mit dem (relativ auf dieses) unabhängigen Grunde, da Basis und Existirendes in ihm sich nothwendig zu Einer absoluten Existenz vereinigen, die höchste Persönlichkeit; der auch, wenn die lebendige Einheit beider Geist ist, so ist Gott, als das absolute Band derselben, Geist im eminenten und absoluten Verstände. So gewiß ist es, daß nur durch das Band Gottes mit der Natur die Personalität in ihm begründet ist, da im Gegentheil der Gott des reinen Idealismus, so gut wie der des reinen Realismus, nothwendig ein unpersönliches Wesen ist, wovon der Fichtesche und Spinozische Begriff die klarsten Beweise sind. Allein weil in Gott ein unabhängiger Grund von Realität und daher zwei gleich ewige Anfänge der Selbstoffenbarung sind, so muß auch Gott nach seiner Freiheit in Beziehung auf beide betrachtet werden. Der erste Anfang zur Schöpfung ist die Sehnsucht des Einen, sich selbst zu gebären, oder der Wille des Grundes. Der zweite ist der Wille der Liebe, wodurch das Wort in die Natur ausgesprochen wird, und durch den Gott sich erst persönlich macht. Der Wille des Grundes kann daher nicht frei seyn in dem Sinne, in welchem es der Wille der Liebe ist. Er ist kein bewußter oder mit Reflexion verbundener Wille, obgleich Mich kein völlig bewußtloser, der nach blinder mechanischer Nothwendigkeit sich bewegte, sondern mittlerer Natur, wie Begierde oder Lust, und am ehesten dem schönen Drang einer werdenden Natur vergleichbar, die sich zu entfalten strebt, und deren innere Bewegungen unwillkürlich sind (nicht unterlassen werden können), ohne daß sie doch sich in ihnen gezwungen fühlte. Schlechthin freier und bewußter Wille aber ist der Wille der Liebe, eben weil er dieß ist; die aus ihm folgende Offenbarung ist Handlung und That. Die ganze Natur sagt uns, daß sie keineswegs vermöge einer bloß geometrischen Nothwendigkeit da ist; es ist nicht lautere reine Vernunft in ihr, sondern Persönlichkeit und Geist (wie wir den vernünftigen Autor vom geistreichen wohl unterscheiden); sonst hätte der geometrische Verstand, der so lange geherrscht hat, sie längst durchdringen und sein Idol allgemeiner und ewiger Naturgesetze mehr bewahrheiten müssen, als es bis jetzt geschehen ist, da er vielmehr das irrationale Verhältniß der Natur zu sich täglich mehr erkennen muß. Die Schöpfung ist keine Begebenheit, sondern eine That. Es gibt keine Erfolge aus allgemeinen Gesetzen, sondern Gott, d.h. die Person Gottes, ist das allgemeine Gesetz, und alles, was geschieht, geschieht vermöge der Persönlichkeit Gottes; nicht nach einer abstrakten Nothwendigkeit, die wir im Handeln nicht ertragen würden, geschweige Gott. In der nur zu sehr vom Geist der Abstraktion beherrschten Leibnizischen Philosophie ist die Anerkennung der Naturgesetze als sittlich-, nicht aber geometrischnothwendiger, und ebensowenig willkürlicher Gesetze, eine der erfreulichsten Seiten. «Ich habe gefunden,» sagt Leibniz, «daß die in der Natur wirklich nachzuweisenden Gesetze doch nicht absolut demonstrabel sind, was aber auch nicht nothwendig ist. Zwar können sie auf verschiedene Art bewiesen werden; aber immer muß etwas vorausgesetzt werden, das nicht ganz geometrisch nothwendig ist. Daher sind diese Gesetze der Beweis eines höchsten, intelligenten und freien Wesens gegen das System absoluter Nothwendigkeit. Sie sind weder ganz nothwendig (in jenem abstrakten Verstande), noch ganz willkürlich, sondern stehen in der Mitte als Gesetze, die von einer über alles vollkommenen Weisheit abstammen» 32). Das höchste Streben der dynamischen Erklärungsart ist kein anderes als diese Reduktion der Naturgesetze auf Gemüth, Geist und Willen. Um jedoch das Verhältniß Gottes als moralischen Wesens zur Welt zu bestimmen, reicht die allgemeine Erkenntniß der Freiheit in der Schöpfung nicht hin; es fragt sich noch außerdem, ob die That der Selbstoffenbarung in dem Sinne frei gewesen, daß alle Folgen derselben in Gott vorgesehen worden. Auch dieses aber ist nothwendig zu bejahen; denn es würde der Wille zur Offenbarung selbst nicht lebendig seyn, wenn ihm nicht ein anderer auf das Innere des Wesens zurückgehender Wille entgegenstünde; aber in diesem an-sich-Halten entsteht ein reflexives Bild alles dessen, was in dem Wesen implicite enthalten ist, in welchem Gott sich ideal verwirklicht, oder, was dasselbe ist, sich in seiner Verwirklichung zuvor erkennt. So muß also doch, da eine dem Willen zur Offenbarung entgegenwirkende Tendenz in Gott ist, Liebe und Güte oder das Communicativum sui überwiegen, damit eine Offenbarung sey; und dieses, die Entscheidung, vollendet erst eigentlich den Begriff derselben als einer bewußten und sittlich-freien That. Unerachtet dieses Begriffs, und obwohl die Handlung der Offenbarung in Gott nur sittlich- oder beziehungsweise auf Güte und Liebe nothwendig ist, bleibt die Vorstellung einer Beratschlagung Gottes mit sich selbst, oder einer Wahl zwischen mehreren möglichen Welten eine grundlose und unhaltbare Vorstellung. Im Gegentheil, sobald nur die nähere Bestimmung einer sittlichen Nothwendigkeit hinzugefügt wird, ist ganz unleugbar der Satz: daß aus der göttlichen Natur alles mit absoluter Nothwendigkeit folgt, daß alles, was kraft derselben möglich ist, auch wirklich seyn muß, und was nicht wirklich ist, auch sittlich-unmöglich seyn muß. Der Spinozismus fehlt keineswegs durch die Behauptung einer solchen unverbrüchlichen Nothwendigkeit in Gott, sondern dadurch, daß er dieselbe unlebendig und unpersönlich nimmt. Denn da dieses System von dem Absoluten überhaupt nur die eine Seite begreift - nämlich die reale oder inwiefern Gott nur im Grunde wirkt, so führen jene Sätze allerdings auf eine blinde und verstandlose Nothwendigkeit. Wenn aber Gott wesentlich Liebe und Güte ist, so folgt auch das, was in ihm sittlichnothwendig ist, mit einer wahrhaft metaphysischen Nothwendigkeit. Würde zur vollkommenen Freiheit in Gott die Wahl im eigentlichsten Verstände erfordert, so müßte dann noch weitergegangen werden. Denn eine perfekte Freiheit der Wahl würde erst dann gewesen seyn, wenn Gott auch eine weniger vollkommene Welt, als nach allen Bedingungen möglich war, hätte erschaffen können, wie denn, da nichts so ungereimt ist, das nicht einmal vorgebracht worden, von einigen auch wirklich und im Ernst - nicht bloß wie von dem Kastillanischen König Alphonsus, dessen bekannte Aeußerung nur das damals herrschende Ptolomäische System traf - behauptet worden: Gott hätte, wenn er gewollt, eine bessere Welt als diese erschaffen können. So sind auch die Gründe gegen die Einheit der Möglichkeit und Wirklichkeit in Gott von dem ganz formellen Begriff der Möglichkeit hergenommen, daß alles möglich ist, was sich nicht widerspricht; z.B. in der bekannten Einrede, daß dann alle verständig erfundenen Romane wirkliche Begebenheiten seyn müssen. Einen solchen bloß formalen Begriff hatte selbst Spinoza nicht; alle Möglichkeit gilt bei ihm mir beziehungsweise auf die göttliche Vollkommenheit, und Leibniz nimmt diesen Begriff offenbar bloß an, um eine Wahl in Gott herauszubringen, und sich dadurch so weit als möglich von Spinoza zu entfernen. «Gott wählt,» sagt er, «zwischen Möglichkeiten, und wählt darum frei, ohne Nezessitirung: dann erst wäre keine Wahl, keine Freiheit, wenn nur Eines möglich wäre.» Wenn zur Freiheit nichts weiter als eine solche leere Möglichkeit fehlt, so kann zugegeben werden, daß formell, oder ohne auf die göttliche Wesenheit zu sehen, Unendliches möglich war und noch ist; allein dieß heißt die göttliche Freiheit durch einen Begriff behaupten wollen, der an sich falsch ist, und der bloß in unserem Verstand, aber nicht in Gott möglich ist, in welchem ein Absehen von seinem Wesen oder seinen Vollkommenheiten wohl nicht gedacht werden kann. Was die Pluralität möglicher Welten betrifft, so scheint ein an sich Regelloses, dergleichen nach unserer Erklärung die ursprüngliche Bewegung des Grundes ist, wie ein noch nicht geformter, aber aller Formen empfänglicher Stoff, allerdings eine Unendlichkeit von Möglichkeiten darzubieten, und wenn etwa darauf die Möglichkeit mehrerer Welten gegründet werden sollte, so wäre nur zu bemerken, daß daraus doch keine solche Möglichkeit in Ansehung Gottes folgen würde, indem der Grund nicht Gott zu nennen ist, und Gott nach seiner Vollkommenheit nur Eines wollen kann. Allein es ist auch jene Regellosigkeit keineswegs so zu denken, als wäre nacht in dem Grunde doch der Urtypus der nach dem Wesen Gottes allein möglichen Welt enthalten, welcher in der wirklichen Schöpfung nur durch Scheidung, Regulirung der Kräfte und Ausschließung des ihn hemmenden oder verdunkelnden Regellosen aus der Potenz zum Aktus erhoben wird. In dem göttlichen Verstände selbst aber, als in uranfänglicher Weisheit, worin sich Gott ideal oder urbildlich verwirklicht, ist, wie nur Ein Gott ist, so auch nur Eine mögliche Welt. In dem göttlichen Verstande ist ein System, aber Gott selbst ist kein System, sondern ein Leben, und darin liegt auch allein die Antwort auf die Frage, um deren willen dieß vorausgeschickt worden, wegen der Möglichkeit des Bösen in bezug auf Gott. Alle Existenz fordert eine Bedingung, damit sie wirkliche, nämlich persönliche Existenz werde. Auch Gottes Existenz könnte ohne eine solche nicht persönlich seyn, nur daß er diese Bedingung in sich, nicht außer sich hat. Er kann die Bedingung nicht aufheben, indem er sonst sich selbst aufheben müßte; er kann sie nur durch Liebe bewältigen und sich zu seiner Verherrlichung unterordnen. Auch in Gott wäre ein Grund der Dunkelheit, wenn er die Bedingung nicht zu sich machte, sich mit ihr als eins und zur absoluten Persönlichkeit verbände. Der Mensch bekommt die Bedingung nie in seine Gewalt, ob er gleich im Bösen danach strebt; sie ist eine ihm nur geliehene, von ihm unabhängige; daher sich seine Persönlichkeit und Selbstheit nie zum vollkommenen Aktus erheben kann. Dieß ist die allem endlichen Leben anklebende Traurigkeit, und wenn auch in Gott eine wenigstens beziehungsweise unabhängige Bedingung ist, so ist in ihm selber ein Quell der Traurigkeit, die aber nie zur Wirklichkeit kommt, sondern nur zur ewigen Freude der Ueberwindung dient. Daher der Schleier der Schwermuth, der über die ganze Natur ausgebreitet ist, die tiefe unzerstörliche Melancholie alles Lebens. Freude muß Leid haben, Leid in Freude verklärt werden. Was daher aus der bloßen Bedingung oder dem Gründe kommt, kommt nicht von Gott, wenn es gleich zu seiner Existenz nothwendig ist. Aber es kann auch nicht gesagt werden, daß das Böse aus dem Grunde komme, oder daß der Wille des Grundes Urheber desselben sey. Denn das Böse kann immer nur entstehen im Innersten Willen des eignen Herzens und wird nie ohne eigne That vollbracht. Die Sollizitation des Grundes oder die Reaktion gegen das Uebercreatürliche erweckt nur die Lust zum Creatürlichen oder den eignen Willen, aber sie erweckt ihn nur, damit ein unabhängiger Grund des Guten da sey, und damit er vom Guten überwältiget und durchdrungen werde. Denn nicht die erregte Selbstheit an sich ist das Böse, sondern nur sofern sie sich gänzlich von ihrem Gegensatz, dem Licht oder dem Universalwissen, losgerissen hat. Aber eben dieses Lossagen vom Guten ist erst die Sünde. Die aktivirte Selbstheit ist nothwendig zur Schärfe des Lebens; ohne sie wäre völliger Tod, ein Einschlummern des Guten; denn wo nicht Kampf ist, da ist nicht Leben. Nur die Erweckung des Lebens also ist der Wille des Grundes, nicht das Böse unmittelbar und an sich. Schließt der Wille des Menschen die aktivirte Selbstheit mit der Liebe ein und ordnet sie dem Licht als dem allgemeinen Willen unter, so entsteht daraus erst die aktuelle, durch die in ihm befindliche Schärfe empfindlich gewordene Güte. Im Guten also ist die Reaktion des Grundes eine Wirkung zum Guten, im Bösen eine Wirkung zum Bösen, wie die Schrift sagt: in den Frommen bist du fromm, und in den Verkehrten verkehrt. Ein Gutes ohne wirksame Selbstheit ist selbst ein unwirksames Gutes. Dasselbe, was durch den Willen der Creatur böse wird (wenn es sich ganz losreißt, um für sich zu seyn), ist an sich selbst das Gute, solang es nämlich im Guten verschlungen und im Grunde bleibt. Nur die überwundene, also aus der Aktivität zur Potentialität zurückgebrachte Selbstheit ist das Gute, und der Potenz nach, als überwältigt durch dasselbe, bleibt es im Guten auch immerfort bestehen. Wäre im Körper nicht eine Wurzel der Kälte, so könnte die Wärme nicht fühlbar seyn. Eine attrahirende und eine repellirende Kraft für sich zu denken, ist unmöglich, denn worauf soll das Repellirende wirken, wenn ihm nicht das Attrahirende einen Gegenstand macht, oder worauf das Anziehende, wenn es nicht in sich selbst zugleich ein Zurückstoßendes hat? Daher dialektisch ganz richtig gesagt wird: Gut und Bös seyen dasselbe, nur von verschiedenen Seiten gesehen, oder, das Böse sey an sich d.h. in der Wurzel seiner Identität betrachtet, das Gute, wie das Gute dagegen, in seiner Entzweiung oder Nicht-Identität betrachtet, das Böse. Aus diesem Grunde ist auch jene Rede ganz richtig, daß, wer keinen Stoff noch Kräfte zum Bösen in sich hat, auch zum Guten untüchtig sey, wovon wir zu unserer Zeit genugsame Beispiele gesehen. Die Leidenschaften, welchen unsere negative Moral den Krieg macht, sind Kräfte, deren jede mit der ihr entsprechenden Tugend eine gemeinsame Wurzel hat. Die Seele alles Hasses ist Liebe, und im heftigsten Zorn zeigt sich nur die im innersten Centrum angegriffene und aufgereizte Stille. Im gehörigen Maß und organischen Gleichgewicht sind sie die Stärke der Tugend selbst und ihre unmittelbaren Werkzeuge. «Wenn die Leidenschaften Glieder der Unehre sind,» sagt der treffliche J. G. Hamann, «hören sie deswegen auf, Waffen der Mannheit zu seyn? Versteht ihr den Buchstaben der Vernunft klüger als jener allegorische Kämmerer der alexandrinischen Kirche den der Schrift, der sich selbst zum Verschnittenen machte um des Himmelreichs willen? - Die größten Bösewichter gegen sich selbst macht der Fürst dieses Aeons zu seinen Lieblingen - - seine (des Teufels) Hofnarren sind die ärgsten Feinde der schönen Natur, die freilich Korybanten und Gallier zu Bauchpfaffen, aber starke Geister zu wahren Anbetern hat» 33). Nur mögen dann diejenigen, deren Philosophie mehr für das Gynäzeum als für die Akademie oder die Palästra des Lyzeums gemacht ist, jene dialektischen Sätze nicht vor ein Publikum bringen, das sie ebenso wie sie selber mißverstehend, darin eine Aufhebung alles Unterschiedes von Recht und Unrecht, Gut und Böse sieht, und vor welches sie so wenig als etwa die Sätze der alten Dialektiker, des Zenon und der übrigen Eleaten, vor das Forum seichter Schöngeister gehören. Die Erregung des Eigenwillens geschieht nur, damit die Liebe im Menschen einen Stoff oder Gegensatz finde, darin sie sich verwirkliche. Inwiefern die Selbstheit in ihrer Lossagung das Princip des Bösen ist, erregt der Grund allerdings das mögliche Princip des Bösen, aber nicht das Böse selber, noch zum Bösen. Aber auch diese Erregung geschieht nicht nach dem freien Willen Gottes, der sich in dem Grunde nicht nach diesem oder seinem Herzen, sondern nur nach seinen Eigenschaften bewegt. Wer daher behauptete, Gott selbst habe das Böse gewollt, müßte den Grund dieser Behauptung in der That der Selbstoffenbarung als der Schöpfung suchen, wie auch sonst oft gemeint worden, derjenige, der die Welt gewollt, habe auch das Böse wollen müssen. Allein daß Gott die unordentlichen Geburten des Chaos zur Ordnung gebracht und seine ewige Einheit in die Natur ausgesprochen, dadurch wirkte er vielmehr der Finsterniß entgegen, und setzte der regellosen Bewegung des verstandlosen Princips das Wort als ein beständiges Centrum und ewige Leuchte entgegen. Der Wille zur Schöpfung war also unmittelbar nur ein Wille zur Geburt des Lichtes, und damit des Guten; das Böse aber kam in diesem Willen weder als Mittel, noch selbst, wie Leibniz sagt, als Conditio sine qua non der möglich größten Vollkommenheit der Welt 34) in Betracht. Es war weder Gegenstand eines göttlichen Ratschlusses, noch und viel weniger einer Erlaubniß. Die Frage aber, warum Gott, da er nothwendig vorgesehen, daß das Böse wenigstens begleitungsweise aus der Selbstoffenbarung folgen würde, nicht vorgezogen habe, sich überhaupt nicht zu offenbaren, verdient in der That keine Erwiderung. Denn dieß hieße ebensoviel als, damit kein Gegensatz der Liebe seyn könne, soll die Liebe selbst nicht seyn, d.h. das absolutPositive soll dem, was nur eine Existenz als Gegensatz hat, das Ewige dem bloß Zeitlichen geopfert werden. Daß die Selbstoffenbarung in Gott, nicht als eine unbedingt willkürliche, sondern als eine sittlich- nothwendige Theil betrachtet werden müsse, in welcher Liebe und Güte die absolute Innerlichkeit überwunden, haben wir bereits erklärt. So denn also Gott um des Bösen willen sich nicht geoffenbart, hätte das Böse über das Gute und die Liebe gesiegt. Der Leibnizische Begriff des Bösen als Conditio sine qua non kann nur auf den Grund angewendet werden, daß dieser nämlich den creatürlichen Willen (das mögliche Princip des Bösen) als Bedingung errege, unter welcher allein der Wille der Liebe verwirklicht werden könne. Warum nun Gott den Willen des Grundes nicht wehre oder ihn aufhebe, haben wir ebenfalls schon gezeigt. Es wäre dieß ebensoviel, als daß Gott die Bedingung seiner Existenz, d.h. seine eigne Persönlichkeit, aufhöbe. Damit also das Böse nicht wäre, müßte Gott selbst nicht seyn. Eine andre Gegenrede, welche aber nicht bloß diese Ansicht, sondern jede Metaphysik trifft, ist diese, daß, wenn auch Gott das Böse nicht gewollt habe, er doch in dem Sünder fortwirke und ihm die Kraft gebe, das Böse zu vollbringen. Dieses ist denn mit der gehörigen Unterscheidung ganz und gar zuzugeben. Der Urgrund zur Existenz wirkt auch im Bösen fort, wie in der Krankheit die Gesundheit noch fortwirkt, und auch das zerrüttetste, verfälschteste Leben bleibt und bewegt sich noch in Gott, sofern er Grund von Existenz ist. Aber es empfindet ihn als verzehrenden Grimm, und wird durch das Anziehen des Grundes selbst in immer höhere Spannung gegen die Einheit, bis zur Selbstvernichtung und endlichen Krisis, gesetzt. Nach allem diesem bleibt immer die Frage übrig: endet das Böse, und wie? Hat überhaupt die Schöpfung eine Endabsicht, und wenn dieß ist, warum wird diese nicht unmittelbar erreicht, warum ist das Vollkommene nicht gleich von Anfang? Es gibt darauf keine Antwort als die schon gegebene: weil Gott ein Leben ist, nicht bloß ein Seyn. Alles Leben aber hat ein Schicksal und ist dem Leiden und Werden Unterthan. Auch diesem also hat sich Gott freiwillig unterworfen, schon da er zuerst, um persönlich zu werden, die Licht- und die finstre Welt schied. Das Seyn wird sich nur im Werden empfindlich. Im Seyn freilich ist kein Werden; in diesem vielmehr ist es selber wieder als Ewigkeit gesetzt; aber in der Verwirklichung durch Gegensatz ist nothwendig ein Werden. Ohne den Begriff eines menschlich leidenden Gottes, der allen Mysterien und geistigen Religionen der Vorzeit gemein ist, bleibt die ganze Geschichte unbegreiflich; auch die Schrift unterscheidet Perioden der Offenbarung, und setzt als eine ferne Zukunft die Zeit, da Gott Alles in Allem, d.h. wo er ganz verwirklicht seyn wird. Die erste Periode der Schöpfung ist, wie früher gezeigt worden, die Geburt des Lichts. Das Licht oder das ideale Princip ist als ein ewiger Gegensatz des finstern Princips das schaffende Wort, welches das im Grunde verborgene Leben aus dem Nichtseyn erlöst, es aus der Potenz zum Aktus erhebt. Ueber dem Wort gehet der Geist auf, und der Geist ist das erste Wesen, welches die finstre und die Lichtwelt vereiniget und beide Principien sich zur Verwirklichung und Persönlichkeit unterordnet. Gegen diese Einheit reagirt jedoch der Grund und behauptet die anfängliche Dualität, aber nur zu immer höherer Steigerung und zur endlichen Scheidung des Guten vom Bösen. Der Wille des Grundes muß in seiner Freiheit bleiben, bis daß alles erfüllt, alles wirklich geworden sey. Würde er früher unterworfen, so bliebe das Gute sammt dem Bösen in ihm verborgen. Aber das Gute soll aus der Finsterniß zur Aktualität erhoben werden, um mit Gott unvergänglich zu leben; das Böse aber von dem Guten geschieden, um auf ewig in das Nichtseyn verstoßen zu werden. Denn dieß ist die Endabsicht der Schöpfung, daß, was nicht für sich seyn könnte, für sich sey, indem es aus der Finsterniß, als einem von Gott unabhängigen Grunde, ins Daseyn erhoben wird. Daher die Nothwendigkeit der Geburt und des Todes. Gott gibt die Ideen, die in ihm ohne selbständiges Leben waren, dahin in die Selbstheit und das Nichtseyende, damit, indem sie aus diesem ins Leben gerufen werden, sie als unabhängig existirende wieder in ihm seyen 35). Der Grund wirkt also in seiner Freiheit die Scheidung und das Gericht (κρίσις), und eben damit die vollkommene Aktualisirung Gottes, Denn das Böse, wenn es vom Guten gänzlich geschieden ist, ist auch nicht mehr als Böses. Es konnte nur wirken durch das (mißbrauchte) Gute, das ihm selbst unbewußt in ihm war. Es genoß im Leben noch der Kräfte der äußern Natur, mit denen es versuchte zu schaffen, und hatte noch mittelbaren Antheil an der Güte Gottes. Im Sterben aber wird es von allem Guten geschieden, und bleibt zwar zurück als Begierde, als ewiger Hunger und Durst nach der Wirklichkeit, aber ohne aus der Potentialität heraustreten zu können. Sein Zustand ist daher ein Zustand des Nichtseyns, ein Zustand des beständigen Verzehrtwerdens der Aktivität, oder dessen, was in ihm aktiv zu seyn strebt. Es bedarf darum auch zur Realisirung der Idee einer endlichen allseitigen Vollkommenheit keineswegs einer Wiederherstellung des Bösen zum Guten (der Wiederbringung aller Dinge); denn das Böse ist nur bös, inwiefern es über die Potentialität hinausgeht; auf das Nichtseyn aber, oder den Potenzzustand reducirt, ist es, was es immer seyn sollte, Basis, Unterworfenes, und als solches nicht mehr im Widerspruch mit der Heiligkeit noch der Liebe Gottes. Das Ende der Offenbarung ist daher die Ausstoßung des Bösen vom Guten, die Erklärung desselben als gänzlicher Unrealität. Dagegen wird das aus dem Grunde erhobene Gute zur ewigen Einheit mit dem ursprünglichen Guten verbunden; die aus der Finsterniß ans Licht Gebornen schließen sich dem idealen Princip als Glieder seines Leibes an, in welchem jenes vollkommen verwirklicht und nun ganz persönliches Wesen ist. Solange die anfängliche Dualität dauerte, herrschte das schaffende Wort in dem Grunde, und diese Periode der Schöpfung geht durch alle hindurch bis zum Ende. Wenn aber die Dualität durch die Scheidung vernichtet ist, ordnet das Wort oder das ideale Princip sich und das mit ihm eins gewordene reale gemeinschaftlich dem Geist unter, und dieser, als das göttliche Bewußtseyn, lebt auf gleiche Weise in beiden Principien; wie die Schrift von Christus sagt: Er muß herrschen, bis daß er alle seine Feinde unter seine Füße lege. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod (denn der Tod war nur nothwendig zur Scheidung, das Gute muß sterben, um sich vom Bösen, und das Böse, um sich vom Guten zu scheiden). Wenn aber alles ihm Unterthan seyn wird, alsdann wird auch der Sohn selbst Unterthan seyn dem, der ihm alles untergethan hat, auf daß Gott sey Alles in Allem. Denn auch der Geist ist noch nicht das Höchste; er ist nur der Geist, oder der Hauch der Liebe. Die Liebe aber ist das Höchste. Sie ist das, was da war, ehe denn der Grund und ehe das Existirende (als getrennte) waren, aber noch nicht war als Liebe, sondern - wie sollen wir es bezeichnen? Wir treffen hier endlich auf den höchsten Punkt der ganzen Untersuchung. Schon lange hörten wir die Frage; wozu soll doch jene erste Unterscheidung dienen, zwischen dem Wesen, sofern es Grund ist und inwiefern es existirt? Denn entweder gibt es für die beiden keinen gemeinsamen Mittelpunkt: dann müssen wir uns für den absoluten Dualismus erklären. Oder es gibt einen solchen: so fallen beide in der letzten Betrachtung wieder zusammen. Wir haben dann Ein Wesen für alle Gegensätze, eine absolute Identität von Licht und Finsterniß, Gut und Bös und alle die ungereimten Folgen, auf die jedes Vernunftsystem geraten muß, und die auch diesem System vorlängst nachgewiesen sind. Was wir in der ersten Beziehung annehmen, haben wir bereits erklärt: es muß vor allem Grund und vor allem Existirenden, also überhaupt vor aller Dualität, ein Wesen seyn; wie können wir es anders nennen als den Urgrund oder vielmehr Ungrund? Da es vor allen Gegensätzen vorhergeht, so können diese in ihm nicht unterscheidbar noch auf irgend eine Weise vorhanden seyn. Es kann daher nicht als die Identität, es kann nur als die absolute Indifferenz beider bezeichnet werden. Die meisten, wenn sie bis zu dem Punkt der Betrachtung kommen, wo sie ein Verschwinden aller Gegensätze erkennen müssen, vergessen, daß diese nun wirklich verschwunden sind, und prädiciren sie wieder als solche von der Indifferenz, die ihnen doch eben durch ein gänzliches Aufhören derselben entstanden war. Die Indifferenz ist nicht ein Produkt der Gegensätze, noch sind sie implicite in ihr enthalten, sondern sie ist ein eignes von allem Gegensatz geschiedenes Wesen, an dem alle Gegensätze sich brechen, das nichts anderes ist als eben das Nichtseyn derselben, und das darum auch kein Prädicat hat als eben das der Prädicatlosigkeit, ohne daß es deswegen ein Nichts oder ein Unding wäre. Entweder also sie setzen in dem vor allem Grund vorhergehenden Ungrund wirklich die Indifferenz: so haben sie weder gut noch bös (denn daß die Erhebung des Gegensatzes von Gut und Bös auf diesen Standpunkt überhaupt unstatthaft ist, lassen wir einstweilen auf sich beruhen) - und können von ihm auch weder das eine noch das andere, noch auch beides zugleich prädiciren. Oder sie setzen Gut und Bös: so setzen sie auch gleich die Dualität und also schon nicht mehr den Ungrund oder die Indifferenz. Zur Erläuterung des letzten sey Folgendes gesagt! Reales und Ideales, Finsterniß und Licht, oder wie wir die beiden Principien sonst bezeichnen wollen, können von dem Ungrund niemals als Gegensätze prädicirt werden. Aber es hindert nichts, daß sie nicht als Nichtgegensätze, d.h. in der Disjunktion und jedes für sich von ihm prädicirt werden, womit aber eben die Dualität (die wirkliche Zweiheit der Principien) gesetzt ist. In dem Ungrund selbst ist nichts, wodurch dieß verhindert würde. Denn eben weil er sich gegen beide als totale Indifferenz verhält, ist er gegen beide gleichgültig. Wäre er die absolute Identität von beiden, so könnte er nur beide zugleich seyn, d.h. beide müßten als Gegensätze von ihm prädicirt werden, und wären dadurch selber wieder eins. Unmittelbar aus dem Weder - Noch oder der Indifferenz bricht also die Dualität hervor (die etwas ganz anderes ist als Gegensatz, wenn wir auch bisher, da wir noch nicht zu diesem Punkt der Untersuchung gelangt waren, beides als gleichbedeutend gebraucht haben sollten), und ohne Indifferenz, d.h. ohne einen Ungrund, gäbe es keine Zweiheit der Principien. Anstatt also, daß dieser die Unterscheidung wieder aufhöbe, wie gemeint wurde, setzt und bestätigt er sie vielmehr. Weit entfernt, daß die Unterscheidung zwischen dem Grund und dem Existirenden eine bloß logische, oder nur zur Aushilfe herbeigerufene und am Ende wieder als unecht zu befindende gewesen wäre, zeigte sie sich vielmehr als eine sehr reelle Unterscheidung, die von dem höchsten Standpunkt aus erst recht bewährt und völlig begriffen wurde. Nach dieser dialektischen Erörterung können wir uns also ganz bestimmt auf folgende Art erklären. Das Wesen des Grundes, wie das des Existirenden, kann nur das vor allem Gründe Vorhergehende seyn, also das schlechthin betrachtete Absolute, der Ungrund. Er kann es aber (wie bewiesen) nicht anders seyn, als indem er in zwei gleich ewige Anfänge auseinandergeht, nicht daß er beide zugleich, sondern daß er in jedem gleicherweise, also in jedem das Ganze, oder ein eignes Wesen ist. Der Ungrund theilt sich aber in die zwei gleich ewigen Anfänge, nur damit die zwei, die in ihm, als Ungrund, nicht zugleich oder Eines seyn konnten, durch Liebe eins werden, d.h. er theilt sich nur, damit Leben und Lieben sey und persönliche Existenz. Denn Liebe ist weder in der Indifferenz, noch wo Entgegengesetzte verbunden sind, die der Verbindung zum Seyn bedürfen, sondern (um ein schon gesagtes Wort zu wiederholen) dieß ist das Geheimniß der Liebe, daß sie solche verbindet, deren jedes für sich seyn könnte und doch nicht ist, und nicht seyn kann ohne das andere 36). Darum sowie im Ungrund die Dualität wird, wird auch die Liebe, welche das Existirende (Ideale) mit dem Grund zur Existenz verbindet. Aber der Grund bleibt frei und unabhängig von dem Wort bis zur endlichen gänzlichen Scheidung. Dann löst er sich auf, wie im Menschen, wenn er zur Klarheit übergeht und als bleibendes Wesen sich gründet, die anfängliche Sehnsucht sich löst, indem alles Wahre und Gute in ihr ins lichte Bewußtseyn erhoben wird, alles andere aber, das Falsche nämlich und Unreine, auf ewig in die Finsterniß beschlossen, um als ewig dunkler Grund der Selbstheit, als Caput mortuum seines Lebensprozesses und als Potenz zurückzubleiben, die nie zum Aktus hervorgehen kann. Dann wird alles dem Geist unterworfen: in dem Geist ist das Existirende mit dem Grunde zur Existenz eins; in ihm sind wirklich beide zugleich, oder er ist die absolute Identität beider. Aber über dem Geist ist der anfängliche Ungrund, der nicht mehr Indifferenz (Gleichgültigkeit) ist, und doch nicht Identität beider Principien, sondern die allgemeine, gegen alles gleiche und doch von nichts ergriffene Einheit, das von allem freie und doch alles durchwirkende Wohlthun, mit Einem Wort die Liebe, die Alles in Allem ist. Wer also (wie vorhin) sagen wollte: es sey in diesem System Ein Princip für alles, es sey ein und dasselbe Wesen, das im finstern Naturgrund und das in der ewigen Klarheit waltet, ein und dasselbe, das die Härte und Abgeschnittenheit der Dinge, und das die Einheit und Sanftmuth wirkt, das nämliche, das mit dem Willen der Liebe im Guten und mit dem Willen des Zornes im Bösen herrscht, der hätte, obgleich er das alles ganz richtig sagt, doch dieß nicht zu vergessen: daß das Eine Wesen in seinen zwei Wirkungsweisen sich wirklich in zwei Wesen scheidet, daß es in dem einen bloß Grund zur Existenz, in dem andern bloß Wesen (und darum nur ideal ist); ferner daß nur Gott als Geist die absolute Identität beider Principien, aber nur dadurch und insofern ist, daß und inwiefern beide seiner Persönlichkeit unterworfen sind. Wer aber vollends auf dem höchsten Standpunkt dieser Ansicht eine absolute Identität des Guten und Bösen fände, zeigte seine gänzliche Unkunde, indem Böses und Gutes durchaus keinen ursprünglichen Gegensatz, am allerwenigsten aber eine Dualität bilden. Dualität ist, wo sich wirklich zwei Wesen entgegenstehen. Das Böse aber ist kein Wesen, sondern ein Unwesen, das nur im Gegensatz eine Realität ist, nicht an sich. Auch ist die absolute Identität, der Geist der Liebe, eben darum eher als das Böse, weil dieses erst im Gegensatz mit ihm erscheinen kann. Daher es auch nicht von der absoluten Identität begriffen seyn kann, sondern ewig von ihr ausgeschlossen und ausgestoßen ist 37). Wer endlich darum, weil in bezug auf das Absolute schlechthin betrachtet alle Gegensätze verschwinden, dieses System Pantheismus nennen wollte, dem möchte auch dieses vergönnt seyn 38). Wir lassen gern jedem seine Weise, sich die Zeit, und was in ihr ist, verständlich zu machen. Der Name tuts nicht; auf die Sache kommt es an. Die Eitelkeit einer Polemik aus bloßen Allgemeinbegriffen philosophischer Systeme gegen ein Bestimmtes, das wohl mit ihnen manchen Berührungspunkt gemein haben kann und daher auch schon mit allen verwechselt worden ist, das aber in jedem einzelnen Punkt seine eigentümlichen Bestimmungen hat - die Eitelkeit einer solchen Polemik haben wir schon im Eingange zu dieser Abhandlung berührt. So ist es geschwind zu sagen, ein System lehre die Immanenz der Dinge in Gott; und doch wäre z.B. in bezug auf uns damit nichts gesagt, ob es gleich nicht geradezu unwahr heißen könnte. Denn wir haben genugsam gezeigt, daß alle Naturwesen ein bloßes Seyn im Grunde, oder in der noch nicht zur Einheit mit dem Verstande gelangten anfänglichen Sehnsucht haben, daß sie also in bezug auf Gott bloß peripherische Wesen sind. Nur der Mensch ist in Gott, und eben durch dieses in-Gott-Seyn der Freiheit fähig. Er allein ist ein Centralwesen und soll darum auch im Centro bleiben. In ihm sind alle Dinge erschaffen, so wie Gott nur durch den Menschen auch die Natur annimmt und mit sich verbindet. Die Natur ist das erste oder alte Testament, da die Dinge noch außer dem Centro und daher unter dem Gesetze sind. Der Mensch ist der Anfang des neuen Bundes, durch welchen als Mittler, da er selbst mit Gott verbunden wird, Gott (nach der letzten Scheidung) auch die Natur annimmt und zu sich macht. Der Mensch ist also der Erlöser der Natur, auf den alle Vorbilder derselben zielen. Das Wort, das im Menschen erfüllt wird, ist in der Natur als ein dunkles, prophetisches (noch nicht völlig ausgesprochenes) Wort. Daher die Vorbedeutungen, die in ihr selbst keine Auslegung haben und erst durch den Menschen erklärt werden. Daher die allgemeine Finalität der Ursachen, die ebenfalls nur von diesem Standpunkt verständlich wird. Wer nun alle diese Mittelbestimmungen ausläßt oder übersieht, der hat leicht zu widerlegen. Es ist um die bloß historische Kritik zwar eine bequeme Sache. Man braucht dabei nichts selbst, aus eignem Vermögen, hinzustellen, und kann das Caute, per Deos! incede, latet ignis sub cinere doloso, trefflich beobachten. Dabei sind aber willkürliche und unbewiesene Voraussetzungen unvermeidlich. So um zu beweisen, daß es nur zwei Erklärungsarten des Bösen gebe - die dualistische, nach welcher ein böses Grundwesen, gleichviel mit welchen Modifikationen unter oder neben dem guten, angenommen wird, und die kabbalistische, nach welcher das Böse durch Emanation und Entfernung erklärt wird - und daß deshalb jedes andere System den Unterschied von Gut und Bös aufheben müsse; um dieß zu beweisen, würde nichts weniger als die ganze Macht einer tief ersonnenen und gründlich ausgebildeten Philosophie erfordert. In dem System hat jeder Begriff seine bestimmte Stelle, an der er allein gilt, und die auch seine Bedeutung, so wie seine Limitation bestimmt. Wer nun nicht auf das Innere eingeht, sondern nur die allgemeinsten Begriffe aus dem Zusammenhange heraushebt, wie mag der das Ganze richtig beurtheilen? So haben wir den bestimmten Punkt des Systems aufgezeigt, wo der Begriff der Indifferenz allerdings der einzige vom Absoluten mögliche ist. Wird er nun allgemein genommen, so wird das Ganze entstellt, es folgt dann auch, daß dieses System die Personalität des höchsten Wesens aufhebe. Wir haben zu diesem oft gehörten Vorwurf wie zu manchem andern bisher geschwiegen, glauben aber in dieser Abhandlung den ersten deutlichen Begriff derselben aufgestellt zu haben. In dem Ungrund oder der Indifferenz ist freilich keine Persönlichkeit; aber ist denn der Anfangspunkt das Ganze? Nun fordern wir die, welche jenen Vorwurf so leichthin gemacht, auf, uns dagegen nach ihren Ansichten auch nur das geringste Verständliche über diesen Begriff vorzubringen. Ueberall finden wir vielmehr, daß sie die Persönlichkeit Gottes als unbegreiflich und auf keine Weise verständlich zu machen angeben, woran sie auch ganz recht thun, indem sie eben jene abstrakten Systeme, in denen alle Persönlichkeit überhaupt unmöglich ist, für die einzigen vernunftgemäßen halten, was vermuthlich auch der Grund ist, daß sie jedem die nämlichen zutrauen, der nicht Wissenschaft und Vernunft verachtet. Wir im Gegentheil sind der Meinung, daß eben von den höchsten Begriffen eine klare Vernunfteinsicht möglich seyn muß, indem sie nur dadurch uns wirklich eigen, in uns selbst aufgenommen und ewig gegründet weiden können. Ja, wir gehen noch weiter, und halten mit Lessing selbst die Ausbildung geoffenbarter Wahrheiten in Vernunftwahrheiten für schlechterdings nothwendig, wenn dem menschlichen Geschlecht damit geholfen werden soll 39). Ebenso sind wir überzeugt, daß, um jeden möglichen Irrthum (in eigentlich geistigen Gegenständen) darzuthun, die Vernunft vollkommen hinreiche, und die Ketzerrichtende Miene bei Beurtheilung philosophischer Systeme ganz entbehrlich sey 40). Ein absoluter Dualismus von Gut und Bös in die Geschichte übergetragen, wonach in allen Erscheinungen und Werken des menschlichen Geistes entweder das eine oder das andere Princip herrscht, wonach es nur zwei Systeme und zwei Religionen gibt, eine absolut gute und eine schlechthin böse; ferner die Meinung, daß alles vom Reinen und Lautem angefangen, und alle späteren Entwicklungen (die doch nothwendig waren, um die in der ersten Einheit enthaltenen partiellen Seiten und dadurch sie selbst vollkommen zu offenbaren) nur Verderbniß und Verfälschungen gewesen: diese ganze Ansicht dient zwar in der Kritik als ein mächtiges Alexanders-Schwert, um überall den gordischen Knoten ohne Mühe entzwei zu hauen, führt aber in die Geschichte einen durchaus illiberalen und höchst beschränkenden Gesichtspunkt ein. Es war eine Zeit, die vor jener Trennung vorherging, und eine Weltansicht und Religion, die, obgleich der absoluten entgegengesetzt, doch aus eignem Gründe entsprang, und nicht aus Verfälschung der ersten. Das Heiligthum ist, historisch genommen, so ursprünglich als das Christenthum und, wenn gleich nur Grund und Basis des Höheren, doch von keinem andern abgeleitet. Diese Betrachtungen führen auf unsern Anfangspunkt zurück. Ein System, das den heiligsten Gefühlen, das dem Gemüth und sittlichen Bewußtseyn widerspricht, kann, in dieser Eigenschaft wenigstens, nie ein System der Vernunft, sondern nur der Unvernunft heißen. Dagegen würde ein System, worin die Vernunft sich selbst wirklich erkennte, alle Anforderungen des Geistes wie des Herzens, des sittlichsten Gefühls wie des strengsten Verstandes vereinigen müssen. Die Polemik gegen Vernunft und Wissenschaft verstattet zwar eine gewisse vornehme Allgemeinheit, die genaue Begriffe umgeht, so daß wir leichter die Absichten derselben als ihren bestimmten Sinn erraten können. Indes fürchten wir, wenn wir es auch ergründeten, doch auf nichts Außerordentliches zu stoßen. Denn so hoch wir auch die Vernunft stellen, glauben wir doch z.B. nicht, daß jemand aus reiner Vernunft tugendhaft, oder ein Held, oder überhaupt ein großer Mensch sey; ja nicht einmal, nach der bekannten Rede, daß das Menschengeschlecht durch sie fortgepflanzt werde. Nur in der Persönlichkeit ist Leben; und alle Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln Grunde, der also allerdings auch Grund der Erkenntniß seyn muß. Aber nur der Verstand ist es, der das in diesem Grunde verborgene und bloß potentialiter enthaltene herausbildet und zum Aktus erhebt. Dieß kann nur durch Scheidung geschehen, also durch Wissenschaft und Dialektik, von denen wir überzeugt sind, daß sie allein es seyn werden, die jenes öfter, als wir denken, da gewesene, aber immer wieder entflohene, uns allen vorschwebende und noch von keinem ganz ergriffene System festhalten und zur Erkenntniß auf ewig bringen werden. Wie wir im Leben eigentlich nur kräftigem Verstände trauen, und am meisten bei denen, die uns immer ihr Gefühl zur Schau legen, jedes wahre Zartgefühl vermissen, so kann auch, wo es sich um Wahrheit und Erkenntniß handelt, die Selbstheit, die es bloß bis zum Gefühl gebracht hat, uns kein Vertrauen abgewinnen. Das Gefühl ist herrlich, wenn es im Gründe bleibt; nicht aber, wenn es an den Tag tritt, sich zum Wesen machen und herrschen will. Wenn, nach den trefflichen Ansichten Franz Baaders, der Erkenntnißtrieb die größte Analogie mit dem Zeugungstrieb hat 41), so gibt es auch in der Erkenntniß etwas der Zucht und Verschämtheit Analoges, und dagegen auch eine Un-Zucht und Schamlosigkeit, eine Art faunischer Lust, die an allem herumkostet, ohne Ernst und ohne Liebe, etwas zu bilden oder zu gestalten. Das Band unserer Persönlichkeit ist der Geist, und wenn nur die werkthätige Verbindung beider Principien schaffend und erzeugend werden kann, so ist Begeisterung im eigentlichen Sinn das wirksame Princip jeder erzeugenden und bildenden Kunst oder Wissenschaft. Jede Begeisterung äußert sich auf eine bestimmte Weise; und so gibt es auch eine, die sich durch dialektischen Kunsttrieb äußert, eine eigentlich wissenschaftliche Begeisterung. Es gibt darum auch eine dialektische Philosophie, die als Wissenschaft bestimmt, z.B. von Poesie und Religion, geschieden, und etwas ganz für sich Bestehendes, nicht aber mit allem Möglichen nach der Reihe eins ist, wie die behaupten, welche jetzt in so vielen Schriften alles mit allem zu vermischen bemüht sind. Man sagt, die Reflexion sey gegen die Idee feindselig; aber gerade dieß ist der höchste Triumph der Wahrheit, daß sie aus der äußersten Scheidung und Trennung dennoch siegreich hervortritt. Die Vernunft ist in dem Menschen das, was nach den Mystikern das Primum passivum in Gott oder die anfängliche Weisheit ist, in der alle Dinge beisammen und doch gesondert, eins und doch jedes frei in seiner Art sind. Sie ist nicht Thätigkeit, wie der Geist, nicht absolute Identität beider Principien der Erkenntniß, sondern die Indifferenz; das Maß und gleichsam der allgemeine Ort der Wahrheit, die ruhige Stätte, darin die ursprüngliche Weisheit empfangen wird, nach welcher, als dem Urbild hinblickend, der Verstand bilden soll. Die Philosophie hat ihren Namen einerseits von der Liebe, als dem allgemein begeisternden Princip, andererseits von dieser ursprünglichen Weisheit, die ihr eigentliches Ziel ist. Wenn der Philosophie das dialektische Princip, d.h. der sondernde, aber eben darum organisch ordnende und gestaltende, Verstand, zugleich mit dem Urbild, nach dem er sich richtet, entzogen wird, so, daß sie in sich selbst weder Maß noch Regel mehr hat: so bleibt ihr allerdings nichts anderes übrig, als daß sie sich historisch zu orientiren sucht, und die Ueberlieferung, an welche bei einem gleichen Resultat schon früher verwiesen worden, zur Quelle und Richtschnur nimmt. Dann ist es Zeit, wie man die Poesie bei uns durch die Kenntniß der Dichtungen aller Nationen zu begründen meinte, auch für die Philosophie eine geschichtliche Norm und Grundlage zu suchen. Wir hegen die größte Achtung für den Tiefsinn historischer Nachforschungen, und glauben gezeigt zu haben, daß die fast allgemeine Meinung, als habe der Mensch erst allmählich von der Dumpfheit des thierischen Instinkts zur Vernunft sich aufgerichtet, nicht die unserige sey. Dennoch glauben wir, daß die Wahrheit uns näher liege, und daß wir für die Probleme, die zu unserer Zeit rege geworden sind, die Auflösung zuerst bei uns selbst und auf unserem eignen Boden suchen sollen, ehe wir nach so entfernten Quellen wandeln. Die Zeit des bloß historischen Glaubens ist vorbei, wenn die Möglichkeit unmittelbarer Erkenntniß gegeben ist. Wir haben eine ältere Offenbarung als jede geschriebene, die Natur. Diese enthält Vorbilder, die noch kein Mensch gedeutet hat, während die der geschriebenen ihre Erfüllung und Auslegung längst erhalten haben. Das einzig wahre System der Religion und Wissenschaft würde, wenn das Verständniß jener ungeschriebenen Offenbarung eröffnet wäre, nicht in dem dürftig zusammengebrachten Staat einiger philosophischen und kritischen Begriffe, sondern zugleich in dem vollen Glänze der Wahrheit und der Natur erscheinen. Es ist nicht die Zeit, alte Gegensätze wieder zu erwecken, sondern das außer und über allem Gegensatz Liegende zu suchen. Gegenwärtiger Abhandlung wird eine Reihe anderer folgen, in denen das Ganze des ideellen Theils der Philosophie allmählich dargestellt wird. ___________ 1) Diese Bemerkungen bildeten ursprünglich einen Theil der Vorrede zu Schellings Philosophischen Schriften, erster Band, Landshut 1809, wo die Abhandlung zuerst erschien. D. H. 2) [Schellings Werke I, IV.] 3) Sext. Empir. adv. Grammaticos L. I, c. 13, p. 238. ed. Fabric. 4) Frühere Behauptungen der Art sind bekannt. Ob die Aeußerung von Fr. Schlegel in der Schrift: Ueber die Sprache und Weisheit der Indier S. 141: «der Pantheismus ist das System der reinen Vernunft» etwa einen andern Sinn haben könne, lassen wir dahingestellt. 5) Auch Hr. Reinhold, welcher die ganze Philosophie durch Logik umschaffen wollte, der aber nicht zu kennen scheint, was schon Leibniz, in dessen Fußtapfen er zu wandeln sich vorstellt, bei Gelegenheit der Einwürfe des Wissowatius (Opp. T. I ed. Dutens, p. 11) über den Sinn der Copula gesagt hat, zerarbeitet sich noch immer an diesem Irrsal, nach welchem er Identität mit Einerleiheit verwechselt. In einem vor uns liegenden Blatt steht folgende von ihm herrührende Stelle: «Nach der Anforderung Platons und Leibnizens besteht die Aufgabe der Philosophie in Aufweisung der Unterordnung des Endlichen unter das Unendliche, nach der Anforderung Xenophanes, Brunos, Spinozas, Schellings im Aufweisen der unbedingten Einheit beider.» Inwiefern hier Einheit dem Gegensatz zufolge offenbar Gleichheit bezeichnen soll, versichere ich Hrn. Reinhold, daß er, wenigstens was die beiden letzten betrifft, sich im Irrthum befinde. Wo ist für die Unterordnung des Endlichen unter das Unendliche ein schärferer Ausdruck zu finden als der obige des Spinoza? Die Lebenden müssen sich der nicht mehr Gegenwärtigen wider Verunglimpfungen annehmen, wie wir erwarten, daß im gleichen Falle die nach uns Lebenden in Ansehung unsrer thun werden. Ich rede nur von Spinoza, und frage, wie man dieses Verfahren nennen soll, über Systeme, ohne sie gründlich zu kennen, in den Tag hinein zu behaupten, was man gut findet, gleich als wäre es eben eine Kleinigkeit, ihnen dieß oder jenes anzudichten? In der gewöhnlichen sittlichen Gesellschaft würde es gewissenlos genannt werden. - Nach einer andern Stelle in dem nämlichen Blatt liegt für Hrn. R. der Grundfehler aller neueren Philosophie, ebenso wie jener älteren, in der Nichtunterscheidung (Verwirrung, Verwechslung) der Einheit (Identität) mit dem Zusammenhang (Nexus), so wie der Verschiedenheit (Diversität) mit dem Unterschiede. Es ist nicht das erste Beispiel, daß Hr. R. in seinen Gegnern eben die Fehler findet, die er zu ihnen mitgebracht hat. Es scheint dieß die Art zu seyn, wie er die nötige Medicina mentis für sich gebraucht; wie man Beispiele haben will, daß Personen von reizbarer Einbildungskraft durch Arzneien, die sie andere für sich nehmen ließen, genesen sind. Denn wer begeht diesen Fehler der Verwechslung - dessen, was er Einheit nennt, was aber Einerleiheit ist - mit dem Zusammenhang in bezug auf ältere und neuere Philosophie bestimmter als eben Hr. R. selbst, der das Begriffenseyn der Dinge in Gott dem Spinoza als behauptete Gleichheit beider auslegt, und der allgemein die Nichtverschiedenheit (der Substanz oder dem Wesen nach) für einen Nichtunterschied (der Form oder dem logischen Begriff nach) hält. Wenn Spinoza wirklich so zu verstehen ist, wie ihn Hr. Reinhold auslegt, so müßte auch der bekannte Satz, daß das Ding und der Begriff des Dings eins ist, so verstanden werden, als könnte man z.B. den Feind anstatt mit einer Armee mit dem Begriff einer Armee schlagen usw., Consequenzen, zu denen der ernsthafte und nachdenkliche Mann sich doch gewiß selbst zu gut findet. 6) Den Rath, den Hr. Fr. Schlegel in einer Recension der neueren Schriften Fichtes in den Heidelbergischen Jahrb. der Literatur (1. Jahrg., 6. Heft, S. 139) dem letzten ertheilt, sich bei seinen polemischen Unternehmungen ausschließlich an den Spinoza zu halten, weil bei diesem allein das der Form und Konsequenz nach durchaus vollendete System des Pantheismus - welcher nach der oben angeführten Aeußerung zugleich das System der reinen Vernunft wäre - angetroffen werde; dieser Rat mag zwar übrigens gewisse Vortheile gewähren, fällt aber doch dadurch ins Sonderbare, daß Hr. Fichte ohne Zweifel der Meinung ist, den Spinozismus (als Spinozismus) bereits durch die Wissenschaftslehre widerlegt zu haben, woran er auch ganz Recht hat. - Oder ist der Idealismus vielleicht kein Werk der Vernunft, und bleibt die vermeintliche traurige Ehre, Vernunftsystem zu seyn, wirklich nur dem Pantheismus und Spinozismus? 7) Hr. Fr. Schlegel hat das Verdienst, in seiner Schrift über Indien und an mehreren Orten diese Schwierigkeit besonders gegen den Pantheismus geltend gemacht zu haben; wobei bloß zu bedauern ist, daß dieser scharfsinnige Gelehrte seine eigne Ansicht vom Ursprung des Bösen und seinem Verhältniß zum Guten nicht mitzutheilen für gut befunden hat. 8) Ennead. I, L. VIII, c. 8. 9) Man s. dieselbe in der Zeitschr. für spekul. Physik Bd. II, Heft 2, § 54 Anm. [IV, S. 146] ferner Anm. 1 zu § 93 und die Erklärung S. 114. [Schellings Werke IV, S. 203]. 10) A. a. O. S. 59. 60. [Schellings Werke IV, S. 163]. 11) Ebendas. S. 41. [Schellings Werke IV, S. 146]. 12) Das S. 114. [Schellings Werke IV, S. 203]. 13) Es ist dieß der einzig rechte Dualismus, nämlich der, welcher zugleich eine Einheit zuläßt. Oben war von dem modificirten Dualismus die Rede, nach welchem das böse Princip dem guten nicht bei-, sondern untergeordnet ist. Kaum ist zu fürchten, daß jemand das hier aufgestellte Verhältniß mit jenem Dualismus verwechseln werde, in welchem das Untergeordnete immer ein wesentlich-böses Princip ist und eben darum seiner Abkunft aus Gott nach völlig unbegreiflich bleibt. 14) In dem Sinne, wie man sagt: das Wort des Räthsels. 15) In der Abhandlung: «Ueber die Behauptung, daß kein übler Gebrauch der Vernunft seyn kann», im Morgenblatt 1807, Nr. 197, und: «Ueber Starres und Fließendes», in den Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft III. Bd., 2. Heft. Zur Vergleichung und weitem Erläuterung stehe auch hier die hierher bezügliche Anmerkung am Ende dieser Abhandlung S. 203: «Einen lehrreichen Aufschluß gibt hier das gemeine Feuer (als wilde, verzehrende, peinliche Glut) im Gegensatze der sogenannten organischen wohltuenden Lebensglut, indem hier Feuer und Wasser in Einem (wachsenden) Grunde zusammen, oder in Konjunktion eingehen, während sie dort in Zwietracht auseinander treten. Nun war aber weder Feuer noch Wasser, als solche, d.h. als geschiedene Sphären im organischen Prozesse, sondern jenes war als Centrum (mysterium), dieses als offen oder Peripherie in ihm, und eben die Aufschließung, Erhebung, Entzündung des ersten zusammen mit der Verschließung des zweiten gab Krankheit und Tod. So ist nun allgemein die Ichheit, Individualität freilich die Basis, das Fundament oder natürliches Centrum jedes Creaturlebens; sowie selbes aber aufhört dienendes Centrum zu seyn und herrschend in Peripherie tritt, brennt es als tantalischer Grimm der Selbstsucht und des Egoismus (der entzündeten Ichheit) in ihr. Aus wird nun - das heißt: an einer einzigen Stelle des Planetensystems ist jenes finstere Naturcentrum verschlossen, latent, und dient eben darum als Lichtträger dem Eintritt des höheren Systems (Lichteinstrahl- oder Offenbarung des Ideellen). Eben darum ist also diese Stelle der offene Punkt (Sonne - Herz - Auge) im Systeme - und erhöbe oder öffnete sich auch dort das finstere Naturcentrum, so verschlösse sich eo ipso der Lichtpunkt, das Licht würde zur Finsterniß im System, oder die Sonne erlösche!» 16) Tentam. theod. Opp. T. I., p. 136. 17) Ebendas. S. 240. 18) Ebendas. S. 387. 18) Es ist in dieser Beziehung auffallend, daß nicht erst die Scholastiker, sondern schon unter den früheren Kirchenvätern mehrere, vorzüglich Augustinus, das Böse in eine bloße Privation setzten. Merkwürdig ist besonders die Stelle contr. Jul. L. 1, C. III: Quaerunt ex nobis, unde sit malum? Respondemus ex bono, sed non summo, ex bonis igitur orta sunt mala. Mala enim omnia participant ex bono, merum enim et ex omni parte tale dari repugnat. - - Haud vero difficulter omnia expediet, qui conceptum mali semel recte formaverit, eumque semper defectum aliquem involvere attenderit, perfectionem autem omnimodam incommunicabiliter possidere Deum; neque magis possibile esse, creaturam illimitatam adeoque independentem creari, quam creari alium Deum. 20) Tentam. theod. p. 242. 21) Ebendas. P. I. § 30. 22) Aus dem gleichen Grunde muß jede andere Erklärung der Endlichkeit, z.B. aus dem Begriff der Relationen, zur Erklärung des Bösen unzureichend seyn. Das Böse kommt nicht aus der Endlichkeit an sich, sondern aus der zum Selbstseyn erhobenen Endlichkeit. 23) In der oben angeführten Morgenblatt 1807, S. 786. Abhandlung im 24) Augustinus sagt gegen die Emanation: aus Gottes Substanz könne nichts hervorgehen denn Gott; darum sey die Creatur aus Nichts erschaffen, woher ihre Korruptibilität und Mangelhaftigkeit komme (de lib. arb. L. I, C. 2). Jenes Nichts ist nun schon lange das Kreuz des Verstandes. Einen Aufschluß gibt der Ausdruck der Schrift: der Mensch sey ἐκ τῶν μὴ ὄντων, aus dem, das da nicht ist, geschaffen, so wie das berühmte μὴ ὄν der Alten, welches, so wie die Schöpfung aus Nichts, durch die obige Unterscheidung zuerst eine positive Bedeutung bekommen möchte. 25) Möge es einst der treffliche Erklärer des Platon, oder noch früher der wackere Böckh aufhellen, der dazu schon durch seine Bemerkungen bei Gelegenheit der von ihm dargestellten Platonischen Harmonik und durch die Ankündigung seiner Ausgabe des Timäos die besten Hoffnungen gegeben hat. 26) So ist die nahe Verbindung, in welche die Imagination aller Völker, besonders alle Fabeln und Religionen des Morgenlandes, die Schlange mit dem Bösen setzen, gewiß nicht umsonst. Die vollkommene Ausbildung der H�lfsorgane, die im Menschen aufs Höchste gediehen ist, deutet nämlich schon die Unabhängigkeit des Willens von den Begierden oder ein Verhältniß von Centrum und Peripherie an, welches das einzig eigentlich gesunde ist, in dem das erste in seine Freiheit und Besonnenheit zurückgetreten sind, und vom bloß Werkzeuglichen (Peripherischen) sich geschieden hat. Wo hingegen die H�lfsorgane nicht ausgebildet sind oder ganz mangeln, da ist das Centrum in die Peripherie getreten, oder es ist der mittelpunktlose Ring in der oben angeführten Stelle von Fr. Baader. 27) Man vergleiche mit diesem ganzen Abschnitt des Verfassers Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, VIII. Vorlesung über die historische Construktion des Christenthums [Schellings Werke Bd. II, 616 ff.]. 28) So Luther im Traktat de servo arbitrio: mit Recht, wenn er auch die Vereinigung einer solchen unfehlbaren Nothwendigkeit mit der Freiheit der Handlungen nicht auf die rechte Art begriffen. 29) Der Platonische Ausdruck im Timäos S. 349, Vol. IX. der Zweibr. Ausg.; früher in Tim. Locr. de an. mundi, ebendas. S. 5 30) Sehr richtige Bemerkungen über diese moralische Genialität des Zeitalters enthält die mehrmals angeführte Recension von Hrn. Fr. Schlegel in den Heidelb. Jahrbüchern, S. 154. 31) Ein junger Mann, der wahrscheinlich, wie jetzt viele andere, zu hochmüthig, den ehrlichen Weg Kants zu wandeln, und doch unfähig, sich zum wirklich Besseren zu erheben, ästhetisch irre redet, hat bereits eine solche Begründung der Moral durch Aesthetik angekündigt. Bei solchen Fortschritten wird vielleicht aus dem Kantischen Scherz, den Euklides als eine etwas schwerfällige Anleitung zum Zeichnen zu betrachten, auch noch Ernst werden. 32) Tentam. theod. Opp. T. I, p. 365. 366. 33) Kleeblatt hellenistischer Briefe II, S. 196. 34) Tentam. theod. p. 139: «Ex bis concludendum est, Deum antecedenter velle omne bonum in se, velle consequenter optimum tanquam finem; indifferens et malum physicum tanquam medium; sed velle tantum permittere malum morale, tanquam conditionem, sine qua non obtineretur optimum, ita nimirum, ut malum nonnisi titulo necessitatis hypotheticae, id ipsum cum optimo connectentis, admittatur». - p. 292: Quod ad vitium attinet, superius ostensum est, illud non esse objectum decreti divini, tanquam medium, sed tanquam conditionem sine qua non - et ideo duntaxat permitti. Diese zwei Stellen enthalten den Kern der ganzen Leibnizischen Theodicee. 35) Philosophie und Religion, (Tübingen. 1804) S. 73. [Schellings Werke IV, S. 63]. 36) Aphorismen über die Naturphilosophie in den Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft. Bd. I, Heft 1. Aphor. 162. 163. [Schellings Werke I, VII 174: 162. Der Unterschied einer göttlichen Identität von einer bloß endlichen ist, daß in jener nicht Entgegengesetzte verbunden werden, die der Verbindung bedürfen, sondern solche, deren jedes für sich seyn könnte und doch nicht ist ohne das andere. 163. Dieß ist das Geheimniß der ewigen Liebe, daß, was für sich absolut seyn möchte, dennoch es für keinen Raub achtet, es für sich zu seyn, sondern es nur in und mit dem andern ist. Wäre nicht jedes ein Ganzes, sondern nur Theil des Ganzen, so wäre nicht Liebe: Darum aber ist Liebe, weil jedes ein Ganzes ist und dennoch nicht ist und nicht seyn kann ohne das andere.] 37) Hieraus erhellt, wie sonderbar es ist, zu fordern, daß der Gegensatz von Gut und Bös gleich in den ersten Principien erklärt werde. So reden muß freilich, wer Gut und Bös für eine wirkliche Dualität und den Dualismus für das vollkommenste System hält. 38) Niemand kann mehr als der Verfasser in den Wunsch einstimmen, den Hr. Fr. Schlegel in den Heidelb. Jahrb. H. 2, S. 242 äußert, daß der unmännliche pantheistische Schwindel in Deutschland aufhören möge, besonders, da Hr. S. auch die ästhetische Träumerei und Einbildung dazusetzt, und inwiefern wir zugleich die Meinung von der allsschließenden Vernunftmäßigkeit des Spinozismus mit zu jenem Schwindel rechnen dürfen. Es ist zwar in Deutschland, wo ein philosophisches System Gegenstand literarischer Industrie wird, und so viele, denen die Natur selbst für alltägliche Dinge den Verstand versagt hat, sich zum Mitphilosophiren berufen glauben, sehr leicht, eine falsche Meinung, ja sogar einen Schwindel zu erregen. Beruhigen kann wenigstens das Bewußtseyn, ihn nie persönlich begünstigt oder durch eigne hilfreiche Unterstützung aufgemuntert zu haben, sondern mit Erasmus (so wenig man sonst mit ihm gemein haben mag) sagen zu können: semper solus esse volui nihilque pejus odi quam juratos et factiosos. Der Verfasser hat nie durch Stiftung einer Sekte andern, am wenigsten sich selbst die Freiheit der Untersuchung nehmen wollen, in welcher er sich noch immer begriffen erklärte und wohl immer begriffen erklären wird. Den Gang, den er in gegenwärtiger. Abhandlung genommen, wo, wenn auch die äußere Form des Gesprächs fehlt, doch alles wie gesprächsweise entsteht, wird er auch künftig beibehalten. Manches konnte hier schärfer bestimmt und weniger lässig gehalten, manches vor Mißdeutung ausdrücklicher verwahrt werden. Der Verf. unterließ es zum Theil absichtlich. Wer es nicht so von ihm nehmen kann oder will, der nehme überhaupt nichts von ihm, er suche andere Quellen. Vielleicht aber, daß, von unberufenen Nachfolgern und Gegnern, dieser Abhandlung die Achtung zutheil wird, die sie der früheren, verwandten Schrift Philosophie und Religion durch gänzliches Ignoriren erwiesen haben, wozu die ersten gewiß weniger durch die Drohworte der Vorrede oder die Darstellungsart, als durch den Inhalt selbst bewogen wurden. 39) Erziehung des Menschengeschlechts, § 76. 40) Besonders wenn man auf der andern Seite da nur von Ansichten reden will, wo man von alleinseligmachenden Wahrheiten sprechen sollte. 41) Man s. die Abhandlung obigen Inhalts in den Jahrbüchern für Medicin. Bd. III, 1. Heft, S. 113. 20. Jahrhundert Georg Simmel 1858 - 1918 Der Autor Georg Simmel, Soziologe und neukantianischer Philosoph, wurde 1858 in Berlin geboren. 1901 wird er Professor in Berlin, 1914 in Straßburg. Beeinflußt von Kant und dem südwestdeutschen Neukantianismus ist er der Begründer der formalen Soziologie als einer selbständigen Einzelwissenschaft. Deren Untersuchungsgegenstand ist das Spektrum der abstrakt-generellen sozialen Formen (Über- und Unterordnung, Opposition, Konkurrenz, Arbeitsteilung usw.). Er stirbt 1918 in Straßburg. Die Verwandtenehe ex: Vossische Zeitung (Berlin), Sonntagsbeilagen Nr. 22-23 vom 3. und 10. 6. 1894. I Die wachsende Kenntnis von der Vergangenheit und der Gegenwart der Völker vertieft nach zwei entgegengesetzten Richtungen unsere Vorstellungen von dem, was an ihnen vergleichbar ist. Unter der buntesten Mannigfaltigkeit der oberflächlichen Erscheinung überrascht uns tiefgelegene Gleichheit; was als prinzipielle Verschiedenheit auftritt, zeigt genauere Erkenntnis unzählige Male als bloße Variation des überall gleichen Themas. Und umgekehrt bewahrheitet die ausgedehntere Erfahrung täglich jenen alten philosophischen Glaubenssatz, dass es nicht zwei Erscheinungen in der Welt gäbe, die wirklich ganz und gar übereinstimmten: nicht zwei Baumblätter wären absolut gleich; und nach der Gleichheit des ersten Anblicks macht sich die Individualität jedes Wesens und jedes Geschehens geltend; neben dem, worin jedes mit jedem vergleichbar ist, stehen die Seiten, in denen keines mit keinem verglichen werden kann. Es gibt vielleicht kein Gebiet, auf dem eine allgemeine, die ganze bekannte Welt beherrschende Gleichheit sich in ebenso merkbare Verschiedenheiten der Ausgestaltung verzweigt, wie die Beziehungen zwischen Mann und Weib. Über den natürlichen Grundlagen dieser Beziehungen erheben sich überall, wo wir überhaupt von einer »Gesellschaft«, einem Zusammenleben Mehrerer in einer Gruppe hören, auch Gesetze zu ihrer Regelung, Normen und Formen fester wie loserer Bindungen, aufrecht erhalten durch Ordnungen der öffentlichen Gewalt oder, meistens nicht weniger streng, durch Sitte und Instinkt. Es werden zwar einige wilde Völker genannt, bei denen die Reisenden keine noch so unvollkommene Beziehung, die man als Ehe bezeichnen könnte, entdeckt haben; von den Buschmännern Südafrikas, von einigen Bewohnern Sumatras und Kaliforniens, welche letztere in ihrer Sprache kein Wort für »heiraten« haben, von ein paar kleinen Negerstämmen wird der Mangel aller Gesetze und Verbote auf diesem Gebiete gemeldet. Allein diese Fälle sind so verschwindend gering gegenüber denjenigen, wo sonst völlig gesetzlose, völlig kulturfremde Völker wenigstens hier eine Schranke der Willkür anerkennen, dass man sie ruhig als »unmessbare Größen« vernachlässigen kann, oder annehmen darf, dass eine ungenügende Beobachtung seitens des Berichterstatters vorliegt. Zu den verschiedensten Zeiten wie an den verschiedensten Punkten der Welt, unter den wildesten wie unter den höchststehenden Völkern treffen wir die Monogamie an, die unsere Kultur uns als das Selbstverständliche zu betrachten gelehrt hat; wir finden aber ebenso die Ehe eines Mannes mit mehreren Frauen, auch die Ehe mehrerer Männer mit einer Frau; ja, auch eine »Gruppenehe« findet sich, in der eine gewisse Anzahl von Männern mit einer gewissen Anzahl von Frauen in eheliche Verbindung tritt. Bald begegnet uns ein strenges Gebot, nur innerhalb des eigenen Stammes zu heiraten, bald ein ebenso strenges, nur außerhalb desselben die Gattin zu suchen. Neben der fast durchgehenden Herrschaft des Mannes gibt es doch auch Beispiele von Naturvölkern, die der Frau den überwiegenden Einfluss in der Familie einräumen. Während manche Völker dem Mädchen eine Mitgift zugestehen und ihr gewissermaßen den Mann kaufen, werden bei anderen umgekehrt die Frauen wie eine Ware gekauft; und wenn bei einigen die Frau durch die Ehe in die Familie des Mannes eintritt, geht anderwärts der Mann durch die Heirat in die Familie seiner Frau über. So gibt es keine ausdenkbare Kombination ehelicher Verhältnisse, zu der uns nicht die Geschichte und die Völkerkunde Beispiele aus der Wirklichkeit lieferte. Diese fast unübersehbare Mannigfaltigkeit der Eheformen aber birgt wieder einen durchgehenden gemeinsamen Zug: das Verbot der Ehe zwischen nahen Verwandten. Zwar sollen auch hier Ausnahmen vorkommen; von den Chippewäh-Indianern und den Karenen in Asien wird erzählt, dass sie gelegentlich ihre Mütter, Schwestern und Töchter heiraten. Sollte diese Tatsache aber auch wirklich unanzweifelbar sein, so geht sie wahrscheinlich auf eine jener merkwürdigen, mit der Verwandtenehe verbundenen Vorstellungen zurück, auf die ich später zu sprechen komme, und die nicht sowohl eine Gleichsetzung der Verwandtenehe mit jeder anderen, als eine Missdeutung gerade derjenigen Triebe und Erfahrungen beweist, die anderwärts zu ihrem Verbote geführt haben. Solchen vereinzelten Beispielen steht die ungeheure Anzahl der oft rigorosen Gesetze gegenüber, mit denen auch die rohesten Völker die eheliche Beziehung zwischen Verwandten verbieten, und die z.B. bei den Bataks auf Sumatra dies Verbrechen mit Tötung und Gefressenwerden bestrafen. Einige Munda-Kols stützten einem Missionär gegenüber ihre Behauptung, dass die Tiere nicht wüssten, was recht und was unrecht sei, durch die Begründung, dass die Tiere weder Mutter, noch Schwester, noch Tochter respektierten. An der Wiege der modernen Kultur war dies Gefühl nicht weniger lebendig: Plato nennt die Blutschande den schändlichsten, der Gottheit verhassten Frevel, und Lucan meint, wer dies tue, der scheue vor keiner sonstigen Untat zurück. Welches nun die verbotenen Verwandtschaftsgrade sind, darüber gibt es wieder eine Unermesslichkeit verschiedener Bestimmungen. Ich hebe von diesen als besonders wunderlich nur einige hervor, die die Geschwisterehe nicht schlechthin verbieten, sondern sie von dem Altersverhältnis der Geschwister abhängen lassen. Bei den Veddahs auf Ceylon, einem halbvertierten, in den Wäldern lebenden Stamme, in dem aber auf die strengste eheliche Treue gehalten wird, ist die Ehe mit der jüngeren Schwester durchaus legitim und natürlich, dagegen die mit der älteren Schwester oder der Tante wird mit demselben Abscheu betrachtet, den wir vor einer Geschwisterehe empfinden. Von den Nairs wird berichtet: »Sie ehren ihre älteren Schwestern, denen sie die gleiche Stellung wie der Mutter einräumen. Mit den jüngeren Schwestern aber bleiben sie niemals in demselben Zimmer und bewahren ihnen gegenüber die größte Reserve. Ohne dies, sagen sie, würden sie in zu große Versuchungen geraten während, was die älteren Schwestern betrifft, jede Idee einer näheren Verbindung durch den Respekt ausgeschlossen ist.« Obgleich die Nairs also den Veddahs gegenüber schon zu dem Verbot der Ehe auch mit der jüngeren Schwester vorgeschritten sind, zeigt dies eigentümliche Verhalten und seine Begründung doch, dass der Instinkt noch nicht mit völliger Selbstverständlichkeit eine solche Ehe verhindern würde, während dies der älteren Schwester gegenüber schon stattfindet. Auch zwischen verschwägerten Personen ist die Erlaubtheit der Ehe manchmal nicht von dem Grade der Verwandtschaft, sondern von dem Altersverhältnis abhängig. Bei einigen Stämmen der schon erwähnten Bataks fällt die Witwe des älteren Bruders dem jüngeren als Gattin zu, während die Ehe zwischen dem älteren Bruder und der Witwe des jüngeren als Blutschande bestraft wird. Gerade das umgekehrte Verhältnis herrscht bei den Alfuren von Buru. Dem jüngeren Bruder ist es hier verboten, die Witwe des älteren zu heiraten, während der Ehe mit der Witwe des jüngeren nichts im Wege steht. Um die familienrechtlichen Verhältnisse bei den Naturvölkern zu verstehen, muss man im Auge haben, dass der Begriff der Verwandtschaft bei ihnen etwas ganz anderes bedeutet als bei uns. Er umschließt bei ihnen nicht nur, und oft gar nicht, jenen engen, durch das Blut gemeinsamer Eltern zusammengehaltenen Kreis, der sich zunächst auf ein einzelnes Haus beschränkt und sich allenfalls durch das Selbständigwerden der Kinder und ihre Verschwägerung erweitert. Die Zusammengehörigkeit in Gesinnung und Leistung vielmehr, die bei höherer Kultur der blutsverwandten Familie eigen ist, kommt in niederen Verhältnissen meistens dem Stamme zu, d. h. einer größeren Gruppe, in der zwar das Band der Blutsverwandtschaft nicht unwesentlich ist, die aber im ganzen nur durch gemeinsamen Namen, gemeinsame Interessen, gemeinsame soziale Organisation zusammengehalten ist. Die Abstammung von einem sagenhaften Vorfahren, die wir häufig angenommen finden, ist nicht sowohl die Ursache, als der mystische Ausdruck der Zusammengehörigkeit jener Gruppe von Familien, die bei den Naturvölkern dem Individuum gegenüber die Rechte und Pflichten der uns vertrauteren Einzelfamilie ausübt. Sehr oft ist auch die Verwandtschaft durch die Mutter die allein gültige, während dem Vater kein Anteil an dem Blute des Kindes zukommt, so dass nur die Geschwister mütterlicherseits miteinander verwandt sind, und nur die Geschwister der Mutter, nicht aber die des Vaters zum Familienverband gerechnet werden. Diese Formen des letzteren entscheiden nun auch über die Zulässigkeit der Ehen. Bei den Irokesen nahmen die Kinder den Stammesnamen der Mutter an. Gehörte z. B. die Mutter zum Bärenstamm, so war der Sohn ein Bär und durfte daher kein Bärenmädchen heiraten, sondern musste sich sein Weib aus dem Stamme der Hirsche oder der Reiher wählen. In Indien darf kein Brahmane ein Weib heiraten, welches denselben Stammesnamen führt wie er, während bei den Juden kein Mann ein Mädchen heiraten durfte, das auch nur denselben Vornamen führte, wie seine Mutter, und bei Australiern genügt es zur Verhinderung der Ehe, dass das Mädchen denselben Totem hat wie der Mann, also nur eine symbolische Verwandtschaft stattfindet, die kein reales Blutband mehr zu ihrer Begründung aufweisen kann. Noch weiter vielleicht gehen die Verbote in China. Dort führen große Gruppen von Personen den gleichen Zunamen, da es in dem ganzen Reiche nicht mehr als etwa 530 Zunamen gibt; und nun ist es jedem verboten, eine Person mit dem gleichen Zunamen, wie er selbst, zu ehelichen - bei Strafe von 60 Bambushieben. Auch im alten Mexiko und bei den Tscherkessen zerfallen die Gemeinschaften in große Unterabteilungen, die nur gegenseitig heiraten dürfen, während keine derselben in ihren eigenen Grenzen eine Eheschließung duldet; bei den letztgenannten Völkern umfasst jeder dieser Klane, innerhalb deren eine Ehe als blutschänderisch gilt, mehrere 1000 Personen, so dass von Blutsverwandtschaft in unserem Sinne dabei nicht die Rede sein kann. Diese Ausdehnung des Eheverbotes auf die politische Gruppe hat die Folge, dass gerade echten Blutsverwandten, die sich aber zufällig in verschiedenen Klanen finden, was durch Übersiedelung, heimliche Ehen usw. möglich ist, die Ehe ohne weiteres erlaubt ist. Von den Pomtschas in Bogota wird berichtet, dass die Männer und Weiber einer und derselben Stadt sich als Geschwister betrachten und deshalb keine Ehen miteinander eingingen; war aber die wirkliche Schwester zufällig in einer anderen Stadt geboren, als der Bruder, so durften sie einander heiraten. So können auch, wo die Verwandtschaft durch die Mutter gilt, Schwesterkinder sich nicht heiraten, wo umgekehrt ausschließlich Vaterverwandtschaft herrscht, dürfen Bruderkinder es nicht - wohl aber in beiden Fällen Kinder von Bruder und Schwester, weil nun, in Bezug auf die erste Eventualität die Mütter, in Bezug auf die zweite die Väter verschiedenen Blutes sind. Ja, solche Ehen werden besonders bevorzugt. sogar verschiedentlich Auf diese unter primitiven Völkern höchst häufige Vorstellung, dass das Kind nicht mit beiden Eltern gleichmäßig, sondern nur entweder mit dem Vater oder mit der Mutter verwandt sei, gründet es sich auch, dass die Osseten die Ehe mit der Schwester der Mutter für ganz gesetzlich halten, die mit der Schwester des Vaters dagegen als höchst blutschänderisch bestrafen. Demgegenüber bestimmt die moderne Kultur die Verwandtschaft nebst ihren ehehindernden Folgen gleichmäßig nach der Abstammung vom Vater und von der Mutter, aber auch ausschließlich nach dieser. Die Grundlage hierfür bilden die Eheverbote des alten Testamentes, die im ganzen fünfzehn Verwandtschaftsgrade als eheunfähig bezeichnen. Das spätere Judentum ging insofern darüber hinaus, als es die ganze Linie verbot, in der man auf einen biblisch verbotenen Grad stößt, also z. B. die Großmutter, weil die Mutter biblisch verboten ist; die logische Strenge, die das Judentum hier zeigt, bewahrte es auch darin, dass es sich beharrlich der Dispensationen erwehrte, durch die der Katholizismus gelegentlich die Ehe in sonst verbotenen Verwandtschaftsgraden gestattet. Dies wurde schließlich allerdings praktisch unumgänglich, da die mittelalterliche Kirchenweisheit die biblischen Eheverbote wegen Verwandtschaft außerordentlich erweitert und aus den ursprünglichen fünfzehn nicht weniger als fünfzig gemacht hatte. Die Päpste verboten die Ehe bis zum siebenten Grade, und zwar mit der Begründung: weil Gott am siebenten Tage von seinen Werken geruht habe! Die praktischen und theoretischen Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben, riefen von der Reformationszeit an eine höchst umfängliche Literatur hervor; ich will von dieser hier nur eine Probe geben, die die eigentümliche Einteilung der Ehehindernisse, zu der man schließlich gekommen war, gut charakterisiert. Im Jahre 1539 wurde in Freiberg in Sachsen ein Flugblatt öffentlich verkauft, das jene 50 Grade dem Volke beschrieb und mit Strenge auf die Sündhaftigkeit der Ehe innerhalb derselben hinwies. Hierdurch fühlte sich ein Zehnder, Namens Wolff Loß, in seinem moralischen Bewusstsein irritiert, er fühlt Mitleid mit "den armen einfeldigen Leuten in Fellen, so sich mit ihnen aus Unwissenheit zugetragen", und veröffentlicht eine kleine Schrift, in der er die Eheverbote auf ihren Ursprung untersucht und die Jenigen Grade zusammenstellt, die durch göttliches, kaiserliches und päpstliches Recht gemeinsam, dann die durch kaiserliches und päpstliches Recht gemeinsam, endlich die nur durch den Papst verboten sind. In die erste Kategorie gehören Geschwister und Eltern, Onkel und Tanten, des Bruders Weib, der Schwester Mann usw. Darunter auch: Seines Sohnes Tochter, ihrer Tochter Sohn. In der zweiten Kategorie steht nun aber: Ihres Vaters Vater, seiner Mutter Mutter - was eben dasselbe ist. Für den Aszendenten ist also die gleiche Ehe nach allen drei Rechten, für den Deszendenten nur nach zweien verhindert. Die zweite Kategorie verbietet fast ausschließlich Ehen des zweiten Aszendenzgrades direkter und verschwägerter Weise. Die dritte Kategorie enthält höchst verwickelte und abstruse Grade, z. B.: Ihres Vaters Vaters Schwester Mann; ihres Bruders Sohnes Tochter Mann; seiner Schwester Tochter Sohnes Weib. In dieser dritten Nummer sind hauptsächlich die Fälle der Verwitwetheit berücksichtigt, deren Verbot also als das kirchliche Interesse im engeren Sinne erscheint. Übrigens will er mit dieser Unterscheidung niemandem »Ursach noch Raum geben haben, sich wider Zucht und Ehre einzulassen, sondern habe allein den Unterschied göttlichs und menschlichs Verbots anzeigen wollen« um die etwaigen Gewissensskrupel der vorhin erwähnten einfältigen Leute zu heben. Luther selbst hat gegenüber der Rigorosität des katholischen Standpunktes einen entschieden liberaleren eingenommen, der ihm in einem konkreten Falle zugleich die schärfere Betonung des sittlichen Wertes der Ehe ermöglichte. Als Heinrich VIII. von England die Gattin seines verstorbenen Bruders geheiratet hatte und diese Ehe als eine in verbotenem Grade geschlossene aufgelöst werden sollte, schrieb Luther, diese Ehegesetze bänden uns nicht mehr im buchstäblichen Sinne. Der König habe allerdings vielleicht mit seiner Heirat gegen weltliches und menschliches Gesetz gesündigt, allein wenn er sich nun von seiner Frau scheiden ließe, so sündige er gegen ein göttliches Gesetz, das die Ehe unauflösbar mache. Grade umgekehrt hatte die katholische Kirche die Heiligkeit der Ehe gegenüber dem Verbot der Verwandtenehe hintangesetzt- sie hatte bestimmt, dass die aus einer Verwandtenehe hervorgegangenen Kinder in keinen Orden aufgenommen werden sollten, während sie dies unehelichen Kindern ohne weiteres gewährte. Nach jüdischem Rechte sollen die Kinder einer Verwandtenehe ihrerseits unverheiratet bleiben. Es ist sehr bezeichnend für das, was dem asketischen Christentum und das, was dem weltfreudigen Judentum als das Heiligste galt, dass jenes den Sprösslingen einer verbrecherischen Vereinigung den geweihten Stand der Ehelosigkeit, dieses aber gerade ihnen den Stand der Ehe verweigerte. Was die Eheschwierigkeiten in der Christenheit besonders komplizierte, war der Umstand, dass über die reale, wenn auch noch so entfernte Verwandtschaft hinaus noch eine künstliche oder »geistliche« Verwandtschaft (cognatio spiritualis) geschaffen wurde. Seit nämlich die Taufe üblich geworden war, wurden auch Ehen zwischen Paten und Patenkindern verboten, da dies eine Nachbildung des elterlichen Verhältnisses sei; ja auch die Ehen der Paten eines Kindes unter einander wurden verboten. Audovera, Königin zu Soissons, wurde ihrer Krone beraubt und ihre Ehe für ungültig und blutschänderisch erklärt, weil sie ihr eigenes Kind zur Taufe hielt und dadurch ihres Gemahles Chilperich Gevatter wurde! Nachbildungen des Verhältnisses zwischen Eltern und Kindern - noch außer der nachher zu besprechenden Adoption - finden sich auch bei nichtchristlichen Völkern, und zwar mit demselben Erfolge, alle an die Ehe erinnernde Beziehung zwischen den so Vereinten auszuschließen. In sinniger Weise hat sich das Rechtsbewusstsein in dem folgenden Falle dieses Umstandes zu bedienen gewusst. In einer indischen Provinz muss ein Mann, der des Ehebruchs mit einer Frau angeklagt, aber nicht überwiesen ist, eine Garantie dafür geben, dass wenigstens künftig nichts Derartiges vorkommt: er legt seinen Mund einen Augenblick an die Brust der Frau, wodurch sie zu seiner Mutter wird und nie ein anderes als das so symbolisierte Verhältnis zwischen ihnen bestehen darf. Das auf diese Weise geknüpfte Band wird als so heilig betrachtet, dass es noch nie gebrochen sein soll. Dem entspricht es, dass die feierlichste Ehescheidungsformel bei den Arabern ist: »Du bist mir wie der Rücken meiner Mutter«, was übrigens keine Beleidigung für die Frau, sondern im Gegenteil etwas Ehrenvolles ist; es verhindert zugleich, dass die Frau in die Hände der Brüder dieses Mannes fällt; denn durch diese Erklärung macht er sie zugleich symbolisch zur Mutter seiner Brüder. Die gleiche Wirkung hat nun fast überall auch die Adoption. Nach dem römischen und den meisten modernen Rechten ist die Ehe zwischen Adoptiveltern und Adoptivkindern verboten; nur das österreichische Gesetz hat sich dem entzogen. In Indien gibt es eine Form der Adoption, Dattaka genannt, bei der der Adoptierte so sehr Mitglied der adoptierenden Familie wird, dass er überhaupt nicht in dieser, auch in ihren entfernteren Gliedern nicht, heiraten kann. Dagegen wird bei einigen anderen Völkern die Ehe zwischen wirklichen und Adoptivkindern nicht nur gestattet, sondern sogar gewissermaßen nachträglich bewirkt: in Japan und bei den Yallatonns in Indien wird, wenn ein Geschlecht bis auf eine Tochter ausstirbt, häufig der Mann dieser vom Schwiegervater adoptiert also eine Ehe zwischen Adoptivgeschwistern hergestellt - damit das Geschlecht nicht ausstirbt und die Nachkommen Enkel männlicher Linie sind. Hier wie sonst sind es also die soziologischen Verhältnisse und Zwecke, die über die Zulässigkeit der Ehe unter Adoptivverwandten entscheiden; deshalb fällt aber auch diese Entscheidung oft den wunderlichsten historischen Zufällen anheim. Als Mohammed das Weib seines Adoptivsohnes Zaid, Zainab, geheiratet hatte, wurde ihm vorgeworfen, dass der Koran selbst es für Blutschande erklärte, wenn ein Vater eine Frau heiratete, die seines Sohnes Weib gewesen wäre. Kurz nachher erhielt Mohammed eine besondere Offenbarung, des Inhalts, dass der Adoptivsohn nicht, wie es bisher in Arabien der Fall war, als eigener Sohn zu gelten habe. Endlich sind noch zwei Fälle der fiktiven Verwandtschaft in Bezug auf Eheverbote zu erwähnen: die Milchgeschwisterschaft und die Wahlbrüderschaft. Die Ehe mit der Milchschwester ist auf das strengste verboten in Dardistan, im mohammedanischen Rechte, bei den Armeniern und den Truchmenen. Die Wahlbrüderschaft ist eine in primitiven Kulturen häufige, in Europa jetzt nur noch bei den südlichen Slaven vorkommende Form einer lebenslänglichen, durch irgend eine feierliche Zeremonie geschlossenen Interessengemeinschaft mehrerer Personen. Bei den Südslaven, in Montenegro und im griechischbyzantinischen Rechte bildet diese Wahlbrüderschaft ein Ehehindernis; Männer und Weiber gehen untereinander jene Verbrüderung zu Schutz und Trutz, zu Besitzgemeinschaft und Blutrache ein, und von dem Augenblick an verkehren sie nur wie leibliche Geschwister untereinander. In Polynesien erstreckt sich das Verbot sogar auf die ganzen Familien, denen die Wahlbrüder angehören und in denen diese also sich keine Frauen suchen dürfen. Diesen Tatsachen aber steht nun eine Reihe anderer allerdings eine unvergleichlich kleinere - gegenüber, in der die Verwandtenehe Sitte und Gebot ist. Der besondere Charakter, den gerade diese Ehen tragen, wird auch durch solche entgegengesetzten Ordnungen bezeugt; denn sie werden keineswegs als gleichgültig, jeder anderen Ehe koordiniert betrachtet. Vielmehr wird nun eine besondere Betonung auf sie gelegt, die Momente, auf die sonst ihr Verbot erfolgt, sind hier nicht einfach ausgelöscht, sondern wirken wahrscheinlich auch hier, nur gleichsam mit umgekehrtem Vorzeichen. Bei manchen Malayen, z. B. den Kalangs auf Java, findet direkte eheliche Verbindung mit der Mutter oder der Schwester statt, und zwar von der Vorstellung begleitet, dass solche Bündnisse besonders segensreich seien. Der berühmteste Fall einer direkt gebotenen Geschwisterehe ist der der Inkas im alten Peru. Diese waren verpflichtet, ihre älteste Schwester von derselben Mutter heimzuführen. Der Grund hierzu lag in der eigentümlichen Fürstenhauses. historischen Stellung jenes Die Herrschaft des Inka war ein absoluter »Cäsaropapismus«, er ist schlechthin der Gott auf Erden, und durch die Ehe mit der Schwester wird die ungemischte Vererbung des Gottgeistes gesichert. Dadurch waren sowohl die Anhänger des alten Glaubens, welche noch an der Vererbung von der Mutter her festhielten, wie diejenigen, die schon zur Vaterfolge vorgeschritten waren, darüber versichert, dass der rechte Geist der Inkas in dieser Ehe fortgepflanzt würde. Von diesem Gesichtspunkt der Reinhaltung des Blutes aus finden wir die Geschwisterehe als politischreligiöses Gebot gerade bei einer Reihe von Fürstenhäusern; in einem afrikanischen Stamm heiratet zu diesem Zwecke der König seine Tochter, die Königin ihren ältesten Sohn; bei den Ptolemäern in Ägypten war die Geschwisterehe üblich, ohne dass man bei ihren Untertanen eine derartige Sitte feststellen könnte; auf den Sandwichinseln, wo in der Herrscherfamille gleichfalls Bruder und Schwester einander heiraten, wird eine derartige Verbindung, wenn sie bei dem übrigen Volke vorkommen sollte, mit dem größten Abscheu betrachtet; und entsprechend haben die Kalmücken ein Sprichwort: »Die vornehmen Leute und die Hunde kennen keine Verwandtschaft« - womit sie andeuten, dass die Herrscher, aber auch nur diese, in der eigenen Familie heiraten dürfen. Ebenso unterschieden sich die orientalischen Magier von dem unpriesterlichen Volke dadurch, dass sie die Ehe zwischen Vater und Tochter, zwischen Mutter und Sohn als eine ihnen besonders zukommende Pflicht betrachteten. Von den anderweitigen Verwandtschaftsgraden, die zwar nicht nach unseren, wohl aber nach den Begriffen vieler primitiver Völker die Ehe ausschließen, finden sich dennoch einige, die umgekehrt gelegentlich eine Verpflichtung zur Ehe mit sich bringen. Die bekannteste Bestimmung dieser Art ist das jüdische Levirat, d. h. die Pflicht des Mannes, nach dem Tode des Bruders dessen Witwe zu ehelichen. Diese Sitte ist außerordentlich verbreitet, und es gibt keinen Weltteil außer Europa, in dem sie nicht bei einigen Stämmen nachweisbar wäre. Es herrscht indes ein bemerkenswerter Unterschied innerhalb der gleichen Sitte: in einigen Fällen erscheint die Witwe samt ihren Kindern erster Ehe gewissermaßen als Erbstück, das auf den Bruder übergeht; in anderen Fällen aber liegt nicht nur ein solches Recht der Besitzergreifung, sondern eine direkte Pflicht vor. Dies insbesondere dann, wenn der Verstorbene keine Kinder hinterlassen hat, und nun der Bruder, wie es die Bibel ausdrückt, ihm »Samen erwecken« muss, so dass seine Kinder mit der Witwe des Verstorbenen als Kinder dieses letzteren angesehen werden. Dies begegnet außer im jüdischen auch im indischen und malagassischen Rechte. Eine Umkehrung davon zeigt das chinesische Strafgesetz, das die Ehe mit der Witwe des Bruders mit Erdrosselung bedroht, während die mit der Schwester der verstorbenen Gattin als besonders ehrenvoll empfohlen wird. Und eine andere, sehr eigentümliche Variation wird von einigen Malayenvölkern berichtet: es komme dort vor, dass dem noch knabenhaften Jüngling ein schon erwachsenes Mädchen verlobt wird; bis zu der Ehemündigkeit des ersteren aber tritt sein Vater zu der Braut in ein eheähnliches Verhältnis, und die diesem entsprießenden Kinder heißen die Enkel ihres wirklichen Vaters. Hier ist es also der Vater, der dem Sohne »Samen erweckt«. Einige der Motive wenigstens, aus denen so das sonst Verabscheute direkt geboten wird, liegen auf der Hand: die Reinhaltung des Blutes, vielleicht auch das Zusammenhalten von Besitz und Macht einerseits, der Wert der Nachkommenschaft andererseits, den man auch dem Verstorbenen noch nachträglich verschaffen möchte, die Pflicht der Fürsorge für die Witwe, der man am besten nachkommt, wenn man sie heiratet. Sind dies auch keineswegs die einzigen Gründe der Verwandtenehen, wirken dazu auch noch mystische Ideen und Erinnerungen längst entschwundener Sozialverfassungen mit - man hat z. B. das Levirat als ein Überbleibsel prähistorischer Vielmännerei gedeutet - so ist doch das Gebot der Verwandtenehe in seiner Motivierung klar im Verhältnis zu ihrem Verbote. Die Ausnahme ist hier begreiflicher als die Regel. Denn so unzweideutig und leicht festzustellen die Tatsachen des Verbotes der Verwandtenehe sind, so dunkel und schwierig ist ihre Motivierung, der wir uns nun zuwenden. Von den Naturvölkern, die uns die primitivsten Formen und oft eine äußerste Ausdehnung dieses Verbotes zeigen, können wir fast keine direkte, wenn auch nur vermutungsweise Auskunft über seine Entstehung bekommen. Wenn Reisende oder Missionare nach einem Grunde dafür fragten, erhielten sie keine Antwort als etwa, dass es eben von jeher so Gesetz gewesen wäre, oder dass die Scham solche Verbindungen hindere - letzteres eine der typischen Täuschungen, aus denen auch z. B. die Vorstellung hervorgeht, die Menschen seien durch das Schamgefühl dazu gekommen, sich zu bekleiden. Die Kleidung ist offenbar aus Bedürfnissen des Schutzes und des Schmuckes hervorgegangen und dann erst hat die Gewöhnung ihrer das Gefühl der Beschämung an ihr Fehlen geknüpft. So kann man auch das Verbot der Verwandtenehe so wenig aus dem Gefühl der Scham herleiten, - was übrigens auch noch in neuerer Zeit versucht worden ist, - dass die ganze Frage vielmehr ist, aus welchen Ursachen an diese Ehen eben eine solche Empfindung sich habe knüpfen können. Nur von einigen wenigen Völkern, den zisnatalischen Kaffern, den Eskimos, den alten Arabern wird berichtet, dass ihrer Meinung nach aus Verwandtenehen eine schlechte Nachkommenschaft hervorgeht, und dass sie deshalb verboten seien. Dies ist auch der populäre Glaube bei uns und die zunächst sich darbietende Begründung jener Gebote. Der augenblickliche Stand dieser Frage innerhalb der anthropologischen Wissenschaft ist der, dass allerdings ein ungünstiger Einfluss zu nahe verwandten Blutes auf die Nachkommenschaft stattfindet, dass derselbe aber lange nicht so verderblich ist, wie es in weiten Kreisen angenommen wird. Man weiß von einigen isolierten Gemeinden in Frankreich, England, Skandinavien, in denen beständige Wechselheiraten stattfinden, ohne dass irgend eine Entartung der Kinder wahrzunehmen wäre; die Berichte der Tierzüchter über die Erfolge der Inzucht und der Kreuzung widersprechen sich, von einer Seite wird die Verbesserung, von der anderen die Verschlechterung der Rasse durch die Paarung eng verwandter Tiere behauptet. Im großen Ganzen ist aber nicht zu zweifeln, dass irgend ein entartender Einfluss auf die Nachkommenschaft von der Verwandtenehe ausgeht. Die Frage ist nur, ob derselbe stark genug ist, um die Entstehung eines derartig heiligen Gebotes, eines derartig unüberwindlichen Instinktes zu erklären. Dass bewusste Überlegung, vordenkende Furcht vor derartigen Folgen der sozialen Gruppe jene Verbote eingeprägt hätten, ist völlig ausgeschlossen. Der einzig mögliche Weg wäre der der natürlichen Zuchtwahl. Stämme, in denen die Verwandtenehe allgemein geübt wurde, seien zu Grunde gegangen, während diejenigen, in denen sie aus zufälligen Gründen vermieden worden wäre, die kräftigeren und darum im Kampfe ums Dasein siegreichen Individuen hervorgebracht hätten. Da nun gegen das, was tatsächlich nicht geübt wird, schließlich ein Widerwille entsteht, so kann in den Stämmen, die schließlich über ihre Mitbewerber obsiegten, d. h. in den jetzt existierenden, jene nützliche Enthaltung gezüchtet und zu dem direkten Abscheu vor der Verwandtenehe ausgewachsen sein; dieser sei also entstanden, wie alle anderen nützlichen Instinkte, wie der Widerwille gegen unzuträgliche Speisen, wie die unwillkürlichen Schutzbewegungen bei nahender Gefahr usw., ohne dass irgend ein bewusster oder überlegender Wille den Anstoß dazu gegeben hätte. Dass eine derartige Erklärung eine äußerst luftige, keiner historischen Bestätigung zugängige Vermutung ist, ist allerdings ebenso sicher, wie dass wir auf andere Erklärungen als die aus der Nützlichkeit des betreffenden Verbotes nicht hoffen können. Deshalb aber dürfen wir uns, um es zu verstehen, nicht mit einer Möglichkeit begnügen, sondern müssen, möglichst viele aufsuchend, durch die Anzahl der Wahrscheinlichkeiten die Unsicherheit der einzelnen ergänzen. Die älteren Theorien über unser Problem erwähnen einen Zweck, dem das Verbot der Verwandtenheirat dienen soll, und den ich mindestens dem oben genannten Zuchtwahlmomente an Wirksamkeit gleichsetzen möchte. Der alte jüdische Philosoph Maimonides führte nämlich als Grund jener Verbote die Gefahr der Unsittlichkeit an, die bei den in einem Hause Zusammenlebenden allzu nahe läge. In Folge des Verbotes der Ehe aber wüsste nun jeder Mann, dass er seine Neigungen und Gedanken überhaupt nicht nach dieser Richtung wenden dürfte. Der Grundgedanke dabei ist also der, dass Zucht und Sitte innerhalb des engen Kreises der Zusammenlebenden aufrecht erhalten werden muss, wenn nicht jegliche soziale Ordnung zerstört und ein unübersehbares Chaos in allen sittlichen und rechtlichen Verhältnissen entstehen soll. Angesichts der Verlockung indes, die die fortwährende gegenseitige Nähe der Hausgenossen bietet, der steten Gelegenheit, solcher Lockung zum Opfer zu fallen, bedurfte es der schärfsten Trennungsmaßregel, und diese war offenbar das Verbot der ehelichen Verbindung. Wenn nur diejenigen Verbote des Anstandes und der Reserve, die auch zwischen Fernerstehenden gelten, die Mitglieder einer Familie trennten, so würden sie sich nicht nur so machtlos erweisen, wie sie es tatsächlich oft genug zwischen jenen tun, sondern angesichts der besonderen Situation derer, die in enger äußerlicher Verbundenheit leben, noch viel machtloser. Deshalb musste eine Barriere zwischen diesen aufgerichtet werden, die zwischen den Nichtverwandten nicht bestand, und als solche bot sich die Untersagung der Ehe zunächst dar. II Auch Montesquieu und Hume begründeten die Verbote der Verwandtenehe auf die Erhaltung der Familienzucht. Eine anonyme Schrift vom Jahre 1740: »Bescheidene doch gründliche Gegenvorstellung von der Zulässigkeit der Ehe mit des verstorbenen Weibes Schwester« verwirft auch die Ehe mit des verstorbenen Mannes Bruder, und zwar genau aus dem hier betonten Gesichtspunkt, der in diesem Falle und für moderne Verhältnisse freilich einen wunderlichen Eindruck macht- damit der Mann nicht sein Recht, eventuell nach dem Tode des Gatten die Frau zu heiraten, noch bei Lebzeiten desselben missbrauche, wozu das häufige familiäre Beisammensein besondere Gelegenheit gebe. Beachtet man die ungeheure Wichtigkeit, die die Regulierung der hier mitsprechenden Verhältnisse selbst in ihren rohesten Anfängen und bei den primitivsten Völkern besitzt, so ist es begreiflich, dass das strengste Verbot ehelicher Beziehungen zwischen den Familiengenossen ebenso durch den bewussten Willen führender Persönlichkeiten wie durch die unbewussten Prozesse eingeprägt wurde, die alle zweckmäßigen Instinkte in unserer Gattung fest werden lassen. Darum finden wir auch diese Verbote da besonders streng eingehalten, wo auf die häusliche Disziplin großer Wert gelegt wird; z. B. in China, wo Blutschande als Kapitalverbrechen bestraft wird, wie Vatermord, Familienzwietracht und Hochverrat. So lange in Rom die Strenge der häuslichen Zucht auf ihrer Höhe stand, war allen Personen, die unter derselben väterlichen Gewalt standen, d. h. den Verwandten bis zum 6. Grade, die Ehe mit einander verboten; in dem Maße, in dem der enge Zusammenhalt, die strenge Einheitlichkeit des Hauses sich lockerte, wurde auch dies Gebot gemildert, bis in der Kaiserzeit sogar die Ehe zwischen Onkel und Nichte legitimiert wurde. Es bedarf eben der Prophylaxis nicht mehr, sobald die Enge des Zusammenlebens sich löst. Aus demselben Motive erklärt sich aber auch die scheinbar entgegengesetzte Erscheinung: dass nämlich das Gebot der Zucht unter entfernten Verwandten besonders scharf betont wurde. Hat nämlich das Verbot der Verwandtenehe schon so lange bestanden, dass ein fester Instinkt dafür sich entwickelt hat, so wird dieser natürlich am kräftigsten den nächsten Verwandten gegenüber wirken und im Verhältnis der Entferntheit der Verwandtschaft schwächer werden; um einem von dieser Seite her noch drohenden Bruche der Sitte zu begegnen, bedarf es gerade einer energischeren Prophylaxis als für den Fall der Geschwister oder der Eltern und Kinder, die schon der Instinkt auseinander hält. Darum heißt es in der peinlichen Gerichtsordnung Karls V.: So eyner unkeusch mit seiner Stieftochter, mit seines suns Eheweib oder mit seiner Stiefmutter treibt, in solchen und noch näheren Sipschaften - die also gar nicht erst näher erwähnt werden - soll die straf gebraucht werden. Auf diesem Prinzip der Vorsorge beruhen wahrscheinlich auch die allenthalben unzutreffenden Verbote eines auch nur äußerlichen Verkehrs von Personen, zwischen denen das Eheverbot gilt. Auf den Fidschiinseln, bei den Braknas und sonst dürfen Bruder und Schwester, Vetter und Base, Schwager und Schwägerin mit einander weder sprechen noch essen. In Ceylon dürfen Vater und Tochter, Mutter und Sohn sich nicht gegenseitig betrachten. Die überall vorkommenden Verbote des Verkehrs zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern - in der Urbevölkerung Amerikas, im Südseegebiet, unter den mongolischen Stämmen, allenthalben in Afrika wie in Indien - betreffen in vielen Fällen insbesondere den Verkehr der Schwiegermutter mit dem Schwiegersohn, des Schwiegervaters mit der Schwiegertochter. Bei den Kirgisen darf die junge Frau nach der Hochzeit sich überhaupt keinem männlichen Mitglied der Familie ihres Mannes zeigen. Sollte dies nicht gleichfalls darauf beruhen, dass mit diesen neu geknüpften engen Beziehungen schlechte Erfahrungen gemacht worden sind? Bei vielen Völkern, z. B. den Alfuren von Buru, den Dajaks, einigen Malayen, den Serben u. a. dürfen Braut und Bräutigam überhaupt nicht mit einander verkehren, und die Neger halten es für besonders ehrbar, wenn ein Mann ein Mädchen heiratet, das er nie zuvor gesehen hat. Kurz, an allen möglichen Orten zeigt sich eine prophylaktische Tendenz, die Versuchung da aus dem Wege zu räumen, wo ihr nachzugeben eine besonders verabscheute oder besonders nahegelegte Tat wäre; und eine derartige Barriere, ebenso wie das Verkehrsverbot, ist offenbar das Gebot und der Instinkt, dass Verwandte, selbst wenn sonst nichts im Wege stände, nur weil sie Verwandte sind, nie zur Ehe schreiten dürfen. Und wiederum unter der scheinbar entgegengesetzten Tatsache zeigt sich dieselbe Vorsorge, nur eine Stufe höher hinaufgerückt, wenn das islamische Gesetz verbietet, das Gesicht anderer Frauen zu sehen als derer, die man nicht heiraten darf. Eine weitere Reihe von Tatsachen kommt hinzu, um die Begründung der Eheverbote auf das Interesse an der Zucht des Zusammenlebens zu unterstützen. Diese Verbote betreffen nämlich in sehr vielen Fällen keineswegs nur die wirklichen Verwandten, sondern, wie wir an den Fällen der Milchgeschwister, der Klanund Gruppenverwandtschaft gesehen haben, die überhaupt in enger räumlicher Verbindung lebenden Personen. Die Jameos am Amazonenstrom, einige Stämme in Australien und auf Sumatra gestatten keine Ehe innerhalb desselben Dorfes. Je größer die Haushaltungen sind, desto strenger sind die Verbote der Wechselehen innerhalb derselben, z. B. bei den Hindus, den Südslawen, in Ranusa, bei den Nairs. Es ist offenbar viel schwieriger, in einem sehr großen als in einem kleinen Hause Anstand und Ordnung zu bewahren; darum genügte das Verbot der Ehe der nahen Verwandten nicht, sondern es mussten die umfassenden Gesetze eintreten, die bei jenen Völkern das gesamte Haus unter das Eheverbot stellten. Sobald die einzelnen Familien getrennter leben, verhindert selbst Blutsverwandtschaft unter ihnen die Ehe in nur geringem Grade. Bei den Thanea-Indianern Brasiliens, bei denen die Ehen zwischen Verwandten zweiten Grades sehr häufig sind, bewohnt jede Familie ihr eigenes Haus, und ebenso verhält es sich mit den Buschmännern und den Singhalesen; auch dass bei den Juden die Ehe zwischen Geschwistern streng verpönt, die zwischen Geschwisterkindern aber gestattet war, hat man damit erklärt, dass die letzteren nicht in einem Haushalte zusammen lebten. im großen und ganzen sind die Eheverbote bei primitiven Völkern ausgedehntere und strengere, als bei fortgeschritteneren, sie beschränken sich im Laufe der Entwicklung mehr und mehr auf den eigentlichen engeren Familienkreis - offenbar weil die Enge des Zusammenlebens immer mehr nur den letzteren einschließt. Je ausgedehnter und vielgestaltiger das soziale Ganze ist, das uns umgibt, desto kleiner werden die familiären Unterabteilungen, die sich als ein zusammengehöriges Ganzes fühlen, auf desto weniger Personen erstrecken sich also jene Gefahren des engen Beieinanderlebens, gegen die das Eheverbot eine Vorbeugungsmaßregel bildet. Es ist vor kurzem die Ansicht aufgestellt worden, dass dieses Verbot ursprünglich nur innerhalb der »Mutterfamilie« gilt, d. h. jener primitiven Gesellschaftsform, in der die Verwandtschaft nur durch die weibliche Linie fortgepflanzt wurde, die Kinder nur als Kinder der Mutter, nicht aber als die des Vaters galten, benannt wurden und erbten, und der Mann, der eine Frau ehelichte, damit in ihre Familie übertrat. Es ist ferner behauptet, dass diese Mutterfamilie sich keineswegs mit dem Komplex der Zusammenwohnenden deckt. Wenn beide Behauptungen richtig sind, so scheint damit die Hypothese widerlegt, dass das Verbot der Verwandtenehe aus dem Interesse von der Hauszucht entsprungen sei. Allein immer wird man sagen können, dass zu der Zeit, wo der Mann sein mütterliches Haus verlässt, um in einen anderen Lokalverband einzutreten, die Hauptgefahr für die Zucht schon beseitigt ist. Für die Zeit des Erwachens jener Triebe, deren ungeordneter Befriedigung das Eheverbot einen Riegel vorschieben soll, fällt jedenfalls Familiengemeinschaft und Hausgemeinschaft zusammen. Wenn der Mann dann auch bei räumlicher Entfernung jenem Verbote unterliegt, so kann dies sehr wohl eine festgewordene Weiterwirkung der Zeiten sein, in denen er nicht nur Familiengenosse, sondern auch Hausgenosse der Seinigen war. Sicher treten auch andere Nützlichkeiten zu diesen Gründen des Verbotes hinzu. Wenn heutzutage noch die Ehe keineswegs als eine bloße Privatsache der Ehreschließenden gilt, sondern die beiderseitigen Familien daran entweder durch Förderung oder durch Herabsetzung interessiert sind, so wird dies in noch höherem Maße in jenen früheren Zeiten der Fall gewesen sein, wo die soziale Gruppe, der der Einzelne angehörte, noch viel enger innerlich verknüpft war, wo die Interessen des Stammes und der Familie noch viel solidarischer mit denen des Individuums waren. Die fortwährende Bedrohtheit der Existenz durch Feinde, die Notwendigkeit des Zusammenschlusses kleiner Gruppen für Land- und Kriegsgewinn, musste jeder Gruppe die Anknüpfung von Beziehungen zu anderen als politische Notwendigkeit erscheinen lassen; und solche Beziehungen konnten nicht fester begründet werden als durch Wechselheiraten. So hatte denn der Stamm ein höchstes Interesse daran, dass Ehen nicht innerhalb seiner geschlossen wurden, sondern mit außerhalb gelegenen; diese allein trugen zur Ausbreitung seines Einflusses, zum Gewinn neuer Bundesgenossen bei, und es ist deshalb wohl begreiflich, dass die politische Selbsterhaltung die für die Gesamtheit unnütze Ehe innerhalb des eigenen Stammes untersagte. Welche Bedeutung diese familiären und sozialen Beziehungen der Ehe für unsere Frage haben, wie sie sogar wichtiger werden können, als diejenigen Hemmnisse, die aus der wirklichen Blutsverwandtschaft hervorgehen, ersieht man daraus, dass viele Gesetzgebungen die Verwandtschaft, die durch uneheliche Verbindungen entsteht, keineswegs ebenso als Ehehindernis ansehen, als die nur ebenso enge, die legitimen Charakter trägt. - Es ist ferner kein Zweifel, dass dieses Verbot irgend eine Verbindung mit dem uralten Institut der Raubehe besitzt. Bei allen Völkern finden wir, wenigstens noch in symbolischen Hochzeitsgebräuchen, Reste der Sitte, dass die Braut gewaltsam aus dem Hause ihrer Eltern entführt wurde. Es ist sicher, dass vielleicht in dem größten Teil der Erde die Ehen ursprünglich nicht durch friedliche Werbung, sondern durch gewaltsamen Raub geschlossen wurden - ähnlich wie der primitive Handel sich oft in der Form der Kriegszüge vollzog. Welche Ursachen diese Erscheinung produzierten, ist nur unsicher zu vermuten: ob ausschließlich die Begierde der Männer, die nie genug Frauen haben können - ob der häufig geübte Kindermord, der hauptsächlich die Mädchen traf und dadurch die erwachsenen Frauen zu seltenen Kampfpreisen machte ob der Umstand, dass das geraubte Weib ein angenehmerer, weil unbeschränkterer Besitz war, als das aus dem eigenen Stamme, das immer ihre eigene Familie als Rückhalt hatte. Gleichviel, die Tatsache steht fest, und ebenso, dass sie nicht weniger Ursache als Folge des Verbotes war, im eigenen Stamm zu heiraten. Dieses Verbot war für die jungen Männer der stärkste Stachel, kriegerische Tüchtigkeit zu erwerben, weil sie nur durch diese zu einem Weibe kommen konnten; andererseits musste der Gebrauch, der die Tapferkeit und den Ruhm des Kriegers mit dem Erwerb der Frau assoziierte, zu einer Herabwürdigung der Frauen des eigenen Stammes führen und musste es als eine Ehrensache erscheinen lassen, einer so leichten Beute zu entsagen. - Es ist endlich das folgende Moment hervorgehoben worden, nach dem das Verbot der Verwandtenehe nicht aus einer sozialen Zweckmäßigkeit, sondern aus einer individuellen Empfindungsweise hervorgehen soll. Ganz entgegen nämlich dem Motive, das ich für das wahrscheinlichste halte: der Verlockung durch das intime Beisammenleben - hat man behauptet, dass ein solches Beisammenleben, wie Hausgenossen es führen, gerade den sinnlichen Reiz abstumpfe; was man von frühester Kindheit an täglich und stündlich vor Augen habe, begehre man nicht mit Leidenschaft; die Gewohnheit des Zusammenlebens dämpfe die Phantasie und Begierde, die vielmehr nur von dem Fernen und Neuen gereizt werde. Aus diesem psychologischen Grunde seien es nicht die Mitglieder der eigenen Familie, sondern immer Fremde, auf die sich der Wunsch des Heiratslustigen wende. Die psychologische Richtigkeit dieser Theorie ist doch nur eine bedingte. Das intime Beisammenleben wirkt keineswegs nur abstumpfend, sondern in vielen Fällen gerade anreizend, sonst würde die alte Erfahrung nicht gelten, dass die Liebe, wo sie beim Eingehen der Ehe fehlte, oft im Laufe derselben entsteht; sonst würde nicht in gewissen Jahren gerade die erste intimere Bekanntschaft mit einer Person des anderen Geschlechts so sehr gefährlich sein. Auch dürfte den ganz primitiven Entwicklungsstufen, auf denen das fragliche Verbot entsteht, jener feinere Sinn für die Individualität fehlen, in Folge dessen nicht die Frau als solche reizvoll ist, sondern ihre von allen anderen unterschiedene Persönlichkeit. Dieser Sinn aber ist die Bedingung, unter der allein der Wunsch sich von den Wesen, die man schon genau kennt, die einem keinen neuen, individuellen Reiz zu bieten haben, zu fremden, von noch ungekannter Individualität wendet. Solange die Begierde in ihrer ursprünglichen Rohheit den Mann beherrscht, ist ihm jede Frau gleich jeder Frau, insoweit sie nicht allzu alt oder seinen Begriffen nach hässlich ist; und jenes höhere psychologische Abwechselungsbedürfnis dürfte kaum die Kraft gehabt haben, die natürliche Trägheit, die ihn zunächst an die ihm nächsten weiblichen Wesen wies, gründlich zu überwinden - so gründlich, dass jenes rein persönliche Moment größeren oder geringeren Reizes, das jeder mit sich abzumachen hatte, zu einem heiligen, von einem Wall furchtbarster Strafen umgebenen Gesetze wurde. Man mag indes ruhig zugeben, dass auch dieses Moment gelegentlich seinen Beitrag zu der Vermeidung der Verwandtenehe geliefert habe. Denn das Prinzip, mit dem man allein sich dem Verständnis einer sozialen Erscheinung nähern kann, ist dies, dass man die Erklärung nie mit einer einzelnen Ursache für abgeschlossen halte. Die moderne Geologie ebenso wie die Entwicklungslehre unterscheiden sich von früheren Meinungen dadurch, dass sie die Entstehung oder die Veränderung des Seienden nicht auf je eine einfache, auf einmal eintretende katastrophenhafte Veranlassung, sondern auf das langsame Zusammenwirken unzähliger kleiner Anstöße zurückführen. Unendlich kleine Schritte und unendlich Zeiträume sind ihre Voraussetzungen. lange Die Wissenschaft von den sozialen Zuständen muss demselben Motto folgen und ihm noch hinzufügen: unendlich verschiedene Ursachen. Das Verbot der Verwandtenehe ist eine besonders lehrreiche soziologische Bestimmung, weil seine Verbreitung durch die ganze Welt und unter den verschiedensten überhaupt vorkommenden Kulturen es doppelt annehmbar macht, dass an einer Stelle die eine Ursache, an der zweiten die gerade entgegengesetzte, an der dritten beide zusammen darauf hingewirkt haben. Die freundschaftlichen und Bündnisbeziehungen zu fremden Stämmen können das Verbot ebenso hervorgerufen haben, wie das Verhältnis von Feindseligkeit und Raub; die Gleichgültigkeit gegen die Familienmitglieder, mit denen man immer zusammenlebt, ebenso wie die Nähe des Reizes, den dieser Umstand gerade hervorrief und dem man zuvorkommen wollte; der Instinkt der Rassenverbesserung ebenso wie der persönliche Wunsch, an dem Weibe einen möglichst unabhängigen Besitz zu haben. Diesen Erklärungsversuchen, von denen sicher keiner für sich allein ganz zureichend, von denen aber sicherlich jeder für irgend einen Teil der Erscheinungen zutreffend ist, steht eine Reihe anderer Theorien über die Verwandtenehe gegenüber, die nicht sowohl historische, auch sonst als wirksam anerkannte Ursachen jenes Verbotes kenntlich machen, sondern dasselbe aus philosophischen Gründen zu rechtfertigen suchen - meistens Theorien jenes nebelhaften Gebietes, auf dem zwischen dem rechtfertigenden Grunde, den der Denker seinerseits wohl für das Entstehen einer fraglichen Erscheinung geltend machen könnte, und der objektiven Ursache nicht unterschieden wird, die diese Erscheinung historisch hervorgebracht hat. Es wird also z. B. von einer Seite behauptet, es sei die »Bestimmung« der Ehe, dass sie durch die Begründung und Kreuzung der Familien die Menschheit zu einer Einheit verbinden soll. Verwandtenehe sei deshalb unzulässig, "weil sie die Familien isoliere und die Liebe selbstsüchtig auf den kleinen Kreis der Verwandten beschränke." Es ist interessant festzustellen, dass einerseits diese feinsinnige Begründung offenbar nicht im geringsten die realen Kräfte kenntlich macht, aus denen das Verbot der Verwandtenehe geflossen ist, dass sie aber andererseits nichts anderes als eine Vergeistigung des vorhin erwähnten Grundes ist! Die Heirat außerhalb des Stammes bezw. der Familie ist ein Mittel der Verbindung mit anderen sozialen Gruppen, also von greifbarem Nutzen für jede von beiden. Indem diese Bestimmung in das metaphysische Stockwerk aufsteigt, verwandelt sie sich in jene, die nicht als in dem historischen Verlauf der Dinge nachgewiesen, sondern, wenn sie mehr als eine subjektive Idee zu sein beansprucht, nur als Moment innerhalb eines göttlichen Weltplans behauptet werden kann; so dass alle die historischen Kräfte, die die einzelne Erscheinung dieses Gebiets hervorbringen, nur untergeordnete Mittel waren, die jener gottgewollte Zweck der Vereinheitlichkeit des Menschengeschlechts sich dienstbar machte. Tatsächlich ist es auch eine kirchliche Seite, von der jene Behauptung ausgegangen ist. Anderthalb Jahrtausende vor ihr hatte ein Kirchenvater schon behauptet, die Verbote der Verwandtenehe hätten den Zweck, zu hindern, dass die Liebe allzu stark würde. Hier dokumentiert sich noch schärfer die Abschiebung der Begründung von der Wirklichkeit auf dasjenige, was man als Ansicht Gottes zu vermuten wagt. Der fromme Vater meinte jedenfalls, dass die Kombination so mannigfaltiger Gemütsinteressen wie das geschwisterliche und das eheliche Verhältnis sie in sich schließt, die Seele gar zu ausschließlich beherrschen und von der Hinwendung auf ihre nichtIrdischen Interessen ableiten würde. Nach dem Prinzip des divide et impera glaubt er, dass die Herrschaft Gottes oder der Kirche über die Seele eine vollständigere sei, wenn diese ihre Neigungen auf mehrere Personen verteilte. Eine anders gerichtete Philosophie betont es, dass das Verbot der Verwandtenehe der Mannigfaltigkeit innerhalb unserer Rasse diene. »Ob zwar«, so drückt sich Kant aus, »der Abscheu wider die Vermischung der zu nahe Verwandten wohl großenteils moralische Ursachen haben mag - so gibt doch seine weite Ausbreitung Anlass zur Vermutung, dass der Grund dazu auf entfernte Art in der Natur selbst gelegen sei, welche nicht will, dass immer die alten Formen wieder reproduziert werden, sondern alle Mannigfaltigkeit herausgebracht werden soll, die sie in die ursprünglichen Keime des Menschenstammes gelegt hatte.« Andere Philosophen des vorigen Jahrhunderts hatten schon hervorgehoben, dass häufige Ehen unter nahen Verwandten die Familien zu einförmig machten, dass die sinnlichen Anlagen nicht hinreichend gemischt würden und die Menschheit nicht nur physisch, sondern auch moralisch verlieren würde, weil die Mannigfaltigkeit der Pflichterfüllungen verkümmern müsste; zu je mehr Personen man in pflichtfordernden Verhältnissen stände, desto größer sei die Summe sittlicher Interessen, die in dem Maße abnehmen müsste, in dem diese Interessen auf wenigere konzentriert werden. Auch dieser Gedanke, dass die Mannigfaltigkeit der Gestaltungen an sich wertvoll, dass es ein Zweck der Natur sei, durch Kombination aller Elemente alle überhaupt mögliche Verschiedenheit auch zur Verwirklichung zu bringen, dieser Gedanke ist offenbar auch nur eine metaphysische Variation der Erfahrung oder des Instinktes dafür, dass die Inzucht eine Verschlechterung der Rasse bewirkt, eine Tatsache freilich, deren tiefere Gründe noch unbekannt, aber in keinem Fall aus einer Tendenz der Natur auf wachsende Mannigfaltigkeit ihrer Produkte zu schöpfen sind. Es ist dies eine der wunderlichsten Vermenschlichungen der Natur, die damit wie ein abwechslungsbedürftiger Mensch, den seine Unruhe zu immer neuen Unternehmungen treibt, vorgestellt wird. Es ist übrigens interessant, dass man zwar die Verwandtenehe verboten sein lässt, weil eine möglichste Mannigfaltigkeit von Bildungen im göttlichen Schöpferplane läge, andererseits aber die rätselhafte Unfruchtbarkeit der Bastarde, der Mischlinge verschiedener Tier- und Menschenrassen, damit begründete, dass nach göttlichem Ratschlusse die Gattungen sich nicht ins Unendliche vermannigfaltigen sollten! - Eine dritte Deutung endlich verwirft jede natürliche und äußerliche Begründung des Verbotes und basiert es vielmehr auf eine im engeren Sinne sittliche Einsicht: eine solche müsste die Vermischung verschiedener sittlicher Verhältnisse verurteilen, deren jedes bloß rein für sich seine eigentümliche Schönheit und Würde entfalten könnte; mehrere unserer feinsinnigsten Philosophen, z. B. Lotze, haben diese Ansicht vertreten. Wer indes eine Einsicht in die »sittlichen« Verhältnisse hat, die bei der Mehrzahl der Naturvölker zwischen Geschwistern einerseits, Ehegatten andererseits bestehen, wird kaum eines von diesen für so schön und würdevoll halten, dass es durch Kombination mit dem anderen viel zu verlieren hätte; ja umgekehrt, bei der Schwäche dieser sittlichen Bindung könnte man gerade voraussetzen, dass ihre Summierung ein zweckmäßiges Mittel wäre, um in dem Einzelnen überhaupt erst einmal eine größere Stärke der sittlichen Impulse zu wecken. In keinem Falle dürfte dieser zarte und ideale Gesichtspunkt das Verbot der Verwandtenehe bei Menschenfressern und nackten Waldmenschen hervorgebracht haben. Aber auch innerhalb der höchsten Kulturen ist seine Geltung nicht unzweifelhaft. Vor allem deshalb, weil die Ehe selbst durchaus kein einheitliches, nur nach einer Richtung hin gestaltetes Verhältnis ist. Sie schließt vielmehr eine große Anzahl durchaus unterscheidbarer sittlicher Beziehungen ein, sie ist keineswegs nur eine Form und Betätigung individueller Liebe, sondern sie enthält ebenso Elemente der Freundschaft, wie des Vermögensrechtes, sie ist ebenso eine soziale wie eine religiöse Institution. Gerade auf der Fülle der äußeren und inneren Interessen, die sie berührt, beruht ihr besonderer sittlicher Wert, in der Weite ihres Rahmens, der einer Unerschöpflichkeit immer neue Lebensbeziehungen Raum bietet, liegt ihr Reiz und ihre Bedeutsamkeit. Gerade die feinste sittliche Charakterisierung der Ehen zeigt, dass manche einen Ton von väterlichem, manche von mütterlichem Verhältnis in sich schließen, ja vielleicht ist keine von einem leisen Hauch so gefärbter Empfindungen ganz frei. Und weshalb es den Begriff der Ehe stören sollte, wenn etwa noch das geschwisterliche Empfinden in den Bezirk der von ihr umschlossenen äußeren und inneren Bindungen eintrete - ist rein theoretisch in keiner Weise einzusehen. Indes berührt sich diese Theorie mit einer anderen, hundert Jahre älteren, die im Anschluss an ein ehemals mit dem größten Interesse behandeltes Problem entstand und die ich als Schlussanmerkung hier zufüge. Es handelt sich um die jüdischen Eheverbote, die die Christenheit, weil sie in der Bibel standen, als auch für sich gültig und eben dadurch sanktioniert ansah. Nun wurde aber im vorigen Jahrhundert die Frage aufgeworfen: Die jüdischen Ehegesetze seien im Zusammenhange mit den übrigen Ritualgesetzen gegeben; entweder nun seien sie für alle Menschheit gegeben, und dann müssten wir auch jenen Ritualgesetzen gehorchen, oder sie seien nur speziell für die Juden gegeben, dann hätten sie für die Christen keine Gültigkeit. Es kam die Schwierigkeit dazu, dass Gott in offenbarem Widerspruch gegen sein späteres Verbot der Verwandtenehe dieselbe im Anfang nicht nur zugelassen, sondern nötig gemacht habe, indem er nur ein einziges Menschenpaar schuf, dessen Kinder keine Wahl hatten, sondern sich nur untereinander fortpflanzen konnten. Dies letztere Problem ist ein schon lange bestehendes, denn Beatrice in »Viel Lärm um nichts« weigert sich scherzhaft, zu heiraten, weil alle Männer als Adams Söhne ihre Brüder wären und sie nicht in so nahe Verwandtschaft heiraten möchte; und sogar ein wilder Stamm in Kalifornien empfand diese Schwierigkeit so, dass in seiner Mythologie behauptet wurde, es wären am Anfang aller Dinge zwei Paare geschaffen worden, um der Notwendigkeit der Blutschande zu entgehen. Innerhalb der christlichen Kirche suchte man sich in verschiedener Weise hiermit abzufinden. Von einer Seite wurde behauptet, Gott habe für diesen Fall einen besonderen Dispens erteilt; andere meinten, die Geschwisterehe habe vor dem Sündenfall mit dem göttlichen und Naturgesetz harmoniert, und erst nach diesem sei sie zur Sünde geworden; wieder andere, sie sei überhaupt nicht durch ein Gesetz der Natur, sondern durch ein positives Gesetz, aus Zweckmäßigkeitsgründen, wenn auch immerhin durch Gott verboten worden. Welche Zweckmäßigkeitsgründe dies gewesen sein mögen, wird von einer interessanten anonymen Schrift aus dem Jahre 1761 »Historische Abhandlung von den Ehegesetzen und den verbotenen Ehen« auseinandergesetzt. Die peinliche Genauigkeit und feine Ausarbeitung, so meint der Verfasser, welche dem Erbrecht bei den Juden eigen war, setzte eine Maßregel voraus, die alle Verwirrung durch Komplikation verwandtschaftlicher Erbanteile ausschloss. Es wird hier zum ersten Male also die Vermutung ausgesprochen, die in neuester Zeit wieder aufgetaucht ist, dass die vermögensrechtlichen Beziehungen in eine unheilbare Konfusion durch die Verwandtenehe geraten wären, und dass man sie aus diesem Zweckmäßigkeitsgrunde ausgeschlossen hätte. Ferner betont der Verfasser, dass das enge Familienleben der Juden, die Bedeutung, die sie der Verwandtschaft beilegten, ganz besonders zur Vermeidung von Ehen disponieren mussten, die die im Hause erforderliche Subordination und Gliederung völlig zerrüttet hätten. Beides sind durchaus verständige und diskutierbare Gründe, und bilden eine greifbare Hypothese, als deren metaphysische Verfeinerung Theorie Lotzes erscheint. die schon erwähnte Statt des ästhetisch unerfreulichen Bildes, dass sich nach dieser Theorie aus der Vermischung verwandtschaftlicher und ehelicher Verhältnisse ergeben würde, bekommen wir hier ein rechtlich und organisatorisch ungenügendes, dem eine viel realere Kraft für die Herbeiführung des Verbotes zuzuschreiben ist. Seinen letztgenannten Grund verallgemeinert der ungenannte Verfasser zu dem Prinzip: alle diejenigen Ehen seien unrechtmäßig, in denen die natürliche durch den Verwandtschaftsgrad gegebene - Superiorität der einen Person durch die Ehe gekränkt werde. Je näher eine Person dem gemeinschaftlichen Stamme, desto größer sei ihre Superiorität. Da nun in der Ehe der Mann der übergeordnete Teil ist, so sei es unrechtmäßig, dass er seine Mutter oder Tante heirate, da diese ihm von Natur untergeordnet sind; ebenso dürfe er nicht seine Schwester heiraten, da diese ihm von Natur gleichgestellt ist, durch die Ehe aber ihm untergeordnet würde, usw. Dies zeigt natürlich der erste Blick als ein ganz unzureichendes Prinzip; dennoch berührt es sich mit einigen interessanten Tatsachen dieses Gebietes, die allerdings zeigen, dass die hier fraglichen Beziehungen manchmal in ihrer Erlaubtheit oder Unerlaubtheit davon abhängig sind, welches Verhältnis der sozialen Überoder Unterordnung zwischen den betreffenden Personen besteht. Bei den Singhalesen ist es der verheirateten Frau gestattet, so viele Liebhaber zu haben, wie sie will, nur dürfen diese nie einer geringeren Kaste als sie selbst angehören. Offenbar herrscht die Vorstellung, dass die Superiorität der Frau, die sie durch ihre Zugehörigkeit zu einer höheren Kaste besitzt, durch das Verhältnis zu einem Mitglied der niederen herabgesetzt werden würde. Eben dieselbe Empfindung, auf einer anderen Stufe, liegt in der berichteten Tatsache, dass ein Beduinenweib in Dschidda gar kein Bedenken trägt, die Maitresse des ersten besten Europäers zu werden, sich dagegen ewig für entehrt halten würde, wenn sie die Ehegattin eines solchen werden sollte. Ihr Rassenstolz dem Europäer gegenüber würde durch diejenige Superiorität, die sie in allgemeiner und rechtlicher Beziehung dem Ehemann einräumen müsste, gekränkt werden, während eine flüchtige und illegitime Beziehung diese herabsetzenden Folgen nicht hat. Ferner: wo Standesunterschiede Ehehindernisse bilden, werden diese oft so modifiziert, dass wenigstens ein Mann des höheren Standes eine Frau des niedrigeren heiraten darf, nicht umgekehrt. So auf Loti, bei den Makassaren, im früheren Indien. Die Superiorität des Mitgliedes des höheren Standes über das des niederen kann eben in der Ehe nur erhalten werden, wenn jenes der Mann, dieses die Frau ist. - Kurz, die Vorstellung, dass gewisse Überordnungsverhältnisse durch eheliche Beziehungen gekreuzt und gestört werden könnten, bildet manchmal das Motiv für Eheverbote, und so ist es nicht ausgeschlossen, dass auch die Verbote der Verwandtenehe teilweise auf eben dieselbe zurückgehen mögen. Simmel Homepage ¦ Sociology in Switzerland Hans-Jürgen Krahl 1943 - 1970 Der Autor Hans-Jürgen Krahl wird 1943 in Sarstedt bei Hannover geboren. Bei einem Bombenangriff verliert er als kleines Kind ein Auge. Nach dem Abitur an einem humanistischen Gymnasium beginnt er 1963 in Göttingen das Studium der Philosophie, Germanistik, Geschichte und Mathematik. 1961 war er der CDU beigetreten und in Göttingen wird er Mitglied einer schlagenden Verbindung. 1964 tritt er in den Sozialistischen Deutschen Studentenbund ein. 1965 immatrikuliert er sich an der Frankfurter Universität und beginnt bei Theodor W. Adorno seine Dissertation mit dem Thema «Naturgesetze der kapitalistischen Entwicklung bei Marx». 1967 ist er der führende Kopf des Frankfurter SDS. Uwe Wesel schreibt in seinem Artikel «Der Krahl» (DIE ZEIT, 12.9.2002): «Überall ist Krahl 1968 dabei. Beim großen Vietnam-Kongress in Berlin und bei der Debatte mit Ralf Dahrendorf auf dem Frankfurter Soziologentag... Im Herbst ... wird er vor der Paulskirche von der Polizei verprügelt, diskutiert darüber mit Adorno, Günter Grass und Habermas und ist im Wintersemester beim aktiven Streik Sprecher aller protestierenden Studenten. Nach der Institutsbesetzung und der Verhaftung (im Januar 1969) ist Krahl ihr Held... Kaum aus der Untersuchungshaft entlassen, eilt er wieder von Auftritt zu Auftritt... Seit Oktober läuft in Frankfurt ein neuer Prozeß wegen Landfriedensbruch... Heiligabend das absurd harte Urteil: ein Jahr und neun Monate Gefängnis. Krahl geht in Revision und bleibt auf freiem Fuß. Und dann das Ende auf der Bundesstraße 252 ... etwa 50 Kilometer vor Marburg, am späten Abend des 14. Februar 1970. Hans-Jürgen Krahl sitzt neben dem Fahrer, der Wagen gerät auf der eisglatten Straße ins Schleudern und stößt zusammen mit einem Lastwagen, der ihnen entgegenkommt. Krahl ist sofort tot.» A n g a b e n z u r P e r s o n *) ____________________________________________ Angaben zur Person zu machen, kann nicht heissen auch nicht im Hinblick auf ein Gericht wie dieses -, zu definieren, was man heute noch hämisch genug «Persönlichkeit» nennt. Es kommt darauf an, dass wir den Erfahrungshintergrund darstellen, der den Politisierungsprozess und damit auch die Studentenbewegung, so wie sie in ihrer antiautoritären Phase sich gebildet hat, erklärt. Und es sind, was meine Person anbelangt, sehr andere Erfahrungszusammenhänge als die des Genossen Amendt. Ich musste aufgrund meiner Herkunft sehr viel längere Umwege machen, um die bürgerliche Klasse, der ich entstamme, zu verraten. Da ich aus einem unterentwickelten Land komme, nämlich aus Niedersachsen, und zwar aus den finstersten Teilen dieses Landes, war es mir noch nicht einmal vergönnt selbst im Rahmen der bürgerlichen Klasse nicht -, die aufgeklärte Ideologie dieser Klasse zu rezipieren; und ich meine, dass eine kurze Darstellung dieser Ideologie notwendig ist, weil diese Ideologien, die ich selbst kennengelernt habe, mit denen ich mich identifizieren musste, denjenigen ähnlich sind, die auch Themen dieses Prozesses bilden werden, nämlich denen Senghors. In Niedersachsen, jedenfalls in den Teilen, aus denen ich komme, herrscht noch zum starken Teil das, was man als Ideologie der Erde bezeichnen kann, und so habe auch ich mich, als ich meinen politischen Bildungsprozess durchmachte, zunächst nicht anders als im Bezugsrahmen der Deutschen Partei bis zur Welfenpartei bewegen können. Ich konnte mir nicht einmal die Ideologien erarbeiten, die Liberalität und Parlamentarismus bedeuten, - wenn man bedenkt, dass die Dörfer, in denen ich aufgewachsen bin, jene NichtÖffentlichkeit noch pflegen in ihren Zusammenkünften, die an die Rituale mittelalterlicher Hexenprozesse erinnern. Wenn man davon ausgeht, dass heute noch in vielen Teilen der Bundesrepublik, vom bayerischen Wald bis zur niedersächsischen Heide, finsterste Ideologien der Mystik stattfinden, so war es sehr verständlich, dass mich mein Bildungsprozess zunächst einmal in den Ludendorffbund trieb, so dass ich begriffliches Denken nicht anders als aus der Mystik Meister Eckharts und Hroswithas von Gandersheim erfahren habe, d.h. Ideologien, die, wenn man sie marxistisch interpretieren will, sicherlich ausgelegt werden können im Sinne eines utopischen Denkens, wie es Ernst Bloch getan hat, die aber, wenn man sie aus dem Erfahrungszusammenhang der herrschenden Klasse rezipiert, finsterste Unmündigkeit reproduzieren. Und so war es schon ein enormer Schritt an Aufklärung, als ich in meiner Heimatstadt Alfeld im Jahre1961 die Junge Union gründete und der CDU beitrat. Das war der erste Schritt, um mich aus diesen noch an Blut und Boden orientierten Ideologien zu befreien, aus dem feudalen Naturzustand einer Agrarwirtschaft überzutreten in die moderne kapitalistische Industriegesellschaft. Und hier muss ich sagen, dass da gewissermassen eine Odyssee durch die Organisationsformen der herrschenden Klasse hindurch begann, und es gehört, das möchte ich mir ganz persönlich zugute halten, ein enormes Ausmass auch an psychischer Konsistenz dazu, in dieser finsteren Provinz zwei Jahre kontinuierlich an CDU-Versammlungen von Kleinstadt-Honoratioren teilzunehmen, denn nach kurzer Zeit stellten sich - und das ist nicht blosse Metapher - Daumiersche Halluzinationen ein, so dass sich die Zusammenkünfte in Versammlungen von Hammel-Lamm- und Rindsköpfen verwandelten. Der nächste Schritt, nämlich der zur Aufklärung über die CDU, war die christliche Kirche. Denn hier zumindest, in der christlichen Kirche, wieviel Pfadfinderideologie sie auch immer mit sich fortschleppt, erfuhr ich zum ersten Mal etwas über den Widerstand gegen den Faschismus - durchaus noch auf dem Boden der inneren Emigration und der Innerlichkeitsideologien im Sinne Bonhoeffers. Aber selbst das war in den Kleinstadtgymnasien, die meinen Bildungsprozess gezeichnet haben, noch viel zu viel. Denn ich erfuhr von dem Direktor unserer Schule, dass Dietrich Bonhoeffer ein perverser Homosexueller gewesen sei und schon deshalb nicht im Sinne eines anständigen Deutschen interpretiert werden könnte, und ich musste von demselben Direktor erfahren, dass alles Übel der Welt von den Engländern und den Juden gekommen sei und dass das grösste Verbrechen in der Geschichte der Menschheit wohl doch der Nürnberger Prozess war. Das waren also Leute, die sich dann öffentlich damit brüsteten, wie oft und mit welchem Grad sie entnazifiziert worden seien. Doch selbst diese anachronistischen Ideologien ermöglichten es einem in dieser finsteren Provinz noch nicht, irgendeine Bewusstseinsalternative zu sehen, und auf diese Weise machte ich auch meine erste Erfahrung mit der Justiz. Als ich von einem Burschenschaftskonvent nach dem Abitur eingeladen wurde, machte ich die Bekanntschaft eines sogenannten Alten Herrn, eines Amtsgerichtsrats, der lammkotelettverzehrend mir erklärte, dass die Arbeiterklasse doch ewig unmündig und dumm bleiben müsse und wir dazu berufen seien, die Elite zu bilden. Das überzeugte mich zwar nicht, gleichwohl wurde ich, als ich anfing zu studieren, Mitglied einer schlagenden Verbindung; das gab dann allerdings auch den Ausschlag. Es war natürlich, dass ich solch eine schlagende Verbindung zunächst einmal selber nur elitär erfahren konnte, d.h. dass ich selber nur elitäre Kategorien ihr gegenüber entwickeln konnte, denn was dort an Stumpfsinn und Unterdrückung produziert wird, was dort in hirnlosen Köpfen, die alle permanent Faschismus produzieren, vor sich geht, kann man zunächst gar nicht anders als elitär interpretieren. Aus dieser schlagenden Verbindung wurde ich allerdings rausgeworfen, nachdem ich einen antiautoritären Aufstand gegen einen Alten Herrn vorgenommen hatte. Die rückständigen und feudalen Ideologien, die es immer noch gibt, können sich so läutern, dass sie zur herrschenden Lehrmeinung in den Instituten, den Akademien und den Universitäten werden: Von der Mystik des gefälschten siebten Buchs Mose war es kein weiter Weg für mich, um in dem Fach, in dem ich studiere, zur theoretischen Selbstbestimmung zu finden, nämlich zu Martin Heidegger. Und hier möchte ich, um klarzumachen, von welcher Art Ideologie man sich in diesem Zusammenhang lösen musste, ein Zitat bringen. Heidegger schreibt in den «Holzwegen»: «Der Mensch, dessen Wesen das aus dem Willen zur Macht gewillt ist, ist der Übermensch. Das Wollen dieses so gewillten Wesens muss dem Willen zur Macht als dem Sein des Seienden entsprechen. Darum entspringt in eins mit dem Denken, das den Willen zur Macht denkt, notwendig die Frage: in welche Gestalt muss sich das aus dem Sein des Seienden gewillte Wesen des Menschen stellen und entfalten, damit es dem Willen zur Macht genügt und so die Herrschaft über das Seiende zu übernehmen vermag? Unversehens und vor allem Unversehen findet sich der Mensch aus dem Sein des Seienden vor die Aufgabe gestellt, die Erdherrschaftzu übernehmen.» (Ffm. 1950, S. 232) Eine imperialistisch abenteuernde Philosophie - und ich muss sagen, dass ich aus diesem ideologischen Kontext schliesslich mich lösen und zum fortgeschrittenen logischen Positivismus und schliesslich zur marxistischen Dialektik übergehen konnte, was auch den Bildungsgang vieler derjeniger kennzeichnet, die es von ihrer Klassenlage her eigentlich nicht nötig haben, sich der Praxis des Proletariats zuzurechnen, denen aber Übelkeit ankommt, wenn sie ihre eigene Klasse und ihre eigenen Klassengesellen kennenlernen, nämlich ihre Lügen und korrupten Einstellungen, mit denen sie täglich sich selber und das Proletariat bis zur Unkenntlichkeit unterdrücken. Wohlgemerkt, diese Lügen sind noch nicht Ideologie, denn Lügen haben kurze und Ideologien lange Beine; Ideologien sind verschleiernd. Was man selber in der herrschenden Klasse, wenn man ihr Mitglied ist, zu hören bekommt, das sind einfach dumme bornierte Lügen - bei den Kleinstadthonoratioren der CDU, bei den Studienräten und den Amtsgerichtsräten, die sich einer weinseligen Solidarität versichern, in Wirklichkeit aber wie die Wölfe untereinander sind. Da hat sich in der herrschenden Klasse nichts geändert. Eine ganz andere Frage ist es, diese Ideologien zu entlarven - und hier muss ich sagen, dass Heidegger (das, was Adorno als «Jargon der Eigentlichkeit» destruiert hat) einer der entscheidenden Ideologen der herrschenden Klasse geworden war -, Ideologien, die noch heute ihre Attraktion nicht verloren haben, wenn man bedenkt, dass er vor der Weltwirtschaftskrise von 1928/29 das Sein zum Tode feierte und damit jenen imperialistischen Krieg vorwegnahm, den Hitler 1939 entfesseln sollte, dass er eine Entschlossenheit predigte, die nicht weiss, wozu sie sich entschliesst, und darum immer an den Führer sich gebunden hat, dass er eine Bindung predigte nach 1945, ohne zu sagen, woran man sich binden soll, um die Bindungen an die CDU um so fester zu machen, und sicherlich wird er auch noch heute einen Seinstrick finden, nachdem Strauss und Kiesinger in die Seinsvergessenheit, d.h. aus der Regierung gestossen sind, um klarzumachen, dass auch in Brandt, Wehner und Scheel das Sein aufleuchtet. Nachdem mich die herrschende Klasse rausgeworfen hatte, entschloss ich mich dann auch, sie gründlich zu verraten, und wurde Mitglied im SDS. Im SDS erfuhr ich zum ersten Mal, was es heisst: Solidarität - nämlich Verkehrsformen herauszubilden, die sich aus den Unterdrückungen und Knechtungen der herrschenden Klasse lösen. Im SDS haben wir zum ersten Mal erfahren, dass es in der Dritten Welt eine greuelhafte Unterdrückung gibt von seiten der USA und des Systems, das sie repräsentieren; im SDS haben wir zum ersten Mal erfahren, dass, wenn die herrschende Klasse Freiheit sagt, sie die Freiheit meint, sich ihre Macht zu nehmen, und die Freiheit zu unterdrücken, dass, wenn die herrschende Klasse Toleranz sagt, sie Toleranz gegenüber ihrer Herrschaft meint und Intoleranz gegen diejenigen, die zwar alles sagen, aber nichts ändern dürfen. Im SDS haben wir zum ersten Mal erfahren, was es heisst, dass es heute überhaupt noch Ausbeutung gibt. Ausbeutung und Unterdrückung sind sicherlich nicht unmittelbar identisch. Was wir in der Dritten Welt erfahren, ist offene, brutale, terroristische Unterdrückung.Was wir hier als Ausbeutung erfahren, ist im hohen Grade verschleiert, sodass es selbst diejenigen, die am unmittelbarsten davon betroffen sind, nämlich das Proletariat, nicht adäquat wahrnehmen können. Und gerade im Hinblick auf diesen Prozess, in dem es sicherlich um die Dialektik von Ausbeutung in den spätkapitalistischen Industriemetropolen einerseits und unmittelbarer Unterdrückung andererseits in den Kolonien und in den im Elend und Hunger gehaltenen Ländern der Dritten Welt geht, möchte ich Sartre zitieren. Er schreibt in seiner «Critique de la raison dialectique» über den Unterschied von Ausbeutung und Unterdrückung: «Man hätte unrecht, mir die kapitalistische Ausbeutung und die Unterdrückung entgegenzuhalten. Denn dabei muss man bedenken, dass der eigentliche Schwindel der Ausbeutung auf der Grundlage eines Vertrages geschieht. Und wenn es stimmt, dass dieser Vertrag d.h. die Praxis - zwangsläufig in inerte Ware verwandelt wird, so trifft es ebenso zu, dass er gerade in seiner Form ein Wechselverhältnis darstellt: es handelt sich um einen freien Tausch zwischen zwei Menschen, die sich in ihrer Freiheit anerkennen. Der eine gibt lediglich vor, nicht zu wissen, dass der andere unter dem Druck der Bedürfnisse gezwungen ist, sich wie ein materieller Ge genstand zu verkaufen. Aber das ganze gute Gewissen des Unternehmers beruht auf dem Moment des Tausches, bei dem der Lohnempfänger scheinbar seine Arbeitskraft in voller Freiheit anbietet. Zwar ist er nicht frei gegenüber dem Elend, aber juristisch ist er doch tatsächlich frei gegenüber dem Unternehmer, da dieser zumindest theoretisch - im Moment der Einstellung keinen Druck auf die Arbeiter ausübt und sich nur darauf beschränkt, einen Maximallohn festzulegen und alle, die mehr verlangen, zurückzuweisen. Auch hier noch ist es die Konkurrenz und der Antagonismus der Arbeiter selbst, die ihre Forderungen herabsinken lassen; der Unternehmer dagegen wäscht seine Hände in Unschuld. Dieses Beispiel zeigt zur Genüge, dass der Mensch nur für den anderen und für sich selbst Ding wird, eben weil er zunächst durch die Praxis als eine menschliche Freiheit gesetzt ist. Die absolute Achtung der Freiheit des Elenden ist die beste Weise, ihn im Augenblick des Vertrages dem materiellen Druck auszuliefern.» (Hamburg 1967, S. 116) Sartre hat hier das, was in der marxistischen Lehre als Lehrmeinung tradiert wurde, sehr konzentriert zusammengefasst: dass nämlich Ausbeutung eine Herrschaft ist, die auf einem hohen Grad von Verschleierung beruht, verschleiert durch den Tauschverkehr, verschleiert auch durch die Institutionen der Unterdrückung, die bürgerlichen Gerichte, durch die Zwangsgewalt von Recht und Staat. Das bedeutet - und das ist auch die Rolle, die wir im SDS als Intellektuelle in der Aktualisierung des Klassenkampfes zu übernehmen haben -, dass wir im praktischen Kampf die Theorie entfalten müssen, die für das Proletariat, seine Sprach- und Bewusstseinswelt die Herrschaft hier im Spätkapitalismus verständlich macht, die so unendlich manipulativ und integrativ überdeckt ist, sie entschleiert und aufdeckt; dass es unsere Funktion ist, als politische Intellektuelle unser Wissen in den Dienst des Klassenkampfes zu stellen. Die Solidarisierung mit den sozialrevolutionären Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt war entscheidend für die Ausbildung unseres antiautoritären Bewusstseins. Denn dort liegt die Unterdrückung offen zutage; dort ist sie noch nicht verschleiert durch einen schon etablierten bürgerlichen Tauschverkehr. So lehrte uns die Dritte Welt einen Begriff kompromissloser und radikaler Politik, der sich von der seichten, prinzipienlosen bürgerlichen Realpolitik absetzt. Che Guevara, Fidel Castro, Ho Tschi Minh und Mao Tsetungsind Revolutionäre, die uns eine politische Moral kompromissloser Politik vermittelten, die uns zweierlei ermöglichte: Erstens konnten wir uns absetzen von der Politik der friedlichen Koexistenz, wie sie von der Sowjetunion - selbst schon realpolitisch verkommen. betrieben wird, und zweitens konnten wir den Terror, den die USA und in ihrem Gefolge auch die Bundesrepublik in der Dritten Welt ausüben, identifizieren. Auch hier hat Sartre - wenn man das als Kontrast setzt zu der ideologisch verschleierten Unterdrückung in den spätkapitalistischen Metropolen, d.h. der Herleitung der poli tischen Freiheit aus ökonomischer Ausbeutung, die in den funktionierenden Verwertungsphasen des Kapitalismus als solche nicht erkannt wird - die Unterdrückung in der Dritten Welt prägnant gezeichnet. Er sagt im Gegensatz zu dem, was er als Ausbeutung gekennzeichnet hat: «Die Unterdrückung dagegen besteht vielmehr darin, den anderen als Tier zu behandeln. Im Namen ihrer Achtung der Tiere verurteilten die amerikanischen Südstaatler die Fabrikanten des Nordens, weil diese die Arbeiter wie Material behandelten. Nur ein Tier kann man ja durch Abrichtung, Schläge und Drohungen zur Arbeit zwingen und nicht das «Material». Dennoch erhält der Sklave durch den Herren seine Animalität nach der Anerkennung seiner Menschlichkeit. Es ist bekannt, dass die amerikanischen Pflanzer im 17. Jahrhundert die schwarzen Kinder auf keinen Fall in der christlichen Religion erziehen lassen wollten, weil sie damit das Recht verloren hätten, sie als Untermenschen behandeln zu können. Das heisst implizite anerkennen, dass sie schon Menschen waren. Der Beweis dafür ist, dass sie sich von ihren Herren nur durch einen religiösen Glauben unterschieden, von dem man gerade durch den Eifer, den Schwarzen diesen Glauben zu verwehren, zugab, dass sie in der Lage wären, ihn zu erwerben. Selbst die demütigendste Ordnung muss in Wirklichkeit von Mensch zu Mensch gegeben sein, auch der Herr muss auf den Menschen in der Person seiner Sklaven setzen. Man kennt ja den Widerspruch des Rassismus, des Kolonialismus und aller Formen von Diktatur: um einen Menschen wie einen Hund zu behandeln, muss man ihn zuerst als Menschen anerkannt haben. Das geheime Unbehagen des Herrn rührt daher, dass er ständig gezwungen ist, die menschliche Realität in seinen Sklaven in Rechnung zu stellen ... und ihnen gleichzeitig den ökonomischen und politischen Status zu verweigern, der in dieser Zeit die menschlichen Wesen definiert.» (ibid.) Wenn man diesen Unterschied von Ausbeutung und Unterdrückung, den Sartre gekennzeichnet hat, in Rechnung stellt, so gibt es gleichwohl eine objektive Identität, die als wiederum objektive Motivation unseres antiautoritären Protests in den Metropolen durchscheint. Während in den ehemaligen Kolonien, in den ausgebeuteten Ländern der Dritten Welt die unterdrückten Massen auf den Status einer brutalen Animalität reduziert werden, haben sicherlich jene Analytiker und Theoretiker recht (und das erklärt es auch, warum Söhne aus der bürgerlichen Klasse, keineswegs verwöhnt - Zuckerschlecken haben wir alle nicht gehabt, wie es die bürgerliche Presse uns suggeriert -, gleichsam übergelaufen sind zu der Klasse, in der sich die befreiende Menschheit repräsentiert, nämlich im Proletariat), dass es auch hier auf dem entwickeltsten Stand des technischen Fortschritts und auf dem forgeschrittensten Stand der Bedürfnisbefriedigung, weit über das Mass physischer Selbsterhaltung hinaus, so etwas gibt wie eine Vertierung des Menschen. Denn nicht anders ist es zu erklären, dass selbst das bürgerliche Individuum, das unter sehr vielen Zwängen und unter sehr viel Leistungsdruck sich herausbildete, im Grunde genommen durch den Prozess des Faschismus hindurch vernichtet wurde; dass, wie es Theoretiker der Frankfurter Schule einmal gesagt haben, sich einige Menschen schämen müssten, wenn sie «ich» sagen, das bedeutet, dass im bürgerlichen Ich, so wie Marcuse es ausführte, immer noch die Fähigkeit zur Kritik, zur Erfahrung, zur Erinnerung und zum Begreifen enthalten war, dass aber heute im Zuge des technischen Fortschritts und der anarchischen Verwaltung des industriellen Maschinenparkes durch wenige Kapitaleigentümer die Menschen auf blosse Reaktion, gleichsam nach dem Pawlowschen Reflex, reduziert werden; dass sie nurmehr reagieren, aber in keinerlei Weise mehr agieren können. Dieser Verfall des bürgerlichen Individuums ist eine der wesentlichen Begründungen,aus der die Studentenbewegung den antiautoritären Protest entwickelte. In Wirklichkeit bedeutete ihr antiautoritärer Anfang ein Trauern um den Tod des bürgerlichen Individuums, um den endgültigen Verlust der Ideologie liberaler Öffentlichkeit und herrschaftsfreier Kommunikation, die entstanden sind aus einem Solidaritätsbedürfnis, das die bürgerliche Klasse in ihren heroischen Perioden, etwa der französischen Revolution, der Menschheit versprochen hatte, das sie aber nie einzulösen vermochte, und das jetzt endgültig zerfallen ist. Die Form liberaler Öffentlichkeit, gewaltlosen Machtkampfes im Parlament, und auch jene forensischen emanzipativen Leistungen, die einstmals die Zwangsgewalt im Bürgertum, die Zwangsgewalt der richterlichen Gewalt, parlamentarisieren sollten - all diese emanzipativen Gehalte des Bürgertums sind längst zerfallen. Wir trauerten ihnen nach, wir meinten sogar, dass allein Randgruppen, intellektuelle, privilegierte Randgruppen in Stellvertretung für die Arbeiterklasse handeln und gewissermassen eine Art Menschheitsrevolution, ohne Unterschied der Klassen, initiieren könnten. Das alles hat sich sicherlich als Ideologie herausgestellt. Gleichwohl war in diesem Solidaritätsbedürfnis eine entscheidende Wahrheit enthalten, nämlich diese, dass man das Proletariat nur unter Unterdrückung seiner emanzipativen Regungen davon abhalten kann, sich auf irgendeine selbsttätige Weise zu solidarisieren und untereinander zu organisieren. Die wilden Streiks in der letzten Zeit haben gezeigt, dass dies auf die Dauer nicht gelingen wird, dass es wahrscheinlich noch nicht einmal dem grossen Disziplinierungsapparat der Gewerkschaften gelingen wird, das Proletariat an selbsttätiger Organisation zu hindern. Wir haben in einem marxistischen Lernprozess, der durch die Aktionen gegen den Krieg in Vietnam, gegen den Springer-Konzern und die Notstandsgesetze hindurchging, die ersten klassenbewussten Kriterien des Proletariats erkannt. Die antiautoritäre Revolte war ein marxistischer Lernprozess, in dem wir uns allmählich von den Ideologien des Bürgertums gelöst und ihre Emanzipationsversprechen als blosse Ideologie entschleiert haben, und in dem wir uns endgültig klargeworden sind, dass selbst die klassischen Formen der Liberalität und der Emanzipation, die noch den liberalen Konkurrenzkapitalismus leiteten, endgültig dahin sind; dass es jetzt darauf ankommt, im Kampf gegen den Staat, gegen diese bürgerliche Justiz und gegen die organisierte Macht des Kapitals in einem langwierigen und sicherlich schwierigen Prozess Bedingungen zu erarbeiten, damit wir in organisatorischen Kontakt mit der Arbeiterklasse treten können und die geschichtlichen Bedingungen für die Bildung von Klassenbewusstsein schaffen können. Das war ein langfristiger Bildungsprozess, der sich im SDS selber durchsetzen musste. Dazu ist noch ein anderes zu sagen: die entscheidende Erfahrung, die im SDS gemacht worden ist, ist die, dass die gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen heute so durch Herrschaft zersetzt sind, dass ein Verkehr, in dem die Menschen sich nicht gegenseitig wie Dinge behandeln, sondern die einzelnen Subjekte sich in ihrer Objektivität als besondere Subjekte anerkennen, geradezu unmöglich geworden ist. Und das, was im Prozess der Auseinandersetzungen in derAusserparlamentarischen Opposition, in den Kerngruppen des SDS, in den Basisgruppen von jungen Lehrlingen, von der bürgerlichen Presse immer wieder als selbstzerstörerisch interpretiert wurde, nämlich unsere unendlichen Diskussionen und auch jene Aggressionen, die in unseren eigenen Reihen immer wieder auftreten, ist Ausdruck einer organisationspraktischen Bildungsgeschichte, die es bislang in der Geschichte der Bundesrepublik und in der Geschichte Deutschlands seit dem Faschismus nicht gegeben hat: nämlich dass es hier eine Gruppe gibt, die durch alle Irrationalitäten hindurch - denn sicherlich sind wir selbst noch mit den Malen kapitalistischer Herrschaft geschlagen, gegen die wir kämpfen - um herrschaftsfreie Beziehungen, um einen Abbau an Herrschaft und Aggression kämpft; dass dies die einzige Gruppe ist, die versucht, rational darüber zu diskutieren, dass Gewaltlosigkeit in dieser Gesellschaft schon immer eine Ideologie war, dass unter dem Deckmantel der Gewaltlosigkeit Gewalt angewandt wird von der herrschenden Klasse; dass wir diskutieren, was die herrschende Klasse ihrem Gewaltbegriff gegenüber nicht diskutieren kann, nämlich unter welchen gesellschaftlichen Unterdrückungssituationen Gewalt historisch legitim ist. Die Legalität bürgerlicher Gerichte kann sich nicht mehr legitim begründen. Sie ist blanke, unbegründete Gewalt geworden, sie verfügt über keinen Emanzipations- und Legitimationsbegriff, sie übt nur Unterdrückung im Dienste des Kapitals aus. Wir demgegenüber haben erkannt und gesehen, dass es, wenn man gegen diese Gesellschaft kämpft, notwendig ist, die ersten Keimformen der künftigen Gesellschaft schon in der Organisation des politischen Kampfes selbst zu entfalten - die ersten Keimformen anderer menschlicher Beziehungen, herrschaftsfreien menschlichen Verkehrs, selbst um den Preis einer hohen Disziplinierung und Unterdrückung, die wir uns selbst auferlegen müssen. Auch wir können, wie Marx sagt, das künftige Jerusalem in unseren Organisationen nicht vorwegnehmen. Auch in unseren Organisationen, das können wir der herrschenden Klasse offen sagen, herrscht noch - allerdings selbstauferlegte Unterdrückung. Aber der Unterschied zur blinden Unterdrückung der bürgerlichen Klasse ist der: In der bürgerlichen Klasse und ihren Theorien bestand immer schon die antagonistische Wirtschaftsideologie, dass entweder der Egoismus der Menschen den Fortschritt in der Wirtschaft vorantreibt oder dass jeder von seinem einzelnen Egoismus radikal abzusehen habe. In Wirklichkeit, sagt Marx, ist es so, dass im bürgerlichen Tauschverkehr, der auf nichts anderes als auf Profit ausgerichtet ist, jeder einzelne absolut seinen einzelnen und beschränkten Egoismus verfolgt und dass in diesem Konkurrenzkrieg aller Einzelegoismen - und die Konkurrenz ist immer ein latenter Kriegszustand sich das gesellschaftliche Allgemeininteresse als besonderes der bürgerlichen Klasse durchsetzt. Wenn wir diese Gesellschaft verneinen wollen, und zwar in einer bestimmten Form verneinen wollen, so dass sich schon die ersten Keimformen anderer Beziehungen in unserer Organisation selbst andeuten, dann bedeutet das, dass jeder einzelne um der Freiheit des anderen willen von seinem einzelnen Egoismus abstrahieren muss, dass er sich selbst Unterdrückung auferlegen muss, wenn er mit der Freiheit eines jeden anderen, wie es heisst, will zusammenstimmen können. Die kommunistische Organisation des politischen Kampfes löst die Emanzipationsversprechen des bürgerlichen Tauschverkehrs überhaupt erst ein. Und auf diesem Wege werden sich Formen herausbilden, die schliesslich das, was Marx als den Verein freier Menschen, die kommunistisch assoziiert sind, die herrschaftsfrei miteinander verkehren, versteht, zustande bringen. Uns wird immer wieder gesagt, ihr seid deshalb nicht legitim, weil ihr nicht angeben könnt, wie die künftige Gesellschaft aussehen soll. Das sagen immer diejenigen, die meinen, nun gebt uns erst einmal ein Rezept, und dann entschliessen wir uns vielleicht, ob wir mittun wollen. Das sagen jene Heuchler und Feiglinge, die meistens in den Redaktionen der bürgerlichen Presse sitzen. Die künftige Gesellschaft kann man nicht vorwegnehmen. Wir können sagen, wie der technische Fortschritt in hundert Jahren aussehen wird, aber wir können nicht sagen, wie die menschlichen Beziehungen in hundert Jahren aussehen werden, wenn wir nicht anfangen, sie ad hoc, unter uns, im gesellschaftlichen Verkehr zu verändern. Was wir machen können, ist. immanent anzusetzen an jenen verzerrten, unterdrückten Verkehrsformen, die die bürgerliche Gesellschaft entwickelt hat. Wir negieren sie, d.h. wir lösen überhaupt erst im politischen Kampf die Emanzipationsversprechen ein, die Ihr, also die Vertreter auch der bürgerlichen Justiz, gegeben, aber nicht gehalten habt. Diesen Sachverhalt der Solidarität und der Herrschaftsfreiheit in der Organisation des politischen Kampfes hat Maurice Mer-leau-Ponty, einer der grossen französischen Revolutionstheoretiker, dargelegt. Er sagt: «Der tiefe philosophische Sinn des Begriffs der Praxis besteht darin, uns in eine Ordnung einzuführen, welche nicht die der Erkenntnis, sondern die der Kommunikation, des Austauschs, des Umgangs ist... Die Partei im kommunistischen Sinne ist diese Kommunikation, und eine solche Auffassung von der Partei ist kein Anhängsel des Marxismus; sie ist sein Zentrum. Es sei denn, man macht daraus wieder einen Dogmatismus - aber wie sollte er zustandekommen, da er sich von vornherein nicht in der Selbstgewissheit eines universellen Subjekts installieren kann. Der Marxismus verfügt nicht über eine Totalansicht der Weltgeschichte, und seine ganze Geschichtsphilosophie ist nur die Entwicklung partieller Einsichten, die ein geschichtlich situierter Mensch, der sie zu verstehen sucht, über seine Vergangenheit und Gegenwart gewinnt. Sie bleibt hypothetisch, abgesehen davon, dass sie im bestehenden Proletariat und in seiner Einwilligung die einzige Garantie findet, die es ihr gestattet, als Seinsgesetz zu gelten. Die Partei ist also wie ein Mysterium derVernunft: sie ist derjenige Ort der Geschichte, an dem der seiende Sinn seiner selbst inne, an dem der Begriff zum Leben wird, und jede Abweichung, welche die Beziehungen von Partei und Klasse denen von Führern und Truppe anähnelte, indem sie die den Marxismus beglaubigende Prüfung listig umginge, würde aus ihm eine «Ideologie» machen.» («Die Abenteuer der Dialektik», Ffm. 1968, S.62ff.) Das, was ich eben dargelegt habe und von dem jeder sich überzeugen kann, der in unsere öffentlich tagenden Versammlungen kommt, bestätigt, dass es bei uns im Prinzip um die noch herzustellende Beziehung von Organisation und Klasse geht, dass es bei uns um eben diese Kommunikation geht, nicht aber darum, was uns hier von den bürgerlichen Gerichten immer wieder unterstellt wird, nämlich um das Verhältnis von Führer und Truppe; dass es nicht um jene Projektion geht, die immer wieder vorgenommen wird, nämlich die Organisation des Polizeiapparats auf unsere eigene Organisation zu projizieren. Die Phantasielosigkeit, die Begriffsstutzigkeit und die Dummheit der Vertreter der herrschenden Klasse kann natürlich nicht anders, als ihre eigenen autoritären Hierarchien auf uns übertragen. Sie kann, will und darf nicht glauben, dass es bei uns um Fragen herrschaftsfreier Kommunikation geht. Wir machen solange individuelle und vereinzelte Bildungsprozesse mit allen Entstellungen und Narben durch, solange wir entweder Mitglieder der herrschenden Klasse oder der unorganisierten, in sich zerrissenen Arbeiterklasse sind, in der jeder einzelne gezwungen ist, seine Haut zu Markt zu tragen; wir machen solange entstellte und verzerrte Bildungsprozesse durch, solange wir vereinzelt sind und nicht organisiert, solange wir uns den Ideologien der herrschenden Klasse und des kapitalistischen Maschinenparkes unterwerfen müssen. In dem Augenblick aber wird unser Bildungsprozess ein kollektiver, nicht im Sinne der Vernichtung von Individualität, sondern überhaupt erst in der Herstellung von Individualität, so wie er metaphysisch in Hegels «Phänomenologie des Geistes», materialistisch in Marxens «Kapital» und psychoanalytisch in den Theorien Freuds formuliert ist, indem wir diese Gesellschaft als ein totales Ausbeutungssystem durchschauen, in dem die produktive Lebenstätigkeit der Menschennatur verkümmert. Wir machen Bildungsprozesse durch, die überhaupt erst Individualität wieder herstellen und das, was Individualität ist, in einem emanzipativen Sinne rekonstruieren, indem wir uns im praktischen Kampf gegen dieses System zusammenschliessen. Marcuse hat recht, wenn er sagt, dass selbst für die kapitalistische Gesellschaft, in der so viele so ruhig materiell gesichert leben, gilt, dass man nicht Mensch bleibt, wenn man nicht diese Gesellschaft radikal bekämpft; und wir haben eine Legitimation. Diejenigen, die heute die Macht im Staate innehaben, können nur begriffslos um Positionen konkurrieren. Sie haben die Macht inne und nichts anderes. Auch wir kämpfen um die politische Macht im Staat, aber wir haben eine Legitimation, denn unser Machtkampf ist begleitet von einem permanenten Kommunikationsprozess, in dem sich die Kategorien der Emanzipation, die erst im abstrakten Prinzip existieren, realisieren und entfalten, wo sie zum praktischen Dasein werden. Selbst in diesem System, in dem keiner mehr zu hungern hat, in dem kein physisches Elend besteht, bleibt eines bestehen: diese Gesellschaft, so wie sie organisiert ist, hat es im Laufe der Entwicklung der Menschengeschichte nicht nur fertiggebracht, dass man Messer und Gabel hat, dass man sogar Fernsehapparate und Kühlschränke hat, sie hat auch ein hohes Kulturniveau produziert und eine wunderbar reibungslose Zivilisation - Bedürfnisse, die alle den Stand der physischen Selbsterhaltung weit überschreiten. Aber die Allgegenwart eines autoritären Staats und die Abhängigkeit vom Kapital, die die Massen zwingt, ihre Arbeitskraft als Ware zu verkaufen, fesselt das Bewusstsein der Massen immer wieder an jene Formen elementarer Bedürfnisbefriedigung; denn dieser Staat und das Kapital können die Massen - und sie tun es auch - permanent mit der Angst aufstacheln, dass es ihnen auch wieder anders gehen könnte. Jene erweiterte Bedürfnisbefriedigung war nicht verbunden mit einem Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, war nicht verbunden mit einer Entfaltung der Phantasie und der schöpferischen Tätigkeit der Menschennatur. Aber sie ist immer noch, auch hier, obwohl sie all diesen verdinglichten gesellschaftlichen Reichtum besitzt, ängstlich an die materielle Sicherheit und Bedürfnisbefriedigung gebunden, obwohl wir einen Stand materieller Sicherheit haben, der längst eine Entfaltung der Menschen ermöglichte, die weit darüber hinausgehen könnte. Das ist die eigentliche Knechtschaft im Kapitalismus. Das ist das Moment sozialer Unterdrückung, das wir als diejenigen, die privilegiertsind, zu studieren, auch einsehen konnten. Und dieses Privileg wollen wir durchbrechen, so dass man noch einmal die Frage beantworten kann, warum eigentlich solche, die es ihrer Herkunft nach eigentlich nicht nötig haben - das gilt sicherlich auch in der Studentenbewegung nur für einen kleinen Teil -, warum diejenigen, die es ihrer Herkunft nach nicht nötig haben, zur Rebellion und zur Revolution überzugehen, gleichwohl sich fortschrittlichen sozialrevolutionären Bewegungen anschliessen. Es ist nicht das blosse Trauern um den Tod des bürgerlichen Individuums, sondern es ist die intellektuell vermittelte Erfahrung dessen, was Ausbeutung in dieser Gesellschaft heisst, nämlich die restlose und radikale Vernichtung der Bedürfnisentwicklung in der Dimension des menschlichen Bewusstseins. Es ist immer noch die Fesselung der Massen, bei aller materiellen Bedürfnisbefriedigung, an die elementarsten Formen der Bedürfnisbefriedigung - aus Angst, der Staat und das Kapital könnten ihnen die Sicherheitsgarantien entziehen. So hat auch Ernst Bloch -derjenige, dem (vor dem Imperialisten Senghor) als Revolutionär und utopischen Marxisten der Friedenspreis verliehen wurde - argumentiert, wenn er im «Prinzip Hoffnung» die Frage stellt: Warum sind diejenigen, die es nicht nötig haben, zur roten Fahne übergelaufen? Er sagt: «Es ist die sich tätig begreifende Menschlichkeit.» ________________ *) Diese politische Autobiographie war der Beitrag H.-J. Krahls zur Personenbefragung im Prozess wegen Rädelsführerei usw., in dem er zusammen mit den Genossen G. Amendt und K. D. Wolff wegen der Protestaktionen gegen die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1968 an den Präsidenten der Republik Senegal. L. S. Senghor, angeklagt war. Der Beitrag war ohne Konzept frei gehalten worden. Das Tonbandprotokoll wurde im SCInfo 19. Frankfurt 1969. veröffentlicht. (Anm. d. Hg.)