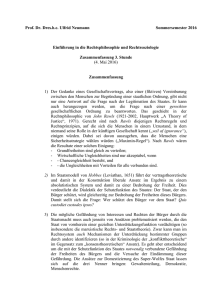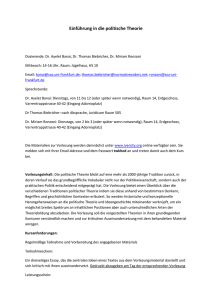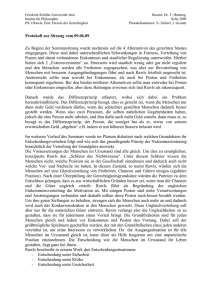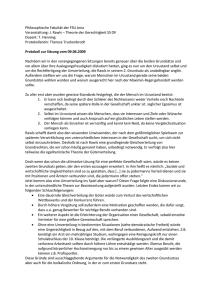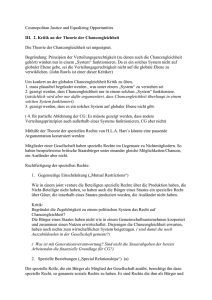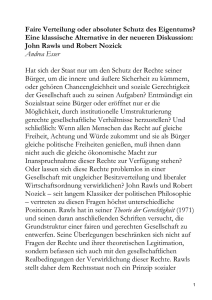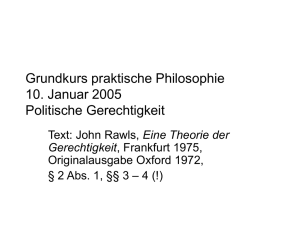John Rawls Unter den Theorien der Gerechtigkeit, die im
Werbung
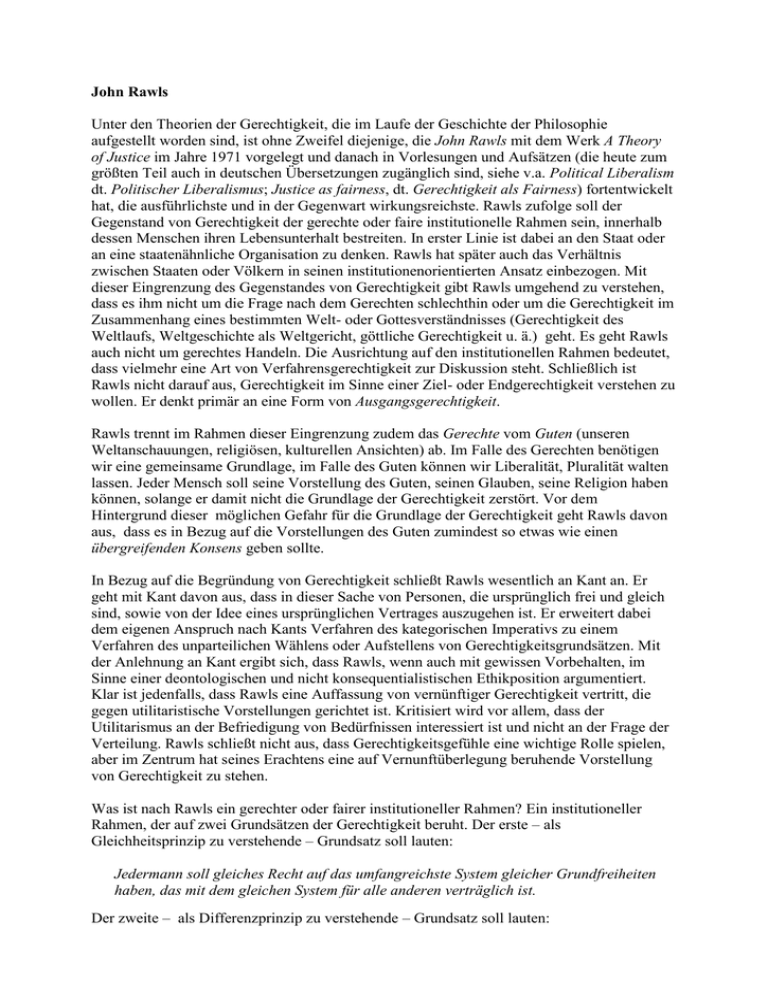
John Rawls Unter den Theorien der Gerechtigkeit, die im Laufe der Geschichte der Philosophie aufgestellt worden sind, ist ohne Zweifel diejenige, die John Rawls mit dem Werk A Theory of Justice im Jahre 1971 vorgelegt und danach in Vorlesungen und Aufsätzen (die heute zum größten Teil auch in deutschen Übersetzungen zugänglich sind, siehe v.a. Political Liberalism dt. Politischer Liberalismus; Justice as fairness, dt. Gerechtigkeit als Fairness) fortentwickelt hat, die ausführlichste und in der Gegenwart wirkungsreichste. Rawls zufolge soll der Gegenstand von Gerechtigkeit der gerechte oder faire institutionelle Rahmen sein, innerhalb dessen Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten. In erster Linie ist dabei an den Staat oder an eine staatenähnliche Organisation zu denken. Rawls hat später auch das Verhältnis zwischen Staaten oder Völkern in seinen institutionenorientierten Ansatz einbezogen. Mit dieser Eingrenzung des Gegenstandes von Gerechtigkeit gibt Rawls umgehend zu verstehen, dass es ihm nicht um die Frage nach dem Gerechten schlechthin oder um die Gerechtigkeit im Zusammenhang eines bestimmten Welt- oder Gottesverständnisses (Gerechtigkeit des Weltlaufs, Weltgeschichte als Weltgericht, göttliche Gerechtigkeit u. ä.) geht. Es geht Rawls auch nicht um gerechtes Handeln. Die Ausrichtung auf den institutionellen Rahmen bedeutet, dass vielmehr eine Art von Verfahrensgerechtigkeit zur Diskussion steht. Schließlich ist Rawls nicht darauf aus, Gerechtigkeit im Sinne einer Ziel- oder Endgerechtigkeit verstehen zu wollen. Er denkt primär an eine Form von Ausgangsgerechtigkeit. Rawls trennt im Rahmen dieser Eingrenzung zudem das Gerechte vom Guten (unseren Weltanschauungen, religiösen, kulturellen Ansichten) ab. Im Falle des Gerechten benötigen wir eine gemeinsame Grundlage, im Falle des Guten können wir Liberalität, Pluralität walten lassen. Jeder Mensch soll seine Vorstellung des Guten, seinen Glauben, seine Religion haben können, solange er damit nicht die Grundlage der Gerechtigkeit zerstört. Vor dem Hintergrund dieser möglichen Gefahr für die Grundlage der Gerechtigkeit geht Rawls davon aus, dass es in Bezug auf die Vorstellungen des Guten zumindest so etwas wie einen übergreifenden Konsens geben sollte. In Bezug auf die Begründung von Gerechtigkeit schließt Rawls wesentlich an Kant an. Er geht mit Kant davon aus, dass in dieser Sache von Personen, die ursprünglich frei und gleich sind, sowie von der Idee eines ursprünglichen Vertrages auszugehen ist. Er erweitert dabei dem eigenen Anspruch nach Kants Verfahren des kategorischen Imperativs zu einem Verfahren des unparteilichen Wählens oder Aufstellens von Gerechtigkeitsgrundsätzen. Mit der Anlehnung an Kant ergibt sich, dass Rawls, wenn auch mit gewissen Vorbehalten, im Sinne einer deontologischen und nicht konsequentialistischen Ethikposition argumentiert. Klar ist jedenfalls, dass Rawls eine Auffassung von vernünftiger Gerechtigkeit vertritt, die gegen utilitaristische Vorstellungen gerichtet ist. Kritisiert wird vor allem, dass der Utilitarismus an der Befriedigung von Bedürfnissen interessiert ist und nicht an der Frage der Verteilung. Rawls schließt nicht aus, dass Gerechtigkeitsgefühle eine wichtige Rolle spielen, aber im Zentrum hat seines Erachtens eine auf Vernunftüberlegung beruhende Vorstellung von Gerechtigkeit zu stehen. Was ist nach Rawls ein gerechter oder fairer institutioneller Rahmen? Ein institutioneller Rahmen, der auf zwei Grundsätzen der Gerechtigkeit beruht. Der erste – als Gleichheitsprinzip zu verstehende – Grundsatz soll lauten: Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist. Der zweite – als Differenzprinzip zu verstehende – Grundsatz soll lauten: Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass erstens vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen [nach einer 2. Formulierung]den am wenigsten Begünstigen die bestmöglichen Aussichten bringen), und zweitens sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen. [Siehe Eine Theorie der Gerechtigkeit, 81, 104. Zu späteren revidierten Formulierungen der beiden Grundsätze siehe unten] Rawls geht davon aus, dass für die Gültigkeit und Akzeptanz dieser Grundsätze sowohl historische Gründe als auch Gründe der Vernunft sprechen. Die beiden Grundsätze gehören zum einen zum Ideengut bürgerlich-demokratischer Staaten und werden in den Verfassungen dieser Staaten tendenziell auch verwirklicht. Zum anderen haben diese Grundsätze, und darauf kommt es Rawls entscheidend an, einen Rückhalt im Vernunftvermögen des Menschen, genauer: im Vermögen des Menschen, seine eigenen und gemeinschaftlichen Interessen vernünftig zu verfolgen – wobei man vernünftig am besten in einem weiten Sinne, sowohl als strategisch-vernünftig als auch als kommunikativ-vernünftig, fasst. Rawls selber hat diese zweifache Bedeutung von „vernünftig“ auch durch die Unterscheidung des Rationalen („rational“) vom Vernünftigen („reasonable“) zum Ausdruck gebracht. Genauer besehen ergeben sich im Falle dieses Vernunftgrundes die beiden Grundsätze Rawls zufolge aus dem Zusammenhang der allgemeinen Tatsache, dass Menschen freie, zweckmäßig handelnde, sowohl eigeninteressierte als auch an Kooperation interessierte, für Sicherheit, Frieden und Wohlstand eintretende Personen sind und dass sie als solche Person (durch Vernunft) der Lage sind, ihre individuellen Interessen miteinander zu koordinieren und auf das Gemeinwohl abzustimmen. Im Kern argumentiert Rawls dahingehend, dass Personen des beschriebenen Profils dann, wenn sie Grundsätze der Gerechtigkeit wählen könnten, sich für diese beiden Grundsätze und keine anderen entscheiden würden. Rawls erläutert diese Entscheidungssituation mittels des folgenden Denkexperimentes, bei dem die Begriffe einer Urposition („original position“) und eines Schleiers des Nichtwissens („veil of ignorance“) eine zentrale Rolle spielen. Man stelle sich eine Gruppe von Menschen vor, die ihre individuellen Bedürfnisse befriedigen und individuellen Ziele verfolgen wollen, die miteinander arbeiten, Güter tauschen, bestimmte gemeinsame Ziele erreichen, miteinander friedlich (ohne Krieg und große soziale Risiken) und gut (in materiellem und kulturellem Wohlstand) leben wollen. Alle sind sowohl an sich selbst, an ihren Freiheiten interessiert, jedoch, um ihre Ziele leichter und effizienter erreichen zu können, auch an Kooperation mit den anderen Mitgliedern. Alle in der Gruppe wissen nicht, ob sie ihre Ziele erreichen werden oder nicht, ob sie arm oder reich sein werden. Sie wissen auch nicht, welche Begabungen oder Schwächen sie aufweisen; sie wissen nichts, was ihnen einen Hinweis darauf geben könnte, ob sie erfolgreich sein oder scheitern werden. Sie sind deshalb auch daran interessiert, dass ihnen in einem Notfall oder im Falle einer schlechteren Stellung in der Gesellschaft geholfen wird. – Als Vergleich: wir wissen nicht, wie es in Zukunft um unsere physische und psychische Gesundheit bestellt sein wird (wir können allenfalls Vermutungen darüber anstellen, indem wir die Krankengeschichte unserer Vorfahren studieren). Weil wir das betreffende Wissen über unseren künftigen Gesundheitszustand nicht haben, sind wir heute daran interessiert, dass uns im Falle von Krankheit Hilfe von der Allgemeinheit zukommt. – Unter all den genannten Voraussetzungen werden sich Rawls zufolge die Mitglieder dieser Gruppe 1) so viele miteinander verträgliche Freiheiten wie möglich einräumen, 2) bei Not, Armut oder bei eklatanter Ungleichheit Hilfe seitens der Gruppengemeinschaft zusichern wollen. – Kurzum: der an individueller Freiheit, Kooperation, Sicherheit und Wohlstand interessierte Mensch entscheidet sich, wenn er einen unparteilichen Interessestandpunkt einnimmt, für die beiden Grundsätze. Die Reihenfolge der beiden Grundsätze ist dabei Rawls zufolge nicht nur äußerlich oder chronologisch. Dem Freiheitsgrundsatz soll systematisch der Primat vor dem Grundsatz des sozialen Ausgleichs eingeräumt werden. Was die Formen oder Arten von Gerechtigkeit betrifft, geht es in beiden Rawls’schen Grundsätzen zur Hauptsache um distributive Gerechtigkeit. Im Falle des ersten Grundsatzes steht die Verteilung von zu gewährenden Freiheitsrechten zur Diskussion. (Rawls denkt hier im Einzelnen an: politische Freiheit, Rede- und Versammlungsfreiheit, Gewissens- und Gedankenfreiheit, persönliche Freiheit, Unverletzlichkeit der Person, persönliches Eigentum, Schutz vor willkürlicher Verhaftung). Hier gilt das Prinzip: jedem gleich viel. Jede Person ist zugelassen, und jede Person hat das gleiche Recht auf Freiheit und erhält das gleiche Paket von Freiheiten und damit die gleichen Startbedingungen bezüglich Freiheiten. [Es liegen hier drei Gleichheitspostulate vor]. Zudem gilt das Prinzip: so viel wie möglich unter der Bedingung der Verträglichkeit. Es gilt mit anderen Worten die bekannte Regel: Die Freiheit des einen darf die Freiheit des anderen nicht beeinträchtigten. Die Freiheiten müssen gesetzmäßig geordnet sein. Beim zweiten Grundsatz kommt zum einen ein weiterer Aspekt hinsichtlich der gleichen Startbedingungen (Chancengleichheit in Bezug auf den Zugang zu Ämtern, Posten; Rawls denkt hier neben der politischen offenbar auch an die soziale und ökonomische Sphäre) zur Sprache, zum anderen die Gestaltung von Ungleichheiten. Gemeint ist damit, dass die Ungleichheiten so zu organisieren sind, dass sie sich nicht zerstörerisch, zu Ungunsten des Gemeinwohls und dabei insbesondere nicht zu Ungunsten von Bevölkerungsschichten, die ohnehin bereits benachteiligt sind, auswirken. Hier kommt, im Zusammenhang von Vorstellungen zu einer optimalen Ausgestaltung der institutionellen Rahmenbedingungen, der Gedanke der Verteilung als präventiver „Umverteilung“ ins Spiel (hier könnte deshalb von korrektiver Gerechtigkeit die Rede sein). Gemeint ist, dass Abgaben an die Gemeinschaft in Form von Steuern, Sozialleistungen, gemeinnützigen Einrichtungen zu leisten sind. Die in diesem Falle relevante Überlegung ist, dass auch bei egalitären Startbedingungen Ungleichheiten zwar nicht zu vermeiden, jedoch in einem begrenzten Rahmen zu halten sind. Durch die verschiedenen natürlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten der Menschen, durch die unterschiedlichen Leistungen, welche die Menschen erbringen, wie schließlich auch durch Zufall (Glück, Pech) ergeben sich Ungleichheiten unter den kooperierenden Akteuren. Diese Ungleichheiten sollten so gestaltet werden, dass sie dem Gemeinwohl dienen und dabei insbesondere den am stärksten Benachteiligten die bestmöglichen Aussichten bieten. [Rawls operiert in Bezug auf die Frage, wie bei Ungleichheit zu verfahren ist, somit nicht mit dem spätestens seit A. Smith diskutierten Gedanken des „trickle-down“, d. h. der Annahme, dass Ungleichheiten automatisch dem Vorteil aller dienen, dass demnach hoher Reichtum einer Elite der beste Garant für einen Reichtum aller ist, der Reichtum der Elite gleichsam von selbst nach unten sickert. Rawls misstraut einer solchen Automatik und fordert deshalb vielmehr eine durch Solidarabgaben zu bewerkstelligende Umverteilung zugunsten der Allgemeinheit. In Bezug auf die Idee der Umverteilung bringt Rawls eine Überlegung zum Pareto-Optimum ins Spiel. Es soll auf der Basis von Freiheit und Chancengleichheit ein Zustand bestehen, bei dem die Verbesserung der einen Person nicht mit der Verschlechterung der anderen (die andere Person bleibt auf ihrem Niveau oder verbessert sich mit) einhergeht.] Um die Gleichverteilung der Freiheiten, wie sie im ersten Grundsatz festgehalten wird, zu verteidigen, bedarf es offenbar, über das individuelle und auf Kooperation zielende Freiheitsinteresse hinaus, auch eines Interesses der einzelnen Personen an Gleichheit/Gerechtigkeit. Rawls zufolge verfügen wir über ein solches Interesse aufgrund unseres Gerechtigkeitsempfindens. Wir als Person halten die andere Person spontan ebenfalls für ein freies Wesen. Wir neigen spontan dazu, der anderen Person ein gleiches Interesse wie uns selber zuzuschreiben. Wenn wir unsere Interessen kooperativ verfolgen und dazu Vereinbarungen treffen (Verträge schließen), befinden wir uns zudem tendenziell in einer demokratieorientierten Haltung. Wir und die andere Person vereinbaren willentlich etwas gemeinsam. Dasselbe gilt beim zweiten Grundsatz. Für die Regelung der Ungleichheiten zum Vorteil des Gemeinwohls und für die damit verbundene Umverteilung der Güter zugunsten der Allgemeinheit bedarf es neben dem unparteilichen Interesse des Einzelnen auch eines Gerechtigkeitsempfindens. Und ein solches ist dabei in unserem Gemeinverstand durchaus verankert. Ist es ein Verdienst, so fragen wir uns, dass jemand durch seine Natur (durch seine körperlichen und intellektuellen Anlagen), durch soziale Herkunft oder durch Glück bevorteilt ist? Eigentlich nicht. Verdienst sollte unserem Empfinden nach an eigene Leistung gebunden sein und nicht an das, was uns die Natur und die soziale Herkunft mitgibt, nicht an das, was zufällig geschieht. Wer im Lotto gewinnt, wird sich sicherlich freuen. Aber er wird kaum stolz darauf sein. Denn irgendwie ist ihm bewusst, dass er diesen Gewinn nicht verdient hat, d. h. dass er nicht auf eigene Leistung zurückgeht. Wer von seinen Eltern viel erbt, ist sicher nicht unglücklich, wird aber kaum oder nur in gedämpfter Weise stolz darauf sein, denn er weiß, dass er von einer fremden Leistung profitiert. Da Vorteile durch Natur, soziale Herkunft und Glück nicht als Verdienst bzw. nicht als Leistung empfunden werden, empfindet man es auch als gerecht, wenn der Bevorteilte etwas zugunsten der weniger Bevorteilten oder jedenfalls zugunsten der Notleidenden abgibt. [Zu diesem Punkt liest man bei Rawls: „Wer von der Natur begünstigt ist, […] der darf sich der Früchte nur so weit erfreuen, wie das auch die Lage der Benachteiligten verbessert.“ Theorie der Gerechtigkeit, 122]. Natürlich ist hier sogleich auch das richtige Maß gefragt. Wer durch Natur, soziale Herkunft und Glück bevorteilt ist, soll so viel abgeben müssen, wie er verkraften kann. Ihn zu überhöhten Abgaben zu zwingen, wäre unserem Empfinden zufolge wiederum ungerecht (und überdies für ihn demotivierend). Aber prinzipiell ist der Gedanke einer Abgabe (oder Umverteilung) in diesem Zusammenhang aus Gerechtigkeitsgründen gerechtfertigt. Genauer besehen ist der Gedanke einer Abgabe für das Allgemeinwohl dabei letztlich nicht primär deshalb gerechtfertigt, weil eine durch die Natur bedingte Ungleichheit kompensiert werden muss, sondern deshalb, weil im Falle von miteinander kooperierenden Menschen immer auch eine solidarische Haftung besteht. Wenn Menschen miteinander kooperieren und dabei im Erfolg dieser Kooperation voneinander profitieren, ist es auch angemessen, dass sie den Erfolg so aufteilen, dass Ungleichheiten nicht zu groß werden. Und noch vielmehr ist es in diesem Falle angemessen, dass sie bei Not füreinander einstehen. Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit hat zu unzähligen Folgebeiträgen und kritischen Stellungnahmen geführt. So gut wie jeder Argumentationsschritt dieser Theorie ist kritisch kommentiert worden. Sie hat zudem zu neuen Diskussionen über ökonomischen und politischen Liberalismus angeregt und die sog. Liberalismus-Kommunitarismus-Kontroverse entfacht. Von Vertretern des Kommunitarismus ist eingewandt worden, dass der ökonomische und politische Liberalismus unbedingt auf Vorstellungen des Guten und des Gemeinschaftlichen angewiesen ist, ohne solche Vorstellungen nicht funktionieren würde, dass er sich somit parasitär zu solchen Vorstellungen verhält, wenn er der Meinung ist, ohne sie auszukommen. Der von Rawls behauptete Vorrang des Gerechten vor dem Guten wird deshalb zurückgewiesen. Was weitere allgemeinere Einwände gegen Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit betrifft, ist behauptet worden, dass sie sich nur auf Menschen konzentriert, die mehr oder weniger erfolgreich in einem durch Selbstinteresse und Kooperationswilligkeit gekennzeichneten Verhältnis zueinander stehen, an Frieden, Sicherheit und Wohlstand interessiert sind, dass sie damit aber diejenigen Menschen außer acht lässt, die nicht (noch nicht / nicht mehr) in ein solches Verhältnis eingebunden sind, die mit anderen Worten außerhalb der „normalen“ Arbeitswelt stehen. Dieser Einwand hat zu der Auffassung geführt, dass man sich genauer über die zu verteilenden Grundgüter verständigen und dass man dabei insbesondere auch über die Fähigkeit oder das Vermögen der Menschen, die verteilten Güter angemessen zu nutzen, nachdenken sollte. Körperlich oder psychisch behinderte Menschen z. B. können verteilte Güter nicht gleich nutzen wie gesunde Menschen. Ältere Menschen oder sozial benachteiligte Menschen können bestimmte Güter weniger gut nutzen als jüngere, sozial starke und gut integrierte Menschen. Es wäre demnach ungerecht, solche Unterscheide in den Nutzungsvoraussetzungen nicht zu berücksichtigen. Laut geworden ist zudem der Vorwurf, dass Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit auf eine staatlich-rechtliche und ökonomische Entwicklungsstufe zugeschnitten ist, wie man sie den USA und in den westeuropäischen Staaten findet. Dem eigenen Anspruch nach müsste sie aber doch global ausformuliert werden. Und in diesem Falle müsste sie der Tatsache Rechnung tragen, dass Staaten mit ungleichen Entwicklungsstufen miteinander interagieren. Schließlich wurde gegen Rawls zu bedenken gegeben, dass es faktisch eine Vielfalt nicht nur von Vorstellungen des Guten, sondern auch des Gerechten gibt und dass deshalb auch im Rahmen des Gerechten über einen möglichen Konsens nachzudenken ist. Diese Bedenken können nicht bedeuten, dass Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit zugunsten einer anderen Theorie aufgegeben werden sollte. Aber es ist klar, dass auf ihrer Grundlage über verteilende und ausgleichende Gerechtigkeit in einem größeren Umfang nachgedacht werden muss, als Rawls selbst dies getan hat. Einige Anhänger von Rawls (z. B. A. Sen, T. Pogge, M. Nussbaum) haben in der Folge dazu denn auch namhafte Vorschläge unterbreitet. Im Weiteren wird seit einiger Zeit darüber diskutiert, ob und, falls ja, wie Rawls‘ Ansatz für eine Gerechtigkeit im Verhältnis der verschiedenen Generationen von Menschen fruchtbar gemacht werden kann. Rawls hat in Politischer Liberalismus, Gerechtigkeit als Fairness und weiteren Texten Präzisierungen und Veränderungen vorgenommen. Er bezieht sich damit zum Teil auf offene Fragen zu seiner grundlegenden Schrift Eine Theorie der Gerechtigkeit, zum Teil reagiert er damit auf Einwände der Interpreten und Kritiker. Es betrifft dies: - Die Neuformulierung der beiden Grundsätze und Modifizierung der Grundsatzkonzeption. Rawls hat die beiden Grundsätze der Gerechtigkeit in den Jahrzehnten nach Eine Theorie der Gerechtigkeit wie folgt neu ausformuliert: „(a) Jede Person hat den gleichen Anspruch auf ein völlig adäquates System gleicher Grundrechte und Freiheiten, das mit demselben System für alle vereinbar ist, und innerhalb dieses Systems wird der faire Wert der gleichen politischen (und nur der politischen) Freiheiten garantiert. (b) Soziale und ökonomische Ungleichheiten müssen zwei Bedingungen erfüllen: erstens müssen sie mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit offenstehen, und zweitens müssen sie sich zum größtmöglichen Vorteil für die am wenigsten begünstigten Gesellschaftsmitglieder auswirken.“ (Politischer Liberalismus, 69f.) „a) Jede Peron hat den gleichen unabdingbaren Anspruch auf ein völlig adäquates System gleicher Grundfreiheiten, das mit demselben System von Freiheiten für alle vereinbar ist. b) Soziale und ökonomische Ungleichheiten müssen zwei Bedingungen erfüllen: erstens müssen sie mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die unter Bedingungen fairer Chancengleichheit allen offenstehen; und zweitens müssen sie den am wenigsten begünstigten Angehörigen der Gesellschaft den größten Vorteil bringen (Differenzprinzip).“ (Gerechtigkeit als Fairness, 78) Unverändert ist Rawls der Ansicht, dass es den Primat des ersten Grundsatzes vor dem zweiten zu verteidigen gilt. Dass beim ersten Grundsatz in der Fassung aus der Schrift Politischer Liberalismus neu von politischen Freiheiten die Rede ist, ist wohl auf den Versuch zurückzuführen, die Abgrenzung zum sozialen und ökonomischen Bereich, von dem im zweiten Grundsatz der Sache nach die Rede ist, besser zu markieren. Unverkennbar ist die Umstellung im zweiten Grundsatz. Die Chancengleichheit (Ämter, Positionen) wird jetzt neu dem Differenzprinzip bewusst vorangestellt. Zu beachten ist weiter, dass Rawls seit der Schrift Politischer Liberalismus davon ausgeht, im Falle der Anwendung der Grundsätze müsse eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein, nämlich die Sicherung der Existenz, die Gewährleistung eines minimalen Lebensstandards der Person. Denn lediglich unter dieser Voraussetzung kann die Person die Grundgüter, die ihr zugebilligt werden, überhaupt sinnvoll für ihre Zwecke verwenden. Es „wird allen Bürgern ein angemessener Anteil an allgemein dienlichen Mitteln zugesichert, so dass sie ihre Freiheiten und Chancen wirksam nutzen können.“ (Politischer Liberalismus, 70) Damit kommt Rawls auf seine Weise dem Einwand entgegen, neben einer möglichst egalitären Verteilung von Grundgütern sei ebenfalls darauf zu achten, dass sich nur dann Gerechtigkeit einstelle, wenn auch die Fähigkeiten, das Vermögen der Person, die Güter angemessen zu nutzen, berücksichtigt würden. - Die Präzisierung des Theorems der Urposition und des Schleiers des Nichtwissens. Das Konzept der Urposition bzw. des Schleiers des Nichtwissens wirft das Problem auf, wie man von der Urposition genauer besehen zu den beiden Gerechtigkeitsgrundsätzen gelangt. Eng damit zusammen hängt die Frage, wie der Schleier des Nichtwissens genauer zu begreifen ist, d. h. was genau in der Urposition „ausgeblendet“ werden muss. Der Weg von der Urposition zum Grundsatz ist vor allem beim ersten Grundsatz nicht in jeder Hinsicht einleuchtend. Weshalb entscheiden Personen sich in einer Urposition für Freiheit und nicht vielmehr für Wohlstand? Es müssen offenbar Personen mit einem ausgeprägten neuzeitlichen Freiheitsbewusstsein vorausgesetzt werden. Um den Gedanken der Gleichheit der Freiheiten plausibel machen zu können, ist Rawls zudem dazu übergegangen, seinen Überlegungen zum Gerechtigkeitssinn, soweit sie das Interesse an Gleichheit, Gleichberechtigung und Demokratie betreffen, ein stärkeres Gewicht einzuräumen. Im Hinblick auf das Design der Urposition ist er davon ausgegangen, dass beim ersten Grundsatz nicht so sehr die eigeninteressierte als vielmehr die in der rechtsstaatlich-demokratischen Kultur verankerte Person vorauszusetzen ist. Auch in Bezug den zweiten Grundsatz kann man zweifeln, ob aus der Urposition und dem Schleier des Nichtwissens tatsächlich das Resultat ‚größtmöglicher Vorteil für die am wenigsten begünstigten Gesellschaftsmitglieder‘ erfolgt. Die eigeninteressierte Person ist hinter dem Schleier des Nichtwissens sicher daran interessiert, im Falle von Existenzbedrohung, Not Hilfe zu erhalten. Aber erstrebt sie, wenn ihr Existenzminimum einmal gesichert ist oder sie über dem Existenzminimum lebt, auch tatsächlich aus Eigeninteresse die gerechtfertigte Ungleichheit bzw. Umverteilung nach dem Leitsatz ‚größtmöglicher Vorteil für die am wenigsten begünstigten Gesellschaftsmitglieder‘. Aber vermutlich geht es, dies sei zugunsten von Rawls gesagt, bei diesem Zweifel um einen psychologischen Aspekt. Wenn wir mit Gütern gesättigt sind, nimmt unser Interesse an Gerechtigkeit ab [Zur Frage, ob die Personen beim angenommenen Schleier des Nichtwissen den zweiten Grundsatz in der Tat auch wählen würde, siehe auch B. Ladwig: Gerechtigkeitstheorien. 138ff.] Die Frage, was im Falle des Schleiers der Nichtwissens genau ignoriert oder abgeschattet werden muss, stellt sich vor allem beim zweiten Grundsatz, genauer: beim Differenzprinzip dieses Grundsatzes. Was muss ausgeschlossen werden, damit die gewünschte Unparteilichkeit erreicht wird? Rawls befürwortet einen sog. starken Schleier des Nichtwissens. Ausgeschlossen werden muss seines Erachtens das Wissen einer Person über ihre physischen, psychischen, intellektuellen Stärken oder Schwächen, ihre Begabungen. Ausgeschlossen werden muss das Wissen der Person über ihre Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse, zu einer Nation, Rasse, zu einem Geschlecht. Sie soll, so Rawls weiter, auch kein Wissen über die besondere Gesellschaft (Sklavengesellschaft, Feudalgesellschaft, bürgerliche Gesellschaft, sozialistische Gesellschaft usw.), in der sie lebt, haben [mit der Annahme von freien, gleichen Personen scheiden die vorbürgerlichen Gesellschaften aber natürlich sogleich aus], kein Wissen über den Stand der Technik, der Ressourcen dieser Gesellschaft. Mit dem Nichtwissen in Bezug auf Technik und Ressourcen soll der Generationenneutralität Rechnung getragen werden. Man kann sich in diesem Zusammenhang auch fragen, über welches Minimalwissen denn die Personen eigentlich verfügen müssen. Dazu gehören offenbar: Das Wissen der Personen über ihr grundlegendes Interesse an eigenen Vorteilen, an Kooperation, an Frieden und Wohlstand. Das Wissen darüber, was es an Grundgütern zu verteilen gibt. Das Wissen darüber, in welcher sozialen, rechtlichen Ordnung die Grundgüter am besten zugeteilt werden. Das Wissen darüber, welche Ungleichheiten, Konflikte es geben kann, wie man die Ungleichheiten, Konflikte bewältigen kann. Das Moralwissen und der dazugehörige Gerechtigkeitssinn: die Personen wissen, dass sie, wenn sie nun eine Vereinbarung treffen, freie und gleiche (gleichberechtigte Wesen) sind. Manche Kritiker Rawls‘ haben angemerkt, dass die angestrebte Unparteilichkeit von Entscheidungen nicht dadurch erreicht wird, dass man Personen in eine Urposition versetzt und sie hinter einen Schleier des Nichtwissens setzt, sondern nur dadurch, dass man möglichst viele Interessen, Standpunkte, Meinungen von Personen einbezieht und dabei den Versuch unternimmt, einen Konsens zu finden. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man Unparteilichkeit dadurch erreicht, dass Einseitigkeiten, Unvollständigkeiten in der Darlegung von Meinungen vermieden werden. Aus der Sicht von Rawls ist meines Erachtens darauf zu antworten: dass man auch bei diesem Vorschlag ein Verfahren der Abstraktion, wie es die Konzeption der Urposition und des Schleiers des Nichtwissens vorsieht, in Anwendung bringen muss. Der Vorteil ist vielleicht, dass die Abstraktionsbasis breiter ist. -Der Verzicht auf umfassenden Wahrheitsanspruch. Es entsteht die Frage: Welche Gültigkeitsart und welcher Gewissheitsgrad soll den aufgestellten Grundsätzen zukommen? Sind sie gültig im Sinne des starken Kognitivismus (Kant, Diskursethik)? Nach Rawls sind die Grundsätze zwar rational und vernünftig in einem nicht-utilitaristischen und insofern autonomen Sinne. Andererseits verzichtet Rawls auf einen umfassenden Wahrheits- bzw. Gültigkeitsanspruch. Sie sind gültig im Rahmen einer rechtsstaatlich-demokratischen Kultur. Zudem sind sie als revisionsfähig anzusehen. Es besteht die Möglichkeit des Überlegungsgleichgewichts („reflective equilibrium“) zwischen Vernunft einerseits und Tatsachen des gemeinen Verstandes, Tatsachen der Geschichte andererseits. -Die Aufstellung einer Liste von Grundgütern („primary goods“). Von welchen Freiheiten/Gütern soll im Einzelnen ausgegangen werden? Rawls hat hier – gestützt auf seine Theorie der Gerechtigkeit – fünf Güterkategorien zusammengestellt (siehe J. Rawls, Die Idee des politischen Liberalismus, Aufsätze 1978-1989. Hg. von W. Hinsch. Frankfurt a.M. 1992, 95, 178). 1. Grundfreiheiten (Glaubens-, Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit usw.) 2. Freizügigkeit, freie Berufswahl 3. Möglichkeit von Ämtern und Positionen 4. Einkommen und Besitz 5. Selbstachtung, Herausbildung des Moralvermögens Man ersieht, dass es um Güter geht, die beide Grundsätze betreffen (individuelle, politische, ökonomische Freiheiten). Es versteht sich dabei, dass bei 1-3 von der Egalitätsforderung auszugehen ist. Bei 4. und 5. müssen Minimalbedingungen erfüllt sein. 4. und 5. können zudem als Güter betrachtet werden, die vorhanden sein müssen, damit Personen Freiheit und Chancen nutzen können und diese außerdem unter moralischen Maßstäben nutzen. - Die Verteidigung des Vorrangs des Gerechten vor dem Guten. Lässt sich das Menschenbild bzw. Personenprofil, d. h. die Annahme freier, gleicher, eigenund kooperationsinteressierter, friedliebender usw. Menschen, so geltend machen, dass der beanspruchte Vorrang des Gerechten (nach Rawls auch: Politischen) vor dem Guten (nach Rawls auch: Metaphysischen) nicht beeinträchtig wird? Wird mit diesem Menschenbild nicht gerade primär eine Vorstellung des Guten, und überdies eine bestimmte Vorstellung des Guten, geltend gemacht? Nach Rawls handelt es sich um ein Menschenbild, auf das sich verschiedene Vorstellungen des Guten relativ leicht im Sinne einer Hintergrundannahme einigen können, so dass der Primat des Gerechten eigentlich nicht in Frage gestellt wird. Auch wenn man das Gerechte im Sinne eines Gutes verstehen will, ist Rawls zufolge der „neuzeitlichen“ Tatsache eines Pluralismus des Guten unbedingt Rechnung zu tragen. Der gleichzeitige Versuch, Konsens auch in der Frage des Guten zu erreichen, soll dabei nicht ausgeschlossen werden. Rawls denkt bei diesem Punkt nicht zuletzt an die kommunitaristischen Einwände. Es soll letztlich darum gehen, das Gerechte durch das Gute zu stabilisieren, dem Gerechten mithilfe des Guten zur Durchsetzung verhelfen. In diesem Punkt hat Rawls sich zum Teil rechtsphilosophischen Ansichten Hegels angenähert. [Man beachte auch, dass der Student Rawls sich stark für Fragen der religiösen Gemeinschaft interessiert hat, einer liberalistischen Haltung ziemlich fernstand]. - Die auf der Basis der Gerechtigkeitskonzeption vorgenommene Beurteilung von Gesellschaftsformen. Es ist erwähnt worden, dass Rawls zwar im Falle der Urposition und des Schleiers des Nichtwissens davon ausgeht, dass die Beteiligten nicht Kenntnis davon haben dürfen, in welcher Gesellschaftsform sie leben werden, dass jedoch aufgrund des ersten Gerechtigkeitsgrundsatzes (freie, gleiche Personen) ausgeschlossen wird, dass vorbürgerliche Gesellschaftsformen (Sklavengesellschaft, Feudalismus) mit dem gewählten Gerechtigkeitskonzept kompatibel sein können. Rawls hat sich in Gerechtigkeit als Fairness auch überlegt, welche bürgerlichen und postbürgerlichen Gesellschaftsformen seinem Gerechtigkeitskonzept angemessen sind. Dabei stehen zur Diskussion: a) Der Laissez-faire-Kapitalismus b) Der wohlfahrtsstaatliche Kapitalismus c) Der planwirtschaftliche Staatssozialismus d) Die Demokratie mit Eigentumsbesitz e) Der liberale, demokratische Sozialismus Rawls hält nur die letzten beiden Formen für akzeptabel. Nur diese sind seines Erachtens mit dem eigenen Gerechtigkeitskonzept kompatibel. a) Gewährt allen Eigentum (auch an Produktionsmitteln), missachtet aber den zweiten Grundsatz, b) Respektiert den zweiten Grundsatz, schließt aber Eigentum (auch an Produktionsmitteln) auf einer umfassenden Basis aus c) Respektiert liberale Grundrechte nicht -Die Anwendung des Gerechtigkeitskonzepts auf eine internationale Ordnung. In Law of peoples dt. Das Recht der Völker hat Rawls ausgehend von seinem gerechtigkeitstheoretischen Rüstzeug acht Grundsätze des Rechts der Völker zur Diskussion gestellt: 1. Völker sind frei und unabhängig und ihre Freiheit und Unabhängigkeit müssen von anderen Völkern geachtet werden. 2. Völker müssen Verträge und eingegangene Verpflichtungen erfüllen. 3. Völker sind gleich und müssen an Übereinkünften, die sie binden sollen, beteiligt sein. 4. Völkern obliegt eine Pflicht der Nichteinmischung. 5. Völker haben das Recht auf Selbstverteidigung, aber kein Recht, Kriege aus anderen Gründen als denen der Selbstverteidigung zu führen. 6. Völker müssen die Menschenrechte achten. 7. Völker müssen, wenn sie Kriege führen, bestimmte Einschränkungen beachten. 8. Völker sind verpflichtet, anderen Völkern zu helfen, wenn diese unter ungünstigen Bedingungen leben, welche verhindern, dass sie eine gerechte oder achtbare politische und soziale Ordnung haben. Dabei soll auch das Verhältnis zwischen liberalen und nicht-liberalen Völkern geregelt werden. Nicht-liberale Völker sind grundsätzlich zu tolerieren und in die Gemeinschaft der liberalen zu integrieren. Sie sind zur Einhaltung der acht Grundsätze aufzufordern. Rawls unterscheidet dabei bei den nicht-liberalen Völkern zwischen sog. Schurkenstaaten und Gesellschaften, die aufgrund mangelhafter Ressourcen nicht liberal oder nicht wohlgeordnet sein können. Bei Schurkenstaaten soll die Möglichkeit einer Intervention nicht ausgeschlossen werden. -Die Anwendung des Gerechtigkeitskonzepts im Hinblick auf Generationengerechtigkeit. Diese Anwendung, zu der sich bei Rawls selber eher Andeutungen finden, ist in neuerer Zeit intensiver von Interpreten Rawls diskutiert worden. Man beachte dazu etwa J. C. Tremmel: Generationengerechtigkeit, in: C. Sedmak (Hg.): Gerechtigkeit. Vom Wert der Verhältnismäßigkeit. Darmstadt 2014, 47-76. Tremmel schlägt folgende Grundsätze der Generationengerechtigkeit vor: „1. Maximiere den Durchschnitt der individuellen Wohlstandsniveaus aller Mitglieder aus allen Generationen. Dabei besteht für jede Generation als wichtigste Pflicht, Kriege und ökologische, soziale und technische Zusammenbrüche, die zu großen Einbußen menschlichen Wohles führen können, zu vermeiden. 2. Keine Generation ist dazu verpflichtet, größere Sparleistungen zu erbringen als ihr Vorgängergeneration.“ Der Maximierungsimperativ im ersten Grundsatz versteht sich aus der Annahme, dass in der Geschichte technologischer Fortschritt besteht und dadurch das Wohlstandsniveau kontinuierlich gehoben wird. Der zweite Grundsatz soll verhindern, dass sich bestimmte Generationen für andere aufopfern müssen. Was Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit nicht leistet – und von ihrer Grundkonzeption her auch nicht zu leisten vorhat – ist der Versuch, sich über Tauschgerechtigkeit, und zwar über ökonomische Tauschgerechtigkeit, zu verständigen. Wenn Menschen auf der Basis gleicher Freiheitsrechte und gleicher Ausgangsbedingungen wie Chancengleichheit selbstinteressiert und zugleich kooperativ miteinander interagieren, entstehen Ungleichheiten nicht nur aufgrund ungleicher natürlicher und sozialer Fähigkeiten, aufgrund von Glück oder Pech sowie aufgrund unterschiedlicher Leistungen. Ungleichheiten entstehen auch dadurch, dass es an ökonomischer Tauschgerechtigkeit fehlt, dass mit anderen Worten auf ökonomischer Ebene eine Ungleichheit von Geben und Nehmen besteht. Jemand erhält als Gegenleistung für sein Produkt nicht den diesem zukommenden Wert. Jemand erhält für seine Arbeitsleitung zu wenig Lohn. Jemand erhält für seine Arbeitsleitung zu viel Lohn. Jemand, der arbeitsfähig ist, erhält etwas, obwohl er nichts leistet. Personen werden für (quantitativ und qualitativ) gleiche Arbeit unterschiedlich honoriert. Der Schaffung gerechter institutioneller Bedingungen wäre es – über Rawls‘ Konzept hinaus – dienlich, solche auf der Ebene des Tausches entstehende Ungleichheiten zu verhindern. Wird dies nicht getan, beschränkt sich die Bekämpfung von zu großen Ungleichheiten in der Gesellschaft auf das Instrument des sozialen Ausgleichs. Doch wie lassen sich die Ungleichheiten auf der Ebene des Tausches überhaupt feststellen? Dazu muss der Wert oder Preis für ein Produkt bzw. für eine Arbeitsleistung doch offenbar gemessen werden können. Wie soll das vor sich gehen? Was bestimmt den Wert? Spontan wird man wohl sagen wollen: Angebot und Nachfrage bestimmen den Wert oder Preis eines Gutes. Doch wird man sich mit dieser Antwort nicht zufrieden geben können. Angebot und Nachfrage sind kein völlig autonomer Mechanismus, sie stehen im Kontext einer Wert-Voraussetzung, in Relation zu einer Wertbasis, einem Wertmaßstab oder einer Wertskala. Doch was ist diese Wertbasis? Diese Frage hat sich bereits Aristoteles gestellt, und seit dem 17. und 18. Jh. hat sich besonderes die klassische politische Ökonomie (Quesnay, Stewart, A. Smith, Say, Marx, Ricardo, Mill u.a.) intensiv damit befasst. Die Antworten darauf fallen unterschiedlich aus. Grundsätzlich gibt es zwei Ansatzpunkte. Es gibt zum einen Theoretiker der Ökonomie, welche die Sache ausgehend vom Nutzen, die ein Gut für uns hat, und damit von der Seite der Konsumtion her zu denken versuchen. Ihrer Ansicht nach hängt der Wert eines Gutes von seinem allgemeinen Nutzen oder allgemeinen Gebrauchswert ab. Der Schwankungen unterworfene Marktpreis eines Gutes wird sich, so nimmt man dabei an, auf seinen allgemeinen Nutzen ausrichten. Das ist im Großen und Ganzen wohl nicht falsch. Wenn man die Sache genauer ansieht, kommt man allerdings in Teufels Küche. Der Nutzen oder Gebrauchswert eines Gutes ist ein qualitativer Wert, ein Gut auf dem Markt dagegen hat einen quantitativen Wert, einen Tauschwert oder einen Preis. Eine Umrechnung ist deshalb nur über abstrahierende und willkürliche Vermittlungsschritte möglich. Ein hoher allgemeiner Nutzen oder Gebrauchswert eines Gutes müsste zur Folge haben, dass dieser auf dem Markt zu einem entsprechend hohen Tauschwert oder Preis gehandelt wird. Die Erfahrung zeigt, dass dies nur zum Teil der Fall ist. Wasser und Luft sind allgemein in hohem Maße nützlich. Solange nicht Knappheit besteht, ist der Preis aber vergleichsweise niedrig. Diamanten, die wenig allgemeinen Gebrauchswert haben (eher Prestigewert), sind dagegen auf dem Markt sehr teuer. Hinzu kommt, dass allgemeiner Nutzen von Gütern etwas Wandelbares, Subjektives, Schichtspezifisches ist. Man darf wohl behaupten, dass Güter, die ein Grundbedürfnis des Menschen abdecken (Nahrung, Wohnung, physische und psychische Gesundheit, Mobilität, Ausbildung), immer einen hohen allgemeinen Nutzen oder Gebrauchswert aufweisen. In Gesellschaften, in denen die Grundbedürfnisse großenteils gedeckt sich, erweitert sich aber die Palette von Gütern, die von hohem allgemeinem Nutzen sind. Unter dieser Bedingung gehören auch Güter dazu, die unser Bedürfnis nach Macht, Prestige und Status befriedigen. Die Annahme, dass ausschließlich oder hauptsächlich Güter, welche Grundbedürfnisse befriedigen, einen hohen Nutzen haben, gilt (aus heutiger Sicht) wohl nur in akuten Krisenzeiten. [Nicht zu bestreiten ist dabei der fundamentale Wertcharakter, den einige dieser Güter im Laufe der Geschichte hatten. Unentbehrliche Nahrungsmittel wie Korn und Fleisch (Vieh) dienten als Wertmaßstab und fungierten vor der Einführung des Metall- und Papiergeldes als Tausch- oder Zahlungsmittel. An diesen Zusammenhang erinnern uns Münzen oder Münzeinheiten wie „pesos“ oder auch das Wort „pekuniär“. Sie stammen offenbar vom lateinischen „pecus“ (= Vieh) oder „pecunia“ (= Vermögen an Vieh, Vermögen, Geldsumme)]. Was den vom allgemeinen Nutzen oder Gebrauchswert ausgehenden Ansatz der Wertbestimmung als solchen betrifft, besteht keine Zweifel, dass er in normativer Hinsicht relevant ist und insofern auch die Frage der Gerechtigkeit tangiert. Der Wert (Tauschwert, Preis) eines Gutes sollte, so die implizite Forderung, an dessen allgemeinen Gebrauchswert gebunden sein. Was wir für ein Gut bezahlen, sollte mit anderen Worten in einem angemessenen Verhältnis zum allgemeinen Gebrauchswert dieses Gutes stehen. Der Preis muss eine Grenze haben, das Gut darf eine Qualität nicht unterschreiten. Anderenfalls ist der Tausch ungerecht. Es gibt zum anderen die sog. Arbeitswerttheoretiker. Sie setzen bei der Produktion an. Sie gehen davon aus, dass die Produktionskosten, genauer: die durchschnittliche Arbeitszeit zu seiner Herstellung, die Wertbasis eines Gutes darstellen. Der Vorteil dieses Ansatzes gegenüber demjenigen, der beim Nutzen eines Produkts ansetzet, besteht darin, dass man eine quantitative Ausgangsbasis hat. Arbeitszeit lässt sich messen. Auf der Grundlage von Zeit lässt sich Leitung errechnen. Natürlich muss man dabei Qualitätsfaktoren einbauen. Es gibt bessere oder schlechtere, qualifizierte und weniger qualifizierte Arbeit, die während ein und derselben Zeitspanne verrichtet wird. Den Arbeiten gehen unterschiedliche Ausbildungswege voraus, die Arbeiten gehen mit unterschiedlichen Graden der Verantwortung einher, sind von unterschiedlicher Bedeutung hinsichtlich der Förderung des Gemeinwohls. Solchen Unterschieden muss Rechnung getragen werden. Bei qualifizierterer, verantwortungsvollerer Arbeit ist mehr Zeit für die Ausbildung und Weiterqualifikation aufgewendet worden als bei Arbeit, die weniger qualifiziert und weniger verantwortungsvoll ist. Dieses Plus an Zeit ist einzuberechnen. Die bessere Qualität einer Arbeit ist als solche zeitlich nicht erfassbar, lässt sich aber in der Endabrechnung in Form einer Zeitgutschrift zum Ausdruck bringen. Es ist offensichtlich, dass auch mit diesem Ansatz eine gerechtigkeitsrelevante Norm zur Diskussion steht. Die unter Gesichtspunkten der Quantität und Qualität zu berechnende Arbeitszeit, die in einem Gut steckt, soll den Wert dieses Gutes bestimmen und damit auch den Gegenwert, den der Arbeitende für dieses Gut erhält, den Lohn. Ist der Lohn unter oder über diesem Wert, kann nicht von Tauschgerechtigkeit gesprochen werden. [Bei der seit der Banken- und Finanzkrise von 2007 laufenden Diskussion über erhöhte Managerlöhne, Boni usw. wäre es angebracht, unter anderem Überlegungen über Tauschgerechtigkeit ins Spiel zu bringen. Dabei lässt sich ausgehend von der Produktionsseite wie folgt argumentieren: Dass Menschen quantitativ und qualitativ unterschiedliche Arbeitsleistungen erbringen, versteht sich. Und es versteht sich damit ebenso, dass unterschiedliche Leistungen unterschiedlich honoriert werden sollen. Wer mehr leistet, soll mehr bekommen. Dies ist ganz im Sinne der Tauschgerechtigkeit. Wenn nun aber in einer Gesellschaft jemand für einen Acht-Stundentag das 50fache dessen erhält, was man durchschnittlich für diese Arbeitsleistung erhält (das Verhältnis 1:50 gehört ungefähr in den Mittelbereich auf der Skala der Lohnschere in Schweizer Unternehmen; siehe „Der Bund“, 25. Juni 2013, S. 7), wird man fragen, ob dies noch etwas mit Tauschgerechtigkeit zu tun haben kann. Machen die unterschiedliche Qualität der Arbeit, die unterschiedliche Ausbildung, die unterschiedlichen Grade der Verantwortung so viel aus, dass 8 Stunden Anstrengung von Körper und Hirn dasselbe sein sollen wie 400 Stunden Anstrengung von Körper und Hirn? Leistet der eine wirklich das 50fache des anderen? Der gesunde Menschenverstand sagt uns: Nein, das ist unmöglich. Nur ein Übermensch könnte das 50fache von dem leisten, was ich leiste. Natürlich bringen wir im Rahmen solcher Überlegungen auch andere Kriterien von „Verdienst“ ins Spiel. So sind wir wohl nicht abgeneigt, einem Menschen, der eine Leistung erbracht hat, die von extrem hohem Nutzen für das Allgemeinwohl ist (z. B. dem Erfinder des Penizilins; der Entdeckerin des Radiums; dem Konstrukteur des Computers; dem Unternehmer, der vorbildlich alle Stakeholderbedürfnisse berücksichtigt), das 50fache von dem, was wir bekommen, zuzugestehen. Ein solches Zugeständnis widerstrebt uns aber ganz bestimmt bei einer Person, die in die eigene Tasche arbeitet; und noch viel mehr natürlich bei einer Person, die mit ihrer Arbeit oder mit ihrem Reichtum bewirkt, dass andere Personen zu Schaden kommen. Alles in allem versteht sich: Ausgehend von Vorstellungen der Tauschgerechtigkeit haben Argumente für überhöhte Löhne prinzipiell einen schweren Stand.]