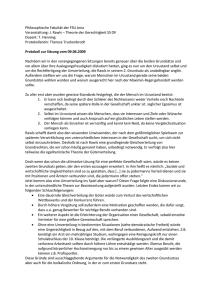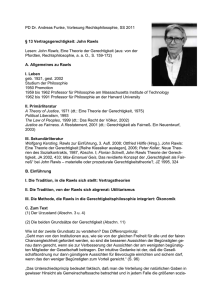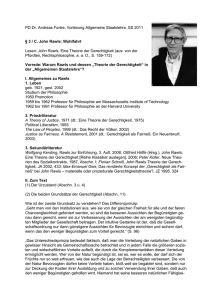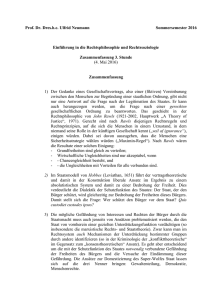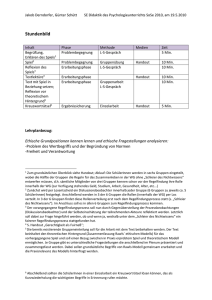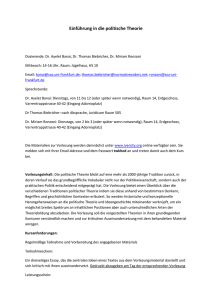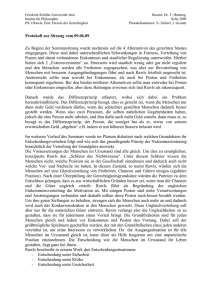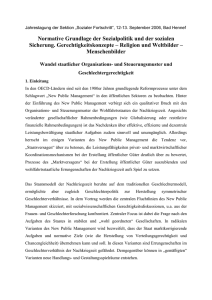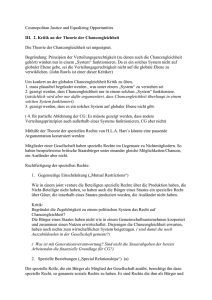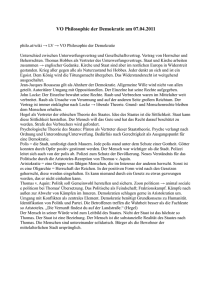Liberalismus und Kommunitarismus in der neueren
Werbung

Liberalismus und Kommunitarismus in der neueren Debatte Die seit dem Erscheinen des Buches „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ von John Rawls 1971 geführte Diskussion um das rechte Staatsverständnis (vorwiegend in den USA) nimmt zentrale Grundprinzipien der Staatstheorie überhaupt wieder auf und bezieht sie auf die moderne Gesellschaft. In der Debatte finden sich die Vertreter wieder, die ein an Aristoteles und Rousseau orientiertes organisches Staatsverständnis vertreten, und diejenigen, die an Hobbes, Locke und Kant orientiert ein vertragstheoretisches Modell zugrundelegen, das Staaten als Aggregate von Einzelindividuen interpretieren. Kommunitaristen gehen davon aus, dass es für die Bestimmung einer gerechten Gesellschaftsordnung immer einen Horizont gemeinsam geteilter Werte geben muss, während die Liberalen davon ausgehen, dass nur ein formaler Begriff von Gleichheit als Ausgangspunkt für die Entscheidung über gesellschaftliche Gerechtigkeitsfragen dienen kann. Kommunitarismus Vorrang des Guten (materiale Werte) vor dem Rechten Teleologisch bestimmt Patriotismus Gemeinwohl Sozial integriertes Selbst als Ausgangspunkt Aristoteles, Rousseau Sandel, Walzer, McIntyre Liberalismus Vorrang des Rechten (formale Gleichheit) vor dem Guten Formal bestimmt Indienstnahme des Staates für eigene Ziele Individuelle Ziele Ungebundenes Selbst als Ausgangspunkt Locke, Kant Rawls John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit Ähnlich wie Hobbes, Locke und Kant nimmt Rawls einen Urzustand oder Naturzustand an, in dem Menschen gesellschaftsstiftende Verträge abschließen. Während bei Hobbes die Menschen im Naturzustand hauptsächlich Sicherheitsinteressen haben und die Menschen bei Locke hauptsächlich an der Sicherung ihres Besitzes interessiert sind, orientiert sich der Gesellschaftsvertrag bei Rawls durch das Interesse, Gerechtigkeit herzustellen. Bevor die Menschen also beschließen, wie ihre Regierung aussehen soll und wie diese Regierung gebildet werden soll, beschließen die Menschen im Urzustand zunächst Regeln, die möglichst viel Gerechtigkeit im Staats realisieren sollen. Zu diesem Zweck führt Rawls zusätzlich zu den klassischen Elementen des Gesellschaftsvertrages den „Schleier des Nichtwissens“ ein. Das bedeutet, dass die Menschen in dem (nur theoretisch konstruierten) Urzustand nicht wissen, in welchem Status der Gesellschaft sie sein werden, ob sie zu den Reichen oder Armen, den Bevorzugten oder Vernachlässigten usw. gehören werden. Auch darüber, welche Fähigkeiten und Begabungen sie haben, haben die Menschen im fiktiven Urzustand keine Kenntnis. Rawls setzt weiter ähnlich wie Hobbes voraus, dass die Menschen im Urzustand eine strategische Vernunft haben, die sie in die Lage versetzt, das für ihre eigenen Interessen Beste zu wählen. Anders als bei Hobbes haben die Menschen aber im Urzustand keine gegeneinander gerichteten Interessen, sie wollen also nicht unbedingt andere übervorteilen, vernichten, beherrschen o.ä.. Rawls überlegt nun, welche Gerechtigkeitsprinzipien solche Menschen ihrem Staatsverständnis zugrundlegen würden. Das Maximin-Prinzip Nach Rawls würden die Menschen im Urzustand die Gerechtigkeitsprinzipien so wählen, dass das schlechtest mögliche Ergebnis der gewählten Alternative besser ist als das aller anderen Alternative, die Menschen wählen also die Variante, die unter worst case Bedingungen das beste Resultat erwarten lässt. Die Menschen überlegen sich also, welche Grundregeln sie bevorzugen würden, wenn sie zu der sozial am schlechtesten gestellten Gruppe im zukünftigen Staat gehören würden. Das Gleichheitsprinzips Nach Rawls würden die Menschen im Urzustand zuerst ein Prinzip der Gleichheit von Grundrechten und Grundpflichten beschließen. Die erste Grundregel lautet also: „Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist.“ Es geht also darum, möglichst viele Freiheiten für den Einzelnen zu garantieren, aber so, dass alle anderen die gleichen Grundfreiheiten haben. Die wichtigsten Grundfreiheiten sind die politische Freiheit (zu wählen, öffentliche Ämter zu bekleiden), Rede- und Versammlungsfreiheit, Gewissensund Gedankenfreiheit, persönliche Freiheit, Schutz von Unterdrückung und Misshandlung, willkürlicher Verhaftung, Recht auf persönliches Eigentum. Die Menschen würden also nach Rawls in erster Linie einen Rechtsstaat auf der Grundlage formaler Freiheitsrechte beschließen. Das Differenzprinzip Als zweiten Grundsatz würden die Menschen im Urzustand nach Rawls ein Prinzip wählen, dass zwar soziale Ungleichheit zulässt, aber nur in dem Maß, bei dem die jeweils am schlechtesten Gestellten noch den größten Nutzen haben. Sie würden also eine Gesellschaft bevorzugen, in der es Unternehmer mit hohem Einkommen und Arbeiten mit geringerem Einkommen gibt, das insgesamt aber so produktiv ist, dass der Arbeiter immer noch besser gestellt ist als in einem System mit Gleichverteilung (Kommunismus). Nur unter diesen Bedingungen können, so Rawls, auch die Begabten und Begünstigten damit rechnen, dass sie Unterstützung durch die weniger Privilegierten bekommen, weil für diese immer noch das best mögliche Resultat herauskommt. Wenn dagegen die Begabten und Begünstigten überhaupt nicht besser gestellt wären, hätten diese kein Interesse, ihre Fähigkeiten der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Ähnlich hätten die Unternehmer sonst kein Interesse, ihr Kapital zu investieren, so dass sich kein ökonomisches Wachstum ergäbe und so weniger zu verteilen wäre, was den Arbeiter absolut schlechter stellen würde als in einem System, wo zwar relative Ungleichheit herrscht, aber absolut für den nicht Bevorzugten noch das bester Ergebnis herauskommt. Kritik Gegen das Differenzprinzip von Rawls ist eingewandt worden, dass nach Prinzipien der Gerechtigkeit nicht alle sozialen Leistungen und Sicherungssyteme auf einen strategisch kalkulierten Vertrag zurückgeführt werden können. Nach Kriterien der Menschenrechte muss jedem Menschen Zugang zu Nahrung, Obdach und medizinischer Versorgung zugestanden werden, unabhängig davon, ob Menschen in einem Naturzustand aus Furcht, selbst betroffen sein zu können, eine solche Versorgung beschlossen hätten. In der gesellschaftlichen Realität weiß auch bereits jeder, ob er zu den Begünstigten gehört oder nicht, dennoch müssen aber bestimmte Grundrechte auch Unterprivilegierten zugestanden werden. Es lässt sich also fragen, welchen Nutzen der „Schleier des Nichtwissens“ in der konkreten Begründung von sozialen Rechten in der gesellschaftlichen Praxis hat. Zudem kann schon gegen das Maximin-Prinzip eingewandt werden, dass nur pessimistische oder risikoaversive Menschen ein worst-case-Szenario zugrundelegen würden. Risikofreudige Menschen würde sich vielleicht für Prinzipien entscheiden, die den Begabten und Privilegierten mehr Rechte zugestehen in der Hoffnung, selbst dazuzugehören. Auch dann müssten aber soziale Mindestsicherungen begründet werden, die sich aus der Vertragstheorie nicht begründen lassen. Schließlich ist auch die Annahme, dass Menschen um höherer absoluter Vorteile willen soziale Ungleichheit akzeptieren würden, fraglich, weil dabei die von Rawls im Urzustand vorausgesetzte strategische Rationalität eine entscheidende Rolle spielt. Möglicherweise würde reale Menschen Ungleichheit als solche gefühlsmäßig ablehnen, selbst dann, wenn sie dadurch absolut besser gestellt sind als in einem System von Gleichheit (vgl. Managergehälter). Die Kritik, die von Seiten des Kommunitarismus an Rawls geübt wurde, geht aber noch weiter, sie bestreitet im Grunde, dass die Grundannahmen in allen Vertragstheorien zugrundegelegt werden, unsinnig sind. Alle diese Vertragstheorien gehen nämlich immer von einzelnen Individuen mit strategischen Interessen aus, blenden dabei aber aus, dass reale Menschen immer schon in einem sozialen Kontext gebunden sind. Die Kritik richtet sich also hier gegen die Grundannahme des ungebundenen Selbst und eines Staates, der bloß als Aggregat von Individuen verstanden wird. Insbesondere Charles Taylor hat gegen die Grundannahmen von Rawls geltend gemacht, dass Menschen nicht einfach Interessen, Werte und Wünsche haben, sondern diese erst in der sozialen Gemeinschaft, in der Auseinandersetzung mit ihr und der Kommunikation mit anderen Menschen entwickeln. Die liberale Theorie geht also nicht nur von Menschen aus, die es nicht gibt, sondern auch von Menschen, die die Voraussetzungen nicht haben, um Werte durch eine Wahl zu realisieren, weil sie diese eben nur in einer sozialen Gemeinschaft entwickeln können. Staaatstheorie von Charles Taylor In seinem Aufsatz „Wieviel Gemeinschaft braucht die Demokratie?“ geht Taylor davon aus, dass nur die Demokratie in der Lage ist, die Freiheit der Person und Wahrung der Rechte zu garantieren. Zu fragen ist aber, was eine Demokratie lebensfähig macht. Zu diesem Zweck untersucht er die sogenannte ökonomische Theorie und die holistische Theorie, um schließlich eine eigene Lösung vorzuschlagen. Kritik an der ökonomischen Theorie Zur ökonomischen Theorie zählt Taylor Hobbes, Locke und Schumpeter. Zentrales Kriterium der Zuordnung ist die Vorstellung, dass die Gesellschaft ein Instrumentarium ist, das die einzelnen Individuen in Anspruch nehmen, um ihre individuellen Interessen durchzusetzen. Die Stärke des demokratischen Staates besteht dann darin, dass es eine Gerechtigkeit gibt, in der die Ziele jedes Einzelnen denselben Wert haben wie die anderer Individuen. Als Methode zur Erzielung dieser Gerechtigkeit gelten regelmäßige Wahlen und Parteienpluralismus als Methode einer Verfahrensgerechtigkeit, die nicht bestimmte Werte (das Gute) vorgibt, sondern lediglich ein formale Prinzip (das Rechte), das sicherstellt, dass alle Interessen gleichberechtigt behandelt werden. Taylor wendet gegen dieses Modell ein, dass jede Regierungsform eine starke Indentifikation der Bürger mit ihr voraussetzt. Die Bürger müssen bereit sein, sich für das demokratische System einzusetzen und ggf. auch Opfer zu bringen (z.B. Steuern zahlen). Das heißt, die Bürger müssen letztlich Patrioten sein. Dies widerspricht aber der Annahme, dass die Bürger den Staat nur als Instrument für die Durchsetzung ihrer privaten Interessen ansehen. Es können also zumindest nicht alle Zielsetzungen in einem Staat individuell sein, wenn dieser auf Dauer als Demokratie Bestand haben soll. Es muss also auch gemeinsame Ziele geben. Kritik an holistischen Modell Rousseaus Das holistische Modell des Staates geht den umgekehrten Weg. Sie setzt voraus, dass Bürger sich selbst regieren wollen und dass es einen Gemeinwillen gibt, die volonté générale. Nach Taylor ist der Marxismus der geistige Erbe dieses von Rousseau formulierten Anspruchs. Dieses Modell überzieht jedoch nach Taylor das (staatlich verordnete) Gemeinschaftsinteresse. Es übersieht, dass die Menschen die meiste Zeit über individuelle Interessen verfolgen. Diese Differenzen kann man nicht einfach übergehen. Im holistischen System wird diesen divergierenden Interessen aber jegliche Legitimität abgesprochen. Patriotismus als Garant der Demokratie Taylors drittes Modell versucht die beiden kritisierten zusammenzuführen und deren Stärken zu vereinen. Darin soll Konkurrenz und Streit der Stellenwert zugesprochen werden, der ihnen in einer Demokratie gebührt, gleichzeitig aber ein zentraler, einheitsstiftender Identifikationpol definiert werden. Dieser Indentifikationspol besteht seiner Meinung nach im „Gesetz“ als Inbegriff von Institutionen und Verfahren des politischen Systems. Alle Bürger sollen sich als Beteiligte am gemeinsamen Unternehmen der Wahrung von Bürgerrechten verstehen (vgl. ähnlich das Modell von Hannah Arendt). Sie sollen sich verpflichtet fühlen, diese Bürgerrechte zu verteidigen. Eine zweite wesentliche Bedingung dafür, dass Demokratie als Identifikation erlebt wird, bezeichnet Taylor die Partizipation. Seiner Meinung nach schwindet nämlich der Bürgersinn in einer Demokratie, die die Partizipation der Bürger auf die bloße Stimmabgabe beschränkt. Taylor denkt bei dieser Partizipation an verschiedene einzelne Bewegungen zu einzelnen Zwecken, in denen die Bürger sich beteiligen und versuchen, Druck auf die Regierungen auszuüben und bestimmte Leute in politische Ämter zu bringen. Manchmal könnten, meint Taylor, aber auch solche Bürgerbewegungen Dinge selbst in die Hand nehmen und autonom regeln. Taylor meint, dass auf diese Weise das Gemeinschaftsgefühl wachsen könnte ohne dass ein Gemeininteresse im Sinne der volonté générale auf der Ebene des gesamten Staates mit entsprechenden Einschränkungen oktroyiert werden muss.