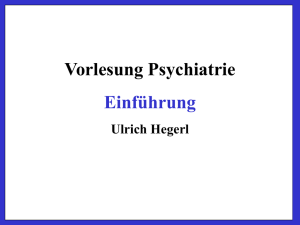Alle Fachgebiete sind gefordert
Werbung

Foto: photothek THEMEN DER ZEIT PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN Alle Fachgebiete sind gefordert Bidirektionale Zusammenhänge zwischen psychischen und den häufigsten körperlichen Erkrankungen sind vielfach belegt. Astrid Bühren, Ulrich Voderholzer, Michael SchulteMarkwort, Thomas H. Loew, Friedrich Neitscher, Fritz Hohagen, Mathias Berger Dr. med. Bühren, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Murnau Prof. Dr. med. Voderholzer, Universitätsklinikum Freiburg Prof. Dr. med. Schulte-Markwort, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Prof. Dr. med. Loew, Universitätsklinikum Regensburg Dr. med. Neitscher, Facharzt für Psychiatrie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Euskirchen Prof. Dr. med. Hohagen, Universität Lübeck Prof. Dr. med. Berger, Universitätsklinikum Freiburg E pidemiologische Untersuchungen sowie Daten der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger weisen darauf hin, dass psychische Erkrankungen in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich zugenommen haben. Dies gilt insbesondere für depressive Störungen. Dass diese Entwicklung nicht nur für die psychosozialen medizinischen Fachgebiete – das heißt Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie für die Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten – * Der Beitrag fasst einige der Hauptgedanken des Vortrags „Stärkung und Förderung der psychiatrischen, psychosomatischen und psychotherapeutischen Kompetenz im ärztlichen Handeln“ vom Deutschen Ärztetag in Magdeburg 2006 zusammen. ⏐ PP⏐ ⏐ Heft 5⏐ ⏐ Mai 2008 Deutsches Ärzteblatt⏐ von großer Bedeutung ist, sondern für die gesamte Medizin, soll im Folgenden erläutert werden*. Psychische Erkrankungen zählen weltweit zu den Hauptgründen für eine langfristige Behinderung. Nach dem Bericht der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2005 tragen neuropsychiatrische Erkrankungen zu 31,7 Prozent aller Lebensjahre bei, die mit einer Behinderung verbracht werden (1). Die fünf vorrangigen Ursachen waren davon die unipolare Depression, Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit, Schizophrenie, bipolare Depression und Demenz. Vergleiche zwischen Ländern mit hohem, mittlerem und niedrigem durchschnittlichem Einkommen zeigen eindrucksvoll, dass die Bedeutung neuropsychiatrischer Erkrankungen in den modernen Industriegesellschaften mit einem hohen mittleren Einkommen deutlich höher ist als in Ländern mit einem mittleren niedrigeren Einkommen, bei denen Infektionskrankheiten und durch Fehlernährung bedingte Störungen weiterhin eine sehr große Rolle spielen. Nach Hochrechnungen der Weltbank und der US-amerikanischen Harvard University zum „global burden of disease“ (2, 3) werden depressive Erkrankungen im Jahr 2020 an zweiter Stelle aller Erkrankungen stehen, wenn man deren sozioökonomische Bedeutung für die Gesellschaft betrachtet. Epidemiologische Querschnittsuntersuchungen in Deutschland wie auch weltweit haben wiederholt sehr hohe Prävalenzraten psychischer Störungen nicht nur im Erwachsenenalter, sondern auch im Kindes- und Jugendalter gezeigt (4, 5). Nach den Daten des Bundesgesundheitssurveys lagen die Zwölfmonatsprävalenzen psychischer Störungen bei Erwachsenen bei 37 Prozent für Frauen und bei 25,3 Prozent für Männer (4). Am häufigsten sind dabei die affektiven und Angststörungen, gefolgt von den somatoformen Störungen und Suchterkrankungen (4). Dementsprechend hoch ist auch der Anteil von Patienten mit psychischen Erkrankungen innerhalb der gesamten medizinischen Versorgungssysteme, das heißt zum Beispiel in der hausärztlichen Praxis, in internistischen oder Allgemeinkrankenhäusern (5, 6) und in der Notfallmedizin (7). Auch weisen Patienten in internistischen Krankenhäusern mit zusätzlicher Depression eine höhere Liegedauer auf (8). Bei Kindern und Jugendlichen liegen die Zwölfmonatsprävalenzraten für psychische Erkrankungen entsprechend einer Analyse von 19 Studien etwa zwischen 15 und 22 Prozent (9). Ob allerdings seelische Erkrankungen zunehmen oder nur verstärkt wahrgenommen und diagnostiziert werden, lässt sich mit epidemiologischen Untersuchungen nicht eindeutig belegen. Unterschiede bei den diagnostischen Kriterien und der Sensitivität der Messinstrumente schränken die Aussagen über Veränderungen in der Epidemiologie ein. Angaben der Rentenversicherungs- 207 THEMEN DER ZEIT SOZIOKULTURELLE GRÜNDE . . . . . . für die Zunahme psychischer Erkrankungen > Kleinere Familien, geringerer familiärer Zusammenhalt > Erhöhte geografische Mobilität mit Abnahme dauerhafter sozialer Bindungen > Veränderte Rollenerwartungen an Frauen und Männer > Deutlich gestiegene berufliche Anforderungen oder Arbeitslosigkeit > Zunehmende Orientierungslosigkeit und Werteverlust > Mangel an körperlicher Aktivität, Übergewicht, Alkoholund Drogenkonsum träger (10, Grafik 1) zeigen eine starke Zunahme der Frühberentungen infolge psychischer Erkrankungen. Im Jahr 2005 erfolgten bei den Frauen bereits 39,6 Prozent der Berentungen aufgrund psychischer Erkrankungen, bei den Männern waren es 28,5 Prozent. Bei der Krankmeldungsstatistik haben als einzige Gruppe die psychischen Erkrankungen zugenommen (11, Grafik 2), während insgesamt der Krankenstand im Jahr 2007 so niedrig war, wie schon lange nicht mehr. Epidemiologische Belege für den Anstieg von Depressionen Entwicklung der Frühberentungsursachen zwischen 1983 und 2005 für die alten Bundesländer nach Krankheitsgruppen, insgesamt (Frauen und Männer, jeweils in Prozent aller Berentungsursachen) Auch diese Statistiken belegen nicht mit letzter Sicherheit, dass die Prävalenz psychischer Erkrankungen tatsächlich zugenommen hat. Doch dürften gestiegener schulischer und beruflicher Leistungsdruck neben einem offeneren Umgang mit psychischen Erkrankungen und eine verbesserte diagnostische Erkennungsrate gemeinsam zu einem Anstieg der Arbeitsunfähigkeitsfälle und Frühberentungen aufgrund psychischer Erkrankungen beigetragen haben. Alles in allem muss man davon ausgehen, dass zumindest einige psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel affektive Störungen und Suchterkrankungen sowie zweifellos Demenzerkrankungen, in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben und vermutlich noch weiter zunehmen werden. Zumindest für eine der häufigsten seelischen Störungen, und zwar der Depression, gibt es mittlerweile auch eindeutige epidemiologische Belege für einen Anstieg der Prävalenzraten (12, 13, 14). Welche gesellschaftlichen Veränderungen könnten zu dieser Entwicklung beigetragen haben? Die Ursachen seelischer Erkrankungen sind oft vielfältig und eher selten monokausal. Genetische Faktoren, körperliche Erkrankungen und eine Reihe psychosozialer Faktoren bedingen in unterschiedlichem Ausmaß, je nach Art der Störung, das individuelle Erkrankungsrisiko. Verschiedene Faktoren (siehe Kasten) könnten dazu beigetragen haben, dass die Vulnerabilität für seelische Erkrankungen insgesamt, besonders aber für depressive Störungen, Persönlichkeitsstörungen, neurotische Störungen sowie Suchterkrankungen heute erhöht ist. Die Zunahme psychischer Erkrankungen bedeutet eine Herausforderung für die Gesellschaft, auf die die Ärzte in den kommenden Jahren reagieren müssen. Dies gilt nicht nur für die „Psycho“-fächer, sondern für die gesamte Medizin. Dass der Mensch ganzheitlich betrachtet und in der medizinischen Versorgung sowohl körperliche als auch seelische und soziale Faktoren berücksichtigt und in ihrem Zusammenspiel gesehen werden sollten, wird niemand ernsthaft bezweifeln wollen, wenngleich die Praxis oft weit davon entfernt sein dürfte. In den letzten Jahren mehren sich Veröffentlichungen über methodisch hochwertige empirische Untersuchungen, die auf eindrucksvolle Weise den Zusammenhang zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen belegen und gleichzeitig auch die künftigen Herausforderungen für die Forschung aufzeigen. Psychische und körperliche Erkrankungen bedingen sich Bidirektionale Zusammenhänge zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen konnten durch epidemiologische Querschnittsuntersuchungen und Langzeitverlaufsuntersuchungen für mehrere der häufigsten Erkrankungen belegt werden. Beispielsweise erhöhen psychische Erkrankungen das Risiko für koronare Herzerkrankung, Schlaganfall und Diabetes (15, 16, 17). Osborn und Mitarbeiter (18) untersuchten den Einfluss schwerer psychischer Störungen auf das Risiko, später an einer kardiovaskulären Erkrankung zu sterben, und stellten ein um mehr als dreifach erhöhtes kardiovaskuläres Mortalitätsrisiko für Personen zwischen 18 und 49 Jahren fest, wenn diese an einer schweren psychischen Erkrankung litten. In der Framingham-Studie GRAFIK 1 Prozent der Erwerbsunfähigkeitsrenten aufgrund psychosomatischer Erkrankungen Psychische Erkrankungen 40 Herz-KreislaufErkrankungen 20 Neubildungen 10 Atmung 0 1983 208 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Stoffwechsel/ Verdauung ⏐ PP⏐ ⏐ Heft 5⏐ ⏐ Mai 2008 Deutsches Ärzteblatt⏐ Quelle: Daten der Rentenversicherungsträger www.vdr.de Bewegungsorgane 30 THEMEN DER ZEIT ⏐ PP⏐ ⏐ Heft 5⏐ ⏐ Mai 2008 Deutsches Ärzteblatt⏐ GRAFIK 2 Arbeitsunfähigkeits(AU)-Fälle aufgrund psychischer Erkrankungen 200 In Prozent (Indexdarstellung: 1994 = 100 %) AU-Fälle 180 160 140 Quelle: Wissenschaftliches Institut der AOK, 2005 (15) konnte gezeigt werden, dass Personen mit depressiven Symptomen verglichen mit Personen ohne depressive Symptome ein deutlich erhöhtes Risiko hatten, in den acht Jahren nach der Index-Untersuchung einen Schlaganfall zu erleiden. Mehrfach wurde gezeigt, dass das Reinfarktrisiko und die Überlebensrate nach Herzinfarkt signifikant davon beeinflusst werden, ob die Patienten an einer zusätzlichen Depression leiden oder nicht (19, 20). Mehrere Faktoren könnten hier eine Rolle spielen, zum Beispiel der Einfluss psychischer Störungen auf die Compliance bei der internistischen Therapie. Im Rahmen der „heart and soul study“ wurden Patienten mit koronarer Herzerkrankung gefragt, ob sie ihre Medikamente eingenommen hatten oder nicht (21). Von den Patienten, die gleichzeitig an einer Depression litten, hatten 14 Prozent ihre Medikamente nach eigenen Angaben nicht eingenommen, in der Gruppe ohne Depression dagegen nur fünf Prozent. Wenn man die Haupt- und Nebensymptome einer depressiven Episode betrachtet, zu denen unter anderem Hoffnungslosigkeit, Antriebsstörungen oder Konzentrationsstörungen zählen, ist es nicht verwunderlich, dass die Compliance bei der Medikamenteneinnahme sowie bei der Nachsorge insgesamt durch eine depressive Störung ungünstig beeinflusst wird – ein möglicher Grund für die geringere Langzeitüberlebensrate. Auf der anderen Seite sind depressive Erkrankungen mit erhöhtem Stress und dessen körperlichen Folgen wie erhöhter CortisolAusschüttung, Inaktivität und Bewegungsmangel verbunden (20) – Faktoren, die wiederum ungünstige Wirkungen auf zum Beispiel kardiovaskuläre Erkrankungen oder Diabetes mellitus haben. Umgekehrt sind schwere körperliche Erkrankungen wie zum Beispiel ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall mit einer hohen Rate sekundärer psychischer Störungen, vor allem Depression verbunden (15, 20). Das Auftreten einer schweren körperlichen Erkrankung ist häufig mit Ängsten, tief greifender Verunsicherung und gravierenden Folgen für 120 100 80 1994 1995 1996 1997 die Lebensqualität verbunden, die das Risiko einer über das übliche normale Ausmaß einer seelischen Reaktion hinausgehenden psychischen Störung deutlich erhöhen. So ist zum Beispiel ein Herzinfarkt ein häufiger und typischer Auslöser für eine erstmalig auftretende schwere depressive Episode. Dabei muss betont werden, dass solche empirisch gesicherten bidirektionalen Zusammenhänge nicht für alle Erkrankungen gleichermaßen gesichert sind. Beispielsweise konnte – anders als bei koronarer Herzerkrankung – bislang kein Einfluss psychischer Erkrankungen auf das krebsbedingte Mortalitätsrisiko beziehungsweise auf den Langzeitverlauf von Tumorerkrankungen empirisch belegt werden (18). Allerdings ist die Lebensqualität von Tumorpatienten stark davon beeinflusst, ob eine depressive Störung vorliegt oder nicht (22). Die unmittelbare Schlussfolgerung aus diesen Daten ist, dass die Therapie psychischer Erkrankungen eine wichtige Präventionsmaßnahme auch für die körperliche Gesundheit darstellt und die Therapie sekundärer psychischer Erkrankungen im Gefolge schwerer körperlicher Erkrankungen von großer Bedeutung für deren langfristigen Therapieverlauf ist. Leider liegen bislang noch zu wenige kontrollierte Studien vor, die sich mit den Effekten psychiatrisch-psychotherapeutischer beziehungsweise psychosomatisch-psychotherapeuti- 1998 1999 2000 2001 2002 scher Behandlung seelischer Erkrankungen, die im Rahmen körperlicher Erkrankungen aufgetreten sind, befasst haben. Hier müsste dringend untersucht werden, ob und welche Therapieformen psychischer Störungen bei körperlichen Erkrankungen effektiv sind und günstige Auswirkungen auf den Verlauf der körperlichen Erkrankung haben. Am Beispiel des Diabetes zeigte ein Review bisheriger kontrollierter Studien, die die Effekte psychologischer Therapien auf den Diabetes untersucht haben, dass hierdurch bei Kindern und Jugendlichen die Blutzuckereinstellung verbessert werden konnte, nicht aber bei Erwachsenen (23). Insgesamt gibt es aber noch zu wenige Studien, um klare Aussagen über den Nutzen solcher Therapien und auch deren erforderliche Intensität machen zu können. Diese Forschungslücke sollte in den kommenden Jahren geschlossen werden. 2003 2004 Im selben Zeitraum ist eine Abnahme von AU-Fällen bei Erkrankungen des Atmungssystems, Verdauungssystems, Muskel-, Skelett- und Bindegewebes zu verzeichnen. Ähnliche Entwicklungen konnten auch anhand der Daten der DAK und der TK gezeigt werden. Probleme in der Versorgung Zahlreiche Faktoren tragen dazu bei, dass psychische Erkrankungen vielfach noch zu selten und zu spät erkannt und nicht ausreichend behandelt werden. Untersuchungen in der primärärztlichen Versorgung haben gezeigt, dass ein relevanter Anteil körperlicher Beschwerden, wie etwa Schmerzen, Müdigkeit und Schwindel, medizinisch nicht erklärt werden kann (24). Medizinisch nicht erklärbare körperliche Symptome und Syndrome (25, 26) weisen eine hohe As- 209 THEMEN DER ZEIT soziation mit psychischen Erkrankungen auf, wenngleich bei einem Teil der Betroffenen auch keine psychische Erkrankung vorliegt. Einer der Gründe für die zu seltene und späte Diagnostik einer psychischen Störung ist die Stigmatisierung seelischer Erkrankungen, die für Betroffene oft mit Scham und dem Gefühl der Minderwertigkeit verbunden sind und dazu führen können, dass Symptome verschwiegen oder verheimlicht werden und eine Behandlung abgelehnt wird (27, 28). Aber auch die geringe Honorierung eines ausführlichen Gesprächs, welches nachgewiesenermaßen die Erkennungsrate psychischer Störungen in der Primärversorgung erhöht (29), verglichen mit apparativen Leistungen, trägt dazu bei, dass viele psychische Störungen unerkannt bleiben. Viele in der Primärversorgung tätigen Ärzte haben außerdem zu wenig Zeit, sich ausführlich mit dem Patienten zu unterhalten und zum Beispiel eine psychosoziale Anamnese zu erheben. Dabei hat eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Dezember 2005 gezeigt, dass Patienten es bei Ärzten am allerwichtigsten empfinden, dass sie menschlich sind und auf ihre Patienten eingehen, noch wichtiger, als auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand zu sein. Der enorme Kostendruck der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und die vergleichsweise geringe Honorierung von Gesprächsleistungen sind vielleicht Gründe dafür, dass in Deutschland die Inanspruchnahme komplementärer/alternativmedizinischer Maßnahmen (zum Beispiel von Heilpraktikern) deutlich höher ist als in anderen Ländern (30). Kampf dem Ärztemangel Die psychosozialen Fächer selbst werden in den nächsten Jahren mit dem Ärztemangel zu kämpfen haben, der in allen Fachgebieten droht und sich auch auf diese Fächer auswirken wird. Nach gegenwärtigen Hochrechnungen wird zum Beispiel die Zahl niedergelassener Nervenärzte im Laufe der nächsten zehn Jahre bedrohlich abnehmen. In einigen Regionen, wie zum Beispiel in ländlichen Regionen der neuen Bundesländer, ist die Relation von Nervenärzten beziehungsweise ärztlichen und Psychologischen Psychotherapeuten und der zu versorgenden Bevölkerung bereits jetzt deutlich zu niedrig. Die wichtigsten Konsequenzen für die Zukunft, die von der gesamten Ärzteschaft als Aufgabe gesehen werden müssen, sind daher: > Maßnahmen zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung und innerhalb der Versorgungssysteme > Maßnahmen zur Verbesserung der Aus-, Weiter- und Fortbildung im Bereich der psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen auch in allen somatischen Fachgebieten. Zum Beispiel durch eine verbesserte Ausbildung in der Diagnostik sowie in kommunikativen Kompetenzen, Förderung der Weiterbildung in fachgebundener Psychotherapie für Ärzte aller Fachgebiete > stärkere finanzielle Förderung der sprechenden Medizin, das heißt von Gesprächsleistungen im Rahmen der GKV-Versorgung > verstärkte Forschungsförderung für Diagnostik und Epidemiologie psychischer Erkrankungen im Zusammenhang mit körperlichen Erkrankungen sowie gezielte Therapieforschung. Schließlich ist von der Politik und den Krankenkassen zu fordern, die finanziellen Verpflichtungen für den – wesentlich auch demografisch und gesellschaftlich bedingten – Morbiditätsanstieg psychischer Erkrankungen zu übernehmen. ❚ Zitierweise dieses Beitrags: Dtsch Arztebl 2008; 105(17): A 880–4 Anschrift für die Verfasser Dr. med. Astrid Bühren Hagenerstraße 31 82418 Murnau E-Mail: [email protected] @ Literatur im Internet: www.aerzteblatt.de/pp/lit0508 REFERIERT THERAPIEERFOLG Bereitschaft zur Verhaltensänderung Voraussetzung Der Therapieerfolg wird von der Änderungsbereitschaft der Patienten beeinflusst. Zu diesem Ergebnis kamen jetzt australische Psychologen, die 248 Patienten nach den Vor- und Nachteilen von Verhaltensänderungen infolge einer Psychotherapie befragten. Die Patienten litten an Angststörungen und Depressionen und wurden ambulant mit Gruppen- oder Einzeltherapie behandelt. Durch die Befragung konnten vier Patiententypen ermittelt werden: Typ 1 („Optimisten“) versprach sich nur Vorteile von Verhaltensänderungen und glaubte fest an die eigene 210 Wandlungsfähigkeit. Patienten vom Typ 2 („Ambivalente“) waren sich der Vor- und Nachteile gleichermaßen bewusst. Typ 3 („Indifferente“) erwarteten weder Vor- noch Nachteile, und Typ 4 („Pessimisten“) sahen für sich nur Nachteile durch Verhaltensänderungen. „Die größten Behandlungserfolge erzielten die Ambivalenten“, so die Wissenschaftler. Die Ambivalenten hatten die differenziertesten Sichtweisen von Erkrankung und Therapie, sie akzeptierten ihre Selbstverantwortlichkeit und rechneten auch mit Rückschlägen. Daher konnten sie mit Schwierigkeiten in der Therapie besser umgehen und langfristig größere Erfolge erzielen. Im Gegensatz dazu machten Optimisten den Fehler, dass sie zu hohe, unrealistische Erwartungen hegten, sich selbst überschätzten und angesichts von Schwierigkeiten zu schnell aufgaben. Indifferenten und Pessimisten fehlte es hingegen hauptsächlich an der Motivation, sich zu ändern. ms McEvoy P, Nathan P: Reconsidering the value of ambivalence for psychotherapy outcomes. Journal of Clinical Psychology 2007; 12: 1217–29. Peter McEvoy, Clinical Research Unit for Anxiety and Depression, St. Vincent’s Hospital, 299 Forbes Street, Darlinghurst, Sydney, NSW 2010 Australia. E-Mail: p.mcevoy @unsw.edu.au ⏐ PP⏐ ⏐ Heft 5⏐ ⏐ Mai 2008 Deutsches Ärzteblatt⏐ THEMEN DER ZEIT LITERATURVERZEICHNIS PP 5/2008, ZU: PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN Alle Fachgebiete sind gefordert Bidirektionale Zusammenhänge zwischen psychischen und den häufigsten körperlichen Erkrankungen sind vielfach belegt. Astrid Bühren, Ulrich Voderholzer, Michael Schulte-Markwort, Thomas H. Loew, Friedrich Neitscher, Fritz Hohagen, Mathias Berger LITERATUR 1. WHO (2005). Mental Health: facing the challenges, building solutions. Report from the WHO European Ministerial Conference. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe. 2. Murray CJL, Lopez AD: The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and diability from diseases, injuries and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge, MA, Harvard School of Public Health on behalf of the World Health organization and the World Bank. Global burden of disease and Injury Series, Vol I; 1996. 3. Murray CJL, Lopez AD: Global Health statistics. Cambridge, MA, Harvard School of Public health on behalf of the World Health organization and the World Bank. Global burden of disease and Injury Series, Vol II; 1996. 4. Wittchen HU, Jacobi F: Die Versorgungssituation psychischer Störungen in Deutschland – Eine klinisch-epidemiologische Abschätzung anhand des Bundesgesundheitssurveys ‘98. Bundesgesundheitsblatt 2001; 44: 993–1000. 5. Arolt V: Die Häufigkeit psychischer Störungen bei körperlich Kranken. In: Arolt V, Diefenbacher A: Psychiatrie in der klinischen Medizin. Darmstadt: Steinkopff 2004 pp.: 19–53. 6. Arolt V, Driessen M, Dilling H: Psychische Störungen bei Patienten im Allgemeinkrankenhaus. Dtsch Ärztebl 1997; 94(20): A 1354–8. 7. König F, Wolfersdorf M: Zur Häufigkeit des psychiatrischen Notfalles. Der Notarzt 1996; 12: 12. 8. Friederich H-C, Hartmann M, Bergmann G, Herzog W: Psychische Komorbidität bei internistischen Krankenhauspatienten. Prävalenz und Einfluss auf die Liegedauer. Psychother Psych Med 2002, 52: 323–8. 9. Ihle W, Esser G: Epidemiologie psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter: Prävalenz, Verlauf, Komorbidität und Geschlechtsunterschiede. Psychologische Rundschau 2002; 53: 159–69. 10. Rentenversicherung in Zeitreihen 2006. Daten des VDR, www.vdr.de. ⏐ PP⏐ ⏐ Heft 5⏐ ⏐ Mai 2008 Deutsches Ärzteblatt⏐ 11. Badura B, Schellschmidt H, Vetter C (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2005: Schwerpunktthema: Arbeitsplatzunsicherheit und Gesundheit – Zahlen, Daten, Analysen aus allen Branchen der Wirtschaft. Berlin: Springer 2006. 12. Cross National Group: The changing rate of depression. Cross na tional comparisons. JAMA 1992; 268: 3096–105. 13. Kessler RC: Psychiatric epidemiology: selected recent advances and future directions. Bull World Health Org 2000; 78: 464–74. 14. Wittchen H-U: [Depression 2000 – a nationwide primary care survey]. Fortschritte der Medizin 2000; 118: 1–3. 15. Salaycik KJ, Kelly-Hayes M, Beiser A et al.: Depressive symptoms and risk of stroke. The Framingham Study. Stroke 2007; 38: 16–21. 16. Lustman PJ, Anderson RJ, Freedland KE, de Groot M, Carney RM, Clouse RE: Depression and poor glycemic control: a meta-analytic review of the literature. Diabetes Care 2000; 23: 934–42. 17. Abas M, Hotopf M, Prince M: Depression and mortality in a high-risk population. IIYear follow-up of the Medical Research Council Elderly Hypertension Trial. The British Journal of Psychiatry 2002; 181: 123–8 18. Osborn DP, Levy G, Nazareth I, Petersen I, Islam A, King MB: Relative risk of cardiovascular and cancer mortality in people with severe mental illness from the United Kingdom’s general practice research database. Arch Gen Psych 2007; 64: 242–9. 19. Lespérance F, Frasure-Smith N, Talajic M, Bourassa MG: Five-year risk of cardiac mortality in relation to initial severity and one-year changes in depression symptoms after myocardial infarction. Circulation 2002; 105: 1049–53. 20. Deuschle M, Lederbogen F: Depression und koronare Herzerkrankung: pathogenetische Faktoren vor dem Hintergrund des Stresskonzeptes. Fortschr Neurol Psychiatr 2002: 70: 268–75. 21. Gehi A, Haas D, Pipkin S, Whooley MA: Depression and Medication Adherence in Outpatients With Coronary Heart Disease. Findings from the Heart and Soul Study. Arch Intern Med 2005; 165: 2508–13. 22. Baumeister H, Balke K, Härter M: Psychiatric and somatic comorbidities are negatively associated with quality of life in physically ill patients. J-Clin-Epidemiol 2005; 58(11): 1090–100. 23. Winkley K, Ismail K, Landau S, Eisler I: Psychological interventions to improve glycaemic control in patients with type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2006; 8, 333 (7558): 65. 24. Kroenke K, Spitzer RI, Williams JB et al.: Physical symptoms in primary care. Predictors of psychiatric disorders and functional impairment. Arch Fam 1994; Med 3: 774–9. 25. Russo J, Katon W, Sullivan M, Clark M, Buchwald D: Severity of somatization and its relationship to psychiatric disorders and personality. Psychosomatics 1994; 35: 546–56. 26. Henningsen P, Zimmermann T, Sattel H: Medically unexplained physical symptoms, anxiety and depression: a meta-analytic review. Psychosom Med 2003; 65: 528–33. 27. Corrigan PW, Rüsch N: Mental illness stereotypes and clinical care: Do people avoid treatment because of stigma? Psychiatric Rehabilitation Skills 2002; 6: 312–34. 28. Gaebel W, Möller HJ, Rössler W: Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Der Umgang mit sozialer Ausgrenzung psychisch Kranker. Stuttgart: Kohlhammer 2005., 29. Kruse J, Schmitz N, Wöller W, Heckrath C, Tress W: Warum übersieht der Hausarzt die psychischen Störungen seiner Patienten? Psychother Psych Med 2004; 54(2): 45–51. 30. Ernst E: The role of complementary and alternative medicine. BMJ 2000; Nov 4; 321 (7269): 1133–5 1

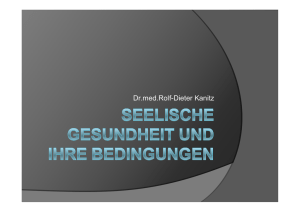

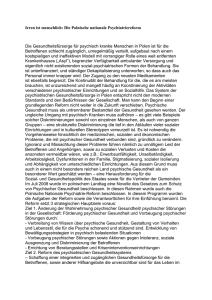
![Beitrag PD Dr. med. Stengler [*, 1,15 MB]](http://s1.studylibde.com/store/data/006705359_1-12f3d356b03128fc2bf54ebc41cb598a-300x300.png)