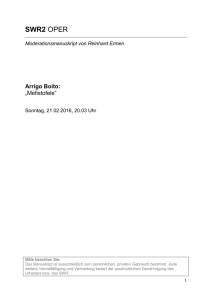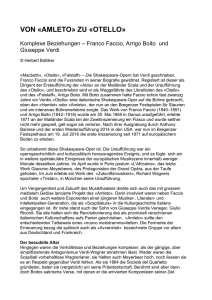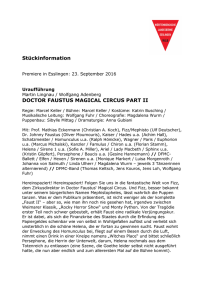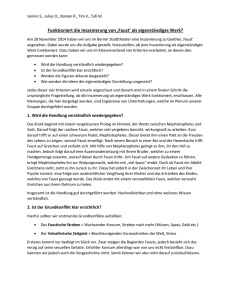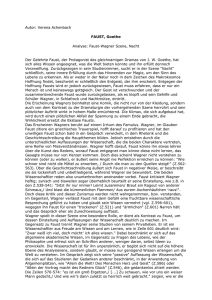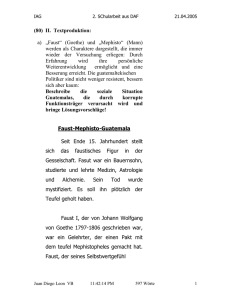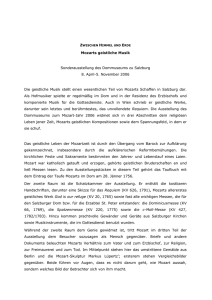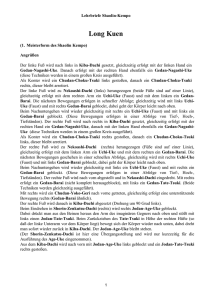SWR2 Musikstunde
Werbung
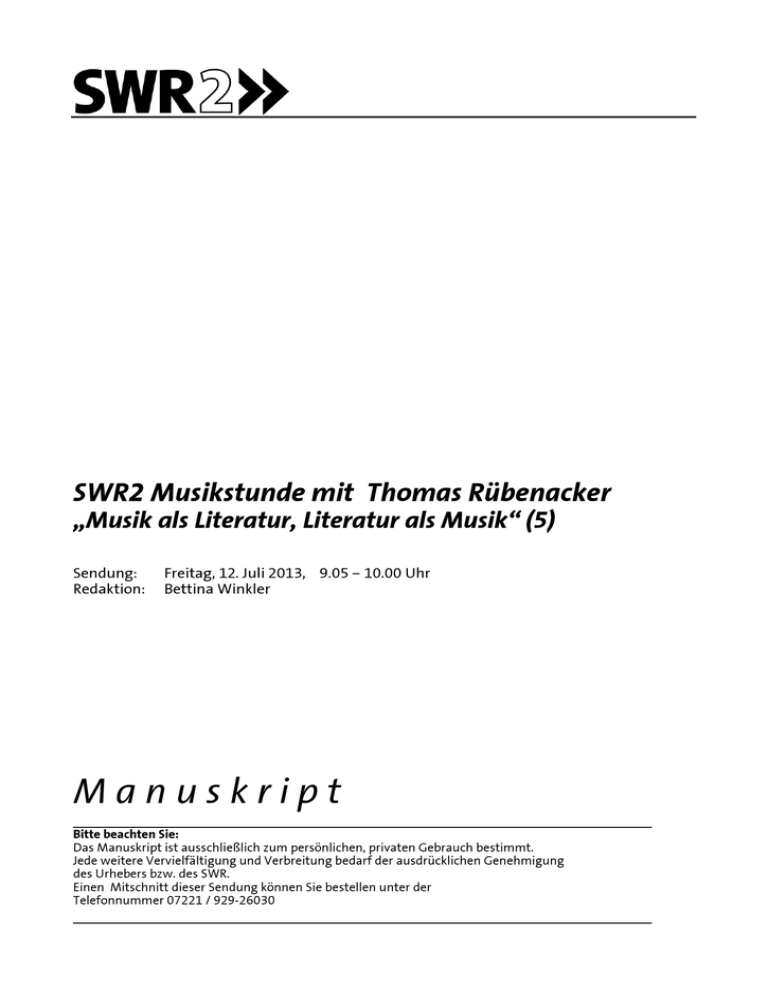
2 MUSIKSTUNDE mit Trüb Freitag, 12. 7. 2013 „Musik als Literatur, Literatur als Musik“ (5) MUSIK: INDIKATIV, NACH CA. … SEC AUSBLENDEN Natürlich gibt es nicht nur den „Faust“, nicht nur die mehr oder minder schwere deutsche Literatur, wenn es um deren mitunter geradezu zwillingshafte Beziehung zur Musik geht. 1902 wurde im britischen Lancashire, im Städtchen Oldham, ein gewisser William Walton geboren. Er war der Sohn zweier Sänger, und er wurde schon früh in den Geigen- und den Klavierunterricht geschickt. Ein Wunderkind war er aber keins, er hatte seine Schwierigkeiten mit beidem. Dafür erblühte ihm nach dem Stimmbruch, als er in Oxford studierte, ein wunderbarer Tenor, den er im semiprofessionellen Universitätschor häufig solistisch spazieren führen durfte. Dort freundete er sich an mit einem anderen Studenten, Sacheverell Sitwell, dem jüngeren Bruder einer exzentrischen Dichterin: Edith Sitwell. Nach dem Studium wollte Walton nicht mehr ins enge Oldham, wusste aber nicht wohin; da bot ihm Sacheverell an, mit ihm, seiner Schwester Edith und dem ebenfalls literarisch tätigen Bruder Osbert nach London zu ziehen, sie hätten da so eine Art Literaten-WG. Sagt Walton: „Ich ging für ungefähr eine Woche und blieb ungefähr 15 Jahre.“ Da wohnten sie also ganz physisch beieinander, die Literatur und die Musik: Die Sitwells machten Walton vertraut mit den britischen belles lettres, und er lieferte vor allem Ediths Exzentrizitäten die ähnlich pointierte Musik. „Facade“ heißt das gemeinsame Werk, das noch heute eines von Waltons beliebtesten ist. MUSIK: WALTON, FACADE, TRACK 24 (3:02) Facade; Dame Edith Sitwell, Ensemble, William Walton; Decca 468 801-2 (LC 00171) Literatur als Musik, Musik als Literatur: Die herrlichen Nonsense-Gedichte von Dame Edith Sitwell vertonte deren Dauer-Hausgast William Walton für ein sechsköpfiges Ensemble, die Verse las in unserer Aufnahme Dame Edith selbst, Walton schwang den Stab: „Valse“. Das Deklamieren hatte Edith übrigens auch bei der Uraufführung in Londons Aeolian Hall verrichtet: mit einem Megaphon hinter einem Paravent. Im Publikum saßen damals Evelyn Waugh, Virginia Woolf und Noel Coward; dem eher traditionellen Songschreiber Coward misshagte das Ganze aber gewaltig, diese vielen Walton‘schen Dissonanzen, und er verließ die Veranstaltung vorzeitig. Damals war Walton noch als „Modernist“ verschrieen, sein erstes Streichquartett ist sogar streng dodekaphon. Als er sich später aber zum Neoromantiker entwickelte, warf man ihm vor, old hat zu sein, ein Altmodler, kein Almjodler! Hören wir daher noch einmal „Facade“: den „Jodelling Song“, ein Jodellied. 3 MUSIK: WALTON, FACADE, TRACK 25 (2:29) Mefistofele; Domingo, Ramey, Ungarisches Nationalorchester, Giuseppe Patané; Sony SM2K 90478 (LC 06868) Noch einmal Sir William Walton und Dame Edith Sitwell in ihrer exzentrischen Jugend: der „Jodelling Song“ aus „Facade – an Entertainment“. Die Autorin deklamierte, der Komponist dirigierte. Aber nach dieser britischen Frivolität aus den Zwanzigerjahren will ich doch noch einmal auf die deutsche gravitas zurückkommen, denn noch sind nicht alle erwähnenswerten Einlassungen mit dem „Faust“ auch wirklich erwähnt worden! (Gounod lasse ich allerdings weg, denn dessen „Margarethe“ ist eher eine „Faust“-Operette.) Erstaunlicherweise veroperte Giuseppe Verdi eine Menge Schiller, die „Räuber“ und „Luisa Miller“ und „Don Carlos“ – aber keinen einzigen Goethe! Auch nicht den „Faust“. Das überließ er seinem besten Librettisten, in dessen Person wieder mal Literatur auf Musik traf und umgekehrt: Arrigo Boito. Geboren 1842 als Sohn eines italienischen Miniaturmalers und einer verwitweten polnischen Gräfin, studierte er später Geige, Klavier und Komposition am Mailänder Konservatorium. Seine erste „Begegnung“ mit dem späteren Freund und Arbeitsfreund Verdi hatte Boito mit neun: Da komponierte er eine Polka auf die Tenorarie „La donna è mobile“ aus dessen Oper „Rigoletto“! Bezeichnenderweise war aber nicht so sehr Verdi das musikalische Vorbild Boitos; der hauptberufliche Kritiker, Lyriker und Romanautor hielt es kompositorisch mehr mit zwei Deutschen, Beethoven und Richard Wagner. Der vermeintliche Verdi-Antipode Wagner aus Germania war dann aber der Anlass für Boitos zweite Begegnung mit Giuseppe Verdi. Nachts um drei Uhr, nach der Erstaufführung des „Lohengrin“ in Italien, warteten Boito und sein Freund Franco Faccio im Bahnhof von Bologna auf ihren Zug. Da gesellte sich Verdi zu ihnen, der sich die erste Italien-Premiere einer Wagneroper natürlich auch nicht hatte entgehen lassen. Und worüber wurde geredet, als die drei Musiker Faccio, Boito und Verdi aufeinander trafen? Über die Schwierigkeit, in fahrenden Zügen schlafen zu können … MUSIK: BOITO, MEFISTOFELE, CD 1, TRACK 1 (5:54) Arrigo Boito, das Preludio seiner einzigen vollendeten Oper „Mefistofele“ nach Goethes „Faust“, und zwar beiden Teilen in schöner Blütenlese. Der Stil ist mehr Wagner als Verdi, aber doch auch eine Fusion von beiden – Boitos erklärtes Ziel: den stile teutonico zu vermählen mit der italianità. Giuseppe Patané dirigierte das Ungarische Staatsorchester. 4 Wie sein Landsmann Ferruccio Busoni war auch Arrigo Boito Atheist, was ihn nicht gerade zum idealen Verfechter der „Faust“-Sage macht: Wenn es keinen Gott gibt, wo kommt dann der Teufel her? Aber während Busoni in „Doktor Faust“ das Menschheitsdrama zwischen Gut und Böse in den Vordergrund rückt, spitzt Boito den Glaubensaspekt noch zu, indem er Mephisto zur Hauptfigur macht und ebenso deren Widerpart, der ja nicht Faust ist, sondern der Wettpartner Gott, der zwar nie selber auftritt, aber durch „himmlische Heerscharen“ allzeit vertreten ist. Am 3. März 1868 wurde der „Mefistofele“ an der Mailänder Scala uraufgeführt – und muss ein grässliches Fiasko gewesen sein. Das Ensemble war zweitklassig, der Dirigent – Boito selber – völlig unerfahren, die Oper mit fast fünf Stunden viel zu lang, und das nicht gerade an Richard Wagners neuem Musiktheater geschulte Publikum pfiff auch noch jede „gewagte“ Neuerung des Komponisten aus. Nach dieser Premiere wurde der „Mefistofele“ nur noch ein einziges Mal gegeben, und der Versuch, ihn auf zwei Abende zu verteilen, musste natürlich ebenso fehlschlagen. Der Wiener Kritiker Eduard Hanslick höhnte dem Goethe-Fan Arrigo Boito noch mit einem Goethe-Zitat hinterher: „Getretener Quark wird breit - nicht stark“. Waidwund zog der Komponist und Textdichter sein Werk zurück und überarbeitete es noch sieben Jahre lang, kürzte vor allem, stellte aber auch um und komponierte neues Material hinzu – um die brutalsten Kürzungen nicht als gigantische Löcher wahrnehmbar zu machen! Auch opferte er dem Gusto seiner Landsleute die ursprüngliche Stimmlage Faustens, nämlich Bariton, für die den Italienern weit geläufigere Tenor/Bass-Polarität, Faust und Mephisto also im jeweiligen männlichen Registerextrem. Am 4. Oktober 1875 wurde die Neufassung in Bologna uraufgeführt, mit einem besseren Ensemble und dem inzwischen erfahreneren Dirigenten Boito: Ecco là, jetzt war's ein Erfolg! Ich möchte Ihnen noch das Finale des 2. Aktes vorspielen, wenn Mephisto Faust auf den Brocken lockt, zur „Nacht auf dem kahlen Berg“, zur Walpurgisnacht. Als Vision im Himmel sieht Faust noch einmal das gefesselte Gretchen, hier Margherita, als todgeweihte Mörderin des gemeinsamen Kindes; aber Mephisto und der Trubel des Hexensabbats verscheuchen derlei schamvolle Gedanken. Wie heißt es bei Goethe: „Der ganze Strudel strebt nach oben,/Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben ...“ Plácido Domingo singt den Faust, Samuel Ramey Mefistofele, dazu Chor und Orchester der Ungarischen Nationaloper Budapest, der Dirigent ist Giuseppe Patané. MUSIK: BOITO, MIFEISTOFELE, CD 2, TRACKS 7 + 8 (6:33) 5 „Mefistofele“, Finale des 2. Aktes, Text und Musik von Arrigo Boito, mit Plácido Domingo als Faust und Samuel Ramey in der Titelrolle, dazu Chor und Orchester der Ungarischen Nationaloper Budapest, der Dirigent war Giuseppe Patané. Johannes Brahms war, ich sagte es bereits, einer der ganz wenigen Komponisten der Romantik, die nicht auf die eine oder andere Art sich mit dem „Faust“-Stoff auseinandersetzen – außer, dass er selbst ein faustischer Künstler war. Sein Freund und Biograph Max Kalbeck ist da aber ganz anderer Ansicht: Er behauptet, die beiden Mittelsätze der 3. Brahms-Symphonie seien „FaustStücke unter der Tarnkappe“, das ganze Werk eine „Faust-Symphonie“. Kalbeck war Musikschriftsteller, Kritiker und Übersetzer von Opern-Libretti, außerdem dilettierte er gelegentlich als Komponist. Als Protégé von Eduard Hanslick verachtete er wie dieser die Neudeutsche Schule und ließ kein gutes Haar an Wagner, Bruckner oder Hugo Wolf. Als Kritiker gab er sich das Pseudonym „Jeremias Deutlich“, was ja ganz putzig wäre, käme es nicht von so hohem Ross herab: „Deutlich“ ist ja deutlich genug, und „Jeremias“ war ein Prophet, der aufgrund seiner profunden Weissagungen zum Gott erhöht wurde; gelegentlich heißt er auch „der Donnerer“ oder „Meister der Klagelieder“. Kalbeck als Kritiker soll ein scharfer Hund gewesen sein; er musste dann aber auch selber einstecken! So schrieb Karl Kraus über ihn: „Er hat einige dürftige lyrische Gedichte geschrieben und einige schon wieder verschollene Operettentexte geliefert, hat fremdländische Opern angeblich ins Deutsche übertragen (…), hat eine ehrfurchtslose 'Bearbeitung' des Don Juan gewagt, hat wohl auch einigen Musikunterricht genossen und wurde, da er weder zum Dichter noch zum Musiker taugte, Zeitungskritiker für Literatur und Musik. Als solcher trat er in die Reihe der Wiener Beckmesser (…), pflanzte die Anschauungen seines Förderers Hanslick fort, hängte sich, um nicht die Überfuhr zur Unsterblichkeit zu versäumen, an die Frackschöße Johannes Brahms' und schien gewillt, alles, was neben diesem in Tönen zu empfinden wagte, einer Rache, einer Laune, einem Spaß zu opfern.“ Nun, richtig ist: Gott hieß für Max Kalbeck mit Vornamen Johannes. Man fragt sich dann aber, wie er als Freund von Brahms auf die Idee kommt, die beiden Binnensätze der 3. Symphonie, ein Andante und ein Poco Allegretto, seien Brahms-Reflexe auf Goethes „Faust“. Ob ihm der Meister nicht vielleicht doch einen Hinweis gab? Das Andante, so Kalbeck, sei „die trügerische Idylle des neuerlich verjüngten Doctoren mit dem unschuldsvollen Gretchen, welche in Aporie und Tragödie endet“ - meint Kalbeck da etwa den Komponisten selber, der ebenfalls als frühzeitig Gealterter gern jungen Mädchen nachträumte? Und das Poco Allegretto, „eine sentimentalische Reminiszenz an die Gretchen-Episode“ - sei wiederum der olle Rauschebart, der immer Verhältnisse einfädelte, sie dann aber abreißen ließ und ihnen in seiner Kunst nachtrauerte? Dann wäre allerdings zumindest dieses 6 Kapitel in Kalbecks vierbändiger Biographie des berühmten Freundes geradezu subversiv: Es würde etwas sehr Intimes aus dessen Leben nicht einfach nur verraten, sondern es sogar kommentieren … Aber wenn schon, dann erscheint mir am „faustischsten“ der Finalsatz mit seiner gebrochenen Aufschwungsemphase, seinem trotzig behaupteten „Dennoch!“. Besonders ohrenfällig wird das in der Aufnahme mit Charles Mackerras und dem Scottish Chamber Orchestra, worin die orchestralen Kräfteverhältnisse angeglichen sind jenen damals berühmten am Meininger Hof, wo Brahms sich am liebsten hörte. MUSIK: BRAHMS, 3. SYMPHONIE, CD 3, TRACK 4 (8:35) 3. Symphonie F-dur; Scottish Chamber Orchestra, Sir Charles Mackerras; Telarc CD-80450 (LC IN-AKUSTIK!) Brahms vielleicht faustisch, vielleicht nicht: Das vom Scottish Chamber Orchestra und Charles Mackerras rekonstruierte Meininger Hoforchester spielte das Allegro-Finale von dessen 3. Symphonie F-dur. Der einzige deutsche Opernkomponist außer Richard Wagner, der alle seine Libretti selber verfasste, war Alfred Lortzing, der „König des Singspiels“. In einem Fall ging es ihm sogar mehr um die Literatur – weil es ihm um die Musik ging, aber eben nicht die eigene! Wolfgang Amadé Mozarts Leben war in der Mitte des 19. Jahrhunderts mehr ein Mustopf von Gerüchten als eine seriöse Künstlerbiografie, und gespielt wurde er eh nur noch selten: Mozarts Nachruhm als Instrumentalkomponist begann so richtig erst mit dem 20. Jahrhundert, mit Radio und Schallplatte. 1833, also 42 Jahre nach Mozarts Tod, schrieb Lortzing ein Singspiel „Szenen aus Mozarts Leben“, in dem höchstwahrscheinlich Salieri den Genius vergiftete, Constanze ein loses Weib war und der Oberintrigant vom Dienst ohnehin der Klarinettist Anton Stadler. Das ist, kurz gesagt, ein LoreRoman mit Musik – nur dass die Musik eben nicht von Lortzing stammt, sondern Vaudeville-üblich vom Gegenstand der Betrachtung selber, eben Mozart. Der Komponist Lortzing trat hier lediglich auf als gewiefter Arrangeur. Einen Rest von Ehrfurcht vor dem Größeren zeigt er darin, dass er seinen Mozart nicht singen lässt – er spricht nur, wie der Teufel im „Freischütz“. Schon gleich zu Beginn wird der doch vermutlich harmlose Antonio Salieri als ein das Schicksal manipulierender Ränkeschmied gezeichnet, zu den Klängen des „Dies irae“ aus Mozarts Requiem empfängt er seine Gäste. Die folgende Arie Salieris soll wohl seine übersteigerte Selbstsicht zeigen, auch sie beginnt mit dem Requiem: „Rex tremendae majestatis“. Im weiteren Verlauf der Selbstbeweihräucherung wechselt Salieri/Lortzing dann zu Mozarts beiden D-dur-Klaviersonaten KV 284 bzw. 311. 7 MUSIK: LORTZING, SZENEN AUS MOZARTS LEBEN, CD 2, TRACK 6 (5:13) Szenen aus Mozarts Leben; Klaus Häger, Cappella der Nordwestdeutschen Musikakademie Detmold, Jan Stulen; MDG 609 1059-2 (LC 6768) Eine literarische mehr als eine musikalische Anstrengung des Albert Lortzing: Das Libretto von „Szenen aus Mozarts Leben“ stammt von ihm, die Musik hat er lediglich arrangiert. Klaus Häger sang Antonio Salieri, die Cappella der Nordwestdeutschen Musikakademie Detmold spielte, der Dirigent war Jan Stulen. Das Melodram, diese ganz besondere Verknüpfung von Literatur mit Musik, hatten wir bereits bei Robert Schumann. Und obwohl Dichtung hier nicht gesungen, sondern zu Klavierbegleitung lediglich deklamiert wird, ist es von Vorteil, wenn der Sprecher Noten lesen kann: Sonst stirbt der Pianist, mal hinterherhechelnd, mal verlangsamen müssend wie in Treibsand. Im 20. Jahrhundert kam ein Typus des Melodrams auf, bei dem die Noten mindestens so wichtig sind wie die Worte: Weswegen die Sprecher dieses Melodrams auch am besten – Sänger sind … Ich meine „Pierrot lunaire“ von Arnold Schönberg, eine Auftragsarbeit für die Schauspielerin Albertine Zehme, 3 x 7 Gedichte des Belgiers Albert Giraud, nicht kongenial, sondern wesentlich besser eingedeutscht von Otto Erich Hartleben. Hier endet alles Deklamieren; Schönberg verlangt gnadenlose Rhythmisierung der Sprache, schreibt Tonhöhen vor und dehnt oder staucht die Aussprache wie auf dem sagenhaften Bett des Prokrustes. Das „Melodram“ ist hier immer kurz vor dem Abheben in den Gesang – aber eben nur kurz davor, denn er findet nie statt. Im Grunde hatte sich aus dem Melodram des 19. Jahrhunderts eine neue Gattung entwickelt: der Sprechgesang. Und rein musikalisch könnte man sagen: Cabaret meets Kontrapunkt, übrigens noch atonal, noch nicht in der besonders strengen Zwölftontechnik. So lustvoll ich selber Melodramen der romantischen Epoche zum besten gebe – den „Pierrot lunaire“ würde ich mir doch nicht zutrauen. Igor Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“ ist ja auch schon schwierig genug … MUSIK: SCHÖNBERG, PIERROT LUNAIRE, AB TRACK 1 (32:52; ACHTUNG! BITTE AM ENDE DER MUSIKSTUNDE ELEGANT AUSBLENDEN!) Pierrot lunaire; Christine Schäfer, Ensemble InterContemporain, Pierre Boulez; DG 457 630-2 (LC 0173) 8 Absage: Das war … Zuletzt hörten Sie einen Ausschnitt aus Arnold Schönbergs Melodram für Sprechstimme und fünf Instrumentalisten, mit Christine Schäfer, dem Ensemble InterContemporain und Pierre Boulez.