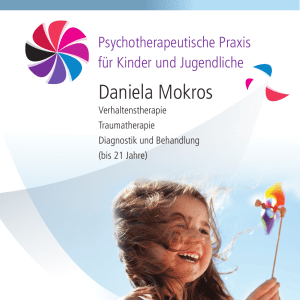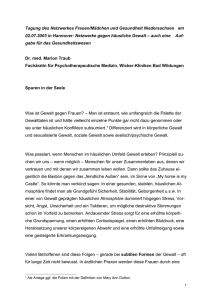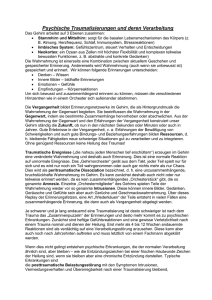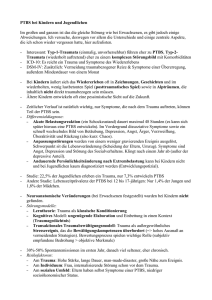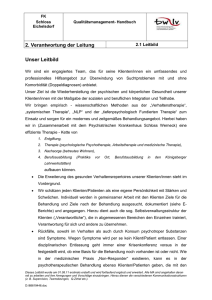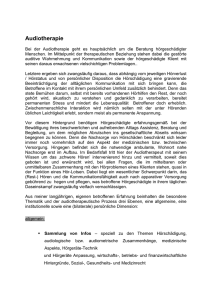Was ist Trauma? - Sigrid Wieltschnig
Werbung

Was ist Trauma? Trauma wird als unvollständige Antwort des menschlichen Organismus auf ein überwältigendes Ereignis definiert. Es entsteht dann, wenn nicht ausreichend Ressourcen vorhanden sind, um dieses Ereignis zu verarbeiten und zu integrieren. Die Auslöser können vielseitig sein, ob es zu einer Traumatisierung kommt, ist auch abhängig von der Konstitution des Betroffenen und vor allem von dessen inneren und äußeren Ressourcen. Ein Mensch, der ein schlimmes Ereignis überlebt hat und danach liebevoll und respektvoll behandelt wird, kann dieses eher integrieren als jemand, der auf Grund der äußeren Umstände nicht sicher ist oder mit Schuldzuweisungen konfrontiert wird. Untersuchungen haben belegt, dass die unmittelbare Zeit nach einer traumatischen Situation maßgeblich beteiligt ist an der Entwicklung der Traumasymptomatik. Traumatherapie Die moderne Traumatherapie stellt einen neuen Ansatz in der therapeutischen Arbeit mit traumatisierten Menschen vor. Die komplexe und oft therapieresistente Traumasymptomatik verlangt nach einem speziellen Zugang mit Einbeziehung des Körpers und des vegetativen Nervensystems. Die Methode ermöglicht durch geförderte sensomotorische Wahrnehmungsfähigkeit der Klienten, durch Imagination und Beziehungsarbeit eine Neuorientierung, sodass die in den Symptomen gebundene Energie freigesetzt und zur Heilung genutzt werden kann. Die zerbrochenen Verbindungen zum Selbst, zum Körper und seinem Selbstheilungspotential, zu den eigenen Ressourcen und Fähigkeiten, sowie zur Gegenwart werden wieder hergestellt. Traumaheilung findet immer im Hier und Jetzt statt. Wir können das Trauma zwar nicht beseitigen, wissen aber heute, dass wir mit Hilfe traumazentrierter Behandlungsmethoden im Hirnstoffwechsel Veränderungen herbeiführen können, sodass Trauma auf neue Art metabolisiert und damit integriert wird. Die blockierten Überlebensreflexe (Orientierungs-, Kampf- und Fluchtreflex) werden regeneriert und der Organismus gewinnt wieder seine natürliche Flexibilität und interaktive Selbstregulationsfähigkeit. Der Körper kann aus seiner Überaktivierung (Hyperarousal) oder Erstarrung (Freeze) langsam herauskommen und so erst Distanz schaffen zu dem traumatischen Ereignis, das ja in der Vergangenheit liegt und dieses auch als vergangen erleben und somit neu bewerten. Im Zuge dieses Prozesses lernen die Klienten, sich in ihrem Körper wieder sicher zu fühlen und den Alltag besser zu bewältigen. Oft können einige Sitzungen schon erhebliche Verbesserung und Erleichterung der Symptomatik bewirken. Zu Beginn der Traumatherapie wird vermieden, nochmals in das traumatisierende Ereignis einzutauchen. Erst wenn genügend Ressourcen aufgebaut und die Klienten imstande sind, das Traumamaterial zu steuern und zu kontrollieren ist eine Traumaexposition sinnvoll. Dabei werden die Hyperaktivierung und die Fixierung des gesamten Organismus auf das traumatische Ereignis vorsichtig aufgelöst. Zu frühes oder zu schnelles Durcharbeiten einer Traumasituation kann auch retraumatisierend wirken, Traumaexposition ist nur bei ausreichender Stabilität und guter Arbeitsbeziehung ethisch vertretbar. Ein gewisses Maß an Exposition ist allerdings für die Traumaintegration wichtig, allerdings muss bei mangelnder Stabilität der Klienten darauf verzichtet werden (Huber, 2004). Plassmann spricht in diesem Zusammenhang vom Prinzip des „Window of Tolerance“. Auf einer Belastungsskala von 1 bis 10 sollten wir die Klienten in einem Bereich zwischen 3 und 7 halten, nur dann kann Heilung stattfinden. Arbeiten wir im Bereich darunter, so wird vielleicht ein leichtes Unbehagen auftreten, die Gefühlsreaktionen sind allerdings zu schwach für eine Traumaintegration. Halten wir die Klienten in einem Bereich über 7, so 1 wird das zu Hyperarousal, vegetativen Symptomen und im schlimmsten Fall zu Retraumatisierung führen (Plassmann 2006). Die Erfahrung, dass Traumaheilung immer auf der Aktivität eines psychischen Selbstheilungsprozesses beruht, gekoppelt mit einer weiteren wichtigen Erfahrung, nämlich der, dass Emotionen nicht nur bei der Krankheitsentstehung, sondern auch bei Heilungsprozessen eine wesentliche Rolle spielen, bilden weitere wesentliche Grundlagen. Die negativen traumatischen und die positiven gesunden Erfahrungen stehen sich gleichsam gegenüber, sie bilden ein bipolares Prinzip. Die positiven Erfahrungen der Person werden auch als Ressourcen bezeichnet. Ein gutes Gefühl für die eigene Gesundheit, also ein guter Kontakt zu diesen Ressourcen ist für erfolgreiche Heilungsprozesse von größter Bedeutung. Die Beschäftigung mit ungelösten Problemen bildet deshalb nur eine Seite der Traumatherapie. Die Beschäftigung, das Kennenlernen, das Neuorganisieren und Erweitern der eigenen Ressourcen ist ein exakt genauso wichtiger Bereich. Trost, Mitgefühl und Anerkennung durch die Therapeutin können ebenso wesentlich zur Heilung beitragen. Auch wenn wir das Geschehene nicht ungeschehen machen können, so können wir aber gemeinsam mit den Klienten das Unrecht benennen und so das oft Unvorstellbare, das diesen Menschen widerfahren ist, anerkennen. Nicht selten geschieht dies in einer Therapiesituation zum ersten Mal. Man kann also von 4 Phasen der Traumabehandlung sprechen: der Stabilisierungsphase der Ressourcenorganisation der Traumaexposition und der Neuorientierung Die Dynamik von Trauma Trauma entsteht dann, wenn ein plötzliches überwältigendes Ereignis auf den Organismus trifft und weder Flucht noch Kampf möglich sind. Die ersten Reaktionen bei Trauma sind instinktiv, im Hirnstamm wird eine außergewöhnliche Energiemenge frei, die uns manchmal unvorstellbare körperliche Leistungen ermöglicht und oft lebenserhaltend ist. Ist es dem Organismus aber nicht möglich diese Ladung an Energie aufzubrauchen, weil die natürlichen Reflexe keinen Ausdruck finden, weil flüchten oder kämpfen nicht möglich sind, so kommt es zu einem Zustand höchster Erregung gekoppelt mit gleichzeitiger Erstarrung. Die geballte Ladung an Energie kann nicht in Handlung, Bewegung, Kampf oder Flucht umgesetzt werden und kann über Jahre zu den vielfältigsten Symptomen führen. Unruhe, chronische Verspannungen, Angst und Panik, Herzrasen, Aggression, chronische Schmerzen, Schlafstörungen, Amnesien, Depression und vieles mehr können dann die Folge sein. Starke Traumata gehen auch häufig mit der Abspaltung von den eigenen Gefühlen (Dissoziation) einher. Viele psychiatrische Erkrankungen wie zum Beispiel die Borderline Störung, die Essstörung u.a. haben häufig ihre Wurzel in einem oft über Jahre traumatisierenden Umfeld und das von frühester Kindheit an. Peter Levine ist der Frage nachgegangen, warum Tiere in freier Wildbahn so gut wie nie traumatisiert werden, obwohl sie ständigen Gefahren ausgesetzt sind und er konnte dabei folgende Beobachtung machen: Ein Beutetier, das Gefahr wittert, wird zuerst einmal flüchten. Erst wenn der Jäger seine Beute erreicht, also unmittelbar vor dem herannahenden Tod fällt das Tier in eine Erstarrung, die einerseits die allerletzte Überlebensstrategie darstellt, denn tote Beute ist im Tierreich oft uninteressant und 2 andererseits das Tier in einen veränderten Bewusstseinszustand bringt, in dem es keinen Schmerz spürt, sollte es dennoch gefressen werden (Levine 1998). Die Traumadynamik beim Menschen unterscheidet sich nicht wesentlich davon. Die unwillkürlichen, instinktiven Bereiche des menschlichen Gehirns sind faktisch identisch mit den betreffenden Arealen bei den Säugetieren und Reptilien. Der Schlüssel zur Heilung von Traumasymptomen liegt daher in unserer Physiologie, ähnlich einem wildlebenden Tier, ist es auch für den Menschen von großer Wichtigkeit nach dem Abklingen der akuten Traumasituation wieder aus der Immobilität und Erstarrung heraus zu kommen und seine volle Bewegungs- und Handlungsfähigkeit wieder zu gewinnen. Ein Tier, das der Gefahr entkommen ist, schüttelt sich heftig ab und geht dann seinen üblichen Tätigkeiten wieder nach. Durch die meist unbewusste Einmischung unseres Bewusstseins werden diese natürlichen Reaktionen unterbunden und die Traumareaktion kann keinen positiven Abschluss finden. Im menschlichen Organismus bleibt dann eine Überladung im Nervensystem und das oft über Jahre und Jahrzehnte. So gesehen ist die Traumasymptomatik keine Erkrankung, sondern ein Versuch des Organismus mit dieser Überladung fertig zu werden. Die Traumatherapie unterstützt den Organismus dabei, diesen unvollständigen Prozess zu Ende zu bringen. Gehirnfunktionen und Trauma Das limbische System Neuere Ergebnisse der Gehirnforschung haben interessante Erkenntnisse gebracht, die in Bezug auf das Verständnis von Trauma von großem Wert sein könnten. Dabei haben sich vor allem Amygdala und Hippokampus, zwei Regionen des limbischen Systems als interessant erwiesen. Im limbischen System werden Erlebnisinhalte affektiv bewertet und emotionale Reaktionen ausgelöst. Es ist der Sitz der Überlebensinstinkte und Reflexe und beeinflusst unter anderem das autonome NS, das die glatte Muskulatur und die Reaktion der Organe auf Stress und Entspannung steuert und zwar auch auf traumatischen Stress: Kampf, Flucht und Erstarren (Rothschild 2002). Amygdala und Hippokampus sind für das Verständnis von Traumaerinnerungen besonders wichtig. Die Amygdala verarbeitet Emotionen und Reaktionen auf stark affektive Erlebnisse und ermöglicht deren anschließende Speicherung. Der Hippokampus verarbeitet Informationen im Kontext einer Zeitlinie in der jeweiligen persönlichen Geschichte, sowie den genauen Ablauf des Erlebten selbst. Während die Amygdala zum Zeitpunkt der Geburt reif ist, entwickelt sich der Hippokampus bis zum 3. Lebensjahr (Nadel und Zola-Morgan 1984). Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass wir uns an unsere frühe Kindheit meist nicht bewusst erinnern. Unsere ersten Jahre werden von Amygdala zwar verarbeitet und deren emotionaler und sensorischer Inhalt auch gespeichert, da der Hippokampus aber noch nicht funktionsfähig ist, ergibt sich keinerlei Aufschluss über den Kontext oder die genaue Ereignisfolge. Gespeichert werden lediglich die mit den Ereignissen verbundenen Gefühle und Körperempfindungen. Dies ist auch der Grund, warum wir zu Ereignissen aus der Säuglingszeit eine andere Form des Kontakts herstellen müssen als über Erinnerung. Nur wenn Amygdala und Hippokampus voll funktionsfähig sind, können wir Ereignisse ausreichend verarbeiten, insbesondere gilt dies für traumatische und sehr belastende Ereignisse. Bei großem Stress wird allerdings die Hippokampus Aktivität durch eine längere Kortisolausschüttung unterdrückt, während die Amygdala unbeeinflusst bleibt. Dies könnte für die mit der PTBS einhergehenden Erinnerungsverzerrungen die Ursache sein. Auch die Größe des Hippokampus wurde in den neueren Forschungen untersucht und man kam zu dem Ergebnis, dass der Hippokampus bei Menschen mit PTBS kleiner ist als beim Bevölkerungsdurchschnitt. Allerdings konnte nicht festgestellt werden, ob der Hippokampus auf Grund der traumatischen Belastungen geschrumpft ist oder ob dieser von Anfang an kleiner war. 3 Kortex Interessant ist auch die Verbindung von Amygdala und Hippokampus zum Kortex (Großhirnrinde). Der rechte Teil des Kortex ist für die Speicherung von sensorischem Input zuständig und eng mit der Amygdala verbunden, alle sensorsichen Informationen passieren auf ihrem Weg in den Kortex die Amygdala. Der linke Teil des Kortex dagegen hängt stark mit dem Hippokampus zusammen und die Verarbeitung von Informationen ist hier sprachabhängig. Van der Kolk (van der Kolk, McFarlane & Weisaeth 1996) hat festgestellt, dass die Aktivität des Brocaschen Zentrums, das in der linken Kortexhälfte angesiedelt ist und für den sprachlichen Ausdruck zuständig ist, während traumatischer Ereignisse ebenso wie der Hippokampus unterdrückt wird. In Momenten höchster Gefahr sind wir meist sprachlos, es fehlen die Worte oder der Sprechapparat ist so angespannt, dass es nur sehr mühsam ist, Worte herauszubringen. Diese oder ähnliche Reaktionen sind auch häufig, wenn Traumaenergie auftritt und deshalb ist die Kommunikation über die Empfindungsebene, das Machen von Angeboten etc. hier besonders wichtig. Man kann von einem traumatisierten Menschen gar nicht erwarten, dass er differenzierte klare Aussagen vielleicht auch noch in der zeitlich korrekten Reihenfolge macht. Dies ist nicht nur für die Therapie von Bedeutung, sondern auch bei Zeugenaussagen vor Gericht geht. Affektregulierung durch sichere Bindung Shore (1994) und Perry (1995) haben untersucht wie sehr die Entwicklung früher Bindung bei Kindern den Umgang mit belastenden Erlebnissen im gesamten weiteren Leben beeinflusst. Das Neugeborene ist nach der Geburt einer Flut von Reizen ausgesetzt auf die es erst nur schlecht vorbereitet ist, denn im Mutterleib sind diese stark gedämpft. Geräusche, Gerüche, Kälte, Hitze, Hunger, Durst oder Schmerz lösen eine große Menge intensiver Empfindungen aus und zunächst hilft die Mutter dem Kind, diese zu regulieren, indem sie das Kind in den Arm nimmt und beruhigt, es füttert usw. Diese Regulation findet vor allem durch Berührung und durch beruhigende Geräusche statt. Doch schon bald entwickeln Mutter und Kind ein Interaktionsmuster, das für die Affektregulierung von großer Bedeutung ist. Sie lernen auch durch Blickkontakt einander zu stimulieren und das Kind gewöhnt sich an immer höhere Grade der Stimulation und Erregung. Diese Entwicklung findet in der rechten Gehirnhälfte statt, der linke Kortex ist zu diesem Zeitpunkt noch unreif. Nach ca. einem Jahr verändert sich die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Das Kind beginnt zu krabbeln, später zu gehen, es wird unabhängiger. Auch die Rolle der Mutter verändert sich. Während sie im 1. Jahr vor allem für das Ernähren, beruhigen, bestätigen zuständig war, steuert sie nun auch die Sozialisation des Kindes, indem sie Grenzen setzt, „nein“ sagt und Missfallen ausdrückt. Wie Mutter und Kind mit dieser Veränderung fertig werden, hängt von 3 Faktoren ab: 1.) 2.) 3.) von der Tragfähigkeit der bereits entstandenen Bindung von der Fähigkeit der Mutter, das Kind auch zu lieben, wenn sie über sein Verhalten wütend ist ob die Mutter in der Lage ist auf angemessene Art und Weise Grenzen zu setzen Etwa um diese Zeit entwickelt sich die Sprechfähigkeit, das Kind beginnt seine sprachlichen Fähigkeiten zu nutzen, um Ereignisse zu beschreiben und seine emotionalen und sensorischen Erfahrungen zu verstehen. Frühe Vernachlässigung, Misshandlungen und Missbrauch, sowie Defizite in der Entwicklung einer Bindung sind für Perry u.a. ein wesentlicher Grund dafür, dass diese Menschen später mit Stress und traumatischen Ereignissen schlechter fertig werden als andere. Die verringerte Aktivität des Hippokampus könnte dafür die Ursache sein. Natürlich könnten PTBS auch bei Menschen mit einer glücklichen Kindheit entstehen und die frühe Kindheit ist nicht die einzige Chance, gesunde Bindungen zu entwickeln. 4 Langzeitstudien haben gezeigt, dass auch andere protektive Faktoren oder Ressourcen einen Ausgleich für in der frühen Kindheit Versäumtes schaffen können (Petzold 1993), wie z.B. Lehrer, Freunde, eine erfüllte Liebesbeziehung oder die sichere Bindung in einer therapeutischen Beziehung. Erinnerung und Trauma Das Gehirn verarbeitet Wahrnehmung und speichert sie als Gedanken, Emotionen, Bilder, Empfindungen und Verhaltensimpulse. Dafür sind mehrere Schritte notwendig: die Kodierung ist der Prozess der Einprägung von Information, die Speicherung entscheidet darüber wie und wie lange die Information bereit gehalten wird und die Reaktivierung macht die Information dem Bewusstsein wieder zugänglich. Je wichtiger eine Information ist und je stärker der mit ihr verbundene Affekt, umso eher wird sie gespeichert werden. Erst 1960 fingen Wissenschaftler an über die Existenz mehrerer Gedächtnissysteme zu spekulieren und man begann zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis zu unterscheiden. Ende der 80er Jahre setzte sich eine weitere Idee durch, nämlich die Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Gedächtnis. Normalerweise sprechen wir vom expliziten Gedächtnis: es speichert Fakten, Konzepte und Ideen, es ist von der sprachlichen Äußerung abhängig, es ermöglicht eine Rechenaufgabe zu lösen, von Ereignissen zu erzählen und aus Geschehnissen einen Sinn abzuleiten oder diese in einer zeitlich richtigen Abfolge einzuordnen. Man spekuliert derzeit darüber, ob die Entstehung von PTBS auch deshalb geschieht, weil die Speicherung eines traumatischen Ereignisses im expliziten Gedächtnis aus irgendeinem Grunde verhindert wird. Das implizite Gedächtnis kommt ohne Sprache aus, es speichert Verhaltensweisen und bleibt meist unbewusst. Ohne das implizite Gedächtnis wären alltägliche Dinge wie gehen, essen, Fahrrad fahren etc. nur äußerst mühsame Tätigkeiten, es ist für die Bewältigung des Alltags von großer Wichtigkeit. Allerdings ergeben sich Probleme, wenn es um das Erinnern von traumatischen Ereignissen geht, sofern diese nicht mit dem expliziten Gedächtnis verbunden sind. Es ist offenbar leichter, Trauma im impliziten Gedächtnis aufzuzeichnen, da die Amygdala nicht jenen Stresshormonen unterliegt wie der Hippokampus. Bei Trauma sind daher häufig belastende Körperempfindungen und verwirrende Verhaltensimpulse im impliziten Gedächtnis gespeichert, ohne dass zwischen ihnen und dem Kontext, in dem sie entstanden sind, Kontakt besteht. Aus diesem Grunde ist es in der Traumatherapie auch von äußerster Wichtigkeit, dass über die Dynamik und Wirkungsweise von Trauma informiert wird, weil dadurch auch ein besseres Verstehen der oft nicht nachvollziehbaren Reaktionen möglich wird. Viele PTBS treten ohne unmittelbaren Auslöser auf und dies macht wiederum große Angst, weil ein Gefühl der Hilflosigkeit oft die Folge ist. Darüber hinaus besteht ein Teil des impliziten Gedächtnisses aus Verhaltensweisen, die durch Konditionierung erlernt worden sind und sie bilden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Grundlage für Traumaauslöser (Trigger). Eine Uniform oder nur eine bestimmte Farbe können traumatischen Stress auslösen und sofern es keine Verbindung zum expliziten Gedächtnis gibt kann es zu ganzen Ketten konditionierter Stimuli kommen. Außerdem werden Verhaltensweisen auf vielfältigste Art auch durch operante Konditionierung beeinflusst: was erwünscht ist wird belohnt, diese Verhaltensweisen werden häufiger ausgeführt als solche, die unerwünscht sind. Wenn z.B. ein Kind dafür bestraft wurde, weil es selbstsicher seine Bedürfnisse einforderte, so wird dieser Mensch später mit hoher Wahrscheinlichkeit eher zurückhaltend sein in diesem Punkt und sollte sie mit einem Partner zusammen sein, der von ihr erwartet dass sie ihre Bedürfnisse auch ausdrückt, so kann dies zu großem Stress führen bis hin zur Panikattacke. Menschen, die in der Kindheit Misshandlungen ausgesetzt waren, können später wieder mit Gewalt in Kontakt kommen, weil ihre natürlichen Impulse sich zu schützen gelöscht worden sind. 5 Verhaltensweisen, die während traumatischer Ereignisse konditioniert wurden, scheinen jedenfalls beständiger zu sein als solche, die unter geringerem Stress entstanden sind. Schon das einmalige Scheitern oder die einmalige Bestrafung einer Überlebensstrategie während einer traumatischen Situation kann das betreffende Verhalten aus dem Repertoire eines Menschen löschen. Dies mag eine Erklärung dafür darstellen, warum Opfer von physischer oder psychischer Gewalt oft jahrelang in der traumatisierenden Situation bleiben. Auch zustandsabhängiges Erinnern spielt in Zusammenhang mit Trauma eine wichtige Rolle. Durch einen äußeren Trigger kann ein innerer Zustand erinnert werden, der mit einer traumatischen Situation verbunden ist und erinnert wird (Beschleunigung der Herzfrequenz, Atemnot etc). Auch eine bestimmte Körperhaltung kann zustandsbedingte Erinnerungen aktivieren. Dies wird in einigen Therapieformen auch als Interventionstechnik verwendet, bei traumatisierten Klienten sollte dies allerdings mit großer Behutsamkeit eingesetzt werden. Somatische Techniken zur Gewährleistung eines sicheren Verlaufs von Traumatherapien Duales Gewahrsein ist die Fähigkeit das Gewahrsein auf mehrere Erfahrungsaspekte gleichzeitig zu richten und Voraussetzung für die sichere Durchführung einer Traumaexposition. Es verhindert, dass sich zu starkes Arousal aufbaut und gewährleistet eine Situation unter Kontrolle zu halten. Die meisten von uns können die vielen inneren und äußeren Sinnesreize miteinander in Einklang bringen. Bauchschmerzen z.B. werden mit anderen zur Verfügung stehenden Informationen verbunden, dem Betroffenen fällt zum Beispiel ein, er hat zu viel gegessen. Bei PTBS wird den inneren Reizen unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit geschenkt. Empfindungen werden oft mit früheren Erlebnissen assoziiert, die aktuelle Situation wird aufgrund beschränkter Informationen beurteilt. Die inneren Reize stehen so sehr im Vordergrund, dass die Außenwahrnehmung eingeschränkt ist und der Ausgleich zwischen dem was wir im Körper empfinden und dem was wir außerhalb des Körpers wahrnehmen, entfällt. Die Folge können schwere Realitätsverzerrungen sein. Wird z.B. eine Empfindung mit dem Erleben von Gefahr assoziiert, so können ähnliche Empfindungen zu dem Schluss veranlassen, dass eine Gefahr in der Umgebung vorhanden sei. Reize und Informationen anderen Inhalts werden nicht beachtet, die Folge können Angst- und Panikzustände sein. Begriffe, die die Aufspaltung der Wahrnehmung innerer und äußerer Sinnnesreize beschreiben sind z.B. das erfahrende Selbst (experiencing self) und das beobachtende Selbst (observing self). Entwicklung dualen Gewahrseins ist notwendig für die Heilung von Trauma und für eine gefahrlose Durchführung einer Traumatherapie. Klienten müssen sich zumindest intellektuell im Klaren sein, dass ein Trauma der Vergangenheit angehört, selbst wenn es sich anders anfühlen mag. Das Risiko einer Retraumatisierung oder eines Ausbruchs von Flashbacks ist hoch, wenn ein Klient zu dualem Gewahrsein nicht in der Lage ist und man an einer traumatischen Erinnerung arbeitet. Erst durch die Entwicklung von dualem Gewahrsein kann sich der Klient mit einem Trauma auseinandersetzen und erkennen, dass es in seiner augenblicklichen realen Umgebung keine Gefahr gibt! 6 Nutzung des dualen Gewahrseins bei Panikattacken und Angstzuständen Durch Anerkennung beider Selbstanteile (erfahrendes und beobachtendes Selbst), können Klienten mit Situationen, in denen sie Gefahr laufen in Angst und Panik zu verfallen, fertig werden. Indem beide Anteile hörbar zum Ausdruck gebracht werden, erkennen Betroffene beide Realitäten an. Z.B: „ich empfinde hier starke Angst“ UND „ich bin im Augenblick in keiner echten Gefahr“ Dabei vergewissert sich der Klient, indem er sich umschaut und die reale Situation einschätzt. Die Konjunktion UND als Verbindungsglied ist dabei wichtig, ein ABER würde eine Negation der ersten Aussage beinhalten. Durch das Akzeptieren beider Perspektiven lässt sich Angst oft schnell verringern, wobei die Situation leicht eskaliert, wenn man jemandem lediglich vermittelt, es gäbe nichts, wovor man Angst zu haben bräuchte (Rothschild 2002). Anwendung des dualen Gewahrseins auf Flashbacks Flashbacks kann man nicht voraussagen, sie können überall und in jeder Situation (auch in der Therapiesituation) ausgelöst werden. Zunächst ist es wichtig, Klienten beizubringen, ihre Flashbacks zu stoppen, bzw. deren Ausbruch zu verhindern. Nachdem die Flaschbacks unter Kontrolle gebracht sind, kann man den Klienten mit den Ressourcen ausstatten, die er braucht, um die traumatischen Erinnerungen in verdaulichen Portionen, eine nach der anderen zu verarbeiten. Sollte ein Flashback während einer Therapiesituation auftreten, so ist es wichtig, das beobachtende Selbst des Klienten aufzuwecken. Klare, Autorität vermittelnde Aufforderungen des Therapeuten sind dabei unter Umständen notwendig. Z.B. „sehen Sie, wo Sie jetzt sind“ Folgendes Protokoll kann danach dem Klienten gegeben werden: Im Augenblick empfinde ich ....................(Emotion) und ich spüre in meinem Körper ...............(Empfindungen, mindestens 3) weil ich mich erinnere an ...................(Art des Traumas, keine Einzelheiten) Gleichzeitig sehe ich mich um und stelle fest, wo ich jetzt bin im Jahr........... hier in ................(Ort) und ich sehe .................(einige Dinge an diesem Ort beschreiben) und deshalb weiß ich dass ......................(Art des Traumas) jetzt nicht/ nicht mehr geschieht. Durch das Protokoll soll es gelingen, die Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen (Rothschild 2002). Tonisieren von Muskeln kann bei PTBS von Vorteil sein, weil durch die Kräftigung der Muskulatur das Erlebnis im Körper zu sein, verstärkt wird. Gezieltes Muskeltraining ist ebenso wertvoll wie bestimmte sportliche Betätigung (joggen, walken, Fahrrad fahren etc.) 7 Entspannungsübungen sind mit Vorsicht zu genießen, sie können bei PTBS leicht eine Traumasituation, Hyperarousal und sogar Flashbacks auslösen. Dagegen können Entspannungsübungen in Verbindung mit Körpergewahrsein zu einer stärkeren Erdung führen und so gesehen auch wieder Ressource sein. Ich habe auch mit bestimmten Übungen aus dem Qigong gute Erfahrungen, vor allem mit solchen wo es um die Stabilität des Körpers geht und wobei die innere Aufrichtung gefördert wird. Körpergrenzen Interpersonelle Grenzen beschreiben den Punkt an dem die Distanz zu einem anderen Menschen vom Angenehmen ins Unangenehme kippt. Im Tierverhalten spricht man von kritischer Distanz, dem Punkt wo ein Tier von vorsichtiger Wachsamkeit zum Angriff wechselt. Der genaue Verlauf einer interpersonalen Grenze hängt nicht nur von der Person, sondern auch von der Situation ab. Was in einer bestimmten Situation mit einer bestimmten Person als angenehm empfunden wird, kann zu einem anderen Zeitpunkt und mit einer anderen Person als sehr unangenehm erlebt werden. Auch die richtige Distanz in der Therapie ist ein wichtiger Faktor für einen erfolgreichen Verlauf. Auch hier gibt es keine konstanten Grenzen, es ist bei jedem Klienten darauf zu achten, dass der Abstand zum Therapeuten passt. Bewährt hat sich, Klienten hinspüren zu lassen und die Stühle so zu stellen, dass die Grenzen leicht verändert werden können. Die Haut als konkrete Grenze Traumata entstehen oft durch Ereignisse bei denen der Körper angegriffen und seine Grenzen verletzt wurden. Indem das Empfinden der Haut als Grenze wieder hergestellt wird, lässt sich Hyperarousal verringern und Kontrolle über den eigenen Körper verstärken. Der Klient nimmt dafür Kontakt zu verschiedenen Körperteilen auf und spürt dabei seine Empfindungen. Dies kann durch halten, reiben etc. geschehen oder aber indem der Klient Kontakt zu den Objekten herstellt, die den Körper berühren (Kleider, Stuhl, Schuhe) Kann bei „dünnhäutigen“ Klienten sehr hilfreich sein, weil dadurch die Körpergrenzen wieder klar werden. Visuelle Grenzen Für manche Klienten stellt es eine große Herausforderung dar, sich vom Therapeuten beobachten zu lassen und kann zu heftigen Reaktionen führen und Schamgefühle auslösen. In diesem Fall ist es hilfreich für die Klienten, wenn die Therapeutin diese Grenze wahrt, indem sie sich wegdreht und so den Klienten Erleichterung verschafft. Übertragung und Gegenübertragung „Zwei Erwachsene arbeiten zusammen an den Resten verbliebener Kindlichkeit“ (Fürstenau). In der Traumatherapie kommt dem Arbeitsbündnis und der Arbeitsbeziehung große Bedeutung zu. Der Therapeut und die erwachsenen Anteile der Patienten arbeiten zusammen, sodass die erwachsenen Anteile lernen können, sich um abgespaltene oder verletzte Anteile (innere Kinder) zu kümmern. Übertragungsverzerrungen werden sofort benannt und abgebaut und die Therapeutin tut alles, um den Klienten ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Die Vergangenheit von der Gegenwart trennen Dies ist das Hauptziel jeder Traumatherapie und eine wesentliche Erfahrung für die Klienten. Sätze wie „die Gefahr ist vorbei“, „Sie haben überlebt“, „Sie sind jetzt sicher“ können dabei wertvoll sein. Wenn ein Klient in der Traumatherapie erfahen kann, dass ein Ereignis in der Vergangenheit liegt, ist dies immer mit großer Erleichterung verbunden. 8 Von besonderer Wichtigkeit ist auch die unmittelbare Zeit nach der traumatischen Situation, die Qualität der Hilfe und des Kontakts zur Umwelt haben großen Einfluss auf die Art und Stärke der Nachwirkungen. Die Reaktionen der Umwelt nach einem traumatischen Ereignis können sogar belastender für den Betroffenen sein als das Trauma selbst. In der Arbeit ist es daher ratsam zuerst die Probleme, die nach der traumatischen Situation aufgetreten sind, zu bearbeiten. Verbindung des Impliziten und Expliziten Durch PTBS werden implizit erinnerte Bilder, Emotionen, somatische Empfindungen und Verhaltensweisen von explizit gespeicherten Fakten und Bedeutungen der traumatischen Ereignisse getrennt, egal ob eine bewusste Erinnerung daran existiert oder nicht. Trauma zu heilen erfordert, alle Aspekte eines traumatischen Ereignisses miteinander zu verbinden. Nur durch die Verbindung des Impliziten und des Expliziten kann eine zusammenhängende Beschreibung jener Ereignisse entstehen, und nur so wird es möglich, diese in der Vergangenheit des Klienten an der richtigen Stelle einzuordnen. Implizit kodierte Empfindungen, Emotionen und Verhaltensweisen im Kontext der traumatischen Erinnerung zu verstehen, ist ein wichtiger Bestandteil des Heilungsprozesses. Man muss sich dabei mit dem befassen, was sich im Körper manifestiert und mit Hilfe von Worten das Erlebte beschreiben und ihm einen Sinn geben. Letztendlich muss den Klienten geholfen werden, Denken und Fühlen zu synchronisieren. So kann ein kohärentes Narrativ des traumatischen Ereignisses entstehen und dieses an den ihm zustehenden Platz in der Vergangenheit des Klienten rücken. Literatur Rothschild, Babette (2002): Der Körper erinnert sich. Die Psychophysiologie des Traumas und der Traumabehandlung. Reddemann, Luise (2001): Imagination als heilsame Kraft. Zur behandlung von Traumafolgen mit ressourcenorientierten Verfahren. Levine, Peter (1998): Trauma-Heilung. Das Erwachen der Tigers. Unsere Fähigkeit traumatische Erfahrungen zu transformieren. Levine, Peter und Klein, Maggie (2005): Verwundete Kinderseelen heilen. Wie Kinder und Jugendliche traumatische Erlebnisse überwinden können. Huber, Michaela (2004): Wege der Trauma-Behandlung. Herman, Judith (2003): Die Narben der Gewalt. Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden. Sachsse, Ulrich, Ozkan, Ibrahim, Streek-Fischer, Annette (2002): Traumatherapie – Was ist erfolgreich? Bessel van der Kolk, Alexander Mc Farlane Lars Weisaeth (2000): Traumatic Stress. Grundlagen und Behandlungsansätze. Theorie, Praxis und Forschung zu posttraumatischem Stress sowie Traumatherapie. Bauer, Joachim (2005): Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone. Petzold, Hilarion (1993): Frühe Schädigungen - späte Folgen? 9