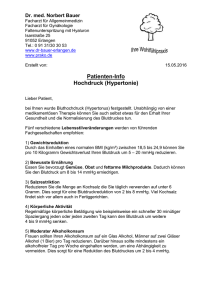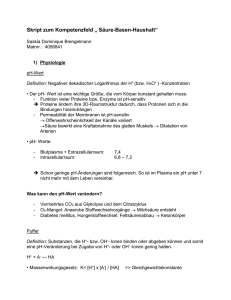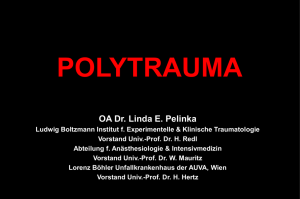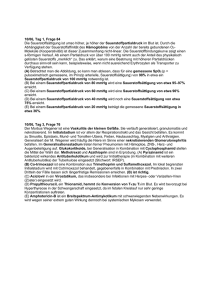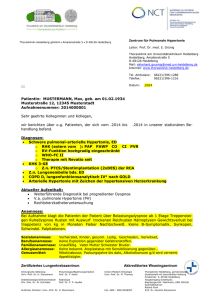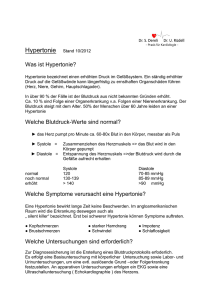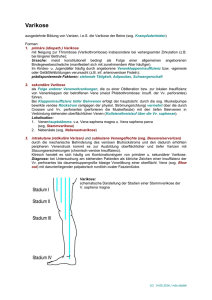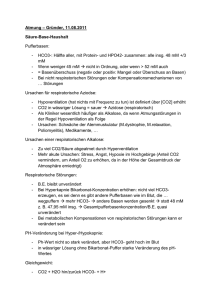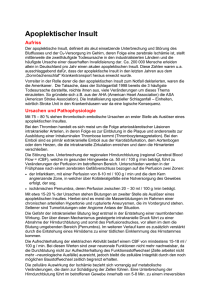Punktion der A. radialis und Blutgasanalyse
Werbung
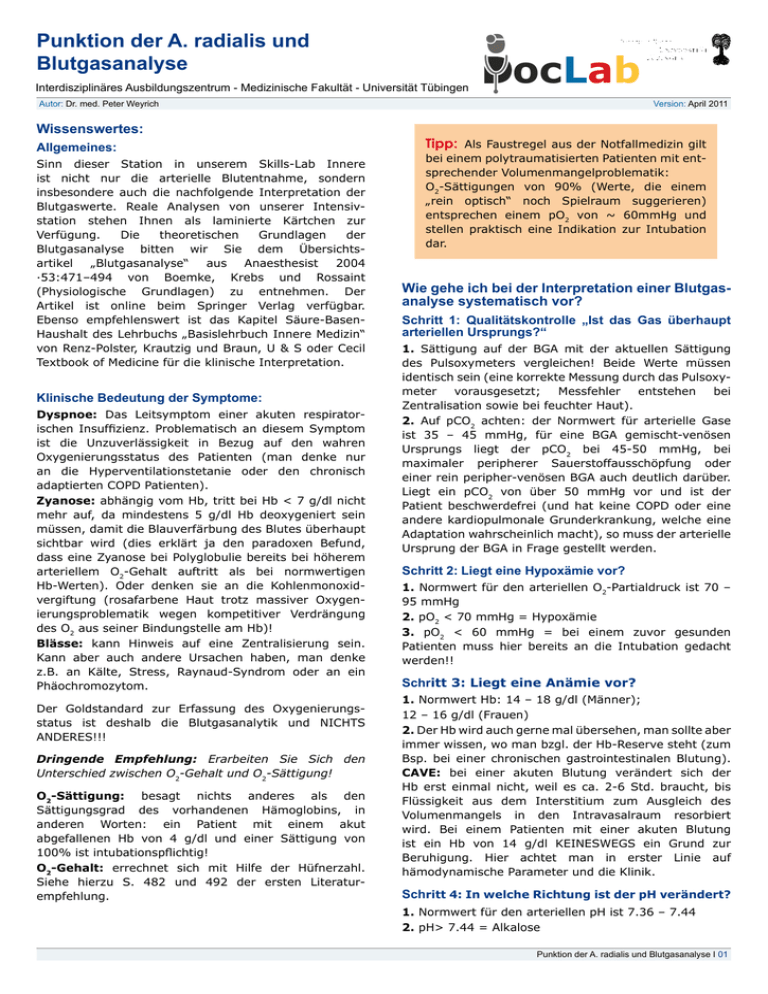
Punktion der A. radialis und Blutgasanalyse Interdisziplinäres Ausbildungszentrum - Medizinische Fakultät - Universität Tübingen Autor: Dr. med. Peter Weyrich Wissenswertes: Allgemeines: Sinn dieser Station in unserem Skills-Lab Innere ist nicht nur die arterielle Blutentnahme, sondern insbesondere auch die nachfolgende Interpretation der Blutgaswerte. Reale Analysen von unserer Intensivstation stehen Ihnen als laminierte Kärtchen zur Verfügung. Die theoretischen Grundlagen der Blutgasanalyse bitten wir Sie dem Übersichtsartikel „Blutgasanalyse“ aus Anaesthesist 2004 ·53:471–494 von Boemke, Krebs und Rossaint (Physiologische Grundlagen) zu entnehmen. Der Artikel ist online beim Springer Verlag verfügbar. Ebenso empfehlenswert ist das Kapitel Säure-BasenHaushalt des Lehrbuchs „Basislehrbuch Innere Medizin“ von Renz-Polster, Krautzig und Braun, U & S oder Cecil Textbook of Medicine für die klinische Interpretation. Klinische Bedeutung der Symptome: Dyspnoe: Das Leitsymptom einer akuten respiratorischen Insuffizienz. Problematisch an diesem Symptom ist die Unzuverlässigkeit in Bezug auf den wahren Oxygenierungsstatus des Patienten (man denke nur an die Hyperventilationstetanie oder den chronisch adaptierten COPD Patienten). Zyanose: abhängig vom Hb, tritt bei Hb < 7 g/dl nicht mehr auf, da mindestens 5 g/dl Hb deoxygeniert sein müssen, damit die Blauverfärbung des Blutes überhaupt sichtbar wird (dies erklärt ja den paradoxen Befund, dass eine Zyanose bei Polyglobulie bereits bei höherem arteriellem O2-Gehalt auftritt als bei normwertigen Hb-Werten). Oder denken sie an die Kohlenmonoxidvergiftung (rosafarbene Haut trotz massiver Oxygenierungsproblematik wegen kompetitiver Verdrängung des O2 aus seiner Bindungstelle am Hb)! Blässe: kann Hinweis auf eine Zentralisierung sein. Kann aber auch andere Ursachen haben, man denke z.B. an Kälte, Stress, Raynaud-Syndrom oder an ein Phäochromozytom. Der Goldstandard zur Erfassung des Oxygenierungsstatus ist deshalb die Blutgasanalytik und NICHTS ANDERES!!! Dringende Empfehlung: Erarbeiten Sie Sich den Unterschied zwischen O2-Gehalt und O2-Sättigung! O2-Sättigung: besagt nichts anderes als den Sättigungsgrad des vorhandenen Hämoglobins, in anderen Worten: ein Patient mit einem akut abgefallenen Hb von 4 g/dl und einer Sättigung von 100% ist intubationspflichtig! O2-Gehalt: errechnet sich mit Hilfe der Hüfnerzahl. Siehe hierzu S. 482 und 492 der ersten Literaturempfehlung. Version: April 2011 Tipp: Als Faustregel aus der Notfallmedizin gilt bei einem polytraumatisierten Patienten mit entsprechender Volumenmangelproblematik: O2-Sättigungen von 90% (Werte, die einem „rein optisch“ noch Spielraum suggerieren) entsprechen einem pO2 von ~ 60mmHg und stellen praktisch eine Indikation zur Intubation dar. Wie gehe ich bei der Interpretation einer Blutgasanalyse systematisch vor? Schritt 1: Qualitätskontrolle „Ist das Gas überhaupt arteriellen Ursprungs?“ 1. Sättigung auf der BGA mit der aktuellen Sättigung des Pulsoxymeters vergleichen! Beide Werte müssen identisch sein (eine korrekte Messung durch das Pulsoxymeter vorausgesetzt; Messfehler entstehen bei Zentralisation sowie bei feuchter Haut). 2. Auf pCO2 achten: der Normwert für arterielle Gase ist 35 – 45 mmHg, für eine BGA gemischt-venösen Ursprungs liegt der pCO2 bei 45-50 mmHg, bei maximaler peripherer Sauerstoffausschöpfung oder einer rein peripher-venösen BGA auch deutlich darüber. Liegt ein pCO2 von über 50 mmHg vor und ist der Patient beschwerdefrei (und hat keine COPD oder eine andere kardiopulmonale Grunderkrankung, welche eine Adaptation wahrscheinlich macht), so muss der arterielle Ursprung der BGA in Frage gestellt werden. Schritt 2: Liegt eine Hypoxämie vor? 1. Normwert für den arteriellen O2-Partialdruck ist 70 – 95 mmHg 2. pO2 < 70 mmHg = Hypoxämie 3. pO2 < 60 mmHg = bei einem zuvor gesunden Patienten muss hier bereits an die Intubation gedacht werden!! Schritt 3: Liegt eine Anämie vor? 1. Normwert Hb: 14 – 18 g/dl (Männer); 12 – 16 g/dl (Frauen) 2. Der Hb wird auch gerne mal übersehen, man sollte aber immer wissen, wo man bzgl. der Hb-Reserve steht (zum Bsp. bei einer chronischen gastrointestinalen Blutung). CAVE: bei einer akuten Blutung verändert sich der Hb erst einmal nicht, weil es ca. 2-6 Std. braucht, bis Flüssigkeit aus dem Interstitium zum Ausgleich des Volumenmangels in den Intravasalraum resorbiert wird. Bei einem Patienten mit einer akuten Blutung ist ein Hb von 14 g/dl KEINESWEGS ein Grund zur Beruhigung. Hier achtet man in erster Linie auf hämodynamische Parameter und die Klinik. Schritt 4: In welche Richtung ist der pH verändert? 1. Normwert für den arteriellen pH ist 7.36 – 7.44 2. pH> 7.44 = Alkalose Punktion der A. radialis und Blutgasanalyse I 01 Punktion der A. radialis und Blutgasanalyse 3. pH < 7.36 = Azidose CAVE: ein normaler pH-Wert schließt das Vorhandensein einer Alkalose/Azidose keinesfalls aus, denn diese kann jeweils kompensiert vorliegen. Schritt 5: In welcher Richtung ist der pCO2 verändert? 1. Normwert arterieller pCO2: 35 – 45 mmHg 2. pCO2 > 45 mmHg: Hyperkapnie 3. pCO2 < 35 mmHg: Hypokapnie Schritt 6: Ist der pCO2 gleichsinnig oder entgegen dem pH verändert? 1. Merkformel „metabolisch miteinander“, d.h. wenn pH und pCO2 gleichsinnig verändert sind, so spricht dies für eine metabolische Genese der Säure-Basen-Störung. 2. Bsp: metabolische Azidose: pH < 7.36, pCO2 kompensatorisch erniedrigt (Organismus versucht, saure Äquivalente abzuatmen und den pH dadurch wieder anzuheben) 3. Bsp: metabolische Alkalose: pH > 7.44, pCO2 kompensatorisch erhöht (Organismus versucht, durch Hypoventilation und damit CO2-Retention der Alkalose gegenzusteuern) 4. Ist der pCO2 hingegen entgegen dem pH-Wert verändert, so spricht dies für das Vorliegen einer respiratorischen Störung des Säure-Basen-Haushalts. Beispiel 1: pH < 7.36 = Azidose, pCO2 > 45 mmHg = ungleichsinnig wie pH = respiratorische Azidose, HCO3aber nicht kompensatorisch erhöht, sondern erniedrigt oder normal niedrig. Beispiel 2: pH > 7.44 = Alkalose, pCO2 < 35 mmHg oder normal niedrig = respiratorische Alkalose, HCO3aber nicht kompensatorisch erniedrigt, sondern erhöht. Auf einen Blick: Normwerte der BGA • arterieller pH-Wert: 7.36 – 7.44 • arterieller pO2: 70 – 95 mmHg • arterieller pCO2: 35 – 45 mmHg • venöser pH-Wert: 7.31 – 7.41 • venöser pO2: 33- 53 mmHg • venöser pCO2: 45 – 50 mmHg Schritt 7: Ist die Anionenlücke erhöht? 1. Normwert der Anionenlücke: 10 – 18 mmol/l (manche Lehrbücher: 10 – 16mmol/l) 2. Formel der Anionenlücke: Natrium – Bikarbonat – Chlorid (Na+ - HCO3- - Cl-) 3. Was besagt die Anionenlücke? Die Anionenlücke dient zur Differentialdiagnostik bei metabolischen Azidosen. Diese können einerseits durch mangelnde Ausscheidung von Protonen (akutes und chronisches Nierenversagen, sogenannte Retentionsazidosen) Verlust an Bikarbonat (meist bei Diarrhöe, (selten) renal tubuläre Azidose, sogenannte Subtraktionsazidosen) entstehen, andererseits durch Anfall von Säureaquivalenten (Ketoazidose, Laktatazidose, Intoxikation mit Salizylaten, sogenannte Additionsazidosen). Bei letzteren (Additionsazidosen) vergrößert sich die Anionenlücke, da negativ geladene Säureaquivalente diese Lücke ausfüllen 4. Anionenlücke > 18 mmol/l = es liegt eine Additionsazidose vor! 5. Vorgehen bei erhöhter Anionenlücke: · ist das Laktat erhöht? = Laktatazidose · Sind Ketonkörper im Urin nachweisbar, oder ist der Blutzucker deutlich erhöht? = Ketoazidose · keiner der Parameter erhöht: z. B. Verdacht auf Intoxikation mit Salizylaten Schritt 8: Liegt möglicherweise eine gemischte Störung vor? 1. An eine gemischte Störung mit sowohl metabolischer und respiratorischer Komponente muss immer gedacht werden! 2. Eine gemischt Störung liegt immer dann vor, wenn Standardbikarbonat und pCO2 im gleichen „Stoffwechselsinne“ wie der pH verändert sind. Herausgeber: DocLab Universitätsklinikum Tübingen Elfriede-Aulhorn-Straße 10 72076 Tübingen Lern- u. Lehrgebäude E-Mail: [email protected] Internet: www.doc-lab.de Autor: PD Dr. med. Peter Weyrich Fotos & Layout: Malte Bongers Punktion der A. radialis und Blutgasanalyse I 02