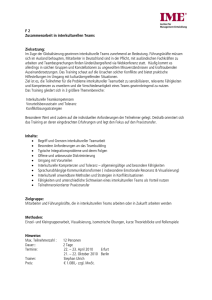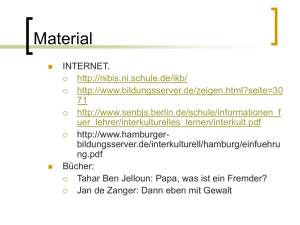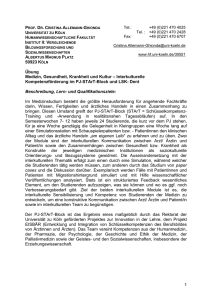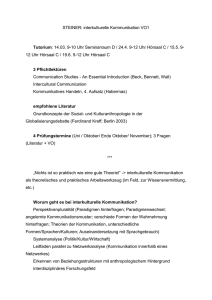Diese PDF-Datei herunterladen
Werbung

jahr 2013 jahrgang 12 ausgabe 21 interculture j ourna l herausgeber jürgen bolten stefanie rathje url interculture-journal.com Online-Zeitschrift für interkulturelle Studien Hermeneutische Zugänge der Interkulturalitätsforschung Hermeneutic Approaches to Intercultural Research Ram Adhar Mall Hermeneutik der Überlappung jenseits der Identität und Differenz Overlapping Hermeneutics beyond Identity and Difference Philipp Altmann Die Interkulturalität als politischer Begriff in Ecuador Interculturality as a political concept in Ecuador Manfred Riegger Empathische Wahrnehmung des kulturell Fremden. Neun Konstruktionsmuster und deren Bedeutung für interkulturelle Bildungsprozesse Empathic perception of the culturally unknown. Nine patterns of construction and their meaning for educational processes Joe Terantino, Claudia Stura, Sabine H. Smith, Jeannette Böttcher Integrating Intercultural Communicative Competence into the curriculum of a department of Foreign Languages: An Exploratory Case Study Die Integration von interkultureller Kommunikationskompetenz in das Curriculum eines Institutes für Fremdsprachen: Eine explorative Fallstudie Yaling Pan Auslandsstudienaufenthalt als Chance zur Förderung interkultureller Kompetenz - Eine empirische Untersuchung chinesischer Studierenden in Deutschland Study abroad as an opportunity to develop intercultural competence – An empirical study of Chinese students in Germany herausgeber jürgen bolten (jena) stefanie rathje (berlin) wissenschaftlicher beirat rüdiger ahrens (würzburg) manfred bayer (danzig) darla deardorff (durham) klaus p. hansen (passau) jürgen henze (berlin) bernd müller-jacquier (bayreuth) alois moosmüller (münchen) alexander thomas (regensburg) yaling pan (peking) chefredaktion mario schulz editing diana krieg kontakt fachgebiet interkulturelle wirtschaftskommunikation (iwk) universität jena ernst-abbe-platz 8 07743 jena [email protected] bibliografische Information der deutschen nationalbibliothek die deutsche nationalbibliothek verzeichnet diese publikation in der deutschen nationalbibliografie; detaillierte bibliografische daten sind im internet über dnb.d-nb.de abrufbar. copyright interculture jo urna l steht unter einer creative commons attribution 3.0 license. verlag wissenschaftlicher verlag berlin. wvberlin.com druck: digitaler buchdruck sdl, berlin, printed in germany preis printausgabe: EUR 22,abo: EUR 18,- pro heft bezug / abonnement direkt über den verlag: wvberlin.com/icj/ issn online: 2196-9485 print: 2196-3363 url interculture-journal.com open access interculture journa l steht als open access publikation kostenfrei unter interculture-journal.com zur verfügung unterstützt von // supported by i n ha l t content Vorwort der Herausgeber Editorial 7 Stefanie Rathje, Jürgen Bolten Vorwort der Herausgeber Editorial Artikel Articles 11 Ram Adhar Mall Hermeneutik der Überlappung jenseits der Identität und Differenz Overlapping Hermeneutics beyond Identity and Difference 33 Philipp Altmann Die Interkulturalität als politischer Begriff in Ecuador Interculturality as a political concept in Ecuador 45 Manfred Riegger Empathische Wahrnehmung des kulturell Fremden. Neun Konstruktionsmuster und deren Bedeutung für interkulturelle Bildungsprozesse Empathic perception of the culturally unknown. Nine patterns of construction and their meaning for educational processes 59 Joe Terantino, Claudia Stura, Sabine H. Smith, Jeannette Böttcher Integrating Intercultural Communicative Competence into the curriculum of a department of Foreign Languages: An Exploratory Case Study Die Integration von interkultureller Kommunikationskompetenz in das Curriculum eines Institutes für Fremdsprachen: Eine explorative Fallstudie 71 Yaling Pan Auslandsstudienaufenthalt als Chance zur Förderung interkultureller Kompetenz – Eine empirische Untersuchung chinesischer Studierenden in Deutschland Study abroad as an opportunity to develop intercultural competence – An empirical study of Chinese students in Germany i n ha l t Rezensionen Reviews content 81 Alexandra Stang 83 Luciole Sauviat 87 Viola Strittmatter Reutner, Ursula (2012): Von der digitalen zur interkulturellen Revolution Schmidt, Judith / Keßler, Sandra / Simon, Michael (2012): Interkulturalität und Alltag. Mainzer Beiträge zur Kulturanthropologie / Volkskunde Berninghausen, Jutta (2012): Ausseneinsichten. Interkulturelle Fallbeispiele von deutschen und internationalen Studierenden über das Auslandsjahr 6 interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Vorwort der Herausgeber Editorial Stefanie Rathje Vorwort der Herausgeber Professorin für Unternehmensführung und Kommunikation, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) Die 21. Ausgabe von interculture j o urna l beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit hermeneutischen Zugängen aus verschiedenen Bereichen der Interkulturalitätsforschung. Jürgen Bolten Professor für Interkulturelle Wirtschaftskommunikation an der Friedrich-SchillerUniversität Jena Im ersten Beitrag „Hermeneutik der Überlappung jenseits der Identität und Differenz“ setzt sich der Philosoph Ram Adhar Mall mit den beiden Konzepten Identität und Differenz für das Verstehen oder die Kommunikation zwischen Kulturen und Philosophien auseinander. Zur Überwindung der konträren Ansätze Identität und Differenz schlägt Mall das Konzept der überlappenden Hermeneutik vor. Der zweite Beitrag von Philipp Altmann geht der Frage nach, ob das lateinamerikanische Land Ecuador ein „interkultureller“ Staat sei, wie es laut Verfassung im Art. 1 festgeschrieben ist. Hierzu beleuchtet Altmann den Begriff Interkulturalität und seine Geschichte und Entwicklung in Ecuador. Er geht dabei der Frage nach, was genau unter Interkulturalität verstanden wird, wovon dieser Begriff sich abgrenzt und wie sich die verschiedenen Organisationen einen interkulturellen Staat bzw. eine interkulturelle Gesellschaft vorstellen. Im dritten Beitrag setzt sich Manfred Riegger mit Konstruktionsmustern und deren Bedeutung für interkulturelle Bildungsprozesse mit Hilfe des Vierevidenzquellenmodells auseinander. Ziel des Modells ist es, mögliche (Miss-) Verständnisse der fremden Kultur und Religion zu benennen, und zu klären, wie Menschen mit den Differenzen zwischen eigener und fremder Kultur und Religion umgehen, um daraus Schlussfolgerungen für pädagogische Bildungsprozesse abzuleiten. Der vierte Beitrag von Joe Terantino, Claudia Stura, Sabine H. Smith und Jeannette Böttcher beschreibt anhand einer explorativen Fallstudie die Integration von Interkultureller Kommunikationskompetenz in das Curriculum eines Institutes für Fremdsprachen. Im letzten Beitrag setzt sich Yaling Pan mit Hilfe einer empirischen Untersuchung von chinesischen Studenten in Deutschland mit der Frage auseinander, welche Chancen ein Auslandsstudienaufenthalt zur Förderung von Interkultureller Kompetenz bieten kann. Geleitet von Theorien interkultureller Kommunikation, werden Empfehlungen zur interkulturellen Vorbereitung chinesischer Studierenden auf ihren Deutschlandaufenthalt gegeben, damit sie während des Aufenthaltes ihre interkulturelle Kompetenz bewusster und effizienter fördern können. 7 Die Ausgabe wird wieder ergänzt durch zahlreiche Rezensionen aus dem interkulturellen Bereich. Alexandra Stang rezensiert das Buch „Von der digitalen zur interkulturellen Revolution“ von Ursula Reutner. Luciole Sauviat rezensiert den von Judith Schmidt, Sandra Keßler und Michael Simon, herausgegebenen Sammelband „Interkulturalität und Alltag. Mainzer Beiträge zur Kulturanthropologie / Volkskunde“. Viola Strittmatter setzt sich abschließend mit dem Buch „Ausseneinsichten. Interkulturelle Fallbeispiele von deutschen und internationalen Studierenden über das Auslandsjahr“ von Jutta Berninghausen auseinander. Die Herausgeber bedanken sich an dieser Stelle bei allen Autorinnen und Autoren und freuen sich auf zahlreiche weitere Beiträge für zukünftige Ausgaben des interculture j ourna l . Beachten Sie hierzu bitte den Open Call auf unserer Webseite im Bereich Mitteilungen. Stefanie Rathje (Berlin) und Jürgen Bolten (Jena) im Oktober 2013 8 interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Editorial The 21th edition of interculture j o urna l deals with the topic of hermeneutic approaches to research in intercultural communication. The central article of this issue, “Overlapping Hermeneutics beyond Identity and Difference” by the philosopher Ram Adhar Mall addresses the significance of the two concepts of identity and difference for an understanding between cultures and philosophies. To overcome the opposition of identity and difference, Mall proposes the concept of overlapping hermeneutics. The second article by Philipp Altmann examines the question whether the Latin American country Ecuador really is an “intercultural” state as codified by the Ecuardorian constitution. Altmann traces the development and the history of the idea of interculturality in Ecuador to clarify how it is understood and how different institutions envision a intercultural country, or an intercultural society. Manfred Riegger explores processes of construction and their meaning for intercultural education with the help of the model of four sources of evidence. The model aims at identifying potential misunderstandings toward a foreign culture or religion and clarifying how people deal with differences between the own and the other to draw conclusions for pedagogic education processes. tural competence in a more conscious and focused way. As always, this edition is complemented by numerous reviews of publications in the field of intercultural studies. Alexandra Stang reviews the book “Von der digitalen zur interkulturellen Revolution” by Ursula Reutner. Luciole Sauviat provides a write-up of on the anthology “Interkulturalität und Alltag. Mainzer Beiträge zur Kulturanthropologie / Volkskunde” edited by Judith Schmidt, Sandra Keßler und Michael Simon. Viola Strittmatter deals with the book “Ausseneinsichten. Interkulturelle Fallbeispiele von deutschen und internationalen Studierenden über das Auslandsjahr” by Jutta Berninghausen. The editors would like to thank all authors for their contributions to this issue and strongly encourage new authors to submit their manuscripts for future publication in interculture j o urna l . Please consider our open call on www. interculture-journal.com under Announcements. Stefanie Rathje (Berlin) and Jürgen Bolten (Jena), October 2013 The fourth paper by Joe Terantino, Claudia Stura, Sabine Smith, and Jeannette Böttcher describes ways of how to integrate intercultural communication competence into the curriculum of a foreign language institute using an explorative case study approach. The concluding article by Yaling Pan presents the results of an empirical study of Chinese students in Germany and underlines the importance of studying abroad for increasing intercultural competence. Based on theories of intercultural communication, she develops recommendations to prepare Chinese students so that during their stay in Germany they can strengthen their intercul- 9 10 interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Hermeneutik der Überlappung jenseits der Identität und Differenz Overlapping Hermeneutics beyond Identity and Difference Ram Adhar Mall Abstract (Deutsch) Prof. i. R. Dr. Die grundlegende These des Artikels lautet, dass weder eine totale Identität, noch eine radikale Differenz für das Verstehen oder die Kommunikation zwischen Kulturen, Philosophien etc. wesentlich ist. Identität und Differenz sind zentrale Fragen der Philosophie. Der Artikel schlägt eine Vermittlung der konträren Ansätze vor, indem die Logik der Überlappung jenseits einer Logik der Identität und Differenz eingeführt wird. Diese These untermauernd, wird das Konzept einer überlappenden Hermeneutik vorgestellt, die sowohl Wittgensteins These der Familienähnlichkeit als auch die Polyperspektivität der indischen Schule der Jaina Philosophie zum Vorbild hat. Der Artikel ist mit freundlicher Unterstützung durch Tony Pacyna (Universität Zürich) entstanden In einem zweiten Schritt wird das Konzept der analogischen Hermeneutik vorgestellt, das weder Identität noch Differenz beinhaltet, und somit eine unerlässliche Rolle für Kompromisse jenseits des totalen Konsens und der radikalen Differenz spielt. Eine solche Hermeneutik unterliegt der Überzeugung, dass der Wunsch zu verstehen und der Wunsch, verstanden zu werden, Hand in Hand gehen, und die zwei Seiten einer hermeneutischen Medaille repräsentieren. Die Frage lautet nicht, wie man Differenzen beseitigen kann, sondern wie man damit umgehen lernt. Am Ende werden abschließend tentative Imperative im Sinne einer interkulturell orientierten Philosophie formuliert. Schlagwörter: Interkulturelle Philosophie, analogische Hermeneutik, Identität, Differenz, Überlappung Abstract (English) The central thesis here is the following: Neither the idea of total identity nor of radical difference is conducive to understanding nor communication among cultures, philosophies etc. The problem of identity and of difference has been a central question for philosophy. The paper proposes mediation between the two opposing camps by introducing the concept of a logic of overlaps beyond the logic of identity and difference. In order to substantiate this, the concept of an overlapping hermeneutics is introduced very much in the spirit of Wittgensteinian thesis of family resemblance and in the spirit of the polyperspectivism of the Indian school of Jaina philosophy. 11 Another central concept, introduced here is the concept of an analogous hermeneutics, which essentializes neither identity nor difference, thus pleading for the vital role played by compromise beyond total consensus and radical dissens. Such a hermeneutics underlies the conviction that the desire to understand and the desire to be understood goes hand in hand and represent the two sides of the same hermeneutic coin. The question is not how to get rid of differences but how to deal with them. In the end a few tentative imperatives are formulated in the spirit of an intercultural oriented philosophy. Keywords: Intercultural philosophy, analogical hermeneutics, identity, difference, overlapping 1. Ein Wort Zuvor Heine spricht in Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland von „der komischen Seite unserer Philosophen“, die „beständig über Nichtverstandenwerden“ (Heine 1997:108) klagen. Als der Kantianer Karl Reinhold Fichte einmal sagte, dass er, Reinhold mit ihm, Fichte, gleicher Meinung sei, soll Fichte ihm gesagt haben, niemand verstehe ihn (Fichte) besser als er (Reinhold). Ist dies nicht eine Art Hermeneutik der Identität? Als Reinhold jedoch einige Jahre später mit Fichte nicht übereinstimmte, sagte Fichte, er (Reinhold) habe ihn nie richtig verstanden. Ist dies nicht eine Art Hermeneutik der Differenz? Mit anderen Worten: Identität = verstehen, Differenz = nichtverstehen? Ein solches hermeneutisches Motto ist viel zu handlich und simpel, um der ungeheuren Komplexität des hermeneutischen Unternehmens gerecht zu werden. Lässt man auf das hermeneutische Anliegen hin die Philosophiegeschichte Revue passieren, so stellt man empirisch belegt fest, dass die Geschichte der Philosophie selbst ein unerschöpflicher hermeneutischer Ort ist, mit der Botschaft, es gibt weder den einen absoluten Text noch die eine absolute Interpretation. Und die These von einer Keuschheit der Bedeutung ist ein selbstverschuldeter Anspruch, die fast jeder erhebt, aber keiner erreicht. Die beiden Kategorien – Identität und Differenz – zählen zu den Großphänomenen der Philosophiegeschichte. Sie spielen eine zentrale Rolle angefangen von der Ontologie, Metaphysik, Logik 12 bis zur Anthropologie und Religionsphilosophie. Die Befürworter und Gegner haben sich gegenseitig bis heute rein philosophisch argumentativ nicht überzeugen können. Könnte es sein, dass in einem tieferen Sinne die Präferenzen für diese oder jene Position den Argumenten vorausgehen? Mit anderen Worten sind Argumente qua Argumente zwar eine notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung für die Überzeugung?1 Die fast unübersichtliche Verflechtung kann und soll nicht das Thema dieses Beitrags sein, sondern betrifft nur die hermeneutische Dimension dieser Kategorien. Die hier vorgeschlagene Konzeption einer Hermeneutik der Überlappung jenseits von Identität und Differenz ist integrativ, und befürwortet einen ontologischen, methodologischen und logischen Pluralismus, orientiert sich jedoch empiristisch-phänomenologisch. Es kommt fast einer protophilosophischen Sünde gleich, wenn man absolut exklusivistische und aprioristische Festlegungen dem konkreten Akt des Philosophierens vorausgehen lässt. Denn wir leben weder in der gleichen Welt, noch leben wir in ganz verschiedenen Welten. Vielmehr leben wir in einer dynamisch-überlappenden, integrativen, sich immer wieder konstituierenden und kontextualisierenden Welt. Die zentrale These, die hier vorgeschlagen, diskutiert und verteidigt wird, ist die folgende: Eine Hermeneutik der Identität versteht unter Verstehen eine Selbstverdoppelung. B versteht A, so die Forderung, nur dann richtig, wenn B A so versteht, wie A sich selbst versteht. interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Ein solches Verstehen käme fast einer säkularisierten unio mystica gleich. Eine Hermeneutik der radikalen Differenz dagegen, macht das Unternehmen Verstehen schon im Ansatz unmöglich. Denn eine radikale Differenz lässt sich erst gar nicht artikulieren. Daher ist die minima moralia einer interkulturell orientierten Hermeneutik die Suche nach Überlappungen jenseits der bloßen Identität und völligen Differenz. Überlappungen kennen Gradunterschiede und manchmal können sie fast inhaltsleer sein, ohne jedoch ihren verbindenden Charakter zu verlieren. Daher sind sie der Humusboden für unterschiedliche Formen des Philosophierens. Andersphilosophieren ist eben Andersphilosophieren, mag es stellenweise konträr oder gar kontradiktorisch sein. Denn das, was Lao Tzu mit Konfuzius, Nagarjuna mit Shankara, Platon mit den Sophisten, Hume mit Descartes, Hegel mit Schopenhauer, Lyotard mit Habermas verbindet, ist letzten Endes nicht das konkrete Wie ihres Philosophierens, sondern das Dass ihres Philosophierens. Will man zwei oder mehrere philosophische Monologe dialog- bzw. polylogfähig gestalten, so muss man das Überlappende suchen und finden. Dies gilt auch dann, wenn Überlappungen fast inhaltsleer zu sein scheinen. Wem Überlappungen jedoch zu wenig sind, liebäugelt zumindest insgeheim mit einer Hermeneutik der Identität. Es besteht ein Primat der Kommunikation und Verständigung vor dem Konsens und ebenso vor dem Dissens. Denn Konsens soll sein, Dissens ist da und Kompromiss ist unser aller Schicksal. Dass die Kompromisse fair sind und bleiben, hängt in der Hauptsache von der Art und Weise unseres Umgangs mit Differenzen ab, die aller Wahrscheinlichkeit nach abgemildert und minimiert, aber nicht restlos beseitigt werden können und sollen. Interkulturelle Orientierung auf allen Gebieten ist mehr als eine notwendige Bedingung für eine friedvolle, zumindest konfliktarme Begegnung der Kulturen. Alle Versuche, Differenzen (Diversitäten) restlos zu tilgen, erheben eine bestimmte Sicht der Dinge in den absoluten Stand. Und dies hat stets eine Gewalt- samkeit in Theorie und Praxis zur Folge gehabt. Kompromissbereitschaft ist eine Tugend. Was jedoch vermieden werden soll, sind nicht die Kompromisse, sondern nur die faulen Kompromisse. Methodologisch kann man von drei Formen einer Kommunikationslogik sprechen: 1. Von einer Logik der Identität, 2. einer der Differenz und 3. einer der Überlappung. Lässt man die Geschichte der Menschheit Revue passieren, so stellt man eine aus dem Geist der Empirie geborene Weisheit von der Unvermeidbarkeit der Differenzen fest. Dieser Beitrag zielt auf die Erarbeitung einer Minimalhermeneutik, die unterschiedliche Auffassungen / Positionen als Alternative aufgreift und ernst nimmt, ohne irgendeine Position in den absoluten Stand zu setzen, einschließlich der eigenen. 2. Logik der Identität und Identitätshermeneutik Seit Menschengedenken ist die Frage nach Identität und Differenz stets ein zentrales Anliegen der Philosophie aller Traditionen gewesen – von Platon bis Hegel, von den Upanishaden bis Shankara und Nagarjuna. Die Vertreter der Identität uniformieren die Begriffe wie z. B. Wahrheit, Erkenntnis, Moral, Recht usw. Sie sind in der Regel Essentialisten und gehen von universalen, unveränderlichen Prinzipien aus. Auf dem Gebiet des Politischen tendieren sie zu monarchischen Modellen, und auf dem Gebiet der Moral zu universalistischen Prinzipienethiken mit dem Anspruch auf Allgemeingeltung. Erstaunlich, dass das Vorhandensein selbst der pluralistischen philosophischen Modelle sie nicht daran hinderte und hindert, diesem Ansinnen gegenüber skeptisch zu werden. Denn der Traum von der Letztbegründung ist entweder ausgeträumt oder es gibt eine Pluralität der Letztbegründungen. Mit Recht nennt Adorno „Identität die Urform von Ideologie“ (Adorno 1973:151). In der „Uniformierung des Wahren“ sieht Ricoeur, wie er sagt, eine erste „Fehltat“, eine erste „Gewaltsamkeit“ (Ricoeur 1974:152). Man kann vom Anspruch 13 und Elend einer Hermeneutik der Identität sprechen. Wer Einheit in einer prä-existenten Entität dingfest macht, handelt gegen den Geist des Dialogs. Identitätsvorstellungen können und sollen höchstens als regulative Ideen gelten, ohne einen ontologischen Anspruch auf Absolutheit und universelle Geltung. Im Geist der Empirie und der Lehre des Bedingtheitsnexus (Pratityasamutpada), plädiert der buddhistische Philosoph Nagarjuna für Kontinuität im jenseits der Identität und Differenz. 3. Logik der Differenz und Differenzhermeneutik Die Protagonisten der Differenz behandeln die Kategorie der Differenz nicht stiefmütterlich und halten sie zumindest für gleichursprünglich mit der Kategorie der Identität. Sie sind in ihrer Haltung anti-essentialistisch, gehen von einem geschichtlichen Gewordensein aller Dinge aus (vgl. Pratityasamutpada – Abhängigkeitsnexus in der buddhistischen Philosophie) und neigen zu relativistischen Auffassungen hinsichtlich der Erkenntnis, Wahrheit, Rationalität, Moral usw. Auf dem indischen Subkontinent waren daher die Buddhisten im Gegensatz zu den Hindus antimonarchisch und demokratisch, weil die anti-essentialistische buddhistische Metaphysik von der Nichtexistenz einer unveränderlichen Seele eine demokratische Gesinnung unterstützt. Eine Hermeneutik, die der Logik der Identität folgt, erkennt die anderen Lesarten eines Texts nicht einmal als ernst zu nehmende Alternativen an. Auf die selbstgestellte Frage, warum es unmöglich ist, ein Hegelianer zu sein, gibt Paul Ricoeur die Antwort, weil für Hegel eine andere Art Sinn zu haben, ein Unsinn ist. Andere Verstehensweisen werden gleichsam a priori als Nicht- oder Falschverstehen abgestempelt. Hier wird Verstehen fast zur Farce. Eine solche Hermeneutik neigt ferner politisch und moralisch entweder zur Usurpation des Anderen oder ignoriert es zur Gänze. Einige der geschichtlichen Kulturbegegnungen belegen dies zur Genüge. 14 Eine Hermeneutik, die einer Logik der Differenz folgt und diese Differenz radikalisiert, macht das Verstehen fast unmöglich. Sie führt zu einem radikalen Relativismus, der die Kehrseite des Absolutismus darstellt, denn Absolutismus ist verabsolutierter Relativismus. Philosophie verliert ihre legitime universelle Applizierbarkeit nicht durch Hinzufügung etwa der Adjektive chinesisch, indisch, europäisch u. a., sondern durch die Selbstverabsolutierung eines bestimmten Adjektivs. Die Adjektive sind, so die Botschaft einer interkulturell-philosophischer Orientierung, eher der Reichtum der Philosophie. Dem Vorurteil, Philosophie sei nur griechisch-europäisch, liegt eine ungerechtfertigte, historisch kontingente Selbstuniversalisierung des Adjektivs europäisch zugrunde. Aus dem Geist des interkulturellen Philosophierens, ist eine derartige Verabsolutierung, sei sie europäisch oder der nicht-europäisch, abzuweisen. Differenz ist jedoch nicht gleich Differenz. Es gilt zwischen zwei Arten von Differenz zu unterscheiden. Auf die Frage: Wann sind zwei Dinge unterschiedlich und wann radikal unterschiedlich, lautet die Antwort: Zwei Dinge sind unterschiedlich, wenn sie Beispiele des gleichen Oberbegriffs sind. In diesem Sinne sind indische und europäische Philosophien unterschiedliche Philosophien; Nagarjuna, Hegel, Kant und Schopenhauer sind unterschiedliche Philosophen; Chinesisch, Sanskrit und Deutsch sind unterschiedliche Sprachen. In allen diesen Fällen existiert die Differenz unter dem gemeinsamen Dach der Überlappung. Verstehen hier ist möglich und wirklich. Eine andere, radikale Art der Differenz herrscht, wenn zwei Dinge sich überhaupt nicht unter einem Oberbegriff subsumieren lassen. In diesem Sinne gilt es: Ist Heraklit ein Philosoph, dann ist Parmenides kein Philosoph; ist westliche Philosophie Philosophie, so ist indische Philosophie keine. Es ist diese zweite Art der radikalen Differenz, die die hier vertretene Hermeneutik der Überlappung strikt ablehnt. interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Interkulturell philosophiert, wer Pluralität anerkennt und Differenz respektiert. Es kommt einem selbstverschuldeten Wunschdenken gleich, wenn man von einer essentiellen Einförmigkeit unter den Menschen ausgeht. 4. Hermeneutik der Überlappung Eine für die interkulturelle Perspektive charakteristische Logik der Überlappung ist in der Empirie verankert und wird von der Einsicht begleitet, dass es gemeinsame Strukturen gibt. Diese dürfen jedoch nicht essentialisiert werden. Sie sind eher vergleichbar mit der These der Familienähnlichkeit Wittgensteins. Die hier von mir vertretene Hermeneutik der Überlappung wendet sich vehement gegen die These, dass Anerkennung von Differenzen zur Beliebigkeit führe. In diesem Zusammenhang möchte ich ganz kurz auf die Logik und Methodologie der Jaina Philosophie (einer der Schulen der indischen Philosophie) hinweisen. Die Jainistische Philosophie mit ihrer de-konstruktivistischen Methodologie der Nicht-Einseitigkeitslehre (Anekaantavaada), warf sowohl dem Buddhismus als auch dem Vedantismus eine einseitige Verabsolutierung ihrer je eigenen Perspektive vor. In allen philosophischen Traditionen sind unterschiedliche Strategien hinsichtlich einer Überwindung dieser gegenseitigen Alternativen vorgeschlagen worden. Die Nicht-Einseitigkeitslehre der Jainas geht von der Unvermeidbarkeit der Standpunkthaftigkeit (nayavada) aus und versieht alle Urteile mit dem Zusatz unter Bedingungen möglich (syad). Genau besehen geht es hier um eine Anwendung der Ethik der Gewaltlosigkeit (Ahimsaa) auch auf das philosophische Denken, denn es gibt nicht nur physische, sondern auch eine intellektuell theoretische Gewalt. Absolutismus jedweder Art ist eine solche Form der Gewaltanwendung abweichenden Positionen gegenüber. Die zweiwertige Logik, die eine Proposition entweder wahr oder falsch sein lässt, wird hier zugunsten einer mehrwertigen Logik – eben der siebenfachen Prädikationslogik der Jaina Philosophie (Saptbhanginaya) – abgelehnt. Dieser zufolge sind philosophische Standpunkte verschieden und plural, schließen einander jedoch nicht aus, sondern können sich eher als komplementär erweisen. So gilt es, die Idee, ja die Ethik der Gewaltlosigkeit (Ahimsaa) nicht nur in der Praxis, sondern ebenso in der Theorie zur Anwendung zu bringen. Denn eine Unterschätzung der theoretischen Gewalt, richtet viel Schaden an, denn wer die eigene Lesart verabsolutiert und alle anderen ablehnt, übt theoretische Gewalt aus. Seit Menschengedenken stellen die Diskurse unter den Menschen und ihren Systemen eine unaufhörliche dialektische Abfolge dar, die das Alte im Hegel‘schen Sinne zwar aufzuheben vermögen, ohne aber den Hegel‘schen Traum von einer endgültigen Synthese in einem bestimmten Denksystem zu verwirklichen. Wer Dialektik zur endgültigen Ruhe bringen will, denkt und handelt gebieterisch. Denn ist das Denken von Haus aus dialektisch, wie kann es Denken bleibend sich selbst überwinden? Auf die Frage: Wie mit Differenzen umgehen? kann in einem tentativen Imperativ formuliert werden: Im Geiste der Jainistischen Logik und Methodologie der mannigfaltigen Standpunkte, die offener, toleranter und demokratischer ist und in Zurückweisung einer Logik der Identität, die essentialistisch, vereinnahmend, absolutistisch und gebieterisch ist, versuche nicht von vornherein von Wahrheit anzufangen, sondern von diversen Standpunkt(en), vermeide die Verabsolutierung eines jeden Standpunktes, einschließlich des eigenen und strebe so nach Kommunikation und Verständigung im Diskurs der Standpunkte, denn der Denkirrtum besteht nicht in unserer allgemeinen Standpunktgebundenheit, sondern in unserem allseitig gefährlichen Willen zum Absolutheitsanspruch. Wer die Frage der Wahrheit der Frage nach der Bedeutung vorausgehen lässt, zäumt das Pferd von Hinten auf. In Anlehnung an Husserls Idee überlappender Inhalte, geht es hier um Per- 15 spektiven, die sich überschneiden und sowohl Relativismus als auch Absolutismus vermeiden. Eine Hermeneutik der Überlappung bietet hier einen Ausweg. Sie besteht jenseits der Fiktionen sowohl eines exklusiven Absolutismus als auch eines radikalen Relativismus, indem sie grundsätzlich davon ausgeht, dass das Beziehen eines Standpunktes erkenntnistheoretisch unausweichlich ist, dass aber unterschiedliche Positionen stets möglich sind und auch realiter vorkommen. Diese Grundannahme ist die Quelle philosophischer Liberalität Offenheit und Toleranz. Sie erweist sich als eine philosophische Tugend im Sinne einer Verzichtleistung auf jeglichen Absolutheitsanspruch. Die hier kurz skizzierte Hermeneutik der Überlappung wird auf folgende Themenbereiche angewendet: Das Verhältnis von Konsens, Dissens und Kompromiss; das Primat der Vorsilbe inter- vor den Vorsilben trans-, intra- und multi-; zur Konzeption interkultureller Philosophie – was sie nicht ist und was sie ist; zur Theorie einer interkulturell orientierten analogischen Hermeneutik (Mall 2012) und auf die Frage, wie man mit Differenzen umgehen kann. 5. Konsens, Dissens, Kompromiss Konsens ist erstrebenswert, Dissens ist stets da. Eine liberale und realitätsbezogene Logik philosophischer Diskurse zielt auf einen Kompromiss, der sowohl theoretisch als auch praktisch frei von Gewaltsamkeit ist. Zur herrschaftsfreien Diskussion (Habermas) sind wir alle verpflichtet. Leider ist diese jedoch keine konstitutive, sondern eine regulative Idee. Als ein intentional noematisches Ziel harrt sie ihrer teilweisen oder gar vollständigen Einlösung. „Es ist wichtig“, schreibt Paul Ricoeur, „den Konfliktcharakter einer entwickelten Gesellschaft ernst zu nehmen. Wir können uns nicht damit bescheiden, auf einen Konsens zu hoffen. Die Idee des Konsenses ist wie die Idee des ewigen Friedens, auf den Diskurs übertragen“ (Ricoeur 1998). Was interkulturelle Diskurse auf jedwedem Gebiet ermög- 16 licht, ist weder die Idee eines vollständigen Konsenses noch die eines völligen Dissenses, sondern die eines „überlappenden Konsenses“ (Rawls 1987:1ff.). Geertz stellt fest: „Nicht um den Konsens geht es, sondern um einen gangbaren Weg, ohne ihn auszukommen“ (Geertz 1995:82). Die hier vorgeschlagene Konzeption einer Hermeneutik der Überlappung könnte eine mögliche Antwort sein. Der Siegeszug eines relativistischen Denkens in unterschiedlichen Graden kann heute nicht in Abrede gestellt werden. Wenn Relativismus aber im Sinne des gesunden Menschenverstandes bedeuten soll, dass wir Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was wir Erkenntnis, Vernunft, Wahrheit, Wert, Gerechtigkeit usw. nennen, dann wundert man sich, wie man kein Relativist sein kann. Die Frage ist daher nicht, wie man den Relativismus loswerden oder widerlegen, sondern wie mit ihm umgehen kann. Dies kann gelingen unter Vermeidung eines unverbindlichen radikalen Relativismus. 6. Zum Primat der Vorsilbe inter- vor intra-, transund multiZunächst ist die interkulturelle Sicht nicht viel anders als die intrakulturelle Sicht, denn innerhalb der gleichen Kultur gibt es auch unterschiedliche Denk- und Handlungsmodelle. Sehr zu Recht schreibt Georg Stenger: „Interkulturelle Philosophie scheint mir ihre Sprengkraft darin zu haben, dass sie zu einer wirklichen Herausforderung der Philosophie insgesamt avanciert. Die Philosophie wird nicht nur aus externen Gründen interkulturell werden müssen, sie wird sich aus internen philosophischen Gründen interkulturalisieren“ (Stenger 2006:14). Die interkulturelle Sicht macht freilich die Palette der Modelle jedoch bunter, reicher und weist unter ihnen grundsätzliche Ähnlichkeiten und erhellende, kulturspezifische Differenzen auf. Daher wirkt die interkulturelle Perspektive befreiend von der Enge der kulturellen Sicht. Sie kann aber auch beängstigend interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) sein, wenn man fälschlicherweise die interkulturelle Begegnung mit Selbstverlust in Verbindung bringt. Unterschiedliche Kulturen sind unterschiedlich, weil sie die anthropologische Gleichartigkeit unterschiedlich entwickeln. Intrakulturelle Verständigungsprobleme innerhalb der gleichen Kultur sind, genauer besehen, interkultureller Natur, weil das Gefühl, die Wahrnehmung der Fremdheit mit Gradunterschieden nie ganz verschwindet. Daher zerfällt die Vorsilbe intra- in die Vorsilbe inter- im Sinne einer fraktalen Rekonstruktion.2 Zur Grundposition der interkulturellen Philosophie gehört wesentlich die Einsicht in das geschichtliche Gewordensein der konkreten Gestalten der Philosophie. Ferner aber auch die Überzeugung, dass Philosophie und Anthropologie sich gegenseitig bedingen und in der Regel ineinander verflochten sind. Daher ist und bleibt die Frage nach dem Primat der einen vor der anderen offen. Die unterschiedlichen Gestalten der Philosophie, ob inter- oder intra-kulturell, können konträr und manchmal sogar kontradiktorisch sein. Eine interkulturelle philosophische Orientierung aber gesteht ihnen allen das Prädikat Philosophie zu sein zu und rettet so eine überlappend-universelle Verbindlichkeit, mag diese noch so inhaltsarm sein. So gehört der Protest gegen Zentrismen aller Art zum Wesenszug der interkulturellen Philosophie. Daher ist interkulturelle Philosophie auch gegen alle Nivellierungsversuche, die in der Regel mit irgendeiner Form der Gewalt einhergehen, die Kategorie der Differenz stiefmütterlich und reduktiv behandeln und die regulative Idee der Einheit metaphysisch-ontologisch, spekulativ-ideologisch und aprioristisch als Einheitlichkeit ab ovo bestimmen. Die Vorsilbe inter- steht für ein Zwischen, das sich auch auf der Ebene der sogenannten intra-kulturellen Vergleiche bemerkbar macht. Dies wird deutlich, wenn wir philosophische Auseinandersetzungen in den unterschiedlichen kulturellen Traditionen beobachten. So scheint die Vorsilbe intra- sich in die Vorsilbe inter- aufzu- heben, weil ein Zwischen nicht aufhört, sich bemerkbar zu machen, auch in den sogenannten intrakulturellen philosophischen Diskursen. Treffen zwei philosophische Traditionen wie z. B. die der Sophisten und die der Platoniker aufeinander, so begegnen sich eigentlich zwei Kulturen der Philosophie im Sinne einer interkulturellen philosophischen Begegnung, auch wenn die beiden der gleichen philosophischen Tradition Griechenlands angehören. Das gleiche gilt auf dem Boden der philosophischen Tradition Indiens in der Begegnung der hinduistischen Tradition mit der buddhistischen. Wenn Philosophie als Philosophie vor den erwähnten Adjektiven ausschließlich trans-kulturell sein soll, dann stellt sich die Frage erstens nach dem Fixpunkt eines tertium comparationis, der in einer bestimmten Tradition nicht fixiert werden darf; zweitens nach einer möglichen trans-kulturellen, fast platonischen Verankerung der Philosophie und drittens nach einer fast apriorischen, bloß analytischen und nominalistischen Bestimmung der Philosophie. Alle drei Möglichkeiten belasten die Vorsilbe trans- in einer Weise, die einer interkulturellen Verständigung nicht dienlich ist. Die Universalisierungstendenz der Vorsilbe trans-, die sich den kulturellen Gestalten der Philosophie verweigert, endet im Leeren, weil eine trans-philosophische Bestimmung das Zwischen im Voraus festlegt. Die Vorsilbe inter- ist frei von diesen Mängeln, weil sie sich als ein im Gespräch, im Diskurs stattzufindendes Erlebnis eines Zwischen versteht, wenn sich philosophische Fragen und Lösungsansätze im Vergleich der weltphilosophischen Traditionen begegnen. In der Abwesenheit eines alle Kulturen transzendierenden Legitimationsgrundes für die Bestimmung der Philosophie bietet eine interkulturelle Orientierung die notwendige Verbindlichkeit, die unparteiisch genug ist, der Gegenposition das gleiche Recht einzuräumen, das sie selbst in Anspruch nimmt. Die theologisch und philosophisch so belastete Vorsilbe trans- liebäugelt mit einem allbestimmenden archimedischen Punkt 17 und träumt von einer allverbindlichen Letztbegründungsinstanz.3 Die Vorsilbe multi- führt ohne die überlappende Verbindlichkeit der Vorsilbe inter- zu einem unverbindlichen neben-, durch- oder gegeneinander. Neben der deskriptiven ist die normative Dimension des Multikulturalismus von zentraler Bedeutung. Und diese Dimension lebt von einer interkulturellen Orientierung. Die Vorsilbe inter- könnte für eine Einstellung stehen, die alle konkreten Gestalten und Orte der Philosophie wie ein Schatten begleitet und verhindert, dass irgendeine bestimmte Gestalt oder irgendein bestimmter Ort der Philosophie sich verabsolutiert. Mit Recht unterstreicht Waldenfels die Rolle der Interkulturalität im Sinne eines „Zwischen, das“, wie er schreibt, „weder auf eine Vielzahl von Eigenkulturen oder gar auf die eigene Kultur zurückgeführt noch auf eine allumfassende Gesamtkultur ausgerichtet werden kann. Interkulturalität bedeutet mehr als Multikulturalität im Sinne einer kulturellen Vielfalt, mehr auch als Transkulturalität im Sinne einer Überschreitung bestimmter Kulturen.“ (Waldenfels 1997:110) In ihren Grundstrukturen unterscheiden sich inter-kulturen Differenzen kaum von intra-kulturellen Differenzen. Eine Sensibilisierung für intra-kulturelle Differenzen erleichtert die Aufgabe inter-kultureller Verständigung. Interkulturelle Philosophie zielt auf einen Paradigmenwechsel im Diskurs der philosophischen Traditionen der Welt. Daher wird die zukünftige Philosophie entweder interkulturell sein oder aber sie wird provinzialistisch bleiben. 7. Interkulturelle Philosophie mit ihrer Verpflichtung zur Hermeneutik der Überlappung Philosophie heute befindet sich in einem Prozess der Entscheidung. Sie muss sich entweder für eine Logik der Identität oder einer Logik der Differenz oder einer Logik der Überlappung entscheiden. Sie ist einer Logik der Identität nicht verpflichtet, weil diese viel zu essentialistisch verfährt. Sie ist 18 ebenso wenig einer Logik der Differenz verpflichtet, weil diese von radikalen Differenzen ausgeht und unverbindlich relativistisch wird. Recht verstanden ist Philosophie heute einer Logik der Überlappung verpflichtet, weil die Anerkennung überlappender Strukturen und Inhalte eine Interpretation, Verständigung und Kommunikation ermöglicht, die Ordnung mit Differenzen Hand in Hand gehen lässt. Eine Logik der Überlappung lehnt eine jede selbstverschuldete Verabsolutierung des eigenen Standpunktes ab. Jenseits der Fiktion einer totalen Kommensurabilität und einer völligen Inkommensurabilität, steht die Überlappungsthese für Gemeinsamkeiten, die aus unterschiedlichen Gründen zwischen den Kulturen zu finden sind (Mall 1995:39ff.). Diese These ist nicht mit einem idealisierten Konsens in seinem transzendentalpragmatischen und kommunikationstheoretischen Zug gleichzusetzen. Sie ist ein phänomenologisch-empirisch nachweisbarer dynamischer Prozess. Habermas Theorie der Kommunikation mit ihren nachmetaphysischen Reflexionen will zwar keine alte Metaphysik der einen absoluten Vernunft. Sie plädiert aber für eine starke Version des Konsensualismus. Im Konsens sieht sie nicht nur ein regulatives Ideal rationaler Diskurse, sondern eine konstitutive Vorbedingung für die Möglichkeit der Kommunikation.4 Die Theorie der Überlappung plädiert für eine schwache Version des Konsensualismus und lässt Diskurse auch ohne Konsens zustande kommen. Nicht die Wünschbarkeit des Konsenses wird hier in Abrede gestellt, sondern der essentialistische und absolute Status. Die hier vertretene Überlappungstheorie kommt der Rawls‘schen Auffassung von einem überlappenden Konsensus sehr nahe. Überlappungsthese bedenkt als methodischen Zugang schon im Ansatz die Vielfalt und Heterogenität. interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) 8. Selbst- und Fremdhermeneutik Es herrscht ein dialektisches Verhältnis zwischen dem Selbst- und Fremdverstehen, und dies trotz der inneren Dynamik der beiden Verstehensarten. Das Selbstverstehen von A wird zum Gegenstand hermeneutischen Verstehens von B. Analoges gilt für das Selbstverstehen von B. In diesem Prozess ist der Konflikt der Interpretationen unvermeidbar und die interkulturelle philosophische Einstellung hilft, jede Selbstverabsolutierung zu vermeiden. Hermeneutisches Unternehmen ist eine unendliche Suche nach Überlappungen, mögen diese noch so minimal sein und nur darin bestehen, dass man den Gegenpositionen auch das Recht, Positionen zu sein, zugesteht. Zwischen absolut gültiger Interpretation und einer interkulturellen Hermeneutik muss gewählt werden. Denn es gibt weder den einen absoluten Text noch die eine absolute Interpretation. In seiner Kritik der Gadamer‘schen Hermeneutik spricht Hörisch von einem „Vereinigungsdelirium“, von einem „Einheitsdelirium“ (Hörisch 1988:67). Oft geht man von der Vorstellung aus, die Innensicht einer Kultur sei für die Angehörigen der gleichen Kultur klar, eindeutig, homogen und widerspruchsfrei. Diese Ansicht entspricht jedoch nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Beim Phänomenologen und Soziologen Alfred Schütz heißt es, dass „das Wissen des Menschen, der in der Welt seines täglichen Lebens handelt und denkt, nicht homogen ist.“ Denn dieses Wissen, so Schütz weiter, „ist erstens inkohärent, zweitens nur teilweise klar und drittens nicht frei von Widersprüchen“ (Schütz 1972:61). Die bekannte homo duplex-These hält die InsiderOutsider-Spannung letztlich für nicht ganz überwindbar und rät dazu, sie zu minimieren und auszuhalten. Es wird zwar für Einheit plädiert, aber von der Idee einer Einheitlichkeit Abstand genommen. Philosophie im Vergleich der Kulturen weist auf das folgende Dilemma hin: Wenn wir z. B. das indische Denken in westliche Kategorien und Konzepte übersetzen, um es zu verstehen, dann ist die Gefahr einer Verdrehung nicht auszuschließen. Tun wir dies aber nicht, so fürchten wir, es nicht verstehen zu können. Das Gleiche gilt auch für den umgekehrten Weg. Es stellt sich die Frage, ob die Denkweisen unterschiedlicher Kulturen so radikal verschieden sind, dass wir sie in unsere eigenen übertragen müssen? Aber wie können wir dies tun, wenn die Unterschiede so radikal sind, dass sie nicht einmal artikuliert werden können? Oder ist eine grundlegende, offene, anthropologische Verankerung überlappend genug, um die Kulturen, die nicht unsere eigenen sind, verstehen zu können? Dass die Kulturen sich seit Menschengedenken über ihre eigenen Grenzen hinweg interpretiert und verstanden haben, auch missverstanden haben, ist ein Beleg für das Verstehen von Kulturen, die nicht unsere eigenen sind. Wenn z. B. ein Philosoph aus der europäischen Tradition die Feststellung macht, die chinesischen Denker beschäftigten sich hauptsächlich mit den Verifikationsimplikationen einer Aussage, während die europäischen Denker die Frage nach der Wahrheit oder Falschheit einer Aussage ins Zentrum stellten, so beweist er, dass er einige Merkmale der chinesischen Philosophie verstanden hat, denn sonst könnte er diese Aussage nicht machen. Interkulturelles Philosophieren geht von der Möglichkeit einer interkulturellphilosophischen Begriffskonkordanz aus und zielt auf die Realisierung dieser Möglichkeit. Ferner ist die Rede von der europäischen, der indischen oder der chinesischen Philosophie selbst eine höherstufige Konstruktion. Plessner warnt vor der Verabsolutierung eines bestimmten Denk- und Kategoriensystems, das seine eigenen geschichtlichen, kontextuellen und transzendentalen Bedingungen auf andere Denkstrukturen überträgt. Daher ergibt sich die Notwendigkeit einer Durchrelativierung des eigenen Weltverständnisses. Im Hinblick auf einen interkulturellen philosophischen Diskurs sind die folgenden Worte Plessners von zentraler Bedeutung: 19 „In dem Verzicht auf die Vormachtstellung des europäischen Wert- und Kategoriensystems gibt sich der europäische Geist erst den Horizont auf die ursprüngliche Mannigfaltigkeit der geschichtlich gewordenen Kulturen und ihrer Weltaspekte frei. In dem Verzicht auf die Absolutheit der Voraussetzungen, welche diese Freilegung selbst erst möglich machen, werden diese Voraussetzungen zum Siege geführt. Europa siegt, indem es entbindet.“( Plessner 1979:299) Hieraus folgt, dass keine philosophische Tradition ihre eigenen Denk- und Verhaltensmuster verabsolutieren darf. Das tertium comparationis muss erarbeitet und nicht per definitionem im Sinne einer apriorischen Methode fixiert werden (Mall 2000). Eine andere Denkweise ist eine alternative Denkweise, die nicht unbedingt falsch sein muss, es sei denn, es handelt sich um eine Denkweise, die neben sich keine andere zulässt. Dies ist ein Dialog hemmender Dogmatismus, ob inter- oder intrakulturell. Wer durch Ausschluss denkt, verhindert offene und tolerante Diskurse. 9. Zur Konzeption einer interkulturellen analogischen Hermeneutik Eine Hermeneutik, die der heutigen de facto hermeneutischen Situation gerecht werden will, muss das Verstehenwollen und das Verstandenwerdenwollen zusammendenken. Oft haben kulturelle Traditionen im Namen des Verstehens Monologe betrieben. Monologische hermeneutische Modelle lassen das Fremde entweder nicht zu Wort kommen oder betreiben eine gewaltsame Einverleibung. Eine solche Hermeneutik könnte man eine reduktive nennen. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass sie erstens eine bestimmte Tradition privilegiert, zweitens diese darüber hinaus verabsolutiert und drittens im Namen des Verstehens das Übertragen der eigenen Strukturen versteht. So trägt eine der heutigen hermeneutischen Situation adäquate Hermeneutik nicht einen gattungsmäßigen, sondern einen analogen Charakter. Das heutige Angesprochensein der Kulturen, Philosophien, Religionen und 20 politischen Weltanschauungen ist von ganz anderer Qualität als das gewesene. Dieses erneute Angesprochensein Asiens, Afrikas und Lateinamerikas durch Europa und Europas durch Asien, Afrika und Lateinamerika ist durch eine konkrete Situation gekennzeichnet, in der die nicht-europäischen Kontinente mit ihren je eigenen Stimmen am Gespräch beteiligt sind. Dieses Gespräch ist von einer vierdimensionalen hermeneutischen Dialektik begleitet. Erstens geht es um ein Selbstverständnis Europas durch Europa. Trotz aller inneren Unstimmigkeiten hat sich Europa, zum größten Teil unter dem Einfluss außerphilosophischer Faktoren, den Nichteuropäern als etwas Einheitliches präsentiert. Zweitens gibt es das europäische Verstehen der nicht-europäischen Kulturen, Religionen und Philosophien. Die institutionalisierten Fächer der Orientalistik und Ethnologie belegen dies. Drittens sind da die nicht-europäischen Kulturkreise, die ihr Selbstverständnis heute auch selbst vortragen und dies nicht den anderen überlassen. Viertens ist da das Verstehen Europas durch die außereuropäischen Kulturen. In dieser Situation stellt sich die Frage: Wer versteht wen, wie und warum am besten? Es mag Europa überraschen, dass Europa heute interpretierbar geworden ist. So verlangt die de facto existierende hermeneutische Situation nach einer Philosophie der Hermeneutik, die offen genug ist, um die Traditionsgebundenheit auch des eigenen Standpunkts einzusehen. Eine interkulturell orientierte hermeneutische Philosophie muss die Forderung nach einer Theorie erfüllen, nach der weder die Welt, mit der wir uns auseinandersetzen, noch die Begriffe, Methoden, Auffassungen und Systeme, die wir dabei entwickeln, historisch unveränderliche, apriorische Größen darstellen. Eine Hermeneutik, die das Identitätsmodell zum Paradigma erhebt, versucht das zu Verstehende in seiner Substanz so zu verändern, dass das Fremde zu einem Echo ihrer selbst wird. Wer Wahrheit durch die eigene Tradition und die eigene Tradition durch die Wahrheit exklusivistisch definiert, macht sich der interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) petitio principii schuldig und gefährdet eine interkulturelle Verständigung. Verstehen ist nach diesem Modell stets mit irgendeiner Form von Gewalt verbunden. Das Motto einer interkulturellen analogischen Hermeneutik lautet daher: Das Verstehenwollen und das Verstandenwerdenwollen gehören zusammen und stellen die zwei Seiten derselben hermeneutischen Münze dar. Wo alles nur dem Wunsch, dass man verstanden werden will, untergeordnet ist, dort wird das Andere in seinem Eigenrecht erst gar nicht wahr- und ernst genommen. In diesem Sinne studierten die Missionare und auch manche Ethnologen mit viel Mühe die fremde Sprachen wie z. B. Chinesisch oder Sanskrit nicht so sehr, um die Fremden zu verstehen, sondern in der Hauptsache, um von ihnen verstanden zu werden. In dem Verstehen des anderen ist zwar der hermeneutische Zirkel nicht ganz vermeidbar. Er darf jedoch auch nicht dogmatisiert werden, als wäre man nur noch dessen Gefangener. Von den folgenden drei hermeneutischen Modellen bejaht die interkulturelle Philosophie das dritte. Diese Modelle sind: I. Das Identitätsmodell erhebt das Selbstverstehen einer Kultur, Philosophie oder Religion zu einem exklusiven Paradigma und verleiht der sonst richtigen phänomenologischen Einsicht einen zu strengen Sinn: Das Unbekannte muss im Modus des Bekannten verstanden werden. Diese Hermeneutik lässt sich von der identitätsphilosophisch orientierten Fiktion einer totalen Kommensurabilität leiten. In einer angewandten Form besagt sie, dass nur ein Buddhist einen Buddhisten, nur ein Christ einen Christen, nur ein Platoniker einen Platoniker, ein Hegelianer einen Hegelianer verstehen kann. Da es aber den Platoniker nicht gibt, führt diese Hermeneutik sich selbst ad absurdum. II. Die Hermeneutik der totalen Differenz verabsolutiert die Unterschiede und hängt der Fiktion einer völligen Inkommensurabilität an. Während die Fiktion der totalen Kommensurabilität das interkulturelle Verstehen zu einer Farce werden lässt, macht die Fiktion der völligen Inkommensurabilität das gegenseitige Verstehen unmöglich. III. Die analogische Hermeneutik, für die die interkulturelle Philosophie plädiert, reduziert nicht und vermeidet die beiden beschriebenen Fiktionen. Sie geht von den aus vielerlei Gründen vorhandenen Überlappungen aus, die Kommunikation und Übersetzung erst ermöglichen. Diese Überlappungen können von dem BiologischAnthropologischen bis hin zum Politischen reichen. Die Andersheit des Anderen wird erreicht, ohne sie zu reduzieren oder zu vernachlässigen. Die starke Identitätstendenz der Moderne und die ebenso starke Differenzthese der Postmoderne verlieren so ihren Stachel. Nur Überlappungen lassen Auslegungen zu. Die Überlappungen entstehen, sie sind nicht autonom, es sei denn, sie wären soziologischer und biologischer Natur mit lebenserhaltenden Funktionen. Sie sind in das Leben eingebettet und hängen von Begründungszusammenhängen, Methoden, Erkenntnissen, Werten, Interessen und Interpretationen ab. Jenseits aller Ontologisierungen stellen die Überlappungen die auf dem Boden des Empirischen und Phänomenologischen zu erreichenden und zu begründenden Gemeinsamkeiten dar. Sehr zu Recht heißt es bei Dilthey: „Die Auslegung wäre unmöglich, wenn die Lebensäußerungen gänzlich fremd wären. Sie wäre unnötig, wenn in ihnen nichts fremd wäre“ (Dilthey 1973:225). Die analogische Hermeneutik vertritt ferner die Ansicht, dass man auch das versteht und verstehen kann, was man nicht ist, sein kann oder sein will. Das Verstehen im Geiste der analogischen Hermeneutik besteht nicht auf ein Verstehen im Sinne des Einleuchtens 21 und Überzeugens, sondern vollzieht ein Verstehen auch im Sinne des Sichzurücknehmen-Könnens. Die analogische Hermeneutik erlaubt uns auch, das zu verstehen, was wir vorher unbedingt nicht konstituiert haben müssen. Die Grenze der Hermeneutik, auch der phänomenologischen, ist dort, wo es auch eine Grenze der Konstituierbarkeit gibt. Allen Intentionen des Verstehens geht das analogisch Andere als das zu Verstehende voraus und ist und bleibt nicht restlos konstituierbar. Das hermeneutische Subjekt der analogischen Hermeneutik ist nicht ein Subjekt neben dem empirischen, kulturellen und historischen, sondern es ist dasselbe Subjekt mit der interkulturellen Einstellung, welche es orthaft ortlos sein lässt. Ein solches hermeneutisches Subjekt als eine meditativ-reflexive Instanz hat keine bestimmte Sprache als seine Muttersprache. Es wird immer von dem Bewusstsein begleitet, dass ein jedes konkretes Subjekt auch ein anderes sein könnte. Die Naivität des bloß mundanen Subjekts besteht in dem Unvermögen, den eigenen Standpunkt als einen unter vielen wahrnehmen zu können. Die höherstufige Einstellung des hermeneutischen Subjekts ermöglicht uns, das wir Standpunkte, einschließlich des eigenen, als Standpunkte begreifen und die nötige Offenheit und Toleranz bezeugen (Mall 1995:91ff.). Die analogische Hermeneutik ermöglicht sogar eine konsensuelle Übereinkunft, ohne sie vorzuschreiben, indem sie keine Gestalt der Philosophie und Kultur zu der einen allgemeingültigen macht. Hält man z. B. eine einzige Interpretation eines Textes für die einzig wahre, so ist einzugestehen, dass es entweder selten eine wahre Interpretation gegeben hat oder die These von der nur einen wahren Interpretation ein Mythos ist. Interpretationsvielfalt besitzt anscheinend eine anthropologische Verankerung. So wie es nicht die eine Interpretation gibt, gibt es nicht den einen Text. Die hier entworfene Konzeption einer analogischen Hermeneutik, ist in dem spannungsreichen Knotenpunkt zwischen unaufhebbaren Traditionsgebun- 22 denheit und der unverzichtbaren Offenheit der Hermeneutik angesiedelt. Die Philosophie der Hermeneutik, die einer solchen Konzeption zugrunde liegt, definiert nicht Wahrheit ausschließlich durch die eigene Tradition und die eigene Tradition durch Wahrheit. Man kann vom Anspruch und Elend einer solchen Koinzidenz zwischen Tradition und Wahrheit sprechen. Dies ist generell abzulehnen, ob es um intra- oder interkulturelle Verhältnisse geht. Eine Hermeneutik, die dem heutigen Diskurs der philosophischen Traditionen in einer globalen Welt dienlich sein kann, trägt nicht einen gattungsmäßigen, sondern eher einen analogischen Charakter: eine gattungsmäßige Hermeneutik geht von einem universalisierten gattungsmäßigen Oberbegriff aus und subsumiert alle anderen hermeneutischen Modelle diesem einen hermeneutischen Rahmen als Sonderfälle. In diesem Sinne sind Habermas und Ricoeur der Gadamer‘schen Hermeneutik zu Recht kritisch und skeptisch gegenüber. Im Geiste der schöpferischen Hermeneutik (M. Eliade), stellt die hier vorliegende Konzeption nicht nur einen liberalen methodischen und epistemologischen, sondern darüber hinaus auch einen transformativen Zugang dar. So ist interkulturelles Philosophieren im Geist der hier entworfenen analogischen Hermeneutik, nicht nur ein Denkweg, sondern ebenso ein Lebensweg. Die Tatsache, dass es seit Menschengedenken grundsätzlich unterschiedliche, ja sogar inkommensurable Buchstabierungsweisen des Welträtsels gibt, deutet letzten Endes auf die weitere Tatsache hin, dass es Grenzen des Verstehens gibt und geben muss. Ein Denken, das hermeneutische Grenzen nicht ernst nimmt, ist kaum dialogisch, weil eine bestimmte Form des Verstehens hier absolut gesetzt wird. Die analogische Hermeneutik dagegen ist der Ansicht, dass Nichtverstehen nicht der Tod der Kommunikation bedeutet. Als Gedankenexperiment möchte man einmal die Frage stellen, wie das Verstehen beschaffen sein müsste, dass z. B. Hegel und Schopenhauer sich gegenseitig ein Verstehen des anderen bescheinigen interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) angesichts der de facto pluralistischen Situation der philosophischen Szene im heutigen Weltkontext der Kulturen. Interkulturelle Philosophie darf nicht zu einem bloßen, aus der Not geborenen Konstrukt reduziert werden. könnten? Ein Frage, die noch keine befriedigende Antwort gefunden hat, ist: Gehört Nichtverstehen als Grenze des Verstehens zu einem Strukturmerkmal des Verstehens? 10.Versuch einer Begriffsbestimmung der interkulturellen Philosophie Die Konzeption der interkulturellen Philosophie, die einer interkulturellen analogischen Hermeneutik zugrunde liegt, sei hier kurz dargestellt: 10.1. Was interkulturelle Philosophie nicht ist I. Sie ist nicht der Name einer bestimmten philosophischen Konvention, sei sie europäisch oder nicht-europäisch. Eine solche eindimensionale Sicht führt zu Kulturalismus und verhindert einen offenen interkulturellen Diskurs. II. Sie ist trotz der notwendigen Zentren der unterschiedlichen philosophischen Traditionen (Ursprungsorte der Philosophie) orthaft und zugleich ortlos. Eine jede konkrete philosophische Tradition kennt einen Ort und eine Zeit und insofern ist sie stets orthaft. Da aber Philosophie qua Philosophie in keiner Tradition ausschließlich aufgeht, ist sie auch ortlos. Sie ist daher keine weitere Addition zu den schon vorhandenen Disziplinen der Philosophie. III. Sie ist kein Eklektizismus verschiedener philosophischer Traditionen, deren Darstellung über die Philosophiegeschichte im Sinne einer Buchbinderkunst nebeneinander heute noch zu finden ist. IV. Sie ist keine bloße Abstraktion, formal-logisch und per definitionem festgelegt. Eine solche methodologisch-apriorische Bestimmung ist nicht hilfreich. V. Sie ist aber auch nicht eine bloße Reaktion oder Hilfskonstruktion VI. Sie ist auch kein Ort der Kompensation, um beim Anderen das zu finden, was einem fehlt. In diesem Sinne wurde, aufgrund von Vorurteilen und in Unkenntnis, von der europäischen Philosophie und von der asiatischen Weisheit gesprochen (Philosophie und Philousia). VII.Sie ist auch kein Ableger der Postmodernität, auch wenn diese jene bejaht und unterstützt. Es ist freilich richtig, dass ein gewisser Zusammenhang zwischen Dekolonialisierung und Dekonstruktion besteht. 10.2. Was interkulturelle Philosophie ist I. Sie ist eher eine philosophische Grundüberzeugung, eine Einstellung, ja eine Denkrichtung, die alle kulturellen Prägungen der einen philosophia perennis wie ein Schatten begleitet und verhindert, dass diese sich verabsolutieren. Die Rede von der einen philosophia perennis hier darf nicht hypostasiert, reifiziert oder ontologisiert werden. Jenseits eines Essentialismus geht es hier um ein Primat der philosophischen Fragestellungen, die im Sinne der Familienähnlichkeiten Wittgensteins ein anthropologischuniverselles Reservoir darstellen und alle unterschiedlichen Zentren der Weltphilosophie miteinander verbinden. II. Sie verfährt methodisch so, dass sie kein Begriffssystem unnötig privilegiert und auf begriffliche Konkordanz aus ist. So leistet sie einen wesentlichen Beitrag zu einem befreienden Diskurs. Daher ist auch die Rede einiger lateinamerikanischer Philosophen von einer 23 befreienden Philosophie völlig richtig. Es ist eine selbstverschuldete Angst, zu meinen, interkulturelle Philosophie dekonstruiere die Begriffe Wahrheit, Kultur, Religion und Philosophie. Was sie jedoch deutlich werden lässt, ist der extrem relativistische und verabsolutierende Gebrauch, der von diesen Begriffen gemacht worden ist und immer noch gemacht wird. Ist Philosophie etwas Universelles, was sie zweifelsohne ist, so kann sie nicht die Verabsolutierung einer philosophischen Konvention bejahen. III. Sie indiziert demnach einen Konflikt, weil die lange vernachlässigten philosophischen Kulturen, die aus Ignoranz, Arroganz und auch wegen diverser außerphilosophischer Faktoren missverstanden und unterdrückt wurden, im heutigen Weltkontext der Philosophie ihre Gleichberechtigung einklagen. IV. Sie ist die Einsicht in die Notwendigkeit, Philosophiehistorie von Grund auf neu zu konzipieren und zu gestalten. Die Universalität der philosophischen Rationalität zeigt sich so in verschiedenen philosophischen Traditionen, transzendiert diese jedoch auch. V. Bei der interkulturellen Philosophie geht es um die Konzeption einer Philosophie, die das eine Omnipräsente der philosophia perennis in vielen Rassen, Kulturen und Sprachen hörbar macht. Interkulturelle Philosophie wehrt die mächtige Tendenz einiger Philosophien, Kulturen, Religionen und politischen Weltanschauungen ab, sich zu globalisieren. Die europäische technologische Denkungsart darf sich nicht die gesunde Vielfalt der Kulturen einverleiben: Verwestlichung ist nicht ohne weiteres Europäisierung. Man möchte fast von einem Mythos der Europäisierung der Menschheit sprechen. Die Ansichten von Philosophen wie Hegel, Husserl, Heidegger liefern zahlreiche Indizien dafür. 24 VI. Die interkulturelle Philosophie entwirft ein Modell der Philosophie, das die allgemeine Applizierbarkeit des Begriffs Philosophie unter legitimer Anerkennung der Vielfalt philosophischer Zentren und Ursprünge bejaht. VII.Sie legt daher den historischen Kontingenzcharakter einer philosophisch-historiographischen Praxis bloß, die alle nicht-europäischen Philosophien im Rahmen und nur vom Standpunkt der europäischen Philosophie her thematisiert. Aufzuzeigen, dass es aber auch anders herum ebenso legitim und möglich ist, darin besteht eines der Anliegen der interkulturellen Philosophie. Sie ist eine Quelle der Bereicherung und Horizonterweiterung im Dienste einer interkulturellen Verständigung und Kommunikation. VIII.Sie weist die Enge und die metonymische Ungenauigkeit bei der Feststellung der Philosophie zurück, weil die Sache der Philosophie in dem einem Namen, im Ausdruck Philosophie nicht aufgeht. Es macht wenig Sinn, das lexikalische Argument derart ausdehnend zu strapazieren. IX. Sie weist auch die unbegründeten Ansprüche des sogenannten linguistischen Arguments zurück, das eine bestimmte Sprachstruktur, z. B. die indoeuropäische essentiell mit philosophischem Denken verbindet. Hier hat Gadamer Recht, wenn er sagt, dass das, was in einer Sprache gesagt wird, auch in einer anderen Sprache gesagt werden kann (Gadamer 1993). Freilich ist die Art und Weise des Sagens kaum übersetzbar. Sie lehnt die Fiktion einer totalen Übersetzbarkeit ebenso ab, wie die einer radikalen Unübersetzbarkeit, und plädiert für das Vorhandensein einer anthropologisch verankerten Fähigkeit zur Übersetzung. Selbst unsere eigenen syntaktischen und semantischen Betätigungen sind – recht verstanden – Übersetzungen interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) unserer Empfindungen, Erlebnisse und Vorstellungen. Vor aller Komparatistik auf jedwedem Gebiet gilt daher, sich die Kultur der Interkulturalität, sprich interkulturelle Kompetenz zu eigen zu machen, um so die Vorbedingungen für die Möglichkeit eines in gegenseitiger Achtung und Toleranz durchgeführten philosophischen Gesprächs zu schaffen. Vergleichende Philosophie ist, um eine altbekannte Metapher zu bemühen, ohne die interkulturelle philosophische Orientierung blind; interkulturelle Philosophie ist ohne die vergleichende Philosophie lahm. 11.Zum Aufklärungspotenzial interkultureller Philosophie Selbst heute noch hört und liest man in fachphilosophischen und fachtheologischen Kreisen zwei Vorwürfe hinsichtlich z. B. der Philosophie und Religion Indiens: Der westliche Fachphilosoph meint, die indische Philosophie sei zu religiös und verwechsele Philosophie mit Religion; der christlich-westliche Theologe dagegen ist der Ansicht, indische Religion sei zu philosophisch und verwechsele Religion mit Philosophie. Das Besondere daran ist, dass sie widersprüchlicher Natur sind. Dass hier fast paradigmatisch, aprioristisch und vor allem Vergleich das tertium comparationis in der je eigenen philosophischen und theologischen Tradition mit einem universalistischen Geltungsanspruch dingfest gemacht wird, braucht nicht weiter begründet und erläutert zu werden. Im Geiste der Unparteilichkeit interkulturellen Philosophierens sei auf eine eher ironische und beinahe peinliche Situation aufmerksam gemachen. Es geht um die Reaktion seitens der indischen Philosophie (Darshana) auf die Urteile der europäischen Philosophie: Indische Philosophie sei intuitiv, spirituell, nicht analytisch und dgl. Studierte man in den 1950‘er Jahren an der Universität Kalkutta, hörte man von den akademischen Philosophen Indiens, indische Philosophie sei spirituell und stehe höher als die europäische Philosophie, die viel zu materialistisch sei. Die negative Besetzung des Ausdrucks spirituell münzte die indische Seite positiv um. Hegel hätte sich gefreut, nur mit umgekehrten Vorzeichen. ■■ Zu Recht wird daher immer wieder die Frage gestellt: Warum haben die vergleichenden Studien wie z. B. die Disziplin der komparativen Philosophie uns eher enttäuscht und nicht zu dem erhofften Erfolg einer interkulturellen und interreligiösen Verständigung geführt? Man hat sogar vom Anspruch und Elend der vergleichenden Philosophie besprochen. Es war Mircea Eliade, der von einer zweiten missglückten Renaissance (Eliade 1973:75f.) sprach.5 Er meinte damit, dass die Entdeckung des indischen Geistes am Ende des 19. Jahrhunderts nur von den Indologen aber nicht von den Fachphilosophen, Fachtheologen, Historikern ernst genommen wurde. Trotz vieler Enttäuschungen hinsichtlich der Versprechungen und Hoffnungen der vergleichenden Philosophie, sei hier dennoch für sie im Dienste der Philosophie, jedoch unter fünf Bedingungen plädiert: Erstens sollen sich die Philosophen von den engen dogmatischen Kulturalismen und Traditionalismen befreien. Zweitens sollen andere, manchmal radikal andere Möglichkeiten des Philosophierens anerkannt und diskutiert werden. Drittens soll die Entdeckung der Differenzen nicht stiefmütterlich behandelt werden. Viertens ist der Philosoph qua Philosoph, hier besonders der vergleichende Philosoph, in der Suche nach Wahrheit zutiefst verpflichtet, unabhängig von seiner traditionellen, schulmäßigen Zugehörigkeit und seiner Präferenzen für manche Denk- und Handlungsmuster, die orthafte Ortlosigkeit des Philosophierens nicht außer Acht zu lassen. Und fünftens soll die Wahrnehmung der Differenzen für das philosophische Geschäft nicht nur als interessant, sondern als ein Reichtum und als fruchtbar empfunden werden. Denn, wer nur Bestätigungen des eigenen Standpunktes sucht, kehrt zu einer zwar komfortablen, aber doch 25 sehr trügerischen Selbstzufriedenheit zurück. Nach Plessner kommt eine solche Wende im philosophischen Denken der Verabsolutierung einer bestimmten anthropologischen Möglichkeit gleich. Da interkulturelle philosophische Orientierung sich auch durch die oben genannten Merkmale definiert, stellt sie eine notwendige und hinreichende Bedingung für die Möglichkeit und Fruchtbarkeit einer komparativen Philosophie dar, die dem Ziel einer interkulturellen Kommunikation und Verständigung dient. Indische, asiatische und europäische Philosophien können voneinander lernen, vorausgesetzt, sie entwickeln auch eine Sensibilität für ihre Differenzen. Es ist eine hegemoniale historische Kontingenz, dass die europäische Philosophie sich entweder einseitig universalisierte oder die außereuropäischen Philosophien als Philosophien erst gar nicht ernst- und wahrnahm. Die heutige hermeneutische de facto Situation im weltphilosophischen Diskurs mahnt zur Selbstbescheidung und fordert von uns allen die Kultivierung einer Tugend der Verzichtleistung auf den Absolutheitsanspruch. ■■ Es ist eine allgemeine, nicht unberechtigte Feststellung, dass einige Merkmale einer bestimmten Denktradition in einigen anderen fehlen. Dies betrifft sowohl die Fragestellungen als auch Lösungsansätze. Nicht unerwähnt bleiben darf jedoch, dass dies auch intrakulturell gilt. Daher scheint die Vorsilbe intra- auf die Vorsilbe inter- zurückführbar zu sein. Leider gehört es zu den festgefahrenen „Dogmen des Orientalismus“ (Matilal 2002: 370ff.), dass das europäisch-westliche Denken dieses Fehlen mit einem Mangel gleichsetzte und es stellenweise heute noch tut.6 Wer aber das Fehlen mit einem Mangel gleichsetzt, traktiert die Kategorie der Differenz reduktiv, weil er eine „Unifizierung des Wahren“ ab ovo vornimmt und, um mit Paul Ricoeur zu sagen, eine „erste Gewaltsamkeit“, eine „erste Fehltat“ (Ricoeur 1974:152) begeht. 26 Das Vorhandensein und Nichtvorhandensein einiger Merkmale und Unterscheidungen deuten auf die prinzipielle kreative Möglichkeit des autonomen menschlichen Geistes hin und lehren uns, dass diese Unterscheidungen nicht essentialistisch für Philosophie missdeutet werden dürfen.7 ■■ Die Situierung der philosophischen Rationalität in den interkulturellen weltphilosophischen Kontext bringt mit sich, dass die Universalität des rationalen philosophischen Denkens die lokalen Differenzen transzendiert, aber diese zugleich auch umfasst und begreift. Die philosophische Rationalität lebt in und durch diese Differenzen. Nur auf diesem Wege können wir die beiden extremen Positionen eines Relativismus und eines Essentialismus vermeiden. Interkulturelle philosophische Orientierung, die als eine grundsätzliche philosophische Einstellung das Philosophieren wie ein Schatten begleitet, ist ein Prolegomenon zur Weltphilosophie, zum weltphilosophischen Denken in seinen kulturspezifischen Gestalten mit grundsätzlichen Gemeinsamkeiten und Differenzen. So vermittelt eine solche Einstellung zwischen der allzu einheitlichen Tendenz der Moderne und der übertriebenen Tendenz zur Pluralität der Postmoderne. Das Ziel einer interkulturell orientierten philosophischen Hermeneutik ist im Wesentlichen weder die Entdeckung bloß der Parallelitäten, die bisweilen das Vorhandensein einiger Merkmale der eigenen Kultur in anderen Kulturen sehen, noch die Feststellung vom Nichtvorhandensein einiger Eigenschaften der eigenen Kultur in den anderen, was oft als Mangel gedeutet wird. Vielmehr geht es hier um die anthropologisch-hermeneutisch verankerten unterschiedlichen Verstehens- und Kommunikationsentwürfe, die nicht nur unterschiedliche Feststellungen und Antwortmuster kennen, sondern darüber hinaus grundsätzlich andere philosophische Möglichkeiten und Themen anschneiden, und so von einem unendlich offenen Reservoir des Verhältnisses zwischen Anthropologie, Philosophie und Hermeneutik zeugen. interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Interkulturelle Hermeneutik ist diesem anthropologischen Reichtum zutiefst verpflichtet. Zum Aufklärungspotential des Projekts der interkulturellen Philosophie gehören: I. Die interkulturelle Sicht macht deutlich, dass es den absoluten Anspruch des einen nicht gibt, es sei denn, man zeichnet aus Vorurteilen oder Unkenntnissen einen Ort, eine Zeit, eine Sprache, eine Religion oder eine Philosophie aus. II. Die begriffliche und inhaltliche Klärung der interkulturellen Philosophie zeigt ferner, dass die Philosophiegeschichte selber ein unendliches Reservoir unterschiedlicher Interpretationen, ein hermeneutischer Ort ist. III. Hieraus folgt, dass es keine bloß apriorische, per definitionem festgelegte Bestimmung der Philosophie und Kultur geben kann. Wer den Terminus interkulturelle Philosophie für ungenau hält, weil er exakte Kriterien vermisst, vergisst, dass auch bei der Identifizierung der Kulturen und politischen Weltanschauungen ein gewisses Maß an Traditionsgebundenheit und persönlicher Entscheidung nicht zu leugnen ist. IV. Wer von philosophischen Argumenten allgemeine Akzeptanz und Einstimmigkeit erwartet, überfrachtet diese. Auch im Kampf der philosophischen Argumente spielen die philosophischen Dispositionen und Sozialisationen eine z. T. sogar entscheidende Rolle (Mall 1996). V. So ist und bleibt die Frage nach dem Wesen der Philosophie unterscheidbar, weil eine jede schulmäßige Antwort einer bestimmten historisch gewordenen philosophischen Tradition ihre Berechtigung und Grenze aufweist. Ferner unterliegt eine jede Definition der Philosophie selbst der philosophischen Diskussion. Was uns verbindet, mag der gemeinsame Traum von einer letztbegründenden Instanz sein, aber sobald dieser Traum sich in einer bestimmten Gestalt konkretisiert und eine universelle Akzeptanz und Geltung beansprucht, wird er zur Lüge. Interkulturelle philosophische Orientierung entlarvt diese Lüge und lässt den offenen eist der Philosophie wehen, wo immer er will. Steht dann die Unentscheidbarkeit der Wesensfrage selbst zur Diskussion? Wie mit diesem Widerspruch umgehen, ist die Frage und nicht, wie ihn beseitigen. So hat Plessner recht, wenn er schreibt: „Diesen Widerspruch unter Berufung auf das Gebot der Widerspruchsfreiheit zurückweisen heißt auf die Selbsterkenntnis der Philosophie verzichten, welche dieses Gebot zur Diskussion stellt“ (Plessner 1979:90). VI. Sie hilft uns daher einen jeden Kulturalismus und Provinzialismus der Philosophie und in der Philosophie zu vermeiden. Mit Recht bemerkt Mircea Eliade, dass europäische Philosophie es nicht vermeiden kann, „provinzialistisch“ zu werden, wenn sie sich nur innerhalb ihrer eigenen Tradition bewegt (Eliade 1973:84). Diese Worte Eliades gelten im Geiste einer interkulturellen philosophischen Orientierung mutatis mutandis für alle philosophischen Traditionen. Es ist freilich eine historische Kontingenz, dass die europäische Philosophie zu lange monologisch verfahren ist. In einem Brief an Jaspers weist Hannah Arendt im Einklang mit dem Geist der interkulturellen Philosophie auf die Notwendigkeit einer deprovincialization of western philosophy (Kohler / Saner 1992:157) hin. Eine solche Forderung zeichnet die interkulturelle Philosophie konstitutiv aus, weil sie eine orthafte Ortlosigkeit besitzt, die es erlaubt, die Universalität der philosophischen Rationalität mit der Praktikabilität der jeweiligen philosophischen Traditionen in Verbindung zu bringen. 27 Das Projekt Interkulturelle Philosophie in Kombination mit der interkulturellen analogischen Hermeneutik und im Geiste der Hermeneutik der Überlappung, bringt eine längst fällige historiographische, begriffsgeschichtliche und lebensphilosophische Erweiterung und Vertiefung der Philosophie mit sich, essentialisiert die eine philosophische Wahrheit (philosophia perennis) nicht, schreibt ihr höchstens die Macht einer regulativen Idee zu, erkennt eine Pluralität der Geburtsorte der Philosophie und lässt sie orthaft ortlos sein. 12.Wie aber mit Differenzen umgehen? Es war Wittgenstein, der eine ähnliche Frage im Hinblick auf die Unausrottbarkeit des Widerspruchs stellte. Seit Menschengedenken wird versucht, Widersprüche im Denken und Handeln aufzulösen und das ideale Ziel der Widerspruchsfreiheit zu erreichen. Für Wittgenstein ist Widerspruch, wie er sagt, keine „Katastrophe“. „Ich möchte“, schreibt er weiter, „nicht so sehr fragen ‚Was müssen wir tun, um einen Widerspruch zu vermeiden?‘, als ‚Was sollen wir tun, wenn wir zu einem Widerspruch gelangt sind?‘“(Wittgenstein 1984:436). Wie Differenz definieren? Eine vorläufige Definition könnte lauten: Differenz besteht in den unterschiedlichen, alternativen Seins-, Denk- und Verhaltensweisen der Menschen. Diese können naturbedingt, gottgeschaffen oder menschengemacht sein. Darüber hinaus können Differenzen kulturelle, religiöse, psychologische, neurologische Gründe haben. Nicht so sehr die Gemeinsamkeiten, sondern eher die Differenzen (auf welchem Gebiet auch immer) sind es, die uns unangenehm sind und oft zu schaffen machen. Dahinter versteckt sich jedoch die Tendenz zur Vereinheitlichung. Gemeinsamkeiten genießen wir und unter Differenzen leiden wir. Dies scheint auf eine Sehn-(Sucht) nach Uniformierung hinzuweisen. Der Dichter-Philosoph Hölderlin schreibt unter der Überschrift Wurzel alles 28 Übels: „Einig zu sein, ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn / Unter den Menschen, dass nur Einer und Eines nur sei“(Hölderlin 1970:240). Daher: Wer mit Differenzen menschlich und gewaltfrei umgehen will, muss diese Uniformierungsgier überwinden. Seit Menschengedenken gehört es zum harten empirischen Befund, dass es Differenzen in der Welt der Natur, der Menschen, der Tiere, ja sogar der Götter gibt. Wird hier der Begriff Differenz verwendet, so werden in erster Linie darunter nicht die landläufigen Unterschiede der Ansichten, der Einsichten, der Standpunkte und dergleichen verstanden. Unter Differenz verstehe ich die fundamentalen kulturellen Differenzen, die ihre je eigenen nicht weiter reduzierbaren Möglichkeiten realisieren. Es gibt nicht die eine singuläre Anthropologie. Es gibt Theorien, die Differenzen erklären und begründen wollen. Und es ist gut so. Es gibt aber ebenso Theorien, die Differenzen beseitigen wollen. Was machen wir aber mit Theorien, die mit einem exklusivistischen Absolutheitsanspruch auftreten und eine Art theoretische und praktische Gewalt ausüben? Dass es Differenzen gibt, ist genug für ihre Erklärung, denn eine endgültige Begründung kann uns nicht gelingen, weil wir nicht vor, sondern nach den Differenzen ihrer gewahr werden. Zu sagen, dass es Differenzen immer geben wird, mag uns rein theoretisch, formal-logisch nicht einleuchten. Aber angesichts der Macht der ungeheuren Empirie scheint dies beinahe eine anthropologische Konstante zu sein. Differenzen werden nicht mutwillig von uns gesucht; sie widerfahren uns. So könnte man von einer unergründlichen, aber universellen Verbindlichkeit der Differenzen sprechen. Differenzen können uns verbinden, wenn wir von einer höheren Ebene einer reflexivmeditativen Einstellung die Einsicht entwickeln, dass die andere Sicht der Dinge auch eine Sicht ist, wenn sie nicht die einzige sein will. Worin besteht dann die Universalität dieser Verbindlichkeit, wenn die Differenzen nicht nur konträr, sondern interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) – nicht selten auch – kontradiktorisch sind? Denn ein radikaler Theist und ebenso ein radikaler Atheist sind wie Feuer und Wasser. Die hier angesprochene Verbindlichkeit scheint eigentlich dann darin zu bestehen, dass beide die Dinge sehr unterschiedlich buchstabieren. Sind nicht Gegenargumente auch dann Argumente, wenn sie sich gegenseitig widersprechen? Was machen, wenn Differenzen sich rein argumentativ nicht beseitigen lassen? Ein Vorschlag wäre, dass man eine Einstellung, eine Einsicht entwickelt, die eine andere Art, die Dinge zu sehen, auch eine legitime, alternative Art ist. Mit Alternativen muss man einen respektvollen alternativen Umgang pflegen. Eine solche Einstellung ist offen, tolerant und friedfertig und hilft uns, alle gewaltsamen, gebieterischen Umgangsformen mit den Differenzen zu vermeiden. Das Credo hier lautet daher: den Welttext lesen und lesen lassen. Aus dem oben Gesagten folgt, dass wir die beiden selbstverschuldeten Fiktionen einer totalen Kommensurabilität und einer radikalen Inkommensurabilität, d. h. eines totalen Konsenses und Dissenses aufgeben und Überlappungen suchen und finden, die Verstehenwollen und Verstandenwerdenwollen Hand in Hand gehen lassen. So ist das Motto, wie schon erwähnt: Konsens soll sein, Dissens ist da und Kompromiss ist unser aller Schicksal. Dass die Kompromisse nicht faul sein sollen, versteht sich von selbst. Unter welchen Bedingungen sind dann Kompromisse nicht faul? Eine notwendige Bedingung hierfür ist die Einsicht in den Wert z B. der Gegenseitigkeit. Absolutheitsansprüche führen zu faulen Kompromissen. Karl Jaspers stellte die Frage, ob man solchen Ansprüchen gegenüber neutral sein kann? Und er antwortete: nein. Ist die hier vorgeschlagene Akzeptanz der Differenzen grenzenlos? Eigentlich nicht. Denn alle Lesarten sind zulässig bis auf eine Lesart, welche die eine absolute Lesart sein will. Eine Lesart, die neben sich keine andere duldet, ist in Theorie und Praxis abzulehnen. Es gibt einen theoretischen Fundamentalismus, eine theoretische Intoleranz, eine theoretische Gewalt, die unter für sie günstigen Bedingungen zur praktischen Gewalt führt. So enthält unsere, hier vorgeschlagene Konzeption einer interkulturellen Orientierung, auf jedwedem Gebiet auch eine Theorie und Praxis der Gewaltlosigkeit. Seit Menschengedenken gibt es das Problem des Verhältnisses von Einheit und Vielfalt. Für Hegel ist das Eine das Wahre, für Adorno genau das Gegenteil. Wie lässt sich dieses Verhältnis kommunikationstheoretisch mit dem hier vorgestellten Ansatz her besser regeln? Es lässt sich besser nicht so sehr durch, erstens Einheit in der Vielfalt, zweitens Einheit und Vielfalt, drittens weder Einheit noch Vielfalt, viertens sowohl Einheit als auch Vielfalt regeln, sondern fünftens, vielmehr durch Einheit angesichts der Vielfalt. 13.Fazit Für den Umgang mit Differenzen im Geiste einer Hermeneutik der Überlappung seien hier einige tentative Imperative formuliert: ■■ Versuche stets Dissense zu minimieren und Konsense zu maximieren, ohne jedoch diese zu essentialisieren oder zu ideologisieren. ■■ Merke, dass es keine allseitig akzeptable, theoretisch argumentative Widerlegung der Differenzen je gegeben hat noch gibt, und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht geben wird. Und dies gilt auch für das Motto: Macht der besseren Argumente. Auf dem Wege gegenseitiger Überzeugungen sind Argumente nur notwendige nicht jedoch ohne weiteres hinreichende Bedingungen. Argumente und Präferenzen verhalten sich fast so wie das Huhn und das Ei. ■■ Stilisiere weder Ähnlichkeit zur Identität noch Differenz zur Unverbindlichkeit und Beliebigkeit. 29 ■■ Gestehe dem Gegner, dem Gesprächspartner das gleiche Recht, eine Position zu beziehen, das Du für Dich in Anspruch nimmst. ■■ Bekämpfe, soweit möglich, einen jeden Standpunkt, der neben sich keinen anderen zulässt und duldet. Absolutheitsansprüche mit universellem Geltungsanspruch sind schon theoretisch fundamentalistisch, intolerant und gewalttätig. Praktiziere reflexiv-meditativ eine Ethik der theoretischen und praktischen Gewaltlosigkeit. ■■ Auch wo eine Entscheidung in einem streng binären EntwederOder zu enden droht, vertraue der vermittelnden, medialen Kraft der Kompromisse, die weder nur Sieger noch nur Verlierer kennen und einen Win-Win Prozess einleiten. ■■ Leite nicht die Unmöglichkeit des Verstehens von einer ab ovo Feststellung radikaler Unterschiede zwischen den Kulturen ab, sondern von dem Scheitern der von Dir unternommenen konkreten Verstehensversuche ab. ■■ Versuche weder Einheit auf Kosten der Differenz, noch Differenz auf Kosten der Einheit zu hypostasieren, denn beide neigen dazu, das menschliche Denken zu fesseln. Der hier vorliegende Beitrag wird mit den Worten zweier Dichterphilosophen aus dem Westen und Osten beschlossen. Der Dichter-Philosoph Hölderlin schreibt und fragt: „Einig zu sein ist göttlich und gut, woher ist die Sucht denn/ Unter den Menschen, dass nur einer und eines nur sei“ (Hölderlin 1970:241). Man beachte, Hölderlin verwendet mit Bedacht nicht den Ausdruck Sehnsucht, sondern Sucht nach Einheit. Bei dem indischen Dichter-Philosophen Tagore heißt es: „Wenn je eine solche Katastrophe über die Menschheit hereinbrechen sollte, dass eine einzige Religion (Kultur, Philosophie; R.M.) alles überschwemmte, dann müsste Gott für eine zweite Arche Noah sorgen, um 30 seine Geschöpfe vor seelischer Vernichtung zu retten“ (Tagore zitiert nach Mensching 1966:178). 14.Literatur Adorno, Th. (1973): Negative Dialektik. Frankfurt a. Main: Suhrkamp. Demorgon, J. (2006): Multikultur, Transkultur, Leitkultur, Interkulutur. In: Nicklas, H. (Hrsg.): Interkulturell denken und handeln. Theoretische Grundlagen und gesellschaftliche Praxis. Bonn: Campus Verlag, S. 27-36. Dilthey, W. (1973): Gesammelte Werke. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. Elaide, M. (1975): Die Sehnsucht nach dem Ursprung. Von den Quellen der Humanität. Wien: Europaverlag. Heine, H. (1997): Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Stuttgart: Reclam. Hölderlin, F. (1970): Sämtliche Werke und Briefe. München: Carl Hanser. Hörisch, J. (1988): Die Wut des Verstehens. Zur Kritik der Hermeneutik. Frankfurt a. Main: Suhrkamp. Hume, D. (1973): Ein Traktat über die menschliche Natur. Hamburg: Meiner Verlag. Gadamer, H. G. (1993): Wahrheit und Methode. Tübingen: Mohr Siebeck. Geertz, C. (1995): Welt in Stücken. Wien: Passagen Verlag. Kohler, L. / Saner, H. (1992): Hannah Arendt / Karl Jaspers’ Correspondance 19261969. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Mall, R. A. (1995): Philosophie im Vergleich der Kulturen. Darmstadt: WBG. Mall, R. A. (1996): Was konstituiert philosophische Argumente? Bremer Philosophica 1996(1). Mall, R. A. (2000a): Intercultural Philosophy. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. Mall, R. A. (2000b): Interkulturelle Verständigung. Primat der Kommunikation vor interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) dem Konsens. Ethik und Sozialwissenschaften 11(3), S. 337-350. Mall, R. A. (2010): Vernunft – interkulturell. In: Yousefi, R. H. (Hrsg.): Viele Denkformen – eine Vernunft. Nordhausen: Traugott Bautz, S. 35-57. Mall, R. A. (2012): Indische Philosophie – Vom Denkweg zum Lebensweg. Freiburg: Alber. Matilal, B. K. (2002): Philosophy, Culture and Religion. Mind, Language and World. Delhi: Motilal Banarsidas. Mensching, G. (1966): Toleranz und Wahrheit in der Religion. München: Siebenstern Verlag. Mohanty, J. N. (2000): Classical Indian Philosophy. New York / Oxford: Rowman and Littlefield Publisher. Pacyna, T. (2012): Was ist transkulturell an Musikvermittlung und reicht das Konzept der Transkulturalität, um Musik im Unterricht zu vermitteln? In: Binas-Preisendörfer, S. / Unseld, M. (Hrsg.): Transkulturalität und Musikvermittlung. New York: Peter Lang, S. 63-80. Plessner, H. (1979): Die Gesellschaft und das Selbstverständnis des Menschen. Philosophische Aspekte. Universitas. Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Literatur 34(1), S. 9-15. Rawls, J. (1987): The Idea of Overlapping Consensus. Oxford Journal of Legal Studies 71, S. 1-25. Ricoeur, P. (1974): Geschichte und Wahrheit. München: List Verlag. Ricoeur, P. (1998): Die Geschichte ist kein Friedhof. Die Zeit 1998(42). Schütz, A. (1972): Das Fremde. Gesammelte Aufsätze. Den Haag: Martinus Nijhoff. Stenger, G. (2006): Philosophie der Interkulturalität. Erfahrung und Welten. Eine phänomenologische Studie. Freiburg / München: Alber. Waldenfels, B. (1997): Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden. Frankfurt a. Main: Suhrkamp. Wittgenstein, L. (1984): Über Gewissheit. Frankfurt a. Main: Suhrkamp. Endnoten 1. In diesem Kontext sind die Worte Humes überzeugend: „Nicht allein in der Poesie und Musikmüssen wir unserem Geschmack und unserem Gefühl (sentiment) folgen, sondern auch in der Philosophie. Wenn ich von irgend einem Satz überzeugt bin, so heißt dies nur, dass eine Vorstellung stärker auf mich einwirkt. Wenn ich einer Beweisführung den Vorzug vor einer anderen gebe, so besteht, was ich tue, einzig darin, dass ich aus meinem unmittelbaren Gefühl entnehme, welche Beweisführung in ihrer Wirkung auf mich der anderen überlegen ist“ (Hume 1973:141). Auch wenn Hume hier die Rolle der Argumente ein wenig herunterzuspielen scheint, behält er Recht mit seiner Einsicht und Ansicht, dass Argumente allein nicht ausreichen (Hume 1973). 2. Vgl. Mall 2010:35ff. und Demorgon 2006:27ff. 3. Vgl. Pacyna 2012:63ff. 4. Vgl. Mall 2000b:337ff. 5. Mircea Eliade schreibt: „Die „Entdeckung“ der Upanishaden und des Buddhismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wurde als kulturelles Ereignis mit weitreichenden Konsequenzen gefeiert. Man erwartete eine radikale Erneuerung des westlichen Denkens als Folge der Konfrontation mit der indischen Philosophie. Wie bekannt ist, trat jedoch dieses Wunder einer zweiten Renaissance nicht nur nicht ein, sondern, mit Ausnahme der Mythologisierungswelle, die Max Müller ausgelöst hatte, gab die Entdeckung der indischen Geistigkeit keineswegs den Anstoß für irgendeine bedeutende kulturelle Schöpfung. Mehrere Gründe werden für den Fehlschlag verantwortlich gemacht wie z. B. die Verdunkelung der Metaphysik und der triumphale Zug der materialistischen und positivistischen Ideologien. Er schreibt: „Der Bankrott der ‚zweiten Renaissance‘ […] kann also nicht der ausschließlichen Konzentration der Orientalisten auf die Philologie angelastet werden. Die Renaissance trat aus dem einfachen Grund nicht ein, weil es dem Studienfach des Sanskrit und anderer orientalischer Sprachen nicht gelang, über den Kreis der Philologen und Historiker hinauszudringen, während in der italienischen Renaissance Griechisch und das klassische Latein nicht nur von Grammatikern und Humanisten, sondern ebenso von Dichtern, Künstlern, Philosophen, Theologen und Wissenschaftlern studiert wurden“ (Eliade 1975:75f.). 31 6. In einem Gespräch mit dem indischen Philosophen und Phänomenologen J. N. Mohanty, fragte einmal Donald Davidson, warum man indische Philosophie studieren sollte, wenn die indischen Philosophen gleiche Antworten auf gleich geartete Fragen gegeben haben wie die westlichen Philosophen? Freilich wäre eine vergleichende Philosophie im Sinne eines bloßen Nebeneinanderstellens gleichartiger Positionen ein unfruchtbares Unternehmen. Unsere interkulturelle philosophische Orientierung hier zielt aber auf neue, kreative Möglichkeiten, sowohl im Hinblick auf die philosophischen Fragestellungen als auch auf die Lösungsansätze. Nur so kann eine globale Philosophie als ein Menschheitsdiskurs zustande kommen, jenseits der Provinzialismen nationaler, geographischer und geschichtlich-gewordener Kulturen. Der interkulturell verankerte Sinn einer orthaft ortlosen Philosophie lässt sich restlos nicht kulturell vereinnahmen. Interkulturalität und Kulturspezifität sind kompatibel. 7. Der bekannte Phänomenologe und indische Philosoph Mohanty, schreibt: “It needs, however, to be emphasized that the talk of ‘lacks’ here must not be construed as defects, but rather as pointing to another possibility, from which we may learn the lesson that none of these distinctions is essential for philosophy“ (Mohanty 2000:51). 32 interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Die Interkulturalität als politischer Begriff in Ecuador Interculturality as a political concept in Ecuador Philipp Altmann Abstract (Deutsch) Promotion in Soziologie (FU Berlin) mit einer Arbeit über den Diskurs der Indigenenbewegung in Ecuador. Studium der Soziologie, Ethnologie und Spanischen Philologie an den Universitäten Trier und Madrid Seit der Verfassung von 2008 ist Ecuador ein „interkultureller“ (Art. 1) Staat. Damit hat die Verfassungsgebende Versammlung lang jährigen Forderungen der Indigenenbewegung im Land nachgegeben und den ersten Schritt zu einer Umgestaltung von Staat und Gesellschaft gemacht. Auch wenn alle Beteiligten einräumen, dass noch ein langer Weg zu gehen ist, hat es die Interkulturalität ins Herz des staatlichen Diskurses geschafft. Bei jeder Gelegenheit wird darauf verwiesen, dass eine bestimmte Institution, ein Programm oder ein Fest interkulturell ist – in aller Regel ohne nähere Definitionen. Hier soll der Begriff der Interkulturalität und seine Geschichte und Entwicklung in Ecuador näher untersucht werden. Damit soll ein besseres Verständnis der Forderungen der Indigenenbewegung und der Position dieses Begriffes in ihrem Diskurs möglich gemacht werden. Insbesondere soll herausgearbeitet werden, was genau unter Interkulturalität verstanden wird, wovon dieser Begriff sich abgrenzt und wie sich die verschiedenen Organisationen einen interkulturellen Staat bzw. eine interkulturelle Gesellschaft vorstellen. Schlagwörter: Interkulturalität, Indigenenbewegung, Ecuador Abstract (English) Since the Constitution of 2008, Ecuador is an “intercultural” (Art. 1) State. With this, the Constituent Assembly gave in to the long-standing demands of the national indigenous movement and made the first step to a reconfiguration of State and society. Even if all parties admit that there is still a long way to go, the interculturality did make it into the heart of the state discourse. At every opportunity, the intercultural character of a certain institution, a program or a festivity is being pointed out – generally without a closer definition. Here, the concept of Interculturality and its history and development in Ecuador will be investigated more closely. With this, a better understanding of the demands of the indigenous movement and the position of this concept within their discourse will be made possible. Especially, it will be pointed out, what exactly is understood as Interculturality, from what this concept differs and how the different organizations imagine an intercultural State or an intercultural society. Keywords: Interculturality, Indigenous Movement, Ecuador 33 1. Einleitung Die Verfassung von 2008 erklärt Ecuador zu einem „interkulturellen, plurinationalen“ (Art. 1) Staat und erfüllt damit langjährige Forderungen der Indigenenbewegung. Schon die vorherige Verfassung von 1998 hat einen Schritt in diese Richtung gemacht, sie erklärte Ecuador zu einem „plurikulturellen und multiethnischen“ (Art. 1) Staat – und vermied damit explizit die politisch brisanten Begriffe Interkulturalität und Plurinationalität. Tatsächlich kämpft die ecuadorianische Indigenenbewegung seit der zweiten Hälfte der 1970er, als Ganzes seit den 1990er Jahren, für eine pluralistische Umgestaltung des Staates und der Gesellschaft in Ecuador. So sollen die indigenen Völker, ihre Kultur und ihre Tradition geschützt und weiterentwickelt werden. Gleichzeitig soll eine Demokratisierung der ganzen Gesellschaft stattfinden, die sich gegen Rassismus, Paternalismus und Exklusion richtet. Plurinationalität und Interkulturalität sind die beiden Begriffe, die die Diskurse und konkreten Forderungen der verschiedenen Indigenenorganisationen zusammenfassen. Der gut untersuchte Fall Ecuadors (etwa: Walsh 2003) kann es damit möglich machen, zumindest einige der Entwicklungsgeschichten der „Black Box ,Interkulturalität‘“ (Földes 2009:504) nachzuzeichnen. Die Indigenenbewegung in Ecuador ist eine sehr pluralistische soziale Bewegung, die aus relativ selbstständigen Organisationen von der lokalen bis zur nationalen Ebene besteht, die miteinander – je nach Situation – kooperieren oder konkurrieren. Diese Organisationen verfolgen verschiedene und teilweise widersprüchliche Strategien und Diskurse, mit denen sie für die Rechte der Indigenen in Ecuador kämpfen. Die numerische Stärke der Indigenenorganisationen und ihrer Bewegung ist umstritten, genauso wie der Anteil der Indigenen an der Gesamtbevölkerung. Fest steht jedoch, dass die Indigenenbewegung seit den 1980er Jahren die stärkste soziale Bewegung des Landes ist, auch wenn sie unter der Regierung 34 von Rafael Correa seit 2006 an Einfluss verloren hat. Nach den Angaben des letzten Zensus 2010 (INEC 2010) leben 14.483.499 Menschen in Ecuador. Davon verstehen sich 1.018.176 Personen oder sieben Prozent der Gesamtbevölkerung als Indigene. Die Gruppe der Schwarzen, Afroecuadorianer und Mulatten ist zusammengerechnet etwa gleich groß (1.041.559), genauso wie die der Montubios, einer Volksgruppe von Bauern im Küstengebiet (1.070.728). Die große Mehrzahl der Bevölkerung, 10.417.299 Menschen, versteht sich als Mestizen, das heißt, sie haben sowohl indigene, als auch europäische Vorfahren (INEC 2010). Diese Zahlen sind aufgrund der langjährigen Unterdrückung und Diskriminierung der Indigenen und den entsprechenden Effekten bei Befragungen nur bedingt vertrauenswürdig. Sowohl die Indigenenorganisationen als auch viele Wissenschaftler gehen von einem deutlich höheren Anteil an Indigenen aus. Die vorliegende Arbeit bedient sich einer begriffszentrierten Diskursanalyse. Diese Methode will über die Untersuchung der in den Diskursen der jeweiligen Akteure zentralen politischen Begriffe, ihrer Entwicklung oder Verschiebung und des Auftauchens alternativer Begrifflichkeiten die Diskurse als solche und ihre Entwicklung besser erfassen. Politische Begriffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie abstrakt, mit Forderungen verbunden und umstritten sind und innerhalb des jeweiligen Diskurses eine Geschichte und Anknüpfungspunkte haben. In diesem Sinne wird der folgende Text die Einführung des Begriffs der Interkulturalität in den Diskurs der ecuatorianischen Indigenenbewegung nachzeichnen und seine Verankerung und nähere Definition dort analysieren. Dieser Prozess ist mit einer zunehmenden Verallgemeinerung des Begriffes verbunden, die es ihm ermöglicht, Inhalte aufzugreifen, die ihm ursprünglich fern sind und ihn so anschlussfähig an andere Begriffe und Diskurse macht. interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) 2. Von der bikulturellen zur interkulturellen Erziehung Es ist nicht klar, wie genau der Begriff der Interkulturalität entstanden und nach Lateinamerika und Ecuador gekommen ist (Walsh 2000:11). Das vorliegende Material erlaubt drei Entstehungsgeschichten. Für Galo Ramón (2009:133) ist die Interkulturalität als theoretischer Begriff der Erziehungswissenschaften in den USA der 1960er Jahre entstanden. Das würde die Einführung des Begriffes im Rahmen der Erziehung für und von Indigenen erklären und eine Übernahme innerhalb des Kontextes von Entwicklungszusammenarbeit und Bildungsprojekten nahelegen. Fernando García und Luis Tuasa (2007:18) sehen im französischen Soziologen Edgar Morin den Begründer des Begriffes der Interkulturalität. In den 1970er Jahren soll er ihn als nicht-diskriminierende und gewaltfreie Alternative zum bestehenden Begriff von Kultur entwickelt haben. Diese Version wird durch den großen Einfluss von Sozialwissenschaftlern auf die diskursive Entwicklung der Indigenenbewegung Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre gestützt. Eine dritte Variante könnte mit der Existenz des Interkulturellen Dokumentationszentrums (Centro Intercultural de Documentación, CIDOC) von 1961 bis 1976 in Cuernavaca, Mexiko, zusammenhängen. Dieses Zentrum wurde von Ivan Illich geleitet und war der Befreiungstheologie und dem undogmatischen Sozialismus verpflichtet (Kaller-Dietrich 2008). Für diese Übernahmegeschichte spricht das große Engagement der katholischen Kirche, vor allem von befreiungstheologischen Gruppen, zugunsten der Indigenen und ihrer Organisationen in den 1960er und 1970er Jahren. Tatsächlich gehen viele der überregionalen Bildungsprojekte auf kirchliche Bemühungen zurück. Nachprüfbar ist nur die Entwicklung der zweisprachigen Erziehung und die Integration kultureller Fragestellungen in ihr. Seit dem Entstehen der ersten indigenen Organisationen in den 1920er Jahren war die Gründung von selbstverwalteten Schulen ein zentrales Ziel der Indigenenbewegung. Die ersten zweisprachigen Schulen wurden in den 1930er Jahren von der in der Gründung befindlichen Ecuadorianischen IndioFöderation (Federación Ecuatoriana de Indios, FEI) in Cayambe, Provinz Pichincha, aufgebaut (Moya 1987:391f.). Die zentrale Figur dieser Entwicklung war die Mitbegründerin der FEI, Dolores Cacuango. Die Schulen dienten nicht nur der Bildung der Kinder vor Ort, sondern auch der Alphabetisierung der Landbevölkerung und der Weiterbildung und Organisierung der Führungspersonen der Indigenenbewegung. Sie waren ein Ausgangspunkt für die Aufwertung der indigenen Identität und die Festigung indigener Traditionen. 1963 wurden sie nach langer klandestiner Arbeit und vielfältiger Verfolgung vom Staat anerkannt, reguliert und dem Bildungsministerium unterstellt (Lazos / Lenz 2004:6). Die Katholische Kirche unter dem Bischof von Riobamba und Befreiungstheologen Leonidas Proaño baute in den 1960er Jahren in der Provinz Chimborazo ein Erziehungssystem über Radio auf, die Volks-Radioschulen Ecuadors (Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE). Diese sollten einen Zugang zu Grundschulbildung und Alphabetisierung in Spanisch und Kichwa für Kinder und Erwachsene bieten, gleichzeitig aber im Sinne der Befreiungspädagogik eine Bewusstwerdung der Unterdrückung und Diskriminierung erlauben. Durch das starke Engagement der Kirche wurde Chimborazo zu einem der wichtigsten Zentren für zweisprachige Erziehung im Land (Lazos / Lenz 2004:7). Die Indigenenorganisationen vor Ort waren von Anfang an in die Entwicklung und Umsetzung der Programme der ERPE eingebunden, konnten sich so politisch und organisatorisch weiterentwickeln. Sie erlebten in den 1960er und 1970er Jahren ein bedeutendes Wachstum (Krainer 1996:43). 35 Im Amazonasgebiet wurde 1964 mit Unterstützung des katholischen Ordens der Salesianer eine Indigenenorganisation, die Interprovinzielle Föderation der Shuar-Zentren (Federación Interprovincial de Centros Shuar, FICSH), aufgebaut, die seit 1972 das Shuar-System der bikulturellen radiophonen Erziehung (Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar, SERBISH) betreibt. Dieses bietet Grundbildung und Alphabetisierung in Shuar und Spanisch an, legt aber besonderen Wert auf die Bewahrung der indigenen Traditionen und die Steigerung des Selbstwertgefühls der Shuar (Moya 1987:394, Lazos/ Lenz 2004:7f.). Auch in diesem Fall trug die Erziehungsarbeit entscheidend zur politischen und organisatorischen Entwicklung bei und ist ein Grund für den bis heute andauernden großen Einfluss der FICSH bei relativ geringer Mitgliederzahl. Durch eine koordinierte Anstrengung zur Alphabetisierung von 1980 bis 1984, an der auch verschiedene Indigenenorganisationen teilnahmen, konnten diese Bildungsprojekte weiter professionalisiert und integriert werden. Eine besondere Rolle spielte das Forschungszentrum für die Indigene Erziehung (Centro de Investigaciones para la Educación Indígena, CIEI) das seit Mitte der 1970er Jahren an der Päpstlichen Katholischen Universität Ecuadors (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE) aktiv war und an dem einige universitär gebildete Indigene teilnahmen. Das CIEI widmete sich der Erforschung von Methoden der Alphabetisierung in Kichwa und betrieb dazu ein Pilotprojekt in Cotopaxi, das ab 1980 die gesamte Alphabetisierungskampagne für Indigene beeinflussen sollte (Lazo / Lenz 2004:10). Parallel zu dieser Entwicklung wird der Begriff der Interkulturalität in den Diskurs über Erziehung und Bildung für Indigene in Lateinamerika eingeführt. Die beiden venezolanischen Anthropologen Esteban Mosonyi und Omar González stellten auf dem 39. Internationalen Kongress der Amerikanisten 1970 in Lima ihr Projekt einer interkulturellen Erziehung in einigen indigenen Ge- 36 meinschaften ihres Landes vor. Ausgehend von ihren Erfahrungen skizzierten sie eine neue Vision der Gesellschaft: „Die Interkulturalisierung besteht im Grunde in der Erhaltung des Bezugsrahmens der Ursprungskultur, aber belebt und erneuert durch die selektive Einfügung von sozio-kulturellen Konfigurationen, die den Mehrheitsgesellschaften entstammen – im Regelfall Nationalgesellschaften. Auf gewisse Weise sucht die Interkulturalisierung den größten Ertrag der Teile in kulturellem Kontakt, wobei sie soweit wie möglich die Dekulturalisierung und den Verlust von ethnokulturellen Werten vermeidet. Es ist nicht nötig, darauf hinzuweisen, dass sich ein typisches Interkulturalisierungsprogramm auf die Muttersprache als symbolisches Kompendium der Kultur als Ganzes konzentrieren muss. Folglich ist eine interkulturalisierte Gesellschaft meist eine zweisprachige oder mehrsprachige Gesellschaft, in der sowohl die lokale, als auch die nationale oder Mehrheitssprache ihre spezifischen Funktionen haben, ohne das sich deshalb Konflikt- oder Wettbewerbssituationen ergeben.“ (Mosonyi / González 1975:307f.) Einige Zeit lang wurde dieser Vorschlag kaum aufgegriffen und nur selten diskutiert. Ein Beispiel ist ein Text vom mexikanischen Anthropologen Guillermo Bonfil Batalla, der 1978 von „den Problemen der interkulturellen Situation“ (Bonfil Batalla 1978:212) spricht und damit die Konflikte zwischen Indigenen und Mestizen in seinem Land meint. Im Jahr 1980 übernimmt das SERBISH den Begriff der interkulturellen Erziehung (López 2009:137f.), womit seine Geschichte in Ecuador beginnt. Kurz später wird die Interkulturalität auf einem Regierungsgipfel der lateinamerikanischen und karibischen Länder 1981 als Alternative zur bisherigen Politik einer Integration und Assimilation der Indigenen vorgeschlagen (Tamagno 2006:25). Ein regionales Treffen von Spezialisten in zweisprachiger Erziehung in Mexiko 1982 spricht sich eindeutig für eine Politik der Mehrsprachigkeit und Multiethnizität aus und empfiehlt den bisherigen Begriff der bikulturellen zweisprachigen Erziehung durch den einer interkulturellen zweisprachigen Erziehung zu ersetzen, interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) um so den offenen Charakter der Kultur hervorzuheben (Walsh 2000:11). Diese kontinentale Unterstützung des neuen Begriffs trägt zu seiner weiteren Verbreitung in Ecuador bei (Walsh 2000:13). Endgültig wird er hegemonisch mit einem Abkommen, das das Erziehungsministerium 1985 mit der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) abschließt. So wird ein Projekt der Interkulturellen Zweisprachigen Erziehung ins Leben gerufen, dass eine bessere Schulbildung für die Indigenen zum Ziel hat. Das Programm beginnt im Schuljahr 1986/87 und hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Auch in diesem Projekt ist die Zusammenarbeit mit indigenen Organisationen explizit vorgesehen (Krainer 1996:46). 1988 führen diese Bemühungen zur Gründung der Nationalen Direktion der Interkulturellen Zweisprachigen Erziehung (Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB) als unabhängiges Büro innerhalb des Erziehungsministeriums (Lazos / Lenz 2004:11). Ab diesem Zeitpunkt werden die bisherigen Erziehungsprojekte, wie etwa das SERBISH, in der DINEIB integriert, behalten aber meist ihre Autonomie (Lazos / Lenz 2004:7f.). Dazu kommen alle Schulen, in denen mehr als 80 Prozent der Schüler Indigene sind (Martínez Novo 2009:179). Die Indigenenorganisationen können weitgehend frei über die Lehrinhalte, Lehrmaterialien und Personalfragen entscheiden, der Staat bestimmt nur die Finanzen (Martínez Novo 2009:174). Damit wird ein Bildungssystem, das „einen eindeutig identitären und fordernden Charakter hat“ (Walsh 2000:12) – und so die Politik der Indigenenbewegung prägt und unterstützt – institutionalisiert und staatlich gefördert. Dazu kommt, dass viele der Führungsfiguren der Indigenenbewegung in diesem System als Lehrer arbeiten – und dadurch an ihre Organisationen gebunden bleiben (Martínez Novo 2010:16). Die DINEIB hat allerdings von Anfang an Schwierigkeiten mit schlechter finanzieller und materieller Ausstattung, die sich auch auf die Löhne auswirken (Martínez Novo 2009:180f.). Auch des- wegen wird die interkulturelle zweisprachige Erziehung selbst von Teilen der organisierten Indigenen als zweitklassig wahrgenommen und für die eigenen Kinder spanischsprachige Schulen bevorzugt (Martínez Novo 2009:181f.). Insbesondere der schlechte Unterricht in Englisch und Informatik sind für diesen Trend ausschlaggebend. In der Provinz Imbabura etwa ist die Zahl der Schüler von Schulen des DINEIB langfristig nicht gestiegen. 1989 waren 11.500 Schüler an solchen Schulen eingeschrieben, 2006 10.795 (Martínez Novo 2009:183). Im Frühjahr 2009 übernimmt der Staat auf Betreiben von Präsident Correa die alleinige Kontrolle über den DINEIB (Martínez Novo 2009:174) und beendet damit den Einfluss der Indigenenorganisationen. Jetzt wird das DINEIB direkt vom Bildungsministerium gesteuert, das alleine über Lehrinhalte und -mittel sowie Personalfragen entscheidet (Martínez Novo 2010:15). 3. Von der interkulturellen Erziehung zur Interkulturalität Nach einer langen Krise reorganisiert sich 1995 die bis dahin gewerkschaftliche und klassen-zentrierte Organisation der Indigenenbewegung FENOCIN (Nationale Föderation von Bauern-, Indigenen- und Schwarzenorganisationen, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) im Zuge eines Programms der internen Demokratisierung um einen Diskurs, der auf nachhaltige Entwicklung und Interkulturalität zielt (FENOCIN 1999:13,53). Die FENOCIN versteht sich von nun an als „pluriethnisch, interkulturell, demokratisch“ (FENOCIN 1999:53) und kämpft „für die Klassen-, ethnische, Geschlechts- und Generationengerechtigkeit, sucht eine nachhaltige Entwicklung mit Identität und verteidigt die individuellen und kollektiven Menschenrechte“ (FENOCIN 1999:103). Sie will ein „plurikulturelles Land aufbauen, in dem die Unterschiede respektiert werden, aber zur gleichen Zeit plurikulturelle Organismen und ein interkulturelles Denken geschaffen 37 werden, die ihm Lebensfähigkeit geben“ (FENOCIN 1999:103). Mit dem Begriff der Interkulturalität distanziert sich die FENOCIN explizit von den vorherrschenden Strömungen der Indigenenbewegung, die sie als ethnischen Fundamentalismus bezeichnet, da sie – nach Sichtweise der FENOCIN – andere Faktoren, wie Klasse oder Geschlecht ausblenden und keine Lösung für die Mehrheit der Gesellschaft, die Mestizen, anbieten (FENOCIN 1999:150). Damit bezieht sich die FENOCIN auf die Begriffe indigene Nationalitäten und Plurinationalität, die die größte Indigenenorganisation, die CONAIE (Konföderation Indigener Nationalitäten Ecuadors, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), verwendet. Diese Begriffe, und der Diskurs, der um sie herum besteht, haben sich seit Ende der 1970er Jahre in Abgrenzung zur bis dahin vorherrschenden sozialistischen und gewerkschaftlichen Prägung der Indigenenbewegung entwickelt. Nur ein Jahr vor der Erneuerung der FENOCIN, 1994, kam diese Entwicklung im Politischen Projekt der CONAIE zu einer vorläufig abschließenden Integration. Dort stellt die CONAIE fest, dass „Ecuador eine Plurinationale Gesellschaft im Entstehen“ (CONAIE 1994:6) ist und fordert daher „den Aufbau eines Plurinationalen und Plurikulturellen Staates“ (CONAIE 1994:6). Dieser Plurinationale Staat zeichnet sich durch territoriale Autonomien für die indigenen Nationalitäten und Völker aus (CONAIE 1994:21f.) und durch eine institutionalisierte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an Entscheidungsprozessen. Entgegen der Interpretation der FENOCIN ist die „Einheit in der Vielfalt“ (CONAIE 1994:13), also der Ausgleich und die Harmonie zwischen den selbstverwalteten Völkern – indigen oder nicht –, ein wichtiger Bestandteil dieses Staates. Die FENOCIN will die verschiedenen laufenden Prozesse und Dynamiken der ecuadorianischen Gesellschaft und damit unterschiedliche Analysekategorien miteinander verbinden und in einem einheitlichen Konzept integrie- 38 ren. So will sie „zur gleichen Zeit die Interkulturalität und die Autonomie der indigenen und afroecuadorianischen Gesellschaften aufbauen“ (FENOCIN 1999:150). Tatsächlich versteht sie die Interkulturalität als Möglichkeit, zu einem Ausgleich zwischen verschiedenen Lebensweisen zu kommen. Die FENOCIN glaubt „an die Interkulturalität und, zur gleichen Zeit, an die besonderen Identitäten ihrer Mitglieder“ (FENOCIN 2004:24). Daher will sie eine Gesellschaft aufbauen, die durch Pluralität auf den Gebieten des Rechts, der Erziehung, der Sprache, der Identität und der Gesundheit charakterisiert ist und damit „sowohl die eigene Kultur der Indios und Schwarzen stärken, als auch eine Verbindungsbrücke zur mestizischen Kultur aufbauen“ (FENOCIN 1999:156). Diese Verbindung soll nicht nur zwischen den verschiedenen (Bildungs-, Rechts-, Gesundheits-) Systemen bestehen, sondern auch über ein vertieftes Wissen von allen Kulturen für jeden Bürger die Möglichkeit zur Wahl zwischen den verschiedenen Systemen erlauben. So soll man etwa wählen können, in welchen Erziehungssystem die eigenen Kinder unterrichtet werden oder ob die eigene Straftat vor einem mestizischen oder einem indigenen Gericht verhandelt wird (FENOCIN 1999:156). Ähnlich der Plurinationalität enthält auch die Interkulturalität ein System von Autonomien. Diese sollen als „politische Autonomie von Kompetenzen und Funktionen“ (FENOCIN 1999:157) im Rahmen einer Dezentralisierung des Staates und über ethnische Grenzen hinweg möglich gemacht werden. So sollen selbstverwaltete und autonome territoriale Eingrenzungen der Indigenen und Schwarzen genauso gebildet werden können, wie interkulturelle Räume in der öffentlichen und Selbstverwaltung. Diese Verflechtung von ethnischer Autonomie und interkultureller Kommunikation soll im Sinne einer Repräsentation in allen Ebenen des Staates eingerichtet werden (FENOCIN 1999:157). Daher lehnt auch die FENOCIN Begriffe wie ethnische Minderheiten als Versuche, die Rechte der Indigenen und interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Afroecuadorianer einzuschränken, ab (FENOCIN 2004:29). Über die Öffnung des Staates für die Teilhabe der verschiedenen Gruppen soll „in unserem Land ein interkultureller, flexibler und demokratischer sozialer Kontext [geschaffen werden], der den Identitäten und den Rechten aller BürgerInnen größere Unterstützung gibt“ (FENOCIN 2004:29). Die Interkulturalität soll ein Projekt für das ganze Land sein, das so seine ethnische, soziale und wirtschaftliche Zersplitterung überwinden kann (FENOCIN 2004:39). Sie muss daher die Geschichte von Ausgrenzung, Rassismus und Kolonialismus und Kolonialität kritisch aufarbeiten, konkrete Ausgrenzungsmechanismen bekämpfen und die notwendigen Veränderungen prozesshaft ermöglichen. Dabei greift sie die Forderungen aller beteiligter Gruppen auf. Aus der Sicht der FENOCIN beginnt dieser Prozess im Alltag. „Das schließt persönliche und Verhaltensveränderungen mit ein, und auch strukturelle Veränderungen der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit“ (FENOCIN o.J.:11). Das Auftauchen des Begriffs der Interkulturalität ist nicht nur eine diskursive Neuerung, sondern auch der Konkurrenz der verschiedenen Organisationen der Indigenenbewegung geschuldet. Die FENOCIN schafft es nach einer langen Krise, ihren Diskurs zu aktualisieren und so in „Konkurrenz um symbolische Dominanz“ (Zald / McCarthy 1979:3) mit der CONAIE als stärkster Indigenenorganisation zu treten. Die Erneuerung ihres Diskurses und dessen Erweiterung um ethnische Aspekte gibt der FENOCIN eine bessere Position im Kampf um „die besten Programme, Taktiken und Führer, um Ziele zu erreichen“ (Zald / McCarthy 1979:3) – und damit Mitglieder zu gewinnen. Der Begriff der Interkulturalität ist in diesem Zusammenhang ein „Schlüsselsymbol“ (Zald 1979:13f.) – genauso wie der der Plurinationalität. Beide Begriffe sollen die Ideen und das Programm der Organisationen, die sie verwenden, repräsentieren und so deren Attraktivität steigern. Wenn ein Schlüsselsymbol dabei erfolgreich ist, wird es von den anderen Organisationen derselben sozialen Bewegung kopiert oder nach- geahmt (Zald 1979:13f.). Somit ist die Interkulturalität auch eine Antwort auf den Begriff der Plurinationalität – und wird von der herausgeforderten Organisation, der CONAIE, schnell in ihren Diskurs integriert. Tatsächlich nimmt diese die Interkulturalität schon in der zweiten Version ihres Politischen Projektes von 1997 auf und will jetzt „die neue humanistische und interkulturelle Gesellschaft aufbauen“ (CONAIE 1997:9). Interkulturalität bedeutet für die CONAIE den Respekt vor „der Vielfalt der indigenen Völker und Nationalitäten und der sonstigen sozialen Sektoren Ecuadors, [sie] fordert aber gleichzeitig die Einheit dieser“ (CONAIE 1997:12). Ein zentraler Bestandteil des Verständnisses der Interkulturalität ist für die CONAIE die Notwendigkeit, eine breitere und offenere Sichtweise auf Kultur zu ermöglichen, als sie in „einer westlichen Perspektive“ (CONAIE 2007:23) üblich ist. Politik, Wirtschaft, Gesundheit überschneiden sich in dieser Sichtweise mit der Kultur. Die explizite Trennung dieser Räume oder Systeme ist daher für die CONAIE – und die anderen Organisationen der Indigenenbewegung – eine „Folklorisierung“ (CONAIE 1994:41), die zum einen die – etwa touristische – Nutzbarmachung der indigenen Kulturen zum Ziel hat, sie aber zum anderen in eine untergeordnete Position zur „elitären und ausschließenden `westlichen Kultur´“ (CONAIE 1994:41) bringen soll. Diese Kritik an Wissensarten erweitert Catherine Walsh, wenn sie die Interkulturalität als Versuch wertet, „zwischen hegemonischen und subalternen Positionen mit verschiedenen Formen, Wissen zu produzieren und anzuwenden“ (Walsh 2003:135), zu vermitteln. Aus dieser Sicht erscheint die Interkulturalität als eine „gegenhegemonische Praxis“ (Walsh 2003:135f.), die auf eine Umdeutung des als legitim betrachteten Wissens abzielt und eine Rehabilitation traditioneller und lokaler Wissensformen anstrebt. Diese Dekolonisierung des Wissens soll durch eine Erneuerung der Grundlagen der Sinnerzeugung, durch „epistemologisches Interkultura- 39 lisieren“ (Walsh 2003:138, Hervorhebung im Original) möglich gemacht werden. Die CONAIE drückt das etwas pragmatischer aus. Für sie benötigt die Interkulturalität als Projekt für das gesamte Land, das die Förderung jedes kulturellen Ausdrucks fördert, die „Einheit der Völker und Nationalitäten und der gesamten Gesellschaft als grundlegende Bedingung für eine plurinationale Demokratie und eine gerechte Wirtschaft“ (CONAIE 2007:7f.). Diese Einheit ist allerdings nicht möglich, „wenn die Kulturen einer beherrschenden Kultur untergeordnet sind“ (CONAIE 2007:21f.). Deshalb muss Ecuador aus einer inklusiven Perspektive neu gedacht werden, einer Perspektive, in der „wir alle das Recht haben, nach unseren Gebräuchen und Gewohnheiten zu leben und das Recht, Räume für den Dialog zu öffnen und für die Erzeugung neuen Wissens, das auf diesen Dialogen zwischen den Kulturen aufbaut“ (CONAIE 2007:21f.). Diese Art von Interkulturalität macht einen völligen Wandel des Verhaltens notwendig, der über die „soziale Mobilisierung“ (CONAIE 2007:21f.) erreicht werden soll. 4. Die Interkulturalität als politischer Begriff Der Begriff der Interkulturalität ist nie auf Widerstand gestoßen – im Gegensatz zu dem der Plurinationalität, der schon in den 1980er Jahren als Versuch, das Land zu spalten oder indigene Republiken zu gründen, diffamiert wurde. Dennoch wurde die Interkulturalität meist als Angelegenheit der Indigenen verstanden – als eine möglicherweise berechtigte Forderung, die aber das Problem der Anderen ist (Walsh 2000:11). Damit bleibt das Bestreben der Indigenenbewegung, über diesen Begriff „mit der hegemonischen Geschichte einer beherrschenden und einer unterworfenen Kultur zu brechen“ (Walsh 2000:12), die unterdrückten Identitäten zu stärken und Räume der Autonomie aufzubauen, meist unverstanden. Aus diesem Bezug auf Kultur und Identität 40 ergibt sich auch die enge Bindung der Interkulturalität an die Erziehung und damit an „eine politische, soziale und kulturelle Institution, den Raum der Konstruktion und Reproduktion von Werten, Einstellungen und Identitäten und der historisch-hegemonischen Macht des Staates“ (Walsh 2000:14). Diese Kulturalisierung der Interkulturalität – im Gegensatz zu einer Konzentration auf die strukturellen Änderungen, die auch in ihr angelegt sind – führt zu einer Zuschreibung der Interkulturalität auf die Individuen, die in einem multikulturellen oder ethnisch pluralem Staat miteinander leben müssen. Ein Vergleich mit Will Kymlicka und seiner Gegenüberstellung von multikulturellem Staat und „interkulturellem Bürger“ (Kymlicka 2003:148) liegt daher nahe. Für Kymlicka, der seine Theorie an seinem Heimatland Kanada entwickelt, ist ein multikultureller Staat einer, der die Diskriminierungen, die in Form von Gesetzen und Verordnungen, aber auch in Schulunterricht, Nationalsymbolen und Feiertagen bestehen, abbaut und die gleichberechtigte Teilhabe aller befördert (Kymlicka 2003:152). Auch ein bestimmter Grad an Selbstverwaltung und Autonomie – ein wichtiges Thema für die Indigenen Ecuadors – kann zu diesem multikulturellen Staat gehören (Kymlicka 2003:153). Um diese beiden Formen von Multikulturalität harmonieren zu können, ist es notwendig, dass der multikulturelle Staat auf Bürger zählen kann, die ihn und seine Ausrichtung unterstützen und (vor allem lokaler) Verschiedenheit gegenüber aufgeschlossen sind (Kymlicka 2003:157) – interkulturelle Bürger also (Kymlicka 2003:153f.). Kymlicka nennt das „lokaler Interkulturalismus“ (Kymlicka 2003:160). So kann eine zunehmende Spaltung in die verschiedenen ethnischen Gruppen, die nun in autonomen, selbstverwalteten Gebieten leben, vermieden werden (Kymlicka 2003:154-157). Auch wenn Kymlickas Ausführungen für die Situation in Ecuador hilfreich sind, so ist seine Gegenüberstellung vom Aufbau von Autonomie und Abbau von Diskriminierung beim Verständnis von interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Interkulturalität irreführend. Tatsächlich versucht die Indigenenbewegung in Ecuador, beide Prozesse gleichzeitig und in wechselseitiger Verstärkung durchzuführen. Dabei geht sie stets von der lokalen Ebene und den alltäglichen Beziehungen zwischen Menschen aus – also von Kymlickas lokalem Interkulturalismus –, um von dort aus die Interkulturalität in immer höheren Ebenen aufzubauen. Statt sich auf den Staat als Zentralinstanz zu beziehen, orientiert sich die Indigenenbewegung bei ihrer Vorstellung von Interkulturalität also an ihrem eigenen Aufbau, der aus autonomen, lokalen Organisationen besteht, die sich auf regionaler Ebene in Föderationen zusammenschließen, die sich auf nationaler Ebene wiederum zu Konföderationen vereinigen. Gerade dieser Aufbau von Unten nach Oben ist das Innovative an der Interkulturalität der Indigenenbewegung in Ecuador. Das Ausgehen vom Lokalen bringt die Dichotomie zwischen Autonomie und interkultureller Kommunikation zwischen den Gemeinden zu einem neuen Sinn: da die Indigenenbewegung sich auf Dorfgemeinschaften oder Stadtviertel bezieht, ist deren – freiwillige und autonome – Einbindung in größere Strukturen unvermeidlich und muss bei Forderungen nach Selbstbestimmung und Autonomie immer mitgedacht werden. Deshalb betonen die Indigenenorganisationen stets den doppelten Charakter ihres Kampfes als Kampf gegen soziale Ungleichheit und ethnische Unterdrückung. Begriffe in Publikationen des ecuadorianischen Staates entwickelt hat. 5. Fazit Bonfil Batalla, G. (1978): Las nuevas organizaciones indígenas (hipotesis para la formulación de un modelo analitico). Journal de la Société des Américanistes 65, S. 209-219. Seit seiner Einführung in den ecuadorianischen Diskurs 1995 konnte sich der Begriff der Interkulturalität behaupten und wurde 2008 sogar in die Verfassung übernommen. Das liegt nicht nur an der politischen Stärke der Indigenenbewegung seit 1990, sondern vor allem auch an seiner hohen Anschlussfähigkeit an andere Diskurselemente. So trägt die scheinbare Offenheit des Begriffes dazu bei, dass er auch in anderen Kontexten übernommen wird und sich mittlerweile zu einem der meistverwendeten Selbst wenn die Interkulturalität im Falle Ecuadors neue Inhalte erhält – wie etwa diejenigen, die sich auf Autonomie und Selbstverwaltung beziehen –, so gilt auch hier, dass die „inflationäre Verwendung“ (Földes 2009:504) des Begriffes im Widerspruch zu seiner geringen Definition steht. Auch als politischer Begriff wird die Interkulturalität „zumeist als voranalytisches Konzept gehandhabt“ (Földes 2009:510) und nicht näher erklärt. Die Diagnose von Földes, dass die Interkulturalität oft „einen starken politisch-ideologischen Sinn erhält“ (Földes 2009:511), bekommt in Ecuador allerdings eine andere Bedeutung, da dieser politische Sinn mit konkreten Inhalten gefüllt werden kann – was im Sprachunterricht und der akademischen Diskussion in Deutschland über diesen Begriff nicht immer der Fall ist. Der politische Begriff der Interkulturalität in Ecuador ist ein Beispiel „für die beeindruckende internationale Laufbahn und Anschlussfähigkeit“ (Földes 2009:514f.) dieses Begriffes, der sich auch in Kontexten etablieren konnte, die seinen – wahrscheinlichen – Ursprüngen fern liegen. Tatsächlich handelt es sich um „ein überaus erfolgreiches kulturelles Globalisierungsprodukt“ (Földes 2009:515), das sich – auch wegen seiner relativen Leere an fassbarem Inhalt – leicht in die verschiedensten Diskurse integrieren lässt. 6. Literatur CONAIE (1994): Proyecto Político de la CONAIE. Quito: CONAIE. CONAIE (1997): Proyecto Politico de la CONAIE. Quito: CONAIE. CONAIE (2007): La CONAIE frente a la Asamblea Constituyente. Propuesta de nueva constitucion- desde la CONAIE- para la construccion de un Estado Plurinacional, Unitario, Soberano, Incluyente, Equitativo 41 y Laico. URL: http://www.cebem.org/ cmsfiles/archivos/principios-lineamientosconaie.pdf [Zugriff am 16.8.2013]. FENOCIN (1999): Hacia el nuevo Milenio. Porque en el campo está la fuerza del Desarrollo de la Identidad y la Vida. o.O.: FENOCIN. FENOCIN (2004): Noveno Congreso Ambato, 20-22 de mayo de 2004. Quito: FENOCIN. FENOCIN (o.J.): Consolidación organizacional, Revolución agraria, Interculturalidad, Soberanía alimentaria, Construcción del Socialismo. URL: http://www.uasb.edu.ec/ UserFiles/380/File/Presentacion%20FENOCIN%202009_Patricio%20Sandoval. pdf [Zugriff am 25.9.2010]. Földes, C. (2009): Black Box ,Interkulturalität‘. Die unbekannte Bekannte (nicht nur) für Deutsch als Fremd-/Zweitsprache. Rückblick, Kontexte und Ausblick. Wirkendes Wort 59(3), S. 503-525. García, F. / Tuasa, L. (2007): Estudio sobre legislación intercultural en el Ecuador. URL: www.cebem.org/cmsfiles/archivos/derechos-ecuador.pdf [Zugriff am 16.8.2013]. Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC) (2010): Censo de Poblacion y Vivienda 2010. URL: http://redatam.inec. gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAct ion?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010 &MAIN=WebServerMain.inl [Zugriff am 10.9.2011]. Kaller-Dietrich, M. (2008): Ivan Illich (1926-2002). Sein Leben, sein Denken. Weitra: Bibliothek der Provinz. In: López, L. (Hrsg.): Interculturalidad, educación y ciudadanía. Perspectivas latinoamericanas. La Paz: FUNPROEIB, Plural, S. 129-218. Martínez Novo, C. (2009): La crisis del proyecto cultural del movimiento indígena. In: Martínez Novo, C. (Hrsg.): Repensando los Movimientos Indígenas. Quito: FLACSO, Ministerio de Cultura del Ecuador, S. 173-196. Martínez Novo, C. (2010): The “Citizen´s Revolution” and the Indigenous Movement in Ecuador: Re-centering the Ecuadorian State at the Expense of Social Movements. Vortragstext SARR Conference “Off Centered States: Political Formation and Deformation in the Andes”, May 27-29, 2010, Quito, Ecuador. URL: http://sarr.emory.edu/documents/ Andes/MartinezNovo.pdf [Zugriff am 16.8.2013]. Mosonyi, E. / González, O. (1975): Ensayo de educación intercultural en la zona arahuaca del Río Negro (Venezuela). In: XXXIX Congreso Internacional de Americanistas (Hrsg.): Lingüística e indigenismo moderno de Amércia. Trabajos presentados al XXXIX Congreso Internacional de Americanistas. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, S. 307-314. Moya, R. (1987): Educación bilingüe en el Ecuador: retos y alternativas. Indiana 11, S. 387-406. Ramón, G. (2009): ¿Plurinacionalidad o interculturalidad en la Constitución? In: Acosta, A. / Martínez, E. (Hrsg.): Plurinacionalidad. Democracia en la Diversidad. Quito: Abya-Yala, S. 125-160. Krainer, A. (1996): Educación Bilingüe Intercultural en el Ecuador. Quito: Abya-Yala. Tamagno, L. (2006): Interculturalidad. Una revisión desde y con los pueblos indígenas. Diario de Campo 39, S. 20-31. Kymlicka, W. (2003): Multicultural states and intercultural citizens. Theory and Research in Education 1(2), S. 147-169. Walsh, C. (2000): Políticas y Significados Conflictivos. Estudios Interculturales 2, S. 9-24. Lazos, E. / Lenz, E. (2004): La Educación Indígena en el Páramo Zumbahueño del Ecuador: Demandas, Exitos y Fracasos de una Realidad. URL: http://www.latautonomy.org/SEIC_18feb.pdf [Zugriff am 16.8.2013]. Walsh, C. (2003): (De)Construir la interculturalidad. Consideraciones criticas desde la politica, la colonialidad y los movimientos indigenas y negros en el Ecuador. In: Fuller, N. (Hrsg.): Interculturalidad y politica: desafios y posibilidades. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Peru, S. 115-142. López, L. (2009): Interculturalidad, educación y política en América Latina: perspectivas desde el Sur. Pistas para una investigación comprometida y dialogal. 42 Zald, M. (1979): Macro Issues in the Theory of social movements. SMO Interaction, the interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Role of Counter-Movements and Cross-National Determinants of the Social Movement Sector. CRSO Working Paper Nr. 204, Center for Research on Social Organization, University of Michigan. Zald, M. / McCarthy, J. (1979): Social Movement Industries: Competition and Cooperation among Movement Organizations. CRSO Working Paper No. 201, Center for Research on Social Organization, University of Michigan. 43 44 interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Empathische Wahrnehmung des kulturell Fremden. Neun Konstruktionsmuster und deren Bedeutung für interkulturelle Bildungsprozesse Empathic perception of the culturally unknown. Nine patterns of construction and their meaning for educational processes Manfred Riegger Abstract (Deutsch) Prof. Dr., apl. Prof. und Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Didaktik des Katholischen Religionsunterrichts und Religionspädagogik Konstruktionsprozesse beruhen grundsätzlich auf vier Faktoren: erstens die standortgebundene Zuschreibung des Subjekts (eigen / fremd), zweitens die korrespondierenden Emotionen (sowohl positive wie Neugier, Faszination usw. als auch Angst, Hass usw.), drittens die sinnliche Wahrnehmung von Phänomenen, welche den Subjekten präsentiert werden und viertens die subjektiven Konstruktionen in Form von neun Konstruktionsmustern, welche eine spezifische Mischung von eigen und fremd mit unterschiedlichen Emotionen in Abhängigkeit der Präsentation sind. Ziel dieses Modells ist es, mögliche (Miss-)Verständnisse der fremden Kultur und Religion zu benennen, zu klären, wie Menschen mit den Differenzen zwischen eigener und fremder Kultur und Religion umgehen, um daraus für pädagogische Bildungsprozesse Konkretionen abzuleiten. Schlagwörter: Evidenzquellen, Konstruktivismus, Fremdheit, Eigen(es), Emotionen, Wahrnehmung, Konstruktionsmuster, interkulturelle Bildung Abstract (English) Processes of construction are basically a product of four factors: firstly the attribution of location of the subject (own / other), secondly corresponding emotions (both positive emotions such as curiosity, fascination etc. and negative emotions such as fear, hate etc.), thirdly sensual perception of phenomenon, which are presented to the subjects, and fourthly construction of subjects as nine patterns of construction, which are specific mixtures between own and strange with various emotions depending on the presentation. The purpose of this model is to denote different possibilities of (mis)understanding the unfamiliar culture and religion, to clarify how people deal with the differences between one’s own and strange cultures and religions and to derive orientation for educational processes. Keywords: Sources of evidence, constructivism, strangeness, own, emotions, perception, patterns of construction, intercultural education 45 1. Einleitung Heute ist es offensichtlich, dass unterschiedliche Kulturen und Religionen in der Öffentlichkeit präsent sind. Während man in vormodernen Gemeinwesen den wenigen Fremden ihren sozialen Ort leicht zuweisen konnte – sie waren Freunde oder Feinde – fügt sich der Fremde heute nicht mehr diesem Freund-Feind-Denken, diesem Innen-Außen-Schema (vgl. Baumann 1996:84). Zudem fehlte vor der Entstehung der „modernen Nationalstaaten der Zwang zur kulturellen Homogenisierung“ (Auernheimer 2012:9), womit auch Differenzen nicht drängend waren. So ermöglichte z. B. das „Milliyet-System d. h. das System der Nationalitäten, des Osmanischen Reiches […] den christlichen Minderheiten ungehinderte Religionsausübung und bis zu einem gewissen Grad ein kulturelles Eigenleben. Wichtig für das Herrschaftssystem war nur die Tributpflicht und der Beitrag zur Rekrutierung des Heeres“ (ebd.). Mit dem relativ neuen Phänomen der Allgegenwärtigkeit der Fremdheit müssen nun viele Menschen erst umgehen lernen. Welche grundsätzlichen Möglichkeiten der Wahrnehmung des kulturell Fremden gibt es? In welcher Beziehung stehen hierbei Empathie und Wahrnehmung? Und welche Konsequenzen sind dann für Bildungsprozesse relevant? Diese Fragen werden im Folgenden bearbeitet. Dazu werden zunächst Grundlagen für ein Modell der Wahrnehmung gelegt (1), das als Vierevidenzquellenmodell entwickelt wird (2). Anschließend werden die sich daraus ergebenden neun Konstruktionsmuster des Fremderlebens ausführlich erläutert (3), um dann Konkretionen für pädagogisch zu verantwortende interkulturelle Bildungsprozesse aufzuzeigen (4). Ein Schluss rundet die Überlegungen ab (5). 2. Grundlegung des Vierevidenzquellenmodells Das hier zu entwickelnde analytische Modell dient der Wahrnehmung des Verhältnisses von eigener Kultur und 46 Religion sowie fremder Kultur und Religion. Folgende vier Aspekte, die vier Evidenzquellen, beeinflussen die Wahrnehmungen der Menschen und lassen sie einleuchtend erscheinen: Ausdrucksform, standortgebundene Zuschreibung, emotionale Färbung und subjektive Konstruktion. Trotz der Komplexität des Sachverhalts wird versucht, die entsprechenden Interdependenzen in einem formalen Modell zu erfassen. Die Funktion besteht darin, den Umgang mit der Differenz zwischen eigener und fremder Kultur bzw. Religion auf Seiten von Subjekten zu erhellen. Dieser Ansatz geht also von aktiv konstruierenden Subjekten aus, die an Bildungsprozessen teilnehmen können. Dennoch begnügt er sich nicht mit bloßer Wahrnehmung von Konstruktionsprozessen, denn dem Modell liegt auch eine normative Vorstellung zugrunde: nämlich eine zunehmende Ausdifferenzierung der Kategorien für die Unterschiede von eigen / fremd und deren ansteigende Integration mit der Zielperspektive empathische Anerkennung der/des Fremden. Angst gilt in diesem Modell als zentrale Emotion. Sie taucht dann auf, wenn wir an Grenzen stoßen, wenn wir in einer Situation sind, der wir uns nicht oder noch nicht gewachsen fühlen, in der wir uns hilflos, abhängig oder ohnmächtig erleben. Evolutionsbiologisch war dies für das Überleben eine sinnvolle Reaktion des Menschen auf Gefahren, als diese nämlich wilden Tieren begegneten, die entweder besiegt werden mussten oder vor denen sie zu flüchten hatten. Im Kontext von interkultureller Empathie heißt das aber: Bei manchen Menschen löst Fremde/s zunächst Angst aus, weshalb sie ihren Fokus auf die Gefahren richten, denen sie mit unterschiedlichen Mitteln Herr zu werden versuchen. Bei der Fixierung auf Bedrohung, Terror und Krieg, übersehen sie aber leicht, dass die meisten Fremden in Wirklichkeit keine Gefahr darstellen, sondern der eigenen Identitätsentwicklung Impulse verleihen können. Natürlich gibt es in der Wirklichkeit viele Konstruktionsmuster und nicht nur neun in Reinform. Das Modell hat dennoch seine Berechtigung, weil es interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) der idealtypischen Klassifizierung und Analyse konkreter Konstruktionsmuster von Subjekten dient. Als idealtypisch wird der Vorgang bezeichnet, weil die Versuche einer Zuordnung in der Wirklichkeit nicht eindeutig ausfallen können. Wird damit das Modell als analytisches Instrument eingesetzt, d. h. werden konkrete Konstruktionen von Subjekten auf ihre jeweiligen Anteile an den einzelnen idealen Mustern hin untersucht, so schmälert dies nicht die normative Ausrichtung des Modells. Zuletzt sei hier auf die noch darzustellenden Muster antipathische Geringschätzung, Xenophobie und gewaltbereite Fremdenfeindlichkeit eingegangen. Diese Muster sprengen in gewissem Sinn den Rahmen des theoretischen Modells, weil hier auch empirisch erhobene Formen des Umgangs mit der Abwehr von Unterschieden einbezogen werden. Insofern bilden diese Muster eine Besonderheit, obwohl das zu erläuternde Modell grundsätzlich ein theoretisch entwickeltes ist. Positiv gewendet: Zu wünschen wäre, dass auch positive Formen des Umgangs mit Unterschieden stärker empirisch untersucht würden. Insgesamt handelt es sich also bei dem folgenden Modell um ein theoriebasiertes und teilweise empirisch abgesichertes Modell, das auf der Basis konstruktivistischer Grundannahmen die Wahrnehmung des kulturell Fremden erklären hilft. Dieses Modell liefert einen Rahmen, innerhalb dessen Fragen der Wahrnehmung interkultureller Empathie systematisch reflektiert werden können, was v. a. für pädagogisch zu verantwortende interkulturelle Bildungsprozesse von Bedeutung ist. 3. Das Vierevidenzquellenmodell Da es nicht ‚den Konstruktivismus gibt, sondern unterschiedliche Strömungen in Wissenschaftstheorie (Mittelstraß), Neurobiologie (Manturana, Varela), Gehirnforschung (Roth, Singer), Kommunikationswissenschaft (Watzlawick), Wissenssoziologie (Luckmann), Systemtheorie (Luhmann) u. a. m. (vgl. Finn 2008), wird hier auf eine Grund- linie Bezug genommen, welche auch von pädagogischen Konstruktivisten wie Horst Siebert, Kersten Reich u. a. vertreten wird. In diesem Verständnis betont der Konstruktivismus, dass man „einer oft von Menschen naiv unterstellten unmittelbaren Verbindung von Welt (‚da draußen‘) und Abbild (‚in uns‘) misstrauen“ (Reich 2008:86) müsse. Deshalb gilt als zentraler Begriff und „moderne Schlüsselkompetenz“ die „Konstruktivität, das heißt das Bewusstsein individueller und kultureller Beobachtungsabhängigkeit von Wirklichkeit“ (Siebert 2003:127). Mit anderen Worten: Die Konstruktionen und Visionen in den Köpfen von Menschen über die Welt da draußen sind nicht einfach Abbilder einer Welt. Einige Grundfragen lauten dann: Wie entstehen innere Vorstellungen über die Dinge und Inhalte der Kulturen und Religionen? Wie verhalten sich Wissen und äußere Wirklichkeit zueinander? Und wie beziehen sich hierbei Empathie und Wahrnehmung aufeinander? Da v. a. die Bedeutung interkultureller Empathie in Wahrnehmungsprozessen kaum bearbeitet wird, wird dies im Folgenden mit Bezug auf das konstruktivistische Paradigma systematisch entwickelt, indem vier Evidenzquellen einer gemeinsamen Konstruktion von Sinn bzw. Bedeutung spezifisch konkretisier werden (vgl. Abb. 1): ■■ Zunächst die sinnliche Wahrnehmung von Phänomenen (d. h. neue Erfahrungen – individuelle oder kollektiv) in den tradierten Ausdrucksformen der Kulturen, ■■ dann die kognitive Konstruktion, die neue Impulse und bereits vorhandene Gedächtnisspuren und Konstrukte miteinander verbindet in der standortgebundenen Zuschreibung (eigen bzw. fremd), ■■ sowie ihre soziale Bestätigung (oder Verleugnung) in der bewertenden subjektiven Konstruktion, die in neun Konstruktionsmustern zum Ausdruck kommt 47 ■■ und schließlich wird alles überlagert vom jeweiligen emotionalen Erleben des Ereignisses oder der Situation, was die emotionale Färbung ausmacht. Auch wenn das Thema Fremdheit in der Literatur kaum zu überblicken ist und kein allgemein anerkanntes Verständnis vorliegt, wird hier von folgendem Grundverständnis ausgegangen: Fremd bezeichnet das, „was einzig in der Weise da ist, dass es sich dem eigenen Zugriff entzieht“ (Waldenfels 2006:110). Während eine Person schon existiert, entsteht das Selbst und das Eigene, „indem sich ihm etwas entzieht, und das, was sich entzieht, ist genau das, was wir als fremd und fremdartig erfahren“ (ebd.:20). Dieses allgemeine Verständnis von fremd, wird im Blick auf die Herkunft des Wortes mit Merkmalen konkretisiert. Die deutsche Sprache verfügt zwar nur über einen Begriff Fremdheit, doch dieser umfasst mehrere Bedeutungen, die im Kern auf drei reduzierbar sind (Waldenfels 1997:20f., 2006:111f ): Erstens wird fremd im Sinne von weit weg verwendet. Fremd ist, „was außerhalb des eigenen Bereichs vorkommt als Äußeres, das einem Inneren entgegensteht (vgl. xénon: gr., externum, extraneum: lat., étranger: frz., stranger, foreigner: engl.)“ (Waldenfels 2006:111f.). Damit bezeichnet fremd einen räumlichen Aspekt, einen Ort. Zweitens ist fremd, „was von anderer Art, was fremdartig, unheimlich, seltsam ist (xénon: gr., insolitum: lat., étrange: frz., strange: engl.)“ (ebd.). In diesem Sinne ist es unvertraut oder unbekannt, womit es sich den Aspekt der Andersartigkeit, der Art des Verständnisses, bezieht. Drittens ist fremd, „was Anderen gehört“ und damit nicht eigen, nicht zugehörig ist „(allótrion: gr., alienum: lat., alien: engl., ajeno)“ (ebd.). Dieser Bedeutungsvariante sind auch die Worte Entfremdung und 48 Ausdrucksform 3.1. Kognitive Konstruktion von Fremdheit gewaltbereite Fremdenfeindlichkeit Fremdenangst (Xenophobie) antipathische Geringschätzung der / des Fremden apathische Distanz gegenüber den/dem Fremden emotionslose Indifferenz gegenüber den/ dem Fremden emotionslose Toleranz gegenüber den/dem Fremden sympathische Einordnung der/ des Fremden ins Eigene empathische Anerkennung der/ des Fremden empathische Aneignung der/des Fremden eigen (nahe, vertraut, zugehörig) fremd negativ Emotionale Färbung Diese Übersicht des Evidenzquellenmodells wird im Folgenden erläutert. (siehe Abb. 1) Subjektive Konstruktion der Konstruktionsmuster positiv (fern, unbekannt, ausgeschlossen) Standortgebundene Zuschreibung Abb. 1: Konstruktionsmuster fremder Kultur und Religion. Quelle: Eigene Darstellung. Entäußerung zuzurechnen. Hier bezieht sich fremd auf den Aspekt des Besitzes, des Ein- und Ausschlusses z. B. in eine bzw. von einer Gruppe. Zusammengefasst gilt: Fremd ist etwas oder jemand, das / der fern, weit weg bzw. außen und/ oder unbekannt bzw. unvertraut und / oder nicht zugehörig bzw. ausgeschlossen ist. Welche Bedeutungen beinhaltet nun das Wort eigen? Fremd steht im Gegensatz, im Kontrast zu eigen. Damit ist etwas oder jemand eigen, das / der nah bzw. innen und / oder bekannt bzw. vertraut und / oder zugehörig bzw. integriert ist (vgl. Abb. 2). Fremdheit ist zunächst eine relationale Kategorie, die Karl Valentin in seinem vielzitierten Dialog Die Fremden auf den Punkt bringt: „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“ (Valentin 2007:176). Fremdheit ist also „keine Eigenschaft von Dingen und Personen“ (Schäffter 1991:12), sie existiert also nicht an sich, denn sie entsteht erst dann, wenn sich Fremde/s dem eigenen Zugriff entzieht. Damit sind die drei Merkmale von Fremdheit nicht objektiv bestimmbar, denn sie sind immer vom Standort des Menschen abhängig, der etwas als fremd bezeichnet: interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Aspekte eigen fremd Räumlichkeit nah, innen fern, weit weg, außen Art des Verständnisses bekannt, vertraut unbekant, unvertraut Besitz oder Ein- bzw. Ausschluss zugehörig, integriert nicht zugehörig, ausgeschlossen Abb. 2: Merkmale von eigen und fremd. Quelle: Eigene Darstellung. Beeinflussung der Wahrnehmung durch persönliche Faktoren wie z. B. soziale Faktoren wie z. B. ■■ Stimmungen, Gefühle, Interessen, Bedürfnisse, Motive, Triebe ■■ Einstellungen, Vorurteile anderer Personen(gruppen) ■■ bisherige Erlebnisse und Erfahrungen ■■ Wert- und Normvorstellungen innerhalb einer Gruppe bzw. einer Gesellschaft ■■ Einstellungen, Wertvorstellungen (engl. beliefs) ■■ (emotionale) Intelligenz, Fähigkeiten und Fertigkeiten Abb. 3: Wahrnehmungsbeeinflussung. Quelle: Eigene Darstellung. „Nur wenn ich weiß, was mir nahe, […] vertraut und […] eigen ist, kann ich etwas als fremd einordnen. Und umgekehrt wird erst dadurch, dass ich etwas als fremd kennzeichne, die Wahrnehmung von Vertrautheit, Nähe und die Zurechnung zum Eigenen möglich. Fremdheit ist also […] eine subjektive Zuschreibung” (Kleinert 2004:31), die der Wissenssoziologie zufolge (Karl Mannheim, Peter L. Berger, Thomas Luckmann u. a.) immer standortgebunden ist. 3.2. Emotionale Färbung Emotionen beeinflussen unser Denken, Reden und Handeln. Dies dürfte unstrittig sein. Die Frage ist nur wie? Geht man davon aus, dass Emotionen vor unserem bewussten Denken, Reden und Handeln vorhanden sind, kann man von Vorgängigkeit der Emotionen sprechen. Zeitlich gesehen hat nicht nur ein Baby, sondern jeder Mensch Emotionen, bevor diese benannt und ausgedrückt werden können. Damit enthalten nicht nur Vorurteile Emotionen, sondern alle Urteile. Wenn dem so ist, dann sind die Einfärbungen der Emotionen vielgestaltiger als positiv und negativ. Dies wird bei den Konstruktionsmustern noch auszudifferenzieren sein. Die Verbindungen von emotionaler Färbung und Mustern des Fremderlebens sind idealtypische Verknüpfungen. Damit kommt es in den Konstruktionsmustern zu einer je spezifischen Verschränkung von Eigenem und Fremdem mit entsprechenden emotionalen Einfärbungen. 3.3. Sinnliche Wahrnehmung von Ausdrucksformen Sinnliche Wahrnehmung im Allgemeinen beruht auf einer „Verschlüsselung und Weiterleitung von Sinnesreizen, die so zu Informationen und letztendlich zu Empfindungen werden“ (Gold 2003:84). Diese mit einem gemäßigten Konstruktivismus vereinbare Annahme ist ein „konstruktiver Prozess“ (ebd.), der sowohl von äußeren „Reizqualitäten“ (ebd.), als auch von „bereits vorhandenem Wissen und Können des Wahrnehmenden abhängt“ (ebd.), welches Reize identifiziert und deutet. Wir wissen wie eine Rose riecht, können uns an deren Duft erinnern, was wiederum unsere Wahrnehmung beeinflusst, wenn uns entsprechende Reize erreichen. Wir wissen, wie unangenehme Auseinandersetzungen mit Fremden anfingen, die bei entsprechenden Reizen aktualisiert werden können. Sobald also Reize aus der Umwelt uns erreichen, greifen wir in unserem Gedächtnis auf gespeicherte Erlebnisse, Erfahrungen, Urteile zurück und fügen den äußeren Reizen noch etwas hinzu. Das kann zu verzerrten oder unangemessenen Urteilen – sogenannten Vor-Urteilen – führen, auch wenn wir subjektiv von der Wahrheit unseres Urteils überzeugt sind. Wenn wir nicht nur unsere eigenen Vorausinformationen ergänzen, sondern Urteile anderer übernehmen, ist unsere Wahrnehmung nicht nur durch persönliche, sondern auch durch soziale Faktoren beeinflusst (siehe Abb. 3). 49 Äußere Reize und Inneres in der sinnlichen Wahrnehmung korrespondieren im vorliegenden Modell mit eigen und fremd. Der darin enthaltene räumliche Aspekt legt den Vergleich nahe, dass eigen und fremd vollständig getrennt sind, wie zwei Räume durch eine Wand getrennt werden. Ohne diese Wand gäbe es weder den eigenen noch den fremden Raum. Die Wand konstituiert beide, indem sie trennt, aber auch verbindet. Wer in einem Haus mit mehreren Mietwohnungen lebt, kennt dieses Phänomen, da er – oft unfreiwillig – das Treiben der Nachbarn mitbekommt. Bezogen auf einzelne Subjekte bedeutet dies: „Das, was mich konstituiert, trennt mich von dem anderen. […] Der andere ist nicht mit mir identisch und kann es nie werden, denn das würde ihn und mich unserer Identität berauben“ (Sundermeier 1996:133f.). Damit ist und bleibt die Wand Konstitutivum und Distinktivum zwischen beiden und darf nicht durchbrochen oder aufgelöst werden. Verstehen des Fremden kann dann nicht als Horizontverschmelzung (Hans-Georg Gadamer) aufgefasst werden, wie dies in der Tradition einer philosophischen Hermeneutik von Paul Ricouer getan wird (vgl. ebd.:78-81). Damit ist festzuhalten: Weil Fremdheit erst dann entsteht, wenn sich Fremde/s dem eigenen Zugriff entzieht, steht die Differenz von Eigenem und Fremdem am Anfang (vgl. dazu auch Akbulut 2013:41). 3.4. Subjektive Konstruktionen der Konstruktionsmuster Am „Anfang steht nicht nur Differenz, sondern auch eine Mischung“ (Waldenfels 2006:118). Menschen unterscheiden sich dadurch, wie sie mit Fremde/m umgehen: Sie können Fremde/s ins Eigene einlassen oder es abwehren, vereinnahmen oder gewähren lassen und sie können dies mit unterschiedlichen Emotionen tun: neugierig oder ängstlich, wertschätzend oder apathisch usw. Da konstruktivistisch gewendet alle Wahrnehmung kognitiv vorstrukturiert ist, kreiert dabei das Gehirn das Mischungsverhältnis von fremd und eigen. Verdeutlicht werden kann dies 50 anhand von sogenannten Vexier- oder Kippbildern. Dem Betrachter vorgelegt, erzeugen sie spontan scheinbar eindeutige Wahrnehmungen beispielweise einer Figur. Doch schon nach kurzer Zeit – je nach Erwartung, Vorinformation usw. – wird eine ganz andere Figur wahrgenommen. In diesem Sinne kippt die Wahrnehmung z. B. zwischen alter und junger Frau oder eben zwischen Eigenem und Fremdem. Die hier vertretene These lautet nun: Je nach Verhältnis von eigen und fremd gibt es nicht nur verschiedene Stile der Fremdbegegnung, sondern Subjekte konstruieren Muster des Fremderlebens. Wie sich auf einem Marktplatz Angebot und Nachfrage in Abhängigkeit von Werbung, Qualität der angebotenen Waren, subjektiven Bedürfnissen der Nachfrager usw. treffen, bilden die Konstruktionsmuster einen Umschlagplatz zwischen Eigenem und Fremdem, zwischen eigener und fremder Kultur bzw. Religion in Abhängigkeit der Dimensionen Ausdrucksform, standortgebundene Zuschreibung, emotionale Färbung und subjektive Konstruktion. Knapp erläutert bedeutet dies: Fremdheit kann nur als Beziehungsaussage verstanden werden. Fremdheit ist also vom eigenen Standort abhängig. Erscheint jemand oder etwas (=Ausdrucksform) einem Subjekt als nahe, vertraut und / oder zugehörig, dann erfolgt durch dieses Subjekt die Standortzuschreibung eigen. Erscheint dagegen jemand oder etwas (=Ausdrucksform) als weit weg, unbekannt und / oder nicht zugehörig, dann erfolgt die Standortzuordnung fremd. Neben dieser ausdrucksformabhängigen Standortzuschreibung ist Fremdheit ein Verhältnis zum Eigenen, das sich mit positiv oder negativ angesehenen Emotionen (Neugier, Wut, Wertschätzung) und subjektiven Konstruktionen verbindet. Damit sind die Grundkategorien von Abb. 1 skizziert. Der Zusammenhang der vier Evidenzquellen wird über die Konstruktionsmuster präzisiert. Insgesamt sind diese Muster unterschiedliche Ausformungen eines Zwischenbereiches, dessen vermittelnder Charakter im Idealfall interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) „weder auf Eigenes zurückgeführt noch in ein Ganzes integriert, noch universalen Gesetzen unterworfen werden kann. Was sich zwischen uns abspielt, gehört weder jedem einzelnen noch allen insgesamt. Es bildet in diesem Sinne ein Land, das niemand (ganz) gehört, eine Grenzlandschaft, die zugleich verbindet und trennt“ (Waldenfels 2006:110). Ein so verstandener Zwischenbereich scheint immer wieder in der Gefahr auf die ein oder andere Art und Weise aufgelöst zu werden (vgl. dazu Sundermeier 1996:73ff.): Bei Betonung von Gleichheit wird die Fremdheit des Fremden enteignet, eingeebnet; bei Betonung von Alterität wird die Fremdheit des Fremden vereinnahmt und bei Komplementarität wird die Fremdheit des Fremden instrumentalisiert. All diese Varianten des Verhältnisses von Eigenem und Fremdem finden sich ansatzweise auch in einzelnen Konstruktionsmustern. 4. Neun Konstruktionsmuster des Fremderlebens Die hier entwickelten Muster Einordnung ins Eigene, Aneignung sowie Anerkennung der / des Fremden konvergieren zum Teil mit drei der vier von Ortfried Schäffter (1991:11ff.) beschriebenen Modi des Fremderlebens, nämlich mit „Fremdheit als Resonanzboden des Eigenen“, „Fremdheit als Ergänzung“ sowie „Fremdheit als Komplementarität“. Ebenso konvergieren die benannten Muster teilweise mit Stufen des entwicklungspsychologischen Modells interkultureller Wahrnehmung von Milton J. Bennett (1993), nämlich „Minimization“ (ebd.:41) (Minimalisierung der Differenz), „Adaption“ (ebd.: 51) (Anpassung an Unterschiede) und „Integration“ (ebd.:59) (Integration der Unterschiede). Die Konstruktionsmuster “Geringschätzung der / des Fremden”, “Fremdenangst” und “(gewaltbereite) Fremdenfeindlichkeit” konvergieren mit Dimensionen von repräsentativen Umfragen der Universität Bielefeld zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in Deutschland bzw. Europa, die seit 2002 durchgeführt werden (vgl. Heitmeyer 2002-2009 und Zick u. a. 2011). Die Erläuterung der Muster erfolgt entsprechend der zunehmenden Ausdifferenzierung der Kategorien zur empathischen Wahrnehmung und Integration von Unterschieden (vgl. dazu Bennett 1993:21). Zur besseren Veranschaulichung wird bei den folgenden Beispielen i. d. R. von zwei Aspekten ausgegangen: Zum einen von einer eigenen deutschen, christlichen Sicht und einer fremden islamischen Kultur bzw. Religion und Religiosität und zum anderen von einer eigenen islamischen Sicht, ohne weitere, sicher notwendige Differenzierungen wie etwa zwischen deutschstämmigen Muslimen, Migranten türkischer oder arabischer Herkunft sowie koptischen, ägyptischen Christen. 4.1. Emotionslose Indifferenz gegenüber den / dem Fremden Dieses Konstruktionsmuster zeichnet aus, dass es nicht mehr darauf ankommt, ob dieses oder jenes geschieht, da „alles in die Monotonie der Gleich-Gültigkeit versinkt“ (Waldenfels 2006:43f.), auch die Emotionen. Vieles langweilt. Damit kommt in diesem Fall kein relevantes Verstehen oder Nicht-Verstehen zustande, weil den Subjekten keine Kategorien zur Unterscheidung verfügbar sind. In der Schule könnten hier Inhalte des Islam einerseits und des Christentums andererseits lediglich kategorienlos angehäuft werden. Eine schulische Notenfixierung könnte diesem Konstruktionsmuster Vorschub leisten, sodass nach der Notenvergabe viel und schnell vergessen wird. 4.2. Apathische Distanz gegenüber den / dem Fremden Hier bestehen lediglich schemenhafte Unterscheidungskategorien, z. B. in Form von ganz allgemeinen Vorstellungen und Begriffen, die mit Apathie verbunden sind. Aus westlicher Sicht könnte die Verschleierung von Frauen im Islam zur Aussage führen: Wie gut haben es nicht-muslimische Frauen in Deutschland. Sie sind gleichberechtigt und auf keine Weise benachteiligt. Der 51 umgekehrte Sachverhalt könnte aus muslimischer Sicht zur Aussage führen: Wenn eine Frau westlich gekleidet ist und kein Kopftuch trägt, ist sie den Blicken der Männer ausgeliefert. Indem ich mich vom Fremden distanziere, erfahre ich durch die Fremdheit etwas mehr von mir (ähnlich wie bei der Aneignung des Fremden). Das Fremde bleibt aber lediglich eine schemenhafte Gegenfolie (Unterschied zur Aneignung), man erkundigt sich nicht nach dem Fremden, hegt keinen Wunsch nach Vertrautwerden, ist weitgehend apathisch. Es wird keine Verschränkung von Eigenem und Fremdem geleistet und doch hat das Fremde eine gewisse Funktion für das Eigene, denn möglicherweise ist man an der Oberfläche freundlich (leben und leben lassen), aber rassistisch, wenn man sich zu einem interkulturellen Kontakt gezwungen fühlt, wie es in den drei Mustern „Geringschätzung“, „Xenophobie“ und „gewaltbereite Fremdenfeindlichkeit“ erfolgt. Alle drei kennzeichnen die „Abwehr von Unterschieden“ (Büttner 2005:19.). Das Erkennen von kulturellen und religiösen Unterschieden ist gekoppelt mit einer negativen Bewertung alles vom Eigenen Abweichenden. „Je größer die Differenz, desto negativer die Abwertung“ (ebd.). Im Vergleich zu den bereits dargestellten Mustern stehen hier zwar besser ausgearbeitete Unterscheidungskategorien zur Verfügung, aber der ursprüngliche Welt- und Glaubensblick ist durch eine „schlechte Integration neuer Kategorien geschützt. Man fühlt sich gegenüber den/ dem Fremden im Belagerungszustand und zur Verteidigung der Privilegien und der Identität genötigt. Häufig kann eine Absonderung in eine Kultur unter Gleichen beobachtet werden, es gibt eine potentielle Unterstützung von Elite- und Hass-Gruppierungen”“(ebd.:20). Kennzeichen dieser Muster ist ein „dualistisches wir-und-die-Denken“ (ebd.:19), häufig von negativen Stereotypen begleitet. Der Glaube an die Höherwertigkeit der eigenen Kultur und Religion ist mit der Tendenz zur Bekehrung der Fremden verbunden. Doch nun zur Erläuterung der Muster. 52 4.3. Antipathische Geringschätzung der / des Fremden Die Beziehung zwischen Eigenem und Fremdem ist mit einem negativen Vorzeichen, mit Antipathie versehen. Fremde/s (Kultur wie Religion) wird hier abgewertet. Da es aber weit genug vom Eigenen entfernt ist, kann es nicht bedrohlich werden. Es ist möglich, dass hier aus Unverständnis geringschätzig über das Fremde gelacht wird (z. B. von deutschen Christen über muslimische Gebete in arabischer Sprache) oder dass Fremde/s bewusst abgewertet wird (z. B. der Koran als Plagiat der jüdischchristlichen Schriften und Lehren). Weiter kann aus christlicher Sicht die Geringschätzung am fremden Islam mit folgenden Formulierungen verdeutlicht werden: „Die muslimische Religion und Kultur passt nicht in unsere westliche Welt“, „Islamische und westeuropäische Wertvorstellungen lassen sich nicht miteinander vereinbaren“ und „Der Islam hat eine verachtenswerte Kultur hervorgebracht“ (Leibold / Kühnel 2008:102). Aus muslimischer Sicht könnte es heißen: Der Westen ist eine Unkultur. Den Christen ist alles erlaubt. 4.4. Angst vor Fremdem (Xenophobie) Wenn das Fremde dem Eigenen zu nahe rückt, kann Angst vor dem Fremden aufkommen. In Anlehnung an die englische Bezeichnung für Fremdenfeindlichkeit (xenophobia) wurde erstmals 1997 in einem Bericht des Runnymede Trust der Begriff Islamophobie in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt (Runnymed Trust 1997). Darunter versteht man die Angst vor muslimischen Personen, allen Glaubensrichtungen, Symbolen und religiösen Praktiken des Islam (vgl. Kühnel / Leibold 2007:135). Entsprechendes trifft auch für die muslimische Seite im Blick auf das Christentum bzw. den Westen zu. Beiden gemeinsam ist, dass man (ständig) auf mögliche Angriffe von Fremden eingestellt ist und man unter Umständen überall die Bedrohung sehen kann. Nach dem 11. September 2001 trugen besonders in Europa verschiedene interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Entwicklungen zu einer Panik bei: „der weltweite Krieg gegen den Terror, die immer sichtbarere Ausbreitung globaler muslimischer Diskurse und Netzwerke, die Verbreitung weltweiter Diskurse über den Islam und Kontroversen über die Verschleierung und über den islamischen Fundamentalismus“ (Casanova 2009:61f.). Aus westlicher, christlicher Sicht befürchtet man, dass alle dunkelhäutigeren Menschen Araber und damit islamistische Terroristen sein könnten. Auch spiegeln folgende Aussagen dieses Konstruktionsmuster wider: „Durch die vielen Muslime hier (in Deutschland) fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land.“, „Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden“ (Leibold / Kühnel 2008:102). Die entsprechende muslimische Sicht von Migranten in Deutschland könnte lauten: „Was wir Muslime tun, ist richtig, was die ungläubigen Deutschen da draußen tun, ist vom Satan“ (Behr 2009:34). 4.5. Gewaltbereite Fremdenfeindlichkeit aus Wut und Hass Das Fremde rückt hier so nahe, dass Menschen meinen das Eigene zu verlieren, wenn sie das Fremde nicht bekämpfen. Von Wut und Hass entzündet erfolgt der Kampf und zwar mit körperlicher Gewaltanwendung oder damit zumindest sympathisierend. Die gewalttätige Ausprägung dieses Musters zeigt sich z. B. durch das Anzünden von Asylantenheimen und das Zusammenschlagen von Fremden auf offener Straße. Daneben gibt es aber auch mit Gewalt sympathisierende Menschen, denen möglicherweise folgende Aussagen zugeordnet werden können: „Es sollte besser gar keine Muslime in Deutschland geben“ und „Muslimen sollte jede Form der Religionsausübung in Deutschland untersagt werden“ (Kühnel / Leibold 2007:143), sowie damit korrespondierend: In Ägypten sollten Christen ihre Religion nicht ausüben dürfen, besser noch wäre es, wenn es keine Christen geben würde. 4.6. Emotionslose Toleranz gegenüber den/dem Fremden Differenzen werden hier als sinnvoll toleriert, wobei die Unterscheidungskategorien kognitiv bewusst und ausgearbeitet sind, aber ohne Verbindung zu Emotionen bleiben. Damit besteht die Fähigkeit, Situationen und Phänomene im Rahmen ihres Kontextes zu interpretieren. Wenn z. B. die Konstruktion durch Einordnung des Fremden in das Eigene wegen zu großer Unzugänglichkeit fehlschlagen muss (z. B. Reinigung vor dem islamischen Gebet mit Wasser, das auch durch die Nase geführt werden muss), kann die Konstruktion so erfolgen, dass die Phänomene aus ihrem eigenen kulturellen Kontext heraus wahrgenommen sowie erklärt werden (in unserem Beispiel: Die Reinigung vor dem Gebet erfolgte, weil Staub und Sand in heißen Gegenden der Erde überall eindringen) und eine Verschmelzung von eigenem und fremdem Horizont ausgeschlossen ist. Dieser Weg betont die Unzugänglichkeit, indem er die Phänomene entweder historisiert oder nach spezifischen Konfigurationen sucht, die fremden Wirklichkeitsannahmen und Wahrheitsansprüchen Geltung verleihen. In diesem Sinne hat hier Toleranz den Beigeschmack von Duldung und Ertragen (lat. tolerare = dulden). Wird Toleranz auch emotional positiv konnotiert und als Mitverantwortung oder als „Anerkennung des Anderen als zwar anders, aber wertvoll und gleichberechtigt“ (Sader 2002:54) verstanden, so wären wir beim Konstruktionsmuster Anerkennung. Zuvor aber noch zum Einordnung- und Aneignungsmuster. 4.7. Sympathische Einordnung des Fremden ins Eigene mit Neugier und Faszination Sympathie prägt hier die Beziehung zum Fremden. Es ist der Versuch, Fremdes so zu verstehen, dass man sich überlegt, wie man sich in der Position der / des Fremden fühlen würde (vgl. Bennett 1993:53). Wahrgenommene oberflächliche Differenzen (z. B. Essund Gebetsgewohnheiten) werden unter vertraute Kategorien eingeordnet 53 (tief im Innersten sind wir alle gleich) und damit minimalisiert nach dem Motto: Solange alle Leute grundsätzlich wie wir sind, können sie nach ihrer Art leben und beten. Die einholende Konstruktion des Fremden an den eigenen Standort setzt „Prozesse der Rezeption (mit Selektion) und der Integration (mit der Anwendung in den eigenen Rahmen) voraus“ (Krämer 2007:42). Ähnlich wie bei Projektion, wird das Neue / Fremde vom Eigenen her selektiv rezipiert und in vorhandene, eigene Erfahrungen und Begrifflichkeiten vollständig integriert. Zum Beispiel: Die für einen in Deutschland lebenden Christen neue Funktion des Minaretts wird von seinem eigenen Vorverständnis des Glockenturms einer Kirche her selektiv rezipiert und an vorhandene, eigene Erfahrungen des Gottesdienstbesuches und das eigene christliche bzw. katholische Kirchenverständnis vollständig angeglichen, obwohl es im Islam weder ein entsprechendes Sakramentennoch Kirchenverständnis (muslimische Gemeinden sind als Vereine organisiert) gibt. Hier werden Gemeinsamkeiten vor dem Trennenden gesucht, was eine vorbehaltlosere und angstfreie Begegnung mit dem Fremden erlaubt. Da aber diese Begegnung auch neugierig und fasziniert erfolgt, wird bei der Einordnung des Fremden an den eigenen Standort dem Eigenen eine deutliche Priorität eingeräumt und damit wird die Unzugänglichkeit des Fremden leicht übersehen. 4.8. Empathische Aneignung der / des Fremden mit Wertschätzung Hier wird Empathie im qualifizierten Sinne eingesetzt. Im Unterschied zu Sympathie ist Empathie der Versuch, Fremdes so zu verstehen, wie es sich aus der fremden Perspektive anfühlt (vgl. Bennett 1993:53). Ersetzt man bei Sympathie Eigenes durch die Freude oder das Leid des Fremden, wobei die Gefühle die eigenen bleiben, erhält man bei Empathie Anteil an der Erfahrung und Perspektive des Fremden, sodass ein wirklicher Wechsel des kulturellen und religiösen Referenzrahmens erfolgt (vgl. 54 ebd.). Aneignung meint hier ein über Grenzen hinweg wertschätzendes und begreifendes Erkennen der Fremdheit, „nicht deren Unterwerfung, Inbesitznahme oder Auflösung in einer ‘Horizontverschmelzung’, sondern der Prozess einer partiellen, distanzwahrenden assimilativen und reziproken Integration im Sinne eines Vertrautwerdens in der Distanz“ (Wierlacher 2000:110). Es erfolgt also eine „partielle Integration“ (ebd.) des Fremden. Dazu ist aber die Kompetenz notwendig, die „Innensicht der Außensicht einnehmen zu können“ (Michel 1992:27f.) (Perspektivenwechsel). Gelingt dies, erfahre ich in der Begegnung mit dem Fremden (z. B. das Fasten im Monat Ramadan) „durch die Fremdheit etwas mehr von mir, weil ich dabei erkunde, warum das Fremde für mich fremd ist“ (König 1999:302) (z. B. Warum fasten viele Christen kaum noch – oder wenn doch, dann nicht aus religiösen, sondern aus ästhetischen Gründen?). Da das Fremde hier die Funktion der Bereicherung für mich haben kann, wird es aber in gewisser Weise funktionalisiert. „Trotz der geleisteten Verschränkung von Eigenem und Fremdem stellt sich hier die Frage, ob nicht gerade diese Funktionalisierung die Wahrnehmung des Fremden nicht zu sehr einengt und es in seiner Eigenart zu wenig freigibt“ (ebd.). 4.9. Empathische Anerkennung der / des Fremden mit Respekt und Achtung Hier kann man sich selbst als jemand sehen, der sich in einem lebenslangen Lern- und Glaubensprozess befindet. Welt- und Glaubenssichten werden als Konstrukte wahrgenommen und beschreibbar (vgl. Bennett 1993:59). Was ist dafür nötig? Nach Georg Wilhelm Friedrich Hegel muss ein Subjekt zuvor eine Phase der Entfremdung durchlaufen, um auf einer höheren Stufe (Synthese) seine Weiterentwicklung zu verwirklichen: Entfremdung vom Eigenen, Irritationen und Brechungen. Nur so kann das fremde Gegenüber einem selbst etwas sagen, das man „sich nicht selbst hätte sagen können“ (Schäffler 2009:28). In der durch solche interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Prozesse der Entfremdung und Selbstbildung hervorgegangenen Anerkennungskonstruktion wird mit Respekt und Achtung die Uneindeutigkeit und Unausschöpflichkeit des Fremden gewahrt, ohne dass das Fremde völlig fremd bliebe. Die Zuordnung zum Eigenen (Ähnlichkeiten entdecken) erfolgt, ohne dass das Fremde angeeignet wird, weil das „Störende und Differente der Fremdheitserfahrung wahrgenommen und beantwortet“ (König 1999:303) werden kann. Z. B.: Ähnlich wie gläubige Muslime am Freitag zum Gebet in die Moschee gehen, können gläubige Christen am Sonntag zum Gebet in die Kirche gehen. Doch wenn Muslime und Christen beten, unterscheidet sich nicht nur die Art des Betens, sondern auch das jeweilige Gottesverständnis erheblich (wenn Christen Gott als Vater bezeichnen, kann das für Muslime einer verbotenen Vermenschlichung Gottes gleichkommen). Auch wenn Verstehen hier sehr weitgehend erfolgt, hat es seine Grenze in jenem Verstehen des Fremden, das das Eigene völlig fremd werden ließe (würden Christen aus Rücksicht auf Muslime auf das Verständnis Gottes als Vater verzichten, würden sie einen Teil ihres personalen Gottesverständnisses aufgeben). Praktisch geht es hier um ein umsichtiges Eintreten für die Entfaltung des Fremden, beispielsweise dadurch, dass Moslems geeignete Räumlichkeiten zum Gebet erhalten können und deshalb grundsätzlich Moscheen in Deutschland erlaubt werden sollten. Würde man diese aber zur Vorbereitung von Terror gegen die deutsche Gesellschaft nutzen, wäre die entsprechende Grenze überschritten. Hier wird also eine Dialogkompetenz mit dem Fremden angestrebt, die die Plausibilität und Selbstverständlichkeit bisheriger Urteile dadurch modifiziert, dass sie neben die einer bislang nicht vertrauten Erfahrung, Religion oder Kultur treten (z. B. Moscheen stehen neben Kirchen). Im Muster der Anerkennung wird erreicht, was eines der schwierigsten Dinge überhaupt ist: Respektvoll und achtsam fremde Perspektiven perspektivisch richtig in die eigene Sicht zu integrieren. 5. Konkretionen für interkulturelle Bildungsprozesse Im Blick auf interkulturelle Bildungsprozesse, schulischer wie außerschulischer Art, erlaubt das hier vorgestellte Modell insgesamt eine Neubewertung und Ausdifferenzierung von wahrnehmen und deuten, denn wahrnehmen ist ein von Emotionen begleiteter Prozess, der nicht ohne subjektives deuten auskommt. Auch die Gestaltung von Begegnungen mit Fremden impliziert Deutungen, die oft nur teilweise die bleibende Fremdheit respektieren und eine tiefe existentielle Bedeutung erhalten. In Einzelnen seien einige Aspekte präzisiert: Konstruktivität von Wahrnehmung: Präsentiert eine Lehrperson eine tradierte Ausdrucksform einer Kultur, einen fremden Inhalt (z. B. einen ursprünglich aus Ägypten stammenden Text für deutsche Schüler/innen), so wird dieser nicht einfach von den Schüler(inne) n 1:1 übernommen. Vielmehr konstruieren die Schüler/innen den Inhalt aufgrund des Eigenen je neu. Der gleiche Inhalt kann also bei unterschiedlichen Schüler(inne)n sehr verschieden ankommen. Ähnlich verhält es sich im außerschulischen Bereich. Begegnen Menschen fremden Kulturen, können diese von Menschen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Für die Initiierung von Bildungsprozessen bedeutet dies, dass man eine gewisse Vorstellung von dem haben muss, was Menschen selbst kulturell ihr Eigenes nennen (wollen oder können). Damit in Zusammenhang steht, dass die für Bildungsprozesse verantwortliche Person einschätzen können sollte, welche Ausdrucksformen bei den Teilnehmenden eher das Sicherheitsbedürfnis oder eher die Neugier ansprechen. Ausdrucksform bzw. Darstellungsform: Die Ausdrucksformen tradierter Kulturen, die fremden kulturellen Zeugnisse, passen oft nicht zum schulischen Unterricht. Weil sie nicht einfach wie andere im Unterricht durchzunehmende Gegenstände behandelt werden dürfen, sollte eine Sensibilisierung stattfinden, die auch der Fremdheit dieser Gegen- 55 stände ihr Recht gibt. Darüber hinaus ermöglicht die Transformation tradierter Ausdrucksformen für den schulischen Kontext in Darstellungsformen einen didaktischen Zugriff. In einem öffentlichen Unterricht sollten unterschiedliche Darstellungsformen dem schulischen Kontext und unterschiedlichen Bezugssystemen (z. B. eigene und fremde Kulturen) angemessen präsentiert werden. Dies ist die Voraussetzung, dass Schüler/innen ihre persönlichen Bedeutungen der / des Fremden finden und erfinden können. Bewusstwerden der Konstruiertheit der Wahrnehmung: Aufgrund der Auseinandersetzung mit dem / den Fremden können Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene Einsicht in die Prinzipien und Mechanismen der Wahrnehmung erlangen. Durch die Konfrontation mit dem / den Fremden können vorreflexive, akkumulierte, sedierte und aktualisierte Vorprägungen bewusst werden. Somit dürfte zukünftig wohl nicht primär objektive Wahrnehmung vom Fremden und Eigenen im Vordergrund stehen, sondern sich des Eigenen und der Mechanismen der Wahrnehmung bewusst zu sein. Es geht also darum, nicht nur die Bilder der / des Fremden, sondern auch von sich selbst zu verstehen, zu akzeptieren oder ggf. zu verändern. Bedeutung von Emotionalität: Während Apathie und Emotionslosigkeit die kognitiven Dissonanzen zwischen Handeln und Einstellungen der Menschen verschleiern (vgl. dazu die sozialpsychologische Theorie von L. Festinger) und Sympathie sowie Antipathie diese reduzieren, wird ausschließlich Empathie dem Fremden voll gerecht. Da aber kein Mensch ohne Emotionen vollständig ist, sind alle pathischen Reaktionen der Teilnehmenden an Bildungsprozessen von Bildungsverantwortlichen sensibel wahrzunehmen, auch solche der Angst vor Fremdem, die evolutionsbiologisch erklärbar ist. Abwertende Konstruktionen: Die Konstruktionsmuster Geringschätzung, Fremdenangst und gewaltbereite Fremdenfeindlichkeit enthalten negative Emotionen, die als Wahrnehmungs- 56 bzw. Erkenntnisfilter wirken. Dagegen mit rein kognitiven Instruktionen anzureden dürfte wirkungslos bleiben, da sie an den emotionalen Filtern abprallen. Für eine Dekonstruktion dieser Muster scheint es hilfreicher, zunächst die zugrunde liegenden Emotionen sensibel wahrzunehmen, um diese zu bearbeiten (z. B.: Was macht Angst? – möglicher Arbeitsplatzverlust; Gewalt; fremde Sprache/n in der Öffentlichkeit). Apathie bzw. Emotionsneutralität: Arbeitet man sich in interkulturell relevanten Bildungsprozessen allein an Wissen über Fremdes ohne emotionalen Bezug ab, dürfte dies im Ganzen zu wenig sein, denn ein solches Wissen wäre lediglich „träges Wissen“ (Renkl 2006:780), ein Wissen also, das zwar vorhanden, aber vom jeweiligen Subjekt nicht nutzbar ist und damit letztlich bedeutungslos bliebe. Sympathie: Sympathie und die alleinige Suche nach Gemeinsamkeiten sind keine Gewähr für gelingende interkulturelle Bildungsprozesse. Vielmehr kennt man das Phänomen von Verliebten, die den / die Geliebte/n unter einer rosarot gefärbten Brille wahrnehmen. Verblasst diese Brille oder wird sie (irgendwann) abgenommen, kann dies ein (böses) Erwachen zur Folge haben. Um dies zu vermeiden scheint eine der Realität angemessenere Empathie auf Dauer angebrachter. Empathie: Empathie ist in interkulturellen Bildungsprozessen, in denen Unterschiede angemessen wahrgenommen werden sollen, am meisten angebracht. Es ist eine Einfühlung, die “durch Vorstellung erreichte kognitive und emotionale Anteilnahme an Erfahrungen anderer Personen” (Bennet 1998:207). Im Vergleich zu Sympathie sind damit besonders zwei Unterschiede bedeutsam: „Anteilnahme“ statt „Ersetzen“ und „Erfahrung“ bzw. „Perspektive“ statt „Position“ (ebd.). Im Vergleich zu Sympathie akzeptiert man dann in interkulturellen Bildungsprozessen Unterschiede. Erarbeitung von Differenzkategorien: Zunächst muss man lernen, innerhalb der eigenen Kultur und Religion Dif- interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) ferenzen wahrzunehmen und in ihnen konstruktiv zu handeln. Erst dann hat man sprachlich fassbare Kategorien verfügbar, um Differenzen gegenüber Fremden und Fremdem in positiven Begriffskategorien beschreiben zu können. Behr, H. H. (2009): Der Satan und der Koran. Zur theologischen Konstruktion des Bösen im Islam und dem therapeutischen Ansatz im Islamischen Religionsunterricht. In: Berger, K. / Herholz, H. / Niemann, U. (Hrsg.): Das Böse in der Sicht des Islam. Regensburg: Pustet, S. 33-52. Ausbildung von empathischer Wahrnehmung: Im Bereich der Schule ist neben interkulturell angelegten Lernprozessen die gesamte Schulkultur anerkennungsorientiert zu gestalten. Doch wo lernen Lehrende dies? Sinnvoll scheint es hier nicht nur für Lehrpersonen, sondern für alle Bildungsverantwortliche, schon in der Ausbildung empathisches Wahrnehmen der / des Fremden zu entwickeln. Dazu sind bereits im Studium auf Begegnung und Reflexion angelegte Konzeptionen notwendig, welche die Ausbildung interkultureller Empathie nicht nur dem Einzelnen oder dem Zufall überlassen, sondern systematisch aufzubauen vermögen. Bennett, M. J. (1993): Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of intercultural Sensitivity. In: Paige, R. M. (Hrsg.): Education for the intercultural Experience. Yarmouth: Intercultural Press, S. 21-42. 6. Schluss Bei den skizzierten Konkretionen ist zu berücksichtigen, dass nicht immer in der konkreten Begegnung mit den / dem Fremden gelernt werden kann. Empathische Wahrnehmung in interkulturellen Bildungsprozessen soll im Blick auf die Verhältnisse in Deutschland berücksichtigen, dass bestimmte Menschen kaum präsent sind. Aus diesem Grund sind auch Lernszenarien realistisch, welche diese Abwesenheit vergegenwärtigen. 7. Literatur Akbulut, N. (2013): Die Kontinuität und Wirkmächtigkeit von Fremdheitskonstruktionen in antiislamischen Diskursen. Interculture Journal 2013(20). URL:http:// www.interculture-journal.com/download/issues/2013_20.pdf [Zugriff am 12.06.2013]. S. 37-45. Auernheimer, G. (2012): Einführung in die interkulturelle Pädagogik. Darmstadt: wbg. Baumann, Z. (1996): Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Frankfurt a. Main: Fischer TB. Bennett, M. J. (1998): Overcoming the Golden Rule: Sympathy and Empathy. In: Bennett, M. J. (Hrsg.): Basic Concepts of Intercultural Communication. Boston / London: Intercultural Press, S. 191-214. Büttner, Chr. (2005): Lernen im Spiegel des Fremden. Konzepte, Methoden und Erfahrungen zur Vermittlung interkultureller Kompetenz. Frankfurt a. Main / London: IKO – Verlag für interkulturelle Kommunikation. Casanova, J. (2009): Europas Angst vor der Religion. Berlin: University Press. Finn, C. (2008): Konstruktivismus für Einsteiger. Paderborn: W. Fink (UTB). Gold, A. (2003): Gedächtnis und Wissen. In: Preiser, S. (Hrsg): Pädagogische Psychologie. Psychologische Grundlagen von Erziehung und Unterricht. Weinheim u. a.: Juventa, S. 69-97. Heitmeyer, W. (2002-2009): Deutsche Zustände. Folge 1-7. Frankfurt a. Main: Suhrkamp. Kleinert, C. (2004): FremdenFeindlichkeit. Einstellungen junger Deutscher zu Migranten. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. König, K. (1999): Fremdes verstehen lernen. Zwischen Abgrenzung und Anerkennung. Katechetische Blätter 124, S. 299-304. Krämer, H. (2007): Kritik der Hermeneutik. Interpretatiosphilosophie und Realismus. München: C. H. Beck. Kühnel, S. / Leibold, J. (2007): Islamophobie in der deutschen Bevölkerung. Ein neues Phänomen oder nur ein neuer Name? Ergebnisse von Bevölkerungsumfragen zur gruppenbezogenen Menschenfreundlichkeit 2003 bis 2005. In: Wohlrab-Sahr, 57 M./ Tezcan, L. (Hrsg.): Konfliktfeld Islam in Europa (Soziale Welt, Sonderband 17). Baden-Baden: Nomos, S. 135-154. Waldenfels, B. (2006): Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Frankfurt a. Main: Suhrkamp. Leibold, J. / Kühnel, S. (2008): Islamophobie oder Kritik am Islam? In: Heitmeyer, W. (Hrsg.): Deutsche Zustände. Folge 6. Frankfurt a. Main: Suhrkamp, S. 95-115. Wierlacher, A. (2000): Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung. München: Iudicium. Michel, W. (1992): Die Außensicht der Innensicht. Zur Hermeneutik einer interkulturell ausgerichteten Germanistik. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 17/1991. München: iudicium, S. 11-33. Zick, A . / Küpper, B. / Hövermann, A. (2011): Die Abwertung der Anderen. Eine europäische Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung. URL: http://library.fes.de/pdf-files/ do/07905-20110311.pdf [Zugriff am 12.06.2013]. Reich, K. (2008): Konstruktivistische Didaktik. Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool. Weinheim u. a.: Beltz. Renkl, A. (2006): Träges Wissen. In: Rost, D. H. (Hrsg.): Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim / Basel: PVU, S. 778-782. Runnymed Trust (1997): Islamophobia. A Challenge for Us All. London: Runnymed Trust. Sader, M. (2002): Toleranz und Fremdsein. 16 Stichworte zum Umgang mit Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Weinheim / Basel: Beltz. Schäffler, R. (2009): Philosophische Grundlagen des Gesprächs der Religionen. In: Müller, T. / Schmidt, K. / Schüler, S. (Hrsg.): Religion im Dialog. Interdisziplinäre Perspektiven – Probleme – Lösungsansätze. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 19-48. Schäffter, O. (1991): Modi des Fremderlebens. Deutungsmuster im Umgang mit Fremdheit. In: Schäffter, O. (Hrsg.): Das Fremde. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 11-42. Siebert, H. (2003): Pädagogischer Konstruktivismus. Lernen als Konstruktion von Wirklichkeit. Neuwied / Kriftel: Luchterhand. Sundermeier, T. (1996): Den Fremden verstehen. Eine praktische Hermeneutik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Valentin, K. (2007): Die Fremden. In: Valentin, K (Hrsg.): Buchbinder Wanninger. Sämtliche Werke Band 4: Dialoge. München: Piper, 176-177. Waldenfels, B. (1997): Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden 1. Frankfurt a. Main: Suhrkamp. 58 interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Integrating Intercultural Communicative Competence into the curriculum of a department of Foreign Languages: An Exploratory Case Study Die Integration von interkultureller Kommunikationskompetenz in das Curriculum eines Institutes für Fremdsprachen: Eine explorative Fallstudie Joe Terantino Abstract (English) Ph.D., University of South Florida, Director of the Foreign Language Resource Center and Assistant Professor of Spanish and Foreign Language Education at Kennesaw State University This article presents an ongoing initiative to integrate intercultural communicative competence into the curriculum of a department of foreign languages. This work identifies and describes the nine emergent steps that were taken as part of the process, giving special attention to the challenges, failures, and successes encountered by the group. In addition, the authors articulate five lessons learned from the project so that other departments, from foreign languages or other disciplines, may learn from the experiences described. The authors conclude with a general statement about the relative difficulty of the project, highlighting the current status and future plans for the initiative. Claudia Stura Keywords: Curriculum reform, foreign language, intercultural communicative competence Ph.D candidate in International Conflict Management at Kennesaw State University, USA Sabine H. Smith Professor of German and serves as Section Head of German Studies at Kennesaw State University (KSU) Jeannette Böttcher M.A., (ABD) teaches Foreign (English) Language Education at the University of Paderborn, Germany Abstract (Deutsch) Der vorliegende Artikel beschreibt die Initiative, interkulturelle Kommunikationskompetenz als festen Bestandteil in das Curriculum eines Institutes für Fremdsprachen zu integrieren. Zudem werden die neun relevanten Schritte, die während dieses Prozesses unternommen wurden, erläutert. Den auftretenden Herausforderungen, Niederlagen und Erfolgen wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Darüber hinaus präzisieren die Autoren die Erkenntnisse, die sie aus dem Projekt gewonnen haben, so dass sich andere Einrichtungen, wie z. B. Fremdsprachenabteilungen oder andere interessierte Institutionen, die hier gesammelten Erfahrungen zunutze machen können. Die Autoren schließen ihren Beitrag mit einer Ausführung über die Schwierigkeit des Projektes ab, beleuchten den derzeitigen Status und geben einen Ausblick auf zukünftige Pläne der Initiative. Schlagwörter: Reform des Curriculum, Fremdsprachen, Interkulturelle Kommunikationskompetenz 59 1. Introduction In a general, educational climate that promotes globalism and cultural diversity, the present case study focuses on the process of introducing intercultural communicative competence (ICC) into the curriculum of the Department of Foreign Languages (DFL) at a regional state university in the southeastern United States. The initiative, sponsored by the university, supported curricular review, assessment, and innovation in connection with the institution’s strategic plan and the mission and vision of its College of Humanities and Social Sciences and the DFL. Specifically, the researchers in this case study drew from a major goal of the institution’s strategic plan: “Goal #6: To promote an inclusive campus environment through the adoption of […] curricula that are guided by the principles of diversity, equity, transparency, and shared governance” (KSU 2010:19). In an ever more global world, and with institutional mandates of providing students with opportunities for intercultural learning, the time was right to launch this comprehensive curricular initiative that was guided by collaboration within the DFL. Because the department’s degree program Modern Language and Culture is grounded in a proficiency-centered curriculum, instruction is facilitated as much as possible through the target language. Hence the initiative of exploring the role of ICC in the department was convened to examine the role of ICC as an integrated, developmental learning outcome for faculty and students in the department. To date, a description of this process has not been documented, although an emergent body of scholarship is beginning to explore this visionary direction in the discipline of language study (Banks 2008, Deardorff 2009, Dupuy & Waugh 2011, Landis et al. 2004, Levine & Phipps 2012). This recent scholarship recognizes the approach by which DFL curricula prepare learners with skills, content knowledge, and dispositions related to the target language and 60 culture. However, the literature does not show that programs systematically develop, assess, or measure the learners’ progressive attainment of intercultural competence, i. e. the ability to navigate successfully any encounter with difference. This case study research operationalizes ICC and examines the steps taken to implement the deliberate and strategic inclusion of ICC as a learning goal in the DFL curriculum. The systematic description of the yearlong process is the subject of this case study. The article begins with an overview of the international call to include ICC in education. Then, there is a description of the nine emergent steps that were undertaken throughout the yearlong process, academic year 2010-2011. The final sections of the article relate the lessons learned from the initiative so that others may benefit from these experiences. This research and the lessons learned have led to one indisputable conclusion. An initiative for integrating ICC into the DFL curriculum is difficult, albeit not impossible, and it requires a more complex process than many would think. 2. Intercultural Competence in Europe and the United States In Europe, with the Bologna Declaration in 1999, a decisive step towards the realization of comprehensive educational goals was taken. The progressing migration within the European Union has made the need for new requirements concerning language education obvious. Foreign language education has to be paired with “adequate intercultural competence” (Stier 2006:2). Furthermore, the old equation, grammar + vocab = language, no longer applies. Realization that a much more comprehensive approach to language education is needed has started discussions about new learning objectives including intercultural competence. According to Byram, Nichols and Stevens, language and culture are regarded as an “integrated whole” (2001:1) and have been taught under different labels interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) for many years. Byram sees the focus no longer on training a grammatically perfect speaker, but on the development of an intercultural speaker. This intercultural speaker should have “the ability to interact with ‘others’, to accept other perspectives and perceptions of the world, to mediate between different perspectives, to be conscious of their evaluations of difference” (Byram and Zarate 1997:239ff. see also Kramsch 1998), which in time will help promoting intercultural citizenship. In his article Internationalisation, intercultural communication and intercultural competence Stier (2006:8) proclaims that “there is a need for: (1) scrutinizing the ideological basis of higher education; (2) drawing from these ideologies, discussing the role of intercultural communication education in higher education; (3) identifying the cornerstones of intercultural competencies; and (4) proposing an adequate model for ICE.” (Stier 2006:8) However, he emphasizes that so far, neither the higher education institutes nor the teaching personnel is fully capable of meeting the needs of modern societies. Among the European intellectuals the discussion on what exactly ICC is and on how it should be integrated into the education system is far from over. The mission of the Bologna Declaration, however, is a vital step towards an “ideological convergence, a European sense of community and cultural conformity – and, consequently of social harmony” (Stier 2006:4). Ideally, says Stier, ICE should comprise the six ‘i-characteristics’: intercultural themes, investigative, interdisciplinary perspectives, interactive, integrated, and integrative views (ibid.:8). Once this six step program is completed, the outcome should equip the student ideally with the six ‘c- characteristics’: communicative competence, cooperative competence, confidence, commitment, critical thinking, and comparability (ibid.:9). Similarly, in the United States the Modern Language Association (MLA) report of 2007 made specific recommendations for foreign language departments to adjust to a changed world and pedagogical paradigm shifts so that foreign language learners would experience their studies as more coherent and integrated (MLA 2007:3), and as equipping students with skills that exceed and transcend functional proficiency in the target language and culture (ibid.:4). As the MLA report states, “language is considered to be principally instrumental, a skill to use for communicating thought and information”, but also as “an essential element of human being’s thought processes, perceptions, and selfexpressions; and as such it is considered to be at the core of translingual and transcultural competence” (ibid.:2). According to the MLA report, the two-tiered configuration of language learning on the one side and literary studies on the other has surpassed its usefulness and should be “structured to produce a specific outcome: educated speakers who have deep translingual and transcultural competence” (ibid.:3). To achieve this goal, the MLA suggests offering students more general courses, like “language and cognition, language and power, bilingualism, language and identity, language and gender, language and myth, language and artificial intelligence, and language and the imagination” (ibid.:60). With these worldwide movements for reforming language education to include intercultural competence as a major component in mind, the initiative to integrate ICC into the DFL curriculum began. 3. Methods Based on a qualitative, case study approach, the objective of this study was to reach a full understanding of the process of integrating ICC in the DFL curriculum. Multiple methods of data collection were used for this study, including a questionnaire, a review of foreign language teaching materials and ICC based workshops and presentations, and in-depth readings and discussions. This approach allowed for understanding the process of integrating ICC in its full context (Merriam 1998, Patton 1990, Stake 1995, 2005). Interpretations culled from analyses, drawn 61 on comprehensive descriptions of triangulated data, were intended to offer new perspectives on this previously uninvestigated field. The purpose was neither to understand some abstract construct nor theory building (Merriam 2009), it was to understand this particular case, which may indicate starting points for future research. As the research question was the driving force behind this study, the purpose was to examine the steps taken in an effort to explore the integration of ICC into the curriculum of the DFL. 3.1. The Case Study Approach To gather the necessary data to depict the department’s approach to integrating ICC, the research paradigm for this study was qualitative, utilizing the case study method. The qualitative paradigm was chosen for this research because it is intended to form an in-depth understanding of the case being investigated. Yin states that a case study “investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (2009:13). Observing the participants in a situated social context was essential for this research. In this study the researchers attempted to describe the case, analyze the themes present in the description, and ultimately make some interpretations from the data. By incorporating data from multiple sources, the object was to reach a full understanding of the phenomenon. In accordance to Yin’s (2009) case study method, the scholars studied certain decisions in the process: why they were taken, how they were implemented and with what result. Hence, this study examined the following research question: Which steps may be taken to explore the integration of ICC into the DFL curriculum? 3.2. Role of the researchers It is important to note that the primary researchers in this study also served as participants in the faculty learning community (FLC) under examination. Be- 62 cause of this dual role as researchers and participants, they began the study with existing relationships within the department and the broader university community. These relationships facilitated the study by providing ease of access and a familiarity with the inner workings of the department. It was also essential for the researchers to acknowledge their role in data collection and analysis. Morse and Richards (2002) refer to this as awareness of self. In this manner knowledge was socially constructed by the researchers as they participated in the faculty learning community. 3.3. A Description of the Setting and the Participants The setting of this study was the DFL at a large, southeastern university during the academic year 2010-2011. This department offers a major in Modern Language & Culture. Spanish is the predominant language taught by the department, and French and German are also offered as options for the major. In addition, Chinese, and Italian are choices for a minor. The unit of analysis in this case study consisted of FLC members, taskforce members, workshop participants, and interested DFL faculty members. These participants consisted of a diagonal cut of the department’s administrative and teaching faculty, lecturers, part-time instructors, and a graduate research assistant with foreign language expertise and a research focus in intercultural competence. Multiple languages were represented in this community including: Chinese, French, German, Italian and Spanish. In addition, several of the faculty participants held joint appointments in a foreign language and in foreign language education. Last, it is important to note that both the members of the faculty learning community and the task force received incentives provided by grant funding. These incentives included book purchases for readings and discussions and participant stipends. They were also required to attend 80 percent of the seminars and workshops and to engage with reading materials. interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) 3.4. Data Collection For this case study data were collected throughout the academic year 20102011. Data were collected primarily through an initial survey, a review of teaching materials and reading-based discussions related to ICC researcher journals, and an end-of-the-process evaluation. As several case study researchers have stated (Gillham 2000, Stake 1995, Yin 2009), it is very important to have multiple sources of evidence in case study research. In this manner a combination of data sources provide a clearer description of the department’s approach to integrating ICC in the teaching methods. The initial survey was administered during a department faculty meeting in the fall 2010 semester. It was conducted among the DFL teaching faculty to gauge faculty awareness and attitudes toward teaching ICC, their knowledge of it as well as assessing their teaching strategies, preferences and materials. Other segments of the questionnaire evaluated the instructors’ perceptions of the students’ knowledge, skills, and dispositions at the beginning and at the end of a typical class. Last, the survey was also used to gauge faculty interest in integrating ICC in the DFL curriculum and examined their support of the project. The questionnaire included 14 questions including several sub-questions. In developing the questions the researchers consulted the work of Banks (2008), Bennett (2010), Byram (1997), Kramsch and Whiteside (2008), the National Standard in FL Education Project (2008) and Schulz (2007). Responses were marked on a 7-point Likert scale ranging from (7) most likely / often to (1) least likely / often. This allowed the authors to make the answers directly comparable to those of other respondents (Beiske 2002). The review of teaching materials took place throughout and after the duration of the faculty learning community. A review of the teaching materials was conducted to gather data related to the inner workings of the department. In addition, participant-observations were used extensively throughout the research process. The questionnaire and reviewing material played only a supporting role in gaining an in-depth understanding of the case, because the investigators aimed to discern the process mainly by observing participants’ behavior as it occurs and make appropriate notes on it. Moreover, observational evidence was used not only to gain a deeper understanding about the process, but also to add new dimensions for understanding the phenomenon being studied (Yin 2009). 4. Data Analysis The methodological approach for this study was exploratory in nature. The general data analysis processes of this research drew heavily from the work of Miles and Huberman (1994:10ff.), which describes qualitative data analysis in three phases: data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. First, data reduction allowed data collection and analysis to become more manageable for the researchers. Second, data display aided in further data reduction and viewing the data in a more organized manner, which also enabled drawing conclusions from the research process. Third, conclusion drawing and verification was used to apply knowledge taken from the literature review to draw conclusions about the faculty learning community and the members’ approach to integrating ICC. More specifically, the study included observations and analyzing documents, as Merriam (1998), Patton (1990) and Stake (2005) recommend. Document analysis was used to review the teaching materials and discussion forums posted on the website, grant documents, the agendas and minutes of the meetings, the assigned readings, and the researcher journals. This form of analysis was used in accordance to Yin to “corroborate and augment evidence from the other sources” (2009:103). Furthermore, the authors aimed to make inferences from the documents about what happened when, how often, and in which regard. 63 5. Results and discussion This exploratory case study focuses on the steps that emerged in a process geared towards integrating ICC into a department of foreign languages. Throughout the study chronology of the academic year 2010-2011, nine steps emerged in the course of this process. The following sections address these steps and their role in the overall process. 5.1. Emerging steps ■■ Step One: Introductory Presentations Charged by the institution’s Office of Diversity and Institute of Global Initiatives, the Chair and graduate research assistant (GRA) of the initiative developed two introductory presentations in early fall 2010. They introduced the faculty to the concept of ICC by offering an overview of theoretical concepts and a suggested definition. Furthermore, by identifying possible intersections between participants’ work in the initiative and performance areas in faculty review (teaching, supervision, and mentoring; professional service; research and creative activity), the faculty members were asked to consider participating in the work groups related to integrating ICC into the DFL curriculum. ■■ Step Two: Incentive Grants After the initial introductory presentations, and to further incentivize faculty participation in the ICC work groups, two mini-grants were secured. The institution’s Center for Excellence in Teaching and Learning (CETL) sponsored a seven-member faculty learning community, and the institution’s Office of Diversity and Institute of Global Initiatives sponsored a thirteen-member task force. Both grant sources funded copies of literature, travel stipends, access to dissemination of new knowledge via conference and workshop attendance and participation. The group leader pursued incentives because it was thought incentive grants 64 might motivate participants to commit to sustained and active participation. In fact, the incentives offered throughout the yearlong process appeared to affect the participants differently. One person indicated, “For me personally, they did not have a part in my decision to join this group” (Interviewee 9). On the other hand, one participant describes the stipends as an essential factor in the process: “Personally, I have to admit that the possibility of earning a stipend to participate attracted me more than if there were no stipend. I feel this also is indicative of our university culture in which many faculty worry about completing work towards Tenure and Promotion requirements, and often things like this are secondary and of less importance. Offering an incentive also aided in creating buy-in on behalf of those participating and receiving the stipend.” (Interviewee 7) Throughout the year it became evident that not all participants were motivated by the grants and subsequent incentives. The researchers also noted that not all of the participants received a stipend. Furthermore, not everyone, who was eligible to receive a stipend, claimed one. ■■ Step Three: Questionnaire In an effort to assess the status of DFL faculty’s perceptions of ICC, an initial questionnaire was designed and distributed to the faculty. The 14-item questionnaire was crafted: 1) to document DFL faculty’s responses with respect to their students’ knowledge, skills, dispositions at the beginning and end of a typical class; and, 2) to have DFL faculty identify the most frequently used and effective teaching strategies and tools in advancing students’ cultural knowledge, skills, and dispositions. Participants were asked to answer closed-ended questions on a Likert scale (1= fully aware/most often/most likely; 7= totally unaware/never/least likely). 18 faculty members responded to the questionnaire. Descriptive statistics data analysis was applied. First, in response to seven hypothetical statements a student might make, which were gleaned from work interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) by Bennett (1993) and are reflective of identifiable ICC stages, most respondents thought that students are likely to have demonstrated surface understanding of complex and important elements in a culture. With respect to faculty’s assessment of a typical student at the end of a course the majority of responses identified students as having developed most likely cultural knowledge and interpersonal communication skills. Second, to advance students’ cultural awareness most effectively, survey participants shared that they use partner / group discussion, followed by film / visual prompts / illustrations and lecture / verbal description/explanation. Results for faculty preferences with respect to teaching the social context of language and nonverbal behavior (voice, body, space) were similar: lecture / verbal description / explanation, followed by film / visual / prompts / illustrations. The data also suggest that faculty tend to teach culture in very similar ways to other course material, preserving preferences for teaching strategies. ■■ Step Four: Limited-access Website Building on the information gathered by the initial questionnaire, the DFL faculty was then asked to share information and teaching materials related to ICC. A plethora of materials was collected from the department, and thus, a discussion took place as to how to organize and share the materials with the entire department. In response to this a limited-access website was created on the institution’s Blackboard server. It was accessible to all of the DFL faculty and instructors. The site contained all resource materials collated from study participants and DFL colleagues. Stored in folders and updated on a monthly basis, these materials included grant documents, agendas and minutes, and resource repositories with both discipline-specific and trans-disciplinary content. For example, the folder Activities housed proficiency-level-specific course assignments ranging from online exercises to cultural simulations. Background Reading and Bibliographies hosted both annotated reference lists and scanned articles in PDF format. In the discussion section, faculty posted and blogged about assignments and work in progress, e. g. revisions of the DFL curriculum assessment plan. There were 309 total user sessions, which resulted in nearly 50 hours of total use. The average use length for the individual was five minutes and nineteen seconds, and the site averaged three sessions per day. 1157 content folders were viewed and 424 files were viewed. More specifically, tools such as the individual files and folders, the discussion board, and email were used most often. ■■ Step Five: Discussion Meetings In addition to constructing the limitedaccess website to organize materials related to ICC, in monthly two and three-hour seminars, study participants met to discuss relevant readings, best practices, and works in progress. The participants took turns in presenting instructional materials and theoretical concepts culled either from individuals’ research, instructional practice, or the grants-sponsored ICC literature. They discussed numerous reading assignments, including documents by Bennett (2010), chapters in Deardorff ’s The SAGE Handbook of Intercultural Competence (2009) and Lustig’s and Koester’s Among US: Essays on Identity, Belonging, and Intercultural Competence (2006). The main focus of these discussion meetings was to introduce a variety of disciplinary perspectives on ICC with the goal of identifying relevant strategies and tools for use in the DFL curriculum. While observing the discussion meetings, the four researchers noted that in the beginning the discussions did not advance toward the goals of accomplishing the necessary steps in identifying aspects of ICC that would be beneficial to the process nor to articulate a plan for introduction and integration. As all four researchers indicated in their notes, the discussions remained rather general. However, after the yearlong process had ended, several participants expressed their perception about the overall im- 65 portance of the discussion meetings. In particular, one participant indicated: “I had the impression that the discussion of the literature review was a door opener to the topic, especially people that were rather reserved in regard to the topic approached it by looking at the language they teach and what has been published in conjunction of ICC.” (Interviewee 4) Furthermore, the authors noted the following as benchmark themes in the discussion meetings: the students’ process of becoming intercultural competent, how to apply ICC in the classroom, the development of a model and check points for tracking student development of ICC during their foreign language studies, and aligning specific ICC concepts with the DFL curriculum. ■■ Step Six: Conference Presentation Early in spring 2011, the study participants synthesized their understanding of ICC with respect to the DFL and presented on the process of integrating ICC into the DFL curriculum at a regional conference organized by the institution’s Center for Excellence in Teaching and Learning. It forced the group to come together to deliver a product representing the culmination of their work. As one researcher remarked, “The CETL conference presentation was very eye opening to me because it was the first time that I was able to see the department’s treatment of ICC as a whole” (Interviewee 7). Another participant of the study also noted: “Presenting parts of our work to a bigger audience at the CETL conference was a good opportunity for us to take stock of what we had done so far. Also it became obvious once again that there is no straight forward plan on how to integrate ICC into any curriculum and that it will take a combined effort to achieve this goal.” (Interviewee 5) By participating in the CETL conference the work group was exposed to the idea of integrating ICC in other teaching fields. Furthermore, it became obvious through discussions with the CETL attendees that although many think integrating ICC into a department of 66 foreign languages curriculum should be easy, it remains a difficult task. ■■ Step Seven: Subcommittee Work Towards the end of the scheduled discussion meetings, it was determined that to effectively conclude the yearlong process of integrating ICC into the curriculum subcommittees were needed to perform more specific tasks. Among these tasks were: to develop an ICC assessment plan for the DFL curriculum, to design and create a public website to share the work related to ICC, and draft a grant-mandated summary report and subsequent scholarly article. The first subcommittee compared and contrasted the scholarship ICC experts to propose a developmental model of ICC for the DFL curriculum. The model aligned identified learning outcomes for linguistic proficiency (following national standards for the profession) with correlational learning outcomes for ICC based on ICC scholarship. The model specified an articulated sequence of ICC target goals for learners during and at the end of the DFL curriculum in correspondence with completion of 1000-level, 2000-level, and 3000-4000 level coursework. The schema also provided details on students’ cultural content knowledge, communicative skills, and ICC. Since the DFL assessment plan is trans-disciplinary and comprehensive, it identified courses for initial, formative, and summative assessments of specified student learning outcomes and provided suggestions for including sequenced ICC assessments in the extant plan. Last, a rubric for assessing students’ levels of ICC at the end of the 2000-level courses was drafted. The second subcommittee designed and created a public website to share all work related to the ICC integration project (https://sites.google.com/ site/icctoolkit/). It features select ICC resources collected by study participants in a format that is easily accessible. The resources exhibited here will serve as a user-friendly toolbox and searchable repository for foreign language educators interested in ICC. The third subcommittee drafted and submitted a interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) summary report of the groups’ work to the grant-funding agencies. In addition, this subcommittee began working on scholarly articles to further document the ICC integration project. ■■ Step Eight: End-of-the-year Evaluation Instruments Two online assessment instruments were used to gauge study participants’ responses to ICC at the end of the yearlong process. First, all study participants were granted access to the online assessment instrument developed by Hammer, The intercultural development inventory (IDI). In confidential sessions, IDI certified colleagues at the institution provided feedback to the study participants during summer 2011. Second, the study participants were invited to respond to a summative questionnaire posted online. This survey was intended to gather the participants’ thoughts about the yearlong process of introducing ICC into the DFL. The results of this survey indicate that the participants found the grant-funded incentives, the discussion meetings, and the subcommittee work to be the most valuable steps in the process of integrating ICC in the DFL curriculum. In addition, a majority of the participants indicated on the final survey that they benefited very much from taking the IDI assessment and participating in the follow-up interview. ■■ Step Nine: Planning for Curriculum Integration To round out the yearlong process of introducing ICC into the DFL, a final step was designed for early fall 2011. In a DFL faculty retreat, study participants summarized the work completed and submitted for peer review and approval three items: A) an ICC definition for adaptation in the DFL; B) a revised DFL curriculum assessment plan with initial, formative, and summative assessments of ICC; and C) a public website with ICC resources, linked to the DFL homepage. In addition, the following steps in the integration process were shared with the faculty and subsequently approved: A) charge the DFL’s curriculum committee to develop and approve ICC-related learning objectives; B) charge the DFL’s assessment committee with developing level-appropriate assignments, assessment instruments, and rubrics. 5.2. Lessons Learned The nine emergent steps chronicled in the previous sections, which relate to the yearlong process of integrating ICC into the DFL curriculum, have enabled learning several valuable lessons. Sharing these lessons here may further discussion of integrating ICC into foreign languages and other fields. Furthermore, the successes and shortcomings experienced may shed light on other academic fields and educational settings. ■■ Lesson number 1 Try to determine what will stimulate faculty buy-in and motivation. Based on the findings related to the role of the incentive grants in this study it was determined that the members participating in the process had different motivating forces behind their work. Some were interested in developing teaching materials related to ICC, while others were genuinely curious about an unexplored topic. Subsequently, the varying motivating factors may also affect the roles the members take in the group. Try to establish direct connections between these factors and the work of the integration process. In addition, the findings from this phase of the research appear to support previous research regarding the role of incentives. MacLeod (1995) explains how the impact of incentives is not always consistent across the members of a particular group or situation. As was seen in this research, often it is the strong players who gravitate, or are reassigned by task leaders, to the incentive-based work (Burgess et al. 2010). Thus, incentives alone cannot be the only motivational force. ■■ Lesson number 2 Try to document all work. Creating a receptacle shell, the limited-access site, served as a valuable resource for this 67 integration process. As materials were collected, meetings were held, and notes were taken, everything was documented and subsequently posted to the site. For example, at the beginning of the integration process the members of the DFL faculty were asked to share teaching materials related to ICC. Many members of the faculty were willing to share, and the limited-access site served as an easy-to-use resource for this purpose. Furthermore, it allowed the researchers and all those involved in the initiative to look back and track the progress that was made. Upon reviewing the course shell usage by the participants of the work group and the other faculty members, it became apparent that the nature of its use evolved as the process transpired throughout the year. Although the shell began as a receptacle of information in which relevant materials were stored, by the end of the year the participants were actively engaged in discussions and individual members posted files for others to review. In addition, reviewing the process through the information posted in GeorgiaView Vista, the university course management system, allowed the researchers to track the process step by step as it developed over the year. cally how we can approach its integration within the department.” (Interviewee 3) Although it was a difficult and time consuming step, establishing the general concept allowed the faculty members to move in unison towards more specific parameters related to the integration of ICC. It is possible that moving directly to the curriculum reform, without first addressing the general concept, would have led to more conflict and confusion. ■■ Lesson number 4 Try to present and evaluate progress of the work at various stages in the process. At the midpoint of the initiative several faculty members of the work group presented the work in progress at the CETL conference. This step allowed the group to synthesize the work that had been completed up to that point. In addition, in this type of conference forum faculty from a range of colleges and universities and from an assortment of disciplines were exposed to our process of integrating ICC into the curriculum. Their participation in the conference presentation provided the opportunity to receive feedback from outside of the work group. ■■ Lesson number 3 ■■ Lesson number 5 Try to move from ICC as a general concept to specific parameters for its integration. The results of the initial questionnaire pointed out how perceptions among faculty in one department varied widely, especially with respect to the importance of teaching culture and ICC as part of a language major. For this purpose the research team determined that reaching a consistent and agreeable definition for ICC was an important step in the process towards integration. This lesson was confirmed by one of the participants of the work group: Try to balance the workload between individuals and subgroups of the faculty group. Throughout this process a conscious effort was made to include a diagonal cut from the DFL faculty. This enabled the formation of a particular group dynamic, which included a voice from all of the respective sub-sections within the department. For this reason, it is important to take into consideration different communication styles and collaborative grouping. For example, splitting the larger work group into subcommittees proved to be an effective strategy for this process. It appeared to allow the subgroups to focus more intently on specific aspects of the tasks required to integrate ICC into the DFL curriculum. “For me personally the reading and subsequent discussions were of great value. Getting more specific details about the topic at hand was very important. I think this is where most of our collaborative work took place in defining ICC and more specifi- 68 interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) 6. Conclusion This case study research, which took place over the academic year 20102011, revealed that integrating ICC into an existing DFL curriculum can be a complex process. For the department, using a faculty learning community approach proved to be an effective, yet time consuming method. In fact, it is still an ongoing initiative. In August of 2011 the DFL faculty decided to further develop the plan by charging the DFL’s curriculum committee to develop and approve ICC-related learning objectives and charging the DFL’s assessment committee with developing levelappropriate assignments, assessment instruments, and rubrics. As a result the following Specific Student Learning Outcomes (SSLOs) were crafted for the Modern Language & Culture major in the academic year 2012-2013: ■■ SSLO ML&C 1d: Demonstrating Intercultural Communicative Competence. Candidates demonstrate appropriate use of language in real-time intercultural interaction, adjust behavior appropriately in intercultural situations, respond with sensitivity to situations of intercultural misunderstandings, and demonstrate critical reflection when faced with unexpected intercultural situations (Knowledge, Skills, Attitudes). ■■ SSLO ML&C 2c: Demonstrating Intercultural Understanding. Candidates recognize and understand differences within and between cultures; they interpret a variety of cultural documents and events and new cultural knowledge; they analytically evaluate cultural generalizations, and distinguish cultural generalizations from cultural stereotypes (Knowledge, Skills, Attitudes). Furthermore, in the academic year 2012-2013, the department created and piloted several assessments to enable tracking the realizations of these SSLOs. Even though the curriculum reform process is still ongoing, the following suggestions are offered: plan specific ICC objectives, link the ICC objectives to the department’s overall assessment plan, and link the ICC objectives to specific courses. Last, it is important to note that the findings of this research reflect data collected from a specific department housed on a particular university campus, and they may not be comparable to data collected from other departments or university settings. Although the results of this research are not readily generalizable, they do provide a rich and valuable description of integrating ICC into a university foreign language department. In addition, as several case study researchers note (Stake 1995, Yin 2009), generalizability is not the goal of case study research. This type of research has the potential to offer a new perspective of an uninvestigated field by providing thick descriptions, and it serves as a starting point for future research. 7. Bibliography Banks, J. A. (2008): An Introduction to Multicultural Education. Boston: Pearson, Allyn & Bacon. Beiske, B. (2002): Research Methods: Uses and Limitations of Questionnaires, Interviews, and case studies. Norderstedt: Grin. Bennett, M. J. (2010): Creating an interculturally competent campus to educate global citizens. Paper presented at the Universidad 2010 7th International Congress on Higher Education. Havana, Cuba. URL: http://www.idrinstitute.org [accessed 07/11/2011]. Burgess, S. / Propper, C. / Ratto, M. / von Hinke, S. / Scholder, K. / Tominey, E. (2010): Smarter task assignment or greater effort: The impact of incentives on team performance. ECON Journal 120(547), pp. 968-989. Byram, M. / Nichols, A. / Stevens, D. (2001): Developing intercultural competence in practice. Clevedon: Multilingual Matters. Byram, M. (1997): Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters. Byram, M. / Zarate, G. (1997): Defining and assessing intercultural competence: Some principles and proposals for the Eu- 69 ropean context. Language Teaching 29(04), pp. 239-243. Deardorff, D. K. (2009): The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks: Sage. Dupuy, B. / Waugh, L. (2011): Proceedings of the Second International Conference on the Development and Assessment of Intercultural Competence. Tuscon: CERCLL. Gillham, B. (2000): Case study research methods. London: Continuum. Kennesaw State University (KSU) (2010): Strategic Plan 2007-2012. URL: http:// www.kennesaw.edu/president/ strategic_plan07.pdf [accessed 08/31/2013]. Kramsch, C. (1998): Language and Culture. Oxford: Oxford University Press. Kramsch, C. / Whiteside, A. (2008): Language ecology in multilingual settings: Towards a theory of symbolic competence. Applied Linguistics 29(4), pp. 645-671. Landis, D. / Bennett, J. / Bennett, M. (2004): Handbook of intercultural training. Thousand Oaks: Sage. Levine, G. S. / Phipps, A. (2012): Critical and Intercultural Theory and Language Pedagogy. Boston: Cengage Heinle. Association of American. URL: http://www. mla.org/pdf/taskforcereport0608.pdf [accessed 08/03/2011]. Morse, J. / Richards, L. (2002): Readme First for a User’s Guide to Qualitative Methods. Thousand Oaks: Sage. National Standard in FL Education Project (2008): Standards for foreign language learning in the 21st century. Alexandria: ACTFL. Patton, M. Q. (1990): Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park: Sage. Schulz, R. (2007): The challenge of assessing cultural understanding in the context of foreign language instruction. Foreign Language Annals 40(1), pp. 9-26. Stake, R. E. (2005): Multiple case study analysis: Step by step cross-case analysis. New York: Guilford Press. Stake, R. E. (1995): The art of case study research. Thousand Oaks: Sage. Stier, J. (2006): Internationalisation, intercultural communication and intercultural competence. Journal of Intercultural Communication 11, pp. 2-8. Yin, R. K. (2009): Case study research. Design and methods. Thousand Oaks: Sage. Lustig, M. W. / Koester, J. (2006): Among Us: Essays on Identity, Belonging, and Intercultural Competence. Upper Saddle River: Pearson. MacLeod, B. (1995): Incentives in organizations: An overview of some of the evidence and theory. In: Siebert, H. (Eds.): Trends in Business Organization. The Kiel Institute of World Economics, pp. 2-48. Merriam, S (2009): Qualitative research: a guide to design and implementation. San Francisco: Wiley. Merriam, S. (1998): Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Wiley. Miles, M. B. / Huberman, A. M. (1994): Qualitative data analysis. Thousand Oaks: Sage. Modern Language Association task force on evaluating scholarship for tenure and promotion (MLA) (2007): Modern Language 70 interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Auslandsstudienaufenthalt als Chance zur Förderung interkultureller Kompetenz – Eine empirische Untersuchung chinesischer Studierenden in Deutschland Study abroad as an opportunity to develop intercultural competence – An empirical study of Chinese students in Germany Yaling Pan Abstract (Deutsch) Prof. Dr., zurzeit Vizedekanin der School of Foreign Studies der University of International Business and Economics (UIBE), Beijing, China Deutschland ist wegen seiner Exzellenz in Lehre und Forschung sowie des vielfältigen und zugleich immer stärker international ausgerichteten Studienangebots in den letzten Jahren zu einem der bevorzugten Studienorte für chinesische Studierende geworden. Chinesische Studenten bilden in Deutschland zurzeit die größte Gruppe ausländischer Studierender. Allerdings ist der Studienaufenthalt chinesischer Studenten nur in ganz seltenen Fällen Gegenstand des wissenschaftlichen Diskurses. Wenn dies der Fall ist, dann werden das Leben und das Studium der chinesischen Studierenden in Deutschland meistens als Konfrontation und als Krisenzeit dargestellt. Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag dazu leisten, dass der Deutschlandaufenthalt viel stärker als Chance zur Förderung interkultureller Kompetenz der chinesischen Studierenden betrachtet und genutzt werden kann. Basierend auf einer empirischen Untersuchung, die die Verfasserin bei chinesischen Studenten in Deutschland durchgeführt hat, wird versucht, positive interkulturelle Erfahrungen der chinesischen Studierenden auszuwerten. Aus dieser Untersuchung und auch geleitet von Theorien interkultureller Kommunikation, werden Empfehlungen zur interkulturellen Vorbereitung chinesischer Studierenden auf ihren Deutschlandaufenthalt gegeben, damit sie während des Aufenthaltes ihre interkulturelle Kompetenz bewusster und effizienter fördern können. Schlagworte: Interkulturelle Kompetenz, kulturelle Anpassung, chinesische Studierende in Deutschland Abstract (English) Germany has become one of the most preferred places of study for Chinese students because of its excellence in teaching and research and also due to the diverse internationally oriented courses offered in recent years. Chinese students in Germany currently form the largest group of foreign students. However, the study of Chinese students in Germany is only in very rare cases the subject of scientific discourse. If this is the case, then life and the study of Chinese students in Germany are usually represented as a time of crisis and confrontation. The present work aims to contribute to the fact that the stay in Germany can be much more seen and used as an opportunity to develop intercultural competence of Chinese students. 71 Based on an empirical study of Chinese students in Germany, the author is trying to evaluate positive intercultural experiences of Chinese students. Founded on this research and the theories of intercultural communication the author gives recommendations for intercultural preparation of Chinese students, who are going to Germany for a study, so that they can develop their intercultural competence more consciously and efficiently. Keywords: Intercultural competence, cultural adaptation, Chinese students in Germany 1. Auslandsstudienaufenthalt: Schock oder Chance? Deutschland ist wegen seiner Exzellenz in Lehre und Forschung sowie aufgrund des vielfältigen und zugleich immer stärker international ausgerichteten Studienangebots in den letzten Jahren zu einem der bevorzugten Studienorte für chinesische Studierende geworden. Nach Angaben der Bildungsabteilung der chinesischen Botschaft Berlin waren an deutschen Universitäten im Jahr 2011 rund 25.000 chinesische Studenten immatrikuliert und bildeten damit nach wie vor die größte Gruppe ausländischer Studierender. Allerdings ist der Deutschlandstudienaufenthalt chinesischer Studenten nur in seltenen Fällen Gegenstand des wissenschaftlichen Diskurses. Wenn dies der Fall ist, dann werden das Leben und das Studium der chinesischen Studierenden in Deutschland meist als eine Konfrontation und als Krisenzeit dargestellt (Guan 2007:12ff., 42ff., Song 2009:19ff., 53ff., Zhou:2010:128ff.). Es werden vor allem die kulturellen Differenzen zwischen China und Deutschland fokussiert (Song 2008) und negative interkulturelle Erfahrungen hervorgehoben, sodass der Deutschlandaufenthalt der chinesischen Studierenden mehr als Gefahr und weniger als Chance betrachtet wird. Kaum thematisiert sind die positiven interkulturellen Erfahrungen und das große Potential zur Entwicklung interkultureller Kompetenz der chinesischen Studierenden. Der Deutschlandaufenthalt sollte jedoch viel stärker als Chance zur Förderung der interkulturellen Kompetenz der chinesischen Studierenden genutzt 72 werden. Denn internationale Zusammenarbeit und interkulturelle Kommunikation werden in der Geschäftswelt heutzutage immer mehr zur erlebten Realität. Eine wachsende Zahl von Unternehmen sieht eine interkulturelle Kompetenz als notwendige Voraussetzung für internationale Zusammenarbeit an. Während dieser Begriff in der euroamerikanischen Forschungswelt Hochkonjunktur hat (Bolten 2007, Lustig / Koester 2007, Rathje 2006, Thomas 2003), ist er in China noch nicht allgemein geläufig. Das Thema der interkulturellen Kompetenz ist in der chinesischen Wissenschaft heute noch weitgehend unbeachtet. Die oben dargestellte Problematik veranlasste die Verfasserin im Sommer 2011 eine qualitative empirische Untersuchung bei chinesischen Studierenden in Deutschland durchzuführen. Ziel der Forschung war es den Deutschlandaufenthalt auch als Chance zur Förderung der interkulturellen Kompetenz zu erfassen und zu gestalten. 2. Das Multidimensionale Modell der interkulturellen Kompetenz Um Klarheit über die Bedeutung der interkulturellen Kompetenz zu gewinnen und um ein Konzept zur Förderung interkultureller Kompetenz für chinesische Hochschulen auszuarbeiten, wurde 2005 bis 2006 eine qualitative empirische Untersuchung in Form von Experteninterviews durchgeführt (vgl. Pan 2008:67ff.). Aufgrund dieser empirischen Untersuchung wurde ein Modell zur Beschreibung der interkulturellen Kompetenz entwickelt (siehe Abb. 1), das die Prozesshaftigkeit, die Dynamik und die Mehrdimensionalität interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Z kultureller Kompetenz zu betrachten und zu überprüfen, in wie weit und in welchen Formen der Studienaufenthalt in Deutschland in Bezug auf die oben dargestellten drei Dimensionen einen Beitrag zum Auf- und Ausbau interkultureller Kompetenz chinesischer Studierenden tatsächlich leistet und leisten kann. Handlungssicher Y Tief Oberflächlich Handlungsunsicher Ethnozentrisch Ethnorelativiert X Abb. 1: Momentaufnahme der interkulturellen Kompetenz eines Einzelnen. Quelle: Pan 2008:102 in der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz hervorhebt. Dieses dreidimensionale Diagramm geht dabei von folgenden Annahmen aus (Pan 2008:67ff.): ■■ Es gibt einen Ansatz des interkulturellen Lernens, der von ethnozentrischem Denken und Verhalten zu einer polyzentrischen oder zumindest ethnorelativen Einstellung gegenüber fremden Kulturen führt (X-Achse). ■■ Zudem gibt es einen Pfad der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz, der vom unbewussten zum bewussten und gleichzeitig vom oberflächlichen zum tieferen Verständnis der fremden Kulturen und zugleich auch der eigenen Kultur führt (Y-Achse). ■■ Während der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz verläuft im Idealfall ein Prozess vom unproduktiven, unsicheren und inadäquaten Verhalten zum sicheren, adäquaten und produktiven interkulturellen Verhalten (Z-Achse). Bei der Untersuchung im Sommer 2011 ging es darum, den Studienaufenthalt chinesischer Studierenden in Deutschland als Prozess der Entwicklung inter- Ein weiteres Ziel der Forschungsarbeit bestand darin, ein tragfähiges Trainingskonzept, das eine Reihe von spezifischen Empfehlungen enthält, zu entwickeln. Dieses Konzept zielt auf die interkulturelle Vorbereitung chinesischer Studierender auf ihren Deutschlandaufenthalt ab, damit sie während des Aufenthaltes ihre interkulturelle Kompetenz bewusster und effizienter fördern können. 3. Entwicklung interkultureller Kompetenz chinesischer Studierenden in Deutschland Um das oben dargestellte Forschungsziel zu erreichen, wurde eine qualitative empirische Untersuchung bei chinesischen Studierenden in Deutschland durchgeführt. Ziel der Forschung war festzustellen, wie der Deutschlandaufenthalt den chinesischen Studierenden zu mehr Ethnorelativität, zur Erweiterung und Vertiefung des Wissens und Verstehens der eigenen und fremden Kultur und zu mehr interkultureller Handlungskompetenz führt. Zugleich ging es bei der Untersuchung auch darum, gewichtige interkulturelle Probleme chinesischer Studierender auszuloten, um entsprechende Lösungsansätze auszuarbeiten. 3.1. Forschungsmethode und Übersicht der Interviewten Bei der qualitativen empirischen Untersuchung wurde mit der Methode des leitfadengestützten Interviews gearbeitet. Bei den Interviews wurden Tonaufnahmen aufgezeichnet, um mit den gewonnenen Daten die Hypothesen zu überprüfen und ggf. Strategien zur Förderung interkultureller Kompetenz auszuarbeiten. 73 Insgesamt wurden Interviews mit 18 chinesischen Studierenden in Berlin, Potsdam und Nürnberg durchgeführt. Darüber hinaus wurden Interviews mit zwei Experten realisiert, die langjährige Erfahrungen mit chinesischen Studenten in Deutschland haben. Nachfolgend wird eine Übersicht der Interviewten dargestellt (siehe Abb. 2). 3.2. Entwicklung der interkulturellen Kompetenz chinesischer Studierenden Alle interviewten Studenten betrachten ihren Deutschlandaufenthalt als Chance zur Entwicklung ihrer interkulturellen Kompetenz. Der Studienaufenthalt in Deutschland leistete laut der Interviewten in allen drei Dimensionen des „Multidimensionalen Modells der interkulturellen Kompetenz“ (Pan 2008:101ff.) einen Beitrag zur Förderung interkultureller Kompetenz. 3.2.1. Von ethnozentrischem Denken zu einer ethnorelativen Einstellung Fähigkeiten und Eigenschaften, die den Prozess hin zu mehr Ethnorelativität fördern, sind entsprechend einer früheren Untersuchung von Pan (2008:110) u. a. positive Einstellung gegenüber Fremden, Differenziertheit, interkulturelle Sensibilität, Einfühlung, Toleranz, Respekt und Multiperspektivität. Der Studienaufenthalt in Deutschland ermöglichte den chinesischen Studierenden nach Ansicht der Interviewten eine intensive Beschäftigung und Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur, wobei sie lernten, Vorurteile über Deutschland und die Deutschen abzubauen und Offenheit, Differenziertheit, Wertschätzung, Respekt und Toleranz gegenüber Fremden zu entwickeln. Dies ist ein Prozess, in dem ihr zunächst klischeehaftes Deutschlandbild immer mehr an Farben, Formen und Facetten gewinnt. Ein Interviewter beschrieb: „Vor dem Aufenthalt in Deutschland war mein Deutschlandbild eher klischeehaft, Deutschland war für mich das Land für anzustrebender Abschluss und Studienfach Universität / Institution Austauschstudent / Selbstzahler Uni Potsdam Selbstzahler Uni Potsdam Selbstzahler Nr1 Name (w./m.) 1. Y. Shan (w.) 2. L. He (w.) 3. S. Zhang (w.) M.A., BWL 4. Z. M. Zhang (w.) B.A., BWL 5. K. Dai (m.) M.A., BWL Uni Potsdam 6. Z. Chen (m.) Dr. Phil, Erziehungswissenschaft HU Berlin 7. L. Qin (w.) Dr. Phil, Erziehungswissenschaft HU Berlin 8. J. Huang (w.) Dr. Phil, BWL HU Berlin 9. J. Wang (m.) Dr. Phil, Virologie FU Berlin 10. J. N. Wu (w.) 11. L. Zhang (m.) 12. Dr. K. L. He (m.) 13. V. Yu (w.) 14. X. Y. Li (w.) M.A., Erwachsenenpädagogik HU Berlin Selbstzahler 15. Z. H. Zhou (m.) M.Sc. , Automative Systems TU Berlin Selbstzahler 16. L. B. Liao (m.) M.A., BWL FAU Austauschstudent 17. S. Chang (m.) M.A., BWL FAU Austauschstudent 18. Z. L. Sun (w.) M.A.,BWL FAU Selbstzahler 19. J. X. Zhu (m.) M.Sc. , Maschinenbau FH Nürnberg Selbstzahler 20. J. Yang (w.) M.A., BWL FAU Austauschstudentin M.A., Public Management Dr. Phil, Wirtschaftsgeographie Dr. Phil, Erziehungswissenschaft M.A., Erziehungswissenschaft Uni Potsdam Uni Potsdam HU Berlin HU Berlin interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Selbstzahler Austauschstudent, Stipendiat einer deutschen politischen Stiftung Stipendiat des China Scholarship Council Austauschstudentin im Rahmen eines SandwichPhD-Programms Selbstzahler in einem strukturierten Doktorandenstudium Stipendiat des China Scholarship Council Stipendiatin des China Scholarship Council Selbstzahler Bildungsabteilung der chin. Botschaft Deutsches Studentenwerk Abb. 2: Übersicht der Interviewten. Quelle: Eigene Darstellung. 74 Austauschstudentin Fußball, Bier und Auto. Seitdem ich vor vier Jahren nach Deutschland kam, ist mein Deutschlandbild vielseitiger und differenzierter. Berlin hier z.B. ist sehr offen und sehr international. Ich habe auch viele Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und China gefunden. Wir sind z.B. beide sehr familienorientiert. Nur diese Familienorientiertheit drückt sich in unterschiedlichen Formen aus.“ (Z. Chen) Eine andere ergänzte: „In China kommt das Bild von den Deutschen oft aus den Hollywoodfilmen: Die Deutschen wirken da sehr kalt. Jetzt leben wir in Deutschland und können die deutsche Kultur und die Deutschen hautnah erleben. Ich habe den Eindruck, dass viele Deutsche zwar zunächst distanziert sind, aber im Inneren warmherzig sind. Ich habe immer wieder viel Hilfe von den Deutschen bekommen. Sie sind sehr hilfsbereit. Sie sind wie Thermosflasche: Außen kalt, innen warm.“ (S. Zhang) Wie Frau Zhang haben auch andere interviewte chinesische Studenten Affinität zur deutschen Kultur entwickelt. Sie betonten jedoch auch, dass sie offen sein müssten, um als Ausländer in Deutschland aufgenommen zu werden. Eine Interviewte ergänzte: „Wenn man von Anfang an klischeebelastet ist und nicht bereit ist, die Klischees und Vorurteile über die Deutschen abzubauen, kann man sich hier auch schwer anpassen“. (J. N. Wu) Viele berichteten, dass sie auch psychische Tiefs erlebt haben, insbesondere am Anfang des Deutschlandaufenthalts. Manche haben dabei auch den Begriff Schock benutzt. Allerdings wiesen viele darauf hin, dass selbst der Schock eine Chance sei, interkulturelle Kompetenz zu entwickeln. Wenn sie aus dem Tief herauskämen, stellten sie meistens fest, dass sie an Stärke und Reife gewonnen hätten. Viele betonten, dass es gerade in der Zeit des Tiefs wichtig sei, die positive Einstellung gegenüber dem Fremden nicht aufzugeben. Einige Befragten haben die Erfahrung gemacht, dass der Studienaufenthalt in Deutschland auch gute Gelegenheiten biete, eine Multiperspektive einzunehmen. Es seien für viele chinesische Studierende in Deutschland neue Erlebnisse, dass die Studenten in den Lehrveranstaltungen sich aktiv beteiligen und offen ihre Meinungen und Ansichten sagen, was in China nicht sehr üblich ist. Durch diese für sie eher neue Diskurskultur können die chinesische Studenten lernen, verschiedene Ansichten und Denkweisen kennenzulernen und dadurch an Multiperspektivität zu gewinnen. Zusammenfassend bietet der Studienaufenthalt in Deutschland den chinesischen Studierenden eine gute Gelegenheit, eine Außenperspektive zu gewinnen, aus der sie die eigene Kultur betrachten und vieles Neues sehen, das sie zuvor nicht gesehen haben. Dadurch lernen die chinesischen Studierenden ihr chinazentriertes Denken und die Selbstverständlichkeit der eigenen Kultur zu hinterfragen, zu differenzieren und zu korrigieren sowie immer mehr Ethnorelativität zu entwickeln. 3.2.2. Die Entwicklung zum tieferen Verständnis der fremden und der eigenen Kultur In den Interviews sagten viele Befragte, dass der Studienaufenthalt den chinesischen Studierenden dabei helfe, die deutsche Kultur immer mehr auch auf der tiefenstrukturellen Ebene zu verstehen. In Deutschland haben sie einen direkten Zugang zur deutschen Kultur und zu Deutschen, was ihnen ermöglicht, eigene Erfahrungen mit dem Fremden zu machen und dadurch ein vielseitiges und facettenreiches Bild über die deutsche Kultur und die Deutschen zu gewinnen. In diesem Prozess lernen sie, die Verhaltensweisen der Deutschen und die dahinter steckende Denkweise, ggf. auch die kulturellen, sozialen und historischen Hintergründen zu interpretieren und zu verstehen. Viele interviewte chinesische Studenten haben die Erfahrung gemacht, dass sie im Laufe des Aufenthaltes in Deutschland auch mehr Interesse und Neugier an der deutschen Kultur entwickelt haben und viele Phänomene, die sie in Deutschland erlebt haben, die ihnen zunächst nicht ganz verständlich sind, verstehen wollten. Dies führe sie dazu, 75 sich mehr über die deutsche Kultur, die historische Entwicklung und die sozialen Zusammenhänge zu informieren. Wenn die chinesischen Studierenden in den Semesterferien nach China zurückkehren, fungieren sie oft als Botschafter der deutschen Kultur und tragen im gewissen Maße auch zu der Gestaltung des Deutschlandbildes der Chinesen bei. Eine Interviewte beschrieb diesen Aspekt folgendermaßen: „Ja, ich lebe und studiere schon 7 Jahre in Deutschland. Jedes Mal, wenn ich von Deutschland nach China zurückkam, stellten meine chinesischen Freunde sehr viele Fragen über Deutschland. Manchmal wurde ich auch eingeladen von Bekannten zu den Schulen, um dort Vorträge über Deutschland zu halten. Ich habe auch viele Fotos in Deutschland gemacht und zeige sie auf meiner Internetseite meinen Freunden und Bekannten in China und sie sind sehr interessiert.“ (L. He) Zugleich fungieren die in Deutschland studierenden Chinesen auch als Botschafter der chinesischen Kultur. Viele haben das Phänomen geschildert, dass ihre chinesische Identität stärker und ihnen bewusster geworden ist, seitdem sie in Deutschland leben. Viele Befragte haben die Erfahrung gemacht, dass ihr Chinawissen sie in Deutschland zu attraktiven Kommunikationspartnern mache, da viele Deutsche an China, insbesondere an der traditionalen chinesischen Kultur interessiert sind. Dies führe sie dazu, mehr über die chinesische Kultur zu lernen, um sie besser zu verstehen und zu vermitteln. Viele sehen die chinesische Identität als ihre Stärke in der interkulturellen Kommunikation mit den Deutschen an. Ein chinesischer Student berichtete: „Solange man in China lebt, ist einem nicht ganz bewusst, dass man Chinese ist. Jetzt lebe ich in Deutschland und es ist mir viel bewusster, dass ich Chinese bin. Mir sind jetzt die Besonderheiten der chinesischen Kultur auch viel bewusster. Ich habe den Eindruck, dass die Deutschen keine Zuneigung zu Menschen haben, die ihre eigene Kultur nicht wertschätzen. Wenn du deine eigene Kultur nicht kennst und nicht in der Lage bist, über deine eigene Kultur zu sprechen, gewinnst du 76 auch nicht den Respekt der Deutschen. Die Deutschen erwarten gar nicht von uns, dass wir genau so denken und uns so verhalten wie die Deutschen. Im Gegenteil, ihre Bereitschaft mit uns zu kommunizieren ist größer, wenn wir authentisch chinesisch bleiben.“ (K. Dai) Viele befragte chinesische Studierende stellten fest, dass der Studienaufenthalt in Deutschland ein Prozess ist, in dem sie immer mehr Interessen an der deutschen und chinesischen Kultur entdeckten, beide Kulturen aus neuen Perspektiven und in einer neuen Tiefe kennenlernen und verstehen. 3.2.3. Die Entwicklung zu mehr interkultureller Handlungskompetenz Nach Aussagen der Interviewten kommt der Kommunikationsfähigkeit eine zentrale Rolle zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz während des Studienaufenthaltes in Deutschland zu. Dabei haben fast alle Interviewten betont, dass die Beherrschung der deutschen Sprache für einen erfolgreichen Studienaufenthalt in Deutschland von entscheidender Bedeutung ist. Es gibt an deutschen Hochschulen zwar Studiengänge, die auf Englisch angeboten sind, aber um den Deutschlandaufenthalt mehr als Chance zur Entwicklung interkultureller Kompetenz und letztendliche auch als Chance zur Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen, seien Deutschkenntnisse unentbehrlich. Ein chinesischer Student misst der Sprachkompetenz große Bedeutung bei: „Wenn man gut Deutsch sprechen kann, gewinnt man in Deutschland Respekt. Die Sprachkompetenz wird oft automatisch mit Kompetenz in anderen Bereichen verbunden. Wenn du gut Deutsch sprichst, unterstellt man, dass du auch in anderen Bereichen kompetent bist.“ (K. Dai) Sprachkompetenz sei eine wichtige Voraussetzung für die Chinesischen Studierenden, sich in Deutschland zu integrieren. Außerdem trage die Tatsache, dass jemand gut Deutsch kann, auch dazu bei, dass er mit dem Aufenthalt in Deutschland zufrieden ist. interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Frau V. Yu vom Deutschen Studentenwerk, die lange Jahre u. a. chinesische Studenten in Deutschland betreut, beschrieb die Situation folgendermaßen: „Die Sprache befähigt zu kommunizieren. Die interkulturelle Kompetenz finde ich z.B. wenn man weiß, ich kann dahin gehen, ich habe Problem und kann darüber kommunizieren. Ich muss nicht deshalb mit allen Deutschen befreundet sein. Das ist nicht unbedingt das Ziel der Integration. Aber die Integration für mich ist schon, wenn jemand Problem hat und weiß, er kann in der Sprache über das Problem reden. Das ist schon der erste Schritt. Deshalb ist es auch wichtig, dass die chinesischen Studierenden mit den Deutschen Kontakte haben, um mit ihnen zu kommunizieren.“ (V. Yu) Anders als das Modell der zentralen Studienorganisation in China, die den Studenten nur wenig Möglichkeit für individuelle Gestaltung ihres Studiums zulässt (Song 2008:190), müssen die chinesischen Studierenden in Deutschland ihr Studium eigenständig und in voller Selbstverantwortung gestalten. Dies sei nach Ansicht vieler Interviewten in der Anfangsphase belastend, aber durch diese Selbstorganisation könnten sie Selbstständigkeit und Selbstsicherheit entwickeln, was wiederum zum souveränen Handeln im interkulturellen Kontext verhelfe. Viele Interviewte meinten, dass eine andere Kultur in den Lehrveranstaltungen, insbesondere in den Seminaren, als in China vorherrscht. Sie müssen zu Worten kommen und sich aktiv beteiligen, während in China viel mehr das Zuhören in den Lehrveranstaltungen wichtig ist. In dieser neuen Kultur können die chinesischen Studierenden ihre Kommunikationsfähigkeit und Diskursfähigkeit entwickeln. Wenn sie aber den Raum der Universität verlässt und in der Alltagskommunikation ist, seien die meisten Deutschen nach Ansicht vieler Interviewten nicht mehr so aktiv in der Kommunikation mit Fremden. Die Deutschen seien nicht gleich herzlich gegenüber Fremden. Umso mehr fanden die Interviewten wichtig, Initiative zu ergreifen und gute Annäherungsstrategien zu entwickeln. Auf jeden Fall sehen fast alle Interviewten die Kommunikationsfähigkeit als Schlüsselkompetenz zur Erlangung der interkulturellen Kompetenz. Im Interview betonte eine chinesische Studentin: „Reflexion ist wichtig, um interkulturelle Kompetenz zu fördern, aber nur reflektieren allein reicht nicht aus. Interkulturelle Kompetenz erwirbt man hauptsächlich durch Kommunizieren mit Mitgliedern aus einer anderen Kultur und für uns bedeutet dies, durch Kommunizieren mit den Deutschen.“ (J. N. Wu) Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass Kommunikationsfähigkeit nach Ansicht der Interviewten in China und Deutschland unterschiedlich interpretiert wird: In China ist es in der Kommunikation wichtig, zuzuhören und wenn jemand etwas sagt, achtet er zuerst darauf, dass er als bescheiden und höflich angesehen wird. In China gehöre es zur Kommunikationsfähigkeit, dass Teilnehmer in der Kommunikation immer wieder erwägen, was sie sagen und wie sie etwas sagen und wie das Gesagte bei anderen Kommunikationspartnern ankommt. In Deutschland hingegen sagen viele Deutsche viel offener ihre Meinungen, ohne sich groß Gedanken dabei zu machen. Jemand gilt als kommunikationsfähig, wenn er schlagfertig ist und klare Ansichten hat. In China gilt es eher als unhöflich, wenn jemand zu direkt seine eigenen Wünsche und Meinungen ausdrückt. In Deutschland müssen die Kommunikationsbeteiligten sich verteidigen können und lernen, offen ihre Meinung zu äußern. Sie sollten nicht abwarten, dass andere die Gedanken des Kommunikationspartners ablesen können. Eine Studentin hat die Erfahrung gemacht, „wenn du alles einfach geschehen lässt, giltst du in den Augen der Deutschen als charakterlos. Wenn du offen deine Meinung äußerst und deine Einstellung auch rechtfertigen kannst, wirst du respektiert. Das ist ganz anders als das, was wir in China gelernt haben.“ (D. Lü) 77 Es gibt auch andere Begriffe, die für die Kommunikation wichtig sind, die aber in China und Deutschland unterschiedliche Bedeutungen haben. Höflichkeit ist einer davon. J. N. Wu beschrieb: „Wenn man in China als junge Frau im Bus einem älteren Herrn ihren Sitzplatz anbietet, gilt es als höflich. In Deutschland wird dies nicht immer gerne angenommen. Denn erstens denken die Männer, dass sie als Männer Frauen zu beschützen haben und ihnen nicht den Sitzplatz wegnehmen sollten. Zweitens könnte der betroffene Mann denken, ‘ah, ich bin doch noch nicht so alt!’ Er freut sich also gar nicht darüber, dass ihm eine Frau ihren Platz anbietet.“ (J. N. Wu) Diese Andersartigkeiten, die die chinesischen Studierenden in Deutschland erleben, sind zunächst Herausforderungen für sie. Zugleich stellten die interviewten Studenten fest, dass sie dadurch auch gelernt hätten, ihre gewohnten Denk- und Verhaltensweisen zu reflektieren und neue Kommunikationsstrategien zu entwickeln, um sich besser in Deutschland kulturell anzupassen. Viele Interviewte fügten hinzu, dass auch Teamfähigkeit eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Studiums in Deutschland sei, weil die Studierenden in den Seminaren oft Gruppenarbeit durchführen müssen. Dafür müssen sie sich in die Gruppe integrieren und sich einbringen. Zusammenfassend fanden die Interviewten, dass der Aufenthalt in Deutschland für die chinesischen Studierenden in vieler Hinsicht eine große Herausforderung ist. Zugleich können sie dabei aber auch viele Kompetenzen entwickeln, die letztendlich zur Förderung interkultureller Kompetenz beitragen. 4. Interkulturelle Vorbereitung chinesischer Studierenden auf den Studienaufenthalt in Deutschland Im Allgemeinen ist festzustellen, dass die chinesischen Studierenden, die als Austauschstudenten oder unterstützt durch einen chinesischen oder deut- 78 schen Förderer in Deutschland studieren, viel zielgerichteter an ihr Studium herangehen und ihren Deutschlandaufenthalt viel effektiver nutzen als die sogenannten Selbstzahler. Die letzteren müssten meistens alleine kämpfen, um an der deutschen Hochschule zurechtzukommen und dies dauerte meistens ein Jahr oder noch länger. Nach Angaben der Bildungsabteilung der chinesischen Botschaft in Berlin sind aber 90 Prozent der insgesamt über 25.000 chinesischen Studierenden, die an deutschen Hochschulen eingeschrieben sind, Selbstzahler. Fast alle Interviewten haben darauf hingewiesen, dass der Studienaufenthalt in Deutschland den chinesischen Studierenden zwar eine Chance für die Entwicklung interkultureller Kompetenz bietet, aber diese Chance zu nutzen fordert wiederum u. a. starke Eigeninitiative und Eigenverantwortung, Lernbereitschaft und Lernkompetenz, Durchsetzungsfähigkeit und nicht zuletzt Diskurs- und Kommunikationsfähigkeit. Diese Eigenschaften und Kompetenzen seien auch wichtige Voraussetzungen dafür, das Studium an einer deutschen Hochschule erfolgreich zu gestalten und abzuschließen. Zum Teil sind dies ganz andere Eigenschaften und Kompetenzen, als die, die für ein erfolgreiches Studium in China vorausgesetzt werden. Für das Letztere seien z. B. viel mehr Fleiß, Selbstdisziplin und Teamfähigkeit erforderlich. Nach der Untersuchung kann zwar die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Austauschstudenten bereits in China schon mehr oder weniger auf den Studienaufenthalt in Deutschland vorbereitet sind. Eine systematisch konzipierte interkulturelle Vorbereitung hat es aber bei keinem der 18 befragten Studenten gegeben. Dabei sind fast alle Interviewten der Ansicht, dass so eine Vorbereitung notwendig sei, um die Effizienz des Deutschlandaufenthaltes und damit die Erfolgschancen chinesischer Studierender in Deutschland zu erhöhen. Nach der oben dargestellten Untersuchung und auch basierend auf anderen Untersuchungen über chinesische Stu- interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) dierende in Deutschland (Guan 2007, Song 2009, Zhou 2010) sind insbesondere folgende Aspekte bei der interkulturellen Vorbereitung chinesischer Studierenden auf den Studienaufenthalt in Deutschland zu berücksichtigen: ■■ Positive Einstellung zur interkulturellen Kommunikation, ■■ Lernbereitschaft und Lernkompetenz, ■■ Deutsche Kulturgeschichte und Werteorientierungen der Deutschen, ■■ Deutschland aus Innen- und Außensicht, ■■ Chinesische Kulturgeschichte und Hauptzüge des Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus, ■■ China aus Innen- und Außensicht, ■■ Studien-Organisation in Deutschland, ■■ Interkulturelle Sensibilität und Multiperspektivität, ■■ Kommunikationsstile der Deutschen und Annäherungsstrategien mit den Deutschen, ■■ Fähigkeit zu Kommunikation (einschl. Diskursfähigkeit und Umgang mit Kritik) und Metakommunikation und ■■ Umgang mit psychischen Schwankungen in einer fremden Umgebung. Es ist ein Desiderat, dass in China Trainingskonzepte ausgearbeitet werden, die die obigen Aspekte miteinbeziehen. Zum einen ist es notwendig, interkulturelle Bildung in das ganze Studium fächerübergreifend zu integrieren, zum anderen sollten durch ein- bis zweiwöchiges interkulturelles Training den Studierenden die Besonderheiten des Studienaufenthaltes im Gastland vermittelt werden. Dadurch können interkulturelle Schlüsselkompetenzen, die für den Erfolg ihres Studiums im Gastland von großer Bedeutung sind, gefördert werden. Auf diese Weise wer- den die Studierenden diesen Aufenthalt besser als Chance zur Weiterentwicklung von interkultureller Kompetenz nutzen können. 5. Literatur Bolten, J. (2007): Interkulturelle Kompetenz. Thüringen: Landeszentrale für politische Bildung. Guan, H. (2007): Anpassung und Integration der chinesischen Studierenden in Deutschland - eine Untersuchung anhand des Beispiels an der Universität Bremen. Bremen: Universität Bremen. Lo, D. (2005): Interkulturelle Kommunikation - Neue Forschungsperspektiven. Taipei: Fu Jen Catholic University Press. Lustig, M. W. / Koester, J. (2007): Intercultural Competence: Interpersonal Communication across Cultures. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press. Pan, Y. (2008): Interkulturelle Kompetenz als Prozess – Modell und Konzept für das Germanistikstudium in China aufgrund einer empirischen Untersuchung. Sternenfels: Wissenschaft und Praxis. Rathje, S. (2006): Interkulturelle Kompetenz – Zustand und Zukunft eines umstrittenen Konzepts. URL: zif.spz.tu-darmstadt. de/jg-11-3/docs/rathje.pdf [Zugriff am 10.10.2012]. Thomas, A. (2003): Interkulturelle Kompetenz – Grundlagen, Probleme und Konzepte. Erwägen, Wissen, Ethik 14(1), S. 137-156. Sun, J. (2008): Rekonstruktion von interkulturellen Differenzen im Hochschulstudium zwischen China und Deutschland aus Sicht chinesischer Studierender in Deutschland: Eine explorative Fallstudie an der Ruhr-Universität Bochum. Bochum: Ruhr-Universität Bochum. Song, J. (2009): Cultural experiences of German and Chinese exchange students and implications for a target group-oriented intercultural training program. Freiburg: Universität Freiburg. Zhou, J. (2010): Zwischen „Elite von morgen“ und Liu Xue La Ji („Müllstudenten“) – Chinesische Studenten in Deutschland. Münster: WV Wissenschaft. 79 Endnoten 1. Die Nummerierung basiert auf der zeitlichen Reihenfolge der durchgeführten Interviews. Der Aufsatz entsand im Rahmen eines Forschungsprojekts (Projektnummer: 11YJA740069), gefördert durch das Bildungsministerium der VR China. 80 interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Rezension Review Ursula Reutner „Von der digitalen zur interkulturellen Revolution“ Alexandra Stang Masterstudium Educational Media – Medien und Bildung an der Universität Duisburg-Essen „Die digitale Revolution hat unser aller Leben in kürzester Zeit verwandelt“ (Reutner 2012:9). In der Tat haben das Internet und die digitalen Medien insbesondere in den letzten Jahren der Entstehung von vernetzten OnlineCommunities Vorschub geleistet. Die Nutzung dieser Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten und Angebote wie Social Networks, Wikipedia oder Youtube gehören vielfach zum Alltag. Durch die technologische Infrastruktur haben die Nutzer heute die Möglichkeit, international auf digitale Inhalte zuzugreifen und mit anderen weltweit zu teilen. Die Welt scheint auf dem Weg zu einem „global village“ zu sein (McLuhan 1962). Mit anderen Worten: Die digitale Gesellschaft bietet sowohl neue Entfaltungsmöglichkeiten für jeden Einzelnen als auch neue Herausforderungen für die zunehmend globalisierte Wissensgesellschaft. Es entstehen andere Öffentlichkeiten, andere Austauschverhältnisse und andere Kulturtechniken. Web 2.0 Anwendungen verändern somit das private und berufliche Kommunikationsverhalten. Auf der einen Seite ergibt sich hieraus die Möglichkeit, eigene Beiträge ins Netz zu stellen, andere Beiträge zu kommentieren und sich international zu Themen in Social Communities auszutauschen. Auf der anderen Seite steht die Frage nach der Kulturspezifik von solchen Angeboten sowie mögliche Sprachbarrieren, die dazu führen können, dass die Nutzer vielfach in den von der eigenen Kultur geprägten virtuellen Räumen verharren. Somit rücken neue Themen in den Fokus der interkulturellen Kommunikationsforschung und -praxis. Vor dem skizzierten Hintergrund stellt Ursula Reutner, Herausgeberin des Sammelbandes „Von der digitalen zur interkulturellen Revolution“, in ihrer Einleitung (2012:9) die berechtigte Frage: „Doch wie sehr wird das interkulturelle digitale Kommunikationspotenzial bislang ausgeschöpft?“ Die vorliegende Publikation ist Bestandteil eines Kolloquiums, das vom Institut für Interkulturelle Kommunikation und der Romanischen Sprachwissenschaft im Juli 2011 an der Universität Passau organisiert wurde. Der Band zeichnet sich durch eine beeindruckende Vielfalt an interdisziplinären Perspektiven einer renommierten Autorenschaft aus Wissenschaft und Praxis aus. Das Ergebnis ist eine umfangreiche Sammlung von theoretischen als auch empirischen Beiträgen aus der Ethnologie, der Medien-, Sprach- und Kulturwissenschaften zu den Chancen als auch Herausforderungen der virtuellen interkulturellen Kommunikation und Zusammenarbeit. 81 Das Buch gliedert sich in drei große Themenschwerpunkte und bietet dem Leser die Möglichkeit, sich mit kulturgeprägten Handlungsmustern, sprachlichen Herausforderungen sowie Forschungsmethoden auseinanderzusetzen: Der Bereich Identität und Persönlichkeit beinhaltet Aufsätze zur digitalen Diaspora, Erinnerungskulturen, Kulturspezifik von Textsorten und kommunikativen Stilen sowie kulturvergleichende Analysen virtueller Portale und Diskussionsforen. Der Abschnitt Teams und Kollektive widmet sich Fragen zur Kulturalität, den Besonderheiten des virtuellen interkulturellen Dialogs, Teamkonflikten als auch Fragen des Wissensaustauschs in virtuellen Räumen. Der letzte Schwerpunkt Zensur und Selbstzensur beschäftigt sich im Kern mit Fragen der Öffentlichkeit und Privatheit sowie Cyberimperialismus. Besonders hervorzuheben ist die kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema. Insgesamt bietet das Buch dem Leser eine gute Grundlage und einen Einstieg in das breite Themenspektrum. Die Publikation spiegelt den aktuellen Stand der Literatur wieder und eignet sich für Studierende und Wissenschaftler, die sich theoretisch und praktisch mit Fragen der virtuellen interkulturellen Kommunikation sowohl in Wirtschafts- als auch Bildungskontexten beschäftigen. Literatur Reutner, U. (2012): Von der digitalen zur interkulturellen Revolution. Baden-Baden: Nomos Verlag. McLuhan, M. (1962): The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. London: Routhledge & Kegan Paul. Reutner, Ursula (2012): Von der digitalen zur interkulturellen Revolution. Baden-Baden: Nomos Verlag. 499 Seiten. Preis 49,00 EUR. ISBN 978-3-8329-7880-8. 82 interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Rezension Review Judith Schmidt / Sandra Keßler / Michael Simon „Interkulturalität und Alltag. Mainzer Beiträge zur Kulturanthropologie / Volkskunde“ Luciole Sauviat M.A., Projektkoordinatorin / Dozentin, Freiberuflich Wo sind Sie gerade während Sie diese Rezension im Interculture Journal lesen? Ist Journals lesen eine Vergnügung und Teil Ihrer Freizeit? Schlagen Sie die Zeit tot, im Bus oder der U-Bahn? Sind Sie im Büro und arbeiten? Ist das Lesen von solchen Artikeln Teil Ihrer Routine, Ihres Alltags oder ist es eine außergewöhnliche Situation, die Sie aus dem Alltag herausreißt? Letzteres wird es kaum sein, denn was ist schon Nicht-Alltag? Schon Norbert Elias hatte Schwierigkeiten mit dem Begriff des Alltags: „Handelt es sich bei ihm (dem Alltag) und dementsprechend auch bei seinem Gegenstück dem `Nicht-Alltag´, um unterscheidbare Sphären, Sektoren oder Regionen menschlicher Gesellschaften? [...] man könnte erwägen, ob man sich hier nicht einfach mit Hilfe einer esoterischen Abstraktion auf Eigentümlichkeiten der gegenwärtigen Arbeits- und Berufsgesellschaften bezieht, auf die man ebenso gut auch durch Begriffe wie Freizeit, Privatsphäre und ihre Verwandten hinweisen könnte und ganz gewiss ihr eigentümliches Gepräge durch die Gesamtstruktur und dementsprechend auch die Machtverhältnisse industrieller Staatsgesellschaften erhalten.“ (Elias 1978:28f.) Kultur und Alltag, bzw. Lebenswelt ist der Forschungsgegenstand der Cultural Studies und der Europäischen Ethnologie; was dazu gehören kann verdeutlicht die Heterogenität der Artikel, die im Sammelband Interkulturalität und Alltag. Mainzer Beiträge zur Kulturanthropologie / Volkskunde vertreten sind. Dieser Sammelband ist das Ergebnis eines studentischen Projekts des Fachschaftsrats des Faches Kulturanthropologie / Volkskunde der Mainzer Universität. Mit einer Ringvorlesung, die den gleichen Titel wie das Buch trug, organisierten im Jahr 2010 die Studierenden interdisziplinäre Vorlesungen, die sich mit Fragen der Interkulturalität in der gegenwärtigen Lebenswelt auseinandersetzten und den Stand der Forschung darstellen sollten. Dafür wurden in Deutschland lebende Wissenschaftler/innen eingeladen, deren überarbeiteten Vorträge die meisten Beiträge dieses Sammelbandes bilden. Das Ergebnis ist ein Buch in einem zugänglichen Schreibstil mit Autoren aus u. a. der Volkskunde / Europäische Ethnologie, Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft, Sprachwissenschaft und Geographie. Die Themen, die behandelt werden, sind entsprechend vielfältig. Der einführende Aufsatz von Roth hebt hervor, dass Alltag und Interkulturalität als Veralltäglichung der Fremdbegegnung und des Fremdverstehens ein ziemlich neues, unerforschtes und zunehmendes Phänomen in den Industriegesellschaften sei. Für die europäische Ethnologie käme es darauf an die stattfindenden 83 interkulturellen Interaktionen zu behandeln und „wie die Menschen im Alltag tatsächlich mit der Differenz umgehen“ (Roth in Schmidt / Keßler / Simon 2012:27). Silke Meyer schreibt vor allem von west-europäischen Beispielen ausgehend über Stereotypen in interkulturellen Kontexten, deren allgemeine Struktur, Wirkweise und Funktion (sowohl als Orientierungsraster wie als Bestätigung eines Wir- und die Anderen-Gefühls). Dabei behandelt sie verbale, visuelle, lautliche und materielle Stereotypen und schließt damit ab, dass Stereotypen in unserer globalen Welt weiter bestehen würden. Andere Autoren des Sammelbands beziehen sich auf scheinbar eher abgrenzte gesellschaftliche Phänomene des Alltags, wie der Beitrag von Sandra Keßler über den Konsum von Sushi. Durch ihre Befragungen stellt sie fest, dass Sushi-Konsum zwar als Fremdbegegnung mit ethnisch-Anderen aber gelöst von seiner japanischen Herkunft angesehen wird und u. a. deshalb als Global Food bezeichnet werden kann. Mattias Kulinna kritisiert den Essentialismus von Ethnomarketing, stellt aber fest, dass neuere Werbepraktiken den Konstruktionscharakter von Ethnizität besser gerecht werden. Miguel Souza schreibt über kommunikative Praktiken von Haupt- und Realschülern mit Migrationshintergrund. Dabei stellt er eine Analysemethode vor, die die Erforschung der interkulturellen Kommunikation auf transkulturelle Aspekte erweitert, indem die Rolle der sozialen Partizipation der Interaktanten und des Forschers hervorgehoben werden. Der Sammelband enthält aber auch Artikel die wenig auf die Gegenwartswelt in Europa bezogen sind. Das Paradebeispiel dafür ist die ethnolinguistische Untersuchung von Svenja Völkel über kognitive Referenzsysteme anhand von Fallbeispielen aus Ozeanien. Sie zeigt, dass es bezüglich der Verwandtschaftsterminologien, der räumlichen Koordinaten, der Language of Respect und den Gesprächskonventionen Unterschiede zu westlichen Sprachen gibt, die unterschiedliche kulturelle Werte und Systeme zum Ausdruck bringen. 84 Weiterhin enthält das Buch drei Beiträge, die sich mit kultureller Produktion im engeren Sinne (Comics und Musik) und ihre Bedeutung für den Ausdruck und die Vermittlung von trans- bzw. interkulturellen Inhalten auseinandersetzen. Jonas Engelmann beschäftigt sich mit der sogenannten hybriden Ästhetik von Comics; am Beispiel von einerseits Hergés hochproblematischen Comic Tim in Kongo, bezüglich seiner rassistischen Projektionen auf Afrika, und andererseits den südafrikanischen Bittercomix von Botes und Kannemeyer, die Critical Whiteness zum Ausdruck bringen bzw. ihre Position als weiße Südafrikaner reflektieren. Er zeigt, dass in Comics „[...] Fragen nach den eigenen Bildern und dem Wissen, aus dem sich diese speisen, gestellt werden“ (Engelmann in Schmidt / Keßler / Simon 2012:93). Schließlich beschäftigen sich zwei Aufsätze mit musikalischer Produktion. Wolfram Knauer schreibt über den Jazz-Musiker Peter Kowald, der Improvisationen mit Musikern aus anderen musikalischen Kulturen als hervorragendes Mittel für interkulturelle Konversationen ansah. Diese Konversationen waren für ihn die Möglichkeit, dass jeder in seiner Sprache kommuniziert, sich jeder zuhört und ein gemeinsames Neues entsteht. Für Sacha Seiler, der sich mit der interkulturellen Transtextualität in den Songs von Paul Simons auseinandersetzt, geht es auch um das Entstehen von etwas Neuem im Rahmen der interkulturellen Kommunikation. Dies zeigt er anhand von Paul Simons Songs, in denen Text und Musik sich zu widersprechen scheinen und trotzdem ein Ganzes bilden: z. B. evoziert seine Musik die lateinamerikanischen Anden, während der Text eine klassische US-amerikanische Geschichte erzählt. Falls es überhaupt sinnvoll ist, diese heterogenen Aufsätze zu kategorisieren, dann könnte man sagen, dass manche Autoren eher die kulturelle Differenz betonen (Roth, Völkel, Meyer) sowie die Missverständnisse oder Konflikte die daraus entstehen können. Während dessen andere eher Phänomene der Transkulturalität und den hybriden Charakter von Kultur interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) betonen (Engelmann, Seiler, Souza). Dieser hybride Charakter ist laut den Herausgebern das, was das Titelbild des Bandes thematisieren soll. Darauf sind die Werbebanners eines Restaurants zu sehen, das japanische, koreanische und chinesische Speisen anbietet. Die Abbildung des Banners, das auf Sushi und Maki zum Mitnehmen hinweist, soll wahrscheinlich mit seinen unglaublich wirkenden Orthographiefehlern den Leser zum Schmunzeln bringen. Ob es dabei um Hybridität geht oder angedeutet werden soll, dass Migranten kein richtiges Deutsch können, bleibt dahin gestellt. Es ruft bei manchen vielleicht in Erinnerung, dass mit dem Begriff der Hybridität nicht nur die Mischung von Kulturen, sondern auch Subversion und Machtverhältnisse thematisiert werden sollen. Bei Homi Bhabha (1994), der das Konzept entwickelte, war Hybridität subversiv, weil es die Zuschreibungen des Kolonisators in Frage stellte, ihn verunsicherte und das Scheitern der Unterwerfung der Kultur der Anderen verdeutlichte. In diesem Fall ist Hybridität diskursive Macht: „In my own work I have developed the concept of hybridity to describe the construction of cultural authority within conditions of political antagonism or inequity. […] the hybrid strategy or discourse opens up a space of negotiations, where power is unequal but its articulation is equivocal.“ (Bhabha 1996:58) Fragen der Macht, ob diskursiv oder auf materieller Basis werden freilich in diesem Band sehr unterbelichtet (eine Ausnahme stellt der Aufsatz von Engelmann dar). Dabei durchziehen Machtverhältnisse interkulturelle Beziehungen - u. a. durch die Definitions- und Deutungsmacht der Statushöheren (Auernheimer 2002) - sowie unseren Alltag, sei es in der Privatsphäre oder der öffentlichen Sphäre. Um auf das Eingangszitat von Elias zurückzukommen, wenn es um den Alltag geht, bezieht man sich eigentlich auf „Eigentümlichkeiten der gegenwärtigen Arbeits- und Berufsgesellschaften“, die „ihr eigentümliches Gepräge durch die Gesamtstruktur und dementsprechend auch die Machtverhältnisse industrieller Staatsgesellschaften erhalten“ (Elias 1978: 28f.). Interkulturelle Phänomene finden nicht in machtfreien Räumen statt in denen die Akteure über die gleichen symbolischen und materiellen Ressourcen verfügen. Es ist nicht die Aufgabe eines solchen Buchs unsere gesamte Lebenswelt und ihre interkulturellen Phänomene zu beleuchten. Durch die Vielfältigkeit seiner Beiträge zeigt es immerhin, dass Interkulturalität unsere Lebenswelt durchzieht, sei es in der Sprache, der Musik, der Nahrung oder schlichtweg den Begegnungen, wo auch immer sie stattfinden. Jedoch ein wesentlicher Bereich, der unseren Alltag oder das eigentümliche Gepräge unserer Gesellschaft strukturiert, prägt, womit wir viel unserer Lebenszeit verbringen, wird gar nicht thematisiert: die Erwerbsarbeit. Anbetracht der zahlreichen Literatur zu Intercultural bzw. Cross-Cultural Management (z. B. Christopher 2012, Smith et al. 2008, Thomas 2008), liegt die Vermutung nahe, dass Arbeiten zur Interkulturalität, einerseits zwischen interkulturellen Management und interkultureller Lebenswelt unterscheiden und, dass andererseits, wenn Interkulturalität bei der Arbeit thematisiert wird, zwischen Management und dem Rest unterschieden wird. Der Rest, Angestellte, Selbständige, prekäre Beschäftigte, etc. wird fast nicht thematisiert bzw. ihr Arbeitsalltag wird als ManagementAufgabe verstanden. Insofern verschafft das Buch gleichzeitig einen eher leichten angenehmen Zugang zu der deutschen akademischen Forschung im Bereich Interkulturalität und Alltag, während es vorhandene Trennungen und Auslassungen reproduziert. Literatur Auernheimer, G. (2002): Interkulturelle Kommunikation, vierdimensional betrachtet. URL: http://www.hf.uni-koeln.de/31372 [Zugriff am 30.04.2013]. Bhabha, H. (1994): The Location of Culture. London / New York: Routledge. 85 Bhabha, H. (1996): Culture’s in Between. In: Hall, S. / Du Gay, P. (Hrsg.): Questions of Cultural Identity. London: Sage Publications, S. 53-60. Christopher, E. (2012): International Management. Explorations Across Cultures. London: Kogan Page. Elias, N. (1978): Zum Begriff des Alltags. In: Hammerich, K. / Klein, M. (Hrsg.): Materialien zur Soziologie des Alltags. Sonderheft 20 der „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie“. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 22-29. Smith, P. B. / Peterson, M. F. / Thomas, D. C. (2008): The Handbook of Cross-Cultural Management Research. Los Angeles/ London / New Dehli / Singapore: Sage Publications. Thomas, D. C. (2008): Cross-Cultural Management Essential Concepts. Los Angeles/ London / New Dehli / Singapore: Sage Publications. Schmidt, Judith / Keßler, Sandra / Simon, Michael (2012): Interkulturalität und Alltag. Mainzer Beiträge zur Kulturanthropologie / Volkskunde. Münster: Waxmann. 163 Seiten. Preis: 24, 90 EUR. ISBN 978-3-8309-2684-9. 86 interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Rezension Review Jutta Berninghausen „Ausseneinsichten. Interkulturelle Beispiele von deutschen und internationalen Studierenden über das Auslandsjahr“ Viola Strittmatter M.A., Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Offene Hochschulen“ der FH Diakonie Bielefeld Deutschland ist eines der beliebtesten und führenden Gastländer für ausländische Studierende (DAAD 2013). Nach dem Internationalisierungsbericht des BMBF aus dem Jahr 2010 studierten im Wintersemester 2009/10 rund 245.000 ausländische Studentinnen und Studenten an deutschen Hochschulen, das sind rund 12 Prozent aller Studierenden in Deutschland. Die interkulturellen Erfahrungen, die im Ausland gesammelt werden, sind für die meisten Studentinnen und Studenten eine der wichtigsten ihres Lebens (vgl. Berninghausen 2012:Klappentext). Gleichzeitig aber berichten sowohl Studierende als auch Dozenten und Verwaltungsmitarbeiter von Missverständnissen und Schwierigkeiten im Unialltag. Welche Erfahrungen machen sogenannte Incomings in Deutschland und Outgoings im Ausland? Wie erleben sie die andere Kultur und die anderen Studienbedingungen? Hierauf will das Buch von Jutta Berninghausen Antworten geben. Das Buch stützt sich auf die Erfahrungen der Autorin als Dozentin für interkulturelle Kommunikation und interkulturelles Management an der Hochschule Bremen. Neben einer theoretischen Einführung zum Verständnis von Interkultur liefert es zahlreiche Erlebnisberichte (Fallbeispiele) von ausländischen und deutschen Studierenden über ihr Auslandsjahr in Deutschland bzw. im Ausland. Mit ihrem Buch möchte Berninghausen einerseits Eltern und Studierende, die ein Auslandssemester planen, ansprechen. Andererseits richtet es sich auch an Lehrende, die interkulturelle Fallbeispiele für Trainingssituationen suchen oder die Situation von Auslandsstudierenden an deutschen Hochschulen besser verstehen wollen. Ausseneinsichten beginnt mit einem ersten Erlebnisbericht (Vorwort) und mit einer kurzen Einleitung. Der Hauptteil besteht aus vier Teilen (mit Unterkapiteln): „In den beiden einleitenden Teilen wird ein wenig Hintergrundwissen vermittelt und der Rahmen beschrieben, in den die Fallbeispiele (3. und 4. Kapitel) eingeordnet werden können.“ (Berninghausen 2012:9) Im ersten Teil führt die Autorin in die interkulturelle Theorie ein. Sie beschreibt u. a. die logischen Ebenen von Kultur und ihre gegenseitige Beeinflussung. Nach der Erläuterung der kulturellen Prägung und der Kulturdimensionen von Edward T. Hall, Geert Hofstede und Fons Trompenaars im zweiten Kapitel beschreibt Berninghausen im dritten was interkulturelle Kompetenz ist. Hierfür gibt sie u. a. die Definition des Instituts für Interkulturelles Management, wonach „interkulturelle 87 Kompetenz […] die Fähigkeit [ist], sich in einer fremden Kultur so zu verhalten, dass die eigenen Absichten verstanden werden und die Verhaltensweisen der Umgebung richtig interpretiert werden können“ (Berninghausen 2012:26). Anschließend stellt die Autorin das am Zentrum für interkulturelles Management (ZIM) der Hochschule Bremen entwickelte und auf einem Modell von Darla Deardorff basierende Prozessmodell für interkulturelle Kompetenz vor. Die beschriebenen Elemente dieses Modells (Bewusstsein, Handlungskompetenzen, Wissen) können in einem interkulturellen Training vermittelt werden und stellen die Grundlage von interkulturellen Vorbereitungen und Sensibilisierungstrainings dar. Um eben diese Trainings geht es im vierten Kapitel, wenn die Autorin die Frage beantwortet, ob und wodurch interkulturelle Kompetenz erlernbar ist: „Interkulturelles Lernen findet auf unterschiedliche Art und Weise statt. […] Um die interkulturelle Kompetenz zu fördern, sind besonders Lernerfahrungen wichtig, die das Individuum dazu veranlassen, die eigene Weltsicht zu hinterfragen. Gewährleisten tun dies insbesondere 2 Arten von Erfahrungen, die aus diesem Grund im Curriculum einiger Studiengänge der Hochschule Bremen verankert sind: Auslandsaufenthalte und interkulturelle Trainings.“ (Berninghausen 2012:32) Da jedoch, so stellt Berninghausen fest, Auslandsaufenthalte allein nicht automatisch zu einer größeren interkulturellen Sensibilität führen, sondern gegebenenfalls sogar zu einer Ablehnung der fremden Kultur, könnten interkulturelle Trainings hier einen wichtigen präventiven Ansatz darstellen. In den Trainings sollen die Teilnehmer lernen, „Erfahrungen in interkulturellen Begegnungen so zu verarbeiten, dass sie gegenseitiges Verständnis maximal fördern und Frustration und Missverständnisse vorbeugen bzw. produktiv nutzbar machen“ (Berninghausen 2012:34). Auf solch einem erfahrungsorientierten Ansatz basiert auch der vom ZIM entwickelte und von der Autorin vorgestellte interkulturelle Trainingsansatz. Dieser ZIM-Ansatz behandelt 88 drei Stufen interkulturellen Lernens (Bewusstmachung interkultureller Unterschiede und Missverständnisse, die Wissensvermittlung unterschiedlicher Kulturmodelle und Methoden und das Erlernen von Fähigkeiten zum Umgang mit interkulturellen Begegnungen). Zum Abschluss des ersten Teils werden im fünften Kapitel ausgewählte Methoden zum Umgang mit interkulturellen Konfliktsituationen dargestellt (z. B. das Wertequadrat von Schulz von Thun). Der zweite Teil des Buches handelt von der Mobilität an der Hochschule Bremen. Er beginnt mit einer Vorstellung der Hochschule Bremen als „eine der internationalsten Hochschulen Deutschlands“ (Berninghausen 2012:41) bzw. des multikulturellen Campus an der Fakultät Wirtschaft, wo ca. ein Viertel aller Lehrveranstaltungen auf Englisch stattfinden (1. Kapitel). Zur Vermittlung kommunikativer Fertigkeiten und interkultureller Kompetenz werden dort die interkulturellen Erfahrungen der Studierenden auch wissenschaftlich thematisiert und von verpflichtenden interkulturellen Trainings begleitet. So ist im Curriculum jedes internationalen Studiengangs eine Auslandsvor- und -nachbereitung integriert, in der die Studierenden über die sozialen, kulturellen und politischen Besonderheiten des Gastlandes informiert werden. Im zweiten Kapitel (Campuskulturen) gibt Katrin Nissel einen Überblick über die verschiedenen Campusansichten sowie Lehr- und Lernstiele an Universitäten. Außerdem stellt sie das unterschiedliche Verständnis von Teamarbeit bzw. vom Verhältnis zur Professorenschaft vor. Dabei geht sie der Frage nach, wie diese Unterschiede das Leben von Studierenden und Dozenten beeinflussen und welche Probleme daraus resultieren können. Anschaulich beschreibt sie diese Unterschiede anhand eigener Erfahrungen als Dozentin in Deutschland, China und Brasilien. So komme beispielsweise in Deutschland der Professorenschaft die Rolle der Wissensvermittlung zu; in Brasilien und China hingegen seien die Professoren auch eine Art Lebensratgeber und Freunde. interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) Anne Löhr stellt im dritten Kapitel die Ergebnisse einer Studierendenbefragung vor, mit der sie in ihrer Diplomarbeit nachweisen konnte, dass interkulturelle Trainings im Rahmen der Lehre an Hochschulen, insbesondere im Zusammenhang mit einem Auslandsaufenthalt, zu einer signifikant höheren interkulturellen Sensibilität (IS) führen. Das Interkulturelle Sensibilität Phasenmodell des ZIM, das die Grundlage der Messung zur Entwicklung von Kompetenz bildet, orientiert sich am Stufenmodell interkultureller Sensibilität nach Milton Bennett und am ersten Teil vorgestellten ZIM-Prozessmodell zur interkulturellen Kompetenz. Mit dem Fragebogen zur Interkulturellen Sensibilität (FIS) kann die Entwicklung interkultureller Sensibilität anhand der drei Skalen Ethnozentrismus, Ethnouniversalismus und Ethnorelativismus beurteilt werden. Geeignet sei der Fragebogen insbesondere als Screening zur IS, als Grundlage zur Planung von Trainingsschwerpunkten, als didaktisches Hilfsmittel zur Motivation durch Selbstpositionierung, um Ziele in der Entwicklung von Teilnehmenden genau zu benennen und zur Evaluation von Trainingsmaßnahmen. Das Kernstück der Arbeit sind die 86 Fallbeispiele im dritten und vierten Teil des Buches. In den beiden einleitenden Kapiteln zum dritten Teil (Incomings) bzw. vierten Teil des Buches (Outgoings) werden jeweils die Hintergründe bzw. Entstehungsgeschichten der Fallbeispiele erklärt: Sie sind alle im Rahmen des Studiengangs Global Management entstanden, der die Studierenden gezielt auf Managementtätigkeiten in international operierenden Firmen vorbereitet. Die Studierenden sollen im Rahmen eines Kurses bei der Autorin ihre Austauschpartner (Incomings) interviewen und dabei Fallbeispiele für unterschiedliche Umgangsformen, Lernkulturen oder besondere Schwierigkeiten sammeln. An jedes Fallbeispiel (ca. eine halbe Seite) ist ein kurze Interpretation angehängt (ca. eine halbe Seite), die von den Studierenden selbst erstellt wurde und mit den Kulturdimensionen von Hall, Hofstede oder Trompenaars bzw. mit den von Thomas entwickelten Kulturstandards erklärt werden. So beschreibt ein Student beispielsweise das etwas andere Präsentationsschema eines brasilianischen Austauschstudenten, der nach seinem Referat nicht verstand, warum seine deutschen Kommilitonen dieses kritisierten. Anders als in Brasilien finden die Deutschen es beispielsweise nicht gut, wenn ein Referat abgelesen oder auswendig gelernt vorgetragen wird. In Brasilien hingegen ist Ablesen und Auswendiglernen üblich, um sich nicht zu versprechen und so den Redefluss zu gewährleisten. Den Fallbeispielen von Incomings folgen Fallbeispiele der Outgoings. In den Rückkehrworkshops präsentieren und interpretieren Studierende ungewohnte oder sehr prägende Situationen, die sie im Ausland erlebt haben. So berichtet eine Studentin davon, dass ihre brasilianischen Kommilitonen in fachlichen Diskussionen immer sehr schnell persönlich würden. Andere Fallbeispiele erzählen von unruhigen und fast chaotischen Vorlesungen in Brasilien oder einem fast unterwürfigen Verhältnis von Studierenden zu ihren Professoren in Indonesien. Eigentlich habe ich aufgrund des Untertitels des rezensiertes Buchs - Interkulturelle Fallbeispiele von deutschen und internationalen Studierenden über das Auslandsjahr - etwas anderes erwartet (längere und ausführlichere Fallbeispiele, weniger Theorie). Der theoretische Teil beinhaltet auch nicht wirklich Neues. Allerdings ist es aber gerade die Kombination von theoretischem Basiswissen und praktischen Beispielen bzw. knappen, interpretierten Fallbeispielen, die dieses Buch ausmacht. Zudem dient das Basiswissen – wie die Autorin eingangs erwähnt – insbesondere zum besseren Verständnis des Rahmens, in den die Fallbeispiele eingeordnet werden können. Die Fallbeispiele sind einfach zu lesen und ich hatte teilweise das Gefühl, die darin beschriebenen Situationen selbst schon einmal erlebt zu haben bzw. konnte mich an ähnliche Situationen während meines eigenen Studiums erin- 89 nern. Neben diesen Fallbeispielen finde ich auch die Beispiele aus der Praxis – also die Darstellung des internationalen Campus an der Hochschule Bremen, die Erläuterung des ZIM-Ansatzes und insbesondere die anschauliche Beschreibung der eigenen praktischen Erfahrungen der Autorinnen – besonders interessant. Denn dadurch gelingt es ihnen, die unterschiedlichen Lehr- und Lernkulturen und somit die Notwendigkeit der Vermittlung interkultureller Kompetenz in speziellen Trainings deutlich zu machen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das Kapitel von Katrin Nissel über die verschiedenen Campuskulturen, da dieser wichtige Aspekt im Hochschulalltag selten thematisiert wird, aber wichtig für den Umgang mit ausländischen Studierenden ist. Durch die verständliche Sprache, die vielen Abbildungen und den übersichtlichen Aufbau ist das Buch gut lesbar. Jedes Kapitel steht als abgeschlossene Einheit für sich, so dass man das Buch nicht linear lesen muss. So habe ich zunächst die Fallbeispiele und dann darauf aufbauend die Ansätze und Trainingsmodelle gelesen. Dadurch konnte ich dem entgehen, dass das Buch in seiner ursprünglichen Reihenfolge sehr plötzlich endet. Denn nach der Aneinanderreihung von Fallbeispielen und ihren studentischen Interpretationen folgt kein abschließendes Kapitel. Es geht der Autorin primär darum, die Erfahrungen der Studierenden im Ausland bzw. der internationalen Studierenden in Deutschland darzustellen – was ihr zweifelsfrei gut gelungen ist - jedoch stehen diese recht unverbunden hintereinander. Obwohl die Interpretationen der Studierenden ohne Frage interessant sind, fehlen mir am Ende des Buches ein paar abschließende Worte der Autorin. Insgesamt liefert Berninghausen mit ihren Ausseneinsichten einen guten Einblick in die Situation ausländischer Studierender und in die Theorie interkultureller Kompetenz. Daher wäre vielleicht der Titel: Ausseneinsichten. Basiswissen und interkulturelle Fallbeispiele passender. Geeignet ist es sowohl für Lehrende, die ausländische Studierende besser verstehen wollen, als auch für diejeni- 90 gen, die interkulturelle Kompetenz auf der Grundlage von Fallbeispielen lehren möchten. Ob Studierende vor ihrem Auslandsaufenthalt tatsächlich dieses Buch lesen, stelle ich in Frage (außer vielleicht Studierende eines speziellen Studiengangs, wie z. B. Global Management an der Hochschule Bremen). Berninghausen leistet mit dieser Arbeit einen wichtigen Beitrag für ein besseres Verständnis der Situation ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen, da sie nicht nur bei einer Situationsbeschreibung stehen bleibt, sondern auch die Probleme, ihre Ursachen und konkrete Lösungsansätze vorstellt. Literatur BMBF (2010): Internationalisierung des Studiums. Ausländische Studierende in Deutschland. Deutsche Studierende im Ausland. Ergebnisse der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System. URL: http://www.studentenwerke.de/pdf/ Internationalisierungbericht.pdf [Zugriff am 20.05.2013]. DAAD (2013): Strategie. Strategy. DAAD 2020. URL: https://www.daad.de/portrait/ presse/pressemitteilungen/2013/Strategie2020 [Zugriff am 20.05.2013]. Berninghausen, Jutta (2012): Ausseneinsichten. Interkulturelle Fallbeispiele von deutschen und internationalen Studierenden über das Auslandsjahr. Bremen, Boston: Keller. 201 Seiten. Preis 16,90 EUR. ISBN 978-3939928-78-2. interculture j ourna l 12/21 (2 0 1 3 ) interculture j ourna l jahr 2013 jahrgang 12 ausgabe 21 herausgeber jürgen bolten stefanie rathje url interculture-journal.com