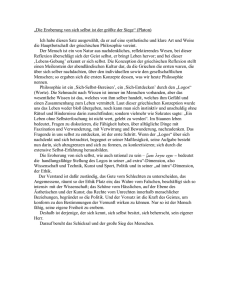Untitled - Widerspruch - Münchner Zeitschrift für Philosophie
Werbung

Widerspruch
jüdisches Denken –
jüdische Philosophie
In den dunkelsten Zeiten des Mittelalters,
als sich die asiatische Wolkenschicht schwer
über Europa gelagert hatte,
waren es jüdische Freidenker, Gelehrte und Ärzte,
welche das Banner der Aufklärung
und der geistigen Unabhängigkeit
unter den härtesten persönlichen Zwängen festhielten
und Europa gegen Asien verteidigten.“
Friedrich Nietzsche
Der größte jüdische Denker
ist nur ein Talent. (Ich z.B.)
Ludwig Wittgenstein
Widerspruch Nr. 37 Jüdisches Denken – jüdische Philosophie
(2001)
INHALTSVERZEICHNIS
jüdisches
Denken jüdische
Philosophie
Zum Thema
Artikel
Konrad Lotter
Judentum und Philosophie.
Stichpunkte und Grenzziehungen
Thomas Meyer
Standortbestimmungen.
Zum Problem einer „jüdischen Philosophie“
Umfrage
7
Fragen zur jüdischen Philosophie heute
8
26
42
Astrid Deuber-Mankowsky
Wer ist z.B. Heidegger? Zur Konjunktion
von deutscher Philosophie und religiöser
Tradition
43
Richard Faber
Überlegungen zum Jüdischen im Christlichen
50
Martin D. Kogut
Answers
57
Daniel Krochmalnik
Jüdische Philosophie – Gestern und Morgen
59
Friedrich Niewöhner
Jüdische Philosophie - Versuch einer
Begriffsbestimmung
66
Bücher
Werner Stegmaier
Von Juden lernen
69
Giuseppe Veltri
Fragen zur jüdische Philosophie als Wagnis
der Eigenart
76
Michael Zank
Antworten
80
Hannah Arendt: Die verborgene Tradition
zum Thema
Ignaz Knips
85
Micha Brumlik: Deutscher Geist und Judenhass.
Martin Schraven
88
Amitai Etzioni
Martin Buber und die kommunitarische Idee
Marianne Rosenfelder
90
Richard Faber, Eveline Goodman-Thau,
Thomas Macho (Hg): Abendländische
Eschatologie.
Alexander von Pechmann
Münchner
Philosophie
92
Leon Roth: Is there a Jewish Philosophy?
Marianne Rosenfelder
93
Werner Stegmaier (Hg): Die philosophische
Aktualität der jüdischen Tradition
Georg Koch
95
Joachim Valentin, Saskia Wendel (Hg):
Jüdische Traditionen in der Philosophie
des 20. Jahrhunderts
Alexander von Pechmann
98
Günter Zöller
Lehr- und Wanderjahre
100
Neuerscheinungen
Theodor W. Adorno: Zur Lehre von der
Geschichte und von der Freiheit
Roger Behrens
107
Gerd Becher, Elmar Treptow (Hg.):
Die Gerechte Ordnung der Gesellschaft
Reinhard Jellen
108
Ernst Bloch/Wieland Herzfelde:
Wir haben das Leben wieder vor uns
Roger Behrens
110
Stefan Bollinger: 1989. Eine abgebrochene
Revolution. Fritz Vilmar (Hg.): Zehn Jahre
Vereinigungspolitik.
Ulrich van der Heyden
111
Reinhard Brandt, Karlfriedrich Herb (Hg):
Jean-Jacques Rousseau (Reihe: Klassiker
Auslegen)
Manuel Knoll
113
Judith Butler: Psyche der Macht
Olaf Sanders
115
H. Drüe, A. Gethmann-Seifert, C. Hackenesch
et al. (Hg.):
Hegels „Enzyklopädie der Wissenschaften“
Georgios Karageorgoudis
116
Wolfgang Fritz Haug: Dreizehn Versuche
marxistisches Denken zu erneuern
Klaus Weber
117
Christoph Hubig, Alois Huning, Günter Ropohl
(Hg.):
Nachdenken über Technik
Michael Ruoff
119
Harald Lemke: Freundschaft
Alexander García Düttmann: Freunde und
Feinde
Roger Behrens
120
Mike Sandbothe (Hg.): Die Renaissance des
Pragmatismus
Chantal Mouffe (Hg.) : Dekonstruktion und
Pragmatismus
María Isabell Peña Aguado
122
F.W.J. Schelling: Von der Weltseele
Martin Bondeli
125
Bettina Schmitz: Die Unterwelt bewegen
María Isabell Peña Aguado
Anhang
128
Hans-Martin Schönherr-Mann:
Das Mosaik des Verstehens
Bernd Mayerhofer
131
Joachim Schulte, Uwe Justus Wenzel (Hg.):
Was ist ein philosophisches Problem?
Jadwiga Adamiak
134
Clemens K. Stepina: Handlung als Prinzip der
Moderne
Percy Turtur
135
Dieter Sturma: Person
Moderne
Percy Turtur
135
Rainer E. Zimmermann:
Die Rekonstruktion von Raum, Zeit und
Materie
Ernst Sandvoss
136
AutorInnen
Impressum
139
138
In: Widerspruch Nr. 37 Jüdisches Denken – jüdische Philosophie (2001), S. 7-8
AutorenInnen: Redaktion
Zum Thema
Zum Thema
jüdisches Denken –
jüdische Philosophie
Die Faszination, die vom jüdischen Denken ausgeht, liegt nicht zuletzt in
seiner Vieldeutigkeit und seinen Widersprüchen begründet. Zum einen
wird es nicht selten mit Kabbala und Geheimlehre assoziiert, deren Endzeit- und Erlösungsvorstellungen die europäische Mystik durchziehen
und sich bei Herzl mit zionistischer, bei Benjamin und Bloch mit kommunistischer Politik verbinden. Zum anderen wird eine Affinität des
jüdischen Denkens zur Rationalität des Kapitalismus unterstellt, die
Juden in der führenden Rolle des kapitalistischen Zirkulationsprozesses
gesehen (Sombart, Horkheimer). Aber auch Neukantianismus und Lebensphilosophie, Phänomenologie und analytische Philosophie sind
maßgeblich durch Juden repräsentiert, so dass das jüdische Denken überhaupt als zur Philosophie prädestiniert oder prädisponiert erscheint.
Auch der Begriff der jüdischen Philosophie, der doch Erwartungen von
festen Grenzen und Systematik schürt, erweckt ganz verschiedenartige
Assoziationen. Den einen bezeichnet er eine bestimmte, vor allem im
Mittelalter beheimatete Religionsphilosophie (Halevi, Maimonides), d.h.
eine Art prä-modernen Denkens, das noch ganz unter dem Patronat des
Glaubens steht. Die anderen hingegen meinen, in ihr das Paradigma
einer neuen, post-modernen Rationalität zu erkennen, die ihre dekonstruktivistischen Verfahren an der rabbinischen Auslege-Kunst orien-
zum Thema
tiert und, unter dem Ausschluss einer absoluten Wahrheit, Raum für
„Differenzen“ schafft (Derrida, Bloom).
Schließlich ist auch die Frage der Geltung oder der Verbindlichkeit weitgehend offen und ungeklärt. Plausibel zwar und gut begründet erscheint
der Vorwurf des Partikularismus. Jüdisches Denken ist das Denken eines
(„ausgewählten“) Volkes, das sich durch seine exklusive Beziehung zu
seinem Gott (dem „Gott Israels“) auszeichnet und eigensinnig auf Abgrenzung beharrt. Gleichzeitig aber werden Abweichung und Fremdheit
zum Vorbild und Modell eines neuen Universalismus, der das Partikulare
nicht identifizieren, homogenisieren und vereinnahmen möchte, sondern
Offenheit und Vielstimmigkeit zu seinem Prinzip hat.
Das vorliegende Heft versucht, Grenzlinien zu ziehen und einen Orientierungsrahmen zu vermitteln. Über das bloß begriffliche und (philosophie-) geschichtliche Interesse hinaus, zielt es auf die Erneuerung eines
Dialogs, der durch Nationalsozialismus und Holocaust gewaltsam beendet worden und auch unter den Bedingungen der Berliner Republik nur
zögerlich wieder aufgelebt ist.
In einem einführenden Artikel unterscheidet Konrad Lotter sechs Perspektiven, unter denen „Judentum“ zur philosophischen Kategorie geronnen
ist. Durch Stichpunkte, inzwischen „klassisch“ gewordenen Fragestellungen und Debatten werden diese Kategorien in ihren Umrissen skizziert
und ihrer Tragfähigkeit problematisiert. – Speziell am Begriff der jüdischen Philosophie selbst (der 1818 erstmals von Leopold Zunz verwendet wurde) zeigt Thomas Meyer die Schwierigkeiten einer – zwischen religiöser, sozialer oder ethnischer Identität schwankenden – Definition.
Unter bewusstem Verzicht auf Allgemeinheit und Verbindlichkeit konzentriert er sich darauf, einzelne hervorragende Positionen zu bestimmen.
Eine Umfrage des Widerspruch, an der Astrid Deuber-Mankowsky, Richard
Faber, Daniel Krochmalnik, Friedrich Niewöhner, Werner Stegmeier, Giuseppe
Veltri und Michael Zank teilgenommen haben, problematisiert den Begriff
der jüdischen Philosophie und fragt nach deren Stellung zur einen Philosophie. Es geht, metaphorisch ausgedrückt, um das Verhältnis „Athen
und Jerusalem“, um die Möglichkeiten einer Erneuerung jüdischer Denktraditionen bzw. um die „Säkularisierung“ und Aufhebung religiöser
Denkfiguren im aktuellen philosophischen Diskurs.
zum Thema
In unserer Reihe „Münchner Philosophie“ erscheint diesmal ein autobiographischer Bericht von Günter Zöller, der ...
Im abschließenden Rezensionsteil werden 19 aktuelle Neuerscheinungen
aus der Philosophie vorgestellt.
Die Redaktion
9
In: Widerspruch Nr. 37 Jüdisches Denken – Jüdische Philosophie
(2001), S. 9-25
Autor: Konrad Lotter
Artikel
Konrad Lotter
Judentum und Philosophie.
Stichpunkte und Grenzziehungen
Das Thema „Judentum und Philosophie“ ist umfangreich und vielfältig. Es
erscheint daher sinnvoll, mehrere Aspekte grundsätzlich zu unterscheiden:
I. Jüdisches Denken und jüdische (Religions-) Philosophie
II. Das Judentum als Gegenstand und Begriff der Philosophie
III. Die „Judenfrage“. Philosophische Diskussion der Juden-Emanzipation
IV. Juden in der deutschen bzw. europäischen Philosophie
V. Jüdische Selbstreflexion
VI. Jüdische Philosopheme. Philosophische Motive der jüdischen Tradition
I.
Jüdisches Denken und jüdische (Religions-) Philosophie
Zuallererst wird jüdisches Denken wohl mit der Tradition des jüdischen
Schrifttums assoziiert. Deren Grundlagen sind:
1. die hebräische Bibel, das Alte Testament (AT), das – einschließlich der Apokryphen – eine Sammlung von Schriften vieler Autoren darstellt, zwischen 1200 und 100 v. Chr. entstanden ist und historische Berichte, Gesetzesvorschriften, Gedichte, prophetische Reden etc. enthält;
2. die sog. mündliche Überlieferung, die Kommentare zum AT beinhaltet, Diskussionen (aus den Lehrhäusern) aufbewahrt, Lehren aus dem AT für das
Leben zieht etc. Sie stammt von etwa 2500 Autoren und wurde später ebenfalls schriftlich fixiert. Diese Überlieferung, der Talmud, der eine Weiter-
10
Konrad Lotter
entwicklung des AT darstellt (und insofern dem Neuen Testament, der
christlichen Bibel, entspricht), zerfällt a) in die Mischna (hebräischer Rechtskodex: in 6 Abteilungen wird die Begehung des Sabbats und anderer Feste
geregelt, das Zivil-, Straf- und Handelsrecht dargestellt, detaillierte Ehevorschriften, Reinheitsgebote etc. formuliert), die um 200 n.Chr. aufgezeichnet wurde und b) in die Gemara, die in einer palästinensischen und einer (bedeutenderen) babylonischen Version überliefert ist, an die Gliederung der Mischna anknüpft, aus Kommentierung und Diskussion besteht
und um 400 n.Chr. in aramäischer Sprache redigiert wurde. – Zu etwa 2/3
besteht der Talmud aus der sog. Halachá (Recht bzw. Religionsgesetz), zu
1/3 aus der Haggáda (Schriftauslegung, Theologie, Philosophie, Legende);
3. die Kabbala oder die jüdische Mystik ist zwischen dem 9. und dem 13.Jh.
entstanden und erhielt in Spanien ihre klassische Ausbildung. Ihre Hauptwerke sind Jezirah („Schöpfung“) und Sohar („Glanz“). Sie verbindet Elemente des Neuplatonismus (das „Eine“, „Emanations“-Vorstellungen etc.)
mit Geheimlehre und Zahlenspielerei (Vokale sind im Hebräischen zugleich
Ziffern, so dass sich Begriffe auch als Zahl, Quersumme etc. angeben lassen). Dominant darin sind die messianischen Erlösungsvorstellungen, die
geschichtlich mit der Vertreibung der Juden aus Spanien zusammenhängen
und die Grundlage messianischer Volksbewegungen (Isaak Luria, 15341572) sowie des ostjüdischen Chassidismus werden, die dem starren Gesetz
eine lebendige Frömmigkeit entgegensetzen. (Der Zerfall des Chassidismus
seit dem Ende des 19. Jh.s ist das Thema der großen Romane von Isaak B.
Singer, z.B. „Die Familie Moschkat“, „Das Landgut“, „Das Erbe“.)
Vor dem Hintergrund dieser Tradition scheint es plausibel, dass der Begriff
der jüdischen Philosophie zumeist als problematisch, d.h. die Philosophie
nicht als authentischer Ausdruck des Judentums angesehen wird. Julius
Guttmann, der bedeutende Historiker der jüdischen Philosophie, beginnt
seine Darstellung mit den Worten: „Das jüdischen Volk ist nicht aus eigener Kraft zu philosophischem Denken gelangt. Es hat die Philosophie von
außen her empfangen, und die Geschichte der jüdischen Philosophie ist eine Geschichte von Rezeptionen fremden Gedankenguts, das dann freilich
unter eigenen und neuen Gesichtspunkten verarbeitet wird“1. Philo von Alexandrien (gest. 45 n.Chr.) hat demnach das jüdische Gedankengut, vor allem
1
J. Guttmann: Die Philosophie des Judentums (1933), Wiesbaden 1985, S.9.
Judentum und Philosophie
11
den Monotheismus, im Sinne Platons, Maimonides (1135-1204) im Sinne von
Aristoteles interpretiert. Hermann Cohens (1842-1918) „Religion der Vernunft
aus den Quellen des Judentums“ ist durch die Philosophie Kants, Franz Rosenzweigs (1886-1929) „Stern der Erlösung“ durch die Philosophie Hegels inspiriert.
Begreift Guttmann die Philosophie des Judentums wesentlich als Religionsphilosophie, so betonen H. und M. Simon, dass die jüdische Philosophie
letztlich keine Religionsphilosophie, sondern nur eine „an Religion gebundene Philosophie“2 sei. Neben den religiösen Aspekt (Synthese von Philosophie und jüdische Religion) tritt hier ein geschichtlicher, sozialpsychologischer Aspekt: das Verständnis der Philosophie als Krisensymptom. Ihre Blütezeiten nämlich erlebte die jüdische Philosophie im antiken Alexandrien, im
mittelalterlichen Spanien und in Deutschland um die Wende vom 19. zum
20.Jh., d.h. dort, wo das Judentum durch die griechische, die islamische und
die aufgeklärt-christliche Kultur besonders bedroht war, durch Assimilation
oder Verfolgung und Vernichtung seine Identität zu verlieren. Sie ist also
wesentlich auch Selbstvergewisserung oder Selbstbehauptung der eigenen
Identität, die nicht nur religiös, sondern auch ethnisch begründet ist.
Auch für Norbert M.Samuelson steht der Krisen- und Bedrohungscharakter
im Vordergrund: die großen Zeiten der jüdischen Philosophie waren das
Mittelalter „als die Juden vom Islam“ und das moderne Deutschland „als
sie vom Christentum bedroht waren“3. Daraus leitet Samuelson ihren
„zwangsläufig polemischen“ Charakter ab.
An diese doppelte (philosophische und sozialpsychologische) Begründung
schließt sich auch Michael Zanks Unterscheidung von jüdischer Philosophie
und jüdischem Denken (bzw. „Denken Israels“) an4. Was jüdische Philosophie ist, wird demnach nicht an den Autoren oder Denkern, sondern an
den Werken festgemacht und dem Interesse, das diese Werke verfolgen.
Besteht vorrangig ein theoretischer (weltdeutender) Anspruch, wie z.B. in
Maimonides’ „Führer der Unschlüssigen“, so handelt es sich um Philoso2 H. Simon/M. Simon: Geschichte der jüdischen Philosophie, München 1984, S.18.
Hervorhebung von mir.
3 N.M. Samuelson: Moderne jüdische Philosophie. Eine Einführung, Reinbek 1995, S.8
und S.327.
4 M. Zank: Einige Vorüberlegungen zur jüdischen Philosophie am Ende des 20. Jahrhunderts. Entwurf einer Antrittsvorlesung zur MartinBuber Stiftungs-Gastprofessur für
jüdische Religionsphilosophie, Frankfurt/Main, J.W. v.Goethe-Universität, 3. Mai 1999.
12
Konrad Lotter
phie; ist ein Werk dagegen auf praktische Belange der religiösen und nationalen Selbsterhaltung gerichtet, wie der „Mishnah Torah“ (ein systematischer Gesetzeskodex), so haben wir es mit jüdischem Denken zu tun.
In Deutschland endet die Tradition der jüdischen Philosophie mit Rosenzweigs „Stern der Erlösung“ (1922) und Martin Bubers „Ich und Du“
(1923). Ihre weitere Entwicklung findet teils in den USA statt, wohin J.
Guttmann, N.N. Glatzer u.a. nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus emigriert sind (Mordechai Kaplan, Emil Fackenheim u.a.), teils in Israel, unter dem Einfluss Bubers und dem aus Litauen stammenden Yeshayahu Leibowitz.
II.
Das Judentum als Gegenstand und Begriff der Philosophie
Judentum als Gegenstand der Philosophie bezeichnet vor allem den Versuch, den jüdischen „Volksgeist“ zu charakterisieren, seine geschichtliche
oder geschichtsphilosophische Bedeutung darzustellen und ihn zu anderen
„Volksgeistern“ ins Verhältnis zu setzen.
Herder etwa sieht den jüdischen Volksgeist vor allem durch drei Eigenschaften geprägt: die Klage über das verlorene und die Sehnsucht nach dem zukünftigen Paradies, die „Anfang und Ende der ebräischen Dichtkunst“5
sind, das Bewusstsein, ein „freies Volk“ zu sein, bei dem zwar das Gesetz
(das Mosaische Gesetz), aber kein Gesetzgeber herrscht, schließlich das Gefühl der Fröhlichkeit und des Stolzes, das aus seinen nationalen Festen
(Passah-, Laubhüttenfest) abzulesen ist, die an den Ausgang aus der ägyptischen Gefangenschaft erinnern.
Weniger freundlich fällt das Bild aus, das Hegel (in seiner frühen Frankfurter
Zeit) zeichnet, wobei er die jüdische Mythologie mit der griechischen vergleicht. Hauptthese: der jüdische Geist ist der Geist der Trennung und der
Absonderung – und zwar „ohne Not“ – gegenüber der Natur ebenso wie
gegenüber den Menschen.
Noah will die Menschen nach der Flut (im Gegensatz zu Deukalion und
Pyrrha) nicht mit der Welt versöhnen und den Bund der Liebe erneuern. Er
will sich „gegen die feindselige Macht“ der Natur sichern, indem er „sie und
5
J.G. Herder: Vom Geist der ebräischen Poesie, in: Herder. Ein Lesebuch für unsere
Zeit, Berlin-Weimar 197810, S.101.
Judentum und Philosophie
13
sich einem Mächtigeren unterwirft“6. Abraham wird zum Stammvater der
Juden indem er „das Band des Zusammenlebens“ zerreißt; Kadmos oder
Danaos hingegen verlassen ihr Vaterland, um neuen Raum für Freiheit und
Liebe zu finden.
Die Motivation der Juden, mit Moses aus Ägypten zu ziehen, entspringt
nicht der Sehnsucht nach Freiheit, sondern der charismatischen Führerfigur
und dem Eindruck, den Moses mit seinen Wunder-Kunststücken auf sie
gemacht hat.
Die Juden sind ein Volk, das gesiegt hat ohne zu kämpfen, ein passives,
schadenfrohes und feiges Volk, ein sklavisches Volk „ohne ... Bedürfnis der
Freiheit“, ein Volk, das vom „Dämon des Hasses“ beherrscht ist.7 Die
Griechen sollten – gemäß dem Gesetz des Solons und des Lykurg, das das
Eigentum beschränkte – „gleich sein, weil alle frei“ waren; die Juden hingegen sollten nur deshalb gleich sein, weil „alle ohne Fähigkeit des Selbstbestehens“ waren.8
Unter dem Einfluss des Rassentheoretikers Gobineau und dem (Sozial-)
Darwinismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts mutiert der „Volksgeist“
bei Nietzsche zur Rasse-Eigenschaft. Die Juden werden zum Volk der Rache,
des Hasses, der List und der Lüge, zum Volk des Ressentiments und des
Priesterbetrugs, das gegen die „blonde ... arische Eroberer-Rasse“9 den
„Sklavenaufstand“ in der Moral unternommen und alle vornehmen Werte
umgewertet hat. Im Juden verkörpert sich der Geist der Askese, der Hass
auf das Leben, die Feigheit vor dem offenen Kampf. Mit seiner GleichheitsForderung pflanzt sich der jüdische Geist fort in den demokratischen und
sozialistischen Gedanken der Neuzeit. – Schwer vereinbar mit dieser geschichtsphilosophischen Wertung erscheint Nietzsches persönliche Hochachtung von Juden und sein Widerwille gegenüber dem Antisemitismus Richard Wagners oder Eugen Dührings.
Für die „Kritische Theorie“ der 30er und 40er Jahre repräsentieren die Juden
eine ökonomische Kategorie: die Zirkulation. Die eigene Zeit diagnostiziert
Horkheimer als den Übergang vom (liberalen) Hoch- oder Konkurrenz6
G.W.F. Hegel: Der Geist des Judentums, in: Werke, Frankfurt/M. 1970, Bd.1, S.276.
ebd., S.282 und S.287.
8 ebd., S.290.
9 F. Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, in: Werke, München 1958 u.ö. (Schlechta),
Bd.2, S.776.
7
14
Konrad Lotter
Kapitalismus zum (totalitären) Spät- oder Monopol-Kapitalismus, bei dem
der freie Tausch und die Vertragsfreiheit durch das Diktat über die Arbeit
verdrängt werden. Im Verlauf dieses Übergangs verliert die Zirkulation, die
traditionell das Geschäft der Juden war, an ökonomischer Bedeutung. Darin
wird zugleich die reale Basis für den neuen Antisemitismus gesehen: „Der
neue Antisemitismus ist der Sendbote der totalitären Ordnung.“10
III.
Die „Judenfrage“. Philosophische Diskussion der Juden-Emanzipation
Geprägt wurde der Begriff der Judenfrage in Deutschland um 1840. Infolge
der rechtlichen Gleichstellung durch die Französische Revolution und die
Verkündung der Menschenrechte verließen viele Juden die Gettos, so dass
sich das Problem der Eingliederung und des Zusammenlebens neu stellte.
Mehr oder weniger existierte das Problem allerdings schon (wie Lion
Feuchtwanger, mit mancher Anspielung auf die Gegenwart, in seiner Josephs-Trilogie scharf herausarbeitet) seit der Antike, seitdem die Juden nach
dem Jüdischen Krieg und der Zerstörung des Tempels (70 n.Chr.) zerstreut
und in der Diaspora lebten. Zunächst ein Thema der Antisemiten, wurde
die Judenfrage, weil sie ein reales Problem bezeichnete, auch von den Juden
selbst aufgegriffen und diskutiert.
Bekannt ist die Diskussion zwischen Bruno Bauer und Marx aus dem Jahr
1843. Solange der Jude jüdisch und der Staat christlich ist, solange kann es
eine politische Emanzipation der Juden nicht geben: das ist die Position Bauers. Zuerst muss sich der Staat selbst von der Religion emanzipieren, d.h.
die Religion zur Privatsache des Bürgers werden, erst dann können die Juden politisch, d.h. rechtlich gleichgestellt werden. Marx setzt der politischen
die menschliche Emanzipation entgegen. „Die Judenemanzipation in ihrer letzten Bedeutung ist die Emanzipation der Menschheit vom Judentum“11, Judentum aber ist gleichbedeutend mit Kapitalismus. „Das Geld ist der eifrige
Gott Israels, vor welchem kein andrer Gott bestehen darf... Der Wechsel ist
der wirkliche Gott der Juden“12. Gelöst wird die Judenfrage infolgedessen
letztlich erst durch die Aufhebung der kapitalistischen Verhältnisse.
10
M. Horkheimer: Die Juden und Europa (1939), in: Gesammelte Schriften, hg. von A.
Schmidt und G. Schmid-Noerr, Frankfurt/Main 1985 ff., Bd.4, S.308.
11 K. Marx: Zur Judenfrage, in: MEW 1, S.373.
12 ebd. S.374 f.
Judentum und Philosophie
15
Vor und nach dieser Diskussion hat es verschiedene andere Beantwortungen der Judenfrage gegeben, von denen ich nur die drei wichtigsten nenne:
- das klassisch-humanistische Konzept von Lessing, Goethe und W.v. Humboldt: die religiöse Gleichstellung der Juden durch Toleranz, die Förderung
ihrer Assimilation durch Erziehung und Bildung.
- das zionistische Konzept von Moses Heß13 und Theodor Herzl14 (auch
Werner Sombarts15 u.a.): die nationale Gleichstellung der Juden durch
Gründung eines eigenen jüdischen Staats.
- das kosmopolitische Konzept Hermann Cohens u.a.: Einigung der Menschheit durch die Juden. Die Idee der einen Menschheit verdanken wir „den jüdischen Propheten ... und nicht den griechischen Philosophen“; die „Eine
Menschheit ist das Korrelat zur Einen Gottheit“16; die Einigung der
Menschheit zu einem Staatenbund signalisiert, am Ende der Tage, die Ankunft des Messias. Damit beginnt die Zeit des Friedens, der Brüderlichkeit,
des Sozialismus.
Die Judenfrage richtet sich nicht nur auf die Möglichkeit des Zusammenlebens
von Juden und anderen Völkern, sie richtet sich auch auf das Problem der jüdischen Identität selbst. Für Martin Buber („Drei Reden über das Judentum“,
1911) z.B., um nur zwei extreme Antworten zu skizzieren, ist dies ein Problem der individuellen (religiösen) Existenz: „was ein auf die einsamste unzugänglichste Insel verschlagener Jude noch als ‚Judenfrage’ anerkennt, das einzig
ist sie“. Für Jean Paul Sartre hingegen („Reflexions sur la question juive“,
1946) wird der Jude erst durch die Anderen bzw. durch die gesellschaftliche Situation zum Juden gemacht. „Die Judenfrage ist durch den Antisemitismus
entstanden“, was dann auch heißt: „wir müssen den Antisemitismus abschaffen, um sie zu lösen“.17
IV.
13
Juden in der deutschen bzw. europäischen Philosophie
„Rom und Jerusalem. Die letzte Nationalitätenfrage“ (1862).
„Der Judenstaat“ (1896).
15 „Die Zukunft der Juden“ (1912).
16 H. Cohen: Jüdische Schriften, hg. von B.Strauß, Bd.1, Berlin 1924, S.213.
17 vgl. A. Bein: Die Judenfrage. Biographie eines Weltproblems, Stuttgart 1980. Das
zweibändige Werk ist das Standardwerk zu diesem Thema. Es stellt auch die Positionen
Mendelssohns, Kants, Fichtes, Hegels, Dührings, E.v.Hartmanns, Nietzsches u.a. dar.
14
16
Konrad Lotter
Alle bedeutenden Schulen oder philosophischen Richtungen des 20. Jahrhunderts werden, zum großen Teil sogar in ihren Gründern und Hauptvertretern, von Juden repräsentiert:
- Neukantianismus (Cohen, Lask, Cassirer u.a.),
- Lebensphilosophie (Bergson, Georg Simmel, Th. Lessing),
- Phänomenologie (Husserl),
- Neomarxismus (R. Luxemburg, Lukács, Bloch u.a.),
- Neopositivismus (Wittgenstein, Neurath, Popper),
- Wissenssoziologie (K. Mannheim, Scheler),
- Frankfurter Schule (Benjamin, Horkheimer, Adorno, Marcuse u.a.),
- Existenzphilosophie (Löwith, H.Arendt, Buber),
- Ökologische Philosophie (G.Anders, H.Jonas, J.Améry, E.Chargaff),
- Postmoderne/ Dekonstruktivismus (Derrida, Lyotard, Levinas u.a.).
Gibt es Merkmale, die die Juden, quer zu den Grenzlinien der philosophischen Schulen miteinander verbinden und es als gerechtfertigt erscheinen
lassen, von einem „typischen jüdischen Denken“ zu sprechen? Nach Ansicht der auf der Rassentheorie aufbauenden Nazi-Ideologie: ja. H.A.
Grunsky zufolge gibt es nur „eine einzige jüdische Philosophie“18, die vor allem zwei Merkmale aufweist:
„nichtjüdisches Geistesgut ... in die jüdische Gesetzesvorstellung hineinzuziehen und ihr unterzuordnen“ (S.16), d.h. alle Themen der „großen arischen Philosophie“ zu „talmudisieren“ (S.34). Arische Schöpfung einerseits
und jüdische Verfälschung andererseits zeigen sich, Grunsky zufolge, in den
Verhältnissen von Maimonides zu Aristoteles, von Spinoza zu Descartes,
von Newton zu Einstein, von Cohen zu Kant, von Marx zu Hegel, von
Freud zu Nietzsche;
Rabulistik, spitzfindige Rechthaberei, die von der Auslegung der Thora auf
die Auslegung anderer Texte übertragen wird (S.18 ff.).
Auch für Ernst Nolte stellt die jüdische Philosophie eine Einheit dar, was
u.a. damit begründet wird, dass in der Geschichte „die nationale und religiöse Solidarität weitaus stärker war als das Empfinden klassenmäßiger Zusammengehörigkeit, und keineswegs nur bei Juden“19. Letztlich dient das
jüdische Denken (als Sonderform oder Funktion quasi des „Willens zur
18
19
H.A. Grunsky: Einbruch des Judentums in die Philosophie, Berlin 1937, S.34.
E. Nolte: Geschichtsdenken im 20.Jahrhundert, Berlin-Frankfurt/Main 1991, S.576.
Judentum und Philosophie
17
Macht“) der Selbstbehauptung des jüdischen Kollektivs, darin besitzt es
seine letzte Gemeinsamkeit.
Micha Brumlik wehrt sich zwar gegen Noltes „ethnozentrische Perspektive“,
die von jüdischer Abstammung auf jüdische Selbstbehauptung schließt, hält
aber trotzdem an der Einheit des jüdischen Denkens fest, das er allerdings
auf ein Denken einschränkt, das drei Kriterien erfüllt, nämlich
- dass die Denker oder Denkerinnen „selbst Juden oder Jüdinnen“ sind,
- dass sie zu ihrem Judentum in einem „bewussten und reflektierten Verhältnis stehen“,
- dass ihr Denken „in der denkenden Entfaltung des Glaubens an den einen, gestaltlosen und geschichtsmächtigen Gott, dessen Taten und Worte
zum Buch wurden“20.
Benjamin wäre demnach ein „jüdischer Denker“, Hannah Arendt hingegen
nur eine „bewusste Jüdin“, da sie sich vom Denken des Judentums weit
entfernt hat.
M.E. lässt sich die Heterogeneität der genannten jüdischen Philosophen inhaltlich überhaupt nicht überbrücken. Höchstens lassen sie sich, wie das
Brumlik ansatzweise tut, nach ihrer Nähe oder Ferne zur jüdischen Religion
klassifizieren, also danach, inwieweit sie ihre philosophischen Argumente
aus der jüdischen Tradition entwickeln. Offensichtliche Übereinstimmung
allerdings herrscht in der außergewöhnlichen formalen (analytischen, kritischen)
Befähigung zur Philosophie bzw. zur geistigen oder künstlerischen Tätigkeit
überhaupt. Nehmen wir z.B. das erste Drittel des 20. Jahrhunderts: der Bevölkerungsstatistik zufolge lebten im Jahr 1925 in Deutschland 564.000 Juden, das entsprach 0,93% der Gesamtbevölkerung.21 Vergleicht man diese
Zahl mit den oben genannten Philosophen, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass in dieser Zeit weniger als 1% der deutschen Bevölkerung den –
aus heutiger Perspektive – Hauptteil der deutschen Philosophie repräsentiert haben. Das ist erklärungsbedürftig und wird in der Regel folgendermaßen erklärt:
durch den Ausschluss der Juden von vielen (handwerklichen) Berufen, was
zu einem verstärkten Andrang in anderen, vor allem „freien“, d.h. kauf-
20
M. Brumlik: Jüdische Philosophie – Jüdische Denker oder Denken des Judentums?,
Vortrag im AudiMax der Universität München am 3. Februar 1993.
21 R. Hirsch/ R. Schuder: Der gelbe Fleck, Berlin 1989, S.740.
18
Konrad Lotter
männischen oder intellektuellen Berufen (wie eben Journalist, Kritiker,
Schriftsteller, Musiker, Philosoph);
durch die besondere Beziehung der Juden zum „Buch“, da die jüdische Identität weniger durch das Land oder die politischen Beziehungen zu den
Nachbarstaaten vermittelt ist, als die immer neue Auslegung, Diskussion
und Kommentierung der heiligen Schriften;
durch die Bedingungen der Humboldtschen Schul- und Universitätsreform,
die auf dem Weg der Bildung, über die Aneignung der klassischen Literatur
und Philosophie, die Assimilation bzw. die Emanzipation fördert oder überhaupt ermöglicht;
durch die soziale Situation der Fremdheit, der Bedrohung und der Verfolgung, die eine besondere Wachheit für die sozialen und politischen Lebensbedingungen bewirkt und auch für geistige Veränderungen sensibel macht.
Robert Jungk spricht von der Heimatlosigkeit als einem philosophischen
„Stimulans“22.
Die Frage, inwieweit die jüdische Religion selbst (und zwar in einem größeren Ausmaß als die christliche oder andere Religionen) das philosophische
Denken fördert und prägt, wird weiter unten aufgegriffen.
V.
Jüdische Selbstreflexion
Von den zahlreichen Reflexionen jüdischer Philosophen über ihre Zugehörigkeit zum Judentum möchte ich nur einige wenige anführen, vor allem unter dem Gesichtspunkt der Typologie, d.h. um anzudeuten, welche wiederkehrenden oder typischen Argumente oder Probleme dabei angesprochen
werden.
Georg Lukács skizziert in „Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog“, auf wenige Worte beschränkt, das Milieu assimilierter Juden in seiner
Heimatstadt Budapest: „Aus rein jüdischer Familie. Gerade darum: Ideologie des Judentums gar keinen Einfluss auf geistige Entwicklung“. 23 Zur Erläuterung fügt er hinzu: seine Familie sei, wie alle Familien aus der Leopoldstadt, in religiösen Fragen vollkommen gleichgültig gewesen; die Religion
interessierte nur als Teil des häuslichen Protokolls, bei Eheschliessungen
und der Abwicklung sonstiger Zeremonien. (Dazu im Widerspruch gibt
22
23
H.J. Schulz (Hg.): Mein Judentum, Stuttgart-Berlin 19792, S.281.
Frankfurt/Main 1981, S.39 und S.241.
Judentum und Philosophie
19
Lukács in der Selbstkritik von „Geschichte und Klassenbewusstsein“ zu,
philosophische Fehler infolge seines „messianischen Utopismus“ begangen
zu haben; siehe unten.)
Von ganz anderer Tragweite ist eine Äußerung von Benjamin, der seine Beziehung zum Judentum als eine Quelle fortwährender Inspiration darstellt:
„Ich habe nie anders forschen und denken können, als in einem, wenn ich
so sagen darf, theologischen Sinn – nämlich in der Gemäßheit der talmudschen Lehre von den neunundvierzig Sinnstufen jeder Thorastelle“24. Das
ist, wohlgemerkt, 1931 geschrieben, also nicht zu der Zeit, als Benjamin seine frühe Sprachphilosophie aus dem AT abgeleitet hat, sondern nachdem er
längst zum Marxismus „übergetreten“ ist. Über die Verbindung von Judentum und Philosophie bei Benjamin existiert inzwischen eine kleine Bibliothek.25
Th. Lessing versucht das Lebensgefühl, die „Grundbefindlichkeit“ der jüdischen Existenz, zwischen der Innenperspektive des „ausgewählten Volks“
und der Außenperspektive des Fremden, des Verachteten, des Außenseiters
(die auf die Innenperspektive zurückschlägt) darzustellen. Von ihm stammt
das Wort vom „jüdischen Selbsthass“26. – Kleine Anekdote: der jüdische
Schriftsteller Benedikt Friedlaender verübte, von Eugen Dührings Tiraden
über die Minderwertigkeit der Juden bewegt, Selbstmord; er setzte Eugen
Dühring als Erben seines beträchtlichen Vermögens ein.
Wenn nicht von Selbsthass, so zumindest von Selbstzweifeln ist Wittgensteins
Verhältnis zum Judentum geprägt. Einerseits hebt er zwar die Intellektualität und geistige Beweglichkeit hervor: „Der Jude ist eine wüste Gegend, unter deren dünner Gesteinsschicht aber die feurig-flüssigen Massen des Geistigen liegen“.27 Andererseits spricht er den Juden, mit deutlicher Beziehung
auf sich selbst, geistige Eigenständigkeit ab und gesteht ihnen nur die Fähigkeit des Kopierens, Reproduzierens und des hermeneutischen Nachvoll24
Brief an Max Rychner, den Herausgeber der „Schweizer Rundschau“, vom 7. März
1931, in: Briefe, hg. von G.Scholem und Th.W. Adorno, Frankfurt/Main 1978, Bd.2,
S.524.
25 vgl. den Artikel „Theologie“ von A. Pangritz, insbesondere die Liste der über 50 Veröffentlichungen zu diesem Thema, in: M. Opitz/ E. Wizisla (Hg.): Benjamins Begriffe,
Frankfurt/Main 2000, Bd.2, S.822f.
26 Lessing beschäftigt sich in zwei Werken mit dem Judentum: „Deutschland und seine
Juden“ (Prag 1923) und „Der jüdische Selbsthaß“ (Berlin 1930).
27 L. Wittgenstein: Über Gewißheit, Werkausgabe Bd.8, Frankfurt/Main 1984, S.468.
20
Konrad Lotter
zugs zu: „Der größte jüdische Denker ist nur ein Talent. (Ich z.B.) – Es ist,
glaube ich, eine Wahrheit darin, wenn ich denke, dass ich eigentlich in meinem Denken nur reproduktiv bin. Ich glaube, ich habe nie eine Gedankenbewegung erfunden, sondern sie wurde mir immer von jemand anderem
gegeben. Ich habe sie nur sogleich leidenschaftlich zu meinem Klärungswerk aufgegriffen.“28 Wittgenstein führt das darauf zurück, dass die Juden
den Basistext ihrer Kultur nur (auf dem Sinai) empfangen, – im Gegensatz zu
den Griechen, die ihn (Homer) selbst erzeugt haben.
Für viele überraschend (vor allem für seine marxistischen Anhänger, trotz
vieler Hinweise, wie z.B. von Martin Jay29) kamen die „Enthüllungs-Interviews“ Horkheimers im „Spiegel“ und in anderen Zeitschriften, in dem er auf
die jüdischen Quellen seiner und Adornos Philosophie hingewiesen hat.
Vor allem seit Beginn der 60-er Jahre hat sich Horkheimer verstärkt mit
Fragen der Religion und des Judentums auseinandergesetzt.30 „Theologie
bedeutet ... das Bewusstsein davon, dass die Welt Erscheinung ist, dass sie
nicht die absolute Wahrheit, das Letzte ist. Theologie ist ... die Hoffnung,
dass es bei diesem Unrecht, durch das die Welt gekennzeichnet ist, nicht
bleibt“. Mit Bezug auf das jüdische Bilderverbot heißt es: er und Adorno
hätten „nicht mehr von Gott, sondern von der ‚Sehnsucht nach dem Anderen’ gesprochen“31. Damit ist nicht nur der Marxismus als Grundlage der
„Kritischen Theorie“ abgelöst und durch die jüdischen Theologie ersetzt;
mehr noch: Marxismus und „Frankfurter Schule“ werden gewissermaßen
als zwei Filialen der jüdischen Theologie dargestellt, nur dadurch unterschieden, dass die eine den Messianismus, die andere das Bilderverbot zur
Geschäftsgrundlage hat. „Marx ist meinem Gefühl nach vom Messianismus
des Judentums bestimmt worden, während für mich die Hauptsache blieb,
dass Gott nicht darstellbar ist, dass aber dieses Nicht-Darstellbare der Gegenstand unserer Sehnsucht ist“.32
28
ebd. - vgl. auch S.476 f.
M. Jay: Dialektische Phantasie. Die Geschichte der Frankfurter Schule und des Instituts für Sozialforschung, Frankfurt/Main 1976.
30 „Über die deutschen Juden“ (1961), „Religion und Philosophie“ (1967), „Psalm 91“
(1968), „Bemerkungen zur Liberalisierung der Religion“ (1971) u.a.
31 M. Horkheimer: Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, in: Gesammelte Schriften
a.a.O., Bd.7, S.351.
32 ebd., S.398.
29
Judentum und Philosophie
21
Völlig andersgeartet ist die Reflexion von Ernst Tugendhat, der Rechenschaft
ablegt über seine Stellung „als Jude in der Bundesrepublik Deutschland“
und über die Möglichkeiten des deutsch-jüdischen Dialogs unter der geschichtlichen Voraussetzung des Holocaust33. Vor allem entwirft er, gegen
Gershom Scholem gerichtet (der die religiöse Identität als die einzige anerkennt), vier Möglichkeiten jüdischer Identität: 1) Religion, 2) Assimilation,
3) Sozialismus und 4) Zionismus.
Die Reihe ließe sich fortsetzen, z.B. durch die Äußerungen von Robert
Jungk, Jean Améry, Günther Anders u.a.34, die nicht nur die Bedeutung ihrer jüdischen Herkunft für die eigene Sozialisation und den Verlauf ihres
(wissenschaftlichen) Lebens reflektieren, sondern auch z.T. ausführlich begründen, weshalb sie nicht in Israel leben wollten und könnten.
VI.
Jüdische Philosopheme. Philosophische Motive der jüdischen Tradition
Auch nach der Emanzipation der Philosophie von der Religion oder Theologie gibt es Motive, Argumentationsstrukturen etc., die überleben, eine säkularisierte Gestalt annehmen und in die Philosophie eingehen.35 Solche
Motive sind:
der Messianismus. Bloch, Benjamin, Horkheimer, Löwenthal u.a. (auch Lukács) weisen in ihrer philosophischen Entwicklung auffallende Parallelen
auf: Sie beginnen beim Neukantianismus der Marburger und der Südwestdeutschen Schule (Cohen, Rickert, Windelband, Lask), vollziehen eine
Wende zur Lebensphilosophie (Simmel), politisieren sich durch den Ersten
Weltkrieg und die Oktoberrevolution, kommen zum Marxismus nicht über
die Vermittlung Hegels (dessen Philosophie z.T. vehement abgelehnt wird),
sondern über mystische (Jakob Böhme, Ketzer-Bewegungen, Franz
v.Baader), zum großen Teil über jüdische Quellen (Kabbalistik, Chassidismus). Der Kommunismus erscheint ihnen als messianische, radikal-
33
E. Tugendhat: Ethik und Politik, Frankfurt/Main 1992, S.80ff.
Vgl. die entsprechenden Beiträge in H.J. Schulz (Hg.): Mein Judentum, a.a.O.
35 Von Gegenwarts-Philosophen jüdischer Abstammung ausgehend, zeigt das von Joachim Valentin und Saskia Wendel herausgegebene Buch „Jüdische Traditionen in der
Philosophie des 20.Jh.s“ (Darmstadt 2000) eione Fülle solcher Motive auf.
34
22
Konrad Lotter
ethische, mystische „Erlösung“ aus dem „Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit“36.
die Negativität. Maimonides zufolge lässt sich das Wesen Gottes mit keinem
positiven Attribut erfassen; zur Erkenntnis Gottes gelangt man infolgedessen nur durch verneinende Aussagen, d.h. durch Aussagen dessen, was
Gott nicht ist. Gottesdienst ist in erster Linie Überwindung des Götzendienstes. Der Kampf gegen die Götzen (Baal) ist eines der Hauptthemen
des ATs. Allgemein steht „Götze“ auch für Entfremdung, Ideologie, falsche Positivität. Gott bzw. Wahrheit sind nur negativ, in kritischer Absetzung gegen das Falsche zu entwickeln. Dass die Wahrheit ex negativo in
dem von ihr Verlassenen aufgesucht wird, ist eine Gemeinsamkeit von kritischer Gesellschaftstheorie (richtiges Leben als Negation des falschen) und
Psychoanalyse (Gesundheit als Negation der Krankheit), die beide von Juden begründet wurden. Zwei entgegengesetzte Formen der Negativität sind:
das Bilderverbot (das Verbot Gott und auch den Menschen als sein Ebenbild
darzustellen) und die Allegorie (die indirekte, über beliebige Zeichen vermittelte, verschieden ausdeutbare Darstellung). Ästhetische Konsequenz davon
ist z.B. die Bevorzugung der Musik und Dichtung vor der Malerei und
Bildhauerei oder die Bevorzugung der „offenen“ und vieldeutigen vor der
realistischen Darstellung. Eine Konsequenz der Allegorie wäre die Tendenz
zur (quasi-religiösen) Avantgarde („leere Transzendenz“) oder auch zur
Postmoderne bzw. zum Dekonstruktivismus. Derridas neugeprägter Begriff
der „différance“ meint a) Verschieden-sein (Unerschöpfbarkeit der
„Schrift“ aufgrund der eigenen Brüche, Widersprüche, Polysemien), b)
(zeitliche) Aufschiebung jedes endgültigen, verbindlichen Verstehens. Er
erhebt Einspruch gegen die eindeutige Zuordnung von „signifiant“ und
„signifié“, die Identifikation der Dinge durch das Zeichen.
Horkheimer und Adorno in der „Dialektik der Aufklärung“: „Die jüdische
Religion duldet kein Wort, das der Verzweiflung alles Sterblichen Trost gewährte. Hoffnung knüpft sie einzig ans Verbot, das Falsche als Gott anzurufen, das Endliche als das Unendliche, die Lüge als Wahrheit. Das Unter36
Vgl. A.Münsterberg: Utopie, Messianismus und Apokalypse im Frühwerk von
E.Bloch, Frankfurt/M. 1982. M.Löwy: Idéologie révolutionaire et messianisme mystique
chez le jeune Lukács (1910-1919), in: Archives de Science sociales des Religions Nr.45/1
(1978). Löwy stellt die These auf, religiös-mystische Sozialrevolutionäre wie z.B. die Figur des Vanja in Savinkows Roman „Das bleiche Pferd (1900) hätten Lukács’ Bild der
Oktoberrevolution mitgeprägt.
Judentum und Philosophie
23
pfand der Rettung liegt in der Abwendung von allem Glauben, der sich ihr
unterschiebt, die Erkenntnis in der Denunziation des Wahns.“37 Verbot des
Bildes als Unterpfand der Rettung: damit wird dann auch die philosophische Überlegenheit der jüdischen über die christliche Religion begründet
(S.167).
Habermas bringt den letzten Satz von Wittgensteins „Tractatus“, wovon
man nicht sprechen kann, davon soll man schweigen, in Verbindung mit
der jüdischen Tradition: "Ein solches Schweigen hat transitiven Sinn. Noch
das Ausgesprochene muss in das gebrochene Schweigen wieder zurückgenommen werden. Wie ein Kommentar liest sich Rosenzweigs Bemerkung:
‚Es gibt nichts im tieferen Sinn Jüdisches als ein letztes Misstrauen gegen
die Macht des Wortes und ein inniges Zutrauen zur Macht des Schweigens’.
– Weil die eigene Sprache, das Hebräische, nicht die Sprache des Alltags,
sondern als die heilige Sprache diesem entrückt war, ist dem Juden die letzte und selbstverständlichste Unbefangenheit des Lebens, in seiner Qual zu
sagen, was er leidet, genommen.“38
Weitere Motive oder Züge, die die Philosophie beeinflusst haben, wären
etwa
- Widerständigkeit. Es gibt im Judentum keine päpstliche Autorität, keine Institution für Inquisition, keinen Kardinal Ratzinger. Der Talmud kennt kein
Verfahren der Synthetisierung, der Ausschließung von Widersprüchen. Bewusst sind einander widersprechende Texte und Kommentare aufgenommen. Aufgabe des gläubigen Juden ist es, seinen eigenen Weg zu Gott zu
finden. (Trotzdem hat sich auch eine jüdische Orthodoxie ausgebildet: eine
besonders strenge Gesetzesgläubigkeit.)
- Rationalität. Das jüdische Verhältnis zu Gott ist weniger durch den Glauben und die Offenbarung als durch das Studium der Thora vermittelt. Fragen den Glaubens werden nicht an kirchliche Instanzen delegiert. Der Spott
über „zwei Juden, drei Meinungen“ kann auch positiv, als Selbständigkeit des
Denkens, gedeutet werden. (Unter den Irrationalisten der europäischen Philosophie befinden sich kaum Juden.)
37
M. Horkheimer/Th.W. Adorno: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt/Main 1971,
S.24f.
38 J. Habermas: Der deutsche Idealismus der jüdischen Philosophen, in: Th.Koch (Hg.):
Porträts deutsch-jüdischer Geistesgeschichte, Köln 1961, S.109.
24
Konrad Lotter
- Diesseits-Orientierung. Leo Baeck hebt hervor, dass die Sehnsucht, die die jüdische Welt der Propheten beschreibt, eine Horizontale ist, d.h. auf die geschichtliche Zukunft gerichtet ist; bei der christlichen Welt der Apokalypse
handelt es sich dagegen um eine Vertikale, sie ist auf eine jenseitige Welt gerichtet.39 „Erlösung“ bezeichnet für die Juden ein innerweltliches Ereignis.
- Naturfremdheit als Konsequenz des Monotheismus, der die Welt nur als
Schöpfung Gottes (und deshalb nur als Zeichen seiner Größe und Allmacht), nicht in ihrer materiellen Eigengesetzlichkeit und Selbständigkeit
wahrnimmt.40 Der Beschneidungsritus könnte als ein Heraustreten aus der
Natur bzw. als Eintritt des Menschen die religiöse Gemeinschaft gedeutet
werden. Der jüdischen Philosophie gebricht es, wie oftmals festgestellt
wurde, an einer Ontologie41. In der Selbstkritik (1967) von „Geschichte und
Klassenbewusstsein“ führt Lukács das Leugnen der Naturdialektik und der
Abbildlichkeit des Erkennens u.a. auf seinen „damaligen messianischen Utopismus“ und den Primat der Praxis in seinem frühen Denken (d.h. auf jüdische Einflüsse) zurück.42
- Primat des Ethischen bzw. der Praxis. Im jüdischen Denken liegt das
Schwergewicht nicht auf dem Wissen über Gott, sondern auf der Nachahmung Gottes, d.h. auf der rechten Art zu leben. „Halacha“43 bezeichnet den
Weg, sich durch richtiges Handeln an Gott anzunähern.44
- Plötzlichkeit bzw. Ereignis. Zu den Grundansichten des Judentums gehört,
dass man den Messias zwar nicht herbeizwingen kann, dass man seiner aber
in jedem Augenblick gewärtig sein muss. Er kann jederzeit kommen, denn:
39
Vgl. L. Baeck: Judaism and Christianity, Philadelphia 1958, S.31. Auch G.Scholem:
Über einige Grundbegriffe des Judentums, Frankfurt/Main 1970, S.121.
40 Vgl. E. Treptow: Die erhabene Natur. Entwurf einer ökologischen Ästhetik, Würzburg 2001. „Während für die griechisch-römische Antike die Anschauung typisch ist,
dass die schöne und die große Natur an sich selbst göttlich ist, respektiert die Bibel die
eigenen Maße der Natur nicht. Sie unterstellt, dass die Natur ein Mittel der Verherrlichung des naturtranszendenten Gottes und seiner übernatürlichen Zwecke ist. Um sich als
Herr seiner absoluten Souveränität zu zeigen, durchbrach Jahwe die Naturordnung, tat
er Zeichen und Wunder.“ (S.204, vgl. S. S.151f. Als Beleg führt Treptow vornehmlich
Stellen aus dem AT an.
41 Z.B. in dem von A. Diemer und I. Frenzel herausgegebenen Fischer-Lexikon Philosophie, Frankfurt/Main 1958 u.ö., Stichwort „Jüdische Philosophie“ (C.Colpe).
42 G. Lukács: Geschichte und Klassenbewußtsein, Neuwied-Berlin 1970, S.27.
43 Vgl. E. Fromm: Ihr werdet sein wie Gott, Reinbek 1980, S.145 ff.
44 Das ethische Fundament der Philosophie Adornos ist wohl eher hier zu suchen, als,
wie mein Freund Manuel Knoll meint, in der Ethik des vögelnden Parasiten Aristipp.
Judentum und Philosophie
25
„Verflucht seien die Gebeine dessen, der das Ende (die Ankunft des Messias) berechnet“45. Seine Ankunft ist an keine Voraussetzung oder Entwicklung geknüpft. Nicht jede Epoche, sondern jeder Augenblick steht so unmittelbar zu Gott. Plötzliche Ereignisse können unser Leben ändern. Im
Gegensatz zu Hegels Dialektik von Kontinuität und Diskontinuität wird die
Geschichte als etwas Brüchiges, Diskontinuierliches, Sprunghaftes begriffen. Darin liegt die Verbindung der jüdischen Theologie zum Geschichtsbild des Anarchismus, zu Benjamins „Jetztzeit“ oder Adornos Begriff der
apparition, des „Himmelszeichens“ 46, in dem das Absolute blitzhaft aufleuchtet.
45
46
Talmud, Sanhedrin 97 b. (Vgl. E. Fromm, a.a.O., S.126 f.)
Th.W. Adorno: Ästhetische Theorie, Frankfurt/Main 1970, S.125.
In: Widerspruch Nr. 37 Jüdisches Denken – Jüdische Philosophie
(2001), S. 26-41
Autor: Thomas Meyer
Artikel
Thomas Meyer
Standortbestimmungen
Zum Problem einer „jüdischen Philosophie“*
I. Annäherungen
Zumindest der Zeitpunkt scheint einigermaßen gesichert: 1818 veröffentlichte Leopold Zunz (1794-1886) seine Schrift „Etwas über die rabbinische
Literatur“, in der es hieß: „Aber auch nur diese höhere Ansicht geziemt der
Wissenschaft, die, erhaben über alle Erden-Kleinigkeit, Länder und Nationen überlebt; nur sie kann uns einst zu einer wahren Geschichte der jüdischen Philosophie führen, worin der Ideengang der Köpfe ausgemittelt und
verstanden und mit den strengen Vorschriften der Geschichte verfolgt
werden muß.“1 Damit ist Friedrich Niewöhners an vielen Stellen nachzulesende Behauptung, so in Ritters „Philosophischem Wörterbuch“, widerlegt,
dass die Zusammensetzung „jüdische Philosophie“ erst in den 1840er Jahren zustande kam. Die Fragen, die eine Bestimmung dessen, was „jüdische
Philosophie“ heißt, stellen, bleiben jedoch die gleichen. Denn schon Zunz
tat sich schwer, jüdischer Philosophie einen genau definierten Inhalt neben
den anderen Bindestrichphilosophien zu geben. Konsequent ist es daher,
was der wohl beste Kenner der Problematik einer jüdischen Philosophie in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich Julius Guttmann (1880-1950),
* Den Aufsatz möchte ich dem Andenken des Münchner Philosophen Richard Hönigswald widmen.
1 Leopold Zunz, Etwas über die „rabbinische Literatur“, in: Ders., Gesammelte Schriften. Band I, Berlin 1875, S.31.
Thomas Meyer
seit 1919 Dozent für Religionsphilosophie an der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin, später deren Leiter, in seinem maßgeblichen Werk „Die Philosophie des Judentums“, schrieb: „Es hat niemals eine
jüdische Philosophie in dem Sinne gegeben, in dem es eine griechische oder
römische, eine deutsche oder französische gibt. Die jüdische Philosophie ist
seit der Antike ihrem Wesen nach Philosophie des Judentums... Ihre Selbständigkeit und Eigenart liegt ganz in dieser religiösen Richtung, mag sie
nun das überkommene Gedankengut zur Begründung des religiösen Judentums verwenden oder die Gegensätze wissenschaftlicher und religiöser
Wahrheit auszugleichen suchen. Sie ist Religionsphilosophie im dem spezifischen Sinne, der durch die Eigenart der monotheistischen Offenbarungsreligion gegeben ist, die sich durch die Energie ihres Wahrheitsanspruches
wie durch die Tiefe ihres geistigen Gehaltes der Philosophie als eine eigene
Macht gegenüberstellte.“2
Gleichwohl, so überzeugend Guttmanns Bestimmung ist, so sehr bedarf sie
der Korrektur. Überzeugend ist sie da, wo Guttmann von der nicht aufzulösenden und stets mitzudenkenden Verzahnung von jüdischer Religion
und jüdischer Philosophie spricht. Das eine ist ohne das andere nicht zu
haben. Wer sich also mit jüdischer Philosophie als einem historischen und
aktuellen Phänomen auseinandersetzt, muss Abschied nehmen von den
historisch ausgebildeten Formationen der nichtjüdischen Philosophie, die
eine Entwicklung hin zur Trennung von Religion und Philosophie kennt.3
Natürlich gibt es Vorstellungen von „jüdischer Philosophie“, die versucht,
eben keine „jüdische Religion“ zu denken; doch diese kommen, wie wir
sehen werden, nicht um die Frage nach der Konzeption und vor allem nach
ihrer Legitimation herum. Korrigiert werden müssen Guttmanns Behauptungen dort, wo er allzu leichtfertig „jüdische Philosophie“ als monolithischen Block versteht, der durch die Zeitläufte einen Wesenskern beibehalten habe und unveränderlich sei. „Jüdische Philosophie“ ist nämlich von
Beginn an in mehreren Gestalten aufgetreten. Zwar verfügen die einzelnen
Ausprägungen wiederum über einen gemeinsamen Bezugspunkt, doch
2
Julius Guttmann, Die Philosophie des Judentums (1933), Wiesbaden 1985, S.10.
Sieht man einmal von Martin Heideggers Verdacht ab, dass alle Philosophie ihren
„ontotheologischen“ Charakter stets beibehalten habe. Siehe dazu die präzise Untersuchung von Rudolf Brandner, Heideggers Begriff der Geschichte und das neuzeitliche
Geschichtsdenken, Wien 1994.
3
Standortbestimmungen
zumindest die Rezeptionsgeschichte widerspricht Guttmanns Vorstellung
von der „jüdischen Philosophie“.
Wer das allerdings behauptet, der muss über ein Begriffsnetz verfügen, das
sich gerade in der Retrospektive bewährt. Ein solches hat der Religionsphilosoph Michael Zank vorgelegt. Die ‚Formationen’ – um es zunächst neutraler zu sagen – jüdischen Denkens, lassen sich in drei Kategorien zusammenfassen: einmal die „jüdische Philosophie“ selbst, das „jüdische Denken“ („Jewish Thought“) und das „Denken Israels“ („machsevet Israel“).4 Diese drei
Kategorien sind jedoch sehr unterschiedlich konstruiert. Während die „jüdische Philosophie“ in der Philosophie ihren Oberbegriff hat, sind die beiden
anderen letztlich am religiös gedachten Oberbegriff Israel orientiert, so daß
selbst der Einordnungsversuch von historischen Gestalten oder Denksystemen unter einer besonderen Schwierigkeit steht. Die Vielgestaltigkeit, die
am Anfang steht, erinnert an Derridas Rede von den „mehreren Ursprüngen“, die ein Phänomen hat. Der gewohnte hermeneutische oder begriffsgeschichtliche Zugriff erweist sich als verfehlt; er sucht eine Eindeutigkeit,
die die Texte nicht hergeben.
Zanks Unterscheidung wird noch vertieft durch die Problematik: Ist zum
Beispiel Walter Benjamin ein „jüdischer Philosoph“? Oder sind seine „Geschichtsphilosophischen Thesen“, seine Gedanken über den Messianismus
dem „Denken Israels“ zuzuordnen? Dort, wo ‚westliche Selbstverständlichkeiten’ und die Annahmen einer ganzen Tradition sofort zu greifen scheinen, nämlich bei der Vorstellung einer „jüdischen Philosophie“, entsteht
tatsächlich sehr schnell die Notwendigkeit zur Differenzierung und Präzisierung. Denn das, was man gewohnt ist durch Analyse entkoppeln zu können, erweist sich als nicht auflösbar – es sei denn, um den Preis der Zerstörung des Inhaltes. Freilich ist dies bei Maimonides etwa eher der Fall als bei
Moses Mendelssohn. Wer aber nur über Kenntnisse mittelalterlichscholastischer Philosopheme verfügt, wird Maimonides’ „Sefer“ ebenso wenig verstehen wie der, der Mendelssohns „Phaidon“ nur als Auseinandersetzung mit Plato liest. Er wird beide zwar auf unterschiedliche Art falsch
4
Die folgenden Überlegungen orientieren sich an Michael Zanks Antrittsvorlesung am
3. Mai 1999 in Frankfurt/Main, gehalten anlässlich der Übernahme der Martin-BuberGastprofessur für jüdische Religionsphilosophie. Der Text ist unter "http://www.
bu.edu/mzank/Michael_Zank/JuedischePHil.html" im Internet zugänglich.
Thomas Meyer
verstehen, was aber für eine Bestimmung des Begriffs „jüdischer Philosophie“ auch nicht gerade tröstlich ist.
Ein weiterer Aspekt, der die Problematik nur unterstreicht, ist die historische
Zuordnung jüdischer Denker. Natürlich wäre es einfach, eine Geschichte der
„jüdischen Philosophie“ zu erzählen, die sich auch gegenüber dem „jüdischen Denken“ sowie dem „Denken Israels“ verantwortlich zeigt. Man
hätte so zu sprechen von Philo von Alexandrien, Moses Maimonides, Spinoza, Moses Mendelssohn, Hermann Cohen und Martin Buber bis hin zu
Emmanuel Levinas und Ze’ev Levy. Aber unabhängig von der zeitlichen
Richtigkeit dieser Folge ist dann zu fragen, ob und inwiefern die Genannten
sich in das gängige Schema von Antike, Mittelalter, Aufklärung und Moderne einordnen lassen. Wie verhalten sich Aufklärung und Haskala, die jüdisch-deutsche Aufklärung? Kann man die Texte der Philosophen in eine
zeitliche Reihenfolge bringen, um Geschichte dann als Abfolge von Systemen zu formulieren, wie dies etwa Ernst Cassirer getan hat?5 Mit ebenso
guten, das heißt: erkenntniskritischen und hermeneutischen, Gründen hätte
man das Recht, die Texte als philosophische Auseinandersetzung zwischen
der je gegenwärtigen Philosophie und den Lehren des Judentums sowie
dem Judentum der Autoren zu lesen. Für ein solches Deutungsmuster haben die Werke des Breslauer Rabbiners und Religionsphilosophen Albert
Lewkowitz ein bedeutendes Beispiel geben.6 Diese Fragen nach der historischen Zuordnung scheinen sich unabhängig von jenen zuvor angegebenen
drei Kategorien zu stellen, da es sich hierbei um Übertragungsversuche in
ein der „jüdischen Philosophie“ – im weitesteten Sinne gebraucht – zunächst inadäquates, weil im logoszentrierten westlich-griechischen Denken
fundiertes Geschichtsschema handelt.
5
Ernst Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der
neueren Zeit, Berlin/Göteborg 1906-1950. Das Werk erschien in vier Bänden, der letzte
wurde fünf Jahre nach Cassirers Tod in Englisch publiziert, eine deutsche Übersetzung
erfolgte erstmals 1957.
6 Albert Lewkowitz hat drei Monographien geschrieben, die jeweils in Breslau veröffentlicht wurden und unter dem Obertitel „Das Judentum und die geistigen Strömungen der
Neuzeit“ standen : zur Renaissance (1929), zur Aufklärung (1929) und zum 19. Jahrhundert (1935). – Zu Lewkowitz siehe vom Verfasser: Thomas Meyer, Ernst Cassirer und
Albert Lewkowitz. Was heißt und zu welchem Ende studiert man Philosophiegeschichte?, in: Trumah 11 (2001), S.81-97.
Standortbestimmungen
Desweiteren wäre die Frage zu beantworten, ob und wie die genannten drei
Kategorien durch das nichtjüdische Umfeld Veränderungen erfahren haben.
Die Konzepte von Assimilation und Akkulturation oder die Versuche der
Isolierung, kurz alle jüdischen Reaktionsweisen auf ihre nichtjüdische Umwelt, müssten auch für die Problematik einer „jüdischen Philosophie“ Anwendung finden. Philosophiegeschichte müßte in unserem Zusammenhang
unbedingt um die Dimension des Historischen, das heißt um sozialgeschichtliche und ideengeschichtliche Aspekte, erweitert werden. Schon
längst ist in der geschichtlichen Forschung ein Konsens darüber erzielt worden, dass Judentum und Nichtjudentum in komplexen Austauschverhältnissen standen, dass etwa karolingische Pauluskommentare voller verheimlichter Midraschtexte sind, und daß sich in dem umfänglichen Korpus mittelalterlicher Traktate jüdischer Autoren auf Schritt und Tritt Übernahmen der
aristotelischen und christlichen Philosophie finden lassen. Wer dabei von
„Austausch“ redet, müßte allerdings genau angeben, wo jeweils die ideologischen, religiösen und sozialen Grenzen dieses Verhältnisses lagen.7 Keine
leichte Aufgabe; denn die Integration von methodischen Überlegungen aus
anderen Disziplinen ist bisher nicht die Stärke der Philosophiegeschichtsschreibung.
Diese sozialgeschichtlichen Fragestellungen aber haben Bedeutung für die
Gegenwart. Denn bei all den Unterscheidungen steht unausgesprochen ein
Komplex im Hintergrund, der für jede Beschäftigung mit dem Judentum
konstitutiv ist: Was heißt „Judentum“? Welcher Aspekt soll betont werden:
Gesetzestreue, rabbinische Tradition? Oder soll nach liberalen, orthodoxen
oder rekonstruktivistischen Formen des religiösen Judentums unterschieden
werden, die von den wiederum zahllosen Typen eines säkularen Judentums
zu unterscheiden sind?
Allein die Frage nach einer „jüdischen Philosophie“ zu stellen, bedarf also
einer Vielzahl von Vorüberlegungen, die ihrerseits voller normativer Annahmen sind, wie Willi Goetschel in einem wichtigen Aufsatz gezeigt hat.8
Daher kann – nach der vorgenommenen, keineswegs vollständigen De7
Dazu ist soeben ein neues Standardwerk erschienen, das diesen Fragenkomplex mustergültig vor allem aus der Sicht des Historikers und Ideengeschichtlers darstellt: Andreas Gotzmann, Rainer Liedtke, Till van Rahden (Hg.), Juden, Bürger, Deutsche. Zur
Geschichte von Vielfalt und Differenz 1800-1930, Tübingen 2001.
8 Willi Goetschel, „Jüdische Philosophie“ – Ein Querverweis, in: Babylon. Beiträge zur
jüdischen Gegenwart 13-14 (1994), S.119-132, hier S.119 f.
Thomas Meyer
konstruktion der Selbstverständlichkeit von „jüdischer Philosophie“ – weder eine Definition des Gegenstandes gegeben, noch soll eine bloß weitere
Geschichte der jüdischen Philosophie erzählt werden.
Ich beschränke mich daher im folgenden auf die Darstellung einiger Positionen, die versucht haben, das Problem einer „jüdischen Philosophie“ möglichst komplex zu diskutieren, die allerdings unserer weitgehenden Infragestellung noch nicht gefolgt sind. Dies hätte wohl als eine allzu schnelle
Erledigung der Problemstellung gewirkt. – Danach werde ich anhand des
Philosophen Hermann Cohen einige ungeordnete Überlegungen darüber
anstellen, wie problematisch, aber auch erkenntniserschließend es sein kann,
wenn man von ihm als „jüdischem Philosophen“ spricht.
II. Positionen
1999 erschien eine Essaysammlung aus dem Nachlaß von Leon Roth. Unter
dem Titel „Is there a Jewish Philosophy?“9 wurden Aufsätze zusammengestellt, die erwarten ließen, von prominenter Seite endlich eine Antwort auf
die wohl rhetorisch gestellte Frage zu bekommen. Weit gefehlt. Der von
1928 bis 1951 an der Hebrew University in Jerusalem lehrende, einflussreiche Philosoph Leon Roth, der seine Fakultät bewusst unter den bis heute
gültigen Namen „Denken Israels“ gestellt hatte, umkreist zwar das im Titel
genannte Thema und gibt sogar eine Definition „jüdischer Philosophie“,
aber statt Kriterien für seine Begriffsbestimmung zu nennen, übt er sich in
der Analyse unterschiedlicher Autoren. Für Roth ist „jüdische Philosophie”
wohl „the thinking and rethinking of the fundamental ideas involved in
Judaism and the attempt to see them fundamentally, that is, in coherent
relation one with another so that they form one intelligible whole.“10 Vielleicht klingt es etwas hart, doch ganz Unrecht hatte der Rezensent Kenneth
Seeskin nicht, als er diesen Definitionsversuch „platitudinous“ nannte.11 Obwohl Roth ein äußerst subtiler Kenner der Tradition jüdischen Denkens
war und sein ganzes Leben mit deren Erforschung verbrachte, erscheint
9
Leon Roth, Is there a Jewish Philosophy? Rethinking Fundamentals. Library of Jewish
Civilization, Oxford 1999. – Siehe Rezension in diesem Heft.
10 Leon Roth, a.a.O., S.8.
11 Kenneth Seeskin, Review: Leon Roth, in: Shofar. An interdisciplinary Journal of
Jewish Studies 19 (2001) 3, S.180 f., hier S.181.
Standortbestimmungen
sein Vorschlag tatsächlich ein wenig dünn. Er stellt ein bekanntes Rationalitätskriterium an das Ende seiner Definition: „one intelligible whole“, an
dem sich seine Auffassung von „jüdischer Philosophie“ orientiert. Nicht
nur, dass damit etwa kabbalistische Formationen ausgeschlossen werden, –
er übernimmt auch ein scheinbar genuin idealistisches Argument und verpflanzt es unter großem Erklärungsvertrauen in einen fremden Zusammenhang. Im weiteren Verlauf des Buches wird allerdings klar, in welchem
Zusammenhang seine Rede vom „intelligiblen Ganzen“ steht. Für Roth
steht das monotheistische Judentum vor allem für eine universalistische Ethik,
eine Doktrin, die auf der Vorstellung eines transzendenten, von der Welt
separierten Gottes beruht.
Kontextualisiert man diese Definition Roths, dann muss auch Seeskins
Vorwurf relativiert werden. Es wäre dann auch Hermann Cohens Projekt
einer „Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums“12 in den Kontext
einzubeziehen. Dort entwickelt der Marburger Neukantianer eine Philosophie, die zwar als der formale Abschluss seines an Kant ausgerichteten
System verstanden werden kann, aber in einem tieferen Sinn eine Auseinandersetzung mit dem Satz darstellt: „Die Vernunft hat den Zwiespalt in
den Menschen mit seinem Gotte gebracht.“13 Cohen schreibt hier keine
bloße Theodizee, sondern breitet das Konzept eines ethischen Universalismus aus, das sich als „detaillierte Interpretation religiöser Glaubensinhalte
und religiöser Lebensführung im Horizont der Vernunft“14 präsentiert. Es
geht Cohen nicht länger um einen Gegensatz zwischen Philosophie und
Theologie, sondern um deren Einheit, wie sie die jüdischen Propheten in
ihren Schriften vorlegten. Sein Programm unternimmt den Versuch, den
Kantischen Begriff der Vernunft als Instrument für die Lektüre der prophetischen Schriften nutzbar zu machen, wobei er sich selbst verändert und
schließlich die Berechtigung seines Einsatzes ebenso hervorscheint wie die
12
Siehe die gleichnamige programmatische Schrift, die in ihrer zweiten Auflage bewusst
auf das immer wieder fälschlicherweise hinzugefügte „Die“ verzichtet: Hermann Cohen,
Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums (19292). Aus dem Nachlass herausgegeben von Bruno Strauß, Wiesbaden 19953.
13 Hermann Cohen, a.a.O., S.272.
14 Helmut Holzhey, Der systematische Ort der „Religion der Vernunft“ im Gesamtwerk
Hermann Cohens, in: Helmut Holzhey, Gabriel Motzkin, Hartwig Wiedebach (Hg.),
„Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums“. Tradition und Ursprungsdenken in Hermann Cohens Spätwerk, Hildesheim u.a. 2000, S. 7-59, hier: S.50.
Thomas Meyer
Notwendigkeit seiner Veränderung. Die transzendentale Methode wird
sukzessive zu einer religionsphilosophischen Methode, die als Einheit beider erscheint.
Wichtig war und ist Cohens Position. War und ist doch selbst von dem
Judentum grundsätzlich wohlgesonnenen Richtungen, wie dem Kulturprotestantismus von Harnacks, Troeltschs und ihren zeitgenössischen Schülern, immer wieder verdeutlicht worden, wie sehr man das Judentum als
eine historisch längst überwundene Religion hält. Erst auf dem Hintergrund
der Vorlesungen Harnacks über das „Wesen des Christentums“ werden die
explizit ethischen Positionen verständlich, wie sie die Vertreter der „Wissenschaft vom Judentum“ favorisierten. Bis heute weigert man sich in
Deutschland, ihre Forschungen, wie die von Benzion Kellermann, Uriel
Tal, Steven S. Schwarzschild oder jüngst Christian Wiese, in der nichtjüdischen Religionsphilosophie zur Kenntnis zu nehmen.15
Zeitgenössische Denker wie Micha Brumlik haben Cohen und seinen Schülern allerdings immer wieder eine Verwässerung „jüdischen Denkens“ vorgeworfen, weil diese letztlich eine Formel wie „Judentum + das Denken
darüber = universalistische Ethik“ postulierten. Dabei wird jedoch häufig
unterschlagen, dass das Judentum stets im Spannungsfeld von Universalismus
und Partikularismus gestanden hat, daß für es also die Notwendigkeit einer
ethischen Konzeption existenziell war: Ein universalistischer Anspruch, der
gerade aus der Verantwortung, das ausgewählte Volk Gottes zu sein, auf die
gesamte Menschheit ausgedehnt wurde und wird. – Die Partikularitäten, mit
denen das Judentum sich konfrontiert sah und sieht, sind Legion. Doch die
Zuweisung, diese Spannung zwischen Partikularismus und Universalismus
verweise in die lange Reihe von Heilsgeschichten, greift zu kurz. Denn sie
ist weder aufzuheben noch entscheidbar; sie ist konstitutiver Teil des Judentums. In ihm wird Ethik, wenn die Rede überhaupt Sinn macht, als „Erste
Philosophie“ präsentiert bzw. ist immer gegenwärtig. Sie kommt nicht, wie
man es seit Aristoteles gewohnt ist, bloß hinzu.
Innerhalb dieses Spannungsverhältnisses bedarf es eines Konzepts, das sowohl den Bestand der Religion als auch den Freiraum für die Reflexion über
sie ermöglicht. Es ist der Vernunftbegriff, der genau hier einsetzt. Der von
Cohen und auch von Hermann Levin Goldschmidt verwandte Begriff der Ver15
Christian Wiese, Wissenschaft des Judentums und Protestantische Theologie im
Wilhelminischen Deutschland. Ein Schrei ins Leere?, Tübingen 1999.
Standortbestimmungen
nunft zielt darauf ab, die Möglichkeit einer kritischen Reflexion auf die für
die Tradition zentralen Begriffe des Ursprungs, des Gesetzes und der Quellen zu eröffnen, um sie für die jüdische Philosophie selbst zu verorten.16
Aber auch die Präzisierung von Roths Konzept bringt einen, wenngleich
anderen, Argumentationsstrang hervor: In seiner Londoner Ringvorlesung,
an deren Beginn die Frage „Is there a Jewish Philosophy?“ stand17, zeigt
Roth, dass „jüdische Philosophie“ sich durch Diskontinuitäten auszeichne,
die allein deshalb unvermeidlich waren, weil das Denken in keinem einheitlichen Raum zustande kam. Er greift das Motiv einer zersplitterten, sich erst
immer wieder zu erobernden Sicht auf die philosophischen Probleme als
Tradition jüdischen Denkens auf. Kontinuität bietet die jüdische Religion
mit ihren mündlichen und schriftlichen Quellen; der Blick auf das aber, was
in der nichtjüdischen Philosophie geschieht, ist durch vielfältige Hindernisse verstellt. Die Ausgrenzungsmechanismen nichtjüdischer Gesellschaften
nehmen hier direkten Einfluss auf die Möglichkeit der Rezeption; ganz
unabhängig davon, dass sich die traditionssichernde jüdische Religion und
die philosophische Reflexion über sie in einer säkularen Umwelt abspielen.18
Hier zeigt sich das Wechselspiel zwischen Universalismus und Partikularismus in existenzieller Form erneut: in dem kompliziert korrelationalen Gefüge von Inklusion und Exklusion bildet sich eine Art offener Wunde aus.
Damit aber verweisen all diese Überlegungen über jüdische Philosophie,
jüdisches Denken und Judentum auf die Frage nach der „jüdischen Identität“. Lutz Niethammer hat in seinem brillanten Großessay „Kollektive Identität“19 völlig zu recht auf die Gefahren vor einer gedankenlosen Verwendung des „Plastikwortes“ (Uwe Pörksen) Identität gewarnt, – aber gleichzeitig den Diskurs um „jüdische Identität“ ausgenommen. Dies deshalb, weil
hier mehr als irgendwo sonst die Problematik der Identität unmittelbar mit
der Wesensfrage eines Kollektivs verbunden ist. Die von Roth und anderen
benutzte Rede von der Diskontinuität der „jüdischen Philosophie“ verweist
16
Siehe dazu die von Willi Goetschel im Passagen Verlag (Wien) herausgegebenen
Schriften Goldschmidts. Wichtig ist dafür der Aufsatz: Willi Goetschel, „Jüdische Philosophie“ – Ein Querverweis, a.a.O., S.129.
17 Raymond Goldwater (Hg.), Leon Roth: Jewish Philosophy and Philosophers, London
1962.
18 Siehe Kenneth Seeskin, Jewish Philosophy in a Secular Age, Albany 1990.
19 Lutz Niethammer, Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur, Reinbek 2000.
Thomas Meyer
also stets auf die Frage nach der jüdischen Identität und somit auf das
Problemfeld, das Arthur Hertzberg mit der Frage „Wer ist Jude?“ umschrieben hat.20 – Wenn also Diskontinuität und jüdische Identität existenziell
aufeinander verweisen, und die eine Bestimmung sich von der anderen
abhängig sieht, dann kann der eigentliche Denkraum niemals affirmativ
sein. Zuspruch kann jüdisches Denken nur geben, wenn es sich auf die
Tradition bezieht, in der die zahlreichen Spannungsverhältnisse ausgeglichen sind. „Ausgleich“ heißt dann gerade nicht, das Störende weggedacht
zu haben, sondern ihm einen Platz gegeben zu haben. Sobald die Grenze
des innerjüdischen Dialogs aber überschritten wird, so wäre zu folgern,
beginnt der Kampf um Anerkennung erneut und in aller Schärfe. Durchaus
im Einklang mit der philosophischen Tradition des Judentums kann daher
Hertzberg schreiben: „Aber Gott und die Geschichte haben die Juden dazu
gezwungen, den Herrschenden Dinge zu sagen, die sie vielleicht nicht hören wollen.“21
An diesem Punkt möchte ich die Darstellung von Positionen zur jüdischen
Philosophie beenden. Die Monographien und Sammelbände, die sich mit
dem Problem beschäftigen, ohne auf die hier aufgeführten Punkte zu verzichten, füllen inzwischen Bibliotheken. Wenn daher immer wieder betont
wird, wie gleichzeitig eng und weit der in sich extrem heterogene Begriff
„jüdischer Philosophie“ ist, dann kann vielleicht der Rückgriff auf einen
konkreten Philosophen selbst mehr Klarheit bringen.
III. Ein notwendiger Exkurs:
Wendet man die letzten Überlegungen auf die Frage an, wer denn „jüdischer
Philosoph“ sei, sieht man sich schnell vor große Probleme gestellt. Sicherlich sind Saadiah ben Yosef al Fayyumi, Moses Mendelssohn und Ernst
Cassirer jüdische Philosophen. Gemessen an den Regeln der Halacha wäre
dies religiös belegt durch ihre jüdische Herkunft. Aber was wäre „jüdisches
Denken“ bei Cassirer, von dem es doch keine Zeile über ein genuin jüdisches Problem zu geben scheint? Was ist mit Philosophen wie Edmund
Husserl oder Helmuth Plessner, die getauft waren, die aber von den nationalsozialistischen Rassengesetzen zu Juden gemacht wurden?
20
Arthur Hertzberg (in Zusammenarbeit mit Aron Hirt-Mannheimer), Wer ist Jude?
Wesen und Prägung eines Volkes (1998), München 2000.
21 Arthur Hertzberg, a.a.O., S.12.
Standortbestimmungen
In diesen Fragen kommt ein Komplex zum Vorschein, der bis jetzt ausgeklammert wurde: Was verändert sich für das Feld einer „jüdischen Philosophie“ durch den Versuch der Vernichtung des europäischen Judentums?
Sind die Bemühungen jüdischer Philosophen vor der Shoah überhaupt
noch für uns Heutige „erreichbar“, oder liegen sie nicht in einer Zeit voller
Utopien und einer unerwiderten Liebe, die vom „Deutsch-jüdischen Parnass“ träumte, wie dies Moritz Goldstein tat?
Zunächst drei Beispiele für philosophische Judenbilder22, die zeigen sollen,
wie maßlos antisemitisch philosophische Reflexion werden kann und wie
wenig diese Form der Argumentation auf die biographische Seite alleine
geschlagen werden kann. Zugleich verweisen die Beispiele darauf, wie
schmerzlich und blamabel es ist, dass es die deutsche Universitätsphilosophie bis zum heutigen Tage nicht für nötig hielt, eine Geschichte des Antisemitismus in der deutschen Philosophie anzuregen.23
Am 23. Februar 1929 hält der Wiener Wirtschaftswissenschaftler und Kulturkritiker Othmar Spann in der vollbesetzten Aula der Münchener Universität einen Vortrag mit dem Titel „Die Kulturkrise der Gegenwart“. Veranstalter ist der „Kampfbund für deutsche Kultur“. In dem Teilabdruck der
Rede in den „Mitteilungen des Kampfbundes für deutsche Kultur“ beklagt
Spann, dass Philosophen wie „Cohen, Kastor und Cassirer, der heute noch
in Hamburg lehrt“, das Monopol um die Kantdeutung an sich gerissen
hätten. Nach den bekannten Phrasen der nationalistischen Kulturkritik,
findet sich folgender Satz: „Das deutsche Volk musste sich die Kantische
Philosophie wie eine fremde Kunst und auch noch von Fremden abermals
erklären lassen.“24
22
Sehr differenziert zu den philosophischen Judenbildern der deutschen Idealisten und
bei Karl Marx siehe jetzt: Micha Brumlik, Deutscher Geist und Judenhass, München
2000. – Siehe Rezension in diesem Heft.
23 Einen Vorstoß wird wohl die Studie von Christian Tilitzki machen, die leider erst
Anfang 2002 erscheinen wird. Nach Angaben des Akademie Verlages (Berlin) wird das
Werk cirka 1400 Seiten in zwei Bänden umfassen. Dargestellt werden soll der Zeitraum
zwischen 1918 und 1945 für alle deutschen philosophischen Fakultäten, wobei nahezu
400 Philosophiedozenten in den Blick kommen. Die Arbeit argumentiert, so der Verlag,
institutionengeschichtlich, biographisch und ideengeschichtlich. Die Untersuchung wird
sicherlich im „Widerspruch“ nach Erscheinen ausführlich vorgestellt werden.
24 Othmar Spann, Die Kulturkrise der Gegenwart, in: Mitteilungen des Kampfbundes
für deutsche Kultur 1(1929) 3, S.33-44, hier: S.34.
Thomas Meyer
Genau dreizehn Jahre zuvor hatte der nicht minder bekannte Kantspezialist
Bruno Bauch die Philosophen Cohen und Cassirer als „Fremde“ bezeichnet,
die zwar herausragende Vertreter ihres Volkes sein mochten, besonders
Hermann Cohen, die aber aufgrund ihrer jüdischen Herkunft gar nicht in
der Lage seien, den Nationalheros Immanuel Kant zu verstehen oder gar zu
deuten.25 Soweit die feindliche Bestimmung dessen, was man unter „Jude“
zu verstehen habe. Man achte allerdings darauf, dass sowohl Bauch als auch
Spann jeden Antisemitismus weit von sich weisen, ganz im Gegenteil: Sie
seien zu ihren Thesen allein durch philosophische Reflexion gekommen.
Noch immer nicht ausreichend in die Textgeschichte Martin Heideggers einbezogen, ist ein Gutachten, das er am 25. Juni 1933 auf Bitten des Bayerischen Kultusministeriums über den Münchener Philosophen Richard Hönigswald (1875-1947) angefertigt hat. Hönigswald war sicherlich der eigenständigste Kopf unter den sogenannten Neukantianern. Erst in Breslau,
dann in München entfaltete er eine erfolgreiche Lehrtätigkeit. Nach dem
„Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933
wurde die Entlassung Hönigswalds betrieben. Es regte sich an der Münchener Universität und darüber hinaus, selbst bei Bruno Bauch, Widerstand.
Die Studentenschaft favorisierte Heidegger als möglichen Nachfolger. Aus
dem Gutachten selbst soll nur ein kurzer Abschnitt zitiert werden: „Die
Gefahr besteht vor allem darin, dass dieses Treiben den Eindruck höchster
Sachlichkeit und strenger Wissenschaft erweckt und bereits viele junge
Menschen getäuscht und irregeführt hat.“26 Ähnliches hat man einst Sokrates vorgeworfen.
IV. Hermann Cohen
25
Siehe dazu die hervorragende Edition von Ulrich Sieg, die außerdem Ernst Cassirers
entschiedene Antwort auf Bauchs Ungeheuerlichkeiten enthält: Ulrich Sieg, Deutsche
Kulturgeschichte und jüdischer Geist. Ernst Cassirers Auseinandersetzung mit der
völkischen Philosophie Bruno Bauchs. Ein unbekanntes Manuskript, in: Bulletin des
Leo Baeck Instituts, 88 (1991), S.59-91. Das unbekannte Manuskript findet sich auf den
Seiten 73-87.
26 Martin Heidegger, Hönigswald aus der Schule des Neukantianismus, in: Martin Heidegger, Gesamtausgabe. I. Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976. Band 16:
Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges. Hg. v. Hermann Heidegger, Frankfurt/Main 2000, S.132 f., hier: S.132. Zuerst veröffentlicht in: Claudia Schorcht, Philosophie an den bayerischen Universitäten 1933-1945, Erlangen 1990, S.161.
Standortbestimmungen
Bisher wurden viele Fragezeichen gesetzt. Es konnte jedoch hoffentlich
deutlich gemacht werden, dass „jüdische Philosophie“ keinesfalls durch
Komplexitätsreduktion näher bestimmt werden kann. Im folgenden möchte
ich in aller Kürze Hermann Cohen vorstellen. Es geht mir dabei gar nicht
um eine Auflösung der Fragezeichen, vielmehr um den Nachweis der Vielheit der Stimmen aus der einen Vernunft, als die sich diese eine „jüdische
Philosophie“ versteht. Man mag das nach dem Gesagten für problematisch
halten; doch vielleicht ist es für einen Augenblick erlaubt, die Vernunft als
„Maß“ zu nehmen. Vielleicht ist solche Überlegung wertlos; dann dient sie
wenigstens der Erinnerung.
In Hermann Cohens Denken zeigt sich die Schwierigkeit „jüdischer Philosophie“ exemplarisch. Verfolgen wir seinen Weg, der bis zuletzt der eines
Außenseiters – ganz im Sinne Hans Mayers – war. Der 2. Februar 1876 ist
ein besonderes Datum in der deutschen Philosophiegeschichte, denn an
diesem Tag bestätigte das Preußische Kultusministerium den jüdischen
Gelehrten als Nachfolger des verstorbenen Albert Lange in Marburg und
damit war der erste jüdische Philosophieprofessor Deutschlands gekürt.
(Noch Herbert Schnädelbach widmet in seiner Darstellung der deutschen
Philosophie, die nach dem Tode Hegels einsetzt und vorgibt, ihre Entwicklung bis 1933 zu verfolgen, dem Ereignis keine Zeile.)
Schon wenige Jahre später wird der überzeugte jüdische Deutsche in eine
Debatte hineingezogen, die aufgrund der Struktur der Argumente bis heute
paradigmatische Bedeutung hat: den sogenannten „Berliner Antisemitismusstreit“ (Walter Boehlich). Der preußische Historiker H.v. Treitschke hatte
die deutschen Juden mal wieder zur Taufe und zur Aufgabe ihrer angeblichen Sonderexistenz aufgefordert. Neben zahlreichen anderen Vertretern
des deutschen Judentums meldete sich auch Cohen zu Wort.27 „Es ist also
doch wieder dahin gekommen, dass wir bekennen müssen. Wir Jüngeren
hatten wol hoffen dürfen, dass es uns allmählich gelingen würde, in die
‚Nation Kants’ uns einzuleben; dass die vorhandenen Differenzen unter der
grundsätzlichen Hilfe einer sittlichen Politik und der dem Einzelnen so
nahe gelegten historischen Besinnung sich auszugleichen fortfahren würden; dass es mit der Zeit mögliche werden würde, mit unbefangenem Aus27
Hermann Cohen, Ein Bekenntniß in der Judenfrage, Berlin 1880. Zitiert nach der
leicht zugänglichen, jedoch sehr problematischen Ausgabe von Walter Boehlich (Hg.),
Der Berliner Antisemitismusstreit, Frankfurt/Main 1965, S.126-151.
Thomas Meyer
druck die vaterländische Liebe in uns reden zu lassen, und das Bewusstsein
des Stolzes, an Aufgaben der Nation ebenbürtig mitwirken zu dürfen. Dieses Vertrauen ist uns gebrochen: die alte Beklommenheit wird wieder geweckt.“28
In all seinen weiteren Veröffentlichungen, die einer strengen eigenen Systematik am Leitbild Kants verpflichtet sind, wird die in diesen Sätzen ausgedrückte Gleichzeitigkeit von jüdischem Selbstbewusstsein, Anspruch auf
Teilhabe an dem Gefühl Deutscher zu sein und der philosophischen Dignität dieser Konstruktion betont.29 Der jüdische Philosoph Hermann Cohen
hat jüdische Philosophie – jetzt können wir die Anführungszeichen erstmals
weglassen – also in einer ganz bestimmten Hinsicht betrieben. Sein Projekt
zielte ab auf eine Simultaneität, zumindest aber auf eine Parallelität, von
„Deutschtum und Judentum“30. Mit der heute leichtfertigen – weil allzu
schnell in den Geruch eines falsch zu verstehenden Romantizismus kommenden – Rede von der „deutsch-jüdischen Symbiose“ hat Cohens Projekt jedoch nur dem Namen nach etwas zu tun. Zwar fiel es Gershom Scholem
nicht zuletzt deshalb leicht, die „deutsch-jüdische Symbiose“ zu kritisieren,
weil aus ihr schnell eine inhaltsleere Pathosformel wurde. Und auch dass die
eine solche Option immer nur für einen kleinen Teil des liberalen Teil des
deutschen Judentums bestand, kann nicht verleugnet werden. Gleichzeitig
aber bildete die Vorstellung der „Symbiose“, wie Michael Brenner sehr überzeugend zeigen konnte, ein tragendes Fundament für das, was er die „Renaissance“ des Jüdischen in der Zeit der Weimarer Republik nennt.
Cohen hatte sich Kant nicht bloß deshalb ausgesucht, weil es Ende des 19.
Jahrhunderts im akademischen Deutschland eine starke Bewegung hin zu
28
ebd., S.126 f.
Zu Hermann Cohen siehe die Standardwerke von Geert Edel, Von der Vernunftkritik
zur Erkenntnislogik. Eine systematische Rekonstruktion der Entwicklung der theoretischen Philosophie Cohens, Freiburg/München 1988; Helmut Holzhey, Cohen und
Natorp. Bd. 1: Ursprung und Einheit, Bd. 2: Der Marburger Neukantianismus in Quellen, Basel/Stuttgart 1986; Hartwig Wiedebach, Die Bedeutung der Nationalität für
Hermann Cohen, Hildesheim u.a. 1997. Unerlässlich für jede Beschäftigung mit dem
Marburger Neukantianismus ist die historisch und ideengeschichtlich argumentierende
Arbeit von Ulrich Sieg, Aufstieg und Niedergang des Marburger Neukantianismus. Die
Geschichte einer philosophischen Schulgemeinschaft, Würzburg 1994.
30 Siehe Hermann Cohen, Deutschtum und Judentum mit grundlegenden Betrachtungen
über Staat und Internationalismus. Durchges., erg. und mit einem kritischen Nachwort
als Vorwort, Gießen 19163.
29
Standortbestimmungen
Kant gab, sondern weil zahlreiche sowohl liberale als auch orthodoxe31
jüdische Denker in der Lektüre Kants Anschlussmöglichkeiten vorfanden,
die mit ihrem Judentum und der Reflexion darüber in einem wesenhaften,
zumindest sehr engen Zusammenhang standen. Die „jüdische Tat“ am
neuen Kant-Verständnis Cohens war sicherlich die Leugnung der „Dingan-sich“-Problematik. Jener metaphysische Rest schien für den kritischen
Erkenntnistheoretiker ein nicht hinzunehmender Störfaktor bei seiner Vorstellung von der „transzendentalen Methode“, die auch den Kantschen
Grenzbegriff in den Verstehensprozess mit einbezieht. Die Ausdehnung
des Abstrakten, die Entgegenständlichung, die in dieser „Tat“ steckt, weist
zumindest hin auf das jüdische Bilderverbot.
In Cohens Religionsbuch wird deutlich, wie sehr es ihm bei der Bestimmung von jüdischer Philosophie um eine Koppelung der gegenseitigen Ansprüche geht. Für Cohen ist die Vernunft der Ursprung der Religion, und
ihre Urquelle das Judentum. Dabei wird schnell deutlich, was sich schon
zuvor in den Werken vollzog, dass nämlich mit Kant nicht der Anfang zu
machen ist. Lange Zeit ist Platon der Wegweiser, später – etwa in der umstrittenen „Logik der reinen Erkenntnis“ – kommen die Vorsokratiker hinzu. Cohen verdichtet die Philosophiegeschichte, die sich auch hier an kantianischen Vorgaben orientiert, zu einer nichtontologischen Geschichte des
Seinsdenken wie der Verwobenheit von Ethik und Menschheitsgeschichte.
Cohen macht sich zu keinem Zeitpunkt Illusionen über den Konstruktionscharakter dieser Vorgehensweise. Diese bewusst geschriebene „Philosophiegeschichtsphilosophie“ (Odo Marquard) erweist sich in der „Religion
der Vernunft aus den Quellen des Judentums“ als der historische Nachweis,
das die Ursprünge des Judentums schon immer in der Gleichzeitigkeit von
Religion, Sittenlehre und Philosophie lagen. Cohen kennt deren Ausdifferenzierungsprozesse; aber alleine die Möglichkeit und die Folgerichtigkeit
seiner „Religion“-Schrift weisen nach, dass es etwas Unveränderliches in
diesem dreifachen Ursprung gegeben hat, dessen genauere Architektur als
Eckwerte einer spezifisch „jüdischen Hermeneutik“ (Almut Brucker und
Reiner Wiehl) hier nicht näher ausgeführt werden kann.
31
Die Begriffe „liberal“ und „orthodox“ werden hier in Anlehnung an den üblich gewordenen Sprachgebrauch benutzt. Wissenschaftlich sind solche Kategorien allenfalls
als Webersche Idealtypen vertretbar.
Thomas Meyer
Unter den genannten Fragen und Infragestellungen wäre Cohen neu zu
lesen. Es ergäbe sich dann das Bild, dass jüdische Philosophie und jüdische
Religion sich in Grundpfeilern der Versicherung der Existenz G’ttes, der
Sittenlehre, den Lehren von Willensfreiheit und Unsterblichkeit wesenhaft
verbunden sind. Ihre Gedoppeltheit macht beide einmalig in der Verantwortung für die Menschheit, die wiederum in der Auserwähltheit des Volkes Israels begründet liegt.
„Nach schweren Kämpfen erst errang die Religion in der Gegenwart wieder
ihr Recht, eine Wahrheit zu verkünden, die über die erfahrbare Wirklichkeit
hinausgreift. Es bedurfte der Tiefe des Widerstreites von Wissen und Glauben, um in umfassender Erkenntnis Wissenschaft und Religion in der Verschiedenheit ihres Sinnes zu erfassen. So gewiß es eine Kulturaufgabe der
Menschheit ist, die Wirklichkeit in ihrer erweislichen Gesetzlichkeit zu erkennen, kann nie die Menschheit auf Wissenschaft allein ihr Leben gründen. Denn wofür der Mensch sein Leben einsetzt, wenn es Sinn und Wert
haben soll, die Idee des Guten wird nirgends von der Wissenschaft als entscheidende Macht der Wirklichkeit festgestellt. Doch vertraut der der Idee
sich weihende Mensch auf den Sieg des Rechts und der sittlichen Wahrheit.
In der Kraft und Tiefe des religiösen Erlebens des Guten als Offenbarung
Gottes erfüllt die Seele die Gewißheit, in der Welt der Endlichkeit und
Verworrenheit zugleich und dennoch in einem Reich göttlicher Ziele zu
leben. Im Glauben gewinnen die Ideen Kraft und Wahrheit, die Welt zu
beherrschen und zu durchdringen.
Es ist die Wahrheit der jüdischen Religion, die tiefsten Hoffnungen des
Menschenherzens auf ein Reich sittlicher Wahrheit, Gerechtigkeit und Güte
zum lebendigen Erfassen göttlichen Seins und Wirkens gesteigert und dadurch in ihrem ewigen Recht befestigt zu haben. Darum gehört die jüdische
Religion nicht der Vergangenheit einer überwundenen Kulturepoche an,
sondern erweist ihr Leben in dem Segen, der von ihr in den Ernst der Kulturarbeit strömt. So lange die Menschheit über den Augenblick hinaus an
Werten schafft, die keine Gegenwart vollendet sieht, ist der heilige Gott
Hort und Zuversicht, Sehnsucht und Erquickung wahrhaften Menschentums.“32
32
Albert Lewkowitz, Zur Philosophie der jüdischen Religion, in: Jahres-Bericht des
jüdisch-theologischen Seminars Fraenckel’scher Stiftung für das Jahr 1915, Breslau 1916,
S.3-20, hier: S.19 f.
In: Widerspruch Nr. 37 Jüdisches Denken – Jüdische Philosophie (2001), S. 42-84
AutorenInnen: Astrid Deubler Mankowsky, Morton D. Kogut, Richard Faber, Daniel Krochmalnik, Friedrich Niewöhner, Werner
Stegmaier, Giuseppe Veltri, Michael Zank
Artikel
Umfrage
Fragen zur jüdischen Philosophie
heute
I. Bis 1933 spielten jüdische Denker in der deutschen Philosophie eine große Rolle. Durch die Rückkehr von Emigranten erlebte diese Tradition nach
1945 nochmals eine kurze Renaissance. Dann brach sie ab. Heute gibt es
wieder Ansätze: etwa die Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg
oder der Jüdische Verlag bei Suhrkamp.
1.
2.
3.
Sehen Sie Chancen, daß sich heute in Deutschland und Mitteleuropa wieder ein jüdisches Geistesleben etabliert?
Gibt es Ihrer Meinung nach aktuelle politische Tendenzen, aber
auch mentale Einstellungen, die dem im Wege stehen?
Worin sehen Sie den ‚Gewinn’ sowohl für Nicht-Juden als auch für
Juden?
II. In der Geschichte der Philosophie ist es üblich geworden, eine Rubrik
„jüdische Philosophie“ zu bilden, unter der Denker wie Philon, Maimonides,
Mendelssohn, Cohen und Buber zusammengefaßt werden. Dieser Rubrizierung entgegen steht allerdings die Auffassung, daß es im Grunde nur eine
Philosophie gibt, die solche Etikettierungen nicht erlaubt.
1.
Läßt sich Ihrer Meinung nach eine Denktradition identifizieren, die
in dem Spannungsfeld zwischen „Athen und Jerusalem“ philoso-
Umfrage
2.
phiert und über die religiöse Motivation hinaus auf säkulare Weise
argumentiert hat?
Wenn ja, worin sehen Sie das Spezifische, das solches jüdisches
Philosophieren ausgezeichnet hat und auszeichnet?
III. Eine der Wurzeln jüdischen Denkens war die rabbinische Tradition, die
in Deutschland ihre Schwerpunkte in Berlin und Breslau hatte. Nach dem
neueren Antisemitismus in Europa, der im Holocaust gipfelte, hat auch bei
anderen jüdischen Denkern eine Rückbesinnung auf das Judentum stattgefunden.
1.
2.
Haben die Bemühungen, die aus der damit einhergehenden Auseinandersetzung mit den europäischen Denkmustern hervorgegangen sind, die Gegenwartsphilosophie Ihrer Meinung nach insgesamt befruchtet oder eher gelähmt?
Sehen Sie im jüdischen Philosophieren heute (neue) Konfliktlinien,
die zwischen Traditionsbezug (etwa dem rabbinischen) und modernem bzw. postmodernem Denken verlaufen? Und wenn ja,
welche?
Astrid DeuberMankowsky
Fragen zur jüdischen Philosophie
heute
Ad I. Es fällt mir schwer, die Frage nach den heutigen Chancen des jüdischen Geisteslebens zu beantworten. Je mehr ich darüber nachdenke, desto
fragwürdiger erscheint sie mir. Dies beginnt eigentlich schon mit den ersten
beiden Sätzen des Vorspanns. Wer ist gemeint, wenn von „jüdischen“
Denkern in der „deutschen“ Philosophie die Rede ist? Wäre Wittgenstein,
Österreicher und Enkel eines zum Christentum konvertierten Juden, ein
„jüdischer“ Denker in der „deutschen“ Philosophie? Fällt Georg Simmel –
eigentlich ein Soziologe – der wegen seiner jüdischen Herkunft in Berlin
keine Professur erhielt und deswegen nach Strassburg emigrieren musste –
Umfrage
unter die Rubrik? Martin Buber – ist er ein Philosoph im strengen Sinn und
welche Rolle spielte er vor 1933 für die „deutsche“ Philosophie? Gehört
Ernst Bloch dazu – auch er der Sohn einer zum Christentum übergetretenen Familie? Gershom Scholem, definitiv kein Philosoph? Cassirer – er
spielte auch nach 1933 von den USA aus eine wichtige Rolle in der deutschen Philosophie.
Ich befürchte, daß die Bezeichnung „’jüdische’ Denker in der ‚deutschen’
Philosophie“ vor allem zum Ausdruck bringt, wie wenig bisher im Rahmen
der „deutschen“ Philosophie über das Verhältnis von Philosophie, Philosophen und deren unterschiedliche kulturelle, nationale, religiöse und nicht
zuletzt geschlechterbedingte Lebenszusammenhänge nachgedacht wurde.
Was ist z.B. Heidegger? Ist er ein „deutscher“ oder ein „katholischer“ Philosoph, der in der „deutschen Philosophie“ eine wichtige Rolle spielte?
Wenn Franz Rosenzweig gemeint sein sollte, weiß ich nicht, von welcher
Tradition nach 1945 die Rede ist, die noch einmal eine „kurze Renaissance“
erlebt hat. Mir fallen stattdessen Namen ein wie Hannah Arendt oder Ernst
Tugendhat; – beide haben eine wichtige Rolle in der „deutschen Philosophie“ nach 1945 gespielt, wenn auch nicht immer von Deutschland aus.
Freilich hat ihr Denken nichts zu tun mit den „jüdischen Studien“ in Heidelberg. Ihre wichtigsten Bücher sind auch nicht im „Jüdischen Verlag bei
Suhrkamp“ erschienen. Ebenso wenig wie jene der „jüdischen“ Hausautoren von Suhrkamp, um nur Adorno und Benjamin zu nennen. Ist mit der
angesprochenen Tradition die berühmte und großartige „Wissenschaft des
Judentums“ gemeint? Die Frage nach ihrer Überlieferungsgeschichte nach
1933 ist freilich selbst ein Gegenstand der Forschung und kontroverser ländergrenzenübschreitender Debatten, in denen nicht zuletzt die Frage nach
dem Selbstverständnis von jüdischer Geschichtsschreibung, jüdischer Geschichtsphilosophie und jüdischer Philosophie mitverhandelt wird.
So hat sich etwa Gershom Scholem – einer der schärfsten Kritiker der
„Wissenschaft des Judentums“ – als deren legitimer Erbe verstanden. Für
ihn setzte sich die Tradition der Wissenschaft des Judentums an der Hebräischen Universität in Jerusalem fort, die er selbst mit seinen Forschungen
vorantrieb und doch nicht weniger (selbst-)kritisch kommentierte als die
„deutsche“ Wissenschaft des Judentums des 19. Jahrhundert. Anders als
sein verstoßener Schüler Jacob Taubes hielt er eine Wiederaufnahme der
Verbindung deutsch-jüdisch weder für möglich noch für wünschbar. Jacob
Umfrage
Taubes dagegen verstand sich als „Erzjude“ und Philosoph in Deutschland
nach 1945. Er hat unter dem Titel „Hermeneutik“ Philosophie, Kulturwissenschaft und Religionswissenschaft verbunden, um an der Grundlegung
einer bereits von Dilthey eingeforderten „Kritik der historischen Vernunft“
weiterzubauen und dabei die „Streitfrage zwischen Judentum und Christentum“ – so die Überschrift einer seiner Aufsätze – wie kaum jemand in seiner Generation öffentlich zur Diskussion gestellt.
Daß seine Schriften in den letzten zwei Jahren eine neue Rezeption erfahren, könnte als Indiz dafür gedeutet werden, daß die Sensibilisierung für die
Bedeutung wächst, die kultur- und religionswissenschaftliche Fragestellungen innerhalb der Philosophie und für die Philosophie haben. Ich befürchte
jedoch in diesem Fall, daß die Rezeption seiner Schriften, wenn, dann höchstens in Randbereichen der disziplinären Philosophie geschieht.
Die ausführliche Kommentierung des Vorspanns lässt mich nun die Frage,
ob sich heute in Deutschland oder Mitteleuropa wieder ein jüdisches Geistesleben etabliere, kürzer beantworten. Wenn das „wieder“ suggeriert, es
hätte einmal ein harmonisches, ein homogenes „jüdisches Geistesleben“
gegeben, so möchte ich auf die spannungsreiche Vieldeutigkeit hinweisen,
die sich bereits aus der Frage ergibt, wer oder was ein „jüdischer Philosoph“ sein soll. Was heute als „jüdisches Geistesleben“ bezeichnet wird,
war seit der Aufklärung und bereits bei Mendelssohn immer zugleich ein
Ringen um das, was Jüdischsein in der Moderne bedeutet, wie sich Jüdischsein zu Religiössein auf der einen, wie sich Jüdischsein zu Deutschsein auf
einer anderen Seite, das heißt zur Staatsangehörigkeit verhält. Das implizierte die Frage des Verhältnisses von Judentum und Christentum und zwar zu
einem Christentum das zugleich Staatsreligion war und ausgestattet mit dem
von Kant begründeten Anspruch auf den Status einer „universalen“ bzw.
„Vernunftreligion“. War von jüdischer Seite her Deutschsein verbunden
mit der Frage des Christentums, so konnte nur von deutsch-christlicher Seite her das Deutschsein selbst zu einer Quasireligion erklärt werden, wie es
im Nationalsozialisten etwa die „Deutschen Christen“ taten. Ebenso konnte
sich, wie die Geschichte von Heinrich Heine deutlich zeigt, auch nur ein
Christ von seiner Religion emanzipieren, ohne von Staats wegen auf die religiöse Herkunft festgelegt zu werden. Eben diese „Freiheit“ hatte Heinrich
Heine nicht. Nichtjüdinnen und Nichtjuden sahen sich in ihrem Bekenntnis
zum preußischen Staat nicht zu einem Bekenntnis zum Christentum ge-
Umfrage
zwungen. Dies war für Jüdinnen und Juden anders. Der Philosoph Hermann Cohen hat dieses Ungleichgewicht im Verhältnis von deutschem
Staat, Christentum und Judentum in seinem Aufsatz aus dem Jahr 1916
„Der Jude in der christlichen Kultur“ mit allen Konsequenzen deutlich zum
Ausdruck gebracht. Eine dieser Konsequenzen besteht darin, daß „Jüdischsein“ in der christlichen Kultur eine beständiges Bewußthalten der Fragilität
der kulturellen Identität und der Notwendigkeit bedeutet, sich die eigene
kulturelle Tradition in Erinnerung zu halten.
Wenn sich nun heute „wieder“ ein „jüdisches Geistesleben“ etabliert, dann
lebt auch dieses von Debatten um jüdische Identität. Ein Beispiel dafür sind
die Romane, Gedichte und Essays der Berliner Schriftstellerin Esther Dischereit. Eines ihrer Bücher trägt den bezeichnenden Titel Übungen, jüdisch
zu sein. Diese Debatten sind in Deutschland – durch die Zuwanderung von
Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion – um die Frage der
kulturellen Differenzen innerhalb der jüdischen Gemeinden noch einmal
um einiges komplexer – und reicher – geworden. Ein Beispiel für einen kreativen Umgang mit den vorgefundenen Differenzen ist etwa die Gruppe
„Meshulash“ in Berlin. Sie tritt, um schließlich noch die Frage nach „Mitteleuropa“ zu streifen, neben vielen anderen Aktivitäten auch als Herausgeberin eines „Europäisch-jüdischen Magazins“ mit dem Titel „Golem“ hervor.
„Golem“ ist zweisprachig, englisch und deutsch und bekennt im Editorial
der ersten Nummer programmatisch: „...wir behaupten, daß Juden in Europa nicht nur ihre Vergangenheit haben. Das europäische Judentum lebt –
trotz aller gegenteiligen amerikanisch-israelischen Prophezeiungen –, es ist
heterogen, und es wird auch in der Zukunft ein fester Bestandteil im Konzert der Völker Europas sein.“
Gibt es Ihrer Meinung nach aktuelle politische Tendenzen, aber auch mentale Einstellungen, die dem im Wege stehen?
Politische Tendenzen, die Heterogenität, Vielfalt und Differenziertheit als
positive Werte fördern, unterstützen auch Initiativen wie die erwähnten von
„Meshulash“. Während politische Tendenzen, die homogene Identität versprechen und die Angst vor der Komplexität unserer Realität auf die Angst
vor „Anderen“ projizieren, auch dem im Wege stehen.
Die Formulierung „mentale Einstellung“ ergibt mir wieder keinen Sinn. Ich
meine, es geht darum, kulturelle Werte und Denktraditionen stark zu machen, die eine Haltung der Neugierde, der Gastfreundschaft und des Inte-
Umfrage
resses an unbekannten Lebens- und Denkweisen fördern – und damit verbunden die Fähigkeit zu einer kritischen Reflexion auf die eigene Lebensund Denkweise und deren Geschichte. Dies setzt freilich voraus, daß die
Berührung mit Unbekanntem nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung erfahren wird.
Ad II. Tatsächlich gibt es die Gewohnheit, Philosophen wie Maimonides,
Mendelssohn oder Cohen unter der Rubrik „jüdische Philosophie“ zusammenzufassen. Dies ist aus mehreren Gründen eine schlechte Gewohnheit, die
man sich deshalb auch schnell abgewöhnen sollte. Einige dieser Gründe
dürften sehr schnell deutlich werden, wenn man sich vor Augen hält, daß –
außer Buber – keiner der Genannten mit dem Ausdruck „jüdische Philosophie“ etwas hätte anfangen können. Sie haben sich als Philosophen verstanden und als Juden. Freilich haben sie das Verhältnis zwischen Philosophie und Judentum philosophisch, also in ihrer Funktion als Philosophen
und in ihren philosophischen Werken mit philosophischen Methoden reflektiert; so wie dies auch Thomas von Aquin in Bezug auf das Verhältnis
von Philosophie und Christentum tat. Thomas hat sich dabei übrigens in
zentralen Punkten seiner philosophischen Argumentation auf Maimonides
gestützt. Auch für Kant war das Verhältnis von Philosophie und Christentum eine philosophische Frage, die er in intensiver Auseinandersetzung mit
Mendelssohn reflektierte. Genauso wie für Hegel oder Schelling oder
Nietzsche. Sie alle haben ihre philosophischen Konzepte in Abgrenzung,
Ergänzung oder sogar unter ausdrücklichem Rekurs auf das Christentum
formuliert: Ohne daß sie heute eine Rubrik „christliche Philosophie“ bilden.
In einer Rubrizierung „jüdische Philosophie“ sehe ich die Gefahr, daß vergessen, oder verdrängt wird, daß die „eine“ Philosophie seit der Übersetzung der griechischen Klassiker aus dem Arabischen im Spanien des 9.
Jahrhunderts nie ein Fakt, sondern immer ein Postulat war, um deren Einlösung man unter unterschiedlichen historischen Bedingungen aus jüdischer, christlicher und islamischer Perspektive gerungen hat. Im günstigsten
Fall mit philosophischen Argumenten.
Eben weil die Konjunktion von jüdisch und Philosophie an die zentrale
philosophische Frage nach dem Verhältnis von Universalem und Partikularem rührt, möchte ich dafür plädieren, an dem Ausdruck „jüdische Philosophie“ festzuhalten, ihn jedoch zugleich als Herausforderung an die sich
Umfrage
als universal verstehende Philosophie zu betrachten. Diese Herausforderung bedeutet: Die Frage, die sich in der Konjunktion jüdisch – philosophisch als Frage nach dem Verhältnis von Universalem und Partikularem
erhebt, auch an den als „eine Philosophie“ fungierenden Kanon zu stellen.
Und zwar als Frage nach der untergründigen Bedeutung und Rolle, die dem
Christentum in dieser als universal geltenden Philosophie zukommen. Die
Frage nach dem Verhältnis von Universalität und Partikularität sollte uns zu
den konkreten Partikularen führen. Dies sind im vorliegenden Fall die konkreten religiösen Traditionen des Judentums aber auch des Christentums
und, wie immer deutlicher wird, auch die Tradition des Islam.
Die Frage nach einer Denktradition, die im „Spannungsfeld zwischen ‚Athen und Jerusalem’“ philosophiert, bezieht sich, wie ich annehme, auf die
„deutsche“ Philosophie. Wenn nicht, wäre als aktuelle Diskussion jene zu
nennen, die Lévinas initiiert und Derrida fortgesetzt hat. Freilich zeigt sich
just in dieser Diskussion, daß sich der Gegensatz, nimmt man den philosophischen Anspruch ernst, in ein sehr komplexes gegenseitiges Bedingungsverhältnis auflöst.
Speziell für die „deutsche“ Philosophie möchte ich an das Werk von Hermann Cohen erinnern, der in geradezu paradigmatischer Weise im Spannungsfeld zwischen „Athen und Jerusalem“ philosophiert hat. Das zunehmende Interesse an seinem Werk und die Debatten, die sich an seine neuere
Rezeption anschließen, lassen hoffen, daß es zu einer Wiederentdeckung
dieser philosophischen Tradition auch im größeren philosophischen Rahmen kommt.
Wenn ja, worin sehen Sie das Spezifische, das solches jüdisches Philosophieren ausgezeichnet hat und auszeichnet?
Ich möchte, um Essentialisierungen auf der einen und Allgemeinplätze auf
der anderen zu vermeiden, ein Beispiel anführen. Es zeigt weniger an, was
„jüdisches“ Philosophieren auszeichnet, als was der philosophische Gewinn
eines Philosophierens sein könnte, das sich auf die religiöse Tradition bezieht, um die eigenen Grundlagen zu reflektieren und Denkmöglichkeiten
zu vergrößern. Das Beispiel stammt aus Hermann Cohens Ethik des reinen
Willens und bezieht sich auf die zentrale Frage der modernen Philosophie,
wie Universalität zu denken ist, ohne das Partikulare preiszugeben. Unter
Bezugnahme auf die christliche bzw. jüdische Tradition unterscheidet Co-
Umfrage
hen zwei Formen, die Universalität der Menschheit zu denken. Die eine orientiert sich an der christlichen Erlösungslehre. Sie ist im Johannesevangelium in dem Satz (14,6) ausgedrückt „Niemand kommt zum Vater denn
durch mich“. Christus, der Gottessohn ist der exemplarische Mensch. Das
heißt, wer im emphatischen Sinn Mensch werden, wer Anteil haben will an
dem universalen Begriff der Menschheit, kann dies (nur) durch Christus,
bzw. durch die Taufe. Er muss seine/ihre Vorgeschichte, seine/ihre alte
Religion und, wenn nötig, auch die Familie aufgeben. Von diesem Modell,
das im modernen Universalitätskonzept so wirksam und geschichtsmächtig
geworden ist, unterscheidet Cohen nun ein Konzept der universalen
Menschheit, das statt an Christus am Fremdling orientiert ist. Aus der exemplarischen Bedeutung, die der Fremdling für die Propheten spielt, leitet
Cohen einen ethischen Begriff der Humanität ab. Dieser richtet sich an der
Position des Fremdlings aus: Ist im christlich orientierten Konzept der Humanität Christus der exemplarische Mensch, so erhebt Cohen an dessen
Stelle den Fremdling „zum Vertreter des Menschen unter den Völkern“.
Damit löst Cohen im Rekurs auf die jüdische Tradition den Begriff der
Menschheit von seiner Fixierung auf einen idealen Begriff des Menschen
und misst ihn stattdessen an der Position, die in der postulierten Universalität dem Fremdling zugedacht ist. Er schreibt damit die Erfahrung des
Fremdseins in den Begriff der Universalität ein. Die Frage, ob dies noch jüdisch ist, scheint mir weniger zentral, als jene, ob sich dieser Begriff der Universalität weiterdenken, universalisieren – und sowohl politisch wie philosophisch fruchtbar machen ließe.
Ad III. Statt auf „Konfliktlinien“ möchte ich auf die befruchtende Verbindung hinweisen, die Talmudstudium und postmodernes Denken eingehen
können. Dies zeigt sich etwa in den Arbeiten von Daniel Boyarin. Er ist
Taubman Professor of Talmudic Culture an der University of California in
Berkeley. In seinem jüngsten Buch Unherioc Conduct. The Rise of Heterosexuality
and the Invention of the Jewish Man zeigt er entlang einer talmudgeschulten
Deutung von Texten der Tradition und aus der Moderne, dass das Männlichkeitsideal in den rabbinischen Texten keineswegs dem westlichen Ideal
des agressiven, starken, dominanten Mannes entspricht. Vor dem Hintergrund seiner Talmudstudien einerseits und dem Denken von TheoretikerInnen wie Homi Bhaba, Jacques Lacan, Gayatri Spivak u.a. andererseits
Umfrage
macht Boyarin macht deutlich, daß die jüdische Tradition die Konstellation
von Natur – Kultur – Geschlecht und Begehren anders gefaßt hat, als sie
heute oft allzuschnell als Universale im Rahmen der abendländischen Geschichte propagiert wird. Damit gelingt es auch ihm, neue Denkmöglichkeiten und damit neue Horizonte zu öffnen.
Richard Faber
Überlegungen zum Jüdischen im
Christlichen
„Was verdankt man nicht alles den Juden! Dass man ihnen das Christentum
selbst verdankt, will ich nicht erwähnen, da noch wenig Gebrauch davon
gemacht worden ist.“ Wir Menschen, speziell wir Europäer und Deutsche
verdanken den Juden sehr viel – nicht zuletzt das Christentum selbst.
Man musste nicht unbedingt der hochdialektische (Anti-)Christ und (Anti-)
Jude Heinrich Heine sein, um das schon im frühen 19. Jahrhundert zu erkennen. Doch waren es – vor wie nach Heine – nur wenige, die es tatsächlich taten, und noch weniger, die diese Erkenntnis ähnlich prononciert aussprachen wie er. Manch heutiger Philosemit verdrängt wiederum – geblendet vom nicht hoch genug zu veranschlagenden christlichen Antijudaismus
bzw. Antisemitismus – die jüdische Deszendenz bis Essenz des Christentums (und spezifisch christliche Momente Jüdischer Philosophie1).
Was die Persistenz des Jüdischen im Christlichen angeht, ist freilich von einem „Mehr oder weniger“ auszugehen. Doch das ist banal, nicht anders als
– ähnlich fundamental – Differenzierungen im Begriff Christentum wie Judentum einzufordern. Erfüllt man dieses Postulat, ergibt sich das nur
scheinbare Paradox, dass bestimmte Judentümer den ihnen analogen Christentümern näher stehen als anderen Judentümern und vice versa. Jacob
Taubes hat z. B. gezeigt, dass Gershom Scholems strikte Entgegensetzung
von christlichem und jüdischem Messianismus nicht ‚hinhaut‘, ganz abgesehen von der zum Messianismus insgesamt quer stehenden Gnosis, die auch
11
Vgl. R. Faber, Walter Benjamin und das „Vater unser“ – mehr als eine historisch-philologische Glosse, in: Zschr. f. Religions- und Geistesgeschichte 51 (1999), S. 70-74.
Umfrage
ein jüdisches Phänomen war – von der Kabbala an bis zu Benjamin und
Taubes.2
Letztere waren sogar „moderne Marcioniten“, also – wie profan–philosophisch auch immer – Schüler des häretischen Paulus-Jüngers, ja „Erzketzers“ Marcion, dem der selbst moderne Marcionit Ernst Bloch einen „metaphysischen Antisemitismus“ bescheinigt hat. Doch vorerst genug der –
mehr oder weniger paradoxen – Subtilitäten. Heines Aphorismus allein
schon läßt die Frage nach Existenz, Legitimität und Notwendigkeit jüdischer Philosophie prinzipiell positiv beantworten, wobei ich selbstverständlich von hermeneutischer Philosophie spreche, einer Philosophie also, die gar
nicht anders kann, als mit und gegen die Tradition zu denken: Aug‘ in Aug‘
mit ihr. (So wie noch der auch rabbinisch beeinflußte Jacques Derrida.)
Besser wäre – nicht weniger evident –, von einem keineswegs einheitlichen
Traditionsbündel zu sprechen, zu dem natürlich auch die gleichfalls in sich
differenten griechischen und römischen Traditionsstränge gehören – gerade
als ihrerseits religiöse. Nicht nur jüdische und christliche, sondern schon
vor- und außerjüdische bzw. vor- und außerchristliche Philosophie war wesentlich Religionsphilosophie, wenn Religionskritik auch eher ein- als ausschließend. Authentische (Religions-)Philosophie ist keineswegs religiös –
im kultischen Sinn –, weder irrational noch autoritär oder auch nur affirmativ. Sie ist wesensmäßig kritisch, wie prinzipiell schon die jüdische Prophetie3, der noch der Prophet aus Nazareth zuzurechnen ist. Die „Achsenzeit“,
die griechische Philosophie und jüdische Prophetie, als erste Aufklärungen,
miteinander verbindet4, ist mehr als eine ‚geschichtsphilosophische Kon2
J. Taubes, Walter Benjamin – ein moderner Marcionit? In: N. W. Bolz/R. F. (Hg.),
Antike und Moderne. Zu Walter Benjamins „Passagen“, Würzburg 1986, S. 31 ff.; vgl.
ders., Vom Kult zur Kultur. Bausteine zu einer Kritik der historischen Vernunft. Gesammelte Aufsätze zur Religions- und Geistesgeschichte, München 1996; ders. (Hg.),
Gnosis und Politik, München u.a. 1984 sowie die einschlägigen Beiträge des Sammelbandes „Abendländische Eschatologie. Ad Jacob Taubes“, Würzburg 2001.
3 Vgl. u.a. P. Zenger, Prophetie und Prophezeiung, in: H. Schmidinger (Hg.), Zeichen
der Zeit. Vorträge der Salzburger Hochschulwochen 1998, Innsbruck/Wien 1998, S. 68109.
4 Vgl. K. Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München 1963, S. 19-42, aber auch J. Ebach, Genie und Wahnsinn der Propheten? Suchbewegungen am Beispiel
Ezechiels, in: B. Effe/R. F. Glei (Hg.), Genie und Wahnsinn. Konzepte psychischer
‚Normalität‘ und ‚Abnormität‘ im Altertum, Trier 2000, S. 25-44. – Ebach zeigt, ausgehend von analogen Ausführungen Platons, dass prophetischer Wahnsinn nicht zu leug-
Umfrage
struktion‘. Umgekehrt war und ist solche Aufklärung auf Mythologie (die
selbstverständlich auch die Bibel kennt) verwiesen, arbeitet sich an ihr ab5
oder arbeitet sie – im günstigen Fall – durch6.
Erst dann kann Philosophie die berühmt-berüchtigte „Dialektik der Aufklärung“ vermeiden, wie nicht nur Klaus Heinrich überzeugt ist, der immer
wieder die philosophische Dignität der Freudschen Metapsychologie herausgestellt hat und – gleichzeitig – auf dem Unabgegoltenen griechischer,
vor allem aber römischer Mythologie insistiert hat: für eine realitätstüchtige
Zivilisationstheorie. Der überhaupt nicht „lügende“ Dichter Ovid ist Heinrichs Kronzeuge in diesem Prozess gegen Idealismus jeglicher Art7, aber
auch die jüdische Prophetie gilt Heinrich ihres Protest- wie Bündnispotentials wegen als conditio sine qua non kompetenter Philosophie.8 Und auf eine
solche – schon bei Heine und Benjamin – vorfindliche Vielstimmigkeit
kommt es mir prinzipiell an: eine komplexe Traditionspflege – den Ausdruck „Pflege“ doppeltironisch verwendet.9
nen ist, jedoch in Relation zu gesellschaftlichem und rationalistischem gesehen werden
muss, ja – auf provokative Weise – metaaufklärerisch fungiert.
5 Ich beziehe mich selbstverständlich auf Hans Blumenbergs berühmte „Arbeit am Mythos“ (Frankfurt/M. 1979), aber auch auf sein – so viel weniger beachtetes, in vielfacher
Hinsicht jedoch komplementäres – Buch „Matthäuspassion“ (Frankfurt/Main 1988). –
Zur politologischen Kritik an Blumenberg verweise ich auf: R. F., Der PrometheusKomplex. Zur Kritik der Politotheologie Eric Voegelins und Hans Blumenbergs, Würzburg 1984, Teil B.
6 Überragendes Beispiel für ein solches „Durcharbeiten“ ist Thomas Manns literarischphilosophischer bzw. philosophisch-literarischer „Josephs“-Roman. (Zu seiner Formbestimmung als literarisch-philosophisch bzw. philosophisch-literarisch vgl. R. F./B.
Naumann (Hg.), Literarische Philosophie – Philosophische Literatur, Würzburg 1999;
auf die speziell jüdische Literarizität der Tetralogie hat hingewiesen: E. Drave, Strukturen jüdischer Bibelauslegung in Thomas Manns Roman „Joseph und seine Brüder“. Das
Beispiel Abraham, in: J. Ebach/R. F. (Hg.), Bibel und Literatur, München 1995, S. 195213.)
7 Vgl. die ersten vier Bände der „Dahlemer Vorlesungen“ Klaus Heinrichs und speziell
ihren 7. Band: „psychoanalyse“ (Basel/Frankfurt 1981-2001). Zusätzlich verweise ich
auf die leider nur hektographierte Vorlesungsmitschrift: Klaus Heinrich, Zivilisation und
Mythologie III – Ovid Metamorphosen. Vorlesungen über Orpheus, Berlin 1983.
8 Vgl. die beiden frühen Bücher „Versuch über die Schwierigkeit nein zu sagen“ und
„Parmenides und Jona“ (Frankfurt/M. 1964 bzw. 1966). Wichtige Ansätze Heinrichs
werden weitergeführt von J. Ebach, Kassandra und Jona. Gegen die Macht des Schicksals, Frankfurt/M. 1987.
9 Vgl. R. F., Kritik der Romantik. Zur Differenzierung eines Begriffs, in: U. Helduser/J.
Weiß (Hg.), Die Modernität der Romantik. Zur Wiederkehr des Ungleichen, Kassel
Umfrage
Athen, Jerusalem und Rom sind nicht einfach zu ‚synthetisieren‘, doch unter Aushaltung teilweise zerreißender Spannung gleich unaufgebbare Bezugspunkte unserer kulturellen, nicht zuletzt philosophischen Überlieferung, wobei vor allem Jerusalem nach wie vor um seinen gleichberechtigte
Rang zu kämpfen hat. Bis heute wird die mit seinem Namen verbundene
Tradition zu einseitigen Gunsten der griechisch-römischen oder eines um
sein Judentum weitgehend gebrachten Christentums allzu sehr vernachlässigt, wenn nicht mißachtet. – Selbst wenn die jüdische Kultur (inzwischen)
hochgeachtet wird, bleibt nicht ausgeschlossen, dass sie als bloße (durchaus
attraktive) Fremdkultur (exotistisch miß-)verstanden und ihr konstitutiver
Beitrag zur eigenen: der christlich-europäischen Kultur beachtlich unterschätzt wird. Das „Abendland“ ist aber wesentlich auch jüdisch – ob das
Nietzsche und den Seinen paßt oder nicht.
Immerhin sind die Nietzscheaner konsequent, indem sie das Christentum,
als „Judentum in zweiter Potenz“, in ihre entschiedene Feindschaft mit einbeziehen – im Unterschied zu Goethe etwa, der das Christentum „mit dem
Judentum in einem weit stärkeren Gegensatz“ stehen sah als „mit dem Heidentum“. Schon diese Unterstellung war nicht ungefährlich, obwohl durch
ein stark hellenisiertes bzw. romanisiertes, tatsächlich „um sein Judentum
gebrachtes“ Christentum in gewisserweise legitimiert. – Nietzsche ist in jeder Hinsicht radikaler gewesen, hat das bleibend Jüdische eines authentischen Christentums erkannt, deswegen aber zugleich ein extremes Antichristen- und Antijudentum bekannt. Der fatale Neopaganismus des späten
19.- und frühen 20. Jahrhunderts – vor allem in Deutschland, jedoch auch
Frankreich und Italien – ist ohne ihn undenkbar: jener Antihumanismus,
der nur noch eine archaische und heroische, elitäre und immoralistische Antike kennen will, diese eben ‚dehumanisiert’.10
1999, S. 19-47 sowie ders., Von erotischer Mystik zu mystischer Erotik. Friedrich von
Spee und Friedrich von Hardenberg im Vergleich, in: R. F./V. Krech (Hg.), Kunst und
Religion. Studien zur Kultursoziologie und Kulturgeschichte, Würzburg 1999, S. 195213.
10 Ich teile die Interpretation von H. Cancik und H. Cancik-Lindemaier, in: Philolog und
Kultfigur. Friedrich Nietzsche und seine Antike in Deutschland, Stuttgart/Weimar 1999,
Kap. II; vgl. auch dies., Philhellénisme et antisémitisme en Allemagne: le cas Nietzsche,
in: D. Bourel/J. Le Rider (Hg.), De Sils-Maria à Jérusalem. Nietzsche et le judaisme. Les
intellectuels juifs et Nietzsche, Paris 1991, S. 21-46 sowie H. Cancik, Nietzsches Antike,
Stuttgart/Weimar 1995 und R. F. (Hg.), Streit um den Humanismus, Würzburg 2002.
Umfrage
Ich zitiere pars pro toto folgende Passage aus Nietzsches „Genealogie der
Moral“. „... ‚Rom gegen Judäa, Judäa gegen Rom‘: – es gab bisher kein größeres Ereignis als diesen Kampf, diese Fragestellung, diesen todfeindlichen
Widerspruch. Rom empfand im Juden Etwas wie die Widernatur selbst,
gleichsam sein antipodisches Monstrum; in Rom galt der Jude ‚des Hasses
gegen das ganze Menschengeschlecht überführt‘: mit Recht, sofern man ein
Recht hat, das Heil und die Zukunft des Menschengeschlechts an die unbedingte Herrschaft der aristokratischen Werthe, der römischen Werthe anzuknüpfen.“
Nietzsche blieb, nicht der einzige, der davon überzeugt war, ein Recht, ja
die Pflicht zu haben, „das Heil und die Zukunft des Menschengeschlechts an
die unbedingte Herrschaft ... der römischen Werthe anzuknüpfen“. Er und
seine konservativ-revolutionären Rezipienten waren antijüdisch, weil prorömisch oder: prorömisch, weil antijüdisch. Sie unterlagen dem dualistischen
Schema „Rom gegen Judäa“ und projektiv, wie sie generell waren, indem sie
„Judäa“ bzw. „Juda“ zuerst „diesen todfeindlichen Widerspruch“ unterstellten: „Der Haß des Juden gegen den Römer ist der angeborene Haß des Parasiten gegen die staatliche Ordnungsmacht, der Haß einer asozialen Rasse
gegen die mächtige Ordnung, die der römische Staat verkörpert, erwachsen
aus dem sicheren Gefühl, dass der Jude nur da, wo der Staat schwach ist,
sein Leben voll entfalten kann.“
Ich habe einen Satz Hans Oppermanns aus dem Jahre 1943 zitiert. Der damalige Straßburger Latinist behauptet – in der „Schriftenreihe zur weltanschaulichen Schulungsarbeit der NSDAP“: „Die Verjudung der alten Welt
ging über alles hinaus, was wir uns aus eigener Erfahrung vorstellen können.“ – Oppermann, indem er psychologisch projiziert, reprojiziert ‚historisch‘. Und der antijüdische Kampf der (Prä-)Faschisten ist weithin ein
Krieg auf (längst) vergangenem Boden, was ihm aber nichts an Gewicht
nimmt. Als „Genealogen“, für die „Jud(ä)a“ der Keim aller (modernen) Übel ist, können sie gar nicht anders als sehr weitgehend einen ‚historischen
Diskurs‘ zu führen, ihre aktuelle Ideologie historisch zu kostümieren.
Ich bleibe historisch-kritisch und konstatiere insofern: Die spätjüdische Apokalyptik protestierte aktiv gegen den römischen Imperialismus – alles andere denn unehrenhaft, der Erzrabbiner Ben Sakkai zog sich jedoch prototypisch in eine staatsloyale Synagogalreligion zurück, und sein Zeitgenosse Flavius Josephus wurde sogar zu einem Propagandisten römischen Kaisertums
Umfrage
– obgleich in des jüdischen Gottes Namen. Dabei war ihm der erste jüdische Philosoph im engeren Sinn, der durchaus apologetische Alexandriner Philon, vorausgegangen. Zugespitzt kann man formulieren, dass Philon Platon
‚mosaisierte‘, indem er Moses ‚imperialisierte‘: Augustus zu dessen universalem Erben proklamierte – nicht anders als dann der christliche Theologe
Eusebius Konstantin zum idealen Nachfolger Christi und Augusti zugleich.
Sehr einflußreiche, obgleich unauthentische Religionsphilosophie, gar Theologie ist wesentlich apologetisch, ja ideologisch. Doch gibt es eine mehr oder
weniger ausgeprägte – wenn meist auch ungewollte – Dialektik des Apologetischen. Hat zum Beispiel – um das Maimonides- und Spinoza-Problem
auf sich beruhen zu lassen – Moses Mendelssohn die Aufklärung eher judaisiert oder das halachische Judentum eher rationalisiert? War (der späte)
Hermann Cohen mehr ein kantianischer Jude oder ein jüdischer Kantianer?
Man kann diese Fragen in einer wesentlichen Hinsicht auf sich beruhen lassen und – fruchtbarer wie entscheidender – auf das jeweilige emanzipatorische bis revolutionäre Potential der Synkrasien bzw. Symphilosophien abheben. Dann stellen sich – überrepräsentativ beim heterodoxen Marxisten
Bloch – beachtliche jüdische Anteile heraus und unbeschadet dessen, dass
sein religionsphilosophisches Hauptwerk mit „Atheismus im Christentum“
überschrieben ist. Pointe dieses 1968 erschienenen Buches ist, dass seine
Religionsgeschichtsphilosophie – trotz „Atheismus“ und „Christentum“ –
tief jüdisch ist, aber nicht, weil Bloch ein (so unzionistischer wie ungläubiger) Jude war, sondern ein hochreflektierter Biblizist – nicht zuletzt im
Blick aufs Alte Testament, die Jüdische bzw. Hebräische Bibel.
Vor’m Reden von Jüdischer Philosophie nur aufgrund der jüdischen Herkunft des jeweiligen Philosophen – in noch so gut gemeinter Anwendung
der „Nürnberger Gesetze“ – ist nachdrücklich zu warnen. Ich will gar nicht
von der zum Katholizismus konvertierten und als „christliche Märtyrerin“
verehrten Edith Stein sprechen (oder den sich allzu sehr mit der „Konservativen Revolution“ einlassenden Weltanschauungsproduzenten Karl
Wolfskehl und Hans-Joachim Schoeps). Auch in den Fällen Cassirer, Kelsen, Wittgenstein und der meist jüdischen Mitglieder des „Wiener Kreises“
mag es gute kultur- und sozialpsychologische Gründe geben, von einer jüdisch mitbedingten Genese ihrer Theorie zu sprechen, ob sie aber substantiell jüdisch ist, scheint mir weitestgehend zu verneinen zu sein. Die (zeitweilige) Vertreibung dieser und anderer jüdischer Intellektueller, die Er-
Umfrage
mordung (nicht weniger) war Verbrechen und Verlust zugleich. Doch jüdische Philosophie (und Literatur allgemein) ohne jeden biblischen – nicht
einmal vermittelt biblischen – Bezug scheint mir inhaltlich unmöglich Jüdisch sein zu können. Das im weitesten Sinne biblische Kriterium – Apokalyptik, Midrasch, Talmud, Kabbala usw. einbeschließend – erscheint mir so
zentral, dass ich umgekehrt ‚Jüdischen Geist‘ dort am Werk sehe, wo bei
Nichtjuden (auch) ein vor- und außerchristlicher Biblizismus konstitutiv ist
– selbstverständlich auf die reflektierteste Weise, jede Substituierung vermeidend und die existentiell jüdische Differenz voll respektierend.
‚Nach Auschwitz‘ hat sich diese Differenz – selbst in den Augen eines so
agnostischen Juden wie Jean Améry – nur vertieft: Sartres Dictum, dass der
Antisemitismus den Juden zum Juden mache, hat dem Existenzial assimilierter Juden nach Auschwitz bloß zum Ausdruck verholfen. – Auschwitz stellt
insgesamt eine fundamentale Zäsur dar. Denken (und Dichten) wird in jede
nur vorstellbarer Zukunft hinein von ihm (und Hiroshima) außerordentlich
herausgefordert sein. Dass der gleich Améry weitestgehend assimilierte und
agnostisch gebliebene Günther Anders dies, wie kein anderer, auf den Begriff gebracht hat, hängt – kultur- und sozialpsychologisch – mit seinem unbeschadet dessen nie geleugneten Judentum zusammen, doch auch – und
kaum weniger – mit seiner bibelexegetischen Kompetenz, die es Anders erlaubte, in Form „Profaner Theologie“ geistesgegenwärtige Zeitdiagnose zu
betreiben.
Dies ist mein aktuelles, wenn man will, analytisches Argument für auch Biblische und insofern Jüdische Philosophie, von mir „Profane“ bzw. „Negative
Theologie“ geheißen. Ich verweise auf meinen Aufsatz „Profane Theologie
hellenischer, jüdischer und christlicher Provenienz. Über Walter Benjamins
Kafka-Studien“ im (zusammen mit Jürgen Ebach herausgegebenen) Sammelband „Bibel und Literatur“. – Was das Negative solcher Theologie oder
besser Philosophie angeht, füge ich hinzu, dass Jüdisches – groß geschrieben, also inhaltlich verstanden -, der Gottesfrage nicht ausweichen, auf keinen Fall umstandslos atheistisch oder gar antitheistisch sein kann. Sinn für
und Begehren nach Transzendenz – noch so anthropologisch bzw. soziologisch verstanden – sind Jüdischem unaufgebbar, wenigstens die Artikulation
ihres Entzugs: die Klage über den Transzendenzverlust.
Wieder ist mit Vorrang Franz Kafka zu nennen, der – nur konsequent –
auch am Messianischen negativ festgehalten hat. Noch Agnes Heller ist ihm
Umfrage
verpflichtet, wenn sie politologisch (freilich mehr im Sinne Derridas als
Benjamins) formuliert: „Der leere Stuhl wartet auf den Messias ... Die Politik kann diesen unbesetzten Stuhl nicht gebrauchen; aber solange man den
Stuhl beläßt, wo er ist, genau dort ..., wo er in seiner warnenden, vielleicht
sogar pathetischen Leere fixiert bleibt, müssen die politischen Handlungsträger sein Dasein immer noch in Rechnung stellen. Zumindest steht es ihnen frei, sein Dasein in Rechnung zu stellen. Alles übrige ist Pragmatismus.“
Ich selbst erinnere abschließend daran, dass der (Prä-)Faschist Charles
Maurras nicht zuletzt deshalb Antijudaist war, weil er im jüdischen Gewissensgott die Referenz jeglichen Antiautoritarismus – unter Einschluß des
Liberalismus – sah. Nicht nur er war tremendiert vom michaelischen – jegliches Seiende in die Schranken weisenden – Ruf: „Wer ist wie Gott?“ und
von der aus dieser rhetorischen Frage folgenden Aufforderung, Gott mehr
zu gehorchen als den Menschen (und ihren Institutionen). Auch der „Vulgärmaurrasist“ Adolf Hitler (Carl Amery) war überzeugt, dass das Gewissen
„eine jüdische Erfindung“ sei. – Ich möchte – wie Heinrich Heine – nicht
erwähnen, dass man den Juden das Gewissen selbst verdankt, da leider noch
wenig Gebrauch davon gemacht worden ist. (Auch von den Juden nicht,
wie kaum betont werden muss.)
Morton D. Kogut
Answers
I'd respond to the questions in the order that they appear on the question
page:
I.
l. Yes, l do, but not one that is intellectually grounded upon Jewish
doctrines of revelation.
2. Traditional anti-Semitic attitudes are, of course, a negative factor, but
far from fatal. Unless victimized by acts of physical violence, Jewish
intellectuals should continue to function without whimpering or complaining. Only this approach will command respect for valid ideas and
the persons presenting them. Neither attitudes nor respect can be leg-
Umfrage
isolated.
3. In my view, too many Jaws are disturbed by the fact that most nonJews disUke them. This often produces ideadonal inhibirion and general
inumidation, perhaps nurtured by an unconscious urge to ingratiate.
II. l. Philosophy can incorporate tradioonal religious ideas, including
judgements about the existence or role of God, äs long äs it relies exclusively on the evidence of feason and experience. Howeyer, whenever
articies of faith or divine revelation enter the fray as pnmises, we've
moved from philosophy into sacred theology. This implies that (with a
few exceprions) the main philosophical stream has been secular.
2. My answer to this question depends upon one's definition of "Jewish
Philosophy." Does it mean:
a) Philosophers who are ethnic Jews, but whose writings either
scorn or ignore the claims of Jewish sacred truth — e.g., Spinoza,
Marx, Bergson — or
b) Philosophers who attempt to use reason and evidence about Torah-related themes? In this category l would place Philo, Maimonides, Saadya Goan, Halevi, Buber, and quite a few others in the
Kabbalistic stream.
III. l. l think that the very presentation of this question suggests a false
view of the historical relationship of past and present. Tradirional philosophy is much more than the thoughts of our dead processors. It has
established not only our issues of concern, but methodologies and ruies
of evidence. For this reason, it must be reformed dialectically, and not
by deconstrucrionist assault. The latter leads to a quasi-comical anarchy
of ideas.
2. As l have already implied, l have little regard for rabbinical contributions to pure philosophy. Since rabbis regard the absolute truth of the
Torah as unchallengeable, any attempt at inquiry leads to question begging treadmill.
As for Kabbalistic writings, they are fascinating as literature, not rational
thoughts.
Umfrage
Daniel Krochmalnik
Jüdische Philosophie – Gestern
und Morgen
Für die ungeheuren Leistungen von Juden auf allen Gebieten der deutschsprachigen Kultur und Wissenschaft, insbesondere auf dem der Philosophie
zu Beginn des vorigen Jahrhunderts gab es eine Reihe von unwiederbringlichen Rahmenbedingungen, von denen ich nur zwei in Erinnerung rufen
will: Trotz der fortschreitenden Nationalisierung der deutschen Judenheit
seit dem Ende des 18. Jahrhunderts blieb die mittelalterliche Einheit des
aschkenasischen Judentums (was ja eigentlich „deutsches Judentum“ heißt) in
Mittel- und Osteuropa in manchen Hinsichten in den folgenden beiden
Jahrhunderten noch erhalten – zum Beispiel in sprachlicher Hinsicht. Jiddisch war im Westen des Zarenreichs und im Osten des Kaiserreichs und
der Donaumonarchie die Sprache der Judengasse, wie der Talmudakademie.
„Vertaitschen“, „verdeutschen“ bedeutet auf jiddisch so viel wie „erklären“
– man machte sich die Sachen auf Deutsch deutlich. Zudem schritt zu Beginn des 19. Jahrhunderts getragen von deutschen Normal-Schulen die
Germanisierung auch im jüdischen Schtetl Mittelosteuropas voran. – Die
moderne Wissenschaft des Judentums ist entgegen gängiger Vorstellung und
nach dem Eingeständnis ihres Gründervaters Leopold Zunz nicht in Berlin,
sondern im Gefolge der deutschsprachigen Aufklärung in Ostgalizien entstanden. Zunehmend wanderten im Laufe des 19. Jahrhunderts, in den Idealen der Schriftgelehrsamkeit erzogene, bildungshungrige junge Juden aus
den unterentwickelten und zunehmend judenfeindlichen jüdischen Siedlungsgebieten im Osten und den östlichen Grenzgebieten in die deutschsprachigen Universitätsstädte.
Wir wollen nur einige Beispiele aus der modernen jüdischen Philosophie für
diese Ost-West-Wanderung der jüdischen Intelligentia nennen. Als erstes
prominentes Beispiel könnten wir Salomon Maimon anführen, der seinen
Weg in seiner Lebensgeschichte sehr anschaulich beschrieben hat und als letztes Beispiel, Emmanuel Lévinas. Aber auch in den Lebensgeschichten von
Umfrage
Edmund Husserl, Edith Stein und Hannah Arendt u. a. findet diese zentripetale Bewegung von der Peripherie in die Zentren statt. Das Ostjudentum
stellte für das mitteleuropäische Judentum vor dem 2. Weltkrieg ein weites
Hinterland und ein scheinbar unerschöpfliches Reservoir von Talenten aller
Art dar, die von den deutschen Bildungsstätten mit Weltruf wie durch
Magnete angezogen wurden. In der Regel ging die Ost-West-Migration mit
Traditionsverlust und Assimilation einher: Husserl wurde Protestant, seine
Schülerin Stein Katholikin und Arendt promovierte bei dem protestantischen Theologen Bultmann über den Kirchenvater Augustinus. Dieser Weg
von Ost nach West war aber keine Einbahnstraße: Junge assimilierte Juden
lernen in Osteuropa, etwa in der Etappe der Ostfront im 1. Weltkrieg ein
sozial kompaktes und religiös intaktes Judentum kennen und werden durch
ihr Ostjudentum-Erlebnis zur religiösen Dissimilation angeregt. In diesem
Zusammenhang wären etwa die bekannten Namen Martin Buber und Franz
Rosenzweig zu nennen. Aber auch solche allgemein weniger bekannten
modernen jüdischen Denker osteuropäischen Ursprungs, wie Abraham Jehoschua Heschel, Josef Dow Soloweitschik, Jeschajahu Leibowitz (hier wäre auch wieder Lévinas anzuführen), die nach dem zweiten Weltkrieg in ihren Zufluchtsländern die wichtigsten jüdischen Denker waren und in ihrem
Philosophiestudium in Deutschland an Philosophen jüdischen Ursprungs,
wie Max Scheler, Hermann Cohen und Edmund Husserl angeknüpft hatten, ließen ihr jüdisches Erbe nicht einfach hinter sich, sondern betrachten
es als einen würdigen Gegenstand philosophischer Reflexion. Der deutsche
Antisemitismus, der sich zunächst gegen die Ostjuden richtete, hat schließlich das Ostjudentum fast vollständig ausgemerzt. Eine so glücklichunglückliche Konstellation wie zwischen Ost- und Westjudentum am Ende
des vorletzten und am Anfang des letzten Jahrhunderts wird es in den
deutschsprachigen Ländern nie mehr geben.
In diesem Zusammenhang muß auch eine zweite, eher negative Rahmenbedingung für die besondere Art der geistigen Kreativität des deutschsprachigen Judentums in diesem Zeitraum erwähnt werden. Anders als im russischen Reich, wo vor dem 1. Weltkrieg die Masse der Juden wohnte, wurden
die Juden in Mitteleuropa nicht durch einen numerus clausus von den höheren Bildungseinrichtungen ferngehalten, sie wurden aber auch nicht wie
in Westeuropa ohne weiteres zur höheren akademischen Laufbahnen zugelassen. Trotz formeller Gleichstellung blieb die jüdische Zugehörigkeit bis
Umfrage
in die Weimarer Republik ein unsichtbares Karrierehindernis. Das zeigte sich
schon bei dem ersten modernen deutschjüdischen Philosophen Moses
Mendelssohn. Ihm verweigerte Friedrich II. 1771 die Bestätigung als ordentliches Mitglied in der Klasse für spekulative Philosophie in der preußischen Akademie der Wissenschaften. Trotz der Emanzipation der Juden in
Preußen (1812) war die Taufe im Zeitalter der Restauration das unumgängliche „Eintrittsbillett“ zur Universität. So mußte der Hegelschüler und
Rechtsphilosoph Eduard Gans, wie Heinrich Heine es ausdrückte, „zu
Kreuz kriechen“, ehe er 1826 zum außerordentlichen Professor der juristischen Fakultät in Berlin ernannt wurde. Das gleiche war selbstverständlich
auch in Österreich, wo Joseph II. bereits 1781 ein Toleranzedikt erlassen
hatte, ungeschriebenes Gesetz. Edmund Husserl mußte für seine akademische Karriere 1886 sein Gewissensopfer bringen und wurde im katholischen Land – immerhin Protestant. Hermann Cohen war (seit 1876) der
einzige jüdische Lehrstuhlinhaber für Philosophie im Kaiserreich bis 1919.
Bei vielen konnte aber nicht einmal das Taufwasser den „gelben Fleck“ abwaschen (H. Cohen an P. Natorp, 29.11.1916). So etwa in dem tragischen Fall
von Georg Simmel. Sein von M. Weber, Windelband, Rickert und Jellinek
befürworteter Ruf nach Heidelberg wurde 1908 durch ein rassistisches Gutachten von D. Schäfer zu Fall gebracht: „Ob Prof. Simmel getauft ist oder
nicht,“ schreibt er, „weiß ich nicht, habe es auch nicht erfragen wollen. Er
ist aber Israelit durch und durch, in seiner äußeren Erscheinung, in seinem
Auftreten, in seiner Geistesart“.
Auch die weltberühmten Vertreter der deutschen Wissenschaft des Judentums waren nie an deutschen Universitäten, sondern in Rabbinerseminaren
in Berlin und Breslau angesiedelt. Die breite Masse der jüdischen Intelligenzija gehörte der Klasse der „sozial freischwebenden Intellektuellen“ (Karl
Mannheim) an. Wie Michael Löwy (Erlösung und Utopie. Jüdischer Messianismus und libertäres Denken. Eine Wahlverwandschaft, 1997) und jüngst
wieder Enzo Traverso (Auschwitz denken. Die Intellektuellen und die Shoah, 2000) gezeigt haben, kompensierten sie ihre soziale Dystopie entweder
durch eine übertriebene patriotische Eutopie wie Cohen und Simmel oder
durch revolutionäre Utopie, wie der Cohen-Schüler Kurt Eisner, Gustav Landauer und Ernst Bloch u.a. Sie waren in der Weimarer Republik an allen
philosophischen, wissenschaftlichen, literarischen, künstlerischen und politischen Avantgarden an vorderster Front beteiligt. Ihre exzentrische Positi-
Umfrage
onalität sicherte ihnen einen privilegierten Beobachtungsstand, von dem aus
sie als „Fremde“ (G. Simmel) die Entfremdungserscheinungen der Gegenwart besser durchschauen und als „Feuermelder“ (W. Benjamin) die politischen Katastrophen mit prophetischer Hellsicht voraussehen konnten.
Auch diese unglücklich-glückliche Konstellation ist unwiederbringlich verloren und man kann sich, wie Gershom Scholem in einem Brief an Walter
Benjamin von Februar 1940 fragen: „wie würde ein Europa nach der Ausscheidung der Juden aussehen?“. Jedenfalls wird das deutsche, das europäische und das universale Denken noch auf lange hinaus von der Erbschaft
dieser jüdischen Nonkonformisten zehren.
Im grundlegenden jüdischen Gesetzeskodex, der Mischna heißt es: „Mit dem
Tode (MiSchäMät) des R. Akiwa schwand die Herrlichkeit der Tora ... Mit
dem Tode des Rabban Jochanan Ben Sakkais, schwand der Glanz der
Weisheit etc.“ (Sota IX, 14). Dieser Satz stammt aus dem 2. Jahrhundert
nach den vernichtenden Niederlagen der Juden gegen die Weltmacht Rom.
Seither hat man das Studium der Tora und die jüdische Weisheit schon oft
tot gesagt; doch nach jeder Katastrophe sind sie an anderen Orten wieder
auferstanden. Ein quantitatives Argument dagegen ist nicht stichhaltig,
denn die heutigen jüdischen Gemeinden in Deutschland, etwa in Mainz,
Augsburg und Regensburg sind nicht kleiner als ihre mittelalterlichen Vorläufer, die das aschkenasische Judentum, ja das Judentum insgesamt doch
unauslöschlich geprägt haben. Wenn wir zudem den Renouveau juif in
Deutschland und Frankreich in diesem Jahrhundert studieren, dann sehen
wir, daß es immer einzelne charismatische Persönlichkeiten waren, die eine
Ausstrahlung auf Generationen von Schülern hatten. So übte etwa der
Frankfurter Rabbiner Nechemia Nobel aus Frankfurt, der über Schopenhauer promoviert hatte, einen starken Einfluß auf wichtige Vertreter der
Frankfurter Schule, wie Leo Löwenthal, Siegfried Kracauer und Erich
Fromm aus. Plötzlich werden in ihrem Denken religiöse Begriffe wie Messias und Bilderverbot wieder aktuell, die ihnen aus ihrer areligiösen oder
manchmal ausgesprochen antireligiösen Erziehung kaum vertraut gewesen
sein dürften. Ähnlich intensiv war die Ausstrahlung Jakob Gordins, der aus
Rußland stammte und in Berlin über Hermann Cohen promoviert hatte, auf
junge jüdische Widerstandskämpfer während der deutschen Besatzung in
Frankreich. Er hat die geistige Atmosphäre vorbereitet, in der Emmanuel
Lévinas nach der Befreiung wirkte und jüdische Linksintellektuelle aus dem
Umfrage
Umkreis von Jean Paul Sartre, wie Arlette Elkaim Sartre, Benny Lévy, Bernard-Hery Lévy und Alain Finkielkraut Anfang der 80er Jahre im Anschluß
an Lévinas die jüdischen Quellen wieder entdeckten.
Trotz dieses Gesetzes von den kleinen Ursachen und großen Wirkungen,
wonach im Reich des Geistes ein großes Licht tausend kleinere anzünden
kann, müssen zumindest Kerzen vorrätig sein. Auch nach dem Krieg gab es
jüdische Denker im deutschsprachigen Raum; doch konnten sie unter Juden
kaum Schule machen. Die jüdischen Zentren in Mittel- und Osteuropa sind
in Bezug auf die jüdische Gelehrsamkeit heute und auf lange Zeit
Randbezirke geworden. Nach dem historischen Gesetz vom wandernden
Gravitationszentrum des Judentums hat sich der geistige Schwerpunkt der
jüdischen Diaspora nach Israel und Amerika verlagert. Wenn wir die
langfristige Bewegung dieses Zentrums beobachten, dann zeigt sich, daß es
sich in der islamischen Welt vom Osten nach Westen, von Babylon und
Palästina nach Spanien und in der christlichen Welt von Westen nach
Osten, von Frankreich nach Polen verschiebt. Mit der Rückkehr des
Judentums nach Palästina in diesem Jahrhundert bekommt das jüdische
Denken eine völlig neue Ausgangsbasis. Zum ersten Mal seit zweitausend
Jahren unterliegt es nicht mehr den Bedingungen des Exils, mit seinen
fremdbestimmten Lebensverhältnissen und mit seiner verzerrenden Fremdund Selbstwahrnehmung. Die geistigen Kräfte der Juden zerstreuen sich
nicht in allen Richtungen des nichtjüdischen Lebens, sondern entspringen
einem freien jüdischen Leben und beziehen sich darauf zurück.
Auch das untergegangene Ostjudentum ist in Israel und Amerika gleichsam
wieder auferstanden. In Israel gibt es zahlreiche Talmudakademien und
chassidische Höfe, die die osteuropäischen Namen ihrer Herkunftsorte tragen (Brisk, Mir, Slabodka, Belz usw.) und noch niemals waren sie so stark
frequentiert wie heute. Ja sogar die osteuropäische Kleidermode und die
jiddische Sprache ist in diesen Einrichtungen üblich. Die jüdische Tradition
überbrückt damit den tiefen Bruch der Katastrophe und stellt der Welt ungeniert ihre geistigen Schätze vor. Nicht weniger als drei große englischsprachige Talmudausgaben, z. T. mit erschöpfenden Kommentaren, werden
derzeit ediert. Welche Zukunft freilich die jüdische Religionsphilosophie in
Israel, die in der Vergangenheit oft einen apologetischen Zweck erfüllte,
haben wird, muß hier dahingestellt bleiben. Philosophische Reflexionen auf
der Höhe des Quellenstudiums finden sich bezeichnenderweise eher in der
Umfrage
Diaspora als in Israel. Die wenigen namhaften israelischen Philosophen
verarbeiten meistens nur das europäische Erbe, sind eher Philosophiehistoriker als orginelle jüdische Philosophen.
Im 5. Buch Mose sagt der Prophet Mose: „Seht, ich habe euch Gesetze und
Rechtsvorschriften gelehrt (...). Beobachtet sie und übt sie aus, denn das ist
eure Weisheit und Klugheit auch in den Augen der Völker; wenn sie alle
diese Gesetze hören, dann werden sie sagen: fürwahr ein weises und kluges
Volk ist diese große Nation“ (4,5-7). Daraus schließt Moses Maimonides in
seinem Führer der Verirrten, daß das jüdische Gesetz keine arbiträre Ordnung
ist (III, 31), sondern, recht verstanden, mit der Philosophie identisch sein
muß (II,11). Für ihn handelte es sich dabei nicht um eine besondere „jüdische“, sondern um die allgemeine Weisheit. Ausdrücklich fordert er in seinem Kommentar zu den Weisheits-Sprüchen der Synagogenväter: „Höre die
Wahrheit von jedem, der sie sagt!“ (arab.: WaIsma LCHaq MiMan Qaluhu, hebr.:
USchma HaEmet MiMi SchäAmra). Wir dürfen nicht vergessen, daß die
berühmte Antithese "Quid ergo Athenis et Hierosolymis?“, (Was hat Athen mit
Jerusalem zu schaffen?) nicht vollständig ist, und mit der Frage schließt:
„Was die Akademie mit der Kirche?“ (De praescr. Haeret. 7, 9). Sie stammt
von Tertullian, einem christlichen Apologeten, der zugleich der Archeget
der lateinischen Adversus-Judaeos-Literatur war. Wenn er von Jerusalem
sprach, dann hatte er die den Juden verbotene, römische Aelia Capitolina
vor Augen und er redete mit seinen Paradoxien nicht Zion, sondern ausdrücklich Golgatha das Wort. Die jüdischen Weisen (Chachamim) haben die
Tora dagegen stets als Weisheit für die Welt, als Weltweisheit verstanden,
und nicht als „Credo quia absurdum“ (Tertullian, De carne Christi 5).
Nichtsdestotrotz gibt die Tora der Vernunft Inhalte zu denken, die sich die
griechische Schulweisheit so leicht nicht hätte träumen lassen. Sie verlangt
den Kosmos und den Anthropos von der Schöpfung her zu denken (Genesis), die Polis von der Sklavenbefreiung und Offenbarung her (Exodus), den
Nomos von der Heiligung und Nachahmung Gottes her (Leviticus), die
Historia von der zielgerichteten Vorsehung und Erlösung her (Numeri) und
das Theion, das Göttliche vom transzendenten, personalen Gott her (Deuteronomium).
Wenn wir das europäische Denken nicht nur als Erbe des griechischen, sondern auch der biblischen Denkaufgaben verstehen, dann sind Namen wie
Philon, Maimonides, Spinoza, Mendelssohn, Cohen, Buber und Rosen-
Umfrage
zweig nicht nur irgendwelche Philosophen jüdischer Herkunft, sondern
Schlüsselfiguren der europäischen Geistesgeschichte: Philon hat erstmals
die biblische Botschaft in die Begriffe der platonisch-stoischen Philosophie
übersetzt und damit der christlichen Patristik den Weg gewiesen und Maimonides hat sie in aristotelisch-neuplatonischen Begriffe ausgedrückt und
damit der christlichen Scholastik den Weg geebnet. Spinoza hat dagegen die
Bibel und Philosophie vollständig getrennt und damit sowohl die historisch-kritische Bibelwissenschaft begründet, wie die Emanzipation der Philosophie und Naturwissenschaft von der Offenbarung erstmals in der Neuzeit radikal vollzogen, Mendelssohn hat vor dem leibnizianischen, Krochmal vor dem hegelianischen, Cohen vor dem neukantianischen, Buber und
Rosenzweig vor dem nietzscheanischen und kierkegaardschen Hintergrund
die biblische Botschaft in ihrer jüdischen Auslegung behauptet. Hierbei
handelt es sich nicht um müßige apologetische Übungen, sondern um den
Versuch, die beiden Hauptquellen des europäischen Denkens zu verbinden.
Jüdische Philosophie war und ist also nicht nur ein jüdisches Geschäft,
sondern ein unverzichtbarer Beitrag zum europäischen Denken.
Gewiß, für viele zeitgenössische jüdischen Philosophen stand nicht mehr
das ihnen weitgehend fremd gewordene Judentum im Mittelpunkt des
Denkens, wohl aber das Judesein. Für sie war die persönliche Erfahrung der
rassistischen Stigmatisierung als Juden auch ein entscheidender philosophischer Denkanstoß. Aber für Denker, wie Theodor W. Adorno, Hanna Arendt, Günther Anders und Hans Jonas ist „Auschwitz“ keine speziell jüdische Erfahrung, sondern ein Menetekel für die ganze Menschheit. Stigmatisierung, Diskriminierung, Exilierung, Eliminierung droht in unserem
Jahrhundert allen Menschen; die Menschheit blutet, wie Lévinas einmal sagte, durch jüdische Wunden. – Angesichts der verschärften Exils-Erfahrung
im 2. Weltkrieg verfängt die optimistische Aufhebung der chronischen
Dystopie in die Utopie nicht mehr, sondern wird, wenn man so will, in einer vollständigen Atopie überboten. Jüdische Denker, wie Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida, Jean-Francois Lyotard vollziehen wie zuvor schon
Adorno ihre radikale Revision des abendländischen Denkens mit negativen
„Begriffen“ der Alterität, wie „L‘autre“, die „differance“, „Le différend“.
Die an uns gestellte Frage der Redaktion des Widerspruch: „Haben die Bemühungen, die aus der mit (dem Holocaust und der Rückbesinnung auf das
Judentum) einhergehenden Auseinandersetzung mit den europäischen
Umfrage
Denkmustern hervorgegangen sind, die Gegenwartsphilosophie Ihrer Meinung nach insgesamt befruchtet oder eher gelähmt?“ ist wohl eher eine Geschmacksfrage. Sicher aber ist, dass modernes und postmodernes Denken
ohne diese Bemühungen undenkbar wäre.
Umfrage
Friedrich Niewöhner
Jüdische Philosophie –
Versuch einer Begriffsbestimmung
Wie ist der Begriff "Philosophie" mit einem Adjektiv „jüdisch“ zu verbinden, das nicht selbstverständlich zur Philosophie hinzuzugehören scheint,
das als in einem Spannungsverhältnis zur Philosophie angesehen werden
kann, und das die Philosophie vielleicht verändert, ihr Grenzen setzt?
Um es gleich vorweg zu sagen: es gibt nur eine Vernunft, die allgemeine
Menschenvernunft. Es gibt weder eine spezifisch jüdische oder islamische
oder christliche Vernunft; auch kein spezifisch islamisches, christliches oder
jüdisches Denken mit je eigenen Rationalitätsstandards.
Was für einen Sinn hat es dann aber, von einer "jüdischen Philosophie" zu
sprechen? Warum bezeichnen erstmals Leopold Zunz (1818) und Salomon
Munk (1849) im 19. Jahrhundert die Reflexionen der Juden im Mittelalter
als "jüdische Philosophie"?
Versuch einer Bestimmung:
1. Wenn ein Jude philosophiert, dann ist das nicht notwendig eine jüdische
Philosophie. Beispiele: Baruch de Spinozas "Ethik", Karl Marx' "Das Kapital", Edmund Husserls "Ideen zu einer reinen Phänomenologie".
2. Wenn ein Jude (oder ein Christ, Muslim, Atheist) über Moses Maimonides
oder Jehuda Halevi schreibt, dann ist das nicht notwendig eine jüdische
Philosophie. So etwas wäre eher zu subsumieren unter "Geschichte" der
Philosophie (wobei noch offen bleiben muß, ob Maimonides oder Halevi
als Philosophen bezeichnet werden können).
3. Wenn ein Christ (oder ein Muslim oder ein Atheist) über das Judentum reflektiert, dann ist das noch keine jüdische Philosophie. In diesem Fall sollte
man eher von Religionsphilosophie oder Religionsphänomenologie sprechen.
4. Wenn jedoch ein Jude über das Judentum als solches mit der allgemeinen Menschenvernunft reflektiert, dann ist das jüdische Philosophie. Jüdische Philoso-
Umfrage
phie ist "Philosophie des Judentums" (Julius Guttmann), wobei "des Judentums" sowohl genitivus objectivus als auch genitivus subjectivus ist.
Begründung:
Es ist Philosophie, weil die Reflexion mit der allgemeinen Menschenvernunft
durchgeführt wird. Philosophie ist immer auch ein Nachdenken über uns
selbst und über unsere Herkunft.
Es ist jüdische Philosophie, weil das Judentum als solches von einem "Juden"
reflektiert wird, er über seine Herkunft nachdenkt, über die Gemeinschaft
reflektiert, zu welcher er gehört.
Was ist der Unterschied zwischen der Reflexion eines Juden über das Judentum und der Reflexion eines Christen über das Christentum?
Ein Jude kann über das Judentum mit der allgemeinen Menschenvernunft
reflektieren, denn er braucht nicht gläubig (fromm, mosaischen Glaubens)
zu sein. Er ist auch dann Jude, wenn er Atheist, Nietzscheaner, Kantianer
oder Anarchist ist. Jude sein heißt nicht, Anhänger der mosaischen Religion
zu sein, sondern Sohn einer jüdischen Mutter und so zu einer Gemeinschaft
gehörend.
Ein Christ jedoch, wenn er wirklich ein gläubiger Christ ist, kann über das
Christentum nur in religiösen Kategorien reflektieren, denn "der Glaube ist
höher als alle Vernunft". Das ist Theologie, aber keine christliche Philosophie.
Es kann keine "christliche Philosophie" geben (Martin Luther, Karl Barth).
Das heißt: nur ein Jude, der nicht gläubig ist, der sich aber dennoch zum Judentum als "seiner" Gemeinschaft bekennt, kann mit der allgemeinen Menschenvernunft über das Judentum reflektieren.
Was ist der Unterschied zwischen einem Juden, der nicht gläubig ist und
der über das Judentum reflektiert, und einem Christ, der nicht gläubig ist
und über das Christentum reflektiert?
Ein Christ, der nicht gläubig ist, ist kein Christ mehr – ein Jude, der nicht
gläubig ist, ist dennoch ein Jude.
Begründung:
Aus dem Judentum kann man nicht austreten; man bleibt auch dann noch
ein Jude, wenn man mit der allgemeinen Menschenvernunft philosophiert.
Umfrage
D. h.: jüdische Philosophie ist die Philosophie von einem Juden, der mit der
allgemeinen Menschenvernunft das Judentum (als Religion oder Ethnizität)
reflektiert.
Das aber heißt nun zweierlei:
1. Jüdische Philosophie ist immer eine Philosophie von einem Denker, die
ihn selbst angeht und notwendig ist, weil sie sich mit der Herkunft des
Denkers, die er nicht abschütteln kann, auseinandersetzt.
2. Jüdische Philosophie hat es immer zu tun mit dem Spannungsverhältnis
zwischen allgemeiner Menschenvernunft und dem partikularen Judentum
(als Religion oder Ethnizität).
Weiterhin geschieht jüdisches Philosophieren immer in einer extremen Situation: im Exil, in einer die jüdische Tradition gefährdenden nicht-jüdischen
Umwelt und in Auseinandersetzung mit nicht-jüdischen Gedanken, Glaubenssätzen und Philosophemen.
Beispiele: Moses Maimonides' "Führer der Unschlüssigen" (in Auseinandersetzung mit dem Islam); Moses Mendelssohns "Jerusalem oder über die religiöse Macht und Judentum" (in Auseinandersetzung mit dem Christentum); Leo Strauss' "Philosophie und Gesetz" (in Auseinandersetzung mit
der Aufklärung).
Wo dieses Spannungsverhältnis verneint wird, sollte man nicht von jüdischer Philosophie sprechen, sondern von Theologie.
Beispiele: Jehuda Halevis "Kuzari"; Franz Rosenzweigs "Stern der Erlösung";
Hermann Cohens "Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums";
rabbinisches Denken.
Ergebnis:
Ist jüdische Philosophie die Philosophie eines Juden, der über das Judentum (als Religion oder Ethnizität) mit der allgemeinen Menschenvernunft
reflektiert, weil diese Reflexion ihn notwendig angehen muß, dann wird ersichtlich, warum die jüdische Philosophie die allgemeine Gegenwartsphilosophie befruchten kann:
Das Verhältnis und die Spannung von Partikularität und Universalität,
Glauben und Wissen, Besonderem und Allgemeinen, Religion und Philosophie, Gesetz und Freiheit, Individualität und Objektivität etc. wird nirgendwo so radikal befragt wie in der jüdischen Philosophie, weil nur der jüdische Philosoph diese Fragen wegen seiner Herkunft stellen muß.
Umfrage
Jüdische Philosophie ist zwar eine Reflexion auf das Judentum, sie kann aber nicht von ihren Ergebnissen her bewertet werden. Da sie in Theologie
umschlägt, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, daß die Wahrheit allein bei
den Rabbinern zu finden sei (wie bei Halevi), ist jüdische Philosophie nur
dann gegeben, wenn die Spannungsverhältnisse nicht aufgelöst und nicht
harmonisiert werden (wie z. B. bei Maimonides und Leo Strauss).
Das wiederum hat zur Folge:
Da jüdische Philosophie mit der allgemeinen Menschenvernunft reflektiert,
muß sie notwendigerweise immer eine kritische Philosophie sein, kritisch gegen die Religion, Ethnizität, Partikularität, den Glauben etc. Als kritische
Philosophie ist sie gegen jeden Dogmatismus.
Diese Begriffe und Problemkomplexe beschreiben die Herkunft des jüdischen Philosophen, nicht seine Zukunft. Diese wird entworfen mit der allgemeinen Menschenvernunft, obwohl dieser Philosoph immer auch Jude
bleiben wird.
Zur Geschichte des Begriffs "Jüdische Philosophie":
1. F. Niewöhner: Vorüberlegungen zu einem Stichwort: "Philosophie, jüdische". In: Archiv für Begriffsgeschichte, Band 24, Bonn 1980, S. 195-220.
2. F. Niewöhner: Philosophie, jüdische. In: Historisches Wörterbuch der
Philosophie, Band 7, Basel 1989, Spalten 900-904.
Werner Stegmaier
Von Juden lernen
In Deutschland kann man nach wie vor nicht unbefangen sein gegenüber
allem, was als "jüdisch" gekennzeichnet wird. In Fragen des "Jüdischen" ist
Objektivität kaum möglich. Es ist zu viel Schlimmes geschehen, und es
kann noch Schlimmeres geschehen, und kein Urteil, so "objektiv" es sich
Umfrage
gegeben haben mag, war daran ganz unschuldig und wird daran ganz unschuldig gewesen sein. Alles "Jüdische" wirft in Deutschland unmittelbar
Fragen der "Schuld" auf. Jedoch nicht nur in Deutschland. Als der amerikanische Jude Daniel Jonah Goldhagen so weit ging, Deutschland mit einem
spezifisch "eliminatorischen" Antisemitismus lange vor der Naziherrschaft
zu belasten, löste er entgegen seiner Absicht eine Debatte über Schuld gegenüber den Juden auch im übrigen Europa aus. Sie ließ seither selbst die
Länder nicht aus, die am schlimmsten unter der Naziherrschaft zu leiden
hatten. Zuletzt hat sie Polen erschüttert. Die Schuld gegenüber den Juden
gewann eine europäische Dimension. Nun stand und steht Europa in Frage,
Europa mit seiner "jüdisch-christlichen" Tradition, die in der Moderne zu
einer "humanistischen" geworden und mitten im 20. Jahrhundert mitten in
einem seiner humanistischsten Länder völlig entgleist war, in dem Land, das
man als "Land der Dichter und Denker" gerühmt hatte. Die Verbrechen im
Namen Deutschlands sind dadurch in nichts "entschuldigt". Ihre zu lange
und zum Teil wissentliche Duldung durch das übrige Europa und durch die
USA werfen dennoch Fragen nach dem europäischen Humanismus als solchem auf und dem Denken, das ihn trägt. Es könnte 1933 bis 1945 nicht
nur versagt, es könnte selbst zu Totalitarismus und Judenvernichtung beigetragen haben.
Es könnte dazu beigetragen haben, weil es sich für "objektiv" hielt. Der Anspruch auf "Objektivität" ist der Anspruch, über "Objekte" Aussagen machen zu können, die jeder mit "Vernunft" Begabte teilen muß. Aus Vernunft objektiv zu urteilen, ist das Ethos des europäischen Humanismus.
Ihm entsprang die europäische Wissenschaft ebenso wie der europäische
Rechtsstaat, im Blick auf beides weiß sich Europa allem anderen Denken in
der Welt überlegen, an ihm mißt es das Denken und Leben der übrigen
Welt. Die USA, die sich als die wahren Erben des europäischen Humanismus betrachten, ordnen von ihm aus die Welt, wenn es ihnen notwendig erscheint, unter Einsatz militärischer Macht. Auch wenn der westliche Humanismus auf Vernunft, nicht auf Macht beruhen soll, kann in seinem Namen doch Macht ausgeübt und durch ihn gerechtfertigt werden.
Friedrich Nietzsche hat der Redlichkeit dieses Humanismus nicht mehr getraut. Er hat ihn als eine unter anderen "Moralen" gesehen, die, wie alle anderen Moralen auch, "zur Macht wollen". Dennoch war diese Moral für ihn
eine besondere. Mit ihrem Anspruch auf Objektivität habe sie die Redlich-
Umfrage
keit zur obersten Tugend gemacht und über Jahrtausende hinweg zu ihr erzogen. Nun zwinge sie ihre Redlichkeit, den letzten Schluß zu ziehen und
sich auch selbst als Wille zur Macht zu sehen. Unter dem Gesichtspunkt der
Macht bedeutet der Anspruch auf Objektivität, so auf der Rede von Objekten zu bestehen, daß jedem, der sich ihr nicht anschließt, Vernunft abgesprochen wird. Im Namen der Objektivität aus Vernunft lassen sich vernünftige Menschen von unvernünftigen, rationales von irrationalem Denken trennen. Die ebenfalls Jahrtausende alte jüdisch-talmudische Tradition
der Auslegung der Tora erschien der europäischen Philosophie und Wissenschaft im wesentlichen irrational. Sofern die Juden dem von ihr definierten Anspruch auf Objektivität aus Vernunft nicht folgen wollten, hätten sie
sich selbst aus dem Humanismus ausgeschlossen. Sie standen damit jedem
Verdacht offen.
Nietzsche hat die Juden und Europa stets zusammengesehen. Er griff "das
Christentum" dafür an, daß es seine jüdischen Ursprünge mit Hilfe griechischer Begriffe zu einer selbstgerechten Moral verfestigt habe, und "die Juden", weil sie – damals – das Christentum hervorgebracht hätten. Zugleich
aber erwartete er von den - nun über ganz Europa zerstreuten - Juden für
die Zukunft ein besseres, ein "gutes" Europa. Hannah Arendt hat in ihren
„Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft“ (München 1986, 71 f.) zu
den "wenigen Europäern", die um den "gesamteuropäischen Aspekt der Judenfrage" wußten, gerade Nietzsche gezählt, "dessen so vielfach mißverstandene Bemerkungen zur Judenfrage durchweg der Sorge um das ‚gute
Europäertum’ entspringen und dessen Einschätzung der Juden im Geistesleben seiner Zeit daher so erstaunlich gerecht ist, frei von Ressentiment,
Schwärmerei und billigem Philosemitismus". "Gut" konnte Europa für
Nietzsche werden, wenn es lernte, seine Moral und seine "moralische Ontologie" von andern her zu perspektivieren und damit auch diesen anderen
Moralen und Seinslehren gerecht zu werden, ihnen nicht mehr – nach Mt.
5, 39 – als einem "Bösen" zu "widerstehen". "Gute Europäer" konnten darum gerade "die Juden" sein: zum einen, weil sie keinen Nationalismus
brauchten, um ein Volk zu sein, und keinen Sozialismus, um Gerechtigkeit
zu lernen, und in der Diaspora zu beidem in Distanz geblieben waren, zum
andern, weil sie, wichtiger noch, von Anfang an anders als griechischchristlich zu denken und immer wieder umzudenken gelernt hatten. Sie waren über Jahrtausende Juden geblieben, hatten es, unter der Feindschaft ge-
Umfrage
gen ihr Denken und die Lebensformen, die sich um es bildeten, selbst gegen ihren Willen bleiben müssen, und ihre bürgerliche Emanzipation hatte
zu einem neuen Antisemitismus geführt, mit dem sie sich neu auseinandersetzen mußten. Wenn sie in den Anfängen Europas die Kraft zu einer "radikalen Umwerthung" der damals herrschenden Werte hatten, so konnten
sie auch jetzt, so Nietzsche, in den Zeiten des Zweifels und der Verzweiflung an den "obersten Werthen" Europas, am ehesten zu einer neuen Umwertung fähig sein. Wie kein Volk sonst hatten sie in ihrem Leben unter
andern Völkern lernen müssen, Macht, soweit sie sie errangen, so besonnen
zu gebrauchen, daß, bei Strafe der Vernichtung, gütliche Verständigung
immer noch möglich blieb.
Was sie nach Nietzsche auszeichnete, war nicht nur ein anderer Umgang
mit Moral, sondern auch und tiefer noch mit der Zeit: Geduld, Ausharren
auch unter ungünstigsten Umständen, Kraft, sich und anderen Zeit zu lassen, Leiden lange hinzunehmen. Im 251. Aphorismus von Jenseits von Gut
und Böse schrieb Nietzsche: Die Juden "verändern sich, wenn sie sich verändern, immer nur so, wie das russische Reich seine Eroberungen macht, – als
ein Reich, das Zeit hat und nicht von Gestern ist –: nämlich nach dem
Grundsatze ‚so langsam als möglich!’“ Das griechisch-christliche Denken
hatte dagegen versucht, die Zeit zu transzendieren, hatte sich jenseits des
Zeitlichen auf ein Zeitloses verpflichtet und sah in ihm das absolute Gültige. Dem folgten alle Unterscheidungen, die es leiteten: Gott und Mensch,
Sein und Werden, Vernunft und Sinnlichkeit, Form und Inhalt, Moral und
Glück, Fortschritt und Gegenwart, Bedeutung und Zeichen, Text und Auslegung. Das Zeitlose war darin stets der Wert, das Zeitliche der Unwert.
Daß das griechisch-christliche Europa so dachte, daß es sich gegen die Zeit
in einem Jenseits der Zeit versichern zu müssen glaubte und seine Moral
darauf gründete, hielt Nietzsche für den Ausdruck einer tiefen Lebensangst,
des Nihilismus.
Er hat sich über das andere "jüdische" Denken als solches nicht näher geäußert, vielleicht aus Unkenntnis, vielleicht aber auch aus Respekt, einem
Respekt, der ihn zurückhielt, es seinerseits zu "objektivieren". Erst hundert
Jahre später und nach der Shoa hat der Jude Emmanuel Lévinas, der aus Litauen stammte und Franzose wurde, von der griechisch-christlichen oder,
wie er sie auch nennt, "westlichen" Tradition aus versucht zu zeigen, wie
Europa von den Juden lernen, wie es sein Denken vom "jüdischen" her in
Umfrage
Frage stellen kann. Viele gingen ihm voraus, vor allem Hermann Cohen und
Franz Rosenzweig. Aber erst nach der Shoa war das Lebensentscheidende
dieses Lernens deutlich. Lévinas sprach ungeschützt vom "jüdischen Denken" (pensée juive) und legte es nicht darauf an, Entsprechungen und Dialoge zwischen ihm und dem griechisch-christlichen Denken zu suchen. Er
dachte von ihrer "Trennung" (séparation) her. Mit einer Radikalität, die er
bei Platon, Descartes, Kant, Nietzsche und neu bei Husserl und Heidegger
erfahren hatte, führte er auf der einen Seite die kritische Tradition der europäischen Philosophie bis dorthin fort, wo sie die jüdische berührte, und
trug, auch in seinen Schriften deutlich getrennt, dieses kritische Denken auf
der andern Seite in die jüdische Tradition der Talmud-Auslegung ein. Das
"westliche" Denken blieb so das westliche und das "jüdische" das jüdische,
aber beide konnten sich selbst in der Berührung mit dem andern vom andern her neu denken. Dies war und ist für beide Seiten schwierig, und Lévinas ging seinen Grenzgang bewußt im Zeichen einer "schwierigen Freiheit".
Er zeigte auf der einen Seite, wie Heidegger, der in der Kritik des Objektivismus in der europäischen Philosophie zuletzt am weitesten gegangen war,
mit seinem Seinsdenken noch immer einer "Neutralität" anhing, die zwar
nicht mehr objektivierbar sein, aber dennoch das Denken aller in Einem
"versammeln" sollte, der "Lichtung des Seins". Heidegger habe damit am
Denken eines Dritten jenseits der Einzelnen festgehalten, das für alle gleich
gültig sein sollte, für das aber eben darum die Einzelnen gleichgültig waren.
Es ist die "Nicht-Gleichgleichgültigkeit" (non-indifférence) der Einzelnen,
die Levinas gegen die "Gleichgültigkeit" des Objektiven, Allgemeinen, Neutralen (indifférence) der europäischen Philosophie geltend macht. In der
jüdisch-talmudischen Tradition waren die Einzelnen niemals gleichgültig. In
der Auslegung der Tora, der unübersehbar vielfältigen und unerschöpflich
bedeutungsvollen Schrift eines Gottes, der auf seiner Unbegreiflichkeit
bestand, waren abschließende Begriffe ausgeschlossen, hatte ein an und für
sich gültiges Allgemeines kein Recht, war Objektivierung Anmaßung. Jedes
Allgemeine war ein Allgemeines, das ein Einzelner auf seine eigene Verantwortung in die Tora hineintrug, um sie zu erschließen, und dem ein anderes
Allgemeines gegenüberstand, das ein anderer auf seine Verantwortung in sie
hineintrug. So ist das Allgemeine niemals an und für sich gültig und der
Einzelne niemals gleichgültig für die Auslegung der Tora, die als Schrift
Gottes Orientierung im ganzen, Orientierung für das Leben im ganzen, die
Umfrage
zen, die für Juden, die auf sie achten, das ganze Leben ist. Um ihre Vielfalt
und Fülle zu erschließen, ist jede einzelne Auslegung von Bedeutung, gerade wenn sie anders ist als die anderen, jede kann die Orientierung erweitern
und erneuern, auch und gerade dann, wenn sie scheinbar ohne Methode
Entlegenes aufeinander bezieht. Im Talmud sind Auslegungen Einzelner,
die die Anerkennung anderer Einzelner und damit Autorität gewonnen haben, in der Regel Auslegungen anderer Einzelner mit Namen gegenübergestellt, und in beider Namen können sich wieder andere Auslegungen anschließen. So wächst ein vielfach verknüpftes Netz von namentlichen Deutungen, das verdichtet werden kann, wo neue Frage entstehen, und wieder
gelöst werden kann, wo Antworten sich überholt haben. Es bleibt in der
Zeit, geht ohne Angst mit der Zeit, ohne sie zu transzendieren.
Wenn die Auslegungen, die immer die Auslegungen Einzelner waren, auch
wenn sie von vielen oder allen angenommen, plausibel werden, dann hat jeder die Auslegung, die er ins Spiel bringt, andern gegenüber zu verantworten. So wird denkbar und plausibel, daß die Einzelnen nicht durch ein Drittes, scheinbar Objektives, sondern allein durch ihre Verantwortung füreinander verbunden sind. Ihre Beziehung ist dann nicht zuerst eine "theoretische", ein gemeinsamer Blick auf Objektives, sondern eine "ethische", der
Blick aufeinander, ins Gesicht des Anderen, das, so Levinas, den theoretischen Zugriff irritiert und als Anmaßung zurückweist. Das Von-Angesichtzu-Angesicht unter Menschen und, in herausragenden Beispielen, unter
Gott und Menschen, beherrscht die Tora, während die "westliche" Philosophie es im wesentlichen übergangen hat. Es ist nach Levinas der Anfang
des Ethischen, das seinerseits allem Theoretischen vorausgeht, des Ethischen als einer Beziehung unter immer anderen, immer anders begegnenden und immer anders zu verstehenden Einzelnen. Die jüdische Tradition
hat nach Levinas diese Gestalt des Ethischen im Denken wach gehalten, eine Gestalt des Ethischen, die alles Allgemeine an die Verantwortung des
Einzelnen bindet und es nicht als Objektives aus ihr entläßt. Sie war so besser gegen Totalitarismus gefeit.
Sie könnte, und das macht sie über die Antwort auf die Shoa hinaus philosophisch aktuell, der alltäglichen Orientierung näher sein als das aus der
"westlichen" philosophischen Tradition Vertraute. In der alltäglichen Orientierung, in der man sich immer neu auf immer neue Situationen einzustellen hat, geht man ohne Angst mit der Zeit um, und man rechnet damit, daß
Umfrage
man es in allen Bereichen, auch in den auf Objektivität drängenden Wissenschaften, mit immer anderen Einzelnen zu tun hat, die zustimmen oder widersprechen können. Die alltägliche Orientierung könnte auch nach wie vor
offener für Religion sein, wenn darunter das Verhältnis zu einem Unbegreiflichen verstanden wird, in dem das Denken immer auch steht, offener,
als es die europäische Philosophie und Wissenschaft wahrhaben will, seit sie
sich im Namen der Aufklärung resolut gegen alle Religion abgegrenzt hat.
Was das für alle gleich gültige Allgemeine unter Menschen dennoch notwendig macht, ist das Recht und mit ihm der Staat, der es durchzusetzen
hat. Levinas und mit ihm Jacques Derrida haben beide konsequent von der
inter-individuellen Beziehung her gedacht als das, was diese Beziehung
wohl überschreitet, sich aber eben darum nicht von ihr lösen darf. Mit dem
Recht im Staat wird Verantwortung über den einen Anderen hinaus für weitere Andere möglich. Es verlangt darum Gleichheit und Allgemeinheit, jedoch nicht Gleichgültigkeit. In jeder richterlichen und jeder politischen und
jeder bürokratischen Entscheidung haben wieder Einzelne für Einzelne
Verantwortung. Wird von dieser Verantwortung abgesehen, werden Menschen als Objekte behandelt, und dies kann ein Anfang von Totalitarismus
sein.
Die Juden in Europa und der ganzen Welt hatten über Jahrtausende ohne
eigenen Staat zu leben. Ihr Denken konnte sich in dieser Zeit in kritischer
Distanz nicht nur zum theoretischen Anspruch auf Objektivität, sondern
auch zur staatlichen Organisation eines Gemeinwillens halten, der, wenn er
entsprechend begabte Führer findet, immer auch entgleisen kann. Die Geschichte hat nach der Shoa zu einem Staat Israel geführt. Er ist sowohl aus
der jüdisch-talmudischen Tradition als auch aus der europäisch-philosophischen Tradition heraus auf weitestgehende Liberalität eingestellt. Unter
den Zwängen der politisch-militärischen Auseinandersetzungen in Palästina
ist er aber auch immer wieder zu harten Machtdemonstrationen übergegangen. Sie drohen nun das andere Denken der jüdischen Tradition erneut zu
diskreditieren.
Einschlägige Veröffentlichungen des Autors:
Nietzsches ‚Genealogie der Moral’. Werkinterpretation, Darmstadt 1994. –
mit D. Krochmalnik (Hg.), Jüdischer Nietzscheanismus, Berlin/New York
1997 (darin: Levinas' Humanismus des anderen Menschen – ein Anti-Nietz-
Umfrage
scheanismus oder Nietzscheanismus?). – Das Gute inmitten des Bösen. Ethische Orientierung aus Zeichen in der jüdischen Tradition. In: J. Simon
(Hg.), Orientierung aus Zeichen. Zeichen und Interpretation III, Frankfurt
am Main 1997. – (Hg.), Die philosophische Aktualität der jüdischen Tradition, Frankfurt am Main 2000 (darin: Philosophie und Judentum nach Emmanuel Levinas). – (Hg.), Europa-Philosophie, Berlin/New York 2000 (darin: Nietzsche, die Juden und Europa). – Emmanuel Levinas. Reihe Meisterdenker, Freiburg (erscheint 2002).
Giuseppe Veltri
Fragen zur jüdischen Philosophie
heute
Ad I. Die Frage nach Chancen für ein jüdisches Geistesleben heute ist sehr
heikel, denn sie ist historisch wohl falsch gestellt. Ein jüdisches Geistesleben ist in Deutschland immer vorhanden gewesen – auch nach der Shoa.
Jüdische Intellektuelle haben sich ihre Spuren in der deutschen Geschichte
nicht tilgen lassen und auf einer deutsch-jüdischen Identität beharrt, auch
wenn diese Identität zwiespältig war, und sie in Deutschland nicht (mehr)
gelebt haben. Das Merkwürdige dabei ist, daß dieser Aspekt im deutschen
und europäischen Raum nicht wahrgenommen wurde, auch nach dem Holocaust nicht. Daß der „Widerspruch“ heute – und nicht vor 20 Jahren –
diese Frage stellt, bezeugt, daß die jüdische intellektuelle Präsenz wieder
wahrgenommen wird, auch wenn dies vor allem (daher auf eingeschränkte
Weise) aus der Perspektive der Shoa geschieht. – Leben wir vielleicht in einer Zeit der Antiquaren, die sich bemühen, das Gedächtnis als Ritual einer
klassifizierten Vergangenheit zu betrachten? So jedenfalls deute ich die sich
in letzter Zeit häufenden Bemühungen, jüdische Museen zu eröffnen und
jüdische Denkmäler zu errichten. Das aber ist ein historisch fragwürdiger
Ansatz, der die Stellung des Judentums in der europäischen Gesellschaft als
(abgeschlossenes?) Kapitel der allgemeinen Geschichte betrachtet. Die Frage bleibt heute wie damals: Ist dies als ein – schon immer christlicher –
Umfrage
Versuch zu deuten, das Judentum per naturam als Vorstadium des heutigen
Denkens zu betrachten, das man, mit Hegel’scher Kategorie, ‚aufhebt’?
Auch die gestellt Frage nach dem „Gewinn“ ist äußerst problematisch. So
redeten einige jüdische Intellektuelle im 17. und 18. Jahrhundert, um die
Stellung des Judentums innerhalb der christlichen Gesellschaft zu verbessern. Heute ist die Frage anders zu stellen: Brauchen wir eine Allgemeinheit,
die uns als Identität dient, oder nur einen gemeinsamen Nenner, damit wir überhaupt kommunizieren können? Die Wahrnehmung des Einzelnen ist das
Einzige, was uns beschäftigen soll und muß in einer Zeit, in der man von
globalem Denken spricht und das Einzelne in das unbestimmte und unbestimmbare Magma zu versinken droht.
Ad II. Das Kompositum „jüdische Philosophie“ verweist historisch gesehen
auf eine kulturelle Auseinandersetzung. Gleichzeitig wird damit die seit der
Antike diskutierte Frage nach der Genealogie des Wissens berührt. Der
Terminus „Philosophie“ ist ja weder hinsichtlich seines Inhalts noch nach
Objekt und Ziel eindeutig zu definieren, da diese je nach Epoche, geographischem Raum sowie soziologischer Gruppe variiert haben. Er läßt jedoch
immer eine Verbindung zu jener griechischen Weltanschauung erkennen,
aus der die „Philosophie“ entstand, und die – der noch heute herrschenden
communis opinio gemäß – der jüdischen Geisteswelt so völlig inkompatibel ist:
„Athen“ und „Jerusalem“ gelten als ein unvereinbares Gegensatzpaar. Derjenige, der sich auf eine Debatte über jüdische Philosophie einläßt, ähnelt
somit dem Seefahrer, der versucht, sein Schiff zwiscken Skylla und Charybdis hindurchzumanövrieren, in der Hoffnung, hier doch noch heil davonzukommen.
Der Begriff „jüdische Philosophie“ spiegelt auch die große Unbefangenheit
des Historikers wider, der die jüdische Literar- und Kulturgeschichte auch
nach philosophisch-historischen Kriterien zu klassifizieren versucht, obwohl doch eine jüdische Philosophie einer contradictio in adiecto gleichkommt.
Verbietet nicht der Universalanspruch des philosophischen Denkens und
damit des menschlichen Wissens eine Segmentierung gemäß einem Teil der
menschlichen Gesellschaft und ihrer jeweiligen Kulturgeschichte?
Die Frage nach der Existenz und dem Wesen der „jüdischen“ Philosophie,
die zum erstenmal von Vertretern der deutschen Wissenschaft des Judentums aufgeworfen wurde, verweist unmißverständlich auf einen anderen,
damit jedoch unmittelbar verbundenen Aspekt: den des jüdischen Selbst-
Umfrage
verständnisses. Man kann dies noch schärfer formulieren: Je mehr der jüdische Zugang zur Philosophie hervorgehoben bzw. verneint wird und die
Thematisierung des Objektes in den Vordergrund der wissenschaftlichen
Diskussion tritt, desto radikaler stellt sich die Frage nach Bestand, Wesen
und Identität der jüdischen im Verhältnis zur allgemeinen Kultur. So verwundert es nicht, daß diese Frage vor allem in der Diaspora gestellt wird,
wo die Gefahr der Assimilation zumindest seit der Wissenschaft des Judentums beständig lauert und sich die eigene Identität in das undifferenzierte
Allgemeine aufzulösen („aufzuheben“, würde Eduard Gans in Hegel’scher
Terminologie sagen) droht.
Die Frage nach der Existenz der jüdischen Philosophie stellt im Grunde eine falsche und unlogische, jedoch paradoxe Denkweise dar, weil der Fachhistoriker und der Philosoph ihr Selbstbewußtsein bei der Bildung des Objektes über- bzw. unterschätzen. Eine jüdische Philosophie existiert nicht
als metaphysische Realität an und für sich, als Monade der Leibniz’schen
Ontologie, sondern entsteht in dem Moment, in dem ein Philosoph dies als
philosophisch möglich und existentiell angebracht erachtet. Eine Idee
braucht keine Materialisierung der Erkenntnis; sie verankert sich im Bewußtsein der Formen, die sich historisch herauskristallisiert haben. Ein Adjektiv vor „Philosophie“ deutet immer auf eine Einschränkung des Objektes und kennzeichnet damit eine Konkretisierung, die philosophischhistorisch begründet und soziologisch-kulturgeschichtlich analysiert werden
muß. Wenn die Philosophie, zumindest seit der Renaissance, um ihre Existenz und Rechtfertigung gegen die Errungenschaften und die Erfolge der
„Wissenschaften“ ankämpft, dann gilt dies vor allem für die jüdische Philosophie. Die Geistesgeschichte des Judentums wird apologetisch mit seiner
Philosophie identifiziert.
Die jüdische Philosophie kann trotzdem nicht in den sogenannten „klassischen Kanon“ tel quel einbezogen werden, weil sie primär als jüdisch verstanden wird. Man darf also annehmen, daß sich die jüdischen Gelehrten in
dem Augenblick, da sie die Beschäftigung mit dem Judentum als wesentlichen Teil der Philosophie betrachten, von deren universellen Anspruch entfernen und vice versa, daß eine jüdische Philosophie nicht existieren darf
oder kann, wenn sie von dem universellen Anspruch absieht. Der universelle Anspruch, basierend auf der Prämisse des homo rationalis, ist das Wesen
des philosophischen Diskurses, ohne den eine Philosophie im klassischen
Umfrage
Sinne nicht möglich ist. Wer diesem Ansatz nicht zustimmt, geht von der
Definition der „Philosophie“ als Geistesprodukt aus, die jegliche Erscheinung des Denkens überhaupt mit berücksichtigt. Somit verliert der philosophische Diskurs an Konsistenz und Relevanz.
Die Debatte um die Definition der „jüdischen Philosophie“ verweist in ihrem historischen Verlauf auf eine grundlegendere Frage, nämlich die nach
der eigenen Identität, mithin auf die Definition des Judentums selbst, die auf
der philosophischen Ebene aus den Teilaspekten von Existenz und Berechtigung besteht. Die Suche nach der eigenen philosophischen Identität erscheint in diesem Lichte besehen als bewußtseinsbildender Faktor im Rahmen der internen kulturgeschichtlichen Standortbestimmung. Die jüdische
Philosophie wendet sich dabei konfliktbewußt gegen den universellen
Wahrheitsanspruch der – vor allem griechischen, dann europäischchristlichen – Philosophie. In dieser Hinsicht fungiert sie sowohl als Apologie ad extra bzw. ad intra als auch als Widerstand gegen die Verallgemeinerung des Einzelnen.
Ad III. Auch hier – wie immer im philosophischen Denken – gilt die scholastische Maxime „distingue frequenter“: was wird philosophisch unter der
sogenannten „rabbinischen Tradition“ verstanden? Die klassische Zeit der
Dispute zwischen den Schulen oder die klassische Zeit des Schul- und
Dogmenverständnis, die man in der christlichen Zeitrechnung „Mittelalter“
und „Frühneuzeit“ nennt? Nur der Bezug auf die zweite Periode kann zu
Konflikten führen; der auf die erste jedoch nicht. Die antike rabbinische
Schule ist durch eine Dialektik gekennzeichnet, die – stoisch und epikureisch in ihrem Ursprung – die Macht und/oder Un- und Ohnmacht des
Wortes und des Diskurses betont hat. Von Theorie war keine Rede, und
daher konnte dies keine Konflikte hervorrufen. Oder schärfer formuliert:
der Konflikt war die Quintessenz ihres Diskurses und wurde daher als solcher nicht (immer) wahrgenommen.
Es ist wahr, daß jüdische Scholastik, und vor allem Maimonides, heute das
jüdisch-philosophische Denken dominiert. Aber nur augenscheinlich und
philosophischhistorisch. In der Tat gibt es keinen Denker – und auch Leibowitz ist keiner –, der als jüdischer Philosoph gelten kann. Fackenheim
und Lévinas sind deutlich als Denker nach dem Holocaust zu qualifizieren
und daher nicht als Philosophen des Judentums zu definieren. Sie betreiben
Erfahrungsphilosophie, die in den Kategorien der allgemeinen Philosophie
Umfrage
als kontingent gelten muß. Oder ist Philosophie doch nur Philosophie des
Erfahrenen?
Michael Zank
Antworten
Ich bedanke mich zunächst dafür, daß mich der “Widerspruch” dazu eingeladen hat, seine “Fragen zur jüdischen Philosophie heute” zu beantworten,
die ich schon deshalb gut gestellt finde, weil sie mich doch auch teilweise
zum Widerspruch reizen.
Ad I. Zunächst zur Voraussetzung, daß “jüdische Denker in der deutschen
Philosophie bis 1933 eine große Rolle” spielten. Stimmt denn das eigentlich? Hier sind einige Beobachtungen, die mich gegenüber dieser Meinung
bedenklich stimmen.
Obwohl es natürlich stimmt, daß 1933 ff. der sogenannte “jüdische“
Einfluß aus allen gesellschaftlichen Bereichen verbannt werden sollte, was
sich auch auf die akademische Philosophie und die philosophische Literatur
bezog, so wollte man damit aber doch vor allem den Liberalismus treffen.
Judentum und Liberalismus sind aber sicher nicht dasselbe. Dementsprechend wurde es den Juden unter den Nazis zunächst ja auch weiterhin erlaubt, sich mit jüdischen Themen zu beschäftigen, sich dem Zionismus
(und somit dem Gedanken der ethnischen Trennung und Auswanderung)
zu widmen und – jüdische Philosophie zu betreiben.
Wie stand es nun mit der Rolle jüdischer Denker vor 1933? Dem politischen Programm einer Vertreibung der Juden aus dem deutschen Kulturleben entspricht die Meinung, daß Juden in den vorausliegenden Jahrzehnten
einen bedeutenden Anteil am allgemeinen Kulturleben besaßen. Womöglich
handelt es sich hierbei aber um einen Trugschluß, ein Konstrukt, oder doch
zumindest um ein schiefes Bild. Man muß nicht gleich Goldhagenianer sein
um zu bemerken, daß die Juden innerhalb Deutschlands und anderswo
trotz aller rechtlichen Emanzipation in gewisser Hinsicht ein Sonderdasein
führten. Dieser Sachverhalt verschleiert sich nur dann, wenn man den Grad
Umfrage
der Eingliederung nach soziologischen Kategorien wie Wirtschaftsverhältnisse oder Bildungsleistungen beurteilt. Schaut man sich dagegen an, wer
sich auf den Korridoren der Universitäten informell unterhielt, ohne eine
Maske äußerlicher Jovialität aufzusetzen, so ändert sich das Bild. Dann erscheint etwa Hermann Cohen (1842-1918) nicht mehr wie im Lehrbuch als
das Haupt der Marburger Schule des Neukantianismus sondern als “unser
jüdischer Spezialkollege“ (Julius Bergmann).
Eine letzte, vielleicht triviale, aber deshalb nicht weniger grundlegende Bemerkung. Der größte Anteil an Philosophen jüdischer Herkunft am Leben
der deutschen Wissenschaft vor 1933 betrifft die Naturwissenschaften und
erst danach die Geisteswissenschaften und am wenigsten die akademische
Philosophie. Man bedenke hierzu, daß der soeben erwähnte Hermann Cohen zu Lebzeiten der einzige (!) Ordinarius für Philosophie (nicht für Geschichte, Mathematik oder Chemie) an einer preussischen Universität war.
Andere erreichten diese Anstellung nur dann, wenn sie ihr Judentum an der
Garderobe abgaben, d.h. konvertierten.
Genug der Bedenken. Ich hoffe, deutlich gemacht zu haben, daß die Vorstellung eines bedeutenden Anteils jüdischer Persönlichkeiten an der deutschen Philosophie einer genaueren Überprüfung bedarf.
Im Unterschied zur gesamten Periode vom Humanitätszeitalter bis hin zur
unseligen Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts gibt es heute völlig andere
Möglichkeiten einer Teilnahme jüdischer Philosophie am deutschen bzw.
europäischen Geistesleben, und zwar genau im Sinne der vom „Widerspruch“ gestellten Frage einer neuen Beziehung zwischen jüdischer und europäischer Philosophie. Hier geht es nicht mehr nur etwa um den von Jürgen Habermas rückblickend konstatierten “deutschen Idealismus der jüdischen Philosophen”, sondern um gegenseitige, wahlverwandtschaftliche
Familienähnlichkeiten zwischen jüdischen, christlichen, und anderen Ansätzen zu einem postmodernen Denken. Diese Ansätze kommen auch nicht
einfach im Zeichen einer verspäteten Trauerbefähigung daher, obwohl uns
sicher die Irrwege der Vergangenheit insgesamt aus einem gewissen dogmatischen Schlaf gerissen haben dürften. Es ist jedenfalls erst heute wirklich
völlig plausibel, sich auch akademisch und systematisch mit Denk-, Sprechund Zugangsweisen zur Philosophie zu befassen, die nicht im neugriechisch-idealistischen Bereich der Nachaufklärungszeit sondern eben auch
vielleicht im Judentum wurzeln. Daß dabei auch die oft übersehenen und
Umfrage
alternativen Denker der Vergangenheit, unter anderem auch solcher jüdische Provenienz, wieder mit Gewinn gelesen werden, sollte uns nicht verwundern. Mit dem Fall alter Paradigmen eröffnen sich Möglichkeiten neuer
Kanonizität.
Ad II. Als Philosophie ist das Philosophieren jüdischer Philosophen oder –
wie ich es zu sagen für angemessener halten würde, da der Titel des Philosophen von Lebenden nur unter Gefahr der Lächerlichkeit in Anspruch genommen werden kann – das Lesen von und Arbeiten mit und an philosophischen Texten und Problemen seitens Menschen, deren primärer Symbol- und Bedeutungsbezug sich aus ihrem biographischen Zusammenhang
mit jüdischem Leben und jüdischen Quellen ergibt, zunächst schlicht und
einfach Philosophie. Das ist schließlich der Vorteil und das Kennzeichen
dieses Kulturphänomens: auch Barbaren können sich seiner bemächtigen,
weshalb also nicht auch die Juden, deren Religion schon dem anspruchsvollen Geschmack des griechischen Weltreisenden Hecataeus von Abdera als
die einer “Nation von Philosophen” erschien. Ich glaube also in der Tat,
daß es, trotz aller Offenheit der Postmoderne, “im Grunde nur eine Philosophie gibt”. Allerdings gibt es am Rande dieser einen Philosophie eine
ganze Reihe von verschiedenen, anderen Philosophien, Diskurse und Symbolcluster, deren sich die eine Philosophie nur dann bemächtigen kann,
wenn sie sich dazu bequemt, sich ihrer eigene Bedingt-, Begrenzt- und Bezogenheit zu erinnern. Philosophie ist ja immer nur ein nach Gründen fragendes Nachdenken, also auch nicht selbst wirklich produktiv und ursprünglich. Das gilt denn auch für den Anteil der Philosophie einerseits und
den des Traditionsbezugs andererseits im Philosophen selbst. Der Philosoph, also der im obigen Sinne an philosophischen Problemen und Texten
arbeitende Mensch, ist nichts ohne seine Erfahrungen und Bedingtheiten,
und die sind immer auch ganz spezifisch, individual und historisch. Dem
Hin und Her von Erfahrung und Reflexion aber muß alle Philosophie irgendwie gerecht werden.
Gibt es denn dann aber soetwas wie jüdische Philosophie? Zwar leugnen dies
viele, darunter auch der bedeutende Politikwissenschaftler und Hermeneut
Leo Strauss, dem es um eine Wiedergewinnung der eigentlichen, d.h. der
politischen, Frage der sokratisch philosophischen Tradition ging, die er
durch den sintflutlichen Einbruch durch die Tradition der Offenbarung für
verschüttet hielt. Aber die bibliographische Tatsache schriftlich vorliegen-
Umfrage
der Werke zur jüdischen Philosophie vom Altertum über das Mittelalter bis
in Moderne und Gegenwart kann doch nicht einfach außer Acht gelassen
werden. Beim Studium dieser Quellen kann man sich von der Frage leiten
lassen, ob es sich dabei jeweils um den Fall einer philosophischen Theologie
(d.h. um Rationalismus und Kritik an der Offenbarung) oder um theologische Philosophie handelt (d.h. um scholastische Metaphysik). Fruchtbarer
wäre es allerdings zu fragen, wie sich jeweils Philosophie und Offenbarung
gegenseitig einschränken, befruchten und korrigieren. Nicht um Überwältigung oder Synthese handelt es sich, sondern um den Versuch einer ernsthaften Bestimmung des Verhältnisses zwischen zwar widerspenstigen aber
deshalb nicht unbedingt einander heterogenen Quellen menschlichen Weltund Selbstverhaltens.
Ad III. Das bedeutet, daß, wenn jüdisches Denken für die europäische
Geisteswelt noch einmal von Interesse und Bedeutung werden soll, dies nur
in dem Maße und dann möglich ist, wenn es sich um ein Denken aus jüdischen Quellen handelt, d.h. um ein Denken, das die Widerständigkeit zwischen, sagen wir einmal, griechischem und rabbinischem Denken nicht von
vorneherein zugunsten der einen oder der anderen Seite entscheidet, noch
sich auf historisch bereits gegebene Lösungen verläßt, sondern sich von
neuem dem Durchbuchstabieren der Differenzen und Gemeinsamkeiten
widmet. Ein Ansatz, der beide Quellen gleich ernst nimmt, kann uns womöglich einen philosophischen Zugang zu der Logik und Symbolik einer
völlig anderen Texttradition verschaffen und so zur Bereicherung nicht nur
für Juden sondern für alle philosophisch Interessierten werden.
Der wohl entscheidende Unterschied zwischen diesem Entwurf und dem
unter jüdischen Philosophen vor 1933 üblichen Redeweise ist der, daß wir
uns heute nicht mehr in einer apologetischen Situation befinden. Vor hundert Jahren schien es noch nötig, die nicht-jüdischen Zeitgenossen immer
wieder auf Ähnlichkeiten zwischen Kantianismus und Judentum oder auf
die weltgeschichtliche Bedeutung der jüdischen Religionsquellen aufmerksam zu machen. Solche Anpreisung haben wir heute, G=tt sei Dank, nicht
mehr nötig. Allerdings hat der gelassenere Ausgangspunkt auch den Nachteil, daß eine Auseinandersetzung mit den freiheitlich europäischen Quellen
für das jüdische Denken nicht mehr selbstverständlich ist. Früher war es
dem Judentum unmöglich, sich nicht mit Philosophie ins Verhältnis zu setzen, während sich die Philosophie (also sagen wir einmal das christliche und
Umfrage
christlich geprägte Denken) nur insofern mit Judentum beschäftigte, als dies
in die christliche Schablone passte. Gerade weil das heute christlicherseits
nicht mehr geht, ist ja auch die Entdeckung des Judentums, wie es sich
selbst versteht, heute erst möglich und sogar philosophisch spannend.
Denn mit der Aufmerksamkeit auf jüdische Quellen und Symbole wird sich
die europäische Philosophie verspätet auch einiger ihrer anhaltenden Verzerrungen bewußt, wodurch eben die Beschäftigung mit dem Judentum
auch erst europäisch-philosophisch-kritische Relevanz erhält, die mehr ist
als Ausdruck multikultureller Neugierde. Dem enspricht aber, und das erregt bei mir als an der jüdischen Philosophie Interessiertem eine gewisse
Besorgnis, auf jüdischer Seite kein ebenso starker Imperativ, die europäische Philosophietradition als eine Herausforderung von innen wahrzunehmen. Die Frage, die daher ebenso gestellt werden müßte, die ich aber nun
hier nicht beantworten kann, ist die, ob es auf Seiten der jüdischen Philosophie noch weiterhin eine innere Notwendigkeit und einen Ort für die Auseinandersetzung mit der europäischen Philosophietradition gibt, der über
die bloße Apologetik hinaus den Kern des jüdischen Denkens selbst betrifft. Diese Aufgabe aber wäre die eigentliche Aufgabe der jüdischen Philosophie heute.
In: Widerspruch Nr. 37 Jüdisches Denken – Jüdische Philosophie (2001), S. 85-99
Bücher zum Thema
Besprechungen
Bücher zum Thema
Hannah Arendt
Die verborgene Tradition. Essays,
Frankfurt/Main 2000 (Jüdischer
Verlag im SuhrkampVerlag), 184 S.,
36.- DM.
Der Band enthält sieben in den
dreißiger und vierziger Jahren geschriebene Essays und geht zum
größten Teil zurück auf Hannah Arendts erste Buchveröffentlichung
im Nachkriegsdeutschland (Sechs
Essays, Heidelberg 1948). Später
wurde die Sammlung von der Autorin neu konzipiert und erschien
1976 bereits unter dem Titel „Die
verborgene Tradition. Essays“ bei
Suhrkamp. Ein Text wurde aus der
ersten Zusammenstellung herausgenommen (Was ist ExistenzPhilosophie?), zwei andere Texte
wurden hinzugefügt: „Aufklärung
und Judenfrage“ sowie „Der Zionismus aus heutiger Sicht“. Die weiteren fünf Essays sowie die „Zueignung an Karl Jaspers“ wurden in die
Ausgabe von 1976 übernommen:
Über den Imperialismus; Organisierte Schuld; Die verborgene Tradition; Juden in der Welt von gestern;
Franz Kafka; Aufklärung und Judenfrage.
Bei dem 2000 erschienenen Band
handelt es sich um eine Neuausgabe
des bereits 1976 Erschienenen; bis
auf eine knappe editorische Notiz
und einen Klappentext unkommentiert, unkommentiert auch die publizistischen Erwägungen der Textzusammenstellung von 1976 gegenüber der von 1948. Dahinter mag
eine verlegerische Entscheidung
stehen, Zeitgenossenschaft möglichst ungebrochen und unangetastet (wieder-)einzurichten. Die Essays zeigten, so eine Äußerung aus
dem Text des Umschlages, in welchem Maße Hannah Arendts „historisch-politisches Denken insgesamt bestimmt wurde von ihrem
Nachdenken über Positionen jüdischen Selbstverständnisses in der
Moderne“. Für eine Leserschaft, die
mit dem Gesamtwerk der Autorin
vertrauter ist, dürfte eine solche
Deutungslinie gut nachvollziehbar
sein; für eine andere, weniger vor allem mit den späteren Schriften vertrauten, hätte es eine Hilfestellung
bedeutet, kommentierend einen
umgekehrten Lektüreweg zu mar-
Bücher zum Thema
kieren oder zu empfehlen. Den
nämlich, vor allem von „The Human Condition“ (Chicago 1958; dt.
Vita activa oder Vom tätigen Leben,
Stuttgart 1960) ausgehend und von
„On Violence“ (New York 1970; dt.
Macht und Gewalt, München 1975)
zu versuchen, die Entwicklungen
von Hannah Arendts keineswegs
einsinnig-klarem Begriff eines Politischen respektive eines Un- oder
Apolitischen nachzuvollziehen. Gerade dieses Begriffsfeld ist in den
frühen Essays zu Themen der Emanzipation, der Assimilation, des
Pariatums und der Entwicklungen
eines
Zionismus
bestimmend,
gleichwohl aber auch noch wenig
profiliert.
In dem zentralen Text „Die verborgene Tradition“ geht es um ein gesellschaftliches Außenseitertum von
Schriftstellern und Künstlern jüdischer Herkunft, um „die Figur des
Paria“, mit der sich zeige, „daß das
Schicksal des jüdischen Volkes in
Europa nicht nur das eines unterdrückten, sondern das eines Pariavolkes (Max Weber) war“. Als jüdische Parias gelten diejenigen, „die in
den Ländern der Emanzipation weder der Versuchung einer törichten
Mimikry noch der einer Parvenukarriere nachzugeben, sondern statt
dessen versucht hatten, die frohe
Botschaft der Emanzipation so
ernst zu nehmen, wie sie nie gemeint gewesen war, und als Juden
Menschen zu sein.“ Die Geschichte
der Parias beginne mit Salomon
Maimon und ende mit Franz Kafka.
Und es zeige sich ein „grotesker
Widerspruch“ zwischen dem „Einfluß auf die nichtjüdische Welt“ und
der „geistigen und politischen
Wirkungslosigkeit ... in ihrem eige-
eigenen Volke“. Im Rückblick auf
„die verborgene Tradition“ der Parias unterscheidet Hannah Arendt
„vier wesentliche Konzeptionen“:
Die des „Schlemihl oder Traumweltdeuters“, des unschuldig Verurteilten und spöttischen Schöngeistes
(Heinrich Heine), die des „bewußten Paria“ (Bernard Lazare), die des
„Suspekten“ (Charlie Chaplin) und
die des „dichterischen Visionärs“
und „Menschen mit dem guten Willen“ (Franz Kafka).
Die Betrachtungen changieren zwischen einer Hervorhebung von gesellschaftlich politischen Zwängen,
einem Bedauern und latenten Vorwürfen. So zeige, „gemessen an den
politischen Realitäten, Heines unbekümmerte Spottlust etwas Traumhaftes, Irreales“. Nun hafte aber
Heines „Schlemihl“ der „Hebräischen Melodien“ Lazares Engagement in der Dreyfusaffaire und
Chaplins subversiv angelegten Figuren noch die jüdische Herkunft
deutlichst an.“ Kafkas K. (Beschreibung eines Kampfes; Das Schloß)
hingegen kommt „von nirgendwo
her, und von einem früheren Leben
ist nie die Rede“. Allein aufgrund
der „Abstraktheit der Kafkaschen
Romanfiguren“ sei etwas Jüdisches
nicht mehr vorfindbar. Die Autorin
schreibt von einer neuen aggressiven Art des Nachdenkens, dem
„Himmel und Erde“ nicht mehr genügten. Kafkas Sprache sei, so heißt
es in dem Essay „Franz Kafka“, klar
und einfach wie die Sprache des Alltags, nur gereinigt von Nachlässigkeit und Jargon“, ohne Manieriertheit und aus „Mangel an Verliebtheit in Worte als solche fast bis an
die Grenzen der Kälte getrieben“.
So wie Kafkas K. schließlich an
Bücher zum Thema
Entkräftung sterbe, drohe dies jedem, der nicht „innerhalb eines
Volkes“ „als Mensch unter Menschen“ lebe. In der Schlußbemerkung zu „Die verborgene Tradition“ ist von sinnloser Freiheit und
vermessener Unverletzlichkeit der
einzelnen die Rede und von einem
Auftakt „zu den sinnlosen Leiden
des ganzen Volkes“.
Hätte Kafka etwas anderes schreiben sollen als er geschrieben hat?
Welchen Sinn ergäbe ein derartiges
Anraten? Ließe sich nicht einiges,
was Hannah Arendt über Kafkas
Stil schrieb, auch über den Stil Becketts äußern? Der Lektüre bleibt
das Problem, daß die ästhetischen,
politischen und biographischen
Maßstäbe sowie deren Gewichtung
kaum reflektiert und ausgewiesen
sind. Im Blick auf die späteren
Werke ist besonders hervorzuheben, daß Hannah Arendt eine Weltentfremdung der Moderne mit dem
Politikverständnis der Antike konfrontiert. Leitend ist dabei ein aristotelisches Menschenbild, das ein
Politisches vornehmlich im Handeln
(praxis) und in der austauschenden
Rede (lexis) sieht, als vita activa nie
konfliktlos mit einer isolierten „vita
contemplativa“ zu verbinden. Richtschnur ist dabei ein universalistisch
gedachtes moralisches Weltgebäude
(Jaspers),von dem aus die tätigen
Eingriffe auszugehen hätten. Die
Beachtung eines solchen Prinzipiendenkens macht vielleicht verständlicher, daß die Autorin der
frühen Essays an Kafkas Werk eine
Verbindung von visionärer „Genialität“, Modernität und untätiger
Schuld sah. Walter Benjamin, dessen Manuskript der Thesen „Über
den Begriff der Geschichte“ sie aus
der Pariser Nationalbibliothek vor
einer Beschlagnahmung durch die
Nazis rettete, erschien ihr als einer
der
unglücklichsten
Parias:
„...verstand er sich auf nichts weniger als darauf, ‚Lebensbedingungen,
die für ihn vernichtend geworden
waren’, zu ändern“ (Benjamin,
Brecht. Zwei Essays, München
1971) Das Zitat in dem Satz entstammt allerdings Benjamins „Zum
Bilde Prousts“.
Der Text „Aufklärung und Judenfrage“,
bereits 1932 erstveröffentlicht, bietet eine akribische Recherche, inwieweit „die moderne Judenfrage“
und ein Selbstverständnis des europäischen Judentums aus der Aufklärung datierten. Lessings Geschichtsauffassung und deren Rezeption
durch Moses Mendelssohn setzten
zufälligen Geschichtswahrheiten eine notwendige Vernunftwahrheit
der Mündigkeit und der Toleranz
entgegen und eröffneten einem emanzipierten Judentum „undenkliche Horizonte“ von Neuanfängen
einer aufgeklärten „Bildung“. Für
Mendelssohn gestaltete sich dies
noch innerhalb einer „absoluten
Gebundenheit an die jüdische Religion“ und kontrovers zu Lessings
„Eliminierung der Religion als
Dogma“. Nach Hannah Arendts
Darstellung vollzog sich dann mit
Herders „Auch eine Philosophie der
Geschichte der Bildung der
Menschheit“ (1794) eine deutliche
Veränderung im Geschichtsbewußtsein, weniger im Feld der Aufklärung als in dem der aufkommenden
Romantik. Nach Herders Auffassung ist die Vernunft der Geschichte unterworfen, und den „entscheidenden Begriffen Bildung und Toleranz“ wird eine neue Bedeutung
Bücher zum Thema
gegeben. Lessings Primat einer einheitlichen Vernunft vor der Geschichte, einem Kontingenten, wird
ein Primat der jeweiligen Tradition
entgegengesetzt, wenn auch aus der
Idee einer ursprünglichen Gleichheit heraus: „Herder versteht die
Geschichte der Juden so, wie sie
selbst diese Geschichte deuteten, als
Geschichte des auserwählten Volkes
Gottes. Ihre Zerstreuung ist ihnen
Beginn und Vorbedingung ihrer
Wirkung auf das menschliche Geschlecht.“ So zeichneten sich
schwerwiegende Folgen für ein
Selbstverständnis des europäischen
Judentums ab. Aus der „völligen
Gleichheit Lessings“ wurde ein
Konflikt im Verständnis der eigenen
Geschichte, zwischen singulärer
Tradition und Vernunftweltbürgertum, zwischen Theologie und Philosophie und zwischen Ausnahmestellung und Normalität.
„Der Zionismus aus heutiger Sicht“
wurde in der englischen Fassung
(Zionism Reconsidered) erstmals
1945 veröffentlicht. Hannah Arendt, von 1933 bis 1943 Mitglied
der „World Zionist Organization“,
schrieb den Text im Blick auf ein
„Endergebnis von 50 Jahren zionistischer Politik“. Sie beklagte, daß
sowohl nationalistische als auch sozialistische Strömungen sich darin
einig gewesen seien, ein „freies und
demokratisches jüdisches Gemeinwesen“ zu fordern, das „ganz Palästina ungeteilt und uneingeschränkt
umfassen“ sollte. Das Credo der
Autorin war, daß es ohne Austausch
und Verträge unter Gleichen keine
humane Machtausübung gebe. Über
ihr Politikverständnis schreibt Jürgen Habermas in „Philosophischpolitische Profile“ (Frankfurt/Main
1981), daß sie letztlich „der ehrwürdigen Figur des Vertrages“ mehr
vertraut habe „als ihrem eigenen
Begriff einer kommunikativen Praxis“.
Ignaz Knips
Micha Brumlik
Deutscher Geist und Judenhass.
Das Verhältnis des philosophischen
Idealismus zum Judentum, München 2000 (Luchterhand Literaturverlag) 351 S., 48.- DM (€ 24.54)
Die Studie umfaßt den Zeitraum
zwischen dem Ausbruch der Französischen Revolution und der Revolution von 1848 und untersucht die
Beziehungen von Kant, Fichte,
Schleiermacher, Hegel, Schelling
und Marx zum Judentum. Gegenüber anderen Untersuchungen z. B.
von Liebeschütz, Silberner oder
Goldhagen geht es dem Autor nicht
darum, den Nachweis zu führen,
daß sich in den Werken der genannten Philosophen judenfeindliche
Äußerungen finden. Diese sind in
der Regel bekannt. Es geht ihm
darum, „welche Funktion, welches
Gewicht und welche Bedeutung diese Äußerungen im Kontext des Gesamtwerks der Philosophen und
damit in der gesamten ‚Deutscher
Idealismus’ genannten Denkbewegung“ habe. (15) Brumlik bemüht
sich sehr, das Verhältnis unserer
philosophischen Vorfahren zum Judentum aus der Retrospektiven der
Verbrechen des 20. Jhs. herauszuhalten. Dies gelingt ihm teilweise.
Bei Kant finden sich Formulierungen, die solche Verknüpfungen fast
Bücher zum Thema
unmöglich machen. Wenn auch der
von den Nazis mißbrauchte Titel
„Euthanasie“ nicht unmittelbar mit
der Ermordung der Juden in Verbindung steht, so werden beim Leser doch eindeutige Assoziationen
hervorgerufen, wenn er mehrfach
den Ausdruck „Euthanasie des Judentums“ benutzt. Auch wenn Kant
die Quellen des Judentums zu sehr
auf die Thora einschränkt, so läßt
sich daraus gewiß nicht sein „Antijudaismus“ erklären, zumal auch jüdische Zeitgenossen (Bendavid, Ascher) sich von der talmudischen
und rabbinischen Tradition lösen
wollten. Kants „Antijudaismus“ ist
viel eher aus seinem sehr reduzierten Religionsbegriff zu erklären,
wenn er als einzigen Maßstab jeder
Religion nur das Sittengesetz gelten
läßt. Denn den (christlichen) Kirchenglauben oder den Glauben an
Wunder verwirft Kant ebenso als
unsittlich, wie den Gesetzesglauben
der Juden. Kants Stellung zu allen
Religionen ist so sehr von der Aufklärung bestimmt, daß er dem Judentum wie allen Religionen, soweit
sie sich auf Autoritäten jenseits der
menschlichen Vernunft berufen,
sehr distanziert gegenübersteht.
Nicht wie Kant und Schleiermacher,
deren Verhältnis zum Judentum
auch durch einen persönlichen und
bei Schleiermacher sogar durch einen sehr innigen Kontakt mit Juden
geprägt war, konnte Hegel auf solche
Erfahrungen nicht zurückgreifen,
und das Judentum schien ihm in
seiner frühen, vorjenensischen Zeit
nicht mehr als die Vorläuferreligion
des Christentums zu sein. In mehreren Phasen präzisierte und veränderte sich sein Begriff des Judentums, bis er schließlich in der Reli-
gionsphilosophie als Religion der
Erhabenheit einen Begriff ausformulierte, der völlig frei von jenem
Antisemitismus gewesen sei, ganz
im Gegensatz zu manchen romantisch gesinnten Zeitgenossen wie
Friedrich Christian Rühs oder Jakob
Friedrich Fries, denen Brumlik einen völkisch geprägten Antisemitismus vorhält. Dabei wartet Brumlik mit einer „kaum je eingenommenen
Perspektive“
(220)
der
Interpretation des Hegelschen HerrKnecht-Verhältnisses auf. Herr und
Knecht seien nicht Kapitalist und
Arbeiter (Lukács) auch sei das HerrKnecht-Kapitel keine allgemeine
Anerkennungstheorie
(Kojève),
sondern es stelle den „Angelpunkt
von Hegels Theorie des Judentums“
(240) dar. Er setzt an die Stelle der
Knechte die Juden und an die des
Herrn (den jüdischen) Gott. Später
allerdings, im Kapitel zu Marx muß
Brumlik einräumen, daß eine ähnliche Interpretation bereits Bruno
Bauer im Jahre 1841 vorgelegt hatte.
Je mehr sich Brumlik der Jahrhundertmitte nähert, desto unsicherer
wird er. Auch Schelling behandelt die
jüdische Religion als eine Vorläuferreligion. „Auferat Deus omnipotens
velamen ab oculis vestris“ ist, den
(älteren) Papst Johannes XXIII. zitierend, Schellings Hoffnung; in dieser religionsgeschichtlichen Bestimmung des Judentums sieht
Brumlik einen „theologisch hochspekulativen Antijudaismus“ (268).
Brumlik sieht nicht, daß es Schelling
durch seine Unterscheidung von
positiver und negativer Philosophie
möglich war, die heilsgeschichtliche
Dimension und die bürgerlich/politische Wirklichkeit sauber
voneinander zu trennen. Diese Un-
Bücher zum Thema
terscheidung und die daraus folgenden Konsequenzen scheint Brumlik
in bezug auf das Judentum nicht
nachvollziehen zu wollen. Für
Schelling ist es unproblematisch, der
jüdischen Religion nur eine (wenn
auch unverzichtbare) Vermittlerfunktion zuzubilligen und zugleich
für die Juden seiner Zeit die „notwendigen menschlichen Rechte“
einzufordern, und z. B. dem bayerischen König vorzuschlagen, den
Juden ebenso wie den Protestanten
ein Konsistorium und an der Universität eine jüdische Fakultät einzurichten. Solche Ansichten stehen bei
Schelling scheinbar unvermittelt neben antijüdischen Ausfällen, die
Brumlik ignoriert, daß etwa die Juden mit gerissener Bosheit und Gehässigkeit an der Unterwühlung der
staatlichen Ordnung gearbeitet hätten und dergleichen mehr. Angesichts dieser Widersprüchlichkeit
scheint Brumliks Urteil, daß Schelling das positivste Verhältnis zum
Judentum im ganzen Deutschen Idealismus gehabt habe, nicht nachvollziehbar.
Mit der Darstellung Schellings hätte
Brumlik das Buch seinem Untertitel
entsprechend abschließen können.
Er wollte es aber noch um ein Kapitel über den Materialisten Marx erweitern. Hatte er sich bisher nicht
ohne Erfolg bemüht, den deutschen
Denkern Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen, scheint er diese intellektuelle Tugend im Umgang mit Marx
vergessen oder verdrängt zu haben.
Wenn Marx in seinem Artikel „Zur
Judenfrage“ erklärt, daß die „gesellschaftliche Emanzipation des Juden
... die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum“ sei, warum
läßt Brumlik gegenüber dieser Äu-
ßerung Marx’ nicht dieselbe Sorgfalt
walten, wie gegenüber Kants „Euthanasie des Judentums“? Denn
beide stehen in dieser Frage mutatis
mutandis in derselben aufgeklärten
Tradition. Bei Marx finden sich in
seinen nicht zur Veröffentlichung
bestimmten Schriften und Briefen
einige antijüdische und antisemitische Bemerkungen; er ist vom antijüdischen Zeitgeist nicht unberührt;
aber ihn als einen vom „brennenden
Selbsthaß“ getriebenen glühenden
Antisemiten (285), als einen von einer „geradezu krankhaften antijüdischen Idiosynkrasie“ (286) Besessenen zu bezeichnen, geht fehl. Wenn
Brumlik auch noch so nebenbei den
nicht bloß beiläufigen, sondern
prinzipiellen Antisemitismus Richard Wagners (Juden seien von Natur aus zur Musik unfähig) verharmlost, bei Marx aber private, in den
Briefen an seinen engsten Freund
Engels geäußerte antisemitische
Ausfälle auf das Gesamtwerk und
die ganze Person überträgt, dann
vernachlässigt Brumlik jede intellektuelle Sorgfalt. Solche Entgleisungen müßten dem AntijudaismusKritiker Brumlik allzu bekannt sein.
Trotz einiger Abstriche kann das
Buch als eine gelungene Zusammenfassung und Aufarbeitung der
Aufgabe bezeichnet werden. Sehr
kenntnisreich bereitet Brumlik das
Material in verständlicher Weise vor
dem Leser aus, weshalb dieses Buch
auch Nicht-Fachphilosophen empfohlen werden kann. Vielleicht aber
ist es gerade diese Intention des Buches, weshalb es in philosophischer
Hinsicht nicht ganz befriedigt.
Martin Schraven
Bücher zum Thema
Amitai Etzioni
Martin Buber und die kommunitarische Idee
Wien 1999 (Picus-Verlag), 60 S.,
15.80 DM.
In „The New Golden Rule“ (1996;
dt.: „Die Verantwortungsgesellschaft) stellt Etzioni sein neues
responsiv kommunitaristisches Paradigma einer guten Gesellschaft als
das Bestreben dar, „einen Weg zu
finden, Elemente der Tradition (auf
Tugenden basierende Ordnung) mit
Elementen der Moderne (gut geschützte Autonomie)“ (19) zu verbinden. Im Rahmen der „Wiener
Vorlesungen im Rathaus“ hielt er
am 13. Juli 1999 einen Vortrag über
kommunitarische Themen bei Martin Buber, insbesondere über dessen
Werke „Ich und Du“ und „Between
Man and Man“. Etzioni präzisiert
darin seine Position als die einer
Vermittlung „zwischen der Respektierung universeller individueller
Rechte und der Anerkennung partikularer Verpflichtungen“ (12) einerseits und der Auffassung früherer
Kommunitarier andererseits, die
sich darauf konzentriert hatten, die
soziale Macht der Person zu begründen und zu untersuchen, „welche Implikationen die partikularen
Verpflichtungen der Person gegenüber ihren Gemeinschaften haben
können“ (12). Bei Buber interessiert
Etzioni nun, wie das richtige
Gleichgewicht zwischen individuellen Rechten und sozialer Verantwortung aussähe, und spielt dabei
die klassisch liberale Position gegen
die eigene und die Bubers aus. Ging
der klassische Liberalismus von freien autonomen Individuen aus, wel-
welche „freiwillig zu ihrem Nutzen
einen Staat bilden“ (13), so stehe für
den Kommunitarier an Anfang die
Gemeinschaft, welche die Individuen formt, – eine Position, die mit
Bubers ‚Apriori der Beziehung’ als
anthropologische und soziologische
Prämisse konvergiere. Denn bei
Buber entsteht Individuation aus
und innerhalb der Beziehung; im
Idealfall der echten Reziprozität des
Ich-Du-Dialogs erfahren wir eine
„Begegnung“. Für ihn sind Beziehungen, inklusive Gemeinschaften,
je schon historisch und kulturell bestimmt. Und die Gefahr eines Identitäts- und Autonomieverlusts durch
die Subsumierung des Ich unter die
diadischen Ich-Du- oder die gemeinschaftliche Wir-Beziehung ist
gebannt durch die Voraussetzung
der Freiheit und das Postulat der
Unaufgebbarkeit des Ich. Während
der Liberalismus jedoch von der
vernunftgeleiteten Interessenaggregation mittels Verhandlungen ausgeht, gründe der Kommunitarismus
die Beziehungen auf die Idee eines
Wertedialogs innerhalb der Gemeinschaft. Dies aber entspreche
dem Buberschen Ideal eines authentischen und vorbehaltlosen Gesprächs, in dem reziprok die Perspektive der jeweils anderen Person
wahrgenommen wird.
Für Etzioni hat kommunitarisches
Denken eine normative Basis, und
seine Formulierungen des Guten
sind soziologisch fundiert. Buber
hingegen habe, wie Etzioni meint,
eher anthropologisch und philosophisch als ethisch argumentiert, und
auch die Beziehung zu Gott entbehre bei ihm einer normativen Dimension. Dem steht allerdings entgegen,
daß sich Buber gerade mit dem Ar-
Bücher zum Thema
gument, er führe einen Dialog, dagegen verwahrte, eine Lehre zu verkünden. Das Ideal des Dialogs entbehrt jedoch ebensowenig
der
Normativität wie sein Begriff von
Gemeinschaft und Bund, welche er
gefährdet sieht durch die Lebensbedingungen der modernen Zivilisation. Das Instrumentelle der „Ich-EsWelt“, die Gesellschaft, drohe die
Gemeinschaft zu überwuchern.
Etzioni kategorisiert Buber schließlich als „alten Kommunitarier“. Er
erwähne zwar in „Ich und Du“ die
Verantwortung für den anderen;
aber daraus erwachse wenig „normative Führung“ (49). Im Gegensatz zu den „responsive Communitarians“ kenne Buber keinen Begriff
von individuellen Rechten als „Gegenstück zur Forderung nach gesellschaftlicher Verantwortung“ (49).
Etzioni vergleicht die kommunitarische Betonung der Rolle gesellschaftlicher Normen als Quelle gesellschaftlicher Ordnung und Basis
der Gesetze mit Bubers in „Pfade in
Utopia“ entwickeltem Zusammenhang von vitalem Gemeinschaftsleben und schwachem Staat, bzw. absterbender Gemeinschaft und erstarkendem repressivem Staat.
Etzioni hat in seinem Vortrag gezeigt, wie Elemente der Buberschen
Sozialphilosophie, insbesondere sein
Gemeinschaftsbegriff, dem Kommunitarismus einzuverleibt werden
können. Ob man Martin Buber allerdings mit einer solchen Interpretation gerecht wird, wäre selbst ein
interessantes Vortragsthema. Es
hätte anzusetzen, wo Etzioni aufhört, nämlich bei „Pfade in Utopia“.
Dort legt Buber seinen libertären
Humanismus und Sozialismus –
insbesondere in Anlehnung an und
in Auseinandersetzung mit Gustav
Landauer – dar und entwickelt das
Ideal einer Lebens-, Geistes- und
Arbeitsgemeinschaft, des die frühe
Kibbuzimbewegung in Palästina
prägen sollte.
Marianne Rosenfelder
Richard Faber, Eveline GoodmanThau, Thomas Macho (Hg)
Abendländische Eschatologie.
Ad Jacob Taubes, Würzburg 2001
(Königshausen & Neumann), kart.,
570 S., 98.- DM.
Der von Richard Faber, Eveline
Goodman-Thau und Thomas Macho herausgegebene Band ist das
Ergebnis einer Tagung 1997 anläßlich des 10. Todestags des jüdischen
Religionsphilosophen Jacob Taubes
sowie des 50. Jahrestags des Erscheinens seines Hauptwerks, das
dem Band den Titel gab: Abendländische Eschatologie. Diese ist denn
auch zeitlebens Taubes’ Thema gewesen: die jüdisch-christliche Vorstellung „Dein Reich komme“, der
er
als
der
unterschwelligsubversiven, gegen alles Einverständnis mit ‚dieser Welt’ rebellierenden und revoltierenden Leitidee
in der Geschichte des Abendlandes
nachgegangen ist. Er hat diese Idee
– ob als messianische Diesseitshoffnung, als apokalyptische Endzeitvision oder als gnostische Weltverachtung – der griechisch-römisch
geprägten christlichen Macht- und
Erfolgsgeschichte entgegengehalten.
Der Band dokumentiert den weitverzweigten, oft unterschätzten
Einfluß des Berliner Religionsphilosophen. Er versammelt insgesamt
Bücher zum Thema
35 Beiträge, die eine zumeist kritische Auseinandersetzung mit Taubes’ Überzeugungen, Sichtweisen
und Thesen führen, die das Beieindruckende seiner Persönlichkeit ahnen lassen. Der Leser wird so zu einem Parforceritt durch die Geistesgeschichte
des
Abendlandes
veranlaßt, in der Augustin so präsent ist wie Max Weber, Paulus so
gegenwärtig wie Hegel oder Marx,
und die dem Leser manches abverlangt. Einiges sei genannt: der Beitrag von Christoph Schulte über Paulus, den Taubes als die maßgebliche
Schlüsselfigur des Abendlandes ansah: „Paulus, nicht Jesus ist nach
Taubes der Begründer einer universalen, christlichen Eschatologie und
Geschichtsphilosophie“ (10). Der
Bedeutung der „marcionitischen
Häresie“ in Taubes’ Geschichtsverständnis geht Carsten Colpe nach.
Hans-Jürgen Goertz untersucht seine
Rezeption des Reformators und
Revolutionärs Thomas Müntzer
nach,
dessen
revolutionärer
Wunsch, das Reich Gottes zu realisieren,
prägend
für
die
Herausbildung
des
modernen
zukunftsorientierten
Zeitbewußtseins und den Anfang der modernen Geschichte geworden sei.
Natürlich darf in einer solchen Abendländischen Eschatologie nicht
der ‚Heilsökonom’ Karl Marx fehlen, dessen Deutung und Einordnung Manfred Lauermann durchaus
kritisch nachgeht. Warum in eine
solche Reihe auch der ‚Apokalyptiker’ Kierkegaard und sein Begriff
der Angst gehört, versucht David
Fopp Band
Der
in seinem
umkreist
Beitrag
vieles,
zu klären.
vielleicht
zu vieles: die Voraussetzungen, die
Taubes zu seinem Werk veranlaßt
haben oder haben könnten; die Be-
züge, die er selbst nicht hergestellt
hat, aber hätte herstellen können,
wie die zu Hobbes, Novalis oder
Hölderlin. Man hätte, so scheint
mir, gut und gern auf einige Bezüge
verzichten können, um dafür deutlicher auf Taubes’ gegenwartsbezogenes Anliegen einzugehen, das nur
in einigen Beiträgen deutlich wird,
und das ihn in den 60er Jahren zum
engagierten Befürworter der Studentenbewegung hatte werden lassen, der für ein „Bündnis der Philosophen mit den Partisanen“ (Dreßen,
303)
eintrat.
Den
entscheidenden
Gesichtspunkt
Taubes’ in dieser Debatte scheint
mir sein Verhältnis zu Max Weber
zu markieren, dem A.U. Sommer
nachgeht: Ihm ging es nicht, wie
Weber, um die Genese der modernen Wissenschaft und Technik oder
des Kapitalismus, sondern um das,
was diesem okzidentalen Rationalitätstyp ins Gehege kommt, den Ablauf stört. „Taubes liegt an Revolution, an Um- und Ausbruch, Weber
hingegen am Standhalten unter den
Bedingungen der Moderne.“ (367)
Das Buch ist eine Hommage an einen unbequemen und unorthodoxen, inspirierenden und wohl auch
inspirierten, jüdischen und nichtjüdischen, vorwärts und rückwärts
gewandten, revolutionären und reaktionären Denker, der es weder
sich noch anderen leicht gemacht
hat. „Oft die Koalitionen und die
Waffen wechselnd“, schreibt seine
Frau Margherita von Brentano,
„nirgends ganz zugehörig, kannte er
weder Berührungsängste noch
Loyalitäten: in Gegensätzen denkend und lebend, mißachtete er im
Leben, in der Wissenschaft und in
der Politik die installierten Depar-
Bücher zum Thema
tements. So machte er sich ... immer
wieder auch Freunde zu Gegnern
und Gegner zu Freunden.“ (24)
Alexander von Pechmann
Leon Roth
Is there a Jewish Philosophy? Rethinking Fundamentals, London/
Portland 1999 (The Littman Library
of Jewish Civilization), 199 S.,
15,95 £, 21,95 $.
Leon Roth (1896-1963) war der erste Professor für Philosophie an der
Hebrew University in Jerusalem.
Zusammen mit J.C. Magnes, Martin
Buber und Gershom Scholem stand
er für eine arabisch-jüdische Partnerschaft. Als Ethiker war Roth überzeugter Vertreter einer auf absoluten Werten beruhenden Moral.
Als Lehrer ging es Roth darum, seine Studenten zum Denken zu ermutigen, zum Denken über das Judentum, welches er als Ausdruck des
Monotheismus, als Antithese zum
Mythos und als das Wesen von Ethik und Moralität verstand. Roth
lebte, was er „predigte“. Abgestoßen von den Massakern jüdischer
paramilitärischer
Organisationen,
von den Exzessen des seinem Verständnis nach dem Jüdischen nicht
gemäßen lex talionis und der daraus
resultierenden politischen und moralischen Entwicklung im Nationalstaat Israel kehrte er 1951 in sein
Geburtsland England zurück. Er
wolle lieber Fremder in der Fremde,
als Fremder im eigenen Land sein.
Roths Vortrag vor der Hillel Foundation in London (1960) mit dem
Titel „Is there a Jewish Philosophy?“ ist der Schlüssel zum Verständnis der in diesem Buch veröf-
fentlichten Essays. Die Tatsache,
daß ein Philosoph jüdisch ist oder
auf Hebräisch schreibt, bedeutet
nicht, daß seine Philosophie jüdisch
sei. Genausowenig wie man von einem jüdischen Physiker auf die „jüdische Physik“ schließen könne. Mit
Solo Barons „Social and Religious
History of the Jews“ versteht Roth
Philosophie als „rethinking of fundamentals“. Was sind die Grundlagen und Elemente jüdischen Lebens und jüdischer Geschichte?
Was bleibt an philosophischem Gehalt? Jüdische Philosophie ist nicht,
was jüdische Philosophen von der
jüdischen Kultur ihrer Zeit übernehmen. So war z.B Philo ein großer Jude und interessanter Denker,
er dachte durch und mit Platon und
der Stoa. Seine Interpretation des
Judentums war geprägt von diesen
nicht-jüdischen Denksystemen, welche seine Philosophie konstituierten. Seine Konklusionen waren
nicht das Resultat eines Nachdenkens über die Natur der Dinge,
sondern ein hellenisiertes Denken
über die Natur des Judentums.
Maimonides, Mendelssohn, Cohen
und andere jüdische Philosophen
können nach Roth analog interpretiert werden. Roth präzisiert nun
das Unternehmen „jüdische Philosophie“ folgendermaßen: Philosophie ist das „thinking and rethinking
of fundamentals“ (7). Wird dem
Begriff der Philosophie ein Objekt
zugefügt, ist ihre Anwendung begrenzt. So wie die Philosophie der
Wissenschaft das Denken und Überdenken der Grundlagen der Wissenschaft ist, ist die Philosophie des
Judentums die Reflexion der
Grundlagen des Judentums. Roth
kommt zu folgender Eingrenzung
Bücher zum Thema
seines Themas: „Jewish philosophy,
or rather the philosophy of Judaism,
is the thinking and rethinking of the
fundamental ideas involved in Judaism and the attempt to see them
fundamentally, that is, in coherent
relation one with another so that
they form one intelligible whole“
(8). Das jüdische Denken, so Roth,
ist, auch wenn es sich mit der sog.
abendländischen Philosophie amalgiert, jüdisch, soweit es die Grundlagen des Judentums reflektiert.
Diese Reflexion hat zu beginnen bei
Moses, den Propheten und den
Psalmen. Hier wurden die genuin
jüdischen Prinzipien gelegt, an ihnen hat sich das zu bewähren,was
als jüdische Philosophie gelten
kann. Jüdische Philosophie heute
kann nur dann lebendige Philosophie sein, wenn sie sich auf die klassischen jüdischen Philosophen
stützt, welche sich an Moses und die
Propheten anlehnen und gegen das
Mythische auflehnen. Für Roth ist
das Judentum der klassische Ausdruck des Monotheismus und seiner
Implikationen für die Wissenschaft,
vor allem aber für die Moral.
In den in diesem Band veröffentlichten Essays widmet sich Roth
folgenden Themen: die Imitatio Dei
und die Idee der Heiligkeit; jüdisches Denken als Beitrag zur Zivilisation; die Bedeutung der biblischen
Prophetie in unserer Zeit; Reflexionen über die Interpretation der heiligen Schrift; Elemente des Judentums; Autorität, Religion und Gesetz im Judentum; Moral und
Demoralisierung in der jüdischen
Ethik sowie Mystik. Besondere
Aufmerksamkeit widmet Roth der
religiösen Relevanz Spinozas für das
heutige Judentum und den jüdi-
schen Denkern Maimonides und
Ahad Ha’am, dem herausragenden
Vertreter eines kulturellen Zionismus.
Das Judentum hat der Welt die Bibel geschenkt. Wer sich auf die Lektüre Roths einläßt, sei auf eine akribische Exegese philosophischer
Texte auf ihren biblischen hebräischen Ursprung hin gefaßt.
Marianne Rosenfelder
Werner Stegmaier (Hg.)
Die philosophische Aktualität
der jüdischen Tradition.
Frankfurt/Main 2000 (Suhrkamp),
kart., 516 S., 32,90 DM.
Die Anregung zu dem von Werner
Stegmaier (Philosophie, Greifswald)
herausgegebenen Band gab der Vorstoß Emmanuel Levinas’ „die europäische Philosophie von der
jüdischen Tradition her zu begrenzen und so neu zu begreifen“, wie
der Herausgeber selbst in seinem
Levinas gewidmeten Beitrag aufzeigt. Auf den Spuren von Levinas
hat mit Jacques Derrida einer der
meist diskutiertesten Theoretiker
der Gegenwart die jüdische Tradition entdeckt und zu seinem Denken
in Beziehung gesetzt – thematisiert
im Beitrag von Elisabeth Weber
(Philosophie, Santa Barbara, Cal.).
Erkannte Derrida in der Orientierung an der Schrift „einen Ursprung
des
philosophischwissenschaftlichen Denkens, dem es
sich maßgeblich verdankte und den
es dennoch verkannte und herabwürdigte“, so begann doch die jüdische Tradition als Orientierung an
der Schrift. Wie sich das Denken
Bücher zum Thema
Levinas’ und Derridas jedoch nicht
darauf beschränkt, die jüdische Tradition freizulegen, so versucht umgekehrt der im vorliegenden Werk
präsentierte Ansatz die Frage der
philosophischen Aktualität jüdischer
Tradition über die ermutigenden
Anfänge der beiden französischen
Philosophen hinausgehend im Ganzen neu zu stellen. Daß ein derartig
weitreichendes Forschungsprojekt
nur auf interdisziplinärem Wege angegangen werden kann, dokumentieren die hier versammelten Beiträge von Philosophen und Kulturwissenschaftlern
verschiedener
Provinienz, die im September 1998
an der internationalen Forschungskonferenz auf der Ostseeinsel Hiddensee teilgenommen hatten.
Ziel dieses komplexen Forschungsansatzes ist es nicht, wie in gewohnter Sichtweise, die jüdische Tradition an den in der griechischen Antike wurzelnden Rationalitätskriterien
philosophisch-wissenschaftlichen
Denkens zu messen, unter denen sie
willkürlich und irrational erscheint,
sondern in umgekehrter Blickrichtung jene zum Horizont kritischer
Reflexion dieser Kriterien zu machen. Diese gewissermaßen verfremdende Perspektive ermöglicht
ebenso die feste Grenzziehung zwischen europäischen Rationalitätsstandards und der weit älteren jüdischen Tradition der Auslegung der
Tora zu hinterfragen, wie Grundentscheidungen der europäischen
Philosophiegeschichte im Licht ihrer Auseinandersetzung mit der jüdischen Tradition kritisch zu reflektieren. Diese Problemstellung umfaßt jedoch nicht nur den Blick
griechisch-europäischen Denkens
auf die jüdische Tradition, sondern
umgekehrt auch die Auseinandersetzung herausragender Vertreter
jüdischen Denkens mit den Standards europäischen Denkens.
Diese vielschichtigen Fragestellungen geistesgeschichtlich unter aktualisierender Perspektive auszuloten,
bestimmt die Themenkomplexe und
Gliederung des Bandes, der so nicht
als Textsammlung zu einem Thema,
sondern als arbeitsteilig erstelltes
kohärentes Werk gelesen werden
sollte. Der zugrunde liegenden Ausrichtung entsprechend bilden den
Anfang Beiträge, in denen den Ursprüngen der jüdischen Tradition
der Auslegung der Tora nachgegangen wird – der zentralen Bestimmung der „Orientierung“ als dem
praktisch-ethischen Handeln im
Kontext unterschiedlicher und pluraler Auslegungen der Tora und ihrer Verschriftung, die sich einer für
das griechisch-europäische Denken
spezifischen Vereinheitlichung im
reinen Denken entziehen. Diese
Denkweise schlägt sich, so Johann
Maier (Judaistik, Köln) auch in der
Präferenz geteilter und konkurrierender politischer Autoritäten nieder – Alleinherrscher wie Moses
und David bilden Ausnahmen.
In einer anschließenden zweiten
Abteilung werden „hermeneutische
Standards der Auslegung der Tora
in der jüdischen Tradition“ im Hinblick auf die Auseinandersetzung
mit der griechischen Philosophie
ausgelotet, mit dem besonderen Interesse, welche Maßstäbe der Tora
in der jüdischen Tradition für die
Philosophie bedeutsam wurden und
neu aktuell werden könnten. Die
damit verbundene Intention, herkömmliche Grenzen zu überschreiten und die Horizonte jüdischer
Bücher zum Thema
Tradition und Philosophie füreinander zu öffnen, visieren diverse
Beiträge über Philon von Alexandrien und vor allem den bedeutendsten jüdischen Philosophen, Maimonides, der im Mittelpunkt dieses
Themenkomplexes steht, an. Von
den Auseinandersetzungen um
Maimonides ausgehend, werfen Beiträge einer dritten Abteilung die
Frage „nach Bedingungen und
Möglichkeiten jüdischen Philosophierens, nach Berührungen und
Auseinandersetzung der jüdischen
Tradition mit der griechischen und
christlichen Philosophie“ auf. Der
religionsvergleichende Diskurs des
Mittelalters werde hierbei zu einer
Wurzel dessen, was man in der
Neuzeit dann „jüdische Philosophie“ nennen konnte.
Die Wirkungen der jüdischen Tradition auf die europäische Philosophie
aufzuspüren, erweist sich um so
schwieriger, je vielfältiger jene sich
selbst, nicht nur in Tora und Talmud, sondern auch als Kabbala,
Mystik und Magie präsentiert. In einer vierten Abteilung verdeutlicht
dies Manfred Walther (Rechtsphilosophie, Hannover), der das Problem
erörtert, ob das Denken Spinozas,
also des Juden, der am meisten die
europäische Philosophie beeinflußte, als Jüdische Philosophie bezeichnet werden könnte. Im Mittelpunkt dieser vierten Abteilung steht
Moses Mendelssohn und der aus
der Spannung seines Denkens zwischen dem Bekenntnis zur jüdischen Tradition einerseits, zum
Vernunftbegriff der Aufklärung andererseits resultierende Versuch der
Begründung des Judentums als einer Religion der Vernunft. Dies
kennzeichnet Daniel Krochmanik (Jü-
dische Philosophie, Heidelberg)
durch das Sokratische Motiv im
Denken Mendelssohns. „Das Judentum Mendelssohns war eben
dadurch philosophisch aktuell, daß
es im Gegensatz zum Christentum
sokratisch sein konnte, nicht nur
nicht auf Dogmen festgelegt, sondern kritisch gegen alle Dogmen“.
Konsequent unterscheidet Mendelssohn im Judentum zwischen dem
jüdischem Gesetz, der Halacha, die
er als Verhaltensregel ohne Zwang
deutet und der Religion als Glaube.
Eine kritische Würdigung erfährt
Mendelssohn im Denken Kants.
Zwar verwirft Kant implizit in seiner Widerlegung aller Gottesbeweise auch den Ansatz Mendelssohns,
doch wie sich Kant andererseits der
Mendelssohnschen Deutung des
Glaubens als Handlungsglauben annähert, so findet dessen, aus seinem
Verständnis der jüdischen Tradition
gewonnener, Begriff der „Orientierung“ Eingang in die Kantische
Konzeption der Vernunft. Josef Simon (Philosophie, Bonn) zeichnet
das gedankliche Religionsgespräch
nach, das Kant nach dem Tod
Mendelssohns in seinen späten
Schriften mit ihm führte.
Die vom jungen Hegel behauptete
im Denken Mendelssohns nicht
aufgelöste Unterscheidung zwischen
Autonomie des Denkens und Heteronomie (des Gesetzes) „sollte zum
Leitmotiv der Frage nach der philosophischen Aktualität der jüdischen
Tradition im 20. Jahrhundert werden“. Unter dem Eindruck eines
wachsenden Antisemitismus entschied sich Hermann Cohen, renommierter Neukantianer und als
erster Jude Professor der Philosophie in Deutschland, sich dem Ju-
Bücher zum Thema
dentum zuzuwenden. Diese späte
Wendung Cohens fand ihren Niederschlag in dem richtungsweisenden Werk „Religion der Vernunft
aus den Quellen des Judentums“.
Im Unterschied zu Philon, Maimonides oder Mendelssohn, die jüdische Religion und europäische Vernunft in Einklang bringen wollten,
führt Cohens Weg über die europäische Philosophie hinaus zum Judentum zurück. In seinem, die fünfte
und letzte Abteilung einleitenden
Beitrag beschreibt Rainer Wiehl (Philosophie, Heidelberg) den Versuch
Cohens, in seiner „Logik des Ursprungs“ und seiner „Methode der
Reinheit“ die „reine“ Vernunft
Kants und Platons mit dem jüdischen Monotheismus zu verbinden,
den er als den eigentlichen philosophischen Ursprung bestimmt. Einen
ganz anderen Weg beschreitet Cohens Schüler Franz Rosenzweig in
dessen
philosophisch-religiösem
Entwurf der Existenz das Jüdische
als eine Möglichkeit aufgehoben ist.
Zurecht bezweifelt Micha Brumlik
(Erziehungswissenschaft,
Heidelberg), ob hier noch von jüdischer
Tradition zu sprechen ist.
Den Abschluß des Bandes, nach
den eingangs erwähnten Beiträgen
über Levinas und Derridas bildet
schließlich die Stellungnahme des israelischen Philosophen Ze’ev Levi,
die die aktuelle Philosophie zur Politik hin überschreitet, in der der
Umgang mit der Tradition zur existentiellen, über Krieg und Frieden
entscheidenden Frage werden kann.
Für Levis Plädoyer, „die Auslegung
der Tora als Lebensorientierung
weiter offen zu halten“, kann die
Philosophie mit der tradierten Frei-
heit ihres Denkens Hilfestellung
bieten.
Georg Koch
Joachim Valentin, Saskia Wendel
(Hg)
Jüdische Traditionen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts
Darmstadt 2000 (Wiss. Buchgesellschaft), geb., 298 S., 64.- DM.
Die Herausgeber Saskia Wendel
und Joachim Valentin haben unter
dem Titel „Jüdische Traditionen in
der Philosophie des 20. Jahrhunderts“ Beiträge verschiedener Autoren versammelt, die dem „Jüdischen“ jüdischer Denker nachgehen. Sie tragen damit, so will mir
scheinen, dem Umstand Rechnung,
daß die Philosophie nicht in oder
aus Traditionen besteht, sondern
daß sie von einzelnen Menschen betrieben wird. Chronologisch werden
insgesamt sechszehn DenkerInnen
bzw. PhilosophInnen von F. Rosenzweig über M. Horkheimer,
Th.W. Adorno und H. Jonas bis zu
Simone Weil, J.-F. Lyotard und J.
Derrida vorgestellt. Ihnen geht eine
einleitende Betrachtung des katholischen Sozialethikers W. Lesch über
das Verhältnis von Religion und
Philosophie, von „Jerusalem und
Athen“, voraus.
So sehr es die Autoren durch den
biographischen Zugang vermeiden,
von einer „Essenz“ des Jüdischen
oder einer „jüdischen Identität“
auszugehen – was die beiden Herausgeber in ihrer Einleitung auch
ausdrücklich abweisen –, so sehr
besteht nun aber umgekehrt die Gefahr, bei den verschiedensten Den-
Bücher zum Thema
kern ihrer jüdischen Geburt und
Herkunft wegen irgend etwas „Typisch Jüdisches“ zu finden, wie das
Bilderverbot oder die Heimatlosigkeit, und fein säuberlich herauszupräparieren. Sicherlich tut solches
Vorgehen den explizit jüdischen
Denkern wie F. Rosenzweig, G.
Scholem, E.L. Fackenheim oder
auch E. Lévinas keinen Zwang an;
bei anderen aber, wie H. Arendt, V.
Flusser oder J. Derrida kann dies
dazu führen, auch noch das NichtJüdische im Denken dieser jüdischen Denker als besondere Weise
des Jüdischen zu erklären. Die Autoren tragen diesem Bedenken insofern Rechnung, als sie selbst auf
das Problematische hinweisen (siehe
insb. C. und P. Althaus über H. Arendt (163), auch A. Hillach über V.
Flusser (214-230)).
Der Vorteil dieses bio- wie monographischen Verfahrens besteht
zweifellos darin, gleichsam autobiographisch die Auseinandersetzung
der DenkerInnen sowohl mit ihrer
nichtjüdischen Umwelt als auch mit
ihrer jüdischen Herkunft und Tradition nachvollziehen und dadurch die
Problematik der „Judenfrage“ im
20. Jahrhundert auf ‚höchstem Niveau’ transparent machen zu können. Es erinnert und vergegenwärtigt den unverlierbaren Anteil des
Jüdischen an der Philosophie und
weit darüber hinaus am Geistesleben Europas in diesem Jahrhundert.
Allerdings bleiben, weil in die monographische Darstellung einverwoben, die aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen nur implizit. So
meine ich, in allen Darstellungen eine fundamentale Distanz dieser
DenkerInnen zur Macht zu erkennen, die sich freilich ganz unter-
schiedlich ausgeprägt und artikuliert
hat, sowie ein tiefes Mißtrauen gegenüber den Ansprüchen einer europäischen
„ordnungsgemäßen
Vernunft“. Sie unterlaufen allesamt
die gängige Vorstellung vom Bruch
zwischen Religion und Aufklärung,
zwischen Vor- und Moderne. Nicht
zufällig steht geschichtlich am Beginn F. Rosenzweig, der dem Aufklärerprojekt H. Cohens und einer
„Wissenschaft des Judentums“ angesichts der Exzesse des 1. Weltkrieges vorhält, den Aufklärern auf
den Leim zu gehen und damit „ein,
wenn auch, ehrenvolles ‚Begräbnis
des Judentums’“ (89) zu inszenieren. Auch wenn diese Vorbehalte
sich ganz unterschiedlich geäußert
haben, so stellen doch alle die so
‚vernunftgemäße’ Unterscheidung,
Ordnung und Gliederung in Religion und Theologie einerseits und
Vernunft und Philosophie andererseits, in eine theoretische und eine
praktische Philosophie, in die
Grundlagen- und die Einzelwissenschaften in Frage. Allemal ist ihr
Denken grenzenüberschreitend und
–überwindend, oszilliert und changiert zwischen scheinbar disparaten
Ebenen und Feldern; und allesamt
sind sie dem Vorwurf des Irrationalismus ausgesetzt gewesen. Wer es
sich leicht macht, mag darin das Erbe einer jüdischen Tradition erkennen, die, vormodern, den Prozeß
der Ausdifferenzierung in wohlunterschiedene Subsysteme noch nicht
internalisiert hat und noch in ‚Zusammengehörigkeitsträumen’
schwelgt. Alle Beiträge aber machen
mehr oder weniger deutlich, daß
diese Auseinandersetzung mit der
Moderne, angefangen mit der Glaubensphilosophie F. Rosenzweigs,
Bücher zum Thema
über die bekannte „Dialektik der
Aufklärung“ M. Horkheimers und
Th.W. Adornos bis zu J.-F. Lyotards Kritik einer positiven und darstellenden Vernunft und Derridas
Kritik des europäischen Logo- und
Phonozentrismus, zwar in der jüdischen Tradition wurzelt oder zu-
mindest durch sie angeregt ist, daß
diese
jüdischen
DenkerInnen
gleichwohl ein unentbehrlicher Stachel im Fleische einer allzu selbstgewissen europäischen Vernunft
waren und sind.
Alexander von Pechmann
In: Widerspruch Nr. 37 Jüdisches Denken – Jüdische Philosophie (2001), S. 100-106
Autor: Günter Zöller
Artikel
Günter Zöller
Lehr- und Wanderjahre
Gerne folge ich der Einladung von „Widerspruch“, mich, der ich erst seit
relativ kurzer Zeit zu den Münchener Philosophen gehöre, den Leserinnen und Lesern dieser Zeitschrift vorzustellen.
Anfang 1999 bin ich, einem Ruf an die Universität München folgend,
nach fast zwanzig Jahren Studium, Lehre und Forschung im Ausland
nach Deutschland zurückgekehrt. Die lange Zeit in anderen europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten hat meine philosophische
Arbeit und meine Einstellung zum akademischen Lehren, Lernen und
Forschen sicher ebenso nachhaltig geprägt wie mein vorheriges Studium
der Philosophie in Deutschland. Seit meinem Studienbeginn Mitte der
siebziger Jahre habe ich, oft aus größter Nähe, Erfahrungen gemacht mit
einem ganzen Spektrum von philosophischen Positionen und Schulrichtungen. Die Orts- und Länderwechsel haben mir auch ein umfassendes
Bild der vielfältigen universitären Landschaft in Westeuropa und den
Vereinigten Staaten vermittelt. Beides, die philosophisch-inhaltliche wie
die akademisch-strukturelle Perspektivenvielfalt, hat dazu beigetragen,
daß ich einen gewissen Abstand zur Situation der Philosophie und der
Universität in Deutschland gewonnen habe. Diese Distanz läßt mich das
Gute schätzen und dem weniger Guten mit Geduld, aber auch mit Widerstand begegnen. Im folgenden will ich einige nähere Angaben zu
meinem philosophischen Werdegang kurz und knapp in den Kontext der
Gegenwartsphilosophie stellen.
Günter Zöller
Während meines Philosophiestudiums in Bonn in der zweiten Hälfte der
siebziger Jahre habe ich von Anfang an die Beschäftigung mit dem Werk
Kants und mit den Bemühungen um dessen philosophische Aktualisierung gesucht. Über den einen meiner akademischen Lehrer, Hans Wagner, konnte ich noch die äußerste Spätphase des Neukantianismus aufnehmen, in der es - unter Berücksichtigung von Husserls Phänomenologie und Heideggers Fundamentalontologie - zur Wiederaufnahme und
Fortführung der geltungstheoretischen Orientierung des klassischen,
erkenntnistheoretischen Neukantianismus kam.
Besonders nachhaltig hat mich dabei das systematische Vorhaben einer
transzendentalen Subjektstheorie, einschließlich der Theorie der konkreten, leiblich-individuell verfaßten Subjektivität, beeinflußt. Wichtig war
für mich dabei die Bekanntschaft mit den z.T. erst von Hans Wagner aus
dem Nachlaß edierten Arbeiten von Richard Hönigswald, der von 1930
bis zu seiner Zwangsversetzung in den Ruhestand im Jahre 1933 in
München gelehrt hatte. Nach der Pogromnacht des 9. November 1938
und nach einem mehrwöchigen Aufenthalt im Konzentrationslager Dachau konnte Hönigswald Deutschland im darauffolgenden Jahr noch
verlassen.
Der andere große Einfluß aus meiner Studienzeit war die, auf stupender
Textkenntnis beruhende, Kantdeutung meiner akademischen Lehrerin
Ingeborg Heidemann, die über ihre akademischen Lehrer Nicolai Hartmann, Gottfried Martin und Heinz Heimsoeth und unter dem Einfluß
Heideggers eine ontologisch-metaphysische Kantdeutung in Reaktion
auf das Kant-Bild des Neukantianismus vertrat.
Des weiteren hat mich die von der philosophischen Anthropologie und
der Existenzphilosophie her entwickelte Fichte-Interpretation meines
dritten akademischen Lehrers, Peter Baumanns, gründlich und umfassend in das Werk Fichtes eingeführt. Zu Fichte bin ich, nach Jahren der
eigenen Arbeit zu Kant, seit Mitte der neunziger Jahre mehr und mehr
zurückgekehrt, ohne allerdings den historischen und systematischen
Rückbezug auf Kant je aufgegeben zu haben. Prägend war schließlich
auch die problemorientierte Aktualisierung der Kantischen Transzendentalphilosophie durch Gerold Prauss, der Schüler von Martin und Wagner
gewesen war und der zu Beginn meiner Studienzeit noch in Bonn lehrte.
Lehr- und Wanderjahre
Insgesamt haben mir meine Bonner Studienjahre nachhaltig eine normative Konzeption von Philosophie als systematischer Grundwissenschaft
vermittelt, bei der der systematische Anschluß an transzendentalphilosophisches Denken mit der historischen Orientierung an Kant und Fichte
zusammengeht.
Ende der siebziger Jahre habe ich dann, nach dem Magisterabschluß mit
einer systemvergleichenden Arbeit zu Kant und Heidegger, das Studium
in Bonn unterbrochen, um an der Ecole normale supérieure in Paris bei
Jacques Derrida und am Collège de France bei Jules Vuillemin zu studieren. Ich habe damals außerdem an Lehrveranstaltungen von Louis
Althusser, Michel Foucault und Roland Barthes teilgenommen. In Derridas geschlossenen Seminaren für die Studierenden der Ecole und seinem
Privatissimum hat mich besonders der exakte, ganz unmanipulative,
dabei aber originelle Umgang mit klassischen philosophischen Texten
beeindruckt. Jules Vuillemin gehörte damals zu den ersten, die sich in
Frankreich mit amerikanischer analytischer Philosophie auseinandersetzten, und mein eigenes philosophisches Interesse ist dadurch dauerhaft in
diese Richtung gelenkt worden.
Schon während der Arbeit an meiner Bonner Dissertation zur theoretischen Gegenstandsbeziehung bei Kant bin ich dann zu weiteren Studien
in die Vereinigten Staaten gegangen, und zwar an die Brown University,
eine der Ivy League Schools im Nordosten der U.S.A., wo Roderick
Chisholm lehrte, der zusammen mit Quine und Wilfrid Sellars zu den
Großen der amerikanischen Nachkriegsphilosophie gehörte. Dabei war
Chisholm mehr als die beiden anderen historisch interessiert, allerdings
primär im Sinne der geschichtlichen Anregung und Verortung der eigenen Arbeiten auf den Gebieten von Erkenntnistheorie, Metaphysik und
Ethik in der europäischen philosophischen Tradition. Der Hauptbezugspunkt bei Chisholm war die österreichische philosophische Tradition,
speziell Franz Brentano und seine Schüler, und hier insbesondere Meinong sowie Husserl. Nach Hans Wagner war Chisholm für mich der
zweite akademische Lehrer, der es vorbildlich verstand, historische philosophische Autoren im Kontext der eigenen systematischen philosophischen Anstrengungen wiederaufzunehmen. Insbesondere seine Arbeiten
zur Intentionalität und Subjektivität des Mentalen haben meine kantisch-
Günter Zöller
neukantianische Grundausrichtung in der Philosophie in methodischer
wie sachlicher Hinsicht wesentlich erweitert.
Nach anfänglicher Tätigkeit als Dozent für Deutsch an der Brown University habe ich dann Mitte der achtziger Jahre in die philosophische
Lehre übergewechselt, war zunächst als Assistant Professor am Grinnell
College, einem der zehn führenden privaten Liberal Arts Colleges des
Landes, dann an der University of Iowa. Letztere ist eine der großen
staatlichen Forschungsuniversitäten des Mittleren Westens, die in dieser
Region die Funktion der Privatuniversitäten an der Ostküste als Stätten
von spezialisierter, fortgeschrittener Forschung und Lehre ausüben. Ich
habe dort die akademische Laufbahn vom Assistant Professor über die
Gewährung von Tenure (Lebenszeitanstellung) als Associate Professor
bis zum Full Professor durchlaufen und war auch Departmental Executive Officer oder Chair des Philosophie-Departments an der University
of Iowa.
Philosophisch bestand an der University of Iowa eine ungewöhnliche
Situation, insofern die analytische Philosophie zwar dominierte, aber
keiner der Kollegen ihrer damals noch vorherrschenden Variante als
Sprachanalyse anhing. Eher wurde phänomenologisch unterfütterte Begriffsanalyse betrieben unter dem Einfluß von Roderick Chisholm und
von Gustav Bergmann, einem Mitglied des Wiener Kreises, der seit den
späten dreißiger Jahren im Philosophie-Department der University of
Iowa mit beträchtlichem Einfluß auf die amerikanische Nachkriegsphilosophie gewirkt hatte („Iowa ontology“) und erst kurz nach meinem Eintritt ins Department verstarb. Auch die weit verbreitete materialistische
Wende in der Philosophie des Geistes hat der Bergmann-Schülerkreis
nicht vollzogen. Ich selber habe während meiner Zeit an der University
of Iowa vor allem zu Problemen der theoretischen Philosophie Kants
publiziert, mit Forschungen und Veröffentlichungen zu Fichte und
Schopenhauer begonnen und über Philosophie der Neuzeit, Gegenwartsphilosophie, Ästhetik sowie Kunst- und Musikphilosophie Lehrveranstaltungen abgehalten. Meine sieben Doktoranden aus dieser Zeit sind
inzwischen selber als Professorinnen und Professoren an amerikanischen
Universitäten und Colleges tätig.
Lehr- und Wanderjahre
Neben den beinahe tagtäglichen Gedankenaustausch mit den eigenen
Kollegen, wie er in den U.S.A. üblich ist, trat der enge, langjährige und in
vielen Fällen bis heute anhaltende regelmäßige Kontakt mit „fellow Kantians“ an anderen Universitäten und Colleges, der hauptsächlich auf
regionalen, nationalen und internationalen Tagungen und Kongressen
gepflegt wurde. Ich habe im Laufe meiner Zeit in den U.S.A. aus nächster Nähe miterleben können, wie die Beschäftigung mit Kant sich aus
recht bescheidenen Anfängen, die zumeist von englischer Seite angeregt
waren, in eine förmliche akademische Industrie gewandelt hat. So war
ich 1985 Gründungsmitglied der North American Kant Society, war
auch über mehrere Jahre hinweg in Ämtern dieser Organisation tätig und
gehöre weiterhin zu den Herausgebern ihres Publikationsorgans, den
North American Kant Society Studies in Philosophy, sowie zum Stab der
Editoren der auf insgesamt fünfzehn Bände angelegten Kant-Ausgabe
bei Cambridge University Press. Während noch vor zwanzig Jahren das
Studium Kants in Nordamerika im wesentlichen auf die Kritik der reinen
Vernunft und die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten in englischen
Übersetzungen beschränkt war, sind heute die meisten von Kants
Druckschriften in modernen englischsprachigen Übersetzungen verfügbar, und viele amerikanische Kolleginnen und Kollegen konsultieren und
zitieren ausgiebig den deutschen Originaltext.
In der nordamerikanischen Fichte-Forschung habe ich ähnliche, wenn
auch dem Ausmaß nach geringere Veränderungen miterleben können.
Fichtes Schriften aus der Jenaer Zeit werden binnen kurzem komplett in
neuen englischsprachigen Übersetzungen vorliegen. Seit 1992 veranstaltet die North American Fichte Society alle zwei Jahre in Nordamerika
eine Tagung zu einem Thema oder Werk Fichtes, deren Beiträge dann in
Auswahl in Sammelbänden publiziert werden.
Zu den positiven Erfahrungen meiner langjährigen Lehr- und Forschungstätigkeit in den U.S.A. gehört auch die im Wettbewerb erfolgende Vergabe von Forschungsstipendien verschiedener Provenienz und
Dauer, die unter teilweiser oder vollständiger Freistellung von Lehrverpflichtungen das eigene Forschen und Publizieren gezielt fördern. Ich
selber habe mehrfach solche Förderung, die über die Gewährung regulärer Freisemester hinausgeht, genossen, teils von meiner eigenen Universi-
Günter Zöller
tät gewährt, teils von der nationalen Stiftung für Forschung in den Humanwissenschaften (National Endwoment for the Humanities, Washington, D.C.), bei der meine deutsche Staatsbürgerschaft kein Hinderungsgrund für die finanzielle und ideelle Unterstützung war. Im Rahmen
dieser langen Reihe von Forschungsstipendien habe ich damals auch die
geographische und kulturelle Isolation im Mittleren Westen immer wieder kompensieren können durch Forschungsaufenthalte an der Ostküste
(Harvard University, Brown University), in England (Queen's College,
Oxford), Paris (Ecole normale supérieure) und Deutschland (Universität
Tübingen). Gegen Ende meiner Zeit in den U.S.A. kam dann noch eine
Beurlaubung zur Wahrnehmung einer Gastprofessur an der Princeton
University hinzu.
Wenn ich nach all den positiven akademischen Erfahrungen im Ausland
dennoch nach Deutschland zurückgekehrt bin, dann liegt das vor allem
an den besonderen Arbeitsmöglichkeiten, die mir die Professur an der
Universität München bietet. Kant und der deutsche Idealismus gehören
zu den traditionellen Schwerpunkten der Münchener Philosophie. Aufgrund der besonders reichen personalen Ausstattung in diesem Bereich
ergibt sich in München die Möglichkeit zu Forschungs- und Lehraktivitäten auf hohem Niveau. Hinzukommt, daß viele der jüngeren Kolleginnen und Kollegen selber in England oder in den U.S.A. studiert oder
gelehrt haben. Damit ist durchweg eine Beachtung gewisser analytischer
Standards im Umgang mit historischen philosophischen Texten und
Problemstellungen gewährleistet. Schließlich habe ich aufgrund der seit
langen Jahren bestehenden weltweiten Bedeutung Münchens als Forschungszentrum zur Philosophie Fichtes hier die Gelegenheit, mit Studierenden sowie Fachkolleginnen und Fachkollegen aus Europa und
Übersee in der Avantgarde der Fichte-Forschung tätig zu sein.
Auch nach meinem Weggang aus den U.S.A. unterhalte ich weiterhin
enge Kontakte zu amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, auch zu
wissenschaftlichen Verlagen und Zeitschriften dort. Ich nehme auch
noch regelmäßig an philosophischen Tagungen in den U.S.A. teil und bin
bemüht, im Gegenzug amerikanische Kolleginnen und Kollegen für
Vorträge und andere Beiträge zur philosophischen Forschung und Lehre
in München zu gewinnen.
Lehr- und Wanderjahre
Gewiß ist an den deutschen Universitätsverhältnissen allgemein und
speziell an der Lage der Philosophie in Deutschland manches auszusetzen, insbesondere die mannigfaltige Überlastung der Lehrenden, damit
verbunden die fehlende Betreuung und Beratung der Studierenden, die
oft einseitig betriebene und von einem oberflächlichen Informationsstand geprägte Fixierung auf die U.S.A. und der politische octroi von
Universitätsreformen. Doch weiß ich aus eigener Anschauung, daß man
anderswo nicht ohne universitäre Probleme lebt, sondern allenfalls mit
anderen.
Bei aller grundsätzlichen Zufriedenheit mit meinen Arbeitsmöglichkeiten in München möchte ich aber meine persönlichen und fachlichen
Erfahrungen im Ausland nicht missen. Insbesondere bin ich davon überzeugt, daß die Zeit im Ausland und die Lehrtätigkeit in Deutschland
bei mir in der richtigen Reihenfolge stattgefunden haben. Das hat es mir
erspart, als akademischer Knecht beginnen zu müssen und hat mir von
Anfang an die relativ freie Entfaltung meiner Interessen und Fähigkeiten
ermöglicht.
Im Rahmen meiner Münchener Professur will ich auch in Zukunft im
systematischen Bereich der Transzendentalphilosophie, speziell der Subjektstheorie, und in philosophiegeschichtlicher Hinsicht über Kant und
den deutschen Idealismus sowie die Philosophie des neunzehnten und
zwanzigsten Jahrhunderts lehren und forschen. Dazu kommt ein langjähriges Interesse an Ästhetik und Kunstphilosophie, das ich unter Einbezug der vielfältigen Möglichkeiten des Münchener Kultur- und Kunstlebens weiter pflegen will. Zu meinen konkreten Projekten gehört eine
national und international besetzte Vortragsreihe an der Universität
München zu Fichtes praktischer Philosophie im Wintersemester 2001-02
sowie die Ausrichtung des Kongresses der Internationalen JohannGottlieb-Fichte-Gesellschaft an der Universität München im Jahre 2003.
Bis dahin hoffe ich auch die noch aus den U.S.A. mitgebrachten editorischen Projekte zu Kant und Fichte abgeschlossen zu haben. Meine Lehrund Wanderjahre werden hoffentlich nicht so schnell zum Abschluß
kommen.
In: Widerspruch Nr. 37 Jüdisches Denken – Jüdische Philosophie (2001), S. 107-137
Neuerscheinungen
Besprechungen
Neuerscheinungen
Theodor W. Adorno
Zur Lehre von der Geschichte
und von der Freiheit
Nachgelassene Schriften, Abt. IV:
Vorlesungen Bd. 13, hg. vom Th.W.
Adorno Archiv, hg. von R. Tiedemann, Frankfurt/Main 2001 (Suhrkamp), Ln. geb., 491 S., 64.- DM.
Die Vorlesung „Zur Lehre von der
Geschichte und von der Freiheit“,
mit der Adorno im Wintersemester
1964 sein geschichtsphilosophisches
Kolleg
beschloss,
behandeln
„Komplexe aus einem philosophischen work in progress“; mithin
geht es „um Proben dialektischer
Philosophie, einmal das Verhältnis
von Weltgeist und Naturgeschichte,
zum anderen die Lehre von der
Freiheit betreffend“ (10). Gemeint
sind die beiden ersten Modelle aus
der 1966 fertig gestellten „Negativen Dialektik“ – das dritte Modell,
die „Meditationen zur Metaphysik“,
spielt gleichsam in die Vorlesung, ist
aber auch Thema einer bereits im
Rahmen der Nachlassschriften veröffentlichten Vorlesung von 1965
(Metaphysik. Begriff und Probleme,
1998). Zudem weist das Vorlesungsthema – wie überhaupt das Projekt
der „Negativen Dialektik“ – auf
früheste philosophische Problemlagen Adornos hin, wie er sie schon in
seinen beiden Vorträgen „Die Aktualität der Philosophie“ und „Die
Idee der Naturgeschichte“ expliziert
hatte.
Geschichte und Freiheit sind dabei
selbst als eine dialektisch vermittelte
Begriffsfiguration zu denken. Es
geht Adorno um „das Verhältnis
von Individuum und Freiheit, das ja
mit dem Verhältnis des Allgemeinen, der großen objektiven Tendenz, zum Besonderen weitgehend
identisch ist“. Eingeschlossen sind
somit auch philosophische Gesichtspunkte der Erfahrung, des
Subjekts, des Sinns, des Fortschritts
und des Bewusstseins, – eigentlich
Grundprobleme dialektischen Philosophierens, die immer wieder die
Auseinandersetzung mit Hegels
„Logik“ berühren – Infragestellungen des Identitätspostulats. Insofern
rekurriert Adorno auch auf seine
„Drei Studien zu Hegel“ aus dem-
Neuerscheinungen
selben Arbeitszeitraum, die die Vorlesung gewissermaßen kommentierend begleiten.
In der „Negativen Dialektik“ heißt
es konzentriert: „Keine Universalgeschichte führt vom Wilden zur
Humanität, sehr wohl eine von der
Steinschleuder zur Megabombe. Sie
endet in der totalen Drohung der
organisierten Menschheit gegen die
organisierten Menschen, im Inbegriff von Diskontinuität. Geschichte
ist die Einheit von Kontinuität und
Diskontinuität.“ (ND, 314) Dies berührt den Übergang von idealistischer Subjektphilosophie zur materialistischen Diagnose einer „Dialektik der Aufklärung“, wie Adorno
und Horkheimer sie als kritische
Theorie der Gesellschaft entworfen
haben: „weil der Sinn, den die Geschichte qua Logik der Dinge hat,
nicht der Sinn des individuellen
Schicksals ist, sondern dem Individuum gegenüber immer als ein
Blindes, Heteronomes und potentiell Zerstörendes überhaupt sich
gibt. Und diese Einheit des zu
Durchdringenden und des Undurchdringlichen, oder, wenn ich es
so formulieren darf, diese Einheit
von Einheit und Diskontinuität ist
eigentlich das Problem der geschichtsphilosophischen Konstruktion.“ (43 f.)
Der derart geschichtsphilosophisch
fundierte Begriff der Freiheit ist als
Dialektik von Identität, Bewusstsein
und Unfreiheit darzustellen; angesichts der gegenwärtigen Weltkrisenlage, die ihre Kriegshandlungen
als Verteidigung der persönlichen
Freiheitsrechte und überhaupt der
Freiheit der Person verteidigen vorgibt, eine hochaktuelle Kritik, wenn
es in Adornos Vorlesung heißt:
„Persönlichkeit ist die Karikatur
von Freiheit.“ (370) Doch beweist
sich in dieser Aktualität wieder die
Kontinuität des fortlaufenden Unheils, die Geschichte „als permanente Katastrophe“. Im Spiegel dieser
geschichtsphilosophischen Deutung
ist für Adorno eben der Gedanke an
ein negatives Moment, der auch
schon die Geschichtstheorie seines
Freundes Walter Benjamin bestimmte, „nicht von der Hand zu
weisen, ob nicht schon im Ursprung, etwa gar in dem Menschwerden der Menschen selber irgend
etwas Schreckliches geschehen ist,
wie es in den Mythen von der Erbsünde und ähnlichen Vorstellungen
überliefert ist“ (81).
Wie die Nachlassschriften insgesamt, sind auch diese Vorlesungen
sorgfältig editiert, wofür Rolf Tiedemann verantwortlich zeichnet.
Schließlich sind die Vorlesungen als
Einführung in Adornos Denken zu
empfehlen, weil in der freien Rede
viele Argumentationsfiguren zugänglicher sind als dann in den bisweilen sich sperrig gebenden Schriften wie etwa der „Negativen Dialektik“.
Roger Behrens
Gerd Becher, Elmar Treptow (Hg.)
Die Gerechte Ordnung der Gesellschaft
Texte vom Altertum bis zur Gegenwart. Frankfurt/Main 2000
(Campus), 48.- DM.
Das Spannungsverhältnis zwischen
den Globalisierungsprozessen, die
bislang vor allem in Gestalt wirtschaftlicher Liberalisierung aufgetre-
Neuerscheinungen
ten sind, und den damit verbundenen Problemen sozialer Gerechtigkeit, die vor allem in der Gestalt
von Massenarbeitslosigkeit und eines veränderten Verteilungsrahmen
des Staates spürbar geworden sind,
markiert eine in der sozialwissenschaftlichen wie in der öffentlichen
Diskussion noch weitgehend unbegriffene und mit vielen Unsicherheiten und Ungewissheiten behaftete,
zu allem Überfluß noch ideologisch
aufgeladene Problemlage. In Hinblick auf anstehende Aufgaben theoretischer und praktischer Problembearbeitung stellen Gerechtigkeitsfragen – und das heißt vor
allem auch: Ungleichheits- und Verteilungsfragen – eine der großen
Herausforderungen moderner, globalisierter Gesellschaften dar.
Daß aber die Frage nach Gerechtigkeit, die Frage, „ob und warum die
gesellschaftlichen Individuen einen
gleichen oder ungleichen Anteil an
der politischen Herrschaft, dem ökonomischen Reichtum und den
geistigen Gütern besitzen“ (2),
schon seit dem Entstehen der ersten
Hochkulturen ein zentrales Thema
war, das bei allen geschichtlichen,
sozialen und semantischen Veränderungen bis in die Gegenwart aktuell geblieben ist, dokumentiert die
von Gerd Becher und Elmar Treptow sorgfältig ausgesuchte und klug
editierte Textsammlung. Diese versammelt auf 364 Seiten 31 exemplarische Schriften von Denkern wie
Mo Ti, Platon, Aristoteles, Thomas
von Aquin, Dante, Hobbes, Rousseau, Kant, Mill, Marx, MüllerArmack, Rawls, Walzer, Giddens
und Habermas, die zu diesem Thema wesentliche Beiträge geleistet
haben. Alle Texte, die aus Ägypten,
Babylonien, Asien, Griechenland,
Rom, Persien, Europa und den USA
stammen und einen Zeitraum von
über viertausend Jahren umfassen,
sind kurz aber prägnant sowie neutral eingeleitet, ohne jedoch verschiedene Schwächen und weiße
Flecke der Theoretiker zu verschweigen, und geben bei aller Gedrängtheit wesentliche politische,
kulturelle und sozioökonomische
Kontexte so wieder, daß ein elementares Verständnis der (mitunter
sinnvoll gekürzten) Texte möglich
wird. Zusätzlich sind die Schriften
mit aufschlußreichen Anmerkungen
versehen, die auch dem Laien ein
kontextuelles und umfassendes Verstehen gestatten. Zu mäkeln gibt es
allenfalls an der mit viereinhalb Seiten durchaus zu kurz gekommenen
Einleitung. Denn wer auf so kurzem
Raum die aktuelle Problemlage der
Globalisierung, die Kohärenz von
Wirtschaftswachstum und sozialen
Diskrepanzen, die stillschweigend
übernommenen Prämissen und damit blinden Flecke des sozialdemokratischen Konzepts der Chancengleichheit, die Unterscheidung des
Aristoteles von verteilender Gerechtigkeit und ausgleichender Gerechtigkeit so prägnant vermittelt bekommt, der traut den Verfassern
auch ähnlich Kluges auf breiterem
Raum zu und hätte sich dementsprechend über Ausführlicheres gefreut.
Eine der besonderen Leistungen der
Herausgeber ist es unter anderem,
die (bislang als aristokratisch und
apolegetisch
aufgefaßten)
Ausführungen des Aristoteles (der
schon für seine Zeit die Existenz
von Klassenkämpfen klar erfaßt hat:
„Ganz allgemein greifen die Men-
Neuerscheinungen
schen zum Aufstand auf der Suche
nach Gleichheit.“) über die (Verteilungs-) Gerechtigkeit eine für die
Gegenwart progressive Wendung zu
geben, ohne diese Konzeption in ihrer Logik semantisch verbiegen zu
müssen: „Die besondere Gerechtigkeit umfasst die ‚verteilende’ und
‚ausgleichende’ Gerechtigkeit ... Die
gerechte Verteilung oder Zuteilung
hat den Maßstab des Werts oder
Würdigkeit, axia der Menschen; sie
lässt ihnen proportional (geometrisch) zu ihren ungleichen Verdiensten ungleich viel Geld und Ehren
bzw. öffentliche Anerkennung zukommen. Die ungleichen Menschen
werden also in gleicher Weise ungleich behandelt. (In der heutigen
Auseinandersetzung über die Verteilungsgerechtigkeit tritt an die
Stelle des Maßstabs der Würdigkeit
in der Regel die Bedürftigkeit des
Menschen). Im Unterschied zur
‚verteilenden’ regelt die ‚ausgleichende’ oder ‚ordnende’ Gerechtigkeit die ökonomischen Verhältnisse
– vor allem den Warentausch – sowie die rechtlichen Beziehungen.
Ihr Maßstab ist nicht die geometrische, sondern die zahlenmäßige, arithmetische Gleichheit. Sie beruht
auf den Grundsatz der Gleichheit
von Leistung und Gegenleistung,
von Ware und Preis, von Schaden
und Schadenersatz und wird ... ohne
Ansehung der Person unmittelbar
zur Geltung gebracht.“ (73) Daß
nun die aktuellen, sich mit der Globalisierung ergebenden sozialen
Diskrepanzen auch aus der ausgleichenden Gerechtigkeit resultieren,
die unabhängig von den Personen
einzig die Arbeitsleistung ohne Berücksichtigung der technischen
Hilfsmittel zum Maßstab nimmt
und somit global das Produktivitätsgefälle zu einem Wohlstandsgefälle macht, ist nun eine jener Einsichten, die zwar in dieser Textsammmlung nicht explizit formuliert werden und dennoch mit der
Kenntnis dieser Schriften überhaupt
erst möglich werden und eine Erfassung dieses Problems erlauben.
Kurzum: Wer sich einen Überblick
über die relevanten und elementaren
Gerechtigkeitstheorien verschaffen
will, kommt nicht umhin, einen
Blick in dieses Buch zu werfen, und
wer Lesefreundlichkeit ohne die
Höhe der Erkenntnis zu verlieren
bewundert, wird an dieser Lektüre
seine Freude haben.
Reinhard Jellen
Ernst Bloch/Wieland Herzfelde
Wir haben das Leben wieder vor
uns, Briefwechsel 1938–1949, hg. v.
Jürgen Jahn, Frankfurt/Main 2001
(Suhrkamp), Ln. geb., 320 S., 78.DM.
Ernst und Karola Bloch emigrierten
1933 zunächst in die Tschechoslowakei, 1938 dann in die Vereinigten Staaten; der Schriftsteller,
Gründer und Leiter des MalikVerlags Wieland Herzfelde und seine Frau Trude Herzfelde flohen
1939 aus Europa vor den Nazis in
die Vereinigten Staaten. Kennengelernt hatten sich der Philosoph
Bloch und der Verleger Herzfelde
im April 1936. Zeugnis der schnell
sich ergebenden Freundschaft ist
der Briefwechsel, der 1938 beginnt
und sich bis 1949 fortsetzt, als beide
Familien nach Deutschland zurückkehren – Bloch als Ordinarius für
Neuerscheinungen
Philosophie in Leipzig, Herzfelde
als Professor für Literatur, ebenfalls
an der Universität Leipzig.
Im Aurora-Verlag publiziert Herzfelde 1946 Blochs einzige Buchveröffentlichung in den USA, „Freiheit
und Ordnung. Abriss der Sozialutopien“, ein eigenständiger Vorabdruck eines dann im „Prinzip Hoffnung“ zentralen Kapitels. Dieser,
1943 ins Leben gerufene Verlag, der
zunächst „Tribüne“ heißen sollte,
war als Forum für deutsche Exilliteratur gedacht. Herzfelde fungierte
als Geschäftsführer, Bertolt Brecht,
Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Ernst Bloch und andere zählten
zu den Gründungsmitgliedern. Der
Verlagsnamen ist ganz in Blochs
Sinne gewählt – er verweist auf „die
erste (und dunkelste) Schrift Jakob
Böhmes: ‚Aurora oder Morgenröte
im Aufgang’,“ wie Bloch am
10.12.1943 an Herzfelde schrieb
(94).
Der Briefwechsel, der, so Herausgeber Jürgen Jahn, „zu den umfangreichsten Korrespondenzen der amerikanischen Exiljahre Blochs“
gehört, dokumentiert mehr als eine
berufliche Freundschaft zwischen
Autor und Verleger. Es sind Dokumente gegenseitiger Hilfe und
Unterstützung der Migranten; es
geht um Unwegsamkeiten bei der
Wohnungssuche, um private Dinge,
auch um Blochs Unzulänglichkeiten
das Englische betreffend, freilich
auch um die Erörterung der politischen Situation, Nazideutschland
und den Weltkrieg. Aber insgesamt
ist es weniger ein theoretischer
Briefwechsel, den die beiden
Schriftsteller hier pflegen, sondern –
wenn man so will – einer der gelebten Philosophie, der Praxis, und
zwar durchaus in dem Sinne, in dem
Bloch das Alltagsleben, das Existenzielle auch in seinen Schriften aufgenommen hat. Bloch scheint hier
seine Philosophie der Hoffnung im
eigenen Leben zu erproben. „The
dreams of better life“, so Bloch über sein Manuskript, behandelt „einen sehr amerikanischen Stoff“ –
aber: „In der Ausarbeitung ist es das
deutscheste Buch geworden, voll
von altem Deutschland; ohne dass
ich das doch im geringsten wollte,
im Gegenteil.“ (43) Und Bloch
schreibt am 10.2.1945: „Ja, mein
Wieland, die Zeit ist atemraubend.
‚Spuckst du deine rote Fahne aus,
mein Lieber?’ sagt in einem Konzentrationslagerroman eine SABestie in der Folterkammer. Nun
kehrt sich was um, wie im Märchen.“ (116)
Der Briefwechsel ist mit Anmerkungen des Herausgebers versehen.
In einem Anhang findet sich eine
Skizze der „Enzyklopädie der Hoffnungen“, woraus dann das „Prinzip
Hoffnung“ wurde. Ein kommentiertes Personenregister runden die Edition des Briefwechsels ab.
Roger Behrens
Stefan Bollinger
1989. Eine abgebrochene
Revolution. Verbaute Wege nicht
nur zu einer besseren DDR?, Berlin
1999 (trafo Verlag), 345 S., 44.80
DM.
Fritz Vilmar (Hg.)
Zehn Jahre Vereinigungspolitik.
Kritische Bilanz und humane Alternativen, Berlin 2000 (trafo Verlag),
286 S., 34.80 DM.
Neuerscheinungen
Die staatliche Einheit Deutschlands
wird nicht überall und von jedem,
wie die offiziellen Jubelfeiern zum
10. Jahrestag im Oktober 2000 bei
einigen vermuten lassen, kommentarlos gut geheißen. Kommt man in
den Osten Deutschlands, ist zunehmend Unwillen über die Vereinigung
der
Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen
Demokratischen Republik und über
deren Folgen vor allem der ostwärts
der Elbe lebenden Menschen des
wiedervereinigten Landes zu hören
und zu spüren. Fragt man nach,
hört man oftmals: „Das wollten wir
so nicht!“ In den offiziellen Verlautbarungen und Umfrageergebnissen hört es sich alles anders an. Da
ist man zufrieden, klagt hin und
wieder ein bißchen über die noch
nicht vollendete „innere Einheit“.
Die Schaffung von Industriewüsten
mit den wenigen neu geschaffenen,
publikumswirksam angepriesenen
Oasen, sowie die Schaffung von
Millionen Arbeitslosen, die Steigerung von Kriminalität, Drogenkonsum und Rechtsradikalismus werden als gegeben hingenommen. Es
gab, so tröstete man sich, ja keine
Alternative.
Daß die deutsche Vereinigung, die
in Wirklichkeit ein Anschluß der
DDR an die Bundesrepublik war,
auch anders hätte laufen können,
machen zwei Bücher aus dem Ostberliner trafo Verlag deutlich. Welche Wege in eine selbstbestimmte,
wenn auch ungewisse Zukunft von
den Ostdeutschen selbst verbaut
wurde oder ihnen durch den nach
dem Mauerfall am 9.11.1989 ungehemmt in den Osten strömenden
westdeutschen Parteien zu gehen
unmöglich gemacht wurde, zeigt das
Buch von Stefan Bollinger. Der Verlauf der Ereignisse zwischen Herbst
1989 und Frühjahr 1990 im Osten
Deutschlands, der DDR, war, so
weiß Bollinger überzeugend zu argumentieren, nur ein – wenn auch
wichtiger – Teil eines weltweiten
Umbruchs der ökonomischen, politischen und schließlich sozialen
Verhältnisse. Der Wunsch, nur die
Resultate eines der einschneidendsten Ereignisse in der deutschen Geschichte zu vermelden, ist stark und
verständlich. Aber diese Resultate
erklären nur wenig. Was in den vier
oder acht Monaten zwischen Oktober 1989 und Januar 1990 bzw. September 1989 und April 1990 auf
deutschem Boden entschieden wurde, das hat über 40 Jahre deutschdeutscher Geschichte, Aufstieg,
Verbrechen und Untergang des Faschismus, den Triumph des Staatssozialismus zur Voraussetzung.
Darüber berichtet dieses Buch. Die
Ergebnisse der überzeugenden und
fundierten Argumentationen basieren auf gründlicher Quellenrecherche. Sie zu widerlegen, dürfte denjenigen, die gern die von Bollinger
zu Rate gezogenen Dokumente und
Zeitzeugen ignorieren, äußerst
schwer fallen.
Was die Ostdeutschen in den zehn
Jahren nach der Wiedervereinigung
verloren haben, wird in dem von
Fritz Vilmar herausgegebenen Sammelband deutlich. Der Herausgeber,
der eine Anzahl der zum Abdruck
gelangten Beiträge selbst verfaßt
oder mit anderen Autoren gemeinsam geschrieben hat, vertritt auch in
diesem Band seine immer stärker in
der Praxis Bestätigung findende
These von der „strukturellen Kolonalisierung“ Ost- durch West-
Neuerscheinungen
deutschland. Fallstudien, so über die
Liquidation und Diskriminierung
ostdeutscher Eliten, die „Abwicklung“ der „Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften“ oder
die Beseitigung sozio-kultureller
Einrichtungen der DDR, belegen
ausdrucksstark diese These, die vor
allem von denjenigen angezweifelt
werden, die keine Kolonialherren
sein wollen. Außerdem wird die
Frage nach einer deutschen Verfassung, die auch vom deutschen Volk
bestätigt werden sollte, gestellt.
Denn so etwas gibt es nicht in
Deutschland. Im Mittelpunkt der
deutsch-deutschen Diskussion und
Disharmonien stand und steht die
Frage nach der Finanzierung der
staatlichen Einheit Deutschlands.
Auch sie wird in dem Sammelband
ausführlich diskutiert. Das Ergebnis
sieht anders aus als öffentlich behauptet. Die Gewinner der Einheit
Deutschlands sind die westdeutschen Wirtschaftsunternehmen. So
drängten Handelsketten aus der
Bundesrepublik, die den Binnenmarkt der DDR unter sich aufgeteilt
hatten, Produkte aus dem Osten
Deutschlands aus den Regalen der
Kaufhäuser und Geschäfte. Damit
gingen unzählige Produzenten und
Zulieferer bankrott. Die traditionellen Märkte der DDR in Osteuropa,
so wird herausgearbeitet, „brachen
nicht weg“, wie oftmals behauptet
wird; sie wurden den ostdeutschen
Produzenten schlicht „abgenommen“. Im Interesse des Machterhalts der Regierenden in der Bundesrepublik mußte Deutschland sich
auf die kostenintensivste Weise vereinigen. Die übereilt vollzogene
Währungsunion, so wird in einem
Kapitel hingewiesen, zog den größ-
ten volkswirtschaftlichen Rückschlag nach sich, der in der gesamten Geschichte des Kapitalismus
bisher zu verzeichnen war.
Es wäre wünschenswert, wenn beide Bücher übersetzt werden könnten, damit auch hierzulande die
deutsche Vereinigung am 3. Oktober 1990 differenzierter beurteilt
werden kann.
Ulrich van der Heyden
Reinhard Brandt, Karlfriedrich
Herb (Hg.)
Jean-Jacques Rousseau, Vom
Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien
des Staatsrechts (Reihe: Klassiker
Auslegen), Berlin 2000 (Akademie
Verlag), 308 S., 39,- DM.
Nicht bloß klassische, sondern kanonische Texte sollen in der von
Otfried Höffe herausgegebenen
Reihe Klassiker Auslegen kommentiert werden. Die Neuerscheinung
zu Rousseaus Du Contrat social ist bereits der 20. Band dieser Reihe, in
der gemäß Höffes Arbeitsschwerpunkt vor allem Werke der praktischen Philosophie interpretiert werden. Die Aufsatzsammlung liefert
einen von elf Autoren erstellten kooperativen Kommentar zu Rousseaus kurzer Schrift, der ihrem Aufbau und Themenverlauf weitgehend
folgt. Dabei wird das erste Buch des
Gesellschaftsvertrags deutlich ausführlicher besprochen als die anderen
drei, was in Anbetracht seiner Bedeutung angemessen ist. Gemeinsam ist den Beiträgen, daß sie –
zweifellos zurecht – Rousseaus Republikanismus betonen, der sich an
antiken
Vorbildern
orientiert.
Neuerscheinungen
Knapp die Hälfte der Beiträge sind
von französisch- und englischsprachigen Autoren verfaßt und von
Michaela Rehm übersetzt, die in ihrem eigenen Aufsatz eine innovative
Interpretation von Rousseaus Entwurf einer Zivilreligion leistet.
Von Herausgeber Karlfriedrich
Herb, der bereits Ende der 80er
Jahre über Rousseaus Theorie legitimer
Herrschaft promoviert hat, sind neben seiner Mitarbeit am Einführungsartikel zwei Aufsätze enthalten. Im ersten Aufsatz wendet sich
Herb – wie bereits in seiner Dissertation und einem Aufsatz von 1993
– gegen die häufig angenommene
Fundierung des Gesellschaftsvertrags
im Diskurs über die Ungleichheit und
betont den „Funktionsverlust des
Naturzustandsmodells in Rousseaus
Prinzipientheorie des Rechts“ (39).
Herbs zweiter Aufsatz stellt heraus,
daß Rousseaus modernitätskritische
Ablehnung von Repräsentation und
Markt „seiner politischen Philosophie einen utopischen wie erinnernd
resignativen Zug“ verleiht (181).
Auch Reinhard Brandt, der zweite
Herausgeber, hat bereits 1973 eine
Monographie über Rousseaus Philosophie der Gesellschaft veröffentlicht.
Neben seiner Mitarbeit am Einführungsartikel hat er zu diesem Band
einen weiterführenden Aufsatz verfaßt, der die Transformation des Gesellschaftsvertrags in das Kantische Ideal des Bürgerbundes nachzeichnet.
Lesenswert ist außer den angeführten Aufsätzen auch der Beitrag von
Wolfgang Kersting. Kersting beschränkt sich nicht auf eine immanente Deutung des Gesellschaftsvertrags, sondern verortet Rousseaus
Vertragsidee in der Tradition des
neuzeitlichen
Kontraktualismus.
Durch den Vergleich insbesondere
mit Hobbes’ Staatsvertrag verdeutlicht er die Eigentümlichkeit von
Rousseaus Vertragstheorie. Dabei
spart er keineswegs mit Kritik: „Der
Vertrag ist jedoch ein völlig verfehltes
Symbol für eine Republik“ (58).
Patrick Riley bemüht sich in seinem
Beitrag um eine Erklärung des Gemeinwillens. Als möglichen Ursprung dieser ungewöhnlichen Idee
erachtet er „eine Verschmelzung der
Allgemeinheit (Einheit, Gemeinschaftlichkeit) der Antike mit dem
Willen (Zustimmung, Vertrag) der
Moderne“ (117). Auch wenn Rileys
These bedenkenswert ist, weist sein
Aufsatz manche Schwächen auf. So
heißt es über einen vollkommenen
Staat in Rousseaus Sinne: „die Gesetze, besonders die allgemeinsten
Gesetze, müssen von jedem gewollt
werden, der ihnen unterworfen ist,
um verpflichtend zu sein – und sie
müssen verpflichtend gemacht werden, weil die Gesellschaft rein auf
Übereinkunft beruht“ (127). Auch
abgesehen von dem problematischen Komparativ der allgemeinsten
Gesetze, womit Gesetze gemeint
sind, „in denen es nur um Rousseaus Vision eines Gemeinwohls
geht“, ist Rileys Aussage unzutreffend. Denn die Verpflichtung der
Untertanen gegenüber den Staatsgesetzen, die sie sich als Mitglieder des
Souveräns selbst gegeben haben, ist
die Folge davon, daß alle Bürger
beim ursprünglichen Gesellschaftsvertrag über das „Gesetz der Stimmenmehrheit“ einstimmig übereingekommen sind (Buch 1. 5). Nur
deshalb kann eine Mehrheit verpflichtend für eine Minderheit entscheiden, ob ein Gesetzesvorschlag
Neuerscheinungen
dem Gemeinwillen entspricht oder
nicht (Buch 4. 2).
Abschließend muß noch eine
Schwäche der gesamten Aufsatzsammlung angesprochen werden:
Die Stellenangaben zu den Schriften
Rousseaus beziehen sich ausnahmslos auf die französische PléiadeAusgabe von Rousseaus Werken.
Damit wird es für den deutschen
Leser im Regelfall schwierig, die Zitate, ihre Übersetzungen und den
Kontext, aus dem sie entnommen
wurden, zu überprüfen. Dabei hätte
durchaus die Alternative bestanden,
die wichtigsten Schriften Rousseaus
nach den gängigen UTB Ausgaben
zu zitieren oder zumindest Buch
und Kapitel des Gesellschaftsvertrags
mit anzugeben.
Manuel Knoll
Judith Butler
Psyche der Macht. Das Subjekt
der Unterwerfung. Gender Studies.
Frankfurt/Main 2001 (Suhrkamp),
198 S., 19.90 DM (€ 10).
Der Titel der deutschen Übersetzung von „The Psychic Life of Power – Theories in Subjection“, das
im Original 1997 bei Stanford University Press erschien, greift zu kurz
und wirkt dadurch zumindest irreführend. Denn es geht Judith Butler
in ihrem lesenswerten Buch weder
darum, der Macht eine Psyche zuzuschreiben, noch das Subjekt als
Unterworfenes neu zu erfinden. Ihr
Gegenstand ist vielmehr die Psyche
und ihre Konstitution als Effekt der
schon von Foucault beschriebenen
Machtdispositive.
Dass sie – anders als Foucault, der
in der Seele nichts anderes sehen
wollte als ein „Gefängnis des Körpers“ (Überwachen und Strafen, 48)
– den Fokus überhaupt wieder auf
die Psyche legt, kann als Indiz dafür
gelesen werden, dass, wie Hauke
Brunkhorst jüngst feststellte, „sich
die jüngste Postmoderne zum Subjekt zurück(dreht)“ (in: „die Zeit“,
4.10.01, 93). Dafür gäbe es einen
guten Grund: die Aufhebung des
Subjekt-Dualismus. Denn das Erbe
Foucaults bestand aus zwei unvereinbaren Subjekten, dem von den je
schon
wirksamen
MachtTechnologien unterworfenen und
produzierten Subjekt und dem in
den Nischen – also außerhalb der
Macht – tätigen Subjekt ästhetischer
Selbstgestaltung. Für Butler aber
wirkt die Macht auf zweierlei Weise
auf das Subjekt ein: zuerst als seine
Möglichkeitsbedingung und formierende Kraft, und dann „als das, was
vom Subjekt aufgenommen und
wiederholt wird.“ (18) Soweit wiederholt Butler nur die klassische
psychoanalytische Denkfigur, die
die bisweilen leidenschaftliche Verhaftung in der Unterdrückung erklärt.
Der ‚Clou’ der Butler’schen Argumentation besteht nun darin, dem
unterworfenen Subjekt durch die affirmative Nutzung von Macht eine
Handlungsfähigkeit erwachsen zu
lassen, die die sie ermöglichende
Macht übersteigt (20). Die Verinnerlichung der Macht geht einher
mit der Bildung von Handlungsfähigkeit, die aufgrund ihrer Kontingenz der Autonomie immer einen
Spalt offen hält. Aus dieser Verinnerlichung resultiert allerdings auch
noch eine zweite Wende: der Um-
Neuerscheinungen
schlag von der Unterwerfung des
Begehrens in das Begehren der Unterwerfung. Wie aber kommt es dazu? Butler Antwort klingt einleuchtend: Um das Begehren zu bändigen, macht das Subjekt dieses selbst
zum Gegenstand der Reflexion; das
Begehren wird so zum Begehren
der Reflexion und schließlich zum
Begehren nach „Subjektivation“
(subjection). Das Ergebnis ist eine
aufhebungsresistente Ambivalenz,
die im Original-Titel schon anklingt.
Subjection meint in erster Linie einen
Prozeß der Unterwerfung; aber eben immer auch den Prozeß, der
das Subjekt handlungsfähig macht.
Das Verhaftet-Bleiben in der Unterwerfung bricht die hochfliegende
Selbstgestaltungsemphase. Trotzdem aber ermöglicht das „Paradox
des Subjekts“ ein Werden als „ruhelose Praxis der Wiederholung“ (33).
Wiederholt wird, was je schon verloren ist.
Schon deshalb ist für Butler Freuds
Aufsatz über Trauer und Melancholie eine ihrer wichtigsten Referenzen. Der Ambivalenzkonflikt ist allerdings schon bei Hegel angelegt,
dessen unglückliches Bewußtsein
zum Ausgangspunkt der Butler’schen Überlegungen wird. Entkommen sind wir ihm nicht. Die
Lektüren führen von Hegel über
Nietzsche zu Freud und Foucault
und über Althusser zu Freud zurück
in die psychischen Anfänge, wo die
Melancholie zeigt, dass „man überhaupt nur etwas wird, wenn man
den anderen als sich selbst in sich
aufnimmt.“ (182)
Olaf Sanders
H. Drüe, A. Gethmann-Siefert, C.
Hackenesch, W. Jaeschke, W. Neuser, H. Schnädelbach
Hegels
"Enzyklopädie
der
philosophischen
Wissenschaften" (1830). Ein
Kommentar zum Systemgrundriß
Frankfurt/Main 2000 (Suhrkamp),
561 S„ 34.90 DM
Der dritte und umfangreichste Band
der von H. Schnädelbach herausgegebenen Kommentare zu den
Hauptwerken Hegels ist ausschließlich der Enzyklopädie gewidmet
und enthält Beiträge von sechs Autoren.
Zu der Enzyklopädie existieren bisher - im Unterschied zur Phänomenologie des Geistes oder auch zur
großen Logik — keine Gesamtkommentare, sondern nur Kommentare bestimmter Teile (Fetscher, Lakebrink) sowie Monographien, die sich auf Einzelaspekte
beziehen oder auf das Hegeische
Gesamtsystem abzielen.
Hegels knappe, manchmal trockene
Formulierung mancher Passagen
der Enzyklopädie, deren Thematik
er in anderen Werken ausführlicher
behandelt, sowie das große Spektrum der philosophischen Wissenschaften, die in ihr ihren Platz finden, erhöhen die Anforderungen an
die Kommentierungsarbeit, auch
oder gerade wenn diese bloßen Einführungszwecken dienen soll. Diesen Anforderungen werden die
meisten Autoren des vorliegenden
kooperativen Kommentars gerecht.
Vorzüglich ist etwa die Behandlung
des Teils zur Philosophie des subjektiven Geistes und zur Phänome-
Neuerscheinungen
nologie des Geistes durch Hermann
Drüe (206-289): Nach ausführlichen
Einleitungen zu jedem der Kapitel
dieses Teils folgen Anmerkungen
mittextnahen Erläuterungen. Das
Verhältnis zur großen Phänomenologie kommt allerdings etwas zu
kurz (259). Vor allem wird die Stellung der Phänomenologie des Geistes im System der Wissenschaften
aus der Sicht der Enzyklopädie
nicht hinreichend thematisiert. Auch Christa
Hackenesch gelingt es in ihrem Beitrag (87-138) über den Teil zur Wissenschaft der Logik (§19-§244) - in
lockerer Anlehnung an den Textaufbau — eine kontinuierliche Erläuterung dieses Textabschnittes
und zugleich eine Einführung in
Hegels Begriff der Logik zu geben.
Allerdings thematisiert auch sie die
Unterschiede zur großen Logik
nicht (betreffend die Unendlichkeit
§93-94, das Maß §107, den Aufbau
der Lehre vom Wesen und — an
einem Punkt - die Quantität). Das
liegt wahrscheinlich daran, daß sie
sich nicht auf die Inhalte, sondern
auf die Darstellung und auf bestimmte Argumente beziehen.
Die Beiträge über die Teile zur Naturphilosophie (Neuser), zur Philosophie des absoluten Geistes, also
zur
Philosophie
der
Kunst
{Gethmann-Siefert), zur Religionsphilosophie und zur Philosophie
schlechthin (beides Jaeschke) entfernen sich eher vom Ziel eines einführenden
Kommentars:
Gethmann-Sieferts Ausführungen
sind weniger ein Kommentar zu den
Stellen über die Kunst als eine Einführung in Hegels Philosophie der
Kunst, die die Vorksungen über Äs-
thetik, stark berücksichtigen. Neuser
berichtet über die naturwissenschaftlichen und naturphilosophischen Theorien, auf die sich Hegel
bezieht oder die er voraussetzt, und
kommentiert den Text kaum. Für
das Verständnis der Hegeischen Naturphilosophie im Allgemeinen sind
aber Neusers Erklärungen durchaus
angebracht. Und Jaeschke verwikkelt sich schnell in viele entwicklungsgeschichtliche und historische
Ausführungen, die zwar hilfreich
sind, aber nur den Anschein eines
Kommentars vermitteln.
Die Lehre vom objektiven Geist
und die Einleitung der Enzyklopädie werden von H. Schnädelbach
behandelt - die drei Stellungen des
Gedankens zur Objektivität zwar
kürzer, aber ausführlich genug.
Schnädelbachs Kommentierungen
zur Einleitung beschränken sich ansonsten auf die Erläuterung einiger
Grundbegriffe, dürften aber - für
diesen Textabschnitt — den Bedürfnissen des Einsteigers am
nächsten kommen. Der Band, der
ausführlich Literatur und einen Anhang mit besonderen Sacherklärungen enthält, ist für den Einstieg in
das System der Enzyklopädie besonders zu empfehlen.
Georgios Karageorgoudis
Wolfgang Fritz Haug
Dreizehn Versuche marxistisches
Denken zu erneuern. Berlin 2001
(Dietz Verlag), 175 S., 29.80 DM.
Wir können nicht flüchten vor den
Ereignissen dieser Welt. Und selbst
Neuerscheinungen
wenn wir im Geiste flüchteten, dauerte „die Gefahr in der Regel länger
als die Flucht“ (Brecht) und beim
Ankommen in der Realität sind wir
wieder und wieder damit konfrontiert, das Ungedachte denken, das
Schwierige meistern und die Verhältnisse verändern zu müssen. Ansonsten werden wir von diesen verändert, ohne es zu merken. In Zeiten, in denen im Zeichen von
Menschenrechten Kriege geführt,
im Namen von Demokratie totalitäre Politikformen durchgesetzt werden und die Welt ideologisch
zerpalten wird in gute, zivilisierte,
gerechte
Nationen
und
terroristische
Schurkenstaaten,
benötigen wir ein Denken, das
sowohl die Entstehung dieser
neuartigen hegemonialen Strukturen
als auch ein widerständiges Handeln
in ihnen und gegen sie möglich
Wolfgang Fritz Haug bezieht sich in
macht.
seinen dreizehn Versuchen, diese
aktuellen Entwicklungen zu denken,
auf Marx, Gramsci, Brecht, Luxemburg und andere DenkerInnen
menschlicher Emanzipation. Doch
tut er dies nicht, um deren Analysen
ihrer jeweiligen gesellschaftlichen
Zeitausschnitte auf heute zu übertragen. Vielmehr geht es ihm darum
zu prüfen, ob und wie das begriffliche Handwerkszeug dieser VorDenkerInnen auf den neuesten
Stand gebracht werden kann, um
die Widersprüche neoliberaler Produktionsweise dergestalt zu erfassen, dass Herrschaftsprozesse und
Befreiung daraus gedacht werden
können. Die Aktualisierung Marx’
ist Haugs zentrales Anliegen und
dazu werden dessen theoretische
Überlegungen mit der Realität konfrontiert: „Eine Weltauffassung lebt
nur, solange sie auch der werdenden
Geschichte – nicht nur der vergangenen – angehört, und das heißt, solange sie auf von der Wirklichkeit
gestellte Probleme antwortet, durch
deren Aktualität sie, die Theorie,
selbst aktualisiert wird“ (34). Um
dies leisten zu können, arbeitet
Haug in seinem achten Versuch den
„utopischen Überschuss in der
marxschen Theorie“ (89) heraus,
den er in drei zentralen Feldern gesellschaftskritischer Anliegen Marx’
sieht: „Es sind drei Kritiken, in Reihenfolge ihres Auftauchens bei
Marx: die Kritik der Objektform der
Wirklichkeit, die Ideologie-Theorie,
die Wertformanalyse“ (92). Diese
drei „Basisoperationen der marxschen Theorie“ seien in der Lage,
auch auf die aktuellen Entwicklungen kapitalistischer Gesellschaftsformationen bezogen zu werden. So
kann eine ideologietheoretische Analyse die Frage denken, wie in der
neuen Produktionsweise des HighTech-Kapitalismus auch die Zustimmung der Subjekte zu ihr reguliert wird, ohne die die Formen
neuer Herrschaftsverhältnisse nicht
erklärt werden können; so ist die
Wertformanalyse Voraussetzung für
die Beantwortung der Frage, welche
Strukturen mit welchen Inhalten die
kapitalistischen Verhältnisse am Leben erhalten können; so ist für befreiungstheoretisches Denken zentral, wie „die Wirklichkeit statt in der
Gestalt des Wirkenden unter Einschluss der menschlichen Tätigkeit
begriffen zu werden in die Form des
Objekts kommt“ (93/94) und damit
die Praxis der Subjekte (sowohl im
Offizialmarxismus des Stalinismus
als auch in strukturalistischen Theorien) hinter den materiellen Bedin-
Neuerscheinungen
gungen und ihren Strukturen verschwindet.
In Haugs Versuchen ist neben der
Klärung aktueller Problematiken für
eine gesellschaftskritische und emanzipatorische Politik und damit
einer Rückschau auf die historischen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten eingreifenden Denkens
und Handelns die durch Brecht und
Gramsci inspirierte Theoretisierung
der Rolle von kritischen Intellektuellen in sozialen Bewegungen bedeutsam. Gramsci versah sie mit
dem Etikett „organische Intellektuelle“, darauf anspielend, dass sie
sich so wie Fische im Wasser in den
sozialen Bewegungen zu bewegen
hätten: avantgardistisch und popular
denkend, und gleichzeitig sich als
handelnde Subjekte in diesen Bewegungen verstehend. Kritische Analyse bedeutet für Intellektuelle demnach, sich selbst als Akteure in den
Verhältnissen zu denken und nicht
als Außenstehende. In den Worten
Brechts, die Haugs elftem Versuch
entnommen sind, klingt dies so: „Er
(der Aussagende) muss treten als einer, der für das Zustandekommen
des Vorausgesagten nötig ist“. Auf
dieser Linie versteht Haug sich
selbst als organischer marxistischer
Intellektueller, der die Verhältnisse
denkend und in diese eingreifend
mit anderen gemeinsam neue, kooperative Formen als Vorschein einer Gesellschaft praktiziert, in der
der Mensch kein „erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes und geächtetes Wesen“ (Marx) mehr sein wird.
In seinen Versuchen, ein solches
Denken zu erneuern, bemüht sich
Haug, die Konstellationen neuer
Befreiungsbündnisse zu skizzieren,
weil das Band zwischen Marxismus
und Arbeiterbewegung nicht mehr
besteht bzw. diese selbst als handlungsfähige Einheiten nicht mehr
existieren. Antirassistische Initiativen, feministische Bewegungen, die
Bewegung der mexikanischen Indígenas werden dabei ebenso in den
Blick genommen wie kirchenkritische christliche Basisgemeinden oder Globalisierungskritiker. Und
Haug macht es sich nicht leicht, eigene Positionen der Vergangenheit
in der Auseinandersetzung mit der
„brave new world des High-TechKapitalismus“ (20) und ihren Gegenbewegungen als veraltet und verfehlt zu demaskieren. Denn für ihn
ist „nichts kostbarer als begriffene
Irrtümer, nichts tödlicher als blinder
Wiederholungszwang“ (21).
Klaus Weber
Christoph Hubig, Alois Huning,
Günter Ropohl (Hg.)
Nachdenken über Technik.
Die Klassiker der Technikphilosophie, Berlin 2000 (edition sigma),
kart., 415 S., 39.- DM.
Wer eine Einführung oder ein
Nachschlagewerk zu den Klassikern
der Technikphilosophie benötigt,
der wird um „Nachdenken über
Technik“ nicht herumkommen. In
knappen Artikeln stellen namhafte
Technikphilosophen die einschlägigen Denker mit entsprechender
Sachkenntnis dar. Die Arbeit, die
dem Leser in ihrer Übersichtlichkeit
einen raschen Zugriff garantiert,
füllt damit eine Lücke in der technikphilosophischen Literatur aus.
Die Breite der Darstellung bietet bei
Neuerscheinungen
minimalem Zeitaufwand für den
Rezipienten maximale Information.
Als Disziplin und eigenständiges
Fach hat sich die Technikphilosophie erst im 19. Jahrhundert etabliert. Natürlich besitzt die Technik,
und hier vor allem die Mechanik,
eine sehr viel weiter zurückreichende Geschichte. Christoph Hubig
führt deshalb zu Beginn in die historischen Wurzeln der Technikphilosophie ein, wobei sich der Bogen
von Platon bis zu Hegel und Marx
spannt. Friedrich Rapp und Günter
Ropohl ergänzen dies um eine systematische Übersicht. Die entsprechende Kategorisierung nennt einen
ökonomischen, kulturphilosophischen, metaphysischen, technokratischen, neomarxistischen, ökologischen, ontologischen, handlungstheoretischen und soziologischen
Zugang. Der Einleitung folgen Rezensionen der Klassiker. In circa 88
Einzelbeiträgen auf 407 Seiten eröffnet sich ein repräsentativer Überblick.
Das Spektrum der behandelten Autoren mag folgende willkürliche
Auswahl verdeutlichen. Nachdenken über Technik berücksichtigt
nicht nur bekannte Arbeiten, wie
etwa Ulrich Becks Risikogesellschaft.
Auch Stanislav Lem mit Summa technologiae oder Serge Moscovicis Versuch einer menschlichen Geschichte der
Natur kommen zur Besprechung.
Gerade die Darstellung der weniger
geläufigen Arbeiten zur Technikphilosophie macht das Nachschlagewerk zu einer wertvollen Sammlung,
die dem Einsteiger in diese philosophische Spezialdisziplin zwar sicher
nicht die detaillierte Auseinandersetzung ersparen kann, aber ohne
Zweifel einen überaus wertvollen
Zugang bietet. Das schließt auch
populäre Vertreter des angelsächsischen Sprachraumes ein. Thorstein
Veblen, Frederick Taylor, Lewis
Mumford und Carl Mitchum werden präzise und knapp abgehandelt.
In dieser Reihe könnte man John
Dewey vermissen, dessen instrumentalistische philosophische Phase
mit der entwickelten technischen
Gesellschaft der Vereinigten Staaten
in engstem Zusammenhang steht.
Umso überzeugender sind dagegen
beispielsweise die Einblicke, die ein
profunder Kenner der Materie, wie
Hans Heinz Holz für die Technikphilosophie Ernst Blochs zu eröffnen vermag. Insgesamt liegt damit
ein solides Nachschlagewerk vor.
Michael Ruoff
Harald Lemke
Freundschaft. Ein philosophischer
Essay, Darmstadt 2000 (wiss. Buchgesellschaft), 220 S., 39.90 DM.
Alexander García Düttmann
Freunde und Feinde. Das Absolute, Wien 1999 (Turia & Kant), br.,
80 S., 20.- DM.
Nicht nur durch die Übersetzung
von Jacques Derridas ‚Politiques de
l’amitié’ ist Freundschaft zum
Mode- und Lieblingsthema der
Feuilletons geworden; es spiegelt
sich hierbei auch der Zeitgeist, die
Zerrissenheit der modernen Gesellschaft, das Misslingen bürgerlicher
Individualität, die – wenn sie beim
Selbst keinen Halt mehr findet – im
und am Anderen versucht sich zu
identifizieren. Freundschaft ist,
nachdem die tradierten Struktur-
Neuerscheinungen
modelle von Familie und Gemeinschaft in der Krise sind, ein Rettungsbegriff sozialen Miteinanders.
Vom Begriff der Freundschaft hat
wohl jeder genügend Vorverständnis, um zu wissen, dass hier etwas
Gutes verhandelt wird, was sich
auch leben lässt – zumal ja ein Diskursfeld an Begriffen betreten wird,
das ganz ohne den mittlerweile verachteten Ballast sozialistisch gefärbter Worte auszukommen scheint:
keine Rede von Solidarität, vom
Genossen ist fällig; über Freundschaft lässt sich auch als soziales
Problem streiten, ohne wirklich von
sozialen Problemen zu sprechen.
Dem versucht der Hamburger Philosoph Harald Lemke mit seiner
Promotionsschrift eine andere
Wendung zu geben. Ihm geht es um
„eine Philosophie der Freundschaft«, die »die konkrete Möglichkeit
gelingender
Subjektivität
aus[weist].“ (2) Es geht um Glück
und Lebenslust, schließlich darum,
mit einer „Praxis der Freundschaft“
ein „gutes Sozialleben“ zu verwirklichen (3) – als mögliche und notwendige Grundlage „demokratischer Sittlichkeit.“ (4) Fundiert sind
Lemkes Überlegungen philosophiehistorisch in der Antike, bei Epikur
und Aristoteles vor allem. Die Theoriereise führt weiter in die Spätantike, Renaissance und Aufklärungsphilosophie, mündet schließlich in
der Neuzeit und Gegenwart. Hier
findet Lemke den soziologischen
Befund, der seine These stützt: nach
dem Ende von Familien-, Ehe- und
Liebesbeziehungen bleibt „die Praxis von Freundschaft“ als „eine Ästhetik der Existenz einer Ethik des
Selbst.“ (3) Allerdings kündigt sich
in solchen Formulierungen bereits
an, dass seine „kritische Theorie der
guten Freundschaft“ (50 ff., vor allem 57 ff.), die er zur „Praxologie
des Freundens“ (111 ff.) ausbaut,
eine politische, emanzipatorische
Dimension reklamiert, die die kritische Theorie nur herbeizitiert, um
in jener Gegenwartsdiagnose zu
münden, die heute von der – mitunter rechten – Sozialdemokratie geprägt ist: soziologisch ist das etwa
Giddens „Politik des Lebensstils“,
die Gesellschaftsvorstellung von
Beck und Beck-Gernsheim. Philosophisch führt Lemke eine Reihe
von halb vitalistischen, halb fundamentalontologischen Begriffen ein,
die auch ungefähr der ideologischen
Rahmung entsprechen, die mit Namen wie Dilthey, Husserl oder Heidegger verbunden ist – dazu gehören „Vollleben“, „Wohlvermögen“
(gebunden an die „euzenologische
Einsicht“), „Wohllust“; aus dem
Griechischen: die „Sorge um sich
selbst als Freund“, „Freunden“,
„Widergefreundetwerden“
oder
„der Gefreundete“. Durch solchen
Jargon der Eigentlichkeit erfährt der
Begriff der Freundschaft eine Überhöhung, die sich vom luziden
Grund des begriffsreflexiven Aufrisses zunehmend löst und die
„Praxis der Freundschaft“ in die gar
nicht gemeinte Nähe eines Ratgebers rückt. Ähnlich wie einst Erich
Fromm mit seiner ‚Kunst des Liebens’ empfiehlt auch Lemke mit der
„Kunst des Freundens“ Selbstverständliches wie Verstiegenes. In seinen Worten: „Ausgangspunkt für
die Kunst des guten Freundens ist
die gewöhnliche Grundbewegung
einer ausgeglichenen Wechselseitigkeit des Tuns und Lassens im Geben und Nehmens.“ (111)
Neuerscheinungen
So gerät die Freundschaft zur Idylle
einer Lebenspraxis, zur Enklave des
gelingenden Lebens, dem Gesellschaft äußerlich und schemenhaft
bleibt. Mitunter wird Lemkes Entwurf an genau den Stellen redundant, an denen sich entschieden hätte, ob er es mit einer kritischen
Theorie ernst meint, wenn etwa die
„Befriedigung sozialer Bedürfnisse“
zum „inhärenten Zweck des
persönlichen Soziallebens“ erklärt
wird (46), was ja nicht mehr aussagt,
als die Gesellschaftlichkeit des Menschen mit dem gesellschaftlichen
Menschen zu erklären. Dass etwa
Freundschaft im Sinne Adornos
„Erziehung zur Mündigkeit“ gedacht wird, ohne ein Wort darüber
zu verlieren, dass Adorno dabei die
nachfaschistische Gesellschaft vor
Augen hatte, offenbart an Lemkes
Vorstellung von kritischer Theorie
eine nicht unproblematische Realitätsferne. Exemplarisch macht die
sich ebenso an seinem Umgang mit
Marxens Praxisbegriff bemerkbar.
Marx hätte, so Lemke – der damit
Habermas, Honneth u.a. folgt –,
den Praxisbegriff auf Arbeit eingeschränkt. Wenn nach Marx eine
„Veränderung und Verbesserung
der Lebensbedingungen … nur als
Veränderung der Produktionsverhältnisse denkbar“ ist, schließt Lemke daraus eine „Reduktion der gesellschaftlichen Realität auf das
Wirtschaftsleben“ (84), die Marx
eben philosophisch vornehme.
Doch von übergangenen Nuancierungen im Begriff Praxis und Arbeit
bei Marx einmal abgesehen, besteht
die Brisanz der Marxschen Überlegung ja nicht in ihrer theoretischen
Spekulation, sondern in der radikalen Kritik einer Gesellschaft, die
den Menschen real auf die Arbeit
reduziert. Nur insofern bleibt
„Marx’ Philosophie der Praxis den
Denkkategorien der bürgerlichen
Arbeitsgesellschaft verhaftet“ (84),
weil er seine Philosophie an den Realkategorien bemisst, die Lemke
verborgen bleiben. Lemke glaubt
offenbar an die Kraft der Begriffe,
die nur geändert werden müssten,
um auch Gesellschaft anders aussehen zu lassen. Das entspricht seinem Gesamtentwurf zur »Praxis der
Freundschaft«, der die gelingende
Freundschaft auch eher zur Frage
der richtigen Wortwahl macht, denn
zur Frage der dann tatsächlich statthabenden Freundschaft. Die Empfehlungen, die dieses Buch gibt, sind
doch zu selbstverständlich, als dass
sie eine Philosophie der Freundschaft benötigten, oder bleiben so
abstrakt, dass sie es noch dem egozentrischsten Narzissten gestatten,
sich als guter Freund zu brüsten.
Allemal bleibt jedoch Lemkes theoriegeschichtliche Systematik hervorzuheben, die in Düttmanns „Freunde und Feinde“ schon aufgrund der
Essayform fehlt. Während Lemke
wenigstens für eine kritische Theorie der Freundschaft votiert, deren
Kritikbegriff streitbar ist, übt Düttmann – der in anderen Schriften
durchaus auch als kritischer Theoretiker operiert – sich in Entscheidungslosigkeit. Der Philosoph müsse „in der Vergangenheit und in der
Gegenwart Verbündete suchen …,
um begriffliche Klarheit zu gewinnen.“ (70) Das bleibt äußerst fragwürdig, wenn ein Verbündeter etwa
Carl Schmitt ist und die begriffliche
Klarheit sich in der dekonstruktiven
Masche verstrickt. So heißt es zu
Marcuse: „die ‚große Weigerung’ ist
Neuerscheinungen
umso mehr eine ‚große Weigerung’,
je weniger sie eine ‚große Weigerung’ ist.“ (68) Wie dies jedoch
Freundschaft als „Versuch über die
Befreiung“ erklären soll – so Titel
des zweiten Essays –, lässt Düttmann im Dunkeln, weshalb denn
Lemkes ‚Freundschaft’, trotz neoliberal verkleideter Sozialpartnerschaft, zumindest in der Intention
und Argumentation deutlicher ist.
Roger Behrens
Mike Sandbothe (Hg.)
Die Renaissance des Pragmatismus. Aktuelle Verflechtungen
zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie, Weilerwist 2000
(Velbrück Verlag), kart., 335 S., 39.DM.
Chantal Mouffe (Hg.)
Dekonstruktion und Pragmatismus. Demokratie, Wahrheit und
Vernunft, Wien 1999 (Passagen),
200 S., brosch., 43.- DM.
Es war doch zu erwarten, dass das
Unbehagen, das unter anderem die
Postmoderne am Ende des 20.
Jahrhunderts erweckt hatte, einige
Reaktionen hervorrufen würde, die
auf der Suche nach Hoffnung mit
oder ohne Erkenntnis sind. Die philosophische Postmoderne hatte ja
zuletzt eine durchführbare Regulierung der Vielfalt von Einsichten
und Lebensweisen fast für unmöglich erklärt, was außer einem pathetischen Gestus wenig Perspektiven
eröffnete. Ob die so genannte Renaissance des Pragmatismus als
Antwort auf diese Aussichtlosigkeit
gelesen werden kann? Das Kokettieren mit der Rhetorik der Post-
moderne zunächst und der später
daraus entstandene Dialog zwischen
Richard Rorty und Jean-François
Lyotard sprechen dafür; denn es
war hauptsächlich Rorty, der auf
den amerikanischen Pragmatismus,
vor allem in der Version von John
Dewey und William James, aufmerksam machte. Es überrascht daher nicht, dass fast die Hälfte der
Artikel in dem von Mike Sandbothe
herausgegebenen Sammelband sich
hauptsächlich mit dem Denken von
Richard Rorty beschäftigt.
Die Frage, warum ausgerechnet der
Pragmatismus den Puls unserer Zeit
angeblich besser treffen könnte als
eine andere Theorie, stellt sich zunächst in dieser direkten Form
nicht. Vielmehr wird die Renaissance des Pragmatismus „aus der
Perspektive unterschiedlicher Diskursstrategien“ dargestellt, was allerdings dieses Comeback leider
nicht erklärt. Dies mag ja daran liegen, dass die meisten der beteiligten
Autoren (von „Autorinnen“, wie
Sandbothe schreibt, kann ja wirklich
nicht die Rede sein: Von den zwölf
Artikel, die im Band gesammelt
wurde, ist nur einer von einer Frau
verfasst!) bereits seit langem im Dialog miteinander stehen, was angeblich die These des Herausgebers belegt, nach der die Annahme einer
starken Separation zwischen „den
philosophischen Traditionen des
analytischen und des kontinentalen
Denkens zu einem Anachronismus
geworden ist“ (28). Ob diese Trennung bereits für überwunden erklärt
werden kann, ist fraglich. Eine Intensivierung des Dialogs ist allerdings deutlich spürbar.
Der Band hat von daher keinen einführenden Charakter. Die Lektüre
Neuerscheinungen
der Texte verlangt Vorkenntnisse
über den früheren Pragmatismus.
Er erfüllt vielmehr die Aussichten,
die der Untertitel weckt, so dass der
Band für diejenigen, die am Pragmatismus interessiert sind, eine Bereicherung ist. Gesammelt hat Mike
Sandbothe Texte von so renommierten Autoren wie Robert B.
Brandom, Rorty selbst, Arthur Fine,
und Hilary Putnam auf amerikanischer Seite und Ludwig Nagl, Wolfgang Welsch und Albrecht Wellmer
auf der deutschen. Während Brandom, Fine, Rorty und Wellmer sich
mit einzelnen Definitions- und Beschreibungsproblemen des Pragmatismus beschäftigen, diskutieren
Welsch, Sandbothe, Barry Allen,
und Bjør Ramberg in ihren Beiträgen unterschiedliche Aspekte von
Rortys Pragmatismus. Nagl und
Putnam wenden ihre Aufmerksamkeit William James zu, einem der
Väter des Pragmatismus. Antje
Gimmler, als einzige Autorin, und
Joseph Margolis untersuchen, wie
und inwiefern das kontinentale Erbe
wichtiger Denker wie Hegel oder
Descartes auch in den Neopragmatismus einfließt. Während aber Hegels Legat nicht nur von J. Dewey,
sondern auch von Autoren wie
Brandom oder Rorty gewürdigt
wird, stellt der Cartesianismus jenen
Teil des kontinentalen Denkens dar,
den die angelsächsische Tradition
am heftigsten abgelehnt hat. Trotzdem zeigt Margolis, dass der „cartesianische Realismus“ als Referenzpunkt auch in dem Neopragmatismus einen wichtigen Wert hat.
Wer der brillanten und beredten
Darstellungsweise eines James’ oder
eines Rortys verfallen ist, findet hier
in dem üblichen, wohl nötigen aka-
demischen Stil einen sehr hilfreichen Überblick nicht nur über wichtige Fragen des klassischen und
neuen Pragmatismus, sondern auch
über einige Alternativen, die der gegenwärtige Pragmatismus für den
Umgang mit den aktuellen Aufgaben anbietet, die sich der Philosophie und der Wissenschaft stellen.
Dieser Überblick konzentriert sich
hauptsächlich auf Fragen der Erkenntnis und der theoretischen Philosophie. Leider fehlen wichtige Aspekte des Pragmatismus selbst, die
aber eher an ein Verständnis von
Philosophie anknüpfen, das wenig
Beachtung in der Akademie findet,
wonach das Denken auch und vor
allem eine Orientierung im Leben
darstellt und demzufolge eine erzieherische und soziale Rolle zu verantworten hat. Nicht nur Dewey hat
einen großen Teil seiner Arbeit der
Pädagogik gewidmet. Ebenso war
James der Überzeugung, dass der
Pragmatismus, auch als Methode
verstanden, eine große Hilfe bei der
Gestaltung der Vielfalt sowie der
Akzeptanz der Begrenzungen unseres menschlichen Lebens sei. Hier
kommt auch der sophistische Charakter des Pragmatismus durch –
nicht nur wegen der bereits angesprochenen Beredsamkeit einiger
seiner bekanntesten Vertreter, sondern auch wegen der Sorge um die
Sache der polis, verstanden als Raum
der menschlichen Angelegenheiten.
Es ist gerade dieses Gesicht des
Neopragmatismus, das in dem von
der politischen Philosophin und Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe herausgegebenen Buch Dekonstruktion und Pragmatismus. Demokratie, Wahrheit und Vernunft im
Vordergrund steht. Ebenso wie bei
Neuerscheinungen
dem von Sandbothe herausgegebenen Band handelt es sich hier um
eine Sammlung von Texten, die jedoch als Diskussionsbeiträge eines
Symposiums entstanden sind. Neben Richard Rorty und Jacques
Derrida diskutierten auch Simon
Critchley und Ernesto Laclau.
Zwei Fragen scheinen den Tenor
dieses Symposiums gebildet zu haben. Die eine betrifft Rortys utopischen Liberalismus; die andere untersucht Derridas Dekonstruktion
hinsichtlich ihres politischen Wert.
Beide Fragen stehen in einem engen
Zusammenhang, dessen letzter Referenzpunkt Rortys Buch Kontingenz,
Ironie und Solidarität ist. Bekanntlich
unternimmt Rorty dort eine Unterscheidung zwischen der „privaten
Ironikerin“ und dem „öffentlichen
Liberalen“, nach der Derrida, Heidegger, Nietzsche etc. zum Typ der
„privater Ironikerin“ gehören, die
aus der Sicht der Politik „im besten
Fall unnütz und im schlimmsten
Fall gefährlich“ sind (KI 142). Im
Zentrum der Debatte steht nun eine
kritische Auseinandersetzung mit
Rortys Verständnis von Politik sowie die Überprüfung der politischen
Tauglichkeit des Denkens Derridas.
Anders formuliert: Es handelt sich
um eine Diskussion über die politischen Möglichkeiten, die im Pragmatismus und in der Dekonstruktion stecken könnten.
Über die Realität dieser Möglichkeiten scheinen Mouffe, Laclau und
Critcheley einer Meinung zu sein.
Mehr noch – während der Lektüre
wird man das Gefühl schwer los, als
ob Dekonstruktion ein Mittel sei,
eine gewisse Naivität zu korrigieren,
die Rortys Auffassung von liberaler
Demokratie unterstellt wird. Ge-
genüber Rortys Beschreibung der
Politik als einer Angelegenheit „von
pragmatischen, kurzfristigen Reformen und Kompromissen –
Kompromissen, die in einer demokratischen Gesellschaft in Worten
ausgedrückt und verteidigt werden
müssen“ (46), wird der Verdacht
aufgestellt, ein solcher Konsens
würde sich, so Mouffe, als „ziemliches Missverständnis des Wesens
der Demokratie“ darstellen (29);
denn das Feld, in dem ebenso Konflikte und Meinungsunterschiede
stattfinden sollen, wird durch die
Idee eines Konsenses neutralisiert.
Derridas Überlegungen aus der
Sicht derjenigen, denen im Laufe
eines konsensuellen Verfahrens Unrecht geschieht, könnten als eine
sehr abgeschwächte Form von Lyotards Darstellung eines Widerstreits
verstanden werden. Auch die Sprache von Derrida ist etwas besonnener. In seinem Beitrag erinnert er
immer wieder daran, dass jede persönliche Entscheidung, die man
trifft, ebenso eine Verantwortung
gegenüber einem Anderen bedeutet
(187-193). Diese Idee, die sich eher
als eine Variante von Kants kategorischem Imperativ anhört, enthält
meiner Meinung nach auch eine utopische Komponente. Denn wie
kann ich annehmen, dass jeder oder
jede, der/die handeln, diese Verantwortung wahrnimmt? Hannah
Arendt erinnert uns in ihrem Buch
Vita Activa immer wieder daran,
dass die Unvorhersehbarkeit unseres Handelns zu den Bedingungen
(oder Miseren, je nachdem)
menschlicher Existenz gehört. Ist
dann auch unsere Verantwortung
begrenzt? Diese Frage lässt die politischen Konsequenzen der De-
Neuerscheinungen
konstruktion, so wie sie in diesem
Band zu lesen sind, auch als eine
Utopie erscheinen. Die letzte Frage,
mit der wir es hier schließlich zu tun
haben, ist fast so alt wie der Mensch
selbst; denn sie betrifft dessen Stellung als Individuum und als soziales
Wesen. Eigentlich ist es die Spannung, die durch diese beiden Stellungen entsteht: während Rorty dafür plädiert, sie durch die radikale
Trennung der beiden Bereiche zu
neutralisieren, scheint Derrida eher
für das Aushalten derselben zu stehen.
Unabhängig davon, ob der Leser
oder die Leserin sich als Ironikerin
oder als Liberaler versteht, ist der
von Mouffe herausgegebene Band
eine Einladung, um über Politik
nachzudenken, die man nicht verpassen sollte; denn: „Es kann keine
demokratische Politik ohne philosophische Reflexion geben...“ (33).
Bei Büchern dieser Art hat man darüber hinaus den Vorteil, dass man
mit einer direkten Antwort von Seiten der Teilnehmer rechnen kann,
so dass auch die Gedanken in die
Dynamik des Dialogs fließen, und
dieser Fluss macht sich auch bei der
Lektüre positiv bemerkbar.
María Isabell Peña Aguado
F. W. J. Schelling
Historisch-kritische Ausgabe im
Auftrag der Schelling-Kommission
der Bayer. Akademie der Wissenschaften, Reihe I, Werke, Band 6:
Von der Weltseele – Eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus (1798), hg. von J. Jantzen
unter Mitwirkung von T. Kisser;
Vorrede zur Übersetzung (1798),
hg. von K.T. Kanz und W. Schieche, Stuttgart-Bad Cannstatt 2000
(Frommann-Holzboog), Leinen,
526 S., 528.- DM.
Der im vergangenen Jahr erschienene, dem Gedenken an HansMichael Baumgartner gewidmete 6.
Band in der Werke-Reihe der Historisch-Kritischen Schelling-Ausgabe
präsentiert Schellings Schrift „Von
der Weltseele“ (1798) sowie eine
neuerlich entdeckte kurze Vorrede
Schellings zu einer deutschen Übersetzung der Abhandlung „Versuch
über die Eigenschaften des Sauerstoffs...“ (1798) aus der Feder des
französischen Botanikers P.P. Alyon.
Die Schrift „Von der Weltseele“
steht im Kontext des bei Schelling
nach Mitte der 90er Jahre des 18.
Jahrhunderts einsetzenden Plans,
Fichtes transzendentales System der
Wissenschaftslehre durch ein System der Naturphilosophie zu komplettieren. Dabei zeichnet sie sich
im Unterschied zu Schellings anderen naturphilosophischen Schriften
zwischen 1797 und 1800 durch das
Bemühen aus, ein materialreiches
und in seinem Stufenbau weitgehend durchkomponiertes System
der Naturphilosophie vorzulegen.
Die in dieser Periode exponierte Idee einer produktiven Natur, einer
Natur, die mittels ursprünglicher
Tätigkeit und Hemmung sowie mittels polarer Kräftebeziehung zu
stets neuen, höherorganisierten
Gleichgewichtszuständen
strebt,
wird hier unter Beizug zahlreicher
naturwissenschaftlicher Ergebnisse
an Stufen der anorganischen und
Neuerscheinungen
organischen Natur festgemacht. Auf
die Darstellung von Dualitäten des
Lichtes, der Wärme und der Luft
und von Polaritäten des Magnetismus und der Elektrizität folgen
Ausführungen zu – den chemischen
Prozess integrierenden – Stufen der
Pflanzen- und Tierwelt. Der Vergleich mit Schellings anderen frühen
naturphilosophischen Schriften offenbart überdies, dass in der Schrift
„Von der Weltseele“ ein besonderes
Augenmerk auf die, unverkennbar
an Kants Reflexionen zur Auflösung der Antinomie der teleologischen Urteilskraft anschließende,
Beziehung von mechanischer und
organischer Natur gerichtet wird.
Schelling sucht nach dem ursprünglichen Prinzip beider Naturbereiche.
Dabei erweist sich seiner Ansicht
nach nicht nur jeder Versuch, dieses
Prinzip im Chemismus aufzuspüren,
als vergeblich, zumal sich daraus der
für das Verständnis der organischen
Natur maßgebliche zufällige, freie
Natureffekt gerade nicht plausibel
machen lässt. Auch die Bestrebungen, dieses Prinzip als eine ursprüngliche Lebenskraft oder, mit
Blumenbach, als Bildungstrieb zu
begreifen, sind seines Erachtens
zum Scheitern verurteilt, wird doch
bei vitalistischen Vermögen dieser
Art das Verständnis von organischer Natur immer schon vorausgesetzt. Schelling stellt von daher die
These auf, das erste Prinzip könne
nur in einem Dritten bestehen, einem Dritten, das zwischen Mechanischem und Organischem oszilliere. Dieses nennt er „Organisation“.
Und diese ihrerseits charakterisiert
er bald, in sichtlicher Anlehnung an
Schillers ästhetischen Trieb, als
„freyes Spiel von Kräften“, bald,
unter ausdrücklicher Berufung auf
Goethes Idee der Naturmetamorphose, als „Individualisierung“ der
Materie. Schließlich wird die besagte
Organisation
auch
als
„gemeinschaftliche Seele der Natur“
oder kurz „Weltseele“ bezeichnet.
Schelling
will
damit
einen
Gedanken,
den
die
älteste
Philosophie ausgesprochen hatte,
erneut zur Geltung bringen.
Wie die Herausgeber im „Editorischen Bericht“ des Bandes konstatieren, gibt es zahlreiche ältere und
neuere Quellen, welche Schelling
bei seiner Wiederaufnahme des Gedankens der Weltseele – welcher in
der älteren Philosophie spätestens
dort greifbar wird, wo das Eine in
der Auffassung der Ein-Allesheit
nicht mehr als emanierendes, sondern als formendes, bildendes Prinzip angenommen wird – beeinflusst
haben dürften. Im Blick auf die ältere Philosophie werden Anaxagoras,
Straton, die Stoiker einerseits, der
Platon des „Timaios“ und die Neuplatoniker, besonders Cusanus andererseits genannt. (Man hätte auch
auf Heraklit hinweisen können).
Unter den neueren Anregern finden
Bruno, Spinoza und einige Autoren,
die sich nach den Attacken Wolffs
und Jacobis auf Spinoza dem Lager
des Pantheismus zurechnen lassen,
unter Schellings Zeitgenossen besonders Maimon, Reinhold, Franz
von Baader und Novalis Erwähnung. Durch Maimons und Reinholds Beiträge zu Fragen der rationalen und empirischen Psychologie
kommt seit Anfang der 90er Jahre
gerade auch der Terminus „Weltseele“ („anima mundi“) stark in Umlauf. Wie die Recherchen der Herausgeber erbracht haben, ist auch
Neuerscheinungen
Ploucquets Dissertation „De hylozoismo“ aus dem Jahre 1764 als
wichtiger Hintergrund für Schellings
Zuwendung zur Weltseele-Thematik
in Betracht zu ziehen.
In diesem Zusammenhang wären
vielleicht auch einige Überlegungen
zur Frage angebracht gewesen, wo
Schellings Verständnis von Weltseele vor dem Hintergrund des genannten Geflechtes möglicher Quellen
zu verorten ist. Aufgrund seiner
später in aller Deutlichkeit geäußerten Ansicht, die Einheit von Einheit
und Allesheit schließe die qualitative
Differenz beider nicht aus, sowie
aufgrund seines Diktums, die Weltseele manifestiere sich überall und
nirgendwo und könne deshalb letztlich nicht mehr als räumliche Bestimmung verstanden werden, liegt
es nahe, dass Schelling hinsichtlich
des Verhältnisses von Seele und
Materie an einen durch die neuplatonische Auffassung des Einen geprägten Weltseelebegriff anknüpft.
Die Weltseele ist aus der Sicht
Schellings offenkundig das Eine,
das die Vielheit der Materie enthält,
sie durchdringt, aber nicht die Vielheit der Materie selbst ist. Eine
Weltseele, die nach stoizistischer
Auffassung als eine Form von feiner
Materie (Licht, Luft, Feuer usw.)
aufgefasst wird, bleibt hinter dieser
Vorstellung zurück. In bezug auf
das Verhältnis von Gott und Natur
ergibt sich dagegen für Schelling
durchaus ein direkter Bezug zum
stoizistischen Begriff der Weltseele.
Wie die Stoiker eliminiert gleichfalls
Schelling die aristotelische Trennung von Substanz bzw. Gott und
Weltseele. Die Weltseele wird nicht
nur als das der Natur immanente,
sondern auch eigens als das höchste,
göttliche Prinzip aufgefasst. Schelling vertritt damit nichts anderes als
einen entschiedenen WeltseelePantheismus, und dies zu einer Zeit,
in welcher der alles andere als harmlose Vorwurf des Pantheismus=Atheismus einen neuen Höhepunkt erreicht. In bezug auf die
neueren Einlassungen zum Thema
der Weltseele ist ersichtlich, dass
Schelling weder den moralischpraktischen Weltseele-Begriff, der
nach Kants kritizistischem Bruch
übrig bleibt, noch Reinholds Wiederentdeckung der Weltseele im
Begriff des Vorstellungsvermögens
gutheißen kann. Schelling sieht sich
vielmehr als Erneuerer des traditionellen metaphysischen WeltseeleBegriffs Brunos und Spinozas. Dabei hindert die Tatsache, dass Kant
die Einheit von mechanischer und
organischer Natur zwar nicht als
Ungedanke, aber doch als eine wenig sinnvolle Idee bzw. Hypothese
der Naturphilosophie betrachtet,
Schelling nicht daran, seinem Weltseele-Begriff am Ende auch einen
Kantischen Geist einzuhauchen. Mit
der Konstruktion der Natur aus einem über Mechanismus und Organismus stehenden Prinzip sieht sich
Schelling offenbar auch als Realisator eines Vorhabens, das sich aus
Kants dritter Kritik herauslesen
lässt.
Dass Schellings Weltseele-Schrift
nun endlich in einer soliden, die
Fassung von 1798 mit den Varianten der Ausgaben von 1806 und
1809 ergänzenden und mit den nötigen textkritischen Anmerkungen
versehenen Form vorliegt, ist erfreulich. Die sorgfältige und aufwendige Arbeit der Herausgeber
verdient großes Lob. Lediglich zwei
Neuerscheinungen
kritische Bemerkungen zur Editionspraxis drängen sich auf. Der
Band enthält einen mehr als 150
Seiten langen Teil mit „Erklärenden
Anmerkungen“. Dabei werden auch
zu vielen Stellen, die einer Sachanmerkung nicht zwingend bedürfen,
vergleichende Zitate bestimmter
Autoren angeführt. Es besteht kein
Zweifel, dass dieser Teil eine wichtige Hilfe ist für alle, die sich künftig
mit Schellings früher Naturphilosophie auseinandersetzen wollen.
Dennoch muss man sich fragen, ob
mit diesem Vorgehen die Aufgabe,
die eine Edition generell zu erfüllen
hat, nicht überschritten wird. Als
Leser eines Bandes der SchellingWerke fragt man sich zudem, weshalb die nur drei Zeilen lange und
inhaltlich unergiebige „Vorrede zur
Übersetzung“ aufgenommen wurde.
Wäre dafür nicht ein Band mit
Schelling-Dokumenten der geeignetere Ort gewesen?
Martin Bondeli
Bettina Schmitz
Die Unterwelt bewegen.
Politik, Psychoanalyse und Kunst in
der Philosophie Julia Kristevas, Aachen 2000 (ein-FACH-vlg), brosch.,
240 S., 34.80 DM.
Der Name Julia Kristeva ist auch im
Bereich der Philosophie geläufig, ihre Bücher jedoch scheinen die wenigsten gelesen zu haben. So könnte
man etwas plakativ die Erfahrung
beschreiben, die man immer wieder
bei der Erwähnung des Namens der
Wissenschaftlerin, Psychoanalytikerin, Schriftstellerin und Philosophin
Julia Kristeva macht. Dabei ist die
in Bulgarien geborene und in Frankreich lebende Kristeva eine der
wichtigsten und produktivsten
Vertreterinnen des französischen
Strukturalismus. Es mag an der
Vielseitigkeit ihres Werkes oder an
der Komplexität ihrer Texte liegen,
Tatsache ist, dass sie innerhalb der
deutschen Akademie außer von einigen gewagten Germanisten viel zu
wenig rezipiert wird. Desto erfreulicher ist, dass die in Würzburg lehrende Philosophin Bettina Schmitz
ihre zweite Studie zu Kristeva veröffentlicht hat.
Während Schmitz in ihrer ersten
Veröffentlichung unter dem Titel:
Arbeit an den Grenzen der Sprache. Julia
Kristeva (Königstein/Ts. 1998) das
Werk von Julia Kristeva und dessen
Entstehung sehr akribisch im Rahmen seiner intellektuellen Umgebung untersucht und kontextualisiert, geht sie in diesem Buch Die
Unterwelt bewegen. Politik, Psychoanalyse
und Kunst in der Philosophie Julia Kristevas dem politischen Verständnis von
Kristeva nach. Ein Verständnis, das,
so Schmitz, „sich über das Erleben
des Einzelnen, über ihre Gefühle
und Phantasien definiert“ (7). Gar
kein leichtes Unterfangen, wenn
man bedenkt, wie eine „Politik des
Individuellen“ – so die Definition
Schmitz’ in Anlehnung an Kelly Olivers Beschreibung – unserer geläufigen Auffassung von Politik widerstrebt. Wohl gemerkt, dass diese geläufige Auffassung gerade in ihrer
Unmittelbarkeit immer wieder eine
Erklärung schuldig bleibt. Denn gerade im Zeitalter der Globalisierung
scheint es schwieriger denn je, einem Bereich des Politischen, in den
nicht sogleich das Marktwirtschaftliche und das Soziale hineinfließen,
Neuerscheinungen
Konturen zu verleihen. Und doch
verspricht die Lektüre Schmitz’ in
ihrem Vorgehen einige produktive
Ergebnisse. Zwei Begriffe dienen
als Säulen, die ihr Unternehmen
stützen: Der Begriff der Revolution
und der Begriff der Revolte. Diese
beide Begriffe markieren auch
Kristevas eigene Entwicklung in
Annäherung an das Phänomen des
Politischen, das nach wie vor an den
eigenen Prozeß des Subjektwerdens
gefesselt zu sein scheint. So führt
uns Schmitz souverän durch das
komplexe Denken und die nicht
minder komplexe Begrifflichkeit
Kristevas und zeigt uns, wo die Meilensteine ihrer Auffassung von Politik liegen. Diese Führung findet in
Kristevas Hauptwerk Die Revolution
der poetischen Sprache ihren ständigen
Referenzpunkt, den Schmitz in ihrer
Lektüre zerlegt und in verschiedenen Schritten, immer um die Frage
nach dem Politischen kreisend, präsentiert. Dabei verzichtet sie auf den
inzwischen üblich akademischen
Ton sowie auf ausführliche Anmerkungen, die die Lektüre eines Buches öfters unnötigerweise verlangsamen. So lesen wir das Buch von
Schmitz, als ob sie uns Leser als
Gesprächpartner in ihren Reflexionen über die Möglichkeiten sowie
über die Mängel in Kristevas Konzeption von Politik ausgewählt hätte.
Die ersten vier Kapitel des Buches
stellen so keine systematische Darstellung von Kristevas Theorie in
engeren Sinne dar; sie sind eher der
Versuch, die Logik ihrer Theorie
aus der Sicht verschiedener Perspektiven auszulegen. Diese Perspektiven werden mit Hilfe von
Begriffe gewonnen, die für Kriste-
vas Denken zentral sind. Aber auch
frühere Texte werden von Schmitz
beachtet, so dass schließlich aus den
Spuren des Politischen bei Kristeva
dessen gesamten Entwicklung zum
Vorschein kommt.
Die Frage, die sich im Laufe der
Lektüre immer wieder herauskristallisiert, ist die nach den realen
Möglichkeiten einer „Politik des Individuellen“. Ist es überhaupt möglich, dass mein eigener Prozess des
Subjektwerdens – Voraussetzung
für meine Teilnahme an dem Bereich des Symbolischen – sowie
meine eigene Ausarbeitung von Gefühlen und Trieben so in Einklang
mit den verschiedenen Momenten
des Prozessen und der Ausarbeitung
eines Anderen kommt, dass wir von
einer gemeinsamen politischen
Handlung ausgehen können? Eine
spontane Skepsis scheint hier angebracht, und Schmitz Position
schöpft aus ihr auch Nutzen, auch
wenn man ab und zu das Gefühl
hat, dass sie Kristeva auch dort ein
wenig in Schutz nimmt, wo sie ihr
Denken etwas mehr hätte strapazieren können. Gerade im letzten Kapitel, in dem sie Kristevas Wendung
vom Begriff der Revolution zum
Begriff der Revolte herausarbeitet,
verdeutlicht Schmitz, wie wenig
Kristeva trotz der Akzentverschiebung – sie würde bei dem Begriff
der Revolte nicht mehr so sehr die
sprachliche Problematik, sondern
eher eine psychische bearbeiten – an
den entscheidenden Punkten ihre
ursprünglichen Überlegungen verändern möchte. So zeigt Schmitz,
wie die Theorie der Transpositionalität, die Kristeva in Die Revolution der
poetischen Sprache entfaltet hat – eine
komplexe Theorie, die in Anleh-
Neuerscheinungen
nung an linguistische, poetische und
psychoanalytische
Überlegungen
herausarbeitet, wie der Mensch zu
einem Sprachwesen wird, und wie
dabei „Körperliches und bereits
vorhandene gesellschaftliche sowie
sich bildende psychische Strukturen
aufeinandertreffen“ (181) durch eine intensivere Ausarbeitung psychischer Aspekte, die wiederum mit
denjenigen Grenzen zu tun haben,
die wir als sprechende und soziale
Wesen, die aber auch Triebe und
Gefühle haben, erleben –, zum Begriff der Subversion und dem der
Revolte kommt. Diese Entwicklung
spricht eher für ein Insistieren auf
dem individuellen Charakter der
Veränderungen, die, so Kristeva,
absolute Voraussetzung sind, um
auch gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen.
Wie und warum die Revolte, im
Prinzip als subjektiver Vorgang verstanden, sich so besonders produktiv gerade bei der Ausarbeitung gesellschaftlichen Verhältnisse erweist,
wird schwer verständlich. Schmitz
ist sich dieser Problematik bewusst
und bemerkt immer wieder, dass Intersubjektivität in Kristevas Modell
kaum Platz findet. Sie erklärt zwar,
wie bei Kristevas Auffassung politischer Praxis ein Moment der „Mikrosubjektivität“ zu finden ist, das
eher aus der „Zweiersituation von
Analytikerin und Analysand oder
Analysandin“ entnommen ist (186187); aber das Problem der Verbindung zwischen den individuellen
und den gesellschaftlichen Veränderungen bleibt weiterhin offen. Dies
ist umso bemerkenswerter, wenn
man Kristeva als eine Denkerin betrachtet, die, wie die Autorin betont,
immer wieder Möglichkeiten der
Vermittlung sucht (35). Schmitz
deutet an, wie die Intersubjektivität
einer solchen politischen Praxis
konkret aussehen könnte. Ein Beispiel dafür sei die Praxis des Affidamento, die von den Feministinnen
der Diotima-Gruppe vorgeschlagen
wurde; aber auch bei dieser Praxis
haben wir es nur mit einem Modell
der Zweierbeziehung zu tun, wie die
Autorin selber bemerkt. Es wiederholt sich daher die Frage, ob man
nicht mit einem anderen Begriff von
Politik operieren sollte, um überhaupt Kristevas Theorie als solche
zu verstehen. So scheint auch Arendts Auffassung vom politischen
Handeln, die Schmitz in Hintergrund immer wieder betrachtet, eher hinderlich als hilfreich zu sein,
um Kristeva hinsichtlich einer politischen Theorie zu lesen, wenngleich die Sprache und der Vorgang
des Erzählens eine zentrale Rolle
bei den theoretischen Arbeiten beider Autorinnen spielen.
Die Untersuchung über Kristevas
Politik des Individuellen vervollständig Schmitz mit einem Kapitel,
in dem sie auf ihre Auseinandersetzung mit dem Feminismus eingeht.
Kristevas Äußerungen über das
Weibliche, ihre Arbeiten über den
Begriff der Mutter sowie ihre
grundsätzliche Ablehnung des Feminismus haben aus ihr eine sehr
häufig kritisierte Autorin im Bereich
der Feministischen Theorie gemacht. Schmitz fasst Kristevas Position sowie die Kontroverse, die sie
hervorgerufen hat, zusammen. Hier
finden wir die Schmitz, die wir aus
anderen Texten kennen: klar, sachlich und nüchtern in der Darstellung
und immer die verschiedensten Positionen und Einwände beachtend.
Neuerscheinungen
Sehr hilfreich für die Lektüre ist das
Glossar, das viele von den im Text
immer wiederkehrenden Begriffen
einzeln erklärt. Der Band wird
schließlich ergänzt durch einen
Briefwechsel der Autorin mit der
Malerin und Psychoanalytikerin Ingrid Buchfeld, die übrigens auch das
schöne Umschlagbild entworfen
hat. In diesem Briefwechsel, der den
Titel Sehnsucht nach einem anderen Ort
oder Der unmögliche Wunsch, trägt, finden wir auch Kristevas Denken mit
einer sehr poetischen Ader ausgesprochen. Ein rundum schönes
Buch und eine gute Art, mit Kristevas Denken in Berührung zu kommen.
María Isabell Peña Aguado
Hans-Martin Schönherr-Mann
Das Mosaik des Verstehens.
Skizzen zu einer negativen Hermeneutik, München 2000 (edition fatal), book on demand, 17.60 DM.
„Ein Buch für viele nicht“ – schlägt
man das jüngste Produkt aus der
Werkstatt des am GeschwisterScholl-Institut lehrenden Münchner
Philosophen Hans-Martin Schönherr-Mann auf, springt einem gleich
auf der ersten Seite diese Warnung
entgegen. Nicht von ungefähr erinnert sie an Nietzsche, einen der
großen Zertrümmerer der Metaphysik, dessen Zarathustra ausdrücklich
„ein Buch für alle und keinen“ sein
wollte. Vorsicht ist also geboten, die
in Aussicht gestellte Exklusivität der
Lektüre zugleich ein Quell der Verunsicherung: Ist man selbst der Lektüre gewachsen; gehört man zu den
wenigen, für die dieses Büchlein ge-
schrieben ist, zu den wenigen, die ...
verstehen?
Um das „Verstehen“ bzw. um das
„Verstehen des Verstehens“ – die
traditionelle Aufgabe der philosophischen Hermeneutik – geht es in
dieser knapp 100 Seiten umfassenden Textsammlung, die 66 einschlägige philosophische Fragmente zu
einem bunten „Mosaik des Verstehens“ bündelt und auch darin, im
fragmentarisch-aphoristischen Duktus des Philosophierens, dem Vorbild Nietzsches folgt. Der Untertitel
klärt auf und verdunkelt zugleich,
wohin die intellektuelle Reise geht:
Vorgelegt werden „Skizzen zu einer
negativen Hermeneutik“. Skizzen
sind Zeichnungen eher denn Analysen, im besten Falle aufmerksame
Beobachtungen, feinfühlig beschreibende Erkundungen mit Einsichtscharakter, der Kunst verwandt, wo sie als Vorstudien Verwendung finden, auf die in der
Regel der große Wurf – das Bild, die
Skulptur, die Inszenierung – folgt.
Den großen Wurf, sprich eine zum
System verdichtete Theorie der negativen Hermeneutik wird es – aller
Voraussicht nach – nicht geben.
Weil es sie nicht geben kann, weil
Philosophieren nach und in der
Tradition Nietzsches für den Verfasser bedeutet, jeden universalistischen Wahrheitsanspruch fahren zu
lassen und auf den großen Wurf zugunsten der kleinen Form, des Essays, des Aphorismus zu verzichten.
Dies gilt ganz besonders für eine
„negative Hermeneutik“, die gegen
den philosophischen Mainstream
Differenz und Nichtverstehen als Fundamente und Horizont jeglichen
Verstehens behauptet und nicht in
der gelingenden Verständigung, im
Neuerscheinungen
Konsens, sondern im (gemeinsamen) Erleben der Differenz(-en)
das Ethos des Verstehens verankert.
Schon aus ‚ästhetischen’ Gründen
ist sie gehalten, den mannigfachen
Erfahrungen und Erfahrungsweisen
der Differenz auch durch die Art
der Darstellung Rechnung zu tragen. Differenzen lassen sich eben
nur um den Preis ihrer Aufhebung
ins System – der Philosophie, der
Familie, der Liebe, des Sexes – integrieren. Will man sie respektieren,
darf man sie nicht zwanghaft in die
Einheit eines Prinzips versammeln,
nur um sie anschließend aus dieser
Einheit heraus erklären zu können.
Differenzen – so das methodische
wie ethische Credo des Verfassers –
sind anzuerkennen, zu beschreiben
und auszuhalten, nicht aber (systemisch oder dialektisch) aufzuheben.
Darin unterscheidet sich die negative Hermeneutik Schönherr-Manns
von der negativen Dialektik Adornos,
der gegen alle Erfahrung an der
(theoretischen) Möglichkeit und
(praktischen) Wünschbarkeit der
Versöhnung, an der prinzipiellen
Identität von Identität und Differenz festhält.
In kurzen, oftmals nur eine halbe
Seite langen und durchweg sehr persönlich gefärbten Texten nähert sich
Schönherr-Mann seinem Thema.
Eine Ordnung ist nicht erkennbar
und aus den oben genannten
Gründen wohl auch nicht beabsichtigt. Gemäß der Überzeugung, daß
das Nichtverstehen in den Falten
des Verstehens siedelt, wendet sich
der Verfasser insbesondere solchen
Phänomen zu, die nach herkömmlichem „Verständnis“ Verstehen intendieren, voraussetzen, implizieren,
ermöglichen, die aber, recht eigent-
lich besehen, doch nur die Kraft
und Gewalt des Nichtverstehens
bezeugen: der Begegnung, dem Gespräch und der Sprache, der
Freundschaft, der Liebe, der Zärtlichkeit und dem Sex, der Anderen,
der Familie, Gott und der Religion.
So wenig es eine „wirkliche“ Begegnung zwischen zwei Menschen gibt
ohne die Anerkennung der gegenseitigen Differenz, so wenig gibt es
Liebe, Sex, Zärtlichkeit, Freundschaft, mit anderen Worten: ein
Verstehen „der Anderen“, das nicht
zugleich ein Nichtverstehen wäre.
Weil verstehen immer bedeutet,
„etwas Anderes verstehen“ (16), ist
„die Bedingung jeglichen Verstehens das
Nichtverstehen“ (17). Das Nichtverstehen wurzelt „am Grunde des
Verstehens“, und es stellt zugleich
dessen unverrückbaren Horizont
dar: Erst wenn wir nichtverstanden
haben, wenn wir uns der unüberbrückbaren Differenzen bewußt
geworden sind, die uns von uns
selbst, unseren Repräsentationen
und von den anderen trennen, haben wir verstanden, sind wir uns
begegnet, vermögen wir – trotz allem – zu lieben und zu genießen, zu
hassen und zu verwünschen. Der
Wunsch nach Übereinstimmung,
nach grenzenloser Hin- und (Selbst)Aufgabe, Erfüllung, Verschmelzung, das Sehnen nach Identität,
markiert demgegenüber nicht Anfang und Ziel, sondern das Ende
jeglichen Verstehens. Wo das Gesetz der Einheit waltet, wo Konsens
und Universalität regieren, haben
die Differenzen ausgespielt, kann es
weder Begegnung noch Verstehen
geben, jedenfalls nicht im Sinne der
negativen Hermeneutik. Im Spiel
der Liebenden – so Schönherr-
Neuerscheinungen
Mann – entfalte sich diese antihegelianische Dialektik des Verstehens
in ihrer größten Komplexität, zugleich aber auch in ihrer größten
Schwierigkeit: So wenig zur Liebe
die Erfüllung gehört, „die ihr Tod
ist“ (23), so sehr bedarf sie „ihre(r)
Verhinderung und Beeinträchtigung, ihre(r) Gefährdung und ihre(r) Störung“ (ebd.), um jene Spannung zu erzeugen, der sie ihre
Lebens- und Liebeskraft verdankt.
„Liebe realisiert sich ob ihrer Beschränkung“ und nicht trotz! „Lieben heißt verstehen in seiner vollen
Komplexität und Differentialität,
heißt somit primär Nichtverstehen.“
(25) Gleiches gilt selbstverständlich
auch für das Gespräch unter Freunden, den Sex und den Glauben an
Gott. Weil wir uns – auch als Liebende, Freunde oder Sexualpartner,
als Betende und Bittende, verzweifelt Hassende und sehnsuchtsvoll
Hoffende – verfehlen, permanent
miß- und nichtverstehen, weil wir
nicht zueinander finden, weder im
Guten noch im Bösen, bleiben wir
einander zugeordnet, können wir
miteinander auf nicht-banale Art
und Weise kommunizieren.
Die ethischen Konsequenzen einer
solchen Argumentation liegen auf
der Hand: Will man Menschen begegnen, „wahrhaft“ begegnen, will
man „der Anderen in ihrer absoluten Andersheit“ (11) gewahr und
gerecht werden – und um nichts
anderes geht es letztlich in diesem
Buch: um Kunst und Geheimnis
der ‚wahren’ Begegnung –, muß
man das Trennende suchen, fördern, unterstützen, verbreiten, es
stark machen gegen die ‚Gemeinde’;
von ihr zuallerst gelte es sich – so
der keineswegs allgemeingültige Rat
des Verfassers – fernzuhalten, und
sei es um den Preis, von eben dieser
Gemeinde als Egoist (oder Schlimmeres) beschimpft (und ausgegrenzt) zu werden. Gemeinschaft
vermag keine wirkliche Begegnung
mit anderen Menschen zu stiften, in
der Menge ist jeder einsam – und
bleibt es. Wahre Begegnung setzt
die Kraft zur selbstgewählten Isolation voraus – und zwei, die sich in
diese Begegnung teilen, ohne die
Andere überwältigen oder beherrschen zu wollen: „Möchte man jemandem begegnen, dann will man
nicht dessen, deren Leben ändern,
nicht bereiten, nicht vorprägen,
nicht missionieren. Man will davon
hören, es sehen, es spüren, es sein
lassen, wie es ist.“ (12)
Dieses Credo könnte einen wunderbaren kategorischen Imperativ
abgeben, wäre nicht die Zeit für kategorische Imperative endgültig vorbei. So stellt es nicht mehr als eine
unverbindliche Empfehlung dar: für
alle, die sich davon angesprochen
fühlen. „Das Mosaik des Verstehens“ ist in der Tat „(ein) Buch für
viele nicht“; dieses aber auf eine so
charmante und gesprächige Weise,
die es dem Rezensenten zur lieben
Pflicht werden läßt, es den wenigen
wärmstens ebenso zu empfehlen
wie jenen ambitionierten Münchner
Verlag, der es herausgebracht hat.
Die „edition fatal“ ist – dieser
Hinweis sei mir an dieser Stelle
erlaubt – nach eigenem Bekunden
ein nicht kommerziell orientiertes
Unternehmen, das originellen und
kritischen Arbeiten aus dem Bereich
der Gesellschaft-, Geistes- und
Kulturwissenschaften ein Forum
bieten will und zu diesem Zweck
nicht nur auf die Veröffentlichung
Neuerscheinungen
lichung ihres Programms im Internet sowie auf CD-Edition setzt,
sondern vor allem auf eine Technologie („Books on Demand“), die es
erlaubt, auch kleinste Auflagen in
hoher Qualität kostengünstig zu realisieren. Angesichts der vorliegenden Publikationen darf man auf Zukünftiges gespannt sein!
Bernd Mayerhofer
Joachim Schulte, Uwe Justus Wenzel (Hg.)
Was ist ein philosophisches
Problem? Frankfurt/Main 2001
(Fischer), 216 S, 29,14 DM.
Mit dieser Frage setzen sich in dem
Sammelband 15 AutorInnen auseinander, fast alle (emeritierte) ProfessorInnen für Philosophie. Ihre Antworten sind keine Versuche,
philosophische Probleme zu definieren, sondern Versuche einzukreisen, was unter philosophieren verstanden werden kann. Dabei befassen sich die AutorInnen mit dem
„Handwerk“ Philosophie und stellen Verfahrensweisen der Disziplin
(etwa Begriffsanalyse) sowie Philosophiekonzeptionen vor. Auch die
Unterschiede zwischen einer philosophischen
und
einer
(fach)wissenschaftlichen Behandlung eines Gegenstands werden erörtert. Neben dieser Abgrenzung
der Philosophie als akademischer
Profession sind einige der Beiträge
dem Thema gewidmet, wie sich philosophische Fragestellungen zur
Lebenspraxis, zu Mythen oder Gewissheiten des Alltags verhalten.
Anhand des Verhältnisses zwischen
Literatur und Philosophie betrachtet
beispielsweise Christoph Menke den
Vorwurf, „die Philosophie betreibe
eine in ihren Konsequenzen gefährliche Infragestellung sozialer Praktiken“ (124). Er argumentiert, Philosophie sei keine „gewaltsame Infragestellung und Unterbrechung einer
funktionierenden Praxis von außen“, sondern setze dort an, wo die
Praktiken tragenden Überzeugungen „selbst schon in Probleme, in
irritierende Unbestimmtheiten oder
Gegensätzlichkeiten geraten sind“
(125). Die Beschäftigung mit
Grundlagen von Wissen und Verstehen, das Wissen um die Grenzen
philosophischer Verfahren kann
philosophische
Problemlösungen
davor bewahren, „in Positionen zu
enden, denen eine umfassende
Wahrheitsfähigkeit durchaus nicht
wird zugeschrieben werden können“ , formuliert Dieter Henrich in
seinem Beitrag „Das eine Problem,
sich Problem zu sein“ das Streben
um die Klärung der Grundlagen
menschlichen Lebens (99).
Die Darstellung, in wie weit philosophische Probleme Fragestellungen aus der Lebenspraxis aufgreifen,
dürfte den Sammelband für philosophisch interessierte Laien interessant machen. Die Mehrzahl der Beiträge, die einem philosophischen
Schnelldurchlauf
gleichkommen
(Dieter Henrich), bringt in dieser
Hinsicht auch erhellende Klarstellungen. Daher lassen sich die drei
sehr schnell hingeschrieben wirkenden Kurztexte von Richard Rorty (Im
Dienst der Welterschließung), Georg
Meggle (Meine philosophischen
Probleme und ich) sowie Martha
Nußbaum (Arbeit an der Kultur der
Vernunft) durchaus verdrängen.
Jadwiga Adamiak
Neuerscheinungen
Clemens K. Stepina
Handlung als Prinzip der Moderne, Studien zu Aristoteles, Hegel
und Marx, Wien 2000 (Passagen),
br., 135 S., 39.10 DM.
Das Buch enthält vier bereits veröffentlichte Aufsätze; der Essay über
die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ wurde in dieser Zeitschrift,
der Nr. 32 des Widerspruch, erstmals abgedruckt.
Der erste Aufsatz beschäftigt sich
mit dem Verhältnis von Praxis und
Poiesis bei Artistoteles, bei dem sich
Handeln unter den Bedingungen einer Sklavenhaltergesellschaft in
selbstbestimmtes, „ethisches“ Verhalten (Praxis) und fremdbestimmte, „niedrige“ Arbeit (Poiesis) ausdifferenziert. Künstlerisches Schaffen, als hervorbringendes Handeln
eigentlich der Poiesis zugeordnet,
läßt sich in dieser Gesellschaft nur
als Legitimation der Herrschaft zur
Praxis „adeln“ und verliert so die
Freiheit der Darstellung. Der zweite
Teil legt dar, wie der frühe Marx in
den Ökonomisch-philosophischen
Manuskripten Hegel „vom Kopf auf
die Füße stellt“, dessen bürgrliche
Deutung
des
Herr-KnechtVerhältnisses im folgenden Abschnitt ausgeleuchtet wird. Im letzten Teil über „zeitgenössische
Handlungsphilosophie“ werden verschiedene (dogmatische) Richtungen marxistischer Philosophie und
die kritische Theorie, speziell in ihrer „modernen“ Form der Theorie
kommunikativen Handelns, vorgestellt und kritisiert. Im Ergebnis
wird festgehalten, daß keine existie-
rende Theorie das Gewaltverhältnis
von Herrschaft und Knechtschaft
theoretisch aufzulösen imstande ist.
Percy Turtur
Dieter Sturma (Hrsg.)
Person. Philosophiegeschichte
— Theoretische Philosophie Praktische Philosophie,
Paderborn 2001
(mentis), br., 463 S., 98.- DM.
Die umfangreiche, dreigeteilte Aufsatzsammlung beginnt mit Beiträgen
zum Begriff "Person" im Wandel
der Zeiten, z.B. dem von Annemarie Pieper zur Existenzphilosophie.
Die folgenden Aufsätze behandeln
Theorien zur Person und personalen Identität, z.B. der Beitrag von
Martine Nida-Rümelin zur zeitlichen Kontinuität, der sich für eine
"realistische" Betrachtung stark
macht, und der Aufsatz von Dieter
Bimbacher zum Problem der
Grenzziehung des Begriffs "Person" zwischen Tier und Maschine.
Im praktischen Teil geht es schließlich um ethische Implikationen des
Begriffs "Person", etwa in dem Aufsatz von Dieter Sturma zu den
Menschenrechten, die an den theoretischen Begriff des Subjekts gekoppelt sind, dem Beitrag von Barbara Merker, die eine "Ethik der
Unvollkommenheit" entwirft, und
dem Aufsatz von Ludwig Siep zur
biomedizinischen Ethik.
Der umfangreiche Band bildet ein
ausführliches Kompendium aktueller Diskussionen zum Thema "Per-
Neuerscheinungen
son" mit Schwerpunkt auf analytischer Philosophie.
Percy Turtur
Rainer E. Zimmermann
Die Rekonstruktion von Raum,
Zeit und Materie
Frankfurt/Main 1998 (Peter Lang),
geb., 313 S., 89.- DM.
Der Titel des teilweise recht anspruchsvollen Buches erinnert an
das fundamentale Werk des Mathematikers Hermann Weyl (18851955) Raum, Zeit, Materie (1918),
den Zimmermann auch erwähnt. In
der Einleitung (‚Aspekte des Rekonstruktionsbegriffs’) werden die
Grundbegriffe, Intentionen und der
Aufbau der Studie erläutert. Im ersten Teil befaßt sich der Autor – im
Anschluß an R. Penrose – mit der
„physikalischen Binnenperspektive“, im zweiten mit dem „philosophischen Ansatz“ und im dritten
mit
„Wissenschaftstheoretischen
Aspekten der Rekonstruktion“. Ein
stattliches Literaturverzeichnis und
ein Personenregister bilden den
Abschluß. Der zweite, bei weitem
umfangreichste Teil ist der Naturphilosophie Schellings gewidmet,
die als Paradigma erscheint und in
der „Freiheit als letztem Grund der
Evolution“ wurzelt. Andere Kapitel
befassen sich mit der Selbstorganisation der Natur, der „Tübinger Axiomatik“, dem Spätwerk Schellings,
der Schelling-Rezeption bei E.
Bloch sowie mit Zeit und Zeitlichkeit. Im dritten Teil erörtert Zimmermann unter anderem „Status
und Horizont großer, vereinheitlichender Theorien von allem
(TOEs).“ Damit schließt sich der
weite thematische Kreis von einem
oft vernachlässigten Zweig der idealistischen Naturphilosophie des
Neunzehnten zu nicht weniger ambitiösen, wenn auch vielleicht realistischeren, naturwissenschaftlichen
Vorhaben des Zwanzigsten Jahrhunderts.
Die Probleme eines so umfassenden
Vorhabens liegen auf der Hand: Zu
den äußerst schwierigen, in der Sache begründeten physikalischen
Problemen: Was ist Raum? Was ist
Zeit? Was ist Materie? gesellen sich
nicht geringere historische, philosophische und methodische Fragen
wie der Vergleichbarkeit, Erkennbarkeit und terminologischen Faßbarkeit, ganz abgesehen von der brisanten
RekonstruktionsProblematik. Zimmermann hat sich
redlich bemüht, all diese Hürden zu
nehmen und dabei offensichtlich
ganz plausible Ergebnisse erzielt, so
wenn er der mit Einsteins Relativitätstheorien verbundenen Geometrisierung der physikalischen Welt
eine „Dynamisierung der Geometrie“ zur Seite stellt (49) und von einer „zweiten Geometrisierung“ der
Welt durch R. Penrose spricht. Ob
das von I. Kant erörterte Problem
des Weltanfangs tatsächlich als
„durch die Twistortheorie von Penrose bewältigt“ (59) angesehen werden kann, erscheint allerdings fraglich. Überzeugender ist der Hinweis
auf die neue Aktualität von Schellings Freiheitsgedanken (65), allerdings unter Verzicht auf dessen idealistische Metaphysik, was sich
besonders in Schellings Auffassung
des Lichts zeigt (219 f.), die heute
nicht mehr aus dem Reich des Idealen, sondern aus dem Bereich der
Neuerscheinungen
Materie abgeleitet wird. Man wird
dem Autor wohl oder übel zustimmen müssen, wenn er konstatiert:
„Natürlich ist das Unbefriedigende
an all diesen gegenwärtig gängigen
Ansätzen, die auf eine künftige
‚Theorie von allem’ abzielen, daß sie
in Wahrheit keine sind. Sie zielen
bestenfalls auf Theorien aller Physik, aber nicht auf wirkliche Theorien von allem.“ (284) Ob man Z.s
terminologischen, ein wenig exotisch wirkenden Vorschlägen, wie:
„Metapherisierung“
der
Welt,
„Denklinienkonsistenz“ beim Rückgriff auf historische Konzepte der
Philosophie, die auf einer „Linie“
liegen, oder „Insichtnahme“ anstelle
von Sichtung folgen wird, bleibt abzuwarten.
Ernst Sandvoss
In: Widerspruch Nr. 37 Jüdisches Denken – Jüdische Philosophie (2001), S. 138-139
AutorenInnenverzeichnis
AutorInnen
JADWIGA ADAMIAK, Journalistin,
München
ROGER BEHRENS, M.A., Lehrbeauftragter am Institut für Allgemeine
Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg
ASTRID DEUBER-MANKOWSKY,
Wiss. Assistentin am Kulturwissenschaftlichen Seminar, HumboldtUniversität Berlin, Mitherausgeberin
der Zeitschrift „die Philosophin“
RICHARD FABER, Dr. phil. habil.,
Privatdozent, Soziologe, Freie Universität, Berlin
ULRICH VAN DER HEYDEN, Dr.
phil., Dr. rer. pol., Kolonialhistoriker und Politikwissenschaftler, wiss.
Mitarbeiter am Institut für Soziologie, FU Berlin
REINHARD JELLEN, Student der
Philosophie, München
GEORGIOS KARAGEORGOUDIS, Jurist, wissenschaftliche Hilfskraft am
Institut für Philosophie (Lehrstuhl
I), München
IGNAZ KNIPS, Lehrbeauftragter der
Uni Köln, Abt. Internationale Beziehungen, Köln
MANUEL KNOLL, Dr. phil., Lehrbeauftragter am Institut für Politische
Wissenschaften der LMU und der
Hochschule für Politik, München
GEORG KOCH, M.A., Antiquar und
freier Autor, München
DANIEL KROCHMALNIK, Dr. phil.,
Prof., Hochschule für Jüdische
Studien, Heidelberg
KONRAD LOTTER, Dr. phil., Lehrbeauftragter am Institut für allg. und
vergleichende Literaturwissenschaft
der Uni München
BERND MAYERHOFER, M.A., Lehrbeauftragter am GSI der Universität
München, freier Autor
THOMAS MEYER,
FRIEDRICH NIEWÖHNER, Dr. phil.,
Prof., Leiter der Abt. Forschungsförderung der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel
ALEXANDER VON PECHMANN, Dr.
phil., Lehrbeauftragter der VHS
München
MARÍA ISABELL PEÑA AGUADO,
Dr. phil., Lehrbeauftragte der TU
Chemnitz, Gastprofessorin für
Philosophie an der Hochschule für
Graphik und Buchkunst Leipzig
MARIANNE ROSENFELDER, M.A.
der politischen Philosophie, freie
Journalistin, München
MICHAEL RUOFF, Dr. phil., Philosoph und freier Autor, München
OLAF SANDERS, Dr. phil., wiss.
Assistent am Institut für Allgemeine
Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg
MARTIN SCHRAVEN, Dr. phil. habil.,
Privatdozent für Philosophie, Universität Bremen, Schelling-Forschungsstelle, Ebersberg
WERNER STEGMAIER, Dr. phil.,
Prof., Institut für Philosophie, Universität Greifswald
PERCY TURTUR, M.A., freier Autor,
München
GIUSEPPE VELTRI, Dr. phil., Prof.,
Direktor des Leopold-Zunz-Zentrums zur Erforschung des europäischen Judentums, Halle-Wittenberg
KLAUS WEBER, Dr. phil., Prof. für
Psychologie, FH Frankfurt, Gastprofessor für Psychologie, Universität Innsbruck
MICHAEL ZANK, Prof., Dr. phil.,
Assistant Professor of Religion,
Boston University, Massachusetts
(USA)
RAINER R. ZIMMERMANN, Prof.,
Dr. rer.nat., Dr. phil., Fachbereich
Allgemeinwissenschaften, Fachhochschule München
GÜNTER ZÖLLER, Prof., Dr. phil.,
Professor für Philosophie, Ge-
schäftsführender Vorstand des
Philosophie-Departments, LMU
München
In: Widerspruch Nr. 37 Jüdisches Denken – Jüdische Philosophie (2001), S. 139
Impressum
Impressum
Impressum
Tel & Fax: (089) 2 72 04 37;
e-mail: [email protected]
Widerspruch
Münchner Zeitschrift für Philosophie
21. Jahrgang (2001)
Erscheinungsweise
halbjährlich / ca. 1000 Exemplare
Herausgeber
Münchner Gesellschaft für
dialektische Philosophie,
Tengstr. 14, 80798 München
Redaktion
Jadwiga Adamiak, Reinhard Jellen,
Manuel Knoll, Georg Koch, Wolfgang
Melchior (Internet), Konrad Lotter
(verantw.), Alexander v. Pechmann,
Martin Schraven, Percy Turtur
Verlag
Widerspruch Verlag,
Tengstr. 14, 80798 München.
Gestaltung: Percy Turtur, München
ISSN 0722-8104
Preis
Einzelheft: 12.- DM
Abonnement: 11.- DM ( zzgl. Versand)
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder. - Für unaufgeforderte
Manuskripte wird keine Haftung übernommen. – Nachdruck von Beiträgen
aus Widerspruch ist nur nach
Rücksprache und mit Genehmigung
der Redaktion möglich.