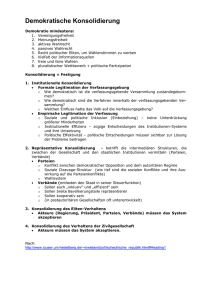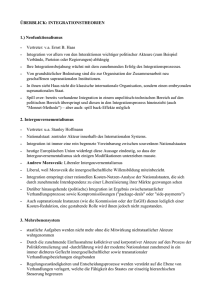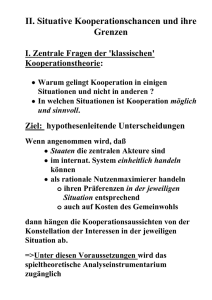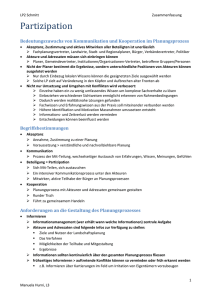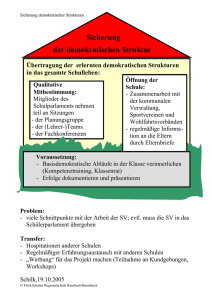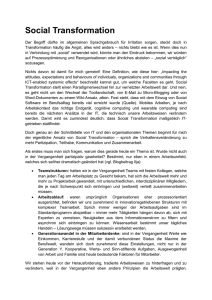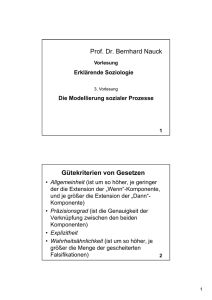Die Transformation Osteuropas : Eine Herausforderung für
Werbung
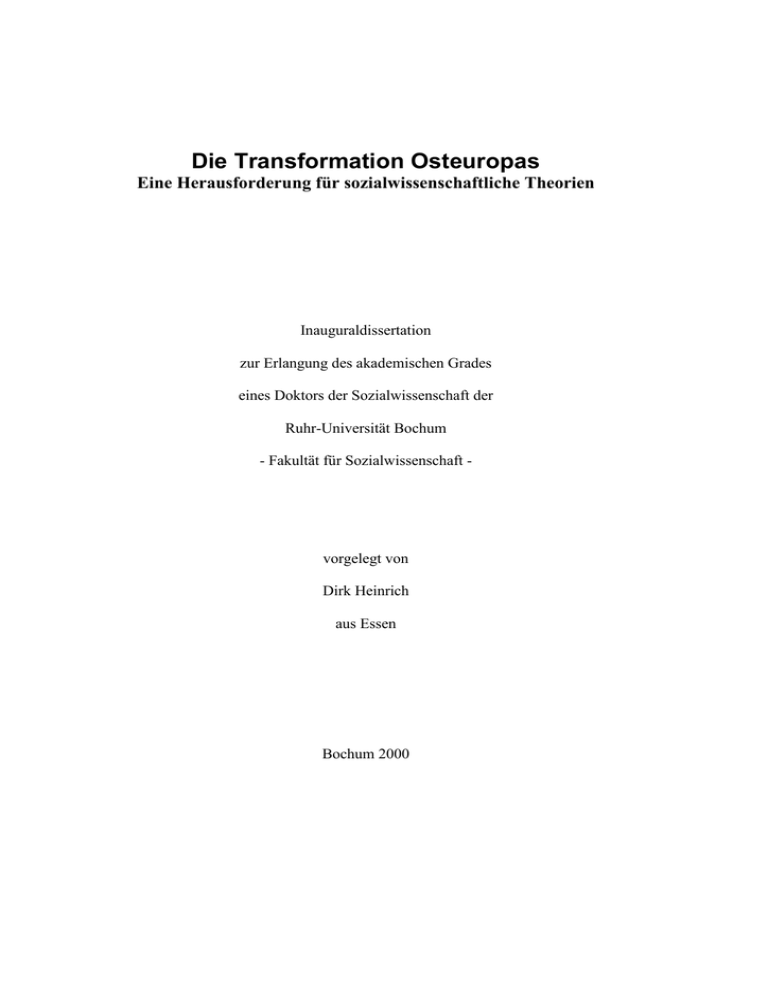
Die Transformation Osteuropas Eine Herausforderung für sozialwissenschaftliche Theorien Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum - Fakultät für Sozialwissenschaft - vorgelegt von Dirk Heinrich aus Essen Bochum 2000 INHALT iii iv Abbildungen Abkürzungsverzeichnis 1 EINLEITUNG I. TRANSFORMATIONSFORSCHUNG VOR 1989 17 II. DER ZUSAMMENBRUCH DER ALTEN ORDNUNG 29 1 Makrotheoretische Ansätze 1.1 Systemische Defizite 1.2 Geopolitische Herausforderungen 1.3 Modernisierungsdefizite Exkurs: Modernisierungstheorien Ökonomische Defizite Politische Defizite Defizite in der Wertverallgemeinerung 1.4 Zusammenfassung 30 31 35 40 40 46 48 60 68 2 Mesotheoretische Ansätze 2.1 Exkurs: Institutionentheorien 2.2 Defizite intermediärer Institutionen 2.3 Effekte strategischer Institutionenänderungen 2.4 Zusammenfassung 73 74 82 92 98 3 Mikrotheoretische Ansätze 3.1 Interaktionen politischer Akteure 3.2 Öffentliche Mobilisierung 3.3 Zusammenfassung 102 105 117 129 4 Die Verhandlungen an den Runden Tischen: Ein Modellentwurf 4.1 Strategische Spiele 4.2 Normativer Rahmen 4.3 Verständigung 4.4 Zusammenfassung 135 i 137 148 156 160 III. IV. DIE KONSOLIDIERUNG DER NEUEN POLITISCHEN ORDNUNG 162 1 Vorbemerkung 1.1 Demokratie 1.2 Konsolidierung 163 163 167 2 Das Erbe der kommunistischen Regime 2.1 Strukturelles Vermächtnis 2.2 Institutionelle Defizite 2.3 Elitenkontinuität 2.4 Zusammenfassung 176 177 186 192 197 3 Der Umbau der Institutionen 3.1 Verfassung 3.2 Regierungssystem 3.3 Wahlsystem 3.4 Parteien und Interessengruppen 3.5 Architekten des institutionellen Umbaus 3.6 Zusammenfassung 199 200 209 216 223 230 235 4 Stabilisierung 4.1 Institutionelle Stabilitätsbedingungen 4.2 Compliance 4.3 Zusammenfassung 236 237 241 245 5 Die politische Konsolidierung im Spannungsfeld von Wirtschaft und Kultur 5.1 Erste Reaktionen: Dilemmas der Reformen 5.2 Erste Revisionen: Chancen und Risiken für Reformen 5.3 Zusammenfassung 247 247 255 260 ERGEBNIS 262 1 Die Mehrebenenanalyse des Zusammenbruchs 265 2 Die Mehrebenenanalyse der politischen Konsolidierung 273 3 Schlußfolgerungen für die Theoriebildung 281 LITERATUR 300 ii ABBILDUNGEN Abbildung 1: Games of Transitions by Agreement Abbildung 2: Charakteristik der „RT-Spiele“ in Osteuropa Abbildung 3: Der Zusammenbruch Abbildung 4: Die politische Konsolidierung iii 108 147 298 299 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS BCP BRD BSP bspw. bzw. CSFR CSSR DDR ders. DGS d.h. dies. FDGB GUS Hg. HSWP Jg. KGB KPdSU NÖS Nr. PUWP RGW RT SED SEU SU u.a. UDF UdSSR US USA USS v. vgl. Vol. z.B. z.T. z.Z. Bulgarien Communist Party Bundesrepublik Deutschland Bulgarien Socialist Party beispielsweise beziehungsweise Tschechische und Slowakische Föderative Republik Tschechoslowakische Sozialistische Republik Deutsche Demokratische Republik derselbe Deutsche Gesellschaft für Soziologie das heißt dieselbe Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Gemeinschaft unabhängiger Staaten Herausgeber Hungarian Socialist Worker’s Party Jahrgang Komiteit gossudarstwennoi besopasnosti = Komitee für Staatssicherheit Kommunistische Partei der Sowjetunion Neues Ökonomisches System der Leitung und Planung Nummer Communist Party of Poland Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe Runder Tisch Sozialistische Einheitspartei Deutschlands Subjective Expected Utility Sowjetunion unter anderem Union of Democratic Forces Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken United States United States of America Union Souveräner Staaten von vergleiche Volume zum Beispiel zum Teil zur Zeit iv Einleitung EINLEITUNG 1 Einleitung 2 Die vorliegende Arbeit ist eine vergleichende Untersuchung sozialwissenschaftlicher Erklärungs- und Untersuchungsansätze zur Transformation Osteuropas. Es werden Leistungen und Grenzen aktueller theoretischer Ansätze in der Transformationsforschung aufgezeigt und ein Modell entworfen, mit dem sich die Ansätze zusammenfügen lassen. Ziel ist es, mit einer Methode, die unterschiedliche theoretische Perspektiven integrieren kann, zum Verständnis der Transformation beizutragen und an der Entwicklung der noch jungen Transformationsforschung mitzuwirken. Die Transformation Osteuropas ist ein Glücksfall für den Versuch, eine integrative Methode zu entwickeln. Selten hat ein Thema so viele Wissenschaftler aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen beschäftigt und in einem vergleichbaren Maße zur Anwendung unterschiedlicher theoretischer Perspektiven motiviert. Darüber hinaus bietet die historische Nähe zum Anwendungsbezug Vorteile: Einstieg und Zugang zum Thema fallen vergleichsweise leicht, weil zahlreiche Quellen und umfangreiche Literatur, in der das Phänomen Transformation mit aktuellen theoretischen Methoden aufgearbeitet wird, zur Verfügung stehen. Zugleich ist die zeitliche Distanz von bis zu einer Dekade eine gute Voraussetzung für einen nüchternen Blick; die Entwicklung in den osteuopäischen Staaten läßt sich mittlerweile realistischer einschätzen, und entsprechend kann ein erstes kritisches Resümee zum Beitrag der Transformationsforschung Osteuropas und zu den blinden Flecken der theoretischen Beschreibungen gezogen werden. Warum es zu den umfangreichen theoretischen Anstrengungen kam, wird verständlich, wenn man rekapituliert, welche Bedeutung die Ereignisse in Osteuropa für die Sozialwissenschaften hatten. Deshalb erfolgt einleitend eine kurze Momentaufnahme der Ereignisse um 1989, mit der an das Thema Transformation Osteuropas und an die Problemstellung und Herausforderung, die sich aus der Transformation für die Sozialwissenschaften ergaben, herangeführt wird. Anschließend wird die These der vorliegenden Arbeit entwickelt und das Vorgehen zu ihrer Prüfung vorgestellt. Die jüngsten Umbrüche in Osteuropa, die ihre dramatischen Höhepunkte von 1989 bis 1992 hatten, sind uns allen noch in lebendiger Erinnerung. Auch wenn heute, ca. 10 Jahre später, die anfängliche Euphorie und Begeisterung vor dem Hintergrund enttäuschter Erwartungen, schmerzlicher Entwicklungen und realistischerer Entwicklungseinschätzungen verblaßt sein mögen, so ist das Erstaunen über die Plötzlichkeit und das Ausmaß der Entwicklung noch nicht gewichen. Wir sind Zeugen eines Prozesses geworden, bei dem sich in einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne tiefgreifende Veränderungen mit weitreichenden Folgen ereigneten1: Die kommunistischen Regime2 in der 1 Für eine ausführliche Darstellung der politischen Prozesse in den Jahren des Umbruchs vgl. Weltgeschehen, W. Zürrer (Hg.:): Band IV 1989 und IV 1991 (für die Entwicklung in der Sowjetunion), Band II 1990 (für die Entwicklung in Rumänien und Ungarn), Band IV 1990 (für die Entwicklung in Polen und der Tschechoslowakei). Einleitung 3 DDR, der Tschechoslowakei und in Rumänien brachen zusammen. In Polen gewann die Solidarnosc die Wahlen zum nationalen Parlament, d.h. eine nicht-kommunistische Regierung entstand. In Ungarn und Bulgarien wurden Mehrparteiensysteme etabliert. Parallel zu diesen Ereignissen erfolgte der Zusammenbruch der Sowjetunion. Diese Entwicklung und die vorausgehenden politischen und ökonomischen Veränderungen in der Blockvormacht spielten sicherlich eine Schlüsselrolle beim Zusammenbruch der anderen kommunistischen Regime. Mit der Breshnew-Doktrin3 drohte noch die Gefahr einer militärischen Intervention der Truppen des Warschauer Paktes für den Fall, daß die kommunistischen Staaten Mittel- und Osteuropas politische Alleingänge planten. Mit der Wahl Gorbatschows zum Generalsekretär der KPdSU bzw. zum Präsidenten der Sowjetunion und mit der von ihm angestrengten Reformpolitik der Glasnost sowie Perestroika veränderte sich die Beziehung zwischen den kommunistischen Staaten. Der in der Breshnew-Doktrin zum Ausdruck kommende sowjetische Hegemonialanspruch wurde endgültig aufgegeben, als Gorbatschow bei den Feiern zum vierzigsten Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 verkündete: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“. Damit fiel ein wesentlicher Rückhalt nationaler kommunistischer Führungen weg, auf den diese ihren Widerstand gegen demokratische Reformen noch hätten stützen können. In der DDR zeigte sich diese Auswirkung besonders deutlich: Der Prozeß, der mit den Bürgerprotesten gegen die Wahlfälschung bei den Kommunalwahlen im Mai 1989 begann und sich mit der Grenzöffnung in Ungarn am 11. September des selben Jahres rasant beschleunigte, konnte sich nun weitgehend ungehindert fortsetzen. Im Juni 1989 hatte sich die DDR-Führung noch solidarisch mit der Repressionspolitik der chinesischen Regierung gezeigt, die am 4. Juni auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking ein Massaker veranstaltet hatte. Damit demonstrierte das Politbüro Stärke und signalisierte Repressionsbereitschaft. Kaum vier Monate später, am 18. Oktober 1989, wurde der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker vom SED-Politbüro abgesetzt, und am 7. November trat dann sogar die gesamte DDR-Regierung zurück. Der Grenzöffnung in Ungarn folgten Ausreisen über die Prager und Warschauer Botschaften der BRD. Die 2 Der Verwendung des Begriffs Kommunismus ist in diesem Zusammenhang keine inhaltliche Bedeutung beizumessen. Seine Nutzung rechtfertigt sich allein durch Konvention. In der Literatur werden die osteuropäischen Systeme vor ihrem Umbruch vorwiegend mit dem Begriff Kommunismus beschrieben (vgl. exemplarisch v. Beyme 1995: 26; Elster / Offe / Preuss 1998). Diesem Trend wird hier - mit der Intention, eine einheitliche und unmißverständliche Terminologie beizubehalten - gefolgt. Dies geschieht auch auf die Gefahr hin, daß fälschlich angenommen werden kann, hinter der Begriffswahl verberge sich der Versuch, auf zynische Art und Weise die Ideen Marx‘ und Engels‘ als von der Geschichte widerlegt zu disqualifizieren. 3 Die Breshnew-Doktrin steht für den sowjetischen Hegemonialanspruch in Osteuropa, der sich insbesondere mit der Rechtfertigung des Einmarsches der Truppen des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei im August 1968 verfestigte. Die Rechtfertigung bezog sich auf die Prinzipien der „gegenseitigen brüderlichen Hilfe“ und des „proletarisch-sozialistischen Internationalismus“. Aus ihnen wurde zum „Schutz der sozialistischen Errungenschaften“ das Recht und die Pflicht zur Intervention abgeleitet (Meissner 1969). Einleitung 4 DDR-Führung ließ die Flüchtlinge in Zügen durch das DDR-Gebiet ausreisen. Die Bevölkerung reagierte nicht etwa – wie die Führung wohl hoffte – mit Protesten gegen die Flüchtlinge, sondern verstärkte ihre gegen die DDR-Führung gerichteten Demonstrationen in Leipzig, Dresden und Berlin. Am 9. November 1989 fiel dann die Mauer, nachdem die DDR die sofortige und unverzügliche Reisefreiheit verkündete. Im September des folgenden Jahres unterzeichneten die beiden deutschen Außenminister und die Außenminister der vier Siegermächte den „Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland“ und schufen so die völkerrechtlichen Voraussetzungen für die Wiedervereinigung Deutschlands. Am 3. Oktober 1990 kam es zum Beitritt der DDR zur BRD. 1989 begann auch in der Tschechoslowakei ein friedlicher Umbruch („velvet revolution“4). Am 29. November wurde im Abgeordnetenhaus die Beendigung der dominanten Rolle der kommunistischen Partei beschlossen, im Dezember dann wurde Vaclav Havel zum Präsidenten der CSFR gewählt. 1990 folgten die ersten demokratischen Parlamentswahlen. Die Verhandlungen um die Machtverteilung in der Föderation kumulierten in der Auflösung der CSFR in zwei unabhängige Staaten - Tschechien und Slowakei - am 25. November 1992. In Ungarn und Bulgarien kam es 1990 zu den ersten freien Wahlen. Ebenso in Rumänien, wo in einem blutigen Aufstand 1989 die letzte Bastion des Stalinismus in Osteuropa fiel. Der Diktator Ceauçescu und seine Frau wurden nach dem Urteil eines Militärtribunals exekutiert. Kurz darauf wurden von einer Interimsregierung Dekrete erlassen, die die Führungsrolle der kommunistischen Partei abschafften und Parlaments- und Präsidentenwahl einleiteten. Nicht nur die föderale Tschechoslowakei, sondern auch der Staatenverbund Jugoslawien und die in der Sowjetunion zusammengefaßten 15 Republiken fielen auseinander. Im Dezember 1991 erkannte Deutschland in einem Alleingang die Unabhängigkeit Kroatiens an. Im Januar 1992 folgte dann die Anerkennung Kroatiens und Sloweniens durch die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedsstaaten. Die Auflösung der Sowjetunion - wie sie von Stalin erschaffen wurde - kündigte sich mit den Unabhängigkeitsbestrebungen der drei baltischen Staaten an5. Estland erklärte bereits 1988 Estnisch zur offiziellen Staatssprache, und 1989 wurde Lettisch in Lettland zur Staatssprache. Weitere Schritte zur Eigenständigkeit folgten 1989 unter anderem mit der Souveränitätserklärung in Lettland und Litauen. Und im November 1990 erklärten dann die Führer der drei baltischen Staaten in einem gemeinsamen Beschluß, daß sie den neuen Unionsvertrag nicht unterschreiben würden. Gorbatschow stemmte sich gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen, konnte sie nach dem mißlungenen Putschversuch am 19. August 1991 aber nicht mehr aufhalten. Die drei baltischen Staaten wurden 4 Vgl. zur „sanften Revolution“ Baláz (1996). Vgl. für die Entwicklung in Lettland Plakans (1997), für die Entwicklung in Litauen Krickus (1997) und für die Entwicklungen in Estland Raun (1997). 5 Einleitung 5 aus der Union entlassen, und ihre Unabhängigkeit wurde anerkannt. 1991 erklärten auch die zentralasiatischen Republiken (Usbekistan, Kirkisien, Turkmenistan, Tadschikistan, Kasachstan), die Republiken Transkaukasiens (Armenien, Aserbeidschan, Georgien) und die westlichen Republiken (Ukraine, Weißrußland, Moldowa) ihre Unabhängigkeit. Allein Rußland verzichtete auf die Unabhängigkeitserklärung. Gorbatschow versuchte, die Republiken in einer Union Souveräner Staaten (USS) zusammenzuhalten. Das Projekt scheiterte, als bei einer Volksbefragung in der Ukraine mit deutlicher Mehrheit gegen die Union votiert wurde. Die Präsidenten Rußlands, der Ukraine und der Parlamentspräsident Weißrußlands vereinbarten daraufhin die Bildung einer Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS). Mit dem Anschluß der zentralasiatischen und transkaukasischen Republiken (allerdings ohne Georgien) bildete dieser Verbund, der weder Staatsgebilde ist noch Bürger mit einer gemeinsamen Staatsangehörigkeit umfaßt, das Ende der Sowjetunion. Der russische Präsident Jelzin verkündet am 25. Dezember 1991, daß die Sowjetunion aufgehört habe zu existieren. Die Umbrüche der politischen Landschaft bildeten aber nur einen Ausschnitt - sozusagen die „Highlights“, mit denen sich der Gegenstand in Erinnerung rufen läßt - eines über die Grenzen des Politischen hinausgreifenden Prozesses. Parallel zu den politischen und territorialen Änderungen erfolgten gravierende ökonomische und kulturelle Änderungen. Die planwirtschaftliche Organisation, in der die Politik die Kontrolle über wirtschaftliche Abläufe beanspruchte, sowie ihre schattenwirtschaftlichen Randerscheinungen sollten in eine Marktwirtschaft, in der ein effektiveres Wirtschaftssystem gesehen wurde, überführt werden. Auch wenn Länder wie Ungarn und Polen bereits vor dem Umbruch marktwirtschaftliche Elemente eingeführt hatten, so waren dies doch nur erste, vergleichsweise kleine Schritte eines fundamentalen Umbaus. Das Projekt der Einführung einer Marktwirtschaft, bei der das wirtschaftliche Management durch die Regierung zurückgeschraubt werden sollte, staatliches Eigentum privatisiert werden sollte, Preise nicht mehr staatlich reguliert, sondern über Geld- und Marktmechanismen gesteuert werden sollten und privates Unternehmertum ermöglicht sowie gefördert werden sollte, erforderte umfassende institutionelle Änderungen. Selbst elementare Voraussetzungen für Privatisierung und die Integration der nationalen Märkte in den internationalen Handel wie die Sicherung individueller Rechte, mit denen Vertragssicherheit und Privateigentum garantiert werden, gab es nicht und mußten von Grund auf neu aufgebaut werden6. Die politischen und ökonomischen Neustrukturierungen mußten auf das kulturelle Selbstverständnis der Bürger rückwirken. Die kollektiven Werte und individuellen Kompetenzen, die sich unter den kommunistischen Regimen herausgebildet hatten, 6 Für einen Überblick über die ökonomischen „Tasks of the Transition“ vgl. Clague (1992: 5f). Einleitung 6 wurden obsolet. Neue Identifikationsmöglichkeiten, Selbstdefinitionen und Solidaritätsformen wurden gesucht. Der institutionelle Umbau erforderte für den Erfolg seiner angestrebten Ziele - Marktwirtschaft und Demokratie - eine adäquate Kultur ökonomischer und politischer Einstellungen und Aktivitäten. Leistungsorientierung und Unternehmergeist mit Risikobereitschaft für den Aufbau einer funktionierenden Marktwirtschaft mußten sich entwickeln und die Etablierung einer funktionierenden Demokratie war auf den Ausbau bürgerlicher Werte und zivilgesellschaftlicher Aktivitäten angewiesen. Vielfach wies die Entwicklung aber in eine ganz andere Richtung: Zuvor unterdrückte religiöse oder nationalistisch-ethnische Identifikationsmuster bildeten für viele Bürgerinnen und Bürger einen willkommenen Ersatz für die ideologischen Identifikationsmuster, die mit dem Zusammenbruch wegfielen. Die Sozialwissenschaften hatten zu diesem Zeitpunkt nicht mit einem derartig raschen Zusammenbruch gerechnet und waren deshalb von der Plötzlichkeit der Ereignisse überrascht. Was sich ex post als Stagnation erwies, wurde ex ante gerne als Stabilität interpretiert (v. Beyme 1994: 16f). Dementsprechend unvorbereitet traf auch das Ausmaß der gesellschaftlichen Änderungen die Sozialwissenschaften. Der Soziologie, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft fehlten bewährte, praxisorientierte Strategiekonzepte für ein derartiges Großprojekt der gesellschaftlichen Neustrukturierung. Trotzdem mußte schnell gehandelt werden, weil Entscheidungen bereits Prozesse anstießen, deren Wirkungen sich nicht wieder rückgängig machen ließen. Für Ökonomen und Ökonominnen war es nun wichtig, die angemessene Geschwindigkeit für die Überführung der Planwirtschaft in privatwirtschaftliche Geldwirtschaft und für die Integration der Transformationsökonomien in die Weltwirtschaft abzuwägen (vgl. Harberger 1992; Fischer 1992; Riese 1995). Allerdings mangelte es an Erfahrung mit Wirtschaften in Transformationsprozessen. Weil Reformanstrengungen stets mit Unsicherheiten konfrontiert sind, waren radikale Änderungen riskant. Es gab keine sicheren Erkenntnisse bezüglich eines erfolgversprechenden Weges zur Marktwirtschaft, nicht zuletzt weil die heterogenen Konditionen der staatlichen Unternehmen und der gesellschaftlichen Kontexte berücksichtigt werden mußten. Die post-kommunistischen Staaten unterschieden sich untereinander z.T. gravierend in ihrem ökonomischen Erbe aus der kommunistischen Zeit und somit auch in ihren ökonomischen Voraussetzungen. Außerdem mußten hohe soziale Kosten bei erfolgloser Umsetzung der Transformationsstrategien befürchtet werden. Bei Unwirtschaftlichkeit drohten Firmenschließungen, und von den Privatisierungen waren Preissteigerungen bei den Konsumgütern zu erwarten. Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler sowie Soziologinnen und Soziologen waren von den Ereignissen in doppelter Hinsicht gefordert. Erstens mußte das theoretische Defizit, das durch den Mangel zielgenauer Prognosen über die Entwicklung Einleitung 7 der kommunistischen Staaten offensichtlich wurde, im Nachhinein mit schlüssigen Erklärungen ausgeglichen werden. Bekannte Ansätze, die den verschiedenen etablierten theoretischen Paradigmen folgen, aber auch neue Modelle, wurden ins Feld geführt, um die Ursachen und Dynamiken des Zusammenbruchs des Kommunismus in Osteuropa aufzuarbeiten. Die zweite Herausforderung bestand - und besteht auch noch eine Dekade nach dem Zusammenbruch - darin, den Prozeß der Konsolidierung der neuen Ordnung wissenschaftlich zu begleiten. Nicht nur die Pfade zu einer effektiven Marktwirtschaft, sondern auch die zu einer stabilen Demokratie sind beschwerlich und kompliziert. Es gibt Hindernisse wie die genannten sozialen Kosten, die die Akzeptanz demokratischer Institutionen senken. Auf Abwege kann die Entwicklung geraten, wenn der Umbau politischer Institutionen von machtstrategischem Opportunismus korrumpiert wird. Und Abgründe tun sich auf, wo Unabhängigkeitsbestrebungen oder politisches Kalkül religiöse, nationalistisch motivierte oder ethnische Konflikte bzw. Kriege provozieren. Hier sind die Sozialwissenschaften gefordert, Risiken aufzudecken und auf Chancen für eine wünschenswerte, zur erfolgreichen Konsolidierung führende Entwicklung hinzuweisen. Die theoretischen Herausforderungen, die aus der Transformation Osteuropas folgen, fordern nicht nur die unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen, sie erweisen sich auch als ein Erprobungsfeld für sozialwissenschaftliche Ansätze konkurrierender Paradigmen. Rückblickend stehen die Ansätze in einem Wettbewerb um die angemessene Erklärung des Zusammenbruchs. Mit Blick auf die zu erwartende Entwicklung untersteht die Transformationsforschung einerseits einem Paradigmentest, weil der Versuch einer umfassenden Gesellschaftsreform mit dem Unmöglichkeitstheorem holistischer Politik konkurriert (vgl. Wiesenthal 1999). Andererseits muß sie sich bewähren, indem sie relevante Kriterien identifiziert, anhand derer sich die Möglichkeiten für eine erfolgreiche Konsolidierung einschätzen lassen. Im Wettbewerb der Paradigmen liegt eine Chance für die sozialwissenschaftliche Theoriebildung, die mit der vorliegenden Arbeit aufgegriffen wird; im kritischen Vergleich der verschiedenen Ansätze sollen die Stärken und Schwächen bzw. Leistungen und Grenzen konkurrierender, aber auch sich öffnender, integrierender Konzepte aufgedeckt werden. Die verschiedenen theoretischen Ansätze der Transformationsforschung konkurrieren bereits bei der Begriffswahl und mit der durch sie nahegelegten globalen Definition der Prozesse in Osteuropa. Die verschiedensten Begriffe wurden zur Etikettierung der Umbrüche gewählt: Systemwechsel, Systemwandel, Revolution, Regimewandel, Modernisierung, Transition und Transformation werden quasi synonym gebraucht. Bestimmte als entscheidend erachtete Charakteristiken der Entwicklung sowie Eigenheiten, aber Einleitung 8 auch Unterschiede zu anderen Entwicklungen werden mit der Begriffswahl hervorgehoben7. Auch in dieser Arbeit wird mit der Verwendung des Transformationsbegriffs eine spezifische Perspektive auf die Prozesse in Osteuropa präjudiziert, und das, obwohl er eine weitgehend neutrale, für unterschiedlichste Perspektiven offene und allgemeine Kennzeichnung des gesamten Phänomens leisten soll. Mit Transformation soll im folgenden ein Prozeß benannt werden, der von einem bestimmten strukturellen Zustand ausgeht und zu einem neuen strukturellen Zustand führt. Dieser Umbildungs- oder Austauschprozeß kann alle gesellschaftlichen Teilsysteme betreffen. Daher lassen sich die politische, die ökonomische, die kulturelle und die soziale Transformation voneinander unterscheiden. Die Veränderung sozialer Strukturen wird in den Sozialwissenschaften, insbesondere in der Soziologie, gemeinhin als sozialer Wandel beschrieben. Insofern stellt sich die Frage, welche Merkmale die Prozesse eines sozialen Wandels wie in Osteuropa derartig hervorheben, daß sie einen eigenen Begriff verdienen. Das distinktive Merkmal ist die Radikalität des Wandels. Die Transformationen in Osteuropa waren nicht etwa durch einen vorsichtigen, adaptiven Wandel der Strukturen an eine veränderte Umwelt gekennzeichnet. Dann hätte nämlich ein neues Gleichgewicht innerhalb der alten Ordnung die Stabilität des Systems gesichert. Die Änderungen in Osteuropa sind vielmehr dadurch gekennzeichnet, daß alte Strukturen aufgelöst wurden und daß versucht wird, neue Strukturen - eine neue Ordnung - zu etablieren. Die Systeme vollzogen und vollziehen noch einen Identitätswandel. Ein solcher Identitätswandel fällt auch unter das Konzept des sozialen Wandels. Sozialer Wandel umfaßt gleichermaßen den Wandel innerhalb eines Systems und den Wandel des Systems (vgl. Parsons 1951: 480f; Zapf 1969). Die Forschung zum sozialen Wandel allerdings bezieht sich vorrangig auf den erstgenannten Prozeß. Dagegen soll mit dem Transformationsbegriff hervorgehoben werden, daß - anders als beispielsweise bei einer gradualistischen Rationalisierung - ein Prozeß grundlegender Änderungen der Systemidentität in einem hochdynamischen Tempo den Anwendungsbezug der Untersuchung bildet. Der Transformationsbegriff bezeichnet aber nicht etwa nur einen, in der bisherigen Forschung vielleicht zu kurz gekommenen, Teilbereich des sozialen Wandels. Er ist auch offen für die Untersuchung der Prozesse, die zwischen dem alten und neuen strukturellen Zustand stattfinden. Die Transformationsforschung thematisiert nicht nur Ursachen und Richtung der Änderungsprozesse und bleibt daher auch nicht wie die Forschung zum sozialen Wandel primär makrosoziologisch (vgl. Zapf 1969: 18). Weil in der Transformationsforschung die Art und Weise des Umbildungs- oder Austauschprozesses nicht festgelegt ist, sondern offen, interessiert sie sich auch für die Verlaufsformen 7 Besonders deutlich wird diese Intention bei der Verwendung des Begriffs „Revolution“. Mit dieser Charakterisierung des Umbruchs wird versucht, dem öffentlichen Protest eine zentrale Bedeutung für den Zusammenbruch zuzuweisen (vgl. Opp 1994; Goldstone 1994). Einleitung 9 und Sequenzen der Änderungsprozesse. Damit schließt Transformationsforschung neben den Makroprozessen auch Mesoprozesse wie den Institutionenumbau und Mikroprozesse wie das Aushandeln neuer institutioneller Arrangements ein. Politische, ökonomische und kulturelle Änderungen, die in der Geschichte westlicher Demokratien nacheinander verliefen und oftmals in einem Verhältnis von Bedingung bzw. Voraussetzung und logischer Konsequenz zueinander standen, vollzogen sich in Osteuropa gleichzeitig. Zur Kennzeichnung dieses Ausmaßes der Änderungsprozesse in Osteuropa wird in der aktuellen Transformationsforschung häufig der Begriff des Systemwechsels gewählt (vgl. Merkel 1994; Rüland 1994; Welzel 1994). Systemwechsel steht für eine alle Teilbereichstransformationen umfassende Charakterisierung der osteuropäischen gesellschaftlichen Änderungen. Die vorliegende Arbeit schließt sich dieser Terminologie nicht an, weil durch die Begriffswahl nicht vorgegeben werden soll, wie das Ausmaß der Transformation Osteuropas relativ zu anderen Transformationen - bspw. Südeuropas oder Lateinamerikas - eingeschätzt wird. Hier gibt es durchaus unterschiedliche Einschätzungen8. Die Frage, inwiefern Gleichzeitigkeiten herausragende Merkmale der osteuropäischen Transformation bildeten und in ihnen ein bisher unbekanntes Dilemma begründet liegt, das den erfolgreichen Übergang zur Marktwirtschaft und Demokratisierung erschwert oder sogar verhindern kann, ist bis heute unbeantwortet. Dieser Umstand wird mit der Verwendung des Systemwechselbegriffes verdrängt. Dem Transformationsbegriff wird in der vorliegenden Arbeit mit dem Bemühen um Neutralität gefolgt. Mit ihm soll die Festlegung auf ein analytisches Primat vermieden werden. Zugleich soll einer Bewertung der osteuropäischen Transformation im Vergleich zu anderen Transformationen vorgebeugt werden, um für Akzente und Schwerpunkte, die in Analysen der osteuropäischen Transformation gesetzt werden, offen zu bleiben. Dennoch ist der Transformationbegriff nicht vollständig neutral9. Mit seiner Verwendung wird die Radikalität, d.h. die Intensität und die hohe Dynamik, der Umbrüche hervorgehoben. Dieser evaluative bias rechtfertigt sich nicht nur durch die all8 Przeworski weist die Einschätzung zurück, daß die Transformationen in Osteuropa und insbesondere der Konsolidierungsprozeß mit umfassenderen Schwierigkeiten konfrontiert ist als die vorausgegangenen Transformationen Südeuropas und Lateinamerikas: „A glance at the macroeconomic indicators at the time of democratic transition suffices us to conclude that Latin American countries did not enjoy an easier situation than Eastern European countries.“ (1991: 139). Darüber hinaus finden sich bereits bei O’Donnell (1986) vielfach Anmerkungen über die Schwierigkeiten einer kulturellen Anpassung an das neue Regime und über ökonomische Herausforderungen, die mit der Demokratisierung in Südeuropa und Lateinamerika einhergingen. Sie erinnern stark an die „Gleichzeitigkeiten“, die als die Besonderheiten der osteuropäischen Transformation identifiziert werden. 9 Anders argumentiert hier Sandschneider (1994: 23): Für ihn ist der Bergriff „Transformation“ neutral, weil er inhaltlich und ideologisch unbelastet ist. Sandschneider unterstellt, daß der Begriff „Transformation“ auf eine intentionale Änderung des Systems verweise, im Gegensatz zu „sozialem Wandel“, der evolutionäre Prozesse beschreibe. Genau von dieser Verwendung des Transformationsbegriffes soll hier aber Abstand genommen werden, weil sie in bezug auf das angemessene theoretische Paradigma bereits eine Vorentscheidung zugunsten mikro- und vielleicht noch mesotheoretischer Ansätze trifft. Einleitung 10 gemeine Überraschung über den Zusammenbruch, sondern auch durch eine gewisse Intersubjektivität, die durch die ausnahmslos übereinstimmenden Einschätzungen in der etablierten Transformationsforschung zum Ausdruck kommt. Neutral ist der Begriff in dieser Arbeit auch deshalb nicht, weil er in einer Weise eingeführt wird, die vorgibt, daß es einer integrativen Perspektive bedarf, die sowohl Makro- als auch Meso- und Mikroprozesse berücksichtigt, um die Entwicklungen in Osteuropa theoretisch aufzuarbeiten. In diesem methodischen bias des Transformationsbegriffes spiegelt sich das Projekt der vorliegenden Arbeit wider. Ob die Prämisse einer integrativen Perspektive gerechtfertigt ist, muß anhand der Argumente und Ergebnisse dieser und vergleichbarer Arbeiten erst noch entschieden werden. Die Fragestellung in dieser Arbeit betrifft also die Methode10, mit der sich die sozialwissenschaftliche Forschung komplexen sozialen Phänomenen nähern kann. These der Untersuchung ist, daß nur eine integrative Methode, die unterschiedliche analytische Ansatzhöhen zusammenführt, theoretische Herausforderungen, wie sie sich aus komplexen sozialen Phänomenen bzw. Prozessen ergeben, annehmen und bewältigen kann. Die Erklärung und eine entwicklungsbegleitende Forschung werden erst möglich, wenn Prozesse wie die Transformation Osteuropas sowohl auf der Makro- als auch auf der Meso- und Mikroebene, also mit einem Mehrebenenansatz, reflektiert11 werden. In der Transformationsforschung gibt es bereits Untersuchungen, die mit einer Mehrebenenanalyse arbeiten. Merkel hat eine solche Methode entwickelt (vgl. 1995). Mit einer analytischen Trennung von „Problem-Triaden“ der Transformationstheorie kann er einerseits den Untersuchungsgegenstand eingrenzen, so daß sich Problembereiche trotz vielfältiger Wechselwirkungen untersuchen lassen, und andererseits kann er zeigen, daß die Variablen verschiedener analytischer Ebenen miteinander verwoben sind12. Dieser Methode wird in der in der vorliegenden Arbeit nicht gefolgt, weil sie einen anderen Schwerpunkt setzt. Es geht nicht darum, den Untersuchungsgegenstand anhand zusätzlicher analytischer Kategorien auf eine übersichtliche Größe zu reduzieren, um dann Variablen auf den verschiedenen sozialen Ebenen und ihre Wechselwirkungen zu identifizieren. Vielmehr sollen Vorzüge und Bausteine eines Mehrebenenmodells aufgezeigt werden, in dem nicht nur Variablen der unterschiedlichen Ebenen zusammengeführt werden, sondern für die Prozesse auf der jeweiligen Ebene auch die analytische 10 Mit Methode ist hier die analytische Ansatzhöhe gemeint. Damit einher geht oftmals auch die Präferenz für entweder eine deduktiv-nomologische oder eine induktiv-generalisierende Forschungslogik. 11 Zur Reflexion als Funktion bzw. Aufgabe von Theorie vgl. Willke (1995: 133). 12 Merkel trennt in die „systemspezifische Triade“. Hier wird in soziale, ökonomische und politische Transformationsprozesse differenziert. In eine „phasenspezifische Triade“, die nach Zeitabschnitten – Ende des alten Systems, Demokratisierung und Konsolidierung – differenziert. Und in eine „ebenenspezifische Triade“, mit der die Transformation nach ihren Prozessen auf der Makro-, Meso- und Mikroebene zerlegt werden kann. Auf diese Weise kann Merkel die Interdependenzen und Wechselwirkungen innerhalb der einzelnen Triaden untersuchen (vgl. 1995: 32). Einleitung 11 Perspektive, ihre Logik und ihre Mechanismen genutzt werden. Die vorliegenden Arbeit versucht zu zeigen, wie systemische Prozesse, Struktur- bzw. Differenzierungsprozesse, Institutionalisierungs- und Entinstitutionalisierungsprozesse, Interaktionen und Akteurshandeln miteinander verbunden sind. Theorien können allerdings nicht einfach willkürlich miteinander kombiniert werden. Bei der parallelen Nutzung unterschiedlicher Prämissen dürfen keine Widersprüche auftreten. An die These der Angemessenheit einer integrativen Methode für die Untersuchung komplexer Phänomene schließt deshalb die Frage an, auf welche Weise verschiedene Forschungsansätze miteinander verbunden werden können und was daraus für den theoretischen Status der Modelle folgt. Der Entwurf einer Mehrebenenanalyse muß also: a) Kriterien für das Primat einer bestimmten analytischen Perspektive bei der Untersuchung eines Teilausschnitts des Phänomens angeben, b) Schnittstellen aufzeigen, an denen sich die Ebenen aneinanderfügen lassen, und c) klären, welche Einschränkung aus der Kombination unterschiedlicher theoretischer Paradigmen bezüglich der Aussagekraft folgt. Nur so läßt sich zeigen, wie die Theorien ineinandergreifen können, ohne dabei in Widerspruch zu ihren eigenen Prämissen zu geraten, und warum es sinnvoll sein kann, von deterministischen und prognosefähigen Modellen zugunsten einer realitätsnäheren Modellierung Abstand zu nehmen13. Um zu zeigen, wie die Variablen unterschiedlicher Analyseebenen ineinandergreifen und sich darüber hinaus auch die Logiken der entsprechenden Perspektiven ergänzen, wird folgendes Vorgehen gewählt: Eine Auswahl von Beiträgen, die die Transformationen Osteuropas aus verschiedenen analytischen Perspektiven untersucht, wird vorgestellt. Die Ergebnisse der Beiträge werden dabei mit der Zielsetzung aufgearbeitet zu verdeutlichen, für welche Bereiche sich bestimmte analytische Ansatzhöhen bewähren, wo die jeweiligen Grenzen einer Makro-, Meso- und Mikroanalyse liegen und an welchen Stellen die analytischen Ebenen zusammengefügt werden können. Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Themen der Transformationsforschung, wie sie vor 1989 betrieben wurde (Teil I). Es wird gezeigt, warum die vorhandenen Transformationstheorien eine Erklärung oder sogar Vorhersage der Transformation Osteuropas nicht leisten konnten bzw. auf einen solchen Anspruch erst gar nicht angelegt waren, und wodurch sich die Fragestellung der aktuellen Transformationsforschung von den Themen früherer Untersuchungen abhebt. Den Kern der Arbeit bilden die Teile zum Zusammenbruch der alten Ordnung (Teil II) und zur Konsolidierung der neuen politischen Ordnung (Teil III). In ihnen werden die zwei großen Fragestellungen der Transformationsforschung nach 1989 aufgearbeitet14. 13 Zum Verhältnis von der Prognosequalität theoretischer Modelle und der Wiedergabe von Realität durch theoretische Modelle vgl. v. Beyme (1995: 11). 14 Diese Gliederung macht nicht nur Sinn, weil sie den Themen der Transformationsforschung folgt. Eine ähnliche analytische Trennung des Untersuchungsgegenstands Transformation schlagen auch Kopecky Einleitung 12 Die erste Fragestellung entsprang der Überraschung über die Entwicklung der osteuropäischen Systeme „now, out of never“ (Kuran 1989; 1995). Als Reaktion auf die Geschehnisse bildete die Frage nach den Ursachen des Zusammenbruchs der kommunistischen Systeme das erste große Thema der Transformationsforschung. In Teil II werden Beiträge zusammengetragen, die den analytischen Blick zurück auf diese einleitende Phase der Transformation werfen. Die Beiträge werden entsprechend der analytischen Ansatzhöhe ihrer Modelle und Erklärungen den makrotheoretischen, den mesotheoretischen oder den mikrotheoretischen Ansätzen zugeordnet. Von einer systemspezifischen Unterteilung, die Prozesse in den gesellschaftlichen Teilsystemen getrennt betrachtet, wird abgesehen, weil gerade in den Wechselwirkungen über die Teilbereiche hinweg ein Schlüssel für das Verständnis des Zusammenbruchs liegt. Dafür unterliegt dem Vergleich der verschiedenen Erklärungsmodelle eine andere Unterteilung. Sie erfolgt entlang der Dynamik des Transformationsprozesses bzw. des Zusammenbruchs. Mit dieser Kategorie wird für die Mehrebenenanalyse eine neue Dimension gewonnen. Anhand der Dynamik lassen sich nämlich nicht nur Phasen bzw. Abschnitte analytisch trennen. Sie bildet ein Kriterium, mit dem - anders als in einem statischen Mehrebenenmodell - Abschnitte der Transformation angegeben werden können, für die sich eine bestimmte analytische Perspektive bewährt. Anhand dieser Zuordnung wird dann auch deutlich, wo die Schnittstellen liegen, an denen die analytischen Perspektiven ineinandergreifen können, d.h. wo sich Integrationsmöglichkeiten für unterschiedliche theoretische Ansätze auftun. Modelle zusammenzuführen, die verschiedenen Prämissen folgen, ist nicht selbstverständlich und steht oftmals gegen die Intention der Autoren. Zum Teil sind die Analysen mit einem exklusiven Erklärungsanspruch verfaßt worden. In diesen Fällen soll gezeigt werden, daß der Erklärungsbereich dennoch eingeschränkt ist, so daß für die umfassendere Fragestellung, um die es hier geht, zusätzliche Erklärungsbausteine hinzugefügt werden müssen. Die Modelle müssen sich für Erklärungsmodelle anderer analytischer Ansatzhöhen öffnen und damit andere Prämissen zulassen, um ad hoc Erklärungen und Widersprüche zu vermeiden. Teil II schließt mit einem Kapitel ab, in dem ein Modellentwurf für die Verhandlungen an den Runden Tischen vorgestellt wird. Sie bildeten in fünf osteuropäischen Staaten den Übergang von der Phase des Zusammenbruchs der alten Ordnung zu der Phase des Entstehen einer neuen Ordnung. Runde Tische hatten in Ungarn, der DDR, in Polen, in der Tschechoslowakei und in Bulgarien eine zentrale Bedeutung bei der Ablösung der alten Regime und z.T. auch bei der Formulierung der institutionellen Grundlagen für die und Mudde (2000) vor. Sie unterscheiden zwischen einer „...transition from a communist regime [...] to a democracy and the subsequent transition from an initial democratic arrangement towards a truely consolidated democracy.“ (Kopecky / Mudde 2000: 521). In dieser Gliederung sehen sie einen wichtigen Schritt zum Verständnis der unterschiedlichen Entwicklungen in den ostmitteleuropäischen Staaten einerseits und den post-sowjetischen bzw. post-jugoslawischen Staaten andererseits: Sie befinden sich in unterschiedlichen Transitionsphasen. Einleitung 13 neuen demokratischen Regime. Trotz dieser Schlüsselstellung im Transformationsverlauf sind die Verhandlungsprozesse theoretisch kaum aufgearbeitet. Mit dem Modellentwurf wird versucht, zum Verständnis der Prozesse beizutragen und die Rolle der Runden Tische bei den Transformationen Osteuropas aufzudecken. Die zweite Fragestellung, auf die sich die Forschung zur Transformation Osteuropas konzentrierte, ist die nach den Bedingungen und Chancen bzw. Risiken einer erfolgreichen Etablierung von Demokratie und Marktwirtschaft. Teil III befaßt sich dementsprechend mit der Konsolidierung der neuen Systeme. Dabei erfolgt aus pragmatischen Gründen eine Einschränkung auf die Konsolidierung des politischen Teilsystems. Eine weiterreichende Untersuchung, die außerdem die Bedingungen und Prozesse einer Konsolidierung in den Bereichen Kultur und Wirtschaft umfaßt, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daß aber das politische Teilsystem und nicht etwa das ökonomische oder kulturelle gewählt wurde, hat auch einen inhaltlichen Grund. Die Grundlagen für die ökonomische und kulturelle Konsolidierung werden im Rahmen des Umbaus der politischen Institutionen gelegt15. Das macht die Prozesse in den anderen Teilbereichen zwar nicht weniger interessant oder minder relevant. Dem politischen Umbau kommt aber eine vorrangige Bedeutung zu, der bei der Eingrenzung des Themas hier Rechnung getragen wird. Die komplexe Fragestellung nach der politischen Konsolidierung läßt sich ebenso wie die Frage nach dem Zusammenbruch präzisieren, wenn der Prozeß entsprechend seiner Dynamik in Abschnitte gliedert wird. Am Beispiel der politischen Konsolidierung wird mit einer Auswahl zentraler Themen gezeigt, daß für den Versuch, Aussagen über eine zukünftige Entwicklung – Konsolidierungschancen und -risiken der jungen Demokratien - zu wagen, die Trennung in Erbe, Umbau und Stabilisierung fruchtbar ist. Die Frage nach der Konsolidierung verweist auf einen Prozeß, dessen Ergebnisse in einem dynamischen Zusammenwirken 1. von Variablen, die sich aus der Hinterlassenschaft der kommunistischen Systeme ergeben, 2. von Variablen, die sich im Umbauprozeß herausgebildet haben und 3. von Variablen, die bestimmen, ob das aktuelle Handeln der Akteure und die aktuellen Institutioneneigenschaften zur Stabilisierung beitragen, festgelegt werden16. 15 Damit soll nicht behauptet werden, daß Politik die hierarchische Spitze der Gesellschaft oder ihr Steuerungszentrum im Sinne der „alteuropäischen“ Vorstellung des Primats der Politik bildet. Es wird lediglich von der „...Möglichkeit einer absichtsvollen und im Sinne der eigenen Ziele erfolgreichen Intervention [...] der Politik in die Strukturen und Prozesse der Wirtschaft und anderer Funktionssysteme...“ (Scharpf 1989:18) also einer Steuerungschance ausgegangen. Mit der Frage nach den Bedingungen der Etablierung neuer demokratischer Institutionen werden die Umsetzungsschwierigkeiten politischer Zielvorstellungen gerade zum Untersuchungsgegenstand der Konsolidierungsforschung. 16 Merkels Mehrebenenmodell hingegen suggeriert eine statische Betrachtungsweise, weil es unberücksichtigt läßt, daß bestimmte Abschnitte der Konsolidierung durch eine hervorgehobene Bedeutung von Variablen auf einer oder zwei analytischen Ebenen gekennzeichnet sind (vgl. 1995). Einleitung 14 Ganz anders als die Beiträge zum Zusammenbruch haben die meisten Beiträge zur politischen Konsolidierung einen klar reduzierten Erklärungsanspruch. Sie beschränken ihren Untersuchungsgegenstand auf einen kleinen, eng umgrenzten Ausschnitt. Der Hauptteil der Beiträge befaßt sich entweder mit der Bedeutung einzelner institutioneller Arrangements wie der Verfassung, des Regierungs- und Wahlsystemssystems oder der Parteien bzw. des Parteiensystems für die Konsolidierung, oder er untersucht die Auswirkungen von Wechselwirkungen innerhalb des Institutionenmix‘ bzw. von politischen Institutionen mit Variablen aus anderen gesellschaftlichen Teilbereichen. Auch diese Beiträge lassen sich wie die Analysen zum Zusammenbruch zu einem vollständigeren Bild der politischen Konsolidierung zusammenfügen. In diesem Bild werden nicht nur Kriterien einer Konsolidierung benannt. Es gilt auch, die Bedingungen für die Erfüllung solcher Kriterien auf den unterschiedlichen analytischen Ebenen und in den zeitlichen Abschnitten zu nennen sowie die Bedeutung einzelner Variablen zu klären. Erst mit diesen Bausteinen kann die Konsolidierungsforschung aus dem laufenden Prozeß der Konsolidierung heraus einen Blick auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung wagen. Die Themen und Problembereiche der Konsolidierung der neuen politischen Ordnung werden den drei Phasen der Konsolidierung zugeordnet: Aus dem Erbe der kommunistischen Regime ergeben sich Aufgabenstellungen, aber auch erste Bedingungen für den Umbau. Bei dem Umbau der Institutionen werden in meist komplizierten Verhandlungsprozessen und aufeinanderfolgenden Entscheidungsschritten die Grundlagen für eine demokratische Ordnung gelegt. In der Phase der Stabilisierung entscheiden dann bestimmte Institutionenmerkmale einerseits und die Handlungen der Akteure andererseits über die Chancen und Risiken einer Überführung der neuen Institutionen in stabile demokratische Strukturen. Über die Phasen der Konsolidierung hinweg, aber auch innerhalb der Phasen, greifen die analytischen Ebenen ineinander. Es sind nicht ausschließlich entweder Makro- oder Meso- oder Mikroprozesse, die die Stabilisierungschancen bestimmen. Vielmehr läßt sich zeigen, daß ein Ensemble von Kriterien auf allen drei Ebenen in einer der Dynamik des Konsolidierungsprozesses folgenden Abfolge über die Aussichten für die Entwicklung der jungen Demokratie entscheiden. Im abschließenden Kapitel von Teil III wird auf Wechselwirkungen eingegangen, die sich daraus ergeben, daß die politische Konsolidierung im Spannungsfeld wirtschaftlicher und kultureller Entwicklungen liegt. Bei den Transformationen Osteuropas findet die politische Entwicklung im Kontext eines weitreichenden Umbaus im Bereich der Wirtschaft und tiefgreifender Änderungen des kulturellen Selbstverständnisses sowie der kulturellen Identität der Bevölkerung und der Eliten statt. Unmittelbar im Anschluß an den Zusammenbruch wurde in diesen Gleichzeitigkeiten ein bedrohliches Hindernis für die politische Konsolidierung und die Etablierung einer funktionierenden Marktwirtschaft gesehen (vgl. Offe 1994; Elster 1990). Die Negativszenarien, die sich aus der Einleitung 15 kritischen Einschätzung ergaben, erfüllten sich nicht. Aus diesem Grunde sind Ende der 90er Jahre die Einschätzungen der Entwicklungschancen zurückhaltender und positiver geworden. Positiver, weil sich einige Länder schneller in die gewünschte Richtung entwickeln konnten als erwartet wurde. Zurückhaltender, weil erkannt wurde, daß vor dem Hintergrund des komplexen Variablengefüges der Wechselwirkungen Vorhersagen, positive wie negative, ausgesprochen schlecht zu treffen sind. Der letzte Teil der Arbeit (Teil IV) stellt die Ergebnisse der Diskussion unterschiedlicher Ansätze der Transformationsforschung und der Themen der Transformation zusammenfassend dar. Es werden Mehrebenenmodelle für den Zusammenbruch und für die Konsolidierung entworfen, in denen die Integration der verschiedenen theoretischen Ansätze erfolgt. Die Arbeit schließt mit einem Überblick über aktuelle Theorietrends und der Einordnung der vorgeschlagenen Methode in die Landschaft sozialwissenschaftlicher Theorien. In der vorliegenden Arbeit konnten nicht alle Beiträge zur Transformation Osteuropas berücksichtigt werden. Es mußte eine Auswahl getroffen werden, die sich an der Bedeutung der Beiträge für die Beantwortung der Fragestellungen zur Transformation Osteuropas - den Ursachen des Zusammenbruchs der alten Ordnung und der Problematik der Konsolidierung einer Demokratie - orientierte. Insofern kann keine Vollständigkeit beansprucht werden. Auch wurde nicht versucht, die aufgezeigten Zusammenhänge auf jedes einzelne Beispiel einer Transformation Osteuropas anzuwenden. Mit der Auswahl der Beiträge hat gleichzeitig eine Einschränkung der Beispiele, auf die zur Verdeutlichung verwiesen wird, stattgefunden. Am ausführlichsten und umfangreichsten wurde zum Zusammenbruch der ost- und südmitteleuropäischen Staaten geforscht. Deshalb werden die besonderen Entwicklungen der baltischen Staaten sowie anderer Nachfolgestaaten der UdSSR, Albaniens und des ehemaligen Jugoslawiens nur am Rande erwähnt. Im Vordergrund der Arbeit steht eine methodische Fragestellung - nicht eine komparative Analyse, in der alle möglichen Fälle berücksichtigt werden sollen. Die Fragestellung der Arbeit selbst ist so komplex, daß der Gegenstand eingegrenzt werden muß, um zu vorsichtigen Ergebnissen zu gelangen. Aus diesen Gründen werden sich die meisten Hinweise auf die Entwicklungen in Polen, der Tschechoslowakei (Tschechien und Slowakei), Bulgariens, der DDR, Rumäniens, Ungarns und der SU beziehen. Des weiteren werden die Beispiele hauptsächlich zur Verdeutlichung der theoretischen Modelle und daher durchaus auch wechselnd herangezogen. Es wird nicht versucht, die Transformation einer konkreten Auswahl osteuropäischer Staaten nachzuvollziehen. Vielmehr bildet die Untersuchung der theoretischen Bewältigung nicht aller, aber der zentralen Fragen sowie Themen- und Problembereiche der Transformation Osteuropas den Fokus der Arbeit. Einleitung 16 Auch die behandelten Themen der politischen Konsolidierung erschöpfen nicht die gesamte Problematik der Chancen und Risiken einer wünschenswerten Entwicklung. Die Auswahl rechtfertigt sich durch die Bedeutung, die den Themen in der Transformationsforschung beigemessen wird. Besonders die Bedingungen und Wirkungen der neuen Verfassungen, des gewählten Regierungssystems, des Wahlsystems und der Struktur der Parteien und Interessengruppen bilden die Schwerpunkte aktueller Forschung. Das bedeutet keinesfalls, daß Themen wie „der Einfluß der internationalen Verflechtung“ oder „die Auswirkung von föderaler bzw. zentraler Organisationsform des Staates auf die Konsolidierungschancen“ weniger relevant sind. Zum Teil verweisen sie sogar auf gravierende Lücken in der Transformationsforschung17, die jedoch mit der vorliegenden Untersuchung nicht aufgearbeitet werden können, sondern eine eigene Untersuchung verdienen. Der Autor ist bestrebt, mit den genannten Einschränkungen einen Beitrag zur Klarheit der Argumentation und zur Seriosität der Methode zu leisten. 17 Eine kritische Revision der Themen und Lücken (insbesondere im Bereich der internationalen Beziehungen) aktueller Transformationsforschung liefern Kopecky und Mudde (2000). Transformationsforschung vor 1989 I. TRANSFORMATIONSFORSCHUNG VOR 1989 17 Transformationsforschung vor 1989 18 Eine integrative, über mehrere analytische Ebenen reichende Analyse stellt in der Transformationsforschung eine Neuerung dar. Vor 1989 hatten entweder makrotheoretische oder mikrotheoretische Ansätze die Transformationsforschung bestimmt. Transformationsforschung wurde als Demokratisierungsforschung betrieben oder als ein Unterkapitel bei der Erforschung des sozialen Wandels behandelt. Bis in die 70er Jahre herrschten makrotheoretische bzw. markrosoziologische Ansätze vor; Lipset (1959), Moore (1966), Huntington (1965, 1966, 1968) und Parsons (1951; 1969a; 1969b; 1972) sind ihre bekanntesten Vertreter. Lipset (1959) führte demokratische Stabilität und die Entwicklung zur Demokratie auf eine Liste von strukturellen Variablen zurück, die er aus Korrelationstudien gewann. Diese Variablen entscheiden in seinem Modell darüber, ob die beiden prinzipiellen Charakteristiken einer stabilen Demokratie, ökonomische Entwicklung und Legitimität, erfüllt werden. Die ökonomische Entwicklung wird von Wohlstand, Industrialisierung sowie dem Grad der Urbanisierung und Bildung bestimmt. Über die Legitimität entscheiden die Effektivität des Systems (als Funktion der ökonomischen Entwicklung) und die Art und Weise, wie mit historisch entstandenen Konfliktlinien umgegangen wird. Sowohl für Wohlstand als auch für Industrialisierung und den Grad der Urbanisierung kann Lipset eine Korrelation zur Existenz von Demokratien feststellen. Dabei zeigt sich, daß der Grad der Bildung der wichtigste Faktor ist. Diese Ergebnisse kann Lipset auch kausal begründen (1959: 81f): Industrialisierung und Urbanisierung wirken unterstützend bei der Entwicklung von Wohlstand. Wohlstand und Bildung fördern Demokratie, weil sie die Voraussetzungen dafür schaffen, daß die unteren Schichten einerseits länger planen können und andererseits eine komplexere und differenziertere Sicht auf die Politik haben: „A belief in secular reformist gradualism can only be the ideology of a relatively well-to-do lower class.“ (Lipset 1959: 83). Mit Bildung und Wohlstand reduziert sich der Zuspruch zu Ideologien und die Unterstützung von Extremisten, weil sie den Glauben an demokratische Normen wie politische Toleranz und universalistische Normen, die eine Auswahl auf der Basis von Kompetenz und Leistung fordern, hervorbringen und unterstützen. Legitimität ist nach Lipset deshalb entscheidend, weil Legitimitätskrisen die Stabilität des politischen Systems gefährden. Drei Quellen der Legitimität nennt Lipset (1959: 86f): Erstens die Übereinstimmung der Normen einer Gesellschaft mit den demokratischen Normen. Zweitens die Fähigkeit des politischen Systems, mit einer effektiven Bürokratie effektive Entscheidungen zu treffen, und drittens die Unterstützung der demokratischen Entscheidungsfindung durch die Institutionen des politischen Systems. Als effektiv werden die politischen Entscheidungen bewertet, wenn die zentralen Themen, die historisch die Gesellschaft gespalten haben, bewältigt werden. Die Rolle der Kirche bzw. der Religion im Staat sollte geklärt sein. Den unteren sozialen Schichten Transformationsforschung vor 1989 19 muß mit dem allgemeinen Wahlrecht der Zugang zur Macht garantiert werden und Assoziationsfreiheit eingeräumt werden. Und der Verteilungskampf um das nationale Einkommen muß auf moderate Bahnen gelenkt werden. Hier können intermediäre Institutionen1 eine vermittelnde Funktion einnehmen und konstitutionelle Arrangements (die Pateiensystem, Wahlsystem und Staatsform gestalten) so eingerichtet werden, daß sie sowohl die gesellschaftliche Werteintegration fördern als auch eine moderate Spannung zwischen konkurrierenden politischen Kräften aufrechterhalten. Während sich Lipset auf die makrosoziologischen Bedingungen einer demokratischen Ordnung konzentrierte und die Genese der Bedingungen unbeachtet ließ, rückten Moore und Huntington die historischen Entstehungsbedingungen der strukturellen Voraussetzungen moderner Gesellschaftsformen ins Blickfeld. Moores (1966) makrosoziologisch-historische Untersuchung zur Herkunft von Diktatur und Demokratie zeigt drei Wege von der vorindustriellen zur modernen Welt, denen er den Status genereller Entwicklungsmuster zuwies. Der erste Weg ist durch die „bourgeois revolution“ geprägt (Moore 1966: 3f): Sie führte auf demokratischem Wege zur modernen Gesellschaft, und sie hat die Kombination von Kapitalismus und westlicher Demokratie hervorgebracht. Typische Beispiele sind die puritanische Revolution (der Bürgerkrieg in England), die französische Revolution und der amerikanische Bürgerkrieg. Der zweite Weg führte zwar auch zum Kapitalismus, endete aber anschließend im Faschismus (Moore 1966: 228f): Diese „capitalist and reactionary form“ der Modernisierung konnte in Japan und in Deutschland beobachtet werden. Der dritte und letzte Weg ist „communism“, wie er in China und Rußland entstand (Moore 1966: 162f, 453f). Alle drei Entwicklungspfade führt Moore auf dominante historische Macht- und Konfliktkonfigurationen zurück (1966: xif): Aus der Art und Weise, wie die ländliche Oberklasse und die Bauern mit der zentralen Herausforderung der Kommerzialisierung der Landwirtschaft umgingen, ergaben sich langfristig die richtungsweisenden Konfigurationen. Die Konfiguration der „bourgeois revolution“ war dadurch gekennzeichnet, daß sich eine Gruppe herausbilden konnte, die ökonomisch unabhängig war und die gegen die Hindernisse einer demokratischen Version des Kapitalismus kämpfte. Die ländliche Oberklasse war entweder an diesem Kampf direkt beteiligt oder wurde in einer Revolution bzw. in einem Bürgerkrieg „aus dem Weg geräumt“. Die bäuerliche Bevölkerung war, wenn nicht beteiligt, dann bedeutungslos. Bei der Konfiguration der „capitalist and reactionary form“ der Modernisierung war der Impuls einer bürgerlichen Revolution schwächer, und wenn es zu einer solchen kam, dann wurde sie zerschlagen. Als Ergebnis der abgebrochenen bürgerlichen Revolution verbündeten sich Teile der industriellen 1 Vgl. für eine Definition und zur Erläuterung der Funktion von intermediären Institutionen in dieser Arbeit: Teil II, Kapitel 2. Transformationsforschung vor 1989 20 und kommerziellen Klasse mit Dissidenten der herrschenden Klasse, die sich hauptsächlich vom Land rekrutierte (Landadel), um die politischen und ökonomischen Änderungen durchzusetzen, nach denen eine moderne industrielle Gesellschaft verlangt. Semi-parlamentarische Systeme wurden gebildet, die zwar der Industrialisierung förderlich waren, aber schwache Demokratien hervorbrachten. Die Konsequenz der Moderne ohne echte Revolution war der Faschismus (Moore 1966: 506). Der Kommunismus bildete nach Moore das Resultat einer Konfiguration, bei der umfassende ländliche Bürokratien die Kommerzialisierung der Landwirtschaft und die Industrialisierung unterdrückten. Dies führte dazu, daß die städtisch-bürgerliche Schicht zu schwach blieb, um Allianzen mit der Landbevölkerung für eine bürgerliche Revolution zu bilden und daß eine riesige bäuerliche Landbevölkerung bestehen blieb, die zur Hauptkraft eines revolutionären Umbruchs wurde. Ebenso wie Moore formulierte Huntington seine Transformationstheorie auf der Basis einer makrohistorischen Untersuchung der Entwicklungspfade zur politischen Modernisierung und Demokratie (vgl. 1965; 1966; 1968). Politische Modernisierung ist in seinem Konzept durch drei Kriterien gekennzeichnet: 1. die Rationalisierung von Autorität, 2. die Ausdifferenzierung neuer politischer Funktionen sowie der entsprechenden Strukturen, die diese Funktionen erfüllen, und 3. die zunehmende politische Partizipation gesellschaftlicher Gruppen sowie der Entwicklung entsprechender Assoziationen (Verbände, Parteien). Das erste Kriterium steht für die Ablösung traditioneller Autoritätsformen und die Etablierung einer singulären, säkularen, national-politischen Autorität. Das zweite Kriterium beschreibt die Entwicklung einer administrativen, rational arbeitenden Hierarchie, in der die Verteilung von Positionen weniger nach dem Kriterium der Zuschreibung („ascription“), sondern nach dem der Leistung („achievement“) erfolgt. Und das dritte Kriterium verweist auf den Umstand, daß in modernen politischen Systemen die Bürger in die Regierungsangelegenheiten involviert sind. Um eine Entwicklungsprognose zu formulieren, war es für Huntington entscheidend zu zeigen, daß nicht nur die parlamentarische Demokratie, sondern auch die Einparteiendiktatur kommunistischer Prägung diese Kriterien erfüllen kann (vgl. 1966; 1968). Über welchen dieser beiden Wege die politische Modernisierung eingelöst wird, entscheidet sich mit der strukturprägenden historischen Entwicklung in dem jeweiligen Land. Der Prozeß der Demokratisierung vollzog sich nach Huntington sukzessive über viele Jahrhunderte, in denen die Rationalisierung der Autorität einem strukturellen Differenzierungsprozeß2 und der zunehmenden Massenpartizipation folgte. In Kontinentaleuropa, England und Nordamerika hat diese Entwicklung demokratische Systeme hervor2 Mit struktureller Differenzierung meint Huntington eine Ausdifferenzierung politischer Funktionen und der parallelen Entwicklung spezialisierter Strukturen, die die entsprechende Funktionserfüllung leisten: „Areas of peculiar competence –legal, military, administrative, scientific – become seperated from the political realm, and autonomous, specialised, but subordinate, organs arise to dicharge those tasks.“ (1966: 378). Transformationsforschung vor 1989 21 gebracht. Andere Länder, die in den 60er Jahren an der Schwelle zur politischen Modernisierung standen, hatten von diesen drei Entwicklungstypen völlig abweichende historische Erfahrungen gemacht. Ihre Erfahrungen mündeten in eine soziale Struktur, in der Huntington ein unüberwindbares strukturelles Hindernis für eine demokratische Entwicklung in absehbarer Zukunft sah. Die in die Unabhängigkeit entlassenen afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Staaten hatten oftmals eine feudale Struktur geerbt. Damit ging eine Sozialstruktur einher, bei der der Graben zwischen arm und reich, zwischen moderner Elite und traditionsorientierter Masse und zwischen politisch, sozial sowie ökonomisch Starken und Schwachen enorm tief war. Die Kluft konnte in den Staaten, die erfolgreich eine Demokratie etablierten, durch eine starke Regierungsmacht geschlossen werden (wie im Europa des 17. Jahrhunderts), oder es gab sie erst gar nicht (wie in Nordamerika3). In diesem Unterschied steckt der für Huntington entscheidende Hinweis auf die Entwicklungschancen neuer Demokratien: Demokratische Institutionen stehen in einem Konfliktverhältnis zu den Modernisierungs- und Reformerfordernissen, die sich mit Themen der sozialen Wohlfahrt, einer ausgeglicheneren Einkommensverteilung und der Bildung eines Mittelstandes ergeben. Entsprechende Modernisierungsschritte brächten für die Staaten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas fundamentale Änderungen, die nach Huntington eigentlich nur mit Revolutionen durchgesetzt werden können. Nur so können starke Regierungen schwache Regierungen ablösen. Die liberalen, pluralistischdemokratischen Regierungsformen Westeuropas oder Nordamerikas lassen sich nicht einfach übertragen. Huntington meint, daß in den Ländern, in denen die Modernisierung simultan eine Konzentration von Macht, Strukturdifferenzierung und die Ausweitung der Partizipation verlangt, dieses Ziel viel besser durch ein Einparteiensystem erreicht werden kann. Dieser strukturelle Zusammenhang veranlaßte ihn zu der These, daß der Kommunismus das relevante Modell für die Modernisierung der Staaten im 20. Jahrhundert sei: „If Versailles set the standard for one century and Westminster for another, the Kremlin may well be the most relevant model for the modernizing countries of this century.“ (Huntington 1966: 413). Huntingtons und Moores Transformationsanalysen sind Beispiele für die historisch inspirierte makrotheoretische Argumentation, daß in der Geschichte eine Weichenstellung für die strukturelle Entwicklung erfolgt und so die Chancen einer zukünftigen Entwicklung determiniert werden. Die Geschichte hat nun den Makrodeterminismus Lipsets, Moors und Huntingtons widerlegt. Der zentrale Zusammenhang von Wohlstand und Demokratisierung in Lipsets Modell wurde mit der Entwicklung armer Länder in Südeuropa und Lateinamerika zu 3 „Americans, de Tocqueville said, were born equal and hence never had to worry about creating equality; they enjoyed the fruits of a democratic revolution without having suffered one.“ (Huntington 1968: 7). Transformationsforschung vor 1989 22 Demokratien aufgebrochen. Moores und Huntingtons Vorstellung, nach der in modernen Gesellschaften unterschiedliche Entwicklungswege möglich waren, hat mit den Entwicklungen in Osteuropa erheblich an Plausibilität eingebüßt. Seit den 90er Jahren kann das kommunistische Modell nicht mehr als Modernisierungsalternative neben dem Modell demokratischer Gesellschaften bestehen. Alle drei Ansätze argumentierten überwiegend auf der Basis von Korrelationsstudien. Bestimmte Eigenschaften eines Anfangszustandes wurden mit Eigenschaften eines Endzustandes in Verbindung gebracht. Faschismus, Kommunismus oder Demokratie bildeten ein Ergebnis, das von spezifischen strukturellen Bedingungen determiniert wurde, die die Autoren als essentiell erachteten. Einen von der induktiven Logik dieser makrohistorischen komparativen Soziologie abweichenden, makrotheoretischen Ansatz entwickelte Parsons. Seine Aussagen über gesellschaftliche Entwicklung deduzierte er aus der Logik seines systemtheoretischen Modells. Bereits in den 50er Jahren hatte Parsons Grundbausteine für eine Theorie des sozialen Wandels formuliert, die er dann in den 60er Jahren mit einem Ansatz zum strukturellen Wandel weiter ausarbeitete. In den 50er Jahren versuchte er zu zeigen, daß mit dem „structural-functional“ Ansatz (1951: 535) die Dynamik des Wandels innerhalb eines sozialen Systems, aber auch der Wandel des sozialen Systems selbst, erklärt werden kann. Parsons beschrieb zwei Problemstellungen des sozialen Wandels: Erstens, warum es zum Wandel kommt, also welches seine Auslöser sind. Dabei spielen die Konzepte des Gleichgewichts („equilibrium“) und der Spannungen („strains“) eine zentrale Rolle. Und zweitens, in welche Richtung der Wandel verläuft. Den Schlüssel zum Muster des gesellschaftlichen Entwicklungstrends sah er in den 50er Jahren in Max Webers Prinzip der Rationalisierung (1951: 496f). Diese Vorstellung baute er in den 60er Jahren zu einem Evolutionskonzept der gesellschaftlichen Entwicklung aus (vgl. 1969a, 1969b). Die Auslöser gesellschaftlicher Änderungsprozesse liegen in strukturellen Spannungen, die das gesellschaftliche Gleichgewicht stören (1951: 480f). „Spannung bezieht sich hier auf die Beziehung zwischen zwei oder mehreren struktuellen Einheiten (z.B. Subsysteme eines Systems), die die Tendenz hat, einen Druck in Richtung auf den Wandel dieser Beziehung auszuüben, eine Veränderung, die mit dem Gleichgewicht des betreffenden Systemteils unvereinbar wäre.“ (Parsons 1969a: 38). Solche Spannungen entstehen beispielsweise durch Störungen der Erwartungsmuster des Persönlichkeitssystems, die durch kulturelle Entwicklungen, z.B. technischen Fortschritt oder religiöse Ideen, angestoßen werden (1951: 490f) oder aber auch von der politischen oder ökonomischen Ebene des Systems ausgehen (1969a: 46). Die Integrationstendenz des Handlungssystems wehrt sich gegen den Wandel, weil das System eine Tendenz zum „boundarymaintaining“ hat (1951: 481). Stabile Systeme können interne Spannungen ausgleichen, so daß auch äußere Änderungen neutralisiert werden, bevor sie stabilitätsbedrohende Transformationsforschung vor 1989 23 Auswirkungen entfalten, wenn das Wertesystem stabil ist (1969a: 40). Werden die gesellschaftlichen Werte und Normen aber derart in Frage gestellt, daß die Spannungen nicht durch Wiederherstellung der Konformität gelöst oder anderweitig gehemmt bzw. isoliert werden können, dann verbleibt nur der Weg einer Wandlung der Struktur: „Wenn die Spannung groß genug wird, können die Kontrollmechanismen die Konformität mit den normativen Erwartungen, die den Bestand der Struktur garantieren, nicht mehr aufrechterhalten“ (Parsons 1969a: 38). Entweder wird das alte Gleichgewicht in einem „re-equilibrating process“ wiederhergestellt, oder ein neues Gleichgewicht wird mit der strukturellen Neuorganisation4 des Systems angestrebt. Parsons bezog sich in seinen Analysen bereits 1951 auf die Entwicklung in der Sowjetunion (SU), um seine Vorstellungen zum sozialen Wandel zu verdeutlichen (1951: 525f): Die strukturellen Widersprüche, die er in der Entwicklung des revolutionären Regimes des Sowjetsystem feststellen konnte, veranlaßten ihn schon damals zu einer kritischen Einschätzung der Systemstabilität. Die erste zentrale Spannung identifizierte er in dem Widerspruch, der sich daraus ergab, daß die utopische Annahme einer zwangfreien Gesellschaftsform der Realität eines Konformitätsdrucks weichen mußte. Zumindest die Teile der Bevölkerung, die an der revolutionären Bewegung nicht beteiligt waren, mußten entsprechend der revolutionären Werte diszipliniert und zu ihnen hin erzogen werden. Der Widerspruch wurde legitimiert, indem der Zustand einer zwangfreien, kommunistischen Gesellschaft in die Zukunft projiziert wurde, so daß der aktuelle Zwang als (vorübergehendes) Mittel zum Zweck deklariert werden konnte. Eine zweite Spannung sah Parsons in den Auswirkungen der drastischen Industrialisierungsanstrengungen in der SU. Er konnte zwar erkennen, daß die Industrialisierung der Systemstabilität anfänglich zuträglich war: Interne Anstrengungen helfen, einen Zustand der „emergency“ aufrechtzuerhalten, der die Integration der Gesellschaft fördert. Allerdings produziert erfolgreiche Industrialisierung auch eine Spannung, weil sie Individualismus fördert. Es findet nämlich eine Verschiebung vom Orientierungsmuster „universalistic-ascriptiv“ zum Orientierungsmuster „universalistic-achievment“ statt, die von der Struktur des Wertesystems nicht aufgefangen werden kann. Das hat seine Ursache darin, daß die Ungleichheiten, die sich aus der sozialen Stratifikation in einer industriellen Gesellschaft ergeben, offensichtlich der herrschenden Ideologie widersprechen. In diesem Widerspruch ist ein Integrationsproblem angelegt. Ungleichheit kann nicht - wie in den kapitalistischen Gesellschaften – mit funktionaler Leistungsfähigkeit legitimiert werden. Parsons versuchte auch die Richtung anzugeben, die ein aus Spannungen resultierender Strukturwandel einschlagen kann. In den 60er Jahren formulierte er seinen evolutionä4 An dieser Argumentation wird deutlich, daß Parsons‘ Theorie des strukturellen Wandels eine Transformationstheorie in dem hier verstandenen Sinne darstellt: Strukturelle Neuorganisation beschreibt einen Prozeß, bei dem sich die gesamtgesellschaftliche Struktur – als Reaktion auf eine Entwicklung, bei der das gesellschaftliche Norm- und Wertemuster in Frage gestellt wird - (radikal) wandelt. Transformationsforschung vor 1989 24 ren Ansatz des Strukturwandels (1969b), bei dem das Konzept der Rationalität hinter die gesteigerte Anpassungskapazität zurücktritt, die den Modernisierungsprozeß neuzeitlicher Gesellschaften charakterisiert. Parsons entwarf universelle Regeln („Universalien“) für die Evolution von Kultur und Gesellschaft. Sie stellen strukturelle Innovationen dar, die zu einer gesteigerten Anpassungskapazität führen und somit dem Bestand des Systems zugute kommen. Die Entwicklung moderner Gesellschaften in dem evolutionären Prozeß ist zielgerichtet (1972: 176). Sie bewegt sich auf eine Struktur „...bürokratischer Organisationsformen zur Realisierung kollektiver Ziele; Geld und Marktsysteme; ein allgemeingültiges universalistisches Rechtssystem und die demokratische Assoziation mit gewählter Führung...“ (1969b: 72) zu. Diese strukturellen Veränderungen sind als evolutionäre Universalien das Resultat von Differenzierungsprozessen und dem damit einhergehenden funktionalen Bedarf an integrativen Strukturen. In seinen Beiträgen zur evolutionären gesellschaftlichen Entwicklung äußerte sich Parsons wiederholt zum sowjetischen bzw. kommunistischen Gesellschaftssystem. Dabei verknüpfte er das evolutionäre Konzept mit seinen früheren Analysen der Spannungen und Gleichgewichtsstörungen und konnte so eine zwar vorsichtige, aber dennoch konkrete Prognose zur Entwicklung der SU wagen, die den Leser heute in ihrer Klarheit überrascht und deshalb hier ausführlich zitiert wird: „Ich stelle tatsächlich die Prognose, daß sich die kommunistische Gesellschaftsorganisation als instabil erweisen wird und entweder Anpassung in Richtung auf die Wahlrechtsdemokratie und ein pluralistisches Parteiensystem machen oder in weniger entwickelte und politisch weniger effektive Organisationsformen „regredieren“ wird; im zweiten Fall würden sich die kommunistischen Länder viel langsamer weiterentwickeln als im ersten Fall. Diese Voraussage stützt sich nicht zuletzt darauf, daß die Kommunistische Partei überall die Aufgabe betont hat, das Volk für eine neue Gesellschaft zu erziehen. Langfristig wird ihre Legitimität bestimmt untergraben, wenn die Parteiführung weiterhin nicht willens ist, dem Volk zu vertrauen, das sie erzogen hat. In unserem Zusammenhang aber heißt dem Volk zu vertrauen: ihm einen Teil der politischen Verantwortung anzuvertrauen. Das kann nur bedeuten, daß die monolithische Einheitspartei schließlich ihr Monopol der politischen Verantwortung aufgeben muß. (Damit sind keinesfalls die vielen komplizierten Wege analysiert, auf denen sich diese Entwicklung vollziehen könnte; aber damit ist die Richtung angezeigt, in die die Entwicklung höchstwahrscheinlich gehen wird, wenn die negativen Konsequenzen vermieden werden sollen).“ (1969b: 71). An dieser Prognose wird zweierlei deutlich: Erstens hat sich die strukturell-funktionale Theorie Parsons‘ mit ihrer Vorhersage bewährt5. Mit der makrotheoretischen Analyse konnten sowohl Ursachen des Umbruchs anhand der Spannungen erkannt werden als 5 Was nicht heißen muß, daß außer dem von Parsons betonten Legitimitätsproblem keine weiteren Faktoren Ursache der Entwicklung gewesen sein konnten. Ex post lassen sich die Ursachen natürlich differenzierter betrachten. Transformationsforschung vor 1989 25 auch die Richtung der Entwicklung angezeigt werden. Zweitens wird deutlich, was die Theorie nicht leistete und auch nicht zu leisten vorgab: Das Wie des Wandels verbleibt ungeklärt, weil die Wege der Entwicklung - wie der parenthetisch gefaßte Teil des Zitats ausführt - nicht analysiert werden. In den 70er und 80er Jahren verblaßte das Interesse der Transformationsforschung an makrotheoretischen Entwicklungskonzepten. Es fand ein Bruch mit dem makrosoziologischen Paradigma statt. Neue Wege wurden beschritten, um die Erfahrungen, die mit den zahlreichen Demokratisierungen in Südeuropa und dann in Lateinamerika gemacht wurden, theoretisch aufzuarbeiten. Dabei rückten andere Themen ins Blickfeld der Transformationsforschung. Insbesondere, weil sich die makrotheoretische Transformationsforschung, die die Wege der Demokratisierung beschreiben wollte, nicht bewahrheitet hatte, konnten sich nun Ansätze behaupten, die die Strategien der Demokratisierer und ihrer Gegner in den Mittelpunkt rückten. Die bekannteste und umfangreichste vergleichende Studie Transitions from Authoritarian Rule; Prospects for Democracy ist am Woodrow Wilson International Center for Scholars unter der Leitung von Guillermo O’Donnell, Phillippe C. Schmitter und Laurence Whitehead (1986) entstanden. Schon der Titel verweist auf den von den bisherigen Transformationstheorien abweichenden Fokus der Studie. Den Untersuchungsgegenstand bildet ein Zwischenstadium: „What we refer to as „transition“ is the intervall between one political regime and another.“ (O’Donnell / Schmitter 1986: 6). Die Autoren konzentrierten sich nicht etwa auf den Zusammenbruch des alten Regimes, sondern auf die Phase des Übergangs von autoritären zu demokratischen Regimen. In den 80er Jahren waren die Umbrüche in Südeuropa und Lateinamerika weniger auf Überraschung gestoßen als der Umbruch in Osteuropa in der folgenden Dekade. Was das öffentliche Interesse und die Intellektuellen beschäftigte, war daher weniger die Frage nach dem Warum, also den Ursachen des Umbruchs, als vielmehr das Risiko einer Rückwärtsbewegung zum Autoritarismus und z.T. auch die Befürchtung einer Entwicklung zum Sozialismus (vgl. O’Donnell / Schmitter 1986: 11f). Deshalb lag das primäre Interesse bei den Fragen nach dem Wie, d.h. der Gestaltung des Übergangs, und nach den Chancen für eine Stabilisierung der Demokratie. Neben dem vitalen Interesse, die jungen Demokratien zu stabilisieren und gegen regressive Tendenzen zu immunisieren6, gab es zwei weitere Gründe dafür, daß anders als bei der Transformation Osteuropas die Ursache der Transformationen wenn überhaupt, dann nur von sekundärem Interesse für die Forschung war. Der erste Grund liegt in dem Unterschied zwischen dem Selbstverständnis der kommunistischen Regime und dem der autoritären Regime: Der Kommunismus war ein Zukunftsentwurf mit ideologischem Charakter, der eine 6 Dieses Interesse bildet explizit den normativen Hintergrund der Studie. Lowenthal bemerkt einleitend, daß das Transition-Projekte einer „normative Orientation“ mit einem „...frank bias for democracy...“ (1986: x) folgte. Transformationsforschung vor 1989 26 Welt versprach, die es anzustreben galt. Die Utopie diente den Regimen Osteuropas, sich auf eine unbestimmte, aber in jedem Falle sehr lange Zeit zu legitimieren. Nichtkommunistische autoritäre Regime nach dem Zweiten Weltkrieg hingegen waren von vornherein als Übergangsregime konzipiert - „They are regimes that practice dictatorship and repression in the present while promising democracy and freedom in the future.“ (O’Donnell / Schmitter 1986: 15). Sie legitimierten ihre Herrschaft in der Regel mit dem Verweis auf ihre Leistung als Stifter sozialen Friedens oder ökonomischen Fortschritts. Der Übergang zur Demokratie war in den autoritären Regimen angelegt und war im Bewußtsein der Öffentlichkeit präsent – der Bestand der autoritären (Übergangs-)Regime stand unter kontinuierlichem Begründungsdruck. Ein zweiter Grund für das mäßige Interesse der Transitionsstudie an den Ursachen der Transformation läßt sich darin vermuten, daß demokratisierende Schritte in autoritären Regimen überlegt und intentional und nicht etwa aus einer Not- und Zwangslage heraus erfolgen. Die Demokratisierung mit liberalisierenden Schritten bietet sich nämlich paradoxerweise zu einem Zeitpunkt an, zu dem der Erfolg des autoritären Regimes umfassend wahrgenommen wird7. Das Regime muß also nicht - entgegen seinem Interesse zusammenbrechen, damit es zu einer Demokratisierung kommt. Ganz im Gegenteil, die Stabilität der Regime kann eine günstige Voraussetzung für den Wandel bilden. Unter diesen Umständen mußte sich die Überraschung über die Transformation in Grenzen halten und die Frage nach dem Zusammenbruch in den Hintergrund geraten. Liegt das primäre Interesse dann bei den dynamischen Prozessen des Übergangs8, geraten Akteurskonstellationen und Entscheidungen sowie Motive der am Umbau beteiligten Akteure ins Blickfeld; Elitenhandeln, die Rolle des Militärs und die Wirkungen öffentlicher Mobilisierung bilden den Fokus. Externen Variablen wie der geostrategischen Situation wurde als Kontext für die Öffnung des autoritären Regimes nur eine untergeordnete Bedeutung zugeschrieben. Wiederholt taucht der Hinweis auf, daß „domestic, internal factors“ über die Institutionalisierung und den Verlauf der Transition entscheiden (O‘Donnell / Schmitter 1986: 18; Lowenthal 1986: xi). Mit den internen Faktoren sind nicht etwa regimespezifische Struktureigenschaften gemeint, sondern Akteurskonstellationen und Akteure, deren Entscheidungen keinesfalls von makrostrukturellen Faktoren determiniert werden. Daraus erklärt sich das analytische Primat der Beiträge in der Transitionsstudie9. Ihren Kern bilden akteurstheoretische Ansätze. Hinweise auf strukturelle Variablen, die der „... strukturalistisch aufgeklärte de7 O’Donnel und Schmitter führen diesen paradoxen Zusammenhang aus: Die „Soft-Liner“, als Initiatoren der Liberalisierung, hoffen in einer erfolgreichen Phase, daß die Effektivität des Regimes in öffentliche Unterstützung für das Regime während der Transition übertragen werden kann (1986: 16). 8 Insofern handelt es sich bei den Studien nämlich auch nicht um theoretische und empirische Transformationsstudien, wie bspw. Merkel (1995: 31) bemerkt, sondern eben um Transitionsstudien, die eine begrenztere Fragestellung bearbeiten. 9 Der Zusammenhang von Dynamik des Änderungsprozesses und analytischer Ansatzhöhe der Untersuchung wird in der vorliegenden Arbeit ausführlich ausgeführt (vgl. Teil IV). Transformationsforschung vor 1989 27 skriptiv-typologische Akteursansatz ...“ (Merkel 1995: 31) der Transitionsstudie durchaus enthält, fungieren nicht als Erklärungsbausteine des Zusammenbruchs. Strukturelle Variablen werden von den Autoren mit der Absicht eingeführt, die Schwierigkeiten zu spezifizieren, die im Erbe der autoritären Regime angelegt sind und somit Ausgangsbedingungen für den Start der Institutionalisierung eines demokratischen Regimes beschreiben, so daß komparative Aussagen über Entwicklungschancen und -risiken möglich werden10. Von der akteurszentrierten Transformationsforschung der 80er Jahre, die primär als Transitionsforschung betrieben wurde, konnten weder Antworten auf die Frage nach den Ursachen des Zusammenbruches der osteuropäischen Regime noch Vorhersagen über die weitere Entwicklung erwartet werden. Es lag nicht an der theoretischen Qualität der Ergebnisse, daß die Transformationsforschung Ende der 80er Jahre von dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime überrascht wurde. Vielmehr verbindet die Transformation Osteuropas die alte Fragestellung nach den Ursachen gesellschaftlicher Entwicklung mit der Frage nach den Prozessen des Übergangs - der Transition. Mit der Transformation Osteuropas steht die sozialwissenschaftliche Theorie also vor Fragenkomplexen, die umfangreicher sind als die Fragestellungen, die Parsons bei seinem Ausführungen zum sozialen Wandel oder die Transformationsforschung zu den Umbrüchen in Südeuropa und Lateinamerika beschäftigten. Einerseits interessieren die Ursachen des Zusammenbruchs und andererseits die Prozesse des Übergangs und die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken für das neue, angestrebte Regime. Für die aktuelle Transformationsforschung bedeutet das, daß sie eine Syntheseleistung zu erbringen hat. Es muß versucht werden, zusammenzufügen, was historisch getrennt war. Mit der Transformation Osteuropas haben sich Problemstellungen ergeben, die in den Transformationstheorien vor 1989 thematisch und zeitlich auseinanderfielen. Für eine 10 Beispielsweise lassen sich in der komparativen Studie O’Donnells derartige Hinweise finden (1986): Eine Gefahr für die Demokratisierung in den meisten lateinamerkanischen Staaten wird in dem strukturellen Erbe eines vergleichsweise hohen Militarisierungsgrades, der als eine Bedrohung für die Autoritätshoheit des demokratischen Souveräns verstanden wird, gesehen. Darüber hinaus gab der hohe Grad sozio-ökonomischer Ungleichheit eher Grund zur pessimistischen Einschätzung der Entwicklungschancen, weil Demokratien nicht als optimale Lösung für „Equity-Probleme“ gelten. Der zivilgesellschaftliche Hintergrund bildet auch eine interessante Größe. In Lateinamerika war er wesentlich schwächer ausgeprägt als in Südeuropa, so daß den Ideen der politischen Demokratie und des Pluralismus eine zweifelhafte Bedeutung zugeschrieben wurde. O’Donnell befürchtete daher für Lateinamerika eine generelle Offenheit für autoritäre Lösungen, wenn sich die demokratischen Institutionen nicht bewährten oder anderweitig Chaos drohte. Auch wurde in den Studien versucht, aus den Spezifika der autoritären Herrschaftsausübung Aussagen über den möglichen Weg zur Demokratisierung abzuleiten. (O’Donnell <1986: 4f> erweitert im Versuch, generalisierende Aussagen zu treffen, zwar die klassischen drei Typen moderner Herrschaftsformen – Totalitarismus, Autoritarismus und Demokratie -, muß aber so viele Ausnahmen und Hybride der neuen Typen einführen, daß an der generalisierenden Qualität der Typologie gezweifelt werden kann.). Demnach erfolgte auch mit diesen Hinweisen keine Untersuchung der Ursachen der Ablösung des alten Regimes. Die Autoren versuchen nur zu klären, warum die Demokratisierung in Südeuropa vielversprechender verlief als in Lateinamerika (Schmitter 1986:4) und ob aus dem Weg der Transition Schlüsse für die Demokratisierungsmöglichkeiten gezogen werden können. Transformationsforschung vor 1989 28 umfassende Analyse des Phänomens „Transformation Osteuropas“ müssen sie heute zusammengebracht werden: Auslöser des Zusammenbruchs, Dynamiken des Umbaus und Mechanismen der Konsolidierung bilden das Ensemble der Untersuchungsgegenstände aktueller Transformationsforschung. An eine makrotheoretische Logik zur Transformation bzw. zum sozialen Wandel wird heute angeknüpft, wenn System- und Strukturdefizite kommunistischer Regime aufgezeigt werden, die zwar nicht zwingend den Zusammenbruch induzieren, mit denen sich aber Bedingungen (also Ursachen) für die Öffnung eines „Transformationsfensters“ benennen lassen. Wie die dynamischen Prozesse des Übergangs und Umbaus ausgestaltet werden, hängt von der Zusammensetzung der beteiligten Akteure und ihren Entscheidungen bzw. Handlungen ab. Solche Prozesse können mit mikrotheoretischen Analysen untersucht werden, was auch schon die Transitionsforschung der 80er Jahren gezeigt hat. Zusammenbruch der alten Ordnung II. DER ZUSAMMENBRUCH DER ALTEN ORDNUNG 29 Zusammenbruch der alten Ordnung 30 1. Makrotheoretische Ansätze Makrotheoretische Ansätze beschreiben die „Strukturierung der Transformationsoptionen“. Sie untersuchen, wie in den kommunistischen Systemen die Möglichkeit für eine Transformation entstanden ist, indem sie system- oder strukturspezifische Defizite und innere Widersprüche herausstellen. In der systemtheoretischen Perspektive wird die Transformation als ein autonomer Prozeß sozialer Evolution beschrieben. Der Zusammenbruch folgte einer inneren Logik, ergab sich also aus systemimmanenten Eigenschaften. Die besonderen Eigenschaften der kommunistischen Systeme blockierten die Strukturerhaltung des Systems bei gegebenen Umweltanforderungen. Strukturtheoretische Ansätze konkretisieren diesen Zusammenhang, indem sie beschreiben, wie über externe Bedingungen interne Prozesse in Gang gesetzt wurden, die wiederum den Charakter der externen Beziehungen maßgebend bestimmten. Solche Bedingungen können sich aus der Interstate-Competition ergeben. Der Wettbewerb kann Konfliktlinien, aber auch Konvergenzlinien hervorbringen. Die geopolitische Theorie konzentriert sich auf den ersten Aspekt; die Auswirkungen zwischenstaatlicher Konflikte auf die Systemstabilität. Modernisierungstheorien hingegen konzentrieren sich eher auf die Eigengesetzlichkeit der internen Entwicklung im System, die durch externe Variablen lediglich angestoßen wird, und damit auf den zweiten Aspekt. Die Modernisierung führte zu Konvergenzen sowohl durch den wirtschaftlichen Wettbewerb als auch durch den Kulturtransfer in der „Weltkultur“ über die Medien oder die z.T. durchlässigen Grenzen. Die Einteilung der im folgenden vorgestellten Ansätze erfolgt einerseits nach dem Abstraktionsgrad der Theorien und andererseits nach dem Ausmaß der Bedeutung, die den externen bzw. internen Variablen zugeschrieben wird. Die systemtheoretischen Untersuchungen stellen in ihren Mittelpunkt den Vergleich der spezifischen Steuerungsmodi und Umweltverarbeitungskapazitäten von kommunistischen Systemen und demokratischen Systemen. Der geopolitische Ansatz betont die Bedeutung der Interstate-Competition und damit das Primat externer Variablen. Eine weitere Gruppe bilden Erklärungsversuche, die modernisierungstheoretisch argumentieren. Sie identifizieren interne Prozesse bzw. Strukturdefizite als Ursachen von Krisen. Diesen systemimmanenten Defiziten und Widersprüchen wird in den Analysen zur Transformation in Osteuropa die größere Aufmerksamkeit geschenkt. Deshalb wird ihren Argumenten in den folgenden Abschnitten auch das Hauptaugenmerk entgegengebracht. Zusammenbruch der alten Ordnung 31 1.1 Systemische Defizite Brechen Systeme zusammen wie in Osteuropa, dann liegt das daran, daß ihnen wichtige Stabilitätsfaktoren fehlen. Aus der systemtheoretischen Perspektive konnten die westlichen Systeme bestehen, weil sie eine höhere Stabilisierungsfähigkeit als die kommunistischen Systeme zeigten. Die autopoietische Systemtheorie - wie von Luhmann (vgl. 1984) entwickelt - bietet ein Instrumentarium, mit dem sich die spezifischen Faktoren benennen lassen, die in kommunistischen Systemen für den Stabilitätsmangel verantwortlich waren. Das Autopoiese-Konzept beschreibt den Grad, in dem Systeme nach funktionsspezifischen Kriterien operieren bzw. operativ geschlossen sind (vgl. Luhmann 1984; Willke 1989). Soziale Systeme haben in einer evolutionären Entwicklung zum Primat der funktionalen Differenzierung sogenannte Spezialsprachen in Form spezialisierter Kommunikationsmedien herausgebildet (vgl. Luhmann 1975: 170f; 1984: 222; 1994: 28f): Für das Teilsystem der Politik ist dies Macht, für die Wirtschaft Geld und für die Wissenschaft Wahrheit (um nur einige Beispiele zu nennen). In diesen Medien entscheidet die sogenannte Leitdifferenz, ob und wie Information verarbeitet werden kann (vgl. Willke 1992: 169). Politik differenziert und selektiert nach dem Code Regierung oder Opposition, Wirtschaft nach zahlen oder nicht zahlen und Wissenschaft nach wahr oder unwahr. Erst die Ausbildung dieser systemspezifischen, binären Codierungen erlaubt es, Information bzw. Umwelteinflüsse effektiv nach systemspezifischen Rationalitäten zu verarbeiten. Als entscheidendes Stabilitätskriterium für ein System identifiziert die autopoietische Systemtheorie die Funktion der dynamischen Strukturanpassung an exogene wie endogene Anforderungen oder Schocks (vgl. Luhmann; 1984 Willke 1989). Diese Anforderungen können in funktional stark differenzierten modernen Gesellschaften erfüllt werden, wenn sich die Strukturen der Teilsysteme dynamisch und mit der allgemeinen funktionalen Differenzierung koevolutiv entwickeln (vgl. Sandschneider 1994). Die System-Umwelt-Relation erfordert immer wieder Anpassungsleistungen. Sie bilden die Voraussetzungen für eine effektive Problembearbeitung, die davor schützt, daß neue Anforderungen und Schocks die Systemstabilität gefährden. Für gesellschaftliche Teilsysteme folgt daraus, daß sie mit Bezug auf die Umwelt hinreichend ausdifferenziert und spezialisiert sein müssen (vgl. Luhmann 1984: 476f). Systeme unterscheiden sich signifikant in ihrer Anreizperzeption. Die Qualität der unterschiedlichen Wahrnehmung und der aus ihr folgenden Reaktionen läßt sich an der systeminternen Differenzierung messen und verweist damit auf den Grad des autopoietischen Charakters des Systems. Nur wenn Systeme ihrem eigenen Code bzw. ihrer eigenen Leitdifferenz folgen, d.h. selbstreferentiell (autopoietisch) operieren, können sie eigene Rationalitäten ausbilden, mit denen optimal auf Umweltanforderungen reagiert werden kann (Luhmann 1984: 60f). Nicht erfüllt wird die Anpassungsleistung, wenn es Zusammenbruch der alten Ordnung 32 eine den differenzierten Teilsystemen „übergeordnete Superrepräsentation“ (Merkel 1994) gibt. Mit „übergeordneter Superrepräsentation“ ist der Übergriff teilsystem-unspezifischer Codes gemeint. In diesen Fällen kann das Teilsystem nicht mehr nach eigenen Kriterien Umweltanforderungen verarbeiten. Die Dominanz einer systemfremden Leitdifferenz der Anreizperzeption senkt bei hoher Komplexität die Problemlösungskapazität, weil die Vorteile der Ausdifferenzierung unterminiert werden, was effizienzmindernd wirkt. Die Autopoiesis wird resistent gegen teilsystem-spezifische Anforderungen, so daß das Teilsystem nicht in der ihm eigenen Rationalität auf die Umweltänderungen reagieren kann. Das System verliert in der sich verändernden Umwelt zunehmend an Stabilität. Was folgt aus diesen Zusammenhängen für autoritäre bzw. totalitäre Systeme wie den kommunistischen Regimen? Systemtheoretisch wird argumentiert, daß moderne Formen nicht-demokratischer Systeme durch die repressiv erzwungene Übernahme einer Leitdifferenz gekennzeichnet sind (Sandschneider 1994): Die gesellschaftlichen Teilsysteme wurden im Kommunismus durch die Übernahme des Codes des politischen Teilsystems an die Politik gekoppelt1. Die Ökonomie oder auch die Wissenschaft konnten nicht mehr nach ihren eigenen Kriterien operieren, sondern mußten sich immer primär dem Code der Politik unterordnen. Sie verloren ihre Autonomie, d.h. die unabhängige, teilsystem-rationale Verarbeitung von Umweltanreizen war unmöglich. Die Folge eines solchen Zustandes ist eine rigide Steuerung mit Funktionskrisen. Dysfunktionalität kann weder weiterverarbeitet noch durch Anpassung kompensiert werden. Die inadäquate Struktur perpetuiert sich, weil keine effektiven Rückkoppelungsmechanismen entwickelt werden können. Mobilisierungsressourcen und Verarbeitungskapazität werden nicht nur unterdrückt, sondern auch verbraucht, so daß ein adäquater Strukturwandel über Selbststeuerungs- und Selbstorganisationskapazitäten (Autopoiesis) innerhalb des bestehenden Systems unmöglich wird. In einem solchen Zustand wird eine Transformation nötig, da die Absorption externer Anreize nur mit einer Umdefinition der Leitdifferenz und der Zulassung teilsystemischer Differenzen, also dem Identitätsverlust des bestehenden Systems, gelingt. Sandschneiders systemtheoretische Argumentation bewältigt die theoretische Herausforderung des Zusammenbruchs kommunistischer Regime auf hohem Abstraktionsniveau. Sie bewegt sich auf einer Allgemeinheitsstufe, die den pauschalen Vergleich zwischen planwirtschaftlich organisierten, kommunistischen Regimen und marktwirtschaftlich organisierten, demokratischen Regimen ermöglicht. Historische Prozesse bestätigen die systemtheoretischen Annahmen auch in einer weniger abstrakten Konfrontation mit empirischen Fakten. Heute läßt sich anhand offenkun1 Mit dem Primat einer Leitdifferenz findet eine Entdifferenzierung statt. Sie etabliert sich mit der Despezifizierung teilsystemischer Codes. Die gesamte Wirklichkeit wird nach dem dualen Code der Partei, nämlich sozialistisch / antisozialistisch kommuniziert (vgl. Pollack 1990). Zusammenbruch der alten Ordnung 33 dig gewordener funktionaler Defizite nachzeichnen, wie es zum evolutionären Zusammenbruch kommen mußte (Brie 1992): Funktionale Defizite wurden bspw. in der SU mit dem Konstitutionskonzept als zentrale Dimensionen der Identität des Systems etabliert: Der Sozialismus konzipierte und legitimierte sich als „Gegenform“ (Brie 1992: 70f; Bude 19932) zu den Modernisierungserscheinungen des Kapitalismus. Damit wurde der Sowjetunion die konfrontativ-kompetitive Beziehung zu den nichtsozialistischen Weltmetropolen in die innere Struktur „eingeschrieben“. Garantierte ihr sozialbürokratisch organisierter Gesellschaftstyp anfänglich auch äußere Stabilität, so führte andererseits die mangelnde funktionale Differenzierung und die administrative Ressourcenzentralisierung zur inneren Selbstauflösung – insbesondere wegen der immensen Kosten für den (militärischen) Wettbewerb. Das Fortschrittspotential der in einigen Dimensionen durchaus modernen Gesellschaft reduzierte sich drastisch durch die zentrale Organisation, von der eigentlich eine stärkere Rationalität erwartet wurde. Systemimmanente Krisen wurden daher unvermeidbar. Auf der Grundlage dieser Logik stellt sich der Transformationsprozeß als evolutionärer Krisenzyklus dar, den Brie (1992) wie folgt beschreibt: Die künstlich zurückgehaltenen Potentiale führten in der SU nicht nur zur ökonomischen Stagnation. Sie verstärkten auch den Drang, strukturelle Evolutionspotentiale nach der Logik teilautonomer Systeme mit spezifischen Codes auszubilden - jenseits des dominanten politischen Steuerungsmodus. Beispielsweise bildeten sich in privaten Kreisen Nischen mit teilsystemischen Logiken. Jede Veränderung, die mit konsequenten Reformen des Systems erfolgen würde (d.h. jede Tendenz, dem Drang nach Differenzierung nachzugeben), mußte aber bei der vorhandenen Universalisierung der Rationalität des politischen Systems zum Zusammenbruch führen. Jede kreative Nutzung eines Krisenzyklus in Form einer sinnvollen inneren Komplexitätserweiterung stellte die Reproduktionslogik des Systems generell in Frage. Mit dieser Argumentation läßt sich dem Staatssozialismus eine Paradoxie nachweisen, die unvermeidbar zu einer Krise oder mindestens zu subversiven Tendenzen führen muß. Die Anforderungen, die mit dem Streben nach Erhalt oder sogar Überlegenheit des Systems innerhalb des Weltsystems entstehen, dürfen die Evolutionsfähigkeit und die damit verbundenen Potentiale der Gesellschaften nicht unterdrücken. Nicht rigide Steuerung, sondern nur eine kybernetische Lenkung3 kann Stabilität garantieren (vgl. Sandschneider 1994) und einen effektiven Rückkopplungsmechanismus in Funktion setzen (vgl. Merkel 1994). Die Unterdrückung der Evolutionsfähigkeit und der teilsystemischen Rationalitäten durch eine rigide Steuerung (mit einem dominanten Code, 2 Diese negative Selbstdefinition weist Bude auch für die DDR nach, deren Politikkonzept er als „tragische Selbstbeschreibung“ tituliert. 3 Damit ist hier die Selbststeuerung gemeint, die einem teilsystemischen Code folgt und eine Rückkopplung garantiert. Zusammenbruch der alten Ordnung 34 einer dominanten Leitdifferenz) sind aber zentrale Identitätsmerkmale autoritärer und insbesondere totalitärer Systeme. Die Zuständigkeit der Systemtheorie für die Transformationsforschung bleibt abgrenzbar und läßt Raum für die Theoretisierung individueller und kollektiver Handlungen, die nicht im Widerspruch zur Systemtheorie stehen muß. Zum Teil deutet sich dieser Schritt in den systemtheoretischen Analysen an. Bei Brie (1992) beschreiben der Prozeß der Dezentralisierung von Macht und die Entstehung von Gegengesellschaften (Nischen) nichts anderes als oppositionelle Potentiale auf der Grundlage einer bunten Palette individueller Bedürfnisse und Orientierungen. Diese reichen von strategischen Optionen beim zunehmenden horizontalen Aushandeln von Interessen bis hin zu Bestrebungen zur Herstellung einer überzeugenden integren Identität des Individuums in einer Gemeinschaft. Hieraus erwächst die Notwendigkeit einer systematischen Erklärung dieser Prozesse individueller und kollektiver Interaktionen nach der Logik der relevanten individuellen Orientierungen. Eine solche Erklärung beginnt mit der Untersuchung der Begrenzungen des diskretionären Raums individueller Entscheidungen und Handlungen, die an der Untersuchung der strukturellen Bedingungen ansetzt. Die Beschreibung des Handlungsrahmens findet auf der Grundlage konkreter struktureller Entwicklungen statt. Über historische, geopolitische Variablen und Besonderheiten der Organisationsformen, der Institutionenstruktur sowie des Differenzierungsgrades können die „...strukturellen Möglichkeitsbedingungen der Demokratie innerhalb gegebener Machtkonstellationen...“ (Merkel 1994: 14) identifiziert werden. Diese die Richtung der inkrementalen evolutionären Prozesse konkretisierenden und dynamisierenden Bedingungen stehen im Mittelpunkt der strukturtheoretischen Ansätze. Zusammenbruch der alten Ordnung 35 1.2 Geopolitische Herausforderungen Die geopolitische Theorie hat strukturelle Variablen des Zusammenbruchs in expliziter Abgrenzung zu den Modernisierungs- und Konvergenztheorien sowie der ökonomischen Theorie herausgearbeitet. Dimensionen der politischen Ökonomie - wie Mängel des ökonomischen Systems des Kommunismus - werden als abhängige, von geopolitischen Größen determinierte Variablen behandelt (vgl. Collins 1995). Die Modernisierungs- und Konvergenztheorien werden mit dem Hinweis zurückgewiesen, daß ihren unspezifischen und schlecht zu verifizierenden Annahmen mit der geopolitischen Theorie ein Ansatz entgegengehalten werden kann, der einem deduktiv-nomologischen Anspruch gerecht wird. Collins und Waller (1993) beanspruchen explizit, die Antriebskräfte für Krisen und Zusammenbrüche von Staaten angeben zu können, die in ihrer streng kausalen Wirkungsweise auch Vorhersagen erlauben. Der Zusammenbruch des Kommunismus läßt sich in dieser Darstellung kurzerhand als „geopolitisches Scheitern“ kennzeichnen. In der geopolitischen Theorie dient das Konfliktpotential der Interstate-Beziehung als Erklärungsgrundlage für den strukturellen Zusammenbruch (Collins / Waller 1993; Collins 1995): Die Autoren gehen davon aus, daß die militärischen Positionen im internationalen Machtkampf im wesentlichen von der geopolitischen Lage abhängig sind. Der Zugriff auf Ressourcen, die Anzahl der Grenzen bzw. Fronten und die Ausdehnung des Staatsgebietes prägen die geopolitische Belastung und bestimmen damit die Haushaltslast sowie die Fiskalpolitik des Staates. Hierdurch werden interne Dimensionen von externen Konfliktlagen determiniert. Der Ressourcenzugang in Konfliktsituationen erhält somit indirekt über die Steuerpolitik eine Schlüsselstellung für innenpolitische Prozesse. Die geopolitische Macht wird im Umkehrschluß bestimmt von der internen Ressourcengewinnung. Eliten und Öffentlichkeit reagieren auf die Belastung dieser Makroprozesse. Kumulieren die Konfliktsituationen, wie in der Sowjetunion, läßt sich der Staatszusammenbruch mit dem von Collins gezeichneten Wirkungsmodell (bei zunehmender Verletzlichkeit des Staates und seiner Herrscher in Krisen) nachvollziehen. Die geopolitische Theorie beruft sich mit ihrer Argumentation auf Max Weber (vgl. 1972: 520f), demzufolge die Legitimität der Eliten gegenüber der Bevölkerung von der Machtausübung des Staates nach außen abhängt: Die durch die Eliten vertretenen Ideologien sind nur dann populär, wenn die geopolitische Situation günstig ist. Folgerichtig findet zur Legitimitätswahrung ein Kampf um das externe Machtprestige statt. Auf die zunehmenden Konfliktsituationen wird mit einem verstärkten Rückgriff auf Ressourcen reagiert, der bei Überextension - wie beim Rüstungswettlauf und Kriegen - zu deren Erschöpfung bis hin zur staatlichen Desintegration führt. Einerseits erscheint die Führung ineffektiv. Das bestimmt sowohl den Grad der Elitenkonvergenz, als auch die Re- Zusammenbruch der alten Ordnung 36 aktion der Öffentlichkeit; d.h. in Folge der fiskalischen Probleme kommt es zur Legitimitätskrise. Andererseits bestimmen solche, die Legitimität der Herrschenden in Frage stellenden Krisen, die oft mit dem Kontrollverlust über die Mittel der Gewalt einhergehen, auch die Entstehung von ethnischer Identifikation und Nationalismus. Desintegration wird neben Systemänderung zu einer naheliegenden Option für diejenigen, die die Kosten der wahrgenommenen Ineffektivität zu tragen haben. In der Tat stand es in den späten 80er Jahren um die geopolitischen Faktoren der SU schlecht: Durch das Wettrüsten geriet sie in ihrem Zugriff auf Ressourcen gegenüber ihrem politischen Gegner USA ins Hintertreffen. Die übermäßige Ausdehnung des Staatsgebietes trug zur Beschleunigung der Wirtschaftskrise bei. Darüber hinaus war die SU als Binnenland an vielen weit voneinander entfernten Grenzen militärisch aktiv, was die wirtschaftlichen Kosten des Truppenerhalts in astronomische Dimensionen wachsen ließ. Es erscheint plausibel, daß unter diesen Bedingungen der wirtschaftlichen Schwächung innenpolitische Konflikte in der SU zunahmen und damit zum Zusammenbruch beitrugen. Nach der geopolitischen Theorie wird der Ausgang der Krise aber keineswegs der Gestaltung politischer Akteure zugeschrieben. Selbst das Auftreten zentraler Akteure wie Gorbatschow wird als Ergebnis struktureller Entwicklungen gesehen. Gorbatschow ist lediglich als opportunistische Figur zu verstehen, die nicht etwa aktiv auf den Transformationsverlauf einwirken kann, sondern sich vielmehr den geopolitischen Realitäten anpaßt (vgl. Collins / Waller 1993: 307). Die geopolitische Theorie konnte bereits in den 80er Jahren mit ihrem Modell den Zusammenbruch der SU vorhersagen (vgl. Collins 1980; 1986). Das macht die Wirkungsmodelle der geopolitischen Theorie aber noch nicht zu einem Paradigma für die Transformation oder auch nur für den Zusammenbruch von Staaten. Es bleibt nämlich zweifelhaft, ob die strukturellen Variablen mit den geopolitischen Dimensionen ausgeschöpft sind. Wichtige Probleme sind in dieser Theorie unberücksichtigt: Die SU war nicht nur durch die außenpolitische Konfliktkonstellation unter Druck geraten, sondern auch stark von Korruption betroffen. Diese weitere Variable hatte durchaus nachhaltigen Einfluß auf die Legitimität des Regimes, wenngleich sie nicht notwendigerweise abhängige Variable geopolitischer Dimensionen war. China hat das Problem der Korruption vergleichsweise gut in den Griff bekommen. Die SU nicht. Hieraus erwächst Erklärungsbedarf, der auf die Prozesse innerhalb der Elitenfraktionen verweist. Unterschiedliche Institutionen, Politikstile und Entscheidungsstrategien scheinen entgegen den Annahmen der geopolitischen Theorie zur Verfügung zu stehen. Das verdeutlicht sich auch an der engen Auslegung des Legitimitätsbegriffs von Weber. Machtprestige war nur eine Legitimitätsquelle neben anderen, auf die sich die Machthaber beriefen (vgl. Holmes 1993). Zusammenbruch der alten Ordnung 37 Indirekt deutet sich in der geopolitischen Analyse an, daß die internationale Herausforderung eine wirtschaftliche Modernisierung fordert und somit die Beziehung zwischen Beherrschten und Herrschern sowie die Beziehungen innerhalb der Eliten ändert. Den Eliten und der Fraktionsbildung in ihren Reihen obliegt es, auf die internationale Herausforderung mit Marktreformen oder verstärkter repressiver Ausbeutung zu reagieren. Liberalisierende Marktreformen, wie sie in den 80er Jahren in den osteuropäischen Staaten zu beobachten waren, werden im Zuge von Institutionenänderungen implementiert. Die Analyse des Zusammenhangs von Interstate-Competition und institutionellem Wechsel, der u.a. über die Unterminierung des Repressionswillens in der Elite die Transformation einleiten kann, geht über einen einfachen geopolitischen Makrodeterminismus hinaus. Deshalb müssen die externen geopolitischen Mechanismen durch den Verweis auf interne Spezifika ergänzt werden. Das geschieht, wenn die institutionell vermittelte Beziehung von externen Variablen zu internen Größen thematisiert wird. Weede (1992) unternimmt einen solchen Schritt: Ausgangspunkt für sein Wirkungsmodell bildet der Umstand, daß die Nationalstaaten sich dem internationalen Wettbewerb um effiziente Ressourcennutzung nicht entziehen können. Der Bevölkerung werden Opfer zur Aufrechterhaltung der äußern Sicherheit abverlangt. Als Gegenleistung muß die Regierung Zugeständnisse an die Bürger machen. Diese erfolgen meist in Form von Eigentumsrechten. Die somit anfallenden Kosten bzw. die Abtretung von Kontroll- und Verfügungsrechten bedeuten eine Limitierung der Macht der Regierung. Institutionell fixierte Besitz- und Eigentumsrechte unterscheiden sich wesentlich in ihrer Effizienz. Damit ist die Ressourcennutzung keine fixe Größe, wie es die geopolitische Theorie suggeriert. Staaten mit ineffizienteren Besitz- und Eigentumsrechten sind im Kontext des Interstate-Conflicts effizienteren Nachbarn unterlegen. Es muß die Änderung der Besitz- und Eigentumsrechte also ein instituioneller Wandel erwogen werden, um die nationale Identität im internationalen Macht- und Prestigewettbewerb zu behaupten. Der Druck auf die Staatsfinanzen durch die geopolitische Belastung droht ansonsten einen Schwellenwert zu überschreiten, an dem sich der externe Druck in einer Revolution entlädt. Dieser Hinweis auf institutionelle Änderungen als interne Wirkung des externen Drucks rückt Zusammenhänge in den Vordergrund, die der Komplexität des Transformationsprozesses entsprechen. Allerdings findet mit der Beibehaltung des Konflikts als primäre Erklärungsdimension eine systematische Einschränkung der Analyse statt. Wandel kann nämlich auch als ein Ergebnis von Konvergenzen verstanden werden, die im Rahmen des Konfliktpotentials des „modern world systems“ entstehen und ihre eigene Dynamik entwickeln. Zusammenbruch der alten Ordnung 38 Eine militärische Konfliktsituation kann in einen wirtschaftlichen Wettbewerb münden, der die Grundlage für Konvergenzen der konkurrierenden Systeme bildet. Dieses Argument schließt an die geopolitische Theorie an und bildet eine mit ihr kompatible Ergänzung, wenn der Zusammenhang von Konflikt und Konvergenz offengelegt wird. Ein solcher Zusammenhang wird von Janos wie folgt erklärt (1991): Charismatische Führung kann der Bevölkerung hohe Opfer abverlangen. Deshalb lassen sich Erschöpfung und Desintegration hinausgezögern. Zustimmung oder sogar Unterwerfung unter Führer und Sache werden erreicht. Bezogen auf die Sowjetunion ergibt sich folgendes Bild: Die bolschewistische, kommunistisch-ideologische Revolution gab der Sache und ihren Führern das Charisma der Erlösung von den Bürden zaristischer Herrschaft. Mit der Zeit wird der Zauber der Erlösung von der Routine eingeholt, die Erlösung wird rationalisiert. Subversive Elemente und die drohende Palastrevolution werden mit kontinuierlichem Terror abgewehrt. Stalins exzessive „Säuberungsaktionen“ sind Beispiel für eine derartige Reaktion. Der Tyrann konnte mit diesen Mitteln von der Bevölkerung hohe Opfer für die Aufrechterhaltung des Militärapparates erzwingen. Militarisierung ist aber nur eine der Möglichkeiten, auf die Effekte der globalen wirtschaftlichen Entwicklung zu reagieren. Dies verdeutlicht Janos (1991) mit Spencers Militanz- und Industrialismusmodell: Entweder wird im internationalen Wettbewerb die Option der externen Aktivität gewählt, eine Orientierung, wie sie der Ansatz der geopolitischen Theorie thematisiert. Oder es wird die Möglichkeit der internen Aktivität, d.h. zunehmender Ausbau der Industrie, gewählt. (Auch hier wird deutlich, daß der Ressourcenzugriff nicht - wie in der geopolitischen Theorie - als fixe Größe behandelt werden kann.) Mit Gorbatschow setzte sich die zweite Option durch: Die konfliktinduzierende Idee des Klassenkampfes wird den wirtschaftlichen Ideen des Wettbewerbs untergeordnet oder gänzlich aufgegeben. Der Wandel erfolgt in zwei Schritten. Er beginnt mit der Rationalisierung der Erlösung und dramatisiert sich unter den externen Konditionen des „modern world systems“ mit der Transformation der Militanz zu einer fatalen Form der Industrialisierung. Die geopolitische Theorie behandelt bedeutsame externe Variablen, über die ein Regimewandel angestoßen wird. Allerdings vernachlässigt sie andere Variablen, die ebenso zu Wandlungsprozessen führen können – wie zum Beispiel Korruption – und zur Klärung von länderspezifischen Unterschieden unerläßlich sind. Damit eng verbunden ist eine weitere Einschränkung des Erklärungsbereiches der geopolitischen Theorie. Sie ergibt sich daraus, daß die Theorie nur die Entwicklung der SU thematisiert. Die für die SU geltenden Konfliktlinien versagen bei der Anwendung auf die anderen osteuropäischen Staaten. Für die Transformationen in diesen Staaten spielten vielmehr dem Konfliktpotential entgegengesetzte Variablen, die zu Konvergenzen zwischen Ost und West führten, eine primäre Rolle. Zusammenbruch der alten Ordnung 39 Daher läßt sich mit der Ergänzung der Wirkungsmodelle um interne Variablen der Identitätsverlust und Wandel des Systems in stabilen, durch Entspannung gekennzeichneten Zeiten besser verstehen als mit dem konflikttheoretischen Ansatz der geopolitischen Theorie4. Faktisch hat sich ja die frühere Freund-Feind-Logik extern in der Idee des gemeinsamen europäischen Hauses und intern in Perestroika und Glasnost aufgelöst. Die zunehmende Konvergenz der Systeme manifestierte sich in der intensiveren wirtschaftlichen Kooperation mit dem Westen. Aus der wirtschaftlichen Entwicklung entstanden auch Ansprüche an eine politische bzw. demokratische Umstrukturierung. Auf diesem Wege konnten sich zentrifugale, d.h. desintegrierende, Kräfte legitimieren, aus denen eine bedrohliche Situation für die Regierungsstabilität resultierte. Die in Anlehnung an die geopolitische Theorie formulierten Argumente (1. der durch eine Konfliktsituation hervorgerufenen Notwendigkeit institutioneller Änderungen <vgl. Weede 1992> und 2. der zu Konvergenzen führenden Legitimationsproblematik im geopolitischen Interstate-Conflict <vgl. Janos 1991>) werden von den Modernisierungstheorien aufgegriffen. Interne Variablen wie die institutionelle Änderung in Richtung zunehmender Demokratisierung und die Neudefinition der Legitimität über die Leistungen im wirtschaftlichen Wettbewerb verweisen auf die Annäherung der unterschiedlichen Systeme. Die Konvergenzen führten in kommunistischen Systemen zwangsläufig zu inneren Spannungen. Diesem Thema wird von den Modernisierungs- und Konvergenztheorien ein wichtiger Platz im Mosaik der Erklärungsbausteine zugewiesen. Konvergenzen, beispielsweise zwischen der DDR und der BRD, lassen auch andere externe Variablen, die nicht aus militärischen Krisen- oder Konfliktsituationen erwachsen, vermuten. Darüber hinaus verlangen interne Variablen - wie die Problemverarbeitungskapazität und Selbstbeobachtungsfähigkeit der Regime - nach einer differenzierteren Untersuchung der Legitimitätsproblematik und der institutionellen Besonderheiten in den einzelnen osteuropäischen Staaten. In diesem Zusammenhang zwischen externen und internen Variablen liegt der „natürliche“ Anschlußpunkt modernisierungstheoretischer Argumentation an die geopolitische Theorie. 4 Es lassen sich leicht konkrete Prozesse in der Geschichte der historischen Voraussetzungen der Transformation finden, die Janos‘ zweistufigem Modell des Wandels widersprechen (vgl. Di Palma 1991). Beispielsweise kann Janos' „devolutionist interpretation“ nicht den Übergang von der relativ ruhigen und stabilen Breshnew-Ära zu der folgenden Ära der Krisen erklären. Zusammenbruch der alten Ordnung 40 1.3 Modernisierungsdefizite Wenn strukturtheoretische Analysen des Transformationsprozesses auf Spannungen, Defizite und Differenzierungsmängel der osteuropäischen Systeme verweisen, dann nutzen sie das Vokabular der Modernisierungstheorie. Damit lehnen sie sich an ein von Parsons (1972) entwickeltes theoretisches Gerüst, das den historischen Entwicklungen von Gesellschaften eine universale und evolutionäre Logik unterstellt. Über die Modernisierungstheorie Parsons‘ wurde in den 60er und 70er Jahren eine breite Kritik und Auseinandersetzung geführt (vgl. Alexander 1993; Baláz / Bobach 1995; Müller 1991; Wehler 1975; Zapf 1993), die einerseits Parsons selbst zu Korrekturen veranlaßte (vgl. 1969a, 1969b) und andererseits zu einer Diversifizierung der modernisierungstheoretischen Ansätze führte (Alexander 1993). Insofern bleibt es oft unklar, auf welche Entwicklungsmechanismen sich die Autoren berufen, wenn sie sich des modernisierungstheoretischen Vokabulars bedienen. Aus diesem Grunde sollen hier einige theoretische Vorbemerkungen, quasi als Ordnungsschema für die Vorstellung der modernisierungstheoretisch-strukturellen Argumente, vorangestellt werden. Exkurs: Modernisierungstheorien Ausgangsbasis des Modernisierungskonzepts von Parsons bildet die Idee, daß sich ein universales Entwicklungsmuster für Gesellschaften aufgrund „evolutionärer Wandlungsprozesse“ durchsetzt (Parsons 1969b, 1975): Geraten Gesellschaften in den Einfluß der Weltmärkte, westlicher Kultur oder anderer Variablen im internationalen Kontext5, dann kommt es zu den internen Prozessen der Standardhebung einerseits und Differenzierung andererseits. Standardhebung meint, daß die aus der Differenzierung hervorgegangenen neuen Einheiten über ein erweitertes Anpassungsvermögen verfügen. Differenzierung führt somit zu einer Weiterentwicklung, mit der auf ein breiteres Spektrum von Anforderungen flexibler reagiert werden kann. Standardhebung bedeutet deshalb immer auch zunehmende Komplexität der Strukturen, was eine Integrationsproblematik mit sich bringt. Die neuen Einheiten müssen in den normativen Rahmen der gesellschaftlichen Einheit einbezogen werden. Es bedarf einer Werteverallgemeinerung auf einer höheren Allgemeinheitsstufe, um die soziale Stabilität der neuen komplexen Struktur zu sichern. In dieser Logik der Modernisierung hat sich besonders seit der bürgerlichen, französischen Revolution und der industriellen Entwicklung in England der moderne Gesellschaftstyp herausgebildet, der mit den Systemen Westeuropas, Japans 5 Hier liegt die Anschlußmöglichkeit nach „oben“, d.h. an strukturtheoretische Ansätze, die die InterstateBeziehungen als Ursache der Transformation untersuchen – wie die Geopolitische Theorie. Zusammenbruch der alten Ordnung 41 und besonders der USA, die sich an die Spitze des modernen Systems gesetzt haben (Parsons 1972: 156), identifiziert wird. Der Logik der Differenzierung der Gesellschaft folgt eine Binnendifferenzierung in Subsysteme. Einen Teil dieses allgemeinen Trends in der frühen Phase der Modernisierung bildete die industrielle Revolution, in der sich das Subsystem der Wirtschaft herausbildete. Mit zunehmender Produktivität setzten sich arbeitsteilige Strukturen durch, die einen funktionalen Bedarf an integrativen Strukturen bewirkten (Parsons 1972). Daher wird die industrielle Revolution von einer demokratischen Revolution begleitet. Über letztere definierte sich eine neue Art der Mitgliedschaft in der gesellschaftlichen Gemeinschaft, die Wohlstandsunterschiede politisch z.T. rechtfertigen kann und somit integrativ wirkt; Ungleichheiten werden durch die Gleichheitskomponenten des allgemeinen Wahlrechts und der Abschaffung der Gewichtung von Stimmen ausgeglichen (Parsons 1972). Zentrales Merkmal jeder Industriegesellschaft ist ein universalistisches Rechtssystem, das die Differenzierung der gesellschaftlichen Gemeinschaft von der Regierung und die gleichzeitige legitime Kontrolle über sie garantiert. In einer dritten Modernisierungsrevolution bewegen sich das kulturelle System und die Normen der gesellschaftlichen Gemeinschaft auseinander. Diese Entwicklung setzt parallel zu den Entwicklungen der industriellen und demokratischen Revolution ein und verbindet deren Themen (Parsons 1972): Die Legitimation der gesellschaftlichen Ordnung säkularisiert sich mit einer neuen Kultur, deren Wertestandards sich über die allgemeine Bildungsexpansion durch setzen. Mit der Institutionalisierung einer neuen Kultur - bspw. der intellektuellen Wissenschaftskultur - wird eine Gemeinschaft definiert, die sich nicht auf Religion, sondern auf allgemeine säkulare Werte beruft. Sie erfüllen eine Integrationsfunktion, indem sie die Kluft zwischen den Zielen der Chancengleichheit (als Thema der industriellen Revolution) und Gleichheit der Bürger (als Thema der demokratischen Revolution) und die tatsächlichen Ungleichheiten überbrücken. Die soziale Schichtung ist auf dieser Wertgrundlage legitim, weil sie auf dem „...funktionalen Bedürfnis der Kompetenz...“ (Parsons 1972: 153) beruht. Als Ergebnis der Modernisierung entsteht ein funktional ausdifferenziertes Gesellschaftssystem mit den vier Teilbereichen der Kultur, der Politik, der Ökonomie und der gesellschaftlichen Gemeinschaft. Die besondere Herausforderung für die gesellschaftlichen Strukturen liegt darin, intergrative Institutionen zu stellen, mit denen sich die subsystemischen Leistungen aufeinander abstimmen lassen (vgl. Müller 1991; Parsons 1972). Es läßt sich leicht erkennen, daß Parsons‘ Konzept der universalgesellschaftlichen Modernisierungsentwicklung Kategorien für eine Diagnose der versäumten Differenzierung bzw. Modernisierung in den kommunistischen Gesellschaften liefert: Über die Identifi- Zusammenbruch der alten Ordnung 42 kation struktureller Hindernisse der gesellschaftlichen Differenzierung, aber auch durch den Nachweis mangelnder Integration kann versucht werden, Spannungen und Widersprüche aufzuzeigen, die zur Desintegration der kommunistischen Systeme führten. Modernisierungsdefizite erscheinen offensichtlich; die Ökonomie orientierte sich nicht primär an den Maßstäben der Effizienz, es gab keine Gewaltenteilung und die soziale Ordnung in Form von Gesetzgebung und Regierungsgewalt wurde von einer quasi-religiösen Ideologie geleitet. Und die genauere Betrachtung der Beziehung der Subsysteme zueinander zeigt, warum die Subsysteme ihre funktionalen Anforderungen nicht erfüllen konnten6. Das Subsystem der Ökonomie wurde in seiner Funktion der Anpassung (Adaptation) von den Interventionen des politischen Systems behindert; in den mehr oder weniger starken Ausprägungen einer Befehlswirtschaft in den osteuropäischen Staaten vor 1989 wurde die Allokation der Ressourcen politisch-administrativ gesteuert. In der Beziehung der gesellschaftlichen Gemeinschaft zu dem kulturellen System einerseits und dem politischen System andererseits (Parsons 1980: 284) zeigt sich, warum auch diese drei Teilbereiche ihre Aufgabe nicht erfüllen konnten. Das politische System konnte die formulierten Ziele nicht erreichen (Goal Attainment) und Entscheidungen nicht durchsetzen, weil es nicht in der Lage war, Kapazitäten für effektives kollektives Handeln zu mobilisieren. Einer der Gründe war, daß die im kulturellen System repräsentierten Wertmuster (Latent Pattern Maintenance) keine adäquate Legitimation der Macht aufrechterhalten konnten. Der Konsens für Kollektivhandlungen schwand, weil die Verfahrensregeln für die Autorisierung des Kollektivhandelns keine Unterstützung bei der Bevölkerung fanden – die Bindung des Interesses der Bevölkerung an die kollektiven Ziele war einem nicht aufzuhaltenden Erosionsprozeß unterworfen. Die gemeinsamen Wertebindungen des gesellschaftlichen Gemeinwesens zerfielen, weil u.a. die öffentlich proklamierten Werte nicht den moralischen Werten entsprachen, die durch Internalisierung in das Persönlichkeitssystem verankert wurden. Solidarität integrierte (Integration) nur noch die Gemeinschaften in den gesellschaftlichen Nischen (Freundeskreis und Familie), während sich das Verhältnis zur öffentlichen Gesellschaft rationalisierte – obwohl dem System die Unterstützung entzogen wurde und Verantwortung abgeschoben wurde, griff man gerne auf seine materiellen Vorteile (den Institutionen der sozialen Sicherheit) zurück. Das Grundproblem der osteuropäischen Systeme bildete in dieser Betrachtung die ungenügende Differenzierung und eine damit verbundene behindernde Interdependenz der gesellschaftlichen Subsysteme. Hierin liegt eine der Ursachen der mangelnden Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und Selbstbewertung (vgl. Joas / Kohli 1993; Offe 1994). 6 Mit Parsons‘ Modell läßt sich jedes Handlungssystem (also auch Gesellschaften als soziale Systeme) mit einem allgemeinen Paradigma – dem so genannten AGIL-Schema – auf ihre Funktionserfüllung hin analysieren. Die Subsysteme können danach befragt werden, inwiefern sie 1. die allgemeine Anpassung an die Bedingungen der Umwelt (Adaptation), 2. die Orientierung an der Erreichung von Zielen (Goal Attainment), eine interne Integration des Systems (Integration) und die Erhaltung der Steuerungs- und Kontrollanlagen (Latent Pattern Maintenance) leisten (Parsons 1976: 124). Zusammenbruch der alten Ordnung 43 Anders als in den westlichen Industrienationen bekamen die osteuropäischen Systeme kein Feedback über Märkte bzw. Preise und intermediäre Institutionen der Interessenvermittlung. Ihnen fehlte somit die Grundlage für eine flexible Adaption. Die aktuellen modernisierungstheoretischen Ansätze beziehen sich im wesentlichen auf das Instrumentarium und die Kategorien Parsons‘. In der Argumentation der Autoren findet man daher selten grundlegend neue Ideen. Interessant sind die weitergehenden Analysen und Auslegungen dennoch, weil sie eine konkrete Identifikation der relevanten Variablen und Widersprüche an dem eingetretenen Fall des osteuropäischen Wandels versuchen. Dennoch ist kritisch darauf hinzuweisen, daß mit der einfachen Übertragung des klassischen Modernisierungskonzepts nach Parsons - bzw. mit der unkritischen Anwendung des modernisierungstheoretischen Vokabulars - Korrekturen unberücksichtigt bleiben, die seit den 60er Jahren erfolgt waren. In dieser Zeit hat vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Krisen, sowohl in den entwickelten als auch in den weniger entwickelten Gesellschaften, eine modernisierungskritische Diskussion eingesetzt (vgl. Alexander 1993), die das Konzept der Modernisierung sowohl methodisch als auch theoretisch dekonstruierte (vgl. Wehler 1975). Gesellschaftliche Krisen waren eindeutig eine Folge und Ausprägung der Modernisierung. Fehlgeschlagene Entwicklungsprojekte und das Ausbeutungsargument verwiesen auf die negativen Seiten des amerikanischen Modells. Es zeigte sich, daß nicht nur Fortschritt, sondern auch Regression zur Modernisierung gehörten. Zudem konkurrierten das sowjetische, chinesische und kubanische Modell mit den westlich-kapitalistischen Auslegungen der Modenisierung (Zapf 1991: 33). Mit diesen Widersprüchen wurde klar, daß es sich bei dem Modernisierungskonzept um eine normative Theorie handelte. Ihre Funktion lag nach Alexander darin, den Menschen nahezulegen, wie sie leben sollten (1993). Sie erklärte also weniger als daß sie Motivationen lieferte, indem sie mit der zunehmenden sozialen Differenzierung eine Werteverwirklichung in Aussicht stellte. Besonders die Orientierung an den USA als Vorreiter der Modernisierung (vgl. Parsons 1972) provozierte Ende der 60er Jahre eine Umkehrung der Modernisierungssemantik: „They inverted modernization theory's binary code, viewing american rationality as instrumental rather than moral and expressive, big science as technocratic rather than inventive. They saw conformity rather than independence; power elites rather than democracy; and deception and disappointment rather than authenticity, responsibility, and romance.“ (Alexander 1993: 174). Mit der inhaltlichen Umkehrung, wie sie bei Alexander zum Ausdruck kommt, gerinnt das Konzept der Modernisierung zu einer: „...Formel, die den zweifelhaften Vorzug besitzt, auf jeden gesellschaftlichen Vorgang zuzutreffen und deshalb keinen erklärt.“ (Müller 1991). Zusammenbruch der alten Ordnung 44 Wenn sich heute beobachten läßt, daß die Verwendung des Vokabulars der klassischen Modernisierungstheorie eine Renaissance erfährt, bedeutet das kein Wiederaufleben derselben universalen Logik, wie sie Parsons7 noch vorschwebte. Das Konzept der Modernisierung liefert in den gegenwärtigen Analysen primär eine semantische Heuristik. Hierin liegt seine besondere Leistung. Die identifizierten Sphären in der Gesellschaft Politik, Ökonomie, Kultur und gesellschaftliche Gemeinschaft -, der Grad ihrer Differenziertheit und das Ausmaß von Integrationsleistungen gelten als Bezugsrahmen für die Beschreibung widersprüchlicher Entwicklungen und bilden Ausgangspunkte für den Nachweis struktureller Defizite8. Mit diesen Bezügen lassen sich wichtige unabhängige Variablen für die Destabilisierung der osteuropäischen Gesellschaften auffinden. In den folgenden drei Abschnitten werden Ansätze vorgestellt, welche die widersprüchlichen Entwicklungen und Spannungen in den osteuropäischen Gesellschaftsstrukturen entlang modernisierungstheoretischer Kategorien aufzeigen. Strukturelle Defizite des kommunistischen Systems gelten als verantwortlich für eine verhinderte Differenzierung, für eine Entwicklung, die sich gegen die universale Logik der Modernisierung stemmte. Hierin sehen die Autoren Referenzpunkte für die Analyse der Ausgangsbedingungen des strukturellen Wandels in den osteuropäischen Staaten. Im ersten Abschnitt wird die Diskussion um die mangelnde Abgrenzung der politischen Sphäre von der ökonomischen Sphäre thematisiert. Diese Diskussion löst sich nicht etwa in einem neoliberalen Appell für eine von staatlichen Eingriffen unberührte Ökonomie auf. Vielmehr zeigt sie, daß Rationalitätsverluste nicht nur aus der mangelnden Entscheidungsfreiheit einzelner ökonomischer Akteure resultierten, sondern sich mindestens ebenso aus der mangelnden Institutionalisierung mediärerer Interessenvermittlung ergaben. Dieses strukturelle Hindernis verhinderte die für eine planmäßige Steuerung notwendige Selbstbeobachtung und protegierte ein verfälschtes Feedback. Im zweiten Abschnitt werden Ansätze vorgestellt, die für die demokratischen Entwicklungen im kommunistischen System Defizite identifizieren; eine gesteigerte Anpassungskapazität der sozialen Einheiten „gesellschaftliche Gemeinschaft“ und „Politik“ konnte sich nicht entwickeln. Entgegen der Struktur und Entwicklung kommunistischer Systeme ist eine konsequente Entwicklung der demokratischen Revolution gekennzeichnet von der Entstehung von Parlamenten und Parteiensystemen und der Herausbildung eines liberalen Rechts mit unabhängiger Rechtsprechung, die Vertragsfreiheit und 7 Parsons selbst reformuliert seine Modernisierungstheorie in einer „neo-evolutionären“ Theorie (1969b). In dieser Weise legt auch Zapf das Konzept des evolutionären Determinismus bei Parsons aus (1996: 172f): Hinter dem Konzept verberge sich ein Modell evolutionärer Universalien, das nur ex post gelte, und mit dem sich komparative Analysen bezüglich der Anpassungsfähigkeit verschiedener Institutionen beurteilen ließen. Mit dem Institutionenvergleich könne man Über- bzw. Unterlegenheit einiger Gesellschaften beurteilen. 8 Zusammenbruch der alten Ordnung 45 Privateigentum garantieren (vgl. Müller 1991). Mit der demokratischen Revolution entsteht in dem Modell Parsons' eine Zivilgesellschaft, in der sich die Sphäre des Politischen durch ein Legitimationskonzept auszeichnet, dessen Grundlage die klassischen bürgerlichen Freiheitsrechte und die modernen Rechte der politischen Meinungs- und Interessenartikulation bilden (vgl. Baláz / Bobach 1995). In den kommunistischen Regimen Osteuropas gab es nur schwach entwickelte Ansätze einer Zivilgesellschaft. Daher bildet für die Analyse der politischen Modernisierungsdefizite als Ausgangsbedingungen des Zusammenbruchs der Regime das Konzept der Zivilgesellschaft („Civil Society“) einen zentralen Aspekt. Je nach Ausprägung der zivilgesellschaftlichen Ansätze lassen sich länderspezifische Entwicklungsunterschiede aufzeigen. Der dritte Abschnitt befaßt sich mit den Ansätzen, die an die von Parsons für die Bildungsrevolution identifizierten Differenzierungsprozesse vom kulturellen System und den Normen der gesellschaftlichen Gemeinschaft anknüpfen. Die marxistisch-leninistische Ideologie wurde als quasireligiöse Ideologie erkannt, auf deren Grundlage ein rationalisiertes Verhältnis von Kultur und Gesellschaft unterdrückt wurde. Vor dem Hintergrund der offensichtlich zunehmenden Ungleichheit bezüglich der materiellen und nicht-materiellen Privilegien wie Wohlstand und Macht in den kommunistischen Gesellschaften ergab sich ein Widerspruch zu den Werten der egalitären Ideologie. Eine Werteverallgemeinerung, die die „motivationale Verpflichtung des Individuum“ (vgl. Parsons 1972) zum Erhalt der Gesellschaft aufrechterhalten konnte, wurde durch die ausschließlich geltende Ideologie unterdrückt. Den Mitgliedern der Gesellschaft konnten keine hinreichenden Befriedigungen und Belohnungen geboten werden, so daß die Gesellschaft als Gegenleistung auf Leistungen ihrer Mitglieder hätte zurückgreifen können9. Die Trennung dieser drei Problembereiche ist analytisch und folgt den Kategorien des Modernisierungsprozesses, wie er von Parsons beschrieben wurde. Die Entwicklungen in den Bereichen sind theoretisch10 wie empirisch eng miteinander verwoben, was durch die analytische Trennung nicht vernachlässigt wird. Die Unterteilung ist hilfreich, weil sie der Konkretisierung des mehrdimensionalen und in der Literatur oft unbestimmten Modernisierungskonzepts bzw. -begriffs dient. Sie verdeutlicht außerdem, wo der Schwerpunkt der Argumentation bzw. der Fokus der Untersuchung liegt11. 9 Vgl. Parsons zu Persönlichkeit als Umwelt der Gesellschaft (1976: 131f). Vgl. beispielsweise für die Verbindung von gesellschaftlichem Gemeinwesen mit dem kulturellen System und dem politischen System Parsons 1976 (284f). 11 Joas und Kohli ordnen die Erklärungen des Transformationsprozesses in einer allgemeineren Typologie (1993). Sie orientieren sich dabei an Dimensionen, die sich z.T. in der hier vorgeschlagenen Kategorisierung der modernisierungstheoretischen Ansätze wiederfinden. Damit bestätigt sich die Aussage, daß sich die Untersuchungen in der Regel nur auf Teilbereiche des komplexen, vieldimensionalen strukturellen Entwicklungsprozeß konzentrieren. 10 Zusammenbruch der alten Ordnung 46 Ökonomische Defizite Strukturtheoretische Ansätze, die sich mit dem Verhältnis von Staat und Wirtschaft bzw. Gesellschaft und Wirtschaft auseinandersetzen, versuchen aufzuzeigen, wie die Folgen der Wirtschaftslenkung einerseits und die Auswirkungen der Arbeitsverhältnisse andererseits zur Destabilisierung der osteuropäischen Systeme führten. Bezogen auf die Planwirtschaften ist das konservativ-liberale Argument für einen impliziten Strukturdefekt das sogenannte „Planungsparadox“ (vgl. Luhmann 1984, Ganßmann 1993): „Die uns interessierende Frage lautet, ob ein soziales System sich selbst planen kann und mit welchen Problemen man rechnen muß, wenn dies versucht wird. [...] Jede Planung erzeugt Betroffene – sei es, daß sie benachteiligt werden, sei es, daß nicht all ihre Wünsche erfüllt werden. Die Betroffenen werden wissen wollen und sie werden freie Kapazitäten der Kommunikation nutzen wollen, um zu erfahren und möglichst zu ändern, was geplant wird. Das System reagiert im Falle von Planung deshalb nicht nur auf die erreichten Zustände, auf Erfolge und Mißerfolge der Planung, sondern auch auf die Planung selbst. Es erzeugt, wenn es plant, Vollzug und Widerstand zugleich.“ (Luhmann 1984: 635). Und weiter unten heißt es bei Luhmann: „Planung ist zunächst eine bestimmte Art der Anfertigung einer Selbstbeschreibung des Systems. Im Falle von Planung wird diese Selbstbeschreibung an der Zukunft orientiert. Gerade das eröffnet immer auch die Möglichkeit, sich anders zu verhalten, als eine planmäßige Bestimmung es vorsieht, nämlich etwas Vorgesehenes, mit dem viele rech- Sie heben allerdings hervor, daß das Konzept von Habermas eine Ausnahme bildet. Seine Charakterisierung der Transformation Osteuropas als „nachholende Revolution“ wird von ihnen und anderen Autoren als modernisierungstheoretische Beschreibung des gesamten Entwicklungsprozesses interpretiert (vgl. Balasz / Bobach 1995; Joas / Kohli 1993; Zapf 1996). Diese Rezeption Habermas ist aus zwei Gründen irreführend: 1. beziehen sich die Autoren bei ihrer Rezeption auf den Artikel „Die nachholende Revolution“ (Habermas 1990: 179f), dessen primärer Gegenstand nicht die Entwicklungen in den osteuropäischen Ländern ist, sondern die Bedeutung des Zusammenbruchs des Sozialismus für „...das theoretische Erbe der westeuropäischen Linken.“ (Habermas 1990: 179f). Die Zuordnung des Habermasschen Konzepts der nachholenden Modernisierung zu den modernisierungstheoretischen Änsätzen ist somit nicht plausibel. Das sich in den Entwicklungen der Transformation ausdrückende „Ausgreifen der Moderne“ scheint eher semantisches Ergebnis eines systemtheoretischen Zusammenhanges zu sein, der sich auf die gesellschaftliche Steuerung bezieht: Habermas argumentiert, daß der Versuch, durch administrative Planung den systemischen Eigensinn einer ausdifferenzierten Marktökonomie zu steuern, das Differenzierungsniveau moderner Gesellschaften aufs Spiel setze (1990: 190). Somit entspricht 2. die analytische Ansatzhöhe der von Habermas angedeuteten Entwicklung nicht der Ansatzhöhe modernisierungstheoretischer Untersuchungen (auf Länder- und Jahresebene - Zapf 1996). Habermas argumentiert auf einer höheren Abstraktionsebene. Er liefert keine modernisierungstheoretischen Begründungen und Mechanismen der nationalen Entwicklungen. Deshalb wird hier von der scheinbar selbstverständlichen Einordnung des „Habermasschen Transformationsansatzes“ (Balasz / Bobach 1995; Zapf 1996) in die Gruppe der modernisierungstheoretischen Transformationsanalysen abgesehen. Die alleinige Verwendung des Begriffs der Moderne sagt noch nichts aus über die Analyseebene. Zusammenbruch der alten Ordnung 47 nen, gerade deshalb nicht zu wollen, es zu unterlaufen, zu boykottieren oder auch nur Profit daraus zu ziehen, daß man sich untypisch verhält.“ (1984: 637). Das Paradox steht für den unterstellten Widerspruch zwischen der Art der Entscheidungsfindung (dezentral vs. zentral) und der Wirtschaftslenkung bzw. dem wirtschaftlichen Plan: Zentrale Planung und dezentrales Entscheidungsinteresse schließen einander aus. Der Widerspruch besteht darin, daß die planenden Eliten komplexe Produktionsund Absatzprozesse auf den unteren Ebenen weder komplett vorhersehen noch gestalten können. Sie müssen ihre Konzepte in einen „trial-and-error-Verfahren“ erproben (Ganßmann 1993), bleiben aber auf eine situationsspezifische Mitgestaltung der unteren Ebenen angewiesen. Bei den dezentralen Entscheidungen entstehen dem Plan entgegengesetzte Interessen. Gibt es nämlich keine Entscheidungsspielräume, dann werden die Planer im ad-hoc-Stil intervenieren müssen. Über Lagerhaltung werden dann – wie in der DDR - die nötigen Reserven für die Elastizität bzw. Intervention bei Deckungslücken geschaffen. Heimlich werden Ressourcenreservoirs angelegt, um die öffentlich vorgeschriebenen Planziele zu erreichen; die unrealistischen Planvorgaben werden so unterlaufen. Dadurch entstehen einerseits Grau- und Schattenzonen in der Ökonomie, und andererseits werden den Planern Informationen über die tatsächliche Wirtschaftsleistung vorenthalten (Ganßmann 1993). Allerdings muß der Mechanismus nicht zu der konservativ-liberalen Schlußfolgerung führen, daß das Planungsparadox nur in einer dezentral organisierten Marktwirtschaft vermieden werden kann. Ganßmann (1993) argumentiert, daß durch den Zusammenbruch der Planwirtschaften nicht die Unmöglichkeit von Planung nachgewiesen ist. Vielmehr zeige der osteuropäische Zusammenbruch, daß eine Planung ohne Demokratie nicht möglich ist. Das Planungs-Paradox mache somit deutlich, daß es den kommunistischen Systemen an Formen der politischen Vermittlung von Interessengegensätzen fehlte. Der Planung müsse mit der demokratischen Abstimmung ein Korrektiv hinzugefügt werden, das die im Plan artikulierten Forderungen der Eliten eingrenzen kann. Mit dieser Argumentation hat Ganßmann das Demokratiedefizit beim Festlegen der wirtschaftlichen Ziele als primäre Ursache für die uneffektive Wirtschaftslenkung identifiziert. Hinzu kommen interne Spannungen in der Struktur der realsozialistischen Arbeitsverhältnisse (Ganßmann 1993; Lötsch 1993): Ein zentrales Merkmal der Arbeitsverhältnisse war die Beschäftigungsgarantie. Mit ihr fiel eine in den marktwirtschaftlich-kapitalistischen Gesellschaften zentrale Variable der Steuerung des Arbeitsverhaltens weg: Mit Entlassung konnte nicht gedroht werden, also verblieben nur der Lohnanreiz und die überstrapazierten und daher oft wirkungslosen politischen und moralischen Ressourcen. Lohnsteigerungen liefen ins Leere, weil die Produktion die Nachfrage nicht bedienen konnte und die Kaufkraft des Geldes nachließ. Damit fiel der Konsum hinter die „Selbstbestimmung der Arbeitsverausgabung“ (Ganßmann 1993) als Dimension der Lebensqualität zurück. Das insbesondere für die Zusammenbruch der alten Ordnung 48 Bevölkerung der DDR ständig präsente Reichtumsgefälle wurde auf die unterschiedliche Systemstruktur zurückgeführt. Dabei wurde vergessen, daß der Wohlstand nicht ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand zu haben ist. Hinzu kam, daß der Entwicklung der Produktivkräfte, die im internationalen Wettbewerb dringend erfolgen mußte, eine bestimmte Werthaltung entgegenstand. Vor dem Hintergrund eines nivellierenden Wertesystems wurde die Arbeiterklasse zwar protegiert, die Attraktivität akademischer Ausbildungen hingegen sank (Lötsch 1993). Die Intelligenz war von Statusverlusten betroffen. Dies führte mit zunehmenden wissenschaftlich-technologischen Entwicklungen zu Innovatonsdefiziten. Es fehlten die intellektuellen Potentiale, mit denen sich die realsozialistischen Systeme den globalen Prozessen der Modernisierung im wirtschaftlichen Bereich hätten stellen können. Dies wog besonders schwer vor dem Hintergrund der mangelhaften internationalen Arbeitsteilung im RGW, der eher damit beschäftigt war, den Mitgliedern kooperative Alleingänge mit dem Westen zu erschweren. Das Scheitern der Ökonomie trug so zur Bereitschaft für einen Systemwechsel bei. Allerdings war es nicht ausschließlich ein Differenzierungsdefizit zwischen den gesellschaftlichen Bereichen Politik und Ökonomie, dem das funktionale Versagen der Ökonomie zugeschrieben werden kann. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Planungs-Paradox zeigt, daß Rationalitätsdefizite in der Steuerung nicht nur durch mangelnde Autonomie wirtschaftlichen Handelns entstehen. Das ökonomisch-politische Strukturdefizit mangelhafter demokratischer Kontrolle ist vielmehr ein Integrationsdefizit bezüglich der Vermittlung und Reflexion divergierender politischer und wirtschaftlicher Interessen. Auch der Hinweis, daß das Interesse der wirtschaftlichen Elite bzw. Intelligenz nicht institutionell artikuliert werden konnte, weist auf ein problematisches Demokratiedefizit in den osteuropäischen Staaten und nicht primär auf eine unvollständige marktinduzierte Modernisierung hin. Politische Defizite Bereits an dem Verhältnis von Ökonomie und Politik zeigt sich, welche Effizienzeinbußen mit Demokratisierungsdefiziten verbunden sein können. Mangelndes Feedback stand der nach Effizienzkriterien erfolgenden Allokation von Ressourcen entgegen. Demokratiedefizite bewirkten darüber hinaus auch Spannungen im Verhältnis von der gesellschaftlichen Gemeinschaft zur Politik. Die wirtschaftliche Entwicklung und der Wettbewerb mit dem Westen führten zu einer allgemeinen Standardhebung – beispielsweise über die Reformen der Eigentumsrechte. Die gesellschaftliche Struktur gewann an Komplexität, die sich u. a. in den zu beobachtenden Wohlstandsunterschieden ausdrückte. Solche Ungleichkomponenten müssen in der Logik der Modernisierung durch Gleichheitskomponenten ausgeglichen werden, soll die Stabilität des Systems gewahrt Zusammenbruch der alten Ordnung 49 bleiben. Parsons (1975) interpretierte mit diesem Mechanismus die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts in industrialisierten Gesellschaften. Für die Stabilitätsanalyse der osteuropäischen Staaten wird allgemeiner nach den Chancen angemessener Formen der Interessenrepräsentation und Partizipation – als möglicher Ausgleich für Ungleichheiten – gefragt. Die Wirkung des Mangels an Institutionen, die eine Interessenvermittlung leisten, auf die Integration der Gesellschaft und die politische Integrationsleistung teilweise vorhandener Ansätze einer Civil Society12 stehen im Zentrum der Erörterungen. Die Defizite im Bereich der Institutionen, die eine Interessenvermittlung und -artikulation bzw. die politische Partizipation hätten ermöglichen können, waren offensichtlich und bildeten strukturelle Hindernisse für die demokratische Entwicklung. Der Mangel stand im Widerspruch zu den emanzipatorischen Ideen des Kommunismus und hatte deshalb gravierende Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die gesellschaftliche Anpassungsfähigkeit. Wie sich dieser Wirkungszusammenhang darstellt, wird von Eisenstadt erörtert (1994): Den Ausgangspunkt für die Demokratisierungsdefizite sieht er in dem Umstand, daß die Planwirtschaft nicht leistete, was versprochen wurde. In der wirtschaftlichen Leistung aber war die versprochene „Heilswirkung“ verankert. Damit mußten sich die Systeme mehr auf die totalitäre Legitimation stützen. Nur die Repressionen bildeten eine Möglichkeit, mit der Leistung der weiterentwickelten westlichen Gesellschaften mitzuhalten. In den grundsätzlichen Voraussetzungen der kommunistischen Regime allerdings – bei den Ideen der Freiheit, Emanzipation und auch politischen Emanzipation – hatte auch die Vorstellung einer Civil Society ihre Wurzeln. Die kommunistischen Regime konnten ihre eigenen Ideen nicht negieren, und die Widersprüche zwischen den partizipatorischen Ideen und der totalitären Komponente ließen sich somit nicht vermeiden. Sie wurden vor dem Hintergrund der modernen Institutionen kommunistischer Gesellschaften - wie der Bildungsexpansion einerseits und den eingeschränkten Möglichkeiten zur demokratischen Partizipation andererseits - offensichtlich. Diese „Mißrepräsentation der Moderne“ führte zu dem Aufbrechen der Kohäsion innerhalb der Eliten. Die Kader wurden - so Eisenstadt - in den kommunistischen Gesellschaften mit zwei unterschiedlichen Orientierungen sozialisiert. Einmal mit einer „Jakobinischen Orientierung“, deren strukturelles Äquivalent in dem totalitären Charakter der Regime bestand, und zum anderen im Namen der Freiheit. Der zweite Aspekt war verbunden mit den Ideen von Partizipation und Demokratie und stand somit im Konflikt mit den herrschenden politischen Verhältnissen. Eine aufbrechende Elitenkohäsion ließ sich insbesondere in Ungarn und in der SU beobachten. In den Staaten, in denen sich die Spannungen der Mo12 Für eine ausführliche und allgemeine Einführung in die Problematik der Zivilgesellschaft vgl. v. Beyme (2000). Zusammenbruch der alten Ordnung 50 derne nicht über Konflikte innerhalb der Eliten vermittelten, konnten sich die Widersprüche auf dem Wege der Mobilisierung der Öffentlichkeit – wie in Polen und der DDR – ausdrücken. Eisenstadt weist allerdings darauf hin, daß der Zusammenbruch kommunistischer Regime einem allgemeineren Kriterium unterzuordnen ist. Das Projekt der Moderne leidet generell an einer potentiellen Brüchigkeit. Auch in den westlichen Gesellschaften gibt es Spannungen zwischen den konkurrierenden Konzeptionen des allgemeinen Willens und der Beziehung dieser Konzeptionen zu der tatsächlichen Repräsentation bestimmter Interessen einzelner Gesellschaftssektoren. Mit der Änderung interner oder internationaler Bedingungen kann es dann zu Protesten kommen, die die Beziehung aggregierter Interessen zu den verfolgten Konzepten des Allgemeinguts thematisieren. Moderne Gesellschaften brauchen also einen Rahmen, in dem die verschiedenen alternativen Konzepte der Realisierung des Allgemeingutes konkurrieren können, ohne die Arbeitsweise des Systems zu gefährden. Diese Anforderung verlangt von modernen Gesellschaften, daß sich die Grenzen des Politischen neu definieren lassen und die Basis der Legitimation transformierbar ist. Genau an diesen Kapazitäten mangelte es den kommunistischen Gesellschaften. Die Selbsttransformationsfähigkeit scheiterte bereits an dem Mangel institutionalisierter Möglichkeiten der Vermittlung alternativer Konzepte. Natürlich gab es auch zaghafte Ansätze der Interessenvermittlung. Nur konnten sie diesen Mangel nicht überwinden. Die kommunistischen Gesellschaften mußten ständig um ihre Stabilität ringen (Pollack 1993). Der Ort defizitärer Interessenvermittlung lag in dem Spannungszentrum der einerseits erfolgten funktionalen Differenzierung im ökonomischen Bereich und der politisch forcierten Homogenisierung andererseits (Pollack 1993). Die Spannung bildet eine charakteristische Zustandsbeschreibung kommunistischer Gesellschaften, die Pollack (1993) auf die bereichsspezifischen Verselbständigungstendenzen und die politischideologische Gleichschaltung, die für die unmoderne Verbindung von Individuum und Gesellschaft stand, zurückführt: Politische Entscheidungen wurden ohne Feedback oder Legitimierungsgrundlage bei der Bevölkerung getroffen. Auf das Feedback meinte man verzichten zu können. Vertraut wurde hingegen auf den Einsatz repressiver Machtmittel. Das mußte allerdings eine sinkende Leistungsbereitschaft der Bevölkerung zur Folge haben. Dieser Charakterzug kommunistischer Gesellschaften ließ die Modernisierungsentwicklung in Verzug geraten. Die sich de facto verselbständigenden teilsystemischen Interessen waren, wie sich auch im Falle der Wirtschaftsplanung zeigte, institutionell nicht abgesichert, und eine Institutionalisierung von Interessenvermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum widersprach der herrschenden Ideologie. Dennoch gab es zumindest Ansätze der Interessenvermittlung: In Polen stand die Gewerkschaftsbewegung Solidarosc für die Kritik am Regime, in Ungarn wiesen die innerparteilichen Reformprozesse auf die Interessenpluralität hin, und in der DDR profilierte sich die evangelische Kirche als Anwalt der Modernisierung. Die Funktionswahr- Zusammenbruch der alten Ordnung 51 nehmung dieser Institutionen war allerdings unbefriedigend, was das Beispiel der evangelischen Kirche in der DDR zeigt. Sie spielte zwar mittelbar für die Transformation in der DDR eine bedeutende Rolle. Trotzdem kann daraus nicht geschlossen werden, daß sie im System der DDR eine integrierende Institution mit der Funktion der Interessenvermittlung darstellte. Die evangelische Kirche in der DDR genoß eine begrenzte Autonomie, mit der sie Anlaufstelle für eine kritische Öffentlichkeit sein konnte (Pollack 1993). In ihrem Rahmen fanden vermittelnde Gespräche statt und sie übernahm mit ihrem Engagement kurzfristig eine gesellschaftsstabilisierende Funktion. Wie wenig die Ausübung dieser Funktion an die Kirche als religiöse Institution gebunden war, zeigte sich nach der Öffnung der österreich-ungarischen Grenze. Mit ihr setzte eine Abwanderung der alternativen Gruppen aus der Kirche ein. Damit kann ex post auf die Funktion der Kirche in der DDR geschlossen werden. In Pollacks Darstellung war die Rolle der Kirche primär eine Rolle als Puffer mit begrenzter Integrationsfunktion und nicht etwa eine integrierende Vermittlung alternativer Konzepte. Die relative Bedeutungslosigkeit der Kirche läßt sich mit einem weiteren, modernisierungskompatiblen Argument begründen (Meuschel 1993): Es bildete sich zwar eine „religiöse Kultur des Widerstandes“ in der DDR. Zur Modernisierung gehörte aber die Entwicklung einer säkularen Civil Society der politischen Verständigung. Nur mit ihr können demokratische Strukturen stabilisiert werden, wenn es in der „modernen“ Politik keine letzten Gründe und absoluten Werte mehr geben soll. Als sich in der DDR mit der Veränderung der außenpolitischen Situation alternative Protestmöglichkeiten boten, wurde der religiöse Kontext verlassen. Die Einbindung einer potentiellen Opposition in der Kirche zögerte die Entwicklung einer Civil Society in der DDR also eher hinaus. Die Kirche konnte das Ausbrechen der inneren Widersprüche nur verzögern. Pollacks und Meuschels Argumente verdeutlichen, daß die Rolle der Kirche als intermediäre Institution nicht überschätzt werden darf. Sie war weder ein Modernisierungsfaktor, was die Demokratisierung betraf, noch hatte sie eine katalytische Funktion für die sich mit dem Umbruch durchsetzende Modernisierung. Das Integrationsdefizit, das der mangelhaften Vermittlungsleistung bzw. ungenügenden Partizipationsmöglichkeiten entsprang, offenbarte sich aber nicht nur in der unzureichenden Vermittlung von partialen Interessen der Bevölkerung zu den Entscheidungsträgern. Ähnlich dichotom gestaltete sich das Verhältnis von der Parteiführung zu den Mitgliedern der Partei und den bürokratischen Kadern. Zu dem mangelnden Feedback seitens der Bevölkerung gesellte sich somit der Umstand, daß innerhalb der Bürokratie Aushandlungsprozesse, die einen Rationalitätsgewinn bzw. notwendige Selbstbeobachtung hätten bringen können, nicht institutionell vermittelt, sondern unterdrückt wurden (Glaeßner 1993): Die Kader waren den Parteispitzen nicht aus sachlicher Diensttreue verpflichtet. Die Geltungsgründe der Herrschaft der Avantgarde lagen vielmehr in der herrschenden Zusammenbruch der alten Ordnung 52 Ideologie oder sogar in einer persönlichen Hingabe an den charismatischen Führer. Die Zentrale kontrollierte die Bürokratie mit Anweisungen. Einen „Prozeß der Konfliktaustragung und Konsensbildung konkurrierender Teilbürokratien...“ (Glaeßner 1993: 74) gab es nicht. Mit diesem Hinweis zeigt Glaeßner, wie wenig die politische Führung einer Kontrolle unterstand. Zwei Mängel griffen ineinander. Einerseits begegnete dem Bürger der Staat in Form einer Bürokratie, die die Gründe ihrer Anweisungen nicht offenzulegen brauchte und in der man sich gern auf Anweisungen von oben zurückzog (ein Merkmal kommunistischer Gesellschaften, das sich formal daran festmacht, daß es keine Verwaltungsgerichtsbarkeit gab). Eine Emanzipation der Bevölkerung gegenüber den Herrschenden blieb ausgeschlossen. Sie hätte in einem Zielkonflikt zum Avantgardekonzept der Partei gestanden. In ihrer Ohnmacht zog sich die Bevölkerung in Nischen zurück. Auf der anderen Seite spiegelte die verantwortungsscheue Haltung der Bürokraten ihre Angst vor Entscheidungen wider. Es wurde versucht, Entscheidungen nach oben abzugeben; eine Tendenz, die das System erstarren und zu einem innovationsunfähigen Block gerinnen ließ. Hierin offenbarte sich ein zweifacher Widerspruch kommunistischer Systeme (Glaeßner 1993): Vor dem Hintergrund der marxistisch-leninistischen Doktrin konnte eine Selbstregulierung gesellschaftlicher Subsysteme – wie von Teilbürokratien – nicht zugelassen werden. Und das Ziel der sozialen Gleichheit wurde mit der sozialen Differenzierung innerhalb der Machtsphäre ad absurdum geführt13. Mit dieser Entwicklung bildeten sich Verhaltensweisen und Wertorientierungen, die in einem Konflikt mit dem Gleichheitspostulat standen. Solche Vermittlungsdefizite verlangten nach einer Fortsetzung der inneren Differenzierungsprozesse, die nach Glaeßner nur durch Druck aus der Gesellschaft in Richtung zweier Alternativen – Reform oder Bruch – möglich war. Der Mangel an institutionalisierter Interessenvermittlung läßt sich also einmal in der Beziehung von Bevölkerung und Eliten verorten und zum zweiten innerhalb der Eliten selbst. Der Beziehung von Bevölkerung und Eliten wird in den modernisierungstheoretischen Untersuchungen eine zentrale Rolle für den Verlauf des Zusammenbruchs zugeschrieben. Die Autoren sehen in den unterdrückten Partizipationsmöglichkeiten nicht nur eine wesentliche Ursache für Demokratie- und Integrationsdefizite, sondern auch für die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Ansätze, mit denen sich die Bevölkerung in einigen Ländern zur Wehr zu setzen versuchte. 13 Meuschel (1993) setzt sich ausführlicher mit diesem Widerspruch auseinander. Sie identifiziert zwei Entwicklungstendenzen in der Gesellschaft der DDR. Einerseits eine Entdifferenzierung, deren homogenisierende Strukturen zur Stagnation beitrugen. Auf der anderen Seite versuchte die Partei, eine gewisse Ungleichheit und soziale Differenz aufrecht zu erhalten. Eine Kooperation der Partei mit bereichsspezifischen Fachleuten mußte stattfinden. Mit ihr erfolgte dann aber auch die partielle Freisetzung teilsystemischer Handlungslogiken. Zusammenbruch der alten Ordnung 53 Für die Transformationsanalyse beschreibt das Konzept der Civil Society den Grad, in dem es in den osteuropäischen Staaten Ansätze und Bestrebungen gab, politische Entscheidungen zur demokratischen Disposition zu stellen. Inwiefern gab es Bewegungen, die institutionelle Voraussetzungen anstrebten, die politische Kommunikationsrechte sichern und damit der „... konflikthaften Vielfalt gesellschaftlicher Interessen und Orientierungen ...“ (Deppe / Dubiel / Rödel 1991: 12) Raum geben sollten? Dabei muß man zwei Dimensionen des Verhältnisses der Gesellschaft zur Politik berücksichtigen (Mänicke-Gyöngyösi 1991): Erstens ist Civil Society der Ausdruck der Selbstverteidigung der Gesellschaft gegenüber der staatlichen Politik (und Ökonomie). Und zweitens steht Civil Society für eine sich selbst regulierende Gesellschaft, d.h. für die Bestrebung, staatliche Institutionen, politische Öffentlichkeit und Ökonomie neu zu koordinieren. Für die osteuropäischen Staaten verband sich damit der Versuch, die etatistischen Überregulierungen der Gesellschaft zu überwinden (Mänicke-Gyöngyösi 1991: 221). Das Konzept der Zivilgesellschaft stand in Osteuropa für die Hoffnung, daß sich die Lebenswelt gegen das System durchsetzen könne (vgl. Zapf 1996). Der totalitäre Charakter der osteuropäischen Systeme unterdrückte Formen der Interessenvermittlung und -organisation zwischen autoritärem Staat und Individuum und etablierte damit ein Spannungsverhältnis von gesellschaftlicher Gemeinschaft zur Politik. Mit der Herausbildung einer politischen Gegenöffentlichkeit in einigen Staaten Osteuropas schien sich diese „Spannung“ in der Logik der Modernisierung zu lösen; eine demokratische Entwicklung mußte sich durchsetzen. Die sich in der Entstehung einer unabhängigen Gewerkschaft in Polen oder in den Demonstrationen in Leipzig ausdrückenden Formen einer Zivilgesellschaft standen für die Freiheit von staatlicher Willkür, für Rechtsgleichheit und für ein gleiches Wahlrecht. Ansätze einer Civil Society entstanden vornehmlich in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei. Sie waren eine Reaktion der Gesellschaft auf die „schizoide Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit“ (Deppe / Dubiel / Rödel 1991), d.h. auf die Tendenz zu widersprüchlichen moralischen Ansprüchen des privaten und des öffentlichen Selbst, die in der Struktur der Systeme angelegt war. Die osteuropäischen Regime unterschieden sich bezüglich der Ausprägung zivilgesellschaftlicher Ansätze voneinander. Mit diesen verschiedenen, länderspezifischen strukturellen Hintergründen erschließen sich Ursachen für die Unterschiedlichkeit der Entwicklungen. Im folgenden soll an vier konkreten Beispielen ausgeführt werden, wie mit der Ausprägung der Civil Society erklärt wird, warum es in manchen Staaten zum radikalen Bruch kommen mußte, während in anderen Staaten mit Reformen reagiert wurde. 1. In der DDR gab es einen eruptiven Umbruch. Wo lagen die Ursachen für die Unterdrückung einer Aufarbeitung von Modernisierungsdefiziten in reformierenden Schritten? Zusammenbruch der alten Ordnung 54 Meuschel (1993) argumentiert, daß die Ursachen im Verhältnis von Einparteienherrschaft zur Bevölkerung lagen. Parallel verweist sie auf die Dichotomie der Beziehung der Parteikader und der Bürokraten zu der Avantgarde der Partei, d.h. die Loyalität der Eliten wird thematisiert. Meuschels Analyse zeigt, daß das Konzept der Loyalität strukturell mit dem Konzept Civil Society verbunden ist: Der entscheidende Strukturkonflikt in den kommunistischen Regimen lag nicht so sehr in den sozialen Ungleichheiten entlang der Beziehung von Herrschern und Beherrschten, d.h. der Dichotomie zwischen Gesellschaft und Staat. Vielmehr verstärkte sich die Spannung zwischen Staat und Gesellschaft, da sich als Folge der durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt vorangetriebenen Industrialisierung die Dominanz der Administration über alle Lebensbereiche durchsetzte (Meuschel 1991, 1993: 104). Mit der „Überpolitisierung“ des Lebens entwickelte sich eine unpolitische Haltung in der Gesellschaft. Damit mußte sich die soziale Integration auf Kleingruppen wie Familie und Freundeskreis als moralische Gemeinschaft verlagern. Kritisch war diese Entwicklung vor dem Hintergrund der durchaus erfolgten wissenschaftlich-technischen Entwicklung. Der wachsende Wohlstand und die Technisierung wurden von Leistungsdruck begleitet, der die Gemeinschaften der privaten Nischen untergrub. Meuschel schildert, wie Wärme, Solidarität und Geborgenheit abgelöst wurden von Innerlichkeit, Autoritarismus und Anpassung. Die Nischengesellschaft zerbrach an diesem Rückzug auf Persönlichkeitskultur und die private Welt. Ähnlich argumentieren auch Huinink und Mayer (1993). Sie schildern, wie gerade das soziale Sicherungssystem der DDR in Verbindung mit der restriktiven Politik egoistische, selbstbegünstigende Motive in der Bevölkerung erstarken ließen14. Einerseits war die politische Interessenartikulation nicht möglich. Die Lebensverläufe waren aber von Unsicherheit und Unmündigkeit geprägt, weil sie von eigenen Entscheidungen weitgehend abgekoppelt waren. Die Menschen erfuhren eine direktive Steuerung ihres Lebens von oben. Beispielsweise gab es wenig Entscheidungsmöglichkeiten bei der Wahl des beruflichen Werdegangs. Auf der anderen Seite förderte das System die Entstehung von staatlicher Regulierung unabhängiger, informeller Strukturen (Huinink / Mayer 1993: 154; Zapf 1990: 30). Diese Netzwerke gegenseitiger Hilfe und schattenwirtschaftlicher Aktivitäten wurden von der Regierung wegen der schlechten Versorgungslage geduldet. Hier konnten sich instrumentelle soziale Beziehungen insbesondere im Rückgriff auf 14 Ebenso wie Deppe, Dubiel und Rödel (1991): Sie identifizieren unterschiedliche Konnotationen des Begriffs der Civil Society für einerseits Polen und Ungarn und andererseits die DDR bzw. die deutsche Tradition. Für die Gesellschaften Polens und Ungarns verbirgt sich hinter dem Begriff die Vision der öffentlichen politischen Teilhabe, während sich in der deutschen Tradition mit Civil Society die „...besitzindividualistische Vision einer Marktgesellschaft...“ (12) verbindet. Hierin liegt ein zusätzlicher Verweis auf die Unterschiede der Ansätze einer Civil Society in Polen, Ungarn (evtl. auch der Tschechoslowakei) zu den Bewegungen in der DDR. In der DDR standen die öffentlichen Protestbewegungen - anders als in Polen und Ungarn - nicht für die Teilhabe am öffentlichen Leben und eine verstärkte Selbstverwaltung. Auch gab es in der DDR keine Gegeneliten, die Entwürfe zur Selbstverwaltung hätten entwickeln können (vgl. Zapf 1990: 21). Zusammenbruch der alten Ordnung 55 die staatlichen Garantien entwickeln. Huinink und Mayer charakterisieren die Aktivitäten im informellen Sektor als gekennzeichnet von einer free-rider-Mentalität. Eine solche Entwicklung war besonders problematisch vor dem Hintergrund einer parallel verlaufenden, DDR-spezifischen Entwicklung: Auf Grund der Zweiteilung des deutschen Staates verfügte die SED-Herrschaft nicht über eine unhinterfragte nationalstaatliche Basis (Meuschel 1993: 102). Die SED war laufend damit beschäftigt, nach einem „Modell DDR“ zu suchen, das in Abgrenzung vom Westen eigene Qualitäten besaß. Die Intelligenz – und das gilt verstärkt für die politischen Kader – sah in Reformbemühungen immer die Bedrohung der Eigenstaatlichkeit, was ihre prinzipielle Loyalität zur Parteispitze verfestigte. Diese Entwicklung wirkte allen Ansätzen einer Civil Society, mit denen die Bürger ihr Interesse hätten artikulieren können und eine gesellschaftliche Integration erfolgt wäre, entgegen. Beide von Meuschel hervorgehobenen Entwicklungen griffen ineinander und verursachten den eruptiven Verlauf der Transformation in der DDR. Die starke Loyalität der Eliten verhinderte das Aufbrechen der Antagonismen, wie es sich bspw. in Polen und Ungarn beobachten ließ, wo die Ablösung des kommunistischen Regimes nicht mit einem solchen drastischen Bruch erfolgte. Dem Druck, der sich aus den strukturellen Widersprüchen ergab, wurde mit Reformen nachgegeben. In Polen und Ungarn gab es „Kerne“ einer Civil Society. In der DDR hingegen gab es keine kollektive Erfahrung mit einer widerständigen Praxis. Die Widersprüche stauten sich und lösten sich auf in einer „...eruptiven Geltung der Unzufriedenheit...“ (Meuschel 1993: 99) – in einem Bruch (Glaeßner 1993). Die Widersprüche in der politischen Modernisierung bildeten somit nicht nur eine Voraussetzung für die Auseinandersetzungen innerhalb der Eliten. Sie provozierten vor allem die öffentliche Mobilisierung in den kommunistischen Gesellschaften. Deutlich wird ein solches Aufbrechen der gesellschaftlichen Antagonismen an den Entwicklungen und Ansätzen einer Civil Society vor allem in Polen, aber auch in Ungarn und der Tschechoslowakei. 2. Für Polen läßt sich zeigen, wie die mangelnde Institutionalisierung von gesellschaftlichen Interessenlagen gepaart mit einer Legitimitätsschwäche des Systems öffentlichen Protest provozierte (vgl. Tatur 1991). Die Protestbewegung richtete sich auf eine zunehmende Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen in Form von stärkerer Selbstverwaltung und somit auf eine Stärkung von Elementen einer Civil Society. Nicht einmal die Unterdrückung der Ansätze einer Civil Society konnte den Zusammenbruch verhindern. Das Potential einer „Revolution von unten“ wurde zwar mit repressiven Mitteln unterdrückt (der Erklärung des Kriegsrechts im Dezember 1981 folgte das Verbot der Gewerkschaft). Diese Unterdrückung konnte den Widerstand und Protest lang- Zusammenbruch der alten Ordnung 56 fristig aber nicht brechen. Die Notwendigkeit, politische und ökonomische Änderungen einzuleiten, blieb bestehen. Lediglich der Charakter der Transformation änderte sich; die Veränderungen wurden von „oben“ gelenkt. Dem entsprach ein Stimmungswandel in der Bevölkerung: Das Motiv einer Zivilgesellschaft, sich von der Willkür der Herrschenden zu befreien, wurde abgelöst von der Hoffnung, mit der Einführung von Marktwirtschaft und Privatisierung der katastrophalen ökonomischen Situation zu entkommen (vgl. Linz / Stepan 1998: 255f). Taturs Untersuchungen setzen an den Auswirkungen der demokratischen Defizite des polnischen Systems auf die Integration der Gesellschaft an. In ihrer Darstellung führen die strukturellen Defizite zu einer „sozialen Schizophrenie“ (1991: 238), die sich in einer unvereinbaren Trennung von öffentlichem Selbst und privatem Selbst im Bewußtsein der Bevölkerung widerspiegelte. In dieser Spannung sieht Tatur eine wichtige Ursache für die Entwicklung der Ansätze einer Zivilgesellschaft in Polen: In der etatistischen Gesellschaft des Polens in den 70er Jahren fehlte ein institutionalisierter „Raum“, in dem die gemeinschaftlichen Interessen integriert wurden. Einen öffentlichen Gruppenzusammenhalt gab es nicht. Die Lebensstile der Bevölkerung Polens reflektierten dennoch gemeinsame Moralvorstellungen und Werthaltungen. Diese Orientierungen waren aber eher privater Natur und bezogen sich – wie in den meisten kommunistischen Staaten – auf das Leben in den gesellschaftlichen Nischen der Familie und Freundeskreise (Tatur 1991). Die Haltung in den 70ern gegenüber der staatlichen Ordnung beschreibt Tatur einerseits als Ablehnung, die sich im Rückzug in die Nischen ausdrückte und zur „Dichotomie von öffentlicher und privater Sphäre“ (1991: 237) im Bewußtsein der Menschen führte. Andererseits ließ sich auch eine Tendenz zur Anpassung beobachten, in der die soziale Rolle in ihrer Ausgestaltung den persönlichen Interessen und Loyalitäten folgte. Tatur beschreibt, wie sich aus dieser Haltung ein revolutionäres Potential entwickeln konnte. Der dissonante Zustand - von öffentlichem und privaten Selbst - verlangte nach einer kognitiven Befreiung. Der Widerstand gegen den Staat artikulierte sich auf dem Hintergrund der privaten Moral und der Solidarität in den Nischen. Die kognitve Befreiung zielte darauf, in Wahrheit zu leben; Denken und Handeln in Einklang zu bringen (Tatur 1991: 238). Tatur zeigt mit ihrer Argumentation, daß der Mangel an öffentlicher Gruppenidentität durch die Entwicklung von zivilgesellschaftlichen Ansätzen, die politische Solidarität stiften können, ersetzt werden kann. Damit liefert sie eine Begründung für die modernisierungstheoretische These, nach der sich eine demokratische Entwicklung in einer modernen oder teilmodernen Gesellschaft durchsetzen muß. Mit den Massenstreiks Anfang der 80er Jahre, die sich gegen die Willkür der Herrschenden richteten, bot sich die Möglichkeit der Bildung von Gruppenidentitäten (Tatur 1991): Je nach Haltung gegenüber den Streiks konnte in „wir“ und „sie“ unterschieden Zusammenbruch der alten Ordnung 57 werden. Die Wir-Identität war eine moralische Identität, die in Abgrenzung vom System entstand und in der Sprache der katholischen Kirche und des Papstes formuliert wurde. Mit dieser neuen Identität wurden politische Interessen artikuliert, und somit entstand das Projekt der Civil Society. Institutionalisiert wurde das Projekt mit der Solidarnosc. Das sich neu artikulierte kollektive Selbst baute auf eine Schicksalsgemeinschaft, die mit der Verhängung des Kriegsrechts eine Wandlung erfuhr. Die Basis der Solidarnosc zerstritt sich im Untergrund, was dazu führte, daß sich die Bindung der Arbeiter an die Gewerkschaft auflöste. Die Kirche bot der Schicksalsgemeinschaft jetzt ihren Schutz an. Mitte der 80er vollzog sich somit ein Stimmungswechsel in der Gesellschaft (Tatur 1991: 242): Gemeinschaft wurde im Rahmen der Kirche metaphysisch definiert und rituell erlebt; die Identität der Bewegung wurde entpolitisiert. Tatur weist hier auf eine Entwicklung hin, in der die moralische Grundlage der Civil Society in Polen von dem öffentlichen Leben weitgehend isoliert wurde15. Die Proteste im Mai und August 1988 organisierten sich unabhängig von der Solidarnosc und artikulierten die Ängste einer existentiellen Bedrohung in einer sich kontinuierlich verschlechternden ökonomischen Situation. Materielle und nicht mehr moralische Interessen dominierten jetzt die politischen Einstellungen: Modelle der Reformen, die eine stärkere Selbstverwaltung anstrebten, wurden durch die Bestrebungen der Einführung der Marktwirtschaft abgelöst. Erst die Schwächung der Civil Society ermöglichte die „Revolution von oben“. Die Aushandlungsprozesse an den Runden Tischen waren eine korporatistische Lösung ausgehandelter Kompromisse (Tatur 1991: 245). Diese Ergebnisse werden von Tatur nicht als Resultat der Interessenartikulation einer Civil Society gewertet. Nicht in der Aggregation gesellschaftlicher Interessen lag die neue Legitimationsbasis der gesellschaftlichen Ordnung in Polen. Vielmehr orientierte sich die Zustimmung und Unterstützung des Systems an der ökonomischen Performance. Nur von der Realisierung des Marktes und den Privatisierungen wurde eine Verbesserung der Lebensumstände erwartet. Dennoch hat das Projekt der Civil Society für die Transformation in Polen eine entscheidende Bedeutung gehabt. Die Regierung erkannte die Bedeutung der ehemaligen Gewerkschaftsführer und besonders der Person Walesas bei der informellen Kontaktaufnahme mit der Opposition Ende 1987, die zu der Einrichtung der Runden Tische führten, implizit an. Mit dem Argument von Tatur wird die Bedeutung eines wichtigen Erklärungsschritts klar. Sie beschreibt, wie strukturelle Defizite zu Spannungen auf der Ebene der Bevölkerung - der Akteure also - führen können. Die Prozesse auf dieser Ebene bilden die Voraussetzung für eine weitere strukturelle Entwicklung. Im etatistischen Staatsgebilde Polens, das von einem gering ausdifferenzierten Verhältnis von Staat und Gesellschaft gekennzeichnet war, entwickelten sich aus der Spannung zwischen dem öffentlichen 15 Ähnlich wie in der DDR hemmte die Einbindung der Opposition in die Kirche die Entfaltung der Civil Society auch in Polen (vgl. Meuschel 1993). Zusammenbruch der alten Ordnung 58 und dem privaten Selbst Ansätze einer Zivilgesellschaft. Auch die Untersuchungen zu den Ansätzen einer Zivilgesellschaft in anderen osteuropäischen Staaten weisen auf den reflexiven Zusammenhang von individuellen Dispositionen und strukturellen Änderungen. 3. Für Ungarn bildete der Umgang mit den traumatischen Geschehnissen von 1956 den Referenzpunkt für die Einstellung gegenüber dem herrschenden System. Die verschiedenen Thematisierungen und Interpretationen hatten eine symbolische Wirkung mit Einfluß auf die Transformation des politischen Systems. Die 60er Jahre waren eine Zeit der „kollektiven Verdrängung der Zeitgeschichte“ (Varga 1991). Niemand brach das Schweigen um den Mythos der Niederschlagung einer Konterrevolution, mit dem die drastische Reaktion auf den Aufstand von 1956 verdeckt wurde. Der Mythos der Abwehr einer Konterrevolution bildete die Legitimationsbasis der bestehenden Macht. Die Greueltaten wurden von der Bevölkerung vergessen, um sich einen erträglichen Alltag zu sichern. Die Regierung bot der Bevölkerung im Gegenzug einen gewissen Wohlstand; eine liberalisierte Wirtschaftspolitik, Reisefreiheit, und ein freier Umgang mit ausländischen Kulturgütern wurden eingeführt. Diese Errungenschaften des Kádárismus16 ermöglichten es, sich in die Privatheit zurückzuziehen. Innerhalb der Parteiführung kam es allerdings zu Machtkämpfen, die sich unter anderem an der Debatte um die Formulierungen „Konterrevolution“ bzw. „Volksaufstand“ entzündeten. Parallel zur innerparteilichen Opposition gab es eine alternative Öffentlichkeit in Form von universitären Clubs, der ökologischen Bewegung und einer Vielzahl von Vereinen. Insbesondere die studentischen Aktivitäten und das Anliegen der ökologischen Protestbewegung verlagerten sich auf den außeruniversitären Bereich. Die Elite der Hochschulen beteiligte sich an den Vorschlägen zum Aufbau eines Mehrparteiensystems und demokratischen Wahlkampfes (Szabó 1991: 210), während sich die Bevölkerung an der Interpretation der Geschichte und dem Staudammprojekt öffentlich beteiligen konnte. Der wichtigste Gegenstand der ökologischen Bewegung – der Staudamm für ein Donau-Kraftwerk – wurde zum Symbol eines Scheidepunkts zwischen den konservativen Kräften und den Reformern. Das ließ die Ökologiebewegung zu einem Bestandteil der Demokratisierungsbewegung werden (Szabó 1991: 209). Die ökologische Bewegung stand für die sich selbst verteidigende Gesellschaft gegen den Staat. Die Beteiligung der Intelligenz am politischen Diskussionsprozeß um Konzepte der Selbstorganisation und Selbsthilfe - als Antwort auf die sich seit Mitte der 80er Jahre abzeichnende ökologische Krise – stand für die Bestrebungen einer sich aus 16 Kádár bot der ungarischen Gesellschaft nach der Niederschlagung des Aufstandes von 1956 einen Pakt bzw. Gesellschaftsvertrag an (vgl. Eörsi 1993); die Entpolitisierung der Bevölkerung wurde mit der Verbesserung des materiellen Alltags, z.B. durch rechtliche Ansprüche auf soziale Versicherungsleistungen, „erkauft“. Zusammenbruch der alten Ordnung 59 dem Etatismus befreienden, selbstregulierenden Gesellschaft. In diesen beiden Dimensionen einer Civil Society – Verteidigung gegen den Staat und Bestrebungen zur Selbstorganisation (Mänicke-Gyöngyösi 1991) - fanden die Aktivitäten der Bewegungen in Ungarn statt. Die Eliten reagierten aber auch auf das historische Bewußtsein der Bevölkerung. Das „Komitee für Historische Gerechtigkeit“, das sich aus einer Betroffenheit entwickelte, dann aber öffentliche Bedeutung erlangte, gewann entscheidenden Einfluß auf den öffentlichen Umgang mit der Geschichte. Im Mai 1990 verabschiedete das erste frei gewählte Parlament in Ungarn eine neue Version der Geschichte von 1956; sie wurde offiziell als Revolution formuliert. Damit wurde der Kádárismus symbolisch zu Grabe getragen, und die Bevölkerung Ungarns konnte zur Authentizität zurückfinden. 4. Die Entwicklung in der Tschechoslowakei stand für einen ähnlichen Befreiungsschlag wie er in Ungarn stattgefunden hatte. Dem „Leben der Lüge“ (V. Havel), seit der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968, stand eine unterdrückte, dem Regime widersprechende Werthaltung der Bevölkerung entgegen. Ihre Wurzeln lagen in einer tiefen humanistischen und demokratischen Tradition (vgl. Horský 1991: 296). Als es die Umstände erlaubten bzw. nahelegten, befreiten sich diese Wertorientierungen aus der Privatheit. Die Geschehnisse in Polen, Ungarn und der DDR führten der Opposition vor, daß nicht mit einer militärischen Intervention zu rechnen war und daß friedliche Massendemonstrationen gepaart mit dem Druck demokratisch gesinnter Gruppierungen ein erfolgreiches Prozedere für einen Systemwechsel sein konnten (Horsý 1991: 281). Dem Beispiel der anderen Länder wurde gefolgt mit Massenprotesten und Generalstreiks (November 1989). Die Bevölkerung wehrte sich aber auch in organisierter Form. Bürgerbewegungen, die z.T. an die 1977 gegründete Charter 77 anknüpften oder auch vielfach ganz neu entstanden, stellten sich gegen die Obrigkeit, indem sie den „Demonstrationsrausch“ (Horský 1991: 287) unterstützten oder sogar organisierten – wie im Falle des Streikkomitees der Prager Hochschulen. Die Gewaltlosigkeit der Bewegungen stand für die Authentizität ihrer Werthaltungen; private humanistische Haltungen wurden in der öffentlichen Konfrontation mit den gewalteinsetzenden Parteikadern beibehalten – die Studenten wehrten sich nicht gegen die Knüppel der Polizei. Die in den vier Beispielen wiederholt auftretende Thematisierung der Dispositionen der Akteure und der Werthaltungen in der „gesellschaftlichen Gemeinschaft“ folgt aus der modernisierungstheoretischen Untersuchung der Differenzierungs- und Integrationsdefizite. Die Mechanismen der Modernisierungstheorie führen zu den Dimensionen der (zivilgesellschaftlichen) Kultur und der Legitimation des Regimes. Verschiedene Charaktertypen zu unterschiedlichen historischen Zeitpunkten lassen sich in diesem Rah- Zusammenbruch der alten Ordnung 60 men miteinander vergleichen17. Kognitive und moralische Entwicklungen auf individueller Ebene bilden die Kategorien des Vergleichs und beschreiben die Bedingungen für zivilgesellschaftliche Ansätze. Mit der Modernisierungstheorie liegt also auch eine Perspektive vor, mit der je nach Charakter des Verhältnisses von Individuen zur öffentlichen Sphäre strukturelle Unstimmigkeiten und Spannungen aufgedeckt werden können. Im nächsten Abschnitt spielt die Untersuchung zur Legitimität in kommunistischen Gesellschaften eine zentrale Rolle. Legitimität ist ebenfalls eine Kategorie, die sich auf die Akteure bezieht. Sie beschreibt die von Akteuren (Eliten) wahrgenommene Einstellung und Bewertung anderer Akteure (der Gemeinschaft bzw. Bevölkerung) gegenüber dem Herrschaftssystem (vgl. auch Holmes 1993). Defizite in der Wertverallgemeinerung Dieser Abschnitt stellt Argumente vor, die den Konsens über die Ausübung der Herrschaft und Macht in kommunistischen Staaten problematisieren. Ein solcher Konsens muß auf allgemein anerkannten Werten beruhen. Über sie wird die motivationale Unterstützung der Individuen einer Gesellschaft garantiert. Wie konnten sich die Eliten kommunistischer Gesellschaften, die sich selbst ohne allgemeingültiges, qualifizierendes Kriterium ernannt hatten, Akzeptanz und Unterstützung für ihren Macht- und Herrschaftsanspruch sichern? Sie mußten ihren Anspruch auf eine rationale Grundlage stellen, indem sie sich über Ziele oder Zustimmung betreffend der Form der Machtausübung (legal) legitimierten. Die Auseinandersetzung mit der Legitimation kommunistischer Führungen und der mit ihr verbundenen Probleme bzw. Widersprüche führt zu der Untersuchung der Frage, inwiefern diese Gesellschaften in der Lage waren, den Übergang in die dritte, integrierende Phase der Moderne zu vollziehen. Ließ sich mit ihren Systemen vor dem Hintergrund der geltenden quasi-religiösen Ideologien ein rationalisiertes Verhältnis von Kultur und Gesellschaft etablieren? Die Herausforderung zur Wertverallgemeinerung bzw. der Anspruch, die Führung rational zu legitimieren, ergab sich sowohl aus den wahrgenommenen Entwicklungen in 17 Mänicke-Gyöngyösi analysiert die Auswertung dreier Volkszählungen (1919, 1959, 1979) in der SU, die von den Soziologen L.A. Gordon und A.K. Nazimova (1987) vorgenommen wurden, um zu zeigen, daß die strukturellen Voraussetzungen zu einer kognitiven und moralischen Haltung bei den Bürgern der SU führten, die zivilgesellschaftlichem Engagement widersprach. Für die Lebensstile der 70er und 80er Jahre in der SU zeigt sich dabei folgendes Stimmungsbild (Mänicke-Gyöngyösi 1990: 182): Die Gesellschaft konnte die Vermittlung von öffentlicher und privater Moral nicht leisten. Es stand kein Raum für die Integration gemeinschaftlicher Interessen zur Verfügung. Vielmehr standen der Integration institutionelle Schranken entgegen. Für die Regeln des Verhaltens schienen die Familien und Freundeskeise relevant. Der Grund für die geringe motivationale Unterstützung (Handlungsbereitschaft) lag in dem Verhältnis zu den Normen der öffentlichen Umwelt. In den öffentlichen Sphären der SU – anders als in den Nischen – galten die Werte nur in einer kognitiv-abstrakten Weise. An dieser Haltung hat sich auch in den folgenden Jahrzehnten nicht viel geändert. Zusammenbruch der alten Ordnung 61 den modernen westlichen Staaten – also aufgrund externer Ursachen – als auch aus internen Entwicklungen. Es zeigte sich, wie einerseits der Wettbewerb mit den westlichen Gesellschaften die Werte der marxistisch-leninistischen Ideologie in Frage stellte und andererseits interne Machtprozesse zur Neudefinition der legitimatorischen Basis des Führungsanspruchs führten: Die internen Entwicklungen mit ihren tatsächlichen Einkommens- und Machtunterschieden standen im Widerspruch zu den Zielen der Gleichheit. Es bedurfte daher einer neuen Wertgrundlage auf einer höheren Allgemeinheitsstufe, die die zunehmende gesellschaftliche Differenzierung rechtfertigen konnte – bspw. als funktionales Erfordernis. Nur so hätte die gesellschaftliche Integration gewahrt werden können. Auf welchem Wege der externe Wettbewerb mit den westlichen Staaten über wirtschaftlichen Fortschritt zu einer Legitimationskrise autoritärer bzw. totalitärer Regime führte, kann mit einem konvergenztheoretischen Modernisierungsansatz gezeigt werden (Pye 1990): Die Modernisierung setzte über die Interaktion des internationalen Systems mit den Nationalstaaten alle Regierungen unter Druck. Mit dem Zuwachs des technischen Wissens und der Weiterentwicklung der Medien kam es zu Zusammenstößen der nationalen Kulturen mit der „Weltkultur“; wirtschaftliche Annäherungen und Handelsabkommen entstanden, Informationsbarrieren wurden wirkungslos. Der Zugang zu anderen Kulturen führt zur Konfrontation der durch sie vermittelten Standards mit den engstirnigen nationalen Werten – wie sie die Umsetzung der marxistisch-leninistischen Ideologie vermittelt. Die Werthaltungen sind für die Bildung nationaler Loyalitäten und damit auch für die Legitimität spezifischer Politikstile wichtig. Ungeachtet dessen erfolgten mit der wirtschaftlichen Annäherung auch Eingeständnisse an universelle transnationale Standards, d.h. an andere Kulturen und Werte. Es wird klar, daß mit der Aufweichung idiosynkratischer Werte den nationalen Regierungen eine wesentliche Legitimitätsressource – mit der sich die tatsächlichen Ungleichheiten legitimieren ließen - und damit auch eine Machtressource entzogen wurde. Die Bedeutung der eigenen Werte wird sozusagen von oben relativiert, ohne daß die so entstehende Lücke gefüllt würde, so daß die Unterordnung weiterhin gerechtfertigt werden könnte. Pye bemerkt deshalb zurecht, daß die Modernisierungsprozesse den politischen Kräften die Mobilisierung und Dominierung der Gesellschaft erschweren. Das gilt insbesondere für eine Situation des fortgeschrittenen Vertrauensverlusts, wie sie sich u.a. als Ergebnis des zunehmenden kulturellen Austausches zwischen Ost und West in den marxistisch-leninistischen Systemen herausbildete. Die kommunistischen Führungen haben den Legitimationsmangel wahrgenommen und mußten darauf reagieren. Welche Auswirkungen hatten diese Reaktionen auf die Ak- Zusammenbruch der alten Ordnung 62 zeptanz des Macht- und Herrschaftsanspruchs - und damit mittelbar auf die Stabilität? Holmes (1993) gibt mit einer „Theorie der Legitimationskrise“ eine Antwort auf diese Frage. Er liefert ein komplexes Analyseschema, mit dem sich nicht nur fundamentale Widersprüche kommunistischer Gesellschaften aufzeigen lassen, sondern auch den Krisenentwicklungen eindeutige Indizien zuordnen lassen. Die Indizien für eine der Dynamik der Widersprüche folgende Krise sind die Kampagnen gegen Korruption. In ihnen sieht Holmes das entscheidende Symbol für eine Entwicklung zur Krise; Antikorruptionskampagnen verweisen auf einen Wechsel in der Legitimationsweise. Dieser Wechsel steht für einen Prozeß der Transformation. Den Kern seiner Argumentation bildet eine allgemeine Theorie der Krisen-Dynamik in kommunistischen Staaten (Holmes 1993): Nach der revolutionären Gründung eines Staates ist die Legitimationsweise noch relativ unbedeutend. Macht wird hauptsächlich durch Zwang ausgeübt. Erst mit einer gewissen Routine ändert sich die Situation. Die Führer erkennen die Notwendigkeit, sich selbst zu legitimieren. Damit ändert sich das Primat der Machtausübung. Nicht mehr Zwang beherrscht die Ordnung, sondern eine normative Unterstützung der gesellschaftlichen Ordnung wird bei den Massen gesucht. In dieser Phase wechseln die Führer zu teleologischen Formen der Legitimation. Die Machtausübung soll entweder über einen offiziellen Nationalismus oder über „Eudämonismus“ legitimiert werden. Beides sind zwar Formen rationaler Legitimation, sie müssen aber nicht unbedingt auf Gesetzen und Legalität beruhen. Entscheidend ist, daß die Bürokratie geführt wird, um Ziele - wie wirtschaftliches Wachstum oder Identitätsstiftung über nationale Symbole - zu erreichen. Die „eudämonistische“ Legitimation kann gegen die Intention der Führung wirken, wenn die Bevölkerung mehr erwartet als geleistet wird, oder wenn offizieller Nationalismus inoffiziellen Nationalismus inspiriert. In kommunistischen Systemen kommt es wegen der strukturellen Hindernisse für eine ökonomische Effizienz - unweigerlich zu diesen negativen Auswirkungen. Eine weitere Entwicklung setzt ein. Der Übergang zu einer legal-rationalen Legitimationsform, die modernen Staaten angemessenen ist, wird eingeleitet. Legal-rationale Legitimation stellt den Gehorsam gegenüber Normen über den Gehorsam gegenüber Personen. Der Versuch der Führung, die Balance zwischen den Legitimationsformen zu ändern in Richtung legal-rationale Legitimität, offenbarte sich in der zunehmenden Thematisierung von Korruption. Antikorruptionskampagnen sind ein Indiz für die Wahrnehmung der schwindenden Legitimität des Führungsanspruchs und der Systemform. Die Wahrnehmung der Legitimität bei der Führung konzentriert sich dabei primär auf die Haltung einerseits der Mitglieder der Führung und andererseits der Bürokraten. Ihre motivationale Unterstützung ist entscheidend für den Systemerhalt. Eine nachlassende Unterstützung wird wahrgenommen, wenn Teile der Führung und Bürokaten ihre Macht und Privilegien durch Reformen bedroht sehen. Die „eudämonistische“ Legitimation für die Führung wird unterwandert und somit problematisch. Wird aus den eigenen Reihen eine derartige Bedrohung wahrgenommen, dann Zusammenbruch der alten Ordnung 63 bildet das Bemühen, sich zunehmend gegenüber den Massen zu legitimieren, eine Lösung. Die Führung wechselt dazu über, die öffentliche Meinung gegen Aspekte der Bürokratie – Korruption bzw. Amtsmißbrauch – zu wenden. Hiervon erwartet sie eine Bewegung in Richtung legal-rationale Legitimation. Die Antikorruptionskampagnen reichten nicht aus, um die modernen kommunistischen Staaten in der legal-rationalen Form zu legitimieren. Mit ihnen wurden eher neue Legitimationsprobleme geschaffen, da es einen fundamentalen Widerspruch zwischen kommunistischen Systemen und legaler Rationalität gibt. Der Widerspruch liegt zwischen dem Konzept des „rule-of-law“ und dem kommunistischen Machtkonzept, das nach einer avantgardistischen Führung verlangt. Folglich gesellt sich zu den Bürokaten - als Quelle von Instabilität - die enttäuschte und frustrierte Bevölkerung. Die Führung muß auf eine solche krisenhafte Entwicklung reagieren; entweder mit Zwang oder mit der Gewährung voller legaler Rationalität. Nach Holmes mündet der Widerspruch in einem Kollaps, auch wenn es zeitweise einen Rückzug zum Zwang geben kann. Antikorruptionskampagnen bilden zwar kein Kriterium für die Identifikation einer Krise, sie verweisen aber auf die Wahrnehmung der Akteure. Holmes sieht in dieser Wahrnehmung einen ausreichenden Beleg für eine Krise oder die Bewegung zu ihr. Legal-rationale Legitimation und kommunistische Macht sind inkompatibel. Deswegen kann davon ausgegangen werden, daß mit dem Ausmaß des Bestrebens eines kommunistischen Systems, sich legal-rational zu legitimieren, die Legitimationskrise zunimmt. Ein eindeutiges Zeichen für eine Legitimationskrise liegt auch vor, wenn sich das Regime zurück zum Zwang als Form der Machtausübung bewegt. In der Entwicklung der kommunistischen Staaten Osteuropas ließen sich konkrete Hinweise auf eine transformatorische Dynamik des Legitimationswechsels beobachten (Holmes 1993): Die kommunistische Führung der SU paßte sich Politiken an, die ihr System dem Westen ähnlicher werden ließen. Zu dieser Konvergenztendenz kam es vor dem Hintergrund der ökonomischen- und Legitimationsprobleme. Die Umsetzung der neuen Politiken führte aber entgegen ihrer Intention dazu, daß sich die negativen Folgen des Kommunismus und des Kapitalismus durchsetzten. Die positiven Aspekte der beiden Steuerungsvarianten rückten in die Ferne. Die Ursache für die Realisierung eines solchen „worst-case-scenarios“ sieht Holmes in dem erwähnten fundamentalen Widerspruch zwischen der offiziellen Ideologie und den Versuchen einer rational teleologischen oder legalen Legitimation. Holmes (1993) führt aus, wie die während der stalinistischen Periode vorherrschende Dominanz der Macht durch Zwang von dem Versuch, die Legitimation von der Öffentlichkeit auf der Basis von Leistung zu erhalten, abgelöst wurde: Gegenüber den Massen wurde die „eudämonistische“ Legitimation die dominante Legitimationsweise. Die 60er und 70er Jahre waren von weitgehenden ökonomischen Reformen geprägt. Hätte das Zusammenbruch der alten Ordnung 64 System hier gute Leistung erbracht, dann wäre evtl. die Legitimation gestiegen. Dies war ein wichtiges Ziel der sowjetischen Führung vor dem Hintergrund der geopolitischen Situation. Die schwächere Position der SU im militärischen Wettbewerb mit den USA führte zu einem Verlust des Selbstvertrauens der Führung. Die leistungsbezogene, instrumentelle Legitimation war dann allerdings in den 80er Jahren mit gravierenden ökonomischen Problemen konfrontiert. Die Gründe dafür lagen in der zurückgehenden Integration des osteuropäischen Marktes in den kapitalistischen Markt (vgl. auch Lötsch 1993). Außerdem verhinderten mangelnde politische Reformen eine ökonomische Modernisierung. Der Konservatismus einer Bürokratie, auf die der Druck zur ökonomischen Leistung einen negativen, entfremdenden Effekt hatte, konnte seine hemmende Wirkung ungehindert entfalten. Die „eudämonistische“ Legitimation mußte zusammenbrechen. Der Führung blieb nur, sich in Richtung einer anderen Legitimationsform neu zu orientieren. Ihre Wahl fiel auf die legal-rationale Legitimationsweise, mit der sie die öffentliche Meinung gegen die Kader mobilisierte. Diese Verschiebung identifiziert Holmes für die 70er und besonders die 80er Jahre anhand der zunehmenden Antikorruptionskampagnen als Form der Mobilisierung der Öffentlichkeit. Holmes‘ Untersuchungen zeigen eine deutliche Zunahme von öffentlichen Berichten und Medienkampagnen zur Korruption und Amtsmißbrauch in der Ära nach Breshnew (1993: 120f). In dieser Entwicklung lag ein Hinweis darauf, daß die Führung den Widerspruch zwischen den existierenden Werten und der legalen Rationalität wahrnahm. Je weiter sich die Führung in Richtung legal-rationale Legitimation bewegte, desto mehr fand sie sich selbst in einer widersprüchlichen Transformation. Die Kampagnen wirkten sich somit dysfunktional aus – sie hatten einen negativen Einfluß auf das Regime und die Legitimität des Systems. Es kam zu einer allgemeinen Krise. Die Bewegung von einer Legitimationsform zur anderen mag helfen, eine Krise zu überwinden. Ihr Vorteil liegt in der buy time-Strategie (Holmes 1993). Stehen ihre Ziele aber im Widerspruch zu den strukturellen Voraussetzungen (hier der marxistisch-leninistischen Ideologie), dann wirken sie mittel- bis langfristig eher dysfunktional. Die anderen osteuropäischen Staaten haben mit der Krise in der SU ihre externe Legitimation verloren. Die SU konnte nicht mehr als Modell fungieren. Auf diese Weise initiierten die Prozesse des Integrationsverlustes in der SU die Transformationsentwicklungen in den anderen osteuropäischen Staaten. Der Wandel in den osteuropäischen Staaten ist aber nicht nur Ergebnis der Entwicklungen in der SU. Parallele Prozesse des Legitimationswechsels ließen sich auch außerhalb der SU beobachten. Meuschel (1991) hat bspw. den Legitimationswandel in der DDR untersucht. Sie beschreibt, wie sich Legitimität als Orientierung an den Werten des Antifaschismus und Sozialismus zu einer labilen Loyalität wandelte. In dem neuen Zustand der Loyalität wendeten sich die Mitglieder der Gesellschaft von dem Wertekatalog des Zusammenbruch der alten Ordnung 65 Marxismus-Leninismis ab, akzeptierten aber weiterhin die Herrschaftsverhältnisse, weil diese der Verfolgung privater Interessen nicht im Weg standen, sondern die Realisierung egoistischer Motive ermöglichten und förderten. Während von 1945 bis Mitte der 50er Jahre ein stalinistischer Antifaschismus Legitimität in der DDR stiftete, wurde ab Mitte der 50er bis Ende der 60er mit den technokratischen Reformen und der sozialistischen Utopie versucht, eine teleologische Legitimationsgrundlage aufzubauen (Meuschel 1991). Der Stalinismus war gescheitert. Mit Chruschtschow in der SU und Ulbricht in der DDR setzte eine Reformphase ein, die in dem technisch-wissenschaftlichen Fortschritt die Grundlage für das angestrebte Ziel einer klassenlosen Gesellschaft sah. Die Reformen wurden aber sowohl in der SU als auch in der DDR abgebrochen; in der SU mit dem Beginn der Breshnew-Ära und dem Sturz von Chruschtschow, in der DDR mit dem Einsetzen der Honecker-Ära. Ein entscheidender Grund lag in den ökonomischen Ungleichgewichten und Versorgungskrisen. Sie waren Folgen der Teilmodernisierung. Eine weitere - von Meuschel hervorgehobene - Ursache für den Abbruch der Reformen durch die SED-Führung war die Angst vor Arbeiterunruhen und Demokratisierungsbestrebungen, wie sie sich Ende der 60er Jahre in der Tschechoslowakei beobachten ließen. Eine neue Phase der Systemlegitimation begann. Sie war gekennzeichnet durch den Verlust der Utopie, was sich in dem Label des „real-existierenden Sozialismus“ ausdrückte; das utopische Ziel wurde in eine ungewisse Zukunft verschoben. Damit gerieten aber auch die Widersprüche der Gesellschaft vermehrt ins Blickfeld. Meuschel schildert, auf welchem Wege die Legitimität zur Loyalität transformiert: Die weitgehende Tolerierung bildete die Herrschaftsbasis und nicht eine durch Legitimität gestiftete motivationale Unterstützung. In diesem Zustand glich die DDR stark den westlichen Systemen. Dennoch war der real-existierende Sozialismus wesentlich verwundbarer. Ihm fehlte nämlich – im Gegensatz zu den westlichen Gesellschaften – eine Kultur individueller Verantwortung, Pluralität politischer Institutionen und Mechanismen demokratischer Teilhabe. Persönliches Versagen wurde somit dem Parteienstaat angelastet. Politische Verantwortung für Fehlentwicklungen konnte, anders als im Westen, eindeutig einer politischen Institution zugewiesen werden. Die Gesellschaft war nicht in das politische System eingebunden, konnte sich also auch hier jeder Verantwortung entziehen. Die SED versuchte sich in einer Loyalitätspolitik, indem sie z.B. eine tolerantere Kirchenpolitik verfolgte. Hiermit schuf sie allerdings Möglichkeiten für die Entwicklung oppositioneller Gruppen, die sich aus der Kirche heraus gegen das System wendeten (1989 kam es aus diesen Reihen zu einem Aufruf zum Wahlboykott), und somit Reaktionen provozierten (den Wahlbetrug der SED), die selbst die Loyalität beschleunigt zusammenbrechen ließen. Zusammenbruch der alten Ordnung 66 Pye beschreibt die Diffusion westlicher Wertestandards. Holmes identifiziert die Indizien, die auf eine Erosion der motivationalen Unterstützung des Systems weisen. Meuschel beschreibt den Politikwandel in der DDR in seiner Auswirkung auf die Systemlegitimation. Wie sich allerdings Wertewandel und der Wandel des legitimatorischen Selbstverständnisses auf die individuellen Einstellungsmuster auswirken und auf diesem Wege letztendlich zu einer Disposition für einen Systemwechsel führten, ist nicht Gegenstand der Analysen. Der Wirkungsbeziehung von Legitimationsweise und Motivation muß mit einer Fragestellung auf den Grund gegangen werden, die die Beziehung zwischen normativer Selbstthematisierung eines Systems und den impliziten Persönlichkeits- bzw. Identitätskonzepten aufspüren will. Holmes umgeht das Problem, indem er die Bedeutung der Unterstützung nur indirekt thematisiert; nicht der Einstellungswandel in der Bevölkerung selbst, sondern seine Wahrnehmung durch die Eliten, ist für politische Änderungen verantwortlich. Für die Transformation in der SU können damit wahrscheinlich die zentralen Variablen benannt sein. Die Eliten reagierten auf die mangelnde motivationale Unterstützung. Die Bevölkerung in der SU reagierte passiv auf strukturelle Bedingungen, indem sie mit illegalen und halblegalen, schattenwirtschaftlichen Aktivitäten einen „selbstverstärkenden Aufzehrungsmechanismus“ (Scrubar 1991) förderte. Offen bleibt, über welche Prozesse die Einstellungsmuster in der gesellschaftlichen Gemeinschaft auf die gesellschaftliche Integration zurück wirkten. Auch bei Meuschel deutet sich die Thematisierung der individuellen Einstellungsmuster nur in der Legitimationsdefinition - Legitimation als Orientierung an einen systemspezifischen Wertekatalog - an. In diese Lücke stoßen die Untersuchungen von Bude und Scrubar. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den normativen Widersprüchen und einer Disposition für einen Regimewechsel, wie Bude am Fall DDR zeigt (1993): Die Legitimation der DDR über die antifaschistische Politikkonzeption war eine „tragische“ Selbstbeschreibung. Tragisch war sie, weil sich das gesellschaftliche Streben gegen Verfall und Untergang richtete. Als konstitutives Prinzip der DDR-Gesellschaft fungiert das Ideal der universellen Gerechtigkeit, die in der Tugend der sittlichen Aufrichtigkeit ihr adäquates Persönlichkeitskonzept findet. In der tragischen Perspektive des Antifaschismus ist der Faschismus aus dem Verlust der Einheit der Arbeiterklasse entstanden. Einem ähnlichen erneuten Verfall mußte vorgebeugt werden. So wurden unter anderem auch die Aktivitäten des Stasiapparats und die Tendenz zum Totalitarismus des Systems gerechtfertigt. Zwar bestimmte bis in die 80er Jahre hinein das antifaschistische Selbstverständnis das Identitätsbewußtsein der Jugend. Zunehmend verschob sich aber das Primat der Identifikation auf die DDR als eine im Aufstieg begriffene Gesellschaft. Mit den Reformen der Eigentumsordnung in den 50er und 60er Jahren allerdings kam es zu „Statusge- Zusammenbruch der alten Ordnung 67 winnlern“ (Bude 1993: 276), die bestrebt waren, ihre Position gegenüber Jüngeren und Nachzüglern zu verteidigen. Dieser Legitimationswechsel hin zu einer „teleologischen Legitimation“ – wie auch von Holmes (1993) und Meuschel (1991) beschrieben - legte den Grundstein für die Aushöhlung der antifaschistischen Legitimationsgrundlage. Die Abgrenzung der Aufsteigenden stand im Widerspruch zum Konzept der Einigkeit. Verstärkt wurde der Widerspruch durch die sich in der DDR etablierende Konfliktvermeidungsstrategie, deren Grundlage persönliche Beziehungen - die den Zugang zu den beliebten Westgütern ermöglichten - bildeten. Die Gesellschaft war in der Wahrnehmung ihrer Bürger, die die soziale Ungleichheit täglich erfahren mußten, nicht authentisch. Die Folge davon war eine zweite Gesellschaft neben der des Antifaschismus. Parallel zur „sittlichen Aufrichtigkeit“ in der Öffentlichkeit suchte man sich in dieser Nische seine individuellen Vorteile. Die individuelle Wahrnehmung dieses kulturellen Zusammenbruchs im DDR-Alltag ließ bei der Bevölkerung die Disposition für eine Wende entstehen. Scrubar beschreibt, wie sich die strukturellen Merkmale kommunistischer Gesellschaften auf die normativen und moralischen Haltungen gegenüber dem Regime - und somit auf die soziale Identität und Solidarität - auswirkten. Unter den Bedingungen der „Privatisierung des Staates durch die Partei“ (Scrubar 1991: 418) und der Verstaatlichung der Wirtschaft wurde die primäre Integrationsleistung nur noch durch Umverteilungsnetzwerke erbracht. Sie nutzten auf illegale bzw. halblegale Weise die staatlichen Ressourcen und Institutionen für ihr Selbstinteresse. In der Abhängigkeit der einzelnen von diesen Netzwerken und damit der Erfahrung mangelnder Autonomie lag die Ursache für eine partikularisierende Selbstdefinition der Individuen (Scrubar 1991: 424): Individuelle Leistungen blieben weitgehend unbedeutend. Wichtig waren familiärer und freundschaftlicher Zusammenhalt in den Netzen. Die Gesellschaft dividierte sich entlang dieser Identifikationslinie; über die Netzwerke hinaus gab es keine Solidarität. Gesellschaft wurde als „Feindesland“ (Scrubar 1991: 424) definiert. Scrubar zeigt mit dem Rückgriff auf Parsons, daß in der dichotomen Unterscheidung des „wir“ und der „anderen“ der Grundstein für eine Demodernisierung auf der Ebene der sozialen Beziehungen und normativen Muster gelegt war. Zwei wichtige Errungenschaften moderner Gesellschaften hat der Kommunismus abgeschafft. Dies sind die Motivationsfähigkeit des Geldes und die Kalkulierbarkeit des Handelns (auf Grund der Formalisierung sozialer Beziehungen durch positives Recht). An ihre Stelle traten die Netzwerke. Für die Situationsdefinition solcher Gesellschaften ergibt sich nach Parsons‘ Kategorien der pattern variables18 die Zuordnung zu „particularistic-ascriptive patterns“ (Parsons 1951). Das heißt, Errungenschaften und Wohlstand einzelner sind nicht durch Leistung erworben, 18 Pattern variables bilden ein von Parsons entwickeltes analytisches Schema, mit dem sich soziale Phänomene (Handlungsorientierungen, aber auch Gesellschaften oder Kulturen) klassifizieren und beschreiben lassen (vgl. Parsons 1951: 46f). Zusammenbruch der alten Ordnung 68 sondern auf der Basis von zugeschriebenen Eigenschaften (Positionen bzw. Schlüsselstellungen bei dem Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen), in der Regel illegal entstanden. Moderne Gesellschaften hingegen zeichnen sich durch ein „universalisticachievement pattern“ aus. Wohlstand soll primär eine leistungsbegründete Eigenschaft sein. Die Identitätskonzepte in den kommunistischen Gesellschaften bauten auf eine normative Haltung der Loyalität gegenüber den Netzwerken auf und wurden durch die Erfahrung, daß Leistung nicht belohnt wird, geprägt. Hier sind die desintegrierenden, moralischen Vorbehalte gegenüber den Errungenschaften (Wohlstand) anderer angelegt. Es gab keine übergreifenden verallgemeinerten Werte, die unter den strukturellen Bedingungen des Kommunismus politische Solidarität stiften konnten bzw. Ungleichheiten rechtfertigten. Die strukturellen Defizite waren in Scrubars Perspektive zu tief in den dichotomen sozialen Identitäten verwurzelt. Die Untersuchungen zu den Legitimitätsversuchen kommen zu dem Schluß, daß die vielfältigen Ansätze einer Wertverallgemeinerung die bestehenden Widersprüche der Systeme nur stärkten oder neue heraufbeschworen, sie aber in keinem Falle abbauen konnten. Neue Formen der Legitimation verfingen sich im Widerspruch zu den Werten der vorherrschenden Ideologie. Die motivationale Unterstützung des Systems scheiterte an den Spannungen, die sich aus der ökonomisch-politischen Entwicklung einerseits und der marxistisch-leninistischen Ideologie andererseits ergaben. Symbolische Integrationsversuche realisierten nicht das angestrebte Ziel, weil sie nicht bei der grundsätzlichen Spannung ansetzten und damit an den Erwartungen der Bevölkerung vorbeisteuerten. Vor dem Hintergrund einer quasi-religiösen Ideologie konnte es kein rationalisertes Verhältnis der Gesellschaft und Bürokratie gegenüber der die Macht und Herrschaft ausübenden Führung geben. Integrationsversuche über die Formulierung neuer Legitimationskonzepte trugen vielmehr zur Spaltung der Gesellschaft bei. 1.4 Zusammenfassung Mit der Klärung struktureller Variablen beschreiben systemtheoretische Ansätze im allgemeinen und strukturtheoretische Ansätze im speziellen die Konstitutionen von oben, die als „exogener Schock“ Verhaltensänderungen hervorruft und neue Handlungsoptionen entstehen läßt. Damit liefern sie einen von vielen Bausteinen im Erklärungsgebäude für den gesamten Transformationsprozeß. Die Systemtheorie beschreibt die Prozesse auf der Makroebene des komplexen Transformationsphänomens und liefert damit einen komplementär-ergänzenden Ansatz zur Transformationsforschung. Mit ihr können Zyklen thematisiert werden, die zur Krise Zusammenbruch der alten Ordnung 69 und zum Zusammenbruch des Staatssozialismus geführt haben. Somit läßt sich verstehen, unter welchen Bedingungen das „Transformationsfenster“, das die Chance für einen demokratisch-marktwirtschaftlichen Umbau bietet, in den kommunistischen Gesellschaften entstehen konnte. In der Kategorisierung strukturtheoretischer Transformationsanalysen als entweder konflikttheoretisch oder konvergenz- bzw. modernisierungstheoretisch liegt eine unfruchtbare Dichotomisierung. Die Kategorien verweisen jeweils auf eine der Ausprägungen der vielseitigen und sich wandelnden zwischenstaatlichen Beziehungen. Die Unterscheidung in konflikt- oder konvergenz- bzw. modernisierungstheoretische Ansätze kann lediglich auf die analytische Präferenz der Autoren verweisen; sie kann nicht eine allgemeine Charakterisierung der Transformationsbedingungen darstellen. Die Einordnung der Ansätze anhand dieser Attribute beschreibt ein analytisches Primat bei der Untersuchung und Erklärung zweier paralleler und sukzessiver Prozesse. Sowohl bei den geopolitischen, als auch bei den modernisierungstheoretischen Ansätzen sind die Erklärungslücken offensichtlich. Sie leisten allerdings eine Konkretisierung der evolutionären Vorbedingungen des Zusammenbruchs, wie sie von der Systemtheorie beschrieben werden. Mit der geopolitischen Theorie können einige von der Systemtheorie angedeutete Umwelteinflüsse in ihrer Wirkung auf die Stabilität des alten Regimes konkretisiert werden. Die Modernisierungstheorie zeigt z.T. anhand des Beispiels konkreter Staaten, zu welcher Problematik interne Differenzierungsefizite führen. Der Zusammenhang von diesen externen und internen Prozessen wird an der Schnittstelle von geopolitischer (Konflikt-)Theorie und modernisierungstheoretischer Konvergenztheorie inhaltlich begründet. In der Systemtheorie bildet der Zusammenhang von Umwelteinflüssen und interner Differenzierung einen zentralen Bestandteil der Stabilitätsanalyse. Sie liefert somit den theoretischen Überbau für die Zusammenführung zweier Theoriekonzepte. Der systemtheoretische Beitrag zur Transformationsforschung ist im wesentlichen ein heuristischer: Die Theorie soll die Makroebene der Transformation beschreiben. Den Modellen wird damit der Status von Deskription-, Struktur und Ordnungstheorien zugestanden, die uns befähigen, die Auflösung ehemals stabiler Strukturen nachzuzeichnen19. Die Grenze des systemtheoretischen Beitrags liegt aber nicht nur in diesem zu19 Hondrich (1990) schlägt vor, mit Hilfe seiner systemtheoretisch inspirierten Theorie sozialer Differenzierung Hypothesen zur Veränderung sozialistischer Gesellschaften entlang der diskriminierenden Variablen, die sich aus dem unterschiedlichen Differenzierungsgrad gegenübergestellter Gesellschaftstypen ergeben, empirisch zu prüfen. Mit seinem Vorschlag weist er gleichzeitig auf eine Problematik hin, die von anderen systemtheoretisch orientierten Autoren unberücksichtigt gelassen wird: Daß das differenziertere System problemlösungsfähiger bzw. überlegener ist, ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Ein höherer Differenzierungsgrad birgt prinzipiel Konfliktpotenziale durch mangelnde Integration. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, Gesellschaften nichtunterdrückter Differenzierung nicht per se als überlegenes System anzunehmen, sondern mit Hondrich nach den Bedingungen zu fragen, unter denen stärker differenzierte Systeme Probleme besser lösen. Zusammenbruch der alten Ordnung 70 rückgenommenen theoretischen Anspruch, der sich konsequenterweise in dem zurückgenommenen Universalisierungsanspruch der Autoren (Sandschneider 1994) manifestiert. Auf sie stößt man auch bei den konkreten Dynamiken und verschiedenen Optionen des Wandels. Brie, der sich um eine vergleichsweise konkrete Darstellung bemüht, muß für die Beschreibung der Transformation der Sowjetunion (und z.T. der DDR) schon über die reine Evolutionslogik hinausgehen. Die Evolution beschreibt nur die Prozesse, die zur Entstehung des „Transformationsfensters“ führen. Auf der Grundlage der strukturellen Merkmale staatssozialistischer Systeme können systemtheoretisch zwar Paradoxien bzw. Widersprüche mit evolutionären Mechanismen nachgewiesen werden, die nach Bewegung bzw. Auflösung der Statik verlangen. Die Richtung der Bewegung ist aus dieser Perspektive allerdings keineswegs eindeutig. Denn die verhinderte funktionale Differenzierung mit ihren Folgeerscheinungen allein kann noch nicht den Zusammenbruch des System beschreiben (vgl. auch Merkel 1994)20. Aus diesem Grunde entsteht aus der evolutionär entstandenen Situation auch ein Handlungsvakuum für die relevanten und betroffenen Akteure. Der Verlauf und die Lösung der Krise sind aus systemtheoretischer Perspektive kontingent. „Lösungen“ wie in China sind ebenso möglich wie die Lösungen, die in Osteuropa angestrebt wurden. Aber nicht nur die Systemtheorie, sondern grundsätzlich alle makrotheoretischen Ansätze der Transformationsanalyse haben ein Defizit auf der Akteursebene. Auf der Mikroebene verlieren sie an analytischer Schärfe (vgl. Müller 1991). Sie zeigen zwar Strukturdefizite auf, vor deren Hintergrund sich innergesellschaftliche Konflikte entfesseln. Der Verlauf solcher Konflikte aber kann von den in diesem Kapitel vorgestellten Argumenten nur in den Makrodimensionen struktureller Änderungen (bspw. ökonomischer Konjunkturen, Legitimationskampagnen) nachgezeichnet werden. Die Rolle der gesellschaftlichen Akteure scheint sich selbst in der konkreteren strukturtheoretischen Perspektive auf ein passives Reagieren auf veränderte Makrovariablen zu reduzieren. Der Vergleich verschiedener, historischer „Charaktertypen“ (vgl. Mänicke-Gyöngyösi 1993) und der Verweis auf die Bedeutung individueller Dispositionen für die strukturellen Änderungen (vgl. Tatur 1991) läßt die Prozesse aktiver, d.h. intentionaler Politik- 20 Als Gegenbeispiel soll an dieser Stelle auf Pollack verwiesen werden (1990). In seinen systemtheoretischen Überlegungen zum gesellschaftlichen Umbruch in der DDR reagieren die Akteure nur auf system- und strukturimmanente Prozesse, d.h. systeminterne und -externe Faktoren, die zum Umbruch führen. Die zentrale Ursache für den Umbruch liegt seiner Auffassung nach in der „explosionartigen Austragung“ der Probleme der ineffizienten - weil undifferenzierten - DDR durch den Aufbruch der Geschlossenheit der Systemgrenzen mit der Öffnung der ungarischen Grenze zum Westen 1989. Mit dem Zusammenbruch des Systems entstehen aber auch Optionen für Verhaltensänderungen und für die Neugestaltung von Institutionen. Pollack kann diese Art der Gestaltung und Veränderung der DDR nicht konsistent in den selben Kategorien fassen wie den evolutionären Zusammenbruch; die Logik seiner Erklärung bricht, da er den Prozeß nach dem Zusammenbruch in Handlungs- und Strategiekategorien beschreibt. Deswegen bemerkt Sandschneider zurecht: „Pollack bekommt mit seinem Ansatz eine, aber eben nur eine wesentliche Ursache für den Zusammenbruch der DDR analytisch gut in den Griff.“ (Sandschneider 1990: 38). Dies ist die Ursache, die sich systemtheoretisch erfassen läßt: die funktionalen Defizite der Entdifferenzierung durch Universalisierung einer Leitdifferenz. Zusammenbruch der alten Ordnung 71 gestaltung weitgehend unberücksichtigt. Die internen Dynamiken bleiben aus der strukturtheoretischen Perspektive weitgehend undurchsichtig. Somit kann auch keine makrotheoretische Untersuchung beanspruchen, die Frage nach den letztendlichen Ursachen beantwortet zu haben. Der in den geopolitischen Analysen unterstellte Determinismus greift nicht, weil es sich bei der Transformation um Prozesse handelt, die hochgradig kontingent sind! Der Determinismus scheitert bei der Erklärung von Abwärts- und Krisenbewegungen, die von Erholungsphasen eingeholt wurden, und er scheitert auch an der Erklärung der Unterschiede in den Entwicklungen der einzelnen osteuropäischen Länder. Die sehr unterschiedlich und überraschend verlaufenden Transformationen widersprechen der Annahme, die Handlungen folgten immer nur den Makroprozessen der Geopolitik. Der unterstellte Allgemeinheitsgrad des Wirkungsmodells bringt bei zwei entscheidenden Fragestellungen eine Unschärfe mit sich: Wie Innerelitenkonflikt und öffentliche Reaktion auf die Belastungen im internationalen Konflikt verlaufen und welche Option der „Lösung“ des Staatszusammenbruchs sich durchsetzt bzw. gewählt wird (Revolution, Erholung oder territoriale Desintegration), kann nicht erklärt werden. Die Modernisierungstheorie thematisiert Transformationsprozesse über langfristige Perioden, aber hinterfragt dabei das Konzept der funktionalen Differenzierung auch auf seine motivationalen Grundlagen. Insofern ist der modernisierungstheoretische Ansatz „... eine angewandte Theorie, die Theoriestücke aus verschiedenen Paradigmen in raumzeitlichen Zusammenhang bringt, um z.B. den Übergang von traditionellen zu sich entwickelnden Gesellschaften aus notwendigen strukturellen Voraussetzungen und hinreichenden take-off Innovationen (z.B. getragen von siegreichen Eliten) zu begreifen.“ (Zapf 1996: 172). Unklar bleibt aber auch hier, wie sich die funktionalen Erfordernisse der Makroebene in die entsprechenden Handlungsstrategien der beteiligten Akteure umsetzten. Damit bleiben relevante Interessen und Herrschaftsverhältnisse unberücksichtigt (vgl. Müller 1991). Kurzfristige Prozesse können nicht mit dem Instrumentarium der Modernisierungstheorie erklärt werden. Die Ansatzhöhe der Beiträge zur Transformationsanalyse in diesem Kapitel liegt auf der längerfristigen Ebene der Jahreszahlen. Die durch die strukturtheoretischen Ansätze erfolgte Konkretisierung systemtheoretischer Krisen- und Zusammenbruchsevolution hat - wie die Systemtheorie - Grenzen bei der Erklärung des Transformationsprozesses. Die historischen und strukturellen Voraussetzungen für die über eine Revolution oder den institutionellen Wandel erfolgende Transformation sind zwar geklärt, aber warum z.B. die Bevölkerung auf die Legitimitätskrisen in einer bestimmten Weise reagiert, wird nur angedeutet. Bei den Modernisierungstheorien läßt sich allerdings oft eine gewisse theoretische Bescheidenheit beobachten. Bei der inhaltlichen Diskussion der Transformationsprozesse Zusammenbruch der alten Ordnung 72 wird an vielen Stellen auf Defizite oder Ungenauigkeiten hingewiesen. Grenzen der Erklärung werden aufgedeckt. Die Ansätze öffnen sich theoretisch in zwei Richtungen. Einmal öffnen sie sich nach oben, d.h. zur Ebene der allgemeineren Variablen: An dieser Stelle können die Systemtheorie - mit dem Nachweis der allgemeinen Differenzierungsproblematik in kommunistischen Gesellschaften - und die Geopolitische Theorie mit der Bestimmung der Makrovariablen auf der zwischenstaatlichen Ebene - analytische Erkenntnisse vorlegen. Zum zweiten öffnen sich die Modernisierungstheorien nach unten: Akteurs- und institutionentheoretische Ansätze können mit spezifischeren Analysen bezüglich der internen Entwicklung anschließen. Einige der strukturtheoretischen Ansätze verweisen explizit auf die Schnittstellen zu Theoriekonzepten, die die für die Liberalisierung und den darauf folgenden politischen Wandel relevanten Interaktionen thematisieren. Bei Pye (1990) z.B. ist die vom Charakter der politischen Kultur geprägte Beziehung zwischen „Subjekten“ und Herrschern ausschlaggebend für das Ergebnis des Zusammenstoßes der unterschiedlichen Kulturen. Kulturell geprägte Psychodynamiken entscheiden über die Art der Reaktion auf politische Repression und Terror. Sie tragen so zum Wandel des Systems bei. Auch Weedes (1992) geopolitische Ausführungen machen deutlich, daß auf Akteure und deren Gestaltung - für eine vollständige Erklärung des Transformationsprozesses - nicht verzichtet werden kann. Weede selbst verweist auf die Handlungstheorie Kurans (vgl. 1989; 1995), um die Beziehung zwischen den Prozessen in der Sowjetunion und den Prozessen in den anderen osteuropäischen Staaten zu klären. So läßt sich eher verstehen, warum die Prozesse in diesen Staaten anders verliefen und wesentlich von der Entwicklung in der ehemaligen UdSSR beeinflußt wurden21. Aber auch die Änderung institutioneller Strukturen, die dem Bestreben folgt, eine neue Legitimationsgrundlage zu schaffen - wie mit den Analysen Holmes‘ beschrieben -, ist ein Akt, der nach Entscheidung von Eliten verlangt. Selbstredend spielen hier strategische oder vielleicht auch andere individuelle Motive eine Rolle: Akteure reagieren auf institutionelle Änderungen und entscheiden so mit über den Erfolg bzw. Mißerfolg von Reformen22. Prozesse auf der institutionellen Ebene mit ihren spezifischen Kombinationen von Akteuren und Strategien werden von Ansätzen, die die Transformation auf der Mesoebene untersuchen - wie der „Neuen Institutionellen Theorie“ - thematisiert. Sie tragen zur Klärung der Beziehung zwischen den strukturellen Variablen und dem Handeln der Akteure bei. 21 Weede bezeichnet die Entwicklung in der UdSSR als „Trigger“ für den freieren Ausdruck oppositioneller Präferenzen in den anderen osteuropäischen Staaten (1992). Eine ähnliche Argumentation verfolgt Huntington. Um zu erklären, warum Demokratisierungen in „Wellen“ auftreten, führt er das Konzept des „Snowballing“ ein (1993: 33): „Knowledge of significant political events is increasingly transmitted almost instaneously around the world. Hence event x in one country is increasingly capable of triggering a compareable event almost simultaneously in a different country.“. 22 Auch Zapf teilt die Ansicht, daß mit dem Verweis auf die dramatischen Umbrüche Ansätze anderer Paradigmen – nämlich akteurstheoretische, strategische und elitentheoretische Ansätze der Politikwissenschaft – zur Analyse der Transformation herangezogen werden müssen (1996: 176). Zusammenbruch der alten Ordnung 73 2. Mesotheoretische Ansätze Der Beitrag der Mesotheorien läßt sich am besten einschätzen, wenn man sieht, worin sich die theoretischen Konzepte, auf die diese Bezeichnung paßt, von den makrotheoretischen einerseits und den mikrotheoretischen Ansätzen andererseits unterscheiden. Eine Grenzziehung ist allerdings nicht unproblematisch. Institutionentheoretische Ansätze versuchen nämlich, die in einem solchen Vergleich angelegte Gegenüberstellung und damit die traditionellen Grenzen zwischen theoretischen Paradigmen zu überwinden. Sie versuchen sowohl Mikroelemente als auch Makroelemente für die Erklärung bzw. für das Verstehen sozialer Phänomen miteinander zu verbinden. Allerdings läßt sich allein mit der Berücksichtigung von Institutionen noch nicht eine Überwindung des Dualismus von Struktur und Handlung reklamieren. Die Operationalisierung des Institutionenbegriffs kann durchaus in Übereinstimmung mit der traditionellen Logik der Mikro- bzw. Makroansätze erfolgen. In diesen Fällen ist eine Abgrenzung zu strukturtheoretischen und akteurtheoretischen Ansätzen kaum möglich; die alte Dichotomie bleibt bestehen. Erst die neueren Konzepte, die den Institutionenbegriff mit einer Korrektur der traditionellen theoretischen Prämissen einführen, liefern einen Erkenntnisgewinn, der sich von den Einsichten der Makro- und Mikrotheorien deutlich unterscheidet. Die Leistung der Mesotheorien läßt sich besonders gut im Vergleich der Prämissen der älteren institutionentheoretischen Ansätze mit den Prämissen der neueren Ansätze veranschaulichen. Die Prämissen liegen bei den anthropologisch-psychologischen Begründungen der den Theorien zugrunde gelegten Menschenbilder. Entsprechend dieser theoretischen Fundamente führen die älteren Ansätze Institutionen entweder in kulturalistischer oder in kalkulatorischer Terminologie ein (vgl. Göhler / Kühn 1999). Neuere Ansätze verbinden beide Aspekte und heben sich dadurch prinzipiell auch von den Ansätzen des vorangegangenen Kapitels („Makrotheoretische Analysen“) und des nachfolgenden Kapitels („Mikrotheoretische Analysen“) ab, ohne dabei ihre Anschlußfähigkeit zu verlieren. Der Fokus dieses Neuen Institutionalismus liegt auf einer genuin anderen Ebene als der strukturtheoretischer oder akteurstheoretischer Ansätze. Dies ist die Ebene der Institutionen. Mit der Erklärung der Ursachen für die Dynamiken auf der Ebene der Institutionen (Entstehung, Bestehen und Zerfall von Institutionen) weitet sich die Perspektive und greift zurück auf Variablen der übergeordneten Ebene, der Strukturen, oder der untergeordneten Ebene, der Akteure. Dieser Rückgriff erfolgt allerdings nicht in einer Logik, die Institutionen reduktionistisch entweder rational-kalkulatorisch oder in Kultur auflöst, also jeweils als abhängige Variable betrachtet. Vielmehr sind Institutionen unabhängige Variablen, die unter speziell anzugebenden Bedingungen zu abhängigen Variablen werden können. Zusammenbruch der alten Ordnung 74 Von der eigenständigen Perspektive des Neuen Institutionalismus können wir neue Einblicke in die Dynamiken der Transformation erwarten und bei den institutionentheoretischen Ansätzen zum Zusammenbruch der kommunistischen Regime Osteuropas versuchen nachzuvollziehen. Dabei ist es unerheblich, in welche Richtung der Blick von der Ebene der Institutionen gelenkt wird - auf die sozialer bzw. kultureller Strukturen oder auf die der Akteure -, solange deutlich bleibt, mit welchen Prämissen der Institutionenbegriff eingeführt wurde. Die Variationen, die es hier gibt, sollen im folgenden erörtert werden. 2.1 Exkurs: Institutionentheorien Im Kontext des vorliegenden Themas liegt es nahe, die Vielfalt der institutionentheoretischen Ansätze entlang theoretischer Grundkategorien wie Mikro- bzw. Makroprimat oder rational-kalkulatorische Begründung von Institutionen versus Überindividualität von Institutionen einzuteilen. Allerdings folgt diese Einteilung der bereits erwähnten dichotomisierenden Logik, die zwar für einen Teil der Ansätze eine zutreffende Kategorisierung sein mag, aber den hier interessierenden speziellen Beitrag der Ansätze marginalisieren würde. Institutionentheoretische Ansätze wollen die Reduktion auf entweder Handlung oder Struktur vermeiden, weil die Inkonsistenzen zwischen der beobachteten Welt und den reduktionistischen, theoretischen Konzepten allzu offensichtlich sind und somit nach einer Veränderung der Perspektive verlangen (vgl. March / Olsen 1989: 1). In dieser neuen Perspektive muß man nach dem speziellen Beitrag der institutionentheoretischen Ansätze suchen, wenn Redundanz mit den struktur- oder handlungstheoretischen Ansätzen vermieden werden soll. Um die Methode der Zusammenführung traditionell sich widersprechender Perspektiven nachzuvollziehen, und um zu verstehen, ob mit diesem Schritt eine Realitätsangleichung der theoretischen Konzepte erfolgen kann, empfiehlt sich ein Blick auf die Genese der institutionentheoretischen Ansätze entlang ihrer Konzeptionalisierung in den unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen. So wie die Disziplinen dazu übergehen, Erkenntnisse benachbarter Disziplinen für ihre theoretischen Konzepte zu nutzen, steht die parallele Zusammenführung der älteren Konzepte in den neueren, aktuellen Ansätzen für eine profitable Theorieerweiterung. Ausgangspunkt für die neuere Konzeptionalisierung des Institutionenverständnisses bildeten die sich gegenüberstehenden Perspektiven der Institutionenökonomie einerseits und des soziologischen Institutionenverständnisses andererseits. In der ökonomischen Disziplin wurden Institutionen als Randbedingungen – Constraints – rational-kalkulatorischen Handelns operationalisiert. Diese Perspektive forcierte ein „exogenisiertes“ Verständnis von Institutionen. Die soziologische Perspektive wurde durch Parsons In- Zusammenbruch der alten Ordnung 75 stitutionenverständnis geprägt, bei dem die Internalisierung von institutionalisierten Handlungsmustern, Normen und Werten im Vordergrund steht. Institutionalisierte Handlungsmuster werden in Parsons Verständnis Bestandteil der Bedürfnisdisposition des Persönlichkeitssystems. Somit liegt dieser Perspektive, wie Edeling (1999) es ausdrückt, eine „Endogenisierung von Institutionen“ zugrunde. Beide Perspektiven repräsentieren ein reduktionistisches Verständnis von Institutionen; Entweder wird rationalistisch argumentiert oder kulturalistisch. Erst der Neue Institutionalismus der Soziologie überwindet den Reduktionismus (vgl. Powell / DiMaggio 1991). Die impliziten akteurstheoretischen Prämissen der Institutionenökonomie und des soziologischen Institutionenkonzepts wurden überprüft und auf der Grundlage neuerer kognitionspsychologischer, lerntheoretischer und attributionstheoretischer Erkenntnisse korrigiert. Die Politikwissenschaft, zumindest in der angloamerikanischen Tradition, formulierte ihre institutionentheoretischen Modelle nah an der Logik der Institutionenökonomie, d.h. auf der Basis von im Wettbewerb stehenden, rational kalkulierenden Individuen. Aber auch hier setzte eine Wende ein, die in dieselbe Richtung zeigt wie der Neue Institutionalismus in der Soziologie. Die in den älteren Ansätzen erfolgte anthropologische Begründung von Institutionen in Anlehnung an A. Gehlen wird in den neueren Ansätzen mit der sogenannten kognitiven Wende in den Sozialwissenschaften verbunden (vgl. Göhler / Kühn 1999; March / Olsen 1989). Die neueren Ansätze in der Politikwissenschaft und der Soziologie versuchen mit ihrem Institutionenkonzept einen Makrodeterminismus zu überwinden, ohne auf die rationalistische Konzeption der Institutionenökonomie oder älterer politikwissenschaftlicher Ansätze zurückzufallen. Für eine präzise Positionsbestimmung der Mesotheorien und ihrer theoretischen Syntheseleistung müssen die Unterschiede in den verschiedenen Konzepten ein wenig genauer betrachtet werden: Die Institutionenökonomie definiert Institutionen als Kontext für strategisches Handeln. Die Institutionen bilden Regeln, die die Anzahl der Alternativen beschränken und den Handlungsspielraum der Akteure eingrenzen, indem sie die relevanten Spieler definieren, Ergebnisse und Alternativen vorgeben und bestimmte Präferenzen für Alternativen nahelegen (Göhler / Kühn 1999). Institutionen entwickeln sich und können bestehen – so die „Economic Theory of Institutions“ (North 1986; 1993) -, wenn ihr Nutzen die Transaktionskosten, die in den Interaktionen anfallen, übersteigt. Transaktionskosten bilden den Fokus der Analyse. Sie entstehen in sozialen Situationen bei Opportunitätsproblemen, bei unvollkommener und asymmetrischer Information sowie bei Bedarf nach kostenverursachender Überwachung. Besonders in einer spezialisierten, komplexen Welt müssen Verträge von Dritten abgesichert werden. Die Akteure entwickeln Zusammenbruch der alten Ordnung 76 deshalb eine Nachfrage nach politischen Institutionen, die bspw. Eigentumsrechte und Machtfragen klären. Die Institutionen reflektieren die Präferenzen individueller und kollektiver Akteure (vgl. Powell / DiMaggio 1991), nämlich die Präferenz, Unsicherheit kostengünstig zu reduzieren. Auch bei sich ständig ändernden Vertragspartnern muß nicht jede soziale Situation vertraglich neu geregelt werden (vgl. Göhler / Kühn 1999), wenn institutionalisierte Handlungsregelungen vorliegen. Institutionen stellen sich als ein effizientes Resultat rational-kalkulatorischen Handelns dar. Sie bilden somit ein intentional begründetes Ergebnis individueller Präferenzen und Handlungen. In politikwissenschaftlichen Ansätzen findet sich eine an die ökonomische Argumentation angelehnte Konzeptionalisierung von Institutionen. Politische Ereignisse und Phänomene werden als Konsequenzen kalkulatorischer Entscheidungen erklärt (March / Olsen 1989: 6): Politische Entscheidungsprozesse finden im Wettbewerb strategischer Akteure statt. Sie lassen sich z.B. mit dem Principal-Agent-Modell (vgl. Colemann 1990), in dem die unterschiedlichen Machtverhältnisse einerseits und die Informationsasymmetrie andererseits Transaktionskosten verursachen, operationalisieren. Die Agenten können nicht auf die Vertrauenswürdigkeit ihrer strategischen Partner bauen. Besonders für den Fall, daß sich die Interessen von Agent und Principal widersprechen, gibt es unzählige Beispiele für Vertrauensbruch der Agenten (Opportunitätskosten) durch Bestechlichkeit. Auch in dem politikwissenschaftlichen Konzept bilden Institutionen, die Vertrauen fördern und Loyalität forcieren, ein effizientes Ergebnis rationalkalkulatorischen Handelns. Die ältere soziologische Institutionentheorie wendete sich gegen diese Modelle rationalkalkulierender Akteure (vgl. Selznick 1949). Institutionen reflektieren nicht nur Präferenzen und Macht der sie konstruierenden Akteure. Vielmehr wurde davon ausgegangen, daß die Institutionen eben diese Präferenzen und Machtverhältnisse formen (Powell / DiMaggio 1991). Institutionen sind unabhängige Variable und damit nicht Ergebnis von Prozessen der Interessenaggregation - bspw. zur Reduzierung von Transaktionskosten. Daher kann auch nicht unterstellt werden, daß Institutionen ein optimales Ergebnis individueller Wahlhandlungen sind. Soziale Ordnung stellt sich nicht über Effektivitätserwartungen und Optimalitätskriterien ein; die Basis des gesellschaftlichen Zusammenhalts bildet das individuelle Commitment, das im Sozialisationsprozeß, der Werte, Normen und Einstellungen transportiert, internalisiert wird. Mit der Internalisierung gewinnt die Kultur eine Vormachtstellung vor kalkulatorischen Motiven. Die theoretische Begründung für die Vormachtstellung von Kultur liefert die Handlungstheorie Parsons‘ (1969a; 1972): Parsons konnte die Institutionalisierung als völlige Übereinstimmung individueller Motive mit den kulturellen Mustern konzeptionalisieren, weil sich über die Prozesse der Internalisierung eine Integration der allgemeinen Wertemuster in die Bedürfnisstruktur Zusammenbruch der alten Ordnung 77 des Persönlichkeitssystems vollzog. Kultur wird zu einem Element der Persönlichkeit. Über diesen Weg bestimmt sie die individuellen Handlungsorientierungen. In dem älteren soziologischen Institutionenverständnis herrschte die Vorstellung, daß Institutionen die Akteure „konstruieren“ und sie einschränken. Auch die institutionentheoretischen Ansätze, die auf der Basis eines rational-kalkulatorischen Menschenbildes argumentieren, konzeptionalisieren Institutionen als Constraints (Rahmenbedingungen), die Akteure einschränken. Nur findet über den Prozeß der Internalisierung in den soziologischen Ansätzen ein „Shift“ von der Fremdkontrolle zur Selbstkontrolle statt; nicht Strafe oder suboptimale Ergebnisse garantieren die Befolgung institutionalisierter Handlungsweisen, sondern eine auf eben diese Handlungsweisen abgestimmte Bedürfnisstruktur. Die beiden sich gegenüberstehenden institutionentheoretischen Richtungen begründen ihre prinzipielle Unterschiedlichkeit mit der Mikrofundierung des Institutionenmodells. Während in der Institutionenökonomie und den älteren politikwissenschaftlichen Ansätzen ein rational-kalkulatorisches Handlungsmodell unterstellt wird, argumentieren die älteren soziologischen Ansätze mit einem zwar begründeten, aber durch die neueren Entwicklungen in der Psychologie und Sozialpsychologie überholten kulturalistischen Modell der Institutionen (Göhler / Kühn 1999). Genauso wenig wie von einem Determinismus ausgegangen werden kann, nach dem die internalisierten Normen und Werte direkt handlungsbestimmend wirken, kann noch ernsthaft ein rein rationalistisches Akteurmodell unterstellt werden. Nicht nur die mangelnde Übereinstimmung der theoretischen Konzepte mit beobachteten Phänomenen der politischen Realität (March / Olsen 1989) legt Zweifel nahe. Auch die theoretischen Arbeiten Simons (1954) und Machs (1978) zum Optimalitätsverlust aufgrund der realistischeren „bounded rationality“ und Kahneman und Tverskys Untersuchungen (1974) zu den vielfältigen Brüchen im rationalen Handeln bilden überzeugende Korrekturen des rationales Akteurkonzepts. Die Korrekturen ermöglichen eine Annäherung der Konzepte (Göhler / Kühn 1999): Einerseits müssen Akteure Entscheidungen treffen, andererseits benötigen sie für ihre Wahl einen kulturell vermittelten Erfahrungshintergrund; kultureller und historischer Hintergrund wirken schon auf der Ebene der Präferenzen. Gewählt wird aus einem Pool möglicher Reaktionsmuster (Schemata, Skripts und Habits). Die Schemata, auf die zurückgegriffen wird, helfen Unsicherheit zu überwinden, die rational nicht bewältigt werden kann23. Mit diesem Handlungsmodell gewinnt der soziologische Neo-Institutionalismus an Flexibilität, weil den Akteuren mehr Entscheidungsfreiheit eingeräumt werden kann. Die Sozialisationstheorie mit ihrer Vorstellung von Identifikation und Internalisierung der 23 Anders verhält es sich bei Risiko. Hier können den möglichen Ergebnissen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden. Gewählt wird dann rational nach der Maßgabe des gewichteten erwarteten Nutzens („expected utility“). Unsicherheitssituationen sind dadurch definiert, daß den Ergebnissen keine Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden können. Zusammenbruch der alten Ordnung 78 institutionalisierten Handlungsvorgaben wird zugunsten eines kognitions- und lerntheoretischen sowie attributionstheoretischen Instrumentariums zurückgewiesen (Powell / DiMaggio 1991): Von den Kognitionstheorien wird die Einsicht übernommen, daß Akteure in unsicheren, neuen Situationen weniger nach zusätzlicher Information suchen. Sie nutzen eher die Möglichkeit, auf Routinen, Schemata und Skripte zurückzugreifen. Die Lerntheorien liefern die Einsicht, daß Individuen Informationen in sozialen Kategorien organisieren. Und eine wesentliche Einsicht der Attributionstheorien ist, daß nicht nur Intentionen das Handeln motivieren, sondern daß Akteure oft in umgekehrter Logik vom Handeln auf ihre Motive schließen. Mit der Integration dieser Einsichten in die soziologische Theorie vollzog sich ein „kognitive turn“ auch in der Soziologie der Institutionen. Der NeoInstitutionalismus wechselte von dem normativen zu einem kognitiven Handlungsansatz. Die Kognitionen laufen großenteils nebenbewußt. Sie folgen Routinen und Konventionen. Die gesellschaftlichen Normen sind nicht mehr unmittelbar im Persönlichkeitssystem verankert, sondern werden von Akteuren flexibel gehandhabt. Die Handlungstheorie des Neo-Institutionalismus ist eine Theorie der Praxis, bei der einerseits die kognitve Handlungsdimension stärker betont wird als bei Parsons und andererseits der kalkulierende Aspekt von Kognitionen zugunsten vorbewußter Prozesse reduziert wird. Powell und DiMaggio fassen das Neue an diesen Ansätzen in zwei Punkten treffend zusammen (1991: 24): 1. Der Neo-Institutionalismus etabliert die Zentralität von Kognitionen. 2. Der Neo-Institutionalismus betont die praktische, halbautomatische und nicht-kalkulierbare Natur der praktischen Überlegungen. In der Politikwissenschaft fand eine ganz ähnliche – wenn auch anders motivierte – Entwicklung statt (March / Olsen 1989): Im politikwissenschaftlichen Neo-Institutionalismus bzw. der Theorie politischer Institutionen wurde das Modell des rationalen Wettbewerbs zwischen den Akteuren korrigiert. Auch im politischen Prozeß gibt es Handlungsregeln, die nicht ergebnisorientiert sind. Akteure orientieren sich an Routinen, Konventionen, Prozeduren und Rollen, die in einem Sozialisationsprozeß erlernt wurden. Diese Routinen sind in den politischen Institutionen, wie dem Parlament, den Ministerien, den Gerichten, den administrativen Einheiten, verankert. Der politische Entscheidungsprozeß findet nach einem weitgehend standardisierten Handlungsmuster statt und nicht primär instrumentell unter Nutzung von Machtvorteilen. Die Akteure folgen den Anforderungen ihrer Positionen und der Situationen und handeln nach der Maßgabe ihrer Verpflichtung sowie unter Abschätzung der Angemessenheit. Zusammenbruch der alten Ordnung 79 Für die politischen Institutionen bedeutet das zweierlei: Erstens haben sie eine unabhängige Position gegenüber den individuellen Motiven. Interessen und Präferenzen entwickeln sich innerhalb des Kontextes institutioneller Handlungen. Und zweitens kommt den politischen Institutionen eine symbolische Funktion zu: sie definieren Identitäten auf der individuellen, der Gruppen- und der sozialen Ebene24. Dennoch sind die Akteure in den politischen Prozessen nicht gefesselt. Politik entsteht aus der Verknüpfung von Institutionen, Individuen und der jeweiligen Situation (March / Olsen 1989: 15): Die Informationen über die Konsequenzen von Alternativen werden in institutionalisierten Netzwerken generiert und kommuniziert. Außerdem werden die Erwartungen über zukünftige Präferenzen in Institutionen entwickelt, die wiederum Werte und Bedeutungen von Handlungen definieren. Damit stehen Institutionen für zwei gesellschaftliche Funktionen: Entscheidungen werden durch sie verständlich und z.T. vorhersehbar, und sie leisten mit ihrem symbolischen Gehalt, ihren Riten und Zeremonien, Wichtiges zur Integration der Gesellschaft25. 24 Als Institutionen werden also sowohl soziale Gebilde als auch sozial normierte Verhaltensmuster verstanden (vgl. Mayntz / Scharpf 1995a: 40). „Institutionen umfassen demnach die Strukturen politischer Koordination sowie die kollektiven Sinnwelten, die ihnen Stabilität und Legitimität verleihen.“ (Eisen / Wollmann 1996: 21). 25 Eine anthropologische Begründung für diese Funktionen von Institutionen liefern Göhler und Kühn mit der Herleitung ihres Konzepts einer „Theorie politischer Institutionen“ (Gühler / Kühn 1999): Sie entwickeln ein Institutionenkonzept in Anlehnung an das Institutionenverständnis von A. Gehlen. Danach lassen sich Institutionen instrumentalistisch begründen. Sie stehen für Gewohnheiten, die das Mängelwesen Mensch von Unsicherheit und Kalkulation entlasten. Eine weitere Begründung von Institutionen liegt in ihrer gruppenbildenden Wirkung über die gemeinschaftliche Aktion des rituellen Verhaltens. Rituelles Verhalten ist aber zweckfrei und symbolisch. Institutionen müssen somit sowohl instrumentell als auch zweckfrei begründet werden. Göhler und Kühns Neukonzeptionalisierung des Institutionenansatzes besteht darin, daß sie die funktionale Bestimmung von Institutionen auf funktional differenzierte Gesellschaften übertragen. Ausgangspunkt bildet die Funktionsbestimmung des politischen Teilsystems. Im politischen Prozeß geht es um die Formulierung und Durchsetzung kollektiver Entscheidungen. Als Medium für die Erfüllung dieser Funktionen fungiert Macht (Parsons 1972). Macht bildet daher den Schlüssel zum Verständnis politischer Institutionen. Ähnlich wie bei A. Gehlen legen die Autoren zwei Dimensionen der Macht in ihrer institutionalisierten Form nahe. Sie gehen von einer instrumentellen Machtbeziehung im Weberschen Sinne aus und betonen damit die Zweckgebundenheit politischer Institutionen. Darüber hinaus können sie aber auch in Anlehnung an Hanna Arendt eine nicht zweckgebundene Dimension der Machtinstitutionen ausfindig machen. Macht ist in diesem Verständnis das menschliche Vermögen, miteinander zu reden, zu kooperieren und Handlungen aufeinander abzustimmen. Macht verbindet Handlungs- und Kommunikationsbereiche (Göhler / Kühn 1999: 37). In dieser zweiten Dimension liegt die entscheidende Erweiterung. Über den nicht zweckgebundenen Machtaspekt wird Einheit gestiftet, Integration garantiert. Institutionen der Macht repräsentieren symbolisch gemeinsame Werte und fördern somit die „...Selbstvergewisserung der Mitglieder des Gemeinwesens...“ (Göhler / Kühn 1999: 38). Die Zweidimensionalität der in den Institutionen repräsentierten Machtaspekte spiegelt sowohl die Ideen einer öknomischen Institutionentheorie als auch die des soziologischen Neo-Institutionalismus wider; Institutionen repräsentieren einerseits die instrumentellen Machtbeziehungen (die bspw. zur Durchsetzung der Entscheidungen nötig sind) und die integrationsstiftende symbolische Repräsentation gesellschaftlicher Werte andererseits. Insofern hat sich in den politischen Institutionentheorien parallel zum soziologischen Neo-Institutionalismus eine Synthese kalkulatorischer und kultureller Prämissen vollzogen. Zusammenbruch der alten Ordnung 80 Wie läßt sich diese theoretische Synthese gewinnbringend für die Institutionenanalyse und für die Transformationsanalyse umsetzen? Von einer Mesoanalyse muß man erwarten können, daß sie aufzeigt, über welche Prozesse sich Änderungen auf der Makroebene in Handlungsbedarf und –optionen auf der Mikroebene übertragen. Die Thematisierung institutioneller Prozesse muß sich an der Schnittstelle von systemischen bzw. strukturellen Merkmalen und Dynamiken auf der Handlungs- bzw. Akteursebene bewegen. Die umfassende Fragestellung lautet dann: Auf welche Weise variieren Makromerkmale den Spielraum von individuellen oder korporativen Akteuren, und wie setzen sich Mikroprozesse kurz- und mittelfristig in routinierte, institutionalisierte Prozesse und langfristig in strukturelle und systemische Eigenschaften um? Birgitta Nedelmann (1995) hat eine Checkliste paarweise geordneter Institutionenmerkmale zusammengestellt, deren Ausprägungen über den Zustand und die Dynamiken von Institutionen informieren. In diesem deskriptiven Schema kann sie Aspekte der Mikro- und Makrofundierung von Institutionen integrieren, denn die Merkmale definieren Institutionen gerade in ihrer synthesestiftenden Eigenschaft – der Eigenschaft, sowohl strukturelle Zustände zu repräsentieren als auch Ergebnis strategisch-kalkulatorischer Motive sein zu können. Ein erstes Merkmal bezieht sich auf die Reproduktionsmechanismen von Institutionen. Habitualisierte Handlungsvollzüge – „enacting“ – deuten auf einen hohen Grad der Institutionalisierung. Hingegen kommt es zum „acting“ – strategischen Handeln –, wenn Abweichungen vom institutionalisierten Handlungsvollzug sanktioniert werden müssen (Nedelmann 1995: 17). Das zweite Merkmalspaar bezieht sich auf den Begründungsbedarf von Institutionen. „Internalisierung“ steht für einen hohen Grad der Selbstverständlichkeit institutionalisierter Handlungsvollzüge. „Externalisierung“ hingegen beschreibt die Schutzmaßnahmen, die zur Stützung der Institution und der mit ihr verbundenen Normen und Werte ergriffen werden. Sichtbare politische Rituale repräsentieren eine externalisierte Institutionenbegründung. Bestimmt wird der Begründungsbedarf noch durch ein weiteres Merkmalspaar: Ist mit den institutionalisierten Handlungsroutinen ein intrinsischer Wert verbunden – „Eigenwert von Institutionen“ -, dann bedarf es im Vergleich zu einem Zustand der „Instrumentalität“ von Institutionen weniger Begründungsanstrengungen (Nedelmann 1995: 18). Mit „enacting“, „Internalisierung“ und „Eigenwert“ beschreibt Nedelmann also hochinstitutionalisierte Vorgänge, die routiniert und weitgehend unreflektiert ablaufen. Solche Vorgänge wirken auf der Makroebene strukturierend und strukturstabilisierend. Rückt hingegen der Zweck – „Instrumentalität“ - der Institutionen ins Blickfeld, dann werden die institutionalisierten Handlungen bewußt. Es kommt zu „acting“, und Begründungen in Form von „Externalisierung“ werden angestrengt. Auf der Mikroebene entscheidet sich, wie diese Prozesse umgesetzt werden. Zusammenbruch der alten Ordnung 81 Zwei weitere Merkmalspaare ergänzen die Institutioneneigenschaften um die Bestimmung des Handlungsspielraums und -bedarfs. Leisten die Institutionen eine „Entlastung“ für die Akteure, dann läßt sich von einem hohen Grad der Institutionalisierung ausgehen – hier ist der Handlungsbedarf eher niedrig. Ist die „Belastung“ der Akteure hoch, d.h. besteht Handlungsbedarf, dann muß der Grad der Institutionalisierung niedrig sein (Nedelmann 1995: 19). Die letzte Ausprägung beschreibt den Grad der „Überindividualität“ von Institutionen, der die Vorhersehbarkeit und Selbstverständlichkeit der Handlungsroutinen – und somit auch den Handlungsspielraum – bestimmt. Dem steht der Grad der „Mikrofundierung“ entgegen; müssen Einzelne zur Reproduktion der Handlungsmuster aktiv werden, dann ist der Grad der Institutionalisierung eher niedrig (Nedelmann 1995: 20). In dem durch diese Merkmale definierten Raum institutioneller Ausprägungen können durch Institutionen Handlungsräume eingegrenzt werden, aber auch Handlungsspielräume mit neuen Möglichkeiten26 geschaffen werden. Mit dem Verweis auf die Ausprägungen läßt sich nachvollziehen, aus welchen Grunde bei einer bestimmten Konstitution der Institutionen institutionelle Änderungen nicht angestrebt werden. Ebenso kann angegeben werden, welche institutionellen Zustände offen sind für bewußte und gezielte Änderungen durch Akteure. Mit den Merkmalen liefert Nedelmann die entscheidenden Variablen für eine positionbestimmende Charakterisierung, d.h. für eine Zustandsbeschreibung, von Institutionen. Offen bleibt allerdings die Frage, wie es dazu kommt, daß sich neue Institutionen stabilisieren oder vormals etablierte Institutionen zur Disposition stehen. Um die Dynamik institutioneller Änderungen beschreiben zu können, führt Nedelmann eine weitere Größe ein: das „Flexibilitätsmanagement“ (1995: 22f). Diese Größe bestimmt die institutionelle Stabilität und entscheidet über Prozesse der Entinstitutionalisierung sowie über Prozesse der Institutionalisierung: In einer sich verändernden Umwelt müssen auch bestehende Institutionen flexibel gemanagt werden, um vor Zerfall und Rigidität geschützt zu werden. Ent- und Überinstitutionalisierung müssen vermieden werden. Bei Prozessen der Entinstitutionalisierung wird von „enacting“ auf „acting“ umgestellt. Internalisierte Normen und Werte sind explizit zu begründen, und das institutionalisierte Handeln wird auf Zwecke hin ausgerichtet. Bleibt den Akteuren keine Zeit, dem Prozeß entgegenzusteuern - das institutionelle Arrangement flexibel zu managen -, dann kann es zum institutionellen Zusammenbruch kommen. Die Funktionselite der DDR lieferte ein gutes Beispiel für einen solchen Prozeß: institutionelle Handlungsroutinen konnten nicht flexibel gemanagt werden, obwohl das Bewußtsein über die strukturellen Probleme vorhanden war (Nedelmann 1995: 28). 26 Klassisches Beispiel ist die Institution des Patentrechts; durch die Einschränkung der Verwendung patentierter technischer Neuerungen wird technischer Fortschritt wie wir ihn heute kennen möglich. Erst Patente machen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen lohnenswert und damit zur Handlungsoption. Zusammenbruch der alten Ordnung 82 Bei der Dynamik institutioneller Änderungen wird die Nahtstelle von Makrovariablen und der Mikrofundierung besonders deutlich. Außerinstitutionelle Quellen – exogene Schocks – oder sich widersprechende institutionelle Vorgaben können zwar institutionellen Wechsel von der Makro- oder Mesoebene aus initiieren. Der Begründungsdruck, die Zweifel sowie die Entwürfe neuer institutioneller Modelle verweisen aber auf die Mikroebene. Die Prozesse des institutionellen Umbaus werden von den zentralen Akteuren entlang strategischer Interessen gestaltet (Powell / DiMaggio 1991: 30). Für die Akteure ist das Flexibilitätsmanagement eine „Rational Choice-Belastung“ (Nedelmann 1995: 24). Die Mikrofundierung entscheidet über das Bestehen, den Zerfall und den Neuaufbau von Institutionen. Deutlich wird an dieser Stelle die Öffnung bzw. Anschlußfähigkeit der Mesotheorien nach unten in der Abstraktionsskala sozialwissenschaftlicher Theorieansätze. Im dynamisierten Zustand des institutionellen Wandels kalkulieren die Akteure die Kosten und Nutzen bestehender oder neu zu installierender Handlungsroutinen bzw. Institutionen. Nedelmann spricht sogar davon, daß institutionelle Reformen und Konstruktionen „incentive based“ sind (1995: 30). Die Frage nach den Anreizen stellt sich immer dann, wenn Routinen hinterfragt werden, sich die Internalisierung von Normen und Werten lockert und Handeln sowohl nach außen als auch nach innen gerechtfertigt werden muß – Fragen also, die bei Prozessen der Entinstitutionalisierung auftauchen. Aber auch bei der Konstruktion von Institutionen tauchen sie auf – sie müssen nur positiv gestellt werden: Wie lassen sich Routinen neu einspielen, Werte und Normen internalisieren, und wie kann den Handlungsroutinen ein Eigenwert zugemessen werden. Dennoch finden die Entscheidungsprozesse nicht unter der Bedingung des Naturzustandes statt. Die Wahl der Alternativen - der Gestaltungsspielraum - bleibt durch strukturelle Dimensionen beschränkt und wird von stabilen institutionalisierten Routinen maßgeblich gelenkt. Sie kanalisieren Entscheidungsprozesse und bestimmen die relevanten Akteure. Hier wird deutlich, daß der Ausgangspunkt institutioneller Analysen bei den Makrovariablen struktureller Defizite und institutioneller Widersprüche liegt. Von ihnen aus erfolgt der Verweis auf Ansätze, die in der theoretischen Skala oberhalb der Mesotheorien liegen. Indem die institutionentheoretischen Ansätze selbst auf strukturelle oder evtl. systemische Zusammenhänge verweisen, dokumentieren sie ihre Anschlußfähigkeit an die entsprechenden theoretischen Perspektiven. 2.2 Defizite intermediärer Institutionen Institutionen setzen nicht nur bestimmte Leitideen um und verhelfen gesellschaftlichen Wertorientierungen zur Geltung, indem sie bestimmte Handlungskontexte regulieren und Wertorientierungen etablieren. Institutionen können auch intermediäre Eigenschaf- Zusammenbruch der alten Ordnung 83 ten haben, d.h. zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen vermitteln. Dann leisten sie die vertikale Interessenvermittlung zwischen der Mikro- und Makroebene und regulieren die horizontale Interessenvermittlung zwischen gesellschaftlichen Teilbereichen. Mit einem institutionentheoretischen Ansatz, der intermediäre Institutionen thematisiert, läßt sich konkretisieren, wie strukturelle Defizite institutionalisiert wurden und wie sie auf die Akteure - Eliten und Bevölkerung - wirkten. Mangelnde Intermediarität führte auf der einen Seite zur rigiden, innovationsfeindlichen Elitenloyalität gegenüber der Führungsspitze. Auf der anderen Seite unterdrückte sie wichtige Rückkoppelung, mit der sich die Eliten ein Bild über die Stimmung in der Bevölkerung hätte machen können. Darin liegen die Gründe dafür, daß die strukturelle Unterdrückung gesellschaftlicher Interessenvermittlung und mangelhafte Rückkoppelungsmechanismen auf die Gesellschaften destabilisierend wirkten. Für die Transformationsforschung osteuropäischer Staaten sind Institutionen der horizontalen Interessenvermittlung von einem hervorgehobenen Interesse. Das liegt daran, daß mit der Frage nach den Funktionsbedingungen der untergegangenen Systeme zwei Merkmale ins Blickfeld geraten: die Planwirtschaft und die Parteiherrschaft. Fragt man danach, ob es überhaupt möglich war - und wenn ja, dann wie -, daß unter den Bedingungen einer zentral gesteuerten Planwirtschaft wirtschaftliche Anforderungen erfüllt und Leistungen erbracht werden, dann thematisiert man die Beziehung der zwei gesellschaftlichen Teilbereiche Politik und Wirtschaft. Der Ansatz intermediärer Institutionen versucht, die Verflechtungen und Kanäle der Interessenvermittlung zwischen dem Wirtschaftsbereich und dem politischen Bereich zu untersuchen. Intermediarität bildet auf zweierlei Weise die institutionelle Voraussetzung für die Anpassungsfähigkeit des Gesamtsystems. Sie realisiert gesellschaftliche Integration, weil sie die Voraussetzung für die Partizipation von Interessengruppen bildet. Gleichzeitig sichert sie die funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft, indem sie den Grad der Organisation und die Durchsetzungskraft von Interessen gesellschaftlicher Teilbereiche festlegt. Intermediäre Institutionen leisten die Interessenbündelung und -integration nach innen sowie die Interessenvertretung nach außen (Weinert 1995a: 241). Allerdings sind die intermediären Institutionen an Voraussetzungen für die Erfüllung der Intergrationsfunktion und der Funktion der Sicherung gesellschaftlicher Differenzierung gebunden. Institutionen müssen ein Mindestmaß an Autonomie erreicht haben, damit sie vor Eingriffen übergeordneter Gewalten geschützt sind (Weinert 1995a: 239). Ausdifferenzierte Handlungsarenen der Gesellschaft mit festgelegten Zuständigkeiten und Kompetenzen sowie Akteuren, die nach teilbereichsspezifischen Rationalitäten handeln, bilden die Basis für das Funktionieren intermediärer Institutionen. Gesellschaftliche Teilbereiche können ihre Interessen nach außen nur vertreten, wenn die entsprechenden Instititutionen über Handlungs- und Entscheidungsspielräume verfügen. Zusammenbruch der alten Ordnung 84 Mit diesen Voraussetzungen sind Kriterien benannt, die einen wesentlichen Unterschied zwischen pluralistisch verfaßten und zentralistisch organisierten Gesellschaftssystemen offenlegen: In realsozialistischen Gesellschaften sollten weder gesellschaftliche Teilbereiche Autonomie gegenüber dem politischen Bereich gewinnen, noch war die Bildung bereichsspezifischer Rationalitäten erwünscht. Daher konnte sich in den realsozialistischen Ländern keine Intermediarität entwickeln. Warum aber unterdrückten kommunistische Gesellschaften intermediäre Institutionen, wenn sie doch für die gesellschaftliche Stabilität unabdingbar sind? Für kommunistische Systeme galt allgemein, daß die gesellschaftliche Einheit eine Legitimationsgrundlage bildete. Im gesellschaftlichen Selbstentwurf verstand man sich in Abgrenzung zu den westlichen, kapitalistischen Konkurrenzdemokratien als eine „versöhnte Gemeinschaft“ (Weinert 1995a: 243) - die endgültige Überwindung von Partikularinteressen wurde proklamiert. Den einheitlichen gesellschaftlichen Willen repräsentierte die Partei als exklusiv geltendes generalisiertes Medium. Für die Ausbildung intermediärer Institutionen hatte das gravierende Folgen: Verbände, Parteien und Gewerkschaften mit konkurrierenden Konzepten wurden nicht geduldet, weil Partikularinteressen die Einheitlichkeit bedrohten. Intermediarität wurde als Ausdruck devianter Partikularinteressen mit Strafandrohung (Fraktionsverbot) unterbunden (Weinert 1995a: 245). Politische wie wirtschaftliche Innovationen und Gegenentwürfe gesellschaftlicher Ordnung ließen sich also nicht vermitteln. Die Partei beanspruchte die alleinige Verantwortung für gesellschaftliche Entscheidungen und deren Durchsetzung. Und selbst innerhalb der bürokratischen Hierarchie konnten alternative Ideen nicht vermittelt werden, weil der Handlungs- und Entscheidungsspielraum der nachgeordneten Entscheidungsinstanzen stark eingeschränkt war. Strategische Entscheidungen wurden zu den übergeordneten Ebenen bis zur Parteispitze hin durchgereicht. Eine Vermittlung zwischen den gesellschaftlichen Teilbereichen muß horizontal über die Eliten der Partei und Wirtschaft und die Agenten der Bürokratie und Wirtschaftseinheiten erfolgen. Nomenklatura und Wirtschaftsführer sind die potentiellen Träger der horizontalen Interessenvermittlung zwischen den beiden Bereichen. Untersucht man die Institutionenordnung der osteuropäischen Staaten, dann bekommt man Hinweise auf die Strukturierung der Handlungsarenen und die individuellen Verhaltensorientierungen. Das Verhältnis der leitenden Vertreter von Wirtschaft und Politik läßt sich aus Verfahren der Willensbildung und Entscheidungsfindung ableiten. In den Verfahren zeigt sich, nach welchen institutionalisierten Rationalitätskriterien wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen werden. Am Beispiel der DDR läßt sich verdeutlichen, daß in den kommunistischen Systemen Osteuropas ökonomische Rationalitätskriterien dem Primat der politischen Rationalität der Machtsicherung geopfert wurden. In einer gemeinsamen Studie untersuchen Pirkert, Lepsius, Weinert und Hertle (1995) solche Prozesse. Sie kommen zu dem Schluß, daß Zusammenbruch der alten Ordnung 85 aufgrund der Wirtschaftsverfassungen einerseits und des ideologischen Hintergrunds andererseits die Konflikte zwischen den Rationalitätskriterien der Politik und der Wirtschaft nicht vermittelt werden konnten. Versuche, die auf Reformen zur dringend notwendigen Verbesserung der wirtschaftlichen Leistung zielten - wie in der DDR das NÖS -, scheiterten und offenbarten damit den Wirtschaftsführern die Unbeweglichkeit des Systems. Streckenweise konnten sie die Wirtschaften nur mit Hilfe von Improvisationen und der Hilfe aus dem Westen aufrechterhalten. Die Studie zeigt, auf welche Weise sich an den leitenden Stellen der SED Handlungsroutienen etablierten und Entscheidungsstrukturen institutionalisierten, die verhinderten, daß in den entscheidenden Situationen genügend Flexibilitätsmanagement vorhanden war, um den institutionellen Zusammenbruch zu verhindern. Die Basis der Studie von Pirker, Lepsius, Weinert und Hertle (1995) bilden Interviews mit Repräsentanten der Wirtschaftsführung der DDR. Sie zeigen stellvertretend für alle realsozialistischen Systeme einerseits die konfliktreiche Konstellation zwischen den Wirtschaftsführern und den Mitgliedern der politischen Nomenklatura und andererseits verdeutlichen sie, wie begrenzt der Einfluß ökonomischer Rationalitätskriterien war. Wie gestaltete sich der Handlungsraum der Wirtschaftsführer im „... Spannungsverhältnis von wirtschaftlicher Rationalität und politischen Vorgaben durch die Parteiherrschaft.“ (Pirker / Lepsius / Weinert / Hertle 1995: 8)? Weinerts Beitrag zu der Studie (1995b) thematisiert die Muster der Kritik an den wirtschaftlichen Reformen in der DDR. In ihnen zeigt sich, daß wirtschaftliche Rationalitätskriterien politisch-ideologischen Kriterien widersprachen und diesen unterzuordnen waren. Die wirtschaftlichen Reformen scheiterten im wesentlichen an ihrer Politisierung und Ideologisierung; zwei Entwicklungen, deren institutionelle Voraussetzung die „mono-organisationale Gesellschaftsstruktur“ (Weinert 1995b: 301) mit ihrer Personalisierung der Parteiführung sowie die Unterinstitutionalisierung von Konflikten und der damit einhergehenden Immunisierung gegen Kritik bildeten. Sozialistische Systeme waren grundsätzlich mit diesem Problem behaftet, nicht reformfähig zu sein (Weinert 1995b): Entgegen den Anforderungen effizienten Wirtschaftens und ökonomischer Anpassungselastizität galt nur eine gesellschaftliche Gesamtrationalität. Sektorale Rationalitätskriterien, die sich gegen das „Primat der Einheit der wiederversöhnten Gemeinschaft“ (Weinert 1995a; 1995b) hätten durchsetzen können, wurden unterdrückt. Das holistische Gesellschaftskonzept führte zu einem prinzipiellen Konflikt zwischen der Parteibürokratie und Autonomiebestrebungen gesellschaftlicher Teilbereiche, wie der Wirtschaft. Dieser Konflikt betraf alle sozialistischen Gesellschaften, wenn sie auch mit unterschiedlichen Kompromissen bearbeitet wurden. In allen sozialistischen Gesellschaften gab es institutionalisierte Normen und Werte, die die Vorherrschaft der politi- Zusammenbruch der alten Ordnung 86 schen Rationalität sicherten. Dies waren einerseits die vorgegebene Interpretation des Marxismus und andererseits die dogmatische Ablehnung der Koalitionsbildung durch das auf dem X. Parteitag der KPdSU beschlossene und exportierte Verbot der Fraktionsbildung. Die „ideologische Basisnorm“ des Fraktionverbots war von den Funktionären als Fraktionsangst internalisiert (Weinert 1995b: 289). Hier liegt eine wesentliche Ursache für das Scheitern wirtschaftlicher Reformen bzw. allgemeiner für das Scheitern neuer gesellschaftlicher Interessen, wie es das Beispiel des NÖS und der damit verbundene Sturz Walter Ulbrichts zeigt (Weinert 1995b): Der stalinistisch geprägte Machtpolitiker Ulbricht erkannte, daß nur die ökonomische Öffnung der DDR gegenüber dem Westen die dringend benötigte Verbesserung wirtschaftlicher Leistung erbringen konnte. Mit dem NÖS wurde die Öffnung angestrebt, die aber auch eine Abkehr von dem sowjetischen Modell der Wirtschaftspolitik bedeutete; sie induzierte einen nationalökonomisch eigenständigen Weg. Die Befürworter des NÖS dachten in wirtschaftspolitischen Kategorien, während die Gegner für ein Primat der Außenpolitik standen (Weinert 1995b: 293). Eine eigenständige Legitimation nach innen wollten die Gegner des NÖS nicht auf Kosten der Legitimation durch die enge Bindung an die SU aufgeben. Widersprüche und Schwächen des Systems waren für sie sekundär. Primat des politischen Handelns war die Zusammenarbeit mit Moskau und nicht eine die „bewährte“ Außenpolitik gefährdende Wirtschaftsreform. Dementsprechend fiel auch die Kritik aus. Die mangelnde Zusammenarbeit mit der SU und die zu enge Bindung an die BRD mit der Gefahr der Sozialdemokratisierung einerseits und die unzureichende Beteiligung der Parteibürokratie an den Reformprogammen andererseits waren aus Sicht der Traditionalisten die negativen Implikationen der Reform. Weinert schließt, daß der politischen Kritik am NÖS nicht standgehalten werden konnte, weil das wirtschaftspolitische Konzept die außenpolitischen Wirkungen nicht berücksichtigte (1995b: 297): Nicht wirtschaftliche Rationalitätskriterien entschieden über die Qualität und Zukunft des Reformvorhabens, sondern politisch-ideologische Kriterien. Das zeigte sich auch in der Fortführung des wirtschaftspolitischen Konzepts in der Ära Honecker nach dem Sturz Ulbrichts. Die auf dem VIII. Parteitag 1971 beschlossene „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ baute auf die Fiktion, daß höhere Einkommen und Sozialleistungen die Motivation der Beschäftigten steigern könnte. Das zentrale Motiv dieses Programms war aber ein politisches. Von dem zusätzlichen Einkommen erhoffte man sich eine Stützung der Loyalität in der Bevölkerung. Wirtschaftspolitisch aber war das Programm unausgegoren und erfolglos. Mit der institutionellen Willensbildungs- und Entscheidungsstruktur läßt sich erklären, warum wirtschaftpolitische Reformen in der DDR nicht durchzusetzen waren, obwohl die Schwächen offensichtlich waren und auch von der Elite wahrgenommen wurden (Weinert 1995b: 300f): Zusammenbruch der alten Ordnung 87 Die Entscheidungsstrukturen zeigten eine deutliche Personalisierung der Parteiführung. Nicht in den Abteilungen des Zentralkomitees wurden Programme entworfen und Entscheidungen getroffen, sondern in kleinen Kreisen – oft sogar nur unter vier Augen. Die Steuerungsmacht der Parteibürokratie löste sich in der „mono-organisationalen Gesellschaftsstruktur“ auf. Einzelne Teilbereiche konnten sich nicht mehr artikulieren, und damit wurde auch die wirtschaftpolitische Rationalität marginalisiert bzw. dem politischen Primat untergeordnet. Diese Entwicklung der Entinstitutionalisierung war für alle osteuropäischen Staaten symptomatisch. Sie alle litten mehr oder weniger an der fehlenden Institutionalisierung der Konfliktregelung und der überhöhten Funktion des Parteiführers - ein Ergebnis des Institutionentransfers von der sowjetischen Besatzungsmacht nach dem zweiten Weltkrieg. Irreale Programme wie „Einheit der Wirtschafts- und Sozialpolitik“ konnten nicht in einer Form kritisiert werden, die der Kritik politische Geltung hätte verschaffen können. Die Wirtschaftsführer agierten in komplizierten Beziehungsgeflechten. Ihre Handlungsspielräume waren stark eingeschränkt, weil sie festen institutionalisierten Handlungsmustern folgten. Diese Handlungsmuster waren bestimmt von der Entdifferenzierung in Form horizontaler, institutioneller Fusionsprozesse von Wirtschaft und Staat sowie von Staat und Partei in der Ära Honecker. Wie gering der Einfluß der Eliten der Bürokratie und der Wirtschaftsführer bei der Formulierung politischer Entscheidungen war, zeigen die Entscheidungsmuster in den zentralen Institutionen der Macht (Lepsius 1995): Das Politbüro des Zentralkomitees der SED war die wichtigste Steuerungsinstanz für Partei und Staat. Das Mitglied Günter Mittag war für den Bereich der Wirtschaft zuständig. Bei ihm lag die Kompetenz für die Durchsetzung wirtschaftspolitischer Entscheidungen. Allerdings beruhte seine zentrale Stellung im wesentlichen auf dem persönlichen Zugang zu Honecker. Mittag und Honecker entschieden in informellen Gespächen und umgingen so die Entscheidungsfindung im Politbüro. Dieses Entscheidungsmuster war so etabliert, daß die Mitglieder des Politbüros sich daran gewöhnt hatten, alle Vorlagen Honeckers ohne Debatten zu beschließen. Ganz ähnlich erging es dem Sekretariat der Zentralkomitees der SED. Hier hätten die Beschlüsse der Politbüros vorbereitet und umgesetzt werden sollen. Die Erfolgsaussichten bestimmter Vorhaben waren allerdings von den Zugangschancen zu den Mitgliedern des Politbüros abhängig. Eine Entscheidungsfindung in den kollektiven Gremien des Sekretariats oder auch des Ministerrats (der immerhin formell die Regierung der DDR darstellte) gab es nicht mehr, weil Verhaltensnormen der Verschwiegenheit zwischen den Büros, der Geheimhaltung und des Fraktionsverbots den Handlungsraum der Akteure auf ein Minimum zusammenschrumpfen ließen – Entscheidungen wurden auf die höheren Hierarchieebenen abgeschoben. Positive Sanktionen wurden innerhalb der Bürokratie nicht für Innovationen, Zusammenbruch der alten Ordnung 88 sondern für „... Verhaltensweisen der Apathie, des Ritualismus und des Rückzugs“ (Lepsius 1995: 252) verliehen. Generell waren die staatlichen Agenturen gegenüber der Partei und ihren Organen institutionell durch die Personalisierung der politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen geschwächt. Ganz ähnlich erging es den wirtschaftlichen Bereichen. Sie folgten den Vorgaben der staatlichen Instanzen. Die staatliche Planungskommission beschloß die zu erfüllenden Planvorgaben. Die Wirtschaftsführer hatten sich den Vorgaben unterzuordnen und waren vornehmlich damit beschäftigt, die Planerfüllung nachzuweisen und die Plangrößen im Nachhinein an die tatsächlichen Wirtschaftsgrößen anzupassen. Das stratgische Grundproblem für sie bildete nicht die Frage nach Innovationen, sondern das beständige Krisenmanagement (z.B. über die Beschaffung von West-Devisen). Dabei liefen die Wirtschaftsfunktionäre ständig Gefahr, mit ihren ökonomischen Argumenten gegen politische Ansichten zu verstoßen. In dieser Atmosphäre mußte sich ein innovationsfeindliches Handlungsmuster der Konformität etablieren – widersprechende Äußerungen entbehrten jeder Legitimitätsgrundlage. Ökonomische Rationalitätskriterien konnten sich nicht durchsetzen, weil das wirtschaftliche Handeln direkt von der politischen Steuerung kontrolliert wurde. Politische Werte standen bei den wirtschaftlichen Entscheidungen Pate. Rentabilitätsentscheidungen hingegen waren sekundär. Lepsius faßt daher zusammen, daß die Eliten der DDR zwar loyal waren, aber dafür auch kollektiv handlungsunfähig und ökonomisch reflexionsgehemmt (1995: 362). Institutionalisierte Normen und Werte unterstützten das Primat der Politik. Pirkert zeigt, daß die Akzeptanz einer „Subjektivierung der Macht“ durch den Transfer des Gesellschaftsmodells der SU in die osteuropäischen Staaten gestützt wurde (1995): Die institutionelle Ausgestaltung der osteuropäischen Staaten folgte dem dominanten sowjetischen Einfluß und dem sowjetischen Modell, das nach dem zweiten Weltkrieg mit der Besatzung exportiert wurde. Das sowjetische Modell stand für einen Marxismus-Leninismus, der die fehlende Institutionalisierung parteiinterner Konflikte induzierte. Darüber hinaus haftete der von Stalin geprägte Despotismus an dem Modell, der die Personalisierung von Willensbildung und Entscheidungen ermöglichte. Auf dieser Basis entwickelte sich in allen osteuropäischen Staaten der grundlegende Konflikt zwischen Politik und Wirtschaftskadern. Der Marxismus sollte sich in der Überwindung des Kapitalismus bewähren und war insofern ein fremdreferentielles Gesellschaftsprojekt. Der Leninismus fügte die Disziplinierung zu dem richtigen Bewußtsein hinzu. Es sollte anders als im Kapitalismus mit einer Stimme gesprochen werden und nicht die interne Konfliktaustragung das politische Tagesgeschäft bestimmen. Bewegungen, die von der Hauptlinie abwichen, wurden nicht zugelassen und mit dem 1921 beschlossenen Fraktionsverbot systematisch unterdrückt. Hinzu kam mit dem Stalinismus das Streben nach der Alleinherrschaft des des- Zusammenbruch der alten Ordnung 89 potischen Führers. Stalin institutionalisierte die Unfehlbarkeit seiner Generallinie als Parteiführer mit dem von ihm gesetzten Unfehlbarkeitsprinzip (Pirkert 1995: 367). Er strukturierte die KPdSU zu einer „Partei neuen Typs“ um, der die institutionellen Strukturen für die horizontale und vertikale Vermittlung von gesellschaftlichen Interessen genommen wurden. Während sich das System Stalin unter Zuhilfenahme des Militärs und Geheimdienstes durch Gewalt und Liquidationen legitimierte, sollte sich die Führung der DDR durch Leistung legitimieren. Hier lag die Ursache für die Widersprüche, die sich aus einer im Geiste Stalins geschulten Parteibürokratie mit der Personalisierung bzw. „Subjektivierung der Macht“ einerseits und den Anforderungen eines durch Leistung legitimierten Wirtschaftssystems andererseits ergaben. Der nationalökonomisch eigenständige Weg des NÖS strebte eine Reform nach wirtschaftlichen Rationalitätskriterien an, mußte aber gleichzeitig an zwei Fronten – der Breshnew-Doktrin und dem Primat politischer Werte - standhalten können. Von den Wirtschaftsführern wurde die parteipolitische Zäsur internalisiert (Pirker 1995: 374). Die Eliten, mit ihrer verinnerlichten Angst vor der Institution des Fraktionsverbots und vor der Macht Moskaus, stützten die Personenfixiertheit auch in Systemen, in denen sich die Führer nicht über einen Personenkult wie den Stalins legitimieren konnten. Die Bildung einer rational arbeitenden Bürokratie war vor diesem Hintergrunde unmöglich. Mit den Ansätzen intermediärer Institutionen wird deutlich, wie sich die fehlende, horizontale Vermittlungsleistung zwischen gesellschaftlichen Teilbereichen auswirkte. Sie zeigen, welche Dynamiken auf der Ebene der Eliten aus dem Differenzierungsdefizit entstanden. Über die Differenzierungsproblematik gesellschaftlicher Teilbereichsrationalitäten hinaus läßt sich mit dem Problem der Intermediarität aber auch das Defizit auf der vertikalen Ebene und den damit verbundenen Integrationsproblemen aufzeigen. Die Unterdrückung der Intermediarität steht nicht nur für die Entdifferenzierung gesellschaftlicher Teilbereiche. Mit der mangelnden vertikalen Vermittlungsleistung gesellschaftlicher Interessen wurde auch die Funktion von Institutionen für die gesellschaftliche Integration untergraben, was auf die ökonomische Anpassungsfähigkeit zurückwirkt. Am Beispiel des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) zeigt Weinert, auf welche Weise Institutionen bei der vertikalen Interessenvermittlung zwischen der Bevölkerung und den Entscheidungseliten eingeschränkt wurden (1995a: 246f): Auf der organisatorischen Ebene zeigte sich, daß diese Gewerkschaft per se keine Gegenentwürfe zu Politikkonzepten der Partei entwickeln konnte. Die führenden Mitglieder des FDGB waren kraft ihres Amtes auch Mitglieder der SED-Parteileitung. Die Kader der SED kontrollierten die Gewerkschaftsaktivitäten. Diese Organisationsform führte für die Gewerkschaft zu zwei Problemen. Erstens mußte sie sich als Gegenentwurf zu den bürgerlichen, westlichen Gewerkschaften profilieren. Das hatte zur Folge, Zusammenbruch der alten Ordnung 90 daß der Ausdruck partikularer Interessen unterdrückt wurde, um den Schein der repräsentierten Einheitlichkeit aufrecht zu erhalten. Das zweite Problem entstand bei dem Umgang mit der „abweichenden Bewußtseinslage“ der Arbeiter. Das Klassenbewußtsein der Arbeiter war nicht stark genug verankert, was sich immer wieder an Problemen mit der Kategorie des Kollektiveigentums ausdrückte. Faktisch wurde das Konzept des Kollektiveigentums nicht akzeptiert. Die Wirtschaftsreform unter Ulbricht (NÖS) versuchte, mit einer flexibleren Fassung des Eigentums darauf zu reagieren, konnte sich aber nicht langfristig etablieren. Die Reformen scheiterten an der zentralistischen Wirtschaftsstruktur (Weinert 1995: 248). Die Gewerkschaft erkannte nicht, daß es ihre Aufgabe hätte sein können, die Probleme, die sich aus dem Konzept des Kollektiveigentums ergaben, zu vermitteln. Probleme wurden auf falsche Bewußtseinslagen zurückgeführt, und widersprechende Stimmen verstummten. Die Interessenlage der Arbeiter wurde in dieser Praxis zu einer Frage der Disziplin stilisiert, obwohl es einer Interessenvermittlung bedurfte. Anstatt dieser Aufgabe gerecht zu werden, reduzierte sich der FDGB in seiner Aufgabenerfüllung auf die Verteilung sozialstaatlicher Leistungen für diejenigen, die sich politisch-ideologisch konform verhielten. Mit dem Beispiel wird deutlich, daß die mangelnde Vermittlungsleistung der Gewerkschaft auf der vertikalen Ebene besonders gravierend war. Partikularinteressen wurden weder gebündelt noch zum Ausdruck gebracht. Damit wurde die integrationsstiftende Kraft, die durch eine institutionalisierte Partizipation geleistet werden kann, aufgegeben. Wie aber kann sich die unterdrückte Partizipation in eine unzureichende ökonomische Anpassungselastizität umsetzen? Die Leistungsbereitschaft der Bevölkerung hängt eng mit ihrer Einstellung gegenüber gesellschaftlichen Normen und Werten zusammen. Die Internalisierung der vermittelten Ideologie und der mit ihr verbundenen Werte und Normen war gering. Das zeigte das Beispiel der Gewerkschaft in der DDR. Die nicht-zweckgebundene, integrationsstiftende, symbolische Dimension dieser ansonsten wichtigen Vermittlungsinstitutionen verlor zunehmend an Bedeutung. Sie konnte sich z.T. auch erst gar nicht entwickeln, weil die integrationsstiftende Zusammenfassung gemeinsamer Interessen von vornherein unterbunden wurde. Zentrale Werte wie Kollektiveigentum wurden nicht akzeptiert. Das Verhältnis gegenüber Gewerkschaft und der von ihr repräsentierten Politik entwickelte folgerichtig einen instrumentellen Charakter. Und dies von beiden Seiten: Die Gewerkschaft konzentrierte sich auf die Verteilung sozialstaatlicher Leistungen (bspw. attraktive Ferienaufenthalte), und für die Mitglieder der Gewerkschaft waren diese Güter ersehnte Highlights ihres Arbeitslebens. Die nicht-zweckgebundenen Leistungen verloren an Bedeutung, deshalb konzentrierte man sich auf der Ebene der Mikrofundierung der Institution FDGB auf Nutzenerwägungen. Zusammenbruch der alten Ordnung 91 Um den ökonomischen Herausforderungen zu begegnen, konnte die Führung deshalb auch nur bedingt auf Mobilisierungsressourcen der Arbeiterschaft bauen. Zudem bildete das institutionell unterdrückte Feedback Probleme für die ökonomische Anpassungsfähigkeit, denn der Planung standen alternativ auch keine Rückmeldungen über Marktmechnismen wie die Preisbildung zur Verfügung. Daß die DDR gesamtgesellschaftlich eine gewisse Flexibilität erhalten konnte, lag an der Leistung der Kirche, die politische Interessenartikulation abfing, und an den Aktivitäten der Kommerziellen Koordination, die für den Nachschub ökonomischer Ressourcen sorgte (Weinert 1995b). Hier wird deutlich, wohin die normativ gewollte und institutionalisierte Unterdrückung von Partikularinteressen - durch die verhinderte Entfaltung institutioneller Intermediarität - führen kann. Die personelle Organisationsstruktur der Gewerkschaft erlaubte keine horizontale Interessenvermittlung, weil es den Führungsgremien an Autonomie fehlte. In ihren Entscheidungen folgten sie der Parteiraison und nicht den Problemen und Interessen, die sich im gesellschaftlichen Teilbereich der Wirtschaft entwickelten. Besonders deutlich werden an dem Beispiel aber die Auswirkungen unzureichender vertikaler Interessenvermittlung: Arbeiterschaft und Gewerkschaftsmitglieder fanden im FDGB kein Partizipationsmedium, das ihre Interessen vertrat, was sich unmittelbar auf die gesellschaftliche Integration und ökonomische Anpassungselastizität auswirkte. Die Untersuchungen der intermediären Institutionen bzw, ihres Defizits in den osteuropäischen Staaten setzen an einem frühen Zeitpunkt des Transformationsprozesses an. Sie übersetzen die strukturellen Voraussetzungen der Transformation in deren institutionelles Pendant und konkretisieren damit die Ausgangsbedingungen, an denen die späteren, dynamisierten Prozesse der strategischen Institutionenänderungen ansetzten. Die Beiträge zeigen, warum in kommunistischen Gesellschaften ein Eigenwert institutionalisierter Normen und Werte nicht realisiert werden konnte und warum die nichtzweckorientierte, integrationsstiftende, symbolische Dimension von Institutionen an Bedeutung verlor bzw. unterentwickelt blieb. Institutionalisieren konnten sich hingegen innovationsfeindliche Loyalität in den Reihen der Eliten und mangelndes Feedback aus der Bevölkerung, was zur politischen und ökonomischen Reflexionshemmung führte. Von den Eliten wurden die etablierten Handlungsroutinen zum Teil in langen Sozialisationsprozessen internalisiert. Der hohe Grad der Institutionalisierung stand allerdings einem Flexibilitätsmanagement im Wege; die institutionell repräsentierten Werte und Normen sowie die Handlungsmuster der Eliten waren extrem rigide. Die institutionelle Rigidität in der DDR (vgl. Nedelmann 1995) zeigte sich an den folgenden Merkmalen: Die Prozesse der Willensbildung und Entscheidungsfindung waren in starren Routinen festgelegt und bestimmten Personen zugeordnet – habitualisierte Handlungsvollzüge (enacting) bestimmten das Tagesgeschäft. Ängste vor deviantem Verhalten (Fraktionsangst) und die Parteidisziplin standen für einen hohen Grad der Internalisierung Zusammenbruch der alten Ordnung 92 (bspw. des Unfehlbarkeitsprinzips). Wegen der ideologischen Disziplinierung in den Erziehungsdiktaturen (vgl. Pirkert 1995: 366) und der unhinterfragten Anlehnung an den starken Bruder Sowjetunion ging der Begründungsbedarf der Institutionen gegen Null - der Eigenwert institutionalisierter Vorgänge wurde überhaupt nicht angezweifelt. Rigidität verhinderte ein flexibles Reagieren auf neue Anforderungen, was sich an der Unmöglichkeit wirkungsvoller wirtschaftlicher Reformen in der DDR, aber auch anderen osteuropäischen Staaten zeigte. Vor diesem Hintergrund mußten die Systeme an den neuen - besonders ökonomischen - Anforderungen scheitern. Es war eine Frage der Zeit, wann die institutionellen Fehlkonstrukte nicht mehr als selbstverständlich akzeptiert wurden und auf ihre Zwecke und gratifikatorischen Gehalt hin überprüft wurden. Diese tiefgreifenden Zweifel an den Institutionen dynamisierten den institutionellen Zusammenbruch. Von „enacting“ wurde auf „acting“ umgestellt (Nedelmann 1995), d.h. die Mikrofundierung und damit die strategische Orientierung von Akteuren gewann an Bedeutung. Die Beschreibung der institutionalisierten Handlungsroutinen, die die Rigidität hervorbrachten, behandelt Institutionen als unabhängige Variablen. Erst wenn ein Zeitpunkt eintritt, zu dem sich zeigt, daß es einer deutlichen Änderung bedarf, werden Institutionen zur abhängigen Variable. Wenn alte Institutionen reformiert oder abgeschafft werden, dann bestimmen Akteure über die Neugestaltung der entsprechenden Handlungszusammenhänge. Sie haben über die Reformen entschieden auch dann, wenn sich unerwartete Ergebnisse aus den Änderungen ergeben. 2.3 Effekte strategischer Institutionenänderungen Mit der Untersuchung institutioneller Änderungen können kalkulatorisch argumentierende Institutionenansätze unter der Prämisse des fortgeschrittenen institutionellen Umbruchs bzw. Zusammenbruchs - ohne Verlust der nicht-zweckgebundenen Dimension von Institutionen - in eine umfassende Institutionenanalyse der Transformation Osteuropas integriert werden. Institutionen werden von Akteuren (um)gestaltet. Dennoch entwickeln sie eine eigene Dynamik, die auch unbeabsichtigte Wirkungen hervorbringen kann, so wie die abnehmende Zustimmung zur Linie der Partei und die Verfolgung opportunistischer Interessen. An den Entwicklungen in der SU kann man besonders gut veranschaulichen, welche unerwünschten Effekte eine Institutionenreform hin zur stärkeren Liberalisierung haben kann. Die SU stand unter besonders hohem Leistungsdruck im internationalen Wettbewerb, was ihre wirtschaftliche Situation extrem anspannte und somit Druck auf die politischen Entscheidungsträger ausübte27. Gleichzeitig spielten die Reformen in der SU 27 Vgl. die Ausführungen zu den geopolitischen Herausforderungen im Teil II, Kapitel 1.2. Zusammenbruch der alten Ordnung 93 eine Schlüsselrolle für die Entwicklung in den anderen kommunistischen Staaten. Institutionelle Änderungen konnten ihnen entweder Beispiel für Reformen sein oder indirekt über eine zurückgenommene Einflußnahme der SU auf sie wirken. Dieser von den Strukturtheorien beschriebene Zustand der Interstate-Competition bildet den Ausgangspunkt für die Untersuchungen der „New Institutionalist Theory“ (Nee / Lian 1994): Aus dem Konkurrenzdruck im internationalen Staatenraum bilden sich die Constraints für die Machthaber. Ändert sich die relative Stärke der Staaten, können die Machthaber darauf mit institutionellen Änderungen reagieren. Eine wichtige Variable für die nationale Machposition war im internationalen Kontext des kalten Krieges die wirtschaftliche Performance. Das fortschreitende wirtschaftlich-technische Gefälle zwischen Staatssozialismus und Marktwirtschaft führte dazu, daß ökonomische Reformen vermehrt erwogen und letztlich auch über liberalisierende Maßnahmen eingeführt wurden. Die Einführung von marktwirtschaftlichen, liberalisierenden Elementen kann unbeabsichtigte destabilisierende Folgen haben. Die institutionellen Reformen können die abnehmende Zustimmung zur Linie der Partei in den Reihen der Eliten provozieren. Einer solchen abnehmenden Elitenkohärenz liegt ein „Dilemma of Reforms“ zugrunde (Nee / Lian 1994): Effektive ökonomische Reformen müssen den institutionellen Rahmen der Eigentumsrechte und somit die institutionelle Grundlage der Wirtschaft neu definieren. In dieser Bewegung zum Markt entsteht für die zentralen Machthaber zunehmend Unsicherheit, die von den entstehenden „Kaderunternehmern“ ausgenutzt werden kann28. Die Kaderunternehmer setzen bei entsprechender Präferenz auf der lokalen Ebene ihre Positionsmacht in Marktvorteile um. Liegt die Präferenz bei einer primären Profitorientierung („rent-seeking“ oder „opportunism“), so stehen die Akteure in der institutionell umdefinierten Situation einer für sie erfreulichen neuen Situation gegenüber. Ihnen bietet sich mit der Möglichkeit der Ausnutzung der Marktvorteile die Gelegenheit, eine erhöhte Selbstbegünstigung zu realisieren. Die in dieser Situation entstehende Neubewertung von Handlungsmöglichkeiten der Eliten läßt sich spieltheoretisch modellieren (Nee / Lian 1994): Die (aus strukturellen Gründen) notwendigen institutionellen Änderungen etablieren die Regeln des Spiels, weil sie die Parameter der Wahl bestimmen und (nur) insofern die Handlungen determinieren. In einem „Multi-Agent-RepeatedGame“ ergibt sich aus den neuen institutionellen Situationen für die Kader eine binäre Wahl. Entweder sie bleiben bei ihrer Zustimmung zur Partei, oder sie weichen durch opportunistisches Handeln von der Linie der Partei ab. Die Wahl zwischen diesen beiden Optionen richtet sich nach den individuellen Präferenzen und Kalkulationen einerseits und dem Verhalten der Genossen andererseits. Nee und Lian konstruieren drei Dimensionen der Präferenzstruktur der Eliten. Es gibt die „true-belivers“, „middle-of-the28 Wie sich dieser Zusammenhang erklärt, bleibt bei Nee und Lian weitgehend im Dunkeln, wird aber in bestätigender Weise von Walder ausgeführt (vgl. Walder 1994). Darauf wird im folgenden noch einzugehen sein. Zusammenbruch der alten Ordnung 94 roaders“ und die Opportunisten (reine Nutzenmaximierer). In dieser Reihenfolge repräsentieren die Präferenzstrukturen den abnehmenden Grad der Zustimmung zur Parteilinie. Das Handeln orientiert sich aber nicht nur an den Neubewertungen der Kosten-Nutzen-Erwägungen auf der Grundlage der institutionellen Neuerungen, sondern auch am Handeln der anderen. Die Handlungen anderer üben einen „Demonstrationseffekt“ aus. Mit der zunehmenden Tendenz zu abweichendem Handeln sinkt über den Demonstrationseffekt die Anzahl der Linientreuen. Auf diesem Wege büßt die ohnehin verunsicherte Partei weiter an Kontrollkapazität ein. Mit der abnehmenden Kontrollkapazität sinken die Sanktionsmöglichkeiten, so daß die Bereitschaft, abweichend zu handeln, weiter steigt. In diesem Zusammenhang - dem „trade-off“ zwischen der Kontrollkapazität der Partei und dem abweichenden Handeln – liegt der Schlüsselmechanismus für den Zusammenbruch der Elitenkohärenz. Der sich selbst verstärkende Prozeß wirkt sich in gravierender Weise auf die ökonomische Performance des Staates aus. Denn neben der ideologischen Orientierung der „true-belivers“ konnten nur effektive Sanktionen Opportunisten bzw. „middle-of-the-roaders“ vom Free-Riding abhalten. Über bestrafende Maßnahmen ließ sich der Verzicht auf persönliche Bereicherung durch opportunistisches Handeln auf Kosten der Partei und damit der zentralen Staatsführung durchsetzen; Steuereinnahmen wurden an den Fiskus abgeführt, und der Versuchung der Bestechung wurde widerstanden. Durch die verschlechterte wirtschaftliche Situation fallen auch die positiven Sanktionsmöglichkeiten weg; die „market-temptation“ steigt. Es wird deutlich, daß sich in akzelerierender Weise die Kosten-Nutzen-Kalküle der lokalen Eliten zuungunsten der zentralen Organisation ändern können. Was den Prozeß für das System so bedrohlich - vielleicht sogar fatal - macht, ist die Allgegenwärtigkeit des Demonstrationseffekts; opportunistisches Handeln der höchsten Offiziellen kann aufgrund ihrer Machtstellung nur schlecht sanktioniert werden und wird es deshalb immer geben. Unter der Bedingung eines strukturell dringend erforderlichen institutionellen Wandels ergeben sich verschiedene Handlungsmöglichkeiten für die Eliten. In dieser Situation wirken Mechanismen, die für institutionalisierte Handlungsroutinen bedrohliche Präferenzen und Handlungen provozieren. In dem Prozeß der Liberalisierung, dessen Erfolg im Besonderen auf Loyalität der Eliten angewiesen ist, ergeben sich Chancen zur Selbstbereicherung und schwinden die Sanktionsmöglichkeiten. Dies sind systembedrohliche Bedingungen in einer Situation, die wegen der Änderung bestehender Institutionen durch zunehmende Unsicherheit gekennzeichnet ist. Warum in dem beschriebenen Zustand die Treue zur Parteilinie keine selbstverständliche Institution mehr war, ist damit noch nicht geklärt. Die Treue zur Parteilinie verliert dann an Selbstverständlichkeit, wenn sich unter den Bedingungen liberalisierender institutioneller Reformen für die lokalen Eliten neue Zusammenbruch der alten Ordnung 95 Möglichkeiten zur Selbstbereicherung ergeben. Positionsmacht kann in Marktmacht übertragen werden und sich somit gegen die Intention der Partei durchsetzen. Mit einer Analyse der Principal-Agent-Beziehung29 läßt sich diese Dynamik, die durch die zunehmende Verletzlichkeit des Systems bzw. seinen Zusammenbruch gekennzeichnet ist, präzisieren. Der Zusammenhang von institutionellen Änderungen und ihren dezentralisierenden Wirkungen in der dynamischen Phase institutioneller Reformen wird deutlich (Walder 1994): Ausgangsfrage ist, auf welche Weise die Dynamiken institutioneller Änderungen die die Parteimacht definierenden Interaktions- und Machtbeziehungen beeinflussen. Eine starke Parteimacht baut auf ein institutionelles Setting, das erstens die Topführer in die Lage versetzt, bei ihren Agenten Compliance und Disziplin durchzusetzen, und das zweitens die Autorität über die Bürger ausübt. Daraus ergeben sich für die Parteimacht drei wichtige Variablen: 1.) Agenten müssen in der Erfüllung ihrer Wünsche von den Vorgesetzten abhängig sein. 2.) Sie müssen den Vorgesetzten Informationen über die Aktivität ihrer Untergeordneten zugänglich machen (genau das ist mit Kontrollkapazität gemeint). 3.) Die Vorgesetzten müssen über die Möglichkeit verfügen, ihre Untergeordneten zu belohnen oder zu bestrafen. Über den Charakter dieser Variablen bilden sich die Muster der Abhängigkeit, des Monitorings und des Sanktionierens der Agenten (und der Bürger). Die Muster ändern sich mit den Möglichkeiten, die mit der Neudefinition institutioneller Regelungen entstehen: Die Abweichung von zentraler Planung durch Liberalisierungsmaßnahmen bringt zunehmend ökonomische Alternativen mit sich. Über die notwendigen fiskalischen Reformen, d.h. der Änderung des Steuerflusses, entsteht eine Struktur, die Gelegenheit für Unternehmensautonomie im öffentlichen Sektor schafft. Der fiskalische Einfluß höherer Regierungsebenen auf die niedrigeren Ebenen läßt nach, wenn mit der zunehmenden Bedeutung des lokalen Investments die Agenten von dem Einkommen ihrer admistrativen Position unabhängiger werden. Darüber hinaus eröffnen sich für die lokalen Führer neue Einkommensmöglichkeiten und Karrierechancen jenseits der Parteihierarchie durch die vereinfachten Korruptionsmöglichkeiten. Die lokale Parteikommune bekommt insgesamt durch die institutionellen Änderungen eine ganz neue Bedeutung. Lokale Autoritäten basieren zunehmend auf neuen Ressourcen, die sich über Allianzen und bargaining-Prozesse realisieren. Es entsteht ein lukrativer, separater, privater Sektor, der zur zunehmenden Autonomie der Offiziellen auf lokaler Ebene führt. Reformen, die zur Stärkung des Systems angestrengt werden, können also zu einem beschleunigten Verfall in der Zustimmung zur Parteilinie und damit des institutionellen Machtgefüges führen, weil Möglichkeiten für abweichende Handlungen und deviante Präferenzen entstehen. Dennoch läßt sich nicht schließen, daß nach der Logik des 29 Vgl. zum Principal-Agent-Modell auch (Coleman 1990). Zusammenbruch der alten Ordnung 96 Principal-Agent-Ansatz ein zwingender Automatismus des institutionellen Zusammenbruchs bei Liberalisierungsreformen folgt. Nicht in allen kommunistischen Ländern führten liberalisierende Reformen zum Zusammenbruch. Vielmehr müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Der Principal-Agent-Ansatz läßt komparative Analysen zu, in denen das Ergebnis institutioneller Reformen offen ist – d.h. von Prozeßvariablen, die die Bedingungen nennen, abhängt. Somit kann beispielsweise die sich aufdrängende Frage geklärt werden, warum ähnliche Reformen der Dezentralisierung im Sowjetsystem zum Kollaps und in China - bei konsequenteren Reformen - nicht zum Kollaps führten. Solnik (1996) hat ein solches komplexes Modell entwickelt. Es besteht aus zwei Komponenten: Dem „two-actor principal-agent modell“ (mit simplen spieltheoretischen Annahmen) und der Metapher des Bankenruns. Das Principal-Agent-Modell erklärt die Struktur der Autorität und des Gehorsams. Asymmetrische Besitzrechte definieren die Autorität - d.h. die Machtverhältnisse und Hierarchiestruktur - in der Beziehung zwischen dem Vorgesetzten (Principal) und dem Agenten. Die Autoritätsasymmetrie entsteht dadurch, daß der Vorgesetzte die Befehle gibt, sie wird aber durch die Informationsasymmetrie, die den Agenten in eine bevorzugte Stellung bringt, in einem Gleichgewichtszustand gehalten. Auf dieser Basis funktioniert die Hierarchie; sie gründet auf einer konsensuellen Autoritätsbeziehung, deren Variationen - über institutionelle Änderungen - spieltheoretisch modellierbar sind. Reformen bilden wiederholte kurzfristige Handlungsverträge. Entscheidungstheoretisch ergeben sich daraus wiederholte Spiele mit kooperativen Strategiemöglichkeiten (parteikonformes Handeln) und defektiven Strategiemöglichkeiten (opportunistisches - in diesem Falle nicht parteikonformes Handeln). Von Agentenseite wird unter zwei Bedingungen Kooperation gewählt: Die Autoritätsbeziehung hat kein absehbares Ende, d.h die Zukunft wird nicht unterbewertet30, und für die Agenten gibt es keine alternativen Einkommensquellen („outside credits“). (In diesem eigennutzorientierten Kalkül lassen sich die Opportunisten und „middel-of-the-roaders“ in dem Modell von Nee und Lian <1994> wiedererkennen.) Für die Vorgesetzten ergibt sich daraus für jede Spielrunde eine Situation, in der die Kosten der Beobachtung und Kontrolle abgewogen werden müssen gegen die Kosten, die durch das Ignorieren des Loyalitätsverlustes entstehen. Das läuft auf die Frage hinaus, ob es sich für die Agenten lohnt, auf kurzfristige Interessen (wie z.B. die Nutzung von Korruptionsmöglichkeiten) zu verzichten, um langfristige Interessen zu verwirklichen. Beispielsweise kann die Langfristorientierung mit der zunehmenden Bedeutung und Unabhängigkeit lokaler Politikkommunen abnehmen. Dann werden die Agenten auf lokaler Ebene wählbar und damit unabhängig von den Promotionen durch die Vorgesetzten. In die Bewertungen der Autoritätsbeziehung greift ein Mechanismus, der den 30 Für die Plausibilität des Zusammenhangs von kurzfristiger bzw. langfristiger Orientierung und defektiver bzw. kooperativer Strategie vgl. aufschlußreich Elster (1989: 42f) und Axelrod (1984). Zusammenbruch der alten Ordnung 97 akzellerierenden Prozeß der zunehmenden Defektion erklärt. Mit der Metapher des Bankenruns verdeutlicht Solnik die Logik dieses Mechanismus: Sinkt das Vertrauen in die Bank, dann werden ihr die Besitzrechte bzw. die Verfügungsrechte über den Besitz entzogen. Das läßt die Kurse sinken, was in beschleunigender Weise das Vertrauen in die Investmentstrategien der Banken weiter sinken läßt, usw. Analog gilt für die Beziehung zwischen Vorgesetzten und Agenten, daß sich bei zunehmend wahrgenommener Unfähigkeit ministerialer Überwacher (die staatlichen Unternehmensmanager daran zu hindern, de facto Besitzrechte zu behaupten) die Dezentralisierung mit spontanen Privatisierungen auf lokaler Ebene beschleunigt31. Als wichtige Komponenten in diesem Spiel stellen sich folgende Variablen heraus: die institutionalisierten Eigentumsrechte und Autoritäts- bzw. Machtstrukturen sowie - wie Solnik es formuliert - die Risikobereitschaft der Akteure32. Für die Sowjetunion führte ein dem „Bankenrun“ vergleichbarer Prozeß zu einer starken Desintegration. Die vormals durchaus bestehende Integration wurde duch den hierarchischen Aufbau garantiert. Industrielle Hierarchien fielen dem Prozeß spontaner Privatisierungen zum Opfer. Ehemalige Firmenmanager konnten kleine Unternehmen etablieren, und private Banken entstanden aus der Zentralbank. Staatliche Hierarchien und damit die Institutionen der staatlichen Kontrolle wurden durch opportunistisches Handeln innerhalb der politischen Strukturen Opfer des Bankenruns (mit der Zuweisung von Budgetautonomie und dem Recht auf Steuererhebung verfügten die lokalen Agenten über lukrative Optionen für abweichendes Handeln). Nur so konnten beispielweise lokale Autoritäten Parteibesitz privatisieren. Die Vorgesetzten konnten keine Gegenmaßnahmen behaupten, was dazu führte, daß die Agenten die an sie delegierte (Positions-)Macht so nutzten, als sei es ihre (Markt-)Macht. In China hingegen waren die Bedingungen anders. Hier konnte die innerparteiliche Disziplin als zentripedaler Faktor aufrecht erhalten werden. Die Besitzrechte der lokalen Parteisekretäre hängen trotz der Liberalisierung stark von ihrer Position in der staatlichen Bürokratie ab und Tiananmen 1989 kann als eine Strategie der staatlichen Reputation gesehen werden. Mit derartigen repressiven Maßnahmen können hierarchische Beziehungen zwischen Vorgesetztem und Agenten im Gleichgewicht gehalten werden. 31 Im Modell von Nee und Lian (1994) wird dieser Prozeß mit dem Demonstrationseffekt erklärt. In dieser Darstellung fällt der von Nee und Lian beschriebene „true beliver“ weg. Von der Parteilinie abweichendes Verhalten wird nur noch von Kosten-Nutzen-Kalkülen bestimmt. Die dennoch zu beobachtende Überwindung des von Nee und Lian hervorgehobenen „Freerider-Problems linientreuen Handelns“ (s.o.) erfolgt in Solniks Modell über den Zeithorizont. Weitsichtige Akteure verhalten sich parteikonform, wenn die langfristige Orientierung ein höheres Auskommen verspricht. Ob eine solche eindimensionale Orientierung der Akteure bzw. identische Orientierung bei allen Akteuren unterstellt werden kann, ist fraglich. Die Frage kann an dieser Stelle aber unberücksichtigt bleiben, weil für den beschriebenen Zeitpunkt des Zusammenbruchs die Eigennutzorientierung unterstellt werden kann und somit die von Solnik hervorgehobenen Mechanismen als Erklärungsbausteine angebracht sind. 32 Zusammenbruch der alten Ordnung 98 2.4 Zusammenfassung Institutionentheoretische Ansätze, die die Auswirkungen der mangelnden Intermediarität thematisieren, erklären die Stabilität des institutionellen Defizits und die Schwierigkeit, systemstabilisierende Reformen durchzusetzen - sie erklären die Unbeweglichkeit der realsozialistischen Systeme. Um diese Rigidität und Selbstverständlichkeit eines unflexiblen Zustandes zu begründen, müssen Kategorien bemüht werden, die sich nicht mit strategischen Erwägungen fassen lassen. Rigidität wurde den eingestielten Handlungsroutinen über Sozialisationsmechanismen der „Erziehungsdiktatur“, mit der Internalisierung ideologiekonformer Normen und Werte und den symbolischen Demonstrationen bestehender Machtverhältnisse verliehen. Erst wenn eine solche - künstlich aufrechterhaltene - Stabilität an den realen Anforderungen zerbricht, werden unreflektierte Handlungsroutinen und Machtverhältnisse verstärkt hinterfragt. Strategische Erwägungen gewinnen an Bedeutung in einer Zeit, zu der über zwingend notwendige Reformen nachgedacht wird, oder wenn der institutionelle Zusammenbruch nicht mehr aufzuhalten ist. Für die Analyse der in dieser dynamisierten Phase wirksamen Mechanismen bewähren sich dann die theoretischen Ansätze mit einem strategischen, kalkulatorischen Handlungskern. Hier liegt die Schnittstelle, an der Institutionen nicht mehr einfach die Handlungsmuster der Akteure bestimmen, also unabhängige Variable sind. Sie werden mit den Überlegungen zur institutionellen Änderung zur abhängigen Variable. Akteure entwerfen neue Konzepte, versuchen sie zu implementieren und entscheiden mit ihrem Handeln über ihre Wirkungen. An diesem Punkt setzen die institutionentheoretischen Ansätze an, deren Gegenstand die durch Reformprozesse angestoßene Dynamik ist. Sie argumentieren weniger mit einzuhaltenden Handlungsroutinen als mit den Interessen von Akteuren und dem Wettbewerb zwischen ihnen. Daher ist zunächst unklar, inwiefern sich die Argumentation dieser institutionentheoretischen Ansätze von der Argumentation reiner akteurstheoretischer Ansätze unterscheidet. Man muß nicht zu dem Schluß kommen, daß es sich um eine für die Transformationsanalyse unfruchtbare Reduktion des Institutionenverständnisses handelt. Nach wie vor bewegen sich die Akteure im Rahmen institutionalisierter Handlungsroutinen und Entscheidungsstrukturen sowie institutionell eingegrenzter Handlungsarenen. Jedoch setzen die Untersuchungen zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der institutionellen Reformen bzw. des Zusammenbruchs an. Dieser Zeitpunkt läßt sich mit den Kategorien „Instrumentalität“, „Externalität“ und „acting“ (vgl. Nedelmann 1995) beschreiben. In einer solchen Phase kommt der Mikrofundierung eine entscheidende Rolle zu, und zweckorientierte Kalküle verdrängen die Selbstverständlichkeit institutionalisierter Handlungsabläufe. Thematisiert wird, daß aus instrumentellen Kalkül bestimmten Reformstrategien der Vorrang eingeräumt wird und daß be- Zusammenbruch der alten Ordnung 99 stehende Institutionen dem Prüfstand der instrumentellen Erwartungen nicht mehr gerecht werden konnten, gerade weil der Eigenwert der institutionellen Arrangements angezweifelt wurde oder sogar zusammengebrochen war. Der Zweck von Institutionen gelangt ins Blickfeld, Handlungsroutinen werden hinterfragt, und mit „Externalisierung“ werden Schutzmaßnahmen zur Stützung der Institution und ihrer Normen und Werte angestrengt – Prozesse also, die sich mit Ansätzen, die strategische Erwägungen berücksichtigen, theoretisch angemessen modellieren lassen. Die beiden institutionentheoretischen Perspektiven ergänzen sich nicht nur theoretisch. Sie lassen sich auch auf der konkreten Ebene der Beschreibung des Phänomens „Transformation Osteuropas“ zusammenfügen: Es fällt auf, daß sich die Principal-Agent-Ansätze hauptsächlich auf die Entwicklungen in der SU beziehen. Sie thematisieren die Regulierungs- und Steuerungsproblematik auf der vertikalen Linie innerhalb der Bürokratie, weil in der SU die Vorgesetzten-Untergeben-Beziehung von einer systembedrohenden Loyalitätsproblematik geprägt war. Für die institutionentheoretische Analyse der anderen osteuropäischen Staaten - und hier insbesondere für die DDR - steht dieser Aspekt nicht im Vordergrund. Dementsprechend problematisieren die Ansätze intermediärer Institutionen nicht die Ausweitung der Handlungsoptionen auf den lokalen Ebenen, sondern die Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten außerhalb der Spitze der Parteiführung und die Beschneidung von Kompetenzen. In den unterschiedlichen Perspektiven spiegelt sich der unterschiedliche Charakter der Entwicklungen in der SU einerseits und den ostmitteleuropäischen Staaten andererseits wider. Die unterschiedlichen Entwicklungen waren allerdings auch eng miteinander verwoben: Der Zusammenbruch der SU, der durch die Initiativen des liberalisierenden institutionellen Umbaus eher noch verstärkt als verhindert wurde, wirkte mittelbar auf die institutionellen Entwicklungen der anderen osteuropäischen Staaten: Die Selbstverständlichkeit, mit der sich ihre Machtverhältnisse und Entscheidungsverfahren etablieren konnten, bröckelte, weil mit dem Zusammenbruch der SU eine wichtige, nämlich die externe Legitimitätsgrundlage der orthodoxen Regime wegfiel. Die Machtverhältnisse und Entscheidungsstrukturen verloren ihre Selbstverständlichkeit; ein plötzlicher – offensichtlich nicht zu bewältigender Begründungsdruck beschleunigte die Krise und den institutionellen Zusammenbruch. Die Mesoansätze zeigen, wie institutionelle Änderungen zu graduellen Veränderungen langfristig entstandener und etablierter Strukturen führen können. Vor dem Hintergrund der Geschichte struktureller Entwicklung agieren und reagieren Akteure in einer Weise, die zur Veränderung vorhandener Strukturen über neu installierte institutionelle Arrangements führt. Aus diesem Grunde schließt sich an die strukturtheoretische Transfor- Zusammenbruch der alten Ordnung 100 mationsforschung die Analyse von institutionellen Eigenschaften der kommunistischen Regime an. Über sie wird unter anderem auf der politischen Ebene die Verteilung der Macht und auf der ökonomischen Ebene der Zugang zu den Ressourcen reguliert. Institutionelle Regelungen bilden die Grundlage der für die soziale Ordnung relevanten Abhängigkeiten, Überwachungsmöglichkeiten und Sanktionsmechanismen. Dennoch läßt das nicht den Schluß zu, mit institutionellen Neuerungen verliefen sozialstrukturelle Entwicklungen vorhersehbar. Vielmehr werden durch das Zusammenwirken vieler individueller und korporativer Handlungen innerhalb des mit institutionellen Änderungen neu entstandenen Optionsraums überraschende Wirkungen auftreten; Wirkungen, die nicht beabsichtigt waren oder die es sogar zu vermeiden galt. Die von den institutionentheoretischen Beiträgen identifizierten Mechanismen können diesen Wirkungen z.T. auf den Grund gehen. Sie erklären, warum konkrete institutionelle Reformen nicht die beabsichtigte Identitätswahrung des Systems bewirkten, sondern im Gegenteil zum Zusammenbruch kommunistischer Regime entscheidend beitrugen. Institutionelle Änderungen eröffnen Chancen, bergen aber auch Risiken. Werden in einer Krise Reformen anstelle repressiver Mittel gewählt, so ist die Erholung des Systems (Identitätswahrung) in keinem Falle garantiert. Nicht antizipierte bzw. schwer vermeidbare Folgen notwendiger institutioneller Eingeständnisse (z.B. neuer Eigentumsrechte) können Prozesse anstoßen, die in subversiver Weise das Reformprogramm entgegen der Intention seiner „Architekten“ laufen lassen. Diese Prozesse müssen nicht als zufällige Erscheinungen unerklärbar bleiben. In jedem Falle werden sie durch aggregierte Individualhandlungen bestimmter Akteure verursacht. Die Analyse des Transformationsprozesses ist an der Stelle beschleunigend wirkender Mechanismen des institutionellen Umbaus noch nicht abgeschlossen. Der Prozeß gerät mit den institutionellen Änderungen vielmehr erst in seine „heiße Phase“; in eine Phase, in der sich die Machtverhältnisse mit Chancen für die Einflußnahme neuer Akteure und mit Risiken für bislang Mächtige verschieben. In diesem Stadium bleibt es nur in den seltensten Fällen bei der exklusiven Gestaltung der Transformation durch die Eliten. Spielten die Akteure aus untergeordneten sozialen Positionen für den Prozeß der durch Liberalisierung hervorgerufenen akzelerierende Krisendynamik bisher eine geringere Rolle, so muß das nicht so bleiben. Politische Akteure können sich in den neuen Situationen auch außerhalb der Eliten rekrutieren. Ihre Einflußmöglichkeiten mögen für die mit der Liberalisierung in Gang gesetzten Prozesse zu vernachlässigen sein, müssen aber bei den noch dynamischeren Bargainingprozessen der Demokratisierung bzw. der Orientierung aus der Krise heraus thematisiert werden. Transformationen werden auch durch die Bevölkerung mitgestaltet. Sie kann sich direkt bei der politischen Umgestaltung beteiligen oder gewinnt als Machtressource der politischen Akteure einen wichtigen indirekten Einfluß. Hier öffnet sich eine Erklärungslücke der institutionellen Ansätze. Sie erklären graduelle Änderungen mit den strukturienden Zusammenbruch der alten Ordnung 101 Einflüssen institutioneller Änderungen. Die Verläufe wichtiger strategischer Interaktionen hingegen werden nur angedeutet, denn dafür müssen über grobe Kategorien individueller Motivationen hinaus komplizierte Interessenabwägungen berücksichtigt werden. Institutionentheoretische Ansätze klären nicht, warum Reformen anstelle von Repressionen „gewählt“ wurden, und auch nicht warum sich die Forderungen bestimmter Akteure gegen konkurrierende Ideen bei der Gestaltung der Demokratisierung durchsetzten. Wir erfahren lediglich, welche Handlungs- und Entscheidungschancen für Akteure entstehen. Erst mit einer akteurtheoretischen Perspektive kann versucht werden, diese Erklärungslücke ein Stück weit zu schließen. Zusammenbruch der alten Ordnung 102 3. Mikrotheoretische Ansätze Verhinderte systemische Evolution und strukturelle Mängel schaffen die Ausgangsbedingungen für die konkrete Ausgestaltung der Transformation, die von politischen Akteuren vorgenommen werden muß. Institutionelle Änderungen beschreiben einen ersten Schritt auf dem Pfad in die neue Richtung der Umgestaltung. Einen Schritt, bei dem politische Entscheidungen neue gesellschaftliche Realitäten schaffen, die dann die neuen Möglichkeitsbedingungen für den weiteren Verlauf bilden: „When future historians examine the archievs, they may find that there are possible worlds, close to ours, in which the GDR politburo orders the police to shoot on the demonstrators in Leipzig. But they might also find that there are worlds in which the Chinese hard-liners give in to reformers. Whatever their conclusions, they will not affect the general proposition that events change beliefs and beliefs cause events.“ (Elster 1996: 19). Mit den Entscheidungen und Institutionalisierungen, die sich aus den aufeinanderfolgenden Interaktionsschritten ergeben, verschließen sich vormals gegebene und eröffnen sich neue Möglichkeiten. Solche Prozesse hinterlassen Spuren und sind insofern unumkehrbar. Soll ein Prozeß rückgängig gemacht werden - z.B. mit repressiven Maßnahmen wie in China 1989 -, so ist der neue Zustand doch ein anderer: Nicht nur internationaler Druck pflanzt sich innenpolitisch fort. Auch das für die innenpolitische Stabilität eines Tages vielleicht ausschlaggebende Verhältnis von privater und öffentlicher Einstellung der Bevölkerung verschiebt sich, und auf diesem Wege können sich die Beziehungen von Öffentlichkeit und politischer Elite und die Intraelitenprozesse zwischen Reformern und Hardlinern dramatisierten (vgl. Di Palma 1991). Die neuen Realitäten aggregieren sich aus Entscheidungen von Akteuren im Rahmen struktureller und institutioneller Constraints. Da die Akteure vor dem Hintergrund des „Erbes der Vergangenheit“ handeln, ist der Gestaltungsspielraum bzw. sind die Wahlmöglichkeiten der Akteure nicht beliebig. Ihr Handlungsspielraum wird durch die Grenzen einer „structured contingency“ (Karl / Schmitter 1991) bestimmt. Dennoch werden die politischen Ergebnisse nicht von den objektiven Konditionen determiniert. Die strukturellen und institutionellen Voraussetzungen entscheiden über die Problemlage und über den Verlauf zwar insofern, als sich vor ihrem Hintergrund die Besetzungen von Machpositionen und die Machtausstattung des alten Regimes gestaltet. Es sind aber kollektive Entscheidungen und politische Interaktionen, die den Umbau in einem institutionalisierten Rahmen gestalten - Akteure treffen Entscheidungen. Aus den Prämissen der Makroansätze lassen sich keine Aussagen über den Einfluß bestimmter Akteure bzw. Akteurskonstellationen auf den Transformationsverlauf ableiten. Sie haben eine theoretische Unschärfe, die sich darin ausdrückt, daß die dynamischen Zusammenbruch der alten Ordnung 103 Prozesse des Zusammenbruchs der alten Ordnung und des Entstehens einer neuen Ordnung im Dunkeln bleiben. Von der Identifikation struktureller Makrovariablen allein kann kein Aufschluß über den Zeitpunkt und den konkreten Verlauf der Transformation erwartet werden. Andernfalls hätte ein Verlaufsdeterminismus auf der Basis der Strukturanalyse die Entwicklung vorhersehbar machen müssen, so daß die tatsächliche Überraschung geringer ausgefallen wäre und über uns der Wandel nicht „Now out of Never“ (Kuran 1991) eingebrochen wäre. Erst die Mesotheorien zeigen, auf welche Weise strukturelle Defizite zu einem Aufbrechen des Zusammenhalts innerhalb der Eliten führten und wie diese zunehmende Destabilisierung parallel zur mangelnden Integrationsleistung der Institutionen zum weiteren Legitimitätsverfall beitrug. Solche Dynamiken wirken sich auf die Machstrukturen in den Regimen aus. Damit entstehen neue Entscheidungsmöglichkeiten für Akteure. Hier liegt die Schnittstelle für die Mikroansätze. Sie schließen an die Dynamik der zunehmenden Schwächung der kommunistischen Regime an, indem sie 1. zeigen, wie die Strategien einer uneinheitlichen Führungselite den Zusammenbruch beschleunigten und 2. thematisieren, wie der Zustand abnehmender Legitimität in eine Mobilisierung der Massen umgesetzt wurde und welche Rolle die Mobilisierung für die Dynamik des Zusammenbruchs spielte. In einem Punkt unterscheiden sich Mikrotheorien wesentlich von den Makro- und Mesotheorien. Während der Zugang zu strukturellen und institutionellen Eigenschaften der osteuropäischen Systeme für den Beobachter nur z.T. verstellt ist - die Eigenschaften wurden seit vielen Jahren beobachtet und diskutiert -, finden die Entscheidungsprozesse der politischen Akteure hinter verschlossenen Türen statt. Nur selten Fällen haben Beobachter Zugang zu diesen Prozessen, und selbst dann stellen sich die beobachteten Präferenzen oftmals mit einem strategischen bias dar. Deshalb beschränken sich die Mikrotheorien hauptsächlich darauf, Entscheidungssituationen so zu modellieren, daß sie zu den Ergebnissen führen, die sich beobachten lassen. Man kann nicht wissen, ob die in den Modellen getroffenen Entscheidungen und Präferenzen der Realität entsprechen. Deshalb können die Modelle nur nach der Konsistenz ihrer Argumentation und nach der Plausibilität der aus ihnen folgenden Schlüsse beurteilt werden. Die mikrotheoretischen Ansätze sind keineswegs einheitlich. Sie unterscheiden sich gravierend in ihren theoretischen Prämissen. Es gibt Ansätze, die ihre Modellen mit einem deduktiv-nomologischen Anspruch konstruieren, und es gibt Ansätze, die von einem solchen Erklärungsanspruch zurücktreten. Letztere wollen lediglich verstehen, wie es zu den Transformationen in Osteuropa kommen konnte und warum sich die Umbrüche meist friedlich vollzogen. Die Autoren, die einem deduktiv-nomologischen Anspruch folgen, beanspruchen für ihre Modelle den Status kausaler Gesetzmäßigkeiten. Um diesem Anspruch zu genügen, Zusammenbruch der alten Ordnung 104 müssen sie formal-logische Kriterien einhalten, die hier einleitend kurz zusammengefaßt werden sollen: Theorien, die Makrophänomene mit dem Handeln von Akteuren, ihren Präferenzen und Motiven zu erklären beanspruchen, lassen sich der Metakategorie „Methodologischer Individualismus“ zuordnen. Diese Kategorie verweist auf einen theoretischen Anspruch, den Coleman mit seinem Konzept einer sozialwissenschaftlichen Erklärung - „...internal analysis of system behavior“ (1990: 2f) - formuliert hat. Coleman stellt ein dreiteiliges Paradigma für die Erklärung von Makrolevel-Phänomenen auf: Eine Theorie muß 1.) die Makro-Mikro-Transition, 2.) absichtsvolles Handeln der Individuen und 3.) die Mikro-Makro-Transition beinhalten. Esser (1993) leitet aus diesem Paradigma eine konkrete Operationalisierungsvorschrift für die sozialwissenschaftliche Praxis ab. In einem ersten Erklärungsschritt muß die Logik der Situation geklärt werden, d.h. die situativen Entscheidungsmöglichkeiten und -einschränkungen für die Akteure sind aufzuzeigen. In einem zweiten Erklärungsschritt muß deutlich werden, nach welcher Logik bzw. mit welcher Orientierung die Akteure eine Strategie wählen. In der Selektionslogik liegt der eigentliche Theoriekern, weil sie auf die immanente Handlungstheorie der Erklärung verweist und somit die Prämissen festsetzt, aus denen sich das Phänomen unter Angabe der Antezedensbedingungen (erster Erklärungsschritt) ableitet. Die Logik der Selektion wird als eine rationale Wahl modelliert. Im dritten Schritt muß gezeigt werden, wie sich aus der Vielzahl der individuellen Handlungen kollektive Folgen zusammensetzen; also nach welcher Logik sich das kollektive Explanandum aggregiert. Auch dieser Schritt ist theoretisch sehr anspruchsvoll, weil hier die verwendeten Konstruktionen - zum Beispiel spieltheoretische Modelle - und Mechanismen in Übereinstimmung mit den Dimensionen der Handlungstheorie formuliert werden müssen, um ad hoc-Erklärungen zu vermeiden. Entgegen dem deduktiv-nomologischen Anspruch versuchen einige Autoren erst gar nicht, Modelle zu entwickeln, die Innerelitenprozesse und die Mobilisierung der Massen allgemeingültig als Folge bestimmter Gesetzmäßigkeiten und rationalen Handelns erklären. In einem bescheideneren Ansatz versuchen sie, die Dynamiken des Zusammenbruchs auf der Akteurebene lediglich plausibel nachzuzeichnen (vgl. Colomer 1991, 1995; Offe 1993, 1994; Przeworski 1991)33. Zu viele verschiedene Motive und Variablen bestimmen in ihrem Verständnis, wie Randbedingungen und Entscheidungsmöglichkeiten wahrgenommen werden, welche Handlungsmotive sie stimulieren und über welche Mechanismen sie sich zu einem strukturellen Ergebnis aggregieren. Die Transformation ist in dieser Perspektive zwar auch Ergebnis intentionalen Handelns. Neben rationalen Motiven spielen aber auch nicht-rationale Motive wie moralische Erwägungen oder auch irrationale Entscheidungen einer Rolle. 33 Diese Ansätze werden auch als „Rational Choice-Marxismus“ (v. Beyme 1994) bezeichnet. Zusammenbruch der alten Ordnung 105 Für die Transformationstheorie ist diese Unterscheidung auf zweierlei Weise relevant. Erstens stellt sich die Frage, welche Ansätze plausibler und theoretisch konsistenter die Dynamiken auf der Akteurebene erklären bzw. nachzeichnen. Und zweitens muß geklärt werden, welcher akteurtheoretische Ansatz eher geeignet ist, an die Beiträge der Makro- und Mesotheorien anzuschließen. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die mikrotheoretischen Ansätze vorgestellt. Im ersten Abschnitt werden die Ansätze vorgestellt, die versuchen, alle politischen Akteure zu berücksichtigen. Drei Themen beherrschen die „Spekulationen“ über die Prozesse auf der Mikroebene, die für den Verlauf der Transformation richtungsweisend waren. Dies sind 1. die entscheidungsrelevanten Akteure, 2. die Dynamik der Entscheidungssequenzen und 3. die Strategien und Motive der Akteure. Es läßt sich zeigen, daß bestimmte Akteurskonstellationen und Strategien den Charakter des Zusammenbruchs beeinflussen. Außerdem kann über eine Modellierung der aufeinanderfolgenden Entscheidungssituationen versucht werden zu klären, wie sich die Dynamik des Zusammenbruchs denken läßt. Mit der Analyse der Motive politischer Akteure - die mit ihren Entscheidungen oftmals Ergebnisse erzielten, die ihrem eigenen Interesse diametral entgegengesetzt sein mußten, aber den Wandel angestoßen haben - klärt sich die Frage, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. Im zweiten Abschnitt werden die Ansätze vorgestellt, die sich primär mit einem Akteur, der protestierenden „Öffentlichkeit“, auseinandersetzen. Die Öffentlichkeit wird dann zu einem politischen Akteur, wenn sie sich organisiert und mobilisiert. Eine oppositionelle, politische Öffentlichkeit wurde in den kommunistischen Staaten nicht toleriert. Dementsprechend gering war ihr Organisationsgrad. Zu einem politischen Faktor wurde die Öffentlichkeit erst, als sie sich mit Protesten Gehör zu schaffen suchte. Die Proteste haben sich in unserer Erinnerung als Symbol für den friedlichen Umbruch (mit der Ausnahme Rumäniens) etabliert. Welche Motive die Bürger auf die Straße getrieben haben, beschäftigt die Untersuchungen zur öffentlichen Mobilisierung: Waren es rationale Kalküle, normative Motive oder das Bedürfnis nach einem integeren Selbstbild? 3.1 Interaktionen politischer Akteure Die Transformationen Osteuropas verliefen nach sehr unterschiedlichen Mustern. Das lag nicht nur an den spezifischen, strukturellen und institutionellen Regimeeigenschaften, sondern auch an den spezifischen Akteurskonstellationen, innerhalb derer über konkrete Änderungen entschieden wurde. Daher kann versucht werden, den Charakter der Transformation über die jeweils spezifische Kombination der Akteure mit der von ihnen gewählten Strategie der Umgestaltung zu begründen (Karl / Schmitter 1991): Re- Zusammenbruch der alten Ordnung 106 krutieren sich die Schlüsselakteure aus den Massen oder aus den Reihen der Eliten? Welche Strategie verfolgen sie; Kompromißorientierung oder Druck („Force“)? Die Kombinationen der Merkmale dieser dichotomisierenden Fragestellungen führen zu einer Matrix mit vier Idealtypen von Transformationen. Die Transformationsform, die aus einer Übereinkunft, bei der innerhalb der Eliten ein Kompromiß gefunden wird, resultieren, bezeichnen Karl und Schmitter als „Pakt“. Werden von Eliten Machtmittel im Hinblick auf den Transformationsverlauf effektiv, d.h. erfolgreich gegen den Widerstand aus ihren eigenen Reihen, eingesetzt, dann handelt es sich um eine „Imposition“. Führt eine Mobilisierung der Öffentlichkeit zum gewaltlos erzwungenen Kompromiß, dann liegt eine „Reform“ vor. Der massenhafte Zugriff auf Waffen mit dem Ergebnis des militärischen Sieges über die ehemaligen autoritären Herrscher wird als „Revolution“ bezeichnet. Pakt und Imposition lassen sich als Transformationen von „oben“ charakterisieren, während sich Reform und Revolution aus dem Druck von „unten“ entwickeln. Mit der Wahl der Strategie des Übergangs von autoritären zu demokratischen Systemen „produzieren“ die Akteure die Transformation. Die möglichen Strategien liegen auf dem Kontinuum zwischen den idealtypisch definierten Extrempunkten „Kompromißorientierung“ und „Druck“. Zwischen ihnen liegen eine Vielzahl von Strategien. Es kann z.B. auf Drohungen und Einschüchterungs- oder Unterstützungsmaßnahmen zurückgegriffen werden. Das Zuordnungsmerkmal der Akteure liegt bei der institutionalisierten Position, die sie innehaben. Wird die Richtung der Transformation von unten bestimmt, heißt das, daß sich die relevanten Akteure aus sozial untergeordneten Positionen rekrutieren. Wird von oben über den Verlauf entschieden, dann sind diejenigen die relevanten Akteure, die schon eine bestimmte institutionalisierte, soziale Machtposition bekleiden. Die mit den Idealtypen suggerierte Dichotomie entspricht natürlich nicht der Realität. Es vermischen sich oft Eliten und Nicht-Eliten in ihrem Wettbewerb um Einfluß auf den Transformationsverlauf. Allerdings kann diese Typologie sinnvolle Unterscheidungskriterien liefern, die es erlauben, die Transformationsverläufe Süd- und Mittelamerikas in den 80er Jahren und Südeuropas in den 70er Jahren (Spanien, Portugal und Griechenland) von der Transformation in Osteuropa zu unterscheiden. Nach Karl und Schmitter (1991) lagen die Transformationen in Osteuropa 1989/90 meist zwischen Imposition und Reform, was bedeutet, daß die zentralen Schachzüge der institutionellen Änderungen von oben initiiert wurden. Außerdem kann für die meisten osteuropäischen Staaten trotz der Verhandlungen an den Runden Tischen (RT) mit Ausnahme Ungarns und Polens nicht von einer Transformation durch Pakt ausgegangen werden (vgl. auch Teil II, Kapitel 4). Die Transformationen Lateinamerikas und Südeuropas hingegen fallen zum Großteil unter die Kategorie Pakt (vgl. Karl / Schmitter 1991: 281; O’Donnel / Schmitter 1986). Zusammenbruch der alten Ordnung 107 Die von Karl und Schmitter entwickelten Kategorien bewähren sich als deskriptive Merkmale von Transformationen und für ihre grobe Charakterisierung, nicht aber als ursächliche Erklärungen bestimmter Transformationsoptionen. Offen bleibt die für die Transformationen Osteuropas wichtige Frage, aus welchem Grunde es in dem meisten Ländern zu einem friedlichen Übergang kam. Sowohl Imposition als auch Reform und Pakt bilden friedliche Formen des Übergangs. Sie werden entweder mit der Opposition oder zwischen Fraktionen der Elite ausgehandelt. Alle drei Formen lassen sich deshalb unter dem Begriff des „Transitions by Agreement“ subsumieren. Für diese Formen liefert Colomer ein spieltheoretisches Erklärungsmodell (1991, 1995)34: Akteure lassen sich nach ihren strategischen Orientierungen, die sich aus einer hierarchischen Präferenzordnung der drei möglichen politischen Entwicklungen zusammensetzen, typisieren. Dies sind a) die Präferenz für eine Fortsetzung der autoritären Regierungsform (Continuity), b) die Präferenz für eine moderate Reform (moderate reform) und c) die Präferenz für einen revolutionären Umbruch (Rupture). Die unterschiedlichen Präferenzordnungen ergeben sich als Desiderate der politischen Geschichte der Akteure und der sozialen Struktur, in der sie eingebunden sind. Aus den möglichen Kombinationen der Präferenzen lassen sich sechs Akteurtypen konstruieren, die sich nach dem Grad der Radikalität ihrer Einstellungen – von „Maximalisten“ bis „Gradualisten“ – unterscheiden. Dies sind „Revolutionaries“ (1), „Rupturists“ (2), „Reformists“ (3), „Openists“ (4), „Continuists“ (5) und „Involutionists“ (6). In der formalen, spieltheoretischen Analyse der Interaktionen dieser Akteurtypen interessieren besonders die Situationen, in denen: a) die „Maximalisten“, also „Revolutionaries“ (1) und „Involutionists“ (6) herausfallen und b) keine der beteiligten Gruppen dominiert. 34 Colomer vertritt einen Rational Choice-Ansatz mit deduktivem Anspruch und bedient sich der Spieltheorie zur Modellierung komplexer Entscheidungssituationen, wie Verhandlungen (1995). Bei der Ausformulierung der theoretischen Prämissen - und damit seines Erklärungsanspruchs - verfährt er ausgesprochen vorsichtig. Die Transformation Spaniens Mitte bis Ende der siebziger Jahre dient zwar als allgemeines, idealtypisches Erklärungsmodell – „The Spanish Model“ – für ausgehandelte Systemwechsel, dennoch bleibt der Erklärungsanspruch stark eingeschränkt. Colomer beansprucht nur ein Fragment der politischen Realität, nämlich die Phase zwischen der Liberalisierung und den ersten freien Wahlen, zu erklären. Hier liegen die Grenzen der Allgemeingültigkeit seines Modells; es erhebt keinen Anspruch auf Ausschließlichkeit. Auch die Akteurprämissen werden von Colomer nicht reduktionistisch eingeführt. Ganz im Sinne seiner prinzipiellen Offenheit für andere Erklärungsansätze begründet er ausführlich, warum man in der von ihm untersuchten dynamischen Phase ein Primat strategischer Orientierung annehmen und unterstellen kann: Die große Unsicherheit in Situationen des politischen Systemwandels – die institutionellen Regeln des „Spiels“ ändern sich ständig – veranlassen die Akteure, in besonderem Maße einer strategischen Orientieren zu folgen. Die Schwächen oder sogar der Mangel institutioneller Constraints bilden eine Möglichkeit für Manipulationen und strategische Erwägungen im politischen Interaktionsprozeß. 108 Zusammenbruch der alten Ordnung Nur in diesen Situationen sind nicht-revolutionäre, ausgehandelte Umbrüche möglich. Die Interaktionssituationen bzw. Spiele, die über die Kooperation zu einer ausgehandelten Transformation führen, modelliert Colomer mit den drei Matrixen, die in Abb. 1 dargestellt sind. Abbildung 1: Games of Transition by Agreement 3 Reformists Continuists R r 4 Openists C r 23 41 12 34 5 C r C 5 Continuists r 23 41 12 34 2 Rupturists R r 2 Rupturists R r 22 41 14 33 Darstellung nach Colomer (1991: 1290). Die Zellen beinhalten die für die jeweilige Interaktionskonstellation spezifischen Präferenzordnungen35. Die Zellen rechts unten zeigen die Gleichgewichtslösungen. Alle drei Situationen zeichnen sich durch ein defizitäres Gleichgewicht aus, das sich durch Kooperation verbessern ließe, wenn man – wie Colomer – den Akteuren eine langfristige Orientierung unterstellt36. Um bei den Mitspielern die notwendigen bindenden Zusagen für ein paretooptimales Gleichgewicht zu erreichen, bedarf es allerdings der Fähigkeit, glaubhafte Drohungen („threads“) auszusprechen. In seinen neueren Beiträgen zur Transformationsforschung fügt Colomer (vgl. 1995) dieser Kooperationsbedingung eine zusätzliche, wichtige Dimension hinzu. Nicht nur die angedrohten Sanktionen erreichen ein Commitment, sondern auch Kommunikation kann zu einem kooperativen Gleichgewicht führen. Colomer führt diesen Punkt – leider – nicht weiter aus37. Mit diesem Modell gelingt es Colomer, zwei wichtige Aspekte zu beleuchten: 35 Die Akteure entscheiden sich in dem Modell nicht für eine der drei Alternativen „Continuity“, „reform“ und „Rupture“, sondern für alternative Präferenzpaare und somit für Situationen, die durch die eigene Wahl und die Wahl des „Mitspielers“ definiert sind (vgl. für eine Übersicht der Präferenzordnungen: Colomer 1991: 1288). 36 Anstatt des Konzepts „Nash-Equilibrium“ (vgl. Nash 1951, 1953), bei dem den Akteuren Kurzsichtigkeit (miopia) unterstellt wird, sie sich also nur an unmittelbaren Konsequenzen der Wahl orientieren, verwendet Colomer das anspruchsvollere Gleichgewichtskonzept nach Brams, bei dem den Akteuren vorausschauende Handlungsorientierung und die Antizipation der Handlungen anderer unterstellt wird (Colomer 1995). 37 Wie entscheidend Kommunikation für den Verhandlungsverlauf sein kann, wird in dem Kapitel zu den Verhandlungen an den Runden Tischen deutlich (vgl. Teil II, Kapitel 4.3). Zusammenbruch der alten Ordnung 109 Erstens kann gezeigt werden, welche Akteurkonstellationen kooperationsfähig sind. Damit werden wichtige Bedingungen für eine „Transition by Agreement“ angeben: Einerseits sind Maximalisten nicht kooperationsfähig. Andererseits müssen die Akteure strategische Positionen vertreten, die relativ weit auseinander liegen. Nur unter dieser Bedingung läßt sich ein ausreichendes Abschreckungs- und Drohungspotential aufrechterhalten, das die Defektion unterbindet; es können Massen mobilisiert bzw. repressive Maßnahmen angedroht werden. Zweitens kann diese Modellierung der Entscheidungssituationen Aufschluß über die unterschiedliche Dynamik der Transformationsprozesse in den verschiedenen Ländern geben. Zwei der Spielsituationen für eine ausgehandelte Transformation (zwischen „Continuists“ und „Reformists“ sowie zwischen „Rupturists“ und „Openists“) haben ein „single-force-vulnerable equilibrium“38 (vgl. die Zellen rechts unten in Abb. 1). Mit ihnen lassen sich Transformationen in den Ländern modellieren, in denen eine kontrollierte Öffnung des Systems stattfand, der eine Liberalisierungsphase vorausging wie bei der Transformation in Polen und Ungarn. Initiiert wurde die Öffnung durch je eine Gruppe, den „Openists“, denen in Polen die Regierungsmitglieder unter der Führung General Jaruzelskis entsprachen; sie suchten den Dialog zur wiedererstarkten Gewerkschaft Solidarnosc – den „Rupturists“. In Ungarn entsprach die Gruppe um den Generalsekretär Karoly Grosz dem Präferenztyp „Openists“. Sie isolierte die Hardliner und kündigte bereits 1987 den Dialog mit der Opposition an, der letztlich zur Einführung eines Runden Tisches führte. Bei dem dritten Spiel, dem von „Rupturists“ und „Continuists“, handelt es sich um ein echtes Prisoners‘ Dilemma39. Weil hier beide Seiten einen Anreiz zur Defektion haben, bedarf es einer schwierigen Synchronisierung der kooperationskonsolidierenden Drohungen und Abschreckungen. Diese instabilere Situation soll nach Colomer typisch sein für ein politisches Setting, das durch ein Machtvakuum und einen plötzlichen Kollaps des Systems gekennzeichnet ist. Dieser zweiten Gruppe - Ländern, die einer Defektion auf beiden Seiten der relevanten strategischen Akteure vorbeugen müssen und sich daher plötzlicher und überraschender transformieren - entsprechen die DDR, Tschechoslowakei, Bulgarien und Rumänien. In der Tat verliefen die Transformationsprozesse in diesen Ländern in einem schnelleren Tempo: „... Poland needed 10 years to rid itself of authoritarian communism, Hungary did it in 10 Month, East Germany needed but ten weeks and Czechoslovakia just 10 days. (It could be added that a little over 10 hours was enough time for Rumania.) The truth is 38 Damit wird ausgedrückt, daß die Gefahr für die Gleichgewichtslösung nur von einer Seite ausgeht. Dies sind die Parteien, für die die Auszahlung in der Zelle rechts oben profitabler ist. 39 Das Prisoners‘ Dilemma ist ein Zwei-Akteur-Positiv-Summenspiel, das durch ein instabiles Gleichgewicht gekennzeichnet ist. Das optimale Ergebnis kann in einer einmaligen Entscheidungssequenz nicht erreicht werden, wenn die Akteure rein strategisch orientiert sind. Mit diesem spieltheoretischen Modell lassen sich interdependente Entscheidungssituationen nachzeichnen und Lösungswege aufzeichnen (vgl. Ullmann-Margalit 1977; Gibbons 1992; Scharpf 1997). Zusammenbruch der alten Ordnung 110 that something close to a sudden collapse of the regime took place in the fall of 1989 in the rest of the countries of Eastern Europe after Poland and Hungary.” (Colomer 1991: 1298). Mit dem Verweis auf die Spielsituation können mit Colomers Modell die Länder zwar entsprechend der Dynamik des Wandels unterschieden werden. Die Dynamik selbst ist damit aber nicht erklärt. Im Gegenteil, die Ausprägung der abhängigen Variable – „faster pace“ – wird als Zuweisungskriterium verwendet, mit dem die Länder unter einem Modelltyp zusammengefaßt werden. Damit kann die Dynamik selbst nicht mehr Explanandum sein. Der Grund für dieses Defizit liegt bei den Prämissen des Modells: Es geht von feststehenden Präferenzen der Akteure aus und läßt daher unberücksichtigt, daß die Individuen, die diese Akteurposition einnehmen, eventuell abgelöst werden oder ihre Strategien ändern. Diese Volatilität ist charakteristisch für Systemtransformationen; Allianzen basieren damit auf einer unsicheren Grundlage, und Individuen ändern ihre Position40, weil sich die Bedingungen, unter denen Verhandlungen stattfinden, ständig ändern. Eine statische Charakterisierung der Transformation geht an der Realität vorbei. Transformationsverläufe werden nicht, wie das Modell Colomer suggeriert, in einer einmaligen Spielsituation entschieden. Sie werden in einer Reihe von aufeinanderfolgenden Entscheidungssequenzen gestaltet. Bei jeder Sequenz können sich die relevanten politischen Akteure und dementsprechend der Charakter der Verhandlungen gravierend ändern. In einem dynamischeren Modell dürfen die strategischen Position der Akteure deshalb nicht fixiert sein. Sie müssen sich mit dem Auftreten und der Wahrnehmung bestimmter „Signale“ (vgl. Przeworski 1986, 1991) ändern können. Als Signale können außenpolitischer Druck, der plötzliche Tod eines Regimführers, ökonomische Krisen oder sicherlich auch die Verkündung einer „Sinatra-Doktrin“41 wirken. Aber auch der plötzliche Legitimitätsverlust oder öffentliche Proteste können ein solches Signal sein und somit mittelbar auf den Transformationsverlauf hinwirken. Solche, während der Verhandlungen auftretende, Bedingungen wirken sich auf die Machkonstellationen sowie auf die Präferenzen und Strategien der Akteure aus. Damit wird die Transformation zu einem pfadabhängigen Prozeß. Ein angemessenes Modell für diesen Prozeß muß die sich ändernden Bedingungen in aufeinanderfolgenden Entscheidungssequenzen berücksichtigen können. Przeworski (1991) hat ein der Dynamik des Transformationsprozesses angemessenes Modell entwickelt. Für die Modellierung des ersten Entscheidungsschritts muß die 40 Vgl. für eine ähnliche Argumentation: Przeworski (1986). Gorbatschow verkündete 1989 bei den Feierlichkeiten zu 40. Jahrestag der DDR, daß sich die UdSSR nicht in die Angelegenheiten der anderen osteuropäischen Staaten einmischen werde. Diese Aussage wird in Anlehnung an Frank Sinatras Song „My Way“ Sinatra-Doktrin genannt. 41 Zusammenbruch der alten Ordnung 111 Frage geklärt werden, wodurch es bei den Verhandlungen überhaupt zur Initiierung der Transformation kommen konnte. Die ausgehandelten Kompromisse, mit denen die Bedingungen des Übergangs von der alten zu der neuen Regierungsform und institutionelle Änderungen festgelegt werden, bringen gravierende Risiken für die politischen Akteure. Demokratisierung ist „Unsicherheitsinstitutionalisierung“ (Przeworski 1986, 1988, 1991): Die Macht ist in einer Demokratie nicht mehr einer bestimmten Gruppe zugänglich, sondern wird einem Regelset übertragen. Interessen können ex ante nur über den vorausgegangen Wettbewerb realisiert werden. Dieser Zustand wird von den Teilnehmern an der Verhandlung über institutionelle Reformen antizipiert42. Und zwar wird er schon zu dem Zeitpunkt antizipiert, an dem die Entscheidungen bezüglich einer Liberalisierung des Systems fallen, weil die Demokratisierung, d.h. die eigentliche Transformation, nichts anderes darstellt als die wegen der Unsicherheit z.T. ungewünschte Fortsetzung vorangegangener politischer und/oder wirtschaftlicher Liberalisierung. Die für die Machthaber negativen distributiven Folgen der institutionellen Neuerungen werden von ihnen gegen die Vorteile einer Öffnung des Systems abgewogen. Der den Demokratisierungsverhandlungen vorgelagerte Schritt der Liberalisierung wird damit zu einem strategischen Problem43. Wenn in den Reihen der Eliten mit Machteinbußen und materiellen Verlusten gerechnet werden muß, dann schließt sich die Frage an, warum sie einen Schritt in die Richtung zunehmender Unsicherheit akzeptieren. Aus den Akteurs- und Interaktionskonstellationen44 ergibt sich ein Entscheidungspfad von der Liberalisierung bis zur eventuellen Transformation, der von Przeworski spieltheoretisch rekonstruiert wird (1991): Sehen die Liberalisierer die Möglichkeit der Systemöffnung, so ergeben sich für sie zwei Wahlmöglichkeiten in einer ersten Entscheidungssituation. Entweder sie beharren auf ihrer Position, d.h. der Status Quo der Diktatur bleibt bestehen, oder sie tolerieren autonome Organisationen. Nur wenn die 42 Diese Antizipation der Ergebnisse aufeinanderfolgender Entscheidungssequenzen lassen sich spieltheoretisch als Problem der „backward-induction“ modellieren (Gibbons 1992). In der ex post Perspektive können die entstandenen Gleichgewichte (Nash-equilibrium) so auf ihre Entstehungsgeschichte untersucht werden. Dabei stößt man zwangsläufig auf die Diskussion der relevanten Akteurprämissen. Zeigt sich nämlich, daß mit dem spieltheoretischen Standartmodell des rationalen Akteurs die Kosten-Nutzen-Dimensionen nicht so verteilt gewesen sein können, daß sie über die Maximierungsentscheidungen zu den Gleichgewichten führten, dann müssen andere Prämissen eingeführt werden. Genau das ist - wie gezeigt wird - die Argumentationslinie Przeworskis. 43 „The strategic problem of transition is to get to democracy without being either killed by those who have arms or starved by those who controll productive resouces. As this very formulation suggests, the path to democracy is mined. And the final destination depends on the path. In most countries where democracy has been established, it has turned out to be fragile. And in some countries, transitions have gotten stuck.“ (Przeworski 1991: 51). 44 In Anlehnung an O’Donnell und Schmitter (1986) wird über den Verlauf der Transformation u.a. innerhalb der Eliten mit dem Diskurs zwischen Hardlinern und Liberalisierern entschieden. Innerhalb der Opposition ergeben sich die Strategien aus der Interessenvermittlung zwischen Moderaten und Radikalen. Vor diesem Hintergrund zweier sensibler Machtgleichgewichte werden in der Phase der Liberalisierung Schritte der Öffnung bzw. Massenmobilisierung erwogen und in der Phase der Demokratisierung die Verhandlungen geführt. Zusammenbruch der alten Ordnung 112 zweite Wahl getroffen wird und sich die gesellschaftlichen Kräfte in der vom Regime gewünschten Weise organisieren, dann ist das Liberalisierungsziel erreicht; die autoritäre Struktur der Diktatur ist gelockert. Organisieren sich die verschiedenen Kräfte der Gesellschaft aber weitreichender als von den Liberalisierern gewünscht, ergibt sich für die Liberalisierer eine erneute Wahl. In dieser zweiten Entscheidungssituation können sie einen Schritt zurück gehen - beispielsweise mit erneuten Repressionen die drohende Transformation zur Demokratie vermeiden. Ein derartiger Schritt ist nicht nur für die Opposition, sondern auch aus der Sicht der Liberalisierer kritisch, da bei erfolgreicher Repression oft eine „engere“ Politik die Folge ist; dann werden auch die Liberalisierer der Gnade der Hardliner ausgeliefert sein. Oder die Situation mündet in den allgemein unerwünschten Zustand der Aufstandes. Wie kann es trotz dieses Dilemmas dazu kommen, daß Schritte in Richtung einer zunehmenden Liberalisierung unternommen werden? Przeworski schlägt verschiedene Entscheidungspfade vor (1991): Die Liberalisierer müssen damit rechnen, daß die Opposition bei einer Öffnung ihre besseren Möglichkeiten zur autonomen Organisation ausnutzt. Sie müssen daher auf die Wirksamkeit repressiver Maßnahmen vertrauen können. Das wissen die Oppositionsgruppen in dem rationalen Modell auch. Die Folge ist, daß die Transformation nicht zustandekommt, es sei denn, die Entscheidungen werden auf der Grundlage falscher Annahmen getroffen. Bei den Liberalisierern könnte es sich um versteckte Demokratisierer handeln. Diese ihre eigentliche Präferenz müssen sie vor den Hardlineren verheimlichen können. Die Hardliner müßten dann eine Chance für die Verwirklichung ihrer Interessen in der Liberalisierung sehen. Sie könnten versuchen, der Bevölkerung glaubhaft zu machen, daß die Liberalisierer eigentlich Demokratisierer (also „Verfassungsfeinde“) sind und so repressive Maßnahmen gegen die Liberalisierer gerechtfertigt und legitimiert durchführen, um eine härtere Diktatur durchzusetzen. Die Liberalisierer müssen also ihre tatsächliche Präferenz verheimlichen, damit die Hardliner Zugeständnisse machen, und gleichzeitig ihre wahre Präferenz der Öffentlichkeit signalisieren, damit diese sich weiter als Oppositionskraft organisiert. Plausibler als dieses Doppelspiel ist ein anderer Weg, mit dem Przeworski zeigen kann, daß auch falsche Annahmen zur Transformation führen können. Hier muß die Bevölkerung die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Repression geringer einschätzen als die Liberalisierer, und sie muß diese Einschätzung auch für die Einschätzung der Elite halten. Angesichts der sich überraschend stark organisierenden Öffentlichkeit schraubt die Elite dann tatsächlich ihre eigene Erfolgseinschätzung bezüglich des Gelingens einer Repression herunter, so daß sie ein Transformationsergebnis dem Ergebnis eines Repressionsversuchs vorzieht; die Effektivität des Einsatzes von Waffen wird nicht mehr gesehen. Ein weiteres Szenario ist denkbar (Przeworski 1991): Im Laufe der Liberalisierung treten die oppositionellen Kräfte in Form ihrer Agenten als konkrete Personen in Erschei- Zusammenbruch der alten Ordnung 113 nung. Persönliche Kontakte können zwischen Angehörigen der Eliten und diesen Personen etabliert werden, die mit dem Fortschreiten der Verhandlungen zu Annäherungen führen können45. In einer solchen Verhandlungsatmosphähre wird in der Transformation nicht mehr ein Abgrund gesehen, und Repressionen erscheinen als unzivilisiert. Die Liberalisierer vollziehen eine endogene Präferenzenänderung hin zur Transformation46. Also eine Präferenzenänderung, bei der moralisch-normative Motive nicht ausgeschlossen, ja sogar wahrscheinlich sind. Oder vielleicht verhielt es sich so, daß dem Regime aufgrund seiner wirtschaftlich-politischen Situation nichts anderes übrig blieb als sich zu öffnen, obwohl die öffentliche Mobilisierung nicht zurückgehalten werden kann. Es ist durchaus denkbar, daß sich in einer solchen Situation Liberalisierer selbst zu der Annahme überreden, die Liberalisierung werde im Sinne einer gelockerten Diktatur erfolgreich sein47. Aus diesen drei Szenarien, die das Rätsel um die Initiierung der Transformation auflösen können, müssen Schlüsse für die Prämissen der Modellierung gezogen werden: Geht man davon aus, daß die Akteure rational handeln, dann muß man annehmen, daß sie ihre Entscheidungen auf der Grundlage falscher Information und falscher Einschätzung der politischen Situation („misperception“) getroffen haben. Mit dieser Korrektur findet eine signifikante Einschränkung des rationalen Akteurmodells statt. Ein alternativer Schluß besteht darin, daß man den Akteuren neben dem rationalen Motiv weitere Motive - wie normative und moralische Handlungsorientierung - als Entscheidungsgrundlage einräumt. Neben den anfänglichen Erwägungen der beteiligten Akteure spielen auch Kräfteverhältnisse und Machbalancen eine entscheidende Rolle für den Verhandlungsverlauf. Die Kräfteverhältnisse zwischen Opposition und Elite, aber auch innerhalb der Elite - zwischen Hardlinern und Moderaten -, werden wesentlich über die öffentliche Mobilisierung mitbestimmt. Streiks und Proteste können die Innerelitenkohärenz stören und die strategische Position der Akteure verändern (Przeworski 1988, 1991): Einmal bestimmt die Mobilisierung über Tempo und Rhythmus der Transformation, denn zeigen sich öffentliche Aktionen, so wird das Regime zu einer Reaktion gedrängt. Darüber hinaus hat die öffentliche Mobilisierung auch einen direkten Einfluß auf das politische Kräfteverhältnis. Sie signalisiert den Liberalisierern in der Phase der Liberalisierung wie auch den Demokratisierern in der Phase der Demokratisierung externe Allianzmöglichkeiten, und das kann eine Stärkung der liberalen bzw. demokratischen Position durch die Er45 Ein schönes Beispiel für die Realität solcher Orientierungen ist die Reaktion des tschechischen Premieministers Adamec auf die den Einigunsprozeß hemmenden strategischen Verflechtungen in der vierten Runde des Runden Tisches am 5. Dezember 1989: „Adamec seemed to be drifting off: as if in a dream, he remarked that there were much more interesting things to do, like sitting in a pub over a glass of beer with Havel...“ (Calda, 1996: 148). 46 Warum eine solche Präferenzenänderung nicht-rational ist, wird ausführlich unter dem Stichwort adaptive Präferenzen in Elster (1983) analysiert. 47 Zur Abweichung vom Rationalitätsmodell durch wishful-thinking vergleiche Elster (1989). Zusammenbruch der alten Ordnung 114 weiterung der sozialen Basis bedeuten. Wird die Transformation zu einem späteren Zeitpunkt unvermeidlich, wie es die Eigendynamik und der instabile Charakter der Liberalisierung suggeriert, dann wird auf der Basis des neuen Kräfteverhältnisse um die Gestaltung der Institutionen gerungen. Die Kräfteverhältnisse innerhalb des Machtblocks verschieben sich während der Liberalisierung und der Demokratisierungsverhandlungen ständig. Die Brüche im Machtblock werden sichtbar und signalisieren somit der Opposition Handlungsraum für politische Aktionen. Die Veränderung des Legitimitätsgrades des Regimes bei der Bevölkerung steht also in einem sich gegenseitig beeinflussenden Verhältnis zur Innerelitenkohärenz, d.h. der Loyalität einzelner Machthaber und Agenten zu den Führungseliten. Hierin liegt ein Hinweis, auf welche Art und Weise die Delegitimierung zur Transformation beiträgt und sie nicht etwa verursacht. Aus dem Grad der Delegitimität lassen sich keine Wahrscheinlichkeiten für Umbrüche ableiten. Ein solcher Schluß widerspricht auch der Tatsache, daß in vielen westlichen Industriestaaten relativ stabile soziale Verhältnisse vorliegen, obwohl auch dort die Frustration über die politischen und ökonomischen Verhältnisse hoch ist. Bedrohlich wird die Delegitimierung erst, wenn sie sich in organisierter Form, z.B. als autonome Organisation, in dem Streben nach alternativen Visionen Ausdruck verschafft (Przeworski 1991). Alternativen treten vornehmlich dann in Erscheinung, wenn sich Fraktionen innerhalb der Eliten bilden, die sich für liberalisierende Reformen stark machen, d.h. alternativen Konzepten Raum verschaffen. Loyalitätsverfall und Legitimitätsverfall sind zwei sich gegenseitg beinflussende und verstärkende Prozesse. „Hence, public mobilization and splits in the regime feed on each other.“ (Przeworski 1991: 56)48. Mit diesem Ergebnis löst sich das theoretische Dilemma der Debatte um die Charakterisierung der Transformation als eine Transformation von oben oder als eine Transformation von unten. Der Erklärungsgehalt einer solchen Charakterisierung tendiert gegen Null. Sie besitzt höchstens einen Informationsgehalt bezüglich der analytischen Perspektive bzw. Präferenz des Autors. 48 Und weiter unten heißt es: „Indeed, the top-down and bottom-up models often compete to explain liberalizations. The reason for this analytical difficulties is that the model that simply distinguishes the two directions is too crude. Short of real revolution - a mass uprising that leads to the disintegration of the apparatus of repression - decisions to liberalize combine elements from above and from below. For even in those cases where divisions in the authorian regime became visible well before any popular mobilization, the question is why the regime cracked at a particular moment. And part of the answer is always that the Liberalizers in the regime saw the possibility of an alliance with some forces that up to then had remained unorganized, which implies that there was some force in the civil society with which to ally. Conversely, in the cases in which mass mobilization antedated visible splits in the regime, the question remains why the regime decided not to repress it by force. Again, part of the answer is that the regime was devided between Liberalizers and Hardliners. Liberalization is a result of an interaction between splits in the authoritarian regime and autonomous organization of civil society.“ (Przeworski 1991: 57). Zusammenbruch der alten Ordnung 115 Ein besonders anschauliches Beispiel für das Zusammenspiel von Loyalitäts- und Legitimitätsverlust in eine unvorhergesehene und unbeabsichtigte Richtung, bildet die Entwicklung in der DDR. Die Verallgemeinerung von friedlichen Transformationsprozessen, die in den allgemeinen Modellen Przeworskies und Colomers angelegt ist, setzt die Transformation der DDR den Transformationen in den anderen osteuropäischen Staaten gleich49. Sie erscheint dann als eine bewußt ausgehandelte Transformation. Bei der Transformation der DDR handelt es sich aber um einen Sonderfall, bei dem nicht davon ausgegangen werden kann, daß der Zusammenbruch durch eine Annäherung von Opposition und Machtelite ausgelöst wurde. Die herrschenden Eliten konnten nicht – wie in den anderen Staaten - als Akteure auftreten, sondern wurden mit dem Beitritt der DDR zum Staatsgebiet der BRD zu Zuschauern degradiert (vgl. Offe 1994). Einflußreich waren die Akteure, die das sinkende Boot verließen und damit ungewollt den Zusammenbruch der DDR heraufbeschworen. Ab dem Zeitpunkt der zunehmenden Abwanderung und des Falls der Mauer spielten dann zunehmend externe Akteure aus der BRD eine wichtige, gestaltende Rolle. Ausgangsbedingung für den Zusammenbruch war auch für die DDR der institutionelle Konstruktionsmangel: die mangelnde Selbstbeobachtungsfähigkeit. Damit fehlte es an institutionalisierter Wissens- und Handlungsrationalität. Der Konstruktionsmangel stellte sich als ein moralisches Defizit mit ökonomischen Folgen dar. Die DDR war, wie die anderen osteuropäischen Regime, darauf angewiesen, seine Bürger einzusperren und die Wahrnehmung politischer Rechte zu unterdrücken. Dennoch gab es einen gravierenden historisch-kulturellen Unterschied, der eine zentrale Voraussetzung für die besondere Entwicklung der DDR Transformation bildete (Offe 1993, 1994): Die DDR stellte weder eine Nation noch einen staatlichen Verbund von Nationen, sondern nur eine „Teilnation“ (Offe 1993: 283), dar. Anstatt auf nationale Legitimationskräfte berief sich das Regime auf die „Antithese zur Vergangenheit“; auf das „politisch-moralische Substrat ‚antifaschistischer Staat‘“ (Offe 1994: 252). Dieses moralische Konstrukt war zwar Stabilitätsgarant, verbrauchte sich aber in der Realität des Alltags und konnte deshalb den zunehmenden Migrationsdruck nicht aufhalten. Allein die Repressionen garantierten den Erhalt des realsozialistischen Wirtschaftssytems; planwidriges gesellschaftliches Interesse konnte unterdrückt werden und Korruption unterbunden werden (Offe 1993). Der funktionierende Repressionsapparat wurde durch die Geschehnisse im Jahre 1989, die dem Migrationsdruck ein Ventil öffneten, überfordert. Ungarn öffnete seine Grenzen und schuf damit die Möglichkeit, Repressionen mit der Wahrnehmung der Exit-Option aus dem Weg zu gehen - die „Produktivkraft Repression“ stand der DDR nicht mehr zur Verfügung (Offe 1993, 1994: 36). Das galt insbesondere nach der 49 Vgl. beispielsweise Colomer (1991: 1298). Zusammenbruch der alten Ordnung 116 Aufkündigung der Breshnew-Doktrin durch Gorbatschow50. Vor dem Hintergund dieser außenpolitischen Ereignisse konnte eine Volksbewegung entstehen, die selbst als eine schwache Opposition die Stabilität des Regimes bedrohte. Der Repressionsapparat verlor seine Bedeutung nicht durch eine liberale Öffnung oder einen inneren Zerfall der DDR - wie es die Anwendung des Modells von Przeworski nahelegen würde. Die „Revolution“ in der DDR war vielmehr eine Exit-Revolution (Offe 1993, 1994): Die individuelle Abwanderung mit dem Wunsch nach wirtschaftlichem Wohlstand und nicht etwa der politische Kampf um eine neue Ordnung zerstörte die Basis des Regimes. Das zeigt sich einerseits an der Bedeutungslosigkeit des Runden Tisches51 und andererseits an der im Vergleich zu anderen osteuropäischen Staaten schwachen Opposition in der ehemaligen DDR. Auf indirektem Wege, über das private Handeln der Akteure, wurde das Regime zur Änderung bewegt52. Der moralisch anspruchsloseren Exit-Option kommt nach Offe für die Transformation in der DDR das Primat gegenüber der moralisch anspruchsvolleren Voice-Option zu. Die Wahl der Voice-Option war nachgeordnet, wie die Entwicklung und Bedeutung der Bürgerbewegung in der DDR zeigte. Sie konnte sich erst mit einer weit vorangeschrittenen Schwächung des Regimes entwickeln und bezeugte mit ihrem frühen Untergang ihre Bedeutungslosigkeit53. Ein nicht beabsichtigter Effekt der Abwanderung war, daß sie die DDR zu einer „Konkursmasse“ degradierte, für die es einer politischen Lösung bedurfte. Die Lösung bestand darin, daß BRD-Eliten die entscheidenden Akteure nach der vertraglichen Selbstauflösung der DDR wurden (Offe 1993: 287). Was sich bei Przeworski mit dem Konzept des „misperception“ bereits andeutet, radikalisiert sich in der Analyse Offes. Die Entwicklungen liefen in der DDR nicht nach einer rationalen Planung von Akteuren. Akteure trafen zwar Entscheidungen. Die Gestaltung des Transformationsprozesses sowie die kollektiven Folgen der Entscheidungen gerieten den politischen Akteuren aber außer Kontrolle. Der Grund dafür lag nicht nur in der besonderen historischen Situation der DDR, sondern auch in den Motiven der Bevölkerung. In den anderen osteuropäischen Ländern entsprang die Transformation zu einem marktwirtschaftlich-demokratischen System dem Wunsch nach Souveränitätsgewinn. Im Falle der DDR hingegen wurde Souveränität abgetreten; anderen wurde die Entscheidung über Um- und Neugestaltung überlassen. 50 Ein weiteres Kriterium für die Zurückhaltung der Führung war nach Offe das Negativbeispiel vom Massaker in China (1993: 292, 1994: 32). Mit dieser Interpretation steht Offe allein da. Verbreiteter ist die Einschätzung, daß die Erinnerung an das Massaker wie ein Damoklesschwert über der osteuropäischen Oppositionsbewegung hing (vgl. exemplarisch Goldstone 1994; Opp 1994). 51 Vgl. auch aufschlußreich Preuss (1996). 52 Die Transformation als kollektives Explanandum ist in dieser Perspektive unbeabsichtigte Folge absichtsvollen individuellen Handelns. 53 Eine alternative Erklärung der politischen Marginalisierung der Oppositionsbewegung in Ostdeutschland, die auf veränderte Kontextbedingungen nach dem Zusammenbruch und das politischkulturelle Erbe des Staatssozialismus verweist, gibt Kamenitsa (1998). Zusammenbruch der alten Ordnung 117 3.2 Öffentliche Mobilisierung Die Montagsdemonstrationen in Leipzig bilden in unserer Erinnerung ein Symbol für den friedlichen Umbruch der kommunistischen Regierungen in Osteuropa. Dennoch sollte die Bedeutung der Demonstrationen für den Transformationsprozeß mit Vorsicht beurteilt werden. Bei der Lektüre der Analysen zum öffentlichen Protest entsteht oftmals der Eindruck, daß der Zusammenbruch durch die Demonstrationen hervorgebracht wurde. Prosch und Abraham (1991) beispielsweise sehen in der öffentlichen Mobilisierung die Ursache für die Demokratisierung und bedienen sich dementsprechend auch des starken Wortes Revolution, um dem Prozeß ein signifikantes Etikett zu verpassen. Diese Einschätzung bestätigt zwar einen verbreiteten und durch die Medien vermittelten Eindruck, läßt aber die für den Beobachter im Dunkeln verlaufenen Innerelitenprozesse unberücksichtigt und widerspiegelt unter Umständen auch nur ein unkritisches, verklärtes Bild des politischen Engagements in den osteuropäischen Gesellschaften und besonders in der DDR. Nach Offe (1994) folgte die Mobilisierung in der ehemaligen DDR der mehr oder weniger zufälligen Schwächung des Regimes54; der Umbruch war daher eher eine Folge individueller isolierter Entscheidungen, die das Regime empfindlich berührten, als Folge eines bewußten, kollektiven politischen Engagements. Offe will damit wohl nicht sagen, daß die Proteste keine Rolle in der Entwicklung gespielt haben. Er hebt lediglich hervor, daß die Schwächung des Regimes erst sehr weit vorangeschritten sein mußte, damit eine vergleichsweise schwache öffentliche Mobilisierung seinen Bestand bedrohen konnte55. Eine Entscheidung in der Frage, welche Bedeutung die öffentliche Mobilisierung für den Zusammenbruch hatte, muß auch die Innerelitenprozesse berücksichtigen, die Proteste ermöglichten. Da diese Prozesse für den Beobachter aber weitgehend undurchsichtig bleiben, wird sich die Frage nach der Bedeutung nicht sicher beantworten lassen. Wenn Proteste auch nicht immer eine primäre Rolle für den Umbruch eingenommen haben, so haben sie doch mindestens einen mittelbaren Einfluß auf die Entwicklung. Politische Akteure können versuchen, die Bürgerbewegung nach ihren Interessen zu instrumentalisieren. Unabhängig davon, ob ihnen das gelingt, sind sie gezwungen, auf die Proteste zu reagieren. Die Reaktionen können sehr unterschiedlich ausfallen; in der DDR ließ man die Protestierenden weitgehend gewähren, während die Machthaber in China ein Massaker veranstalteten. Diese Varianz in den Reaktionen auf die Proteste 54 Dazu, wie Transformationsprozesse auf revolutionäre Bewegungen wirken können, vgl. auch die aufschlußreiche Untersuchung von Ryan (1994) zu den Entwicklungen in Guatemala und Venezuela. 55 Ekiert (1996) bspw. stützt diese Argumentation mit Bezug auf andere osteuropäische Staaten. Nach ihm konnten soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliche Potentiale wie in Ungarn der Tschechoslowakei und in Polen von den Machthabern vor 1989 erfolgreich unterdrückt werden und das System in seiner Stabilität nicht bedrohen, weil der Fragmentierungsgrad innerhalb der Eliten und der Organisationsgrad der oppositionellen Akteure gering waren. Zusammenbruch der alten Ordnung 118 war ausschlaggebend für den unterschiedlichen Verlauf der Transformationen. Die demonstrierenden Teile der Bevölkerung bildeten somit einen Akteur neben anderen im Transformationsprozeß, auch wenn ihr Beitrag zum Zusammenbruch eher indirekt und nicht aktiv gestaltend war. Ungeachtet der Bedeutung, die man öffentlichem Protest für die Transformation zuschreibt, bildet er ein erklärungsbedürftiges Phänomen. Das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens vom 4. Juni 1989 spielte für die Entwicklung des öffentlichen Protestes in Osteuropa und insbesondere der DDR eine maßgebende Rolle. Das DDR-Regime solidarisierte sich mit den Vorgängen in China und signalisierte somit den Demonstrationswilligen im eigenen Land Repressionsbereitschaft. Derartige Randbedingungen machen das Zustandekommen öffentlichen Protests als Erklärungsgegenstand zu einer Herausforderung56, die sich in drei Abschnitte unterteilen läßt: Erstens muß zu erklären versucht werden, warum sich Akteure - je nach Interpretation der Logik der Situation - unter mehr oder weniger riskanten Bedingungen dazu entschieden, öffentlich zu protestieren. Zweitens muß deutlich werden, warum sich ausgerechnet zu einem bestimmten Zeitpunkt genügend Bürger zu einem öffentlichen Protest entschlossen haben (so daß gerechtfertigterweise von öffentlicher Mobilisierung die Rede sein kann). Die dritte Herausforderung besteht darin, daß die Erklärung einen Hinweis enthalten muß, der zeigt, unter welchen Bedingungen die öffentliche Mobilisierung von der Aggregationsproblematik der Logik der kollektiven Handelns - im Sinne Olsons (1968) - unbeeindruckt bleibt: Die Erklärung muß Motive aufweisen können, die die Akteure veranlassen, die Kosten einer repressiven Reaktion der Machthaber und des eventuellen Mißerfolgs ihres Engagements zu einem bestimmten historischen Punkt zu vernachlässigen. Da die „öffentliche Mobilisierung“ ein Kollektivgut ist, muß aus der Erklärung auch ersichtlich werden, warum die Option des „Trittbrettfahren“ für die Akteure nicht in Frage kam57. Die Rolle der öffentlichen Mobilisierung für Transformationen läßt sich am deutlichsten am Beispiel der DDR untersuchen. Den Protesten in Leipzig, Berlin und Dresden wird nicht nur eine entscheidende Rolle für den Zusammenbruch des Regimes zugewiesen, sie bilden auch den Fokus der meisten Untersuchungen zur öffentlichen Mobilisierung in den Transformationen Osteuropas. Konnten sich die Akteure allein auf der Grundlage rationaler Erwägungen für eine Teilnahme am Protest entscheiden? Tietzel, Weber, Bode (1991) versuchen ein solches Mo56 Dieses Problem wurde als derartig zentral für das Verständnis der Transformation Osteuropas erachtet, daß die Zeitschrift „Rationality and Society“ eine Extraausgabe unter dem Titel „Rationality, Revolution, and 1989 in Eastern Europe“ (Vol. 6, 1994) herausgab. 57 Pappi sieht in dieser „Kollektivgutproblematik“ sogar das Hauptproblem der Erklärungsversuche von „...revolutionären Ereignissen wie die Montagsdemonstrationen in Leipzig...“ (1995: 237). Vgl. außerdem die klassische Studie zu Revolutionen von Tullock (1971). Zusammenbruch der alten Ordnung 119 dell zu konstruieren. Sie modellieren für eine „ökonomische Analyse“ der sanften Revolution einen rationalen Revolutionär, dessen Handlungslogik die des homo oeconomicus sein soll58. Allgemein erlaubt das Modell für das politische Handeln der Akteure vier alternative Strategien: Sie können erstens abwandern, zweitens widersprechen, drittens mitmachen oder viertens dulden. Die strukturellen Rahmenbedingungen erlaubten in der DDR bis 1989 die beiden ersten Optionen nicht. Am vierzigsten Jahrestag der DDR gibt Gorbatschow den Hinweis auf die Nichteinmischung der UdSSR in die Angelegenheiten der anderen osteuropäischen Staaten („Sinatra-Doctrine“). Darin sehen die Autoren ein entscheidendes Signal für die Akteure: Die Bevölkerung mußte nicht mehr mit derselben Wahrscheinlichkeit darauf gefaßt sein, daß öffentliches Engagement durch staatliche Repression negativ sanktioniert wird. Die Kosten für das Engagement in dieser neuen Situation wurden von den Akteuren neu kalkuliert und bewertet. Die Option Widerspruch rückte näher. Dann öffnete Ungarn - wohl auf Druck des IWFs seine Grenze nach Österreich, womit auf dem Hintergrund der andauernden wirtschaftlichen Schwäche und der damit verbundenen Unzufriedenheit mit privaten und kollektiven Gütern die zweite Strategie (Abwanderung) wieder Bestandteil des individuellen Kalküls wurde. Dennoch, und das gilt in besonderem Maße für das als durchaus rigide eingestufte System der DDR, zögerten die Kosten-Nutzen abwägenden Akteure mit der öffentlichen Mobilisierung. Die DDR-Regierung signalisierte Einverständnis mit dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens und strengte auch schon die Mobilisierung seiner eigenen Truppen an. Das Gespenst einer sowjetischen Intervention wie in Ungarn 1956 und der Tschechoslowakei 1968 schien zwar gebannt, dafür schien nun die DDR-Regierung aber zum Durchgreifen entschlossen. Der eigennutzorientierte homo oeconomicus der Autoren mußte also mit der Teilnahme und mit der Initiierung der öffentlichen Bewegung hohe Kosten assoziieren. Es gab nicht nur die Gefahr repressiver Maßnahmen. Die Öffnung der ungarischen Grenze eröffnete für die DDRBürger die Alternative der Abwanderung und belastete somit die Teilnahmen am Protest zusätzlich mit Opportunitätskosten. Die Autoren erkennen diese Problematik und versuchen, das sich aus ihr ergebene Puzzle mit dem folgenden Argument zu ordnen: Das sich nach einer Netzwerklogik generierende Motiv der moralischen Selbstverpflichtung verbunden mit den sich im Netzwerk generierenden Konventionen macht die „Revolution“ über die öffentliche Mobilisierung möglich. Aus dem moralischen Motiv entsteht die Initialkraft für die Mobilisierung, die jegliche Kosten ignoriert. Und die normative Orientierung an den in den persönlichen Netzwerken gültigen Konventionen hält die Akteure vom Trittbrettfahren ab, d.h. überwindet die sich insbesondere für die Logik der Selektion eines homo oeconomicus stellende Kollektivgutproblematik. Ist der Protest erst einmal initiiert, dann kann nach Tietzel, Weber, Bode die Zunahme der Beteiligung über einen Dominoeffekt erklärt werden. Der Mechanismus beschreibt die Wahr58 Vgl. auch Tietzel und Weber (1994). Zusammenbruch der alten Ordnung 120 nehmung steigender Erfolgswahrscheinlichkeiten bei zunehmendem Umfang der Beteiligten. Diese optimistische Einschätzung der Wirkung des Protests beeinflußt das individuelle Kalkül zugunsten der Protestbeteiligung. Diese Entscheidungssequenz ist nachvollziehbar, widerspricht aber den Prämissen des Modells. Die Kollektivgutproblematik wird über die Integration modellfremder Variablen, wie moralischer Orientierung und normorientierten Handelns, die durch die Geltung von netzwerkgenerierten Konventionen angeregt werden, gelöst. Die als Initialkraft wirkende „moralische Selbstverpflichtung“ verweist auf eine intrinsische Motivation, die das ergebnisorientierte Kalkül des homo oeconomicus in Richtung einer Prozeßorientierung verbiegt. Solche Motive können durchaus eine Rolle gespielt haben. Der Umstand, daß sie bei der Anwendung des Modells berücksichtigt werden, bei der Formulierung der Prämissen aber unberücksichtigt bleiben, wirkt sich auf Kosten der theoretischen Konsistenz aus und führt damit auf Kosten der Erklärungskraft zu theoretischen Interferenzen. Auch erweiterte, nutzentheoretische Modelle verfangen sich in diesem Widerspruch. Prosch, Abraham (1991) beispielsweise versuchen mit der „subjektiv expected utility theory“ (kurz SEU-Theorie) den Protest über subjektiven Erwartungen zu modellieren. Sie weisen den beiden Alternativen Inaktivität und Protest einen Erwartungswert (wahrscheinlicher Nutzen) zu, der die Grundlage für eine Entscheidung bildet. Protest wird dann als subjektiv nützlich bewertet, wenn er - zumindest in der Wahrnehmung der Akteure - zur Mitwirkung an dem Sturz der Regierung führt. Denn mit dem Machtwechsel wird eine Veränderung der Versorgungslage (und insofern Selbstbegünstigung) assoziiert. Formulierte man allerdings den Regierungssturz allein als Nutzen des Protests, würde das auf eine exklusive Ergebnisorientierung der Akteure verweisen, die die öffentliche Mobilisierung am Kollektivgutproblem scheitern ließe. Das erkennen die Autoren. Sie führen aus diesem Grunde ein Handlungsmotiv ein, das in dem Akt der Bekennung zur ehrlichen, nämlich abweichenden politischen Meinung einen individuellen Nutzen identifiziert. Über einen Verstärkungseffekt - ähnlich dem Dominoeffekt bei Tietzel, Weber und Bode - erklären die Autoren die Aggregation der schlagartig zunehmenden Beteiligung am Protest. Bei diesem Mechanismus werden die subjektiven Einschätzungen direkt von der Anzahl der Demonstranten beeinflußt. Daß dies nicht auf eine kontinuierliche Weise erfolgt sondern ruckartig geschehen kann, erklärt die Konstruktion einer kritischen Masse (Threshold-Modell), der es bedarf, um die Erwartungswerte der Akteure zugunsten des Protests zu kippen, d.h. einen Wechsel der Präferenzen in Abhängigkeit der sich ändernden Rahmenbedingungen möglich zu machen. Mit der Veränderung der Rahmenbedingungen verändert sich die Präferenzstruktur, die durch das Verhältnis vom Erwartungswert der Handlungsoption Inaktivität zum Erwartungswert der Protestbeteiligung gekennzeichnet ist. Im August / September 1989 Zusammenbruch der alten Ordnung 121 kommt es über Ungarn, Prag und Warschau als Reaktion auf die ungarische Grenzöffnung zu einer Massenausreise von DDR-Bürgern. Die Autoren gehen davon aus, daß wegen dieses zunehmenden politischen Drucks und wegen der mangelnden außenpolitischen Solidarität in Moskau in der Wahrnehmung der Akteure die Wahrscheinlichkeit des Sturzes der Regierung steigt. Es läßt sich aber plausibel argumentieren, daß die Akteure die Möglichkeitsbedingungen als stark eingeschränkt einschätzten, weil sich die DDR-Regierung nach dem Massaker offiziell mit dem chinesischen Regime solidarisierte und außerdem ihr Polizeiaufgebot massiv verstärkte. Diese Überlegung zur Bestimmung relevanter Rahmenbedingungen („Constraints“) bleibt bei den Autoren unberücksichtigt. Problematischer als die ungeklärte Interpretation der Constraints ist für das Modell aber der folgende Umstand: Die Autoren nutzen die SEU-Theorie explizit in Anlehnung an das von Lindenberg entwickelte Handlungsmodell. Lindenbergs Modell folgt wiederum der von Gary Becker aufgestellten Präferenztypologie (vgl. Lindenberg 1990). In dieser Typologie werden universelle Präferenzen, die sich in den Bedürfnissen nach physischem Wohlbefinden (physical wellbeing) und sozialer Anerkennung (social approval) ausdrücken, als anthropologische Konstanten eingeführt. Alle anderen Präferenzen richten sich auf die Erfüllung dieser Motive und sind insofern instrumentell. In Lindenbergs constraint-driven-Ansatz stellen sie die kontextspezifischen - also die den Rahmenbedingungen angepaßten - Mittel zur „Produktion“ des Ziels dar. In diesem Sinne wäre die von Prosch und Abraham hervorgehobene Bekenntnis zu einer abweichenden politischen Meinung vielleicht eine Variable in der Produktionsfunktion, die sich auf die Verwirklichung des universellen Ziels der sozialen Anerkennung richtet. Soll auf diese Weise argumentiert werden, dann liegt die Erklärungslast auf den Constraints; in ihnen muß der Hinweis darauf liegen, warum Protest eine wichtige Präferenz der Akteure wird. Teilt man die Einschätzung der Autoren bezüglich der abgeschwächten Bedrohung durch repressive Maßnahmen, dann verbleibt immer noch im Dunkeln die Lösung der Frage, warum die demonstrierenden Menschen nicht abwanderten bzw. in welcher Form die durch diese Option entstehenden Opportunitätskosten die Entscheidung für die Option Protest beeinflußten. Teilt man die Einschätzung bezüglich der Repressionswahrscheinlichkeit nicht, dann bleibt eine andere Frage in dem Modell der Autoren ungelöst, nämlich die, warum die Akteure dem Protest zuvor fernblieben. Gegen diese Argumentation ließe sich einwenden, daß die Logik der Aggregation mit der SEU-Modellierung eines Schwellenwertes konsistent geklärt werden kann. Esser unternimmt einen solchen Schritt (1993: 77f): Er argumentiert, daß die individuelle Teilnahme von der Anzahl der anderen Demonstranten abhängt. Die individuellen Schwellenwerte variieren und sind bei den „Pionieren einer sozialen Bewegung“ am niedrigsten; sie demonstrieren auch bei hohem Risiko und mit bescheidenen Erfolgserwartungen und initiieren somit den Aggregationsprozeß. Solche „moralisch gesonne- Zusammenbruch der alten Ordnung 122 nen Menschen“ (Esser 1993: 80) haben nicht nur die Mobilisierung in Leipzig, sondern auch in Ungarn 1956 und in der CSSR 1968 ausgelöst und koordiniert. Essers Erklärung bedarf also zweier unterschiedlicher Akteurstypen mit unterschiedlichen „unmittelbaren“ Motiven: Einerseits einer moralischen Orientierung und andererseits der Eigennutz- oder ökonomischen Orientierung. Daß sich große Gruppen wie die Protestbewegungen aus unterschiedlich motivierten Akteuren zusammensetzen, ist plausibel. Ein theoretisches Problem bleibt trotzdem bestehen: Werden den einzelnen Akteuren auch nicht unbedingt verschiedene Motive unterstellt, so wird doch ein Akteurtyp entworfen, der einerseits eine Schlüsselstellung einnimmt, andererseits aber aus dem Modell fällt. Der moralisch gesonnene Mensch kommt in der SEU-Theorie nicht vor. Wir lernen vielleicht etwas über den Zuwachs an Demonstrierenden. Aus welchen Motiven heraus der Protest entstehen konnte, verbleibt aber weiterhin ungeklärt. Die theoretische Inkonsistenz bestätigt sich auch in empirischen Untersuchungen. Opp, der einen ähnlichen theoretischen Standpunkt wie Prosch und Abraham sowie Esser vertritt (SEU-Theorie), unterzieht die Hypothesen bzw. Variablen zur öffentlichen Mobilisierung einer empirischen Überprüfung (1990). Mit den Ergebnissen dieser Untersuchung zeigt sich, welche Dimensionen und individuellen Motive für die Mobilisierung der Akteure eine wichtige Rolle gespielt haben und welche weniger ausschlaggebend waren. In seinem Erklärungsmodell wird der Protest ebenfalls als Kollektivgutproblematik operationalisiert (Opp 1990, 1991, 1993). Wie in dem SEU-Modell sind es die unvollständig informierten Akteure, die ihre Ziele entsprechend ihrer Präferenzen und subjektiv zugeordneten Wahrscheinlichkeiten unter den externen situativen Restriktionen bzw. Möglichkeiten zu maximieren suchen. Darüber hinaus werden bei Opp die Präferenzen auch von internalisierten Normen geprägt; die Normbefolgung stellt ein eigenständiges Motiv dar. Dieses Modell steht für eine weite Fassung des nutzenorientierten Handelns. Die Nutzenorientierung beschreibt nur die Folgerichtigkeit des Handelns und ist nicht auf einen Nutzentypus - wie den instrumentellen Nutzen des homo oeconomicus fixiert. Aus den Handlungsmotiven leitet Opp vier Variablen für das Zustandekommen des politischen Protests ab: Erstens beeinflußt die politische Unzufriedenheit (gewichtet mit dem subjektiv wahrgenommenen Einfluß) die Entscheidung (1). Zweitens wird von der Erwartung negativer staatlicher Sanktionen über die so entstehenden Risiken und Kosten ein Einfluß auf die Beteiligung erwartet (2). Drittens beeinflussen die internalisierten Normen verbunden mit der Erwartung der Bezugspersonen (3) und viertens eine intrinsische Motivation (4) das Handeln. Eine intrinsische Motivation verbucht die Kosten der Beteiligung (die bei einer Ergebnisoreintierung erwogen werden) über die Prozeßorientierung auf der Nutzenseite. Un- Zusammenbruch der alten Ordnung 123 ter diesen Umständen verliert der politische Protest, formuliert als Kollektivgutproblematik, seine Problematik59. Opp verfängt sich nicht in diesem Dilemma60, da er zwar die Logik des kollektiven Handelns als Aggregationsproblematik anerkennt, dabei aber besonders die Wirkung selektiver Anreize hervorhebt. Selektive Anreize müssen nach Opp im Gegensatz zu Olsons Theorie des Kollektiven Handelns (1968) nicht nur extern verteilt werden, sondern können auch als interne selektive Anreize wirken. Und zwar unter der Bedingung, daß ein entscheidender Einfluß der eigenen Handlung vermutet wird, wenn man die Erwartungen der Bezugspersonen erfüllt und wenn sich mit der Handlung selbst eine Befriedigung einstellt (die Variablen 1, 3 und 4 stimuliert werden). In Opps Vorstellung aggregieren sich die isoliert voneinander getroffenen Entscheidungen über ein „spontanes Koordinationsmodell“. Die Akteure entscheiden sich nach diesem Modell für die gleiche Handlung, weil sie sich in der gleichen Situation befinden. Als ein weiterer wichtiger Kontext für die Mobilisierung der Bürger werden die Netzwerke genannt. In diesen Zirkeln erwächst die Erwartung, daß die Partizipation unterstützt wird. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, daß genau die Variablen, die aus dem Kern des SEU-Erklärungsmodells nicht folgen, den größten Teil der Varianz erklären; dies sind die mit der wahrgenommenen Einflußmöglichkeit gewichtete Unzufriedenheit und die intrinsische Motivation. Die nutzentheoretisch unkomplizierte Variable der Erwartung negativer Sanktionen erklärt die Varianz so gut wie gar nicht. Das Netzwerkkonzept kann nicht als logische Verlängerung des Rational Choice-Modells aufgefaßt werden. Die Normbewertung ist daher nicht als eigenständiges Motiv mit den Ausprägungen gutes und schlechtes Gewissen konsistent in das Erklärungsmodell integrierbar. Für eine konsistente Darstellung der Proteste bedarf es also eines Modells, das über die reine Eigennutzenorientierung hinaus andere Motive integrieren kann. Ein solche Integration leistet das Exit-, Voice- und Loyaltymodell von Hirschman (1972, 1993). Mit dem Exit- und Voice-Mechanismus beschreibt Hirschman folgende Logik: Empfinden Konsumenten oder Mitglieder einer Organisation Enttäuschung bezüglich der Qualität der Güter oder Dienstleistungen, dann bieten sich ihnen generell zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder sie wählen die Option Exit, wandern ab, was auf indirektem Wege die Organisation zu Verbesserung drängen kann61. Oder sie wählen die Option Voice, d.h. widersprechen oder protestieren - meist mit der Absicht einer direkten Qualitätsverbesserung. Die beiden Umgangsweisen mit der Unzufriedenheit unter59 Vgl. hierzu auch Hirschman (1988) und Jordan (1996). Um ein Dilemma handelt es sich natürlich nur in dem Fall, daß das Besondere der Proteste in der Überwindung der Kollektivgutproblematik gesehen wird, also wenn man danach fragt, wie es möglich war, daß strategisch kalkulierende Akteure sich an einer solchen scheinbar riskanten Aktion beteiligten. 61 Nämlich als unbeabsichtigte Folge absichtsvollen Handelns. 60 Zusammenbruch der alten Ordnung 124 scheiden sich aber nicht nur in ihrer Wirkungsweise, sondern auch in ihrem Charakter. Voice ist kostenintensiver als Exit und verlangt, um etwas zu bewirken, oft nach kollektivem Handeln. Insofern handelt es sich bei den Entscheidungen für die Option Voice um individuelle Beiträge zur Herstellung eines öffentlichen Gutes, mit all seiner Problematik (Olson 1968). Die Exit Option hingegen verfolgt ein individuelles Ziel und richtet sich somit nur auf die Herstellung eines privaten Gutes. Neben diesen ergebnisorientierten Motiven wird das Handeln von einem weiteren Faktor bestimmt: der Loyalität. Ihr liegt ein Gefühl zugrunde, das in der Art eines Elastizitätsfaktors die rein mechanistische Umwandlung von Unzufriedenheit in Exit oder Voice irritiert. Das Gefühl der Verbundenheit mit der Organisation zögert Exit bzw. Voice bis zu einer bestimmten Schwelle hinaus. Ab diesem kritischen Punkt tendieren die loyalen Mitglieder dahin, ihrer Unzufriedenheit besonders kräftigen Ausdruck in Voice zu verschaffen, während die weniger loyalen eher Exit wählen. Die über das Loyalitätskonzept eingeführte Toleranz steht für die Dehnungs- und Stauchungsfunktion des Hydraulikmodells, mit dem Hirschman die Plötzlichkeit und Heftigkeit von Exit und Voice Aktionen erklärt. Konstitutiert sich die Logik der Situation als eine Verschlechterung, kann das einen Unzufriedenheitsdruck verursachen, der in Voice oder Exit kanalisiert wird. Je mehr Druck dabei in Exit mündet, desto weniger Druck ist für Voice verfügbar. Voice und Exit stehen in dem Modell also in einem disproportionalen Austauschverhältnis, für das Hirschman die Metapher einer Wippe (seesaw-modell) wählt. Das Verhältnis kippt allerdings dann, wenn sich beobachten läßt, daß die beiden Optionen miteinander kollaborieren, d.h. wenn sie sich - wie in der DDR 1989 - gegenseitig verstärken, also in eine positive Beziehung zueinander treten. Damit ist das Modell für einen ganz entscheidenden Erklärungsschritt geöffnet: Ein Mehr an Exit kann über die positive Verstärkungsbeziehung gelegentlich mehr Partizipation an Voice-Aktionen erklären. Und das Adjektiv „gelegentlich“ weist hier auf die Constraints; ändern sich die Rahmenbedingungen, so daß beispielsweise mehr Exit möglich wird, dann kann sich daraus eine Situation ergeben, in der sich die Akteure ihrer neuen Wahl bewußt werden und evtl. das Bedürfnis verspüren, die ganze Breite dieser neuen Diskretion auszuschöpfen; Voice wird stärker. Für die konkreten Entwicklungen in Osteuropa gibt Hirschman mit diesem Modell einen fruchtbaren Hinweis für die Erklärung des unterschiedlichen Charakters der Transformation in der DDR einerseits und der anderen osteuropäischen Staaten andererseits: Nach dem gewaltsamen Abbruch der Abwanderung durch den Mauerbau 1961 blieb die Hoffnung auf Exit erhalten und wurde auch - selbst wenn nur symbolisch - massenhaft über das Westfernsehen vollzogen. Als die Bedingungen für die Exit-Option sich erneut 1989 mit der Grenzöffnung in Ungarn änderten, wurde verstärkt mit Exit und Voice Zusammenbruch der alten Ordnung 125 reagiert62. In der Durchführbarkeit der Exit-Option und den direkten Hindernissen der Voice-Option liegt Hirschmans Erklärung der unterschiedlichen Entwicklung der DDR zu Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn. In der Tat gab es in den drei letztgenannten Ländern nie eine Exit-Option, wie in der DDR. Weder tatsächlich, wie bis 1961 und nach der Grenzöffnung 1989, noch symbolisch63 konnte ein Leben in einem anderen politischen und ökonomischen System gewählt werden. Der aufgebaute Druck mußte sich dort also über andere Kanäle entladen: in Polen über die Streiks der Danziger Werftarbeiter, die von der Gewerkschaft Solidarnosc organisiert wurden und bis zur Anerkennung der Gewerkschaft im August 1980 führten (Voice); in der Tschechoslowakei über die politischen Reformbemühungen bis zur sowjetischen Intervention im Prager Frühling 1968, und über die zunehmende Radikalisierung der Bürger auf den Straßen der Städte und der Streikbereitschaft der desintegrierenden Gewerkschaften 1989; in Ungarn über den Versuch einer liberalen Erneuerung bis zur blutigen Niederschlagung des „Ungarnaufstandes“ 1956, und über die spektakulären Demonstrationen und Sit-Ins, die 1988 von oppositionellen Gruppen zur Erinnerung an die Geschehnisse und Opfer (Imre Nagy) der Niederschlagung organisiert wurden. Was in dem Modell Hirschmans ungeklärt bleibt, ist die Frage, wie sich das private Handeln in öffentliche Aktionen verwandelt und wie sich die individuellen Beiträge zu dem kollektiven Gut Protest aggregieren. Ein Ansatz für die Aggregationslogik liegt in dem Hinweis, daß privates Handeln über die Medien öffentliche Berücksichtigung findet und somit Voice-Charakter gewinnt. Dieser Hinweis wird von Lohmann aufgegriffen und mit einer Extension des Modells ausgeführt. Lohmanns erweitertes Modell geht von der Interdependenz der Konsumentenentscheidungen aus (1994): Individuelle Handlungen können unter ähnlichen Bedingungen gegenseitig verstärkend wirken und zu einem kollektiven Phänomen aggregieren. Demonstrationen stellen in diesem Modell „Informationskaskaden“ dar, denen Lohmann eine Schlüsselrolle für den Kollaps eines Regimes zuweist (speziell gilt das für die DDR 1989). Dahinter steckt folgende Idee: werden die Beschwerden (Voice) der Konsumenten öffentlich, so gewinnen sie für die anderen Konsumenten die Bedeutung eines Stichworts oder Signals („informational cue“). Sie ziehen auf der Grundlage des Signals weitere Schlußfolgerungen über die Qualität des Produktes, was über die Wahl zwischen den Handlungsoptionen Exit oder Voice mitentscheidet. Lohmann modelliert damit eine Aggregation in zwei Schritten: Zuerst wird in einem „signaling-game“ Infor62 Bei der Übertragung des Exit-, Voice- und Loyalitymodells auf die Transformation der DDR bleibt von Hirschman unberücksichtigt, daß die Exitoption durchaus mit hohen Kosten belastet ist. Anders als der Verzicht auf eine Dienstleistung, läßt sich der Verzicht auf das Leben im gewohnten Umfeld schlecht ersetzen und ist daher oft schmerzhaft. 63 Symbolisch wurde die Exit-Option in DDR zwischen 1961 und 1989 über das Westfernsehen wahrgenommen. Den Bürgern boten sich über dieses Medium Identifikationsmuster mit ihren kapitalistischen Nachbarn an, deren oft beneidenswerte Lebenswelt tagtäglich präsentiert wurde. In einem Umfeld sich beschleunigender Veränderungen liegt es dann nahe, daß die Chance zur politischen Interessenartikulation vermehrt wahrgenommen wird. Zusammenbruch der alten Ordnung 126 mation über den Zustand der Welt von Sendern den Empfängern übermittelt. Die Wahl zwischen den beiden Optionen Exit und Voice wird dann in einem zweiten Schritt mit einem „benefit-cost-approach“ erklärt. Das Kosten-Nutzen-Modell soll in diesem Zusammenhang nur darauf verweisen, daß die Akteure systematisch auf einen Wechsel der Anreizstrukturen reagieren. Die individuellen Entscheidungen bleiben sozial eingebettet und von persönlichen Netzwerken beeinflußt. Damit hängt der Nutzen - auf den der Begriff „benefit“ verweist - des Einzelnen nicht nur von den politischen Bedingungen und der individuellen Entscheidung, sondern auch von den Beziehungen zum Umfeld ab. Mit dem Kaskade-Mechanismus kann die Umwandlung von Enttäuschung, also einer privaten Disposition, in das öffentliche Gut Protest problemlos modelliert werden. Die Dynamik der Informationskaskade generiert sich endogen durch die Mitteilung über die Änderungen des Beteiligungsumfangs am Protest. Das Kollektivgutproblem sieht Lohmann mit den Implikationen der Interdependenz der Entscheidungen gelöst: Das kostenintensive politische Handeln wird von den Akteuren als Herstellung von Information interpretiert. Sie schätzen ihre Handlung als potentiell ausschlaggebend für die Handlungen anderer ein. Somit geht der Beitrag der einzelnen Handlung auf dem Hintergrund der anderen Beiträge nicht ins Bedeutungslose, Nichtrationale über. Jede Handlung kann einen entscheidenden Einfluß auf die politische Entwicklung gewinnen, da jede Handlung das Potential hat, eine Informationskaskade auszulösen. Ein entscheidender Vorteil des Modells liegt darin, daß es die Interpretation des allgemeinen politischen Klimas (der Constraints) als bestimmt vom Repressionswillen der Regimes vermeidet. Denn es informiert darüber, daß ungeachtet einer solchen Einschätzung die Festlegung des Grades der Repression durch das Status Quo Regime ambivalent ist. Von jeder Aktion kann ein Signal ausgehen, das - sowohl bei Durchsetzung als auch beim Nachgeben der Regimes - die Assoziation des Legitimitätsverlustes und der Unsicherheit der Machthaber transportiert und so eine Informationskaskade auslöst. In den Modellen von Hirschman und Lohmann ist für die Logik der Selektion, also für die individuelle Entscheidungsorientierung, neben der Eigennutzorientierung immer auch - mindestens gleichberechtigt - die individuelle Orientierung an einer kollektiven Identität Einflußfaktor der Handlungsentscheidung. Hierin gehen sie eindeutig über die einfachen, eindimensionalen Akteurmodelle der ökonomischen Theorie hinaus. Bei Lohmann sind die Entscheidungen explizit in sozialen Netzwerken eingebettet, und die sich auf diese Weise bildenden kollektive Identitäten und Gemeinschaftsgefühle drücken sich bei Hirschman in dem Konzept der Loyalität aus64. Mit diesen Faktoren können die Modelle zusätzlich zu der Relevanz der Änderungen externer Variablen (unzufriedenstellende ökonomische Situation, Entwicklungen in der Sowjetunion und China, 64 Vgl. für eine ähnliche Einschätzung auch Pfaff (1996). Zusammenbruch der alten Ordnung 127 die Rolle der Medien u.a.m.) auf endogene Mechanismen der Handlungsorientierung (Interdependenz der individuellen Handlungen, auch derer, die außerhalb der unmittelbaren Erreichbarkeit in sozialen Netzwerken stehen) weisen. Das macht die Überraschung über die Entwicklungen verständlich; externe Faktoren und politische Variablen determinieren nicht den Gang der Geschichte in mechanistischer Weise, sondern werden intern nach einer schwer zu durchschauenden, weil multikausalen, Logik übersetzt. Das kann in der Perspektive, die mit der rationalen Orientierung der Akteure eindeutige quasi-kausale Wirkungsmachanismen aufstellen will, zu Paradoxien führen: Verschärfte Repressionen können die öffentliche Mobilisierung couragieren und somit die Opposition stärken, obwohl sie ungünstig auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis wirken. Ein weiterer Vorteil der Exit-, Voice- und Loyalitymodelle ist, daß sie einen Ansatz für die Erklärung der unterschiedlichen Entwicklung der DDR einerseits und der anderen osteuropäischen Länder andererseits bieten; ein Schritt, den man bei anderen Beiträgen vermißt und der für die Robustheit des Modells steht. Die Öffnung des Akteurmodells kann noch über den Verweis auf die aus inter-individuellen Variablen folgenden Handlungsorientierungen hinausgehen. Di Palma (1991) und Kuran (1991) verorten die Dynamiken des Wandels in intra-personalen Dispositionen. Auf diesem Wege lassen sich Entwicklungen erklären, die in ihrer Spontaneität und Heftigkeit über das Maß, das sich mit inter-individueller Solidarität und Vertrauenserwartung verstehen läßt, hinausgehen. Individuelles Engagement gewinnt auch jenseits der Erwartungs- und Unterstützungshandlungen des sozialen Umfeldes an Bedeutung. Isolierte, die öffentliche Mobilisierung initiierende Handlungen werden so erklärbar65, d.h. es muß nicht auf wenig überzeugende, weil inhaltsleere, Hilfskonstruktionen wie „moralische Selbstverpflichtung“ und „Helden der Revolution“ (Tietzel / Weber / Bode 1991; Esser 1993) zurückgegriffen werden. Di Palma stellt die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Erfahrungen mit den realsozialistischen Regimen als persönliche Wiederentdeckung der öffentlichen Würde und des öffentlichen Raumes dar (1991): Der Akt der Zurückweisung des Regimes bildet einen Akt der Katharsis bei dem das verlorene Selbstbewußtsein wiedergewonnen wird. Freeriding bildet insofern kein Problem für die Aggregation, als die Wiederentdeckung des öffentlichen Selbsts einen klar definierten, intrinsischen Nutzen birgt. Krisen sind ein willkommener Anlaß, die Verwirklichung dieses kognitiven Ziels mit der Auflösung der in kommunistischen Regimen impliziten Antagonismen wahrzunehmen. Die Verbindung von exogenen, strukturellen und institutionellen Einflüssen mit endogenen bzw. individuellen Reaktionen stellt Di Palma über den Begriff der Legitimität 65 Dies ist ein vielleicht wichtiger Erklärungsschritt, der von Hirschman und Lohmann unberücksichtigt bleibt, aber auch von Kuran und Di Palma so nicht formuliert wird. Eine Erklärung der öffentlichen Mobilisierung, die Vollständigkeit beansprucht, sollte aber auch die Handlungsmotive der „Anstifter“ zur Erstellung des kollektiven Gutes integrieren (vgl. dazu ausführlich Elster 1989). Zusammenbruch der alten Ordnung 128 her. In ihm liegt der Schlüssel für die Transformation. Nach Di Palma (1991) ist Legitimität in kommunistischen Systemen axiomatisch. Das bedeutet, daß die Gesellschaft zur Wahrheit erzogen werden muß und daß das Konzept der Civil Society keine Bedeutung hat. Für die Legitimität ist damit die entscheidende Beziehung nicht die von Herrscher und Beherrschten, sondern die Beziehung von Herrschern und ihrer Administration (also eigentlich Loyalität). In Anlehnung an Weber66 argumentiert Di Palma, daß die Legitimität kraft Mythos mit der Routinierung abnimmt. Das führt dazu, daß sich Paternalismus durchsetzt und sich zeitgleich durch den Wettbewerb mit dem Westen Antagonismen bilden. Mit der paternalistischen Erziehung zur Wahrheit angesichts der sich dramatisierenden inneren und globalen Realitäten und der daraus entstehenden Leistungsanforderungen wird die Lüge als kognitiver Triumph des Totalitärs zu Wahrheit. Die Bevölkerung mit ihren einzelnen, individuellen Bedürfnissen nach einem öffentlichen Selbst reagiert auf die Antagonismen mit der Bildung einer zweiten Gesellschaft, in der die Wahrheit kommuniziert wird und aus der heraus Reaktionen auf Krisen geboren werden. Dieser im Zusammenhang mit der Transformation neue Hinweis auf die spannnungsreiche Verbindung von Systemeigenschaften und individuellen kognitiven Dissonanzen ist nicht nur vor dem Hintergrund des totalitären Charakters vieler ehemals kommunistischer Regime plausibel, sondern auch ausbaufähig. Kuran zeigt, daß mit einem solchen Ansatz eine gute - weil sparsame und präzise - Erklärung für das Zustandekommen öffentlicher Mobilisierung möglich ist, die gleichzeitig die Unmöglichkeit der Vorhersage einer solchen Entwicklung veranschaulicht. Kuran (1991) modelliert für sein Erklärungsmodell, das dem Modell Di Palmas ähnlich ist, einen Akteur mit privaten und öffentlichen Präferenzen: Private Präferenzen sind in einer bestimmten historischen Situation fixiert, öffentliche Präferenzen hingegen stehen unter der Kontrolle des Akteurs. Das psychologische Wohlbefinden der Akteure ist in diesem Konzept abhängig von der Mischung und Übereinstimmung der beiden Präferenztypen. Unterscheiden sie sich, dann stellt sich eine „Preference-Falsification“ ein. Ein solcher dissonanter Zustand stellt einen Autonomieverlust dar, der mit psychologischen Kosten belastet ist. Stimmen die Präferenzen überein, ist die Integrität der Persönlichkeit hergestellt, und ein psychologischer Nutzen realisiert sich darin, zu sich selbst ehrlich zu sein. Die öffentlichen Präferenzen hängen von den privaten Präferenzen ab, sind aber auch interdependent, d.h. - ganz im Sinne Lohmanns - abhängig von der Größe der Opposition. Kuran konstruiert ein Schwellenmodell, in dem die Aggregation öffentlicher Präferenzen zu einer echten öffentlichen Mobilisierung über zwei Wege erreicht werden kann: Entweder wächst die öffentliche Opposition bei fixen privaten Präferenzen bis zu einem Punkt, an dem die externen Kosten der Beteiligung an der Opposition hinter die internen Kosten der „Preference Falsification“ fallen oder die 66 Vgl. Weber (1972: 142f). Zusammenbruch der alten Ordnung 129 privaten Präferenzen variieren. Damit bekommen alle Faktoren, die die internen oder externen Kosten bzw. Nutzen beeinflussen, einen Einfluß auf die jeweiligen individuellen revolutionären Schwellenwerte. Die Annahme der individuell variierenden Schwellen für die Beteiligung an der öffentlichen Mobilisierungen führt zu einer schlüssigen (und auch weit rezipierten) Aggregationslogik. Mit den individuellen Schwellensequenzen einer Gesellschaft entstehen Gleichgewichte, die sowohl sehr unempfindlich als auch sehr empfindlich für geringe Constraint- und Präferenzänderungen (externe und interne Kosten-Nutzen-Verteilungen) sein können. Kuran zeigt mit simplen spieltheoretischen Mitteln, wie je nach Verteilung der revolutionären Schwellen („revolutionary thresholds“) über den Bandwagon-Mechanismus67 explosive Oppositionszuwächse entstehen oder auch nicht. Es läßt sich mit dem Mechanismus außerdem zeigen, daß eine verbreitete Unzufriedenheit noch kein hinreichendes Kriterium für revolutionäres Engagement ist. Die beiden entscheidenden Variablen für das Zustandekommen der öffentlichen Mobilisierung sind vielmehr die vorab existierende Verteilung der Schwellen und die Veränderung dieser Schwellen. In ihnen sind Makro- und Mikrovariablen integriert, und insofern kann Kuran beanspruchen, daß sein Konzept individualistische und strukturalistische Ansätze integriert; beide Perspektiven beschreiben die ausschlaggebenden Bedingungen der gleichen Geschichte. Kurans Modell führt - wie auch Di Palmas Modell - zu der Schlußfolgerung, daß konkret für kommunistische Regime unter den strukturellen Bedingungen a) der „Lüge“ („I am Cain and I am Abel“), b) der katalysierenden Anstöße durch die Entwicklung in der sowjetischen Außenpolitik („Sinatra Doctrine“) und c) der Abweichungen im Establishment die Last der Mobilisierung eines politischen Veränderungsprozesses bei dem individuellen Bedürfnis liegt, zu sich ehrlich zu sein bzw. den intra-personalen Konflikt zu lösen. 3.3 Zusammenfassung Die Widersprüche, die sich aus den strukturellen Defiziten ergeben und zu einer Schwächung des Systems führen, können Zweifel an eingefahrenen Handlungsroutinen aufkommen lassen. Dann geraten die starren Herrschaftsstrukturen in Bewegung. Unter Umständen wird über institutionelle Änderungen nachgedacht. In dieser neuen Dynamik weitet sich der Entscheidungsspielraum für die Akteure. Mit der zunehmenden Diskretion individueller Handlungen verlieren Strukturen und Institutionen an direktem Einfluß auf den Transformationsprozeß, etwa im Sinne einer Eigenlogik. Verlauf und 67 Der Bandwagon-Mechanismus beschreibt einen Mitläufereffekt, bei dem sich einzelne dem Handeln oder der Meinung einer Majorität anschließen, weil sie glauben, damit erfolgreicher zu sein (vgl. zu diesem Mechanismus auch Coleman 1990). Zusammenbruch der alten Ordnung 130 Ausgang der Transformation folgen nicht mehr nur strukturellen Gesetzmäßigkeiten oder institutionellen Mechanismen. Sie werden vielmehr in z.T. komplizierten Abstimmungsprozessen hinter verschlossenen Türen von Akteuren gestaltet. Mit Akteurtheorien kann dennoch versucht werden, die Ungewißheit des Verlaufs und Ausgangs der Transformation in diesen dynamischen Prozessen mit einer Modellierung von Entscheidungssequenzen der Akteure zu überwinden. Hier gibt es prinzipiell zwei unterschiedliche Möglichkeiten: 1. Entweder geht man davon aus, daß mit der im Transformationsprozeß zunehmend öffentlich verlaufenden Kommunikation die Erfassung der Präferenzen und Ziele der politischen Akteure möglich wird. Unter dieser Voraussetzung - des abnehmenden Informationsmangels - lassen sich die Motive der beteiligten Akteure spiel- und tauschtheoretisch zu konkreten Verhandlungsergebnissen modellieren (Pappi 1995); die Handlungen der Akteure sind nicht mehr unvorhersehbar. Gegen diesen erklärungstheoretischen Optimismus lassen sich allerdings starke Argumente anführen: Der Transformationsprozeß ist gerade dadurch gekennzeichnet, daß weitreichende Entscheidungen unter geringer Information getroffen werden (vgl. Bos 1994). Es gibt immer externe unvorhersehbare Variablen, die die Entscheidungen beeinflussen, und oft ist nicht einmal ersichtlich, wer die Entscheidung für die Strategiewahl trifft, da die Innerelitenprozesse für den externen Beobachter weitgehend undurchschaubar bleiben. Auch die Äußerungen, die in der öffentlichen Debatte fallen, können nicht ohne weiteres als Grundlage für Annahmen über die tatsächlichen Präferenzen und Ziele der Akteure gelten. Vielmehr muß davon ausgegangen werden, daß Informationen oft mit strategischem bias vorgebracht werden: „If people behave strategically in pursuit in their interests, they also emit messages in this way.“ (Przeworski, 1991: 17). 2. Eine andere Möglichkeit besteht darin, auf der Grundlage von Akteursmodellen die Entscheidungssequenzen theoretisch zu modellieren, so daß sich der Charakter und Prozeß des Zusammenbruchs plausibel nachvollziehen lassen. Diese Möglichkeit wird dem Umstand gerecht, daß wir über die tatsächlichen Interessen bzw. Präferenzen der Akteure unter den undurchsichtigen Bedingungen strategischer Spiele nur spekulieren können68. Einerseits kann mit dem Modell der Prozeß nachvollzogen werden, d.h. die Entscheidungsschritte werden theoretisch begleitet. Andererseits kann die Frage nach den Möglichkeitsbedingungen einer Transformation zur Demokratie und dem Abbau der Autoritätsmacht beantwortet werden. Auf diesem Wege wird deutlich, welche Strategien und Motive in kritischen Situationen entscheidend für die Bestandsgefährdung des alten Regimes und für die Neugestaltung der Autoritätsstruktur sein können. Der 68 Pappi bezeichnet dieses Vorgehen als „Gedankenexperimente in der doppelten Form“, weil in solchen Modellen 1. die Präferenzen und Interessen der Akteure und 2. die Akteurskonstelationen ohne empirischen Bezug gesetzt werden (1995: 238). Diese Setzung ist hier mit Spekulation gemeint. Zusammenbruch der alten Ordnung 131 Prozeß der Transformation muß nicht als ein Verlauf willkürlicher Entscheidungen gesehen werden. Selbst dann nicht, wenn die Entscheidungsprozesse für den Beobachter undurchsichtig bleiben. Entscheidungssequenzen können nachgezeichnet werden: Schlüsselakteure lassen sich typisieren (vgl. O’Donnell / Schmitter 1986) und zentrale Interaktionen benennen (vgl. Huntington 1991-92). Theorien und Modelle des dynamischen Systemwandels können auf der Mikoebene der Akteurstheorien entwickelt werden. Diese zweite Möglichkeit wird in der Regel von den Ansätzen gewählt, die sich mit den Mikroprozessen der Transformation auseinandersetzen. Eine Ausnahme bilden die Untersuchungen zur öffentlichen Mobilisierung. Hier sind die Präferenzen und Strategien öffentlich und deshalb auch nicht strategisch verzerrt. Spekuliert wird dennoch: Die individuellen Motive und die Wahrnehmung der Situation sind für den Beobachter weitgehend undurchsichtig. Deshalb werden für die Klärung der wichtigen Frage, wie es zum öffentlichen Protest kommen konnte - ähnlich wie bei der Modellierung der Verhandlungsprozesse - Modelle verwendet, deren Beitrag zum Verständnis des Phänomens Protest primär nach Plausibilitätsgründen beurteilt werden muß. Bei der Modellierung der Entscheidungen, die von den politischen Akteuren getroffen werden, zeigt sich, daß sich die Art bzw. der Charakter des Zusammenbruchs nicht aus einer singulären Entscheidungssituation ergibt. Solche statischen Modelle, wie sie von Karl und Schmitter sowie Colomer entwickelt wurden, werden der Dynamik der Umbruchprozesse nicht gerecht. Vielmehr handelt es sich um sukzessive Entscheidungssituationen. Nach jeder Sequenz können sich die Strategien der Akteure ändern, weil sie sich an die neu geschaffene Situation anpassen müssen, in der sich Ausgangsbedingungen und Machtverhältnisse geändert haben können. Przeworskis dynamisches Modell zeigt, daß die Akteure oftmals nicht in der Lage sind, die Änderung der Ausgangsbedingungen korrekt zu antizipieren. Ungewollt verschieben sich die Machverhältnisse derart, daß beispielsweise die Öffentlichkeit als wichtiger politischer Akteur auftritt und Machtressourcen für Teile der Eliten schwinden. Im Extremfall der DDR führt der sich gegenseitig verstärkende Prozeß von Loyalitätsverlust und Legitimitätsverlust sogar so weit, daß die eigenen Eliten und die Bevölkerung zu Zuschauern „degradiert“ wurden. Externe Eliten übernahmen die „Abwicklung“ des alten Regimes und dessen Umbau. Solche Ergebnisse zeigen, daß nicht nur rationale Motive und Entscheidungen zum Zusammenbruch führten. Eine verzerrte Wahrnehmung der reellen Möglichkeiten und unbegründete Hoffnungen veranlaßten Entscheidungen, die zu Ergebnissen führten, die so von den politischen Akteuren nicht gewollt sein konnten. Mit der Modellierung der Entscheidungssequenzen läßt sich also nachzeichnen, wie es zu diesen unbeabsichtigten Folgen individueller Entscheidungen kommen konnte. Wenn ein Ergebnis der Modellierung aber ist, daß in den Entscheidungen nicht primär eine Zusammenbruch der alten Ordnung 132 rationale Umsetzung der Möglichkeitsbedingungen gesehen werden kann, die Möglichkeiten vielmehr falsch wahrgenommen werden, dann werden mit diesen Modellen Vorhersagen unmöglich. Wie soll der Erfolg strategischer Lügen und Mißverständnisse vorhergesehen werden? Und ebensowenig sind ein endogener Präferenzenwandel und irrationale Anwandlungen - wie Wunschdenken - kalkulierbar69. Die Leistung der Modelle beschränkt sich deshalb darauf, zum Verständnis der Prozesse beizutragen, ein „retrospektives Erklärungsmodell“ (Colomer 1991) zu liefern. Przeworski (1986, 1991) akzeptiert diese Einschränkung. Er will mit seinem Modell explizit keine Vorhersagen treffen, sondern beansprucht, nur Entscheidungsschritte zu modellieren, die zur Liberalisierung und zum Zusammenbruch führen können. Er zeigt, wie Korrekturen an dem rationalen Handlungsmodell und die Einführung alternativer Handlungsorientierungen die Entscheidungsmotive bei den Verhandlungen erklärend begleiten70 können. Solche Korrekturen durch die Integration realistischerer Annahmen über Handlungsmotive zeigen dann auch, warum die Prozesse so wie sie verliefen weder vorhergesehen noch geplant waren. Eine ähnliche Einschränkung des Erklärungsanspruchs findet sich bei den Analysen zur öffentlichen Mobilisierung. Die Beiträge zu den Protestbewegungen unterscheiden sich auf allen zentralen Erklärungsstufen voneinander: Es wird mit Handlungsdimensionen gearbeitet, die vom theoretisch sparsam konstruierten, eindimensionalen Akteur bis zum mehrdimensionalen Selbst reichen. Die strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen bzw. Variablen der individuellen Möglichkeitsbedingungen werden unterschiedlich bewertet71 und die Aggregation der vielen individuellen Handlungen zu kollektiven Ergebnissen wird unterschiedlich modelliert. Demnach unterscheiden sich die Beiträge nicht nur in der Qualität ihrer Erklärungsmodelle, sondern auch in dem an sich selbst gestellten Erklärungsanspruch. Für die Diskussion, welche Motive für die Beteiligung am öffentlichen Protest ausschlaggebend waren, bildet die Einschätzung der Gefahr repressiver Reaktionen eine wichtige Rolle. Hier unterscheiden sich die Urteile der Autoren. Einige sehen in dem Massaker am Platz des himmlischen Friedens in China und der öffentlichen Solidarisierung der DDR-Führung mit der Führung in Peking eine zunehmende Bedrohung, die die DDR-Bevölkerung hat wahrnehmen müssen. Andere Autoren betrachten die Verkün69 Wenn Wünsche die Annahmen und die Informationsselektion der Wahrnehmung bestimmen, kann keine Interessenabwägung auf dem Hintergrund der Möglichkeitsbedingungen nachvollzogen werden. 70 „Bounded rationality“ (Simon 1954) ist eine solche Korrektur. Mit diesem Konzept läßt sich misperception integrieren. 71 Ganz besonders auffällig wird die Differenz, die sich auf die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit repressiver Reaktionen des DDR-Regimes auf die Montagsdemonstrationen in Leipzig bezieht. Zum Teil wird die Teilnahme an den Demonstrationen als eine Handlung unter extremem Risiko für das persönliche Wohl gesehen. An anderer Stelle findet sich dem entgegen die Einschätzung, daß die Abwesenheit eines solchen Risikos die Demonstrationsbereitschaft erklärt. Zusammenbruch der alten Ordnung 133 dung der „Sinatra-Doctrin“ als ein Signal für die Bevölkerung, die historische Chance zum Regimewandel gefahrlos in die eigene Hand zu nehmen. Wie die Signale tatsächlich gedeutet wurden, läßt sich im Nachhinein schlecht klären. Festzuhalten bleibt aber, daß eine rationale Motivation, die mit dem Protest eine Verbesserung der politischen und ökonomischen Situation verband, nicht ausreicht, um das Ausmaß der öffentlichen Mobilisierung zu klären, selbst dann, wenn öffentliches Engagement gefahrlos hätte wahrgenommen werden können. Die Erklärung scheitert an der Kollektivgutproblematik. Realistischer scheint zudem die Einschätzung, daß von den Protestierenden mit Repressionen gerechnet wurde, was für ausschließlich eigennutzorientierte Akteure ein weiterer Grund sein mußte, den Demonstrationen fern zu bleiben. Andere, nicht-rationale Motive, wie die Orientierung an den sozialen Normen der persönlichen Netzwerke oder das Bedürfnis nach einem integeren privaten und öffentlichen Selbstbild, müssen hier gewirkt haben72. Dies hat Auswirkungen auf den Erklärungsanspruch der Modelle zur öffentlichen Mobilisierung. Würde es sich bei der Teilnahme am Protest um eine rationale Reaktion auf bestimmte historisch-strukturelle Voraussetzungen handeln, dann ließe sich der Protest voraussehen. Handeln die Akteure aber auf der Grundlage unterschiedlicher Motive, dann lassen sich die Reaktionen der Bevölkerung schlecht einschätzen bzw. vorhersagen. Hirschmans und Lohmanns Modelle beispielsweise zeigen, daß bei einer bestimmten Motivlage die verstärkte Erwartung von Repressionen gerade zur öffentlichen Mobilisierung führen können, obwohl dies aus rationalen Erwägungen nicht plausibel ist. Der „Preis“ für eine realitätsnähere Modellierung der Entscheidungen, die zu den Protesten führten und damit für ein besseres Verständnis, besteht also in diesem zurückgenommenen Erklärungsanspruch. 72 Allerdings muß der heroischen Vereitelung des Prozesses - und das gilt insbesondere für Analysen und Kommentare zur Transformation in der DDR - mit Vorsicht begegnet werden. Ist ex post eine Demokratisierung zu beobachten, dann kann man ihr Zustandekommen zwar erklären, muß damit aber keineswegs geklärt haben, ob die Demokratie ex ante überhaupt das primäre Ziel der Bevölkerung war. Paradoxerweise vermischen sich besonders bei den Erklärungsversuchen, die nahe an einem ökonomischen Kosten-Nutzen-Konzept argumentieren (d.h. eigennutz- und ergebnisorientierte Motivation als grundlegende Motive unterstellen), die Unterschiede von einer Verbesserung der individuellen Versorgungslage und einer Demokratisierung. Wurde nämlich das Kosten-Nutzen-Kalkül für die Beteiligung am Protest von der antizipierten Verbesserung des individuellen Zugangs zu materiellen Gütern mitbestimmt, ist das nur nach konventionell-konstruierten Maßstäben eine Option für Demokratie. Wie weit die Realität von diesem Maßstab abweichen kann, zeigen die rege Diskussion über die Konsolidierungsschwierigkeiten der Demokratie, das unmittelbare Einschlafen der Bürgerbewegungen nach 1989 und die z.T. zu beobachtende regressive Tendenz in postkommunistischen Gesellschaften. Auf diesem Hintergrund läßt sich die Transformation nur schwer als eine Veränderung verstehen, die dadurch zustande kam, daß sich individuelle Unzufriedenheit über die Verteidigung und über den Kampf für eine moralische Wahrheit (die sich etwa in der Demokratie verkörpert) löste. Die Unzufriedenheit scheint vielmehr immer auch eine materielle Unzufriedenheit gewesen zu sein, für die die Herstellung des öffentlichen Gutes „Protest“ nur ein Zwischenstadium zur Erreichung eines materiellen persönlichen Gutes darstellt, was naiv mit dem politischen Zustand Demokratie assoziiert wurde. Zusammenbruch der alten Ordnung 134 Zusammenfassend gilt, daß sowohl bei der Modellierung der politischen Entscheidungsituationen als auch bei den Modellen, die die öffentliche Mobilisierung zum Gegenstand haben, ein deduktiv-nomologischer Anspruch nicht aufrechterhalten werden kann. Das liegt daran, daß der Kern der Modelle, nämlich die Handlungstheorie, von multi-motivationalen Akteursprämissen ausgehen muß. Die Akteure treffen ihre Entscheidungen nicht nur nach Maßgabe rationaler, sondern auch nicht-rationaler und sogar irrationaler Motive. Welche Motive unter welchen Bedingungen für eine Entscheidung maßgeblich sind, läßt sich nur schwer bestimmen73. Der Vorteil von Modellen, die von mehreren Akteurmotiven ausgehen, liegt nicht nur in einer realitätsnäheren Modellierung der politischen Interaktionen und des öffentlichen Protests. Sie öffnen die Mikroansätze für einen Anschluß an Makro- und Mesotheorien. Strukturelle und institutionelle Bedingungen wirken nicht nur als Constraints auf das Akteurshandeln, wie von den rationalistischen Konzepten unterstellt. Sie wirken auch über ihre symbolische und kulturelle Dimensionen, die in Sozialisierungsprozessen vermittelt werden, auf die Präferenzenbildung der Akteure. Akteure folgen Handlungsroutinen demzufolge auch aus internalisierten, meist unreflektierten Motiven, d.h. aus Motiven, die nicht ergebnisorientiert sind - wie z.B. normative und moralische Orientierungen. Derartige nicht-rationale Motive gehören zum Handlungsrepertoire der Akteure in einem multi-motivationalen Ansatz. Die verschiedenen Handlungsmotive bilden neben dem Verweis auf die Constraints eine weitere Schnittstelle für den Anschluß an Meso- und Makrotheorien. 73 Ließe sich angeben, daß unter bestimmten Bedingungen ein Motiv vorherrscht, dann könnte versucht werden, von einem einfachen Modell Vorhersagen zu deduzieren. Colomer (1991) versucht dies. Der Versuch scheitert jedoch, weil der öffentliche Protest ein Phänomen war, zu dessen Erscheinung verschiedene Motive beigetragen haben müssen. Zusammenbruch der alten Ordnung 135 4. Die Verhandlungen an den Runden Tischen: Ein Modellentwurf Die mikrotheoretischen Ansätze gehen davon aus, daß Akteure eine Chance hatten, auf die Entwicklung im Transformationsprozeß einzuwirken. Konkrete Entscheidungen wurden gefällt zur Liberalisierung, Öffnung und zur Überführung der autoritären Regime in demokratische Regime. Die Relevanz von Entscheidungen einzelner oder kollektiver Akteure (vertreten durch Agenten) wird besonders in den Ländern deutlich, in denen zwischen Opposition und Machtelite der Übergang zur Demokratie und zu marktwirtschaftlichen Strukturen ausgehandelt wurde. In Ungarn, der DDR, Bulgarien, Polen und der Tschechoslowakei entschieden Verhandlungsführer an Runden Tischen über die verfassungsmäßigen Fragen einer Neugestaltung der sozialen Ordnung. Wie lassen sich diese Vorgänge in einer theoretischen Untersuchung der Transformationsprozesse berücksichtigen? Nach welcher Maßgabe entschieden und handelten die Akteure? Die Runden Tische wurden z.T. unter extremen Bedingungen eingerichtet. Es trafen nicht nur die Interessen neuer oder alter, oft verbotener Oppositionsgruppen auf die Interessen der Parteibosse und der Nomenklatura. Es standen sich - wie in Polen und der Tschechoslowakei - sozusagen Peiniger und Gepeinigte gegenüber. Nach einer langen Tradition der Unterdrückung und Kontrolle von kritischen Stimmen konnten diese Zusammentreffen keine unbelasteten Situationen mehr sein. Trotzdem kam es in den meisten Fällen zu Einigungen und kooperativen Arrangements, die über weitreichende Veränderungen zu einer friedlichen Transformation führten. Das bestätigt einerseits, daß in der Phase des institutionellen Umbaus die Entscheidungen individueller und kollektiver Akteure für den Verlauf und den Ausgang des Wandels bestimmend waren. Andererseits schließt sich die Frage an, welche Motive und Entscheidungen der Akteure einer friedlichen Entwicklung unter den schwierigen Bedingungen Ende der 80er Jahre den Weg ebneten. In der Transformationsliteratur gibt es kaum Versuche, die Entscheidungsprozesse der am Umbau beteiligten Akteure theoretisch aufzuarbeiten74. Hier soll nun versucht werden, dem Verständnis der Entscheidungsprozesse und damit des Transformationsprozesses theoretisch ein Stück näher zu kommen, indem anhand fünf ausführlicher und reichhaltiger Berichte über die Verläufe an den Runden Tischen die Verhandlungs74 Es lassen sich lediglich Versuche finden, die entweder über Korrelationen institutionelle Ergebnisse als Nachweis für gesetzte Akteursprämissen interpretieren (vgl. Geddes 1996; Welsh 1994) oder die weitab von empirischen Beobachtungen „sterile“ Modelle aufgrund logischer Schlüsse entwickeln (vgl. Przeworski 1991). Korrelationen bilden zwar eine gute Prüfung für theoretische Hypothesen, klären aber nicht die interaktiven Prozesse, die hinter den Ergebnissen stehen bzw. sie ermöglicht haben. Theoretische Modelle, die weitab von der Empirie entwickelt werden, können zwar nachweisen, daß nicht nur rationale Entscheidungen getroffen werden. Was jedoch fehlt, ist das Verständnis für die Motivlage, die hinter diesen Entscheidungen liegt. Zusammenbruch der alten Ordnung 136 schritte theoretisch nachgezeichnet werden. Die Berichte liegen in einem von Jon Elster veröffentlichtem Sammelband „The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism“ (1996) vor. Sie alle thematisieren das Aushandeln von Institutionen und konstitutionellen Arrangements an den Runden Tischen. Die Berichte sind im historisch-narrativen, also deskriptiven Stil verfaßt. Ihre Verfasser halten sich mit Generalisierungen weitgehend zurück. Dennoch zeichnen sich z.T. Ähnlichkeiten und gemeinsame Verlaufsmuster der Verhandlungen an den Runden Tischen ab. Auf der Basis solcher Gemeinsamkeiten versuchen die Autoren, an der einen oder anderen Stelle Begründungen bzw. Mechanismen in Form von Ursache-Wirkung-Zusammenhängen anzugeben. Hierin liegt ein erster Schritt zu einem erklärenden Beitrag. Es gibt aber natürlich auch signifikante Unterschiede zwischen den Entwicklungen der einzelnen Staaten. Der Grund dafür liegt nicht nur in den spezifischen historisch-strukturellen Voraussetzungen, sondern ergibt sich auch aus den Motiven und Spielzügen der an den Verhandlungen beteiligten Akteure. Solche Unterschiede widersprechen pauschalisierenden Einschätzungen, die versuchen, die gesamte osteuropäische Transformation unter einer gemeinsamen Charakterisierung zu subsumieren - wie „Der Sieg der Demokratie und der Marktwirtschaft über den Kommunismus“. Gerade die jüngsten Diskussionen um die Osterweiterung transnationaler und supranationaler Organisationen verweisen auf die Unterschiede der osteuropäischen Staaten. Ökonomische Performance und politische Konvergenz, an denen sich die als relevant erachteten Zutrittskriterien orientieren, sind auch von den institutionellen Designs und ihrer Legitimationsbasis, wie sie sich in der Zeit der Runden Tische als Verhandlungsergebnisse herausbildeten, abhängig. Abweichungen und Unterschiede in der Entwicklung der einzelnen Staaten lassen sich in einer Erklärung als unterschiedliche Ausprägung abhängiger Variablen interpretieren. Dies ist dann möglich, wenn man allgemeine Faktoren (unabhängige Variablen) erkennen kann, die in ihrem Mischungsverhältnis den Verlauf der Verhandlungen in die eine oder andere Richtung lenken. Eine solche vergleichende Analyse der Prozesse an den Runden Tischen der fünf Staaten soll die theoretische Reflexion der Berichte leisten. Darüber hinaus zeigt die Auseinandersetzung mit dem Thema, daß ein reduktionistisches, eindimensionales Akteursmodell aus Plausibilitätsgründen zurückgewiesen werden muß. Der durch solche Modelle abgedeckte Bereich kann nur einen Teil der Erklärung des gesamten Phänomens umfassen. Für die blinden Flecke der Erklärung eignen sich andere Ansätze, die über eine multi-motivationale Perspektive in einer umfassenden Erklärung integriert werden müssen. In der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie sich die Prozesse an den Runden Tischen und die aus ihnen folgenden unterschiedlichen Entwicklungen theoretisch reflektieren lassen, werden drei analytische Perspektiven kombiniert. Zuerst wird gezeigt, wie ein Ansatz, der vom erfolgsorientierten bzw. nutzenmaximierenden Handeln der Zusammenbruch der alten Ordnung 137 Akteure ausgeht, zur Erklärung beitragen kann. In einem zweiten Schritt werden dann Normorientierung und im dritten Verständigungsorientierung als zusätzliche Akteursmotive eingeführt. 4.1 Strategische Spiele Die Verhandlungsführer an den Runden Tischen traten als Vertreter von Interessenverbänden, Organisationen, sozialen Bewegungen oder Parteien in Erscheinung. Als Agenten versuchten sie, in den Verhandlungen zu Ergebnissen zu kommen, die im Interesse der durch sie vertretenen kollektiven oder korporativen Akteure lagen. Niemand wird deshalb bestreiten wollen, daß für die Verhandlungen strategisches, machtorientiertes Handeln der Akteure eine wichtige Rolle gespielt hat. Mit dieser Feststellung allerdings muß noch kein „Commitment“ für eine eindimensionale Modellierung der Akteursmotive erfolgt sein. Es kann sich bei der Handlungsorientierung Nutzenmaximierung vielmehr um ein Motiv neben anderen handeln. Eine theoretische Analyse der Transformation muß daher für andere Dimensionen individueller Motivationen und für eine kritische Verwendung des Akteurbegriffs offen bleiben75; Normorientierung und die Unterordnung strategischer Schritte unter einen gemeinsam geteilten Werthorizont müssen möglich sein. Die Verhandlungsschritte dennoch in dem Vokabular und mit den Mechanismen der Spieltheorie zu beschreiben, muß keinen Widerspruch zu diesen Vorannahmen bilden. Eine mehrdimensionale Sicht der Akteursmotive bei gleichzeitiger Nutzung rationalistischer Theorien mit eindimensionalem Akteurskonzept ist durchaus möglich76. Auch wenn der Erklärungsbeitrag des Rational Choice-Ansatzes eingeschränkt ist, bleibt er doch für einen bestimmten Bereich alternativlos (vgl. Elster 1989, 1989a, 1989b). Allerdings gilt dies nur für Ansätze, die Korrekturen und Ergänzungen einer orthodoxen spieltheoretischen Sicht - wie sie in den Arbeiten von Luce und Raiffa (1957) und Nash (1951, 1953) vorliegen – berücksichtigen und nicht simplifizierend mit dem überholten Modell des homo oeconomicus arbeiten. Die Ansätze sollten die wichtigsten Weiterentwicklungen des rationalen Akteurmodells berücksichtigen77. Mit den Korrekturen 75 Vgl. zum Beispiel den integrativen Ansatz Przeworskis (1991). Ullmann-Margalit formuliert die wissenschaftstheoretische Grundlage für ein solches Vorgehen und liefert damit die Begründung für die Verwendung des spieltheoretischen Ansatzes neben anderen Ansätzen (1977): Sie versteht spieltheoretische Studien als rationale Rekonstruktionen im Sinne Carnaps. Mit den Rekonstruktionen lassen sich Szenarien aufbauen, die idealtypischen Charakter aufweisen (Ullmann-Margalit 1977: 2). Mit der spieltheoretischen Rekonstruktion lassen sich die „korrekten“ Züge im wettbewerbsgewinnenden Sinne verstehen. Die idealtypischen Konstruktionen können als bench mark dem Studium tatsächlichen Handelns dienen (Schelling 1963: 3). 77 Dies sind vor allem Schellings Hervorhebung der „focal points“ (1963), Simons „bounded rationality“ (1954, 1990) und Tverskys und Kahnemanns „prospect theory“ (die sich insbesondere auf die Berücksichtigung von Frameingprozessen und „risk aversion“ konzentriert, vgl. 1979). Darüber hinaus 76 Zusammenbruch der alten Ordnung 138 des rationalen Akteurmodells erfolgt aber auch eine deutliche Einschränkung der Erklärungsleistung der Rational Choice-Ansätze: Werden den Akteuren nicht nur rationale, sondern auch nicht-rationale oder sogar irrationale Motive zugestanden, dann kann die Theorie keine klaren Vorhersagen mehr treffen. Deduktive Schlüsse scheitern, weil Wirkungsmodelle nicht mehr eindeutig sind und die ceteris paribus-Bedingungen der rationalistischen bzw. spieltheoretischen Modelle für die Realität kaum gelten. Der Erklärungsanspruch tritt somit hinter die Deskription und Entwicklung heuristischer Modelle zurück. Diese Einschränkung gilt auch für den Versuch, die Verhandlungen an den Runden Tischen spieltheoretisch nachzuvollziehen. Verhandlungen lassen sich als „Mixed-Motive Games“ charakterisieren (Schelling 1963). Sie sind sowohl durch Konflikt, als auch durch ein gegenseitiges Aufeinanderangewiesensein gekennzeichnet. Daß die Verhandlungspartner auf einander angewiesen sind, zeigt die Bereitschaft oder auch erkannte Notwendigkeit, an Verhandlungen teilzunehmen; beide (bzw. alle) Seiten erhoffen einen Gewinn von der Zusammenarbeit. Der Konflikt entsteht bei der Ausgestaltung der distributiven Kompromißfindung, d.h. der Frage, wie der gemeinsam erzielte Gewinn aufgeteilt wird. Über den Erfolg und das Ergebnis der Verhandlungen entscheiden die Verhandlungsmacht, das strategische Geschick wie auch die Motive der Beteiligten. Diese Komponenten bestimmen den charakterlichen Schwerpunkt der Verhandlung: - Überwiegt das Motiv des relativen Vorteils, dann kann die Konfliktorientierung so weit die Verhandlung beherrschen, daß evtl. die Kooperationsvorteile für die Bewertung der Situation keine Rolle mehr spielen (vgl. Scharpf 1988). Es handelt sich dann um ein Nullsummenspiel, bei dem der eigene Nutzen nur mit dem Nutzenverlust des anderen zunimmt. - Wird die Verhandlung hingegen als ein „Common-Interest Game“ verstanden, d.h. als ein Verfahren, das auf starke gemeinsame Interessen baut, dann kann die Kooperationsorientierung das Spiel in ein Koordinationsspiel (Positivsummenspiel) transformieren. Diese beiden Ausprägungen, Nullsummenspiel (Konflikt) und Koordinationsspiel (Kooperation), bilden die Endpunkte auf einem Kontinuum (siehe Abb. 2). In der Realität finden sich meist Mischformen, eben „Mixed-Motive Games“. Auf der Basis der gemischten Motivlage der Akteure wird die Verteilung des Kooperationsgewinns verhandelt. Dabei spielt die Verhandlungsstärke eine bedeutende Rolle. Sie ist eine wichtige Voraussetzung für die Strategiewahl und Erfolgswahrscheinlichkeit der beteiligten Akteure. Es läßt sich leicht zeigen, welchen Einfluß diese Größe auf die Verteilung des hat sich ganz wesentlich Jon Elster um die Korrektur des rationalen Modells bemüht (vgl. Elster 1987, 1992). Zusammenbruch der alten Ordnung 139 Ergebnisses der Kooperation hat (vgl. Elster 1989a zum Mathew-Effekt): Der wohlhabendere Spieler kann bei dem ärmeren Spieler eine zu seinen Gunsten ungleiche Aufteilung des gemeinsam erarbeiteten Gutes durchsetzen. Er wird dem Armen einfach anbieten: „take it or leave it“, da er den Verlust des Kooperationsgewinns riskieren kann und außerdem weiß, daß der arme Spieler lieber einen kleinen Anteil nehmen wird als gar keinen. Denn auch ein kleiner Gewinn bringt eine Verbesserung der Situation des Armen. Die objektive Verhandlungsposition des Wohlhabenden ist stärker, und die Verhandlungsposition des Armen ist schwächer; der distributive Anteil kann also proportional zur Asymmetrie der objektiven Bedingungen steigen oder schrumpfen. Die Verhandlungsgegenstände an den Runden Tischen bildeten im weitesten Sinne Machterhalt und Machtgewinn (dazu zählen auch Organisations- und Partizipationsrechte). Zu ihrer Realisierung wurde Verhandlungsmacht strategisch eingesetzt, die im politischen Kontext durch unterschiedliche Ressourcen definiert ist. Die Ressource, über die die Opposition in den osteuropäischen Staaten verfügte, war Legitimität. Ihre Anliegen fanden starken Rückhalt in der Bevölkerung. Wer sich mit der Opposition verbündete, konnte deshalb auf einen Legitimitätsgewinn hoffen. Die Machteliten fanden sich zu Verhandlungen mit der Opposition bereit, weil sie zur Wiederherstellung und Sicherung des sozialen Friedens einen Weg aus der Delegitimation finden mußten. Als Gegenleistung boten sie Liberalisierung und Demokratisierung und/oder die Verwirklichung von Menschenrechten an. Diese Eingeständnisse bildeten ihre wichtigste Verhandlungsressource. Weniger offensichtlich, aber keineswegs minder bedeutend für den Verhandlungsverlauf, wurden zwei weitere Ressourcen eingesetzt: Für die Opposition bildete die Drohung, Unruhen (Proteste oder Streiks) bei ungenügenden Eingeständnissen der Regierung nicht zurückhalten zu können, eine Machtquelle. Für die Regierung war der Verweis auf eine mögliche Intervention Rußlands bzw. auf die Notwendigkeit, die eigene Armee gegen Protestierende einzusetzen, wenn ihre Interessen oder die der Sowjetunion nicht ausreichend berücksichtigt würden, eine Drohung mit starker Wirksamkeit. Insbesondere bei der Ausgestaltung konstitutioneller Designs spielte der Einsatz der Ressourcen der Moraleliten (Opposition) im Verteilungskampf gegen die Ressourcen der Machteliten eine entscheidende Rolle (vgl. Preuss 1996). Die Machteliten nutzten die Ressourcen, um konstitutionelle Institutionen durchzusetzen (bspw. Regierungsform und Wahlsystem), die bei der Institutionalisierung demokratischer Spielregeln den eigenen Interessen gute Chancen garantieren sollten. Aber auch auf Seiten der Opposition war das wichtigste Argument für die Durchsetzung ihrer institutionellen Vorstellungen der Verweis auf ihre Machtressource: Sie reklamierten für sich, die legitimen Interessen der Bevölkerung zu artikulieren. Zusammenbruch der alten Ordnung 140 Durch die Verteilung der Verhandlungsmacht und den Einsatz der entsprechenden Ressourcen wurde der Verhandlungsverlauf an den Runden Tischen in Osteuropa entscheidend geprägt: In Bulgarien ließ die relativ starke Position der Regierung die Konsensbildung zuungunsten der Opposition verlaufen (Kolarova / Dimitrov 1996): Die hohe Mitgliedschaft in der ehemaligen Kommunistischen Partei Bulgariens (BCP) zeigt, daß trotz der Krise eine stabile Legitimationsbasis der herrschenden Eliten vorhanden war. Die Bereitschaft, mit der Opposition zu verhandeln, entstand also zu einem bedeutenden Teil aus der extern aufgezwungenen Notwendigkeit und nicht aus einem echten Kooperationsbedürfnis. Die Sowjetunion unterstützte und inspirierte den Demokratisierungsprozeß, internationaler Druck und Isolation machten ihn notwendig. Aber auch intern gab es Probleme. Die starken Repressionen gegen Menschenrechtsbewegungen und ethnische Probleme führten nicht nur zur Ausreise von 300.000 Türken, sondern auch zu Protesten der Bevölkerung. Daß die regierende Partei dennoch über Verhandlungsmacht verfügte und sie auch in den Verhandlungen einsetzen konnte, zeigte sich an den erfolgreichen Manipulierungsversuchen, mit denen die Verhandlungen an den Runden Tischen strategisch gelenkt wurden. Die Position der Regierung war so stark, daß sie die Runden Tische als vorwegnehmende Maßnahme instrumentalisieren konnte. Die Änderungen waren marginal, d.h. finanzielle und organisatorische Machtressourcen konnten gehalten werden. Eine Strategie der Regierung bestand darin, die Agenda der Runden Tische zu manipulieren. So gelang es ihr beispielsweise, daß der Parteibesitz nicht thematisiert wurde. Die Runden Tische konnten in Bulgarien die regierende Kommunistische Partei (BCP) nicht dekonstruieren - lediglich ihr Name änderte sich: Sie avancierte ganz im Zeitgeist zur Sozialistischen Partei Bulgariens (BSP). Durch die Verhandlungen mit der Opposition wurde die ohnehin dominante Position der Partei auf eine legitime prozedurale Basis gestellt. Zu einer solchen machtstrategischen Instrumentalisierung der Runden Tische trug auch die Tatsache bei, daß Bulgarien keine Dissidenten- und Oppositionstradition hatte. Der Verhandlungspartner der Regierung formierte sich erst im Dezember 1989 als eine lose Union der demokratischen Kräfte (UDF), die schlecht strukturiert war und nur einige wenige Mitglieder aufweisen konnte. Trotzdem schien sie während der Unruhen im Januar 1990 die einzige politische Kraft zu sein, die die Massenproteste kontrollieren konnte. Dies mag ein Grund für die BCP gewesen sein, sich an die Runden Tische zu setzen. Aufgrund des geringen Organisationsgrades aber konnte kein gemeinsames Programm der Oppositionskoalition in dieser bereits hochdynamischen Phase des Umbaus vorgewiesen werden. Obwohl die Zeit drängte, war es für die UDF am wichtigsten, Zeit zu gewinnen, um ein Programm auszuarbeiten. Die organisatorische Verhandlungsschwäche der Opposition erlaubte es der Elite, die - wegen der angespannten politischen und ökonomischen Lage - notwendigen Reformen als vorbeugende Maßnahmen ohne Kompromißbereitschaft gegenüber Zusammenbruch der alten Ordnung 141 der UDF, d.h. ohne Berücksichtigung oppositioneller Interessen, durchzuführen. Die Beteiligung der Opposition hatte also mehr eine symbolische Funktion, und dies war wohl auch das bedeutendste Motiv für die Bereitschaft, mit der Opposition zu verhandeln. Die Regierung drängte beständig auf schnelle, ihr gefällige Lösungen. Jedoch stellte sich diese Strategie als kritisch heraus. Die UDF an den Gesprächen zu beteiligen, reichte nicht aus. Die Bevölkerung fühlte sich betrogen und reagierte dementsprechend auf die Ergebnisse nach der ersten Wahl mit Protest. Erst dann schien die BCP die Runden Tische über ihren symbolischen Gehalt hinaus ein wenig ernster zu nehmen. In Polen waren die Voraussetzungen, unter denen die Gespräche stattfanden, ganz anders als in Bulgarien. Das Land befand sich 1989 in einer starken ökonomischen, sozialpolitischen sowie moralischen Krise (Osiatynski 1996). Einen Ausweg aus dem mit der Krise einhergehenden Legitimitätsdefizit sah man nur in der Kooperation mit der Gewerkschaft Solidarnosc. Sie fungierte als Legitimitätsgarant. Auch die Solidarnosc war bereit zu kooperieren. Sie hatte auf dem Hintergrund der Erfahrungen unter dem Kriegsrecht und mit dem Verbot oppositioneller Bewegungen seit 1981 ihre Alles-OderNichts-Strategie aufgegeben. Beide Seiten setzten sich mit der Einstellung an die Runden Tische, daß nur ausgehandelte Kompromisse eine funktionierende und deshalb erstrebenswerte Lösung sind. Die Beteiligten schienen ausnahmslos auf eine vernünftige Lösung hohen Wert zu legen. Das zeigten die Bestrebungen, öffentlich zu debattieren und die Vergangenheit nicht zu thematisieren, so daß Drohungen, Streitigkeiten und Emotionen keine strategische bzw. blockierende Rolle bei den Verhandlungen spielen konnten. Die Verhandlungsmacht der Regierung war nicht nur wegen der Krise und wegen des zunehmenden internationalen Drucks geschwächt. Mit dem Verlauf der Runden Tische brach die Machtelite auf. Die Verhandlungsführer der Machtelite verband eine informelle Solidarität mit der Opposition, so daß nach und nach die konservativen Köpfe der Nomenklatura, die sich nicht kompromißbereit zeigten, als „die Anderen“ isoliert wurden. Dennoch überraschte alle das Ergebnis der auf die Runden Tische folgenden Wahlen78. Es zeigte, wie falsch das Bild der Regierung und der Opposition von dem Rückhalt, d.h. der Legitimität, der Regierung bei der Bevölkerung war. Hätten die Akteure ein realistischeres Bild über die Kräfteverhältnisse gehabt - wäre die schwache, objektive Verhandlungsposition der Regierung bekannt gewesen -, dann wären wahrscheinlich andere Verhandlungsstrategien verfolgt worden. Die Opposition hätte versuchen können, die Interessen der Regierung bei den Verhandlungen um die konstitutionelle Gestaltung weiter zurückzudrängen und die angestrebte Institutionalisierung eines ökonomischen 78 Ein Ergebnis der Verhandlungen am Runden Tisch in Polen war, daß nur 35 % der Parlamentssitze (Sejm) frei gewählt werden konnten (65 % wurden von der Partei besetzt). Die Solidarität erzielte einen von beiden Seiten unerwartet hohen Triumph (beinahe 80 % der Stimmen) bei den frei zu wählenden Sitzen (vgl. Linz / Stepan 1996: 255f; Geddes 1996). Zusammenbruch der alten Ordnung 142 Wandels weiter voranzutreiben. Die Regierung hätte wohl versucht, sich gegen einen derartig starken Machtverlust abzusichern, denn ihr Bestreben war es ja, die Kontrolle über die Entwicklung Polens zu behalten. In ihrer Vorstellung sollte sich die verhandelte Demokratieidee auf eine Demokratie beschränken, in der die alte Machtelite nicht verlieren konnte (vgl. Osiatynski 1996). Der Fall Bulgarien zeigt, wie wichtig die Information bezüglich der Verhandlungsmacht ist. Trotz des wahrgenommenen hohen „public supports“ der Regierungspartei zeigen die Unruhen, daß falsche Wahrnehmung und mangelnde Information bezüglich der Machtressourcen (hier Legitimität) zu gefährlichen Zügen im Strategiespiel führen können. Auch in Polen führte unvollständige Information zu einer Verzerrung der Verhandlungsmacht. Die Machteliten erhielten mehr Zugeständnisse, als ihnen bei vollständiger Information hätte zugestanden werden müssen. Hätte die Regierung gewußt, wie schlecht es um ihren Rückhalt in der Bevölkerung tatsächlich stand, dann wäre es wohl kaum zu derartig weitreichenden Reformen gekommen. Die Transformation hätte so nicht stattgefunden. Osiatynski (1996) kommt sogar zu dem Schluß, daß nur wegen der falschen Einschätzung des Machtgleichgewichts der Prozeß der Transformation mit der Einrichtung der Runden Tische initialisiert wurde und sich verselbständigen konnte. Verhandlungsparteien können ihre Verhandlungsmacht mit strategischen Zügen stärken, wenn es ihnen gelingt, die ihnen nützlichen Ergebnisse als unbedeutend darzustellen. Genau das geschieht, wenn sie wie in Polen ihre Position als relativ stark darstellen können. Die verhandelnde Partei wird aber auch relativ stärker, wenn sie geringe Risikoabneigung zeigt und dem Verhandlungspartner suggerieren kann, ihr Zeitdiskontierungsfaktor sei niedrig, d.h. wenn sie vorgibt, daß sie sich nicht kurzfristig orientieren muß (vgl. Elster 1989a; Axelrod 1984). Die UDF in Bulgarien hatte für alle offensichtlich einen niedrigen Zeitdiskontierungsfaktor. Sie vereinte Koalitionspartner mit sehr unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Programmen. Das führte zu der Annahme, ihre Einheit könne nicht über die Wahlen hinaus bestehen. Langfristige Strategien waren aus diesem Grunde für sie zwar irrelevant, Zeitgewinn aber von höchster Bedeutung (Kolarova / Dimitrov 1996). Für die Regierung hingegen war es wichtig, schnelle Ergebnisse zu erzielen. Dies bot für die Opposition die Chance, ihre Schwäche in Stärke zu konvertieren. Und in der Tat lag hier der wichtigste bargaining-chip der UDF. Sie glaubte, daß ihre Wahlchancen durch eine Verspätung der Wahlen ansteigen würden. Sie konnte deshalb glaubwürdig damit drohen, die Verhandlungen abzubrechen; durch eine Verspätung hatte sie nichts zu verlieren. Die BCP hingegen wollte schnell zur Durchführung von Wahlen kommen, sie war also gegenüber Verspätung verletzlich. Ihre Strategie bestand darin, nur so viel Änderungen wie nötig schnellstmöglich durchzusetzen - „the quicker the less“ (Kolarova / Dimitrov 1996: 194). Da die Opposition aber keine weiteren Ressourcen hatte, um ihren Interessen Nachdruck zu Zusammenbruch der alten Ordnung 143 verleihen, und die Verhandlungsmacht der Regierung zu stark war, konnte sich die Regierung mit ihrer Strategie durchsetzen. In dem strategischen Umgang mit der kommunizierten Information liegt keine andere Absicht, als die Wahrnehmung des Gegenübers bezüglich der eigenen Verhandlungsposition zu beeinflussen. Das Ergebnis von Verhandlungen ist von der Antizipation der Verhandlungmacht und der Verhandlungsstrategien der anderen Partei abhängig. Für den Einsatz der Verhandlungsstrategien ist es deshalb entscheidend, den Verlauf der Nutzenkurve den anderen zu verheimlichen (vgl. Schelling 1963). In Polen hätten kompromißlosere Forderungen der Opposition durchgesetzt werden können, wenn die Regierung nicht glaubhaft eine niedrigere Nutzenkurve - als es der Realität entsprach hätte kommunizieren können. In Bulgarien hingegen baute die von der Regierung signalisierte Risikoabneigung nicht auf objektive Bedingungen. Dem Verhandlungspartner wurde niedrige Risikoabneigung glaubhaft gemacht, was aus ihrer Sicht zwar wünschenswerte Ergebnisse hervorbrachte, sich aber als riskantes Spiel herausstellte. Es fällt auf, daß die eindeutige Bestimmung der Verhandlungspositionen der Parteien schwierig ist. Das liegt neben dem gegenseitigen Informationsdefizit auch an der Schwierigkeit die Akteure eindeutig zu definieren. In Bulgarien stand der Akteur Opposition für ein uneinheitliches Konglomerat verschiedener Interessen. In Polen zersplitterte die Machtelite hauptsächlich entlang der Trennungslinie von Partei und Regierung, aber auch innerhalb der Partei. Ehemalige Kontrahenten verbündeten sich gegen einen neu definierten Dritten. Die gesamte Situation transformierte von einem „Mixed-Motive Game“ zum „cooperative problem solving“ (Osiatynski 1996), d.h. einem „CommonInterest Game“, in dem das Motiv des relativen Vorteils zweitrangig ist (vgl. Schelling 1963). Für die Tschechoslowakei lassen sich ähnliche Mechanismen beschreiben (vgl. Calda 1996). Auch hier spielte die falsche Wahrnehmung der Position des Verhandlungspartners eine wichtige Rolle. Der Opposition war nicht bekannt, wie schlecht die Verhandlungsposition der Regierung war. Es gab keine Information - z.B. durch Überläufer darüber, wie schwach es um das Establishment stand. Eine weitere Stärkung ihrer Verhandlungsposition gewann die Regierung mit der Angst der Opposition, die Armee könnte eingesetzt werden. Nur so gelang es ihr, sich Zeitaufschübe einzurichten, für die die Opposition im Nachhinein bezahlen mußte. Die Regierung nutzte den Zeitgewinn zur Zerstörung von Polizeiakten, was es heute unmöglich macht, mittlere und niedrige Nomenklatura-Vertreter zur Verantwortung zu ziehen. Die Opposition in der Tschechoslowakei fand bei der Bevölkerung eine breite Unterstützung, konnte aber andererseits die schwache Verhandlungsposition der Regierung nicht erkennen. Dementsprechend reflektieren die ausgehandelten Kompromisse - wie auch in Polen - nicht die tatsächlichen Verhandlungspositionen von Regierung und Op- Zusammenbruch der alten Ordnung 144 position, sondern lediglich wahrgenommene Verhandlungsstärke bzw. unterstellte Absichten. Aufgrund des Informationsdefizits gewannen die Strategien des „political gamble“ eine bedeutende Rolle. In einem derart ungewissen Setting kann es für die Opposition vorteilhaft sein, mangelnde Integrität zu kommunizieren. Ihre Verhandlungsführer sind nicht einfach Agenten kollektiver Akteure. Vielmehr stellen sie sich als Moderatoren oder Vermittler zwischen den „radikalen“ Massen und der Machtelite dar. Auf diesem Wege kann die interne Schwäche paradoxerweise ihre Verhandlungsmacht stärken. Denn eine schwache Position liefert die Glaubwürdigkeit für die Behauptung, bei mangelnden Eingeständnissen der Regierung könnten Unruhen nicht vermieden werden. Mangelnde Integrität impliziert nämlich nicht weniger Opposition. In der Tschechoslowakei konnte die Opposition diese Strategien nutzen, weil sie eine hohe Unterstützung in den Straßen Prags und anderer größerer Städte genoß. Sie argumentierte, daß die Zeit knapp werde, weil die Bevölkerung wegen der ausbleibenden Verhandlungsfortschritte ungeduldig würde. Als Vermittler befürchte sie außerdem, zu weit reichende Kompromisse würden als fadenscheinig und faul zurückgewiesen. Sie selbst hätten bei solchen ungefälligen Lösungen mit dem Legitimitätsentzug durch die Massen zu rechnen79. Mit dieser Drohung definierte sich die Opposition als unverzichtbarer und wertvoller Verbündeter der Regierung. Für die Verhandlungsführer der Regierungen ist diese Strategie weniger sinnvoll. Mangelnde Integrität zu kommunizieren, würde hier primär ein Aufbrechen der Loyalität und damit einhergehend Diffusion von Macht signalisieren. Sie kann dafür aber die Delegation des eigenen Interesses als strategischen Schritt einsetzen (vgl. Schelling 1963). Kolarova und Dimitrov vermuten eine solche Strategie hinter der Verhandlungstaktik der BCP-Führung in Bulgarien (1996). Diese tauschte nach dem 6. Februar 1990 die relativ unbedeutende Person Pirinskis für den ehemaligen Verhandlungsführer Lukanov ein, als dieser zum Premier gewählt wurde. Mit dieser Ablösung einer relativ bedeutenden durch eine relativ unbedeutende Person versuchte die BCP, Zeit für die Lösung interner Konflikte zu gewinnen bzw. interne Reorganisationen durchzuführen. Es läßt sich deshalb davon ausgehen, daß Pirinski mit dem Auftrag handelte, die Debatte zu verzögern, bis ein echter Verhandlungsführer wieder gebraucht wurde, oder daß die BCP-Führung ohnehin keine echten Verhandlungen in den Plenumssitzungen wünschte und deshalb Pirinski mit der Gesprächsführung beauftragte. Die Strategie der Delegation stellt einen Schritt zur Einrichtung einseitiger Kommunikation dar. Der Verhandlungspartner steht für den betreffenden Zeitabschnitt vor vollendeten Tatsachen bzw. eingeschränkten Möglichkeiten. Ganz ähnlich wirkt das Argu79 In Polen wurde ähnlich argumentiert: „’If we agree to such a compromise, it will be useless for you,’ said Bujak at one point of the negotiations, ‘for if society does not accept the deal, you would sign a contract with a partner that has ceased to exist’.“ (Osiatynski 1996: 49). Dies war ein besonders starkes Argument auf dem Hintergrund der Betonung der Notwendigkeit, öffentlich zu verhandeln. Denn diese Tradition gab der Drohung die Glaubwürdigkeit. Zusammenbruch der alten Ordnung 145 ment, Vorschläge müßten erst einmal mit dem Gesetz abgestimmt80 bzw. mit höheren Autoritäten wie der Hegemonialmacht Rußland abgesprochen werden. In diesem Fall wird mit zeitlichem Verzug gedroht. In Polen und der Tschechoslowakei haben die regierenden Eliten zu Beginn der Verhandlungen ihre Position durchaus vor dem Hintergrund einer möglichen russischen Invasion ausbauen können. Der tschechoslowakische Premier und mehrfache Verhandlungsführer von Runden Tischen Ladislav Adamec hat sich bei Gorbatschow nicht nur grünes Licht für Reformen im Stile der sowjetischen Perestroika geholt81. Er betonte außerdem immer wieder die Notwendigkeit, die Reformen mit sowjetischen Interessen abzustimmen. Die Kommunisten nutzten in der Diskussion um die zukünftige Gestaltung des Verteidigungsministeriums und des Ministeriums für Inneres wiederholt eine derartige Strategie. Sie bestand aus dem Verhandlungsargument, der Warschauer Pakt - d.h. die Sowjetunion – würde niemals eine nichtmilitärische bzw. nicht-kommunistische Person für einen solchen wichtigen Posten akzeptieren. Sie verwiesen dabei auf die Situation in Polen. In Ungarn und der DDR gestalteten sich die Verhandlungen an den Runden Tischen etwas anders. Auch wenn in diesen Staaten Legitimitätsmangel der Regierungen ein primäres Motiv für die Einrichtung von Runden Tischen war, so können die Verhandlungen trotzdem nicht als Kampf um die Verteilung von Machtressourcen interpretiert werden. In Ungarn führten außenpolitischer Druck und die internen wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten dazu, daß die Regierungspartei die Kooperation mit den uneinheitlich organisierten Oppositionsparteien suchte (vgl. Sajo 1996): Die Regierungspartei (HSWP) selbst war in zwei Lager gespalten. Sie bildeten sich aus den konservativen Kräften und den Reformkommunisten. Die Oppositionsparteien verfügten zwar über die symbolische Ressource, die „Helden“ der 56er Revolution zu repräsentieren und nicht für das ökonomische und moralische Desaster der Nation verantwortlich zu sein. Sie beanspruchten aber, besonders aber auf Grund ihrer Uneinheitlichkeit, keine Legitimität durch die Bevölkerung. Die Regierungspartei fühlte sich ebenso wenig als Repräsentant der Bevölkerung, hatte aber die Kontrolle über Information und administrative Vorgänge. Sie hatte außerdem die für Reformen nötige Expertise. Wohl aufgrund des mangelnden Rückhalts bei der Bevölkerung hatte keiner der Verhandlungspartner ein Interesse daran, das Risiko der Festlegung eines zukünftigen Gesetzgebungsverfahrens einzugehen. Deshalb gab es bei den Runden Tischen auch keine echte Agenda für legislative Änderungen. Den Verhandlungspartnern ging es lediglich um eine friedliche Trans80 „Kucera asked for time and emphasized that all the demands must be dealt with in accordance with the law.“ (Calda 1996: 137). 81 „The dramatic round took place almost immediately after Adamec`s return from Moscow, where he had gone for consultations and presumably met with Gorbachev . (...) The Soviets had allegedly given Adamec the green light for reforms provided they were modeled on the Soviet perestroica.“ (Calda 1996: 145-147). Zusammenbruch der alten Ordnung 146 formation zu einer Gesellschaft mit demokratischen Wahlen. In der Verhandlung sollten nur Mittel und Wege der Wahl zwischen Gesetzgebungsverfahren - Parlament bzw. Referendum - festgelegt werden. Auch in der DDR lag das primäre Interesse der Machteliten darin, Macht in eine legitime Ressource der Politik zu transformieren (vgl. Preuss 1996). Wenn die Regierung auch nicht - wie in Ungarn - eine demokratische Umwälzung plante, so hat sie doch aus einer Position heraus verhandelt, die durch ein tiefes Gefühl der Unfähigkeit zu herrschen bestimmt war. Die Vermeidung von Chaos wurde angestrebt mit dem Versuch, das Machtvakuum mit Hilfe der Opposition auszufüllen. Zur Charakterisierung der Runden Tische in der DDR findet sich ein entscheidender Hinweis bei Preuss (1996). Er hebt hervor, daß die wichtigste Entscheidungsregel bei den Verhandlungen die Mehrheitsregel war. Deshalb können diese Runden Tische nicht als „typische“ Verhandlungssysteme gelten. Die Verhandelnden verstanden sich, wenn auch nicht als legitime, so doch als korporatistische Vertreter, die kollektive Entscheidungen treffen mußten trotz ihres unklaren konstitutionellen Status. Faßt man den spieltheoretisch inspirierten Blick auf die Verhandlungen an den Runden Tischen in den fünf osteuropäischen Staaten zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: In Ungarn und der DDR führten die Verhandlungsgegenstände der Runden Tische eher zu einer kooperativen Haltung als zu einer Konfliktorientierung. Die Verhandlungen in diesen Ländern lassen sich daher kaum als „Mixed-Motive-Spiele“ im Sinne Schellings (vgl. 1963) bezeichnen. Die Beziehung zwischen den Spielern in Ungarn und der DDR war hier bedeutend stärker als in den anderen Ländern durch das gemeinsame Interesse geprägt. In einem solchen Koordinationsspiel kommt es daher auch nicht wie bei „echten“ Verhandlungen zum taktischen Umgang mit Information. Ebenso wenig kommt es zum Einsatz von Strategien, mit denen die Aufteilung des kollektiven Gutes in sichselbst-favorisierender Weise manipuliert wird. Das Motiv des gemeinsamen Interesses überwiegt. Für Polen und die Tschechoslowakei zeichnete sich im Verlaufe der Runden Tische eine Transformation der Mischungsverhältnisse des „Mixed-Motive Games“ zugunsten der Kooperation und zuungunsten des Konflikts ab. Besonders in Polen wurde auf strategische Manöver, die partikulare Interessen begünstigten, demonstrativ verzichtet. Dies zeigte sich in dem gemeinsamen Interesse, die Verhandlungen in der Öffentlichkeit zu führen. In Bulgarien hingegen verhielt es sich ganz anders. Die Verhandlungsschwäche der Opposition erlaubte der Regierung eine unkooperative Haltung. Sie brauchte keinen größeren Konflikt zu fürchten bzw. einen Verlust des Kooperationsgewinns, da die Opposition nicht in der Lage war, ein einheitliches Interesse zu formulieren. Die Regierung hatte lediglich mit der Mißbilligung durch die Bevölkerung zu rechnen. Dementspre- 147 Zusammenbruch der alten Ordnung chend war ihre Strategie von dem Ziel bestimmt, Unruhen zu vermeiden. Die Runden Tische stellten ein Mittel zur Erreichung dieses Ziels dar. Die Verhandlungen mit der Opposition hatten einen oberflächlichen, symbolischen Charakter. Sie wurden dazu genutzt, Entscheidungen schnell und unter Ausschluß der Öffentlichkeit durchzusetzen, so daß oppositionelle Interessen nicht berücksichtigt werden mußten. Die Verhandlungssituation in Bulgarien läßt sich somit als asymmetrisches Nullsummenspiel kennzeichnen. Die Machtverhältnisse waren ungleich verteilt, und beim stärkeren Partner, der Regierung, dominierte das Motiv des relativen Vorteils. In einem Verhandlungsspiel hat das Mischungsverhältnis zweier beteiligter Motive eine zentrale Bedeutung - Kooperation und Konflikt. Will man den Charakter der Verhandlungen an den Runden Tischen in den fünf hier diskutierten Ländern bestimmen und vergleichen, kann man das anhand der Ausprägung der beiden Motive versuchen. Je stärker die Konfliktorientierung ausgeprägt ist und je mehr sie sich aufgrund der asymmetrischen Machtgleichgewichte durchsetzen kann, desto eher waren die Verhandlungen durch die Eigenschaften eines Nullsummenspiels gekennzeichnet. Je mehr das Motiv des gemeinsamen Interesses überwog, desto eher handelte es sich bei den Verhandlungen um ein Koordinationsspiel (oder Positivsummenspiel). Daraus ergibt sich folgende Übersicht: Abbildung 2: Charakteristik der „RT-Spiele“ in Osteuropa Koordinationsspiel Nullsummensspiel DDR Ungarn Tschechoslowakei Polen Bulgarien Zusammenbruch der alten Ordnung 148 4.2 Normativer Rahmen Die Zuordnung der Länder auf der Achse (Abb. 2) folgte bisher dem Grad der Interessenkonvergenz der Verhandlungspartner und ihrer Verhandlungsmacht bzw. des taktischen Einsatzes der sie definierenden Ressourcen. Der Begriff der Verhandlungsmacht beschreibt die normfreien, rein strategischen Determinanten des Ergebnisses einer Verhandlung. Die Entfaltung dieser Determinanten wurde durch bestimmte Kontextbedingungen ermöglicht. Sie definieren die „Logik der Situation“ (vgl. Esser 1993) und können deshalb auch nach einer anderen Orientierung als der strategischen verlangen; die normfreie Orientierung muß keineswegs das alleinige Motiv der Akteure an den Runden Tischen sein. In Verhandlungssituationen kann das Motiv Normorientierung eine wichtige Rolle spielen. Es kann helfen, Probleme zu lösen. Es kann aber auch, wenn die Normen zu stark divergieren, neue Probleme schaffen (Elster 1989a: 215). Wird die Normorientierung geteilt, dann gibt sie für Verhandlungen einen Kontext vor, in dessen Rahmen strategische Züge zwar eingeschränkt, aber durchaus möglich sind. Diese Rahmenbedingungen für strategisches Handeln können selbst Ergebnis normativer Übereinstimmungen sein. Einigen sich die „Spieler“ in (Vor-)Verhandlungen explizit oder auch nur stillschweigend auf normative Prinzipien für die Verhandlungen, dann müssen diese bei der Erklärung von Prozessen und Ergebnissen der Runden Tische berücksichtigt werden. Dabei gilt, daß die Normorientierung ebensowenig ein exklusives Motiv der Akteure ist wie die strategische Orientierung. Sie steht vielmehr in einer Wechselbeziehung zum Selbstinteresse der Verhandlungspartner (vgl. Elster 1989a). Das in Abbildung 2 zusammengefaßte Ergebnis der Untersuchung strategischer Aspekte der Verhandlungen gibt zwar ihren Charakter wieder, löst aber nicht die Frage, auf welcher Grundlage verhandelt wurde. Hierzu kann die Untersuchung der Rolle normativer Orientierungen an den Runden Tischen dienen. Verhandlungen kommen zustande, wenn eine Möglichkeit gesehen wird, Konfliktlinien zu überwinden. Eine solche Möglichkeit kann mittels Orientierung an Gerechtigkeitsnormen und durch die Konvergenz dieser Normen geschaffen werden (Zartman 1997). In Verhandlungssituationen kann nicht auf existierende Institutionen zurückgegriffen werden, die die Entscheidungsregeln und Autoritätshierarchien festlegen. Jede beteiligte Partei hat ein natürliches Veto82, das ihr erlaubt, ungebunden an den Verhandlungen teilzunehmen und sie somit jederzeit abbrechen zu können. Aus diesem Grunde ist der Modus der Entscheidungsregel Einstimmigkeit. Damit sich die Parteien bei konfligierenden Interessen einigen können und sich nicht blockieren, muß es in Verhandlungen 82 Hier wird auf formalem Wege deutlich, warum es sich bei den Verhandlungen in der DDR im strengen Sinne (nach der Definition Schellings) nicht um Verhandlungen handelte. Es wurde per Mehrheitsregel entschieden. Zusammenbruch der alten Ordnung 149 zur Übereinstimmung bezüglich der Entscheidungsgrundlagen kommen. Bei Verhandlungen geht es um Verteilungsfragen. Deshalb wird die Entscheidungsgrundlage in einem zustimmungsfähigen Gerechtigkeitsprinzip gesucht. Gerechtigkeitsvorstellungen als Vorbedingung der Konsensfindung setzen entweder einen gemeinsamen Wertehorizont der beteiligten Akteure als Entscheidungsregel für die Verhandlungen voraus, oder sie fordern von den Akteuren die Einigung auf einen normativen Kontext für ihre Zusammenarbeit. Nur eine solche Übereinstimmung kann nach Zartman den Konfliktlösungsmechanismus in Verhandlungen kontrollieren. Die Kooperationsgewinne können trotz Konflikt erreicht werden, weil der Kontext zustimmungsfähiger Entscheidungsregeln die Logik der Situation definiert; individuelles Kalkül und strategische Orientierung werden deutlich eingeschränkt. Gibt es die Übereinstimmung nicht, dann wird es in den Verhandlungen keine Lösung geben. Die Pluralität von Normen bei Verhandlungen kann ein neues Problem kreieren: Divergierende Gerechtigkeitsbegriffe lassen sich in den Verhandlungssituationen als substantielles Veto einsetzen und können auf diesem Wege gegen Einigungen wirken. Aus diesem Grunde müssen in (Vor-)Verhandlungen die Gerechtigkeitsanschauungen so koordiniert werden, daß sie von allen akzeptiert werden können. Diese Übereinkünfte sind „konstitutionelle“ Übereinkünfte, die die terms of trade der Verhandlungen etablieren und sich nicht mit dem Rückgriff auf Machtressourcen, Machtpositionen oder dem strategischen Geschick der Akteure treffen lassen (vgl. Zartman 1997). Die Gerechtigkeitsbegriffe und der Prozeß der Einigung auf geteilte Gerechtigkeitsprinzipien werden zwar auch im strategischen bias formuliert, aber diese Strategie allein erklärt weder die von den Akteuren vertretenen Gerechtigkeitsprinzipien noch die gemeinsamen Prozesse der Einigung über die normative Entscheidungsregel oder die geteilte Akzeptanz der Prinzipien. Die Gerechtigkeitskonzepte, an denen sich Akteure orientieren, können drei Kategorien von Gerechtigkeitsprinzipien zugeordnet werden (Zartman 1997: 124): Diese sind Priorität („priority principle“), Gleichheit („equality“) und Ungleichheit (im von Sinne Gerechtigkeit als begründeter Ungleichheit „equity“). Alle Variationen der Übereinkunft bzw. Nichtübereinkunft lassen sich auf diese drei Typen reduzieren, und dementsprechend kann jedes Ergebnis mit einem Prinzip oder der Kombination von Prinzipien klassifiziert werden. Wenn interessenbasierte Positionen in absoluter Priorität wurzeln, oder wenn die Gerechtigkeitsprinzipien der einen Partei unvergleichbar mit denen der anderen Partei sind, dann wird Konflikt vorherrschen. Einigungen müssen durch die Überwindung der Unvergleichbarkeit von Gerechtigkeitsprinzipien erreicht werden. Die Konfliktregelung basiert damit auf der beiderseitigen Akzeptanz eines Prioritätsprinzips oder auf der gemeinsamen Festlegung eines Prinzips für Gleichheit bzw. begründeter Ungleichheit („equity“) und deren Bezugspunkte, d.h. des Bereichs, auf den die Gerechtigkeitsregeln angewendet werden sollen. Zusammenbruch der alten Ordnung 150 Die Einigung auf normative Prinzipien war nicht in allen fünf Ländern konstitutives Merkmal der Verhandlungen an den Runden Tischen. Im folgenden wird daher dargelegt, unter welchen Bedingungen solche Prinzipien eingeführt werden mußten und wie diese den Verhandlungsverlauf bestimmten, d.h. welche Kontextbedingungen für strategisches Handeln mit den normativen Prinzipien gesetzt wurden. Ausgangsbedingung für die Verhandlungen in Bulgarien war, daß die Regierung nicht wirklich delegitimiert war - schon gar nicht im Vergleich zu den anderen osteuropäischen Staaten. Sie bedurfte aber zur politischen Überwindung der ökonomischen Rezession und des mit der internationalen Isolierung einhergehenden politischen Drucks eines liberaleren Erscheinungsbildes. Die Regierung konnte mit ihrer Überlegenheit gegenüber der Opposition nach außen Zusammenarbeit signalisieren, ohne wirklich mit ihr zu kooperieren. Erst als sie sich verkalkulierte, es zu Demonstrationen kam, mußte sie die Interessen der Opposition ein wenig mehr berücksichtigen (deswegen der kleine Ruck nach links auf dem Kontinuum in Abb. 2). Im großen und ganzen konnte die Regierung die Transformation aber nach ihren Vorstellungen gestalten. Es gab nahezu keine echten Verhandlungen. Was an Verhandlungscharakter übrig blieb, läßt sich befriedigend in den Kategorien der Verhandlungsmacht und des strategischen Kalküls erklären. Und auch das Ergebnis entspricht einer solchen Charakterisierung. Von der Regierung wurde ganz nach dem Grundsatz: „... to increase their distributive shares, bargainers engage in tactics that either decrease the probability of reaching an agreement or decrease the size of the total to be shared“ (Elster 1989a: 82) vorgegangen: Sie konnte aufgrund ihrer Position und wegen der Unfähigkeit der Opposition, klare Präferenzen zu formulieren, kontrollieren, ob Einigungen getroffen wurden oder nicht. Aber auch die zweite Strategie schien von der Regierung Bulgariens eingesetzt zu werden. Definiert man als Kooperationsgewinn die Beruhigung der Situation, dann fand in der Tat die strategische Manipulationen der Regierung an den Runden Tischen auf Kosten des Kooperationsgewinns, des gemeinsam zu erstellenden öffentlichen Guts, statt. Die Bevölkerung reagierte auf die ersten Verhandlungsergebnisse mit vehementen Protesten. Die starke Verhandlungsposition der Regierung zeigt, daß sie sich die Haltung „take it or leave it“ erlauben konnte und daher keine normative Grundlage für die Verhandlungen anzustreben brauchte. In Ungarn war man sich einig darüber, daß mit den Runden Tischen die friedliche Transformation zu einer Gesellschaft mit demokratischen Wahlen vorbereitet werden sollte (vgl. Sajo 1996). Wegen der allgemeinen Unsicherheit der Situation, zeigten die Akteure keine Bereitschaft, mit einer Verfassungsbildung Verantwortung zu übernehmen. Sie verstanden ihre Rolle als Kurzzeitmandate ohne weitreichende Verantwortung. Zusammenbruch der alten Ordnung 151 Über die zukünftige Gesetzgebung sollte die Bevölkerung mittelbar mit der Wahl zwischen Gesetzgebungsverfahren - durch Parlament oder Referendum - entscheiden. Sajo (1996) kennzeichnet die Akteure an den Runden Tischen daher allgemein als interessenlos. Das erklärt das Fehlen gravierenden Konfliktlinien bei den Verhandlungen. Der Gegenstand, um den verhandelt wurde, barg kein Konfliktpotential. Der Konflikt lag also nicht zwischen den Parteien, sondern wurde von den Runden Tischen weg in die Reihen der Machtelite verlagert. Der Kooperationsgewinn war ein öffentliches Gut, um dessen Verteilung nicht gestritten werden mußte und konnte. Die Kooperationsergebnisse in Ungarn müssen deshalb nicht mit Hilfe strategischer Machtorientierung der Akteure erklärt werden. Auch gab es keine Pluralität der kooperativen Arrangements. Man einigte sich zügig über die Ergebnisse, und dementsprechend spielten Normen für die Erklärung der Ergebnisse ebensowenig eine Rolle. In der DDR trafen an den Runden Tischen zwar unterschiedliche Interessen aufeinander: Die Regierung wollte ihre Legitimität und damit ihre Machtgrundlage wiedergewinnen. Die Opposition kämpfte für die Realisierung der Menschenrechte. Ganz ähnlich wie in Ungarn standen sich die Interessen aber nicht konfligierend gegenüber. Die Opposition hatte kein Machtinteresse, und die Regierung fühlte sich unfähig zu herrschen, d.h. sie wollte Situationen vermeiden, in denen sie handeln mußte. Ein gemeinsames Interesse beherrschte die Verhandlungen: das Interesse an einer neuen Verfassung. Diese Orientierung war derartig stark, daß eine Mehrheitsregel als Entscheidungsgrundlage von allen akzeptiert wurde, was nur möglich ist, wenn das Interesse, das die Parteien an den Runden Tisch führte, nicht divergiert. Was an Pluralität der kooperativen Arrangements übrig blieb, wurde über diese Regel gelöst, bedarf zur Erklärung also keines weiteren Verweises auf Normen. In der DDR wurde um die Verteilung von Kooperationsgewinnen auch nicht strategisch-manipulativ verhandelt. Vielmehr erbrachten die Verhandlungsführer auch eine hier Koordinationsleistung zur Erstellung eines öffentlichen Gutes - die neue Verfassung. Die Orientierung der Akteure folgte in dem situativen Rahmen der DDR und Ungarns einem geteilten Interesse. Deshalb ging es an den Runden Tischen im Wesentlichen darum, Kooperation bestmöglich zu koordinieren. Das institutional engineering war also lediglich eine technische und keine strategische Herausforderung. Die Logik der Situation in Bulgarien hingegen gestattete es der Machtelite, die Interessen der Opposition weitgehend unberücksichtigt zu lassen. Eine Orientierung an Normen, die ein Verhandlungsergebnis ermöglichen, war in diesen drei Ländern deshalb nicht nötig, weil es entweder keine echten Konfliktlinien zwischen den Parteien gab (DDR und Ungarn), oder weil es keine echten Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition gab (Bulgarien). Das typische Situationsmerkmal von Verhandlungen, der ambivalente Cha- Zusammenbruch der alten Ordnung 152 rakter der Situation, trifft auf die Situation in diesen Ländern nicht zu; es handelte sich nicht um „Mixed-Motive Games“. Kooperation und Konflikt konkurrierten nicht und deshalb lösten sich die Probleme ohne gemeinsam ausgehandelte normative Rahmenbedingungen für die Verhandlungen. Die Verhandlungen in Polen und der Tschechoslowakei hingegen erfüllten die Kriterien von „Mixed-Motive Games“. Bei ihnen stellt sich die Frage, welche Motive die Kooperation bei den Verhandlungen trotz unterschiedlicher Reformvorstellungen und Machtinteressen ermöglichten. In Polen standen sich Parteien gegenüber, die eine gemeinsame, von Feindschaft geprägte Vergangenheit hatten, und darüber hinaus divergierten die Ambitionen der Parteien gravierend, so daß die Konfliktlinien deutlich hervortraten. Die Vorstellung weitreichender politischer und ökonomischer Reformen stand hier der anfänglichen Vorstellung der Regierung gegenüber, die Opposition nur symbolisch und nicht inhaltlich zu berücksichtigen. In der Tschechoslowakei waren die Konflikte zwischen der Machtelite und der Opposition nicht so offensichtlich Von allen Beteiligten antizipiert, daß die Verhandlungen zu weitreichenden Reformen führen würden. Dementsprechend trat ein Konflikt auch weniger um die fundamentale Frage auf, wie weit die Reformen zu gehen hätten. Die Interessen divergierten vielmehr bei der Frage, wie der Übergang zu einer demokratischen Regierung zu gestalten sei. Für Polen und die Tschechoslowakei läßt sich zeigen, daß die Orientierung an normativen Prinzipien zur Ermöglichung von Kooperation trotz deutlicher Konfliktlinien beigetragen hat. Betrachtet man die Ausgangsbedingungen für die Einrichtung der Runden Tische in diesen Ländern, dann wird deutlich, welche Gerechtigkeitsprinzipien den Rahmen für die Verhandlungen setzten. Die Runden Tische in Polen haben eine lange Vorgeschichte mit den unterschiedlichsten, meist über kirchliche Repräsentanten vermittelten, Versöhnungsversuchen (vgl. Osiatynski 1996; Tatur 1996). Die eigentlichen Vorverhandlungen begannen schon Ende 1987. Die Untergrundgewerkschaft Solidarnosc bot über ihren inoffiziellen Vermittler Gemerek einen Antikrisenpakt an. Dieser sollte zu einem Vertrag über die Implementierung eines dringend notwendigen wirtschaftlichen Reformpakets führen. Als Gegenleistung für die angebotene Zusammenarbeit wurde die Anerkennung der Gewerkschaft Solidarnosc gefordert. Andere explizite politische Reformen waren nicht Bestandteil des Verhandlungsvorschlages. Mit Osiatynski läßt sich aber annehmen, daß die Solidarnosc davon ausging, ihre Anerkennung könne nicht ohne gravierende strukturelle Reformen erfolgen; die Einführung einer legalisierten oppositionellen Arbeiterbewegung in einem autoritären System wie dem polnischen war undenkbar. Die Regierung stellte sich deshalb die Zusammenarbeit eher in Form einer vagen Koalition - also nicht in Form eines Pakts - vor. Die Opposition sollte an einer „breiten Koalition für Zusammenbruch der alten Ordnung 153 Reformen“ partizipieren dürfen. Damit wurde der Opposition keine echte Beteiligung angeboten. Die Regierung wollte sie vielmehr als Legitimitätszulieferer für nur kosmetische wirtschaftliche Reformen nutzen. Die Idee der politischen Reformen wurde generell mit der Ablehnung, die Existenz einer Opposition offiziell anzuerkennen, zurückgewiesen. Die Forderungen der beiden Lager basierten auf ihren Vorstellungen von einer angemessenen, d.h. gerechten, Berücksichtigung ihrer Interessen in Verhandlungen. Diese „priority justice positions“ waren für die andere Seite unbefriedigend, und deswegen verwundert es nicht, daß die Verhandlungen nicht zustande kamen. Erst mit der Dramatisierung der politischen Situation und einer zunehmenden Spaltung des Zentralkomitees der kommunistischen Partei (PUWP) kam es zur erneuten Tuchfühlung. Nachdem sich Lech Walesa als inoffizieller Oppositioneller zu Gesprächen bereit erklärte, schlug im August 1988 General Jaruzelski einen Runden Tisch vor. Die Parteien formulierten ihre Interessen wieder in einer Weise, die keine Einigung über die Vorbedingungen der Verhandlung zustande kommen ließ. Die Relegalisierung der Solidarnosc wurde von der Opposition erneut als Vorbedingung gestellt, und die Regierung blockierte die Anerkennung von höchster Stelle. Erst in privaten Konsultationen fand eine Annäherung der Prinzipien der Parteien statt. Jede Seite anerkannte einen Teil der Forderungen der anderen Seite und nahm ihre eigenen Forderungen zum Teil zurück. Die Solidarnosc akzeptierte, daß die Legalisierung ein Resultat der Runden Tische sein sollte und nicht eine Vorbedingung. Auch würde nicht Walesa, sondern Masowiecki die Verhandlungen führen. Die Regierung akzeptierte hingegen die Vereinbarung freier Wahlen in einem Setting, das weiterhin die Mehrzahl der Parlamentssitze der kommunistischen Koalition garantieren sollte. Bei der Auswahl ihrer Verhandlungsführer sah sie davon ab, Hardliner vorauszuschicken; Ciosek verhandelte. Im Januar 1989 gab es dann ein zweites Treffen, bei dem die Regeln für die Runden Tische festgesetzt wurden und der Verhandlungswille bestätigt wurde. Als Gerechtigkeitsprinzip setzte sich „equality“ durch. Equality liegt das Prinzip der Reziprozität, also des ausgewogenen Austausches und der ausgewogenen Zugeständnisse, zugrunde, welches das gemeinsam determinierte Ergebnis der Vorverhandlungen bildete. Es wurden nicht etwa Zugeständnisse relativ zum Beitrag vereinbart - wie bei der Einigung auf ein „equity“-Prinzip. Auch die Verhandlungsgegenstände für die Anwendung des stillschweigend vereinbarten Prinzips wurden in Vorverhandlungen festgelegt: Gewerkschaftspluralismus sowie politische und ökonomische Reformen sollten verhandelt werden. Die Geschehnisse der Vergangenheit blieben unberücksichtigt, womit besonders deutlich wird, daß es sich um eine normative Vereinbarung handelte. Gemeinsam wurde davon ausgegangen, daß diese stillschweigend getroffene Übereinkunft83 die Verhandlungen erleichtern würde84. 83 84 Vgl. Schelling zu „tacit agreements“ (1963). Vgl. Holmes zu „tying your tounges about sensitive questions“ (1988: 19f). Zusammenbruch der alten Ordnung 154 Die Entwicklung in Polen bestätigt, daß erst die Einigung über die normativen Grundlagen der Verhandlung kooperative Lösungen ermöglichten. Sie verhinderte den strategischen Einsatz aller möglichen Machtfaktoren (wie bspw. Schuldzuweisungen durch die „Moralelite“). Die Einigungen in Verhandlungen können also durch die Überwindung der Unvergleichbarkeit von Gerechtigkeitsprinzipien erreicht werden. Die Verhandlungen in der Tschechoslowakei gestalteten sich etwas anders als in Polen. Es war von Beginn an klar, daß die politischen Reformen nach tiefgreifenden Änderungen verlangen konnten. Den Kommunisten glitt - für jeden ersichtlich - die Macht aus der Hand. Sie mußten somit eine Teilung der Verantwortung anstreben, die früher oder später mit einer Änderung der Verfassung von 1960/68 einhergehen würde. Calda schätzt die Situation nicht so ein, als hätten die Gespräche die Machtkämpfe entscheiden können (1996). Die Gespräche hatten aus seiner Sicht mehr eine regulative Funktion. Dennoch kann man davon ausgehen, daß auf der Basis eines gemeinsamen Interesses der Parteien an der Transformation zur Demokratie Kompromisse bezüglich zukünftiger Machtchancen ausgehandelt wurden. Bei Verfassungsbildungen geht es um Distributionsfragen. Auch wenn die wahrscheinlichen Ergebnisse antizipiert werden, lassen sie sich aber nicht nur auf eine strategische Orientierung zurückführen (vgl. Elster 1988b). Dem Gerechtigkeitsbegriff der Verhandlungspartner kann eine entscheidende Rolle zufallen. Die anfänglichen Forderungen der Opposition beinhalteten gravierende politische Änderungen: Präsident Husak sollte neben anderen wichtigen Führern abdanken, die Verfassung geändert werden, und die parlamentarische Versammlung sollte rekonstruiert werden. Außerdem verlangte die Opposition eine Untersuchung der Geschehnisse der Studentenunruhen vom 17. November 1989, die Amnestie politischer Gefangener sowie Presse- und Informationsfreiheit (Calda 1996). Die Regierung bestand hauptsächlich auf der Einhaltung der Gesetze bei den Verhandlungen. Damit konnte die Abdankung des Präsidenten nicht in den Verhandlungen oder durch die Regierung bestimmt werden. Nur das Parlament konnte eine solche Entscheidung treffen. Die Machtelite forderte, die Präsidentschaft zu respektieren und eine „Normalisierung des Lebens“ durchzusetzen. Man wurde sich schnell über die gemeinsame Aufgabe, die angespannte Situation im Lande zu beruhigen, Streiks und Demonstrationen zu verhindern, einig. Die Opposition lehnte lediglich den Begriff der Normalisierung für diese Anstrengungen ab. In der Präsidentenfrage kam es zu keiner Einigung. Havel, der in den Verhandlungen die Opposition vertrat, versuchte, die Abdankung des Präsidenten Husak ultimativ durchzusetzen. Er verwies dazu auf die Bevölkerung, die es zu beruhigen gelte, wenn es zu keinen neuen Demonstrationen kommen sollte. Adamec akzeptierte ein solches Ultimatum nicht, sondern bot alternativ die Beteiligung der Opposition an einer neuen Regierung Zusammenbruch der alten Ordnung 155 an; die Opposition sollte sich als politische Partei registrieren und ihre Kandidaten für vakante Ministerposten aufstellen. Für die Opposition wäre mit einer solchen Regierungsbeteiligung eine Verantwortungsübernahme verbunden gewesen, auf die sie zu diesem Zeitpunkt nicht vorbereitet war und gegen die sie sich deshalb wehrte. Somit steckten die Verhandlungen in einer Sackgasse. Zwar verlangsamte sich dadurch der Transformationsprozeß. Eine langsame Annäherung konnte aber dennoch stattfinden, weil sich die Akteure auf Bereiche konzentrierten, in denen Einigungen möglich erschienen. Die Basis für diese Verhandlungen bildete das gemeinsame Ziel, politische Änderungen gesetzeskonform abzuwickeln. Weil politische Änderungen unumgänglich schienen, waren weitgehende Gesetzesreformen nötig. Dafür mußten Prozeduren verhandelt werden, die Regeln für die Absetzung der Mitglieder des Parlaments und der National Versammlungen Tschechiens und der Slowakei festlegten. An den Runden Tischen wurde daher vermehrt verhandelt, wie die Umformung der legislativen Gremien zu gestalten sei. Die Verschiebung auf diesen Verhandlungsgegenstand machte Kompromisse möglich. Hier konnten nach einem gemeinsam geteilten Gleichheitsprinzip Fortschritte erzielt werden. Die Zusammensetzung des Parlament als gesetz- und verfassungsgebende Versammlung sollte in einem angemessenen Rahmen die oppositionellen Kräfte berücksichtigen. Auch wenn die Verteilung der 350 Sitze weitgehend arbiträr war, so wurden sie doch wahrscheinlich nach einem Gerechtigkeitsprinzip verteilt, das nicht nach dem Gleichheitsprinzip vorgeht, sondern die Ungleichheit der Kräfte (gemessen an ihrem geschätzten Rückhalt in der Bevölkerung) berücksichtigt. Die Einverständnisse setzten somit ein geteiltes „equity“-Prinzip voraus, das diesen „Beitrag“ der Parteien berücksichtigte. Von dieser Vereinbarung profitierte nicht nur die Opposition. Sie erreichte zwar die angestrebten Änderungen der politischen Strukturen. Mit dem Kompromiß gelang es aber auch der Machtelite, sich eine Vetoposition bezüglich konstitutioneller Reformen zu sichern. Da es zur Änderung der Verfassung einer Zweidrittelmehrheit bedurfte, besetzte die kommunistische Partei trotz ihrer Minderheitenposition eine Schlüsselposition. Dieser Zustand lag in keiner Weise im Interesse der Opposition. Havel mußte in seiner Amtszeit als Präsident dann auch erleben, wie die Tschechoslowakei auseinanderbrach, weil man sich auf eine Verfassungsreform nicht einigen konnte. Die 1960/68er Verfassung ist für ein totalitäres Regime konstruiert worden und bot keine angemessenen Lösungsmechanismen, die den Konflikt von Tschechien und der Slowakei hätten abfangen können. Insofern kann die Teilung der Tschechoslowakei als ein Ergebnis der Kompromisse an den Runden Tischen interpretiert werden (vgl. Calda 1996). Die Ursache für diese Entwicklung ist darin zu sehen, daß für die Verfassungsänderung keine Einigung bezüglich der Gerechtigkeitsprinzipien erlangt wurden, nach denen hätte verfahren werden können. Lediglich die schrittweise Beteiligung oppositioneller Kräfte fand eine zustimmungsfähige Entscheidungsgrund- Zusammenbruch der alten Ordnung 156 lage85. Die Verfassungsfrage war ein wichtiger Gegenstand der Verhandlungen in der Tschechoslowakei, der nicht bewältigt wurde. Das zeigt, Konflikte können nicht über Kompromisse gelöst werden, wenn interessenbasierte Positionen in absoluter Priorität wurzeln (vgl. Zartman 1997). Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß eine unter den Verhandelnden geteilte Normorientierung die Konsensfindung bei bestehenden Konfliktlinien begünstigt und mitbestimmt. Die Einigung auf einen normativen Rahmen für einen festgelegten Bereich erklärt den veränderten Charakter der Verhandlungen zu Beginn und zum Ende der Runden Tische in Polen und der Tschechoslowakei (daher die Positionsverschiebung der beiden Länder nach links auf dem Kontinuum in Abb. 2). Mit dem Verweis auf die normative Orientierung an Gerechtigkeitskonzeptionen werden der Verhandlungscharakter und das Ergebnis der Runden Tische verständlicher; die Einigung auf normative Prinzipien erklärt, auf welche Weise Kooperation trotz Konflikt möglich war. Dennoch gibt es einen blinden Fleck in der Erklärung: Unklar bleibt der Prozeß, mit dem die Wahl der Gerechtigkeitsprinzipien gesteuert wurde und die Akzeptanz und Festlegung gemeinsamer Positionen erfolgte (Zartman 1997: 135). Wie kommt es, daß sich ehemals verfeindete Kontrahenten in Polen und der Tschechoslowakei auf eine gemeinsame normative Grundlage für Verhandlungen einigen konnten? 4. 3 Verständigung Bei der Diskussion der Normorientierung in den Verhandlungssituationen der Runden Tische wurde die Frage, ob diese Orientierung tatsächlich ein eigenständiges Motiv neben strategischer Orientierung ist oder nicht, außen vorgelassen. Die „priority principles“ können durchaus einem self-serving bias folgen, was eher Anstoß für eine utilitaristische Begründung der Normorientierung gibt. Damit ließe sich der Verhandlungsprozeß wieder einer singulären Akteursorientierung - dem Maximierungsprinzip unterordnen. Insbesondere der Umstand, daß die Normen erst in den aktuellen Situationen von den Akteuren geschaffen werden, legt die Rückführung einer Orientierung an Gerechtigkeitsprinzipien auf ein strategisches Motiv (bspw. Opportunismus) nahe. Es gibt einflußreiche Arbeiten, die auf der Grundlage dieser Orientierung die Entstehung von Normen thematisieren (vgl. Ullmann-Margalit 1977; Coleman 1990). Läßt sich aber zeigen, daß die normative Orientierung einer genuin anderen Handlungsorientierung als der strategischen Orientierung entspringt, dann kann ein solcher Reduktionismus nicht mehr aufrecht erhalten werden. 85 Aus diesem Grunde befindet sich die Tschechoslowakei auf dem Kontinuum in Abbildung 2 auch rechts von Polen. Zusammenbruch der alten Ordnung 157 Die Prozesse der Akzeptanz und Festlegung gemeinsamer normativer Positionen können mit Habermas‘ Theorie des kommunikativen Handelns erklärt werden (vgl. Müller 199486). Mit ihr wird der strategischen- und der Normorientierung die Verständigungsorientierung, die sich in Kommunikationssituationen herausbilden kann, zur Seite gestellt. Die Einführung dieser weiteren Orientierung, als ein Motiv für das Handeln der Akteure an den Runden Tischen, bildet den zentralen Schritt zu einem „Multiple-SelfModell“ als Analyseschema für „Mixed-Motive Games“. Verständigung - nach Habermas - kann nicht mit strategischem bias erfolgen. Verständigungsorientierung setzt bei der Erklärungslücke an, die nach der Untersuchung der Verhandlungen entlang strategischer Motive und geteilter Gerechtigkeitsprinzipien verbleibt: Die Motivation, sich an die Runden Tische zu setzen, um dort zu verhandeln, war aus nutzentheoretischer Sicht plausibel. Die tatsächliche Zusammenarbeit in Polen und der Tschechoslowakei trotz divergierender Interessen als Ergebnis geteilter und ausgehandelter Gerechtigkeitsvorstellungen für bestimmte Verhandlungsgegenstände war ebenso plausibel. Wie es zur Einrichtung dieser konstitutionellen Vorbedingungen der Verhandlungen kommen konnte, ist allerdings noch ungeklärt. Die für diesen Schritt wichtigen Faktoren, die Annäherungsprozesse bezüglich der Gerechtigkeitsvorstellungen sowie Vertrauen und Lernen durch Verhandeln, lassen sich mit Habermas‘ Theorie des kommunikativen Handelns theoretisch fassen. Verständigungsorientierte Kommunikation ist durch die Einigung bezüglich aller Geltungsansprüche, die mit der Sprechakthandlung implizit verbunden sind, gekennzeichnet (Habermas 1981): Die Akteure beziehen sich in Kommunikation auf drei Referenzen. Teleologische und strategische Aspekte der Kommunikation verweisen auf die Sachreferenz der objektiven Welt im Popperschen Sinne. Mit dieser Referenz verbindet sich der implizite Geltungsanspruch nach Wahrheit und Wirksamkeit. Der normative Aspekt der Kommunikation beinhaltet darüber hinaus die Fremdreferenz zur sozialen Welt. Hier liegt der Geltungsanspruch in der objektiven Beurteilungsmöglichkeit der Richtigkeit, d.h. der Frage nach dem normkonformen Handeln und der Legitimität der Normen. In der dritten Referenz schließlich wird der Akteur selbst als eine Welt vorausgesetzt. In dem Ausdruck von Erlebnissen verweist seine Selbstreferenz auf die subjektive Welt. Sie impliziert den Geltungsanspruch der Wahrhaftigkeit bzw. Authentizität in dem Ge86 Müller wendet einen solchen multi-motivationalen Ansatz an (1994). Er identifiziert für Verhandlungen in der internationalen Politik eine Erklärungslücke als den Bereich zwischen einer plausiblen Motivation zur Zusammenarbeit und der tatsächlichen Zusammenarbeit. Sie wird von ihm mit Verständigungsorientierung gefüllt. Die Bedingungen, unter denen transnationale Verhandlungen stattfinden, sind ähnlich den Bedingungen, unter denen die Verhandlungen an den Runden Tischen stattfinden. In der internationalen Politik stellt sich das Problem der Kooperation in einem weitgehend unregulierten Feld. Verhandlungen um Verfassungsänderungen an Runden Tischen sind ebenso unreguliert wie die internationale Zusammenarbeit; Constitution-building findet im gesetzesfreien Raum statt. Zusammenbruch der alten Ordnung 158 sagten. Die drei Geltungsansprüche („Rationalitätsimplikationen“) Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit kommen bei der Verständigungsorientierung zur Geltung. Der Hinweis, daß die Geltungsansprüche in der Kommunikation implizit erhoben werden, schließt keineswegs strategische Handlungsorientierung aus87. Nicht jede Kommunikation ist automatisch verständigungsorientierte Kommunikation. Machtverzerrungen und Informationsasymmetrien, also Abweichungen von einer „idealen Sprechsituation“, heben den einen oder anderen Begründungsdruck auf, so daß die entsprechenden Geltungsansprüche umgangen werden können. Dennoch bestehen die Geltungsansprüche und ermöglichen somit prinzipiell die Verständigungsorientierung. Empirisch wird eine „ideale Sprechsituation“ ohne Machtverzerrung und Informationsasymmetrien in Verhandlungen kaum zu finden sein. Vielmehr muß man von Mischungen unterschiedlicher Orientierungen ausgehen, in der eine von strategischen Kalkülen beherrschte Kommunikation durchaus möglich ist - wie das Beispiel der Runden Tische in Bulgarien deutlich zeigt88. Situationen, die strategisches Kalkül verlangen, schließen Verständigungsorientierung aber auch nicht aus. Sie bildet nicht nur einen Koordinations- und Integrationsmechanismus für lebensweltliche Bezüge. Selbst Situationen, die von Erfolgsorientierung dominiert sind, werden von lebensweltlichen Bezügen mit Verständigungsaspekten berührt (vgl. Habermas 1992). Verständigungsorientierung ist immer möglich, wenn Interaktionen eine starke Bedeutung haben. In den Interaktionen der Verhandlungen spielen Sprechhandlungen eine zentrale Rolle. Durch die häufigen Treffen können lebensweltliche Bezüge an Bedeutung gewinnen. Das schafft die Voraussetzungen für einen Diskurs, in dem die rationale Prüfung der impliziten Geltungsanspüche durch Argumente erfolgen kann. Ein solcher Meta-Diskurs wird dann geführt, wenn sich die Geltungsansprüche nicht auf unhinterfragte Regeln des Sozialen beziehen und somit ein Begründungsdruck für sie entsteht. Bei den Runden Tischen impliziert die Möglichkeit unterschiedlicher „priority principles“ alternative Begründungsmöglichkeiten der mit diesen Prinzipien verbundenen Geltungsansprüche. Sie können in einem rationalen Diskurs thematisiert werden. Ein solcher Diskurs ist an die Voraussetzung gebunden, daß ohne den Einsatz von Macht miteinander kommuniziert wird. Diese Voraussetzung wird natürlich in keiner Verhandlungssituation, die in der Typologie Schellings einem „Mixed-Motive Game“ entspricht, erfüllt. Der gleichberechtigte Zugang zum Diskurs ist durch den ungleichen Zugang zur Macht und Information verzerrt. Die Verhandlungsteilnehmer bemühen sich aber um eine institutionalisierte Korrektur der machtverzerrten Sprechsituation. Eine solche Korrektur läßt sich an dem Bestreben erkennen, die Verhandlungen öffentlich zu 87 In diesem Falle ließe sich der Ansatz verständigungsorientierten Handelns auch nicht mit strategischem und normativen Handeln kombinieren. 88 Die überwältigende Verhandlungsmacht der Regierung und die Ohnmacht der Opposition ließen für die Strategien der Regierung keinen Begründungsdruck entstehen - die Opposition hatte keine andere Wahl als sich den Entscheidungen, die aus der Regierungsriege kamen, zu beugen. Zusammenbruch der alten Ordnung 159 führen und geheime Absprachen zu unterlassen89. In Polen wurden zum Beispiel Kompromisse erst auf der Grundlage der von Mazowiecki formulierten Vorbedingung „...no secret deals, that is, the negotiations had to remain open to social review...“ (Osiatynski 1996: 55) möglich. Außerdem wurde die letzte Sitzung der Runden Tische über die nationalen Fernsehsender ausgestrahlt. Eine wahrscheinlich aber wesentlich wichtigere Voraussetzung, die in Polen und der Tschechoslowakei erfüllt wurde, war das Zustandekommen einer gemeinsamen Lebenswelt, in der sich eine Kompetenz zur Empathie entfalten konnte, die die Konvergenz unterschiedlicher Gerechtigkeitskonzepte begünstigte. Die gemeinsame Lebenswelt entstand mit den vielen intensiven Interaktionen der Verhandelnden. Mit der Zeit wurden in Polen und der Tschechoslowakei die Verhandlungen an den Runden Tischen durch eine Atmosphäre gegenseitiger Sympathie getragen. In Polen entwickelte sich an den Runden Tischen nahezu eine Freundschaftsbeziehung zwischen - wie Osiatynski es formuliert (1996) - ehemaligen Gefangenen und ihren Wärtern. Und auch in der Tschechoslowakei schien die lebensweltliche Orientierung zeitweise die Erfolgsorientierung zu überlagern; Adamec ließ sich im Eifer der Verhandlungen zu der Aussage hinreißen, mit Havel lieber gemeinsam ein Bier trinken gehen zu wollen, als zu verhandeln (Calda 1996: 148). Eine solche Äußerung steht für die wechselseitige Anerkennung, die als eine wichtige Voraussetzung des rationalen Diskurses gegeben sein sollte. In der Verständigungsorientierung kann der Schlüssel für die Akzeptanz und die Festlegung gemeinsamer Gerechtigkeitspositionen liegen. Mit ihr lassen sich die Entstehensund Entwicklungsprozesse eines durch die Beteiligten gesetzten normativen Rahmens für die Verhandlungen erklären. Des Rahmens, der den Aktionshorizont für die strategischen Kalküle definierte. Wenn die Entstehung der Kontextbedingungen für strategisches Handeln an den Runden Tischen kommunikationstheoretisch abgeleitet wird, konvertiert die Situationslogik zur abhängigen Variable (vgl. auch Müller 1994). Der Verhandlungskontext wird in der Kommunikation, die zur Einigung auf ein geteiltes Gerechtigkeitsprinzip führt, durch die Reflexion der Akteure bezüglich der Richtigkeit umgestaltet. Als unabhängige Variable setzt die neu definierte Situationslogik dem strategischen Verhandeln um die Distribution der Kooperationsgewinne (in den „Mixed-Motive Games“) Grenzen. Die Verständigung bezieht sich damit auf die Festlegung des verallgemeinerbaren Rahmens, in dem sich das Austragen partikularer Interessen einfügen läßt (vgl. Müller 1994). Somit widersprechen die Distributionspräferenzen, die in den Interessen der Verhandlungspartner zum Ausdruck gebracht werden, nicht dem Hinweis auf Verständigungsorientierung. 89 Öffentlichkeit hat den Effekt, daß sich die Akteure auf allgemein anerkannte und akzeptierte Prinzipien und Argumente beziehen müssen und nicht allein nach Maßgabe ihres Selbstinteresses handeln können (vgl. Elster 1994; Elster / Offe / Preuss 1998). Zusammenbruch der alten Ordnung 160 Für Polen und die Tschechoslowakei kann die Verständigungsorientierung die gravierende Veränderung der Verhandlungsatmosphäre und -bedingungen erklären. 4.4 Zusammenfassung Bei der Entwicklung des Modells für verhandelte Transformationen wechselt die analytische Perspektive: Das Modell der Handlungen und Entscheidungen unter bestimmten Kontextbedingungen wurde durch ein Modell, das die Gestaltung der Kontextbedingungen erklären kann, ergänzt. Die spieltheoretische Auseinandersetzung ermöglicht eine vergleichende Charakterisierung der Verhandlungen an den Runden Tischen der fünf Ländern. Mit der Untersuchung der strategischen Komponenten erschließen sich Dimensionen, anhand derer ein solcher Vergleich erfolgen kann. Die Dimensionen definieren sich aus Faktoren, z.B. dem taktischen Einsatz strategischer Mittel, die Aussagen über den unterschiedlichen Charakter der Länder ermöglichen. So ergibt sich für die Verhandlungen in dem jeweiligen Land ein Mischungsverhältnis von Kooperations- bzw. Konfliktorientierung der beteiligten Akteure, entlang dessen sich ein sinnvoller Vergleich durchführen läßt: An den Runden Tischen der DDR und Ungarn überwog das gemeinsame Interesse, so daß es weniger um eine konfliktträchtige Verteilung von Machtchancen ging als um die Koordination einer von Opposition und Machtelite gemeinsam getragenen Politik („Common-Interest Games“). In Polen und in der Tschechoslowakei verschoben sich die charakterlichen Schwerpunkte der Verhandlungen in Richtung zunehmender Kooperation. Dennoch blieben Konfliktlinien vorhanden, die eine Kompromißfindung nötig machten und entlang derer sich die Parteien gemäß ihrem Interesse strategisch engagierten („Mixed-Motive Games“). Die Verhandlungssituation in Bulgarien hingegen ist primär durch die Orientierung der Machtelite bestimmt gewesen. Die asymmetrische Machtverteilung erlaubte es ihr, die Interessen der Opposition weitgehend unberücksichtigt zu lassen, d.h. eine extrem unkooperative Haltung einzunehmen und nicht wirklich zu verhandeln (eine solche Spielsituation ließe sich als „Take-It-Or-Leave-It Game“ oder „Pure-Conflict Game“90 bezeichnen). War das situative Setting der Runden Tische durch ein gemeinsames Kooperationsinteresse bei vorhandenen Konfliktlinien zwischen Opposition und der Machtelite gekennzeichnet, dann wurde die Kooperation erst in einem Kontext gemeinsam geteilter Gerechtigkeitskonzepte möglich. Genau das läßt sich für die Tschechoslowakei und Polen beobachten. Die günstigen Kontextbedingungen für erfolgsorientiertes Handeln der Kompromißfindung in Distributionsfragen selbst kann von den Akteuren gestaltet werden. Die stati90 Vgl. Scharpf zu archetypischen Spielkonstellationen (1997: 72f). Zusammenbruch der alten Ordnung 161 sche Sicht, nach der die Akteure mit fixen Präferenzen im Rahmen einer bestimmten Situationslogik handeln, muß deshalb ergänzt werden. In dem Wandel der Logik der Situation wird der Kontext - in der spieltheoretischen Modellierung noch unabhängige Variable - zur abhängigen Variable. Die Rahmenbedingungen für die Kompromißfindung erhielten ihre Dynamik nicht etwa primär durch historisch strukturelle Veränderungen, sondern durch Annäherung der Gerechtigkeitsvorstellungen der an den Verhandlungen beteiligten Akteure. Die Annäherungen bezüglich einer normativen Rahmensetzung für die Verhandlungen setzt einen Diskurs über die Geltung der Normen voraus. Die Verständigungsorientierung der Akteure kann hier zu der Annäherung und Festlegung von Gerechtigkeitskonzepten beigetragen haben. Mit ihr läßt sich die Dynamisierung der kontextuellen Bedingungen, die sich in der Tschechoslowakei und Polen beobachten ließ, erklären. Mit einem Akteurmodell, das von einem multi-motivationalen Ansatz ausgeht, kann die Dynamik eines kleinen aber bedeutenden Abschnitts der Transformation in einer Mikroperspektive analysiert werden. Die durch historische Prozesse geschaffenen Möglichkeitsräume für die institutionelle Mitgestaltung der Transformation waren nicht so eng, daß die Akteure nur nach einer festen Logik der Situation handeln konnten. In der hochdynamisierten Phase der Runden Tische blieb Raum für die Gestaltung der Handlungskontexte. Die Bedingungen, unter denen die Verhandlungen stattfanden, konnten durch die Akteure mitgestaltet bzw. umdefiniert werden. Die Akteure hatten z.T. die Möglichkeit, ihr zukünftiges, für die inhaltliche Entscheidungsfindung relevantes Handlungsrepertoire mit normativen Prinzipien zu binden. So wurde die Realisierung kollektiv rationaler Ergebnisse (Kooperation und Kompromißfindung) trotz Konflikt möglich. Dieser Prozeß, in dem Handlungen und Entscheidungen Kontexte für weitere Handlungen und Entscheidungen schaffen, ist in Situationen, in denen Interessenkonflikte aufeinandertreffen und berücksichtigt werden müssen, auf einen multi-motivationalen Ansatz angewiesen. In dieser Perspektive können die ineinander verschränkten Prozesse von Selektionslogik - die Wahl einer bestimmten Handlungsalternative - (vgl. Esser 1993) und der Logik der Situation - die Bedingungen für diese Wahl - heuristisch nachvollzogen und theoretisch aufgearbeitet werden. Konsolidierung der politischen Ordnung III. DIE KONSOLIDIERUNG DER NEUEN POLITISCHEN ORDNUNG 162 Konsolidierung der politischen Ordnung 163 1. Vorbemerkung Das Erreichen des Ziels hängt nicht nur von den Mitteln und dem Prozeß ab. Es hängt auch von der Definition des Ziels ab. Das Ziel politischer Konsolidierung ist in der Transformationsforschung aber keineswegs eindeutig definiert1. Die Kriterien für Demokratie weichen stark voneinander ab, und gleiches gilt für die Interpretation dessen, welche politischen Systeme aufgrund welcher Eigenschaften als stabilisiert – demokratisch konsolidiert – gelten können. Anstatt in den unterschiedlichen Definitionen Widersprüche aufzuspüren, d.h. die Entscheidung für das bessere Konzept treffen zu wollen, kann mit den vielfältigen Definitionen und Kategorien die Komplexität und Wechselwirkungen der Problemkreise einer demokratischen Konsolidierung nachgezeichnet werden. Nicht die Entscheidung darüber, welche Kriterien uns im Falle ihrer Erfüllung über die erfolgreiche Konsolidierung informieren, sondern das Aufspüren von relevanten Gefahren und Risiken für eine erfolgreiche Etablierung neuer demokratischer Systeme folgt aus der Komplexität der Transformationsdiskussion. 1.1 Demokratie Definitorische Schwierigkeiten ergeben sich bereits bei dem Begriff der Demokratie. Hier stehen sich in der Transformationsforschung formale, auf Verfahren (daher auch „prozedurale Demokratiekonzepte“ genannt) und Institutionen rekurierende, und normative, auf inhaltliche Zielbestimmungen der Demokratien weisende, Konzepte gegenüber. Erstere beziehen sich in ihren Demokratiedefinitionen auf einen klar umrissenen Katalog formaler Kriterien, der die Verfahren und Orte (Institutionen) gesellschaftlicher Konfliktregulierung benennt. Nicht zuletzt die Eindeutigkeit liberaler Demokratietheorien hat zu ihrer Etablierung als Mainstream der Transformationsforschung (vgl. Merkel 1995; Offe 1994) beigetragen. Den formalen Konzepten stellen normative Demokratiedefinitionen eine komplexere Kriterienliste zur Seite. Formale Verfahrensregeln können nicht unabhängig von den Wechselwirkungen in den Netzwerken, in denen die konkrete Politik gestaltet wird, das bestimmende Kriterium demokratischer Strukturen sein. Der konkrete Fall der Demokratisierung Osteuropas zeigt, daß die alleinige Definition über Verfahren die konkreten Ergebnisse außer acht läßt, obwohl diese ausschlaggebend für die Legitimität sein können. Den sparsamsten Versuch einer prozeduralen Demokratiedefinition liefert wohl Przeworski, indem er Demokratie im wesentlichen als System organisierter Unsicherheit 1 Schedler beschreibt die gegenwärtige Konsolidierungsforschung als „...Babilonian chorus of voices singing songs of democratic consolidation.“ (1998: 103). Konsolidierung der politischen Ordnung 164 charakterisiert (1991: 13). Diese Definition ist aber nicht anspuchslos, nur weil sie auf eine schlichte Formel gebracht ist (vgl. dagegen Merkel 1995), vielmehr liegt mit ihr das liberal-prozedurale Demokratiekonzept in semantisch geronnener Form vor. Mit Unsicherheit verweist Prezeworski auf den Umstand, daß die Ergebnisse der politischen Konflikte den wettbewerbenden Kräften ex ante unbekannt sind. In diesem Merkmal liegt ein wesentlicher Unterschied zu autoritären Systemen, in denen die Ergebnisse ex post an die Erwartungen ex ante angepaßt werden können. In Demokratien hingegen können sich die Akteure strategisch an Erwartungen, nicht aber an Ergebnissen orientieren, weil diese auch von den schwer zu antizipierenden Handlungen anderer abhängen – sie sind determiniert vom Wettbewerb konkurrierender politischer Kräfte. Die Ergebnisse sind allerdings nicht vollkommen kontingent, so daß den Akteuren jede Grundlage für rationales Handeln fehlen würde2. Przeworskis Konzept der Unsicherheit ist weniger radikal als es die Formulierung suggeriert. Unsicherheit bezieht sich lediglich auf das konkrete Ergebnis. Die politischen Akteure haben aber durchaus eine Vorstellung von den Wahrscheinlichkeiten, die sie den Konsequenzen ihrer Handlungen zuweisen können. Auf dieser Grundlage bilden sie Erwartungen und kalkulieren ihre Strategien. Insofern sind die Ergebnisse zwar nicht vorbestimmt, aber ebensowenig vollkommen unbestimmt. Die politischen Kräfte ringen im Wettbewerb um die Gelegenheit, ihre Interessen vorzubringen. Sie ringen aber in einem institutionellen Rahmen, der die Regeln des Wettbewerbs und die Regeln für Sanktionen defektiven Handelns festsetzt. Darauf verweist Przeworski mit der Spezifizierung der Unsicherheit als organisierte Unsicherheit. In einer Demokratie wird der Wettbewerb über Wahlen reguliert. Über sie werden politische Programme ratifiziert bzw. die Zuständigkeit derjenigen, die die Programme entwickeln, bestätigt. Darüber hinaus stehen in einer Demokratie nicht frei agierende Individuen miteinander im Wettbewerb, sondern kollektive Organisationen, die in der Lage sind, Zwang auf diejenigen auszuüben, deren Interesse sie vertreten. Dieser institutionalisierte Handlungsrahmen hält Individuen davon ab, ihr persönliches Interesse defektiv, d.h. auf Kosten der kollektiven Ziele, durchzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ergebnisse im Wettbewerb wird somit vom institutionellen Rahmen3 und den Ressourcen der politischen Kräfte bestimmt. Mit dem Attribut „organisiert“ und der Kategorie „Unsicherheit“ definiert Przeworski Demokratie über prozedurale Verfahren, die das System der Konfliktbearbeitung festlegen. Von den Akteuren muß in diesem Verständnis kein Commitment gegenüber bestimmten Normen und Werten gefordert werden, sondern lediglich Commitment zu den 2 Eine enge Auslegung des Begriffs der Unsicherheit würde keine Erwartungsbildung erlauben, womit rationales bzw. strategisch-politisches Handeln unmöglich würde. Der Unsicherheitsbegriff bei Przeworski entspricht insofern eher dem Risikobegriff, der die Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten zu möglichen Ergebnissen erlaubt. 3 Institutionen haben distributive Effekte. Beispielsweise wirken sich unterschiedliche Wahlsysteme auf die Verteilung politischer Macht aus. Konsolidierung der politischen Ordnung 165 Verfahren eines abstrakten Regelwerks. Damit distanziert sich Przeworski von normativen Demokratieansätzen, die Demokratien über die Verfahren hinaus auch über die Ergebnisse der Verfahren bewerten. Bei prozeduralen Demokratiekonzepten stimmen die ex-ante-Bwertungen und ex-post-Bewertungen der Ergebnisse überein. Die Verfahren und damit jedwedes Ergebnis werden gleichsam als legitim gewertet. Dagegen sind im normativen Demokratieverständnis nur bestimmte Ergebnisse legitim, insofern modifizieren die ex post Bewertungen der Ergebnisse die ex-ante-Commitments gegenüber den Verfahren, was die gewünschte Regelbefolgung gefährden kann (Przeworski 1991: 14). Przeworskis Konzept der organisierten Unsicherheit verweist auf eine Demokratiedefinition, die primär durch Wettbewerb und Partizipation gekennzeichnet ist. Diese Definition schließt an Dahls (1971) Demokratiekonzept an. Während Przeworski aber primär für das prozedurale Demokratieverständnis argumentiert und die institutionelle Ausgestaltung der organisierten Unsicherheit offen läßt, findet man bei Dahl eine konkretere Darstellung. Bei ihm werden die beiden Demokratiedimensionen „öffentlicher Wettbewerb“ (public contestation) und „politische Partizipation“ (right to participate) auf ihre institutionellen Voraussetzungen zurückgeführt: Die politischen Institutionen müssen garantieren, daß die Partizipationsrechte möglichst viele Bürger einbeziehen („highly inclusive“) und daß diese Bürger die uneingeschränkte Möglichkeit haben, 1. ihre Präferenzen zu bilden, 2. diese gegenüber den anderen Bürgern und den politischen Eliten hervorzubringen und 3. bei der Regierung eine Berücksichtigung und Gewichtung ihrer Präferenzen ohne Diskriminierung (wegen Inhalts oder Quelle der Präferenzen) zu erfahren (Dahl 1971: 2). Für die demokratischen Institutionen ergeben sich daraus die folgenden acht prozeduralen Minima (Dahl 1971: 3): 1. Assoziationsfreiheit, 2. Meinungsfreiheit, 3. aktives Wahlrecht, 4. passives Wahlrecht, 5. eine pluralistische Struktur der Informationsquellen, 6. offener Zugang zu öffentlichen Ämtern, 7. freie und faire Wahlen sowie 8. Institutionen, die sicherstellen, daß die Regierungspolitik von Wählerstimmen und anderen Ausdrucksformen der Bürgerpräferenzen abhängen. Dahls Demokratiekonzept bildet auch heute noch die Grundlage für einen bedeutenden Teil der Transformationstheorien. Die Theorien unterscheiden sich lediglich in Nuancen, die dadurch entstehen, daß einzelne institutionelle Dimensionen unterschiedlich gewichtet oder ergänzt werden. In solchen Korrekturen drücken sich die empirischen Erfahrungen mit den Transformationen in den letzten dreißig Jahren aus. Grundlage der Demokratiekonzepte aktueller Transformationstheorien bildet Schumpeters4 Definition 4 Bei Schumpeter heißt es. „...die demokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels Konkurrenzkampf um die Stimmen des Volkes erwerben.“ (1980: 428). Mit dieser Demokratiedefinition stellt Schumpeter die Verfahren – und nicht etwa Ziele – der Demokratie in den Vordergrund; er formuliert den modus procedendi demokratischer Ordnungen. Konsolidierung der politischen Ordnung 166 repräsentativer Demokratie, und in der institutionellen Ausgestaltung den prozeduralen Minima wird den Kategorien Dahls gefolgt. Während Di Palma (1990: 16) das Konzept Dahls noch unverändert übernimmt, setzen Kraus sowie Linz und Stepan bzw. Linz, Stepan und Gunther eigene Akzente. Für Linz und Stepan (1996) bzw. Linz, Stepan und Gunther (1995) spielt die Unabhängigkeit, d.h. die ungeteilte Macht, der demokratisch gewählten Regierung eine entscheidende Rolle. Sie definieren deshalb als zusätzliches Demokratiekriterium, daß die Regierung nicht von Machtzentren beeinflußt werden darf, die sich nicht demokratisch legitimieren müssen. Mit dieser Hervorhebung wollen die Autoren die „electoral fallacy“ (Linz / Stepan 1996: 4) vermeiden - den Trugschluß, daß freie Wahlen allein auch hinreichende Bedingungen einer souveränen, demokratisch legitimierten Regierung sein können. Die Erfahrung mit den Transformationen in Mittel- und Südamerika hat nämlich gezeigt, daß das Militär als eine nicht demokratisch legitimierte Macht (bspw. in Guatemala während der 80er Jahre) eine demokratisch gewählte Regierung signifikant einschränken kann, so daß sie in ihren politischen Entscheidungen nicht mehr souverän ist. Darüber hinaus kann das Kriterium der Unabhängigkeit der demokratisch gewählten Regierung von einem weiteren Argument abgeleitet werden (Kraus 1990): Demokratie läßt sich in Abgrenzung zu autoritären Regimen als ein Verfahren verstehen, das primär der Bearbeitung und Kanalisierung gesellschaftlicher Konflikte dient. Das demokratische Merkmal der Konfliktbearbeitung ist - ganz ähnlich wie bei Przeworskis „organisierter Unsicherheit“ - die „relative Ungewißheit“ der Resultate politischer Willensbildung. Politikinhalte dürfen nicht fixiert werden, sondern müssen sich aus dem politischen Wettbewerb ergeben. Die Institutionen müssen den ungewissen Charakter des politischen Wettbewerbs garantieren, indem sie der Intervention politischer Kräfte, die das Resultat gemäß ihrem Interesse ändern wollen, vorbeugen (Kraus 1990: 196f). Linz und Stepan bzw. Linz, Stepan und Gunther sowie Kraus entwickelten ihr Demokratiekonzept entlang der Erfahrungen, die in Mittel- und Südamerika und in Südeuropa mit der Einführung demokratischer Institutionen gemacht wurden. Ihre Demokratiedefinition richtet sich primär gegen die Einmischung demokratisch nicht legitimierter Vetokräfte. Gleichzeitig schließt die geforderte Ungewißheit der Resultate des politischen Wettbewerbs bzw. Konflikts aber Zieldefinitionen der Demokratie und damit eine normative Demokratiekonzeption aus. So wie diese Autoren vor dem empirischen Hintergrund der Transformation zusätzliche Kriterien zur Ergänzung der theoretischen, prozeduralen Demokratiekonzeption finden, so formuliert auch Offe mit Blick auf die Besonderheit der osteuropäischen Transformation zusätzliche Demokratiekriterien. Seine Version widerspricht allerdings den prozeduralen Konzepten. Er weist auf die Notwendigkeit der Flankierung des demokratischen Prozesses durch die Formulierung von Politikinhalten bzw. -ergebnissen (vgl. Offe 1994: 92). Dieses normative Demokratiekonzept steht im Widerspruch zu der von Konsolidierung der politischen Ordnung 167 Przeworski oder auch Kraus geforderten institutionalisierten Unsicherheit bzw. Ungewißheit der Ergebnisse politischer Willensbildungsprozesse. Offe argumentiert, daß die Ungewißheit Ergebnisse entstehen lassen könnte, die die Legitimität des demokratischen Regimes untergraben: Entstehen - ungeachtet, ob gewollt oder ungewollt als Nebenfolge - Ergebnisse, die systematisch bestimmte gesellschaftliche Gruppen benachteiligen, dann kann ein Punkt erreicht werden, an dem die Toleranzgrenze dieser Gruppen überschritten ist. Besonders die tiefgreifenden politischen und ökonomischen Änderungen in Osteuropa verlangen zur Stabilisierung des politischen Systems nach einer sozialpolitischen Flankierung, die den Verlust ökonomischer Ressourcen über Sicherungs- und Umverteilungsmechanismen abfedern. Offe mißt der Sozialpolitik für die Transformation der osteuropäischen Gesellschaften eine konstitutive Bedeutung zu: Sie hat einen politischen Wert, weil die Legitimität der demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen nur gewährt ist, wenn sozialpolitisch garantiert wird, daß die Bevölkerung sich nicht von ökonomischen Verlusten oder den Ergebnissen der demokratischen Willensbildung existentiell bedroht fühlen muß (Offe 1994: 94). Auf dieser Grundlage kann Offe für die demokratische Konsolidierung in Osteuropa den Wohlfahrtstaat nicht als Folge, sondern als notwendige Voraussetzung definieren. In der Kontroverse um die Demokratiedefinitionen in der Transformationsforschung zeigt sich die Komplexität der Problematik. Die Transformationen in Mittel- und Südamerika und in Südeuropa forderten die Regime mit neuen Problemen heraus, die zu Nachbesserungen der Theorie führten. Die Besonderheiten der Transformation Osteuropas stellen die Demokratiekategorien der Transformationsforschung erneut in Frage. In der Schwierigkeit, eine von Raum, Zeit und Kultur unabhängige Theorie zu formulieren, drückt sich die Vielzahl der zu bedenkenden Variablen und Zusammenhänge aus. Diese Vielfalt wirkt sich auch auf die unterschiedlichen Einschätzungen der Konsolidierungsbedingungen aus. 1.2 Konsolidierung Mit der Frage nach der Konsolidierung werden die Kriterien der Demokratie unter Hinzunahme einer weiteren Dimension thematisiert. Diese ist der angesetzte Zeitraum für eine Konsolidierung, dessen Umfang von den Anspüchen abhängt, die an Institutionen, Entwicklungspfade sowie die Einstellungen und Verhaltensstile der Akteure gerichtet werden. Der Anspruch steigt darüber hinaus mit der Hinzunahme externer Variablen, zum Beispiel Position und Rolle des neuen politischen Systems im internationalen System, und interner Variablen, die sich auf andere gesellschaftliche Teilbereiche beziehen, zum Beispiel ökonomischer Erfolg politischer Entscheidungen und politische Konsolidierung der politischen Ordnung 168 Kulturmuster der Bevölkerung. Je anspruchsvoller und komplexer die Konzepte einer krisenresistenten, demokratischen Struktur, desto weiter verschiebt sich der Zeithorizont für eine erfolgreiche Konsolidierung auf eine längerfristige Perspektive. Kurzfristige Perspektiven hingegen grenzen die relevanten Variablen ein. Sie bezieht sich meist nur auf das Verhalten entscheidungsrelevanter politischer Eliten. In der Debatte um die relevanten Konsolidierungskriterien stehen sich die anspruchsvollen maximalistischen Konzepte und die weniger anspruchsvollen minimalistischen Konzepte gegenüber. Huntingtons (1991) Beitrag steht für die maximalistische Konzeption, während Di Palma eine minimalistische Perspektive vertritt (vgl. Gunther / Diamandouros / Puhle 1995: 7; Merkel 1995). Für Huntington steht die Entwicklung einer demokratisch-politischen Kultur im Zentrum der Konsolidierung (1991: 258f). Damit setzt er die Entwicklung demokratischer Werte bei den Eliten und bei der Bevölkerung als Voraussetzung für eine demokratische Stabilisierung. Daß neben den Einstellungen und dem Verhalten von Eliten auch politische Werthaltungen der Bevölkerung relevant sind, erklärt sich bei Huntington aus der Bedeutung, die er der Legitimität beimißt: Demokratien können in seiner Perspektive nur effektiv sein, wenn sie Legitimität entwickeln. Da junge Demokratien an mangelnder Legitimität leiden, sind sie oft nicht effektiv. An diesem Widerspruch müssen sie aber nicht zerbrechen. Das wird deutlich, wenn man den Legitimitätsbegriff differenzierter betrachtet. Legitimität generiert sich nicht nur aus der Leistung (Effektivität) des politischen Systems. Neben dieser „Performance-Legitimität“ gibt es auch eine prozedurale Legitimität, die sich auf die Werte einer demokratisch-politischen Kultur stützt. Und hier liegt die Herausforderung, aber auch die Hoffnung für junge Demokratien. Kann eine politische Kultur etabliert werden, in der die Verfahren der Demokratie Legitimität (prozedurale Legitimität) genießen, dann spielt die Leistung des Systems (Performance) eine nachgeordnete Rolle. Mit der Rolle, die der Legitimität in der Transformationstheorie zugewiesen wird, lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Konsolidierungskonzepte verdeutlichen. In der Einschätzung der Bedeutung der Legitimität durch Leistung unterscheidet sich das minimalistische Konzept eigentlich nicht von dem maximalistischen Anspruch. Sowohl Huntington als auch Di Palma argumentieren, daß die Performance-Legitimität in demokratischen Regimen nicht die Bedeutung hat, die sie in autoritären Regimen hat. Der Grund ist, daß es aktuell keine attraktive Regimealternative zum demokratischen System gibt. Der Leistungswettbewerb, in dem sich die autoritären Regime gegenüber den demokratischen Regimen befanden, existiert für die demokratischen Regime nicht mehr. Mit dem Verschwinden von Alternativen ändert sich die Erwartung bezüglich der Leistung von Demokratien. Schlechte Leistungen hindern nicht mehr unbedingt die demokratische Unterstützung, wie dies oftmals für autoritäre Regime galt; die Frage des „system blame“ (Linz / Stepan 1996), die für die Legitimität nicht-demokratischer Systeme bedeutend war, stellt sich für demokratische Systeme nicht mehr. Die Enttäu- Konsolidierung der politischen Ordnung 169 schungen der Bevölkerung richten sich unter der Abwesenheit einer Regimealternative nicht gegen das Regime selbst. Ganz im Gegenteil. Sie können Bestandteil des demokratischen Systems sein. Das gilt dann, wenn die Bevölkerung fähig ist, zwischen Regime und Regierung bzw. Regierenden zu unterscheiden (Huntington 1991: 260). Die Legitimität des Regimes hängt von dieser Unterscheidungsfähigkeit ab. Auch wenn die Regierenden nicht unterstützt werden, kann das politische System noch Unterstützung erfahren. Wird die Regierung abgewählt, kann das einer Bestätigung des institutionalisierten Weges eines demokratischen Regierungswechsels gleichkommen, wenn sich in der Wahl kein Votum gegen das Regime ausdrückt5. Das kann sogar für den Fall gelten, daß reformierte kommunistische Parteien die Macht wiedererlangen, so geschehen in Litauen 1992, in Polen 1993 und in Ungarn 1994. In diesen Fällen handelte es sich nicht um Regierungswechsel, die eine Bewegung weg von Demokratie darstellten6. Die kommunistischen Parteien waren in allen drei Fällen vielmehr darum besorgt, ein demokratisches Image aufrechtzuerhalten. In diesem Bestreben übertrafen sie sogar oftmals die demokratischen Standards ihrer Vorgänger, von denen noch z.T. zivile Freiheiten im Namen ihrer nationalistischen und anti-kommunistischen „Mandate“ verletzt wurden (Linz / Stepan 1996: 454f). Der Unterscheidungsleistung geht nach Huntington ein wichtiger Lernprozeß voraus. Die Bevölkerung muß in einem Sozialisationsprozeß eine Werthaltung verinnerlichen, die Demokratie nicht nur aus der Perspektive der Problemlösung sieht, sondern sie primär als ein System versteht, in dem die Herrschenden ausgewechselt werden können. Hinsichtlich der Bedeutung, die der aus kulturellen Werten gespeisten prozeduralen Legitimität beigemessen wird, unterscheiden sich die beiden Konsolidierungskonzepte allerdings gravierend. Di Palma weist die Notwendigkeit einer demokratischen Werthaltung als Voraussetzung für eine demokratische Stabilisierung entschieden zurück. Zur Begründung führt er die unbedeutende Rolle an, die er der prozeduralen Legitimität beimißt; bei Di Palma heißt es: „Legitimacy Is Not Neccessary“ (1990: 144). Entscheidend für die Stabilität sind nach ihm ausschließlich das Elitenhandeln und die Bedingungen, die im „Democratic Agreement“, der Institutionalisierungsphase der Demokratie, ausgehandelt wurden. „Convent“, „Compliance“ und „Support“ (Di Palma 1990: 145) der Eliten reichen für die Implementation demokratischer Institutionen aus und stellen sich im Prozeß des „Demokratic Agreements“ implizit ein - der Übereinkunft folgen quasi-automatisch psychologische und strategisch-organisatorische Commit5 Auch Lawson sieht hierin einen entscheidenden Indikator für demokratische Regime: „A Regime can incorporate any number of the features of democratic politics, including constitutional provision for elections, but these are fairly meaningless unless an opposition is able to succeed legitimatly to government in open contest. [...] Opposition will then be directed at other contestants for government power, and not normally at the regime itself.“ (1993: 200). 6 Segert (1995a) führt aus, daß die primäre Gefahr der Rückkehr zu autoritären Strukturen nicht von den Nachfolgeparteien ausgeht. Ihr gelegentlicher Aufstieg verweist vielmehr auf die Chance einer Konsolidierung der Demokratie. Konsolidierung der politischen Ordnung 170 ments. Die Übereinkunft selbst genügt, um das Überleben der Demokratie zu sichern. Ausschlaggebend sind nämlich nicht die politischen Werte der Eliten, sondern ihre Vorstellungen davon, wie man auf Krisen reagieren soll. Diese Argumentation ist plausibel, wenn man bedenkt, daß externer und interner Druck sich bereits in der Übergangsphase als hinreichender Anlaß für die „Konvertierung“ kommunistischer Eliten zu liberalisierenden und demokratischen Politikern erwiesen hat und nicht etwa ein Wertewandel vorausgesetzt werden mußte. Di Palma weist mit seinem Demokratisierungskonzept Huntingtons Konzept der demokratisch-politischen Kultur als Voraussetzung für die demokratische Konsolidierung begründet zurück. Die Konsolidierung wird von ihm mit seinem minimalistischen Konzept ihrer psychologischen und kulturellen Implikationen entledigt. Deshalb müssen keine theoretisch unsicheren und damit z.T. willkürlichen institutionellen Konsolidierungskriterien festgelegt werden. Dieser konzeptionelle Vorteil wird allerdings mit einem bedeutenden theoretischen Nachteil „erkauft“: In Di Palmas Konzept wird die Konsolidierung auf die demokratischen Übereinkünfte und somit auf die Phase des Umbaus reduziert. Es läßt sich nicht angeben, wann die Konsolidierung abgeschlossen ist. Bei einem maximalistischen Konzept – wie dem Huntingtons – verhält sich das anders. Da die Legitimität des demokratischen Prozesses hervorgehoben ist und somit die Werthaltung in den Blickpunkt rückt, ergibt sich ein abstraktes „Ziel“ bzw. die Vorstellung von einer konsolidierten Demokratie. Eine demokratisch-politische Kultur läßt sich aber nicht direkt beobachten. Deshalb müssen anspruchsvolle Konsolidierungskonzepte Kriterien entwickeln, die als valide Merkmale einer stabilen Demokratie gelten können. Huntington versucht, Kriterien von seiner zentralen Annahme über den Charakter einer stabilisierten Demokratie abzuleiten (1991: 266): Demokratien sind in dem Maße konsolidiert, in dem die systemkonformen Reaktionen institutionalisiert sind. Das bedeutet, daß die demokratischen Prozesse eine gewisse Selbstverständlichkeit erreicht haben müssen, in der sich die demokratische Werthaltung der Eliten und der Bevölkerung reflektiert. Ein valides Kriterium für die Etablierung einer solchen demokratischpolitischen Kultur ist das Bestehen des „two-turnover tests“. Die zweimalige Regierungablösung kann zwei Dinge zeigen: erstens, daß es mindestens zwei bedeutende politische Parteien gibt, die sich zur Demokratie bekennen, und zweitens, daß sowohl die Eliten als auch die Bevölkerung im Rahmen des demokratischen Systems handeln (Huntington 1991: 267). Huntington räumt ein, daß dies ein harter Test ist. Und hierin liegt ein ganz gravierender Nachteil maximalistischer Konsolidierungskonzepte. Bedeutende Demokratien, die zum Teil als Musterbeispiel stabiler Systeme gelten – wie bspw. Italien, Japan und Deutschland – können durch die konsequente Anwendung solcher Tests aus dem „Club“ konsolidierter Demokratien ausgeschlossen werden. Institutionelle Konsolidierungstests, die sich auf Wiederholung und Kumulation beziehen, Konsolidierung der politischen Ordnung 171 sind also mit einer prinzipiellen Unschärfe ausgestattet. Das liegt an ihrem unklaren theoretischen Unterbau (vgl. Di Palma 1990: 142). Sie müssen Listen maximalistischer Forderungen bilden, um alle möglichen Ursachen für das Mißlingen der Konsolidierung berücksichtigt zu haben. Die Kriterien sind aufgrund historischer Transformationserfahrungen durchaus berechtigt. Im Falle ihrer Erfüllung kann nämlich gesichert von einer konsolidierten Demokratie ausgegangen werden, und darin liegt die Stärke maximalistischer Konzepte. Sie können Konditionen einer stabilen Demokratie angeben. In ihrer Anwendung auf konkrete Konsolidierungsprozesse sind die Kriterien allerdings nahezu willkürlich, so daß auch mit den maximalistischen Konzepten der Zeitpunkt einer abgeschlossenen Konsolidierung nicht verläßlich angegeben bzw. theoretisch begründet werden kann. Die Differenz zwischen einem maximalistischen und einem minimalistischen Konsolidierungskonzept basiert auf den unterschiedlichen Anforderungen an den Institutionalisierungsstand der Demokratie und der Entscheidung, wessen Verhalten - Eliten und/oder Bevölkerung - für die Stabilisierung relevant ist. Über diese Variablen vermittelt sich der gravierende Unterschied in der Zeitperspektive der Konsolidierung – im minimalistischen Konzept tendiert die Stabilisierungsphase gegen Null, im maximalistischen Konzept hingegen gegen unendlich. Eine Positionen zwischen diesen Konzepten beziehen Schmitter (1995) sowie Gunther, Diamandouros und Puhle (1995). Schmitter weist anspruchsvolle Konzepte wie das Huntingtons zurück, indem er den Interaktionsmustern zwischen den relevanten politischen Gruppen, die eine „zufällige Zustimmung“ zur Demokratie fördern, mehr Bedeutung zumißt als einer demokratisch-politischen Kultur in Form normativer Commitments und persönlicher Bekenntnisse zur Demokratie. Andererseits stellt er die Stabilisierung demokratischer Verhaltensmuster und die Bestätigung der institutionalisierten demokratischen Verfahren in Abhängigkeit zu einer Liste potentiell entscheidender Faktoren, die in Di Palmas Verständnis als willkürlich gewählte Kriterien disqualifiziert würden. Dies sind sowohl exogene Faktoren, wie die Position der jungen Demokratie im internationalen Umfeld, als auch endogene Faktoren wie die nationale Geschichte und der Verlauf der Demokratisierung. Damit gewinnt die Einbindung in internationale nicht-staatliche und staatliche Organisationen, die politische Situation der Nachbarländer sowie vorautoritäre Demokratieerfahrungen, Handlungsstrategien der Eliten und das Verhalten der Bevölkerung an Bedeutung. Allerdings formuliert Schmitter die Kriterien mit einem theoretisch zurückgenommenen Anspruch. Zwar haben die genannten Faktoren einen Einfluß auf die Konsolidierung, dennoch verbleibt der kausale Zusammenhang – besonders der endogenen Faktoren – im Unklaren. Schmitter selbst stellt fest, daß die Faktoren nicht den Status notwendiger Voraussetzungen einnehmen (1995: 50f): Es gibt Länder, die den Zustand stabiler De- Konsolidierung der politischen Ordnung 172 mokratien erreichen konnten ohne umfassende Beteiligung der Bevölkerung, ohne eine fortgeschrittene wirtschaftliche Entwicklung oder auch ohne die kulturelle Voraussetzung einer staatsbürgerlichen Tradition. Diese Liste ließe sich nahezu beliebig für sämtliche Faktoren weiterführen. Einzige, prinzipielle Voraussetzung bleibt die Herstellung einer nationalen Identität und territorialer Grenzen, weil sich auf demokratischem Wege nicht entscheiden läßt, welche politische Einheit zugrunde gelegt werden soll bzw. kann (Schmitter 1995: 49). Dennoch verweist Schmitter auf die Relevanz wirtschaftlicher Faktoren, kultureller Prozesse der politischen Sozialisation und ethischer Einschätzungen (1995: 48). Das zeigt, daß sein Konsolidierungskonzept zwischen einer minimalistischen und einer maximalistischen Version angesiedelt ist. Schmitters institutionalistische Kriterien beanspruchen einen mittelfristigen Zeitrahmen für die Konsolidierung. Auch Gunther, Diamandouros und Puhle (1995) verweisen auf einen mittleren Zeithorizont bei ihrer Kriterienwahl für eine konsolidierte Demokratie. Sie definieren ein demokratisches Regime als konsolidiert, wenn alle politisch signifikanten Gruppen die zentralen politischen Institutionen als einzig legitimen Rahmen des politischen Wettbewerbs anerkennen und den demokratischen Spielregeln folgen (Gunther / Diamandouros / Puhle 1995: 7). Mit dieser Definition rücken sie Einstellungsmuster und das Verhalten der Eliten in den Vordergrund. Sie bilden die signifikanten Gruppen, die die politischen Institutionen akzeptieren und demokratische Verhaltensnormen befolgen müssen. Gunther, Diamandouros und Puhle wenden sich damit gegen Konsolidierungskonzepte, die den Einstellungsmustern und Verhaltensnormen der Bevölkerung eine zentrale Bedeutung für die Stabilisierung zumessen. Abweichende Tendenzen und anti-demokratische Dissidenten wird es wohl immer - und das heißt auch in konsolidierten Demokratien - geben. Daher kann man nicht umfangreiche Bedingungen an eine Konsolidierung stellen, die eine etablierte demokratisch-politische Kultur voraussetzen. Ausschlaggebend ist, daß die Eliten demokratische Prozeduren respektieren und somit der Opposition im demokratischen Wettbewerb eine Chance geben. Darüber hinaus müssen die Eliten Normen befolgen, die Gewalt und Einschüchterung zurückweisen. Denn nur so kann den Verlierern im politischen Konflikt garantiert werden, daß sie die Austragung des Konflikts überleben und auch nach verlorener Wahl eine Chance zur Wiederwahl haben. Wird also die Legitimität der demokratischen Institutionen akzeptiert, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, daß gesellschaftliche Konflikte und Interessengegensätze kanalisiert werden, d.h. über demokratisch repräsentative Institutionen vermittelt werden (Gunther / Diamandouros / Puhle 1995). Mit einer solchen Institutionalisierung gesellschaftlicher Konflikte wird eine gewalttätige außerparlamentarische Konfliktaustragung, die eine Stabilisierung der Demokratie gefährden könnte, unterbunden. Einstellung und Verhalten der Eliten werden von Gunther, Diamandouros und Puhle als die Konsolidierung der politischen Ordnung 173 zentrale Stütze für einen demokratischen Umgang mit politischen bzw. gesellschaftlichen Konflikten verstanden. Sie entscheiden über die Chancen einer Konsolidierung, weil sie die Institutionen der Interessenvermittlung - d.h. auch der Konfliktaustragung ermöglichen und tragen. Dennoch läßt sich in Anschluß an diese Argumentation plausibel erklären, daß für das Verhalten der Eliten der Rückhalt in der Bevölkerung entscheidend ist. Linz, Stepan und Gunther (1995) zeigen, daß institutionelle Kriterien und vor allem Kriterien, die das Verhalten der Eliten betreffen, eng mit den Einstellungen in der Bevölkerung verwoben sind und damit gemeinsam über den Konsolidierungsgrad entscheiden können: Die institutionellen Kriterien legen fest, daß keine Machtreserven und -zentren außerhalb der institutionalisierten demokratischen Verfahren die Politik bestimmen dürfen, und daß es bei den Eliten keine Bestrebungen geben darf, die die demokratischen Institutionen herausfordern. Hinzu kommt nun, daß es zur Konsolidierung auch noch einer demokratischen Einstellung in der Mehrheit der Bevölkerung bedarf. Linz, Stepan und Gunther (1995) legen mit diesem Kriterium zwar nicht - wie Huntington - die langfristige Perspektive eines kulturellen Wandels einer Konsolidierung zugrunde. Sie formulieren aber ein anspruchsvolleres Konzept als Di Palma, Schmitter oder auch Gunther, Diamandouros und Puhle. Die Bevölkerung muß in ihrem Konzept nicht nur die demokratischen Verfahren und Institutionen als legitim und angemessen anerkennen, sondern darf sich darüber hinaus auch nicht für anti-demokratische Alternativen engagieren. Das Einbeziehen der Einstellung der Bevölkerung liegt nahe, wenn man das Verhalten der Eliten thematisiert, weil anti-demokratische Alternativen natürlich nicht nur von den Eliten vorgegeben sein müssen, um eine Bedrohung für die Stabilität der demokratischen Verfahren darzustellen. Sie können auch als machtpolitische Reaktionen auf Stimmungslagen, Einstellungen und vorhandene cleavages (Konfliktlinien) in der Bevölkerung entstehen. Was bleibt bei der allgemeinen theoretischen Bescheidenheit und den z.T. widersprüchlichen Konzepten der Konsolidierung für die Transformationsforschung? Alle Konzepte benennen Kriterien einer konsolidierten Demokratie. Zum einen weisen die „Democratic Agreements“ im minimalistischen Konzept auf die Bedeutung und Wirkung strategischer Commitments der Eliten hin. Zum anderen tangiert der „twoturnover test“ der maximalistischen Konzeption Problemkreise und Risiken, die sich über die Eliten hinaus auf die Bevölkerung beziehen, institutionelle Dimensionen ausführlich problematisieren und Wechselwirkungen zwischen den Bereichen Kultur und Politik aufgreifen. Dazwischen liegen Konzepte wie das von Schmitter, Gunther, Diamandouros und Puhle oder von Linz, Stepan und Gunther. Sie legen Kriterien für eine stabile Demokratie zugrunde, die sie entlang der Erfahrungen aus der Geschichte der demokratischen Regimewechsel gewonnen haben. Mit dem Verweis auf historische Konsolidierung der politischen Ordnung 174 Erfahrung begründen sie die Relevanz der Kriterien. Allerdings läßt sich nur schwer entscheiden, welche Bedeutung den Kriterien beizumessen ist, und noch viel schwieriger ist der Versuch, sie in eine Rangfolge einzuordnen: Die vielen Kriterien, „... sind weder für die Transformation noch für die Konsolidierung notwendig – und mit Sicherheit reichen sie dafür auch nicht aus.“ (Schmitter 1995: 52). Mit dieser Ambivalenz bringt Schmitter das Dilemma für die Bildung einer von Raum, Zeit und Kultur unabhängigen Transformationstheorie auf den Punkt. Die Entwicklungspfade junger Demokratien vom Autoritarismus oder Totalitarismus über Liberalisierung zur Demokratie sind vielfältig. Deshalb lassen sich problemlos Beispiele finden, die bewährte Kriterienlisten als unzureichend disqualifizieren, und genauso lassen sich historische Beispiele finden, deren demokratische Stabilisierung offensichtlich ist, obwohl bislang als unerläßlich geltende Konsolidierungskriterien7 nicht erfüllt wurden. Besteht das Erkenntnisinteresse der Transformationsforschung allerdings darin, Problemkreise und Risiken der Konsolidierung aufzudecken, dann ist mit einem umfangreichen Katalog relevanter Kriterien viel geleistet. Man kann mit einem zurückgenommenen Anspruch auf eine allgemeine Theorie der Konsolidierung verzichten, womit man dem Entwicklungsstand der Konsolidierungstheorie keinen Abbruch tut. Sie ist eine Wissenschaft, die noch am Anfang ihrer Entwicklung steht (Schmitter 1995: 52)8. Für den Beobachter der Transformation bedeutet dies, daß die spezifischen Prozesse und Hindernisse der Konsolidierung, die jede Demokratie durchläuft, im Vordergrund stehen. Damit gibt man der Diskussion einzelner spezifischer Problemkreise Raum und kann über ihre Bedeutung und Dringlichkeit entscheiden, ohne sie anderen Kriterien unterordnen zu müssen. Dem aktuellen Stand der Transformationstheorie wird Rechnung getragen, wenn im folgenden nicht versucht wird, die relevanten Kriterien und den Zeitpunkt festzulegen, die bestimmen, warum und wann sinnvoll von einer krisenresistenten, demokratischen Konsolidierung ausgegangen werden kann. Die kontroversen Diskussionen bieten vielmehr Anlaß, sich mit den Argumenten und Studien zu den angeschnittenen Problemkreisen ausführlicher auseinanderzusetzen, um zu sehen, wie vielfältig und verwoben der Prozeß demokratischer Stabilisierung ist. In die Vielfalt der Variablen läßt sich eine Systematik bringen: Ursachen für Erfolge und Mißerfolge demokratischer Konsoldierung werden auf verschiedenen analytischen 7 Für eine Liste solcher Kriterien, die traditionell in der Transformationssforschung als wichtig für das Gelingen einer demokratischen Konsolidierung galten, vergleiche Schmitter (1995: 51f). 8 Diese Einschätzung gilt in besonderem Maße für die Transformationsforschung Osteuropas. In einem Überblick über die aktuelle Demokratisierungsliteratur resümieren Kopecky und Mudde: „Eastern European ‚transitology‘ and ‚considology‘ are today still in their embryonic phase, particularly in terms of theory-builing. [...] Consequently an enormous confusion exists within the academic community over what democratic transition and consolidation exactly mean and the wide variety of definitions currently in use ...“ (2000: 519). Konsolidierung der politischen Ordnung 175 Ebenen und unter Berücksichtigung verschiedener Phasenabschnitte identifiziert. Die Einteilung gestattet es, klar umrissene, bereichsspezifische Entwicklungen zu untersuchen. Die analytische Ebene differenziert sich in drei Bereiche: Auf der Makroebene läßt sich nach den Strukturen fragen, die den Ausgangspunkt und die damit die Bedingungen für den demokratischen Wandel bestimmen. Auf der Mesoebene interessieren die Institutionalisierungsprozesse der Demokratie und die Rolle intermediärer Institutionen für die Konsolidierung. Und auf der Mikroebene kann das Thema der Kompatiblität der Einstellungen, Motive und des Verhaltens von Eliten und Bevölkerung mit den demokratischen Institutionen aufgegriffen werden. Mit dieser analytischen Differenzierung können Konsolidierungsprobleme spezifiziert werden. Die Bedingungen der Vergangenheit, die Prozesse der Gegenwart und die Erwartungen für die Zukunft lassen sich für die einzelnen Länder so miteinander in Beziehung setzen, daß rückwirkend Prozesse verstanden werden können und aktuelle Chancen und Risiken für eine gewünschte Entwicklung eingeschätzt werden können. Konsolidierung der politischen Ordnung 176 2. Das Erbe der kommunistischen Regime Die Bedeutung des Erbes der Vergangenheit wird in der Transformationsforschung unterschiedlich eingeschätzt. Für manche Autoren ist es wichtig zu betonen, daß die Konsolidierung nicht durch das institutionelle Erbe determiniert wird: „...I can think at least two reasons why the new democracies should be more alike than the conditions that brought them about. First, timing matters. The fact that recent transitions to democracy occured as a wave also means that they happened under the same ideological and political conditions in the world. Moreover, contagion plays a role. Co-temporarlity induces homogeneity: The new democracies learn from the established ones and from another. Second, our cultural repertoire of political institutions is limited. In spite of minute variations, the institutional models of democracy are very few.“ (Przeworski 1991: 9899)9. Dem steht die Einschätzung gegenüber, daß die politische Ordnung des alten Regimes den Demokratisierungsprozeß prägt (vgl. Glaeßner 1994: 15f; Huntington 1991; Baylis 1998). Es wird argumentiert, daß Erblasten der Vergangenheit als Restriktionen wirken, die die Möglichkeiten der liberalisierenden Maßnahmen, wie die Gewährung bürgerlicher Freiheiten und Rechte, sowie die Inklusionsdimension, die sich auf die Ausweitung partizipatorischer Rechte bezieht, gravierend einschränken (Kraus 1990)10. Dieser Dissens läßt sich auflösen, wenn man erstens klären kann, was mit dem Begriff Erbe in bezug auf die Konsolidierung gemeint ist, und wenn zweitens davon Abstand genommen wird, kausale Zusammenhänge zwischen Strukturen, Institutionen und Akteuren einerseits und einem bestimmten Stabilisierungsgrad andererseits aufdecken zu wollen. Spricht man im Kontext der Transformationsforschung das politische Erbe der post-kommunistischen Gesellschaften an, dann verweist man auf die Besonderheiten der Aufgabenstellung für einen langfristigen demokratischen Umbau. Die alten politischen Strukturen bilden den Ausgangspunkt für die neuen Systeme. Sie bestimmen das Ausmaß des Umbaus, den je nach dem, in welchem Maße zivilgesellschaftliche Ansätze eingeschränkt waren, freie und umfassende Wahlen nicht stattfanden, rechtsstaatliche Garantien vorenthalten wurden und rational-legale Normen der Bürokratie unbekannt waren, ergeben sich Gestaltungsaufgaben für die Konstrukteure des demokratischen Umbaus. Über diese Makrovariablen hinaus, die Minimalanforderungen einer erfolgreichen demokratischen Konsolidierung darstellen (vgl. Linz / Stepan 1996), kann mit dem Verweis auf institutionalisierte Handlungsroutinen sowie bestimmte Eliten und ihre eventuelle Kontinuität danach gefragt werden, inwiefern Meso- und Makrodimensionen 9 Vgl. für eine übereinstimmende Einschätzung auch die von Crawford und Lijphard herausgegebene Studie zum Thema Demokratisierung (1997). 10 Auch die Chancen und verschiedenen Wege ökonomischer Reformprogramme werden auf Merkmale zurückgeführt, die die kommunistischen Regime unterscheiden (vgl. Stark / Bruszt 1998). Konsolidierung der politischen Ordnung 177 als Ressourcen der Etablierung einer stabilen Demokratie dienen bzw. für sie ein Hindernis oder sogar eine Bedrohung darstellen11. Die sich mit dem Verweis auf die unterschiedlichen Analyseebenen andeutende Vielfalt der Variablen induziert einen vorsichtigen Gebrauch deterministischer Aussagen. Die Diskussion des Erbes der post-kommunistischen Gesellschaften kann allerdings eine Systematik der spezifischen Problemkreise für die Konsolidierung dieser Gesellschaften aufzeigen. Die Systematik liegt dabei in den Gemeinsamkeiten, die sich für die Entwicklungspfade und die Aufgaben der Transformation in Rußland und in den ostmitteleuropäischen Staaten aufgrund ihrer ähnlichen Vergangenheit aufzeigen lassen; Gemeinsamkeiten, die besonders in Abgrenzung zu anderen politischen Transformationen in Lateinamerika und Südeuropa deutlich werden. 2.1 Strukturelles Vermächtnis Bezüglich der Makrovariablen politischer Herrschaftsstrukturen wiesen die osteuropäischen Staaten weitgehende Gemeinsamkeiten auf. Der überwiegende Teil der osteuropäischen Staaten (DDR, Bulgarien, Tschechoslowakei, UdSSR) besaß Herrschaftsstrukturen, die sich in vielen bedeutenden Dimensionen ähnlich waren. Ausnahmen bilden Polen und Rumänien. Traditionell hat man in der Transformationsforschung versucht, mit drei Begriffen die existierenden, unterschiedlichen Regimetypen nach ihrer Form der Herrschaftsausübung zu klassifizieren. Neben der Demokratie existierten autoritäre und totalitäre Regime12. Typologien, mit denen man Regime charakterisieren will, müssen sich als analytisch sinnvoll erweisen. Dieser Anspruch hat Bewegung in die Demokratieforschung gebracht. Mitte der 80er Jahre wurde erkannt, daß die drei Kategorien nicht mehr der Heterogenität in den Formen der Herrschaftsausübung gerecht wurden – zu viele verschiedene, nicht-demokratische Regime hätten der Kategorie „Autoritäres Regime“ untergeordnet werden müssen13. Mit der traditionellen Einteilung würden Unterschiede unter 11 Zu den Defiziten der rein akteurtheoretischen Konsolidierungsforschung bemerken Haggard und Kaufmann: „They fail to address the factors that shape actors‘ preferences and capabilities in the first place and the conditions under which they might change over time.“ (1997: 265). 12 Mit diesen Begriffen werden in Anlehnung an Weber (1972: 122f) die politischen Ordnungsformen bzw. Herrschaftsformen bezeichnet, die sich anhand ihrer Legitimität unterscheiden lassen. 13 O’Donnell beispielsweise erweiterte die Kategorien um Variationen des Autoritarismustypus (1986: 4f). Dem bürokratischen Autoritarismus stellt er traditionellen und populistischen Autoritarismus, eine Verbindung aus diesen beiden Typen , einen Autoritarismustypus, der auf institutionalisierter Revolution basiert, sowie Sultanismus (als einen Hybrid all dieser Typen) zur Seite. Damit ist das Spektrum autoritärer Systeme aber noch nicht abgedeckt. O’Donnell nimmt explizit wenig stratifikatorisch ausdifferenzierte Systeme, wie in Kuba und Nicaragua, heraus. Aus dem spezifischen Charakter der Herrschaftstypen versucht O’Donnell Aussagen über mögliche bzw. wahrscheinliche Wege zur Demokratie abzuleiten. Die Vielfalt der Typen verhindert allerdings generalisierende Aussagen, so daß O’Donnell abschließend bemerken muß: „...that there is not nor is there likely to be in the foreseeable future, a vìa revolutionaria open for countries that have reached some minimal degree of stateness and Konsolidierung der politischen Ordnung 178 den Tisch fallen, und die Beobachter könnten nicht mehr die Variabilität der Veränderungen und Entwicklungen der Regime verstehen. Linz und Stepan haben deshalb zwei weitere Typen dem Schema hinzugefügt – posttotalitäres Regime und Sultanismus (1996: 38f). Mit diesen neuen Typen lassen sich wichtige strukturelle Charakteristiken hervorheben, die besonders für die Forschung der osteuropäischen Transformation von Bedeutung sind, weil sich aus ihren Charakteristiken die speziellen Entwicklungspfade und –aufgaben in Abgrenzung zu den Transformationen in Lateinamerika und Südeuropa begründen. Moderne Regimetypen unterscheiden sich in der Klassifizierung nach Linz und Stepans entlang vier konstitutioneller Charakteristiken der Herrschaftsausübung (1996: 44-45)14: „Pluralism“ beschreibt die Toleranz gegenüber Interessen neben den von den staatlichen Institutionen bearbeiteten Themen oder sogar konträr zu ihnen und bezieht sich außerdem auf die Autonomie und Bedeutung organisierter Interessen bzw. alternativer Lebensstile. „Ideology“ gibt Aufschluß über die legitimierende oder/und politikdeterminierende Rolle einer Ideologie in den Regimen. „Mobilization“ beschreibt die Rolle, die der aktiven Unterstützung der Regierungspolitik oder eines Gesellschaftsauftrages durch mobilisierte Teile der Bevölkerung beigemessen wird. Und das letzte Kriterium, „Leadership“, thematisiert den Ort, die Verfahren und die Legitimierung der Herrschaftsausübung. Mit diesen vier Charakteristiken lassen sich die Staaten Osteuropas den nicht-demokratischen Regimetypen zuordnen. Da die Charakteristiken auch strukturelle Eigenschaften demokratischer Regime berücksichtigen, deuten sich in der Ausprägung der Charakteristiken bereits die Demokratiedefizite der osteuropäischen Staaten auf der Makroebene an. In autoritären Regimen gibt es wenig politischen Pluralismus, was sich vor allem an der mangelnden Mitgestaltungsmöglichkeit des politischen Geschehens zeigt. Allerdings gibt es in autoritären Regimen oft mehr oder weniger eingeschänkten sozialen und ökonomischen Pluralismus. Das politische System kommt in der Regel ohne eine ausformulierte und richtungsweisende Ideologie aus, und genauso wenig greift es auf die Unterstützung durch mobilisierte Bevölkerungsteile zurück. Ein Führer oder eine kleine Elitengruppe bildet den Souverän im Rahmen von Normen, die zwar formal nicht ausformuliert werden, aber gut vorhersehbar sind. Für die osteuropäischen Staaten trifft diese Beschreibung teilweise auf Polen zu. Ein totalitäres System konnte dort nie vollständig installiert werden (Linz / Stepan 1996: 255). Zwar wurden oppositionelle Parsocial complexity of capitalist social relations.“ (1986: 10). Das heißt, daß die durch die Herrschaftsstrukturen ermöglichten Transformationspfade nur Möglichkeiten aufweisen, nicht aber über wahrscheinliche Entwicklungspfade informieren. 14 Zu dieser Art der Typenbildung läßt sich kritisch anmerken: „While clearly nuanced and promising, this line of explanatory work has nevertheless suffered from a lack of synthesis, and a general tendency to create as many categories of previous regimes as there are countries studied.“ (Kopecky / Mudde 2000: 527). Konsolidierung der politischen Ordnung 179 teien weder toleriert noch zugelassen, dennoch konnte die katholische Kirche einen Raum relativer Autonomie behaupten, der es Teilen der Gesellschaft ermöglichte, der Ideologie des Regimes zu widerstehen - die Kirche stand für eine ideologische Alternative zum kommunistischen Regime und konnte somit ein Zentrum des Widerstandes bilden (vgl. Micha 1997: 72f). Die Führung wußte um den starken Rückhalt der Kirche in der Gesellschaft, was für sie Grund war, mit der Kirche zu verhandeln und ihr Zugeständnisse einzuräumen. Zu diesem eingeschränkten politischen Pluralismus kam ein zum Teil ausgeprägter ökonomischer Pluralismus. Weite Teile der polnischen Landwirtschaft widersetzten sich der Verstaatlichung, wurden kooperativ betrieben oder verblieben in Privatbesitz, und in den achtziger Jahren erlebten private Firmen - die „zweite Ökonomie“ - einen bedeutenden Aufschwung (vgl. Tatur 1995: 96f). Diese Elemente des limitierten Pluralismus verhinderten die vollständige Penetration durch den Staat wie sie die anderen osteuropäischen Staaten in ihrer totalitären Phase erfuhren. Im Totalitarismus gibt es weder ökonomischen noch sozialen oder politischen Pluralismus - es gibt neben der Parteienherrschaft und -doktrin keinen Raum für eine parallele Wirtschaft oder Gesellschaft (Linz / Stepan 1996: 40f): Die Ideologie spielt eine tragende Rolle im Herrschaftssystem. Die Eliten und Gruppen der Gesellschaft gewinnen aus ihr Legitimität sowie Mission und treffen vor ihrem Hintergrund Entscheidungen. Die Mobilisierung ist umfassend, d.h. große Teile der Bevölkerung sind in staatlichen Organisationen obligatorisch Mitglied. Die totalitäre Führung begründet sich oft charismatisch, herrscht in nicht definierten Grenzen und ist sowohl für Mitglieder als auch für Nicht-Mitglieder in ihren Entscheidungen unberechenbar. Die Rekrutierung zu Führungspositionen hängt von dem Erfolg und dem Engagement in der Parteiorganisation ab. Alle ostmitteleuropäischen Staaten mit Ausnahme Polens haben in der stalinistischen Phase Totalitarismus erfahren, den sie erst nach Stalins Tod überwinden konnten. Im post-totalitären Regime hat eine Bewegung weg vom Stalinismus bzw. ein Prozeß interner Wandlungsprozesse weg vom Totalitarismus eingesetzt (vgl. Linz / Stepan 1996). Die schlimmsten Repressionsformen wurden eingestellt, auch wenn Kontrollmechanismen wie die Staatsicherheit der DDR aufrecht erhalten blieben. Politischer Pluralismus wird zwar weiterhin unterdrückt, eine zweite Wirtschaft und parallele Kultur alternativer Lebensstile können sich allerdings durchaus entwickeln. Obwohl die führende Ideologie der früheren totalitären Phase noch gilt, haben das Bekenntnis zu ihrer utopischen Perspektive bzw. der Glaube an ihre Realisierung nachgelassen. In der parallelen Gesellschaft oder zweiten Kultur wird die offiziell verkündete Ideologie als Lebenslüge verstanden. Im Vordergrund steht jetzt die programmatische Übereinstimmung. Das Interesse der Führung in die Mobilisierung der Bevölkerung läßt nach, und parallel dazu lassen auch Konformität und Übereinstimmung in der Bevölkerung mit den Organisationszielen nach. Zunehmend bestimmen Karrierestreben und Opportu- Konsolidierung der politischen Ordnung 180 nismus das öffentliche Handeln, während die Privatisierung von Werten ein allgemein akzeptierter Zustand wird15. Die Führung legitimiert sich nicht mehr über ihr Charisma und sieht sich sogar mit einer parteiinternen, ansatzweise demokratischen Prüfung konfrontiert. Rekrutiert wird nicht mehr nur aus den eigenen Reihen. Da Sachverstand und Leistung die Ideologie als primäre Legitimitätsgrundlage weitgehend abgelöst haben, können sich die führenden Eliten auch aus den Technokraten des Staatsapparates zusammensetzen16. Linz und Stepan haben diesen Regimetyp eingeführt, weil die osteuropäischen Systeme in der Phase nach Stalins Tod (1953) sich wandelten und nicht mehr sinnvoll in den Kategorien des Totalitarismus beschreiben ließen, aber mit der Ausnahme Polens aufgrund des mangelnden Pluralismus genauso wenig als autoritäre Regime qualifiziert werden konnten. Pluralismus bleibt auch in post-totalitären Regimen signifikant limitiert; die offizielle Partei hat immer noch die alleinige Entscheidungskompetenz. Weil die Änderungen in den Bereichen „Pluralism“, „Ideology“, „Mobilzation“ und „Leadership“ in einem Prozeß – d.h. nicht auf einen Schlag – erfolgen, muß man unterschiedliche Ausprägungen des post-totalitären Typus unterscheiden17. Die Abkehr von totalitaristischer Herrschaft äußert sich primär in der Einschränkung bzw. Prüfung der Führung und der Zulassung zivilgesellschaftlicher Kritik des Regimes. Der Prozeß der Abkehr vom Totalitarismus bleibt an diesem Punkt stehen, wenn alle Kontrollmechanismen des Parteienstaats beibehalten werden wie in der Tschechoslowakei nach 1968 und der DDR nach Ulbricht. Der Prozeß kann aber auch weitergeführt werden, wie in Ungarn, wo ab 1982 tiefgreifende ökonomische Änderungen erfolgten, mit der die staatliche Regulierung eingeschränkt und Privatbesitz nicht nur zugelassen wurde, sondern auch rechtliche Absicherung erfuhr (vgl. Mänicke-Gyöngyösi 1991). Auch im politischen Bereich ging die Abkehr vom Totalitarismus in Ungarn recht weit. Zwar wurden bis 1987 keine oppositionellen Bewegungen oder Parteien zugelassen, auch gab es keine bedeutenden, organisierten Interessengruppen. Innerparteilich wurden allerdings zunehmend Konflikte - auch mit Rückgriff auf gesellschaftliche Unterstützung – ausgetragen (vgl. Mänicke-Gyöngyösi 1991; Tökés 1997). Eine weitere Regimeform ist der Sultanismus (Linz / Stepan 1996: 51f): In ihm bleibt der ökonomische und soziale Pluralismus erhalten, ist aber vor Interventionen des Despoten ungeschützt18. Kein Bereich ist durch Gesetze geschützt. Es gibt zwar keine füh- 15 An dieser Stelle setzt Hirschman den Exit-Voice-Loyality-Mechanismus zur Erklärung des Systemzusammenbruchs an (1993). 16 Vergl. hierzu Holmes Analysen der wechselnden Legitimitätsgrundlagen (1993). 17 Nach Linz und Stepan sind dies 1. „early post-totaltarianism“, 2. „frozen post-totaltarianism“ und 3. „mature post-totaltarianism“ (1996: 46). 18 Linz und Stepan entwickeln den Typus Sultanismus in Anlehnung an Webers Ausführungen zum Patrimonialismus. Bei Weber heißt es: „Mit dem Entstehen eines rein persönlichen Verwaltungs- (und: Militär-) Stabes des Herren neigt jede traditionelle Herrschaft zum Patrimonialismus und im Höchstmaß der Herrengewalt: zum Sultanismus: Konsolidierung der politischen Ordnung 181 rende Ideologie, mit der Entscheidungen gerechtfertigt werden. Dennoch wird der Führer glorifiziert und mit willkürlich gewählten Symbolen und einer Pseudoideologie, der weder intern Glaube noch extern Berechtigung zugesprochen wird, gestützt. Die allgemein niedrige Mobilisierung der Bevölkerung erfolgt durch Zwang, d.h. ohne dauerhafte Organisation. Mobilisiert wird lediglich die Gewalt gegen Oppositionsbestrebungen. Die Führung ist stark auf die Person des Sultans konzentriert und ihre Legitimation ist willkürlich. Es gibt keine gesicherten Karrierepfade. Das Personal rekrutiert sich aus dem Familien- oder Freundeskreis sowie aus Verbündeten, die sich in der Unterstützung des Regimes – i.d.R. mit Gewalt - bewährt haben. Die Unterordnung qualifiziert für eine Position, und sie erfolgt aus Angst und auf der Basis von Belohnung. Der Typus Sultanismus trifft teilweise auf Rumänien vor 1989 zu19. Ceausescu war seit seinem Führungsantritt 1965 damit beschäftigt, seine Machtbefugnisse auszubauen. Bis Mitte der 70er Jahre konnte er einen hochgradig personalisierten, uneingeschränkten und willkürlichen Führungsstil etablieren. Familienmitglieder besetzten Machpositionen, keiner war vor persönlichen Übergriffen geschützt, und Kritik wurde so brutal unterdrückt, wie in keinem anderen osteuropäischen Land. Eine zweite Kultur konnte sich wegen der umfassenden Kontrolle nicht bilden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Staaten Osteuropas wurden in Rumänien keine liberalisierenden Reformen angestrengt. Ansätze der Reformpolitik, wie sie sich in Polen, Ungarn, aber vor allem auch der SU mit Gorbatschows Perestrojka und Glasnost beobachten ließen, wurden ebenso wie die Unterordnung unter den Hegemon SU abgeblockt (vgl. Gabanyi / Henya 1994). Deshalb war auch die Anzahl unabhängiger sozialer Bewegungen in keinem Land so niedrig wie in Rumänien (vgl. Linz / Stepan 1996: 352). Zwar nahm die Ideologie des MarxismusLeninismus eine führende Rolle ein, dennoch wurde ihre Auslegung durch Ceausescu zunehmend widersprüchlich und opportunistisch bzw. dem vorherrschenden Nationalismus untergeordnet, was für ein sultanistisches Regime typisch ist. In der Dimension die „Genossen“ werden nun erst recht zu „Untertanen“, das bis dahin als präeminentes Genossenrecht gedeutete Recht des Herren zu seinem Eigenrecht, ihm in (prinzipiell) gleicher Art appropriiert wie irgendein Besitzobjekt beliebigen Charakters, verwertbar (verkäuflich, verpfändbar, erbteilbar) prinzipiell wie irgendeine wirtschaftliche Chance. Äußerlich stützt sich die patrimoniale Herrengewalt auf (oft: gebrandmarkte) Sklaven- oder Kolonnen- oder gepreßte Untertanen- oder - um die Interessengemeinschaft gegenüber den letzteren möglichst unlößlich zu machen – Sold- Leibwachen und –Heere (patrimoniale Heere). Kraft dieser Gewalt erweiterte der Herr das Ausmaß der traditionsfreien Willkür, Gunst und Gnade auf Kosten der patriachalen und gerontokratischen Traditionsgebundenheit. Patrimoniale Herrschaft soll jede primär traditional orientierte, aber kraft vollen Eigenrechts ausgeübte, sultanistische eine in der Art ihrer Verwaltung sich primär in der Sphäre traditionsungebundener Willkür bewegende Patrimonialherrschaft heißen“ (1972:133-134). Zwang und willkürliche Legitimation (nicht einmal traditionsgebunden) der Führung sind hier die zentralen Charakteristiken, die Linz und Stepan übernommen haben. Eine solche Beschreibung kann aber keineswegs beanspruchen, die primären Merkmale aller osteuropäischen, kommunistischen Gesellschaften benannt zu haben – wie beispielsweise bei Glaeßner (1994: 23f) unterstellt wird. Die poststalinistischen Gesellschaften legitimierten sich über ihre Ideologie, und die Person des Führers verlor sowohl an Macht als auch an Bedeutung. Beim Sultanismus handelt es sich vielmehr um einen Spezialfall, der nur auf die extremen Bedingungen in Rumänien vor 1989 paßt. 19 Das rumänische Regime wird von Linz und Stepan als „Totalitarianism-cum-Sultanism“ typisiert (1996: 344f). Konsolidierung der politischen Ordnung 182 der Mobilisierung entsprach das Regime eher dem totalitären Typus, weil bis zuletzt umfangreiche Mobilisierungen von allen möglichen Organisationen, die das Regime zu feiern hatten, eingefordert wurden (vgl. Linz / Stepan 1996). Mit den vier konstitutionellen Charakteristiken der Regimetypen – „Pluralism“, „Ideology“, „Leadership“ und „Mobilization“ – läßt sich auf institutionelle Merkmale verweisen, die direkt den Charakter der politischen Machtausübung und indirekt (meist) die Ordnung in den anderen gesellschaftlichen Teilbereichen bestimmen. Man kann die Herausforderungen, die aus spezifischen Herrschaftsstrukturen erwachsen, nur verstehen, wenn ihre institutionellen Auswirkungen deutlich werden. Deshalb muß man nach den institutionellen Handlungsroutinen fragen, mit denen strukturelle Merkmale durchgesetzt und etabliert wurden. Um die Bedeutung des strukturellen Erbes zu verstehen, müssen derartige Implikationen der Makrostukturen auf der Mesoebene erläutert werden. Erst die institutionellen Spezifika struktureller Kennzeichnungen verdeutlichen, welche Last der Vergangenheit, aber auch welche Besonderheiten der einzelnen Länder die Entwicklung hin zu einer konsolidierten Demokratie mitbestimmen. Die institutionellen Spezifika in einer strukturellen Bestimmung bilden das Fundament der Makrostrukturen der Regime. Sie beschreiben den Charakter der Macht- und Herrschaftsbeziehungen in dem Regime, weil sie die mit dem Charakter des Regimes verbundenen Handlungsroutinen kennzeichnen; (intermediäre) Institutionen reflektieren und regulieren den Grad des zugelassenen Pluralismus, über (Bildungs-)Institutionen wird die Ideologie und deren Bedeutung vermittelt, Institutionen bestimmen den Zugang zu sowie Umfang bzw. Beschränkung von Führungspositionen, und der Grad der Mobilisierung spiegelt einen wichtigen Aspekt der institutionalisierten Beziehung zwischen der Führung und der Bevölkerung wider. Anhand der Institutionen läßt sich die für die Demokratisierung maßgebliche regimespezifische Differenz zu demokratischen Strukturen verdeutlichen. Es sind die etablierten Handlungsroutinen und -regulierungen, die in einer Demokratisierung durch Prozesse des institutionellen Umbaus bzw. Aufbaus überwunden werden müssen. Die institutionellen Charakteristika büßen ihre Selbstverständlichkeit ein, die die strukturelle Stabilität der Macht- und Herrschaftsbeziehungen sicherte; die alten Beziehungsmuster und Handlungsroutinen werden in dem strukturellen Wandel in Frage gestellt, abgeschafft oder umgebaut (vgl. Nedelmann 1995). Im Streben nach einer konsolidierten Demokratie werden alle Regime institutionelle Mindeststandards anvisieren, die 1.) zivilgesellschaftliche Strukturen tolerieren und unterstützen, 2.) freien und umfassenden Wettbewerb in politischen Wahlen erlauben, 3.) rechtsstaatliche Sicherheiten garantieren, 4.) die Bürokratie rational-legalen Normen unterwerfen und die 5.) ein gesetzliches Regelwerk bereitstellen, das den Markt rechtlich absichert. Konsolidierung der politischen Ordnung 183 Auch wenn man Polen und Rumänien teilweise ausnehmen muß, so läßt sich doch mit Linz und Stepan entlang ihrer Regimetypen argumentieren, daß die meisten kommunistischen Länder den Totalitarismus in der letzten Dekade vor dem Zusammenbruch überwunden hatten und damit dem post-totalitären Typus zuzuordnen sind (1996: 244f). Mit Rückgriff auf die Regimecharakteristika ist daher ein in den vier Dimensionen gemeinsamer Katalog der strukturellen Problemstellung post-kommunistischer Staaten bei der Demokratisierung aufgestellt. Dieser Katalog erweitert sich mit einem zusätzlichen strukturellen Vermächtnis, das besonders die multinationalen bzw. multiethnischen Staaten Osteuropas bewältigen müssen. Das Erbe des österreich-ungarischen und sowjetischen Imperiums sowie der Expansionismus Nazi-Deutschlands und der Sowjetunion haben zu einer vielfachen Neuzeichnung von Staatsgrenzen in Osteuropa geführt. Dieses Erbe wird erst mit der Demokratisierung zu einem Problem. Unter den nicht-demokratischen Regimen wurden den Minderheiten keine Teilnahmerechte am politischen Prozeß eingeräumt, was nichts Besonderes war, da die gesamte Bevölkerung auf politische Rechte verzichten mußte. In einem demokratischen Regime hingegen muß sich die staatliche Autorität legitimieren, um kollektive Ziele bindend durchsetzen zu können. Die Interessen aller von den Staatsgrenzen umfaßten Bürger müssen berücksichtigt werden, weil ein moderner demokratischer Staat auf der Partizipation seiner Bürger beruht. Die Politik muß inklusiv sein, d.h. darf nicht systematisch bestimmte Gruppen ausschließen oder benachteiligen. Mit der kollektiven Identität, die sich auf ethnisch-nationale Traditionen stützte, lagen alternative Symbole im Widerstand gegen die Unterdrücker bereit. Die ethnische Symbolik bot eine „saubere Identität“, mit der die Distanz zum alten Regime hervorgehoben werden konnte (Offe 1994: 155). Aus dieser Tendenz des östlichen Nationalismus können Probleme für Demokratien in Transformationsprozessen entstehen. Der Begriff der Nation verweist auf gemeinsame Werte, die eine einheitsstiftende Solidarität der Gruppe garantieren. Die Staatsgrenzen Osteuropas sind nun aber so gezogen, daß sie oftmals nicht den nationalen Grenzen entsprechen. Der Grad der nationalstaatlichen Homogenität war besonders in den Föderationen (Sowjetunion, Tschechoslowakei, Jugoslawien) gering20. Hier sind ethnische Konflikte vorgezeichnet, oder es bietet sich zumindest die Möglichkeit für lokale Eliten, Konflikte für ihr politisches Interesse zu instrumentalisieren. Unterschiedlichste und zum Teil auch in Konflikt miteinander stehende Werte verbinden verschiedene Gruppen innerhalb eines durch Staatsgrenzen umfaßten Territoriums oder Gruppen, die sich über Staatsgrenzen hinweg traditionell miteinander verbunden fühlen (vgl. Foster 1995). Diese Staaten haben ein „Stateness-Problem“ (Linz / Stepan 1996: 16): Territorialität und politische Community fallen ausein20 Aus diesem Umstand wird z.T. auch versucht, die unterschiedlichen Ergebnisse der Transformation Osteuropas zu erklären (vgl. Vachdová / Suyder 1997). Konsolidierung der politischen Ordnung 184 ander, oder es bestehen Differenzen darüber, wem bürgerliche Rechte in dem Staatsgebiet zugestanden werden, weil es Differenzen bezüglich der territorialen Grenzen des Staates gibt, oder weil sich nicht konfliktfrei bestimmen läßt, wer Bürger in dem Staat ist. Die Sowjetunion bzw. Rußland geben ein besonders anschauliches Beispiel für das „Stateness-Problem“. Der sowjetische Föderalismus bildete ein prinzipiell konfliktträchtiges, strukturelles Erbe (Linz / Stepan 1996: 368): Das Staatsterritorium umfaßte eine Vielzahl von Territorien mit nationalstaatlichen Identitäten. Der sowjetische Föderalismus förderte aber keineswegs die Integration des multinationalen Staates. Vielmehr schuf er die Basis für eine Politisierung von Ethnizität21. In der Föderation konnten die Republiken der SU zwar kulturelle Eigenarten bewahren und nationale Interessen vorantreiben. Von den Schlüsselstellen der Macht im zentralen Parteienregime aber, wo die wichtigen Entscheidungen gefällt wurden, waren die meisten nicht-russischen Nationalitäten ausgeschlossen – womit Rußland seine „imperialen Vorstellungen“ (Glaeßner 1994: 59) zu verwirklichen suchte. Die Zentrale gab die Ideologie vor und managte die wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten der Republiken. Als sich dann das sowjetische Föderationssystem aus der Elite heraus entlegitimierte und damit der Parteienstaat seine Kontrolle über die Föderation zu verlieren begann, gab es aufgrund der Erfahrungen mit der Zentrale genug Anreize und die Möglichkeit, Ressourcen zu mobilisieren, um Ethnizität zu einem politischen Thema zu erheben, was letztendlich zu dem Zerfall der SU führte. Der Prozeß des Zerfalls ist mit der Abspaltung der baltischen und zentralasiatischen Staaten nicht abgeschlossen. Weiterhin wird die staatliche Integrität Rußlands bedroht bzw. wird die Demokratisierung der Nachfolgestaaten der SU von ethnischen Konflikten und ethno-strategischer Politik der Führung aufgehalten. Das gleiche gilt natürlich für die Nachfolgestaaten des föderalen Jugoslawiens Titos. Das Stateness-Problem besonders der osteuropäischen Föderationen spezifiziert die Problemlage für die Demokratisierung entlang der Heterogenität bzw. Homogenität der Staaten. Eine weitere Spezifizierung erfolgt mit der differenzierten Betrachtung der Art des Regimewechsels in den osteuropäischen Staaten. Für den Beobachter der Konsolidierung bildet zum Zeitpunkt des Regimeumbaus die Art, in der sich der Regimewandel vollzog, Teil der Bestandsaufnahme der strukturellen Ausgangsbedingungen (vgl. Huntington 1991)22. Ihn interessiert, auf welchem Wege 21 Die Politisierung von Ethnizität setzt voraus, daß singuläre ethnische Identitäten nicht gegeben sind, sondern konstruiert werden. Prinzipiell sind multiple Identitäten, die vor einer Polarisierung schützen, möglich. 22 Diese Betrachtungsweise muß nicht der These der vorliegenden Arbeit widersprechen, daß für die Analyse des Zusammenbruchs (als Teil des Wandels) eine Mehrebenenanalyse geeignet ist. Ist die Art des Zusammenbruchs auch nicht nur auf Strukturen zurückzuführen, sondern ebenso von den Konsolidierung der politischen Ordnung 185 sich die Ablösung des nicht-demokratischen Regimes vollzog; beispielsweise läßt sich fragen, ob das kommunistische Regime in einem Prozeß langsamer Änderungen und auf dem Verhandlungswege überwunden wurde, oder ob das kommunistische Regime einfach in sich zusammenbrach. Zu diesen Vorgängen, die in der Literatur als Erosion bzw. Implosion oder Kollaps bezeichnet werden, kommt noch eine weitere Möglichkeit, bei der der Systemwechsel unter der Führung der alten Kader aus der zweiten Reihe erfolgt (v. Beyme 1994: 94f). Das Merkmal, anhand dessen sich die unterschiedlichen Formen des Regimewandels unterscheiden lassen, ist die Zusammensetzung der am Transformationsprozeß beteiligten Akteure23. Die Zusammensetzung entschied, welche Strategien bei dem Übergang berücksichtigt wurden. Je nach Grad der Beteiligung unterschiedlicher Akteure gewinnt der Regimewechsel eine spezifische Struktur. Als Akteure kommen Mitglieder oder Gruppierungen sowohl der Regierung als auch der Opposition in Frage. Die Akteure des Regimewechsels können sich dementsprechend entweder nur aus der Elite zusammensetzen, nämlich dann, wenn die Regierung der Opposition überlegen ist. Dies war der Fall in Ungarn, der SU und zeitweise auch in Bulgarien. Oder die Akteure des Regimewechsels rekrutieren sich primär aus der Opposition, die die Führung übernimmt, nämlich dann, wenn die Opposition der Regierung überlegen ist. So geschehen in Rumänien und der DDR. Als weitere Möglichkeit könnte der Regimewechsel durch eine gemeinsame Aktion (Pakt) von Regierung und Oppositon bewerkstelligt werden. Dies war vor allem der Fall in Polen und der Tschechoslowakei. Huntington bezeichnet diese drei möglichen Regimewechsel („transitions“) in der oben vorgestellten Reihenfolge als „transformation“, „replacement“ und „transplacement“ (1991: 109f). Wie es zu diesen drei unterschiedlichen Formen der „transition“ kommen konnte, ist zwar eine Kernfrage für das Verständnis des Zusammenbruchs, für den Erfolg der Konsolidierung ist diese Frage aber unerheblich. Lediglich die Zusammensetzung der beteiligten Akteure ist für den Prozeß der Demokratisierung entscheidend – sie bildet eine Ausgangsbedingung für die Konstruktion demokratischer Institutionen24. Darüber, wie sich der Zusammenhang von der Art des Regimewechsels und einer erfolgreichen deInteraktionen der beteiligten Akteure abhängig, so hinterläßt sie doch Strukturen, an die in der Phase des Umbaus angeknüpft werden muß. 23 Die Akteure konnten im Prozeß des Zusammenbruchs durchaus wechseln. Dennoch widerspricht die Bedeutung, die der „Art des Regimewechsels“ hier zugewiesen wird, nicht der Dynamik wechselnder politischen Akteure im Transformationsprozeß. Es wird nicht etwa ein statisches Konzept der Charakterisierung des Zusammenbruchs impliziert (wie beispielsweise bei Karl und Schmitter 1991), bei dem vereinfachend bestimmten Akteuren oder einer bestimmten Gruppe von Akteuren die Regie des Zusammenbruchs und Wechsel zugeschrieben wird. Vielmehr geht es darum zu verstehen, daß es durchaus Unterschiede in der Dynamik des Wechsels gab, die ein unterschiedliches Set an entscheidungsrelevanten Akteuren hinterlassen haben, das die Akteurskonstellation bestimmt, von der aus die Konstruktion demokratischer Institutionen startet. 24 Welsch argumentiert, daß nicht die Art des Regimewechsels, sondern die Bereitschaft zu verhandeln, Kompromisse einzugehen einen entscheidenden Einfluß auf die Stabilisierungschancen der neuen Demokratie hat (1994): Verhandlungen und Kompromisse bilden fruchtbare Mittel der Konfliktlösung bei der Einführung neuer Institutionen. Konsolidierung der politischen Ordnung 186 mokratischen Konsolidierung gestaltet, bestehen allerdings unterschiedliche Meinungen. O’Donnell und Schmitter (1986) glaubten, auf dem Hintergrund der Erfahrungen mit den südamerikanischen und südeuropäischen Regimewechseln die institutionellen Ergebnisse als Resultat der Akteursstrategien identifizieren zu können. Damit sahen sie einen starken, deterministischen Zusammenhang zwischen den Eigenschaften des Übergangs und des neuen Regimes. Das zeigte sich besonders bei der „ruptura pactada“ dem verhandelten Übergang - in Abgrenzung zum Kollaps eines Systems. Erfolgreiche Regimewechsel und Demokratisierungen waren Ergebnis von Pakten bzw. Verhandlungen. Politisch bedeutete dies, daß die prodemokratischen Kräfte vorsichtig zu taktieren hatten. Sie mußten sich auf Konzessionen im Tausch für Demokratie einlassen. So war vorgezeichnet, daß die institutionellen Ergebnisse eines verhandelten Regimewechsels tendenziell konservativ sind. Dem entgegen argumentiert Przeworski (1991: 67f), daß Übereinkünfte, wie sie in Pakten getroffen werden, inhärent instabil sind: Werden beispielsweise „konservierende“ Garantien als Konzessionen eingeräumt, wie in Polen ab Juni 1989, wo 65% der Sitze im Sejm den Kommunisten garantiert wurden, so sind diese keineswegs vor Änderungen in dem demokratischen Regime geschützt. Das Beispiel Polens zeigt, daß die Modalitäten des Regimeübergangs zwar Spuren hinterlassen können. Es zeigt aber auch, diese Spuren werden mit der Zeit in dem Prozeß der Institutionalisierung der Demokratie verwischt. Daher kann die Art des Regimewechsels nicht darüber informieren, welche demokratischen Institutionen aus ihren spezifischen Akteurskonstellationen folgten. Allerdings informiert die Zusammensetzung der Akteure über die Ausgangsbedingung für den institutionellen Umbau. Mit ihr sind neben den Variablen „Regimetyp“ und „Nationale Identität“ (bzw. „Stateness“) die Constraints für die ersten Schritte einer demokratischen Konsolidierung gesetzt. Die Art des Regimewandels kann über Partizipation und Organisationsgrad von Opposition und Bürgern Auskunft geben, sie kann darüber informieren, ob es einen Einfluß des alten Regimes gibt, oder sie kann Einsicht geben, ob das demokratische Regime sich mit Kräften auseinander setzen muß, die sich eine Kontinuität der Herrschaft wünschen. 2.2 Institutionelle Defizite Für die Einrichtung demokratischer Institutionen ergab sich insbesondere aus den politischen Herrschaftsstrukturen eine Herausforderung. Mit den Charakteristiken des jeweiligen Regimetyps manifestierten sich in Osteuropa Institutionen und institutionelle Defizite, die besondere Schwierigkeiten für die Institutionalisierung der Demokratie bildeten: Konsolidierung der politischen Ordnung 187 Erstens wurden in post-totalitären Regimen zivilgesellschaftliche Strukturen - vom Staat unabhängige Organisationen und Gruppen - kaum zugelassen. Ganz im Gegenteil. Interessengruppen wie Gewerkschaften, Kollektive und Vereine wurden oftmals in der totalitären Phase aufgebaut und auch in der post-totalitären Phase weiterhin von der Partei kontrolliert (vgl. v. Beyme 2000; Croissant / Merkel 2000; Mänicke-Gyöngyösi 1996). In der UdSSR, aber auch der DDR, Tschechoslowakei sowie in Rumänien und Bulgarien ging die Kontrolle sogar so weit, daß die Interessengruppen unter der Beobachtung der Geheimdienste standen, womit eine aktive Rolle ihrer Führer in der Transformation unmöglich wurde. Aus der Integration der Interessengruppen in den Staatsapparat folgt eine ganz besondere Schwierigkeit bei der Etablierung demokratischer Strukturen (Linz / Stepan 1996: 245): Die Integration von Kollektiven und Gewerkschaften einerseits und der politischen Zentrale andererseits hatte auch eine materielle Dimension. Die Partei veranlaßte Subventionierungen und Prämien, die letztendlich den Arbeitern, Bauern und Bürokraten zugute kamen. Akteure, die von solchen Vorteilen profitierten, sträubten sich oftmals gegen zunehmende Autonomie – ihre Sorge war es nämlich, ihre materielle Sicherheit gegen eine vage Alternative in der neuen marktorientierten Demokratie einzutauschen. Zweitens findet die Installation des freien Wettbewerbs in politischen Wahlen in den post-kommunistischen Gesellschaften seine besondere Herausforderung darin, daß die Politiker nicht wie in anderen modernen demokratischen Gesellschaften unabhängige Gruppen repräsentieren (Linz / Stepan 1996: 245): Unabhängige Unternehmergruppen oder Gewerkschaften gilt es erst noch gegen die zuvor genannten Schwierigkeiten zu etablieren. Außerdem müssen sich politische Parteien gegen die negativen Konnotationen und Assoziationen durchsetzen, die sie von der Führungspartei der kommunistischen Gesellschaft geerbt haben und die mit dem Begriff Partei verbunden werden (vgl. Elster / Offe / Preuss 1998: 132f; Segert 1997)25. Bezeichnenderweise gehörten Führer wie Walesa, Havel und Jelzin auch keiner Partei an. Zu dem Mangel an Parteien und anderen staatsunabhängigen Interessengruppen kommt der Mangel an ausformulierten, konkurrierenden politischen Programmen, die für eine Wettbewerbsdemokratie essentiell sind, wenn sie nicht Gefahr laufen soll, daß sekundäre Themen wie Ethnizität und Religion aus Machtgesichtspunkten instrumentalisiert werden. Parteien müssen die zentralen sozialen cleavages politisch übersetzen, damit ein stabiles Parteiensystem entstehen kann. Stabile Parteiensysteme können allerdings eine marktwirtschaftliche Demokratie nur stabilisieren, wenn sie nicht ethnische Konfliktlinien oder cleavages zwischen Gewinnern und Verlieren der Transformation repräsentieren, sondern eine regulierte Arbeit-Kapital-Konfliktlinie widerspiegeln (vgl. 25 Auffällig ist, daß sich kaum eine der bedeutenden Bewegungen Osteuropas Partei nennt. Bevorzugt werden Begriffe wie Forum, Front oder Kraft (vgl. für eine Übersicht über die Parteienlandschaft in den ostmitteleuropäischen Staaten: Segert 1997). Konsolidierung der politischen Ordnung 188 Merkel 1997: 347f)26. Die Vertretung der Arbeiterinteressen kann für die „sozialverträgliche Gestaltung“ des Übergangs ausgesprochen wichtig sein (vgl. v. Beyme 1997), während ethnische Konfliktlinien beispielsweise die nationalstaatliche Integrität bedrohen können, die eine institutionelle Vorbedingung demokratischer Konsolidierung darstellt. Das strukturelle Erbe staatssozialistischer Modernisierung besteht aber zum überwiegenden Teil gerade darin, daß die Konfliktlinie Arbeit-Kapital systematisch durch die des Privateigentums verdrängt wurde (vgl. Segert 1997: 73), daher bestand vorerst kein Bedarf einer solchen Interessenvertretung. Drittens war die Führung totalitärer Regime dem demokratischen Rechtsstaat fundamental entgegengesetzt, weil sie Macht in undefinierten Grenzen ausübte. Mechanismen der Selbstbindung, wie sie moderne Verfassungen darstellten (vgl. Elster 1988b; Rüb 1995), wurden der Ideologieauslegung und Parteiinterpretation geopfert. Auch im PostTotalitarismus gab es keine Rechtssicherheit für die Bürger. Lediglich Prozeduren zur Einschränkung der Führung und zur Beschneidung der Kontrolle anderer Parteieliten wurden ausgebaut (vgl. Linz / Stepan 1996: 249). Im Gegensatz zu vielen autoritären Gesellschaften kann in den osteuropäischen Staaten daher nicht auf Rudimente einer Verfassungskultur mit selbstbindendem Charakter zurückgegriffen werden27. Sie gilt es erst noch aufzubauen. Viertens kann das Erbe des bürokratischen Apparats post-kommunistischer Gesellschaften für die Bürokratisierung ein besonderes Problem darstellen (vgl. v. Beyme 1994: 175f.). Einerseits sind die Bürokraten nach politischen Kriterien des alten Regimes rekrutiert worden. Das kann die Effektivität der Politik einschränken, wenn die Umsetzung politischer Entscheidungen des neuen Regimes durch eine den Wechsel überdauernde Bürokratie blockiert wird. Außerdem verlangt die Tendenz totalitärer bzw. post-totalitärer Regime, ihre Bürger auszuspionieren, aus Legitimitätsgründen in einem gewissen Rahmen nach Säuberungsprozessen. Besonders problematisch ist dabei, daß nicht etwa Geheimdienste, die mit dem neuen Regime abgeschafft wurden, die Bürger ausspionierten – wie in den meisten autoritären Regimen -, sondern in einem weiten Umfang die Bürger selbst. Aufklärung und Säuberungen der Vergangenheit können daher umfassende gesellschaftliche Konflikte provozieren (vgl. Offe 1994; v. Beyme 1994: 185f). Andererseits kann auch die Entlassung loyaler Bürokraten die Effektivität bedrohen – wer soll die administrativen Vorgänge sonst bewerkstelligen? Je 26 Lipset und Rokkan (1967) führen in ihrer Theorie sozialer Konfliktstrukturen aus, wie sich entlang vier sozialer Konfliktlinien (Zentrum / Peripherie; Kirche / Staat; Stadt / Land; Arbeit / Kapital) in den westlichen Gesellschaften Koalition großer Gruppen, Eliten und Parteien gebildet haben. Konfliktlinien bilden also die Basis für die Ausdifferenzierung parteipolitischer Positionen. 27 Eine Ausnahme bildet evtl. Polen. Michta (1997) argumentiert, daß die Erfahrungen Polens mit einem funktionierenden demokratischen System in der Zwischenkriegszeit (1918-39) auch während und nach der Phase des kommunistischen Regimes mit dem Ideal eines souveränen, politischen Staates verbunden wurde – ein Ideal politischer Partizipation, des Parlamentarismus und der Parteienpolitik, das an die Nachkriegsgenerationen weitergegeben wurde. Konsolidierung der politischen Ordnung 189 mehr Staat und Partei eine Einheit bilden, desto stärker ist die Funktionsfähigkeit der Bürokratie vom Zusammenbruch der Partei betroffen (Linz / Stepan 1996: 250f). Fünftens ergeben sich aus dem Erbe Problemstellungen für die Einführung einer rechtlich abgesicherten Marktwirtschaft: Das Erbe der totalitären und auch der post-totalitären Regime ist besonders problematisch, weil nahezu das gesamte Regelwerk einer freien Marktwirtschaft neu installiert werden muß (vgl. Clague / Rausser 1992; Clague 1992). Wie konfliktgeladen solche Prozesse sein können, zeigt sich an der Diskussion, die sich um die Einführung von Eigentumsrechten entbrannt hat (vgl. Bönker / Offe 1994)28: Welcher Zeitpunkt gilt als legitime Referenz für die Zuteilung von Besitz - die vorkommunistische oder vielleicht die Zeit vor dem 2. Weltkrieg? Oder, wie lassen sich konfligierende Kriterien bezüglich der Gerechtigkeit und Effizienz bei der Wiederherstellung von Eigentum lösen? Neben diesem Katalog allgemeiner institutioneller Herausforderungen post-kommunistischer Regime für die Demokratisierung, der sich aus den institutionellen Dimensionen der politischen Herrschaftsausübung ableiten läßt, führen institutionelle Spezifika einzelner Länder zu Variationen, die sich auf die Spezifika des Regimetypus zurückführenlassen. Das gilt insbesondere für Polen und Rumänien: Für Polen bedeutete der zwar stark limitierte, aber dennoch vorhandene Pluralismus zur Zeit des kommunistischen Regimes eine Begrenzung der Macht von Führung und Partei in Wirtschaft und Politik. Der Pluralismus ermöglichte im ökonomischen Bereich ein rasche und erfolgreiche Privatisierung und im politischen Bereich die ausgehandelte Transformation (Pakt) zwischen Opposition und Führung. Letzteres muß für die politische Konsolidierung nicht unbedingt als Vorteil verstanden werden. Ein verhandelter Übergang verlangt nach Eingeständnissen und Garantien, die den radikalen Bruch mit der Vergangenheit verhindern – die kommunistische Führung kann sich Machtressourcen und damit Einflußchancen sichern (Huntington 1991; O’Donnell / Schmitter 1986; Przeworski 1991: 78). Ein weiteres systematisches Problem für die Entwicklung einer „Political Society“ (dem regulierten gesellschaftlichen Konflikt in demokratisch legitimierten institutionellen Bahnen) war in dem Charakter der Opposition angelegt. Die Opposition gegen den Parteienstaat wurde als „moralischer Diskurs der Wahrheit“ (vgl. Tatur 1991) geführt. Das Erbe dieses Oppositionscharakters ist eine antipolitische Einstellung zugunsten einer ethischen Zivilgesellschaft, die demokratischen Werten widerspricht und sich in einer Parteienlandschaft widerspiegelt, die u.a. durch religiöse cleavages (vgl. Merkel 1997; v. Beyme 1997) geprägt ist. Der demokratische Wettbewerb verlangt nach der Repräsentation konkurrierender Interessen und nicht nach einem ethischen Diskurs. Selbst die bedeutendste Oppositionskraft, die Gewerkschaft 28 Zur Problematik der Restitution von Eigentum vgl. Mansfeldová (1996) zu Tschechien und Jarosz und Weber (1996) zu Polen. Konsolidierung der politischen Ordnung 190 Solidarnosc, formulierte kein interessenbasiertes Programm und war darüber hinaus wie die gesamte Interessenlandschaft Polens stark fragmentiert (Mitcha 1997)29. In Rumäniens totalitärem Sultanismus gab es nicht wie in Polen einen limitierten politischen Pluralismus (vgl. Gabanyi / Hunya 1991). Für einen ausgehandelten Übergang zur Demokratie fehlten deshalb auch die relevanten Akteure – weder gab es friedliche demokratische Gruppen einer Zivilgesellschaft oder demokratische Oppositionsgruppen, noch gab es innerhalb der Führung die Möglichkeit, Reforminteressen zu vertreten. Die Abrechnung mit dem alten Regime fiel heftig aus. Das Regime hinterließ eine vollkommen abgeflachte politische und soziale Landschaft (Linz / Stepan 1996: 344f). Zögerliche oppositionelle Ansätze brachten keine programmatische Kampagne zustande, die in der Lage gewesen wäre, die kommunistischen Kader an der Führung abzulösen. Rumänien bildet eine gutes Beispiel dafür, wie ethnische cleavages die demokratische Konsolidierung verhindern bzw. verzögern können, wenn sie politisch mobilisiert werden (Merkel 1997: 349). Nationalstaatliche, chauvinistische Themen sind weiterhin bestimmende Politikinhalte. Die demokratische Opposition wurde durch die Übertreibung der Bedrohung der nationalen Identität – wie sie auch schon unter Ceausescu üblich war – aufgespalten (vgl. Gabanyi / Hunya 1994: 80f): Die Bedrohung sollte nämlich besonders von der ungarischen Minderheit ausgehen, deren Partei - die Ungarische Demokratische Allianz - zuvor eine wichtige Kraft in der Demokratisierungsbewegung darstellte. Selbst bei den zweiten Wahlen 1995 konnte noch kein politischer Führer, der nicht in der kommunistischen Partei Karriere gemacht hätte, Macht gewinnen30. Rumänien war das osteuropäische Land, das mit Blick auf die Mindeststandards einer konsolidierten Demokratie am weitesten von der Demokratie entfernt war31 (Linz / Stepan 1996: 344f): Die Zivilgesellschaft bleibt schwach, politischen Wettbewerb mit einer echten Regierungsalternative gibt es nicht, der Rechtsstaat hat gravierende Mängel besonders im Minderheitenschutz, eine Reform der Staatsbürokratie gab es nicht, und marktwirtschaftliche Strukturen gilt es erst noch aufzubauen. Bevor aber marktwirtschaftliche und demokratische Institutionen etabliert werden können, muß das „Stateness-Problem“ gelöst werden. Die Konsolidierung nationaler Grenzen ist eine Vorbedingung für die erfolgreiche Einführung demokratischer Institutionen (vgl. Dahl 1989; v. Beyme 1994: 144f, 1997: 25f; Schmitter 1995a, 1995: 49; Linz / Stepan 1996: 16f). Dieser Aufgabe, der Schaffung einer national-staatlichen Integrität, 29 Von Beyme bezeichnet das Parteiensystem von Regimen im Systemwechsel zutreffend als geprägt von „Taxi-Parteien um einzelne Führer, deren Mitglieder in einem Taxi Platz hatten“ (1997: 37). 30 Zur Kontinuität alter Parteien des gewandelten Regimes – und insbesondere für den Fall Rumänien vergleiche von Beyme (1997: 50). 31 Trotz dieser Rückschrittlichkeit wird das gegenwärtige Regime von der Bevölkerung als eine substantielle Verbesserung gegenüber dem Regime unter Causescu empfunden. Linz und Stepan führen diesen Widerspruch auf die allgegenwärtige Angst vor Interventionen im privaten und öffentlichen Leben, die im totalitär-sultanistischen Regime verherrschte, zurück (1996: 364f). Konsolidierung der politischen Ordnung 191 müssen sich alle multiethnischen Staaten stellen. Nationalismus bietet eine Lösung. Er definiert die Bevölkerung, die von einem bestimmten Staatsgebiet eingeschlossen sein soll. In Osteuropa kommt den ethnischen Faktoren bei der Bildung von Nation oftmals eine besondere Bedeutung zu. Der geringe Grad an national-staatlicher Homogenität veranlaßt die Konstrukteure der neuen demokratischen Staaten in den osteuropäischen Staaten zu einer zweigleisigen Strategie (Linz / Stepan 1996: 24f): Einerseits wird im Staatenbildungsprozeß eine Politik verfolgt, die auf eine kulturelle Homogenität zielt. Die dominante Sprache wird zur offiziellen Sprache und die kulturellen Symbole der dominanten Gruppe werden zu Staatssymbolen erhoben. Andererseits wird von der Elite erkannt, daß die demokratische Politik ein breites, inklusives Konzept der „Citizenship“ fördern muß. Diese beiden Strategien haben nur dann gute Chancen, nicht in Konflikt zu geraten, wenn 1. keine signifikante Irredenta außerhalb der Staatsgrenzen existiert, 2. nur eine Nation im Staat existiert und wenn 3. die kulturelle Diversifizierung gering ist. Eine solche Kongruenz von Nationalstaatsbildung und Demokratisierung stellt in Osteuropa einen Ausnahmefall dar. Daher muß versucht werden, Legitimitätsprobleme, die aus Abweichungen von den unter 1. bis 3. genannten Punkten entstehen, über den Weg von Verhandlungen zu lösen. Ansonsten können Eliten kulturelle, religiöse oder ethnische Differenzierung aus machtstrategischen Erwägungen politisieren, was demokratiegefährdende Auswirkungen hat (Offe 1994): Werden politische und ökonomische Interessen in ethnische Kategorien übersetzt, dann besteht die Gefahr, daß sich die nationalstaatlichen Wirtschaftsräume verkleinern, daß die neuen Regime die ethnischen Konflikte politisch nicht bewältigen können und daß Bürgerkriege und internationale Kriege provoziert werden32. Besonders in den Bürgerkriegsgebieten (Rußland und Jugoslawien) sind die Bedingungen für die Demokratisierung schlecht (v. Beyme 1997: 25f). Aber auch unter weniger extremen Bedingungen wirkt die ethnische Identität als kollektive Ressource demokratiegefährdend (Offe 1994: 163f): Ihre Instrumentalisierung für institutionelle Zugeständnisse und den Zuspruch über materielle Ressourcen benachteiligt systematisch andere Gruppen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, daß andere assoziative Strukturen im Bereich der intermediären Interessenvermittlung in der Bedeutungslosigkeit versinken. Mit dem „Stateness-Problem“ hinterlassen die osteuropäischen, kommunistischen Regime den jungen Demokratien ein Erbe, das den Demokratisierungsprozeß in vielfacher Weise bedroht und besondere Herausforderungen an die Verfassungskonstrukteure stellt. Ein föderales Erbe ist nicht prinzipiell fragil. Problematisch wird das Zusammenleben in einem multinationalen Staat erst, wenn das Regime mit seiner Politik bzw. sei32 Auch v. Beyme hebt hervor, daß für Transformationsgesellschaften die Daumenregel der Demokratietheorie nicht gilt, wonach es wenig wahrscheinlich ist, daß Demokratien keinen Krieg miteinander führen (1997: 26). Konsolidierung der politischen Ordnung 192 nen politischen Institutionen die ethnische Polarisierung vorantreiben. Keine der drei Föderationen UdSSR, Jugoslawien und Tschechoslowakei überlebten den Zusammenbruch des Kommunismus. Auch wenn sich mit der Abspaltung ethische Konflikte zum Teil lösten, bildet das Erbe der kommunistischen Regime – die Ungleichbehandlung und Unterdrückung von Minderheiten, aber auch die ohne Rücksicht auf kulturelle Grenzen gezogenen territorialen Staatsgrenzen – weiterhin einen Nährboden für die Mobilisierung ethnischer, pluralisierender Symbole, die der Institutionalisierung der Demokratisierung entgegenlaufen. 3.3 Elitenkontinuität Es ist das institutionelle Erbe, das den regimespezifischen Ausgangspunkt für die Demokratisierung bildet. Mit der Infragestellung der Macht- und Herrschaftsbeziehungen sowie der entsprechenden Handlungsroutinen – widerspiegelt durch die politischen Institutionen – beginnt die Änderung bzw. Auflösung alter Strukturen. So wie sich mit dem Wandel der Institutionen der langfristigere Strukturwandel verdeutlicht, so muß für das Verständnis des institutionellen Wandels ein Blick auf die Ebene der Akteure geworfen werden. Das Erbe auf der Mikroebene bestimmt, wer sich am Umbau beteiligen können wird. Es ist es für den institutionellen Umbau hochgradig relevant, welche Akteure die Änderungen vornehmen bzw. welche Akteure von diesem Prozeß ausgeschlossen sind. Außerdem prägt der institutionelle Kontext die Entscheidungen der Akteure – auch wenn Institutionen zerfallen oder neu aufgebaut werden, spielen sie als Ausgangspunkt für die Reformen oder den Umbau eine wichtige Rolle. Die Chance der Eliten, über die Änderungen hinaus im Amt zu verbleiben bzw. weiterhin Macht- und Schlüsselpositionen zu bekleiden, hängt im wesentlichen mit der Art des Regimewechsels (vgl. v.Beyme 1994: 182f; Ágh 1995) und außerdem dem Charakter des vorangegangenen Regimes zusammen. Es macht einen Unterschied, ob das neue Regime den Bruch mit dem alten Regime nur über formale institutionelle Änderungen vollziehen will oder ob es auch alte Netzwerke und Machtverteilungen mit weitreichenden Säuberungen der Eliten abschaffen will (damit alte Netzwerke aufgebrochen und moralische Ansprüche der Bevölkerung befriedigt werden). Aber selbst die Entscheidung, welchen Weg das neue Regime einschlägt, hängt von der Art des Regimewechsels ab. In einem ausgehandelten Übergang (Pakt) haben die alten Eliten viel mehr Möglichkeiten, ihre zukünftige Position mitzubestimmen, d.h. sich Machtressourcen zu sichern (vgl. Teil II, Kapitel 4), als bei einem revolutionären Sturz des alten Regimes wie in Rumänien. Die Art des Übergangs hängt natürlich mit dem Charakter des Regimes zusammen. Je nachdem, wie weit politischer Pluralismus zugelassen wurde, oder Konsolidierung der politischen Ordnung 193 ob sich zivilgesellschaftliche Ansätze bilden konnten, waren die Möglichkeiten vorhanden, mit einer oppositionellen Bewegung innerhalb oder außerhalb der Eliten den Übergang zur Demokratie auszuhandeln bzw. zuvor liberalisierende Maßnahmen durchzusetzen. Bildete eine zivile Elite den Kern des Regimes (außer in Polen beanspruchte das Militär in den kommunistischen Gesellschaften keine politische Souveränität), dann gelten Voraussetzungen, die einem Regimewandel zwar zugute kommen können, die aber für eine Konsolidierung Probleme aufwerfen: Zum einen sind zivile Führer oft motivierter, einen Regimewechsel einzuleiten, als militärische Eliten (Linz / Stepan 1996: 66f). Das liegt daran, daß sie sich selber als Gewinner in einem zukünftigen, demokratischen Regime sehen können. Militärs hingegen müssen sich in einem demokratischen Regime zivilen Machthabern unterordnen. Die zivilen Eliten sitzen außerdem nicht nur an den Schlüsselstellen, von denen aus der Wandel initiiert wird. Sie haben in der Regel auch eine engere Beziehung zur Gesellschaft – die in einem demokratischen Regime essentiell ist - als Militärs. Bei der Transformation in Osteuropa blieb das Militär relativ neutral, weil es den zivilen politischen Eliten untergeordnet war. Zum anderen aber bildeten die zivilen Eliten eine wichtige Ressource für den Wandel nicht nur, weil sie ihn initiierten, sondern auch weil sie ihn managten. Für eine Ablösung autoritärer Militärregime hingegen ist es typisch, daß sich das Militär aus allen zivilen Verantwortungen herauszieht. Damit ist aber gleichzeitig die Gefahr angesprochen, die mit einer Elitenkontinuität verbunden ist. Sind Eliten an dem Umbau beteiligt, ergibt sich für diese Akteure die Chance, sich einen privilegierten Zugang zu den Machtressourcen zu sichern. Machtgarantien und -reserven können beim institutionellen Umbau Ergebnis der Verhandlungen sein. Verhandelte Regimewechsel hinterlassen zwar institutionelle Spuren, die ein unerwünschtes Erbe alter Eliten weiterreichen können. In Polen beispielsweise konnte sich das kommunistische Regime wichtige Machtressourcen garantieren lassen (vgl. Przeworski 1991 78f; Mitcha 1997; Linz / Stepan 1996: 255f; Geddes 1996): 1. Der kommunistischen Partei wurden 35 % der Parlamentssitze (im Sejm) garantiert; 2. wurde auch garantiert, daß die Opposition die Wahl Jaruzelskis zum Präsidenten nicht verhindern würde. 3. wurden die Angelegenheiten der Landesverteidigung und inneren Ordnung der Kontrolle der Kommunisten überlassen. Solche Zugeständnisse sind nötig, um in den Verhandlungen zu Ergebnissen zu kommen. Allerdings sind diese institutionellen Spuren unter demokratischen Bedingungen nicht irreversibel. Entscheidungen können nicht vorgegeben werden – das Volk kann sie auf demokratischen Wege unterlaufen. Daher sind die Institutionen, die solche Garantien sichern sollen, beim Übergang zur Demokratie prinzipiell instabil (vgl. Przeworski 1991: 79). Damit ist zwar eine Grundvoraussetzung demokratischer Institutionen - Stabilität im Sinne von Selbstverständlichkeit (vgl. Nedelmann 1995) – nicht erfüllt. Dafür braucht aber auch nicht be- Konsolidierung der politischen Ordnung 194 fürchten zu werden, daß sich konservative Kräfte mit institutionellem Rückhalt dauerhaft gegen eine Konsolidierung des demokratischen Regimes stemmen können, wenn es einen friedlichen, ausgehandelten Regimewechsel gab (vgl. dagegen Baylis 1998; Tanase 1999). Im Fall der osteuropäischen Transformation sprechen zwei weitere Argumente gegen die Befürchtung, daß sich die Sicherung von Machtressourcen demokratiegefährdend auswirken könnte: Kader der kommunistischen Partei können nicht wie ehemalige militärische Machthaber direkt ein kontinuierliches Drohpotential aufrecht erhalten, das bestimmte politische Ergebnisse sichert. Wird die kommunistische Partei bzw. ihre Nachfolgeorganisation durch demokratische Wahlen abgelöst, dann kontrolliert sie zwar eventuell weiterhin Ressourcen und Loyalitäten, die ihnen helfen können, spätere Wahlen zu gewinnen (vgl. Segert 1995a). Sie hat aber nicht die Ressourcen, die Souveränität der neuen demokratisch legitimierten Regierung einzuschränken. Bekleiden die abgewählten Kommunisten oder Ex-Kommunisten weiterhin zentrale Positionen innerhalb der staatlichen Verwaltung, muß dies der Konsolidierung einer Demokratie nicht im Wege stehen. Selbst wenn die Eliten der staatlichen oder ehemals staatlichen Unternehmen politischen Einfluß behalten konnten, indem sie ihre Positionsmacht in Marktmacht umwandelten, läßt sich plausibel annehmen, daß sie primär in ihrem Privatinteresse handeln. Sie sind weniger daran interessiert, das politische System herauszufordern, als von demokratischen und marktwirtschaftlichen Änderungen zu profitieren (vgl. v. Beyme 1994: 182). Die politischen Transformationen Osteuropas waren dadurch gekennzeichnet, daß es vielfach gar keine oppositionellen Eliten gab, die alte Eliten hätten ablösen bzw. ersetzen können, wie bei den meisten anderen Systemwechseln. Daher mußten und müssen sich am Übergang und an der demokratischen Konsolidierung alte Teile der Nomenklatura beteiligen (v. Beyme 1994: 176f; Ágh 1995; Haraszti 1999) - lediglich Funktionäre, die Spitzenpositionen bekleidet hatten, wurden abgesetzt. Von dieser Elitenkontinuität geht aber keine unmittelbare Gefahr für eine demokratische Konsolidierung aus. Anders als bei der Ablösung militärischer Regime, bei der die alten Eliten den Zugang zu Zwangs- und Gewaltressourcen meist behalten, müssen die osteuopäischen Zivilregierungen nicht mit militärischen Eingriffen rechnen. Allerdings gibt es andere spezifische Probleme in Osteuropa, die von einer Elitenkontinuität ausgehen und mittelbar die Demokratisierung erschweren. Diese Probleme sind eng mit dem Charakter der Systeme verbunden. Die Eliten der post-totalitären Gesellschaften können zur Sicherung ihres Einflusses und ihrer politischen Macht den bislang unterdrückten Nationalismus schüren bzw. instrumentalisieren und sich damit dem Demokratieaufbau in den Weg stellen. Wie die Politisierung sekundärer Themen bzw. ethnischer cleavages mit einer Demokratisierung konfligiert, wird im Rahmen der Diskussion der Bedeutung des strukturellen und institutionellen Erbes deutlich (vgl. Teil III, Konsolidierung der politischen Ordnung 195 Kapitel 2.1, 2.2): Den zivilgesellschaftlichen Ansätzen in der Gesellschaft fällt es unter dem Primat ethnischer, religiöser oder nationalistischer Themen schwer, eine wettbewerbsfähige politische Gesellschaft mit ihren wichtigen Institutionen der Interessenaggregation und -vermittlung aufzubauen. Nomanklatureliten hingegen kann es gelingen, mit dieser Politisierung ihre Macht auszubauen und sich über Wahlen zu legitimieren (vgl. Offe 1994; Linz / Stepan 1996). Ein weiteres Problem ist bei der Elitenkontinuität innerhalb der (ehemaligen) Staatsbetriebe angelegt. Die Grenzen von öffentlich und privat sind oftmals undurchsichtig, was Raum für Korruption entstehen läßt, unter der die Effizienz und die Legitimität postkommunistischer Staaten nach wie vor leiden. Nach der Ablösung eines sultanistischen Regimes ist die Kontingenz bezüglich der Elitenkontinuität wesentlich höher als bei post-totalitären Systemen (Linz / Stepan 1996): Das hängt mit der Art des Regimewechsels zusammen. Eine Abkehr vom Totalitarismus kann Chancen für einen Regimewandel in post-totalitären Regimen öffnen. Sultanistische Regime hingegen, in denen die private und öffentliche Sphäre sowie Militärund Zivilbereich eng miteinander verknüpft sind, haben nur eine Chance für eine Demokratisierung: die Absetzung des Führers. Dann allerdings kollabiert das Regime, weil die hoch personalisierten Strukturen zusammenbrechen. In dieser Situation ist entscheidend, wie das Machtvakuum ausgefüllt wird. Nicht so sehr die Elitenkontinuität, sondern vielmehr die konkreten Strategien und Entscheidungen der Interimsregierung (z.B. wann demokratische Wahlen abgehalten werden) entscheiden über den Verlauf und die Chancen für eine Demokratisierung (Linz / Stepan 1996: 71f). Wegen der ideologiegeleiteten Entpolitisierung konnten sich auch keine politisch professionellen Bewegungen entwickeln, die eine neue Elite für den demokratischen Umbau hätten bereitstellen können. Im Rahmen der kommunistischen Ideologie wurden gesellschaftliche Konflikte vielfach verharmlost und unterdrückt. Sie wurden auf die schädlichen Einflüsse der konkurrierenden westlichen Welt zurückgeführt und führten damit zu einer Entpolitisierung der Gesellschaften. Somit bestimmte ein weiteres Charakteristikum der politischen Herrschaftsausübung, nämlich die Rolle der Ideologie (neben dem Grad des Pluralismus und zivilgesellschaftlicher Ansätze), das Erbe der kommunistischen Staaten auf der Mikroebene. Kirchliche Gruppen spielten eine Rolle bei der Demokratisierung, zogen sich dann aber mit der Ausnahme von Polen und der Slowakei - wo der Katholizismus weiterhin bedeutenden Einfluß auf die Politik hat - aus der Politik zurück. Kulturelle Eliten bekleideten Spitzenpositionen, denen sie vielfach nur schwerlich gewachsen waren, was den professionellen Politikern der kommunistischen Partei oder ihrer Nachfolgepartei als Angriffsziel diente (v. Beyme 1994: 185). Gab es auch in den Spitzenpositionen einen Elitenwechsel, so waren die Bereiche Wirtschaft und Verwaltung sowie Justiz von einem weitgehenden Elitenwechsel ausge- Konsolidierung der politischen Ordnung 196 schlossen. Alte Kader besetzten weiterhin wichtige Positionen, weil sich die umfangreichen Verwaltungen nicht uno actu auswechseln ließen. Ein weiterer Grund für die im Vergleich zu anderen Regimewechseln relativ hohe Elitenkontinuität in der Transformation Osteuropas liegt in der Art, wie mit dem alten Regime „abgerechnet“ wurde. Eine „Säuberung“ der Eliten war unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ausgesprochen problematisch (vgl. v. Beyme 1994; Offe 1994): Prinzipiell wurde das vergangene Unrecht eher mit den Organisationen der Staatssicherheit33 assoziiert als mit bestimmten politischen Führungspositionen. Wenn daher die Akten von Organisationen wie der Stasi, der Securitate oder des KGB als Beweismaterial herangezogen werden sollten, drohte neues Unrecht, weil sie oftmals zur Kompromittierung Oppositioneller gefälscht und zum Teil vernichtet wurden oder unvollständig sind. Darüber hinaus gilt unter rechtsstaatlichen Bedingungen der Grundsatz nulla poena sine lege, auf den sich die Eliten des alten Regimes im Falle der Anklage berufen konnten, wenn sich die Strafbarkeit nicht aus den Gesetzen des alten Regimes selbst ergab. Der relativ bescheidene Elitenwandel in Osteuropa verschafft zwar pragmatische Vorteile mit dem Blick auf das politische Management im neuen Regime. Ungeklärt bleibt allerdings, ob die Verdrängung der Vergangenheitspolitik unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten zu rechtfertigen ist, und damit auch, ob eine unbewältigte Vergangenheit, die sich in der Elitenkontinuität ausdrückt und die ja teilweise auch Ansprüche von Opfern leugnen muß, eine verläßliche Basis für sozialen Frieden bilden kann (Offe 1994: 187f). Kurzfristig läßt sich bezüglich der Elitenkontinuität mit v. Beyme (1994: 189f) resümieren, daß die Eliten in Osteuropa nicht mit Säuberungen, sondern durch langsame Verdrängung im politischen Wettbewerb abgelöst wurden und langfristig ein „Generationenaustausch“ durch das Nachrücken kompetenterer Politiker oder auch Verwaltungsangestellter erfolgt. Die Art des Regimewechsels und der Charakter des kommunistischen Regimes bestimmen aber nicht nur die Chancen für bestimmte Teile der Eliten und neue Eliten, Einfluß auf die Gestaltungsprozesse zu gewinnen. Sie haben auch einen prägenden Einfluß auf den Organisationsgrad der Eliten und damit darauf, welche ideologische Orientierung sich durchsetzen kann. Die Transformationen Osteuropas verliefen nicht nach einem überlegten Plan oder mit einer konkreten Zielvorstellung34. Das gilt selbst für Rußland, wo die Änderungen aus der Elite heraus bewußt entwickelt wurden. Gorbatschows Konzepte der Perestoika, Glasnost und des gemeinsamen europäischen Hauses waren zwar bewußte Reform33 Hier besonders die Rechtsverletzungen in Gefängnissen, Lagern oder psychischen Anstalten (Offe 1994: 187f). 34 Auch irrationale und nicht-rationale Motive können Einfluß auf die Entscheidungssequenzen gehabt haben, die zum Zusammenbruch führten (vgl. Przeworski 1991; Teil II, Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit). Konsolidierung der politischen Ordnung 197 schritte. Dennoch konnte die Elite die Effekte dieser Schritte nicht voraussehen (und das galt auch für Gorbatschow). Der Prozeß bekam eine unerwartete Dynamik. In den anderen osteuropäischen Ländern verliefen die Änderungen ähnlich unvorhergesehen und z.T. noch weniger gesteuert. Hinzu kommt, daß sich wegen der Unterdrückung von Opposition in den kommunistischen Regimen keine organisierte Oppositionsbewegung bilden konnte. Der Organisationsgrad ist für den institutionellen Umbau entscheidend, weil er die Verhandlungsstärke bestimmt (vgl. Teil II, Kapitel 4.1). Opposition fand informell in privaten, oft voneinander unabhängigen Netzwerken statt, was eine denkbar schlechte Voraussetzung für die Formulierung ideologischer und programmatischer Regimealternativen ist35. Dementsprechend gab es eine „Apathie kollektiver Aspirationen“ (Elster / Offe / Preuss 1998: 13). Darüber hinaus gab es bei den nicht-revolutionären Umbrüchen keine siegreiche Elite, die mit einem kohärenten Plan oder konkreten Demokratisierungsprojekt antreten konnte. Den Architekten der neuen Regime fehlte es außerdem an einer Basis für ihre Legitimität bzw. für ein politisches Mandat, mit dem ein umfassender Konstruktionsprozeß hätte getragen werden können. Mit dieser Dynamik des nicht intentional gesteuerten Wandels und dem Erbe eines geringen Organisationsgrades einer Opposition, dem Mangel einer Gegenelite und fehlender konkreter inhaltliche Programme der Demokratisierung ergibt sich für die Konsolidierung eine ganz besondere Problematik: Die Formen des neuen, demokratischen Regimes werden im Wettbewerb schlecht organisierter politischer Eliten und Gruppen formuliert. Diese politischen Akteure sind extrem fragmentiert, ihnen mangelt es an realisierbaren politischen Programmen, ihre Angebote sind uneindeutig und ihre Existenz kurzlebig (Elster / Offe / Preuss 1998: 11f). 2.4 Zusammenfassung Auf der Makroebene des Erbes können strukturelle Dimensionen identifiziert werden, mit denen eine Zustandsbeschreibung der Ausgangssituation für den demokratischen Umbau in den osteuropäischen Staaten möglich wird. Insofern läßt sich davon ausgehen, daß die Vergangenheit (das Erbe) die Möglichkeiten der Gegenwart (den Umbau und evtl. die Stabilisierung) strukturiert (vgl. Brie 1996a: 39). Die drei strukturellen Dimensionen, die in diesem Abschnitt angesprochen wurden, sind der Regimetyp, das Problem der territorialen Integrität („Stateness-Problem“) und die Art des Regimewechsels. Sie beeinflussen entscheidend, mit welchen Herausforderungen und Bedingungen 35 Eine Ausnahme bilden natürlich Polen und Ungarn. Dennoch wurden keine handlungsfähigen Akteure ausgebildet. In Polen wurde mit Verhängung des Kriegsrechts 1981 die Opposition in ihre Schranken gewiesen. In Ungarn wurde der Reformprozeß aus den Reihen der kommunistischen Eliten initiiert – auch hier gab es kein Platz für alternative Regimekonzepte . Konsolidierung der politischen Ordnung 198 der Umbau auf der Mesoebene der Institutionen und der Mikroebene der Akteure konfrontiert ist: Der Regimetyp bestimmt das institutionelle Defizit und somit den Umfang des „institutional engeneering“. Das „Stateness-Problem“ klärt über die Voraussetzung für den institutionellen Aufbau auf, indem es den Blick auf die territoriale Konsolidierung als eine Voraussetzung für den Aufbau demokratischer Institutionen lenkt. Die Art des Regimewechsels wiederum bestimmt ganz wesentlich die Elitenkontinuität und in Verbindung mit dem Charakter des Regimetyps (mehr oder weniger repressiv) die „Qualität“ der Elite – ihre programmatische Stärke bzw. Schwäche sowie ihren Organisationsgrad. Konsolidierung der politischen Ordnung 199 3. Der Umbau der Institutionen Der politische Umbau erfolgt über institutionelle Neuerungen. Deshalb werden in diesem Kapitel primär Prozesse, die auf der Mesoebene stattfinden, thematisiert. Das heißt nicht, daß der institutionelle Umbau frei von jeglichen Randbedingungen gestaltet werden kann. Vielmehr wird er - wie im vorangegangenen Kapitel ausgeführt - vom strukturellen Erbe und dem Erbe auf der Mikroebene, das sich mit dem Organisationsgrad politischer Gruppierungen und dem Grad der Elitenkontinuität konkretisiert, eingeschränkt. Auch das institutionelle Erbe grenzt die Gestaltungsmöglichkeiten ein. Wenn Handlungsroutinen und Netzwerke nicht vollkommen zusammengebrochen sind, d.h. eine gewisse Kontinuität bewahren konnten, dürfen sie bei der Umgestaltung der institutionellen Landschaft nicht unberücksichtigt bleiben. Darüber hinaus bestimmen die notorischen Defizite der kommunistischen Regime auf der Ebene intermediärer Institutionen die Agenda des institutionellen Umbaus. Sowohl aus den Defiziten, aber auch aus dem Zusammenbruch ehemaliger politischer Institutionen und aus den institutionellen Mindeststandards, die eine demokratische, politische Ordnung fordert, ergeben sich die Aufgaben für den institutionellen Aufbau. Politische Strukturen ändern sich, wenn Institutionen umgestaltet werden. Die Umgestaltung wird von Akteuren in komplexen Interaktionsprozessen durchgeführt, aus denen bestimmte institutionelle Designs als ein Ergebnis interdependenter Entscheidungen hervorgehen. Wie sich die Änderungen auf der Mesoebene der Institutionen langfristig strukturbestimmend auswirken, ist dann eine Frage der Stabilisierung. Der Umbau betrifft daher die Makroebene erst langfristig und somit nur indirekt. Deshalb ist die analytische Ebene, auf der strukturelle Makrovariablen thematisiert werden, für die konkreten Schritte des institutionellen Umbaus nur indirekt bedeutsam. Die Makrovariablen des Erbes bilden zwar Constraints für den institutionellen Umbau, und die angestrebte politische Struktur dient als Orientierungspunkt für die Architekten der demokratischen Institutionen. Die Konstruktion einer neuen Struktur findet aber über die Änderungen auf der Mesoebene statt, auf die Entscheidungen, Präferenzen und Strategien sowie die Interaktionskonstellationen der beteiligten Akteure, also Mikroprozesse, einen direkten Einfluß haben. Konsolidierung der politischen Ordnung 200 3.1 Verfassung „Institutionen sind Manifestationen von Leitideen, die bestimmte Rollen und Wertorientierungen vermitteln.“ (Glaeßner 1994: 198). Die Leitideen werden in der Regel in der Verfassung kodifiziert. Sie bildet den grundlegenden Normcode, an dem sich der Institutionenbildungsprozeß orientieren muß. Politische Institutionen werden von ihnen abgeleitet. Mit einer Verfassung wird die Meinungsbildung, die politische Willensbildung und die Entscheidungsfindung strukturiert (Glaeßner 1994), indem sie durch bestimmte Handlungsroutinen Erleichterung schafft oder aber auch Zwang auf die Akteure ausübt, die an den Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Verfassungen müssen festlegen, über welche Verfahren der Prozeß der politischen Entscheidungen reguliert wird, sie stiften Konsens, regulieren die Mobilisierung der Gesellschaft und dienen der Legitimierung der politischen Herrschaft (vgl. Merkel / Sandschneider / Segert 1996; Rüb 1995). Über sie wird daher vornehmlich reguliert, auf welchem Wege die Macht verteilt wird, welche Funktionen die verschiedenen Regierungsagenturen und -abteilungen einnehmen und wie sich die Beziehung zwischen Regierung und Öffentlichkeit gestalten soll (vgl. Finer / Bogdanorn / Rudden 1995). Wie dieser Katalog der Staatsaufgaben erfüllt werden soll, wird in den konkreten Vorgaben bzw. Gesetzen der Verfassung zu der institutionellen Ausgestaltung des politischen und wirtschaftlichen Lebens kodifiziert. In den Rechten, die den Schutz der Freiheiten des Individuums vor der Intervention des Staates garantieren (negative Rechte), oder in den Ansprüchen auf bestimmte Leistungen wie soziale Sicherheit, Recht auf Arbeit oder medizinische Versorgung (positive Rechte), offenbaren sich die Leitideen der Gesellschaft. Aufgrund eines impliziten Werte- und Normkatalogs wird über die Gesetze der Verfassung das Verhältnis von Bürger und Staat - das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft - festgelegt. Die traditionelle, liberale Funktionsbeschreibung von Verfassung verweist auf die Begrenzung der Staatsmacht, d.h. den Schutz der Individuen vor der Willkür der Herrschenden (vgl. Rawls 1977). Zur Gestaltung dieses Schutzes müssen institutionelle Sicherungen und Verfahren der Machtbegrenzung festgelegt werden. Damit erfolgen über die Schutzfunktion auch institutionelle Vorgaben, mit denen eine bestimmte politische Ordnung errichtet bzw. ein politisches Gemeinwesen konstruiert wird (vgl. Preuß 1994). Insofern hat die Verfassung Integrationswirkung: mit der politischen Ordnung gestalten sich die Möglichkeiten für die Berücksichtigung der Interessen und Werte verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Die Formulierung von Schutzrechten hat also auch immer einen inhärent politischen Charakter, weil sie mit institutionellen Formen (Regierungs- und Wahlsystem) die Rahmenbedingungen vorgibt, die von den politischen Akteuren berücksichtigt werden sollen und genutzt werden können. Konsolidierung der politischen Ordnung 201 Der Schutz der Individuen wird formal durch die konstitutionelle Begrenzung der demokratischen Majoritätsregel umgesetzt. Die Majoritätsregel muß dahingehend begrenzt werden, daß durch die Stimme der Mehrheit individuelle Rechte nicht verletzt werden können und daß bestimmten politischen Änderungen Hindernisse auferlegt werden (Elster 1988: 2f): Rechtssicherheit wird durch die Prinzipien der Legalität und der Rechtsstaatlichkeit garantiert. Das erste Prinzip besagt, daß Bestrafung nur dann erfolgen darf, wenn die Handlung explizit durch ein Gesetz verboten war, welches zu dem Zeitpunkt galt, zu dem die Handlung erfolgte. Damit werden willkürliche Bestrafung und rückwirkende Gesetzgebung verhindert. Das Prinzip der Legalität hindert die gegenwärtige Mehrheit daran, Gesetze für die Vergangenheit zu erlassen. Rechtsstaatlichkeit hingegen ist auf die Zukunft gerichtet. Sie soll rechtliche Sicherheit für die Zukunft garantieren, damit beispielsweise langfristige Projekte (Investitionen) vor der Willkür wechselnder Mehrheiten geschützt sind. Mit solchen Prinzipien findet eine klare Einschränkung diskretionärer Spielräume der Regierungsmehrheit statt. Deshalb läßt sich die Verfassungsgebung auch als eine „... generelle Strategie ... [zur] ... Reduktion von Unsicherheit durch Selbstbindung ...“ (Rüb 1995: 531) formulieren. Mit Elster gesprochen, wirken die Verfassungen in der Erfüllung dieser Funktion als ein Schutz der Demokratie vor Kurzsichtigkeit (myopia) (1988: 13). Die demokratische Mehrheitsregel selbst könnte nicht ohne gewisse Selbstbeschränkungen existieren. Gegenstand der Mehrheitsentscheidungen darf es bspw. nicht sein, wann Wahlen abgehalten werden, wie die Wahlbezirke definiert sind und nach welchen Mechanismen (Wahlsystemen) die Stimmen in Gewinner transformiert werden. Wäre der Zugriff der Mehrheit auf diese Regulierungen unbeschränkt, würde strategischen Manipulationen Tür und Tor geöffnet. Neben dem Risiko, daß die Macht für partikularistische Absichten mißbraucht wird, gibt es bei uneingeschränkter Souveränität der Regierung ein weiteres Risiko, gegen das individuelle Rechte von den Verfassungen geschützt werden müssen. Dies sind Entscheidungen, die ein kollektives Ziel (ökonomischer Wachstum, militärischer Erfolg) über zivile und politische Freiheiten stellen36. Regierungen streben in der Regel einen weiten, freien Entscheidungsrahmen für ihre politischen Entscheidungen an. Warum also sollten sie eine Selbstbindung, womöglich sogar eine Bindung an die Entscheidung ihrer Vorgänger, akzeptieren? Hier liegt eine wesentliche Problematik bei der Einschätzung der Rolle einer Verfassung für Demokratien: Wo liegen die Gründe für die Selbstbindung der politischen Macht? Elster gibt zwei Gründe an (1988: 8f): Erstens ist die Stabilität und Dauerhaftigkeit von Institutionen ein Wert an sich, weil erst durch diese Eigenschaften langfristige Planung 36 Und zwar nicht nur, weil es sich bei den individuellen Freiheiten um einen Wert an sich handelt, sondern auch - wie Elster zeigt (1988: 5) - aus rationalen Erwägungen: Wenn auch in vielen Fällen das allgemeine Gut auf Kosten der individuellen Freiheit gefördert werden kann, läßt sich daraus nicht schließen, daß eine generelle Verletzung individueller Freiheiten den selben Effekt hat. Konsolidierung der politischen Ordnung 202 möglich wird. Und zweitens gibt es unkluge Entscheidungen, die sich nicht einfach rückgängig machen lassen. Parlamente sind genauso wenig wie individuelle Akteure gefeit davor, daß sie Entscheidungen auf der Grundlage von Leidenschaften oder Selbsttäuschungen treffen, die hinterher bereut werden37. Ohne die Selbstbindung durch Einschränkungen werden Demokratien schwächer und sind nicht etwa stärker (vgl. Holmes 1988a), wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Das bedeutet, daß die Verfassung in einem demokratischen Regime die Umsetzung einer rationalen Strategie ist, dem ansonsten drohenden Partikularismus und mangelnden Schutz vor Kurzsichtigkeit vorzubeugen (Elster 1988: 15). Dieses Motiv und nicht etwa der Wunsch, sich vor dem Einfluß kommunistischer Eliten zu schützen, sollte auch für Verfassungsbildungen in Osteuropa ausschlaggebend sein. Derartige Ansprüche an Verfassungen zu formulieren, entspringt einer formalen Betrachtung, die zunächst die konkrete Umsetzung im politischen Tagesgeschäft unbeachtet läßt. Ob das politische Tagesgeschäft den normativen Verfassungsvorgaben gerecht wird, d.h. ob die Verfassung als normative Kraft auf die Institutionenbildung und damit letztlich auch auf die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung wirkt und damit ihrer Funktion gerecht wird, ist eine weiterführende Frage. Auch wenn man dem Argument zustimmt, daß rechtliche und institutionelle Kontinuität eine Grundvoraussetzung für eine stabile Demokratie bilden, läßt sich dennoch über die Bedeutung von Verfassungen debattieren. Verfassungen lassen sich nämlich in zweierlei Weise kritisieren: - Verfassungen gelten als unvollständig (vgl. Finer / Bogdanorn / Rudden 1995): Die konkrete politische Praxis läßt sich nicht einfach aus den Verfassungen ableiten. Vielmehr wird in aufwendigen Interpretationsbemühungen der nationalen Gerichte (insbesondere des Verfassungsgerichts) die Übereinstimmung des alltäglichen politischen Geschäfts mit der Verfassung geprüft. Außerdem werden politische Entscheidungsprozesse von institutionellen Organisationen zuwege gebracht, die in den Verfassungen nicht erwähnt sein müssen; kirchliche Organisationen, intermediäre Organisationen, Wirtschaftskorporationen, Medien aber auch andere Gruppen wie ethnische Minoritäten, die Bürokratie und das Militär. Konkret bedeutet dies, daß ein in der Verfassung kodifizierter Minderheitenschutz aber auch Umweltschutz oder das Versprechen sozialer Sicherheit vom politischen Definitionsprozeß abhängen können. Besonders im Falle der osteuropäischen Staaten führt das häufig zu einer deutlichen Diskrepanz zwischen Verfassungsnormen und der Verfassungswirklichkeit (Glaeßner 1994: 225f): Trotz umfangreicher Minderheitenrechte verbleibt es oft im Unklaren, aufgrund welcher Kriterien sich Min37 Ein Hauptteil der Arbeit Jon Elsters behandelt solche Phänomene beschränkter Rationalität und ihre Überwindungsmöglichkeiten (vgl. 1987). Konsolidierung der politischen Ordnung 203 derheiten als solche definieren können und damit den entsprechenden Schutz genießen. - Verfassungen mangelt es an Effektivität (Finer, Bogdanorn, Rudden 1995): Zwar können Verfassungen ein adäquates Mittel für die Selbstbeschränkung („Selfbinding“) bezüglich der Herrschaftsausübung der aktuellen Mehrheit sein (vgl. Elster 1988; 1988a). Dem läßt sich aber entgegenhalten, daß Verfassungen überflüssig sind, weil im Interessenkonflikt mit den Vorgaben der Verfassung das verfassungsmäßige Handeln erneut ein Akt der Selbstbindung ist. Verfassungen verschieben also lediglich das Problem der Selbstbindung und heben es nicht etwa auf38. Wenn die Mächtigen sich ohnehin zurückhalten müssen, dann ist die schriftliche Fixierung konstitutioneller Normen redundant. Das bestätigen auch Beispiele wie Großbritannien, Neuseeland und Israel. Diese demokratischen Staaten kommen ohne Verfassungen aus. Gegen den in dieser Argumentation zum Ausdruck kommenden Verfassungspessimismus läßt sich neben dem Argument, das Verfassungen als rationale Strategie zur Überwindung nicht-rationaler Kurzsichtigkeit und Tendenz zum Partikularismus deutet, auch ein an der praktischen Erfahrung gewonnenes Argument anführen: Nicht alle Verfassungen werden ignoriert, und meistens werden wenigstens einige ihrer Vorgaben befolgt (Finer / Bogdanorn / Rudden 1995). Es läßt sich somit festhalten, daß Verfassungen zwar nicht allein den Schutz vor der Willkür der Mehrheit, den regierenden Eliten, garantieren können. Verfassungen sind aber auch nicht nur Fiktionen. Wird eindeutig an ihnen „vorbeiregiert“, dann ergibt sich für die Regierenden zumindest ein Begründungsdruck. Sie müssen den Verfassungsbruch rechtfertigen. Werden die Vorgaben der Verfassung befolgt und umgesetzt, dann ist diese „realistisch“ – sie kanalisiert und beschränkt das Ausmaß und die Wirkungsrichtung der Macht einer Regierung und ihrer verschiedenen Organe (Finer / Bogdanorn / Rudden 1995) und bestimmt die Ausgestaltung der politischen Ordnung. Für die post-kommunistischen Staaten gibt sich bei der Verfassungsgebung zuvorderst die Aufgabe, den Bürgern politische Rechte und individuelle Freiheiten zu garantieren, auf die sie unter der Herrschaft der kommunistischen Regime verzichten mußten. Außerdem muß versucht werden, die konstitutionellen Grundlagen der politischen Ordnung stabil zu halten. Die kontinuierliche Änderung von Verfassungsvorgaben schafft Unsicherheit und verhindert das Zustandekommen von Vertrauen, weil der Eindruck 38 Preuß (1994) führt dieses Dilemma aus: Anders als bei zwei Individuen mit konfligierenden Interessen kann bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verfassungsorganen keine Entscheidung durch eine höhere Autorität herbeigeführt werden. Das Verfassungsgericht ist eine Schöpfung der gleichen Verfassung, die auch dem Parlament oder der Regierung zugrunde liegt. Warum also sollte es eine höhere Autorität haben, wo doch Regierung und / oder Parlament ihre Position im Streitfall zumindest auf eine Legitimierung durch die Bevölkerung stützen können, während Verfassungsgerichte demokratisch schwach legitimiert sind. Konsolidierung der politischen Ordnung 204 entsteht, daß aus opportunistischen Gründen von Machthabern strategisch manipuliert wird (vgl. Offe 1999). Eine fragile Verfassungordnung ist nicht in der Lage, überlebensfähige Institutionen zu bilden, die für langfristige Planungen wichtig sind. In Osteuropa scheinen allerdings die Dimensionen, die einer Verfassung Stabilität verleihen können, kaum berücksichtigt. Eine verfassungsgebende Versammlung gab es nur in Bulgarien und ein breiter öffentlicher Diskurs über die Inhalte der Verfassung hat kaum stattgefunden (vgl. Linz / Stepan 1996; Bos 1996). So bleibt die Legitimität der Verfassungen zweifelhaft, und gleiches gilt für den Anspruch, daß Verfassungen einen Grundkonsens der gesellschaftlichen Gemeinschaft abbilden sollen. Der Prozeß der Verfassungsgebung scheint weniger von dem Bestreben, ein solides Fundament für eine Demokratie zu schaffen, als von der „Logik der Machtablösung“ (Rüb 1994a), d.h. von der Zusammensetzung der Akteure und ihren Strategien, bestimmt gewesen zu sein (Glaeßner 1994: 210f). Bei den verhandelten Transformationen in Polen und Ungarn war die Formulierung der Verfassung ein Prozeß graduell gefaßter Kompromisse. Diese wurden von den Oppositionsbewegungen und den reformbereiten Kommunisten getragen (vgl. Teil II, Kapitel 4). Die Diskussion um die Verfassungsordnung fand zuerst an den Runden Tischen statt und war nach der Ablösung der Kommunisten vom Auseinanderbrechen der Oppositionsbewegungen belastet. Auf dieser Grundlage ließ sich kein gemeinsamer gesellschaftlicher Grundkonsens formulieren. Deshalb stehen die Verfassungen von Polen (Verfassungsgesetz) und Ungarn nicht für einen umfassenden gesellschaftlichen Konsens, sondern reflektieren eher den kleinsten gemeinsamen Nenner für eine gemeinsame Wertorientierung. Eine ähnliche graduelle Anpassung der Verfassung an die veränderten normativen Grundlagen des Staates fand in der DDR und der Tschechoslowakei statt, bevor es zum endgültigen Kollaps der Regime kam. In beiden Ländern beschied die nationale Frage den Verfassungsrevisionen ein frühes Ende. In der Tschechoslowakei behinderten die alten Verfassungelemete einen Grundkonsens, weil sie national-ethnische Ambitionen ignorierten (vgl. Calda 1996). Und mit dem Beitritt zur BRD und damit der Übernahme ihrer Verfassung wurden die Versuche einer eigens für die DDR-Bürger formulierten Verfassung obsolet. Völlig neue Verfassungen entstanden immer dann, wenn der Regimezusammenbruch in der Bildung von neuen Staaten mündete, wie in Tschechien, Slowakei und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Für die Republiken Tschechien und Slowakei bildeten Verfassungsentwürfe, die den regionalen Kammern bereits vor dem Zusammenbruch der Tschechoslowakei vorlagen, die Grundlage für neue Verfassungen. In Rußland war nach dem Zusammenbruch der UdSSR der Prozeß der Verfassungsbildung am deutlichsten von machtstrategischen Überlegungen geprägt. Trotz des Referendums zur Verabschiedung der neuen Verfassung vom 12.12.1993 bildete das Verfassungsrecht in Ruß- Konsolidierung der politischen Ordnung 205 land primär ein Instrument zur Stärkung der Machtpositionen und nicht etwa der Machtkontrolle (Bos 1996: 179f). Bei den Transformationen, die unter dem dominanten Einfluß der Ex-Kommunisten erfolgten, wurden recht zügig neue Verfassungen verabschiedet (Segert 1996: 120f): In Rumänien und Bulgarien bildeten die Parlamente die verfassungsgebende Versammlung. Die zu einem frühen Zeitpunkt abgehaltenen Wahlen schufen in Rumänien Bedingungen, unter denen der Verhandlungsprozeß um die Verfassungsgebung ohne die Beteiligung von Gegeneliten zwischen den Reformkommunisten erfolgen konnte. In Bulgarien hingegen kam es zu einem Umschwung der Kräfteverhältnisse während der Phase der Verfassungsgebung, bei dem die nicht-kommunistische Opposition ihre Position stärken konnte und somit auch stärkeren Einfluß auf die institutionelle Gestaltung gewann als in Rumänien (vgl. auch Kolarova / Dimitrov 1996). Die Art des Regimewechsels bestimmte die Akteurskonstellation in der Krise und wirkte somit indirekt auf die Gestaltung der Verfassungen. Das Ausmaß des Einflusses alter reformbereiter Eliten, neuer Eliten, aber auch oppositioneller Kräfte im Verfassungsgebungsprozeß definierte, inwieweit die neue Verfassung ein vom gesellschaftlichen Grundkonsens geprägtes oder eher ein von machtstrategischen Erwägungen beeinflußtes Normgebilde widerspiegelt. Verfassungsstabilität hängt von der Grundlage ab, auf die sich eine Verfassung stützen kann. Um einer fragilen Verfassung vorzubeugen, muß sie einen gesellschaftlichen Grundkonsens widerspiegeln. Verfassungen sind aber auch Vehikel der Selbstbeschränkung politischer Machthaber (vgl. Elster 1988; Holmes 1988), was bedeutet, daß die Stabilisierung demokratischer Institutionen letztendlich durch das Verhalten der politischen Akteure erfolgen muß. Wenn sich die politischen Akteure verantwortlich, d.h. weitsichtig, verhalten, können konstitutionelle Machtbegrenzungen z.T. von der demokratischen Kontrolle ersetzt werden: „If laws are promulgated by a properly elected assembly and administered by proper participatory procedures, the need for constitutional constraints may appear less urgent.“ (Elster 1988: 8). Welche Dimension ist nun aber für die Stabilisierung bedeutender: das Ausmaß, in dem im Prozeß der Verfassungsgebung versucht wurde, einen gemeinsamen Grundkonsens zu formulieren, oder das Verhalten der Akteure im politischen Tagesgeschäft? Verfassungen können grundsätzlich dann einen konstitutiven Beitrag zur Stabilisierung leisten, wenn sie entweder formal legitimiert sind oder empirisch legitimiert sind (vgl. Merkel / Sandschneider / Segert 1996) oder beides. Welcher der beiden Legitimitätsformen eine größere Bedeutung für die Stabilität beigemessen werden kann, bildet den zentralen Gegenstand der aktuellen verfassungstheoretischen Debatte in der Transfor- Konsolidierung der politischen Ordnung 206 mationsforschung. Im folgenden werden die wichtigsten Argumente dieser Debatte aufgezeigt. Formale Legitimität ergibt sich gemäß den Verfahren der Verfassungsschöpfung (Elster 1994: 43f): Erstens bemißt sich die formale Legitmität der neuen Verfassung danach, wie die verfassungsgebende Versammlung zustande gekommen ist, d.h. ob sie demokratisch legitimiert war. Dies nennt Elster Legitimität von oben. Für diese Legitimitätsform ist beispielsweise die Unabhängigkeit der verfassungsgebenden Versammlung von Regierung und Parlament entscheidend, weil so die Unabhängigkeit von der an bestimmten Interessen orientierten Tagespolitik bestmöglich gewährleistet werden kann. Als zweites ist die (interne) Verfahrenslegitimität von Bedeutung. Sie hängt davon ab, welches interne Entscheidungsverfahren bei den Abstimmungen und Verhandlungen angewendet wurde. Drittens und letztens gewinnt die neue Verfassung Legitimität von unten, wenn sie dem Volk zur Verabschiedung vorgelegt wird. Aus der unterschiedlichen Kombination dieser formalen Legitimitätsquellen läßt sich eine Skala der Verfahrenlegitimität von „sehr demokratisch“ bis „demokratietheoretisch bedenklich“ konstruieren (Merkel / Sandschneider / Segert 1996: 20f): Sehr demokratisch wurde verfahren, wenn vom Volk eine verfassungsgebende Versammlung gewählt wird, die ihren Verfassungsentwurf nach demokratischen Prinzipien entwickelt bzw. beschließt und diesen dann auch dem Volk zur Annahme in einem Referendum vorlegt. Das gilt auch für den Fall, daß das Referendum ausbleibt – wie bei der Verfassungsgebung in Bulgarien (1991). Legitimität von oben wird eingebüßt, wenn durch ein bestehendes Staatsorgan der Verfassungsvorschlag ausgearbeitet wird und dann durch ein Referendum vom Volk angenommen wird – wie in Rußland (1993) und Rumänien (1991). Der Verfassungsentwurf wird in diesen Fällen also nicht unabhängig von Parlament oder Regierung entwickelt. Dieses Verfahren wird besonders dann demokratisch bedenklich, wenn die Annahme des Verfassungsentwurfs auch noch ohne Annahme in einem Referendum erfolgt. In diese letzte Kategorie fallen Polen (1992), Tschechien (1992), die Slowakei (1992) und Ungarn (1989). Aber auch wenn gelten sollte, daß „... the perceived legitimacy of the [constitution-making] process will be one determinant of the extent to which those rules are actually obeyed.“ (Elster / Offe / Preuss 1998: 64), darf die Bedeutung des Schöpfungsaktes nicht überschätzt werden. Es gibt besonders bei Regimezusammenbrüchen einen tradeoff zwischen demokratisch einwandfreien Verfahren der Verfassungsschöpfung und Zeitknappheit. In den Zeiten des Umbruchs sind die verfassungsgebenden Eliten oftmals nur während eines begrenzten Zeitabschnitts kompromißbereit, der keinen Raum für die zeitraubenden formal-legitimierenden Verfahren läßt. Längere Interimsphasen ohne demokratische Verfassung werden nicht gern in Kauf genommen, weil die Verfassungen die Grundlage der staatlichen Gemeinschaft und des politischen sowie wirt- Konsolidierung der politischen Ordnung 207 schaftlichen Handelns festlegen. Besonders in Osteuropa kam den neuen demokratischen Verfassungen eine große Bedeutung zu, da sich die neuen Führungen darum bemühten, jede Beziehung zum Kommunismus zu löschen und von der führenden Rolle der Partei Abstand zu nehmen. Deshalb waren in den osteuropäischen Ländern auch unmittelbar nach dem Kollaps der Regime Änderungen der Verfassung zu beobachten. Für die Entscheidung eine schnelle Lösung trotz der mangelnden formalen Legitimität anzustreben, spricht auch der Umstand, daß die Annahme durch einen Volksentscheid für die demokratische Stabilität nicht besonders bedeutend sein muß. Es gibt zahlreiche konsolidierte Demokratien mit stabilen Verfassungen, die ohne Verfassungsreferendum ausgekommen sind; das gilt beispielsweise für die Bundesrepublik Deutschland, Griechenland und Uruguay. Entscheidend sind auch die Kontexte, unter denen die Referenden durchgeführt werden. Sind diese gekennzeichnet durch Informationsverzerrung, und hat die politische Elite sich nicht um eine konsenssuelle, öffentliche39 Debatte bemüht, dann ist die Annahme des Entwurfs durch die Bevölkerung bedeutungslos für die demokratische Stabilität. Viel wichtiger als die formale Legitimität erscheint daher das politische Tagesgeschäft und die Übereinstimmung der in der Verfassung festgeschriebenen Institutionen mit demokratischen Grundsätzen. Empirische Legitimität steht vor der formalen Legitimität. Gerade weil bei der Verfassungsgebung die Spieler selbst die Spielregeln bestimmen und die verfassungskonforme Selbstbindung in einer noch instabilen politischen Situation immer wieder Compliance einfordern muß, ist die Handlung der Akteure und die Qualität des durch die Verfassung vorgegebenen institutionellen Designs so entscheidend. Handeln sie im Rahmen der Verfassungsinstitutionen, dann kann die Verfassung eine unterstützende Wirkung auf die demokratische Konsolidierung haben. Die Verfassung und ihre Institutionen müssen sich als Symbol für Stabilität und Kontinuität bewähren, um das Vertrauen der Eliten und der Bürger bzw. Bürgerinnen zu gewinnen. Empirische Legitimität bemißt sich allein aus der direkten Compliance der Akteure und aus den Eigenschaften der in den Verfassungen festgelegten Institutionen (vgl. Elster 1988; Merkel / Sandschneider / Segert 1996). Für die Compliance gilt es, in den demokratischen Regierungssystemen mit den institutionellen Bestandteilen der Verfassung Entscheidungsprozesse so vorzustrukturieren, daß die funktionalen Anforderungen demokratischer Regierungsysteme optimal erfüllt werden können. Demokratien müssen institutionell in die Lage versetzt werden, ein 39 Das Kriterium der Öffentlichkeit im Prozeß der Verfassungsgebung kann von entscheidender Bedeutung sein, weil unter dem Blick der Öffentlichkeit bei den Akteuren die Tendenz besteht, sich auf allgemein anerkannte und akzeptierte Prinzipien und Argumente zu beziehen und nicht nur nach Maßgabe des Selbstinteresses zu handeln. Die Beobachtung durch die Öffentlichkeit kann somit eine zivilisierende Wirkung haben (vgl. Elster 1994; Elster / Offe / Preuss 1998). Konsolidierung der politischen Ordnung 208 stabilitätswahrendes Gleichgewicht zwischen drei strukturell in ihnen angelegten Paradoxien zu schaffen (Diamond 1990: 48f): - In Demokratien muß es Konflikte geben können, aber gleichzeitig ein gewisser Grundkonsens aufrecht erhalten bleiben. - Politische Entscheidungen müssen repräsentativ sein und zugleich muß die Regierbarkeit gewährleistet werden. - Demokratien brauchen eine möglichst breite Zustimmung für ihre Entscheidungen, müssen aber gleichzeitig effektiv entscheiden können. In diesen Paradoxien stehen sich Regierbarkeitsprobleme und Legitimitätsprobleme gegenüber. Legitimität generiert sich dabei auch aus dem Grad der Regierbarkeit, die auf die Leistungsfähigkeit des Systems – die die Zustimmung generiert - zurückwirkt. Die institutionellen Anforderungen für Demokratien lassen sich vor dem Hintergrund der aus den Paradoxien folgenden Spannungen in zwei Dimensionen zusammenfassen (vgl. Thibaut 1996; Merkel 1996: 94f; Merkel / Sandschneider / Segert 1996: 24f): Erstens darf es keine systematische Benachteiligung von jedweden Minderheiten oder politischen Gruppen geben, d.h. die soziale und politische Inklusion der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen soll durch das institutionelle Design gewährleistet werden. Und zweitens müssen von der Bevölkerung die Entscheidungen und Politiken des Staates akzeptiert und gutgeheißen werden. Damit ist die Effizienz der Institutionen angesprochen. Die Bewältigung von Inklusions- und Effizienzproblemen bildet daher den Bewertungsmaßstab für die Legitimität und somit die Leistungsfähigkeit der in den Verfassungen festgeschriebenen Verfahren bzw. Institutionen wie Regierungs- und Wahlsystem. Die Leistungsfähigkeit und die institutionell vorgeschriebene Struktur der politischen Entscheidungsprozesse stehen in einem engen Zusammenhang (Thibaut 1996). Bevor die konkreten institutionellen Elemente der Verfassung installiert werden können, muß das grundlegende Problem der staatlichen Integrität gelöst sein. Wie läßt sich aber das „Stateness-Problem“ in multinationalen Staaten bewältigen? Um der Politisierung kultureller, religiöser oder ethnischer Konflikte aus machtstrategischen Erwägungen vorzubeugen, muß im Rahmen der Verfassungsgebung die Grundlage für eine konsensuelle Politik geschaffen werden. Dabei sind die Verfassungsarchitekten mit einer paradoxen Situation konfrontiert (Offe 1994: 172f): Die Kräfte, die eine alternative Identität gegenüber dem kommunistischen Regime anboten, indem sie den ethnischen Nationalismus hervorhoben, bilden jetzt die stärkste Bedrohung für die Einführung eines neuen, demokratischen Regimes. Eine Verfassung, die der Politisierung ethnischer Konflikte vorbeugen soll, muß umfassende und gleiche Bürgerrechte garantieren. Dazu gehört, daß dem Respekt vor den Menschenrechten ein hoher Stellenwert beigemessen wird, demokratische Teilnahme Konsolidierung der politischen Ordnung 209 garantiert ist und Selbstbestimmungsrechte eingeräumt werden. Werden Bürgerrechte gemäß der ethnischen Zugehörigkeit vorenthalten, dann hat dies auch Auswirkungen auf den sozioökonomischen Status – auf die Verteilung politischer und ökonomischer Ressourcen. Deshalb muß verhindert werden, daß sich in heterogenen Staaten die dominante Gruppe in bedeutenden Bereichen durchsetzt. Wenn Administration, Schulen und Medien auf eine offizielle Sprache begrenzt werden (wie bspw. in der rumänischen Verfassung), dann stellt das eine Majoritätspolitik dar, die zur legitimitätsgefährdenden Polarisierung führen kann (vgl. Glaeßner 1994). Wenn es auch an Akteuren mangelt, die andere kollektiv-rationale Strategien finden als die Ethnifizierung, so gibt es doch Chancen für eine Bewältigung des „Stateness-Problems“ (Offe 1994: 183): Ethnische Konflikte lassen sich auch befrieden, 1. wenn ein Lernprozeß stattfindet, der über einen oft von Leiden geprägten Weg zu der Erkenntnis führt, daß ethische neutrale Konzepte in der Politik gestärkt werden, 2. wenn der ethnische cleavage im Zuge der ökonomischen Modernisierung zu einem klassenpolitischen Konflikt wird, bei dem verteilungspolitische Fragen im Vordergrund stehen, und 3. wenn sich „multiple Identitäten“ bilden, die situationsspezifisch unterschiedliche Identifikationen erlauben. Die Chancen für die Realisierung dieser positiv evolutionären Entwicklungen, lassen sich allerdings schlecht einschätzen. 3.2 Regierungssystem Ein Kernstück der Verfassung ist die Festlegung auf das Regierungssystem. Hier entscheidet sich, welche Beziehung zwischen den staatlichen Gewalten herrschen soll. Das Regierungssystems bestimmt, wie Legislative und Exekutive voneinander abhängig sind und sich gegenseitig kontrollieren. Da die institutionelle Ausgestaltung ein Ergebnis der Akteurskonstellationen darstellt, bildet die konstitutionelle Festlegung des Regierungssystems - zumindest in den Ländern, in denen der Regimewechsel nicht von oben verordnet wurde - einen Kompromiß. In jedem Falle galt: wer die Verfassung schreibt, sichert sich Einfluß im politischen Geschehen (vgl. Elster 1994: 49; Przeworski 1991; Geddes 1996): In den Kompromiß fließen die strategischen Orientierungen der am Verfassungsprozeß beteiligten Akteure. Parteien mit einem starken Präsidentschaftskandidaten, und dies waren oft die Ex-Kommunisten, versuchten, sich mit einem Präsidentenamt, das mit umfassenden Kompetenzen ausgestattet sein sollte, die Macht zu sichern. Neue politische Gruppierungen hingegen wollten ihren Einfluß in einem System mit gestärktem Parlament, in dem sie ihre Interessen eher berücksichtigt sehen, sichern. Das Ergebnis solcher strategischen Verhandlungen kann dann problematisch werden, wenn Mischformen von Parlamentarismus und Präsidentialismus entstehen, die Kom- Konsolidierung der politischen Ordnung 210 petenzzuweisung nicht eindeutig oder widersprüchlich ist oder wenn die institutionellen Vorgaben die Gefahr eines permanten Konflikts zwischen den Gewalten bergen. Die Mischformen liegen auf einem Kontinuum zwischen den beiden Idealtypen „Parlamentarisches Regierungssystem“ und „Präsidentielles Regierungssystem“. Entlang dieser Idealtypen hat sich Anfang der 90er Jahre eine Debatte um die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Regierungssysteme entfacht. Zu dieser Renaissance einer alten demokratietheoretischen Fragestellung kam es, weil für die Verfassungen der post-kommunistischen Staaten westliche Verfassungen, z.B. die deutsche und insbesondere die U.S. amerikanische, als Orientierungspunkt galten (vgl. Linz / Stepan 1996). Es sollte entschieden werden, welches Regierungssystem der Konsolidierung junger Demokratien am angemessensten ist. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit den Demokratisierungen in Südeuropa und Süd- bzw. Mittelamerika wurde versucht, allgemeingültige Rückschlüsse für den Zusammenhang von Regierungssystem und demokratischer Stabilität zu ziehen. Sie bildeten die Grundlage für den Vergleich der institutionellen Leistungsfähigkeit parlamentarischer und präsidentieller Regierungssysteme im Hinblick auf ihre Inklusions- und Effizienzeigenschaften. Der Vergleich der Regierungssysteme in der Vergleichenden Regierungslehre erfolgt entlang der Beziehung zwischen Legislative und Exekutive, die im parlamentarischen System durch gegenseitige Abhängigkeit und im präsidentiellen System durch gegenseitige Unabhängigkeit gekennzeichnet ist (Stepan / Skach 1993: 3f): „A pure parliamentary regime in a democracy is a system of mutual dependence: The chief executive power must be supported by a majority in the legislature and can fall if it receives a note of no confidence. The executive power (normally in conjunction with the head of state) has the capacity to dissolve the legislature and call for elections. A pure presidential regime in a democracy is a system of mutual independence: The legislative power has a fixed electoral mandate that is its own source of legitimacy. The chief executive power has a fixed electoral mandate that is its own source of legitimacy.“. In dieser Beziehung sind die Randbedingungen für die Politik der neuen Regime in Osteuropa festgeschieben, innerhalb derer sie den wirtschaftlichen Wandel bewerkstelligen müssen bei gleichzeitiger Stabilisierung der Demokratie. Eine Kernthese, an der sich die aktuelle Debatte um die angemessene Regierungsform für Transformationsgesellschaften reibt, lautet, daß jungen Demokratien bei der Bewerkstelligung gravierender sozio-ökonomischer Reformen und der politischen Stabilisierung die institutionellen Eigenschaften eines parlamentarischen Regierungssystems eher entgegenkommen. Der Präsidentialismus hingegen sei besonders in Umbruchphasen durch ein strukturelles Defizit gekennzeichnet, weil er Anreize für Akteure setze und Entscheidungsregeln vorgebe, die besonders der demokratischen Konsolidierung Konsolidierung der politischen Ordnung 211 entgegenwirkten (vgl. Glaeßner 1994; Lijphard 1991; Linz 1990, 1990a; Stepan / Skach 1993; Riggs 199740). Die Argumente der Autoren, die diesen Standpunkt vertreten, lassen sich in fünf Punkten zusammenfassen: - In parlamentarischen Regierungssystemen sind die Regierungen geneigt, mit parlamentarischen Mehrheiten ihre Programme durchzusetzen. Das liegt daran, daß die gegenseitige Abhängigkeit von Exekutive und Legislative Anreize schafft und Entscheidungsregeln setzt, eine Ein-Parteien-Mehrheit oder Koalitionsmehrheit aufzustellen. In präsidentiellen Regierungssystemen hingegen gibt es die Möglichkeit und daher auch die Tendenz, bei fehlenden Mehrheiten mit Hilfe von Dekreten zu regieren. Mehrheiten sind für die demokratische Konsolidierung wichtig, weil sie den Entscheidungen bzw. Reformprogrammen demokratischen Rückhalt geben können, während ein Regieren am Parlament vorbei eine unangemessene Strategie für Programme zur ökonomischen und politischen Neustrukturierung darstellt. - Parlamentarische Regierungssysteme sind eher in der Lage, mit einem Mehrparteiensystem zu regieren. Für alle Mitglieder in einer Koalition gibt es den Anreiz zu kooperieren, wenn sie nicht die Macht verlieren wollen. Demokratien können daher im Parlamentarismus auch mit mehreren Parteien in der Legislative funktionieren. Das Amt des Präsidenten hingegen ist unteilbar. Die Kabinettsmitglieder stehen daher nicht als Agenten einer überdauernden Koalition in der Regierung, sondern als Individuen, die aus machtstrategischen Erwägungen des Präsidenten von ihm berufen werden können. Die Beteiligung mehrerer Parteien vereinfacht allerdings das demokratische Regieren, weil sich die Koalitionsbildung durch Inklusion auszeichnet. In Koalitionen können die vielschichtigen ethnischen, religiösen und / oder ökonomischen Konflikte über die Parteien, die idealerweise eine Position in diesen cleavages beziehen, von der Legislative berücksichtigt werden. Präsidentielle Systeme haben eher die Neigung, politisch zu polarisieren, besonders dann, wenn Exekutive und Legislative unterschiedliche parteipolitische Präferenzen haben. Darüber hinaus werden die Interessen organisierter Gruppen an den Rand gedrängt und damit Ansätze ziviler und politischer Gesellschaft erstickt. - Die Exekutive im parlamentarischen Regierungssystem ist weniger geneigt, am Rande der Verfassung zu regieren. Wenn in präsidentiellen Systemen mit Dekreten regiert wird, weil die Politik des Präsidenten keine Mehrheit der Exekutive im Parlament findet, wird oftmals am Rande der Verfassung regiert. Wegen seines eigenen Mandats sieht sich der Präsident zu einem solchen eigenständigen Schritt legitimiert. In parlamentarischen Systemen kann das Parlament eine Regierungsumbildung mit einem Mißtrauensvotum veranlassen, wenn die Führung am Rande der Verfassung regiert. Durch die Tendenz, mit Dekreten zu regieren, werden im präsi40 Bei Riggs heißt es bezüglich der Einführung präsidentieller Systeme in jungen Demokratien sogar: „...it is surely a recipe for desaster.“ (1997: 274). Konsolidierung der politischen Ordnung 212 dentiellen Regierungssystem die demokratischen Institutionenen der Legislative und der Parteien und damit auch die Legitimität des demokratischen Regimes geschwächt. - In parlamentarischen Regierungssystemen können Regierungskrisen gelöst werden, bevor sie sich zu Regimekrisen entwickeln. Das liegt an zwei Entscheidungsregeln: Erstens kann sich die Regierung nicht ohne eine Mehrheit in der Legislative bilden, und zweitens kann sie bei einem Vertrauensverlust von der Legislative abgesetzt werden. Im präsidentiellen Regierungssystem hingegen, ist es extrem schwer, den Präsidenten abzuwählen. Regierungskrisen können sich daher eher zu Regimekrisen entwickeln, was einer demokratischen Konsolidierung fundamental entgegengesetzt wirkt. Oftmals wird in Regimekrisen sogar der Ruf nach Einmischung des Militärs und damit die Aufhebung demokratischer Grundsätze laut. - Das politische System kann im parlamentarischen Regierungssystem eher langfristige Partei- und Regierungskarrieren bilden, die Loyalität und Erfahrung hervorbringen. Präsidenten tauschen gerne die Kabinettsmitglieder nach Maßgabe ihrer politischen Anliegen aus. Geht der Präsident, dann verschwinden auch die Minister. Dieser Wechsel erübrigt sich im Parlamentarismus wegen der Koalitionsmehrheiten. Wichtige Minister haben häufig lange und enge Bindungen zu ihren Parteien und werden im Falle der Wiederwahl auf ihren Posten belassen. Das ist deshalb ein Vorteil, weil Kontinuität und Erfahrung („continuity in governance“) der Regierung in ihren Verhandlungen mit der Bürokratie und den Agenten nationaler und internationaler Akteure helfen. Für die post-kommunistischen Staaten bedarf es in dem Streben nach Inklusion und Effizienz besonders des Aufbaus einer zivilen und politischen Gesellschaft. In einem präsidentiellen Regierungssystem muß unter Berücksichtigung der fünf aufgeführten Argumente aber eher eine Gefährdung und Unterdrückung eines solchen Aufbaus gesehen werden. Organisierten Gruppen fällt es schwer, Einfluß geltend zu machen oder etwa politische Kurse zu korrigieren, weil der Chef der Exekutive für einen feststehenden Zeitraum gewählt wird. Und Parteiprogrammen kommt hier weniger Bedeutung zu als in parlamentarischen Systemen. Die Gegenposition in der Debatte argumentiert nicht für eine prinzipielle Überlegenheit des präsidentiellen Systems. Sie plädiert für eine differenziertere Sichtweise und wendet sich vornehmlich aus methodischen Erwägungen gegen die Präsidentialismuskritik. Thibaut (1996) und Nohlen (1991) unterstellen den Untersuchungen Stepans, Lijphards und vor allem Linz‘ einen methodischen bias. Dieser kommt darin zum Ausdruck, daß eine mit Idealtypen formulierte Kritik die für politische Verfahren und Ergebnisse bedeutende Variationen des präsidentiellen Regierungssystems nicht berücksichtigt. Ihre Kritik läßt sich in den folgenden Punkten zusammenfassen: Konsolidierung der politischen Ordnung - 213 Die Kritik am Präsidentialismus orientiert sich weniger an seinen inhärenten Eigenschaften, als an Merkmalen anderer institutioneller Arrangements wie dem Wahlsystem oder dem Parteiensystem. Demokratieabträgliche oder –gefährdende Auswirkungen können auf dieser Basis dann nicht dem Präsidentialismus zugeordnet werden, weil ein bestimmtes Wahl- oder Parteiensystem nicht als feststehende Eigenschaft des Präsidentialismus angesehen werden kann. - Die Präsidentialismuskritik postuliert kausale Zusammenhänge, die von der konkreten Variation zusätzlicher institutioneller Faktoren des politischen Systems in unzulässiger Weise abstrahieren. Faktoren wie das Wahlsystem oder auch die konkreten historischen Bedingungen bestimmen den Zusammenhang zwischen Regierungsform und politischem Wettbewerb bzw. den Charakter der Parteienlandschaft. Die Annahme des kausalen Zusammenhangs zwischen Präsidentialismus und einer Tendenz zur Fragmentierung und Polarisierung des politischen Wettbewerbs ist deshalb nicht plausibel. Genauso wenig ist es plausibel, daß präsidentielle Regierungssysteme prinzipiell nicht konsensorientiert sind - ein Gegenbeispiel bildet der Präsidentialismus in den USA. - Die Präsidentialismuskritik argumentiert von einer Position aus, die unterstellt, daß für Demokratien in der Konsolidierungsphase vor allem institutionell garantierter Konsens wichtig ist. In politischen Konflikten wird eine Bedrohung für junge Demokratien gesehen. Damit findet das funktionale Erfordernis der Inklusion eine unzulässige Überbetonung. Effektivität, die sich in der Entscheidungs- und Problemlösungskapazität ausdrückt, wird unterbewertet. Rückt man dem entgegen die Effektivität ins Blickfeld, dann kann die Überlegenheit eines Regierungssystems nicht auf seine Eigenschaften, insbesondere Konsens und Kompromiß zu fördern, zurückgeführt werden. - Ebenso wie die Konsens- und Kompromißfähigkeit einer politischen Ordnung nicht nur vom Regierungssystem abhängen, hängt auch die Entscheidungs- und Problemlösungskapazität von intervenierenden Variablen ab. In der Policy-Forschung werden hier Faktoren wie die interne Organisation der Regierung, die Beziehung zur Legislative und Verwaltung und die konkrete personelle Besetzung der Regierungseinheiten identifiziert. Aus diesen Gründen lehnen Thibaut und Nohlen eine komparative Analyse der Regierungsysteme ab, wenn in ihr die verschiedenen Variationen der Regierungssysteme nicht berücksichtigt werden oder konkrete gesellschaftspolitische Probleme und Konfliktstrukturen unberücksichtigt bleiben. Den Idealtypen stehen in der Realität Regierungsysteme mit spezifischen, institutionellen Variationen gegenüber, die sich im historischen Kontext der Länder entwickelt haben. Erst die Verschränkung von Regierungssystem und den zusätzlichen institutionellen Dimensionen des politischen Systems entscheidet darüber, ob das System eher konsens- und kompromißorientiert (konsensde- Konsolidierung der politischen Ordnung 214 mokratisch) oder eher leistungs- und problemlösungsorientiert (mehrheitsdemokratisch) ist. Hierin besteht die z.T. verdeckte Fragestellung, die der Debatte um die Überlegenheit eines der Regierungssysteme unterliegt. Für die institutionentheoretische Untersuchung der Konsolidierungschancen ist die Frage entscheidend, ob die mehrheitsdemokratischen oder die konsensdemokratischen Elemente adäquat auf die Problemstruktur eines Landes reagieren können (Merkel 1996). Autoren wie Linz, Stepan und Scach, Lijphard und Glaeßner unterstellen dem Präsidentialismus eine Tendenz zur Majoritätsherrschaft. Dem parlamentarischen System hingegen wird eine höhere Konsensfähigkeit unterstellt. Aufgrund des mangelnden Grundkonsens in den Transformationsgesellschaften wird in der Machtkonzentration eine Gefahr gesehen, und es wird davon ausgegangen, daß die gesellschaftlichen Differenzen nur in einem Konsensmodell adäquat abgearbeitet werden können. Ob ein politisches System allerdings primär macht- oder konsensorientiert ist, hängt nicht nur vom Regierungssystem ab. Für eine solche Beurteilung muß die zum Regierungssystem parallele institutionelle Ausgestaltung des Wahlsystems, des Parteiensystems, der Verbände, der Verwaltung und relevanten politischen Akteure berücksichtigt werden. Erst der in der Realität vorliegende Mix dieser institutionellen Arrangements entscheidet über die Fähigkeit des politischen Systems, Inklusion und Effizienz zu generieren. Der institutionelle Kontext entscheidet also über die Orientierung des politischen Systems – ob eher konsens- oder eher majoritätsorientiert. Darüber hinaus entscheidet der sozio-ökonomische und historische Kontext über die Angemessenheit der jeweiligen Orientierung41. Es kann nämlich nicht einfach davon ausgegangen werden, daß für junge Demokratien ein genereller Vorteil konsensueller Institutionen gegenüber einem mehrheitsdemokratischen Institutionenmix besteht42. Es verhält sich nämlich vielmehr so, daß es Regierungsfunktionen - wie Regierbarkeit und Effektivität - gibt, die eher durch majoritäre Entscheidungsmechanismen optimiert werden und daher in einer Machtkonzentration ihr institutionelles Äquivalent finden. Andere Regierungsfunktionen – wie Repräsentation und Integration gesellschaftlicher Interessen - werden eher durch konsensorientierte Verfahren optimiert (Thibaut 1996: 53). Welcher Orientierung aus Stabilitätsgründen der Vorrang einzuräumen ist, hängt primär von der Kon- 41 Hier muß einschränkend angemerkt werden: Selbst wenn das dem sozio-ökonomischen Kontext angemessene System gewählt wird, ist dies keine Garantie für die Erfüllung der mit der Einführung des entsprechenden Regierungssystems verbundenen Hoffnungen. Gerade für parlamentarische Systeme zeigt sich in Ostmitteleuropa, daß in Abwesenheit einer gut funktionierenden Exekutive und demokratischer politischer Parteien die Parlamente ihre Demokratisierungschancen nicht ausschöpfen können (D.M. Olson 1997: 402f). In der Transformation waren die Parlamente mit dem Übergang von Passivität zum Aktivismus und von der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit oft überfordert. Die erweiterten Handlungsoptionen blieben wegen der mangelnden Handlungsfähigkeit ungenutzt („opportunity/capability gap“). 42 Dagegen Lijphart (1991:75f). Konsolidierung der politischen Ordnung 215 fliktstruktur der Gesellschaft und dem sozio-ökonomischen Kontext ab (Merkel / Sandschneider / Segert 1996; Merkel 1996): Für Gesellschaften, in denen eine starke Fragmentierung vorliegt und die ethnisch, national oder religiös heterogen sind, erfüllt die institutionell vorgegebene Konsensorientierung Inklusions- und Effizienzansprüche. Bereits integrierte Gesellschaften mit einer homogenen Struktur können stärker die Vorteile majoritär orientierter Institutionen (Policy-Innovationen <Thibaut 1996>) ausnutzen. Für den sozio-ökonomischen Kontext der Konsolidierung post-komunistischer Staaten gilt, daß die institutionelle Ausgestaltung der Regierungssysteme funktional-äquivalente Lösungen für die spezifischen Probleme der Systemwechsel bieten muß. Die Institutionen müssen die Konflikte bewältigen, die aus der Änderung der politischen und wirtschaftlichen Makrostrukturen resultieren können, und die tiefgreifenden Wirtschaftsreformen bewerkstelligen. Neben den kontextabhängigen Kriterien für die Angemessenheit eines Regierungssystems lassen sich auch kontextunabhängige Aussagen bezüglich der institutionellen Leistungsfähigkeit von Regierungssystemen treffen. Dies gilt für die Zwischenformen – hierin stimmen die konträren Positionen in der Debatte um die Vorzüge des präsidentiellen bzw. des parlametarischen Regierungsystems überein. Zwischenformen sind oftmals das Ergebnis einer weitreichenden Kompromißbildung wie sie z.B. in Polen am Runden Tisch stattgefunden hat. Um die Zwischenformen zu identifizieren, muß man die institutionelle Ausgestaltung der Beziehung von Legislative und Exekutive genauer untersuchen. Dies kann anhand von Kriterien geschehen, wie sie Merkel (1996: 77) zusammengefaßt hat: Die Machtbeziehung von Parlament und Regierung bzw. Parlament und Präsident wird geprägt von den Kontrollrechten des Parlaments gegenüber der Regierung, vom Vorhandensein eines Rechts des Präsidenten, das Parlament aufzulösen oder die Regierung abzusetzen, sowie von legislativen Vetorechten und speziell zugewiesenen Politikmandaten des Staatsoberhauptes. Merkel beschreibt anhand dieser Kriterien die institutionellen Besonderheiten von Regierungsystemen, die sich nicht eindeutig als präsidentielle Regierungssysteme (wie es in seiner reinen Form in keinem osteuropäischen Staat installiert wurde) oder als rein parlamentarisches System (wie die Regierungssysteme in Bulgarien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei) identifizieren lassen (1996: 78): Die erste Mischform bildet das „präsidentiell-parlamentarisches Regierungssystem“ wie es in Rußland eingeführt wurde. In diesem Regierungssystem werden zwei Führer der Exekutive gewählt. Der Präsident wird vom Volk direkt gewählt und der Premier wird indirekt, vom Parlament, gewählt. Der Präsident hat außerdem nicht nur das Recht, Mitglieder des Kabinetts auszutauschen. Er hat auch Vetorechte gegen ein parlamentarisches Mißtrauensvotum. Insofern ist die kontrollierende Wirkung des Mißtrauensvo- Konsolidierung der politischen Ordnung 216 tums des Parlaments gegenüber der Regierung stark beschnitten. In der anderen Mischform, dem „parlamentarisch-präsidentiellen System“, gibt es zwar auch eine doppelte Führung in der Exekutive. Jedoch sind die Rechte des Präsidenten beschränkter. Er kann nicht gegen den Willen des Parlaments die Regierung entlassen oder den Regierungschef stürzen. Diese Kategorie bildet eine institutionelle Charakterisierung des polnischen Regierungssystems. Mit der Typologie lassen sich das Machtverhältnis von Exekutive und Legislative sowie die Machtkonflikte innerhalb der Legislative eines semipräsidentiellen Systems verdeutlichen. In beiden Mischsystemen ist der potentielle Konflikt zwischen den Gewalten strukturell angelegt. Zwischen Präsident und Regierung bzw. zwischen Präsident und Legislative gibt es keine eindeutige Kompetenzzuweisung. Vielmehr wird innerhalb der Exekutive um Kompetenzen gestritten. Das hemmt die Entscheidungsfähigkeit des Regierungssystems (vgl. Merkel / Sandschneider / Segert 1996; Merkel 1996; Glaeßner 1994), was den Verlust der Unterstützung in der Bevölkerung nach sich zieht. In Polen hatte der ständige Konflikt zwischen Präsident und Sejm bzw. Regierung einen politischen Stillstand zur Folge. Wichtige Entscheidungen wurden aufgeschoben, und daher konnten anstehende Probleme nicht gelöst werden (Merkel 1996). In Rußland hat Jelzin den institutionell angelegten Konflikt zwischen Exekutive und Legislative entschieden, in dem er einfach ohne Mehrheiten mit der Hilfe von Dekreten politische Entscheidungen durchsetzte. Mit diesem Vorgehen bewegt sich das Regime weg von demokratischen Entscheidungsprozeduren hin zu autoritären Regierungsstilen. Deshalb kann dort auch kaum noch von einer „Institutionalisierung der Demokratie“ die Rede sein, sondern eher von der Durchsetzung eines „plebiszitären Autoritarismus“ (Brie 1996: 172; Bos 1996). Kontextunabhängig, also ohne Beachtung des institutionellen und der sozio-ökonomischen Randbedingungen, läßt sich zusammenfassen, daß eine uneindeutige Allokation von Entscheidungskompetenzen und die konfligierende Definition von Machtstrukturen in Mischsystemen dem Konsolidierungsprozeß junger Demokratien entgegen wirkt. Der im Semipräsidentialismus institutionell angelegte Konflikt um Kompetenzen kann zu wechselseitigen Blockaden führen, die die Entscheidungseffizienz der Regierung unterdrücken. 3.3 Wahlsystem Ganz ähnlich wie es die Auseinandersetzung um die Angemessenheit eines bestimmten Regierungssystems gibt, gibt es auch eine Diskussion um die Vorzüge bestimmter Wahlsysteme für die Konsolidierung (vgl. Lijphard / Waisman 1996; Geddes 1996; Gebethner 1996). Wahlsysteme haben eine zentrale Bedeutung bei der Ausgestaltung Konsolidierung der politischen Ordnung 217 des politischen Wettbewerbs – sie bestimmen, ob er sich eher konsensual oder eher konfliktorientiert gestaltet. Die wichtigste Eigenschaft von Wahlsystemen ist die Übersetzung der Wahlpräferenzen der Bürger in demokratisch legitimierte politische Macht (Elster / Offe / Preuss 1998: 111f). Die Art des Wahlsystems bestimmt die Relation zwischen Stimmen und Mandaten. In dieser Relation kann je nach Repräsentationssystem ein mehr disproportionales oder ein stärker proportionales Verhältnis herrschen. Genau an dieser Stelle entzündet sich die Debatte um die Auswirkung der verschiedenen Wahlsysteme. Über die Relation von Stimmen und Mandaten wirkt das Wahlsystem auf die Art der politischen Willensbildung, auf die Struktur des Parteiensystems und -wettbewerbs, darauf, wie ethnische, religiöse, nationale sowie weitere soziale cleavages politisch gemanagt werden und wie politische Alternativen strukturiert werden (Nohlen / Kasapovic 1996; Elster / Offe / Preuss 1998). Satori (1994) faßt die Effekte von Wahlsystemen in zwei Kategorien zusammen: Sie haben einen „constrain-effect“, weil sie die Entscheidung der Wähler auf eine festgelegte Weise umsetzen und sie somit beschränken, und sie haben einen „reductive-effect“, weil sie die Anzahl der politischen Parteien mit beeinflussen. Wie kann der Übersetzungsprozeß von Wählerpräferenz zu politischer Macht im Wahlsystem gestaltet werden? Diese Frage wird auf zwei Dimensionen entschieden: Erstens auf der Dimension der Repräsentation und zweitens auf der Dimension der Entscheidungsregeln (Nohlen / Kasapovic 1996: 18f): Die politische Repräsentation kann nach der Mehrheitswahl erfolgen, bei der es das primäre Ziel ist, für eine Partei oder einen Verbund von Parteien eine politische Regierungsmehrheit zu erzielen, oder nach der Verhältniswahl, bei der darauf abgezielt wird, die Kräfteverhältnisse organisierter aber auch nicht organisierter Interessen in der Bevölkerung wiederzugeben. Die Entscheidungsregeln setzen sich aus den „technischen Elementen“ - der Einteilung der Wahlkreise, der Listenform, d.h. der Form der Kandidatur und Stimmgebung und der Verrechnung der Stimmen - mit denen die konkrete Ausgestaltung des Wahlsystems erfolgt, zusammen. Alle Wahlsysteme, auch die gemischten, bei denen über die Kombination von Entscheidungsregeln Mehrheits- oder Verhältnisorientierungen ausgeglichen bzw. kombiniert werden, lassen sich entweder der Mehrheits- oder der Verhältnisrepräsentation zuordnen – „Tertium non datur“ (Nohlen / Kasapovic 1996: 19). Der Grund dafür, daß auf der Repräsentationsebene keine gemischten Systeme existieren können, liegt in der widersprüchlichen Funktionserfüllung, die sich in den Zielen von Mehrheitswahl einerseits und Verhältniswahl andererseits ausdrücken - besonders zwischen Repräsentation und Partizipation können Zielkonflikte bestehen. Entsprechend werden in der Debatte um das angemessene, besser geeignete Wahlsystem die Vorteile der Repräsentation durch Mehrheitswahl gegenüber der Repräsentation durch Verhältniswahl gegenübergestellt (Nohlen / Kasapovic 1996: 20f): Von der Mehrheitswahl wird erwartet, daß sie der Zer- Konsolidierung der politischen Ordnung 218 splitterung der Parteien vorbeugt, weil die Chancen der kleinen Parteien, Mandate zu gewinnen, gering sind. Eng damit verbunden ist der Effekt, daß sich die Parteien bei der Mehrheitswahl durchsetzen, die um die Gunst der breiten Wählerschicht der gemäßigten Wähler werben, was zur politischen Mäßigung führt. Eine Stabilisierungswirkung wird erwartet, weil die Mehrheitswahl das Entstehen von Mehrheitsregierungen begünstigt. Gleichzeitig kann es aber auch recht schnell zum politischen Wechsel kommen, weil geringe Änderungen der Stimmenverhältnisse zu großen Umschwüngen bei den Mandatsverhältnissen führen können. Und nicht zuletzt wird der Mehrheitswahl ein Legitimitätsvorteil unterstellt, weil die Wähler unmittelbar über die Regierungsführung entscheiden. Die Vorteile der Verhältniswahl werden besonders in der Eigenschaft gesehen, eine breite Repräsentation der gesellschaftlichen Orientierungen und Interessen im Parlament zu gewährleisten. Somit können nicht nur gesellschaftliche Änderungen berücksichtigt werden, sondern es ergibt sich die Notwendigkeit, bei Koalitionsabsprachen über Kompromisse zu verhandeln, die eine Integration verschiedener gesellschaftlicher Interessen und damit die Berücksichtigung gesellschaftlicher Konfliktlinien gewährleisten. Außerdem verhindern Verhältniswahlen manufactured majorities (Kasapovic / Nohlen 1996: 224) - künstliche Mehrheiten, denen keine Mehrheit bei den Wählern gegenübersteht, womit auch extremen, politischen Änderungen vorgebeugt wird. Mit diesen Argumenten wird auf Anforderungen an die institutionelle Leistungsfähigkeit von Wahlsystemen verwiesen. Vor allem wird von ihnen die Erfüllung dreier zentraler Funktionen erwartet (Nohlen / Kasapovic 1996: 183f): Sie sollen die gesellschaftlichen Interessen und Meinungen repräsentieren, die politische Macht wenigstens so weit konzentrieren, daß effektive politische Entscheidungen zustandekommen und durchgesetzt werden können, und sie dürfen der Partizipation von Bürgern und Interessengruppen an der politischen Macht nicht im Wege stehen43. Die Diskussion, die die Leistungsfähigkeit von Wahlsystemen entlang der Repräsentationsform thematisiert, führt aus zweierlei Gründen an der Problematik des angemessenen Wahlsystems vorbei: Es wird verkannt, daß erstens die Erfüllung der funktionalen Anforderungen und die politischen Auswirkungen des Wahlsystems erst durch das Zusammenspiel der Elemente der Entscheidungsregeln geprägt werden und daß zweitens der sozio-kulturelle und politische Hintergrund wesentliches Kriterium der Angemessenheit eines Wahlsystems bleibt. Die politischen Effekte des Wahlsystems auf andere institutionelle Ebenen - wie das Parteiensystem - und die Erfüllung funktionaler Anforderungen der Wahlsysteme lassen sich durchaus gestalten. Erst die Kombination verschiedener Elemente des Wahlsy43 Nohlen und Kasapovic stellen diesen drei Hauptanforderungen zwei weitere zur Seite (1996: 184): Die Einfachheit des Wahlsystems, so daß die Umsetzung des Votums in politische Macht nachvollziehbar ist, und Legitimität, die sich auf die Akzeptanz des Wahlsystems bezieht. Konsolidierung der politischen Ordnung 219 stems bestimmt den Typus des Verhältniswahlsystems bzw. des Mehrheitswahlsystems (Nohlen / Kasapovic 1996: 22f): - Die Einteilung der Wahlkreise in Einer- oder Mehrpersonenwahlkreise kann die Funktion der politischen Repräsentation gestalten, da sich die Größe des Wahlkreises auf die Proportionalität von Stimmen und Mandaten auswirkt. Werden wenige Mandate in einem Wahlkreis vergeben, dann wird ein höherer Stimmenanteil benötigt, um ein solches zu realisieren. Kleine Parteien haben dabei schlechtere Chancen, so daß die Interessen der Bürger nicht proportional übersetzt werden können. Damit wirkt die Wahlkreiseinteilung auf das Parteiensystem und hat eine weitere politische Bedeutung in der Gestaltung der Machtverhältnisse. - Kandidatur- und Stimmgebungsverfahren unterscheiden sich danach, ob eine Einzelkandidatur und dementsprechend eine Einzelstimmenabgabe erfolgt oder ob Parteien über Listen kandidieren bzw. Listenstimmgebung vorgegeben ist. Mit diesen Elementen kann vor allem die Funktion der politischen Repräsentation gesteuert werden. Führen die anderen Elemente des Wahlsystems dazu, daß die Parteien geschwächt sind, dann kann dieser Effekt mit einer Listenwahl ausgeglichen werden. Wird dementgegen eine zu große Machtkonzentration bei den Parteien bemängelt, können eine Einzelkandidatur oder nicht starre Listen, die eine Kandidatenreihenfolge vorschreiben, eine Lösung für eine nicht zufriedenstellende Repräsentation darstellen. Die politischen Auswirkungen dieser Elemente des Wahlsystems sind in dem Verhältnis von Wähler und Kandidaten sowie von Kandidat und der jeweiligen Partei zu suchen. Bei Einzelkandidaturen können sich die Wähler durch konkrete Personen vertreten sehen, und der Kandidat wird unabhängiger von seiner Partei. Bei Listenwahlen hingegen hat der Wähler geringeren Einfluß auf die parteiinterne Kandidatenauswahl, und dementsprechend steigt die Abhängigkeit des Kandidaten von seiner Partei. - Für die Verrechnung der Stimmen, die sich auf Repräsentationsfunktion und Konzentrations- bzw. Effektivitätsfunktion auswirkt, ist die Wahl der Entscheidungsregel zwischen Majorz und Proporz richtungsweisend. Majorz begünstigt die Konzentrationsfunktion, weil derjenige Kandidat das Mandat gewinnt, der eine relative oder absolute Mehrheit der Stimmen bekommt - nur der Sieger eines Wahlkreises bekommt ein Mandat. Die politische Wirkung dieser Entscheidungsregel besteht darin, daß die Entscheidungssituation für die Wähler an Klarheit gewinnt. Negativ kann sich allerdings auswirken, daß durch die Konzentration eine Partei vorherrscht und damit die Motivation für Opposition sowie die Parteienlandschaft verödet und die Wahlbeteiligung nachläßt, weil die nicht erfolgreichen Stimmen völlig unberücksicht bleiben. Im Proporz hingegen, der auf Repräsentation zielt, finden auch die Stimmen, die keine Mehrheit erlangen konnten, Berücksichtigung, weil die Vergabe der Mandate nach dem Stimmenanteil erfolgt. Parteien haben deshalb einen Konsolidierung der politischen Ordnung 220 Anreiz, um jede Stimme zu kämpfen, wodurch ein reger Wettbewerb der Parteien erwartet werden kann. Außerdem ist der Anreiz für die Wähler höher, sich an der Wahl zu beteiligen. Die Konzentrationsfunktion kann allerdings auch bei Proporzsystemen erfüllt werden, nämlich dann, wenn künstliche Hürden bei der Umsetzung von Stimmen in Mandate eingeführt werden. Solche Sperrklauseln können je nach Ansatzhöhe einen Konzentrationseffekt haben, weil kleinen Parteien der Zugang zur parlamentarischen Repräsentation erschwert wird. Die Erfüllung funktionaler Anforderungen, die politischen Auswirkungen des Wahlsystems und damit auch die Vor- und Nachteile des gewählten Repräsentationsprinzips hängen aber nicht nur vom „technischen Design“ des Wahlsystems ab. Die historischen Erfahrungen eines Landes und die sozialstrukturellen Bedingungen, die den Grad der gesellschaftlichen Homogenität sowie die gesellschaftlichen Konfliktlinien vorgeben, sind der bestimmende Kontext, in dem Wahlsysteme eine spezifische Wirkung entwickeln. Sie bestimmen den von Satori festgestellten „constrain-effect“ auf die Entscheidungsfreiheit der Wähler mit. Solche Kontextvariablen entscheiden darüber hinaus über den von Satori erwähnten „reductive-effect“, weil sie Auswirkungen des Wahlsystems auf die Parteienlandschaft mitbestimmen. Repräsentieren die Parteien nämlich beispielsweise diffuse Programme oder sind sie schlecht organisiert und gibt es eine hohe Wählerfluktuation, wie in den meisten ostmitteleuropäischen Staaten, dann können auch die Entscheidungsregeln der Wahlsysteme die Anzahl der Parteien nicht reduzieren geschweige denn die Parteienlandschaft strukturieren (Elster / Offe / Preuss 1998: 129). Wie relevant der Kontext für die Wirkung des Wahlsystems ist, offenbart sich auch bei empirischen Untersuchungen zu den Wahlsystemen in Osteuropa. Wie auch die Festlegung der anderen institutionellen Dimensionen der Verfassung, folgt die Wahl und die Ausgestaltung des Wahlsystems weniger der Einschätzung ihrer Funktionsweise und Angemessenheit als der machtstrategischen Orientierung der verhandelnden Akteure, die die Verfassung gestalten. Dennoch kann versucht werden, die Wahlsysteme der post-kommunistischen Staaten nach der Erfüllung von Funktionsanforderungen und damit auch z.B. nach einem durch seine Elemente gesetzten Primat bei Konsens- oder Konfliktorientierung zu untersuchen, um konkrete Probleme für die Konsolidierung herauszustellen. Das vorherrschende Repräsentationsprinzip in den post-kommunistischen Staaten ist die Verhältniswahl. Die Gestaltung der Entscheidungsregeln ist in den Wahlsystemen relativ konform (Kasapovic / Nohlen 1996): Es handelt sich um Verhältniswahlsysteme mit Mehrpersonenwahlkreisen und Sperrklauseln. Diese Elemente sind kombiniert mit starren Listen und Einzelstimmgebung. Sowohl in Polen und Rumänien, als auch in der Slowakei und in Tschechien gibt es die Verhältniswahl in Personenwahlkreisen. Bulgarien weicht von diesem System etwas ab. Zwar gilt auch dort die Verhältniswahl mit Konsolidierung der politischen Ordnung 221 Sperrklausel. Die Verrechnung der Stimmen erfolgt aber zuerst auf der nationalen Ebene. In Ungarn verhält es sich so, daß die Verhältnismandate durch kompensatorische Mandate ausgeglichen werden, um Disproportionseffekte, die durch die Vergabe von Listenmandaten nach Proporz zustande kommen können, auszugleichen. Die Gründe bzw. Motive für die Einführung des Verhältniswahlrechts sind darin zu sehen, daß die Herrschaftseliten entweder ihren politischen Machtanspruch aufgegeben haben oder die Opposition – wie in Polen – große Wahlsiege erringen konnte, was sie legitimierte und befähigte, Reformen in Richtung Verhältniswahl durchzusetzen. Dem unterliegt die Annahme, daß diejenigen, die die institutionelle Gestaltung des politischen Systems bestimmen bzw. aushandeln, von politischem Selbstinteresse geleitet werden (vgl. Geddes 1996: 18; J. Simon 1997: 371). Damit spielen machtstrategische Erwägungen und die Verhandlungsmacht bei der Verabschiedung eines Wahlsystems eine wichtige Rolle. Entsprechend zeigte sich auch, daß Kommunisten, die ihre Macht behalten konnten, das Majoritätsprinzip bevorzugten. Und das aus drei Gründen: 1. weil die organisatorische Basis ihrer Partei besser war als die der Oppositionskräfte, 2. weil sie davon ausgingen, daß die Mitglieder der lokalen Verwaltung noch in der Lage waren, genug Stimmen anzuziehen, und 3. weil sie darauf bauten, daß sie auf der nationalen Ebene Kandidaten nominieren konnten, die sich eines höheren Bekanntheitsgrades in der Öffentlichkeit erfreuten (Elster / Offe / Preuss 1998: 112). Aus denselben Gründen setzten sich die oppositionellen Parteien eher für Verhältniswahlsysteme ein. Fast alle Oppositionen in kommunistischen Staaten gehörten zu der Kategorie der kleineren Interessengruppen und Parteien sowie Parteien und Interessengruppen, die sich unsicher über ihre zukünftig bevorzugte, proportionale Repräsentation waren - sie unterschätzten dabei aber oftmals ihre Stärke und fanden sich deshalb mit Zugeständnissen ab, mit denen sie sich nicht zufrieden gegeben hätten, wenn ihre Einschätzungen akkurater gewesen wären (vgl. Geddes 1996: 21f). Die machtstrategische Determiniertheit des Wahlsystems zeigt sich auch an den Reformen der Wahlsysteme. Mit dem Machtverlust und der Zersplitterung der kommunistischen Parteien oder Nachfolgeparteien nahm allgemein die Tendenz hin zur Verhältniswahl (Bulgarien, Polen und Jugoslawien) zu. Kombinierte Wahlsysteme wie das in Rußland kamen aufgrund von Kompromissen und Wahlsiegen der oppositionellen Kräfte zustande. Seit Jelzins Wahl 1991 gab es einen ständigen Machkonflikt zwischen dem Präsidenten und dem Parlament, bei dem die Gestaltung der Verfassung eine zentrale Stellung einnahm. In einer umfassenden Untersuchung zu den Wahlsystemen in Osteuropa kommen Kasapovic und Nohlen zu den folgenden Schlußfolgerungen (1996: 248f): Die politischen Auswirkungen der kombinierten Wahlsysteme sind in besonderem Maße kontextabhängig. Sie bilden vielleicht eine angemessene institutionelle Lösung für Pattsituationen, die sich aus den machtstrategischen Motiven der politischen Akteure ergeben, allerdings stehen bei der Instrumentalisierung von Elementen der Entscheidungsregeln im Konsolidierung der politischen Ordnung 222 machtstrategischen Kalkül nicht die Funktionserfüllungen und schon gar nicht Inklusions- und Effizienzkriterium der Institutionen im Vordergrund. Daher können die konkreten Wahlsysteme sowohl den Erwartungen der Verhältniswahl als auch den Erwartungen der Mehrheitswahl entsprechen. Die politischen Auswirkungen des angewendeten Verhältniswahlrechts auf die Parteienstruktur, den Proportionseffekt (Verhältnis von Stimme und Mandat) und der Regierungsbildung (Koalitionsregierung oder Einparteienregierung) zeigen zwar z.T. die Auswirkungen, die aufgrund der theoretisch konstatierten Zusammenhänge erwartet werden könnten. Allerdings gibt es auch bedeutende Ausnahmen. Besonders eine Kontextvariable zwingt zur Zurückhaltung bei der Einschätzung des Zusammenhangs zwischen Verhältniswahl und Mehrparteiensystem: Die Parteienlandschaft in den post-kommunistischen Staaten ist derartig instabil, daß sich von ihr nicht abstrahierend auf einen solchen Zusammenhang schließen läßt. Dementsprechend vorsichtig muß auch mit der Einschätzung bezüglich der Erfüllung der funktionalen Erfordernisse der Wahlsysteme umgegangen werden (Nohlen / Kasapovic 1996: 180f): Mehrheitswahlsysteme können zwar eher Konzentration und Partizipation fördern. Verhältniswahlsysteme hingegen vor allem Repräsentation und über die institutionelle Ausgestaltung der Wahlkreise und Listen auch Konzentration. Damit sind nicht bestimmte Designs der Wahlsysteme funktionaler als andere. Vielmehr müssen vor dem Hintergrund gesellschaftspolitischer Erfordernisse Prioritäten gesetzt werden, mit denen sich die Wahl eines Repräsentationssystems und deren institutionelle Ausgestaltung begründen läßt44. Allen funktionalen Erfordernissen kann kein Wahlsystem gerecht werden, zumal es auch Zielkonflikte zwischen Anforderungen wie Partizipation und politischer Stabilität gibt. Sowohl die politischen Auswirkungen als auch die Erfüllung der funktionalen Erfordernisse von Wahlsystemen verweisen auf zwei Dimensionen: Einmal entscheidet der „innere Kontext“, d.h. die Ausgestaltung der technischen Elemente, und zum zweiten der „äußere Kontext“, die sozio-ökonomischen Herausforderungen und die Gestaltung des institutionellen Umfeldes (Parteienstruktur, Regierungssysteme usw.), und nicht etwa pauschal das gewählte Repräsentationsprinzip, über die politische Angemessenheit und die Funktionalität eines Wahlsystems. In der akademischen Diskussion darf allerdings nicht untergehen, daß Wahlsysteme in der Regel nicht aufgrund ihrer besonderen Eignung zur Bewältigung gesellschaftlicher 44 Die Entscheidung für ein Wahlsystem ist immer auch mit einer Debatte darüber, was demokratische Repräsentation leisten soll, verbunden. Blais (1991) stellt fest, daß empirische Überprüfungen von Wahlsystemen viel weniger ihre tatsächlichen Konsequenzen widerspiegeln als die Werthaltung, die die Entscheidung für ein Wahlsystem bestimmte. Je nach Einschätzung, ob Ziele wie Stabilität, Führungsstärke, Zuverlässigkeit, Fairneß oder auch Legitimität dem Kontext angemessen bzw. erforderlich sind, fällt die Präferenz für ein bestimmtes Design des Wahlsystems aus. Die Werte weisen auf die Frage nach der Funktion der demokratischen Repräsentation, den Erwartungen also, die mit der Einführung eines Wahlsystems verbunden sind. Konsolidierung der politischen Ordnung 223 Herausforderungen eingeführt werden. Wahlsysteme sind primär Ergebnis strategischer Kalküle45, die Auswirkungen auf Machtkonstellationen zu antizipieren versuchen und sich bezüglich der Wirkungsweise von Institutionen täuschen können. 3.4 Parteien und Interessengruppen Parteien und Parteiensystem sind zwar nicht Gegenstand des in der Verfassung vorgeschriebenen institutionellen Designs der neuen politischen Systeme. Der Institutionalisierungsgrad von Parteien bzw. die Institutionalisierung eines Parteiensystems haben aber einen bedeutenden Einfluß auf die Gestaltung der politischen Ordnung. Die Konsolidierung der Demokratie ist eng mit der Institutionalisierung eines Parteiensystems verbunden, weil in modernen Demokratien die Struktur der Parteien und die Art des Wettbewerbs in den Wahlen einen bedeutenden Effekt auf die Stabilität der demokratischen Institutionen haben. Die in dem jeweiligen Parteiensystem agierenden Parteien können als intermediäre Institutionen der Interessenartikulation und -aggregation wirken. Den Parteien in Osteuropa kommt dabei eine herausragende Bedeutung zu. Andere intermediäre Gebilde, wie Interessengruppen, sind unterentwickelt und oftmals zu schlecht organisiert, um einen Einfluß auf die Politikgestaltung auszuüben. Mit der Thematisierung der Parteienentwicklung und der Parteiensysteme in Osteuropa wird nicht nur die Aufgabe der Parteien im politischen Gestaltungsprozeß und damit ihre Rolle in der Konsolidierung angesprochen. Mit ihr wird exemplarisch die allgemeinere Problematik der Institutionalisierung eines funktionierenden System intermediärer Interessenvermittlung thematisiert. Interessengruppen und Parteien stehen in einem Wirkungszusammenhang. Zwischen ihnen muß sich eine Arbeitsteilung zwischen einerseits funktionaler und andererseits territorialer Interessenrepräsentation durchsetzen (vgl. Rüb 1995). In Ermangelung einer solchen Ausdifferenzierung kommt es rasch zu einer Überforderung der Parteien, die zu Staatskrisen führen kann, wenn z.B. Lohnkonflikte nicht von den Tarifpartnern geregelt werden, sondern zu politischen Konflikten werden (v. Beyme 1997: 44f). Andererseits kann die Dominanz der Institutionenform Partei dazu führen, daß sich Parteien nicht primär auf die materielle Gestaltung der Politik konzentrieren, sondern sich vermehrt auf der symbolische Ebene der Politik engagieren. Werden auf dieser Ebene dann Moral, Ethnizität, Nation und Religion themati- 45 Hierin muß allerdings keineswegs eine Gefährdung für die demokratische Stabilität gesehen werden. In einer vergleichenden Studie zum Effekt der Wahlsysteme auf die Demokratisierung in Zentraleuropa kommt J. Simon (1997) zu dem Ergebnis, daß die Form des Wahlsystems eher einen geringen Effekt auf die Systemstabilität hat. Und dies gilt, obwohl die machthabenden Parteien gravierende Änderungen in den Wahlsystemen nach den ersten Wahlen durchgesetzt haben (eine Ausnahme bildet Ungarn); ein Schritt, der eher machtstrategischen Opportunismus als demokratische Motive vermuten ließe. Die Änderungen konnten das Wahlergebnis nur unmerklich beeinflussen. Konsolidierung der politischen Ordnung 224 siert, birgt das die Gefahr einer ideologischen Polarisierung in der Gesellschaft (vgl. Glaeßner 1994: 251f; Elster / Offe / Preuss 1998: 146). Welche Anforderungen können in modernen Gesellschaften an Parteien und Parteiensystem gestellt werden? Parteien fungieren als vermittelnde Instanz zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen einerseits und der Ebene politischer Entscheidungen andererseits, die für die Mitglieder der Gesellschaft bindend formuliert werden. Daraus ergeben sich als Anforderungen an die Parteien, die gesellschaftliche Integration und Konfliktaustragung im politischen System zu bewerkstelligen, Interessen zu repräsentieren und die entsprechende Unterstützung zu mobilisieren, Interessen zusammenzufassen und Ziele zu formulieren sowie Führungspersonal zu rekrutieren (Segert / Machos 1995: 233). Zwei Dimensionen des Parteienwettbewerbs gewinnen dadurch für das Funktionieren des demokratischen Regimes an Bedeutung: die numerische Dimension, die auf die Fragmentierung46, d.h. auf die Zahl der Parteien, verweist, und eine qualitative Dimension, deren Ausprägung durch die ideologische Polarisierung im politischen Konflikt zwischen den Parteien bestimmt wird (Thibaut 1996: 56). Die numerische Dimension wird von der Geschichte der Parteien und der sozialen Bewegungen sowie vom Typ des vorangegangenen Regimes und im Falle Osteuropas auch von der vorkommunistischen Vergangenheit bestimmt. Zudem hat die durch die Verfassung vorgegebene Institutionenstruktur, wie Festlegung des Regierungssystems und Wahlsystems, einen mitgestaltenden Einfluß auf Anzahl und Grad der Fragmentierung der Parteien. Die qualitative Dimension ergibt sich aus der Funktionswahrnehmung und Rolle der Parteien in der Gestaltung der Interessenaggregation und -vermittlung. Also daraus, auf welche Art und Weise sie sich entlang der gesellschaftlichen cleavages differenzieren, um Unterstützung in dem noch recht unstrukturierten Wählermarkt in Osteuropa zu mobilisieren. Diesem Verweis auf Variablen, die den Grad der Fragmentierung und Polarisierung bestimmen, liegt die grundlegende Annahme der Kontextgebundenheit des Parteiensystems zugrunde47. Die Entstehung der Parteien bildet den Ausgangspunkt für die numerische Dimension des Parteiensystems. Sie gestaltete sich in den post-kommunistischen Staaten unter Bedingungen, die sich deutlich von den Bedingungen unterscheiden, die nach dem II. Weltkrieg oder nach dem Autoritarismus Lateinamerikas bzw. Südeuropas galten. In Europa und Amerika konnte nach dem Zusammenbruch der totalitären und autoritären Regime bei der Gestaltung von Parteien und des Parteiensystems an Traditionen aus demokratischen Zeiten angeknüpft werden. Waren oppositionelle Parteien auch verboten, so wurden dennoch im Untergrund Organisationsstrukturen aufrechterhalten, oder wichtige Akteure setzten sich ins Ausland ab. Im Falle Osteuropas gab es zum großen 46 Nach Sartori kann dann von Fragmentierung des Parteiensystems gesprochen werden, wenn mehr als fünf Parteien im Parlament repräsentiert sind oder sich an der Regierung beteiligen (1976: 126f). 47 Ähnlich bei Segert (1995: 233). Konsolidierung der politischen Ordnung 225 Teil gar keine demokratische Vergangenheit und wenn, dann lag sie zu lang zurück, um an sie anknüpfen zu können. Das gleiche gilt für Akteure, die mit dem Rückgirff auf bestimmte Parteitraditionen politische Programme hätten präsentieren können. Auch sie gab es nicht. Die Parteienlandschaft glich mit der Ausnahme der (ex)kommunistischen Parteien einer tabula rasa (Elster / Offe / Preuss 1998: 131). Die Parteien entstanden erst im Zuge der Umbrüche, und dementsprechend bildete sich das Parteiensystem zeitlich parallel zu der Institutionalisierung demokratischer Strukturen aus. Segert und Machos unterscheiden drei Typen von Parteien, die bei der Transformation in Osteuropa eine Rolle spielten und spielen (1995: 276f): Es gibt historische Parteien, Nachfolgeparteien und Oppositionsbewegungen. In Osteuropa waren die historischen Parteien aus den oben genannten Gründen relativ bedeutungslos. Die Nachfolgeparteien der kommunistischen Partei wandelten sich in Parteien, die am demokratischen Wettbewerb teilnehmen. Dabei beharrten sie entweder als kommunistische Parteien auf ihren ideologischen Inhalten, oder sie avancierten zu sozialdemokratischen Parteien (vgl. Ishiyama 1995). Die Oppositionsbewegungen werden mit dem Begriff der „Ein-PunktUmbrellaparteien“ oder „single-issue Parteien“ (Glaeßner 1994: 261) charakterisiert. Bei ihnen handelte es sich in der Regel um Zusammenfassungen verschiedenster Interessen, die in einem Punkt übereinstimmten; der Widerstand gegen das kommunistische Regime vereinte sie. Die Hoffnung, daß sich aus den Oppositionsbewegungen heraus Parteien entwickeln würden, mit denen ein dem westlichen Parteiensystem vergleichbares System aufgebaut werden könnte, hat sich schnell zerschlagen. Die Bewegungen fielen oftmals mit dem endgültigen Zusammenbruch der kommunistischen Regime entlang ihrer ansonsten heterogenen Interessenlinien auseinander, weil ihnen zentrale Eigenschaften fehlten wie ein kohärentes Programm, klare Entwürfe für den politischen Wandel sowie eine zuverlässige organisatorische Basis. Damit ergab sich für den Zustand der Parteien in Osteuropa eine Situation, die Glaeßner treffend als eine „Proto-Parteienlandschaft“ bezeichnet (1994: 252): Parteien fungieren primär als organisationale Basis für die Interessen alter oder auch neuer Eliten, womit die Bedeutung von Persönlichkeiten die Bedeutung der Parteien verdrängte. Weil die Parteien eben nicht der Beteiligung der Bürger an der Politik dienen, steht es schlecht um ihre Funktionserfüllung; Interessenartikulation und -aggregation werden von ihnen nur ungenügend geleistet. Daraus erklären sich auch ihre schwache soziale Basis und ihr niedriger Institutionalisierungsgrad. Neben diesen historischen Hintergründen, die eine Tendenz zur Fragmentierung begünstigen, spielen die institutionellen Randbedingungen eine entscheidende Rolle für die numerische Gestaltung des Parteiensystems. Die Wahl des Regierungs- sowie des Wahlsystems kann sich auf die Struktur des Parteiensystems auswirken. Beim institutionenkonformen Handeln der entscheidenden politischen Akteure kann so mit „institu- Konsolidierung der politischen Ordnung 226 tional engineering“ eine entscheidende Weichenstellung für die Stabilisierung eines demokratischen Parteiensystems erfolgen. Allerdings wirken Variablen wie Regierungssystem und Wahlsystem im Verbund auf die Herausbildung des Parteiensystems (v. Beyme 1997: 27f). Damit gewinnen die institutionellen Wechselwirkungen an Komplexität, so daß nur eingeschränkt allgemeine Aussagen getroffen werden können. Festhalten läßt sich: mit freien und gleichen Wahlen - am besten nach einem Verhältniswahlrecht - bei gleichzeitiger Einführung eines parlamentarischen Regierungssystems können die Parteien an Bedeutung gewinnen; sie können unter diesen Bedingungen als vermittelnde Instanzen zwischen den Bürgern und Eliten - also der Ebene politischer Entscheidungen – fungieren (vgl. Segert / Machos 1995: 291). Bei der Verhältniswahl gewinnen unterschiedlichste Interessen zwar die Chance der Berücksichtigung und können somit eine faire Repräsentation fördern. Allerdings besteht die Gefahr der Zersplitterung des Parteiensystems. Auch hat ein präsidentielles Regierungssystem, bei dem der Präsident vom Volk gewählt wird, in Kombination mit einem Mehrheitswahlsystem strukturierende Wirkung auf das Parteiensystem (vgl. v. Beyme 1997: 28). Die Bedeutung der Parteien für den politischen Vermittlungsprozeß ist unter diesen Bedingungen relativ gering, der Konzentrationseffekt auf die Parteienlandschaft eher stark. Zwischen diesen extremen Polen liegen die institutionellen Designs, bei denen mit spezifischen institutionellen Elementen Proportions- bzw. Disproportionseffekte ausgeglichen werden, wie bspw. Sperrklauseln. Diese Gestaltungsmöglichkeiten zeigen, daß unterschiedliche Wahlsysteme die gewünschten Konzentrationseffekte auf die Parteienlandschaft erwirken können (Nohlen / Kasapovic 1996: 187). Sperrklauseln können die Bedeutung kleiner Parteien in parlamentarischen Systemen begrenzen und damit einer zu großen Fragmentierung vorbeugen. Ob es zu derartigen, theoretisch zu erwartenden, Wirkungen im Institutionengeflecht kommt, hängt letztendlich davon ab, ob Einstellungen und Verhalten der Eliten institutionellen Vorgaben folgen. Eine zunehmende Fragmentierung kann, muß aber nicht, mit einer zunehmenden ideologischen Distanzierung der politischen Standpunkte zusammenhängen. Ob es sich so verhält, muß auf dem Hintergrund der qualitativen Dimension des Parteienwettbewerbs untersucht werden. Die numerische Dimension ist kein hinreichender Indikator für die Stabilität der demokratischen Institutionen. Wenn in einem fragmentierten Parteiensystem alle Parteien die Legitimität des politischen Systems akzeptieren und den institutionellen Spielregeln folgen, dann muß hinter der Fragmentierung keine politische Polarisierung liegen (Sartori 1976: 179). Mit der qualitativen Dimension wird also auf den Grad der Polarisierung verwiesen, der über die von den Parteien zu übernehmende Funktionswahrnehmung einer demokratiefördernden Rolle informiert. Sartori hat die Art des Parteienwettbewerbs in einem Mehr-Parteiensystem mit den zwei Begriffen moderater und polarisierter Pluralismus charakterisiert (1976: 131f, 173f): In einem polarisierten Parteienwettbewerb liegen die politischen Meinungen, für die die Parteien Konsolidierung der politischen Ordnung 227 stehen, maximal auseinander. Entsprechend tief sind die cleavages, es gibt kaum Konsens, und die Legitimität des politischen Systems wird in Frage gestellt. Letzteres zeigt sich insbesondere an dem mit der Polarisierung verbundenen Phänomen der Anti-System Parteien. „Briefly put, we have polarization when we have ideological distance...“ (Sartori 1976: 135). Für das politische System besteht die Gefahr, daß die Opposition sich unverantwortlich verhält und der Wettbewerb unfair wird. Unter diesen Bedingungen ist insbesondere in Krisensituationen die Handlungsfähigkeit des politischen Regimes stark eingeschränkt. Im ideologisierten Konflikt kommt es leicht zur Lähmung der politischen Entscheidungsinstanzen oder zu schlecht kalkulierten Reformen. Moderater Pluralismus hingegen ist gekennzeichnet durch eine relativ geringe ideologische Distanz zwischen den bedeutenden Parteien (es gibt keine Anti-System-Partei von Bedeutung) sowie durch das Streben aller Parteien, sich an der Regierung zu beteiligen, und damit ihrer Bereitschaft zur Koalitionsbildung. In Osteuropa liegen die Parteiensysteme zwischen diesen beiden Polen, haben aber eine starke zentrifugale Tendenz hin zu einer zunehmenden Polarisierung (Elster / Offe / Preuss 1998: 141, 147). Die Ursache für diese Tendenz liegt in den sozialen Konflikten. Sie komplizieren das Entstehen stabiler Parteien und eines moderat pluralistischen Parteiensystems. Den Ausgangspunkt des Parteienwettbewerbs bildete die Entstehung der neuen Parteien bzw. der parteiähnlichen Organisationen. Sie sind entweder aus dem Konflikt mit dem kommunistischen Regime oder aus den Herausforderungen in der Phase des Regimezusammenbruchs hervorgegangen. Zu diesen Zeitpunkten bestand der zentrale cleavage zwischen Befürwortern und Gegnern der staatlichen Unabhängigkeit; die Befürworter waren meist antikommunistisch orientiert und die Gegner prokommunistisch (Kasapovic / Nohlen 1996: 246). Alle anderen Konfliktlinien waren dieser bestimmenden Konfliktlinie untergeordnet. Als das Ziel der staatlichen Unabhängigkeit erreicht wurde, zerfielen etliche der politischen Organisationen. Als dominanter Parteientyp in der politischen Landschaft nach der Regimeablösung bewahrte sich die „Anti-Partei“, die als Reaktion auf die Einparteienherrschaft auf einem Konzept der anti-politics basierte. Den oppositionellen Bewegungen ging es weniger um den Aufbau alternativer Parteien als um den Aufbau einer autonomen Civil Society. Die Foren und Netzwerke des Widerstandes waren dementsprechend schlecht organisierte soziale Bewegungen. Für die Profilbildung der Parteien, die sich aus ihnen entwickelten, waren daher politischer Stil, Images und dominante Persönlichkeiten bedeutender als politische Programme und Themen. Dem gegenüber stand die unklare Interessenlage der Wähler in den postkommunistischen Gesellschaften (vgl. Segert / Machos 1995: 236f). Diese fehlende Differenzierung in der Wählerschaft gepaart mit einem Mangel an differenzierten intermediären Institutionen der Interessenvermittlung, über die sich interessenbasierte Konsolidierung der politischen Ordnung 228 kollektive Identitäten hätten entwickeln können, verursachen eine hohe Volatilität der Wähler (vgl. Glaeßner 1994: 251f: Merkel 1997: 9f). Die Parteien konnten sich nicht entlang bereits existierender sozio-ökonomischer cleavages bilden, weil es unter den Bedingungen des Staatssozialismus keine Assoziationsfreiheit gab und die soziale Differenzierung nur schwach ausgebildet war. Dementsprechend gering ist die Ausprägung kultureller sowie ideologischer Profile bei den Wählern, und ihre Parteipräferenzen sind extrem instabil. Nur ethnische und religiöse Minoritäten bieten eine klare Interessenlinie, die zur Identitätsstiftung taugt. Stabile Konfliktlinien ließen sich wenn, dann nur in diesen Bereichen und zwischen den Interessen der Landbevölkerung und den Interessen der industriell geprägten bzw. urbanen Bevölkerung erkennen (vgl. Segert / Machos 1995: 236f). In den osteuropäischen Staaten war der in den westlichen, europäischen Demokratien zentrale cleavage im traditionellen Klassenkonflikt zwischen Arbeitern und Eigentümern an Produktionsmitteln nicht vorhanden. Solche Verteilungskonflikte ließen sich verhandeln und daher in einem moderaten Parteienwettbewerb, der demokratische Stabilität fördert, vermitteln. Weniger Stabilität kann erwartet werden, wenn ethnische Unterschiede eine Rolle spielen. Derartige Konflikte sind Null-Summen-Spiele („Entweder-oder Konflikte“; siehe Elster / Offe / Preuss 1998: 147f), die zu extremer Konfrontation tendieren und somit eine Tendenz zur Polarisierung und unzivilisierten Formen der Konfliktaustragung im Parteienwettbewerb haben. Für den Charakter des Parteienwettbewerbs waren also nicht so sehr vermittelbare sozio-ökonomische Interessen ausschlaggebend, ebenso wenig sind die Parteien in den Bereichen stabiler gesellschaftlicher Interessen verankert. Vielmehr „schweben“ die Parteien über der Gesellschaft. Die Bildung der Parteien folgte nämlich aus den Reihen der Eliten, deren primäres Motiv nicht die Berücksichtigung wichtiger gesellschaftlicher Interessen war. Interessen und Konflikte der Bevölkerung wurden vielmehr für eigenes Machtstreben instrumentalisiert (Offe 1994: 135f). Die Konfliktlinien der Parteien liegen entsprechend auf der Ebene der Eliten. Solche Parteien leiden oftmals an schwachen organisatorischen Ressourcen und sind durch eine schwache Bindung zu den ökonomischen und sozialen cleavages der Gesellschaft gekennzeichnet (vgl. v. Beyme 1994: 297f, 1997). Für die Institutionalisierung eines stabilen Parteiensystems bilden instabile Parteien oftmals ein Hindernis, weil für sie das primäre Motiv nur eine Realisierung kurzfristiger Interessen und nicht die Aufstellung langfristiger programmatischer Ideen und politischer Projekte sein kann (Elster / Offe / Preuss 1998: 134). Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß der Problemhintergrund für eine erfolgreiche Institutionalisierung von Parteiensystemen in den post-kommunistischen Staaten sowohl bei den politischen Akteuren als auch bei den Wählern verankert ist: Die Parteiensysteme repräsentieren Elitengruppen und keine politische Programmatik, die Beziehung Konsolidierung der politischen Ordnung 229 der Parteien zur Gesellschaft ist unklar, die Interessen der Gesellschaft bilden nicht den Ausgangspunkt für die Parteipolitik, und auf der Seite der Wähler haben sich noch keine dominanten cleavages herausgebildet, die von den Parteien aufgenommen werden könnten. Außerdem ist die Akzeptanz der Parteien als Instrumente der politischen Willensbildung bei den Wählern niedrig (Glaeßner 1994: 266). Die osteuropäischen Parteiensysteme können ihre Schlüsselrolle in der demokratischen Stabilisierung, solange sie durch Instabilität und ein geringes Maß an Institutionalisierung gekennzeichnet sind, nur schlecht wahrnehmen. Entgegen den instabilen Parteiensystemen Osteuropas, die aus den speziellen Entstehungsbedingungen und den daraus folgenden konsolidierungsgefährdenden Tendenzen zur Fragmentierung und Polarisierung hervorgegangen sind, sind stabile Parteiensysteme durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet (v. Beyme 1997: 34f): Erstens sollten sie durch ein Minimum an Extremismus gekennzeichnet sein. Extremismus, der sich in Osteuropa insbesondere am Erstarken nationalistischer Parteien zeigt, ist durch die Tendenz gekennzeichnet, daß die politischen Akteure mit nicht-demokratischen Mitteln ihre Ziele zu realisieren versuchen. Zweitens sollten die Parteien in einer klaren cleavage-Struktur verankert sein. Die Programme der Parteien sollten die sozialen Konfliktlinien widerspiegeln, so daß sie im Parteienwettbewerb kanalisiert werden. Bei mangelnden Parteiprofilen besteht die Gefahr, daß die Wähler für die Versprechen „politischer Wunderheiler“ anfällig werden. Drittens sollte es eine klare Aufgabenteilung zwischen Parteien und anderen Institutionen der Interessenvermittlung geben. Damit wird einmal der Zersplitterung von Parteiensystemen entlang der internen Interessendifferenzierung vorgebeugt. Zum anderen wird einer Überlastung der Parteien vorgebeugt, wenn funktionale Interessen zu intermediären Institutionen neben dem Parteiensystem ausgelagert werden. Viertens wäre der Rückgang überlagerter cleavage-Linien in einer Partei wünschenswert, weil ein solcher „Faktionalismus“ der Eindeutigkeit eines politischen Programms entgegensteht. Fünftens sollte die Volatilität der Wähler nicht zu hoch sein. Parteien können sich stabilisieren, wenn die Fluktuation der Wähler niedrig gehalten wird und sich eindeutige Parteipräferenzen herausbilden. Eine niedrige Fluktuationsrate muß allerdings kein Zeichen für ein demokratisches Parteiensystem sein – sie kann auch aus der hegemonialen Stellung einer Partei entstehen. Sechstens unterstützt Koalitionsbildung den Stabilisierungsprozeß. Wenn zwei weitere Indikatoren berücksichtigt sind: Ist die Alternative zwischen Opposition und Regierung klar und gibt es realistische Alternativen der Koalitionsbildung, dann wirken Koalitionen als Vorbedingung von Regierungseffektivität. Bei der Auflistung solcher Konsolidierungskriterien handelt es sich allerdings mehr um die Beschreibung von Symptomen eines funktionierenden Parteiensystems als um die Auflistung von Konstruktionskriterien für ein stabiles Parteiensystem. Das political engineering gestaltet sich schwierig und ist nur eingeschränkt möglich. Die für den Konsolidierung der politischen Ordnung 230 Grad der Fraktionierung mitbestimmende institutionelle Weichenstellung ist das Ergebnis von Verhandlungen, bei denen machtstrategische Motive mindestens gleichbedeutend neben den normativen Motiven des Aufbaus einer stabilen Demokratie Einfluß nehmen. Aber nicht nur die oftmals kurzfristig orientierten Akteure können das für eine demokratische Konsolidierung unterstützende Institutionendesign behindern. Verfassungsinstitutionen und Parteiensystem sind sowohl bei ihrer Entstehung als auch in ihrer Wirkung und Wechselwirkung von den historischen Hintergründen, sowie den sozioökonomischen und institutionellen Kontexten abhängig. Diese Variablen bilden die Rahmenbedingungen für die Institutionenkonstruktion, bestimmen somit die Eigenschaften des Parteiensystems und entscheiden über die demokratischen Konsolidierungschancen. 3.5 Architekten des institutionellen Umbaus Die Geschichte der Regime und die Art des Übergangs bzw. Zusammenbruchs bestimmen den Grad der Elitenkontinuität und setzen somit die Akteure fest, die als Schlüsselfiguren des institutionellen Umbaus agieren. Nach welcher Maßgabe aber handelten die Akteure beim Umbau? Wieso entschieden sie sich für ein bestimmtes institutionelles Setting? Bei den Ausführungen zu den institutionellen Optionen und deren Wirkung auf eine gewünschte Stabilisierung der Demokratie sind vereinzelt schon die strategischen Erwägungen bei der Wahl eines bestimmten Regierungssystems oder Wahlsystems angeklungen. Welches Motiv kann hinter diesen Strategien sinnvoll vermutet werden, ohne auf eine tautologische Rationalitätsvermutung zu verfallen? Zur Stabilisierung neuer Institutionen muß es zu einer Übereinstimmung der individuellen Handlung mit den institutionellen Vorgaben kommen (vgl. Nedelmann 1995). Diese Compliance hängt nicht nur von der Art der Orientierung ab – langfristig oder kurzfristig -, sondern auch von den Gratifikationen, die bei einem bestimmten institutionellen Design für die Akteure „abfallen“. Hier liegt der zentrale Hinweis für das Motiv der Akteure beim institutionellen Umbau. Institutionen, mit denen Kompetenzen zugewiesen werden und die Allokation von Ressourcen erfolgt, werden gedacht als Quelle der Gratifikationen – ihre Verteilungswirkung wird von den Akteuren antizipiert. Welches aber sind die Gratifikationen für die politischen Akteure? Sie müssen sich für die Erklärung der Mikrodynamiken des institutionellen Umbaus benennen lassen. Die Motive der Akteure lassen sich als Modellannahme auf politisches Selbstinteresse reduzieren (Geddes 1996). Die Beteiligten der Runden Tische, der verfassungsgebenden Versammlung oder der Legislative verfolgen ihr eigenes Interesse, daß sich auf ihre politische Karriere konzentriert. Bei den Untersuchungen zum Zusammenbruch der alten Ordnung allerdings stellte sich als ein zentrales Ergebnis heraus, daß zum Ver- Konsolidierung der politischen Ordnung 231 ständnis der Mikroprozesse, die an der Entwicklung beteiligt waren, derartig reduktionistische Modelle nur ungenügend betragen können. Die Modellierung der Entscheidungssequenzen der politischen Eliten und die Erklärungsversuche zur öffentlichen Mobilisierung haben gezeigt, daß nicht nur rationale, sondern auch irrationale und nicht-rationale Motive zu Entscheidungen führten, die den Zusammenbruch hervorbrachten. Auch bei der Untersuchung der Prozesse, die zur Einrichtung von Runden Tischen führten, wird deutlich, daß sich am besten mit einem multi-motiationalen Akteurmodell die Entscheidungen und Interaktionen auf der Mikroebene nachzeichnen lassen. Vor diesem Hintergrund muß man fragen, warum sich beim institutionellen Umbau ein Modell bewähren soll, bei dem Selbstinteresse das einzige Motiv der Akteure ist. Der erste Grund ist, daß bei der Frage zu den Motiven der Akteure im Prozeß der Institutionenbildung von den Bedingungen, die zu den Verhandlungen führten, abstrahiert wird. Die Entstehung des normativen Kontextes, in dem strategisch – nach Maßgabe des Selbstinteresses – um die institutionelle Ausgestaltung der neuen Ordnung verhandelt werden kann, ist nicht Gegenstand der Fragestellung. Bei der Modellierung der Prozesse an den Runden Tischen hingegen war diese Frage durchaus relevant: Neben dem taktischen Einsatz strategischer Mittel in der Verhandlung interessierte vor allem auch die Konstruktion von Kontextbedingungen, die erfolgsorientiertes Handeln der Kompromißfindung in Distributionsfragen erlaubte. Ist dieser Kontext erst einmal geschaffen, dann ist durchaus Raum für das Feilschen um eine günstige Verteilung machtstrategischer Positionen. Hier setzt die Untersuchung der entscheidungsrelevanten Motive beim Umbau an. Der zweite Grund, der für die Phase des institutionellen Umbaus ein auf Selbstinteresse basierendes Modell rechtfertigt, verweist auf die spezielle Situation in Osteuropa nach dem Zusammenbruch. Zwar muß Selbstinteresse nicht auf politische Karriere und damit auf wertfreies Machtstreben reduziert werden. Wenn bestimmte Institutionen die Chancen heben, Wahlen zu gewinnen und somit politische Ziele zu verwirklichen, dann kann mit dem politischen Selbstinteresse durchaus eine norm- und wertgebundene Orientierung verbunden sein48. Die institutionellen Präferenzen der Akteure stehen dann nicht ungebunden im Raum, sondern hängen von ihrer Rolle in der politischen Arena ab. Diese wird bestimmt von den sozialen Interessen, die ihre Partei repräsentiert, sowie der Position, die die Partei in der Parteienlandschaft einnimmt (vgl. Geddes 1996: 19). Die individuellen Akteure treten also als Agenten der Parteien oder Gruppierungen auf, die im politischen Wettbewerb zueinander stehen, und vertreten somit prinzipiell deren Interessen und Präferenzen. Die Präferenzen für konkrete institutionelle Designs sind von 48 Eine solche Definition von (politischem) Selbstinteresse findet sich auch bei Pappi (1995: 239), der kollektive Ziele, die sich auf das Gemeinwohl beziehen, als Präferenz individueller politischer Akteure in einem Rational Choice-Modell formuliert. Konsolidierung der politischen Ordnung 232 den äußeren Umständen, dem Zeitpunkt, der Wahrnehmung von Optionen und dem Grad der Unsicherheit abhängig. Die Akteure, die zur Zeit des Umbaus miteinander im Wettbewerb standen, instrumentalisierten gesellschaftliche Konfliktlinien für ihr eigenes Machtstreben, was sich am deutlichsten an der Instrumentalisierung sekundärer Themen wie ethnischer cleavages zeigt. Es gab kaum Parteien, die stabile gesellschaftliche Interessen vertraten. Die von ihnen repräsentierten Konfliktlinien widerspiegelten keine langfristigen, sozialen Interessen, sondern Interessenkonflikte auf der Ebene der Eliten49. Nicht um politische Programme wurde gerungen, sondern um die Realisierung kurzfristiger Interessen. Daher kann plausibel angenommen werden, daß in Osteuropa Selbstinteresse weniger für die strategische Repräsentation sozialer Interessen stand als für politisches Karrierestreben und somit für machtstrategisches Kalkül. Unter diesen spezifischen Bedingungen kann man davon ausgehen, daß es den Akteuren um die Sicherung eines Wettbewerbsvorteils im Kampf um die Stimmen geht und darum, ihre Präsens auf dem politischen Parkett zu sichern. Das Modell bewährt sich, wie sich an eindringlichen Beispielen der osteuopäischen Transformation zeigt (Geddes 1996: 21f; Kasapovic / Nohlen 1996: 246f; Gebethner 1996; Elster 1994): - Anfangs, in der Vorbereitung der ersten freien Wahlen, präferierten die kommunistischen Parteien eine starke Präsidentschaft und majoritäre Wahlsysteme. Sie gingen davon aus, daß sie die Wahl gewinnen würden, und wollten somit ihre politische Position stärken. In den Ländern, in denen sich die kommunistische Partei besonders sicher war (Ungarn und Rumänien), setzte sie sich sogar für direkt von den Bürgern gewählte Präsidenten ein, um somit ihre Macht und Legitimität gegenüber der Legislative zu stärken. Wenn die Opposition allerdings schon massiv in der Öffentlichkeit aufgeteten war (Polen) oder die Wahlen erst in einer unsicheren Zukunft stattfinden würden (Bulgarien), votierte die kommunistische Partei für ein vom Parlament gewählten Präsidenten. Außerdem bevorzugten kommunistische Parteien und ihre Nachfolgeorganisationen Mehrheitswahlsysteme: sie überschätzten ihre eigene Popularität, es gab eine verbreitete Präferenz der Parteikader, unabhängig vom Image der Partei, als Individuen zu kandidieren, und lokale kommunistische Kader konnten auf ein funktionierendes politisches und Patronagenetzwerk zurückgreifen. In der Einführung einer proportionalen Repräsentationsform wurde eine Bedrohung dieser lokalen Wahlressourcen gesehen, weil ein Verhältniswahlsystem die Neubestimmung der Wahlbezirke bedeutet hätte. - Kleine politische Gruppierungen, die sich über ihre zukünftige Existenz im Unklaren waren, bevorzugten Formen der proportionalen Repräsentation möglichst ohne oder mit niedriger Sperrklausel. In diese Kategorie fielen fast alle Oppositionspar49 Das ließ sich besonders bei den „Taxi-Parteien“ (Beyme 1997: 37), bei denen Akteur und Agent nahezu die selbe Entität bilden, beobachten. In diesen kleinen und kleinsten Parteien, in denen sich die Mitglieder um einen Führer gruppieren, werden primär die Privatinteressen der Führer verfolgt. Konsolidierung der politischen Ordnung 233 teien, aber auch die kommunistische Partei nach den ersten Wahlen. Ausnahmen bildeten die großen Oppositionsparteien Ungarns und die stützenden Fraktionen für Lech Walesa in Polen (1990-1991). In Ungarn, weil sich Kandidaten oppositioneller Parteien und Reformkommunisten schon seit 1985 in ihren Distrikten etablieren konnten. In Polen, weil man in einem gemischten System – halb majoritär und halb proportional – die besten Chancen für Walesa sah. Parteien mit charismatischen Persönlichkeiten bevorzugten eine Verhältniswahl mit nicht-gebundenen Listen („open list proportional representation“), weil bei dieser Stimmgebungsform die Reihenfolge der Kandidaten verändert werden kann und somit der Wähler mit darüber entscheidet, wer die Partei vertreten soll. Starre Listen (close-list system) hingegen wurden von Parteien mit weniger bekannten Persönlichkeiten oder mit dominanter Führung bevorzugt, weil damit die Parteiführung entscheidet, wer sie vertreten soll. Welche institutionellen Ergebnisse sich allerdings durchsetzen konnten, ergab sich erst aus den Verhandlungen der am Umbau beteiligten Akteure. Die Ergebnisse variierten mit den äußeren Umständen, dem Zeitpunkt und den wahrgenomenen Optionen sowie dem Grad der Unsicherheit, die die Verhandlungsmacht der Parteien bzw. Akteure bestimmten. Ein Beispiel für den Einfluß der äußeren Umstände auf Institutionenbildungsprozesse bildet der Rückzug der SU aus den politischen Angelegenheiten der ostmitteleuropäischen Staaten. Die Verhandlungsmacht der kommunistischen Parteien mit der Opposition bzw. innerparteilichen Reformkräften ließ drastisch nach, nachdem die Unsicherheit bezüglich einer Intervention sowjetischer Truppen aufgehoben war. Besonders an der Entwicklung der Institutionen in Polen läßt sich die Wirkung der Verschiebung der Verhandlungsmacht in zeitlichen Etappen nachzeichnen (vgl. Osiatynski 1996; Geddes 1996): Während sich in der Situation der Unsicherheit bis April 1989 die Interessen der kommunistischen Partei gut durchsetzen konnten, zeichnete sich beginnend im Juni 1989 eine drastische Veränderung zugunsten oppositioneller Interessen ab. Bis April 1989 war das Präsidentenamt mit weitreichenden Machtbefugnissen ausgestattet, galt ein Mehrheitswahlsystem und wurden der kommunistischen Partei und ihren verbündeten 65 Prozent der Sitze im Sejm zugesprochen. Der Präsident wurde von der Legislative gewählt, in der die kommunistische Partei eine garantierte Mehrheit besaß. Mit dem symbolischen Rückzug der SU und den negativen Wahlergebnissen für die kommunistische Partei50 änderten sich ab Juni 1989 die Bedingungen der Präsidentschaftswahlen und der Parlamentszusammensetzung. Die deutlich eingeschränkte Verhandlungsmacht der kommunistischen Partei führte dazu, daß sich der Reformprozeß beschleunigte. Der Präsident wurde nun von den Bürgern direkt gewählt, und es wurde 50 Von den frei wählbaren Mandaten im Sejm gingen alle an die Opposition, die Mandate im Senat gingen zu 99 Prozent an die Opposition (Nohlen, Kasapovic 1996: 117f). Konsolidierung der politischen Ordnung 234 das Verhältniswahlrecht eingeführt, weil sich mittlerweile selbst kommunistische Abgeordnete über ihre tatsächliche Stärke innerhalb des Parteiensystems unsicher waren. Von Oktober 1991 an, konnten außerdem weitere einschränkende Kompromisse bezüglich der Machtbefugnisse des Präsidenten geschlossen werden, weil die Verhandlungsmacht der kommunistischen Partei immer weiter nachließ; die öffentliche Unterstützung ließ nach und die Repräsentation in der Legislative war nur noch klein. Ähnlich zeigte sich auch die Entwicklung in Bulgarien und Rumänien und Ungarn. Die kommunistischen Parteien (bzw. Nachfolgeparteien) konnten hier nach ersten Machteinbußen ihre Stärke zwar auf einem mittleren Niveau halten (Geddes 1996: 24f), dennoch setzten sich institutionelle Optionen durch, die den kleinen und oppositionellen Parteien entgegen kamen. In Ungarn änderte sich zwar nicht das Wahlsystem. Dafür wurden aber Legitimitätsquellen und Machtbefugnisse des Präsidenten weiter eingeschränkt, nachdem von der SU keine Bedrohung mehr ausging, sich die Opposition organisieren konnte und die öffentliche Unterstützung für die kommunistische Partei nachließ (vgl. Sajó 1996). Diese Eingeständnisse lassen sich auch als Folge der Wahlsiege der Opposition in Ungarn nach den ersten Wahlen werten. In Rumänien und Bulgarien wurde ähnlich wie in Polen das Mehrheitswahlrecht gegen das Verhältniswahlrecht ausgetauscht. Die institutionellen Eingeständnisse der kommunistischen Parteien in Bulgarien und Ungarn wurden gegen ein Zugeständnis bezüglich des Zeitpunktes für die Wahlen eingetauscht (Geddes 1996). Je früher die Wahlen stattfanden, desto geringer war die Chance für die Opposition, sich zu organisieren und einen organisierten Wahlkampf zu führen (vgl. auch Teil II, Kapitel 4). Mit dem Hinweis auf die Akteursmotive gewinnt man ein Verständnis dafür, welchen Akteuren bestimmte institutionelle Settings entgegenkommen. Die Wege der institutionellen Änderungen lassen sich nachzeichnen. Dennoch erfolgt die Gestaltung des institutionellen Designs keinesfalls voluntaristisch. Der Verweis auf die äußeren Umstände hat gezeigt, daß die Wahl immer unter bestimmten Bedingungen stattfindet, die nicht von den Akteuren kontrolliert werden. Darüber hinaus entfalten einmal installierte politische Institutionen Wirkungen, die die Strategien der Akteure bzw. Parteien beeinflussen (Glaeßner 1994; 251f). Institutionen kreieren „agency“; sie setzen die Regeln und Grenzen der Freiheit der Akteure fest und definieren die Verantwortung, die den Akteuren zugewiesen wird (Elster / Offe / Preuss 1998: 27f) und bilden damit einen neuen Ausgangspunkt für anschließende Veränderungen. Konsolidierung der politischen Ordnung 235 3.6 Zusammenfassung Auf der Mesoebene des politischen Umbaus können die Institutionen identifiziert werden, deren Ausgestaltung und Wirkungsweise für die Konsolidierung einer Demokratie entscheidend sind. Die Grundlagen eines neues Regimes entstehen, wenn in einer neuen Verfassung veränderte Leitideen und Wertorientierungen der Gesellschaft formuliert werden und mit den institutionellen Elementen der Verfassung die formale Umsetzung dieser Ideen festgelegt wird. Neben den in der Verfassung formulierten Regeln des politischen Wettbewerbs spielen die Institutionen der Interessenaggregation und -vermittlung für die Gestaltung der Demokratie eine zentrale Rolle. Parteien und gegebenenfalls weitere Gebilde intermediärer Interessenvermittlung kanalisieren die gesellschaftlichen cleavages im politischen Prozeß. In den seltensten Fällen läßt sich eindeutig angeben, welchen formalen Kriterien die Verfassungen, ihre Elemente wie Regierungs- oder Wahlsystem oder das Parteiensystem genügen müssen, damit die Konsolidierung der jungen Demokratien gelingen kann. Das hat zwei Gründe: Erstens ist die Wirkung von Institutionen hochgradig kontextabhängig. Institutionen entfalten ihre Wirkung im Kontext anderer Institutionen. Dieser Institutionen-Mix ist zudem in seiner demokratiefördernden Wirkung von sozioökonomischen Kontextvariablen - wie Homogenitätsgrad der Gesellschaft - abhängig. Zweitens ist die Wirkung der Institutionen mikroabhängig. Akteure gestalten die Institutionen nach der Maßgabe strategischer Kalküle und entscheiden mit ihrer Compliance, welche institutionellen Vorgaben sich durchsetzen werden. Die Mikroabhängigkeit des institutionellen Umbaus bringt zwar konkrete institutionelle Ergebnisse hervor. Dennoch kann nicht behauptet werden, daß die Zusammensetzung der am Gestaltungsprozeß beteiligten Akteure die Struktur der neuen Demokratien determiniere. Werden in Verhandlungen auch Ergebnisse erzielt, die sich gut in spieltheoretischen Modellen nachzeichnen lassen, so verändern sich doch kontinuierlich die Constraints für die Spiele. Es kann nicht sicher eingeschätzt werden, wie die Wähler reagieren, und selbst die Profis im politischen Geschäft durchschauen nicht die komplexen Wechselwirkungen mit anderen institutionellen Arrangements. Zudem läßt sich nicht absehen, welche neuen Akteure auf dem politischen Parkett erscheinen werden bzw. wer abtritt. Konsolidierung der politischen Ordnung 236 4. Stabilisierung Heute, ca. 10 Jahre nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime, befinden sich die osteuropäischen Staaten immer noch in der Konsolidierungsphase. Ungelöste ethnische Konflikte (Rumänien), Segregationsbestrebungen (Rußland) und antisemitische Semantik (Polen und Rußland) sowie die Politisierung dieser sekundären cleavages sind die offensichlichsten Symptome undemokratischer Tendenzen und konfliktorientierter Politikstile, die sich nicht demokratisch mit Kompromissen lösen lassen. Läßt sich auch nur schwer einschätzen, zu welchem Zeitpunkt die Phase der politischen Konsolidierung in Osteuropa abgeschlossen sein wird, so kann man doch Wesentliches über Ausgangsbedingungen und somit über die Herausforderungen, die die jungen Demokratien zu bewältigen haben, festhalten. Mit der Thematisierung des Erbes und der Prozesse des Umbaus erhält man Aufschluß über die Konsolidierungschancen. Mit dem Erbe sind durch vorausgegangene Prozesse Bedingungen für die Strategien des institutionellen Umbaus vorgegeben. Mit dem institutionellen Umbau werden Weichen für die politische Entwicklung gestellt. Hierin begründen sich die Chancen und Risiken einer langfristigen demokratischen Stabilisierung, über die mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Phase institutionellen Umbaus mehr Aussagen getroffen werden können. Von dem institutionellen Umbau gehen langfristig strukturelle Änderungen aus, genauso wie sich mit ihm die Zusammensetzung der politisch einflußreichen Akteure ändern wird. Auf der Makroebene wird ein demokratisches Regime angestrebt, und auf der Mikroebene ist es für eben dieses Ziel bedeutend, daß sich sämtliche relevanten Akteure im Rahmen der durch die (neuen) Institutionen vorgegebenen Entscheidungsspielräume und Normen bewegen. Von den Einstellungen und dem Handeln der Akteure hängt es letztlich ab, ob sich die neuen Institutionen etablieren und sich somit das demokratische Regime (die neuen Makrostrukturen) etabliert. Institutionen haben Polity-Aspekte, die auf die Ordnung des politischen Systems und damit auf seine Struktur weisen. Sie haben aber auch Policy-Aspekte, weil sie die Voraussetzung für die Entwicklung und Durchsetzung politischer Inhalte bilden und damit Entscheidungen auf der Mikroebene bestimmen bzw. von ihnen in ihrem Bestand abhängen. Die Stabilisierung des demokratischen Systems hängt von dem Zusammenspiel der verschiedenen Variablen auf den unterschiedlichen analytischen Ebenen ab. Die Abstimmung des Institutionen-Mix auf die gesellschaftlichen Herausforderungen und das Handeln der Akteure im neuen Regelwerk bestimmen den Erfolg der politischen Konsolidierung. Der Erfolg zeigt sich, 1. wenn die demokratischen Strukturen so stabilisiert sind, daß das neue politische Regime seine Identität in der ständigen Konfrontation mit Konsolidierung der politischen Ordnung 237 Umwelteinflüssen strukturell behaupten kann - den demokratischen Modus des Prozessierens beibehält51 - und dennoch flexibel auf Umweltänderungen reagiert kann, wenn 2. die Institutionen, die ein demokratisches Design bilden, etabliert sind und 3., wenn sich bei der Bevölkerung und den Eliten demokratische Identitäten gebildet haben. Damit sind alle drei Analyseebenen des umfassenden sozialen Phänomens der politischen Konsolidierung angesprochen. Bleibt diese Beschreibung aber nicht inhaltslos, solange keine konkreten Kriterien, die als Indizien für einen solchen Erfolg fungieren, angegeben werden können? In der einleitenden Diskussion zur Konsolidierung wurden mit den Ausführungen zu den Konzepten „Demokratie“ und „Konsolidierung“ die Problematik der Stabilisierung demokratischer Regime bereits diskutiert. Als Ergebnis ließ sich festhalten, daß die abstrakten Beschreibungen unter Punkt 1 bis 3 keinen theoretisch gesicherten Kriterienkatalog für die Identifikation einer konsolidierten Demokratie angeben. Es läßt sich nicht gesichert sagen, welche Makrovariablen Auskunft über die erfolgreiche Stabilisierung geben können. Die in den Untersuchungen zur Konsolidierung angegebenen Kriterien sind jedoch keineswegs überflüssig. Sie dienen als Aufriß der Problemkreise, mit denen der Versuch einer demokratischen Konsolidierung konfrontiert ist. Diese Problemkreise beziehen sich einerseits auf die strukturierende Wirkung der neuen Institutionen in ihrem Zusammenspiel und andererseits auf die Effekte institutioneller Änderungen auf das Handeln der Akteure. Hierin liegt der Schlüssel für die Makrostabilität und zwar unabhängig davon, ob ein maximalistisches oder ein minimalistisches Demokratiekonzept als Orientierungspunkt für die Konsolidierung dient. Was aber genau müssen einerseits die Institutionen und andererseits die Akteure für eine Stabilisierung leisten? Die Antwort auf diese Frage haben die Ausführungen zum institutionellen Umbau z.T. schon vorweggenommen. In der Diskussion um das angemessene Institutionendesign geht es ja gerade darum, die strukturierenden Wirkungen zu antizipieren. Die Überlegungen konzentrieren sich aber häufig sehr eingeschränkt auf die Wirkung institutioneller Elemente wie Regierungs- und Wahlsystem oder Parteienstruktur und vernachlässigen daher oft die Frage, wie sich die einzelnen Elemente in das gesamte Institutionengefüge einpassen. Zu ihrer Beantwortung bedarf es der Angabe allgemeinerer Stabilitätsbedingungen auf der Mesoebene und der Mikroebene. Dieser Schritt wird in den folgenden zwei Abschnitten unternommen. 4.1 Institutionelle Stabilitätsbedingungen Der institutionelle Umbau fand zu einem Zeitpunkt statt, in dem nicht nur in der Wissenschaft konkurrierende Konzepte optimaler demokratischer Institutionen diskutiert 51 Vgl. auch Schedler (1998) zur „regime continuity“. Konsolidierung der politischen Ordnung 238 wurden. Der Institutionentransfer nach Osteuropa52 erfolgte zu einer Zeit, die vom starken Zweifel an denselben Institutionen gekennzeichnet war. Oftmals galten die Institutionen in den Herkunftsländern bereits als reformbedürftig, woraus sich prinzipiell das „... Problem des Transfers schwacher Institutionen in fragile Systeme ergibt ...“ (Nedelmann 1995: 32). Dennoch kann man begründet schon während der Phase des Umbaus Chancen und Risiken für eine erfolgreiche Demokratisierung herausarbeiten. Über systematische und über ganz konkrete Probleme der jungen Institutionen können Aussagen getroffen werden. Aussagen, die klären, welche institutionellen Vorgaben die Etablierung demokratischer Strukturen begünstigen und wie Institutionen die Compliance relevanter Eliten sowie die Legitimität gegenüber der Bevölkerung hervorbringen. Für Verfassungsinstitutionen und intermediäre Institutionen lassen sich Standards formulieren, die funktionale Kriterien für einen demokratischen „quality-check“ auflisten, der über die Chancen und Risiken informiert: Um die Überführung institutioneller Vorgaben in stabile Strukturen zu leisten, müssen Institutionen „agency“ hervorbringen (Elster / Offe / Preuss 1998: 27f). „Agency“ bezeichnet die erfolgreiche und abgeschlossene Institutionalisierung von Regeln und Grenzen für die Entscheidungsfreiheit und Verantwortung der Akteure. Sie bildet somit ein erstes Kriterium für die Konsolidierung der neuen politischen Ordnung. Ein Mißlingen der Konsolidierung würde sich daran zeigen, daß sich Akteure nicht mehr auf Regeln zum Schutz ihres Lebens, ihres Eigentums oder ihrer Freiheit beziehen können, weil legitime Gesetze und Rechte systematisch gebrochen werden – Krieg, Bürgerkrieg, und gewaltsame Unterdrückung werden wahrscheinlich. Für eine Konsolidierung ist hingegen kennzeichnend, daß politische Konflikte und Verteilungskonflikte nach feststehenden Regeln ausgetragen werden. Mit „agency“ sprechen Elster, Offe und Preuss das allgemeine Problem der Institutionenordnung der Gesellschaft an. Institutionen müssen spezifische Fähigkeiten einzelnen Handlungseinheiten zuordnen. Diese Allokation von „agency“ muß in verschiedenen Dimensionen geleistet werden. Lepsius (1990: 53f) hat vier solche Dimensionen, die als Konkretisierung der Stabilitätsanforderungen für Institutionen fungieren können, herausgearbeitet: Erstens müssen die Institutionen die „Kompetenzallokation“ leisten. Sie müssen Entscheidungskompetenzen, die festlegen, was von wem entschieden werden darf, definieren. Damit entsteht auch der Anspruch nach Erfüllung der in den jeweiligen Bereichen anfallenden Aufgaben. Zweitens muß die „Ressourcenallokation“ gewährleistet sein. Mit ihr entscheidet sich die Art, wie über politische, wirtschaftliche oder militärische Macht verfügt wird, wer sie nutzen kann. Drittens bedarf es der „Legitimitätsallokation“, mit der die Be52 In der Transformationsforschung ist der Begriff „Institutionentransfer“ oftmals für die osteuropäische Transformation reserviert (vgl. Lehmbruch 1996): Mit ihm soll die Fremdbestimmtheit des Umbruchs hervorgehoben werden. Hier wird er neutraler eingeführt. Er steht lediglich für die Orientierung der ostmitteleuropäischen Staaten an westlichen Konzepten der politischen- und der Wirtschaftsverfassung. Konsolidierung der politischen Ordnung 239 gründung der staatlichen Herrschaft erfolgt. Es muß also institutionell festgelegt sein, wer die soziale Ordnung rechtfertigt. Als vierte Zuordnung muß die „Kontrollallokation“ gesichert sein. Mit ihr wird festgelegt, wer unter welchen Bedingungen Sanktionen anwenden darf, die von den institutionellen Regelungen abweichendes Handeln vorbeugen und bestrafen sollen. Erst mit einer solchen institutionellen Differenzierung lassen sich demokratiefeindliche Handlungen ausgrenzen und wird einzelnen Handlungen und Handlungskontexten die Chance gegeben, eigene Ziele zu verfolgen und Kompetenzen in festgelegten Handlungskontexten zu entwickeln. Eine Voraussetzung für die klare Zuordnung von Kompetenzen zu Handlungskontexten ist die differenzierte Zuständigkeit von Institutionen (vgl. Rüb 1996: 41f). Wie die Erfahrung mit den kommunistischen Regimen zeigt, muß darauf geachtet werden, daß es nicht zu einer Vermischung institutioneller Sphären kommt; Institutionen müssen horizontal differenziert sein (Elster / Offe / Preuss 1997: 31): Dazu gehört die Abgrenzung unabhängiger Zuständigkeitsbereiche und eine stark eingeschränkte Übertragbarkeit von Macht- und Statuspositionen von einem institutionellen Bereich zum anderen. Diese horizontale Differenzierung institutioneller Sphären gab es in den kommunistischen Regimen nicht. Vielmehr waren sie durch tight coupling gekennzeichnet; die politische Exekutive hat Entscheidungen über Investitionen im ökonomischen Bereich getroffen und hatte auch einen weitgehenden Einfluß auf Wissenschaft, Medien und Gerichtsbarkeit. Hier vermischten sich die Sphären. tight coupling ist in den kommunistischen Gesellschaften dafür verantwortlich gewesen, daß politische Strategien wissenschaftlich legitimiert wurden oder auch dafür, daß die Rechtsprechung den Herrschenden untergeordnet wurde. Zur demokratischen Stabilität hingegen gehört institutioneller Pluralismus, der durch die funktionale Trennung von Zuständigkeitsbereichen Spezialisierungsgewinne - wie fachliche Kompetenz - fördert (Rüb 1996: 42), klare Verantwortungsstrukturen schafft und verhindert, daß Krisen und Funktionsdefizite sich von einer Sphäre in die andere fortpflanzen (Elster / Offe / Preuss 1997: 31). Die horizontale Differenzierung ist nicht nur ein Kriterium für die Stabilisierung von Verfassungsinstitutionen. Sie läßt sich auch als Qualitätsmerkmal der Institutionen der intermediären Interessenvermittlung anwenden53. Parteien sind zwar wichtige intermediäre Institutionen, die zwischen der Gesellschaft und den staatlichen Entscheidungsinstanzen vermitteln, indem sie Forderungen und Unterstützungsleistung aus der Gesellschaft weiterleiten. Andere intermediäre Interessenverbände sind in Osteuropa aber noch recht unterentwickelt. Deshalb findet die horizontal differenzierte Arbeitsteilung zwischen Parteien und Interessengruppen nicht oder kaum statt. Die Parteien müssen nicht nur die territoriale Repräsentation leisten, sondern auch die funktionale (vgl. v. Beyme 1997; Merkel 1997). Dieser Zustand birgt zwei Risiken. Einerseits sind die Par53 Zur Rolle der horizontalen Differenzierung in neuen Demokratien siehe auch O’Donnell (1998). Konsolidierung der politischen Ordnung 240 teien überfordert mit der Vielfalt der Konfliktthemen und andererseits besteht die Gefahr, daß sich Konflikte ausweiten und zur Staatskrise heranwachsen, weil sie durch die Parteien in die staatlichen Arenen hineingetragen werden. Ein Beispiel für eine solche Entwicklung bilden die Lohnkonflikte in Rußland, die sich regelmäßig zu einer Staatskrise auszuweiten drohen (vgl. v. Beyme 1997: 44). In der Erfüllung des Stabilitätskriteriums horizontaler Differenzierung der territorialen und funktionalen Aufgabenbereiche besteht für die intermediäre Ebene der Demokratien Osteuropas weiterhin eine kaum zu überschätzende Herausforderung. Über den Erfolg der osteuropäischen Parteien wird in Zukunft auch entscheiden, inwiefern ihnen die soziale Verankerung gelingt. Eliten, die aus der Legislative heraus mit machtstrategischem Kalkül Parteien gründen, fehlt oftmals die Beziehung zu gesellschaftlichen Problemlagen und die Verantwortung für die Vermittlung gesellschaftlicher Interessen. Den Parteien fehlt es entsprechend an Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung, weil sie „... erkennbar das Resultat einer dezisionistischen Setzung sind ...“ (Wiesenthal 1999: 6) - hinter solchen Entscheidungen vermutet man Willkür. Diese Mängel können besonders vor dem Hintergrund der schwach ausgeprägten intermediären Ebene der empirischen Legitimität der Verfassung entgegenwirken und damit die demokratische Stabilität gefährden. Wie entscheidend die Differenzierung institutioneller Spähren ist, zeigt auch eine Schwerpunktbildung in der aktuellen Konsolidierungsforschung, die bei den Problemen einer Etablierung formeller demokratischer Institutionen liegt (Merkel / Croissant 2000, Brie 1996; O‘Donnell 1998). Hier wird gezeigt, daß sich neben den intentional eingeführten formalen Institutionen, wie der Verfassung, der Regierungsform, der Gesetzgebung und dem Wahlsystem, auch informale Institutionen bilden, die entweder an alte Traditionen anknüpfen oder sich in Netzwerken neu bilden. Informalen Muster sozialer Beziehungen bilden sich in jedem politischen System und existieren auch in stabilisierten liberalen Demokratien. Sie können aber zur Gefahr für die Demokratie werden, wenn sie „... auf der horizontalen Ebene die exekutive Macht hemmen, oder [...] sich in die vertikale Dimension zwischen Regierende und Regierte schieben, ...“ (Merkel / Croissant 2000: 24). Ein Kriterium für die demokratische Stabilisierung ist demzufolge, daß informale Institutionen formale Institutionen nicht verdrängen dürfen. Kommt es zu einer solchen Verdrängung, dann handelt es sich um eine „defektive Demokratie“ (Merkel / Croissant 2000), die durch Illegitimität gekennzeichnet ist. Eine solche Entwicklung zeichnet sich in Osteuropa insbesondere für Rußland ab; Rechtsgrenzen werden durch die Exekutive verletzt, und die Bedeutung des Parlaments wird unterhöhlt, wodurch legitime Verfahren und bürgerliche Freiheitsrechte in die Bedeutungslosigkeit verbannt werden (Brie 1996). Informale Institutionen setzten sich gegen die demokratischen, rechtsstaatlichen Institutionen durch, und mit dem Machausbau des Präsidentenamtes erfuhren die defektiven Prozesse sogar eine Formalisierung. Konsolidierung der politischen Ordnung 241 Wie die Entwicklung in Rußland zeigt, besteht in jungen Demokratien die Gefahr, daß neue Regeln selbst immer wieder zum Gegenstand der Konflikte werden, d.h. die Selbstbindung der Akteure noch nicht funktioniert. Das Verhalten der Akteure entscheidet, ob beim institutionellen Umbau das Kriterium erfolgreich institutionalisierter „agency“ erfüllt werden kann und ob sich die differenzierten Zuordnungen von Handlungsfähigkeiten gegen opportunistische Tendenzen durchsetzen können. Die Akteursmotive und Interaktionsprozesse, die zur Durchsetzung der formalen demokratischen Kriterien führen, bleiben bei der Diskussion institutioneller Stabilitätskriterien noch unberücksichtigt. Erst eine Untersuchung der Mikroprozesse kann Bedingungen angeben, unter denen ein Zustand sich ständig ändernder Regelungen vermieden wird. Die Stabilisierung politischer Institutionen verweist also nicht nur auf die Mikroebene, weil Akteure über ihre Gestaltung entscheiden. Institutionen haben immer auch eine „kulturelle Dimension“, die den Zusammenhang von funktionierenden Regelstrukturen und individuellen Motiven deutlich macht (Eisen 1996: 36f): Institutionalisierung von Demokratie erfolgt zwar über die Einrichtung formeller Strukturen. Sie bedarf darüber hinaus aber der adäquaten sozio-kulturell geprägten Einstellungsmuster und Werthaltungen von Akteuren. Aus ihnen generiert sie die für die Stabilität unerläßliche Legitimität. 4.2 Compliance Neue Institutionen können noch keine strukturprägende Wirkung entfalten, weil die durch sie vorgegebenen Handlungsroutinen erst die entlastende Selbstverständlichkeit ausbilden müssen, die dann zu einem strukturbestimmenden Merkmal des neuen Regimes wird. Sollen Institutionen erfolgreich als Strukturen politischer Koordination eingeführt werden, dann müssen sie auf der Ebene kollektiver Sinnwelten Stabilität und Legitimität generieren (vgl. Eisen / Wollmann 1996: 21). Handlungsroutinen sind von den politischen Akteuren noch nicht internalisiert, haben keinen Eigenwert und wirken daher noch nicht entlastend - der Glaube an die Legitimität, der eine entscheidende Grundlage für die langfristige Stabilität bildet, muß sich erst noch entwickeln. Beim institutionellen Umbau entsteht daher eine Rational Choice-Situation für die Akteure (Eliten sowie Bevölkerung). Das bedeutet, daß die mit den neuen Institutionen zusammenhängenden Normen und Werte noch keine relevante Handlungsorientierung bilden und sie daher vorzugsweise nach ihrer instrumentellen Nützlichkeit bewertet werden, was für die politischen Entscheidungsfindungen eher eine Be- als Entlastung darstellt. Die Einhaltung der institutionellen Vorgaben bei dem institutionellen Aufbau Konsolidierung der politischen Ordnung 242 ist von den Anreizen und Gratifikationen abhängig, die mit den Institutionen verbunden sind (Nedelmann 1995). In einer Phase institutioneller Neuerungen kann also davon ausgegangen werden, daß der instrumentelle Charakter von Verfassungsinstitutionen im Vordergrund steht. Akteure, die mit den institutionellen Regelungen unzufrieden sind, wissen, daß die fraglichen Regelungen nicht aus einer fernen Vergangenheit stammen und sich durch eine bewährte Vergangenheit legitimieren. Sie sind erst kürzlich eingeführt worden und lassen sich deshalb noch recht leicht anzweifeln und ändern. Außerdem wurden die Regelungen in turbulenten Zeiten nicht zuletzt auch auf der Grundlage der Nutzenkalküle der beteiligten Akteure eingeführt. Dementsprechend schwach ist der Institutionalisierungsgrad der Regelungen. Es lassen sich leicht Verbündete für einen Vorstoß in Richtung Neuformulierung der Regelungen finden – diese Gefahr besteht besonders dann, wenn die Autonomie der Institutionen von einer demokratisch gewählten Mehrheit in Frage gestellt wird. In der Mikroabhängigkeit der neuen Institutionen muß allerdings nicht nur ein Nachteil bzw. eine Gefährdung für den Konsolidierungsprozeß gesehen werden. Eine instrumentelle Einstellung gegenüber neuen Institutionen wägt nämlich auch die Vor- und Nachteile der vorangegangenen Institutionen gegenüber den neuen ab, worin eine Chance für demokratische Institutionen liegen kann. Erst wenn in der Restitution alter Institutionen ein Vorteil gesehen wird, kann die Elitenkontinuität problematisch werden - es muß nicht prinzipiell davon ausgegangen werden, daß die Akteure eine stabile Präferenz für die alte Ordnung haben. Der Prozeß der Stabilisierung neuer Institutionen aber auch die Präferenz für die alten Institutionen hängt von den Anreizen und dem Zeitpunkt der Gratifikationen ab. Damit ist der Zeithorizont der Akteure bei ihrer instrumentellen Kalkulation von entscheidender Bedeutung. Der Grad der kurzfristigen („miopia“) bzw. langfristigen Orientierung („foresight“) entscheidet über den Erfolg der Institutionalisierung. Institutionalisierte Handlungsroutinen können zählebig sein. Werden ihre formalen Grundlagen (Verfassung, Parteiengesetz usw.) auch geändert, können sich dennoch alte Handlungsroutinen in politischen Netzwerken fortsetzen. Der Prozeß des institutionellen Umbaus ist daher durch eine paradoxe Konstellation gekennzeichnet (Nedelmann 1995: 36f): Oftmals weichen die importierten politischen Institutionen von der Sozialstruktur ab (sie mögen zwar die relevanten cleavages in den westlichen Gesellschaften regulieren, passen aber nicht auf die aktuellen Konfliktlinien in den osteuropäischen Staaten, d.h. sind nicht in der Lage, diese Konflikte zu kanalisieren und die entsprechenden Interessen zu aggregieren), womit die neuen Institutionen schwach bleiben. In diesem Falle können sich die institutionellen Reste aus der Vergangenheit strukturprägend durchzusetzen. Damit werden die neuen Institutionen davon abgehalten, ihre Eigenlogik zu entwickeln, und die politischen Akteure sind kaum mehr von ihrem instru- Konsolidierung der politischen Ordnung 243 mentellen Nutzen (Entlastungen durch hohe Institutionalisierung) zu überzeugen. Der Rückgriff auf alte Institutionen kommt dann besonders der kurzfristigen Rationalität entgegen. Die Bürger und z.T. auch politischen Eliten fühlen sich von neuen Institutionen kurzfristig nicht belohnt, da sie individuelle Nachteile zugunsten langfristiger kollektiver Vorteile eintauschen müssen. Die alten Institutionen bringen die gewohnten (kurzfristig gedacht) sicheren Gewinne54. Neue Institutionen werden nur eingeführt, wenn von ihnen langfristig höhere Gewinne erwartet werden können55. Im Gegensatz zu früheren Demokratisierungen spielt der Zeithorizont der Akteure bei den Demokratisierungen in Osteuropa eine zentrale Rolle (Schmitter / Santiso 1998): Durch die Plötzlichkeit und Reichweite der Transformationen sind die Entscheidungseliten mit multiplen Unsicherheiten konfrontiert. Sie durchschauen oftmals nicht den Kontext, in dem sie ihre Entscheidungen treffen müssen. Die Wechselwirkungen ihrer Entscheidungen in unterschiedlichen Bereichen tendieren dazu, nicht antizipierte und nicht intendierte Effekte zu produzieren. Auch können sie sich im Prozeß der Entscheidungsformulierung nicht auf frühere, historische Erfahrungen beziehen. Für die Eliten besteht somit in dem neuen institutionellen Kontext ein hohes Risiko, Positions- und Machtverluste zu erleiden. Sie müssen dennoch die Bereitschaft entwickeln, für die Chance, in Zukunft Macht und Position zu gewinnen, kurzfristig Verluste zu akzeptieren. Für eine Konsolidierung demokratischer Institutionen ist es daher entscheidend wichtig, ob es gelingt, von kurzfristigen Erwartungen auf langfristige Planung bei der Bevölkerung und bei den politischen Eliten umzustellen. Für den erfolgreichen Umbau demokratischer Institutionen kommt es also besonders darauf an, 1. inwieweit und wie schnell es gelingt, die mit dem institutionellen Umbau verbundenen Gratifikationen zu realisieren, 2. wie weit die Geduld der Eliten und Bevölkerung reicht (vgl. Offe 1994) und 3. inwiefern sich Vertrauen in die neuen Institutionen herausbilden kann. 54 Dieser Konflikt, der durch die Mikroabhängigkeit des Institutionenaufbaus entsteht, läßt sich als interund intra-personales Prisoners‘ Dilemma (PD) formulieren: Auf der inter-personalen Ebene müssen einzelne auf individuelle Gewinnmaximierung verzichten, damit kollektive Gewinne realisiert werden (von denen sie unter Umständen sogar ausgeschlossen bleiben). Auf der intra-personalen Ebene muß auf unmittelbare Gewinne zugunsten langfristiger Gewinne verzichtet werden. Für beide Dilemmas (sofern sie die tatsächliche Einstellung vieler Bürger in Osteuropa reflektieren) bildet wohl nur die Änderung der objektiven Bedingungen (Auszahlungen) eine Lösung. Eine effektive Sozialpolitik muß die individuellen Kosten der kollektiv angestrebten Ziele abfedern. Individuell muß erkannt werden, daß sich der Verzicht auf die unmittelbare Nutzenrealisierung lohnt. Es muß in die Regeln des politischen und ökonomischen Spiels, denen unbedingt gefolgt werden muß, vertraut werden können. Hier liegt die Verantwortung bei den politischen Eliten. Sie dürfen das institutionelle Regelwerk nicht aus opportunistischen Gründen manipulieren (Vergleiche zum Zusammenhang von Vertrauen und demokratischer Konsolidierung auch Offe 1999). 55 Nedelmann schätz die Stabilisierung demokratischer Institutionen als sehr schwierig ein, weil die demokratische Norm des „kritischen Bürgers“ und die Institution von Opposition eine prinzipielle Infragestellung demokratischer Regime bedeute (1995: 33). Gegen diese prinzipielle Schwäche läßt sich einwenden, daß idealerweise die Kritik des Bürgers und der Opposition sich nicht gegen das demokratische Regime richtet, sondern gegen die Entscheidungen der Regierung, die mit demokratischen Mitteln abgewählt werden kann. In der Kritik kann sich also gerade eine stabile Institutionalisierung der Demokratie ausdrücken. Konsolidierung der politischen Ordnung 244 Bei der Auflistung solcher Anforderungen an Institutionen darf nicht vergessen werden, daß die Compliance mit ihnen nicht verordnet werden kann oder auf der Grundlage von bestehenden Normen oder Verträgen (die gebrochen werden können) entsteht. Wegen der Mikroabhängigkeit der Stabilisierung muß die Übereinstimmung der individuellen Handlung mit den institutionellen Vorgaben aus sich selbst („selfinforcing“ <Przeworski 1991>) erfolgen. Die Autorität der Regeln ist somit äquivalent zur Bereitschaft der Akteure, opportunistischen Versuchungen zu widerstehen; einer Bereitschaft, die von den Opportunitätskosten und dem Vertrauen in die anderen Akteure abhängt (Elster / Offe / Preuss 1997: 30f). Diese „selfinforcing“ Compliance mit den neuen Institutionen läßt sich nach Przeworski unter zwei Bedingungen herstellen (1991): Erstens müssen die Institutionen den fairen politischen Wettkampf garantieren. Das kann durch sich wiederholende Wahlsituationen geleistet werden. Erst vor diesem Hintergrund werden die politischen Eliten Verluste akzeptieren, weil sie in dem institutionellen Setting eine Chance für ihre Interessen in der Zukunft sehen. Zweitens müssen die kurzfristigen Interessen der Akteure in langfristige Orientierungen überführt werden. Das gelingt, wenn die Institutionen effizient sind, d.h. Möglichkeiten schaffen, die materielle Wohlfahrt zu verbessern. Unter dieser Bedingung wird es attraktiver sein, Verluste in der Demokratie zu akzeptieren, als sie in einer nicht-demokratischen Zukunft zu vermeiden. Sehen die Akteure ihre Chance, distributive Gewinne (Effizienz) zu realisieren, und erwarten sie reziproke Compliance (Fairneß), dann besteht eine gute Chance dafür, daß sie die Autorität der selbstgesetzten Regelungen akzeptieren. Somit läßt sich das Problem der vertikalen Dimension von Institutionen (vgl. Elster / Offe / Preuss 1997: 30f) lösen. Vertikal meint, daß die Stabilisierung von Institutionen dann gewährleistet ist, wenn den Entscheidungen der Akteure von einer höheren Entscheidungsebene Bedingungen (Constraints) auferlegt sind. Diese Hierarchie findet aber ihr Ende bei den in der Verfassung formulierten Regelungen. Auf dieser Ebene müssen die einmal in einem Akt der Selbstbindung installierten Regelungen so akzeptiert werden, als wären sie von einer höheren Instanz eingesetzt. Eine weitere Bedingung für fairen Wettbewerb ist die Abwesenheit systematischer Benachteiligung von politischen Gruppen oder Minderheiten. Die Institutionen müssen also entsprechend dem Grad der gesellschaftlichen Heterogenität bzw. Homogenität soziale und politische Inklusion gewährleisten. Damit werden - über die geforderte Compliance der Eliten hinaus - die in der Bevölkerung verankerten Interessen einbezogen. Für die Stabilität der Institutionen darf das Kriterium nicht vernachlässigt werden, weil ablehnende Stimmungen in der Bevölkerung von den Eliten instrumentalisiert werden können. Das Kriterium der Effizienz bezieht sich ebenfalls auf die Bevölkerung. Haben die distributiven Eigenschaften der Institutionen die Wirkung, daß die Chancen zur materiellen Wohlfahrt steigen, dann werden politische Entscheidungen im Rahmen der Institutionen auch eher akzeptiert und gutgeheißen. Dieses Verständnis der Kriterien Konsolidierung der politischen Ordnung 245 Inklusion und Effizienz (vgl. Thibaut 1996; Merkel 1996: 94f; Merkel / Sandschneider / Segert 1996: 24f) zeigt, daß institutionelle Stabilität nicht nur ein Rational Choice-Problem der vertikalen Akzeptanz neuer institutioneller Regelungen durch die Eliten ist. Institutionelle Stabilität verlangt auch nach der Erfüllung von Akzeptanzkriterien der Bevölkerung. Zusammenfassend bilden diese Lesarten von institutioneller Effizienz und sozialer und politischer Inklusion die empirische Legitimität der Verfassungsinstitutionen. Empirische Legitimität ist somit ein entscheidender Faktor, der den Verfassungen der jungen Demokratien „innere Souveränität“ gibt (Merkel / Sandschneider / Segert 1996: 18f). Aus ihr bestimmt sich die Dauer und damit die Stabilität der demokratischen Verfahren. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Beispiel dafür, daß selbst wenn Verfassungen im Schöpfungsakt unzureichend legitimiert sein sollten (mangelnde formale Legitimität), ihnen aus der täglichen Bewährung mit der Zeit Stabilität zuwachsen kann. Permanenz ist für die Stabilisierung entscheidend. Die Zeit arbeitet für eine Stabilisierung durch Akzeptanz der institutionellen Regelungen, besonders seitens der Eliten. Sie wirkt als ein unterstützender Faktor für die Compliance, weil Regelungen, die lange gelten, stabiler bzw. selbstverständlicher werden. Mit der Zeit wird das Kosten-Nutzen Verhältnis beim Ändern der Regeln unkalkulierbarer, weil sich Akteure schon arrangiert haben und lernen konnten, Chancen in dem geltenden Rahmen zu nutzen. Außerdem konnten sich über die Zeit hinweg Spiele wiederholen und somit reziproke Compliance, auf die sich Vertrauen aufgebaut, erfahren werden56. Bewährtes und Selbstverständliches wird nicht so schnell geändert. 4.3 Zusammenfassung Die Angabe von verläßlichen Makrokriterien, von denen der Stabilisierungsgrad der neuen Demokratie abgeleitet werden kann, bleibt auf unbestimmte Zeit unmöglich. Zum jetzigen Stand der Konsolidierungstheorie verfangen sich solche Versuche in den theoretischen Schwierigkeiten, die mit der präzisen Angabe von Konsolidierungskriterien für Demokratien verbunden sind. Auf der Meso- und Mikroebene hingegen lassen sich durchaus allgemeine Kriterien angeben, die über demokratiefördernde Kriterien für Institutionen und Akteurshandeln informieren: Institutionen müssen den Akteuren Grenzen und Regeln für ihre Handlungen und Entscheidungen auferlegen, so daß die Bereiche ihrer Kompetenz feststehen, die Verfügung über Ressourcen geregelt ist, klar wird, wie die Herrschaftsverhältnisse gerechtfertigt sind und geregelt ist, wie mit defektiven Handlungen umgegangen wird. Darüber hinaus müssen zwischen den verschiedenen institutionellen Sphären klare Grenzen gezogen 56 Vgl. auch zur Wirkung wiederholter Spiele auf Kooperation: Axelrod (1984). Konsolidierung der politischen Ordnung 246 sein, damit die Anreize zum „tight coupling“ niedrig gehalten werden und intermediäre Interessenvermittlung stattfinden kann. Die Akteure müssen Compliance mit den neuen institutionellen Vorgaben zeigen. Ob es dazu kommt, hängt von den erwarteten Gratifikationen ab, die mit einem institutionenkonformen Handeln verbunden werden. Bei den Akteuren muß sich eine Haltung durchsetzen, die kurzfristigen Versuchungen widersteht. Die Zeichen dafür stehen gut, wenn es gelingt, den institutionellen Wandel rasch voranzubringen, so daß Gratifikationen in absehbarer Zeit erwartet werden können, die Akteure geduldig sind und Vertrauen in die neuen Institutionen entsteht. Aber auch die Zeit hilft der Compliance. Etablierte und bewährte Verfahren geraten selten unter Druck. Konsolidierung der politischen Ordnung 247 5. Die politische Konsolidierung im Spannungsfeld von Wirtschaft und Kultur Die Chancen für eine Konsolidierung der neuen osteuropäischen Systeme läßt sich nicht einschätzen, ohne den Blick über die Grenzen des politischen Teilsystems zu wagen. Die Stabilisierungschancen besonders in Osteuropa, wo nicht nur die politische Ordnung neu definiert wird, hängen von den Wechselwirkungen zwischen den gesellschaftlichen Teilbereichen Politik, Wirtschaft und Kultur ab. Zu dem Entwicklungspfad einer neuen politischen Ordnung, wie er hier skizziert wurde, laufen parallel die Pfade wirtschaftlicher Neustrukturierung57 und kultureller Umorientierung58. Diese Entwicklungen sind eng miteinander verwoben. Bei der Institutionalisierung einer neuen politischen Ordnung können nicht nur selbstreferentiell die Effekte der neuen Institutionen auf den Modus der Durchsetzung kollektiv verbindlicher Entscheidungen thematisiert werden. An vielen Stellen werden die Wechselwirkungen mit den Entwicklungen in den anderen gesellschaftlichen Teilbereichen deutlich: Mit der Abhängigkeit stabilitätsrelevanter Variablen - wie der Compliance der Eliten mit den institutionalisierten Regeln oder der Legitimität des neuen politischen Regimes bei der Bevölkerung - wird die Effizienz des wirtschaftlichen Teilbereichs berührt. Und mit den gesellschaftlichen cleavages, die den „natürlichen“ Anknüpfungspunkt für Parteien und andere intermediäre Institutionen der Interessenvermittlung und -aggregation bilden, werden kulturelle Dimensionen angeschnitten; cleavages stehen für Kategorien, entlang derer sich Identifikationsmuster bilden und die an der Definition integrationsstiftender Solidaritätsformen beteiligt sind. In den 10 Jahren, die seit dem Zusammenbruch verstrichen sind, hat sich die Einschätzung, aufgrund welcher Wechselwirkungen die Konsolidierung einer demokratischen Marktwirtschaft gefährdet ist, deutlich verschoben. Auch hieran zeigt sich, wie schwer es fällt, selbst kurzfristige Prognosen zu den Konsolidierungschancen abzugeben. Mit fortschreitender Entwicklung änderte sich der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Argumentation in der Diskussion um die Konsolidierungschancen. 5.1 Erste Reaktionen: Dilemmas der Reformen Den Ausgangspunkt des institutionellen Umbaus in den postkommunistischen Staaten bildete der verbreitete Wunsch nach einem demokratischen Wandel in einer Situation 57 Vgl. hierzu ausführlich: Rueschemeyer, Stephens, Stephens (1992); Clague, Rausser (1992); Haussner, Jessop, Nielsen (1995). 58 Vgl. hierzu ausführlich: Mänicke-Gyöngyösi (1991, 1995b, 1996); Tatur (1991); Rose, Seifert (1995); v. Beyme (1994: 328f); Thaa (1997). Für den speziellen Fall der Transformation Ostdeutschlands vgl. die Veröffentlichungen der Max-Planck-Arbeitsgruppe „Transformationsprozesse in den neuen Bundesländern“ (Wielgohs / Wiesenthal 1997; Wiesenthal 1996). Konsolidierung der politischen Ordnung 248 des ökonomischen Bankrotts. Von der Transformation wurde erwartet, daß sich strukturelle Prozesse, die in den westlichen Gesellschaften über lange Zeitabschnitte – Jahrzehnte – evolutionär erfolgten, mit einem Schlag durchsetzen würden. In der gedrängten Zeitstruktur der Entwicklung wurde ein „Dilemma der Gleichzeitigkeit“ gesehen (Offe 1994): Entscheidungen mußten getroffen werden, mit denen eine Entwicklung ermöglicht werden soll, die bislang in der Geschichte der Modernisierung sukzessive erfolgte (Nationalstaatsbildung, Marktwirtschaft, Demokratisierung, Wohlfahrtstaat). Die nationalstaatliche Identität der betreffenden Gesellschaft galt es zu definieren, politische und ökonomische Grundlagen in einer Verfassung festzulegen, und gleichzeitig mußte die „normale Politik“ geleistet werden. Entscheidungen in allen drei Bereichen treffen zu müssen, konfrontierte die Reformeliten mit einem hohen Grad an Kontingenz, was für die Staatsbürger und Wirtschaftssubjekte Unsicherheit brachte und für die politischen Entscheidungsträger Anreize zum opportunistischem Handeln schuf. Daher wurde befürchtet, daß sich die Problemlösungsstrategien gegenseitig blockieren könnten59. Die Entscheidungen, die in den einzelnen Bereichen anstanden, schienen inkompatibel. In den Wechselwirkungen, die zwischen den Reformen in den Bereichen der Politik und der Wirtschaft zu erwarten waren, wurde ein erstes grundlegendes Problem für den Umbau der postkommunistischen Gesellschaften gesehen (Glaeßner 1994: 190f): Es wurde davon ausgegangen, daß man in einer demokratischen Ordnung die harten Maßnahmen des ökonomischen Umbaus nur ungenügend durchsetzen kann. Die Alternative, eine autoritäre marktwirtschaftliche Ordnung einzuführen, die soziale Ressourcen für den ökonomischen Aufbau mobilisieren kann, kam als Reformstrategie nicht in Frage. Auch autoritäre Marktwirtschaften bedürfen des Rückhalts der Gesellschaft, wie er sich am besten über demokratische Verfahren verwirklichen läßt. Ein zweites grundlegendes Problem, das für den Umbau der postkommunistischen Gesellschaften identifiziert wurde, schließt an das erste an. Es bezieht sich auf die mangelnde Erfahrungen im Umgangs mit marktwirtschaftlichen und demokratischen Institutionen und wurde somit an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft einerseits und Kultur60 andererseits lokalisiert. Es wurde davon ausgegangen, daß es insbesondere in 59 Auch wenn die „Gleichzeitigkeiten“ eine offensichliche Eigenschaft der Transformationen Osteuropas sind, so müssen sie doch nicht unbedingt das exklusive Merkmal dieser Transformationen sein. O’Donnell hat mit Blick auf die Entwicklungen der lateinamerikanischen Demokratien bereits auf die trade-offs der Demokratie „.. in terms of more effective, and more rapid opportunities for reducing social and economic inequalities.“ (1986: 10) verwiesen. Die trade-offs bildeten eines der generellen Themen der Transitionsforschung (O’Donnell / Schmitter 1986). Übereinstimmend wurde in ihnen eine Gefahr für die Demokratisierungschancen gesehen, wenn starke sozio-ökonomische Ungleichheiten neben einer Kultur existieren, in der Demokratie wegen ihrer vermeintlichen Schwäche ablehnend begegnet wurde und eine Offenheit für autoritäre Lösungen weit verbreitet war. So eine Situation konnte für Lateinamerika identifiziert werden und dementsprechend pessimistisch wurden für diese Region die Demokratisierungschancen eingeschätzt. 60 Die Verwendung des Kulturbegriffs in der Konsolidierungsdebatte ist alles andere als eindeutig – sie ist uneinheitlich und fast nie explizit. Dennoch läßt sich der angesprochene Bereich für die Konsolidierung der politischen Ordnung 249 Rußland und den südosteuropäischen Gesellschaften an einer „kulturellen Fundierung“ für ein demokratisch-martwirtschaftliches System fehlte (Glaeßner 1994). Die kommunistischen Systeme hatten die Entstehung einer adäquaten „Mentalität“ verhindert und dort, wo sie vor der Etablierung eines autoritären, planwirtschaftlichen Systems bestanden hat, zurückgedrängt. Es gab 1989/90 keine kulturelle Basis für die neuen politischen und ökonomischen Ordnungen. Das einzige Fundament, auf das das Projekt des Umbaus bauen konnte, war der verbreitete, aber diffuse Wunsch, Marktwirtschaft und Demokratie einzuführen. Beiden Aspekten fehlte der kulturelle Rückhalt. Die ökonomischen Akteure und die Bürger konnten nicht in den Prozeß des Umbaus und der Stabilisierung integriert werden. Die schwierige, simultane Einführung von Demokratie und Marktwirtschaft birgt ein hohes Maß an Unsicherheit, die eine Identitätsbildung einerseits als verantwortlicher Staatsbürger der neuen Demokratie und andererseits als Wirtschaftssubjekt in der neuen Wirtschaftsordnung erschwert61. Deshalb wurde erwartet, daß kulturelle Dimensionen Transformationsproblematik bestimmen: Die Einführung des Kulturbegriffs folgt der These, daß die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung zunehmender Differenzierung eine Veränderung der gemeinschaftlichen Solidaritätsformen und der Werte und Normen erfordert. Der osteuropäische Transformationsprozeß läßt sich als gesellschaftlicher Differenzierungsprozeß charakterisieren: Transformation kann als der Versuch gesehen werden, das Primat der politischen Rationalität durch eine differenzierte Struktur, in der die gesellschaftlichen Teilbereiche eigene Rationalitäten verfolgen können, abzulösen. Mit den differenzierten, komplexeren Strukturen ergibt sich - ganz im Sinne des Modernisierungskonzepts Parsons’ (1969a; 1969b) - die Notwendigkeit einer universalistischen Normstruktur. In einem unabhängigen, universalistischen Rechtssystem müssen beispielsweise Eigentumsrechte verbindlich geklärt sein, damit das Marktsystem seine eigene Rationalität entwickeln kann. Und für die politische Bürokratie muß das Rechtssystem definieren, wie weit die Amtsautorität reicht und wo sie eingeschränkt wird. Diese Normen sind auf Legitimität und damit auf die Unterstützung der gesellschaftlichen Gemeinschaft angewiesen: Nur in ihrem Rahmen kann Solidarität gestiftet werden, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bzw. die Integration der Gesellschaft garantiert. Dafür müssen sich die Gesellschaftsmitglieder mit den neuen Normen und Werten identifizieren. Auf der Persönlichkeitsebene bedeutet das, daß sie ihre autonomere Individualität akzeptieren und als Wirtschaftssubjekte nutzen müssen. Sie müssen außerdem eine demokratische Identität entwickeln, die Pluralismus akzeptiert und unterstützt. Entscheidende Elemente bei der Bildung der neuen Identität sind einerseits die kulturellen Traditionen und Erfahrungen, die während der kommunistischen Herrschaft internalisiert wurden sowie die neuen Formen der Interessenaggregation und -vermittlung (über intermediäre Institutionen und die Identifikation mit der von den Eliten vertretenen Positionen). Der kulturelle Hintergrund unterscheidet sich z.T. gravierend bezüglich der Erfahrungen mit zivilgesellschaftlichen und pluralistischen Werten. Über die erfolgreiche Institutionalisierung von Interessenaggregation und -vermittlung kann gemeinschaftliche Solidarität gestiftet werden, die mit den Normen der demokratisch-marktwirtschaftlichen Strukturen kompatibel ist. Mißlingt diese Form der Solidaritätsstiftung, dann können sich Identitäten entlang ethnischer Kategorien und Symbolik bilden, die zwar Solidarität stiften, aber oftmals die staatliche Integrität bedrohen und mit den pluralistischdemokratischen sowie den individualistisch-marktwirtschaftlichen Werten im Widerspruch stehen. Insofern steht der Verweis auf den kulturellen Bereich auch für das kulturelle Erbe. Die Erfahrungen mit dem kommunistischen Regime, die Internalisierung bzw. Identifikation mit den entsprechenden Werten geraten neben den Prozessen der Aktualisierung nationaler Identitäts- und Solidaritätsbildung über Formen der Interessenaggregation und -vermittlung in den neuen demokratisch-martwirtschaftlichen Strukturen ins Blickfeld. 61 Besonders die ungeklärte nationale bzw. territoriale Integrität der Gesellschaft birgt für die Bürger der osteutropäische Staaten, die mit dem „Stateness“-Problem konfronitiert sind, ein hohes Maß an Unsicherheit. Konsolidierung der politischen Ordnung 250 der Identitätsbildung an Bedeutung gewinnen (vgl. Offe 1994). Hiermit ging die Gefahr einher, daß nationale und ethnische Identitäten (wie in der ehemaligen SU und in Jugoslawien) betont werden oder daß sich die Bevölkerung an Doktrinen, wie die der katholischen Kirche in Polen (vgl. Holzer 1994: 151f), klammert. Prozesse der nationalen Gemeinschaftsbildung lassen sich durchaus instrumentalisieren. Sie können aber nicht gezielt in Richtung erwünschter Verfahrensregeln und Allokationsentscheidungen manipuliert werden, selbst wenn sie eng damit verbunden sind (Offe 1994). Deshalb mußte befürchtet werden, daß die Strategien der gemeinschaftlichen Identitätsbildung den Architekten der Reformen nicht nützen, sondern ihre Aufgabe eher zusätzlich komplizieren würden. Zu Beginn der 90er Jahre wurde verstärkt auf prinzipielle Widersprüche gleichzeitiger politischer und wirtschaftlicher Reformen aufmerksam gemacht62. In den Wechselwirkungen zwischen den gesellschaftlichen Teilbereichen Politik und Wirtschaft wurde von kritischen Sozialwissenschaftlern die zentrale Konsolidierungsproblematik gesehen63. Man fürchtete außerdem, daß weitere Widersprüche angestoßen werden könnten: Die negativen Auswirkungen der gleichzeitigen Einführung von politischen und ökonomischen Reformen könnten einen Prozeß anstoßen, der die mangelnden kulturellen Ressourcen und potentiellen Konfliktherde in reelle Probleme der Akzeptanz der neuen Institutionen und handfeste Konflikte überführt. Eine „Pandorabüchse der Paradoxien“ (Offe 1994) drohte sich zu öffnen. Der Zusammenbruch der demokratischen Institutionen stand zu befürchten, weil die unzureichende Erfahrung im Umgang mit den neuen Institutionen und sekundäre Themen der nationalen oder ethnischen Identitätsbildung als Hindernisse für den Erfolg der Reformen gesehen wurden. In der gleichzeitigen Einführung von Marktwirtschaft und Demokratie wurde ein „asymmetrischer Antagonismus“ (Offe 1994) gesehen. Es wurde angenommen, daß Demokratie grundsätzlich der Implementation wichtiger ökonomischer Struktur- und Institutionenänderungen widerspreche. Elster (1990) argumentierte, daß Demokratie die konsequente Reform des Preissystems und der Eigentumsverhältnisse behindere. Er begründete diesen Zusammenhang wie folgt (Elster 1990): Eine Voraussetzung für die marktwirtschaftliche Reform ist, daß die vom Staat festgesetzten Preise freigegeben werden, da sie der Eigentumsreform im Wege stehen. Außerdem muß mit der Preisreform eine Eigentumsreform einhergehen, weil eine staatlich gelenkte Verteilung (Allokation) die gewünschte Entwicklung der Marktkräfte behindert. Ohne Eigentumsreform würden Preissignale eine Ressourcenknappheit nicht reflektieren oder sogar ignorieren, was eine ineffiziente Verwendung des Kapitals mit sich brächte. Die beiden Reform62 Diese Argumentation richtete sich gegen die Vorstellungen neoliberaler Reformstrategen und ihre Versuche der Implementation eines „Designer-Kapitalismus“ (vgl. Hausner / Jessop / Nielsen 1995; v. Beyme 1994: 221f). 63 Vgl. auch ausführlich zu den Paradoxien der Konsolidierung Rüb (1995). Konsolidierung der politischen Ordnung 251 schritte, Deregulierung der Preise bzw. Abbau von Subventionen und Einführung des Privateigentums, haben aller Voraussicht nach (und wie die Erfahrungen der letzten 10 Jahre bestätigen) umfassende, negative soziale Konsequenzen. Firmenschließungen, Arbeitslosigkeit und die Entwertung von Besitzständen64 sind ihre unpopulären Begleiterscheinungen, die eine Verstärkung von Eigentumsunterschieden und damit von sozialen Unterschieden induzieren. Bei einer solchen Entwicklung muß mit sozialen Konflikten gerechnet werden, die der Demokratisierung im Wege stehen und die Bevölkerung dazu veranlassen könnten, die „demokratische Responsivität des politischen Systems“ (Wiesenthal 1999) gegen die ökonomischen Reformen zu richten, d.h. unter Nutzung ihrer neuen Partizipationsrechte die Wirtschaftsreformen zu blockieren. Die politischen Reformen einer Demokratisierung bedeuten aber nicht nur die Einrichtung demokratischer Partizipationsrechte. Demokratie muß auch die Etablierung verfassungsmäßiger Garantien leisten. Rechtssicherheit ist die zentrale Voraussetzung für Investitionen. Können die ökonomischen Agenten nicht davon ausgehen, daß Eigentumsrechte respektiert werden, dann verkürzt sich ihr Zeithorizont, was dem Investitionsbestreben fundamental widerspricht. Verfassungsrechtliche Garantien für die neuen Eigentumsverhältnisse lassen sich unter der Bedingung sozialer Spannungen allerdings schlecht festschreiben. Die Verfassungen bleiben unbeständig, so daß anstatt der erwünschten Rechtssicherheit rechtliche Unberechenbarkeit und Unsicherheit dominieren. Beispiele für diesen von Elster beschriebenen Zusammenhang lassen sich in Polen, Bulgarien, Rumänien und Tschechien beobachten. In diesen Ländern bildeten die Parlamente die verfassungsgebende Versammlung (vgl. Linz / Stepan 1996; Elster / Offe / Preuss 1996). Bei einer solchen Konstruktion bestimmen die Spieler selbst die Spielregeln, was der gewünschten Verfassungsstabilität widersprechen kann und unerwünschte Möglichkeiten für eine interessengeleitete Politik öffnet (vgl. Teil III, Kapitel 3.1). Konstitutionelle Sicherheit ist nur dann gewährt, wenn sie den institutionellen Rahmen und die Spielregeln der Demokratie bindend festschreibt und somit langfristig Rechtssicherheit garantiert. Der von Elster angeführte strukturelle Zusammenhang ist im Grunde nicht neu. Er ist theoretisch schon vor den Entwicklungen in Osteuropa von Vertretern der Modernisierungstheorie formuliert worden. Sie argumentierten, daß die Konkurrenzdemokratie erst durch die sozio-ökonomische Voraussetzung einer entwickelten Marktwirtschaft ermöglicht wird (vgl. Lipset 1981): Wenn in einer Demokratie neue Verteilungsrichtlinien bzw. Kriterien für die Güter- und Ressourcenallokation formuliert werden, dann ist zu befürchten, daß die Mächtigen in ihrem eigenen Interesse handeln. Hinzu kommt, daß die Eliten ein demokratisches Mandat für die Reform der Eigentumsverhältnisse haben müssen und zur Rechenschaft über ihre Reformen verpflichtet sind. Daraus ergibt sich 64 Beispielsweise verlieren die Ersparnisse über inflationäre Entwicklungen ihren realen Wert, und vormals politisch zugeordnetes Quasieigentum wird enteignet, weil es nach Kriterien zugeteilt wurde, die marktwirtschaftlich-ökonomisch betrachtet sinnlos sind. Konsolidierung der politischen Ordnung 252 das paradoxe Ergebnis, daß Demokratie eine Voraussetzung für die wirtschaftliche Liberalisierung bildet. Bei der Übertragung des bekannten theoretischen Zusammenhangs auf die neue Entwicklung Osteuropas kommen allerdings erschwerende Faktoren hinzu. Dies sind die mangelnde Erfahrung im Umgang mit politischen und sozialen Konflikten, die sich nicht nur wegen der negativen Folgen der Wirtschaftsreformen für die Wohlfahrt der Bevölkerung verstärken, sondern die auch auf der Grundlage der unsicheren gemeinschaftlichen Identität und den damit vorgezeichneten nationalen und ethnischen Spannungen entstehen. Eine aktive Teilnahme an der Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse wurde unter den kommunistischen Regimen unterdrückt (vgl. Teil II, Kapitel 1.3). Damit konnte die Verantwortung für politisches Mißmanagement leicht und zu recht externalisiert werden. Mit der weiterhin sich schwierig darstellenden Etablierung von institutionalisiertem Konfliktmanagement fehlt den post-kommunistischen Gesellschaften auch heute noch die institutionelle Basis für die verantwortliche Einbeziehung und Beteiligung der Bürger und wirtschaftlicher Akteure beim demokratischen und wirtschaftlichen Umbau. Die distributiven Konflikte müssen institutionalisiert werden, damit die produktiven Aspekte gesellschaftlichen Konflikts genutzt werden können und die individuellen Kosten und Risiken des Übergangs abgefedert werden. Bis heute gibt es aber kaum Interessenverbände, Parteien oder Gewerkschaften, die in der Lage sind, soziale Pakte zu schließen und auf Grund umfassender Strukturen65 im allgemeinen Interesse zu handeln (Przeworski 1991). Die historischen Erfahrungen und das institutionelle Erbe der post-kommunistischen Gesellschaften resultierten in einem Mangel an den nötigen kulturellen Ressourcen zur Etablierung zivilgesellschaftlicher Organisationsformen und schufen die Grundlage für nationale, ethnische und religiöse Konflikte. Dieser Umstand barg gravierende Risiken für den institutionellen Umbau und erschwerte die Stabilisierung der jungen Demokratien und Marktwirtschaften. Elster räumte zwar die Möglichkeit ein, daß sich auf einer niedrigeren Ebene Lösungen der strukturellen Dilemmas finden lassen könnten (1993). Aber auch die Prozesse auf der Meso- und Mikroebene, die durch die Reformen angestoßen wurden, schienen die negative makrotheoretische Argumentation zu stützen: Auf den Akteursebene ist die demokratische Stabilisierung eine Frage der Compliance der Akteure mit den demokratischen Institutionen unter den neuen ökonomischen Bedingungen (vgl. Przeworski 1991; Nedelmann 1995). Die Compliance ist von zwei Kriterien - Fairneß und Effizienz – abhängig, die sich widersprechen können. Fairneß verlangt, daß die bedeutenden Interessen geschützt werden, während Effizienz die Not65 Nur umfassende Interessenverbände können die Auswirkungen ihrer Interessenpolitik auf die gesamtgesellschaftliche Situation berücksichtigen und können kein Interesse daran haben, Partikularinteressen gegen das Allgemeinwohl durchzusetzen (Olson 1968). Konsolidierung der politischen Ordnung 253 wendigkeit mit sich bringen kann, gegen Interessen zu verstoßen. Regierungen müssen in Phasen grundlegender ökonomischer Reformen gegen Eigentumsrechte bzw. -interessen (Bodenreformen oder Maßnahmen, die zur Arbeitslosigkeit führen) verstoßen, wenn allokative Effizienz durchgesetzt werden soll. Gerade weil demokratische Verfahren restriktiv sein können - Eigentum und Besitzstände bedrohen können -, sind die Bedingungen, unter denen Demokratie bzw. die dezentralen Strategien autonomer politischer Akteure in eine Gleichgewichtssituation überführt werden, generell fragil (Przeworski 1991). Auf der Mikroebene wird auch die für den Konsolidierungsprozeß kritische Bedeutung des Zeitfaktors deutlich: Ökonomische Reformen können langfristig zwar erfolgreich sein, bringen kurzfristig aber Benachteiligungen für große soziale Gruppen. Damit provozieren sie die Opposition wichtiger politischer Kräfte, die unter demokratischen Bedingungen auf die Stimmungswechsel in der Öffentlichkeit reagieren müssen. Der Erfolg politischer und ökonomischer Reformen ist somit auch von den Mikrovariablen Vertrauen und Geduld abhängig. Sie könnten den „Schatten der Zukunft“ verlängern (vgl. Axelrod 1984) und somit die kurzfristigen in langfristige Rationalitäten überführen. Vertrauen generiert sich nicht nur aus der Fairneß, sondern setzt ein Minimum an institutioneller Gratifikation für die politischen Akteure voraus (Nedelmann 1995). Ob die Eliten oder die Bürger der postkommunistischen Staaten einen substantiellen Nutzen in den neuen politischen und ökonomischen Institutionen sehen können, bleibt zweifelhaft. Vertrauen wird nicht zuletzt aus diesem Grunde auch als die fehlende Ressource in den postkommunistischen Staaten bezeichnet (vgl. Sztompka 1995). Läßt dann auch noch die öffentliche Unterstützung nach (beispielsweise wegen der sozialen Kosten), tendieren die politischen Akteure zu unrealistischen Versprechen, was zum Zusammenbruch des Vertrauens beiträgt. Mit der Geduld, die sich auf die Effizienz bezieht, verhält es sich ähnlich. Die Geduld der Bevölkerung - und damit auch mittelbar die Geduld der politischen Akteure - kann sich prinzipiell nur unter vier Bedingungen zugunsten der neuen Institutionen entwickeln (Offe 1994: 77f): Entweder ergibt sich 1. eine Art Wirtschaftswunder, womit sich verhindern ließe, daß die Geduld der Bevölkerung überstrapaziert wird, oder es wird 2. die Geduld der Bevölkerung mit einer Mischung von positiven und negativen Sanktionen aus dem internationalen System subventioniert. 3. könnten die jungen Regierungen versuchen, die sozialen Unannehmlichkeiten sozialpolitisch zu mildern, und 4. ließen sich rückwärts gewandte Entwicklungen verhindern, wenn die Mitglieder der Gesellschaft ihre Interessen von Vertretungen (intermediären Institutionen) geschützt sähen. Die Aussichten für die osteuropäische Transformation deckten sich nicht mit den positiven Szenarien – sie wurden von Offe eher negativ eingeschätzt. Ein Wirtschaftswunder, wie es Westdeutschland erlebte, hängt ebenso wie die Möglichkeit positiver Sanktionen von den finanziellen Zuwendungen wohlhabender Geberländer ab. Das für eine derar- Konsolidierung der politischen Ordnung 254 tige Unterstützung notwendige Kreditvolumen würde die Geberländer wohl überlasten. Eine sozialpolitische Milderung widerspräche hingegen dem schöpferischen Zerstörungsprozeß; die Entwicklung müßte sich umkehren, der Sozialstaat würde zur Voraussetzung für Markt und Demokratie. In Osteuropa zeigt sich nach Offe außerdem ein der gesellschaftlichen Integration über die Vermittlungsleistung intermediärer Institutionen widersprechender Prozeß: Der Entwicklung einer „Zivile[n] Selbstorganisation jenseits von Markt, Staat und ethnischer Gemeinschaft...“ (Offe 1994: 80) muß unter den Bedingungen präsidentieller Verfassungssystemen und der Erstarkung charismatischer Politik eine geringe Chance zugewiesen werden. Die Wechselwirkungen zwischen den gesellschaftlichen Teilbereichen der Politik, Wirtschaft und Kultur führten in den frühen Reaktionen auf den Umbau in Osteuropa zu einer kritischen Sicht der Entwicklungschancen: Przeworski ging davon aus, daß mit einem kontinuierlichen Konflikt über die Basisinstitutionen gerechnet werden muß und Institutionen wahrscheinlich nur als temporäre Lösungen gewählt werden (1991). Dennoch konnte er keinen wesentlichen Unterschied bei den Bedingungen der Einführung einer ökonomisch effizienten Demokratie in Osteuropa zu den Bedingungen in den vielen anderen Ländern dieser Welt, in denen auch von Wohlstand und Demokratie geträumt wird, sehen. Nach seiner Einschätzung handelt sich auch in den post-kommunistischen Ländern um „normale“ Probleme armer kapitalistischer Länder im Bereich der Wirtschaft, Politik und Kultur. Pointiert stellt er fest: „The East becomes the South“ (Przeworski 1991: 191). Offe (1994) und Elster (1990) hingegen entwarfen ein deutlicheres „Negativszenario“, das sich wie folgt zusammenfassen läßt: Die Makroprozesse des strukturellen Umbaus, d.h. der nachholenden Modernisierungsschritte (Nationalstaat, Marktwirtschaft, Demokratie und Wohlfahrtsstaat), waren historisch aufeinanderfolgende und aufeinander aufbauende Prozesse. Sie gingen davon aus, daß ihre gleichzeitige Einführung wahrscheinlich scheitern würde, und zwar an den Folgen der mangelnden Mesofundierung gesellschaftlicher Interessenintegration, der unzureichenden Konfliktkanalisierung und Risikoabfederung (intermediäre Institutionen) und der überspannten Beanspruchung der Geduld und Zuversicht auf der Mikroebene, d.h. an der kurzfristigen Interessenorientierung seitens der Eliten und der von den schmerzhaften Folgen des wirtschaftlichen Umbaus betroffenen Bevölkerung. Das Scheitern würde dann eine rückwärtsgewandte Entwicklung („backlash“) in allen gesellschaftlichen Teilbereichen bedeuten: Marktwirtschaftliche Reformen könnten aufgehalten oder sogar zurückgedrängt werden, autoritäre Machtstrukturen und ethnische Konflikte könnten an Bedeutung gewinnen, so daß nicht nur gemeinschaftliche Identität als Bürger einer demokratisch-marktwirtschaftlichen Gesellschaft, sondern auch die territoriale Integrität bedroht sind. Konsolidierung der politischen Ordnung 255 5. 2 Erste Revisionen: Chancen und Risiken für Reformen Dem „Negativszenario“, das in den ersten Reaktionen auf die Umbrüche Osteuropas entworfen wurde, läßt sich entgegenhalten, daß es bisher in der angenommenen Dramatik nicht in Erfüllung gegangen ist. Die systematische Skepsis war inkorrekt (Wiesenthal 1999: 6). Trotz der hohen sozialen Kosten bei den Transformationen konnten sich die Nachfolgeparteien des kommunistischen Regimes nicht durchsetzen (vgl. Wollmann / Wiesenthal / Bönker 1995). Die früheren Untersuchungen sind damit aber keinesfalls wertlos. Erstens ist die Transformation noch nicht abgeschlossen, und zweitens haben die Hinweise Offes und Elsters die Aufmerksamkeit für konkrete Problembereiche in der Schnittmenge gesellschaftlicher Teilbereiche sensibilisiert. Sie bilden als „WorstCase-Szenarien“ immer noch einen Referenzpunkt für nachfolgende Untersuchungen erfolgreicher Transformationentwicklung. So hat auch Elster selbst die Bedeutung seiner Argumentation eingeschätzt: „To repeat, this sketch of an argument is mainly intended to provide a framework for discussion. By offering specific premises for a pessimistic conclusion, it should make it easier to discuss whether there are grounds for being more optimistic.“ (Elster 1990: 316). Die aktuellere Transformationsforschung kann sich aber erst einmal von der Untersuchung prinzipieller Hindernisse abwenden und auf die Probleme der praktischen Umsetzung neuer Politiken konzentrieren. Dazu gehört auch eine Neuformulierung bzw. Konkretisierung der Wechselbeziehungen zwischen den gesellschaftlichen Teilbereichen. Eine solche Revision der Wechselwirkungen muß erklären können, aus welchen Gründen sich die Entwicklung der demokratischen Konsolidierung bisher erfolgreicher darstellte als erwartet; wie begründen sich die Chancen für eine Verzögerung oder sogar Aufhebung der vom Zeitfaktor diktierten, die demokratischen Ansätze bedrohenden Widersprüche? Während sich das Negativszenario für den Bereich der Politik nicht bestätigte, wurden im Bereich der wirtschaftlichen Konsolidierung die Schwierigkeiten unterschätzt. Die Kosten des Umbaus (Produktionseinbrüche und Fall des Sozialprodukts) sind höher ausgefallen als erwartet und übersteigen sogar die Werte, die man von den Transformationen in Südamerika kannte. Diese Fehleinschätzung begründet sich aus dem begrenzten Wissen über die Ausgangsbedingungen der Transformation (Wollmann / Wiesenthal / Bönker 1995): Einer Einschätzung des Transformationserfolges fehlt jeder Vergleichshintergrund, da die eingeschränkte Fähigkeit zur Selbstbeobachtung der kommunistischen Systeme eine unsichere Basis für die Vergleichsdaten bildete und somit zu Konsolidierung der politischen Ordnung 256 unterschiedlichen Schätzungen der Produktionsverluste führen mußte. Aus diesem Grunde läßt sich auch der Erfolg der wirtschaftlichen Reformen schwer einschätzen. Erst mit dem mittelfristigen zeitlichen Abstand Mitte der 90er Jahre ließen sich die Kennzahlen der osteuropäischen Wirtschaften realistischer einschätzen. Mit der Kenntnis der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Bedingungen wurde auch die Einschätzung der Chancen und Risiken für eine erfolgreiche Konsolidierung zielgenauer. Konsolidierungserfolge zeichneten sich ab, und die Schwierigkeiten der Institutionenstabilisierung konkretisierten sich im politischen Alltagsgeschäft. Eine erste Phase der politischen und wirtschaftlichen Reformen war abgeschlossen; die rechtlichen Voraussetzungen für eine marktwirtschaftliche und demokratische Struktur waren eingeführt. Nach etwa fünf Jahren konnte unter Kenntnis realistischerer Kennzahlen für die Bedingungen des wirtschaftlichen Umbaus nach den Bedingungen für eine zukünftige Stabilisierung der in den Verfassungen kodifizierten Demokratie gefragt werden. Die Frage zielte auf die Bedingungen des Institutionenumbaus auf der Akteursebene, da die formalen Voraussetzungen für eine sich selbst regelnde Ökonomie und politische Verfahrensregeln zur Stabilisierung offensichtlich nicht ausreichten. Daher gerieten institutionalisierte Formen korporatistischer Verhandlungen und Konflikte einerseits und Formen der Parteienkonkurrenz andererseits verstärkt ins Blickfeld (Mänicke-Gyöngyösi 1995b): Institutionalisierte Handlungszusammenhänge sind auf strategisch relevante Akteursgruppen angewiesen. Sie können als korporatistische Akteure bzw. Agenten korporatistischer Akteure die gesellschaftlichen Konflikte in einer Weise austragen, die die gesellschaftliche Integration und die kreative Nutzung des Konfliktpotentials ermöglicht. Nur so kann verhindert werden, daß Konflikte systembedrohend ausufern oder Kategorien wie Ethnizität, Religion und Nation als primäre, konfliktreiche Identitätskonzepte gesellschaftlicher Integration an Bedeutung gewinnen. Aus Akteurskonstellationen müssen die stabilisierenden Institutionalisierungsschübe hervorgehen. Diese Entwicklung in der Transformationsforschung bestätigt ein Ergebnis des Kapitels zum institutionellen Umbau66: Die Untersuchungen zur Konsolidierung muß sich insbesondere auf Prozesse der Meso- und Mikroebene konzentrieren. Auf diesen Ebenen liegt in der aktuellen Situation der Schlüssel zur Stabilisierung effektiver Marktwirtschaften und repräsentativer Demokratien. Zwar lassen sich in der Diskussion zur Zielbestimmung der Entwicklung post-kommunistischer Staaten Widersprüche auf der Makroebene thematisieren. Und ebenso muß bei den Voraussetzungen für die Etablierung neuer institutionalisierter Handlungszusammenhänge das strukturelle Erbe berücksichtigt werden. Dennoch liegt der Fokus auf den „untergeordneten“ Analyseebenen, da hier bestimmt wird, welche Institutionen und Akteurskonstellationen sich langfristig stabilisieren werden, so daß zu einem späteren Zeitpunkt einmal sinnvoll von Strukturen die Rede sein kann. Die osteuropäischen Staaten befinden sich zur Zeit in einer dynami66 Vgl. Teil III, Kapitel 3. Konsolidierung der politischen Ordnung 257 schen Phase des Umbaus und der Ausgestaltung neuer Formen der Durchsetzung kollektiv verbindlicher Entscheidungen in der Politik, neuer Formen der Verteilung und Ressourcenbereitstellung in der Wirtschaft, aber auch der Definitionen neuer integrationsstiftender Solidaritätsformen der gesellschaftlichen Gemeinschaft. Den Akteuren stellt sich in dieser noch instabilen Situation die Aufgabe, die politischen, ökonomischen und kulturell-kommunikativen Medien zu entwickeln, die die gesellschaftliche Modernisierung im Sinne der funktionalen Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Teilbereiche und gleichzeitig die gesellschaftliche Integration gewährleisten; Machtbeziehungen, Modi der Mobilisierung von Ressourcen sowie Einfluß und Commitment gegenüber den neuen gesellschaftlichen Normen und Werten gilt es jetzt allgemein verbindlich und dauerhaft zur Stabilisierung der Interaktionen zu definieren. Über den kulturellen Hintergrund, die unterschiedlichen Traditionen und den Charakter des Zusammenbruchs wirkt die spezifische Vorgeschichte der einzelnen Länder auf die aktuellen Identitätskonzepte der Eliten und Öffentlichkeit und beeinflußt somit den Prozeß und Erfolg der zivilgesellschaftlichen Erneuerung. Die Neubildung der nationalen Identitätsmuster ist eine wesentliche Voraussetzung für die demokratische Konsolidierung und für eine effektive Marktwirtschaft, d.h. die Kongruenz der Identitäten mit den autoritären bzw. post-totalitären Regimen muß überwunden werden. Die Bedeutung der kulturellen Dimension läßt sich am Vergleich der Entwicklungen der ostmitteleuropäischen Staaten mit Rußland zeigen (Mänicke-Gyöngyösi 1995b): In den ostmitteleuropäischen Staaten bilden z.T. die zivilgesellschaftlichen Traditionen und die intellektuellen Diskurse Anknüpfungspunkte für eine demokratische Identität. Es entstanden konkurrierende Kräfterelationen, die eine Grundlage für den demokratisch-pluralistischen Prozeß der politischen Willensbildung sind. Die neuen Eliten rekrutierten sich aus den oppositionellen Bewegungen, was einen ersten demokratischen Wandel beschreibt, in dem Gemeinschaftskonzepte mit neuen Werten zur Geltung kommen. In Rußland hingegen hat es nur einen Wechsel der Staatsform gegeben - ohne die Beteiligung von Gegeneliten. Hier fehlt es daher an Ansatzpunkten für eine neue, auf demokratische, zivilgesellschaftliche Werte aufbauende Identitätsbildung67. Auf die Demokratisierungsansätze wird mit Auflösungstendenzen reagiert, weil die weggefallene, teilweise erzwungene, ideologische Solidarität auf der Staatsebene durch regionale ethnische Symbolik, der die neuen Identitätskonzepte folgen, aufgefangen wird. Das kulturelle Erbe der stalinistischen Unterdrückung und Säuberung setzt sich in Ländern wie Rußland und der Ukraine in der „... Unfähigkeit der Menschen, sich auf einer freiwilligen und demokratischen Basis zusammenzuschließen...“ (Fukuyama 1999: 12) 67 Hinzu kommt erschwerend, daß es in Rußland eine lange, ungebrochene Tradition der Autokratie als dominante politische Kultur gibt. Die Reaktion auf die negativen Erfahrungen mit der Demokratie wurden dementsprechend mit Autoritätsverlust, Chaos und Verfall in Zusammenhang gebracht (vgl. G. Simon 1996). Konsolidierung der politischen Ordnung 258 fest. Diese Tendenz steht der Bildung zivilgesellschaftlicher, solidaritätsstiftender Assoziation entgegen. Normen und Werte, die eine „inclusion“ der Gesellschaft bewerkstelligen müssen, können sich unter diesen Bedingungen nicht auf Bürgersinn und politische Werte stützen. Damit ist die Gefahr verbunden, daß eine intolerante Gemeinschaft, die sich über konfliktreiche ethnische Symbolik zusammenschließt und damit zu „...exclusion, zu Ausgrenzung und Hass...“ (Fukuyama 1999: 13) anderen Gemeinschaften gegenüber führt, die Basis für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bildet. In einer ersten Revision der Konsolidierung stellt sich insbesondere die Frage, welche Mechanismen auf der Mikro- und Mesoebene es verhindern konnten, daß es zu der befürchteten rückwärtsgewandten Reaktion der Akteure kam. Die Antwort liegt bei den besonderen Ausprägungen der Handlungszusammenhänge der Eliten und bei der Rolle der Öffentlichkeit in Osteuropa: Für die Eliten im Bereich der Politik und der Wirtschaft muß für den Zeitraum nach dem Zusammenbruch von einer „Akteurslücke“ ausgegangen werden. Die Gründe dafür sind vielschichtig (Wollmann / Wiesenthal / Bönker 1995): Der politische Zusammenbruch erfolgte ohne relevante Gegeneliten, aus denen die für Demokratien typischen Akteure hätten rekrutieren werden können. Neue Eliten sind aufgrund mangelnder Erfahrung mit kollektiven Entscheidungen, Kompromissen und öffentlicher Verantwortung oft überlastet. Hinzu kommt, daß in dem neuen System Vermittlung, die an spezifischen politischen Interessen orientiert ist, kaum nachgefragt wird. Der Grund dafür ist in der „erfolgreichen“ Nivellierung von sozialstrukturellen Differenzen während der kommunistischen Herrschaft zu suchen. Das hat zur Folge, daß die demokratischen Institutionen einen relativ homogenen „Input“ erfahren und den politischen Akteure keine an „Policy“-Themen orientierte Profilbildung gelingt. Ganz analog zeigt sich das Problem für die Wirtschaft. Hier scheiterte die Hoffnung, daß die Privatisierung staatlicher Betriebe Akteure generiert, die an einer Stärkung der marktwirtschaftlichen Strukturen interessiert sind. Es zeigt sich, daß die Privatisierung diejenigen begünstigte, die aufgrund ihrer Position im alten System einen bevorzugten Zugang zum Volkseigentum hatten. Dies sind die vormaligen Direktoren und Belegschaften der Großbetriebe, denen halbstaatliche Holdings bzw. Privatisierungsagenturen gegenüberstehen. Für diese Akteure stellt eine konsequente Privatisierung und Marktöffnung aber oftmals eine Bedrohung dar. Sie wehren sich gegen den Abbau von Staatskrediten und Lohnsubventionen und stemmen sich somit gegen marktwirtschaftliche Reformen. Bezüglich der Öffentlichkeit stellt sich die Situation weniger einheitlich dar. Zwar hat es in den osteuropäischen Staaten parallele Erfahrungen mit der Staatsmacht und ähnliche Sozialisationsversuche der „Erziehungsdiktaturen“ (Parsons 1972) gegeben, dennoch ist die Verteilung der kulturellen Ressourcen für die Herausbildung einer Civil Society länderspezifisch unterschiedlich (Mänicke-Gyöngyösi 1995b; Wollmann / Konsolidierung der politischen Ordnung 259 Wiesenthal / Bönker 1995): Die parallele Erfahrung besteht darin, daß der allmächtige Staat die Erfahrungen im Umgang mit der Obrigkeit nachhaltig prägte. Eine tiefe Skepsis gegenüber kollektiv organisierten Formen der Interessenvertretung und die mangelnde Kenntnis der Verfahren ziviler Selbstorganisation sind die anhaltende Folge. Die mit dieser Haltung induzierte Passivität wird unterstützt von der Erwartung, daß staatliche Institutionen für alle gesellschaftlichen Belange zuständig sind. Diese Wechselwirkung zwischen dem kulturellen und dem politischen Bereich gilt vergleichsweise für den Bereich der Wirtschaft. So schwer es fällt, politische Parteien entlang prägnanter Interessendifferenzen zu bilden, so schwer fällt es auch, Assoziationen der Wirtschaftsinteressen zu organisieren. Interessen, die organisationstauglich sind, ergeben ein Bild zerstreuter Verbändestruktur (Wollmann / Wiesenthal / Bönker 1995: 19f). Über diese mehr oder weniger stark ausgeprägte, gemeinsame Erfahrung hinaus gibt es gravierende länderspezifische Unterschiede, die die Chancen für die Bildung zivilgesellschaftlicher Institutionen mitbestimmen (vgl. Mansfeldová / Szabo 2000). Unterschiede im kulturellen Erbe der osteuropäischen Staaten - damit sind hier Traditionen zivilgesellschaftlicher und privatwirtschaftlicher Ansätze gemeint - beeinflussen die pfadabhängige Entwicklung von intermediären Gebilden. Der sogenannte „Gulaschkommunismus“ Ungarns beispielsweise bildet einen positiven Erfahrungshintergrund, für wirtschaftliche und politische Selbstorganisation. In Rußland hingegen gibt es nahezu keine zivilgesellschaftliche Erfahrung (vgl. Beichelt / Kraatz 2000). Diese Spezifizierung der Wechselwirkungen zwischen dem kulturellen Hintergrund einerseits und dem politischen und wirtschaftlichen Bereich andererseits läßt Aussagen über den bisherigen Verlauf der Transformation und die aktuellen Probleme für eine wirtschaftliche und politische Konsolidierung zu. Unerwarteterweise wirkten die Akteursdefizite in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch entlastend (Wollmann / Wiesenthal / Bönker 1995: 20f): Die Abwesenheit durchsetzungsfähiger Interessengruppen bewahrte die Einführung der Wirtschaftsreformen trotz unerwartet hoher Wohlfahrtseinbußen vor demokratiegefährdenden Konflikten, wie sie noch von Elster und Offe vorhergesehen wurden. Die Eliten gewannen bedeutend an Entscheidungsspielraum, weil die Bevölkerung am politischen Leben vergleichsweise uninteressiert war. Die Schwäche der intermediären Ebene (kollektive Akteure und Institutionen) kann aber nur eine vorübergehende Hilfe im Reformprozeß sein. Die negativen Auswirkungen des Mangels sind absehbar. Der politische Bereich ist nicht nur stark belastet, weil die Entlastungswirkung gesellschaftlicher Selbstorganisation sich nicht entwickelt. Ein wegen mangelnder pluralistischer Strukturen kaum kontrolliertes, staatliches Monopol politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen ist auch der Gefahr ausgesetzt, privat besetzt und damit für opportunistische Interessen instrumentalisiert zu werden. Die Konsolidierung der politischen Ordnung 260 mangelhafte Interessenvertretung birgt außerdem zusätzliche Risiken für die gesellschaftliche Integration. Da gesellschaftliche Konflikte nicht entlang der klassischen politischen cleavages verlaufen, besetzen Themen wie Nation, Tradition, Religion und Ethnizität die politische Agenda. Die Problematik der Politisierung ethnischer Konflikte liegt in der Schnittmenge von Politik und Kultur und läßt sich der Frage nach den Chancen der Entwicklung einer politischen, zivilgesellschaftlichen Kultur unterordnen. Die Verknüpfung der beiden Konzepte „Zivilgesellschaft“ und „Transformation“ bildet daher ein zentrales Thema der neueren politischen Transformationssforschung (vgl. Croissant / Lauth / Merkel 2000; v. Beyme 2000; Masfeldová / Szabó 2000; Kraus 2000). Die Verknüpfung erfolgt über eine funktionalistische Bestimmung des Konzepts der Zivilgesellschaft (Croissant / Lauth / Merkel 2000: 11f): Die Erfüllung der Schutzfunktion, der Sozialisierungsfunktion, der Vermittlungsfunktion, der Gemeinschaftsfunktion und Kommunikationsfunktion der Zivilgesellschaft bestimmt den Konsolidierungsgrad der Demokratie. Die Erfüllung der Funktionen klärt nämlich, in welchem Maße die Bürger vor staatlicher Willkür geschützt werden, Rechtsstaat und Gewaltenteilung etabliert sind, Bürger zivile Tugenden erlernen, wie politische Eliten rekrutiert werden und ob im öffentlichen Raum ein Medium demokratischer Selbstreflexion der Gesellschaft institutionalisiert ist. In der Neuformulierung der Transformationsprobleme gewinnt die Pfadabhängigkeit und damit das kulturelle Erbe im Bereich des zivilgesellschaftlichen Vorlebens an Bedeutung68: Der Institutionenumbruch steht und fällt mit dem Tempo, in dem es „...gelingt, diese institutionelle Erblast des ancient règime abzuwerfen und Raum für zivilgesellschaftliche Entwicklungen und deren privat-wirtschaftliche und inner-gesellschaftliche Aktivitäten und Institutionenbildungen zu schaffen“ (Wollmann / Wiesenthal / Bönker 1995: 22). Voraussetzung dafür ist, daß die institutionellen Reste des allmächtigen Staates abgeschafft werden und die neuen staatlichen Strukturen so eingerichtet werden, daß sich privatwirtschaftliche und eigengesellschaftliche Handlungsstrukturen etablieren können. 5.3 Zusammenfassung Der Hauptwiderspruch der Konsolidierung hat sich nach den ersten erfahrungsreichen Jahren verschoben. Die Widerstände gegen eine erfolgreiche Konsolidierung demokratisch-marktwirtschaftlicher Strukturen werden nicht mehr primär an der Schnittstelle des politischen mit dem wirtschaftlichen Bereich gesehen, wie noch zu Beginn der 90er 68 Vgl. für eine ähnliche Argumentation bezüglich des Zusammenhangs von ökonomischen und gesellschaftlichen Änderungen Hausner, Jessop, Nielsen (1995). Konsolidierung der politischen Ordnung 261 Jahre. Entgegen der Logik der ersten Negativ-Szenarien mußte man erkennen, daß sich unter den Bedingungen demokratischer Institutionen die harten Maßnahmen des ökonomischen Umbaus durchaus durchsetzen ließen. Die Bedeutung des Zeitfaktors – wie sie von Przeworski, Offe und Elster hervorgehoben wurde – hat sich für die Schnittmenge von Politik und Wirtschaft geändert. Besonders Offes Einschätzung der Bedeutung der Geduld der Bürger und der negativen Folgen ihrer Überspannung traf so nicht zu. Das Dilemma der Gleichzeitigkeit, so kann man zu diesem späteren Zeitpunkt schließen, entdramatisierte sich aufgrund der unpolitischen Haltung der Bevölkerung und wegen des niedrigen Organisationsgrades gesellschaftlicher Interessen. Die aktuelle Herausforderung der Konsolidierung liegt nicht mehr primär an der Schnittstelle politischer und wirtschaftlicher Reformen. Sie hat sich auf die Schnittstelle von Politik und Wirtschaft einerseits mit dem kulturellen Erbe bzw. den kulturellen Ressourcen andererseits verlagert und wirkt von dort aus auf die einzelnen gesellschaftlichen Teilbereiche zurück. Damit haben sich die Ausgangsbedingungen für die Stabilisierung geändert. Anfangs standen noch die Risiken für demokratische Reformen, die direkt aus den Wohlfahrtseinbußen bei marktwirtschaftlichen Reformen folgten, im Vordergrund. Kulturelle Defizite schienen nur indirekt eine Bedrohung der neuen demokratischen Ordnung zu bilden – und zwar dann, wenn die überspannte Geduld der Eliten und der Bevölkerung die Instrumentalisierungschancen ethnischer Konflikte steigerte. Heute hingegen gerät die direkte Gefährdung der weitergehenden Stabilisierung demokratischer Institutionen und wirtschaftlicher Effizienz durch den Mangel an entsprechenden kulturellen Ressourcen ins Blickfeld. Die Stabilisierung demokratischmarktwirtschaftlicher Strukturen steht heute vor der Aufgabe, die Bildung einer zivilgesellschaftliche Identität zu fördern und sich gegen die Tendenzen der Identitätsfindung entlang konfliktreicher - meist ethnischer - Dimensionen durchzusetzen. Ergebnis IV. ERGEBNIS 262 Ergebnis 263 Um ein komplexes Phänomen wie die Transformation Osteuropas zu verstehen, bedarf es - und das wurde ausführlich diskutiert – einer Vielzahl theoretischer Ansätze und Perspektiven. Es wurde gezeigt, daß einzelne Ansätze blinde Flecken haben, d.h. Fragestellungen offen lassen, deren Beantwortung für das Verständnis der Transformation unausweichlich ist. Die unterschiedlichen theoretischen Perspektiven können allerdings nicht einfach willkürlich miteinander kombiniert werden. Ein eklektischer Umgang mit Theorie läßt sich nur vermeiden, wenn bestimmte Fragestellungen zu Teilaspekten des Phänomens der jeweils relevanten analytischen Ebene und der entsprechenden theoretischen Perspektive zugeordnet werden. Bei einer solchen Zusammenführung dürfen sich die Aussagen der verschiedenen Perspektiven nicht widersprechen. Aus diesem Grunde sind die Schnittstellen anzugeben, an denen sich die analytischen Ebenen aneinanderfügen lassen. Und die Prämissen der Theorien müssen so formulieren sein, daß sie die Integration der anderen Perspektiven erlauben. Mit diesen Kriterien sind die Grundvoraussetzungen für ein Mehrebenenmodell benannt. Sie bilden die Koordinaten für eine erfolgreiche Navigation durch die Komplexität des Phänomens. Diese Arbeit hat gezeigt, welche theoretische Perspektive sich für welche Fragestellungen eignet. Auch wurde versucht zu zeigen, an welcher Stelle weiterführende Fragen auftauchen, die auf eine andere analytische Ebene verweisen, so daß sie „natürliche“ Anknüpfungspunkte für andere theoretische Perspektiven bilden. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, welche Nachteile ein exklusiver Erklärungsanspruch für eine bestimmte analytische Perspektive hat: Entweder lassen sich ohne weiteres Gegenbeispiele finden, oder die Ansätze verfangen sich in Widersprüchen zu ihren eigenen Prämissen. Die Gegenbeispiele begrenzen den Erklärungsanspruch dieser Beiträge auf einen beschränkten Teilbereich des Phänomens. In diesem Fall muß zur Beantwortung des umfassenden Phänomens doch wieder mit Hilfe anderer Perspektiven gearbeitet werden. Wenn theoretische Ansätze in ihrer Anwendung den eigenen Prämissen widersprechen, ist dies meist ein Hinweis auf ein reduktionistisches Theoriekonzept. Im Bemühen um eine eindeutige und einfache Modellkonstruktion wird an der Realität vorbei modelliert. Weder die Reduktion auf einen Makrodeterminismus noch die Konstruktion eines reduktionistischen Akteurmodells werden dem Charakter und der Dynamik der Transformationsprozesse gerecht. Zahlreiche Beiträge antizipieren mittlerweile die Defizite, die sich aus einer reduktionistischen Konzeption der Prämissen ergeben, und öffnen sich daher für andere Perspektiven. Die Autoren beschränken sich entweder auf eine eindeutig abgegrenzte Fragestellung und verweisen somit die Anschlußfähigkeit anderer theoretischer Perspektiven oder sie formulieren die Prämissen ihrer Modelle so, daß sie den Prämissen von Ansät- Ergebnis 264 zen, die gesellschaftliche Prozesse auf einer anderen analytischen Ebene beobachten, nicht widersprechen1. Die folgenden Ausführungen zu den Ergebnissen der Untersuchungen des Zusammenbruchs der alten, kommunistischen Ordnung und zu der Problematik des Entstehens einer neuen, politischen Ordnung sind in Abbildung 3 (Seite 298) und 4 (Seite 299) zusammengefaßt. 1 Diesen Schritt vollziehen die akteurtheoretischen Ansätze, die mit einem multi-motivationalen Akteurkonzept arbeiten. Die Vielseitigkeit der Motive verweist auf den Einfluß verschiedener sozialer Kontexte und Institutionen. Wann welche Orientierung dominiert, wird stark von den Kontexten bestimmt. Die Akteure sind nur bedingt frei in der „Wahl“ der Motive. Beispielsweise lassen die über Sozialisationsprozesse internalisierten Normen und Werte nicht zu, daß Entscheidungen lediglich nach einem eigennutz-kalkulierenden Kalkül getroffen werden. Ergebnis 265 1. Die Mehrebeneanalyse des Zusammenbruchs Eine erste Phase der Transformation ist abgeschlossen. Die kommunistischen Regime Osteuropas sind zusammengebrochen. Neue Staaten haben sich gebildet, die alten Verfassungen sind revidiert oder gegen neue, demokratisch orientierte, Verfassungen ausgetauscht worden, und die Eliten der ersten Reihe mußten abtreten. Für die Theorie ergab sich aus dem Zusammenbruch eine Herausforderung. Hatten doch nur die wenigsten Wissenschaftler die Entwicklung voraussehen können, so versuchten nach dem Zusammenbruch um so mehr Autoren, mit ihrem favorisierten theoretischen Ansatz die Entwicklung nachzuzeichnen. Zwar gilt die landläufige Meinung, daß man hinterher stets klüger ist, auch für wissenschaftliche Untersuchungen. Die nachgereichte Erklärung der Geschehnisse steht aber vor einem zusätzlichen theoretischen Problem: Wird nun auf einmal offensichtlich, warum die osteuropäischen Systeme zusammenbrechen mußten, dann wird es um so unverständlicher, daß die Entwicklung uns derart überraschte. Eine theoretische Untersuchung des Zusammenbruchs muß deshalb auch eine Antwort auf die Frage zulassen, warum die Entwicklung nicht vorauszusehen war. Die Antwort kann sich entweder aus den Modellen selbst ergeben oder mit dem Hinweis auf andere, anschlußfähige Ansätze erfolgen, bei denen der Schlüssel zur Antwort lieg,. Für den Zusammenbruch ergibt sich aus der Zusammenführung der verschiedenen theoretischen Perspektiven ein Modell (vgl. Seite 298) , das 1. das Phänomen auf unterschiedlichen analytischen Ebenen untersucht (Achse I), 2. von statischen Zustandsbeschreibungen bis zur Untersuchung dynamischer Prozesse reicht (Achse II) und 3. im Abstraktionsgrad von allgemeinen Aussagen über kommunistische Gesellschaften bis zur Beschreibung konkreter Interaktionen variiert (Achse III). In Abbildung 3 sind entsprechend dieser Dimensionen die drei Achsen dargestellten, auf denen sich die theoretischen Beiträge plazieren lassen2. Die allgemeinste Formulierung liefert die systemtheoretische Zustandsbeschreibung. Sie identifiziert Defizite auf der Makroebene, die für alle kommunistischen Systeme galten und stabilitätsbedrohende Ausmaße annehmen konnten: Die osteuropäischen Systeme waren sämtlich durch ein Differenzierungsdefizit gekennzeichnet, das aus einer unterdrückten soziokulturellen Evolution resultierte. Prozesse der ökonomischen, politischen und kulturellen Systembildung wurden mit der Unterdrückung funktionaler 2 Die Achsen sollen die Ausprägungen der Dimensionen lediglich auf einem Ordinalskalenniveau darstellen. Das heißt, sie informieren lediglich darüber, auf welcher Ebene die Untersuchung erfolgt, und über ein Mehr oder Weniger bezüglich der Dynamik und des Abstraktionsgrades. Theorien überschreiten zunehmend die analytischen Ebenen. Deshalb muß auch bei dieser Dimension nicht von dem EntwederOder einer Nominalskala ausgegangen werden. Ergebnis 266 Differenzierung verhindert. Das Primat einer Leitdifferenz verhinderte, daß die gesellschaftlichen Teilsysteme nach einem eigenen basalen Code operieren konnten. Alle Teilsysteme hatten sich dem teilsystemischen Code der Politik unterzuordnen. Diese Entdifferenzierung behinderte die effiziente Problemverarbeitung und Strukturanpassung. Auf Anreize und Umweltanforderungen konnte nicht spezifisch, also adäquat, reagiert werden, weil die repressiv erzwungene Unterordnung unter den Code sozialistisch / antisozialistisch die Vorteile teilsystemischer Rationalitäten unterdrückte. Strukturtheoretische Analysen wie von der geopolitischen Theorie und der Modernisierungstheorie geleistet schließen an die systemtheoretische Argumentation an. Die geopolitische Theorie führt aus, wie schwierig es für die SU gewesen ist, mit der Umweltanforderung militärischer Konflikt bzw. militärische Machtkonstellation umzugehen. Die externe Anforderung übersetzte sich in eine interne Herausforderung. Zur Behauptung im militärischen Wettbewerb muß von der Wirtschaft eine effiziente Ressourcennutzung geleistet werden. Die Interstate-Competition auf dem militärischen Gebiet wurde somit zu einem internationalen Wettbewerb um die effiziente Ressourcennutzung, was in den kommunistischen Staaten vor allem in den 80er Jahren zu liberalisierenden Marktreformen führte. Aus dem Konflikt wurde Konvergenz. Die Modernisierungstheorie konzentriert sich eher auf die internen Probleme, die aus dem Differenzierungsdefizit folgen. Interne Schwächen werden dann offensichtlich, wenn externe Anforderungen, wie militärischer Wettbewerb, nicht verarbeitet werden können. Hier liegt die Schnittstelle, an der sich die Modernisierungstheorie für die geopolitische Argumentation öffnen muß und umgekehrt die geopolitische Theorie eine Präzisierung ihrer Argumentation durch die Modernisierungslogik erfährt. Aber nicht nur auf dieser inhaltlichen, sondern auch auf der theoretischen Ebene lassen sich geopolitische und modernisierungstheoretische - konvergenz- und konflikttheoretische Analysen zusammenführen. Die systemtheoretische Argumentation ordnet Konflikt den Umwelteinflüssen zu, auf die mit Strukturanpassung reagiert werden muß. Genau ein solcher Schritt wurde mit den liberalisierenden Reformen unternommen, die zur zunehmenden Konvergenz der prinzipiell planwirtschaftlich-zentralistisch gesteuerten Systeme mit den marktwirtschaftlich-demokratisch gesteuerten Systemen führten. Dennoch beschreibt dieser Zusammenhang primär die Entwicklung in der SU. Die mittelund südosteuropäischen Staaten waren nicht durch einen militärischen Wettbewerb zu wirtschaftlichen Reformen - Konvergenz - gezwungen. Für sie spielte die Entwicklung in der SU eine zwar bedeutende, aber dennoch nur mittelbare Rolle. Andere, primär interne Herausforderungen schwächten die Systeme und veranlaßten sie teilweise zu liberalisierenden Reformen. Hier zeigt sich, daß mit der strukturtheoretischen Argumentation vom Abstraktionsgrad der systemtheoretischen Argumentation abgewichen wird. Obwohl die Strukturtheorien Hinweise auf strukturelle Schwächen geben, die sich Ergebnis 267 meist für alle osteuropäische Staaten identifizieren ließen, gab es strukturelle Spezifika, die z.T. für die unterschiedliche Entwicklung verantwortlich waren. Die modernisierungstheoretischen Analysen führen allgemein aus, wie sich mangelnde Differenzierung negativ im wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Teilsystem der Gesellschaft auswirken. Das politische Teilsystem war mit der Steuerung der Wirtschaft überfordert. Der Versuch, die „chaotische“ Steuerung im marktwirtschaftlichen System durch eine zentrale Steuerung zu rationalisieren, schlug fehl. In den kommunistischen Staaten fehlte es aufgrund der mangelnden Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und des verfälschten Feedbacks an einer verläßlichen Grundlage für rationale Entscheidungen. Das politische Teilsystem kämpfte insbesondere mit den Folgen des Demokratiedefizits kommunistisch verfaßter Regime. Es gab keine effektiven Institutionen der Interessenaggregation und -vermittlung, was sich negativ auf die Integration der Gesellschaft und die Legitimität der Herrschaftsverhältnisse auswirken mußte. Dennoch gab es demokratische Ansätze. Die osteuropäischen Staaten unterschieden sich stark in der Ausprägung zivilgesellschaftlicher Ansätze. Diese demokratischen grasroots sollten für die Entwicklung des Zusammenbruchs eine gestaltende Rolle übernehmen. In der kulturellen Entwicklung entstand für die kommunistischen Gesellschaften dadurch ein Problem, daß die von der marxistisch-leninistischen Ideologie konstatierten Werte, die unabdingbar Teil der gesellschaftlichen Identität waren, zunehmend in Widerspruch zur gesellschaftlichen Realität gerieten. Den Werten der egalitären Ideologie standen Privilegien wie Wohlstand und Macht gegenüber, die sich nicht wie in marktwirtschaftlich-bürgerlich organisierten Gesellschaften über Leistung rechtfertigen ließen. Die strukturtheoretischen Beiträge treten über die analytischen Grenzen der Systemtheorie hinaus. Sie beschreiben, daß die individuellen Dispositionen der Akteure (Eliten und Bevölkerung) mit den strukturellen Merkmalen variieren und geben somit die Schnittstelle zu der analytischen Ebene der Mikroprozesse an. Die geopolitische Situation wirkt sich auf den Zusammenhalt der Eliten aus (Elitenkonvergenz) und bestimmt die Legitimität des Regimes vor der Bevölkerung. Die von den Modernisierungstheorien untersuchten Differenzierungsdefizite bestimmen einerseits den Handlungsrahmen, indem sie im Bereich der Wirtschaft und Politik die Entscheidungsfreiheit bzw. Möglichkeiten der Interessenartikulation der Akteure begrenzen. Andererseits werden mit der Thematisierung kultureller Werte und Normen sowie ihrer Widersprüche die Motivation der Gesellschaftsmitglieder und die Legitimität des Regimes berührt. System- und Strukturtheorien liefern Zustandsbeschreibungen, die zu einem Zeitpunkt ansetzen, zu dem die Dynamik des Zusammenbruchs niedrig war. Dennoch beschreiben sie spannungsreiche Zustände, die nach Veränderung verlangen. Auf strukturelle Defizite, die zur Instabilität über Legitimitätsmangel und abnehmende Elitenkonvergenz führen, muß reagiert werden. Hier liegt die Chance für politische und ökonomische Änderungen. Die Strukturtheorien beschreiben den Schritt der Liberalisierung bereits als Ergebnis 268 eine logische Folge der Schwäche des Wirtschaftssystems und gehen damit über eine reine Zustandbeschreibung hinaus. Die Dynamik der zunehmenden Konvergenz mit marktwirtschaftlichen Systemen kann mit der Liberalisierung beginnen. Die Untersuchungen auf der Makroebene beschreiben die Öffnung des Transformationsfensters. Auf die Spannungen wird von entscheidungsrelevanten Akteuren reagiert. Zu welchem Zeitpunkt und auf welche Weise sie reagieren, kann die Makroperspektive nicht klären. Teilweise sind die Schritte der Liberalisierung wieder zurückgenommen worden (z.B. die NPÖ in der DDR), oder auf Legitimitätsdefizite wurde mit Repressionen reagiert. Es kam aber auch vor, daß wirtschaftliche Freiheiten von politischen Freiheiten flankiert wurden. Diese Vielfalt der Reaktionen läßt sich nicht einfach auf einen Makrodeterminismus zurückführen. Die Akteure, die zwischen den Strategien des Umgangs mit den strukturellen Schwächen und Spannungen wählen, treffen ihre Entscheidung in komplizierten Verhandlungen, deren Ergebnisse nicht aus den objektiven Bedingungen abgeleitet werden können. Wie aber wirken die strukturellen Hintergründe auf diese Entscheidungen bzw. wie wirken die Entscheidungen auf die Strukturen zurück? Diese Frage spannt sich über den theoretische „Graben“ zwischen Makro- und Mikrotheorien, der von den Mesotheorien überbrückt werden kann. Sie können die beiden Paradigmen zusammenführen, indem sie zeigen, auf welche Weise 1. Makromerkmale den Spielraum von individuellen und korporativen Akteuren variieren (Wirkungspfeil 1 in Abb. 3) und wie sich 2. Mikroprozesse kurz- und mittelfristig in routinierte, institutionalisierte Prozesse und langfristig in strukturelle und systemische Eigenschaften umsetzen (Wirkungspfeil 2 in Abb. 3). Somit fügen sie in zwei Schritten die beiden Paradigmen an ihren Schnittstellen zusammen: Der Schritt 1 erfolgt mit der Diskussion horizontaler und vertikaler Defizite intermediärer Institutionen. Die institutionentheoretischen Untersuchungen zur mangelnden Intermediarität zeigen, welche Institutionen als unabhängige Variable Handlungsroutinen und Machtverhältnisse festigen konnten. Normen und Werte, die Konformität mit der marxistisch-leninistischen Ideologie sicherten, wurden von den Akteuren internalisiert und erst hinterfragt, als sich die Schwächen der kommunistischen Systeme nicht mehr verdecken ließen und erste oppositionelle Stimmen zu hören waren. So läßt sich sowohl die anfängliche Stabilität der Systeme als auch die Dynamik, mit der die Institutionen des Systems zunehmend in Frage gestellt wurden, verstehen. Die Dynamik entsteht dann, wenn der Umgang mit den Institutionen nicht mehr unreflektiert, sondern strategisch erfolgt. Hier setzt der Schritt 2 an. Kommt es zu Reformen, dann wird über Institutionen, die die Verteilung der Macht und den Zugang zu den Ressourcen regeln, verhandelt. Die Institutionen stehen unter Begründungsdruck und werden somit zur abhängigen Variable. Ergebnis 269 Bei ökonomischen Liberalisierungsmaßnahmen - wie von den Modernisierungtheorien angedeutet - werden die Institutionen des Eigentumsrechts Gegenstand strategischer Änderungen. Durch die Reformprozesse wird eine Dynamik angestoßen, die den Akteuren z.T. aus der Kontrolle gerät. Am Beispiel des „Dilemma of Reforms“ zeigen die institutionentheoretischen Untersuchungen, daß institutionelle Reformen den unerwünschten Nebeneffekt der abnehmenden Elitenkohärenz haben können. Der strategische, zweckorientierte Umgang mit Institutionen garantiert also nicht die planmäßige Erfüllung der mit den Änderungen angestrebten Wirkungen. In Osteuropa trieben die Änderungen die Schwächung der Strukturen weiter voran und gefährdeten die Identität des Systems. Der Abstraktionsgrad der Mesotheorien unterscheidet sich deutlich von dem der Makrotheorien. Auch wenn sich die poltischen, ökonomischen und kulturellen Institutionen in den kommunistischen Staaten teilweise ähnelten oder sogar Gemeinsamkeiten aufwiesen, unterschied sich der Umgang mit ihnen sowie die Wirkung von institutionellen Änderungen doch gravierend. Daher setzen die Mesountersuchungen auf der Ebene institutioneller Spezifika der gesellschaftlichen Teilsysteme (hier besonders Politik und Wirtschaft) der einzelnen Staaten an. Mit dem vertikalen Institutionendefizit sprechen sie ein Problem an, das für die SU zentral war. Vertikale Institutionen, die die Vorgesetzten-Untergebenen-Beziehung regulieren, konnten dort die Steuerung der Bürokratie nicht leisten, so daß erstens Korruption die Stabilität bedrohte und zweitens lokale Machthaber der Zentrale ihre Loyalität aufkündigten. Für die anderen osteuropäischen Staaten wirkte die Schwäche vertikaler intermediärer Institutionen zwar mittelbar, weil mit der Schwächung der SU eine externe Legitimitätsgrundlage der Herrschaftsverhältnisse wegfällt. Primär war aber ein anderes Defizit von Bedeutung. Es gab keine Institutionalisierung der horizontalen Trennung von Zuständigkeitsbereichen und dementsprechend auch keine intermediären Institutionen, die zwischen den Bereichen vermittelten. Dieses tight coupling bewirkte, daß es keine Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten jenseits der Parteispitze gab. Die institutionentheoretischen Untersuchungen konkretisieren - besonders anschaulich am Beispiel der Entscheidungsprozesse in der DDR -, zu welchen Irrationalitäten diese institutionelle Umsetzung des im System angelegten Differenzierungsdefizits führten. Die theoretische Ansatzhöhe der Mesoperspektive berücksichtigt aber auch Mikroprozesse, nämlich dann, wenn die Reaktionen und den Umgang der Akteure mit den institutionellen Defiziten thematisiert werden. Einige Eliten reagierten mit Antikorruptionskampagnen, andere strebten Änderungen der Eigentumsrechte an, ließen verstärkt politische Pluralität zu oder reagierten mit Repressionen. Welche strukturellen Wirkungen solche Versuche der Etablierung neuer Handlungsroutinen haben, kann eine institutionentheoretische Untersuchung zu klären versuchen. Ergebnis 270 Die Mikrotheorien setzen mit ihren Modellen bei den Entscheidungssequenzen der Akteure an. Sie modellieren damit nicht die institutionalisierenden und strukturierenden Wirkungen der Handlungen von Akteuren, sondern versuchen nachzuzeichnen, wie Entscheidungen getroffen werden konnten, die zu den Ergebnissen wie einer zunehmenden Liberalisierung, repressiven Unterdrückungsmaßnahmen oder auch dem endgültigen Zusammenbruch der kommunistischen Systeme führten. Akteurstheorien untersuchen Prozesse auf der Interaktionsebene. Mit dem Verweis auf bestimmte Akteurskonstellationen, die Strategien der Akteure, ihre Präferenzen und Motive konkretisieren sich ihre spezifischen Entwicklungsunterschiede und -schritte in den einzelnen Staaten. Je nachdem, welche Bedeutung bestimmten Akteursgruppen bei den Entscheidungen, die zu gravierenden Änderungen der Institutionenstruktur führten, zukam, konnte der Charakter des Zusammenbruchs sehr unterschiedlich ausfallen: Verliefen die meisten Übergänge zur Demokratie auch friedlich, so war zumindest in Rumänien eine andere Entwicklung, eine eruptive, gewaltsame Ablösung des alten Regimes, zu beobachten. Aber auch bei den friedlichen Übergängen gab es Unterschiede, die weit in die Konsolidierungsphase hinein wirken können. In einigen Staaten wurde der Wandel weitestgehend von oben, d.h. aus den Reihen der Eliten initiiert (Sowjetunion, Ungarn), während in anderen Staaten die Reaktion und Mobilisierung der Öffentlichkeit eine Schlüsselrolle spielte (Bulgarien, Polen, DDR). Die föderalen Staatenverbände zerfielen weitgehend bei dem Übergang (Tschechoslowakei, Jugoslawien, SU), während es in anderen Staaten nahezu keine „Stateness“-Probleme gab (Polen, Ungarn), sie unterdrückt wurden (Rumänien, Bulgarien) oder sich dadurch lösten, daß der Verfassung eines anderen Staates beigetreten wurde (DDR). Solche spezifischen Entwicklungen lassen sich nur verstehen, wenn die Interaktion der politischen Akteure und Reaktion der Bevölkerung in Betracht gezogen werden. Natürlich setzen sich die Akteurskonstellationen vor dem Hintergrund der strukturellen Eigenschaften sowie der institutionellen Spezifika des kommunistischen Systems zusammen, und die Akteure handeln auch nach Vorgabe institutionalisierter Handlungsroutinen. Hier liegen auch die Schnittstellen der Mikrotheorien, an denen die Analysen auf der Interaktions- bzw. Akteursebene an Analysen auf übergeordneten analytischen Ebenen anschließen. Dennoch verfügen die Akteure über eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Militärischer, ökonomischer, aber auch politischer und moralischer Problemdruck stellen Institutionen unter Bewährungsdruck und verlangen nach neuen Strategien. Innerhalb der Eliten bilden sich Fraktionen, und die Bevölkerung reagiert auf die abnehmende Legitimität evtl. mit Protest, was wiederum die Machtverhältnisse innerhalb der Eliten verschieben kann. In einer solchen Situation entsteht Spielraum für alternative Entwürfe und Entscheidungen, die zu gravierenden Änderungen führen können. Ergebnis 271 Die Akteurtheorien modellieren dynamische Transformationsprozesse, indem sie Entscheidungssequenzen nachzeichnen, welche berücksichtigen, daß sich die Machtverhältnisse in der Elite mit jeder Entscheidungssequenz verschieben können und daß es eine Wechselwirkung zwischen diesen Innerelitenprozessen und der öffentlichen Mobilisierung geben kann (Wirkungspfeil 3 in Abb. 3). Von sukzessiven Entscheidungsschritten geht der Wandel der Systeme aus, wird über neue Regeln der Macht- und Ressourcenverteilung bestimmt. Regeln, die soeben noch galten, sind am nächsten Tag schon wertlos. Nur eine Perspektive, die in der Lage ist, solche Schritte nachzuzeichnen, wird der hohen Dynamik der Geschehnisse gerecht und kann erklären, wie es zu Ergebnissen kommen konnte, die von den Entscheidungsträgern nicht antizipiert wurden und oftmals auch nicht gewollt waren. Die Mikromodelle zeigen mit der Modellierung der Entscheidungssequenzen, warum Akteure in einer bestimmten Art und Weise auf strukturelle und institutionelle Defizite reagierten und wie diese Reaktionen zu den Ergebnissen führten, die sich beobachten ließen. Unklar bleibt aber weiterhin, warum der Zusammenbruch zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgte. Diese Unschärfe läßt sich auch aus der Mikroperspektive beheben nicht gänzlich. Das hängt damit zusammen, daß sich sowohl die Entscheidungen der Eliten als auch die Reaktion der Bevölkerung nicht vorhersehen lassen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, daß mangelnde gesellschaftliche Integration, uneffizientes Wirtschaften und abnehmende Legitimität und Elitenkonvergenz sich ab einem bestimmten Punkt automatisch in Liberalisierungsmaßnahmen und öffentlichen Protest umsetzen. Ein solcher Determinismus läßt sich nicht feststellen, weil eine Vielzahl von Motiven die Entscheidungen der Akteure bestimmt. Innerhalb der Eliten werden Entscheidungen nicht nur nach rationaler Maßgabe getroffen. Irrationalitäten schleichen sich ein, wenn eine falsche Wahrnehmung der Möglichkeiten oder Wunschdenken die Entscheidungen beeinflussen. Und nicht-rationale Motive, wie normative und moralische Orientierungen, spielen eine Rolle bei der Entscheidung zum öffentlichen Protest trotz drohender Sanktionen. Ebenso verhandeln Eliten und Opposition auf der Grundlage einer gemeinsamen normativen Basis, auf die die Parteien sich in von Verständnisorientierung beeinflußten Vorverhandlung teilweise einigen konnten. In dieser Breite individueller Motive liegt der Schlüssel zur Beantwortung der eingangs gestellten Frage, warum der Zusammenbruch der kommunistischen Systeme so schwer vorauszusehen war: Eine Vielzahl von Variablen (Motiven und Kontextbedingungen) bestimmt die Reaktionen und Handlungen der Akteure. Der Zusammenbruch stellt einen Prozeß dar, der sich aus aneinandergereihten Entscheidungssequenzen ergibt, wobei nach jeder Sequenz ein neuer Zustand mit z.T. völlig anderen Voraussetzungen die Grundlage für die nächste Entscheidung bildet. Besonders deutlich wurde diese Dynamisierung kontextueller Bedingungen bei den Verhandlungen an den Runden Tischen. Ergebnis 272 Die politischen Akteure sahen sich nach einzelnen Entscheidungsschritten teilweise mit unerwarteten und unbeabsichtigten Folgen wie Protesten und Wahlniederlagen konfrontiert, die die Machtkonstellationen und somit die Ausgangsbedingungen für die weiteren Verhandlungsschritte gravierend änderten. Der Prozeß der Entscheidungen findet darüber hinaus hinter verschlossenen Türen statt; über die Motive der entscheidungsrelevanten Akteure läßt sich daher nur spekulieren. Damit fehlt die Grundlage für eindeutige Wirkungsmodelle, derer es bedarf, um Zeitpunkt und Entwicklung von Transformationen vorherzusehen. Was die Mikrotheorie aber neben der Erklärung, warum Vorhersagen nicht getroffen werden können, leisten kann, ist ein Verständnis der Akteurskonstellationen, der Strategien der Akteure sowie ihrer Motive und Präferenzen. Mit diesen Größen kann der Prozeß nachgezeichnet werden, so daß die Dynamiken und die verschiedenen Wege zur Demokratie verständlicher werden. Die Analyse des Zusammenbruchs ist mit zwei theoretischen Herausforderungen konfrontiert: Erstens handelte es sich beim Zusammenbruch der kommunistischen Systeme Osteuropas um ein allgemeines Phänomen, von dem ganz Osteuropa betroffen war. Und zweitens vollzog sich der Zusammenbruch in jedem einzelnen Staat auf recht unterschiedliche Weise. Nur in einem Mehrebenenmodell lassen sich beide Aspekte miteinander verbinden, weil dieses den Graben zwischen verschiedenen theoretischen Paradigmen überwinden kann. Der Prozeß des Zusammenbruchs findet sowohl auf der Makro- als auch auf der Meso- und Mikroebene statt. Analysen des Zusammenbruchs, die ausschließlich auf einer analytischen Ebene argumentieren, können diese Zusammenhänge nicht ignorieren. Einige Autoren verweisen deshalb explizit auf Erklärungslücken ihres Modells und ermöglichen somit Anschluß und Ausbau ihrer Modelle. Die Untersuchungen hingegen, die einen exklusiven Erklärungsanspruch reklamieren, zeigen gravierende Defizite: Einerseits werden die Modelle unpräzise, d.h. sie ignorieren spezifische Entwicklungspfade, wenn sie für den Zusammenbruch einen Makrodeterminismus unterstellen. Andererseits zeigen mikrotheoretische Ansätze mit exklusiven Erklärungsanspruch die Tendenz, modellfremde Variablen in ad hoc-Manier einzuführen. Solche Defizite lassen sich in einem Mehrebenenmodell des Zusammenbruchs, das je nach Dynamik des Wandels und in enger Verbindung mit dem Allgemeinheitsgrad der Beschreibungen auf Primate theoretischer Herangehensweisen verweist, vermeiden. Ergebnis 273 2. Die Mehrebenenanalyse der Konsolidierung Die Untersuchung des Zusammenbruchs der kommunistischen Regime folgt primär der Hierarchie der analytischen Ebenen. Die Beiträge zur Erklärung bzw. zum Verständnis des Zusammenbruchs wurden nach den Dimensionen einer ebenenspezifischen Untersuchung geordnet und diskutiert. Bei der politischen Konsolidierung hingegen wurde der Logik einer phasenspezifischen Untersuchung gefolgt. Bei den Versuchen, die Entwicklung der politischen Konsolidierung vorherzusagen bzw. Kriterien für Chancen und Risiken einer demokratischen Entwicklung anzugeben, wurde der Blick auf Variablen gelenkt, die in der Dynamik bestimmter Phasenabschnitte für den Konsolidierungsprozeß an Bedeutung gewinnen. Der Perspektivenwechsel vom Primat der ebenenspezifischen Untersuchung zum Primat der phasenspezifischen Untersuchung liegt in der Sache begründet: Beim Zusammenbruch sind die Phasen abgeschlossen, bei der politischen Konsolidierung nicht. Deshalb können bei der politischen Konsolidierung auch nur Variablen und Mechanismen einzelner Teilphasen untersucht werden. Dementsprechend ändert sich die Fragestellung. Bei einem abgeschlossenen Phänomen wie dem Zusammenbruch besteht das Erkenntnisinteresse darin, die Ursachen und Prozesse des Phänomens zu erklären bzw. zu verstehen. Damit wird automatisch auf die Ebenen der Analyse verwiesen. Im Gegensatz dazu besteht bei dem noch nicht abgeschlossenen Phänomen der Konsolidierung das Erkenntnisinteresse vorwiegend darin, Vorhersagen über die Konsolidierungsentwicklung zu treffen bzw. Chancen und Risiken für eine demokratische Konsolidierung einzuschätzen. Ein solches Interesse lenkt die Aufmerksamkeit auf Variablen und Mechanismen, die sich bis zum Zeitpunkt der Untersuchung beobachten lassen. Haben sich die demokratischen Regime noch nicht zufriedenstellend stabilisiert, dann kann versucht werden, aus Variablen und Mechanismen der Phasen, die einer Stabilisierung vorausgehen, Schlüsse über die zukünftige Entwicklung und Entwicklungschancen zu ziehen3. Somit wird eine phasenspezifische Untersuchung vorgenommen. Je nachdem, ob der Blick zurück gelenkt wird also versucht wird den Zusammenbruch der alten Ordnung nachzuvollziehen, oder ob ein Blick nach vorne gewagt wird, d.h. Aussagen über die zukünftige Entwicklung der neuen Ordnung angestrebt werden, wird im ersten Fall die Aufmerksamkeit primär auf die analytische Ebene gelenkt und im zweiten Fall auf die Phasen des Untersuchungsgegenstandes. Das Modell der politische Konsolidierung (vgl. Seite 299) stellt deshalb 1. den Prozeß in seiner zunächst beschleunigenden und sich anschließend wieder beruhigenden Dynamik dar (Achse II‘), wechselt dann 2. mit dem Ablauf der Phasen die analytische Ebene (Achse I‘) und va3 Nach der Einschätzung von Kopecky und Mudde haben diesen Schritt nur die wenigsten Ansätze der Transformationsforschung vollzogen: „Most studies are actually non-theoretical, describing in often vivid details the political and social developments in (post-) transition countries.“ (2000: 519). Ergebnis 274 riiert 3. im Abstraktionsgrad von allgemeinen Aussagen bezüglich kommunistischer Gesellschaften über institutionelle Spezifika einzelner Staaten bis hin zu konkreten Interaktionen und Motiven (Achse III‘). In Abbildung 4 sind entsprechend dieser Dimensionen drei Achsen dargestellt, auf denen sich die für die Konsolidierung relevanten Phasen plazieren lassen. Der Fluß der Achsen wird an der Stelle unterbrochen, wo sich die beschleunigte Dynamik des Wandels zu beruhigen beginnt, die Richtung der Analyse sich ändert und der Abstraktionsgrad wieder zunimmt. Für die Konsolidierung heißt das: Radikale, hochdynamische Änderungen müssen in einen Zustand überführt werden, in dem Änderungen nur noch graduell und unter der Prämisse der Identitätswahrung erfolgen. Die Fragestellungen der Analyse beziehen sich nicht mehr auf die Ausgangsbedingungen, unter denen Institutionen neu gebildet werden, sondern darauf, welche Bedingungen von den neuen Institutionen geschaffen werden. Und von der Untersuchung der Interaktionen und Motive im Institutionengebungsprozeß wird auf die Suche nach allgemeinen Stabilisierungskriterien demokratischer Systeme abgestellt. Die phasenspezifischen Untersuchungen zum Erbe, Umbau und zur Stabilisierung haben gezeigt, daß jede Phase Variablen und Mechanismen auf z.T. verschiedenen Analyseebenen in den Vordergrund rückt. Damit wird deutlich, daß sich auch die Konsolidierungsforschung nicht nur auf entweder Mikro- oder Meso- oder Makrovariablen stützen kann. Eine Vielzahl von Variablen und Prozessen auf allen drei analytischen Ebenen muß berücksichtigt werden: Die Konsolidierungsprozesse sind eng mit den Entwicklungen, die zum Zusammenbruch führten, verbunden. Die Ursachen sowie der Prozeß des Zusammenbruchs bestimmen als Erbe die Ausgangsbedingungen für die Konsolidierung. Das wird besonders bei der Untersuchung der Runden Tische deutlich, die in der Schnittmenge von Zusammenbruch und Konsolidierung liegen. Im Rahmen der Verhandlungen wurden nicht nur Schritte verabschiedet, die die alte Ordnung kippen ließen. Sie trugen auch aktiv zum demokratischen Umbau bei, in dem erste demokratische Wahlen von ihnen aus initiiert wurden und z.T. demokratische Verfassungen und Institutionen als Verhandlungsergebnis verabschiedet wurden. Das kommunistische Regime und die Art des Regimewechsels hinterlassen somit Spuren, die zwar mit der Zeit verwischen mögen (vgl. Przeworski 1991), an die aber beim Aufbau des demokratischen Regimes erst einmal angeknüpft werden muß. Der Schwerpunkt der Untersuchung des Erbes als Bedingung für die weitere institutionelle Gestaltung liegt auf der strukturellen, d.h. auf der Makroebene. Damit wird die Bedeutung institutionalisierter Handlungsroutinen, stabiler Netzwerke und einflußreicher alter Eliten für den Umbau nicht geleugnet. Die Variablen der Meso- und Mikroebene können z.T. von der Analyse des Regimes und der Art des Regimezusammenbruchs abgeleitet werden (Wirkungspfeile 4 und 5 in Abb. 4). Unterschiedliche Regi- Ergebnis 275 metypen haben je ihre etablierten institutionalisierten politischen Prozesse, und sie haben in ihrem Kontext sozialisierte Eliten mit einem von den Strukturen mehr oder weniger geprägten Rollenverständnis hervorgebracht. Vom Regimetyp lassen sich Schlüsse nicht nur über Eliten und deren Organisationsgrad ziehen, sondern auch über den Organisationsgrad oppositioneller Bewegungen, weil der Regimetyp unter anderem über den Grad der Repressivität (politischer Pluralismus) definiert wird. Die Art des Regimezusammenbruchs - und dazu gehören auch die Bedingungen der Stateness - entscheidet, ob und wer aus den Reihen der alten Eliten politischen (oder auch ökonomischen) Einfluß behält und welche Strategien erfolgversprechend beim demokratischen Umbau eingesetzt werden. Neben diesem eher direkten Einfluß übt die Vergangenheit zudem einen indirekten Einfluß auf den Neuaufbau demokratischer Institutionen aus: Das Erbe bestimmt die Agenda des demokratischen Umbaus, weil es die Aufgabenstellung für die Architekten der Demokratie vorgibt. Damit wird festgelegt, welche institutionellen Defizite es zu beheben gilt. Mit dem Erbe wird hauptsächlich auf Variablen verwiesen, die in einer relativ stabilen, wenig dynamischen Phase der alten, kommunistischen Regime ihren Ursprung haben. Mit der Thematisierung des Umbaus geraten zunehmend Mikrovariablen ins Blickfeld, und der Prozeß dynamisiert sich. So ergibt sich aus den Makrovariablen des Erbes ein jeweils spezifisches „Konsolidierungsfenster“ für den institutionellen Umbau. In der Umbauphase der politischen Konsolidierung zeigt sich nicht ganz so deutlich ein Primat für eine Analyseebene. Makrovariablen werden nicht umgebaut und entscheiden somit nur indirekt über Erfolge und Mißerfolge bei der Konsolidierung der Demokratie, indem sie die sozio-ökonomischen und historischen Bedingungen für den Umbau setzen. Diese Bedingungen konkretisieren sich auf der Meso- und Mikroebene. Der Umbau knüpft an die institutionellen Herausforderungen an, die sich aus dem Erbe ergeben, und ist mit den „hinterlassenen“ Akteuren zu bewältigen. Primär geht es in dieser hochdynamischen Phase um die Einführung demokratischer Institutionen. Mit Demokratie ist ein bestimmtes institutionelles Setting gemeint, das durch die Gestaltung einer neuen oder überarbeiteten Verfassung - mit der Entscheidung für ein demokratisches Regierungs- und Wahlsystem – entsteht sowie durch die Bildung neuer Parteien und anderer Institutionen intermediärer Interessenvermittlung. Das Setting entspringt den Handlungen und Motiven von Akteuren, d.h. ihrem politischen Selbstinteresse. Die Handlungen der Akteure müssen sich aber auch an den institutionellen Regeln orientieren. Deshalb bilden die wechselseitigen Prozesse von Institutionenbildung einerseits und institutioneller Regulierung bzw. Begrenzung von Entscheidungen andererseits (Wirkungspfeil 6 in Abb. 4) den Fokus für die Untersuchung des Umbaus4. Die Übereinstimmung der 4 Vgl. für eine ähnliche Argumentation auch das Jahrbuch 1995 des Wissenschaftszentrums Berlin (Rudolph 1995): Die dynamischen Wechselwirkungen zwischen Akteurshandeln und dem Umbau bzw. der Etablierung neuer Institutionen in Transformationsprozessen werden in Abhängigkeit von historischen Bedingungen thematisiert. Für die Transformationstheorie folgt aus der Komplexität des Ergebnis 276 Handlungen der Eliten aber auch der Bevölkerung mit den demokratischen Institutionen (Compliance) erfordert demokratisches Handeln und eine politisch-demokratische Identität. Darin liegt die Begründung für die Relevanz der Mikroebene für den Umbau. Mikro- und Mesoprozesse bestimmen gemeinsam den Übergang zu dem neuen demokratischen Regime. Sowohl der Aufbau von Institutionen als auch ihre Wirkung sind mikroabhängig. Das bedeutet aber nicht, daß Institutionen allein in den Handlungen der Akteure aufgehen, d.h. von ihnen willkürlich eingeführt werden können und die durch sie erfolgenden Handlungsvorgaben je nach Opportunität einmal befolgt und einmal gebrochen werden. Institutionen entwickeln eine eigene Dynamik im Kontext anderer Institutionen und gesellschaftlicher Kontextvariablen5. Selbst wenn die Akteure versuchen, die Allokationswirkung (auf Macht und andere Ressourcen) der Institutionen zu antizipieren, garantiert ihnen die strategische Manipulation z.B. beim Verfassungsgebungsprozeß keinen Erfolg ihres Kalküls – schließlich handelt es sich bei der Einführung von Demokratie um die Institutionalisierung von Unsicherheit (vgl. Przeworski 1991) bezüglich zukünftiger Machtverteilungen. Die Unsicherheit entsteht aus der nicht vorhersehbaren Präferenz der Wähler, die nicht nur von politischen Faktoren, sondern auch von ökonomischen und kulturellen Faktoren abhängt, welche von politische Eliten kaum gesteuert werden können. Darüber hinaus ergibt sich aus den Wechselwirkungen im Institutionengeflecht (wie zwischen Wahlsystem und Parteiensystem oder zwischen Regierungssystem und Parteiensystem) Unsicherheit bezüglich der langfristigen Allokationswirkung einzelner institutioneller Arrangements. Die Institutionen selbst haben eine strukturierende Wirkung auf das Handeln der Akteure. Sie bilden die neuen Constraints für das strategische Kalkül politischer Eliten, indem sie Anreize und Sanktionen für demokratiekonformes Handeln zu setzen versuchen. Weil die politischen Institutionen die Palette der diskretionären Handlungen definieren und damit die Chancen und Risiken für eine erfolgreiche demokratische Konsolidierung bestimmen sowie eine langfristige, strukturierende Wirkungen haben, gewinnen sie für den Systemumbau eine zentrale Bedeutung6. Die Stabilisierungsthematik wirft die Frage nach den angemessenen Stabilitätskriterien auf, anhand derer sich entscheiden läßt, ob Regime als demokratisch konsolidiert eingeschätzt werden können. Hierzu wurde festgestellt, daß von einer allgemeinen Theorie der politischen Konsolidierung noch abgesehen werden muß. Die Diskussion um minimalistische und maximalistische Konsolidierungskonzepte führt zu dem Ergebnis, daß sich die Konzepte ungenügend begründen und empirisch vielfach scheitern, weil es verschiedene länderspezifische Eigenarten der Entwicklung zu einer konsolidierten DemoProzesses die Einsicht, daß nur eine begrenzte Steuerbarkeit des gesellschaftlichen Wandels möglich ist und daß es eines umfassenden Rahmens zur Analyse des Transformations- und Konsolidierungsprozesses bedarf. 5 Auch die internationalen Dimensionen, wie die Einbindung in oder die Abhängigkeit von transnationalen Gebilden, stellen solche Kontextvariablen dar (vgl. Pridham 1997; 1999). 6 Insofern gilt die von Merkel formulierte These des „politcs first“ (1996: 74). Ergebnis 277 kratie gibt. Konkrete Kriterien der demokratischen Konsolidierung lassen sich nur willkürlich festlegen. So entsteht zwar ein Katalog wünschenswerter, demokratischer Struktur- und Institutioneneigenschaften, der im Umfang variiert. Je mehr formale bzw. prozedurale Ansprüche durch normative Ansprüche ergänzt werden, desto umfangreicher wird der Katalog. Ein von normativen Vorstellungen7 unabhängiger, zuverlässiger Maßstab für den Grad der Konsolidierung konnte aber nicht entwickelt werden. Mit den Hinweisen, daß von einer stabilen Demokratie Kontinuität, Flexibilität und Krisenresistenz erwartet wird, findet quasi nur eine semantische Präzisierung des Stabilitätsbegriffes statt. Konkrete institutionelle Merkmale für Makrostabilität lassen sich aus diesen Beschreibungen nicht ableiten. Auf der Mesoebene bleibt die Formulierung für Stabilitätskriterien, mit denen sich der Grad der Konsolidierung beurteilen ließe, ebenso abstrakt. Die Kriterien, die sich angeben lassen, stellen lediglich Mindeststandards für demokratische Institutionen dar, an denen sich die Architekten der Demokratie in der Umbauphase idealerweise orientieren sollten: Stabilität auf der Mesoebene verlangt nach einer klaren Begrenzung von Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten der Akteure („Agency“) und danach, daß die Handlungs- und Entscheidungskompetenzen zugeteilt (Allokation von „Agency“) und voneinander abgegrenzt werden (horizontale institutionelle Differenzierung). Auf der Mikroebene muß das politische Interesse in Compliance überführt werden können, so daß den institutionellen Vorgaben gefolgt wird. Compliance ist die notwendige Voraussetzung für die Umsetzung der institutionellen Mindeststandards (Wirkungspfeil 7 in Abb. 4), die erfüllt werden müssen, wenn die Institutionalisierung der Demokratie langfristig in stabile Strukturen überführt werden soll (Wirkungspfeil 8 in Abb. 4). Erst wenn die Dynamik institutioneller Änderungen nachläßt, bildet sich die Makrostruktur einer stabilen demokratischen Identität, aus der sich mit der Zeit konkrete Meso- und Mikromerkmale ableiten lassen (die Wirkungspfeile 7 und 8 würden dann in die entgegengesetzte Richtung weisen). Langfristig müssen sich demokratische Strukturen etabliert haben, die sich dadurch auszeichnen, daß ein hoher Institutionalisierungsgrad der Demokratie besteht, d.h. die Akzeptanz der institutionellen Regelungen selbstverständlich und unhinterfragt erfolgt. Die Konsolidierungsforschung hat sich zum Ziel gesetzt, allgemeine Aussagen zur Stabilisierung junger demokratischer Regime zu machen (Schmitter 1995a). Daraus ergeben sich zwei Herausforderungen: Erstens muß geklärt werden, welche Kriterien anzugeben sind, um den Grad der Stabilität, d.h. die Eigenschaften einer konsolidierten Demokratie, zu definieren. Und zweitens muß, um Aussagen über den „richtigen Weg“ zur 7 Auch formale bzw. prozedurale Demokratiekonzepte sind normativ. Ihnen liegen liberale Werte zugrunde. Ergebnis 278 Demokratie formulieren zu können, nach den Bedingungen gefragt werden, unter denen die neue Demokratie installiert wird. Die Kriterien für eine konsolidierte Demokratie lassen sich zur Zeit noch nicht angeben. Was aber angegeben werden kann, ist eine Liste wünschbarer Eigenschaften, die eine Präzisierung der Zielvorstellung oder Mindeststandards junger Demokratien darstellt. Bei der Einrichtung demokratischer Institutionen können dann eben diese auf die Kompatibilität mit den angestrebten Zielen hin überprüft werden. Die Einrichtung demokratischer Institutionen ist kein rein voluntaristischer Akt. Vielmehr handelt es sich dabei um einen Aushandlungsprozeß, der mehr oder weniger direkt an bestehende Strukturen und Institutionen anschließt. Damit gewinnt die Untersuchung der Genese der institutionellen Arrangements des demokratischen Regimes eine entscheidende Bedeutung. Die Forschung zur Genese der institutionellen Arrangements der neuen Demokratien hat bisher entweder Makrovariablen oder Mikrovariablen als ausschließliche, determinierende Ursachen für den Umbau definiert: Als Makrovariablen wurden entweder die historischen Voraussetzungen, Erfahrungen und Traditionen identifiziert oder die Art des Regimewechsels mit der Ausgestaltung der neuen Regime in Verbindung gesetzt (vgl. Lipset / Rokkan 1967; Glaeßner 1994; Linz / Stepan 1996). In den Modellen bilden dann zum Beispiel Verfassungsstrukturen und der Verfassungsalltag der kommunistischen Regime solche historischen Voraussetzungen. Damit werden durchaus relevante Variablen benannt. In den osteuropäischen Staaten wurde nach dem Zusammenbruch tatsächlich an Verfassungstraditionen angeknüpft. Verfassungen der kommunistischen Regime wurden überarbeitet bzw. demokratisiert, und es gab Fälle, in denen demokratische Verfassungen aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg als Vorlage genutzt wurden. Die kommunistischen Verfassungen beinhalteten oftmals demokratische Elemente, die es nur zu stärken und konsequent umzusetzen galt. Das war möglich, weil die Verfassungen teilweise Errungenschaften des bürgerlichen Rechtsstaats formal beinhalteten, ihre Staatszielformulierungen auch in demokratischen Regimen noch konsensfähig waren, d.h. die Verfassungen weniger diskreditiert waren als nach einem Systemwechsel von autoritären oder faschistischen Regimen (v. Beyme 1994: 231f). Dennoch reicht der alleinige Verweis auf solche Makrovariablen nicht aus, um Aussagen über die Konsolidierungsschancen für die neue Demokratie zu treffen. Zentrale Bereiche der Verfassungen, wie das Verhältnis zwischen den Staatsgewalten und das Wahlsystem, wurden neu gestaltet. Diese Innovationen lassen sich nicht direkt von Makrovariablen ableiten. Auch die Art des Regimewechsels kann die konkrete institutionelle Ausgestaltung nicht erklären. Das zeigt der Blick auf die verhandelten Systemwechsel, aus denen unterschiedliche Regierungs- und Wahlsysteme hervorgegangen sind. Ergebnis 279 Wurden in der Konsolidierungsforschung Mikrovariablen thematisiert, so sind die Akteurkonstellationen und die Handlungen und Motive der am Umbau beteiligten Akteure Untersuchungsgegenstand (vgl. Przeworski 1991; Offe 1994; Nohlen 1996; Geddes 1996; Elster / Offe / Preuss 1998). Das politische Interesse und die zukünftigen Machtchancen informieren in den entsprechenden Modellen über bestimmte institutionelle Präferenzen (das gilt auch für den Import ausländischer „bewährter“ Institutionen <Merkel 1996: 85>), die sich nach spieltheoretischen Gesetzmäßigkeiten durchsetzen oder zumindest die Kompromißlösungen beeinflussen können. Der mikrotheoretische Ansatz bewährt sich besonders bei der Erklärung der institutionellen Ausgestaltung der Machtverhältnisse im Regierungssystem und bei der Erklärung der Wahl des Repräsentationsprinzips des Wahlsystems. Aber auch die Untersuchung der Mikroprozesse genügt nicht für die Einschätzung der Konsolidierungschancen der neuen Demokratien. Die Mikroprozesse erklären die Genese der demokratischen Institutionen nur teilweise. Was fehlt, ist die Klärung der Frage, warum bestimmte Präferenzen eine Chance im Gestaltungsprozeß der Institutionen hatten. Über die Chance der Beteiligung bei der Gestaltung der Demokratie entschieden Makrovariablen wie die Art des Zusammenbruchs und die Struktur des vorausgegangenen, kommunistischen Regimes, die in unterschiedlicher Weise externe oder innerparteiliche Opposition zuließ. Mit diesen Variablen werden die Bedingungen für die Berücksichtigung bestimmter Präferenzen und für die Spielsituationen, in denen diese aufeinandertreffen, gesetzt. Derartige makro- und mikrotheoretische Analysen der Konsolidierung verweisen jeweils nur auf Teilaspekte eines umfassenden Prozesses der Entstehung der osteuropäischen Demokratien. Die Konsolidierungsstheorie muß anerkennen, daß sich Prozesse des Regimewandels erst verstehen lassen, wenn mit einem Mehrebenenansatz auf strukturelle Vorgaben verwiesen wird und parallel mit dem Verweis auf die Akteure auch machtpolitische Interessen berücksichtigt werden: Will man die Chancen für die abschließende Phase der Konsolidierung - der Makrostabilität – abschätzen, muß man auf die Mesoebene verweisen, d.h. die Wirkung der Institutionen untersuchen. Will man verstehen, wie welche Institutionen in der Phase des Umbaus entstanden sind, dann muß man die Akteure und Konstrukteure der institutionellen Designs und ihre Motive thematisieren. Will man verstehen, warum einige Akteure ihre Interessen durchsetzen konnten andere hingegen nicht, dann hilft der Blick auf die dem Umbau vorangegangenen Phasen. Hier haben sich das historisch-strukturelle Erbe und die strukturellen Rahmenbedingungen (wie zum Beispiel das internationale Umfeld) gebildet, die eine bestimmte Art des Systemwechsels ermöglichten. Das Handeln der Akteure kann also nicht losgelöst vom sozial-strukturellen und historischen Kontext verstanden werden. Erst vor diesem Hintergrund läßt sich sagen: „...outcomes vary with perceived strength...“ (Geddes 1996: 19). Die wahrgenommene Stärke erklärt sich aus den Machtstrukturen der alten Regime und aus den Prozessen ihrer Auflösung. Ergebnis 280 Das Mehrebenenmodell der Konsolidierungsforschung setzt also je nach Fragestellung und in enger Verbindung mit der zu untersuchenden Phase der Konsolidierung Teilperspektiven, d.h. Primate bestimmter Herangehensweisen, fest. Je nach Phase, auf die sich eine Fragestellung bezieht, kann auf eine bestimmte analytische Ansatzhöhe verwiesen werden. Prozesse des Umbaus lassen sich verstehen, indem auf die Ausgangsbedingungen verwiesen wird. Diese Bedingungen können mit einer Analyse der Makrovariablen angegeben werden. Die Struktur der vorausgegangenen Regime ist verwoben mit institutionellen Eigenschaften und Mängeln auf der Mesoebene und hat bestimmte Handlungs- und Präferenzorientierungen der Akteure hervorgebracht. Dieser Rahmen des „Konsolidierungsfensters“ grenzt die Möglichkeiten des Umbaus ein. Der Umbau läßt sich aus einer analytischen Perspektive, die die Prozesse der Mesoebene thematisiert, nachzeichnen. Institutionentheoretische Ansätze können versuchen, über Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Institutionen aufzuklären, und somit über die Chancen und Risiken der Entwicklung zur stabilen Demokratie informieren. Um allerdings das Zustandekommen des Institutionen-Mix und die Möglichkeiten für institutionelle Änderungen sowie Stabilisierung der demokratischen Institutionen zu verstehen, muß man sich auf die Mikroebene beziehen. Über die Motive der Architekten des neuen institutionellen Designs und die Motivation der Eliten - sich an die institutionellen Regeln zu halten - können akteurstheoretische Ansätze aufklären. Akteurshandeln und Strukturen müssen parallel als Bedingungen für das institutional engineering und damit auch für die Stabilisierungschancen der jungen Demokratie betrachtet werden. Die Stabilisierung der jungen Demokratien Osteuropas wird sich letztendlich daran ablesen lassen, ob soziale und wirtschaftliche Krisen überstanden werden können. Eine derartige Leistungsfähigkeit hängt davon ab, wie gut politische Institutionen und das Handeln der politischen und sozialen Akteure mit den sozio-ökonomischen Bedingungen abgestimmt sind (Merkel 1996: 73) – wie die Makro-, Meso- und Mikrovariablen aufeinander wirken. Ergebnis 281 3. Schlußfolgerungen für die Theoriebildung Um die vorliegende Arbeit in die aktuelle Theoriediskussion einzuordnen, muß ein Blick auf Strategien der Theorieentwicklung und auf Theorietrends in der Politikwissenschaft und in der Soziologie gewagt werden. Ansätze, die unterschiedliche theoretische Paradigmen zusammenführen, entsprechen nicht gerade dem mainstream in der sozialwissenschaftlichen Theorielandschaft. Obwohl die Identifikation eines solchen mainstream bzw. gegenwärtiger Theorietrends in der vielgestaltigen, sich kontinuierlich weiterentwickelnden Theoriewelt ein schwieriges Unterfangen ist, fallen zumindest Konjunkturen dominanter Theorien auf. Bestimmte Ansätze erfreuen sich verstärkter Rezeption und Anwendung, weil sie als adäquate Herangehensweisen für die aktuell interessierenden Fragestellungen identifiziert werden und weil sie das leisten, was von einer sozialwissenschaftlichen Theorie erwartet wird. Die Erwartungen an eine Theorie sind eng damit verbunden, welcher Gegenstandsbereich für eine Wissenschaft identifiziert wird und welcher Anspruch mit der Formulierung und Nutzung eines theoretischen Ansatzes oder Modells verbunden ist. Die Ansprüche an Theorie fallen recht unterschiedlich aus: Einige Autoren erwarten, daß Theorien in einem bestimmten Anwendungsbereich helfen, Phänomene mittels rekonstruierender Modellierung zu verstehen. Andere Autoren nutzen Theorie, um den Gegenstand in einem von der Praxis unabhängigen Code zu entfremden und somit Erkenntnisgewinn zu liefern8. Wieder Andere verlangen von einem theoretischen Ansatz Deduktion nach positivistischer Tradition. Die erwartete „Dienstleistung“ der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung besteht respektive in der möglichst realitätsnahen Wiedergabe von Phänomenen, in einer kritische Reflexion oder darin, Prognosen über zu erwartende Entwicklungen abzugeben. In der Theoriediskussion innerhalb der Politikwissenschaft gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen bezüglich der angemessenen Ansprüche an Theorie. Entsprechend ist die aktuelle Theorieentwicklung auch von divergierenden Trends geprägt. Unterschiedliche Ansätze reklamieren für sich die adäquate Bearbeitung bestimmter Gegenstandsbereiche (oder sogar aller Gegenstandsbereiche) und die Einlösung des von ihnen hervorgehobenen Anspruchs an die theoretische Aussagekraft: Es gibt systemtheoretische (vgl. z.B. Deutsch 1969; Easton 1979; Willke 1983, 1992), institutionentheoretische 8 Willke reklamiert für (System-)Theorie eine eigene Dignität, die entsprechend dem autopoietischen Paradigma der Systemtheorie darin gründet, daß theoretische und empirische Kommunikation selbstreferentiell operieren (1995). Insofern richtet sich Theorie primär auf sich selbst und nicht auf empirische Bezüge. Ihre praktische Bedeutung gewinnen Theorien nach Willke durch ihre Wirkung, die darin besteht, daß sie - wie auch Kunst - nicht Wahrheiten sondern Weltsichten produziert. Für den Beobachter kann sich daraus „... das Aha-Erlebnis einer diskrepanten Erscheinung, die Rückfragen an die eigene normalisierte Perspektive provoziert“ (Willke 1995: 145), ergeben. Ergebnis 282 (vgl. z.B. Lepsius 1995a; Mayntz 1995; Nedelmann 1995; Weinert 1995)9 und Rational Choice-Ansätze (vgl. z.B. Scharpf 1985; Pappi 1995; Downs 1968; Olson 1985; Ordeshook 1995). Normativ orientierte Theorieansätze der Politischen Philosophie, die die Frage nach dem Sinn politischer Institutionen stellen, werden von Formaler Politischer Theorie, die als empirisch-analytische Ansatz das theoretische Erkenntnisinteresse in den Vordergrund stellt unterschieden (vgl. Walsh / Bahnisch 2000), und diese wiederum vom „Area Studies“, bei denen historisch-politische und kulturelle Dimensionen das Politische prägen (vgl. Johnson 1997)10. Eine Durchsicht führender politikwissenschaftlicher Zeitschriften zeigt allerdings, daß sich Rational Choice-Theorien besonders erfolgreich behaupten können11: In der American Political Science Review12, dem American Journal of Political Science, dem Journal of Conflict Resolution, der International Review of Political Science und der Politischen Vierteljahresschrift besteht ein bedeutender Anteil der Beiträge aus Analysen, die mit diesem Ansatz arbeiten13. Die Rational Choice-Theorie steht für die theoretischen Modelle, die in der Politikwissenschaft unter dem Label ökonomische Theorien der Politik oder Neue Politische Ökonomie (vgl. Olson 1965; 1985) zusammengefaßt werden. Dazu werden auch Ansätze gezählt, die als Public oder Social Choice Theory (vgl. Buchanan / Tullock 1962; Downs 1968; Hirschman 1972; Riker 1992) bezeichnet werden und auch Ansätze, die spieltheoretische Modelle als analytisches Instrumentarium anwenden (vgl. Riker 1967; Scharpf 1988a; 1997)14. Den zahlreichen, nicht nur politikwissenschaftlichen, sondern auch soziologischen Rational Choice-Ansätzen ist gemeinsam, daß sie von dem Prinzip des methodologischen 9 Institutionentheoretische Ansätze in der Politikwissenschaft lassen sich allerdings oftmals einem Rational Choice-Ansatz unterordnen. Bespielweise dann, wenn wie im Filtermodell von Czada und Windhoff-Héritier (1991) Institutionen lediglich als Restriktionen bzw. „Handlungskorridore“ rational wählender Akteure eingeführt werden. 10 Nicht genannt sind in dieser Typologie die dialektisch-kritischen Ansätze, weil sich deren Anhänger überwiegend als Soziologen verstanden (v. Beyme 1992: 43). 11 Diese Einschätzung ist weit verbreitet, so daß man bezüglich des dominanten Trends in der politikwissenschaftlichen Theoriebildung und -anwendung von einem Konsens der Wissenschaftsgemeinschaft ausgehen kann (vgl. beispielsweise Wiesenthal 1987; Green / Shapiro 1994; Riker 1992). 12 Für eine Übersicht über den wachsenden prozentualen Anteil der Rational Choice-Artikel in der American Political Science Review vgl. Green und Shapiro (1994: 3). 13 Dieser Hinweis mag als formales Kriterium für eine Trendaussage nicht genügen. Bei Lalman, Oppenheimer und Swistak (1993: 77f) finden sich zwei weitere Hinweise: Erstens gibt es eine Anzahl von bedeutenden Zeitschriften, die speziell der Weiterentwicklung und Anwendung der Rational ChoiceTheorien gewidmet sind: Public Choice, Choice and Welfare, Rationality and Society, The Journal of Theoretical Politics. Und zweites finden Rational Choice-Theorien nicht nur eine weite Verbreitung in der Politikwissenschaft. Ihre theoretischen Modelle und Erkenntnisse erfreuen sich auch einer hohen Anerkennung in der Wissenschafts-Community, was sich besonders deutlich an den Nobelpreisen ablesen läßt, die Paul Samuelson, Kenneth Arrow, Ronald Coase, Gary Becker und Herbert Simon für ihre Beiträge verliehen bekommen haben. 14 Einen kritischen Überblick über die verschiedenen aktuellen Rational Choice-Ansätze in der Politikwissenschaft und ihrer Untersuchungsgegenstände liefern Green und Shapiro (1994), Friedman (1995) und Wiesenthal (1987). Ergebnis 283 Individualismus ausgehen, also soziale Phänomene auf individuelles Handeln und intentionale Entscheidungen zurückführen und als Handlungsmaxime der Akteure Rationalität (in den verschiedensten Ausprägungen) unterstellen. Die Parameter der Theorie bilden einerseits die Randbedingungen (Constraints) und andererseits die Präferenzen und Ziele der Akteure. Rational Choice-Ansätze zeichnen sich durch einen klares Statement bezüglich des theoretischen Anspruchs ihrer Modelle aus. Sie definieren sich als „erklärend-quantifizierende Akteursansätze“ (Pappi 1995: 236), die soziale Phänomene nicht nur erklären wollen - wie etwa auch historisch-typologische Ansätze -, sondern den Anspruch erheben, aus ihren Modellen deduktiv Prognosen über zu erwartende Entwicklungen abzuleiten (vgl. Riker 1992; v. Beyme 1995; Esser 1993: 29f). Will eine Sozialwissenschaft diesen Anspruch einlösen, muß einerseits der theoretische Kern der Erklärungsmodelle eindeutig und einfach formuliert werden und andererseits der Gegenstandsbereich klar abgegrenzt sein. Die Formulierung des theoretischen Kerns der Rational Choice-Theorie, die Handlungstheorie, hat zwar bedeutende Fortschritte gemacht, ist aber kontrovers. Konnten Modifikationen der theoretischen Prämissen auch eine Realitätsannäherung des Akteurmodells bewirken15, so hat sich dennoch eine Kontroverse bezüglich der Frage entzündet, ob die Präferenzen der Akteure, die für ihre Entscheidungen und Handlungen die ausschlaggebenden Parameter bilden, theoretisch abgeleitet werden können oder empirisch erhoben werden müssen16. Die Vertreter der ersteren Position plädieren dafür, die situationsspezifischen Präferenzen der Akteure theoriereich über Brückenannahmen von axiomatisch gesetzten Hauptzielen - „physical wellbeing“ und „social approval“ - abzuleiten (Lindenberg 1996, 1991; Esser 1993). Als situationsspezifische Präferenzen können dann jeweils die Motive unterstellt werden, die diese Hauptziele über eine hierarchische Ordnung von Nebenzielen produzieren, also in der jeweiligen Situation einen mit Blick auf die beiden letzten Werte instrumentellen Nutzen haben. Die Brückenannahmen sollen nach dieser Einschätzung die Kluft zwischen einer relativ leeren Nutzentheorie und der Realität schließen und somit die Voraussetzung für die Erfüllung des deduktiven Anspruchs bilden. Diese orthodoxe Variante der Rational Choice-Theorie wird in der Poltikwissenschaft und in der Soziologie kontrovers diskutiert. Die theoretisch abgeleitete Zielehierarchie der Präferenzen wird abgelehnt (vgl. Opp / Friedrichs 1996; Kelle / Lüdemann 1995; Pappi 1995), weil mit dem Modell klassische politikwissenschaftliche Problemstellungen wie das Wählerparadox, das Dilemma des kollektiven Handelns, das Abstimmungsparadox (vgl. Green / Shapiro 1994) oder auch konkretere Probleme wie die Koalitionsbildung (vgl. Pappi 1995: 238) nicht befriedigend erklärt werden können. Die 15 Vgl. weiter unten zur Strategie „Modification“. Im amerikanischen Kontext wird eine ähnliche Kontroverse entlang Gegenüberstellung von „Preconception vs. Observation“ (vgl. Johnson 1997) oder einer „culturist view“ versus der Rational Choice-Perspektive (Shapiro 1998) geführt. 16 Ergebnis 284 Realität „produziert“ in bezug auf die theoretisch abgeleiteten Vorhersagen Anomalien. Alternativ wird deshalb für eine empirische Ermittlung der Präferenzen plädiert. Hier besteht aber die Gefahr, daß der Prognoseanspruch signifikant eingeschränkt wird, weil die situationsspezifisch definierten Ziele und Präferenzen jeweils neu zu erheben sind. In der Politikwissenschaft wird einer solchen Befürchtung mit dem Verweis auf den Gegenstandsbereich begegnet. Dieser wird nämlich auf einen Bereich eingeschränkt, in dem, anders als beim Gegenstandsbereich der Soziologie, die Präferenzen und Ziele öffentlich diskutiert werden (Pappi 1995: 249), d.h. die Parameter für die theoretische Modellierung gut zugänglich sind. Nur auf der Basis dieser klar umrissenen Einsatzfähigkeit kann die Rational Choice-Theorie ihren „Universalitätsanspruch“ aufrecht erhalten (v. Beyme 1995: 24) und in der Politikwissenschaft ihren Anspruch an Eigenständigkeit (gegenüber der Soziologie bzw. soziologischer Theorien) behaupten (vgl. Willke 1995: 134). Eingesetzt wird die Rational Choice-Theorie dann bei der Untersuchung von Wählerverhalten, Parteienkonkurrenz, Interessengruppen, Stabilität von Koalitionen, Verhandlungssituationen und Konstellationen der internationalen Politik (vgl. Lalman, Oppenheimer und Swistak 1993; Green / Shapiro 1994). „Being attractive does not necessarily imply that a theory is acceptable, valid, or true in all circumstances.“ (Boudon, 1998: 817). Im Gegenteil: Eine Ausweitung des Gegenstandes induziert die Öffnung der Ansätze für andere Paradigmen. Das läßt sich am Beispiel der Steuerungsproblematik zeigen: Mayntz (1995) sieht politische Handlungen in einer derart vielgestalten und komplexen Wirklichkeit eingewoben, daß von ihr keine Steuerung im Sinne einer direktiven, lenkenden Einwirkung erwartet werden kann. Zwar sind Akteure nicht überflüssig und haben in Netzwerken und Verhandlungssystemen durchaus Einwirkungsmöglichkeiten. Ihr Einfluß beschränkt sich aber auf ein „Interdependenzmanagement“ mit dem zwischen politischen und anderen gesellschaftlichen Teilprozessen vermittelt wird. Gesellschaftliche Selbststeuerung, spontane Strukturbildung und politische Steuerung wirken zusammen. Gesellschaftliche Selbstregelungsmechanismen bilden aber nicht den Gegenstand von Akteursmodellen, sondern verweisen auf meso- oder sogar makrotheoretische Modelle. Willke (1995: 144) sieht hier sogar eine Annäherung an die autopoietischer Systemtheorie: Selbstregelungsprozesse führen in der Forschung, die sich mit Steuerungsproblematik beschäftigt, zum Austausch zwischen Akteurstheorien und Systemtheorien. Der unterschiedliche Umgang mit theoretischen Defiziten und bei der Bestimmung des Gegenstandes zeigt, daß unterschiedliche Schritte in der Theorieentwicklung möglich sind: Wird ein theoretischer Ansatz dadurch herausgefordert, daß zentrale Fragestellungen unbeantwortet bleiben, läßt sich zwischen drei Strategien wählen: 1.„Replacement“, 2.„Modification“ und 3.„Supplementation“ (vgl. Shapiro 1998): Im ersten Fall wird die Theorie von einer anderen Theorie ersetzt. Das birgt die Gefahr, daß eine reduktionistische Sichtweise von einer anderen reduktionistischen Sichtweise abgelöst wird. Ersetzt Ergebnis 285 man einfach ein Paradigma durch ein anderes, ebensowenig universell gültiges Paradigma, dann können neue „blinde Flecken“ entstehen. Mit der zweiten Strategie werden die Anomalien der Theorie durch Weiterentwicklungen der Modelle zu überwinden gesucht. Folgende Beiträge waren hier bei der Entwicklung der Rational Choice-Theorie einflußreich: Rikers und Ordeshooks (1968) Beitrag zum „civic virtue“, der zur besseren Erklärung von Wählerverhalten beitrug. Schellings „theory of focal points“ (1963), die ihre Bedeutung bei der Modellierung von Verhandlungsprozessen behaupten konnte. Kahnemans und Tveskys (1979) bzw. Tvesky und Kahnemans (1986) Beiträge zur Erklärung von Entscheidungen unter Risiko17, die zu einer „prospect theory“ geführt haben. Und Simons Beitrag zur Formulierung einer Theorie der „bounded rationality“ (1954, 1990) und damit zur Entwicklung der Werterwartungstheorie oder auch der Theorie des subjektiv erwarteten Nutzens (SEU-Theorie - vgl. Esser 1996). Solche Modifikationen werden von den theoriereichen, orthodoxeren Ansätzen zu Weiterentwicklung ihrer Modelle genutzt. Mit ihnen können die Anomalien zum Teil überwunden werden, weil durch sie auch nicht-rationale (normative) oder sogar irrationale (bspw. „risk-aversion“) Ziele und Präferenzen in die Theorie integriert werden. Dafür muß der Rationalitätsbegriff aber auch entsprechend „aufgeweicht“ werden. Ein derartiger Kompromiß wird natürlich auch eingegangen, wenn die Ziele und Präferenzen von Akteuren empirisch erfaßt werden. Bei einem solchen Vorgehen wird erst gar nicht danach gefragt, inwiefern die erhobenen Ziele rational sind - die Vorstellung des rationalen Akteurs wird dann als „notwendige Lebenslüge dieser Wissenschaft“ (v. Beyme 1995: 20) akzeptiert und nicht etwa mit dem Motiv der realitätsnahen Wiedergabe von Phänomenen eingeführt. Die Aufweichung der theoretischen Konzepte geht zu Lasten der Erklärungskraft. Green und Shapiro (1994) schlagen deshalb alternativ vor, ein klares Rationalitätskonzept beizubehalten, die Bedingungen, unter denen es sinnvoll Anwendung findet, ausfindig zu machen, und die Theorie in „amalgams of strategic and cultural explanations“ (Shapiro 1998: 41) einzufügen. Während „Modification“ noch eine Strategie zur Behauptung des Autonomieanspruches der Theorie sein kann, entspricht das von Green und Shapiro vorgeschlagene Vorgehen der dritten Strategie - „Supplementation“ - einem integrativen Konzept der Zusammenführung verschiedener theoretischer Ansätze. Mit dem Verweis auf die Bedeutung kultureller Variablen, historischer Randbedingungen, soziologischer Variablen und auf Faming-Effekte sowie andere psychologische Variablen machen sich die beiden Autoren für eine Ergänzung der Rational Choice-Theorien durch andere theoretische Ansätze stark. In der Community der Politikwissenschaftler stößt ein solches Integrationsbemühen auf heftigen Widerstand (vgl. Lohmann 1995; Murphy 1995). Darin bestätigt sich ein Trend 17 Die Autoren zeigen, daß die Aussicht auf Verluste handlungsmotivierender wirkt, als die Aussicht auf Gewinne („risk aversion“). Ergebnis 286 zum methodologischen Dogmatismus nach dem Muster „eine Disziplin, eine Methode, eine bevorzugte Analyseeinheit“ (v. Beyme 1995: 20), dem das Streben, die Rational Choice-Theorie als den vorherrschenden und angemessenen wissenschaftlichen Ansatz in der Poltikwissenschaft als mainstream zu behaupten, zuarbeitet18. Es zeigt sich zwar, daß es auch an anderer Stelle in den Politikwissenschaften Integrationsbemühungen gibt, wie im Bereich der Internationalen Politik (vgl. Müller 1994; Zartmann 1997; Wendt 1998)19, der Transformationsforschung (vgl. v. Beyme 1994, 1994a, 1997; Merkel 1994, 1995; Eisen / Wollmann 1996; Elster / Offe / Preuss 1998; Kopecky / Mudde 2000) und der neueren Forschung zur politischen Steuerung (vgl. Mayntz 1991; Mayntz / Scharpf 1995, 1995a20). Dieser Trend scheint aber entweder vergleichsweise schwach auszufallen oder auf eine eher akademische Diskussion beschränkt zu bleiben und weniger forschungsrelevante Verbreitung zu finden. Anders als in der Politikwissenschaft verhält es sich in der Soziologie mit den Theorietrends. Das liegt nicht zuletzt daran, daß sie sich als die allgmeinste aller Sozialwissenschaften versteht, d.h. ihr Gegenstand alles umfaßt, was Sozialität ausmacht (vgl. Schimank 1999, 2000). Die Soziologie kann (will sie sich nicht nur über ihre zahlreichen Teildisziplinen und die entsprechenden speziellen Soziologien, sondern auch als umfassende Gesellschaftswissenschaft definieren) ihren Gegenstand nicht ohne weiteres begrenzen. Daher fällt es auch schwerer, für sie einen einfachen, sparsamen theoretischen Kern zu formulieren – zum Beispiel kann Handeln noch viel weniger als beim 18 Auch mit der Einschränkung des Anwendungsbereiches der Politikwissenschaft wird keineswegs die Integration verschiedener theoretischer Konzepte gefördert. Vielmehr dient diese Strategie oftmals dazu den exklusiven Erklärungsanspruch von Rational Choice-Theorien in der Politikwissenschaft zu unterstreichen (vgl. exemplarisch: Lalman / Oppenheimer / Swistak 1993). 19 Für diesen Hinweis danke ich Helmut Nolte. Einen Überblick über den „State of the Discipline“ in der politikwissenschaftlichen Krisen-, Konflikt-, und Kriegsforschung gibt Brecher (1996). 20 Mayntz und Scharpf versuchen mit ihrem Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus eine Integration der institutionalistischen und handlungstheoretischen Perspektive, mit der die Dichotomie von Akteur und Struktur überwunden werden soll (1995a: 45; Scharpf 1997). Diese Integration erfolgt über das Handlungsmodell, das sich a) durch eine Verbindung unterschiedlicher Handlungsorientierung (bspw. normativer und rational-strategischer), b) durch eine Theorie kollektiver und korporatistischer Akteure und c) durch die Prämisse, daß die jeweilige Handlungsorientierung aus der Handlungssituation mit ihrem spezifischen „Betroffenheitsprofil“ folgt, auszeichnet (1995a: 52f). Die Struktur gesellschaftlicher Teilsysteme wird von den Akteurskonstellationen, die von den verschiedenen, institutionalisierten Modi der Handlungskoordination (Verhandlung, Abstimmung oder Hierarchie) bestimmt sind, geprägt. Aus dieser Betrachtung fallen allerdings die Bereiche heraus, in denen eine eigendynamische Entwicklung durch fehlende Koordination (Mayntz / Scharpf 1995; Mayntz 1991) stattfindet. Mayntz und Scharpf argumentieren, daß diese Entwicklungslogik für die Steuerung und Selbstorganisation in staatsnahen Sektoren, mit denen sich die Politikwissenschaft befaßt, nicht gilt (1995). Sie wenden sich gegen den „Steuerungspessimismus“, wie er aus der Betrachtungsweise der autopoietischen Systemtheorie, die gerade die eigendynamische Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme thematisiert, folge: „Auch funktional differenzierte und transnational verflochtene moderne Gesellschaften sind in der Lage, ihr eigenes Geschick im guten wie im schlechten absichtsvoll zu beeinflussen“ (1995: 33). An dieser Stelle findet in ihrem Modell die Integration unterschiedlicher theoretischer Ansätze eine Grenze. Evolutionäre oder dem autopoietischen Operationsmodus folgende Entwicklungsprozesse bleiben - nicht zuletzt mit dem Bestreben nach Parsimony (theoretischer Sparsamkeit) und mit einem normativen Bekenntnis zum Steuerungsoptimismus (vgl. Scharpf 1989) - unberücksichtigt. Ergebnis 287 politikwissenschaftlichen Interessenfeld auf eine singuläre „soziale Logik“ (vgl. Aretz 1997) reduziert werden. In der Soziologie blickt man außerdem auf eine lange Tradition unterschiedlicher Herangehensweisen zurück, die sich bis heute in der Theorie- und Methodenentwicklung fortgesetzt hat. Als globale Einschätzung wird ihr daher heute attestiert, eine „multiparadigmatische Wissenschaft“ (vgl. Ritzer 1975; Schimank 1999) zu sein. Die Paradigmenvielfalt läßt sich an den zahlreichen Dichotomien ablesen, die sich in der soziologischen bzw. sozialwissenschaftlichen Forschung herausgebildet haben (vgl. Nolte 1999; Wallerstein 1997): makrotheoretische bzw. system- und strukturtheoretische Ansätze stehen mikrotheoretischen bzw. handlungszentrierten Ansätzen gegenüber, Determinismus wird gegen Voluntarismus ins Feld geführt, erklärende grenzt sich von verstehender Soziologie ab, und rationalistische werden von normativistischen Theorien unterschieden, um hier nur die augenfälligsten zu nennen21. Da Theorien kontinuierlich weiterentwickelt werden bzw. neue theoretische Konzepte auftauchen, lassen sich die Dichotomien nur schwer in eine Theoriesystematik einfügen. Ritzer hat in den 70er Jahren (1975) versucht, gegenwärtige Sozialtheorien zu systematisieren. Seine „Trias der Paradigmen“ gilt heute schon nicht mehr (Reckwitz 1997: 31): Durkheims Konzept der „social facts“ wurde weitgehend vom Strukturfunktionalismus abgelöst, der Einfluß der verhaltenstheoretischen, behavioristischen Psychologie wurde vom handlungstheoretischen Paradigma der Rational Choice-Theorien abgelöst, und das kulturwissenschaftliche Paradigma der „social definition“ erfuhr eine „interpretative Wende“ in den kulturtheoretischen und den konstruktivistischen Denkansätzen. Wegen der Weite des Gegenstandes der Soziologie und der langen Geschichte ihrer Paradigmenvielfalt - von der auch die Vielfalt soziologischer Fragestellungen22 und Perspektiven herrührt - ist eine Trendangabe bzw. die Identifikation eines mainstream in der Theorieentwicklung und -anwendung hier schwieriger als in der Politikwissenschaft. Selbst wenn der Einfluß des reduktionistisch-erklärenden Rational Choice-Ansatzes auch in der Soziologie zunimmt, sind kritische bzw. dialektische Standpunkte, die verstehende Soziologie und der Strukturfunktionalismus sowie die Systemtheorie keinesfalls weniger präsent oder weniger bedeutend (vgl. Hitzler 1997). Als Trend muß daher nicht die Dominanz eines Paradigmas angenommen werden, sondern eine gegensätzliche Bewegung, die einerseits im Auseinanderdriften der Sozialwissenschaften durch die Zersplitterung in Teildisziplinen und andererseits aber auch in einer Annäherung unterschiedlicher, vermeintlich gegensätzlicher Paradigmen zu Ausdruck kommt (vgl. DGS Sektion Soziologische Theorien 1998: 87f). 21 Im US-amerikanischen Kontext werden die verschiedenen Theorieansätze der Soziologie auch mit der Dichotomie „nonpositivist“ und „positivist“ klassifiziert (vgl. Denzin 1997). 22 Luhmann charakterisiert die Spannbreite der soziologischen Fragestellungen mit den zwei Fragen „Was ist der Fall?“ und „Was steckt dahinter?“ (1993) und charakterisiert damit die seiner Ansicht nach zentrale Dichotomie soziologischer Herangehensweisen - der auf der einen Seite positivistischen und auf der anderen Seite kritischen Ansätze. Ergebnis 288 Die Zersplitterung in Teildisziplinen folgt aus der Spezialisierung von Interessengebieten, wie sie in den verschiedenen „Bindestrichsoziologien“ (so in politische Soziologie, Rechtssoziologie, Religionssoziologie, Sportsoziologie, Sprachsoziologie und viele mehr) zum Ausdruck kommt. Wissensgebiete behaupten sich aber nicht nur über ihren Gegenstand, sondern sie etablieren für sich auch bestimmte methodische und theoretische Herangehensweisen. Spezielle Soziologien zeichnen sich oftmals durch ihre Anwendungsorientierung aus und gelten deshalb sogar als die hervorgehobenen Vermittler zwischen Theorie und Empirie (Hitzler 1997: 7). Mit der Abgrenzung eigenständiger Gegenstandsbereiche können aber wichtige Wechselwirkungen aus dem Blickfeld geraten, schließlich werden gesellschaftliche (Problem-)Bereiche bei der Ausdifferenzierung in Teilbereiche analytisch getrennt. Die Wechselwirkungen werden dann relevant, wenn komplexe gesellschaftliche Phänomene wie die Transformation Osteuropas untersucht werden. Für die Theorie rücken derartig umfassende Fragestellungen das Zusammenwirken kultureller, ökonomischer und politischer Dimensionen in den Vordergrund, womit das Verhältnis unterschiedlicher, oft teildisziplin-spezifischer Paradigmen entscheidende Bedeutung gewinnt. Die Annäherung unterschiedlicher Paradigmen findet in der Soziologie dort statt, wo theoretische Weiterentwicklungen („Modification“) durch Verknüpfungen von Ansätzen erfolgen. Hier kann man beispielsweise die Verbindung von kognitiven mit Rational Choice-Ansätzen (vgl. exemplarisch Boudon <1998>) nennen oder die Auflösung des Mikro-Makro- Dualismus (als Beispiele lassen sich hier Colemans <1990> bzw. Essers <1993> Makro-Mikro-Makro-Modell oder Giddens <1988> Strukturierungstheorie oder auch Habermas <1992> Verbindung des Lebensweltkonzepts mit dem Systemkonzept anführen)23. Annäherungen finden aber nicht nur über Modifikationen der Theorien statt, sondern lassen sich auch an inhaltlichen Vergleichsgesichtspunkten aufzeigen: Stichweh (1995) etwa weist Überschneidungen und parallele Problemlagen für die Systemtheorie und Rational Choice-Theorie nach. Reckwitz (1997) zeigt, daß trotz gravierender Unterschiede die Kulturtheorie Bourdieus bzw. Giddens und die konstruktivistische Systemtheorie Luhmanns Gemeinsamkeiten aufzeigen. Und Münch (1994) weist nach, daß sich Ökonomie und Moral durchdringen; mit dieser Annäherung entschärft sich die Dichotomie von rationalistischer und normativer Theorieorientierungen. Aus solchen Annäherungen kann aber keinesfalls eine Integrationstendenz bezüglich verschiedener theoretischer Perspektiven abgeleitet werden: „Wechselseitige Kritik und der Aufweis paralleler Problemlagen beschleunigen [zwar] die jeweilige Theoriedynamik, aber die Diversität der Theorien wird dadurch um nichts verringert.“ (Stichweh 1995: 404). Explizite Annäherungen stoßen nicht nur in der Politikwissenschaft, sondern auch in der Soziologie auf heftigen Widerstand, weil oftmals der Autonomiean23 Die hier genannten Beispiele stehen für Annäherung handlungsorientierter an systemorientierte Ansätze. Für eine ausführliche Darstellung und Diskussion dieser Tendenz, aber auch der Annäherung von systemorientierter an handlungsorientierte Ansätze vgl. Nolte (1999). Ergebnis 289 spruch der jeweiligen Theorie aufrechterhalten werden soll. Ein solcher Anspruch findt sich besonders stark bei den Rational Choice-Ansätzen. Sie versuchen, das ökonomische Modell als Grundlage sozialwissenschaftlicher Theoriebildung zu etablieren. Autoren wie Coleman (1990), Esser (1993), Lindenberg (1985) und Kiser und Hechter (1998) beanspruchen mit ihrem Modellen nicht nur einen eingeschränkten Bereich, für den sich plausibel das Primat einer rationalen Handlungslogik annehmen läßt, zu erklären, sondern darüber hinaus das gesamte Feld sozialwissenschaftlicher Fragestellungen abzudecken „...by offering superior models of causal relations and by suggesting plausible causal mechanisms.“ (Kiser / Hechter 1998: 786)24. Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß sich sowohl in der Politikwissenschaft als auch in der Soziologie ein Integrationstrend anhand der Modifikationen und impliziten Annäherungen verschiedener Paradigmen identifizieren läßt. Damit ist aber keineswegs die Koexistenz unterschiedlicher Paradigmen in der sozialwissenschaftlichen Community akzeptiert. Mit den Änderungen und impliziten Annäherungen wird oftmals sogar der theoretische Autonomieanspruch eines Paradigmas zu behaupten versucht, indem Anomalien in der Theorieentwicklung so umdefiniert werden, daß sie unter das bevorzugte Paradigma zusammengefaßt werden können (vgl. beispielsweise Essers Versuch, Irrationalität, Emotionalität, Normorientierung und die Bindung an moralische Verpflichtungen als eine Option „unreflektierten Handelns“ neben der Option rationalen, „reflektierten Handelns“ der Wahl rational Handelnder anheimzustellen und auf diese Weise Anomalien in den Modus der Rational Choice-Theorien zu integrieren <1996>). Parallel zum Trend der impliziten Annäherungen läßt sich deshalb ein Trend zum „Theoriekonflikt“ beobachten. Einen anderen Trend kann man bei der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung feststellen: Themen wie Transformation und Steuerung können nicht exklusiv unter den Zuständigkeitsbereich einer sozialwissenschaftlichen Teildisziplin subsumiert werden25. Die „gesellschaftstheoretische Kontextuierung“ (Willke 1995: 135) derart komplexer Prozesse, die sich auf und zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen abspielen, verlangt eher nach einer multiparadigmatischen Forschung. Der Gegenstandsbereich gewinnt Komplexität aus den Wechselwirkungen, die angrenzende gesellschaftliche Teilbereiche betreffen. Solche Untersuchungen verlangen per Definition 24 Die Voraussetzung für einen solchen Anspruch wird in zwei Schritten gesehen: 1. werden verschiedenste Akeursorientierungen bzw. -motive und Handlungslogiken unter ein Modell zusammengefaßt, mit dem sich dann auch angeben läßt, unter welcher Bedingung eine bestimmte Orientierung vorherrscht und 2. werden andere Theorien und Paradigmen auf das Rational ChoiceParadigma zurückgeführt (vgl. Esser 1993: 321f; Kiser / Hechter 1998: 807f). 25 Merkel (1995) spricht von „sozialwissenschaftlicher Transformationsforschung“ und auch die Arbeiten von Mayntz und Scharpf (1995a, 1995b) und Schimank (1995) am MPI für Gesellschaftsforschung versteht sich als sozialwissenschaftliche Forschung – v. Beyme bemerkt dazu: „...Renate Mayntz und viele andere hätten die Frage, ob sie Politologen oder Soziologen seien, nicht einmal verstanden.“ (1995: 20). Ergebnis 290 nach einer interdisziplinären Methode, danach, einen „shift our viewing angles“ (Wallerstein 1997: 1255) zu vollziehen, und somit nach einer Zusammenführung unterschiedlicher Paradigmen. Sozialwissenschaftliche Theoriebildung tendiert deshalb eher zur Integration bzw. ist auf sie angewiesen, als politikwissenschaftliche Forschung oder die in spezielle Soziologien differenzierte soziologische Forschung. Ansätze, die ihren Geltungsbereich einschränken, können bei der Untersuchung umfassender Phänomene keine Autonomie beanspruchen. Die Untersuchung der Transformation Osteuropas hat gezeigt, wie fruchtbar die Strategie des „Supplementation“ sein kann; diese Form der Integration kennzeichnet eine Position, die der Tendenz, Exklusivität für einzelne Paradigmen in der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung zu beanspruchen, entgegen gesetzt werden kann. Nicht nur der Ausbau – „Modification“ – einzelner Paradigmen muß vorangetrieben werden. Verschiedene Perspektiven lassen sich darüber hinaus fruchtbar zur Reflexion komplexer Phänomene zusammenführen. Aber auch herausgegriffene Teilphänomene wie die öffentliche Mobilisierung, kommen mit reduktionistischen Modellen nur schlecht aus. In dem Maße, wie das Teilphänomen auf andere Phänomene (z.B. die aufbrechende Elitenkohärenz) und die entsprechenden Wechselwirkungen verweist, lassen sich andere Paradigmen bzw. theoretische Perspektiven kaum ausschließen. Für ein realistisches Projekt der Integration bzw. Zusammenführung verschiedener analytischer Perspektiven zur Analyse komplexer gesellschaftlicher Phänomene müssen die Grenzen bzw. Defizite der theoretischen Perspektiven bei der Untersuchung offengelegt werden. Positiv formuliert heißt das: Die Schnittstellen, an denen die verschiedenen Paradigmen ineinandergreifen können, sind anzugeben. Und wie die Diskussion zu den Theorietrends in den Sozialwissenschaften zeigt, hat jedes Paradigma Auswirkungen auf den Erkenntnisanspruch. Leistungen und Einschränkungen eines „integrativen Paradigmas“, das verschiedene analytische Ansatzhöhen zusammenführt, müssen aufgezeigt werden. Die zwei zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, daß sich diese Ansprüche mit einer Mehrebenenanalyse einlösen lassen. Das erste Ergebnis bezieht sich auf die analytische Ansatzhöhe und das zweite betrifft den Erkenntnisanspruch der theoretischen Modelle: 1. Die untersuchungsleitende These der Arbeit, daß für die Modellierung komplexer sozialer Phänomene eine theoretischen Öffnung Bedingung ist, hat sich bestätigt. Die befriedigende Erklärung der Transformation und eine entwicklungsbegleitende Forschung werden erst mit einem Mehrebenenansatz, der die verschiedenen theoretischen Ansatzhöhen integriert, möglich. Ergebnis 291 Die Analysen einzelner Transformationsabschnitte können, wenn sie über die reine Zustandsbeschreibung hinaus Zusammenhänge und Prozesse untersuchen wollen, nicht ohne Verweise auf die übergeordnete bzw. untergeordnete analytische Ebene auskommen. Weder die Untersuchungen zu den Ursachen des Zusammenbruchs noch die Untersuchungen zur Konsolidierung können Prozesse allein mit der Beschreibung von Makro- oder Mikrovariablen ausreichend analysieren. Das Akteurshandeln folgt weder allein normativen Vorgaben, so daß es sich von Makrovariablen ableiten ließe, noch erfolgt es in einem normfreien Raum, so daß strukturelle Variablen allein als Antezedensbedingungen bzw. „externe“ Constraints rationaler Orientierung wirken. Akteure treffen Entscheidungen und haben Gestaltungsspielräume, so daß der alleinige Verweis auf systemische Prozesse und strukturelle Variablen die Variationen des sozialen Veränderungsprozesses nicht ausreichend erfassen kann. Ebensowenig lassen sich die Entscheidungen der Akteure reduktionistisch26 modellieren. Sie folgen nicht nur einem von Eigennutz bestimmten Kalkül. Die Ansätze zur Interaktion der politischen Akteure, zur öffentlichen Mobilisierung und vor allem der Modellentwurf zu den Verhandlungsprozessen an den Runden Tischen zeigen dies. Multimotivationale Modelle bewähren sich, weil sie mit der Mehrebenenanalyse kompatibel sind. Normative Orientierungen verweisen auf Strukturen sowie Institutionen, und sie können als „interne“ Constraints auf die Motive und Handlungsorientierung wirken, weil Werte und Normen über Sozialisationsprozesse internalisiert werden. Diese Aussagen bestätigen sich sowohl bei den aufgearbeiteten Beiträgen zum Zusammenbruch als auch bei der Untersuchung der Problemfelder einer politischen Konsolidierung. Die makrotheoretischen Untersuchungen eigenen sich besonders für die Beschreibung der Voraussetzungen der Änderungsprozesse (Transformations- und Konsolidierungsfenster). Wie systemische und strukturelle Spannungen bzw. Defizite aufgelöst und überwunden werden, zeigen uns die mikrotheoretischen Beiträge. Die Verbindung von beiden Ebenen kann auf der Mesoebene geleistet werden. Auf ihr wird deutlich, auf welche Weise Makromerkmale den Spielraum von Akteuren begrenzen und unter welchen Bedingungen sich Mikroprozesse in strukturelle und systemische Eigenschaften umsetzen. Die gesamte Transformation gestaltet sich somit als ein Prozeß, der analytisch mit Beschreibungen auf der Makroebene startet und auf der Mesoebene eine Präzisierung erfährt, an die die Prozesse der Mikroebene anknüpfen. Die Prozesse der Mikroebene ändern kurz- und mittelfristig die Ausprägungen der Mesoebene. Dies ist ein Prozeß, der langfristig strukturierende Wirkungen entfaltet und somit zu neuen Makroeigenschaften 26 Sowohl Makrotheorien, als auch Mikrotheorien können in Reduktionismus verfallen (vergl. hierzu Giddens 1988: 78 und ausführlich Elster 1991: 116f): Makrotheorien, wenn sie die Motive und damit das Handeln der Akteure über Internalisierung und normative Prägung ausschließlich auf strukturelle Merkmale zurückführen. Mikrotheorien, wenn Strukturen als beliebige, intendierte Schöpfung von Akteure modelliert werden. Ergebnis 292 führt. Dieses Modell einer sozialwissenschaftlichen Analyse entspricht dem Makro-Mikro-Makro-Modell von Coleman (1991: 8f) bzw. Esser (1993: 98f), nach dem soziale Phänomene auf der Makroebene das Ergebnis eines dreistufigen, zirkulären Prozesses bilden27: Auf der Makroebene wird die soziale Situation rekonstruiert. Damit wird die Logik für die Bedingungen und Alternativen des Handelns und Entscheidens der Akteure deutlich. Auf der Mikroebene wird mit einer Handlungstheorie die Logik der Selektion modelliert, so daß das Entscheidungshandeln der Akteure nachvollzogen werden kann. Und auf dem Wege zurück von der Mikro- zur Makroebene werden die Effekte des Handeln in einer Logik der Aggregation zu einem „kollektiven Explanandum“ zusammengefügt. Mit der Mesoebene wird ein Zwischenschritt eingefügt, mit dem die Logik der Situation und die Logik der Aggregation eine Präzisierung erfahren – die Wirkung von strukturellen Eigenschaften (und hier ganz besonders die „internen Constraints“) auf Akteurshandeln werden anhand institutioneller Eigenschaften deutlich, und ebenso wird deutlich, wie Akteurshandeln über Institutionen strukturierend wirkt. Auf der Mesoebene werden somit Transformationsregeln von der Makro- zur Mikroeben und vice versa angegeben. Damit erfüllt der Mehrebenenansatz zwei wichtige Bedingungen für eine Synthese von Struktur- und Akteuransätzen (vgl. Elster / Offe / Preuss 1988: 303): Der Erklärungsrahmen läßt zu, daß Strukturen die Institutionen vorgeben, die wiederum den Modus der Entscheidung prägen und die Entscheidung selbst auch mitbestimmen („forward linkages“). Anders herum können Entscheidungen bzw. Akteure aber auch Institutionen hevorbringen, mit denen eine Veränderung der Strukturen erfolgt („backward linkages“). Dieses Mehrebenenmodell läßt sich in einen umfassenderen Rahmen des Strukturwandels einfügen: Die Beschreibung des Transformationsprozesses stimmt mit der Standardformel von der „Dualität sozialer Struktur“ (Giddens 1988: 240f; Nolte 1999) überein. Giddens hat mit seiner Strukturierungstheorie gezeigt, daß die soziale Struktur sowohl Ergebnis als auch Bedingung für Handeln und Entscheiden der Akteure ist, wobei die institutionelle Analyse die Präzisierung der Beziehung von Struktur und Handlung leistet (1988: 245, 343). Bei Giddens gilt: „Der Handlungsstrom produziert kontinuierlich Folgen, die die Akteure nicht beabsichtigt haben, und diese unbeabsichtigten Folgen können sich auch, vermittelt über Rückkoppelungsprozesse, wiederum als nichteingestandene Bedingungen weiteren Handelns darstellen.“ (1988: 79). Ein solcher Prozeß zeigt sich in zweifacher Weise besonders deutlich bei der Transformation: 27 Der Verweis auf die Ähnlichkeiten der Modelle impliziert nicht das Bekenntnis zum Paradigma des Methodologischen Individualismus, für das die Ansätze von Esser und Colemann stehen. Gefolgt wird dem Modell zwar insofern, als die Analyse gesellschaftlicher Prozesse unterschiedliche Ebenen berücksichtigen muß. In dem hier vorgeschlagenen Modell sollen aber darüber hinaus auch die Mechanismen und Dynamiken, die von unterschiedlichen Paradigmen auf den jeweiligen Analyseebenen identifiziert werden, genutzt werden. Ergebnis 293 Einerseits zeigt sich global bei der Analyse zur Konsolidierung, daß im Erbe die Bedingungen für das Handeln in der Phase des Umbaus angelegt sind. Diese Handlungen sind auf dem Wege, neue Bedingungen zu schaffen, indem neue Handlungsmuster institutionalisiert werden, die sich (hoffentlich) zu demokratischen Strukturen aggregieren. Unter den demokratischen Strukturen, oder wie das Ergebnis der Aggregation auch immer ausfallen mag, gelten neue Bedingungen für Handlungen, die sowohl für Reproduktion als auch für Änderung verantwortlich sein werden. Neue, wenn auch weniger radikale, Änderungs- bzw. Reproduktionsprozesse werden dem Konsolidierungsprozeß folgen – das „Ende der Geschichte“ (Fukuyama 1992) ist selbst mit den Transformationen Osteropas noch nicht erreicht28. Andererseits zeigt sich der rekursive Prozeß auch im kleinen. In den dynamischen Phasen der Verhandlungen an den Runden Tischen und des institutionellen Umbaus finden die Rückkopplungsprozesse zwischen der Mesoebene und der Mikroebene statt. Akteure entwerfen und verabschieden neue Regelungen, die den Ausgangspunkt für nachfolgende Verhandlungen über weitere institutionelle Innovationen bilden. Mit jedem Schritt ändert sich nicht nur das institutionelle Gefüge. Auch die Zusammensetzung der Akteure und die Machtverteilung unter ihnen können bei jedem Zirkel des Prozesses neu sein, so daß sich die Bedingungen für die Bildung von Institutionen wieder gravierend ändern. Handlungen und Entscheidungen finden zwar unter bestimmten situativen Bedingungen statt. Sie schaffen aber immer auch neue Bedingungen für Anschlußhandlungen und -entscheidungen. Die Untersuchungen zur Transformation haben nicht nur gezeigt, daß sich die Mehrebenenanalyse bewährt, weil sie eine realitätsnähere und konsistentere Einschätzung komplexer gesellschaftlicher Prozesse leistet. Auch die an diese Aussage anschließende Aufgabenstellung ist erfüllt: Die Schnittstellen werden deutlich, an denen sich die unterschiedlichen analytischen Perspektiven zusammenführen lassen. Außerdem kann gezeigt werden, welche theoretische Perspektive sich für welche Fragestellung bzw. welchen Teilaspekt des umfassenden Prozesses der Transformation bewährt. Je nachdem, ob die Logik der Situation, die Logik der Handlung und Entscheidung (Selektion) oder die Logik der Aggregation im Zentrum der Untersuchung stehen, kann auf die entsprechende Analyseebene verwiesen werden. Gleiches gilt auch für Phasen der Transformation: Je nach Dynamik einer Phase haben die Prozesse ihren Ausgangspunkt auf einer bestimmten analytischen Ebene. Je weiter allerdings auf den Hierarchieebenen der analytischen Ansatzhöhe nach unten gegangen wird, desto spezifischer werden die Aus28 Fukuyama meinte mit seiner Aussage, daß die westlichen Werte des politischen und wirtschaftlichen Liberalismus über andere Ordnungskonzepte gesiegt hätten. Selbst diese differenziertere Betrachtungsweise ist problematisch, da sich besonders in den post-sowjetischen und postjugoslawischen Ländern „illiberale“, defekte Demokratien herausgebildet haben und die Werte des politischen Liberalismus bei den politischen Akteuren eine nachgeordnete Rolle zu spielen scheinen (vgl. Merkel / Croissant. 2000). Ergebnis 294 sagen. Während bei der Beschreibung systemischer Eigenschaften und struktureller Defizite kommunistischer Gesellschaften die Aussagen noch einen relativ hohen Allgemeinheitsgrad aufweisen, gelangen mit der zunehmenden Dynamik Spezifika einzelner Staaten bis hin zu den Besonderheiten institutionenprägender Interaktionen ins Blickfeld. Die Abnahme des Allgemeinheitsgrades liegt in der Zunahme der Entscheidungsfreiräume der Akteure begründet. Je größer die Freiräume sind, desto mehr Variationen der Entwicklungspfade ergeben sich. 2. Als zweites Ergebnis - parallel zur theoretischen Öffnung - kann festgehalten werden, daß die Rahmenbedingungen für die sozialwissenschaftliche Theoriebildung neu abgesteckt werden müssen. Mit der Integration weiterer analytischer Ebenen werden zusätzliche, vormals modellfremde Variablen berücksichtigt. Damit steigt die Komplexität der theoretischen Konstruktion, so daß weder der Makro- noch der Mikrodeterminismus reduktionistischer Modelle aufrechterhalten werden kann29. Der Anreiz, Modelle mit einem einfachen und eindeutigen Determinismus zu entwickeln (so versucht von der Geopolitischen Theorie oder auch den Rational Choice-Ansätzen) besteht darin, Phänomene nicht nur im nachhinein zu verstehen, sondern ursächlich erklären30 zu können bzw. über die zukünftige Entwicklung Aussagen zu wagen. Auf der Basis einer überschaubaren Menge zentraler Variablen und Wirkungsmechanismen wird versucht, nomologische Kausalbeziehungen zu formulieren, die sich, wenn die entsprechenden Randbedingungen angegeben werden können, auch für Vorhersagen eignen. Daß die Modellierung im Mehrebenenmodell an Einfachheit („parsemony“) und Eindeutigkeit einbüßt, muß dennoch kein Nachteil sein, da im Gegenzug eine realitätsnähere Modellierung möglich wird. Was helfen eindeutige Modelle, wenn sie ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht werden, d.h. weder plausible Erklärungen noch zuverlässige Vorhersagen liefern? Die Untersuchungen zum Zusammenbruch haben gezeigt, daß sich die meisten Theorien auf einen heuristischen Anspruch beschränken oder lediglich für einen sehr beschränkten Ausschnitt einen Erklärungsanspruch aufrecht erhalten können. Sowohl System-, Struktur- und Institutionentheorien als auch Akteurstheorien und die multimotivationale Modellierungen der Verhandlungen an den Runden Tischen verweisen auf einen zurückgenommenen Erklärungsanspruch. Bei der Konsolidierungsforschung verhält es sich ähnlich. Sie wird von deskriptiven Studien bestimmt, was nicht zuletzt aus den Unsicherheiten bezüglich allgemeingültiger Demokratisierungskonzepte und zuverlässiger Konsolidierungspfade, die als Orientie29 Hierin weicht der Mehrebenenansatz auch prinzipiell von dem Makro-Mikro-Makro-Modell ab. Coleman (1991) und Esser (1993) versuchen als Kern des Modells eine eindimensionale Handlungstheorie (SEU-Theorie) zu formulieren, mit der ein deduktiver Erklärungsanspruch aufrechterhalten werden kann. 30 Erklären bezieht sich hier auf den wissenschaftlichen Begriff einer deduktiv-nomologischen Erklärung nach Popper (1984) und Hempel und Oppenheim (1948). Ergebnis 295 rung für die Einschätzung der Entwicklungschancen dienen könnten, resultiert (vgl. Kopecky / Mudde 2000). Wegen der Variablenvielfalt und der Vielfalt der Wirkungszusammenhänge stellt sich das Phänomen Transformation derartig komplex dar, daß eindeutige Kausalbeziehungen schlecht zu identifizieren sind. Allerdings hat die Forschung, und das zeigt sich besonders bei der Untersuchung der Problemfelder politischer Konsolidierung, Wirkungszusammenhänge herausgearbeitet, von denen wir zwar nicht wissen, ob sie im konkreten Fall zum Zuge kommen werden. Sie bilden aber immerhin Mechanismen, mit denen im Nachhinein ein Prozeß modelliert werden kann31. Damit läßt sich auch das „Defizit“ einer Mehrebenenanalyse der Konsolidierung auffangen. Ein zurückgenommener Erklärungsanspruch bildet für die Konsolidierungsforschung, deren Ziel ja gerade der Versuch ist, Aussagen über zukünftige Entwicklungen zu wagen, ein gravierendes Problem: Vorhersagen lassen sich nur auf der Grundlage eindeutiger Wirkungsmodelle, von denen wir in der Mehrebenenanalyse absehen müssen, treffen. Sollen in einer Mehrebenenanalyse die verschiedenen analytischen Ebenen des Prozesses der Transformation berücksichtigt werden, entsteht ein derart komplexes Variablengefüge mit multiplen Interdependenzen, daß allgemeine Aussagen schwierig, wenn nicht unmöglich werden. Die Kompexität der Variablen, die einen Einfluß auf die politische Konsolidierung haben, begründet sich nicht nur aus der Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen institutionellen Elemente und Designs. Zu dieser Komplexität interner Wirkungszusammenhänge kommt die Komplexität externer Wirkungszusammenhänge: Die politische Stabilität hängt mit den Entwicklungen in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen zusammen. Beispielsweise wird die Effizienz des politischen Teilsystems vorwiegend am wirtschaftlichen Erfolg gemessen. Die Ausprägung dieser Größe ist zwar auch von politischen Regulierungen abhängig. Die effiziente Ressourcennutzung kann aber nicht direkt von der Politik gesteuert werden. Über die erfolgreiche Nutzung von Ressourcen und die Verwirklichung demokratischzivilgesellschaftlicher Strukturen entscheiden auch kulturelle Ressourcen einer Gesellschaft. Im kulturellen Erbe sind die Möglichkeiten für die Neubildung kongruenter Identitätsmuster, die eine Voraussetzung für demokratische Konsolidierung und effektive Marktwirtschaft bilden, angelegt. Wegen dieser offensichtlichen Komplexität muß es beim gegenwärtigen Stand der Konsolidierungsforschung genügen, a) die Genese der demokratischen Institutionen nachzeichnen zu können, d.h. zu verstehen, und b) mögliche Entwicklungswege für eine 31 Mechanismen können erklären, warum etwas passiert ist, weil sie Aussagen sind, die sich auf Wirkungszusammenhänge beziehen (Elster 1989: 3f). Sie unterscheiden sich allerdings von gesetzesmäßigen Aussagen. Während gesetzesmäßige Aussagen allgemeingültig sind und keine Ausnahmen zulassen, schließen Mechanismen Aussagen, wie “if p, then sometimes q.” (Elster 1989: 10) nicht aus. Ergebnis 296 demokratische Konsolidierung zu identifizieren. Vom Erklärungsanspruch im deduktivnomologischen Sinne muß zurückgetreten werden, so daß der Anspruch, Vorhersagen über die Entwicklung zu treffen, nicht aufrechterhalten werden kann. Weitreichender und umfassender sozialer Wandel wie in Transformationen ist nicht determiniert. Er läßt sich weder aus den Strukturen, noch aus dem Verhalten bzw. Handeln der Akteure ableiten. Das hat nicht zur Folge, daß man sich darauf beschränken muß, Geschichte zu schreiben. Die Erfahrungen mit den Demokratisierungen nach dem Zweiten Weltkrieg, in Südeuropa und Lateinamerika bieten eine Folie, vor der Chancen und Risiken einer stabilisierenden Entwicklung anhand des spezifischen Institutionen-Mix in einem gegebenen sozio-ökonomischen Kontext identifiziert werden können. Es lassen sich Mechanismen aufzeigen, mit denen problematische Entwicklungen bzw. riskante institutionelle Konstruktionen und demokratische Defizite begründet ausgewiesen werden können. Auch wenn der Pfad zur Demokratie ein unsicherer Pfad bleibt, kann versucht werden, Generalisierungen anhand typischer Dilemmas, Fehlentscheidungen aber auch Fehleinschätzungen aufzuzeigen (vgl. O’Donnell / Schmitter 1986). Hier gewinnt Theorie wieder an Bedeutung. Auch wenn die Vielzahl der Variablen und Wechselwirkungen der Formulierung einer allgemeinen Konsolidierungstheorie im Wege stehen, kann mit einem Mehrebenansatz, dem ein zurückgenommener Erklärungsanspruch zugrunde liegt, wesentliches für die Konsolidierungsforschung geleistet werden: Erstens kann mit zeitlichem Abstand ein Blick zurück gewagt werden, der über die Ausgangsbedingungen für den Umbau informiert und zu dem Verständnis der Prozesse des Umbaus beiträgt. Zweitens entsteht ein Katalog relevanter Kriterien. Kriterien, die beim Blick nach vorne als „quality-check“ fungieren und noch während der Zeit des institutionellen Umbaus über Chancen und Risiken für eine stabile Demokratie informieren. Somit helfen die Mechanismen nicht nur, relevante kausale Beziehungen für vergangene Ereignisse zu identifizieren. Sie können auch als Grundlage für Untersuchungen zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten dienen. Ein Mehrebenenansatz kann das Defizit eindeutiger Kausalbeziehungen also auf zweifache Weise ausgleichen: Soziale Phänome lassen sich realitätsnäher modellieren, und für zukünftige, angestrebte Entwicklungen können Problemfelder angegeben werden. Im Sinne eines possibilistic approach (Hirschman 1979) lassen sich die Möglichkeiten für die erfolgreiche Entwicklung austarieren32. Es gibt kein „Rezeptwissen“, das den richtigen Weg kennt. Das heißt aber nicht, daß sich die Forschung darauf beschränken muß, rückblickend die Änderungsprozesse theoretisch zu sortieren. Mit einer Haltung des „thoughtful wishing“ (O’Donnell 1986: 18) kann sie den Wandel beratend begleiten. Dieser Anspruch ist zwar bescheidener, aber keineswegs „ärmer“, wenn man wie Wallerstein bedenkt: „The possible is richer than the real.“ (1997: 1254). 32 Zum „Möglichkeitsraum der Politik“ vgl. Wiesenthal (1997: 252) . Ergebnis 297 Darüber hinaus ist der Ansatz ausbaufähig. So, wie die bekannten Mechanismen hauptsächlich aus den Erfahrungen mit den Transformationen in Südeuropa und Lateinamerika gewonnen wurden, ist auch die Beobachtung der Transformation Osteuropas eine Quelle für die Theoriebildung. Neue Wirkungszusammenhänge, die vermeintlich stabile Systeme gefährden, den plötzlichen, unerwarteten Umbruch bewirken und die den Transformationstheorien vor 1989 offensichtlich unbekannt waren, lassen sich aus der Analyse des Zusammenbruchs gewinnen. Und die Beobachtung der weiteren Entwicklung in Osteuropa wird neue Einsichten in die Entwicklungschancen und -risiken junger, marktwirtschaftlich-demokratischer Systeme geben. III II I Geopolitische Theorie politisch ökonomisch kulturell(Werte) strukturelle Schwächen: Konvergenz wirtschaflicher Wettbewerb Konflikt abnehmende Elitenkohärenz bei Liberalisierung (2) Motivation/ Legitimität Interessen Meso horizontale und vertikale Defizite intermediäre Institutionen (1) (3) Innerelitenprozesse (Loyalität) Mikrotheorie Mikro Verhandlungen am Runden Tisch hoch niedrig öffentliche Mobilisierung (Legitimität) Ausführung Institutionentheorie mangelhafte Intermediarität und „Dilemma of Reforms“ Legitimität Entscheidungsfreiheit Analytische Ebene Makro Dynamik des Wandels niedrig Abstraktionsgrad (Allgemeinheitsgrad der Beschreibungen) hoch Systemtheorie Umwelteinflüsse und Differenzierungsdefizite internat. Herausforderung und milit. Machtkonstellation Elitenkonvergenz Konkretisierung Modernisierungstheorie Transformationsfenster Abbildung 3: Der Zusammenbruch 298 Analytische Ebene Dynamik des Wandels niedrig III‘ hoch niedrig Mikro/ Meso hoch Mikro: - Politisches Selbstinteresse (6) Meso: - Verfassung - Institutionelle Elemente der Verfassung: Regierungssystem, Wahlsystem - Parteien und intermediäre Institutionen Umbau Kulturelle Konsolidierung Ökonomische Konsolidierung Meso/Mikro Abstraktionsgrad (Allgemeinheitsgrad der Beschreibungen) hoch niedrig I‘ Makro II‘ (5) Mikro: - Elitenkontinuität - Organisationsgrad der Eliten und Opposition Meso: - Institutionelle Defizite (4) Makro: - Regimetyp - „Stateness“ / territoriale Integrität - Art des Regimewandels Erbe Konsolidierungsfenster (7) (8) Mikro: - „Compliance“ Meso: - „Agency“ - Allokation von „Agency“ - Horizontale institutionelle Differenzierung Makro: - Kontinuität der Regimeidentität - Flexibles Reagieren auf sich ändernde Umwelteinflüsse / Krisenresistenz Stabilisierung hoch Makro niedrig Abbildung 4: Die politische Konsolidierung 299 Literatur LITERATUR 300 Literatur 301 Ágh, A.: Die neuen politischen Eliten in Mittelosteuropa, in: Bönker, F. / H. Wiesental und H. Wollmann (Hg.): Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Leviatan, Sonderheft 15, 1995: 422-436. Alexander, J. C.: Modern, Anti, Post, and Neo; How Social Theories Have Tried to Understand the „New World“ of „Our Time“, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 23, 1993: 165-197. Arato, A.: Revolution, Civil Society und Democracy, in: Transit (1), 1, 1990: 110-126. Aretz, H.-J.: Ökonomischer Imperialismus; Homo Oeconomicus und soziologische Theorie, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg.26, 1997: 79-95. Axelrod, R.: The evolution of cooperation, New York, 1984. Baecker, D.: Poker im Osten, Probleme der Transformatinsgesellschaft, Berlin, 1998. Baláz, J. / R. Bobach: Transformationstheorie - Versuch einer Rekonstruktion, in: Heuer, B./ M. Prucha (Hg.): Der Umbruch in Osteuropa als Herausforderung für die Philosophie, Frankfurt, 1995. Baláz, J.: Eine sanfte Dekommunisierung? Der Lustrationsdiskurs nach der „sanften Revolution“ in den tschechischen und slowakischen Medien, in: MänickeGyöngyösi, K. (Hg.): Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität, Berlin, 1996: 163-182. Bauman, Z.: A Revolution in the Theory of Revolutions?, in: International Political Science Review, Vol.15, 1994: 15-24. Baylis, T.A.: Elite change after communism: Eastern Germany, the Czech Republic, and Slovakia, In: East European Politics and Societies, Vol. 12, 1998: 265-299. Beichelt, T. / S. Kraatz: Zivilgesellschaft und Systemwechsel in Russland, in: Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 5, Zivilgesellschaft und Transformation, Opladen, 2000: 115-144. von Beyme, K.: Die politischen Theorien der Gegenwart, Opladen, 19927. von Beyme, K.: Systemwechsel in Osteuropa, Frankfurt, 1994. von Beyme, K.: Ansätze einer Theorie der Transformation der ex-sozialistischen Länder Osteuropas, in: Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 1, Theorien, Ansätze und Konzeptionen, Opladen, 1994a. von Beyme, K. / C. Offe (Hg.): Theorie der Politik im Zeitalter der Transformation, Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 26 / 1995. von Beyme, K.: Parteien im Prozeß der demokratischen Konsolidierung, in Merkel, W. / E. Sandschneider (Hg.): Systemwechsel 3, Parteien im Transformationsprozeß, Opladen 1997: 23-56. von Beyme, K.: Zivilgesellschaft – Von der vorbürgerlichen zur nachbürgerlichen Gesellschaft?, in: Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 5, Zivilgesellschaft und Transformation, Opladen, 2000: 51-70. Literatur 302 Blais, A.: The Debate over Electoral Systems, in: International Political Science Review, Vol. 12, 1991: 239-260. Bobach, R.: Der Umbruch im Osten - Binnenperspektiven, in: Heuer, B. / M. Prucha (Hg.): Der Umbruch in Osteuropa als Herausforderung für die Philosophie, Frankfurt, 1995. Bönker, F. / C. Offe: Die moralische Rechtfertigung der Restitution des Eigentums, in: Leviatan, Heft 3, 1994: 318-352. Bönker, F. / H. Wiesental und Hellmut Wollmann: Einleitung, in: (ders.): Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Leviatan, Sonderheft 15, Opladen, 1995: 11-29. Bönker, F.: The Dog That Did Not Bark? Politische Restriktionen und ökonomische Reformen in den Visegràd-Ländern, in: ders. / H. Wiesental und H. Wollmann (Hg.): Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Leviatan, Sonderheft 15, 1995: 180-206. Bos, E.: Die Rolle von Eliten und kollektiven Akteuren in Transformationsprozessen, in: Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 1, Theorien, Ansätze und Konzeptionen, Opladen, 1994: 81-110. Bos, E.: Verfassungsgebungsprozeß und Regierungssystem in Rußland, in: Merkel, W. / E. Sandschneider und Dieter Segert (Hg.): Systemwechsel 2, Die Institutionalisierung der Demokratie, Opladen, 1996: 179-213. Boudon, R.: Limitations of Rational Choice Theory, in: American Journal of Sociology, Vol. 104, 1998: 817-28. Brecher, M.: Introduction: Crisis, Conflict, War – State of the Discipline, in: International Political Science Review, 1996: 127-139. Brezinski, H.: Der Stand der wirtschaftlichen Transformation, in: Brunner, G. (Hg.): Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa, Berlin, 1996: 131-162. Brie, M.: Realsozialismus zwischen antikapitalistischem Ausbruchsversuch und Selbstaufhebung, in: ders. / D. Klein (Hg.): Zwischen den Zeiten. Ein Jahrhundert verabschiedet sich, Hamburg, 1992: 57-100. Brie, M.: Rußland, das Entstehen einer „deligierten Demokratie“, in: Merkel, W. / E. Sandschneider und Dieter Segert (Hg.): Systemwechsel 2, Die Institutionalisierung der Demokratie, Opladen, 1996: 143-178. Brie, M.: Staatssozialistische Länder Europas im Vergleich; Alternative Herrschaftsstrategien und divergente Typen, in: Wiesenthal, H. (Hg.): Einheit als Privileg, Vergleichende Perspektiven auf die Transformation Ostdeutschlands, Frankfurt/M. / New York, 1996a: 39-104. Brunner, G. (Hg.): Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa, Berlin, 1996. Literatur 303 Brunner, G.: Rechtskultur in Osteuropa, Das Problem der Kulturgrenzen, in: ders. (Hg.): Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa, Berlin, 1996: 91-112. Buchanan, J. / G. Tullock: The Calculus of Consent, Ann Arbor, Michigan, 1962. Bude, H.: Das Ende einer tragischen Gesellschaft, in: Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, 1993: 267-281. Calda, M.: The Roundtable Talks in Czechoslovakia, in: Elster, J. (Hg.): The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, Chicago/London, 1996: 135-177. Clague, C. / G.C. Rausser (Hg.): The Emergence of Maket Economies in Eastern Europe, Oxford, 1992. Clague, C.: The Journey to a Market Economy, in: ders. / G.C. Rausser (Hg.): The Emergence of Maket Economies in Eastern Europe, Oxford, 1992: 1-24. Coleman, J. S.: Comment on Kuran and Collins, in: American Journal of Sociology, Vol.100, 1995: 1616-19. Coleman, J. S.: Foundations of Social Theory, Cambridge, 1990. Collins, R.: The Future Decline of the Russian Empire; An Application of geopolitical Theory, Sociology Lecture Series 1980, veröffentlicht in: ders. (Hg.): Weberian Sociological Theory, New York, 1986. Collins, R. (Hg.): Weberian Sociological Theory, New York, 1986. Collins, R. / D. Waller: Der Zusammenbruch von Staaten und die Revolutionen im sowjetischen Block: Welche Theorien machten zutreffende Voraussagen?, in: Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, 1993: 302-325. Collins, R.: Prediction in Macrosociology: The Case of Soviet Collapse, in: American Journal of Sociology, Vol. 100, 1995: 1552-93. Colomer, J. M.: Transitions by Agreement; Modeling the Spanish Way, in: American Political Science Review, Vol. 85, 1991: 1283-1302. Colomer, J. M.: Gametheorie and the Transition to Democracy; The Spanish Model, Hamshire, 1995. Crawford, B. / A. Lijphart (Hg.): Liberalization and Leninist legacies: Comparative perspectives on democratic transitions, Berkeley, 1997. Croissant, A. / H.-J. Lauth und W. Merkel: Zivilgesellschaft und Transformation: ein internationaler Vergleich, in: Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 5, Zivilgesellschaft und Transformation, Opladen, 2000: 9-50. Czada, R. / A. Windhoff-Héritier: Political Choice: Institutions, Rules and the Limits of Rationality, Frankfurt/M., 1991. Dahl, R.: Poliarchy, New Haven/Yale, 1971. Dahl, R.: Dilemmas of Pluralist Democracy, New Haven, 1982. Literatur 304 Dahl, R.: Democracy and ist Critics, New Haven, 1989. Deutsch, K. W.: Politische Kybernetik, Modelle und Perspektiven, Freibung i. B., 1969. Denzin, N. K.: Whose Sociology is it?; Comment on Huber, in: American Journal of Sociology, Vol. 102, 1997: 1416-29. Deppe, R. / H. Dubiel und U. Rödel: Demokratischer Umbruch in Osteuropa, Frankfurt/M., 1991. DGS-Sektion Soziologische Theorien: Berichte aus den Sektionen, in: Soziologie, 1998: 87-89. Diamond, L.: The Paradoxes of Democracy, in: Journal of Democracy, Vol. 3, 1990: 48-60. Diamond, L.: Towards Democratic Consolidation, in: Journal of Democracy, Vol. 3, 1994: 4-17. Di Palma, G.: Legitimation from the Top to Civil Society. Politico-Cultural Change in Eastern Europe, in: World Politics, Vol. 43, 1991: 49-80. Downs, A.: Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen, 1968. Easter, G. M.: Personal Networks and Postrevolutionary State Building, Soviet Russia Reexamined, in: World Politics, Vol. 48, 1996: 551-578. Easton, D.: A System Analysis of Political Life, Chicago and London, 1979. Edeling, T. / W. Jann und D. Wagner (Hg.): Institutionenökonomie und Neuer Institutionalismus; Überlegungen zur Organisationstheorie, Opladen, 1999. Edeling, T.: Einführung: Der Neue Institutionalismus und die Theorie politischer Institutionen, in: ders. / W. Jann und D. Wagner (Hg.): Institutionenökonomie und Neuer Institutionalismus; Überlegungen zur Organisationstheorie, Opladen, 1999: 7-16. Eisen, A.: Institutionenbildung und institutioneller Wandel im Transformationsprozeß, Theoretische Notwendigkeiten und methodologische Konsequenzen einer Verknüpfung struktureller und kultureller Aspekte des institutionellen Wandels, in: ders. / H. Wollmann (Hg.): Institutionenbildung in Ostdeutschland. Zwischen externer Steuerung und Eigendynamik, Opladen, 1996: 33-62. Eisen, A./ H. Wollmann (Hg.): Institutionenbildung in Ostdeutschland. Zwischen externer Steuerung und Eigendynamik, Opladen, 1996. Eisenstadt, S. M.: The Breakdown of Communist Regimes, in: Daedalus, Band 121, 1994: 21-41. Ekiert, G.: The State Against Society. Political Crisis and Their Aftermath in East Central Europe, Princeton, 1996. Elster, J.: The Multiple Self. Cambridge, 1985. Elster, J.: Rational Choice, New York, 1986. Elster, J.: Subversion der Rationalität, Frankfurt/New York, 1987. Literatur 305 Elster, J.: Introduction, in: ders. / R. Slagstad (Hg.): Constitutionalism and Democracy, Cambridge, 1988: 1-18. Elster, J.: Consequences of constitutional choice: Reflections on Tocqueville, in: ders. / R. Slagstad (ed.): Constitutionalism and Democracy, Cambridge, 1988a: 81-102. Elster, J.: Arguments for Constitutional Choice: reflections on the transition to socialism, in ders. / R. Slagstad (ed.): Constitutionalism and Democracy, Cambridge, 1988b, 303-326. Elster, J.: Nuts and Bolts for the Social Science, New York, 1989. Elster, J.: The Cement of Society: A study of social order, New York, 1989a. Elster, J.: Solomonic Judgements: Studies in Limitations of Rationality, New York, 1989b. Elster, J.: The Necessity and Impossibility of simultaneous Economic and Political Reform, in: Ploszajski, P. (Hg.): Philosophy of Social Choice, Warsaw, 1990: 309-316. Elster, J.: Rationality and Social Norms, in: Arch. europ. sociol., XXXII, 1991: 109129. Elster, J.: Local Justice, New York, 1992. Elster, J.: Die Schaffung von Verfassungen: Analysen der allgemeinen Grundlagen, in: Preuß, U. K. (Hg.): Zum Begriff der Verfassung – Die Ordnung des Politischen, Frankfurt, 1994: 37 - 57. Elster, J.: Introduction, in: ders. (Hg.), The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, Chicago, 1996. Elster, J. / R. Slagstad (Hg.): Constitutionalism and Democracy, Cambridge, 1988. Elster, J. / C. Offe and U. Preuss: Institutional Design in Post-communist Societies, Rebuilding the Ship at Sea, Cambridge, 1998. Eörsi, I.: Der Schock der Freiheit, in: Bayer, J. / R. Deppe (Hg.): Der Schock der Freiheit; Ungarn auf dem Weg in die Demokratie, Frankfurt/M., 1993: 67-76. Erdmenger, K.: Restriktionsanalyse als reflexive Modernisierungstheorie, in: Politische Vierteljahresschrift, 1995: 286-293. Esser, H.: Soziologie: Allgemeine Grundlagen, Frankfurt/New York, 1993. Esser, H.: Die Definition der Situation, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 48, 1996: 1-34. Finer, S.E. / V. Bogdanor und B. Rudden: Comparing Constitutions, Oxford, 1995. Fischer, S.: Privatization in the East European Transformation, in: Clague, C. / G.C. Rausser (Hg.): The Emergence of Maket Economies in Eastern Europe, Oxford, 1992: 227-244. Fishman, R. M.: Rethinking State and Regime, in: World Politics, Vol. 26, 1990: 422440. Literatur 306 Föhlich, S.: Verfassungsreformprozesse in Mittel- und Osteuropa; Typologie des modernen Verfassungsstaats, in: Internationale Politik, Jg. 5, 1997: 25-30. Foster, R.: Nation Making: Emergent identities in postcolonial Melanesia, Ann Arbor, 1995. Friedman, J. (Hg.): The Rational Choice Controversy; Economic Models of Politics Reconsidered, New Haven and London, 1995. Fukuyama, F.: Das Ende der Geschichte: Wo stehen wir?, München, 1992. Fukuyama, F.: Ich oder die Gemeinschaft, in: Die Zeit, Nr. 46., 1999. Gabanyi, A. / G. Hunya: Vom Regimewechsel zur Systemtransformation: Rumänien, in: Pradetto, A. (Hg.): Die Rekonstruktion Ostmitteleuropas, Opladen, 1994: 77112. Gabrisch, H.: Die Entwicklung der Handelsstrukturen der Transformationsländer, in: Brunner, G. (Hg.): Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa, Berlin, 1996: 193-220. Ganßmann, H.: Die nichtbeabsichtigten Folgen einer Wirtschaftsplanung; DDRZusammenbruch, Planungsparadox und Demokratie, in: Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, Frankfurt/M., 1993: 172193. Gebethner, S.: Proportional Presentation Versus Majoritarian Systems, Free Elections and Political Parties in Poland, 1989-1991, in: Lijphard, A. / C. H. Waisman (Hg.): Institutional Design in new Democracies; Eastern Europe and Latin America, Boulder, 1996: 59-76. Geddes, B.: Initiation of new Democratic Institutions in Eastern Europe and Latin America, in Lijphard, A. / C. H. Waisman (Hg.): Institutional Design in new Democracies; Eastern Europe and Latin America, Boulder, 1996: 15-42. Gibbons, R.: Game Theory for Applied Economists, Princeton, 1992. Giddens, A.: Theorie und Gesellschaft, Frankfurt / New York, 1988. Gläßner, G. –J.: Am Ende des Staatssozialismus – Zu den Ursachen des Umbruchs in der DDR, in: Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, Frankfurt/M., 1993: 70-92. Gläßner, G. –J.: Demokratie nach dem Ende des Kommunismus; Regimewechsel, Transition und Demokratisierung im Postkommunismus, Opladen, 1994. Göhler, G. / R. Kühn: Institutionenökonomie, Neo-Institutionalismus und die Theorie politischer Institutionen, in: Edeling, T. / W. Jann und Dieter Wagner (Hg.): Institutionenökonomie und Neuer Institutionalismus; Überlegungen zur Organisationstheorie, Opladen, 1999: 17-42. Goldstone, J. A.: Is Revolution Individually Rational? Groups and Individuals in Revolutionary Collective Action, in: Rationality and Society, Vol. 6, 1994: 139166. Literatur 307 Gordon, L. A. / A. K. Nazimova: Die Arbeiterklasse in der UdSSR; Tendenzen und Perspektiven der sozial-ökonmischen Entwicklung, in: Sozialwissenschaftliche / gesellschaftswissenschaftliche Beiträge, 40, 1987: 205-208. Green D.P. / I. Shapiro: Pathologies of Rational Choice Theory; A Critique of Applications in Political Science, New Haven and London, 1994. Gunther, R. / N. Diamandouros und H.-J. Puhle (Hg.): The Politics of Democratic Consolidation, Baltimore, 1995. Habermas, J.: Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt, 1981. Habermas, J.: Die nachholende Revolution, Frankfurt, 1990. Habermas, J.: Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt/M., 1992. Habermas, J.: Über den internen Zusammenhang von Rechtsstaat und Demokratie, in: Preuß, U. K. (Hg.): Zum Begriff der Verfassung – Die Ordnung des Politischen, Frankfurt/M., 1994: 83-94. Haraszti, M.: Decades of the handshake transition, in: East European Politics and Societies, Vol. 13, 1999: 288-292. Harberger, A.: Strategies for the Transition, in: Clague, C. / G.C. Rausser (Hg.): The Emergence of Maket Economies in Eastern Europe, Oxford, 1992: 297-300. Hausner, J. / B. Jessop und K. Nielsen (Hg.): Strategic Choice and Path-Dependency in Post-Socialism. Institutional Dynamics in the Transformation Process, Aldershot, 1995. Hechter, M.: Introduction: Reflections on Historical Profecy in the Social Sciences, American Journal of Sociology, Vol. 100, 1995: 1520-27. Hempel, C. G. / P. Oppenheim: Studies in the logic of explanation, in: Philosophy of Science, 15, 1948: 135-175. Hirschman, A. O.: Exit, Voice and Loyality: responses to decline in firms, organizations, and states, Cambridge, 1972. Hirschman, A. O.: A bias for hope, Cambridge, 1972. Hirschman, A. O.: Engagement und Enttäuschung: Über das Schwanken der Bürger zwischen Privatwohl und Gemeinwohl, Frankfurt/M., 1988. Hirschman, A. O.: Exit, Voice, and the Fate of the German Democratic Republic. An Essay on Conceptual History, in: World Politics, Vol. 45, 1993: 173-202. Hitzler, R.: Perspektivenwechsel; Über künstliche Dummheit, Lebensweltanalyse und Allgemeine Soziologie, in: Soziologie, 1997: 5-18. Holmes, L.: The End of Communist Power, Anti-Corruption Campains and Legitimation Crisis, Cambridge, 1993. Holmes, S.: Gag rules or politics of omission, in Elster, J. / R. Slagstad (Hg.): Constitutionalism and Democracy, Cambridge, 1988: 19-58. Literatur 308 Holmes, S.: Precommitments and the paradox of democracy, in Elster, J. / R. Slagstad (Hg.): Constitutionalism and Democracy, Cambridge, 1988a: 195-240. Holzer, J.: Stabilisierungserfolg und Gefahr der Unregierbarkeit: Polen, in: Pradetto, A. (Hg.): Die Rekonstruktion Ostmitteleuropas, Opladen, 1994: 143-156. Hondrich, K. O.: Systemveränderungen sozialistischer Gesellschaften - Eine Herausforderung für die soziologische Theorie, in: Zapf, W. (Hg.): Die Modernisierung moderner Gesellschaften, 1990: 553-557. Horský, V.: Die samtene Revolution in der Tschechoslowakei, in: Deppe, R. / H. Dubiel und U. Rödel: Demokratischer Umbruch in Osteuropa, Frankfurt/M., 1991: 281-300. Huinink, J. / K. U. Mayer: Lebensverläufe im Wandel der DDR-Gesellschaft, in: Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, Frankfurt/M., 1993: 151-171. Hüttig, C.: Das Ende des Ost-West-Konflikts als Problem der Theorie internationaler Beziehungen, in: Politische Vierteljahresschrift, 1991: 663-670. Huntington, S. P.: Political Developement and Political Decay, in: World Politics, 17, 1965: 386-430. Huntington, S. P.: Political Modernization: America versus Europe, in: World Politics, 18, 1966: 378-414. Huntington, S. P.: Political Order in Changing Societies, New Haven / London, 1968. Huntington, S. P.: Will more Countries become Democratic?, in: Political Science Quarterly, 1984: 193-218. Huntington, S. P.: How Countries Democratize, in: Political Science Quarterly, Vol.106, 1991-92: 579-616. Huntington, S. P.: The Third Wave; Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, 1991. Ishiyama, J. T.: Communist Parties in Transitions; Structures, Leaders, and Processes of Democratization in Eastern Europa, in: Comparative Politics, Vol. 27, 1995: 147-166. Janos, A. C.: Social Science, Communism, and the Dynamics of Political Change, in: World Politics, Vol. 43, 1991: 81-111. Jarosz M. / B. Weber: Privatization und Reprivatization According to the Plan of Leszek Balcerowisz an His Fellows, in: Mänicke-Gyöngyösi, K. (Hg.): Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität, Berlin, 1996: 259-272. Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, Frankfurt/M., 1993. Literatur 309 Joas, H. / M. Kohli: Der Zusammenbruch der DDR: Fragen und Thesen, in ders. (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, Frankfurt/M., 1993: 728. Johnson, C.: Preconception vs. Observation, or the Contribution of Rational Choice Theory and Area Studies to Contemporary Political Science, in: Political Science & Politics, 1997: 170-174. Jordan, G.: How Bumble-bees Fly: Accounting for Public Interest Participation, in: Political Studies, 1996: 668-85. Juchler, J.: Osteuropa im Umbruch; Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen, 1993. Kahnemann, D. / A. Tversky: Judgement under Uncertainty, in: Science 185, 1974: 1124-1130. Kahnemann, D. / A. Tversky: Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, in: Econometrica, Vol. 47, 1979: 263-291. Kamenitza, L.: The Process of Political Marginalization; East German Movements after the Wall, in: Comparative Politics, Vol. 30, 1998: 313-333. Kappelhoff, P.: Soziale Interaktion als Tausch: Tauschhandlung, Tauschbeziehung, Tauschsystem, Tauschmoralität, in: Ethik und Sozialwissenschaften 6, 1995: 3-67. Karl, T. L. / P. C. Schmitter: Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe, in: International Social Science Journal, Nr. 43, 1991: 269-284. Kasapovic, M. / D. Nohlen: Wahlsysteme und Systemwechsel in Osteuropa, in: Merkel, W. / E. Sandschneider und D. Segert (Hg.): Systemwechsel 2, Die Institutionalisierung der Demokratie, Opladen, 1996: 213-260. Kelle, U. / C. Lüdemann: „Grau Freund, ist alle Theorie...“ Rational Choice und das Problem der Brückenannahmen, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1995: 249-267. Kersting, W.: John Rawls zur Einführung, Hamburg, 1993. Kiser E. / M. Hechter: The Debate on Historical Sociology; Rational Choice Theory and Its Critics, in: American Journal of Sociology, Vol. 104, 1998: 785-816. Klein, D.: Grenzen der Entwicklung des Staatssozialismus - die globalen Probleme, in: Brie, M. / ders. (Hg.): Zwischen den Zeiten. Ein Jahrhundert verabschiedet sich, Hamburg 1992. Kollmorgen, R. / W. Reißig und Johannes Weiß (Hg.): Sozialer Wandel und Akteure in Ostdeutschland, Opladen, 1996. Kolorova, R. / D. Dimitov: The Roundtable Talks in Bulgaria, in: Elster, J. (Hg.): The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, Chicago/London, 1996: 178-212. Literatur 310 Kopecky, P. / C. Mudde: What has Eastern Europea taught us about the democratisation literature (and vice versa) ?, in: European Journal of Political Research, Vol. 37, 2000: 517-539. Kraus, P. A.: Elemente einer Theorie postautoritärer Demokratisierungsprozesse im südeuropäischen Kontext, in: Politische Vierteljahresschrift, Heft 21, 1990: 191213. Kraus, P. A.: Nationalismus und Zivilgesellschaft in Transformationsprozessen, in: Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 5, Zivilgesellschaft und Transformation, Opladen 2000: 71-88. Krickus, R. J.: Democratization in Lithuania, in: Dawisha, K. / B. Parrott (Hg.): The consolidation of democracy in East-Central Europe, Cambridge, 1997: 290-333. Kuran, T.: Now Out Of Never. The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989, in: World Politics, Vol. 43, 1991: 7-48. Kuran, T.: The Inevitability of Furture Revolutionary Surprises, American Journal of Sociology, Vol. 100, 1995: 1528-51. Lalman, D. / J. Oppenheimer und P. Swistak: Formal Rational Choice Theorie: A Cumulative Science of Politics, in: Finifter, A.W. (Hg.), Political Science: The State of the Discipline II, 1993: 77-104. Lawson, S.: Conceptual Issues in the Comparative Study of Regime Change and Democratization, in: Comparative Politics, Vol. 25, 1993: 183-205. Lehmbruch, G.: Die ostdeutsche Transformation als Strategie des Institutionentransfers: Überprüfung und Antikritik, in: Eisen, A./ H. Wollmann (Hg.): Institutionenbildung in Ostdeutschland. Zwischen externer Steuerung und Eigendynamik, Opladen, 1996: 63-78. Lepsius, M. R.: Interessen, Ideen und Institutionen, Opladen, 1990. Lepsius, M. R.: Handlungsräume und Rationalitätskriterien der Wirtschaftsfunktionäre in der Ära Honecker, in: Pirker, T. / ders. / R. Weinert und H. H. Hertle (Hg.): Der Plan als Befehl und Fiktion, Wirtschaftsführung in der DDR, Opladen, 1995: 347362. Lepsius, M. R.: Institutionenanalyse und Institutionenpolitik, in: Nedelmann, B. (Hg.): Politische Institutionen im Wandel, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 35, Opladen, 1995a: 392-403. Lijphard, A.: Presidentialism and Majoritarian Democracy, in: Szoboszlai, G. (Hg.): Democracy and political Transformation, Budapest, 1991: 75-93. Lijphard, A. / C. H. Waisman: Institutional Design in new Democracies; Eastern Europe and Latin America, Boulder, 1996. Lindenberg, S.: An Assessment of the New Political Economy: Its Potentials for the Social Sciences and for Sociology in Particular, in: Social Theorie, 3, 1985: 99114. Literatur 311 Lindenberg, S.: homo oeconomicus, in: Journal of Institutional and Theoretical Economics, 1990: 727-748. Lindenberg, S.: Die Methode der abnehmenden Abstraktion: Theoriegesteuerte Analyse und empirischer Gehalt, in: Esser, H. / H.G. Troitzsch / M. Kluik und H.P. Ohly (Hg.): Modellierung sozialer Prozesse, Bonn, 1991: 29-78. Lindenberg, S.: Die Relevanz theoriereicher Brückenannahmen, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1996: 126-140. Linz, J. J.: The Perils of Presidentialism, in: Journal of Democracy, 1, 1990: 51-69. Linz, J. J.: The Virtues of Parlamentarism, in: Journal of Democracy,1, 1990a: 84-91. Linz, J. J. / A. Stepan und R. Gunther: Democratic Transition and Consolidation in Southern Europe, with Reflections on Latin America and Eastern Europe, in: Gunther, R. / N. Diamandouros und H.-J. Puhle (Hg.): The Politics of Democratic Consolidation, Baltimore 1995: 77-123. Linz, J. J. / A. Stepan: Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore and London, 1996. Lipset, S. M.: Some Social Requisits of Democracy; Economic Development and Political Legitimacy, in: American Political Science Review, 53, 1959: 69-105. Lipset, S. M.: Political Man, The Social Basis of Politics, Baltimore, 1981. Lipset, S. M. / S. Rokkan (Hg.): Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York, 1967. Lötsch, M.: Der Sozialismus – eine Stände- oder Klassengesellschaft?, in: Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, Frankfurt/M., 1993: 115-124. Lohmann, S.: The Poverty of Green and Shapiro, in: Friedman, J. (Hg.): The Rational Choice Controversy; Economic Models of Politics Reconsidered, New Haven and London, 1996: 127-154. Lohmann, S.: The Dynamics of Informational Cascades. The Monday Demonstrations in Leipzig, East Germany, 1989-91, in: World Politics, Vol.47, 1994: 42-101. Lowenthal, A. F.: Foreword, in: O´Donnell, G. / P. C. Schmitter und L. Whitehead: Transitions from Authorian Rule; Prospects for Democracy, Baltimore, 1986. Luce, R.D. / H. Raiffa: Games and Decisions, New York, 1957. Luhmann, N.: Soziologische Aufklärung 2, Opladen, 1975. Luhmann, N.: Soziale Syteme, Frankfurt/M., 1984. Luhmann, N.: „Was ist der Fall?“ und „Was steckt dahinter?“; Die zwei Soziologien und die Gesellschaftstheorie, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 22, 1993: 245-260. Luhmann, N.: Soziologische Aufklärung 4, Opladen, 1994. Mänicke-Gyöngyösi, K. (Hg.): Lebensstile und Kulturmuster in sozialistischen Gesellschaften, Köln, 1990. Literatur 312 Mänicke-Gyöngyösi, K.: Bürgerbewegungen, Parteien und „zivile“ Gesellschaft in Ungarn, in: Deppe, R. / H. Dubiel und U. Rödel: Demokratischer Umbruch in Osteuropa, Frankfurt/M., 1991: 221-233. Mänicke-Gyöngyösi, K.: Konstituierung des Politischen als Einlösung der „Zivilgesellschaft“ in Osteuropa?, in Heuer, B. / M. Prucha (Hg.): Der Umbruch in Osteuropa als Herausforderung für die Philosophie, Frankfurt/M., 1995. Mänicke-Gyöngyösi, K. (Hg.): Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität, Berlin, 1996. Mänicke-Gyöngyösi, K.: Ost- und ostmitteleuropäische Gesellschaften zwischen autonomer Gestaltung und Adaption westlicher Modernisierungsmodelle, in: Wollmann, H. / H. Wiesenthal und F. Bönker (Hg.): Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Leviatan, Sonderheft 15, Opladen, 1995b: 30-53. Mansfeldovà, Z.: Privatisierungsstrategie, institutionelle Konfliktregelung und Symbolisierung im Tschechischen ökonomischen Diskurs, in: MänickeGyöngyösi, K. (Hg.): Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität, Berlin, 1996: 241-258. Mansfeldovà, Z. / M. Szabò: Zivilgesellschaft im Transformationsprozeß OstMitteleuropas: Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei, in: Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 5, Zivilgesellschaft und Transformation, Opladen 2000: 89-114. March, J. G.: Bounded rationality, ambiguity and the engeneering of choice, in: Bell Journal of Economics, 9, 1978: 587-608. March, J. G. / J. P. Olsen: Rediscovering Institutions; The Organizational Basis of Politics, New York, 1989. Masters, R. D.: Evolutionary Biology and Political Theory, in: American Political Science Review, Vol. 84, 1990: 195-210. Maturana, H. R.: Erkennen; Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit, Braunschweig, 1985. Mayntz, R.: Naturwissenschaftliche Modelle, soziologische Theorie und das MikroMakro-Problem, in: Zapf, W. (Hg.): Die Modernisierung moderner Gesellschaften. Verhandlungen des 25 Deutschen Soziologentages in Frankfurt am Main, Frankfurt/M. / New York, 1991: 55-68. Mayntz, R.: Politische Steuerung: Aufstieg, Niedergang und Transformation einer Theorie, in: von Beyme, K. / C. Offe (Hg.): Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 26., Politische Theorien in der Ära der Transformation, 1995: 148-168. Mayntz, R. / F. W. Scharpf: Steuerung und Selbstorganisation in staatsnahen Sektoren, in: dies. (Hg.): Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung, Frankfurt/M. / New York, 1995: 9-38. Literatur 313 Mayntz, R. / F. W. Scharpf: Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus, in: dies. (Hg.): Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung, Frankfurt/M. / New York, 1995a: 39-72. Meissner, B.: Die „Breshnew-Doktrin“. Das Prinzip des „proletarisch-sozialistischen Internationalismus“ und die Theorie von den „verschiedenen Wegen zum Sozialismus“, Köln, 1969. Melone, A. P.: Bulgaria’s National Roundtable Talks and the Politics of Accommodation, in: International Political Science Review, Vol.15, 1994: 257273. Merkel, W.: Struktur oder Akteur, System oder Handlung: Gibt es einen Königsweg in der sozialwissenschaftlichen Transformationsforschung? in: ders. (Hg.): Systemwechsel 1, Theorien, Ansätze und Konzeptionen, Opladen, 1994. Merkel, W.: Theorien der Transformation: die demokratische Konsolidierung postautoritärer Gesellschaften, in: von Beyme, K. / C. Offe (Hg.): Theorie der Politik im Zeitalter der Transformation, Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 26/ 1995. Merkel, W.: Institutionalisierung und Konsolidierung der Demokratien in Osteuropa, in: ders. / E. Sandschneider und D. Segert (Hg.): Systemwechsel 2, Die Institutionalisierung der Demokratie, Opladen, 1996: 73-112. Merkel, W.: Einleitung, in ders. / E. Sandschneider (Hg.): Systemwechsel 3, Parteien im Transformationsprozeß, Opladen, 1997: 9-22. Merkel, W.: Parteien und Parteiensysteme im Transformationsprozeß, ein interregionaler Vergleich, in ders. / E. Sandschneider (Hg.): Systemwechsel 3, Parteien im Transformationsprozeß, Opladen 1997a: 337-372. Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 5, Zivilgesellschaft und Transformation, Opladen 2000a. Merkel, W. / A. Croissant: Formale und informale Institutionen in defekten Demokratien, in: Politische Vierteljahresschrift, Heft 1, 2000: 3-30. Merkel, W. / E. Sandschneider (Hg.): Systemwechsel 3, Parteien im Transformationsprozeß, Opladen, 1997. Merkel, W. / E. Sandschneider und D. Segert: Einleitung: Die Institutionalisierung der Demokratie, in: ders. (Hg.): Systemwechsel 2, Die Institutionalisierung der Demokratie, Opladen, 1996: 9 - 36. Meuschel, S.: Revolution in der DDR. Versuch einer sozialwissenschaftlichen Interpretation, in: Zapf, W. (Hg.): Die Modernisierung moderner Gesellschaften, Frankfurt/m. / New York, 1990: 558-576. Meuschel, S.: Revolution in der DDR; Versuch einer sozialwissenschaftlicher Interpretation, in: Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, Frankfurt/M., 1993: 93-114. Literatur 314 Michta, A. A.: Democratic consolidation in Poland after 1989, in: Dawisha, K. / B. Parrott (Hg.): The consolidation of democracy in East-Central Europe, Cambridge, 1997: 66-108. Moore, B.: Social Origins of Dictatorship an Democracy, Toronto, 1966. Morlino, L. / J. R. Montero: Legitimacy and Democracy in Southern Europe, in: Gunther, R. / N. Diamandouros und H.-J. Puhle (Hg.): The Politics of Democratic Consolidation, Baltimore, 1995: 231-260. Müller, H.: Internationale Beziehungen als kommunikatives Handeln, in: Zeitschrift für internationale Beziehungen, Heft1, 1994. Münch, R.: Zahlung und Achtung; Die Interpenetration von Ökonomie und Moral, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg.23, 1994: 388-411. Murphy, J. B.: Rational Choice Theorie as Social Physics, in: Friedman, J. (Hg.): The Rational Choice Controversy; Economic Models of Politics Reconsidered, New Haven and London, 1996: 155-174. Nash, J. F.: The Bargaining Problem, in: Econometrica, Band 18, 1951: 155-162. Nash, J. F.: Two-Person Cooperative Games, in: Econometrica, Band 21, 1953: 128140. Nedelmann, B. (Hg.): Politische Institutionen im Wandel, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 35, Opladen, 1995. Nedelmann, B.: Vorwort, in: dies. (Hg.): Politische Institutionen im Wandel, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 35, Opladen, 1995: 7-14. Nedelmann, B.: Gegensätze und Dynamik politischer Institutionen, in: dies. (Hg.): Politische Institutionen im Wandel, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 35, Opladen, 1995: 15-40. Nee, V. / P. Lian: Sleeping with the Enemy: A dynamic model of declining political commitment in state socialism, in: Theory and Society, No. 23, 1994: 253-96. Neidhardt, F. / D. Rucht: Auf dem Weg in die „Bewegungsgesellschaft“? Über die Stabilisierbarkeit sozialer Bewegungen, in: Soziale Welt, Vol. 44, 1993: 305-326. Nohlen, D.: Sistemas de gobierno, perspectivas conceptuales y comparativas, in: ders. / M. Fernández (Hg.): Presidencialismo versus Parlamentarismo, Caracas, 1991: 15-36. Nohlen, D. / M. Kasapovic: Wahlsysteme und Seystemwechsel in Osteuropa, Opladen, 1996. Nolte, H.: Annäherungen zwischen Handlungstheorien und Systemtheorien, Ein Review über einige Integrationstrends, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 28, 1999: 93-113. North, D. C.: The Institutional Economics, in: Journal of Instituional and Theoretical Economics, Vol. 142, 1986: 230-37. Literatur 315 North, D. C.: Institutions and Credible Commitments, in: Journal of Instituional and Theoretical Economics, Vol. 149, 1993: 11-23. O’Donnell, G.: Modernization and Bureaucratic Authorianism, Berkley, 1973. O’Donnell, G.: Introduction to the Latin American Cases, in: ders. / P. C. Schmitter und L. Whitehead (Hg.): Transitions from Authorian Rule; Prospects for Democracy, Baltimore 1986: Part II, 3-18. O’Donnell, G.: Horizontal Accountability in New Democracies, in: Journal of Democracy, Vol. 3, 1998: 112-126. O’Donnell, G. / P. C. Schmitter: Tentative Conclusions about uncertain Democracies, in: ders. (Hg.): Transitions from Authorian Rule; Prospects for Democracy, Baltimore 1986: Part IV. Offe, C.: Der Tunnel am Ende des Lichts. Erkundungen der Transformation im Neuen Osten, Frankfurt/M. / New York, 1994. Offe, C.: Wohlstand, Nation, Republik. Aspekte des deutschen Sonderwegs vom Sozialismus zum Kapitalismus, in: Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, Frankfurt/M., 1993: 282-301. Offe, C.: Wenn das Vertrauen fehlt, in: Die Zeit, Nr. 50, 1999: 12-14. Olson, M.: Die Logik des kollektiven Handelns - Kollektivgüter und die Theorie der Gruppen, Tübingen, 1968. Olson, D. M.: Paradoxes of Institutional Developement: The New Democratic Parliaments of Central Europe, in: International Political Science Review, Vol. 18, 1997: 401-416. Olson, M.: The Logic of Collective Aktion, Public Goods and the Theory of Groops, Cambridge, 1965. Olson, M.: Aufstieg und Niedergang von Nationen, Tübingen, 1985. Olson, M.: The Hidden Path to a Successful Economiy, in: Clague, C. / G.C. Rausser (Hg.): The Emergence of Maket Economies in Eastern Europe, Oxford, Blackwell, 1992. Olson, M.: Why Poor Economic Policies must Promote Corruption: Lessons from the East for All Countries, in: Rivista di Politica Economica, March 1996: 9-52. O´Neil / H. Patrick: Revolution from within: Institutional Analyses, Transitions from Authorianism, and the Case of Hungary, in: World Politics, Vol. 48, 1996: 579603. Opp, K. -D.: DDR `89. Zu den Ursachen einer spontanen Revolution, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1991: 302-321. Opp, K.-D.: Dissident Groops, Personal Networks and spontaneous Cooperation. The East German Revolution of 1989, in: American Sociological Review, 1993: 65980. Literatur 316 Opp, K.–D. / W. Roehl: Der Tschernobyl-Effekt. Eine Untersuchung über die Ursachen Politischen Protests, Opladen, 1990. Opp, K.-D.: Repression and Revolutionary Action: East Germany in 1989, in: Rationality and Society, Vol. 6, 1994: 101-138. Opp, K.-D. / C. Lüdemann: Theoriereiche Brückenannahmen? Eine Erwiderung auf Siegwart Lindenberg, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 48, 1996: 542-545. Ordeshook, P.C.: Engineering or Science: What is the Study of Politics?, in: Friedman, J. (Hg.): The Rational Choice Controversy; Economic Models of Politics Reconsidered, New Haven/London, 1996: 175-188. Osiatynski, W.: The Roundtable Talks in Poland, in: Elster, J. (Hg.): The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, Chicago/London, 1996: 21-68. Pappi, F. U.: Zur Anwendung von Theorien rationalen Handelns in der Politikwissenschaft, in: von Beyme, K. / C. Offe (Hg.): Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 26. Politische Theorien in der Ära der Transformation, 1995: 236-252. Parsons, T.: The Social System, New York, 1951. Parsons, T.: Das Problem des Strukturwandels; eine theoretische Skizze, in: Zapf, W. (Hg.): Theorien des Sozialen Wandels, Köln, 1969a: 35-54. Parsons, T.: Evolutionäre Unversalien der Gesellschaft, in: Zapf, W. (Hg.): Theorien des Sozialen Wandels, Köln, 1969b: 55-74. Parsons, T.: Das System moderner Gesellschaften, Weinheim u.a., 1972. Parsons, T.: Der Begriff der Gesellschaft; Seine Elemente und ihre Verknüpfungen, in: Jansen, S. (Hg.): Talcott Parsons zur Theorie sozialer Systeme, Opladen, 1976: 121-137. Pfaff, S.: Collective Identity and the Informal Groups in Revolutionary Mobilization: East Germany 1989, in: Social Forces, 1996: 91-118. Pirker, T. / M. R. Lepsius / R. Weinert und H. H. Hertle (Hg.): Der Plan als Befehl und Fiktion, Wirtschaftsführung in der DDR, Opladen, 1995. Pirker, T.: Kommunistische Herrschaft und Despotismus, in: ders. / M. R. Lepsius / R. Weinert und H. H. Hertle (Hg.): Der Plan als Befehl und Fiktion, Wirtschaftsführung in der DDR, Opladen, 1995: 363-376. Plakans, A.: Democratization and political participation in postcommunist societies: the case of Lativa, in: Dawisha, K. / B. Parrott (Hg.): The consolidation of democracy in East-Central Europe, Cambridge, 1997: 245-289. Pollak, D.: Religion und gesellschaftlicher Wandel. Zur Rolle der evangelischen Kirche im Prozeß des gesellschaftlichen Umbruchs in der DDR, in: Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, Frankfurt/M., 1993: 246-266. Literatur 317 Pollack, D.: Das Ende einer Organisationsgesellshaft. Systemtheoretische Überlegungen zum gesellschaftlichen Umbruch in der DDR, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg.19, 1990: 292-307. Popper, K.: Logik der Forschung, Tübingen, 19848. Powell, W. W. / P. J. DiMaggio (Hg.): The Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, 1991. Preuss, U. K.: The Roundtable Talks in the German Democratic Republic, in: Elster, J. (Hg.): The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, Chicago/London, 1996: 99-134. Preuß, U. K.: Der Begriff der Verfassung und ihre Beziehung zur Politik, in: ders. (Hg.): Zum Begriff der Verfassung – Die Ordnung des Politischen, Frankfurt/M., 1994: 7-36. Przeworski, A.: Democracy as a contingent outcome of conflicts, in: Elster, J. / R. Slagstad (Hg.): Constitutionalism and Democracy, Cambridge University Press, 1988: 59-80. Prezeworski, A.: Democracy and the Market; Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge, 1991. Pridham, G.: The international dimension of democratisation: Theory, practice and inter-regional comparisons, in: ders. / E. Herring und G. Sanford (Hg.): Building democracy? The international dimension of democratisation in Eastern Europe, London, 1997: 7-29. Pridham, G.: Revisiting the international dimension of regime change: Ten years after in East-Central Europe, in: Budapest Papers on Democratic Transition 256, 1999. Prosch, B. / M. Abraham: Die Revolution in der DDR; Eine strukturellindividualistische Erklärungsskizze, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Nr. 43, 1991: 291-301. Pye, L. W.: Political Science and the Crisis of Authoritarianism, in: American Political Science Review, Vol. 84, 1990: 3-19. Raun, T.U.: Democratization and political development in Estonia 1987-1996, in: Dawisha, K. / B. Parrott (Hg.): The consolidation of democracy in East-Central Europe, Cambridge, 1997: 334-374. Rawls, J.: Justice as Fairness in: Höffe, O. (Hg.): Gerechtigkeit als Fairneß, Freiburg 1977. Reckwitz, A.: Kulturtheorie, Systemtheorie und das sozialtheoretische Muster der Innen-Außen-Differenz, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 26, 1997: 317-336. Reißig, R.: Das Scheitern der DDR und des realsozialistischen Systems – Einige Ursachen und Folgen, in: Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, Frankfurt/M., 1993: 49-69. Literatur 318 Riese, H.: Transformation als Oktroi von Abhängigkeit, in: Bönker, F. / H. Wiesental und H. Wollmann (Hg.): Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Leviatan, Sonderheft 15, 1995: 163-179. Riggs, F.W.: Presidentialism versus Parliamentarism: Implications for Representativeness and Legitimicy, in: International Political Science Review, Vol. 18, 1997: 253-278. Riker, W.H.: The Theory of Political Coalitions, New Haven, 1967. Riker, W.H.: Applications of Political Theory in the Study of Politics, in: International Political Science Review, 1992: 5-6. Riker, W.H. / P.C. Ordeshook: A theory of calculus of voting, in: American Political Science Review, 1968: 25-42. Ritzer, G.: Sociology: A Multiple Paradigm Science, Boston, 1975. Rodes, R. A. W.: The New Governance. Gouverning without Gouvernement, in: Political Studies, 1996. Róna-Tas, Á.: The First Shall Be Last? Enterpreneurship and Communist Cadres in the Transition from Socialism, in: American Journal of Sociology , Vol. 100, No.1, 1994: 40-69. Rose, R. / W. Seifert: Materielle Lebensbedingungen und Einstellungen gegenüber Marktwirtschaft und Demokratie im Transformationsprozeß. Ostdeutschland und Osteuropa im Vergleich, in: Bönker, F. / H. Wiesental und H. Wollmann (Hg.): Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Leviatan, Sonderheft 15, 1995: 277-298. Rüb, F. W.: Die Herausbildung politischer Institutionen in Demokratisierungsprozessen, in: Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 1, Theorien, Ansätze und Konzeptionen, Opladen, 1994: 111-140. Rüb, F. W.: Schach dem Parlament! – Über semipräsidentielle Regierungssysteme in einigen postkommunistischen Gesellschaften, in: Leviatan 22, 1994a: 260-92. Rüb, F. W.: Die drei Paradoxien der Konsolidierung der neuen Demokratien in Mittelund Osteuropa, in: Bönker, F. / H. Wiesental und H. Wollmann (Hg.): Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Leviatan, Sonderheft 15, 1995: 509-537. Rudolph H. (Hg.): Geplanter Wandel, ungeplante Wirkungen; Handlungslogiken und -ressourcen im Prozeß der Transformation, Berlin, 1995. Rüland, J.: Theoretische, methodische und thematische Schwerpunkte der Systemwechselforschung zu Asien, in Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 1, Opladen 1994: 271-302. Rueschemeyer, D. / E. H. Stevens und J. D. Stephens: Capitalist Developement & Democracy, Cambridge, 1992. Literatur 319 Ryan, J. J.: The Impact of Democratization on Revolutionary Movements, in: Comparative Politics, Vol. 27, 1994: 27-44 Sajó, A.: The Roundtable Talks in Hungary, in: Elster, J. (Hg.): The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, Chicago/London, 1996: 69-98. Sandschneider, E.: Stabilität und Transformation politischer Systeme, Opladen, 1995. Sandschneider, E.: Systemtheoretische Perspektiven politikwissenschaftlicher Transformationsforschung, in: Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 1, Theorien, Ansätze und Konzeptionen, Opladen, 1994: 23-46. Sartori, G.: Comparative Constitutional Engeneering, An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes, Basinstoke, 1994. Sartori, G.: Parties and party systems, A framework for analysis, Cambridge, 1976. Scharpf, F. W.: Die Politikverflechtungsfalle: Europäische Integration und deutscher Föderalismus im Vergleich, in: Politische Vierteljahresschrift, 26, 1985: 323-356. Scharpf, F. W.: Verhandlungssysteme, Verteilungskonflikte und Pathologien der politischen Steuerung, in: Schmidt, M. G. (Hg.): Staatstätigkeit, International und historisch vergleichende Analysen, Opladen, 1988: 61-87. Scharpf, F. W.: Decision Rules, Decision Styles, and Policy Choices, Discussion Paper 88/3, Köln: MPI für Gesellschaftsforschung, 1988a. Scharpf, F. W.: Politische Steuerung und politische Institutionen, in Politische Vierteljahresschrift, 30, 1989: 10-21. Scharpf, F. W.: Games Real Actors Play; Actor-Centered Institutionalism in Policy Research, Oxford, 1997. Schedler, A.: What is democratic consolidation?, in: Journal of Democracy, Vol. 9, 1998: 91-107. Schelling, T.C.: The Strategy of Conflict, Cambridge, 1963. Schimank, U.: Politische Steuerung und Selbstregulation des Systems organisierter Forschung, in: Mayntz, R. / F. W. Scharpf (Hg.): Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung, Frankfurt/M. / New York, 1995: 101-139. Schimank, U.: Was ist Soziologie?, in: Soziologie, 1999: 9-22. Schimank, U.: Handeln und Strukturen; Einführung in die akteurtheoretische Soziologie, Weinheim und München, 2000. Schlögel, K.: Soziokulturelle Wandlungsprozesse in Osteuropa, Leben in der Übergangsgesellschaft, in: Brunner, G. (Hg.): Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa, Berlin, 1996: 221-240. Schmitter, P. C.: An Introduction to Southern European Transitions from Authoritarian Rule: Italy, Greece, Portugal, Spain, and Turkey, in: ders. / G. O`Donnell und L. Whitehead: Transitions from Authorian Rule; Prospects for Democracy, Baltimore, 1986: Part I, 3-10. Literatur 320 Schmitter, P. C.: Von der Autokratie zur Demokratie; Zwölf Überlegungen zur politischen Transformation, in: Internationale Politik, Vol. 50, 1995: 47-52. Schmitter, P. C.: Organized Interests and Democratic Consolidation in Southern Europe, in: Gunther, R. / N. Diamandouros und H.-J. Puhle (Hg.): The Politics of Democratic Consolidation, Baltimore 1995a: 284-314. Schmitter, P. C. / J. Santiso: Three Temporal Dimensions to the Consolidation of Democracy, in: International Political Science Review, Vol. 19, 1998: 69-92. Schumpeter, J.: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, München 19805. Schweißfurth, T. / R. Alleweldt: Die neuen Verfassungsstrukturen in Osteuropa, in: Brunner, G. (Hg.): Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa, Berlin, 1996: 41-90. Scrubar, I.: War der reale Sozialismus modern? Versuch einer strukturellen Bestimmung, in Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 43, 1991: 415-432. Segert, D.: Aufstieg der (kommunistischen) Nachfolgeparteien?, in: Bönker, F. / H. Wiesental und H. Wollmann (Hg.): Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Leviatan, Sonderheft 15, 1995a: 459-474. Segert, D.: Die Transformationsanalyse Osteuropas. Denkanstöße, theoretische Fortschritte und Defizite, in: Internationale Politik, 1996: 29-35. Segert, D.: Institutionalisierung der Demokratie am balkanischen Rand Osteuropas, in: Merkel, W. / E. Sandschneider und D. Segert (Hg.): Systemwechsel 2, Die Institutionalisierung der Demokratie, Opladen, 1996: 113 - 143. Segert, D.: Parteien und Parteiensysteme in der Konsolidierung der Demokratien Osteuropas, in Merkel, W. / E. Sandschneider (Hg.): Systemwechsel 3, Parteien im Transformationsprozeß, Opladen, 1997: 57-100. Selznick, P.: TVA and the Grass Roots, Berkeley, 1949. Shapiro, I.: Can the Rational Choice Framework Cope with Culture?, in: Political Science & Politics, 1998: 40-42. Simon, G.: Die Russen und die Demokratie, Zur politischen Kultur in Rußland, in: Brunner, G. (Hg.): Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa, Berlin, 1996: 113-130. Simon, H.: A behavioral theory of rational choice, in: Quarterly Journal of Economics, Vol. 69, 1954: 99-118. Simon, H.: Invariants of Human Behavior, in: Annual review of Psychology, Vol. 41, 1990, 1-19. Simon, J.: Electoral Systems and Democracy in Central Europe, 1990-1994, in: International Political Science Review, Vol. 18, 1997: 361-379. Solnik, S. L.: The Breakdown of Hierarchies in the Soviet Union and China; A Neoinstitutional Perspective, in: World Politics, Vol. 49, 1996: 87-105. Literatur 321 Stark, D. / L. Bruszt: Postsocialist pathways: Transforming politics and property in East Central Europe, Cambridge, 1998. Stepan, A. / C. Skach: Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation; Parliamentarianism versus Presidentialism, in: World Politics, Vol. 46, 1993: 122. Stichweh, R.: Systemtheorie und Rational Choice Theorie, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg.24, 1995: 395-406. Szabó, M.: Soziale Bewegungen, Mobilisierung und Demokratisierung in Ungarn, in: Deppe, R. / H. Dubiel und U. Rödel: Demokratischer Umbruch in Osteuropa, Frankfurt/M., 1991: 206-220. Szabó, M.: Vom kommunistischen „Reformwunder“ zur relativen Stabilität im Postkommunismus: Ungarn, in: Pradetto, A. (Hg.): Die Rekonstruktion Ostmitteleuropas, Opladen, 1994: 25-76. Sztompka, P.: Vertrauen: Die fehlende Ressource in der postkommunistischen Gesellschaft, in: Nedelmann, B. (Hg.): Politische Institutionen im Wandel, Opladen 1995: 254-276. Tanase, S.: Changing societies and elite transformation, in: East European Politics and Societies, Vol. 13, 1999: 358-363. Tatur, M.: Zur Dialektik der „civil society“ in Polen, in: Deppe, R. / H. Dubiel und U. Rödel: Demokratischer Umbruch in Osteuropa, Frankfurt/M., 1991: 234-255. Tatur, M.: Interessen und Norm. Politischer Kapitalismus und die Transformation des Staates in Polen und Rußland, in: Bönker, F. / H. Wiesental und H. Wollmann (Hg.): Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Leviatan, Sonderheft 15, 1995: 93-116. Tatur, M.: „Politik“ im Transformationsprozeß. Aspekte des politischen Diskurses in Polen 1989-1992, in: Mänicke-Gyöngyösi, K. (Hg.): Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität, Berlin, 1996: 39-56. Thaa, W.: Die Wiedergeburt des Politischen – Zivilgesellschaft und Legitimitätskonflikt in den Revolutionen von 1989, Opladen, 1997. Thibaut, B.: Präsidentialismus und Demokratie in Lateinamerika, Opladen, 1996. Tilly, C.: To Explain Political Processes, in: American Journal of Sociology, Vol. 100, No.6, 1995: 1594-1610. Tietzel, M. / M. Weber / O. F. Bode: Die Logik der sanften Revolution. Eine ökonomische Analyse, Tübingen, 1991. Tietzel, M. / M. Weber: The Economics of the Iron Curtain and the Berlin Wall, in: Rationality and Society, Vol. 6, 1994: 58-78. Literatur 322 Tökés, R. L.: Party politics and political participation in postcommunist Hungary, in: Dawisha, K. / B. Parrott (Hg.): The consolidation of democracy in East-Central Europe, Cambridge, 1997: 109-149. Tullock, G.: The Paradox of Revolutions, in: Public Choice, Vol. 11, 1971: 89-99. Tversky, A. / D. Kahneman: Rational Choice and the Framing of Decisions, in: Journal of Business, Vol.59, 1986. Ullmann-Margalit, E.: The Emergence of Norms, Oxford, 1977. Vachudová, M.A. / T. Snyder: Are transitions transitory? Two types of political change in Eastern Europe since 1989, in: East European Politics and Societies, Vol. 11, 1997: 1-35. Varga, L.: Geschichte in der Gegenwart – das Ende der kollektiven Verdrängung und der demokratische Umbruch in Ungarn, in: Deppe, R. / H. Dubiel und U. Rödel: Demokratischer Umbruch in Osteuropa, Frankfurt/M., 1991: 167-181. Walder, A. G.: The decline of communist power: Elements of a theory of institutional change, in: Theory and Society, No.23, 1994: 297-326. Wallerstein, I.: Social Science and the Quest for a Just Society, in: American Journal of Sociology, Vol. 102, 1997: 1241-57. Walsh M. / M. Bahnish: The Politics of Political Theorising in the New Millennium, unveröffentlichte Abhandlung, vorgetragen auf der Konferenz der American Political Science Association (August 31 bis September 3, 2000). Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1972. Weede, E.: The Impact of Interstate Conflict on Revolutionary Change and Individual Freedom, (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) Berlin, 1992. Weinert, R.: Intermediäre Institutionen oder die Konstruktion des „Einen“; Das Beispiel der DDR, in: Nedelmann, B. (Hg.): Politische Institutionen im Wandel, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 35, Opladen, 1995a: 237-253. Weinert, R.: Wirtschaftsführung unter dem Primat der Parteipolitik, in: Pirker, T. / M. R. Lepsius / R. Weinert und H. H. Hertle (Hg.): Der Plan als Befehl und Fiktion, Wirtschaftsführung in der DDR, Opladen, 1995b: 285-308. Wehler, H.–U.: Modernisierungstheorie und Geschichte, Göttingen, 1975. Welfens, P. J. J.: Privatisierung, Wettbewerb und Strukturwandel im Transformationsprozeß, in: Brunner, G. (Hg.): Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa, Berlin, 1996: 163-192. Welsh, H. A.: Political Transition Processes in Central and Eastern Europe, in: Comparative Politics, Vol. 26, 1994: 379-394. Welzel, C.: Sytemwechsel in der Globalen Systemkonkurrenz; Ein evolutionstheoretischer Erklärungsversuch, in: Merkel, W. (Hg.): Systemwechsel 1, Opladen 1994: 47-80. Literatur 323 Wendt, A.: Der Internationalstaat: Identität und Strukturwandel in der internationalen Politik, in: Beck, U. (Hg.): Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt/M., 1998: 381-406. Widmaier U. / A. Gawrich und U. Becker: Regierungssysteme Zentral- und Osteuropas, Ein einführendes Lehrbuch, Opladen, 1999. Wielgohs, J. / H. Wiesenthal (Hg.): Einheit und Differenz. Die Transformation Ostdeutschlands in vergleichender Perspektive, Berlin, 1997. Wiesenthal, H.: Rational Choice: Ein Überblick über Grundlinien, Theoriefelder und neuerer Themenaquisition eines sozialwissenschaftlichen Paradigmas, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 16, 1987: 434-449. Wiesenthal, H.: Sturz in die Moderne. Der Sonderstatus der DDR in den Transformationsprozessen Osteuropas, in: Brie, M. / D. Klein (Hg.): Zwischen den Zeiten. Ein Jahrhundert verabschiedet sich, Hamburg 1992. Wiesenthal, H. (Hg.): Einheit als Privileg. Vergleichende Perspektiven auf die Transformation Ostdeutschlands, Frankfurt/M. / New York, 1996. Wiesenthal, H.: Probleme der Transformationssteuerung – eine Perspektive politikwissenschaftlicher Forschung, in: Wielgohs, J. / ders. (Hg.): Einheit und Differenz. Die Transformation Ostdeutschlands in vergleichender Perspektive, Berlin, 1997: 239-254. Wiesenthal, H.: Transformationsforschung als Paradigmentest, in: Berliner Osteuropa Info, 13, 1999: 5-7. Willke, H.: Entzauberung des Staates. Überlegungen zu einer sozialen Steuerungstheorie, Königstein, 1983. Willke, H.: Systemtheorie entwickelter Gesellschaften; Dynamik und Riskanz moderner gesellschaftlicher Selbstorganisation, Weinheim / München, 1989. Willke, H.: Ironie des Staates, Frankfurt/M., 1992. Willke, H.: Theoretische Verhüllungen der Politik - der Beitrag der Systemtheorie, in: von Beyme, K. / C. Offe (Hg.): Theorie der Politik im Zeitalter der Transformation, Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 26/1995: 131-147. Wollmann, H.: Institutionenbildung in Ostdeutschland: Rezeption, Eigenentwicklung oder Innovation?, in: Eisen, A./ ders. (Hg.): Institutionenbildung in Ostdeutschland. Zwischen externer Steuerung und Eigendynamik, Opladen, 1996: 79-114. Wollmann, H. / H. Wiesenthal und F. Bönker (Hg.): Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Leviatan, Sonderheft 15, Opladen, 1995. Zapf, W.: Modernisierung und Modernisierungstheorien, in: ders. (Hg.): Die Modernisierung moderner Gesellschaften; Verhandlungen des 25. Deutschen Soziologentages in Frankfurt am Main 1990, Frankfurt/M., 1991: 23-39. Literatur 324 Zapf, W.: Die Transformation in der ehemaligen DDR und die soziologische Theorie der Modernisierung, Berlin, 1992. Zapf, W.: Die DDR 1989/1990 – Zusammenbruch einer Sozialstruktur?, in: Joas, H. / M. Kohli (Hg.): Der Zusammenbruch der DDR: Soziologische Analysen, 1993: 29-48. Zapf, W.: Modernisierungstheorien in der Transformationsforschung, in von Beyme, K. / C. Offe (Hg.): Theorie der Politik im Zeitalter der Transformation, Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 26, 1996: 169-181. Zartman, W.: Conflict and Order: Justice in Negotiations, in: International Political Science Revue, Vol.18, No.2, 1997. Ziemer, K.: Politischer Wandel in Osteuropa, Die maßgeblichen innenpolitischen Kräfte, in: Brunner, G. (Hg.): Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa, Berlin, 1996: 9-40.